

MASTERPLAN GEHEN KLAGENFURT

Impressum:
Auftraggeber: Magistrat Klagenfurt
Abteilung Straßenbau und Verkehr Paulitschgasse 13 9020 Klagenfurt a. W.
Ansprechpartner: DI Alexander Sadila
in Abstimmung: Abteilung Klima- und Umweltschutz Abteilung Stadtplanung Bahnhofstraße 35 Paulitschgasse 13 9010 Klagenfurt a.W. 9020 Klagenfurt a. W.
Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Hafner Ansprechpartner: DI Robert Piechl
Verfasser: Triagonal GmbH
Firmensitz Niederlassung Klagenfurt Reininghauspark 5/3, 8020 Graz Markweg 4, 9073 Klagenfurt a. W.
Bearbeiter: DI Thomas Klocker
T +43 (0) 676 656 27 21
E klocker@triagonal.at
DI Johanna Lebitsch
T +43 (0) 676 372 14 09
E lebitsch@triagonal.at W www.triagonal.at
6.1
6.1.1

6.1.5
6.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
6.2.1 Fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung ermöglichen
6.2.2
6.2.3
6.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes
6.3.1 Zuwegung zu Haltestellen optimieren und Aufenthaltsqualität erhöhen
6.3.2 Multimodale Mobilitätsknoten schaffen, ausbauen und vernetzen
6.3.3 Multimodalität in der Flächenverteilung
6.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
6.4.1
6.4.2 Fußverkehr richtig
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
7.1 Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
7.1.1
7.1.5 Verkehrsberuhigung und Gestaltung Bahnhofstraße
7.1.6 Barrierefreie Gestaltung der Lendquerung Heinzelsteg
7.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
7.2.1
7.2.3 Wohnquartier „An der Glan“ – Entwicklungsgebiet
7.2.4
7.2.5
7.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes
7.3.1 Klimafitte Gestaltung des Heiligengeistplatzes
7.3.2 Unterführung Ostbahnhof
7.3.3 Anbindung S-Bahn-Haltestelle Ebenthal
7.3.4 Verbindung S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West – Ostbucht
7.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und
7.4.1
7.4.2
des Hauptwegenetzes

1
Einführung – Aufgabenstellung
Die Verkehrsmittelwahl ist zu einem großen Teil angebotsinduziert: je nachdem wie gut und konkurrenzfähig (schnell, komfortabel, sicher, günstig und zuverlässig) das Angebot in einem Verkehrsmittel ist, desto höher wird auch die Nachfrage nach diesem Verkehrsmittel sein. Ein attraktives Angebot erzeugt demnach auch eine entsprechende Nachfrage („Build it and they will come“- Strategie).1




1920
1950 bis heute zukünftig
Abbildung 1 1 Die Geschichte der Verkehrsplanung in Grafiken
Betrachtet man die Verkehrsplanung in der Vergangenheit bzw. teilweise auch bis in die Gegenwart, so ist festzustellen, dass ausgehend von einem sehr dichten und vollständigen Wegenetz im Fuß- und Radverkehr um rund 1920 (das private Auto spielte damals noch keine wesentliche Rolle) ab circa 1950 (mit Beginn der Industrialisierung und dem Aufschwung des privaten Pkws) bis heute vielfach autogerechte Städte geplant wurden, während sich gleichzeitig die Bedingungen für die Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger, Radfahrer, öffentlicher Verkehr) verschlechterten.
Um den Modal-Split Anteil im Umweltverbund zu steigern, muss dessen Angebot konkurrenzfähig sein und dies auch von den Verkehrsteilnehmern so wahrgenommen werden. Das heißt die Verkehrsmittel im Umweltverbund müssen bezüglich Fahrzeit, Komfort, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosten von gleicher oder besserer Qualität wie der motorisierte Individualverkehr sein, damit Menschen langfristig umsteigen. In Zukunft sollten deshalb die oftmals getrennten Fuß- und Radverkehrsnetze miteinander verbunden und beschleunigt werden, der öffentliche Verkehr optimal an Fuß- und Radwegnetze angebunden werden und der motorisierte Individualverkehr verträglich abgewickelt werden.
1 Auszug aus „Copenhagenize“ von Mikael Colville-Andersen

Gehen – als ursprünglichste Form der Fortbewegung bzw. sozusagen als Basismobilität der Bevölkerung – kann als eine urbane Form der Fortbewegung, die wesentlich zum Wohlbefinden des Einzelnen bzw. auch zur Lebens- und Aufenthaltsqualität einer Stadt beitragen kann, gesehen werden. Gehen ist unabhängig vom Alter für fast jeden Menschen möglich. Fast jede Ortsveränderung bzw. Mobilitätskette beginnt auf den ersten Metern und endet auf den letzten Metern zu Fuß - sowohl im öffentlichen Verkehr, wo oft auch längere Zugangswege (oder Umstiege) erforderlich sind, als auch im Pkw- und Radverkehr. Mit dem Masterplan Gehen Klagenfurt, welcher in Abstimmung mit bzw. aufbauend auf dem Masterplan Radfahren Klagenfurt (PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH, 2018) und dem Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV (Traffix Verkehrsplanungs GmbH, 2019) erstellt werden soll, sollen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein weiteres Verkehrsmittel im Umweltverbund zu stärken und dadurch den motorisierten Individualverkehr zu verringern.
Der erste Teil des Masterplans Gehen Klagenfurt beschäftigt sich neben der Darstellung wichtiger Rahmenbedingungen und Herausforderungen mit einer Zustandsanalyse und Zieldefinition für den Fußverkehr von Klagenfurt. Dabei sollen auch Good-Practice-Beispiele aus anderen Städten und Regionen angeführt werden, um die Möglichkeiten und Potentiale der Fußverkehrsförderung aufzuzeigen:
▪ Darstellung der wichtigen Rahmenbedingungen und Herausforderung für den Fußverkehr
▪ Zieldefinition und Strategien für den Fußverkehr in Klagenfurt
▪ Good-Practice-Beispiele auf nationaler bzw. internationaler Ebene
▪ Identifikation von Problem- und Schwachstellen in Klagenfurt
Der zweite Teil des Masterplan Gehens soll – aufbauend auf dem ersten Teil – erforderliche Handlungsschwerpunkte bzw. konkrete Maßnahmen ableiten, um ausgehend vom Ist-Zustand den gewünschten
Soll-Zustand zu erreichen und gleichzeitig Möglichkeiten des Monitorings darstellen. Konkrete Leitprojekte und Handlungsschwerpunkte für die nächsten Jahre sollen dabei angeführt und mit den zuständigen Planungsabteilungen (Klima- und Umweltschutz, Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr) abgestimmt werden:
▪ Handlungsschwerpunkte und generelle Maßnahmen
▪ Ableitung und Definition von Leitprojekten und konkreten Maßnahmen

2
„Zu-Fuß-Gehen“ als Verkehrsmittel
Zu-Fuß-Gehen bildet die Basis und ist sogleich die Voraussetzung aller physischen Mobilität. Egal ob jemand die nächste Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, den Abstellplatz seines Fahrrades oder den Parkplatz seines Autos erreichen will, legt er einen Teil des Weges zu Fuß zurück. Oftmals werden diese kurzen Fußwege in den Statistiken nicht berücksichtigt, weil sie als selbstverständlich erscheinen. Betrachtet man jedoch alle Wegetappen, also auch Zubringerwege zu anderen Verkehrsmitteln oder Wege beim Umsteigen, stellen die Fußwege die überwiegende Mehrheit des Wegeaufkommens dar
Das Zu-Fuß-Gehen war in unseren Breitengraden immer Bestandteil des städtischen Umfelds, fand aber erst eine gewisse Beachtung, als alternative Transportmöglichkeiten, wie etwa die Pferdekutsche und später das Automobil, aufkamen. Mitte des 20. Jahrhunderts – unter der vorherrschenden Dominanz der motorisierten Kraftfahrzeuge – wurde das Zu-Fuß-Gehen von den Planern und der Forschung als eigenes Verkehrsmittel anerkannt. Das Hauptaugenmerk lag in dieser Zeit jedoch nicht in einer Erhöhung des Modal-Split Anteils und der Verbesserung der Umfeldbedingungen für das Zu-Fuß-Gehen, sondern in der Bewältigung der vielen Unfälle von Fahrzeugen mit Fußgängern Fußgänger mussten zu Lasten des aufkommenden Kraftfahrzeugverkehrs von den Fahrbahnen „ferngehalten“ werden. Durch die Etablierung des Trennprinzips in der Straßenplanung haben die Fußgänger dadurch im Laufe der Jahrzehnte ihre eigenen Anlagen im Straßenraum erhalten (vornämlich Gehsteige). Heutzutage muss oft festgestellt werden, dass die den Zu-Fuß-Gehenden eingeräumten Flächen oft zu gering dimensioniert und vielfach auch z.B. durch Hecken, Schildermasten, Mülltonnen, parkenden Fahrzeugen oder auf sonstige Art und Weise blockiert oder zumindest eingeschränkt werden


Abbildung 2 1 links: überbreite Hecke im Bereich Knoten Südring/Rosentaler Straße rechts: teilweise eingeschränkter Gehweg im Bereich Gendarmeriestraße

Die historische und kulturell bedingte Aufteilung der Verkehrsfläche auf verschiedene Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsmittel wurde in den letzten Jahrzehnten in vielen Städten in einem solch ungleichen Maß vorgenommen, dass heute weltweit Planer mit der Beseitigung dieser Missstände und der Ungleichverteilung beschäftigt sind. Früher vorhandene Plätze wurden zu Verkehrsknoten, die Fußgänger verloren immer mehr Bewegungsspielraum. Dass dem Fußverkehr heutzutage wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss – ähnlich wie dem Radverkehr – ist eine notwendige Erkenntnis der Gegenwart, insbesondere aufgrund des Bedürfnisses nach energieeffizienten und schadstoffarmen Fortbewegungsmitteln, der teilweise nicht mehr bewältigbar scheinenden Verkehrsstärken im Kfz-Verkehr sowie dem Wunsch nach einer effizienten Flächennutzung und -verteilung im urbanen Raum
Bei einer zeitgemäßen Planung wird deshalb das Zu-Fuß-Gehen als Fortbewegungsart (wieder) ernst genommen und nicht nur als Freizeitbeschäftigung, Spaziergehen oder körperliche Ertüchtigung betrachtet (Laufen, Joggen, …) Das Zu-Fuß-Gehen sollte in den Planungen aktiv berücksichtigt werden; in Abhängigkeit der Umfeldbedingungen sollte in manchen Bereichen Fußgängern auch der Vorrang gegeben werden, um mittel- bis langfristig das Zu-Fuß-Gehen (wieder) als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren. Der Fußgängerverkehr benötigt nach wie vor eigene Verkehrsnetze; sind diese gut ausgebaut kann der Modal-Split Anteil besonders im Nahbereich (bis zu ungefähr 2 km) beträchtlich sein.
Die Bedeutung des Zu-Fuß-Gehens als „Alltagsverkehrsmittel“ wird oft unterschätzt: in vielen herkömmlichen Mobilitäts- und Verkehrserhebungen werden die Teilstrecken eines Weges, die zu Fuß zurückgelegt werden, einem Hauptverkehrsmittel zugeordnet, anstatt den Fußweg als eigene Etappe zu betrachten. So wird z.B. der Fußweg von einer Quelle zur Einstiegshaltestelle, um in den Bus zu steigen wie auch der Fußweg von der Ausstiegshaltestelle zum Ziel dem öffentlichen Verkehr (als Zu- und Abgangswege zum Hauptverkehrsmittel) zugeordnet und nicht in drei Einzelwege (Zu-Fuß-Gehen – BusFahren – Zu-Fuß-Gehen) zerlegt. Das Zu-Fuß-Gehen wird dadurch bereits per se in den Mobilitätserhebungen unterrepräsentiert, obwohl ohne Fußwege fast keine Ortsveränderung möglich ist.
Tabelle 2.1 Anteil an Wegen je Hauptverkehrsmittel im Werktagsverkehr (Quelle: Österreich unterwegs 2013/2014)

Der Anteil des Zu-Fuß-Gehens am gesamten Verkehrsaufkommen (bezogen auf die Hauptverkehrsmittel) ist dabei in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. In Österreich ist das Verkehrsaufkommen seit dem Jahr 1995 im Fußverkehr um rund 35 % gesunken, während alle anderen Verkehrsmittel ihren Anteil am Verkehrsaufkommen gesteigert haben (Radverkehr: +7 %, MIV-Lenker: +22 %, MIV-Mitfahrer: +1 %, ÖV: +16 %). Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und hängen sehr stark mit der zunehmenden Motorisierung und dem autogerechten Ausbau der Städte zusammen. Dies hat zu veränderten Siedlungsstrukturen, allgemein zunehmenden Weglängen und teilweise zum „Zwang“ geführt, für bestimmte Wege das Auto nutzen zu müssen (z.B. in peripheren Lagen).
Klagenfurt erreichte im Städteranking 2020 von Greenpeace, in welchem die österreichischen Landeshauptstädte anhand sieben verkehrsrelevanter Kriterien verglichen werden, insgesamt den 3. Rang und konnte somit im Vergleich zum Ranking aus dem Jahr 2017 einige Plätze gutmachen (7. Rang im Jahr 2017). Beim Kriterium der Fußgängerfreundlichkeit konnte die Stadt durch die Ausweitung verkehrsberuhigter Zonen (Tempo 30) sowie einer starken Verbesserung der Verkehrssicherheit (Verunfallte pro 1.000 Einwohner) punkten, erreichte im Vergleich der österreichischen Landeshauptstädte in Bezug auf die Fußgängerfreundlichkeit jedoch nur den 6. Rang (gleich wie im Jahr 2017) In Bezug auf den ModalSplit lag Klagenfurt sowohl 2017 wie auch 2020 auf dem vorletzten Rang, was durch den hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr (66 %) begründet wurde, welcher der zweithöchste aller Landeshauptstädte in Österreich war. Der Anteil an zu Fuß zurückgelegten Wegen war mit 11 % der geringste aller Landeshauptstädte in Österreich.
Tabelle 2 2 Anteil an Wegen je Hauptverkehrsmittel (Quelle: VCÖ Publikation „Wie Städte die Mobilitätswende voranbringen“, 2019, welche wiederum Grundlage für das Städteranking 2020 von Greenpeace darstellte)
Für Klagenfurt liegen jedoch auch Erhebungen vor, die ein anderes Bild zeigen Eine Mobilitätserhebung in der Klagenfurter Innenstadt im Jahr 2010 ergab, dass 47 % der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden (16 % zu Fuß, 22 % mit dem Fahrrad und 9 % mit dem öffentlichen Verkehr). Die Klagenfurter Wohnbevölkerung gab in der Mobilitätsstudie Kärnten 2009 an, dass 52 % der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden (23 % zu Fuß, 14 % mit dem Fahrrad und 15 % mit dem öffentlichen Verkehr). Im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 wurde der Anteil des Umweltverbundes für den Binnenverkehr auf 45 % konsolidiert (24 % zu Fuß, 12 % mit dem Fahrrad und 9 % mit dem öffentlichen Verkehr)

Man kann also davon ausgehen, dass für die Klagenfurter Wohnbevölkerung im Binnenverkehr von Klagenfurt das Zu-Fuß-Gehen einen höheren Stellenwert einnimmt als dies aus allgemeinen Statistiken ableitbar ist. Gleichzeitig zeigen die Statistiken auch, dass der Anteil des Zu-Fuß-Gehens im Alltagsverkehr – je nach Rahmenbedingungen – durchaus 20 % und mehr annehmen kann.
Hinsichtlich der demographischen Verteilung ist zu berücksichtigen, dass vor allem in der Altersgruppe bis 14 Jahren der Anteil an aktiven Mobilitätsformen (Gehen und Radfahren) sehr hoch ist (bis zu 34 % der Wege in Österreich); dieser Anteil sinkt dann für alle Altersgruppen bis zu den 65 Jährigen ab und erreicht erst wieder in der Gruppe der 65 bis 74 Jährigen ähnlich hohe Werte (31 % aller Wege in Österreich) bzw. übersteigt er in der Altersgruppe der über 75 Jährigen (mit bis zu 40 % aller Wege in Österreich) sogar den Anteil der jüngsten Altersgruppe Dies bedeutet auf der anderen Seite, dass die Infrastruktur für Fußgänger für alle Altersgruppen - und hier vor allem für die Jüngsten und Ältestenattraktiv gestaltet werden muss. Unabhängig vom Alter ist Zu-Fuß-Gehen für fast jeden möglich und sinnvoll.
Abseits des Umstandes, dass ohne Zu-Fuß-Gehen kaum eine Ortsveränderung möglich ist, weil jede Wegekette zumindest auf den ersten und letzten Metern zu Fuß zurückgelegt wird, kann das Zu-FußGehen bis Distanzen von rund zwei Kilometern als die mit Abstand effizienteste Art der Fortbewegung angesehen werden. Es werden keine Flächen zum Abstellen des „Verkehrsmittels“ benötigt, Zu-FußGehen ist kostengünstig und hat in der Regel keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Durch das Spazieren gehen, flanieren, bummeln, … entsteht Urbanität in städtischen Räumen und die dafür vorgesehenen Räume können in der Regel belebt werden. Zu-Fuß-Gehen bietet zudem einen gesundheitlichen Aspekt, verschiedenste Gesundheitsratgeber empfehlen täglich 10.000 Schritte zu absolvieren, um gesund und aktiv zu bleiben.
Zusammenfassend kann abschließend festgehalten werden, dass Zu-Fuß-Gehen
▪ einfach und unkompliziert ist
▪ nichts kostet
▪ die eigene Gesundheit stärkt
▪ die Umwelt schont und emissionsfrei ist
▪ Straßen, Plätze und urbane Räume belebt und damit
▪ zur Steigerung der Lebensqualität beitragen kann.
Aus diesen Gründen sollten in Klagenfurt auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das Zu-Fuß-Gehen zu fördern und für alle Personen- und Altersgruppen attraktiv zu machen, worauf in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter eingegangen werden soll.

3
Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele
Beim Zu-Fuß-Gehen hat jeder Mensch andere Anforderungen an den Verkehrsraum: ältere und mobilitätseingeschränkte Personen bewegen sich anders durch den Straßenraum als junge und gesunde. Personen mit Kinderwagen oder in Begleitung von Kleinkindern haben andere Ansprüche an den Straßenraum als eine Person, die alleine unterwegs ist und möglichst schnell von A nach B möchte. Für Frauen und ältere Personen ist zudem das Thema Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenraum ein weitaus wichtigeres Thema als für Männer. Dies verdeutlich, dass das Zu-Fuß-Gehen bzw. die Mobilität zu Fuß ein Querschnittsthema ist, welches unterschiedliche Themenbereiche wie z.B. Stadtplanung, Klima- und Umweltplanung, Verkehrs- und Straßenplanung betrifft. Es bestehen vielfältige Verknüpfungen und Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Handlungsfeldern, Planungsinstrumenten und Themenschwerpunkten Im Nachfolgenden sollen aus allgemeinen Rahmenbedingungen, übergeordneten Strategien sowie bereits bestehenden Konzepten auf lokaler Ebene entsprechende Ziele für die Förderung des Fußgängerverkehrs in Klagenfurt abgeleitet werden.
3.1 Technische Rahmenbedingungen und Regelwerke
Das Netz für Zu-Fuß-Gehende baut sich grundsätzlich aus folgenden Infrastrukturelementen auf:
▪ Fußgängerbereiche/-zonen: Fußgängerbereiche/-zonen sind vor allem städtebaulich-architektonische relevante Räume und Plätze. In beschränktem Ausmaß kann in diesen Bereichen Fahrverkehr (Zulieferer, Radfahrer mit geringen Geschwindigkeiten, …) zugelassen werden. Diese Fußgängerbereiche/-zonen sollten an andere Verkehrsnetze (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr) gut angebunden sein, auf jeden Fall jedoch auch an das umgebende Fußgängernetz.
▪ Gehwege: Gehwege werden separat geführt und dienen der Aufnahme der Hauptbeziehungen des Fußverkehrs. In der Netzgestaltung für Zu-Fuß-Gehende bilden sie das Grundelement innerhalb der Stadt. Geh- und Radwege können beiangemessenen Verkehrsstärken und geringen Geschwindigkeitsunterschieden miteinander kombiniert werden.
▪ Befahrbare Straßen und Wege: Diese können sowohl vom Fußgängerverkehr (bei geringen Verkehrsstärken), wie auch vom Fahrverkehr genutzt werden. Grundsätzlich sollte die Gestaltung so erfolgen, dass im Kfz-Verkehr nur geringe Geschwindigkeiten gefahren werden können.
▪ Gehsteige: Gehsteige sind meist baulich von der Fahrbahn getrennt. Sie dienen im Wesentlichen der Erschließung der Gebäude bzw. Grundstücke mit den verschiedensten Nutzungen und der Aufnahme von Zu-Fuß-Gehenden entlang der Straße. In den meisten Fällen sind Gehsteige aus Sicherheitsüberlegungen notwendig, um den (schnellen) Fahrverkehr vom Fußgängerverkehr zu trennen. Bei großen Breiten können Gehsteigflächen auch als Aufenthaltsraum im Straßenraum wahrgenommen werden
▪ Übergänge: Übergänge in jeder Ausprägungsform (niveaugleich, niveaufrei, Schutzweg, Querungshilfe, …) dienen der Überquerung von trennenden Verkehrsanlagen (Schienen, Straßen, …) und verbinden in der Regel einander gegenüberliegende Fußgängernetze.
Bei der Dimensionierung von Fußwegen sind in Österreich die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS-Richtlinien) zu beachten. Menschen mit besonderen Mobilitätsbedürfnissen sind in der Planung besonders zu berücksichtigen. Dazu zählen neben Personen im Rollstuhl oder mit Gehhilfen

auch seh- und hörbehinderte Personen, ältere Personen und Kinder. Dazu werden in verschiedenen Richtlinien und Normen entsprechende technische Rahmenbedingungen dargestellt, welche nachfolgend auszugsweise aufgelistet sind:
▪ RVS 02.03.11 Optimierung des ÖPNV
▪ RVS 02.03.12 Behindertengerechte Ausgestaltung des ÖPNV
▪ RVS 03.02.12 Fußgängerverkehr
▪ RVS 03.02.13 Radverkehr
▪ RVS 03.04.11 Gestaltung öffentlicher Räume in Siedlungsgebieten
▪ RVS 03.04.12 Planung und Entwurf von Innerortsstraßen
▪ RVS 03.04.13 Kinderfreundliche Mobilität
▪ RVS 03.04.14 Gestaltung des Schulumfeldes
▪ OIB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
▪ ÖNORM B1600
Die sogenannte Regelbreite des Verkehrsraums für den Fußgängerverkehr wird mit mindestens 2,00 m festgelegt (gem. RVS 03.02.12). Grundlage hierfür wiederum ist der Bewegungsraum eines Fußgängers von 1,00 m. Dadurch soll ein gefahrloses und bequemes Begegnen und Passieren zweier Fußgänger ermöglicht werden (siehe Abbildung 3 1) Auf unvermeidbaren Engstellen (Bereiche auf einer Länge von max. 1,00 m) ist eine minimale Durchgangsbreite von 1,20 m zu erhalten, bei punktuellen Einschränkungen wie Pollern oder Fahnenmasten sollte die Durchgangsbreite zumindest 0,90 m betragen, was dem minimalen Breitenbedarf eines Rollstuhls entspricht, welcher dem Breitenbedarf von Personen mit Kinderwägen, Rollatoren oder Gepäckstücken gleichzusetzen ist
Der Verkehrsraum für Fußgänger ist in weiterer Folge in Abhängigkeit der Verkehrsstärke zu erweitern, um auch weiterhin eine entsprechende Verkehrsqualität für Fußgänger gewährleisten zu können. Hierfür werden Breitenzuschläge genannt, wie etwa z.B. ein zusätzlicher Schutzstreifen zur Fahrbahn bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h (0,50 m), überstehenden senkrecht oder schräg parkenden Fahrzeugen (0,50 m), Geschäfts- und Ruheflächen (1,00 m) oder bei Haltestellen für den öffentlichen Verkehr (1,50 bis 4,25 m).
Deutsche Richtlinien gehen zwar von einer Verkehrsbreite von nur 1,80 m für den Begegnungsfall zweier Personen aus, lt. gängigen Richtlinien ergibt sich jedoch eine Regelbreite von 2,50 m. Dabei wird ein Platzbedarf von 0,20 m zwischen den Personen hinzugefügt, 0,20 m Abstand zur Gebäude- oder Grundstückskante vorgeschlagen sowie ein 0,50 m breiter Distanzstreifen zum fließenden Verkehr, in dem Leuchten und andere technische Elemente Platz finden können (vgl. Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)). Die Deutsche Bundesregierung spricht sich für eine Verwendung des Regelmaßes von 2,50 m für Gehwege aus.
Die Schweiz unterscheidet bei der Herleitung der nötigen „Trottoirbreite“ die grundlegende Charakteristik des Verkehrsraums gemäß dem „Bedeutungsplan öffentlicher Stadträume“, der einer Art Raumordnungsprogramm und Hierarchisierung von Städten entspricht. Davon abhängig ist das Fußverkehrsaufkommen (Spitzenstunde) und der dafür maßgebende Begegnungsfall. Im Minimalfall (Gehweg mit zumeist nachbarschaftlicher Bedeutung in Wohngebieten) ergibt sich so eine Mindestbreite von 2,00 m,

die durch minimale Umfeldzuschläge (wie sie etwa in Österreich durch die Breitenzuschläge vorgenommen werden) ergänzt werden. Für sog. Quartierzentren, werden darüber hinaus pauschal 0,50 m an Gehwegbreite hinzugerechnet.

Abbildung 3 1 Breitenangaben für die Bewegung von Fußgängern, RVS 03.02.12 (2015)

3.2 Übergeordnete Strategien und Konzepte
Die Entwicklung und Stärkung des Fußgängerverkehrs bzw. der Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger, Radfahrer und öffentlicher Verkehr) ist nicht nur ein lokales Ziel. Vielmehr ist eine Steigerung des Anteils der im Umweltverbund zurückgelegten Wege besonders im urbanen Bereich ein Ziel auf globaler, europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Die Vereinten Nationen formulierten in der Agenda 2030, der sog. „Nachhaltigkeitsagenda“, insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (aus dem Englischen Sustainable Development Goals, kurz SDGs). Das Besondere an der Agenda ist ihre Universalität und ihr vernetztes Verständnis notwendiger sozialer, ökologischer und ökonomischer Maßnahmen, in dem alle Menschen und Institutionen gleichermaßen die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Der Masterplan Gehen der Stadt Klagenfurt versteht sich als Beitrag dieser Agenda und insbesondere der Ziele Gesundheit und Wohlergehen (Ziel 3), Nachhaltige Städte und Gemeinden (Ziel 11) und Klimaschutz und Anpassung (Ziel 13).



Abbildung 3 2 3 der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen aus der Agenda 2030, welchen der Masterplan Gehen entspricht; UNESCO-Kommission, unesco.de
Die Umsetzung dieser Strategie ist eine Herausforderung an die Mobilitätsplanung auf allen Verwaltungsebenen und erfordert eine Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen, wobei sich die Aufgaben und die Verantwortung über den nicht motorisierten Verkehr je nach Themenbereich auf unterschiedliche Gebietskörperschaften, Bundesministerien sowie Verwaltungseinheiten und Organisationen verteilen. Bei der Planung von Radwegenetzen, Fußwegen und für die Integration des nicht motorisierten Verkehrs in den öffentlichen Raum, sind in Österreich grundsätzlich die Gemeinden zuständig. Sie erstellen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und sorgen im Zuge der lokalen Verkehrsplanung dafür, dass es ausreichende Verkehrsflächen für Zu-Fuß-Gehende und Rad fahrende Personen gibt. Planung und Gestaltung von Flächen für den nicht motorisierten Verkehr im Bereich von Landesstraßen fallen in den Wirkungsbereich der Bundesländer; der Bund und damit das Bundesministerium hat keine für die Planung von Verkehrsflächen für Fußgänger und Radfahrer.
3.2.1 Europäische Ebene
In den letzten Jahren erhielt das Thema Fußverkehr auf europäischer Ebene mehr und mehr Beachtung und wurde z.B. 2011 in das Weißbuch der Europäischen Kommission in den „Fahrplan zu einem ein-

heitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ aufgenommen Die Förderung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs sollte als integraler Bestandteil in die Konzeption der städtischen Mobilität und Infrastruktur einfließen.
Das Weißbuch hat zwar keine gesetzliche Verbindlichkeit, legt aber die Kernziele der Kommission für den „Verkehr 2050“ fest. Andere europäische Verordnungen befassen sich nur mit dem Schutz von ungeschützten bzw. verletzlicher Verkehrsteilnehmer durch diverse Vorgaben für die Zulassung von Kraftfahrzeugen oder Teilen davon, die durch die fortschreitende Entwicklung automatisierter und vollautomatisierter Fahrzeuge notwendig geworden sind (z.B. Verordnung (EU) Nr. 2019/2144 und 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates)
3.2.2 Nationale Ebene
Im „Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich“ wurde ein neuer Klimaschutz-Rahmen für den österreichischen Verkehrssektor unter den Schlagwörtern „nachhaltig – resilient – digital“ beschlossen. Vorrangiges Ziel darin ist es den Anteil des Umweltverbunds aus Fuß- und Radverkehr, öffentlichen Verkehrsmitteln und geteilter Mobilität deutlich zu steigern.
Grundbestandteil des Mobilitätsmasterplans ist die Schaffung eines erneuerten rechtlichen Rahmens für die Umsetzung der gesetzten Ziele. Dabei sollen bestehende Materiengesetze in verschiedenen Sektoren hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Vorgaben der Klimaneutralität 2040 (Vorgaben des Pariser Klimavertrags) geprüft werden. Im Anschluss sollen diese neuausgerichteten Rechtsnormen den Rahmen für wirkungsvolle Maßnahmen bieten. Unter Einbezug externer Expertinnen und Experten soll das Mobilitätsrecht umfassend reformiert werden und u.a. die Straßenverkehrsordnung fuß- und radfahrfreundlich umgestaltet werden.
Auch das Bundesministerium ist grundsätzlich bestrebt, den Anteil des Fuß- und Radverkehrs am Modal-Split durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für diese Verkehrsarten zu erhöhen. Es konzentriert sich dabei auf jene Einflussmöglichkeiten, die dem Bund in rechtlicher Hinsicht offen stehen
Der „Masterplan Gehen“ des Bundesministeriums bzw. die „Strategie zur Förderung des Fußgängerverkehrs in Österreich“ hat zum Ziel, die Kommunen durch das klimaaktiv mobil Förderprogramm aktiv zu unterstützen Durch die Einbettung des Themas Fußgängerverkehrs in die klimaaktiv mobil Programme werden den Kommunen Beratung und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von umweltfreundlichen Mobilitätsprojekten geboten. Die Investitionen können dabei für Maßnahmen in unterschiedlichen Themenfeldern eingesetzt werden, wie etwa in eine Verbesserung der Fußwegeinfrastruktur, eine Optimierung der Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln oder die Information und Bewusstseinsbildung und fußgängerorientierte Energieraumplanung für kurze Wege
3.2.3 Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035
Vor dem Hintergrund einer sinkenden Einwohnerzahl und den budgetären Restriktionen des Landes galt es im „Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035“ für Kärnten, Entwicklungspotenziale und neue Technologien zu erkennen und innovative Lösungen zu realisieren. Der gesamte Mobilitäts Masterplan Kärnten besteht aus drei Teilen: der Analyse, der Strategie und den Handlungsfeldern inklusive Maßnahmen. Die Vision des Landes Kärnten ist es, langfristig den Anteil des öffentlichen Personenverkehrs am Gesamtverkehr auf 20 % zu erhöhen, den Anteil des Rad- und Fußgängerverkehrs auf 40 % zu heben und

den motorisierten Individualverkehr von derzeit über 77 % auf 40 % zu senken. Bis 2035 soll in jedem Fall der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs verdoppelt werden. Gleichzeitig sollen die Erreichbarkeit des Landes Kärnten verbessert und die Umweltbelastungen reduziert werden. Die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung stehen dabei im Vordergrund.
Auf Basis einer umfangreichen Analyse, der vom Land Kärnten vorgegebenen verkehrspolitischen Vision und der zu beachtenden übergeordneten Strategien wurden 7 Leitprinzipien inklusive konkreter Ziele für die folgenden 20 Jahre definiert. Diese Ziele geben die Richtung vor, der die Verkehrspolitik und die Verkehrsplanung unter Anwendung der Leitprinzipien bis 2035 folgen sollen. Um den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele evaluieren zu können, wurden begleitend Indikatoren festgelegt. Von der Vision und der Strategie wurden im nächsten Schritt wiederum 7 Handlungsfelder und die zugehörigen Maßnahmen zur Strategieumsetzung abgeleitet. Handlungsfelder fassen unterschiedliche Maßnahmen verkehrsträgerübergreifend zusammen und stellen somit eine thematische Gliederung der einzelnen Maßnahmen dar. Es bestehen Wechselwirkungen und Querbeziehungen zwischen den einzelnen Maßnahmen. Jede Maßnahme leistet ihren Beitrag zur Erreichung der definierten Ziele und wurde daher entsprechend priorisiert.
Als Hauptanliegen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele des Landes Kärnten werden dabei eine abgestimmte Parkraumpolitik, die konsequente Förderung bzw. auch die Bevorrangung des Radfahrens und Zu-Fuß-Gehens und die Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs genannt. Das Zu-FußGehen soll durch eine attraktive Gestaltung von Straßen und Plätzen durch ausreichende Flächen für Fußgänger, Bäume und Begrünungen, Sitzgelegenheiten unter Aspekten der Barrierefreiheit gefördert werden. In Bezug auf den Fußgängerverkehr werden u.a. folgende konkrete Maßnahmen genannt:
▪ An Verkehrslichtsignalanlagen: möglichst kurze („faire“) Wartezeit für Fußgänger, Vermeidung von Fußgängertastern zur Anmeldung (Ausnahmen für die Verlängerung der Grünzeiten an Querungsstellen mit hoher Frequenz von älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen)
▪ Einbindung von Fußwegen in die Planung von ÖV-Haltestellen bzw. bei der Neuausweisung von Siedlungsgebieten
▪ Kein Abmarkieren von Stellplätzen auf dem Gehsteig (kein legalisiertes Parken auf Gehsteigen)
▪ Öffnung von Sackgassen für eine bessere Durchwegung sowie Anbindung peripherer Siedlungsschwerpunkte mit dem Zentrum
▪ Schaffung von Anreizen für den Fußweg im Umfeld von Schulen
▪ Zurückhaltender Einsatz von Schutzwegen (nur bei entsprechenden Fußgängerfrequenzen); Prüfung alternativer Querungshilfen ohne Schutzwegmarkierung
▪ Schaffung von Begegnungszonen und Shared Space-Bereichen in Ortszentren (u.a. zur Reduktion der Geschwindigkeit und Erhöhung der Verkehrssicherheit)
▪ Etablierung von Fußgängerleitsystemen

3.3 Bestehende Strategien auf lokaler Ebene
Auch in Klagenfurt wurden in den letzten Jahren verschiedene Strategien und Konzepte entwickelt, welche teilweise in geförderten Projekten umgesetzt wurden.
3.3.1 Aktionsplan Mobilität Klagenfurt
Der „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ wurde im Jahr 2014 im Gemeinderat der Stadt Klagenfurt beschlossen, Maßnahmen daraus wurden in den letzten Jahren schrittweise umgesetzt. Neben der Bewusstseinsbildung und Positionierung des „Zu-Fuß-Gehens“ und des Fahrrads als „Alltagsverkehrsmittel“ (z.B. durch die Einführung von Dienstfahrrädern für Politiker und Magistratsbedienstete sowie der Unterstützung medialer Kampagnen und Initiativen (Radgipfel, „Radelt zur Arbeit“) wird im „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ festgehalten, dass innerhalb des Stadtgebietes bzw. auch in Verbindung mit den Umlandgemeinden das Radfahren durch folgende Maßnahmen zu unterstützen und zu fördern ist:
▪ Abbauen von Barrieren für den Fußgänger- und Radverkehr, z.B. durch die Öffnung von Einbahnstraßen, die Öffnung von Innenhöfen, Priorisierung an Druckknopfanlagen (Verkürzung der Wartezeiten), Errichtung von Über- bzw. Unterführungen und eine Erhöhung der allgemeinen Durchwegung, um der Flexibilität von Fußgängern und Radfahrern Rechnung zu tragen
▪ intermodale Verknüpfung der Kombination von „Zu-Fuß-Gehen“ und Fahrradfahren mit dem öffentlichen Verkehr als wichtiges Fundament für die klimafreundliche Mobilität, z.B. durch die Schaffung multimodaler Knoten, durch die Erhöhung der Reichweite und des Einzugsgebietes umweltfreundlicher Verkehrsmittel, durch entsprechende Infrastrukturen im Fußgänger- und Radverkehr, durch die Aufwertung von Haltestellen (Qualität und Sicherheit) usw.
▪ Schaffung und Verankerung einer fuß- bzw. radfahrfreundlichen Verkehrsorganisation in den einzelnen Stadtteilzentren durch Verkehrsberuhigungen, Begegnungszonen, Fahrradstraßen etc. z.B. durch Pilotprojekte in fuß- und radfahraffinen Bereichen
▪ Positionierung des „Zu-Fuß-Gehens“ bzw. des Fahrrades als „Alltagsverkehrsmittel“
In Hinblick auf die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer wurden im Rahmen des „Aktionsplans Mobilität Klagenfurt“ weitere folgende Grundsätze definiert, welche als wesentliche Bestandteile in das „Stadtentwicklungskonzept 2020+“ eingeflossen sind:
▪ In der Stadt- und Verkehrsplanung soll das Motto „Stadt der kurzen Wege“ stärker in den Vordergrund rücken. Nahversorgung, Kinderbetreuung und Basisausbildung sollen in möglichst fußläufiger Entfernung vom Wohnort gesichert sein. Bezirks- und Stadtteilzentren sollen in ihrer Ausstattungsqualität gefördert bzw. erhalten werden
▪ Vermeidung von Barrierewirkungen und Hindernissen in Geh- und Radwegen, z.B. durch natürliche Hindernisse wie Bäche und Gräben oder durch künstliche Hindernisse wie Bahn-/Straßenanlagen und Gebäude
▪ Ausbau und Verdichtung des Fuß- und Radwegenetzes
▪ Weiterführung bzw. Anbindung der Geh- und Wanderwege sowie der Radwege und Radrouten in Klagenfurt (z.B. Hauptradrouten) über die Stadtgrenze hinaus in die Umlandgemeinden in Kooperation mit dem Land Kärnten und den Umlandgemeinden
▪ Modal-Split Ziele des Aktionsplans Mobilität Klagenfurt

Die im „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ als verkehrspolitische Vorgabe dargelegten Umsetzungsstrategien zur Verwirklichung der Entwicklungsziele können grundlegend in drei unterschiedliche Zeithorizonte gegliedert werden:
▪ Kurzfristige Umsetzungsstrategien und Maßnahmen sollen vor allem eine Verschiebung des ModalSplits vom Pkw zum Umweltverbund (Fußgänger – Radfahrer – öffentlicher Verkehr) herbeiführen. Die Verschiebung des Modal-Splits soll einerseits durch Angebotsverbesserungen in den Netzen für Fußgänger, Radfahrer und öffentlichen Verkehr erfolgen (Schließung von Lücken, Abbau von Barrieren im Rad- und Fußwegenetz, Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs durch Busfahrstreifen, Verbesserung der intermodalen Verknüpfung), gleichzeitig aber auch von restriktiven Maßnahmen (Parkraumbewirtschaftung) unterstützt werden.
▪ Durch die mittelfristigen regionalen Umsetzungsstrategien und Maßnahmen bis ins Jahr 2030 wird vor allem aufgrund der Inbetriebnahme der Koralmbahn im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr bzw. auch im Güterverkehr eine Verschiebung von der Straße auf die Schiene stattfinden. Innerstädtisch zielen die angeführten Maßnahmen auf eine weitere Stärkung des Umweltverbundes und vor allem auf die Realisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ in verdichteter Bauweise ab. Durch die Schaffung und Ausweisung von Gebieten, die eine Mischnutzung erlauben und damit die Nahmobilität fördern, die konsequente Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und die Aufrechterhaltung bzw. Verschärfung der Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr, sollte es in Summe möglich sein, den angestrebten Modal-Split zwischen motorisiertem Individualverkehr und Umweltverbund von 35:65 im Binnenverkehr bzw. von 50:50 im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr zu erreichen.
▪ Durch die langfristigen Umsetzungsstrategien und Maßnahmen bis ins Jahr 2050 ist vor allem im Innenstadt- bzw. Kernstadtbereich mit einem erhöhten Anteil an kurzen Wegen zu rechnen. Auf der anderen Seite bietet der öffentliche Verkehr eine entsprechende Verknüpfung ins Umland an, sodass hier eine intermodale Verknüpfung zwischen Stadt- und Regionalverkehr besteht. In Summe ist davon auszugehen, dass durch diese Maßnahmen der Anteil der Wege im Umweltverbund (ausgehend von 2030) weiterhin leicht zunimmt und ein Modal-Split Verhältnis in der Größenordnung von 30:70 zu erreichen ist (wobei dies zukünftig weiterer Anstrengungen und die regelmäßige Nachjustierung der im Aktionsplan Mobilität definierten Umsetzungsstrategien und Maßnahmen erfordert).
3.3.2 Stadtentwicklungskonzept 2020+
Das Stadtentwicklungskonzept (STEK 2020+) ist ein „Örtliches Entwicklungskonzept“ für Klagenfurt, dessen rechtliche Basis das Kärntner Gemeindeplanungsgesetz bildet. Im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Kärntner Raumordnungsgesetzes und den überörtlichen Entwicklungsprogrammen sowie unter Berücksichtigung der raumbedeutsamen Maßnahmen und Planungen des Landes, des Bundes und anderer Planungsträger, deren Planungen im öffentlichen Interesse liegen, bildet das Stadtentwicklungskonzept die fachliche Grundlage für die planmäßige Gestaltung und Entwicklung von Klagenfurt, insbesondere für die Erlassung des Flächenwidmungsplanes.
Das Stadtentwicklungskonzept ist jenes Planungsinstrument, das ausgehend von den wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten die übergeordneten Ziele der örtlichen Raumplanung festlegt. Ausgehend von der Stellung von Klagenfurt in der Region wird auf die abschätzbare Bevölkerungsentwicklung, die angestrebte Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung, den abschätzbaren

Baulandbedarf, die funktionelle Gliederung des Gemeindegebietes, die Anordnung des Baulandes, die Festlegung von angestrebten Siedlungsgrenzen, auf Aspekte der Infrastruktur, der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen und der naturräumlichen Ausstattung eingegangen.
Der Planungszeitraum des Stadtentwicklungskonzeptes 2020+ beträgt zehn Jahre; die Festlegungen werden demnach weit in das kommende Jahrzehnt hineinwirken. Darüber hinaus werden auch Ziele formuliert, die weiter in die Zukunft gerichtet sind, so etwa die Umstrukturierung innerstädtischer Gebiete (urbane Potenziale) oder die Verfolgung von Energie- und Nachhaltigkeitszielen, welche einen Planungshorizont von 30 Jahren und mehr aufweisen.
Im Stadtentwicklungskonzept werden vier übergeordnete strategische Ziele für die zukünftige Entwicklung der Stadt Klagenfurt definiert, wobei für den Masterplan Radfahren Gehen vor allem die nachhaltige und umweltschonende Stadtentwicklung (Strategie 2) und die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in Klagenfurt (Strategie 3) von Bedeutung sind:
▪ Strategie 1 – Positionierung der Stadt Klagenfurt im Alpe Adria Raum: Die Landeshauptstadt will ihre Bemühungen verstärken, um gemeindeübergreifende Themen der Standortentwicklung in enger Abstimmung mit den Nachbargemeinden zu bearbeiten. Neben dem Ausbau der Stadt-UmlandBeziehungen sollen sektorale Kooperationen und Allianzen mit den Nachbarstädten im Kärntner Zentralraum ausgebaut werden. Verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten im Alpe Adria Raum werden angestrebt.
▪ Strategie 2 – Nachhaltige Stadtentwicklung, Sicherung der Umweltqualitäten von Klagenfurt: Durch den Einsatz energieeffizienter und ressourcenschonender Technologien soll sich Klagenfurt zu einer Smart City entwickeln. Ökologisch sensible Lebensräume sollen erhalten, pfleglich entwickelt und vor Eingriffen geschützt werden. Die konsequente Verfolgung der Energieziele (-20% CO2 Ausstoß bis 2020, -90% CO2 Ausstoß bis 2050) soll neben der Erhöhung der Energieeffizienz auch zur Reduktion von Luft- und Lärmbelastung und zu einer Erhöhung der Lebensqualität beitragen. Der Innenstadtentwicklung ist dabei höchste Priorität einzuräumen. Neben der Geschäfts- und Dienstleistungsfunktion soll insbesondere auch das innerstädtische Wohnen forciert werden.
▪ Strategie 3 – Hohe Lebensqualität in Klagenfurt erhalten und weiter verbessern: Die Wohnbevölkerung soll bestmöglich vor negativen Einflüssen durch Luftschadstoffe und Lärm geschützt werden. Die historische Altstadt und baukulturell wichtige Ensembles sollen geschützt und für zukünftige Nutzungen geöffnet werden. Für das reiche kulturelle Angebot sollen entsprechende Räume angeboten werden. Die Siedlungsentwicklung in Klagenfurt soll fußgänger- und radfahrerfreundlich sein.
▪ Strategie 4 – Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Klagenfurt: Um im internationalen Standortwettbewerb zu bestehen, verfolgt die Landeshauptstadt Klagenfurt konsequent wirtschaftspolitische Zielsetzungen. Dazu gehören neben der Erhöhung der Servicequalität in der Betriebsansiedelung und der Wirtschaftsförderung, die Sicherung wichtiger Infrastrukturen wie des Flughafens und des Messestandortes. Dem Faktor Bildung kommt ebenfalls eine zentrale Stellung zu. Durch den gezielten Einsatz von erneuerbarer Energie soll der Wirtschaftsstandort Klagenfurt gestärkt, „green jobs“ geschaffen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, sowie der damit verbundene Kapitalabfluss in andere Regionen verringert werden.

3.3.3 Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV
Das Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV wurde im Jahr 2019 vor dem Hintergrund bereits bestehender Zielsetzungen, Strategien und Konzepte als Gesamtmobilitätskonzept mit wesentlichem Schwerpunkt auf eine Neuorientierung des städtischen ÖPNV unter ausdrücklicher Beachtung der anderen Verkehrsträger erarbeitet Die Zielvorstellungen und Strategien bereits beschlossener Konzepte (u.a. Sustainable Energy Action Plan, Aktionsplan Mobilität, Masterplan Radfahren und Smart City Strategie, Stadtentwicklungskonzept 2020+) wurden bei der Entwicklung der verkehrspolitischen Zielvorstellungen mit dem Zeithorizont 2035 ebenso mit einbezogen.
Die Ziele und Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes wurden in das Handlungsfeld 1 – Mobilität der Smart City Strategie übernommen und damit am 27.11.2018 und 25.05.2021 (Version 6.0) vom Gemeinderat beschlossen.
Das Mobilitätskonzept basiert auf einem Leitbild, das auf sechs Leitlinien aufgebaut ist (siehe Abbildung 3 3) Für jene Ziele, die quantifizierbar bzw. seitens der Stadt Klagenfurt auch mit überschaubarem Aufwand beobachtbar bzw. messbar sind, wurden spezifische Indikatoren definiert. Zur Quantifizierung der Wirkungen wurden Planfallberechnungen mit Hilfe des Verkehrsmodells der Stadt Klagenfurt durchgeführt (Bestand, Plannullfall 2035 und Maßnahmenplanfall 2035) und in Form von Verkehrsumlegungsplänen für den MIV und ÖV dokumentiert. Dabei ergaben sich ambitionierte Ziele in Bezug auf die Verlagerung von MIV hin zum Umweltverbund: MIV von 65 auf 35 % bzw. Umweltverbund von 45 % auf 55 %. Stadtgrenzüberschreitend soll ein Verhältnis von 50 zu 50 % (gegenüber 21 zu 79 %) erreicht werden. Entsprechend den Modellrechnungen entspricht das einer Reduktion der Pkw-Fahrleistung im Stadtgebiet von Klagenfurt von 31 % (von 2,16 Mio. Kfz-km pro Werktag auf 1,49 Mio. im Jahr 2035). Der Anteil des Fußverkehrs am Modal-Split im Binnenverkehr soll gemäß dem Konzept von 24 % (2018) auf 25 % (2035) gesteigert werden. Stadtgrenzüberschreitend soll der Fußverkehr bis 2035 auf 1 % am Modal-Split (von 0 % im Jahr 2018) gesteigert werden.
Abbildung 3 3
Leitlinien des Mobilitätskonzepts Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV

Das Herzstück des Mobilitätskonzepts bildet ein umfassendes neues Buskonzept, das ein neues Liniennetz und Angebotskonzept vorsieht. Insbesondere im Kernstadtbereich soll ein dichtes, attraktives ÖV-

Angebot geschaffen werden. Die derzeit 20 Tag- und 8 Abendlinien sollen auf 13 Buslinien (davon 5 Hauptlinien im 10-Minuten-Intervall sternförmig über den Heiligengeistplatz durchgebunden) reduziert werden. Das strategische Maßnahmenkonzept umfasst fünf Handlungsfelder:
▪ Stadtentwicklung und Stadtplanung,
▪ Fuß- und Radverkehr,
▪ öffentlicher Verkehr,
▪ motorisierter Individualverkehr sowie
▪ Umweltverbund verkehrsmittelübergreifend und Multimodalität.
Den Fußverkehr betreffend werden mehrere konkrete Eckpunkte definiert:
▪ Lückenschluss, Erweiterung und Attraktivierung des Fußwegenetzes
▪ Abbau bzw. Minimierung von Barrieren (Hindernisse, Eng- und Gefahrenstellen, Querungsmöglichkeiten, Straßeneinbauten, ungünstig positionierte Verkehrsschilder, etc.)
▪ Erstellung eines stadtweiten Durchwegungskonzepts, Öffnung von Durchgängen und Innenhöfen an dafür geeigneten Stellen
▪ Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume zur Förderung der Nahmobilität und Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualität im Straßenraum in Abstimmung mit der Stadtplanung
▪ Sicherstellung einer engen Maschenweite und Schaffung eines attraktiven Umfelds mit hoher Aufenthaltsqualität bei Neubaugebieten
▪ Verkehrsorganisatorische Optimierungen (VLSA-Regelungen, etc.)
▪ Umsetzung weitgehender Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen, Fußgängerzonen, etc.)
▪ Generell mehr Platz für Fußverkehr (Neuaufteilung des Straßenraums durch Reduktion von MIVFlächen an dafür geeigneten Stellen)
▪ Bewusstseinsbildung, Marketing- und Informationskampagnen (klare strategische Positionierung als „geh- und radfahrfreundliche Stadt“, schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement für Bauträger, Initiierung von Events, Mobilitätstagen, Projekten, Aktionen (insb. in Schulen und Betrieben)
▪ Installierung eines Rad- und Fußverkehrs-Beauftragten
▪ Bereitstellung von anschaulichen Infomaterialien, Leitfäden, etc.
3.4 Ziele für den Masterplan Gehen Klagenfurt
In vielen nationalen und internationalen Städten erfolgte in den letzten Jahrzehnten (seit rund 1950) ein autogerechter Umbau. Die negativen Auswirkungen des autogerechten Stadtumbaus sind teilweise nur mit sehr viel Aufwand wieder rückgängig zu machen bzw. zumindest teilweise zu korrigieren. Die meisten aktuellen Mobilitätskonzepte sehen als zukunftsfähige Strategie eine nachhaltige Verkehrsentwicklung vor, die den motorisierten Individualverkehr zugunsten der Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger – Radfahrer – öffentlicher Verkehr) vermindern soll.
Dies wird auch in den im Kapitel 3.3 zusammengefassten bisherigen Konzepten und Beschlüssen der Stadt Klagenfurt und im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 hervorgehoben und in den jeweiligen Zielvorstellungen immer wieder erwähnt, jedoch fehlen für den Fußgängerverkehr oft konkrete Maßnahmen und Handlungsstrategien. Mit dem Masterplan Gehen soll diese Lücke geschlossen werden.

Für die Gestaltung und Bereitstellung einer attraktiven Fußgängerinfrastruktur in Klagenfurt ist es wichtig, dass zukünftig den definierten Zielvorstellungen und den daraus abgeleiteten allgemeinen Handlungsschwerpunkten (im Kapitel 6) bei konkreten Planungsvorhaben eine hohe Wertigkeit beigemessen wird. Die definierten – seit Jahren bekannten und in vielen Programmen auf unterschiedlicher Ebene genannten – Zielvorstellungen und die daraus abgeleiteten allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen, sollen es erlauben, mittel- bis langfristig eine entsprechende Attraktivierung des Zu-Fuß-Gehens als Alltagsverkehrsmittel zu erreichen. Durch die allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen wird jedoch auch ein entsprechender Spielraum geschaffen, welcher bei der Umsetzung konkreter Planungsvorhaben eine entsprechende Flexibilität erlaubt, grundsätzlich jedoch den mittel- bis langfristigen Fokus für die Etablierung einer attraktiven Fußgängerinfrastruktur für Klagenfurt ins Zentrum rückt.
Eine Herausforderung der strategischen Förderung des Fußverkehrs stellt dabei der Umstand dar, das Planungen im Fußverkehr oft sehr „klein“ sind und nur sehr lokal und kleinräumig umgesetzt werden. Da Zu-Fuß-Gehende alle Räume und Flächen nutzen, die begehbar sind, sollen gerade auch diese kleinräumigen, lokalen Maßnahmen einer Gesamtstrategie folgen und die allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen berücksichtigen. Weiters wird nicht alles in einem überschaubaren Zeitrahmen umzusetzen sein, was an Verbesserungen wünschenswert wäre. Deshalb wird es immer ein Wechselspiel zwischen einer strategisch ausgerichteten Planung und der kurzfristigen Umsetzung von lokalen und kleinräumigen Maßnahmen geben, die allerdings ins Gesamtkonzept des Masterplans Gehen passen sollten.
Aufgrund der übergeordneten und bisher in Klagenfurt erstellten, diskutierten und beschlossenen Strategien und Konzepte können folgende Ziele für den Masterplan Gehen zusammengefasst werden:
▪ Als Gesamtstrategie sollen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fußgänger – Radfahrer –öffentlicher Verkehr) gestärkt und der innerstädtische motorisierte Individualverkehr verringert werden. Dadurch können spürbare Entlastungen im Straßennetz und eine Erhöhung der Lebens- und Umweltqualität erreicht werden. Durch den Masterplan Gehen wird dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wie es im Radverkehr bereits durch den Masterplan Radfahren und im öffentlichen Verkehr durch den Schwerpunkt im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 erfolgte.
▪ In Bezug auf die Netzgestaltung soll im öffentlichen Raum eine Mobilität für Alle ermöglicht werden. Barrieren für den Fußgänger- und Radverkehr sollen, z.B. durch die Öffnung von Einbahnstraßen, die Öffnung von Innenhöfen, Priorisierung an Druckknopfanlagen (Verkürzung der Wartezeiten), Errichtung von Über- bzw. Unterführungen und einer Erhöhung der allgemeine Durchwegungsmöglichkeiten, um der hohen Flexibilität von Fußgängern und Radfahrern Rechnung zu tragen, abgebaut werden
▪ Städtebauliche Bemühungen sollen auf die Realisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ in verdichteter Bauweise abzielen Dies soll durch die Schaffung und Ausweisung von Gebieten, die eine Mischnutzung erlauben und damit die Nahmobilität fördern, die konsequente Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und die Aufrechterhaltung bzw. Verschärfung der Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr erfolgen und die umweltfreundlichen Formen der Mobilität attraktivieren
▪ Zu-Fuß-Gehen soll als Verkehrsart wahrgenommen werden, die genau wie der Radverkehr, der öffentliche Verkehr und der motorisierte Individualverkehr als Netz geplant wird und eine entsprechende Infrastruktur (Wege, Beschilderung, …) erfordert und angemessen gefördert werden muss.

4
Good-Practice Beispiele
Die Darstellung der nachfolgend angeführten Good-Practice Beispiele auf lokaler oder regionaler Ebene zeigen, dass es bei einer erfolgreichen Umsetzung einer Fußverkehrsstrategie nicht nur darum geht, eine attraktive und einladende Infrastruktur für die Fußgänger zur Verfügung zu stellen. Es gibt viel mehr zu berücksichtigen, um urbane Räume, in denen die Verkehrsmittel im Umweltverbund im Vordergrund stehen, zu schaffen und attraktiv zu gestalten. Dabei kann man von den Fehlern und Erfolgen, welche andere Städte und Kommunen gemacht haben, lernen. Fehler, die andere gemacht haben, sollten vermieden werden - Erfolgskonzepte können entsprechend adaptiert und auf Klagenfurt umgelegt werden.
4.1 Begegnungs- und Fußgängerzonen
Das Fuß- und Radverkehrskonzept der Stadt Bregenz wurde 2020 mit dem bundesweit ausgeschriebenen VCÖ Mobilitätspreis Österreich ausgezeichnet. Aufbauend auf einem breit angelegten Beteiligungsprozess wurde ein umfassender Maßnahmenkatalog mit rund 200 Einzelmaßnahmen in 12 Handlungsfeldern erstellt. Das grundlegende Ziel ist die kontinuierliche Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils (2017 bis 2025 von 49 auf 54 % sowie Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die sanfte Mobilität) sowie der Verkehrssicherheit.
Für den Fußverkehr sollen durch Straßenraumgestaltung, Verkehrsberuhigung und der Errichtung von Begegnungszonen die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Quartiersplätze sollen wiederbelebt und als öffentlicher Freiraum wieder wahrgenommen und nutzbar gemacht werden. Weitere Handlungsschwerpunkte beinhalten die engmaschige und kleinräumige Durchwegung von Wohngebieten, insbesondere bei Neubauten (Lückenschlüsse im Wegenetz, …) sowie Maßnahmen zum Freihalten der Gehsteige von Hindernissen und die Evaluierung von Gehsteigparken.
Die Ausweitung der Begegnungszone im Zentrum Richtung Römerstraße und die Errichtung neuer Fahrradabstellanlagen wurden bereits umgesetzt.


Abbildung 4 1 links: Begegnungszone Römerstraße (Quelle: Bregenz Tourismus, C Setz) rechts: Fußgängerzone Kornmarktplatz (Quelle: Bregenz Tourismus)

Als erste österreichische Landeshauptstadt hat die Stadt Salzburg im Sommer 2021 einen „Masterplan Gehen“ beschlossen. Unter dem Motto „Mehr Mobilität für alle“ wurden darin 37 Einzelmaßnahmen in sieben Handlungsfeldern definiert. Zudem wurden zehn Leitprojekte beschlossen, in denen der Masterplan für die Salzburger Bevölkerung sichtbar gemacht werden soll, wie z.B. die Neugestaltung der Innenstadtdurchführung, ein Fußgängerleitsystem und eine Schulstraße.
Zwei weitere nennenswerte Leitprojekte sind der Salzburg-Boulevard und die Begegnungszone Nonntal, wo zum einen eine Achse zwischen Bahnhof und Staatsbrücke im Sinn der „Healthy Streets“ Parameter im Zuge des Stadtbahnausbaus entstehen soll und zum anderen ein Teil der Inneren Nonntaler Hauptstraße zur Begegnungszone als Teil der Ringroute des Salzburger Radhauptnetzes werden soll (siehe Abbildung 4 2 links, Leitprojekte Nr. 6 und 7).


Abbildung 4.2 links: Leitprojekte der Stadt Salzburg gemäß dem Masterplan Gehen rechts: Wochenmarkt am Universitätsplatz (Quelle: Tourismus Salzburg)
4.2 Fußwegenetz und Gehwegeplan
Die Stadt Pontevedra im Nordwesten Spaniens hat mit ihrer Strategie für den Fußverkehr bereits Ende der 90er Jahre eine urbane Reform gestartet, indem sie Kraftfahrzeuge im historischen Zentrum der Stadt verbot und in eine 30 ha große Fußgängerzone verwandelte. Die Strategie basiert auf einer Vielzahl von Maßnahmen. Alle oberirdischen Parkflächen im Stadtzentrum wurden entfernt und stattdessen unterirdische geschaffen bzw. am Stadtrand errichtet – 1.700 freie Stellplätze waren das Ergebnis. Lichtsignalgeregelte Kreuzungen wichen Kreisverkehren und in verkehrsberuhigten Zonen wurde das Geschwindigkeitslimit auf 30 km/h gesenkt. Die Vorteile waren vielfältig: Eine Reduzierung der Unfalltoten auf 0, eine Reduktion der CO2-Emissionen um 70 %, eine Verschiebung des Modal-Splits (¾ der Wege, die früher mit dem Auto zurückgelegt wurden, werden jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt) und während andere Städte der Region schrumpften, hat die Stadt Pontevedra einen Zuwachs von 12.000 Einwohnern (bei einer Gesamteinwohnerzahl von 80.000) verzeichnet.

2011 konnte ein weiterer Schritt der ambitionierten Zielsetzung in Form des metrominuto Pontevedra umgesetzt werden. Kernstück ist ein ähnlich einem U-Bahn-Plan konzipiertes Fußwegenetz mit Knotenpunkten und Linien, das durch das gesamte Stadtgebiet führt. Die einzelnen Strecken sind mit Entfernungen und ungefähren Zeitangaben versehen Parkplätze (kostenpflichtige und kostenfreie), Fußgängerzonen sowie Parks und natur- sowie wassernahe Wege sind darin grob verortet. Der Plan ist online über eine (kostenlose) App abrufbar; im Stadtgebiet sind Hinweisschilder angebracht (siehe Abbildung 4 3)
Das Konzept des Metrominuto Pontevedra wurde seit 2011 bereits in mehr als 50 weiteren europäischen Städten umgesetzt, wie z.B. Toulouse, Florenz, Modena sowie Städten in Russland und Großbritannien.


Abbildung 4 3 links: Metrominuto Plan der Stadt Pontevedra (Quelle: metrominuto.pontevedra.gal) rechts: Schild mit Plan im Stadtgebiet von Pontevedra
4.3 Konzept der 15-Minuten-Stadt
Das städtebauliche Konzept der 15-Minuten-Stadt basiert auf der Zielvorstellung, dass alle relevanten Einrichtungen des täglichen Lebens (von Arbeits- und Ausbildungsplatz über Einkauf bis hin zu Freizeitund Erholungsangeboten) vom Wohnort aus binnen 15 bis 20 Minuten (verschiedene Städte haben hier verschiedene Zeitintervalle) zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein sollen.
Berühmter Vorreiter des Konzeptes soll die Stadt Paris werden. Die Bürgermeisterin ließ bereits das Seine-Ufer für Autos sperren und forcierte den Radwegeausbau. Des Weiteren sollen 170.000 neue Bäume gepflanzt werden und mehrere hundert Kilometer Radwege neu entstehen.

Abbildung 4 4 Konzept der 15-Minuten-Stadt; Ville de Paris, (Quelle: Dr. Volker Steude, lokalkompass.de)

Die kanadische Hauptstadt Ottawa hat in ihrem aktuellen Entwicklungsplan „The Big Five Moves“ vorgestellt: Fünf Themenschwerpunkte, wie die Stadt künftig kontrolliert wachsen soll. Darin verankert ist die Schaffung der 15-Minuten-Nachbarschaft, unterschieden nach städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten.
Abbildung 4 5 Action Plan for 15-minute Neighbourhoods (Quelle: Ecology Ottawa 2021)

Melbourne startete 2018 ein von der örtlichen Regierung konzipiertes 20-Minuten-Nachbarschaftsprogramm: mehrere Nachbarschaften im Großraum der Stadt wurden ausgewählt, um deren praktische Umsetzung zu testen. Ziel ist es, in den weitläufigen Wohnvierteln sowohl temporäre Aktivierungen als auch langfristige Transformationen im Sinne kurzer Wege, einer besseren Versorgung und guter Nachbarschaften umzusetzen. Zur Verdeutlichung der Wegdistanzen: alle Einrichtungen sollen im Umkreis von 800 m Luftlinie vom Wohnort sein.
Abbildung 4 6 20-Minute Neighbourhoods Melbourne (Quelle: The State of Victoria Department of Environment, Land, Water and Planning 2019)


4.4 Transformation von Stadträumen
Während der letzten zwei Jahrzehnte hat die Stadt Ljubljana große Anstrengungen unternommen, den Zentrumsbereich fußgängerfreundlich zu gestalten (heute sind mehr als 100.000 m² Fußgängerzone im historischen Zentrum) und den lokalen Verkehr in Richtung Umweltverbund zu steuern. Laibach wurde 2016 von der Europäischen Kommission aus diesen Gründen auch zur „European Green Capital“ gewählt. Die Maßnahmen waren vielfältig Der öffentliche Verkehr wurde hinsichtlich der Strecken sowie der eingesetzten Fahrzeuge großzügig erweitert. Der „Kavalir“ – kleine weiß-grüne Elektrobusse – ist gratis im Stadtgebiet unterwegs. Im Radverkehr wurde das Bikesharing-System BicikeLJ mit mittlerweile 610 Leihrädern an 61 Stationen, zahlreiche neue Abstellanlagen und vier Radzählstellen errichtet, die von weithin sichtbar die Anzahl der vorbeigefahrenen Radfahrer anzeigen und den Radverkehr positiv bewerben. Für den Fußverkehr wurden vor allem mehrere Zugänge zur Ljubljanica, dem durch die Stadt fließenden Fluss, sowie Querungsmöglichkeiten desselben geschaffen und das Wasser somit ins Stadtleben integriert.
Der Anteil des Autoverkehrs am Modal-Split konnte in den letzten Jahren drastisch reduziert werden (zwischen 2003 und 2013 von 58 auf 42 %). Heute werden 35 % der Alltagswege von der Bevölkerung zu Fuß gemacht. Im Jahr 2015 wurde die zentralen Verkehrsader Slovenska cesta für das Gehen reserviert und Autos nicht mehr zugelassen. Sowohl die Feinstaubkonzentration (- 70 %) als auch der Lärm (- 6 dB) konnten merklich reduziert werden.


neugestaltete Slovenska cesta (Quelle: City of Ljubljana)
Die belgische Stadt Gent stieß bereits in den 1980er Jahren in der mittelalterlichen Altstadt an ihre verkehrlichen Grenzen. Die Lärm-, Abgas- und Staubelastung sowie die Parkplatznot waren so groß, dass die Stadt eine starke Abwanderung verzeichnete. Seit 2017 verfolgt sie deshalb eine radikale Verkehrspolitik und ist in der Innenstadt heute nahezu autofrei. Das Hauptproblem war der hohe Durchgangsverkehr sowie der sogenannte „Semitransitverkehr“, also Fahrten, die Teile der Ringstraße mieden und Abkürzungen oder Umwege durch die Innenstadt wählten. Die Lösung war die Aufteilung der Innenstadt in sechs Zonen und eine Fußgängerzone, wobei direkte Fahrten zwischen den Zonen nur für Einsatzfahrzeuge, Taxis und Busse erlaubt sind Alle anderen Fahrzeuge müssen die Ringstraße außerhalb der Stadt nutzen. Für Radfahrer, Parkplatzsuchende und den öffentlichen Verkehr wurden

Abbildung 4 7 links: Dreifachbrücke Tromostovje (Quelle: Dunja Wedam) rechts:
eigenen Routen festgelegt, um Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern zu reduzieren. Weiters wurden zwischen den Zonen Poller, Bänke und Linien sowie Blöcke aufgestellt. Die Übergänge werden videoüberwacht und Übertretungen konsequent bestraft. Oberirdische Parkplätze wurden im großen Stil rückgebaut, anstatt dessen wurden Tiefgaragen im Stadtzentrum sowie Park&Ride- Anlagen außerhalb der Ringstraße errichtet. Weitere Maßnahmen waren flächendeckende Kurzparkzonen (Ausnahme Bewohner), neue Radwege, Rad-Highways und Fahrradstraßen. Kinder benutzen den öffentlichen Verkehr gratis, Nachtbuslinien wurden eingeführt und die Zustellung von Waren mit Transport-Fahrrädern wird gefördert. Für Fußgänger werden Straßen stunden- oder auch tageweise in Flaniermeilen, Schul- und Spielstraßen umgewidmet. Bewohner dürfen ihre Wohnstraßen selbst für je drei Monate im Jahr zu „Living Streets“ umwandeln und nutzen den Raum für Begegnungen, Straßenfeste und Begrünung
Die Maßnahmen haben bereits große Wirkung gezeigt und die angestrebten Verschiebungen im ModalSplit, die für das Jahr 2030 anvisiert waren, wurden bereits 2019 erreicht. Der Anteil der Autos und Motorräder am Modal-Split konnte von 55 auf 27 % reduziert werden, der des Radverkehrs ist von 22 auf 35 % gestiegen. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs stieg auf 20 % (gegenüber 13 %) und der des Fußverkehrs auf 18 % (von 14 %).


Abbildung 4.8 links: Ausschnitt des „Umlaufplans“ der Stadt Gent (Quelle: City of Gent) rechts: Living Street in Gent (Quelle: citychangers.org, Hanne Geutjens)

4.5 Schulstraßen
Die Stadt Bozen in Südtirol nimmt eine Vorreiterrolle ein, was die Verkehrssicherheit im Schulumfeld betrifft, wo es Schulstraßen bereits seit mehr als 20 Jahren gibt. Das Konzept hat sich seither weltweit etabliert und umfasst temporär begrenzte Fahrverbote für den Kfz-Verkehr im Schulumfeld, sodass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Ausnahmen sind Fahrräder, der öffentliche Verkehr sowie Schulbusse, Inhaber eines Behindertenausweise sowie Anrainer, Rettungsdienste und Polizei. Diese Maßnahme dient nicht nur zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Selbstständigkeit der Schulkinder, sondern auch zur Attraktivierung und Qualitätssteigerung des Schulweges, diesen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Eine Erweiterung der Schulstraße ist die Installation von Schülerlotsen im Umfeld von Grundschulen sowie das Projekt „Pedibus“, bei dem Schulgruppen (mind. 10 Schüler) von Schülerlotsen max. 15 bis 20 Minuten zu Fuß vom Busausstieg zur Schule hin begleitet werden.


Abbildung 4 9 links: Beschilderung der Schulzone in Bozen (Quelle: Google Maps) rechts: Absperrung der Schulzone in Lodi (Quelle: primalodi.it)


Abbildung 4 10 links: Schulstraße Volksschule Vereinsgasse (Quelle: Mobilitätsagentur Wien) rechts: Schulstraße Rothenburgstraße (Quelle: Mobilitätsagentur Wien)

Die Stadt Wien setzt seit dem Jahr 2018 das Konzept der Schulstraßen um: 30 Minuten vor Schulbeginn gilt in der Schulstraße ein temporäres Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge (auch für Anrainer); Radfahren ist weiterhin möglich. Es wird eine Fahrverbotstafel aufgestellt und eine physische Absperrung, etwa ein Scherengitter, aufgestellt (siehe Abbildung 4 10).
In der Stadt Klagenfurt wird ein ähnliches System im Bereich des Schulzentrums Mössingerstraße erfolgreich umgesetzt und trägt in diesem Bereich maßgebend zur Verkehrssicherheit im Schulumfeld bei.
4.6 Fußverkehrszählungen
Die Anzahl der Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, wird häufig unterschätzt, da sie bei der statistischen Datenerfassung oft mit der Nutzung von Verkehrsmitteln kombiniert werden und dann bei Zählungen unberücksichtigt bleiben. Die realistische Erfassung der Fußwege stellt somit eine wichtige Grundlage dar, um ein Bewusstsein für die tatsächliche Bedeutung des Fußverkehrs in der Bevölkerung zu schaffen
Die Stadt Weiz hat im Projekt „City Walk“ das Thema Rad- und Fußverkehr für alle sichtbar gemacht, indem bei der Pezo Brücke eine Rad- und Fußverkehrzählmaschine aufgestellt wurde, die auf einem großen Display die tagesaktuellen Zahlen der Querenden zeigt. Das Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen der Interreg-Programmlinie gefördert wurde, will die Bedeutung des Fußverkehrs deutlich machen und zudem die lokale Bevölkerung zum Gehen animieren.
Abbildung 4 11 Rad- und Fußverkehrszählung –Pezo Brücke in Weiz im Rahmen des Projekts City Walk (Quelle: meinbezirk.at)

Die Wirtschaftskammer Wien erhebt neben ausgewählten Querschnitten zudem gemeinsam mit der Stadtverwaltung seit den 70er Jahren alle zwei Jahre die Zahl der Passanten in 40 Geschäftsstraßen der Stadt. Die Zählung erfolgt zu den üblichen Geschäftsöffnungszeiten an 49 Zählstellen.
In der Stadt Klagenfurt wurden im Bereich der Fußgängerzonen in der Innenstadt in der Vergangenheit Erhebungen zum Einkaufsverhalten durchgeführt (Stadtmarketing Klagenfurt, Innenstadtinitiative).
4.7 Städtebauliche Verträge, Mobilitätsverträge
Im Rahmen der im § 53 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2020 (K-ROG 2020) festgesetzten Vertragsraumordnung kann eine Gemeinde privatwirtschaftliche Vereinbarungen (in der Praxis auch „städtebauliche Verträge“ oder „Mobilitätsverträge“ genannt) abschließen, um festgelegte Ziele der örtlichen

Raumplanung zu erreichen bzw. sicherzustellen. Hierzu zählen u.a. Vereinbarungen mit Grundeigentümern oder Projektwerbern über die Beteiligung an den mit der Gemeinde durch die Festlegung von Grundflächen als Bauland erwachsenden Aufschließungskosten oder Vereinbarungen zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen Verwendung von Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen. Den Gemeinden steht damit ein flexibles und unterstützendes Instrument zu den bisherigen Planungsinstrumenten (z.B. dem Flächenwidmungs- und dem Bebauungsplan) zur Verfügung, um im eigenen Wirkungsbereich Planungsziele und übergeordnete Zielsetzungen umzusetzen.
Die Stadt Klagenfurt hat bereits für zahlreiche Entwicklungsprojekte (z.B. das Projekt „Unsereins“ in der Feschnigstraße, für das Projekt „Seenah Wohnen“ in der Kohldorfer Straße auf dem ehemaligen ÖDK-Gelände, den SmartCity Stadtteil „hi Harbach“, …) städtebauliche Verträge mit den jeweiligen Projektwerbern und/oder Bauträgern abgeschlossen. In ihnen wird z.B. die Sicherung einer öffentlich zugänglichen, fußläufigen Durchwegung, die Errichtung von Carsharing- und/oder Fahrradverleihstationen, die Errichtung von öffentlichen Paketboxen, usw. festgelegt.
Durch die Festlegungen in den städtebaulichen Verträgen können die Zielsetzungen der Stadt Klagenfurt in Bezug auf z.B. die engmaschige Durchwegung von Gebieten konkret vereinbart und gesichert werden. In der Vergangenheit wurden innerhalb von Siedlungen z.B. zwar Geh- und Radwegeverbindungen errichtet, diese jedoch nur den unmittelbaren Bewohnern zur Verfügung gestellt (Privatwege, abgesperrte Wege, …). Dadurch ist in manchen Stadtteilen zwar ein dichtes Geh- und Radwegenetz vorhanden, dieses jedoch nur eingeschränkt nutzbar. Mit dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen können solche Einschränkungen vermindert werden und die Erdgeschoßzonen und Freiflächen in den Siedlungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
4.8 Engmaschige Durchwegung
Der Fußverkehr ist eine der wichtigsten Säulen für nachhaltige Mobilität. Maßnahmen für eine fußgängerfreundliche Gestaltung der Wohnumgebung hatten daher in der Stadt Klagenfurt im Rahmen des Projektes Smart Living in Klagenfurt Harbach (SLiKH) von Anfang an eine sehr hohe Priorität. Zeitgleich mit dem ersten Bauabschnitt soll eine qualitativ hochwertige Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in und um den Bereich hi Harbach errichtet (hi Harbach – Diakonie – Glanbegleitweg) und im Rahmen der weiteren Bauabschnitte sukzessive erweitert werden
Zu-Fuß-Gehende sind sehr umwegempfindlich. Das Fußwegenetz wurde daher möglichst engmaschig geplant, Umwege oder Barrieren wurden bestmöglich vermieden. Im Rahmen der Umsetzungsplanung wurde der Grundsatz beachtet, dass Zu-Fuß-Gehende ihre Wege umso kürzer empfinden, je abwechslungsreicher und angenehmer diese gestaltet werden. Auf dem Areal von hi Harbach soll es ein dichtes barrierefreies Fußwegenetz ermöglichen, dass alle Bewohner und Besucher von hi Harbach ihre Ziele innerhalb der Siedlung zu Fuß einfach und ohne Umwege erreichen können und auch eine Verbindung mit den umliegenden Nutzungen (Diakonie, Glanbegleitweg, …) sichergestellt ist. Während die Siedlung vom Kfz-Verkehr möglichst freigehalten werden soll, sollen für Zu-Fuß-Gehende einfache und möglichst direkte Zugänge zu allen Häusern möglich sein. Bereits bei der Planung der Wege wurde auch die Wartung und Pflege der Wege sowie der Winterdienst mitberücksichtigt, um allen (auch mobilitätseingeschränkten Personen mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, …) eine sichere und komfortable ganzjährige Benutzung der Fußwege in der Siedlung zu ermöglichen.

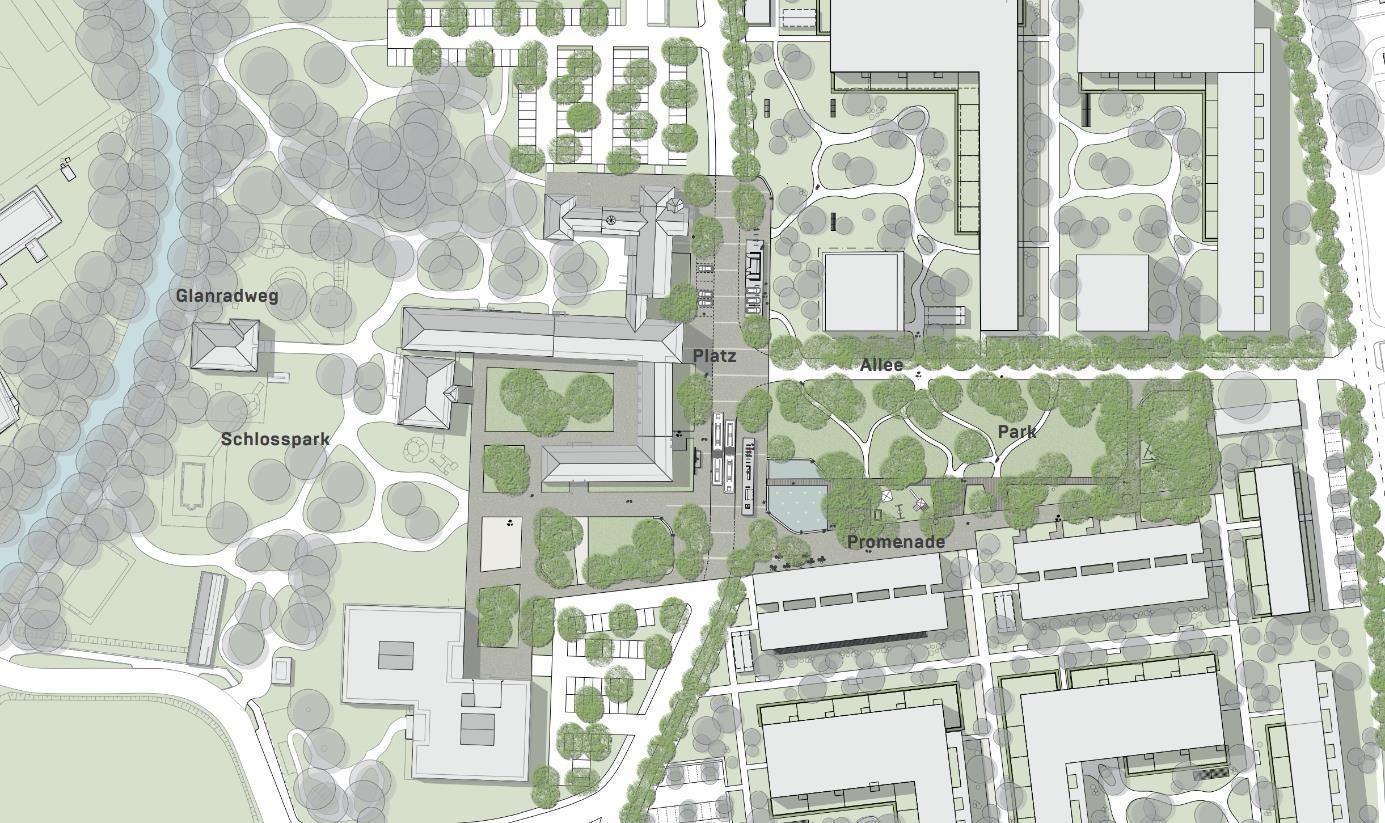
Abbildung 4 12 Durchwegung im Bereich hi Harbach – Diakonie – Glanbegleitweg (Quelle: Masterplan 12/2018, Winkler Landschafts Architektur)

5
Analyse der Situation für Fußgänger in Klagenfurt
Für die Analyse der bestehenden Situation für die Fußgänger in Klagenfurt konnte auf das umfangreiche Datenmaterial der Abteilung Vermessung und Geoinformation beim Magistrat Klagenfurt zurückgegriffen werden, welche für das gesamte Stadtgebiet von Klagenfurt einen routingfähigen Verkehrsgraphen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stellen konnte.
5.1 Bestehendes Gehwegenetz
Klagenfurt liegt auf dem Klagenfurter Feld im Zentrum des Klagenfurter Beckens und erstreckt sich über jeweils rund 15 km in nord-südlicher und ost-westlicher Richtung. Die Stadt umfasst das gesamte Ostufer des Wörthersees; die Gebiete nördlich davon sind Teil des Feldkirchen-Moosburger Hügellandes und des Glantaler Berglandes. Teile des nördlichen Gemeindebezirks Wölfnitz zählen bereits zum Zollfeld, der Süden von Klagenfurt liegt am Fuß des Sattnitz-Höhenzugs. Neben topographischen Hindernissen, wie z.B. dem Kreuzbergl, dem Spittalberg, … stellen vor allem die verschiedensten Bäche und Flüsse in Klagenfurt natürliche Hindernisse – nicht nur für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer –dar (siehe dazu auch Abbildung 5 2). An das unmittelbare Zentrum (Innenstadt) schließt das zentrale Stadtkerngebiet an. Es erstreckt sich weitgehend tangential um den Innenstadtbereich und kann in innenstadtnahe Stadtteile (Villacher Vorstadt, St. Veiter Vorstadt, Völkermarkter Vorstadt, Viktringer Vorstadt) und innenstadtferne Stadtteile (Waidmannsdorf, St. Martin, St. Ruprecht, St. Peter, Annabichl, Welzenegg, Wölfnitz, …) klassifiziert werden. An das Stadtkerngebiet schließen periphere, teils dörflich geprägte Siedlungsgebiete an. Im südwestlichen Stadtgebiet liegt das „Subzentrum Viktring“.
In der Abbildung 5 1 ist die bestehende Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt übersichtmäßig dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass vor allem im Stadtkerngebiet entsprechende Gehwege in den unterschiedlichsten Ausprägungsformen (einseitig oder beidseitig von Fahrbahnen, selbständig geführt neben der Fahrbahn, selbständig abseits der Infrastruktur für den Kfz-Verkehr geführt, …) vorhanden sind, während in den Stadtrandlagen das Infrastrukturangebot für Zu-Fuß-Gehende primär gemeinsam mit der Infrastruktur für den Kfz-Verkehr zur Verfügung gestellt wird (zu Fuß Gehen auf der Fahrbahn bzw. den Wegen erlaubt). Die Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende ist dabei vielfach historisch gewachsen, wobei in den letzten Jahrzehnten – wie in den meisten Städten – primär eine autoaffine Infrastrukturplanung erfolgte und den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern vor allem entlang hochrangiger Straßenzüge vielfach „Restflächen“ zugewiesen wurden bzw. Umwege für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen wurden. Vor allem in größeren Wohnsiedlungen bzw. Wohnbereiche im Stadtkernbereich ist ersichtlich, dass sehr viele Gehwege keine Durchgangsmöglichkeit bieten und entweder nur von einem eingeschränkten Benutzerkreis genutzt werden können (z.B. private Gehwege im Bereich von Siedlungen) oder als „Sackgasse“ enden, wodurch einerseits das öffentlich zugängliche Netz eingeschränkt wird bzw. teilweise auch entsprechende Umwege notwendig sind. Weiters stellt auch die in nord-südlicher und ost-westlicher Richtung durch Klagenfurt führende Eisenbahninfrastruktur (in der Abbildung 5 2 „rot“ dargestellt) eine künstliche Barriere dar, welche sowohl von den motorisierten wie auch von den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern nur an einigen Stellen gequert werden kann. Sowohl entlang von Bächen und Flüssen wie auch entlang der Eisenbahninfrastruktur ist dabei in

der Vergangenheit vielfach für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer eine höhere Anzahl an Querungsmöglichkeiten entstanden als für den motorisierten Verkehr. Ähnliche Barrierewirkungen für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer entstehend auch durch Infrastrukturanlagen wie die A2 Süd Autobahn, welche im Norden der Stadt durch das Stadtgebiet führt (meist untertunnelt), die S37 Klagenfurter Schnellstraße (in Richtung St. Veit), das Flughafenareal oder entsprechend viel befahrene und mehrstreifig ausgebaute Straßenzüge (hochrangiges Straßennetz), welche nur an einzelnen Stellen (meist mit Hilfe von Verkehrslichtsignalanlagen) gesichert gequert werden können, wodurch entsprechende Umwege für Zu-Fuß-Gehende notwendig werden.


Abbildung 5.1 bestehende Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt


Abbildung 5 2 Gewässer und Eisenbahninfrastruktur in Klagenfurt

5.2 Analyse auf Ebene der Stadtstruktur
Unterschiede in Bezug auf die möglichen Prioritäten von Maßnahmen lassen sich für unterschiedliche Gebietstypen, wie z.B. die Innenstadt von Klagenfurt, Viktring als Subzentrum von Klagenfurt, innenstadtnahe und innenstadtferne Stadtteile sowie die kleineren und größeren Siedlungsagglomerationen am Stadtrand festlegen. Dabei ist festzuhalten, dass Verwaltungsgrenzen oder -einheiten fürdie Alltagsund Freizeitwege im Fußverkehr nicht relevant sind. Der Fußverkehr muss flächenhaft für den gesamten Stadtraum betrachtet werden und zwar auch über größere Entfernungen hinweg, welche kaum noch zu Fuß zurückgelegt werden. Nur bei Beachtung dieses Grundsatzes wird man den Anteil des Fußverkehrs in der gesamten Stadt und nicht nur innerhalb bestimmter Bereiche erhöhen können. Unter Wahrung der städtebaulichen Zusammenhänge erscheint es jedoch als sinnvoll verschiedene Stadtteilsituationen und Siedlungsstrukturen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Bedingungen für eine strategische Förderung des Fußverkehrs im Rahmen der Bestandsanalyse zu betrachten.
5.2.1 Innenstadt
In der Innenstadt von Klagenfurt sind mehrere Park- und Grünanlagen, Plätze, Fußgängerzonen und abschnittsweise ein Straßennetz vorhanden, in welchem die Benutzung durch den motorisierten Individualverkehr einschränkt wird (Fahrverbote, Einbahnen, Anrainerverkehr, Begegnungszone, …). Teilweise führen jedoch auch Straßenzüge durch die Innenstadt von Klagenfurt (z.B. Bahnhofstraße, 8.Mai-Straße, …), welche nicht nur eine erschließende Funktion, sondern auch eine durchleitende Funktion durch die Innenstadt von Klagenfurt übernehmen und damit als alternative Route für Fahrten entlang des Rings von Klagenfurt genutzt werden (gebietsfremder Durchgangsverkehr durch die Innenstadt). Als Kernzone kann die Fußgängerzone um den Alten Platz, der Kramergasse und der Wiener Gasse angesehen werden, in welcher auch die höchsten Fußgängerfrequenzen in der Innenstadt verzeichnet werden. Diese Kernzone strahlt in die Osterwitzgasse, zum Fleischmarkt, zum Neuen Platz (mit der Achse über die Postgasse in Richtung Benediktinerplatz) und zum Landhaushof aus
Im Nordwesten der Innenstadt bestehen mit dem Schillerpark, Goethepark, Schubertpark und Achterjägerpark entsprechend attraktive Park- und Grünflächen, welche ausgehend von der Kernzone jedoch „in zweiter Reihe“ hinter entsprechenden Gebäudekomplexen (Ursulinen, Stadtgalerie, Stadttheater, …) liegen und nicht direkt an die Kernzone angebunden sind (über schmale Gassen und teilweise versteckte Wege). Ähnlich ist der Rauscherpark im Nordosten, der Park der Kärntner Freiwilligen Schützen im Südosten oder der Stadtgraben im Südwesten der Innenstadt einzuordnen (siehe Abbildung 5 3) Die Parkflächen sind von der Kernzone der Innenstadt „abgeschnitten“. D.h. außerhalb des unmittelbaren Kernbereiches der Innenstadt, ist die Verkehrsinfrastruktur eher autoaffin geprägt (geschlossene Häuserfronten, beidseitige Parkstreifen, Regelbreiten für Gehwege, …), die bestehenden Grün- und Parkflächen am Rand der Innenstadt sind von der Kernzone abgetrennt und werden deswegen auch nur bedingt als Innenstadträume bzw. zur Innenstadt gehörend wahrgenommen.
Um den Fußgänger- und Radverkehr sowie den öffentlichen Verkehr in der Innenstadt zu fördern wird es notwendig sein, die Menge oder zumindest die Ansprüche des motorisierten Individualverkehrs an Geschwindigkeit und Komfort zu reduzieren, um die Sicherheit und den Komfort für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sowie andere Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum im Zentrum von Klagenfurt (Aufenthalt, Erholung, Freizeit, …) zu erhöhen. Dies trifft vor allem auf jene städtebaulich

wertvollen Flächen zu, die vom ruhenden Individualverkehr beansprucht werden, welche für die Gestaltung und Aufwertung des Umfeldes, die Flächenanforderungen des Fußgänger- und Radverkehrs oder sonstige alternative Nutzungen (z.B. Gastgärten, Verkaufsflächen, …) zur Verfügung gestellt werden können. Vor allem im Umgebungsbereich bestehender bzw. geplanter Tiefgaragen und Parkhäuser (Benediktinerplatz, Kardinalsplatz, …) können hier entsprechende Flächenpotentiale geschaffen werden.
Weiters erscheint vor allem der Übergangsbereich von der Kernzone oder dem Rand von stark mit nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern frequentierten Bereichen als problematisch (z.B. der Ring, Bahnhofstraße, 8.-Mai-Straße, Ursulinengasse, ) Diese Bereiche sind oft noch von einer größeren Menge an Fußgängern frequentiert, während die Infrastruktur und Verkehrsführung (z.B. Gehwegbreiten, Abstellanlagen, Ladezonen für Betriebe, …) sowie die räumliche Gestaltung (geschlossene Häuserfronten, beidseitige Parkstreifen, …) wenig einladend für Fußgänger ist Der Rand der Innenstadt im Übergang zum Ring bzw. der Übergang von stark mit Fußgängern frequentierten Bereichen zu weniger stark mit Fußgängern frequentierten Bereichen sollte deshalb immer in die Planungen und Überlegungen zur Förderung des Fußgängerverkehrs miteinbezogen werden.

Abbildung 5 3 Bestandsanalyse Innenstadt

5.2.2 Subzentrum Viktring
Das städtebaulich definierte Subzentrum Viktring verfügt im Kernbereich über städtische Bebauungsstrukturen und ist infrastrukturell sehr gut ausgestattet Aufgrund der Bebauungsstruktur sind mehrere Plätze oder platzähnliche Räume und Situationen definiert: Viktringer Platz, von der Ferdinand-Wedenig-Straße zum Kreisverkehr in der Keutschacher Straße, von der Volks- und Mittelschule zur Keutschacher Straße. Historisch bedingt ist zudem um das Stift Viktring eine große Park- und Grünanlage (Stiftsteiche, Koschatpromenade, …) vorhanden. Die vorhandene Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer trägt diesen Räumen nur bedingt Rechnung; vielfach führt sie entlang der Straßenzüge, wodurch vor Ort immer wieder „Trampelpfade“ und Abkürzungen über Böschungen und Grünflächen zu beobachten sind. Auf der anderen Seite führt entlang des Rekabaches ein grundsätzlich qualitätsvoller, gemischter Geh- und Radweg in Richtung Glanfurt (Sattnitz) und bindet Viktring an Freizeit- und Erholungsflächen entlang der Glanfurt an (Sattnitzpark, gemischter Geh- und Radweg entlang der Sattnitz, …) Aufgrund der Attraktivität des gemischten Geh- und Radweges entlang des Rekabaches wird dieser auch entsprechend von Zu-Fuß-Gehenden und Radfahrern frequentiert, wodurch das vorhandene Platzangebot (2,50 bis 3,00 m breiter gemischter Geh- und Radweg) jedoch an seine Grenzen stößt. Abseits der Achse Rekabach – Koschatpromenade, sowie entlang der Keutschacher Straße, der FerdinandWedenig-Straße und in Teilen der Keltenstraße, der Siebenbürgengasse und im Umgebungsbereich der Volks- und Mittelschule entlang der Abstimmungsstraße und der Schulstraße ist (trotz vorhandenem Platzangebot in einzelnen Straßenzügen) kaum eine Infrastruktur für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer reserviert.
Zur Belebung des Subzentrums ist eine entsprechende Infrastruktur bzw. Verbindungswege, welche sicher und komfortabel ausgestattet werden, erforderlich, um ein attraktives, zusammenhängendes Netz für die Fußgänger zu schaffen, sowie die klare Definition von Fußgängerbereichen. Vor allem im Wohngebiet südlich der Keutschacher Straße sind teilweise überbreite Verkehrsflächen vorhanden (z.B. ist die Abstimmungsstraße zwischen 9 und 10 m breit, Am Birkengrund zwischen 8 und 10 m breit), welche jedoch nicht strukturiert sind und deshalb primär vom Kfz-Verkehr (fließend und ruhend) beansprucht werden. Aufgrund des „breiten“ Platzangebotes könnte ohne wesentliche Einschränkungen für den fließenden Verkehr eine entsprechende Infrastruktur für den nicht motorisierten Verkehr geschaffen werden und gleichzeitig durch die Einschränkung des Platzangebotes für den fließenden Verkehr auch eine entsprechende Geschwindigkeitsdämpfung erreicht werden.
Des Weiteren sind vor Ort immer wieder ausgetretene Wege oder Pfade über Grünflächen, Böschungen usw. zu beobachten (z.B. im Bereich des neuen Geschäftszentrums südlich der Bushaltestelle Siebenbürgengasse hin zur Carolinenstraße und Abstimmungsstraße, …), was darauf schließen lässt, dass die angebotene Infrastruktur für die Fußgänger nicht den Bedürfnissen vor Ort entspricht. Solche Verbindungen sollen nicht unterbunden, sondern durch eine entsprechende Gestaltung aufgewertet und den Zu-Fuß-Gehenden angeboten werden. Ähnlich stellt sich die Situation im Bereich der neu errichteten Nordspange (Verbindung der Keltenstraße mit der Glanfurtgasse) dar, entlang derer keine Infrastruktur für Fußgänger- und Radfahrer errichtet wurde, die jedoch abschnittsweise sehr stark von diesen frequentiert wird (z.B. im Abschnitt von der Josef-Nischelwitzer-Straße bis zum Feldweg, welcher von der nordöstlichen Ecke der Kleingartensiedlung Richtung Sattnitz führt).

5.2.3 Innenstadtnahe Stadtteile
Eine besondere Herausforderung stellen die Fußwegeverbindungen zwischen der Innenstadt und den innenstadtnahen Stadtteilen (Villacher Vorstadt, St. Veiter Vorstadt, Völkermarkter Vorstadt, Viktringer Vorstadt) dar. Der Ring um die Innenstadt von Klagenfurt stellt aufgrund der hohen Fahrzeugfrequenz und weitgehenden 4-Streifigkeit eine künstliche Barriere dar Bewohner am Rand der Innenstadt haben dadurch nur teilweise einen attraktiven Zugang zur Innenstadt. Zu lange Fußwege für eine gesicherte Querung des Rings, selbst bei kleinen Luftliniendistanzen, können dazu führen, dass ein anderes Verkehrsmittel genutzt wird oder Ziele außerhalb der Innenstadt aufgesucht werden, zumal die innenstadtnahen Stadtteile teilweise ohne eigene Versorgungsinfrastruktur ausgestatten sind (z.B. Lebensmittelmärkte, …)
Als Beispiel für einen nur teilweise attraktiven Zugang in die Innenstadt bzw. eine mit Umwegen verbundene Ringquerung soll hier der Bereich der Döllingerstiege angeführt werden. Über die Döllingerstiege kann direkt vom Ring in die Kaufmanngasse und dann über den Benediktinerplatz und die Postgasse zum Neuen Platz und in den Kernbereich der Innenstadt zugegangen werden. Zur Querung des Viktringer Rings besteht in direkter Verlängerung der Döllinger Stiege jedoch keine Möglichkeit, wodurch entweder ein Umweg in Kauf genommen werden muss (über den Knoten Viktringer Ring / St. Ruprechter Straße / 10.-Oktober-Straße) oder der Viktringer Ring ungesichert gequert werden muss (wie von den meisten Fußgängern bevorzugt). Eine ähnliche Situation besteht im Bereich des Parks der Kärntner Freiwilligen Schützen. Hier bietet die Verbindung Lidmanskygasse – Funderstraße nördlich des Parks eine durchgehende Achse für Zu-Fuß-Gehende und Radfahrer; eine direkte und gesicherte Querung des Rings für Fußgänger (teilweise auch von Schülern des Europagymnasiums, welche zur Regionalbushaltestelle in der Adlergasse zugehen) ist jedoch nicht möglich, sondern mit einem Umweg über die benachbarten Signalanlagen verbunden, welcher jedoch kaum in Anspruch genommen wird (vor allem nicht von Schülern, welche „schnell“ zum Bus wollen)
Ziel der Fußverkehrsförderung in innenstadtnahen Stadtteilen sollte die Gewährleistung der Erreichbarkeit der Innenstadt auf kurzen Wegen und der Ausbau direkter Wegeverbindungen (sowohl in die Innenstadt als auch zu stadtteilrelevanten Nutzungen außerhalb des Rings, wie z.B. zum Hauptbahnhof, zum Messeareal, zum Lendhafen, zum Klinikum Klagenfurt, zu Schulstandorten und Ämtern, …) sein Dabei sollte auch auf den in das Stadtzentrum führenden Straßenzügen sowie entlang des Rings geprüft werden, inwieweit Flächen, die derzeit dem (fließenden und/oder ruhenden) motorisierten Individualverkehr vorbehalten sind, einer Nutzung für Verkehrsmittel im Umweltverbund zur Verfügung gestellt werden können, ohne damit unerwünschte Verkehrsverlagerung zu erzeugen.
5.2.4 Innenstadtferne Stadtteile
Für innenstadtfernere Stadtteile (Waidmannsdorf, St. Martin, St. Ruprecht, St. Peter, Annabichl, Welzenegg, Wölfnitz, …) sind in der Regel zur Attraktivitätssteigerung lokale Fußwege zu nahegelegenen Nutzungen und die direkte Erreichbarkeit der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs wichtig.
Der Stadtteil Waidmannsdorf bietet aufgrund der See- und Zentrumsnähe, der Nähe zu Freizeit-, Naherholungs- und Bildungseinrichtungen, der guten Ausstattung an Versorgungsinfrastruktur sowie aufgrund der guten Verkehrsanbindung ein bevorzugtes Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Siedlungsstruktur weist Bereiche mit unterschiedlicher Charakteristik und unterschiedlichen Ausprägungsformen auf (Ein-

familienhausbebauung, verdichteter Wohnbau, …), wobei sich vor allem im Bereich größerer Wohnsiedlungen immer wieder Barrieren ergeben, da öffentliche Durchwegungen nur teilweise (oder mit Umwegen) möglich sind. Eher in der Randzone von Waidmannsdorf bzw. im Übergang zur Freizeit- und Naturraumzone im Bereich der Ostbucht oder entlang der Glanfurt (Sattnitz) sind Einrichtungen wie Minimundus, Universität, Lakeside Park oder die Sportachse zwischen Stadion und Leichtathletikarena angesiedelt. Versorgungseinrichtungen sind zumeist an den Hauptverbindungen angesiedelt (z.B. Villacher Straße, Universitätsstraße, Siebenhügelstraße, Luegerstraße, Baumbachplatz, Maria-Platzer Straße, Hauptmann-Hermann-Platz, Waidmannsdorfer Straße, …) Für die Förderung des Zu-Fuß-Gehens ist deshalb neben einer lokalen Durchwegung für die direkte Erreichbarkeit unmittelbarer Ziele in der Umgebung (öffentliche Durchwegung) auch die Schaffung zentraler Achsen für den Fußgängerverkehr von Bedeutung. So sollten z.B. entlang der Sportachse zwischen Stadion und Leichtathletikarena eine entsprechende Infrastruktur geschaffen und diese auch an die umgebenden Bereiche (in Richtung Lakeside Park, Ostbucht, …) angeschlossen werden, wie auch eine attraktive Anbindung zwischen dem Lakeside Park über die Universität und Minimundus hin zur S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West errichtet werden Ähnlich ist dies für die Verbindung der S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West mit dem Europark bzw. der Ostbucht zu sehen, welcher in einigen Jahren (mit Inbetriebnahme der Koralmbahn) auch eine zunehmende touristische Funktion zukommen wird oder den bestehenden Achsen entlang des Lendkanals und der Sattnitz. Die Achsen (grüne Achsen, großflächiges Wegenetz, …) sollen innerhalb von Klagenfurt die Stadtteile und die Innenstadt miteinander verbinden, gleichzeitig jedoch auch die lokale Erreichbarkeit sichern
Ähnlich ist die Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende im Stadtteil Welzenegg zu bewerten. Wie in Waidmannsdorf bestehen auch hier Wohnbereiche mit unterschiedlich ausgeprägter Charakteristik (Einfamilienhausbebauung, verdichteter Wohnbau, …), wobei sich vor allem im Bereich größerer Wohnsiedlungen immer wieder Barrieren ergeben, da öffentliche Durchwegungen nur teilweise (oder mit Umwegen) möglich sind. Teilweise sind diese in Welzenegg jedoch bereits im Bestand in einer annehmbaren Dichte gewährleistet (z.B. Venloweg, Duschanbegasse, Hermannstädter Weg, Gladsaxeweg, …) Anders als in Waidmannsdorf sind in Welzenegg kaum bedeutende zentrale Einrichtungen vorhanden, jedoch bestehen innerhalb des Gebietes mehrere Grün- und Freiflächen, vor allem Sportplätze und Parks, welche die Siedlungsstruktur auflockern und zur Naherholung der Bewohner dienen. Handels- und Gewerbebetriebe sind hauptsächlich entlang der Pischeldorfer Straße oder der Völkermarkter Straße konzentriert, innerhalb des Gebietes bestehen entsprechende Nahversorgermärkte Für die Förderung des Zu-Fuß-Gehens ist auch in Welzenegg neben einer lokalen Durchwegung für die direkte Erreichbarkeit unmittelbarer Ziele in der Umgebung (öffentliche Durchwegung) die Schaffung zentraler Achsen für den Fußgängerverkehr von Bedeutung (entlang der Glan, als Verbindung zwischen Naherholungsflächen, …), um die Erreichbarkeit umgebender Stadtteile und Einrichtungen sicherzustellen (z.B. in Richtung An der Walk, in Richtung Klinikum Klagenfurt, …)
Aus den beispielhaften Detailbetrachtungen für die Stadtteile Waidmannsdorf und Welzenegg ist ableitbar, dass die eingangs erwähnten Maßnahmen zur lokalen Förderung des Zu-Fuß-Gehens in „innenstadtfernen“ Stadtteilen trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen in Bezug auf die Siedlungsstruktur und die Ausstattung der Stadtteile mit bedeutenden zentralen Einrichtungen grundsätzlich übertragbar sind. Vor allem lokale Fußwege zu nahegelegenen Nutzungen und zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind wichtig, weshalb stadtteilbezogene Schwerpunkte zur Fußverkehrsförderung und für die Belebung einzelner Straßen und Plätze anzustreben sind. Diese Betrachtungen können jedoch zu kurz

greifen, wenn man nur die Bereiche innerhalb der jeweiligen Stadtteile betrachtet, weshalb durch eine großflächigere Wegenetzbetrachtung vorhandene Barrieren zwischen den Stadtteilen und in die Innenstadt abzubauen sind. Auch wenn vorwiegend der motorisierte Individualverkehr oder die öffentlichen Verkehrsmittel zur Erreichung der Innenstadt oder anderer Stadtteile genutzt werden, ist für innenstadtferne Stadtteile zu prüfen, ob sich attraktive Wege wie z.B. grüne Wegeverbindungen abseits der Straßen bis zur Innenstadt oder in andere Stadtteile schließen lassen. Diese werden möglicherweise in ihrer Gesamtroute eher vom Freizeitverkehr genutzt (z.B. Halbmarathonstrecke entlang der Sattnitz und der Glan, Route entlang des Lendkanals, …), in der Regel fördern sie aber auch etappenweise den Alltagsverkehr zu Fuß.
5.2.5 Ländliche bzw. dörfliche Strukturen innerhalb des Stadtgebietes Für Zu-Fuß-Gehende optimal sind Strukturen mit Radien von etwa 1 km, die die täglichen Versorgungsund Kommunikationsbedürfnisse zu Fuß erledigen lassen. In diesen Größenordnungen liegen daher auch gewachsene ländliche oder dörfliche Strukturen (Gottesbichl, Drasendorf, St. Georgen am Sandhof, Großbuch, Ponfeld, Tultschnig, Trettnig, Waltendorf, ...). Zur systematischen Förderung des ZuFuß-Gehens in kleineren Strukturen ist in erster Linie ein dorfinternes Fußwegenetz erforderlich. Dies kann durchaus schwerpunktmäßig auf den Freizeitverkehr ausgerichtet sein und sollte möglichst zahlreiche Anschlusswege zu den anderen Gemeinde- oder Stadtteilen und möglicherweise auch bis in die Innenstadt bieten.
In kleinteiligen Strukturen bei geringem Autoverkehr ist teilweise mit spielenden Kindern auf der Straße zu rechnen und einer verminderten Aufmerksamkeit beim Queren der Straße. Deshalb sollten die Einfahrten in solch kleinteiligen Strukturen geschwindigkeitsdämpfend und die Geschwindigkeitsregelung für die gesamten Bereiche einheitlich sein, z.B. Tempo 30 oder möglichst noch geringer. Darüber hinaus bieten sich eher linienhafte Querungsanlagen und Fahrbahnverschwenkungen als geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen an.

6
Handlungsschwerpunkte und generelle Strategien
Im folgenden Abschnitt werden allgemeine Handlungsschwerpunkte formuliert, die ein allgemeines Leitbild für das Zu-Fuß-Gehen in der Stadt Klagenfurt vorgeben sollen. Viele Bereiche sind unmittelbar miteinander verknüpft oder bedingen einander sogar. Das übergeordnete Ziel aller Handlungsfelder soll die Schaffung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Infrastruktur für das Zu-Fuß-Gehen in Klagenfurt sein. Die Fußverkehrsinfrastruktur soll dabei logisch, attraktiv, sicher, multimodal sowie repräsentativ sein. Die nachfolgend dargestellten Handlungsschwerpunkte teilen sich in vier Themenfelder:
▪ Straßen- und Verkehrsplanung bzw. Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
▪ Stadt- und Raumplanung bzw. Stadt der kurzen Wege
▪ Multimodale Angebote bzw. Infrastruktur für den Umweltverbund
▪ Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
6.1 Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
Die Planung der Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende erfordert die Beachtung der spezifischen Eigenschaften von Zu-Fuß-Gehenden: Es soll(en)
▪ kurze Wege angeboten werden
▪ eine gute Orientierung gewährleistet sein, also direkte, sichere Wege vorliegen
▪ für ein angenehmes Zu-Fuß-Gehen (Bequemlichkeit, Abwechslung durch gestalterische Maßnahmen, Möblierung, …) gesorgt werden
▪ Wege angelegt werden, welche zu allen Tageszeiten belebt sind und von vielen verschiedenen Nutzergruppen (bezüglich Motivation und Altersstruktur) begangen werden.
Dies kann mit Schlagworten wie logisch, schlüssig, sicher, multifunktional, attraktiv, … zusammengefasst werden Das Straßen- und Wegenetz bzw. alle öffentlichen Räume sollen dabei auf die Bedürfnisse von Zu-Fuß-Gehenden ausgelegt sein und die Belange des Fußverkehrs berücksichtigen.
6.1.1 Definition eines Hauptwegenetzes für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt
Der Grundstock der Netzplanung ist die Festlegung eines strategischen Netzes von Hauptwegen auf Ebene der Stadt Klagenfurt bzw. auch auf Stadtteilebene, welche durch sogenannte Freizeitwege, Flaniermeilen oder Boulevards ergänzt werden Ziel sollte es sein, ein Hauptwegenetz für ganz Klagenfurt und über die einzelnen Stadtteile hinweg zu definieren, dieses an die bestehenden überörtlichen Wanderwege anzuschließen, eine getrennte Wegführung abseits von Kfz- und Radverkehr einzuführen und begleitende Maßnahmen zu setzen, die für Abwechslung und Bequemlichkeit sorgen (Begleitbepflanzungen, Rastmöglichkeiten, …).
Hauptwegeverbindungen sollen in erster Linie der direkten und schnellen Verbindung wichtiger Punkte im Stadtgebiet dienen (z.B. Verbindung von Wohngebieten und der Innenstadt, Verbindung zu wichtigen Ausbildungs- und/oder Arbeitsstätten, ). Diese Hauptwege bilden somit primär ein nachfrageorientiertes Netz. Wo – auch über weite Strecken hinweg – eine hohe Nachfrage zwischen einem Quell- und einem Zielgebiet in Klagenfurt vorhanden ist, sollte auch eine entsprechende Infrastruktur für Zu-FußGehende (Radfahrer und auch im öffentlichen Verkehr) angeboten werden. Dieses Hauptnetz soll durch

Freizeitwege, Flanierrouten oder Boulevards ergänzt werden, welche eher ein angebotsorientiertes Netz darstellen, deren Wege zum Zu-Fuß-Gehen einladen und attraktive Alternativen zum Hauptwegenetz bieten sollen bzw. dieses ergänzen. Hauptwege und Freizeitwege bzw. Flanierrouten ergänzen einander, sollen vorhandene Lücken im Fußverkehrswegenetz schließen und so ein engmaschiges Gesamtnetz über das gesamte Stadtgebiet ergeben.
Durch die strategische Festlegung eines Hauptwegenetzes für Klagenfurt, welches im Stadtentwicklungskonzept verankert wird, soll eine kontinuierliche Erweiterung ermöglicht werden. Flaniermeilen oder Boulevards (z.B. im Bereich der Ostbucht, im Europapark, in der Innenstadt, …) sollen als Freizeitwege betrachtet werden, die ebenso entsprechend attraktiv und sicher ausgebaut werden sollen. Die bestehenden lokalen und überörtlichen Wanderwege sollen angeschlossen werden und eine getrennte Wegführung von anderen Verkehrsarten angestrebt werden. Dazu muss der Fußverkehr flächenhaft für ganz Klagenfurt betrachtet werden und zwar auch über Entfernungen hinweg, die kaum noch zu Fuß zurückgelegt werden, sondern nur noch in Teilabschnitten begangen werden. Grundsätzlich kann das Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende auch mit den Hauptrouten im Radverkehr kombiniert werden, wobei auf entsprechend angepasste Frequenzen zu achten ist. Es ist weder angenehm als Fußgänger zwischen vielen Radfahrern unterwegs zu sein, noch umgekehrt. Überwiegt eine Verkehrsart sollten die Hauptwegenetze auch getrennt werden. Abschnittsweise wird es in Klagenfurt jedoch möglich sein, die gleiche Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende und Radfahrer zu nutzen (z.B. entlang mancher Abschnitte des Sattnitzbegleitweges oder des Glanbegleitweges, …).
Im Rahmen der Umsetzung sollen Wege, die besondere Sorgfalt beiPlanung und Ausführung benötigen priorisiert werden. Hierzu zählen Wege mit hoher Frequenz an Kindern, älteren Menschen sowie sinnesund mobilitätseingeschränkten Personen. Die Verkehrssicherheit gilt dabei als eines der wichtigsten Planungskriterien. Bereiche mit intensiver wirtschaftlicher Nutzung (Innenstadt, Stadtteilzentren, …), in denen die Einkaufs- und Erledigungswege attraktiv, angenehm und bequem auszugestalten sind, sind bei der Planung und Umsetzung ebenfalls zu priorisieren.
6.1.2 Hindernisse und Barrieren entschärfen
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass für etwa 10 % der Bevölkerung bestehende Barrieren und Hindernisse nahezu unüberwindbar sind (z.B. für Rollstuhlfahrer, …) 30 bis 40 % der Bevölkerung (Blinde- und Sehbehinderte, Schwerhörige, Gehörlose oder Taube, Personen mit Kinderwägen, Kinder, ältere Personen, …) könnten erheblich leichter ihre Mobilitätsbedürfnisse erfüllen, wenn keine Barrieren und Hindernisse im öffentlichen Raum vorhanden sind. Zu-Fuß-Gehende sind zudem ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Die Belange der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit sind daher bei der Planung der Fußgängerinfrastruktur vordringlich zu beachten.
Barrierefreiheit ist dabei grundsätzlich eine Aufgabe, welche nicht nur die Verkehrsinfrastruktur betrifft, sondern viele städtische Themen und öffentlichen Räume. Generell kann sie jedoch als Impulsgeber für Maßnahmen angesehen werden, die letztlich allen Zu-Fuß-Gehenden zugute kommen, weshalb Barrierefreiheit vor allem in der Planung von Fußgängeranlagen und im Bereich von Haltestellen im öffentlichen Verkehr eine wesentliche Rolle spielen sollte. Bei Treppen sollten z.B. alternativ auch Rampen oder Fahrstühle angeboten werden (bzw. auch umgekehrt, z.B. im Bereich der Haltestelle Klagenfurt-West). Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollten „ertastbare“ Wegführungen (Randsteine, Häuserkanten, Mauern, taktile Leitsysteme, …) und optische Kontraste angeboten werden

Im Rahmen einer „barrierefreien“ Planung muss jedoch nicht immer primär an Behinderte oder körperlich eingeschränkte Personen gedacht werden, auch die Bedürfnisse von Kindern oder älteren Menschen sollten in der Planung berücksichtigt werden. Um den Eigenheiten und Fähigkeiten älterer Menschen und Kinder zu genügen, müssen die Straßen und Wege fünf grundlegenden Gestaltungskriterien entsprechen, wobei diese sinngemäß nicht nur für Zu-Fuß-Gehende anzuwenden sind, sondern auch für Radfahrer und im öffentlichen Verkehr:
▪ einfache und klare Regelungen
▪ sichere Gestaltung der Infrastrukturanlagen
▪ möglichst langsamer Fahrverkehr im Umgebungsbereich
▪ sorgfältige Instandhaltung und Pflege
▪ bequeme Verbindungen und ansprechende Gestaltung (Rast-, Sitzmöglichkeiten, …)
Wie im Rahmen einer „barrierefreien“ Planung kommen fast alle Maßnahmen im Rahmen einer Kinderoder Seniorenwegsicherung auch allen anderen Zu-Fuß-Gehenden zugute. Dabei sollten auch Synergien genutzt werden. So wurde z.B. in Berlin die Fußverkehrsstrategie mit einem gesonderten Förderprogramm für „barrierefreie öffentliche Räume“ verbunden, um alle wesentlichen Fußverkehrsverbindungen und Gehwege an Einmündungen und Kreuzungen nutzbar zu machen.
In den Themenbereich „Hindernisse und Barrieren entschärfen“ ist auch das Vermeiden von Umwegen oder Steigungen miteinzubeziehen. Unattraktive Fußgängerrouten, die komplizierte Verkehrslösungen, Umwege, Niveauunterschiede (Unter- und Überführungen) bzw. Wartezeiten umfassen, werden häufig nicht genutzt und sollten deshalb nach Möglichkeit vermieden werden. Barrieren durch natürliche Hindernisse (z.B. Bäche und Gewässer) und künstliche Hindernisse (Bahn- und Straßenanlagen, Gebäudekomplexe, …) sollten vermieden bzw. so gut es geht abgebaut werden.
Um die Bedingungen an Ampeln für Zu-Fuß-Gehende zu verbessern, sollen bei bestehenden und neu zu errichtenden Signalanlagen die Druckknopfanlagen durch Festzeitsteuerungen oder andere intelligente Lösungen ersetzt werden bzw. soll geprüft werden, inwieweit diese reduziert werden können. Unverhältnismäßig lange Sperrzeiten für Fußgänger an Ampeln führen häufig zu Rotlichtmissachtungen und sind daher zu vermeiden. Bei vierarmigen Kreuzungen soll es auch vier Querungsmöglichkeiten geben, da es ansonsten zu unnötigen Umwegen kommt.
6.1.3 Plätze und Fußgängerbereiche/-zonen angemessen gestalten Plätze, Fußgängerbereiche und Fußgängerzonen bilden in vielen Fällen die Kernelemente des Wegenetzes für Zu-Fuß-Gehende, mit hoher Frequenz und einer entsprechenden Bedeutung für das unmittelbare Umfeld. Sie sollten deshalb auch adäquat gestaltet werden Mobilität und Verweilen von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, bilden die wesentliche Grundlagen für eine lebenswerte und urbane Stadt. Die Verkehrsmittelwahl ist zu einem großen Teil angebotsinduziert: je nachdem wie gut das Angebot für Zu-Fuß-Gehende ist, desto höher wird auch die Nachfrage sein. Durch die Verbesserung der Situation für Zu-Fuß-Gehende wird jedoch noch mehr erreicht: Die Stadt bzw. das Umfeld wird lebendiger und kommunikativer. Zu-Fuß-Gehen bietet die Chance für direkte Begegnung von Menschen, Aufenthalte im Freien, Erlebnisse, Informationen usw.

Um attraktiv zu sein, haben Fußgängerbereiche hohe gestalterische Ansprüche zu erfüllen. Der angrenzende Raum ist dabei genauso miteinzubeziehen, wie andere Verkehrsträger oder andere Nutzungsansprüche (Aufenthalt, Erholung, Grünraum, Kinderspiel, …). Durch eine „schöne“ Gestaltung kann die Aufenthaltsqualität in Fußgängerbereichen sowie auf Plätzen gesteigert werden. Neben einer „schönen“ Gestaltung sollten Fußgängerbereiche natürlich auch ihre Funktion erfüllen und den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Mit Gestaltungselementen wie Grünanlagen, Rast- und Sitzmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung lässt sich die Aufenthaltsqualität für Zu-Fuß-Gehende spürbar steigern. Durch entsprechende Gestaltungsvorgaben der Stadt in Bezug auf Architektur, Stadt-, Freiraum- und Grünraumplanung kann die Aufenthaltsqualität in Fußgängerbereichen zum Positiven verändert werden. Für die Lebensqualität in der Stadt ist es entscheidend, ob die Plätze für das Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt werden oder für den Aufenthalt von Menschen konzipiert werden.
Die in Klagenfurt in den letzten Jahren teilweise gewählten Ansätze z.B. im Rahmen der Umgestaltung des Pfarrplatzes, in welcher der Anteil an Kfz-Stellplätzen zu Gunsten der Aufenthaltsqualität im städtischen Raum reduziert wurde, sollten in Zukunft konsequent weiterverfolgt werden und Grundlage für eine entsprechende Stadt-, Freiraum- und Grünraumplanung sein. Vor allem in jenen Bereichen, in denen in den letzten Jahren entsprechende Alternativen zum Parken an der Oberfläche geschaffen wurden (z.B. Benediktinerplatz) bzw. in Zukunft geschaffen werden sollen (z.B. Kardinalsplatz)
Es entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, dem Fußverkehr die Restflächen zuzuteilen, die nach der Zuordnung der Fahrstreifen übrig bleiben. Die sogenannte „Regelbreite“ von Gehwegen beträgt nicht 1,50 m, wie immer wieder zu hören ist, sondern 2,50 m (inkl. Schutzstreifen) Grundsätzlich sollte die Straßenraumgestaltung vom Rand aus erfolgen. Zuerst sollten die angestrebten Breiten für den Fußgänger- und Radverkehr festgelegt werden und dann die Breiten für den fließenden Kfz-Verkehr.
Auch bei vorhandenen Straßenquerschnitten kann durch eine Adaption der Fahrflächen und Fahrbahnbreiten Platz für den nicht motorisierten Verkehr geschaffen werden Zudem tragen Einengungen der Fahrfläche dazu bei, dass das Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs sinkt (z.B. bei Mehrzweckstreifen konnte dieser Effekt in Klagenfurt beobachtet werden).
Um die geschaffenen Qualitäten im öffentlichen Raum zu erhalten, müssen diese jedoch nicht nur errichtet sondern auch kontinuierlich gepflegt werden (z.B. Reinigung, Winterdienst, Baumschnitt), um einen dauerhaft attraktiven Aufenthaltsraum sicherzustellen.
6.1.4 Durchwegung sichern und ausbauen
Zu-Fuß-Gehende sind besonders umwegempfindlich. Dies zeigt sich immer wieder bei„Trampelpfaden“ durch Grünbereiche und Wiesenstücke, die das eigentliche „Wunschliniennetz“ offenbaren.
Die Fußwege sollen daher möglichst engmaschig sein und Umwege oder Barrieren vermeiden. Kurze, direkte Wege außerhalb des Straßennetzes, die die Gehzeit verkürzen, attraktivieren zudem das ZuFuß-Gehen gegenüber der Fahrt mit dem Auto. Sofern es die Rahmenbedingungen erlauben, sollten „Trampelpfade“ nicht unterbunden, sondern entsprechend ausgebaut werden, um den Wunsch der ZuFuß-Gehenden nach einer attraktiven Verbindung zu entsprechen.
Vor allem im Bereich neuer Bauvorhaben sind die Durchwegung zu sichern und attraktive Bedingungen für Alle zur Verfügung zu stellen. Bei größeren Baublöcken oder langen Straßenabschnitten sollte eine Durchwegung wenn möglich bereits im Bebauungsplan festgelegt werden.



Abbildung 6 1 „Trampelpfade“ kennzeichnen Wunschlinien von Zu-Fuß-Gehenden
Im Rahmen der „Planungshoheit“ der Stadt Klagenfurt in Bezug auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringen sollte, wird die baurechtliche Bindung häufig bei Nutzungsfragen von Grundstücken, welche sich nicht in öffentlicher Hand befinden, nicht durchgesetzt. Versäumnisse und Fehlentscheidungen in der Vergangenheit sind dabei nur schwer rückgängig zu machen, können jedoch für die Zukunft bei Entscheidungen miteinbezogen werden. Dadurch können sich Möglichkeiten ergeben, entsprechende Freiflächen, öffentliche Räume, Sichtbeziehungen, … zu schaffen bzw. bisher nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten zu ergreifen (z.B. durch Verankerung von Durchgangsmöglichkeiten im Wegerecht)
6.1.5 Sicherheit erhöhen, Unfallfurcht vermindern
Wichtig für alle Zu-Fuß-Gehenden und Radfahrer ist eine sichere und als sicher empfundene Verkehrsund Stadtumgebung. Deshalb sollte auch die Furcht vor Verkehrsunfällen vermindert werden, um das Zu-Fuß-Gehen zu fördern. Dies trifft auf der einen Seite vor allem auf ältere Menschen zu, die sich nicht auf die Straße trauen (aber gerade die Bewegung zu Fuß benötigen würden, um bis ins hohe Alter mobil zu bleiben), auf der anderen Seite aber auch auf Eltern, die ihre Kinder bis zum Schuleingang fahren, um sie vor Unfällen zu schützen und damit gleichzeitig jedoch andere Kinder gefährden.
Schulwege sollten grundsätzlich sicher gestaltet sein Kindern sollte es dadurch erleichtert werden, die Schulwege eigenständig zu Fuß zurückzulegen. Verkehrsverhalten wird großteils von Gewohnheiten, früheren Erfahrungen, eingespielten Routinen und auch vom Image einzelner Mobilitätsformen bestimmt. Da die Schul- und Ausbildungsstätten immer weiter von den Wohnorten entfernt sind und freie Schulwahl besteht, hat sich die mittlere Schulweglänge in den letzten Jahrzehnten deutlich verlängert. Vielfach werden Kinder deswegen mit dem Elterntaxi transportiert. Die Schulwegsicherung ist somit eine wichtige Maßnahme im Umfeld von Schul- und Ausbildungsstätten. Langfristig und zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens ist es sinnvoll, Eltern dazu zu animieren, ihre Kinder mit dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuß zur Schule kommen zu lassen.
Dabei ist es nicht ausreichend „Schulwege“ allein aus fachlicher Sicht und nach Sicherheitsaspekten zu definieren (z.B. von der Polizei, …). Schulwegsicherung sollte auch die Routen miteinbeziehen, welche von den Kindern tatsächlich „verwendet“ werden, da diese oft andere Kriterien anwenden als den reinen Sicherheitsaspekt (z.B. kürzester Weg zur Bushaltestelle, Weg den viele Kinder gehen, …). Für längere

Schulwege können sogenannte „Elternhaltestellen“, verbunden mit einem letzten Fußwegstück für die Schüler und mit einem Halteverbotsbereich in der direkten Umgebung der Schule sinnvoll sein Durch Schulstraßen und Schulwegpläne (von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder Elternhaltestellen zur Schule) sollen Schulstandorte verkehrssicherer gestaltet und Elterntaxifahrten weitgehend entbehrlich sein. Zusätzlich kann dadurch die Aufwertung des Schulumfelds verstärkt in den Fokus rücken, wie dies z.B. im Bereich des Schulzentrums Mössinger Straße seit Jahren der Fall ist.
Um Unfälle zu vermeiden, sollten behindernde Einbauten oder Möblierungselemente auf Fußverkehrsflächen, Unebenheiten in den Belägen, Stolperfallen, fehlende Randsteinabsenkungen, usw. wo es geht, vermieden werden.
Gleichzeitig kommt bei der Förderung des Zu-Fuß-Gehens auch dem Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum eine hohe Bedeutung zu, weil durch evtl. gefühlte Unsicherheiten die Mobilität zu Fuß (oder mit dem Fahrrad) erschwert oder sogar verhindert wird. Entlegene oder einsame Wege werden oft gemieden, auch bei Dunkelheit begangene Verbindungen (z.B. durch Parkanlagen, Unterführungen, …) werden häufig als Angsträume wahrgenommen. Fußgängerverbindungen entlang belebter Umgebungen sowie übersichtliche und gut beleuchtete Anlagen sind deshalb für Fußgängernetze anzustreben. Um Konflikte bei der Querung von Straßen zu vermeiden, müssen sich die Verkehrsteilnehmer gegenseitig sehen und miteinander interagieren können. Auf eine frühe Erkennbarkeit von Überquerungsstellen ist zu achten, Sichtbehinderungen durch Verkehrszeichen, Bepflanzung, Werbeplakate, Schaltkästen usw. sind zu vermeiden. Auch im Querungsbereich parkende Fahrzeuge können Sichthindernisse darstellen. Für Querungsanlagen sind in den technischen Regelwerken und Richtlinien entsprechende Sichtweiten und freizuhaltenden Bereiche genau angegeben. In der Straßenverkehrsordnung ist das Halten und Parken in einem Bereich von 5 Metern an Kreuzungen und Einmündungen, Fußgängerüberwegen und im Bereich von Haltestellen geregelt. Vor allem bei Neu- und Umbauten sollten die entsprechenden Sichtfelder freigehalten und dadurch die Übersichtlichkeit gewährleistet werden.
Durch die Verringerung der Überquerungslängen (durch angepasste Fahrstreifenbreiten, vorgezogene Seitenräume, Rückbau von Abbiegestreifen, Rückbau überdimensionierter Eckausrundungen, …) befinden sich langsamere Zu-Fuß-Gehende weniger lang auf der Fahrbahn, wodurch nicht nur für die ZuFuß-Gehenden sondern vielfach auch für den fließenden Kraftfahrzeugverkehr Verbesserungen erzielt werden können (z.B. Verkürzung von Übergangszeiten an Signalanlagen, …)
6.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
Die „Stadt der kurzen Wege“ bezeichnet ein Leitbild der Stadt(entwicklungs)planung, in dem insbesondere die Bedürfnisse des Fußverkehrs berücksichtigt werden. Dabei richtet sich die Stadtentwicklung nach den Prinzipien der Nähe sowie Nutzungsmischung und gibt Regeln für eine fußverkehrsfreundliche Raum- und Bebauungsplanung vor, mit der das Verkehrsaufkommen möglichst gering gehalten werden kann. Das Ziel ist eine Stadt mit kurzen und attraktiven Fußwegeverbindungen, in der die Notwendigkeit der Nutzung motorisierter Fahrzeuge stark reduziert werden kann. Das Ergebnis ist eine lebenswerte, attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität.

6.2.1 Fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung ermöglichen
Die konsequente Umsetzung des Konzepts der „Stadt der kurzen Wege“ und die Priorisierung des ZuFuß-Gehens in der Stadt- und Verkehrsplanung können dabei helfen, die in den übergeordneten Programmen und Konzepten gesetzten Mobilitäts- und Klimaziele, nachhaltig und effizient zu erreichen.
In Stadterweiterungs- und Entwicklungsgebieten sollte demnach das Erschließungskonzept primär auf die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern und dem öffentlichen Verkehr ausgerichtet sein. Das beinhaltet eine engmaschige Durchwegung, die Anbindung an das Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt, verkehrsberuhigende Maßnahmen und die weitestgehende Freihaltung von ruhendem Verkehr durch z.B. unterirdische Parkgaragen oder Abstellmöglichkeiten im Randbereich.
In Siedlungsgebieten mit vorwiegender Wohnnutzung können Straßen in Begegnungszonen oder Spielstraßen umgewandelt werden. Die öffentlichen Flächen bieten damit neben der wichtigen Verbindungsfunktion auch eine Aufenthaltsfunktion, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. In Anliegerstraßen ermöglichen insbesondere ausreichende Begegnungsräume ein achtsames Miteinander verschiedener Nutzungsansprüche.
6.2.2 Attraktives Wohnumfeld schaffen Menschen wünschen sich ein angenehmes und attraktives Wohnumfeld, in dem sie sowohl Platz für Begegnung als auch für Ruhe finden können. Eine hierfür notwendige ausgewogene Mischung verschiedener Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit, etc.), die attraktiv und abwechslungsreich gestaltet werden kann, soll auf übergeordneter Ebene der Stadtplanung vorbereitet werden. Dies trifft sowohl auf Neuaufschließungsgebiete wie auch bei der Sanierung und Revitalisierung bestehender Potentiale bzw. brachliegender Gebiete mit urbanem Potential (z.B. im Bereich An der Walk; im Bereich Fernheizwerk – Ringquartier, im Bereich „altes“ Hallenbad, Hauptbahnhof – Europan-16, …) zu. Bei einer hohen Siedlungsdichte wird nachweislich mehr zu Fuß gegangen als bei geringer Dichte.
Bereits im „Aktionsplan Mobilität“ der Stadt Klagenfurt wurde definiert, dass eine Siedlungsentwicklung in bestandsnahen Zonen – also Verdichtung, statt Zersiedelung – verfolgt werden und eine Neuausweisung größerer Baulandflächen nur in Abstimmung mit der vorhandenen ÖV-Erschließung und ÖV-Planung erfolgen soll Dies wurde z.B. im Bereich des Entwicklungsgebietes „hi Harbach“ konsequent verfolgt. Um für Zu-Fuß-Gehende entsprechende Bedingungen zu schaffen, sollte zukünftig zudem eine Orientierung und Rücksichtnahme auf das Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende erfolgen. Neben der Nutzungsmischung in der Flächenwidmungsplanung sollen Fuß- und Radwegeverbindungen in Bebauungsplänen berücksichtigt werden, um die Nahmobilität zu fördern und ein attraktives und lebenswertes Wohnumfeld zu schaffen, das Menschen zum Gehen, Verweilen und Austausch motiviert Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die Teil eines attraktiven Wohnumfelds ist, wird in Kapitel 6.3.1 behandelt.
Um ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen, sollten auch in Wohnbereichen entsprechende Flächen und Plätze geschaffen werden, welche nutzungsgerecht gestaltet werden (z.B. ausgelegt auf die Regeneration oder Kommunikation für Bewohner oder Beschäftigte in der Umgebung, …). Vielfach wurden ehemals vorhandene Plätze in der Vergangenheit in autogerechte Straßenkreuzungen umgebaut und sind als Platz kaum noch wahrnehmbar. Falls hier Möglichkeiten bestehen, sollten diese als städtebauliches Element wieder zurückgewonnen, herausgearbeitet und entschleunigt werden.

6.2.3 Grünzüge vernetzen
Wesentlich für die Umwelt- und auch die Lebensqualität in Klagenfurt sind die begrünten Bereiche und ihre Verbindungen untereinander. Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes wurde dafür der Begriff „grünes Netz“ verwendet. Viel Grün in der Stadt oder einem Stadtbezirk ist ein Standortvorteil und ein herausragendes Kriterium, um Menschen zum Bleiben und Verweilen zu animieren und gleichzeitig auch Bewohner aus anderen Bereichen anzuziehen (z.B. Kreuzbergl, Ostbucht, …) Aus diesem Grund sollte im Sinne einer umweltgerechten Stadtentwicklung auf eine ausreichende und qualitätsvolle Begrünung und gute, möglichst fußläufige Erreichbarkeit und Vernetzung der Grünräume geachtet werden. Mit einem guten Angebot an komfortabel in diese Grünstrukturen eingebetteten Fuß- und Radwegen kann deren Qualität deutlich gesteigert werden. Die gute Erreichbarkeit und Vernetzung von Grünflächen tragen maßgebend zur Bereitschaft bei, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren.
Zusammenhängende Grünzüge und Wege an Gewässern werden nicht nur zum Spazieren gehen genutzt, sondern auch – zumindest etappenweise – in Alltagswege integriert, wie z.B. der Sattnitzbegleitweg, der Glanbegleitweg oder der Lendkanal.
6.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes
Zum Teil wird der Wohnort danach ausgesucht, wie gut die öffentliche Verkehrsanbindung vor Ort z.B. zum Arbeits- oder zum Ausbildungsplatz der Kinder ist. Eine kurze, direkte und attraktive fußläufige Verbindung (die berühmte letzte Meile) zur nächsten Bus- oder S-Bahn-Haltestelle erhöht maßgeblich die Attraktivität und Qualität eines Wohn- aber auch Geschäftsstandortes. In den meisten Städten und den dazugehörigen Stadtumlandgebieten ist eine Erhöhung des Anteils an Zu-Fuß-Gehenden nur im Zusammenspiel mit einem entsprechend leistungsfähigen und attraktiven Angebot im öffentlichen Verkehr möglich. Knotenpunkte im öffentlichen Verkehr müssen somit strategisch gut gelegen, fuß- und radfreundlich angebunden sowie attraktiv ausgestaltet werden.
6.3.1 Zuwegung zu Haltestellen optimieren und Aufenthaltsqualität erhöhen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sollen möglichst direkt sowie barrierefrei erreichbar sein. Hierzu zählen auch Querungen im unmittelbaren Umfeld der Haltestelle, an denen es oft zu kritischen Situationen kommen kann, wenn z.B. Personen den Bus in der Haltestelle noch rechtzeitig erreichen wollen. Die Querungen im unmittelbaren Nahbereich einer ÖV-Haltestelle bedürfen daher besonderer Beachtung (z.B. ausreichend Grünzeiten an Signalanlagen, Querungshilfen, …). Gleichzeitig sollte jedoch auch die Erreichbarkeit der Haltestellen nicht vernachlässigt werden. Sind Haltestellen leicht, direkt und ohne Umwege erreichbar kann dies auch zu einer Beschleunigung der Reisezeit führen
Die Haltstellenbereiche selbst sollten eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Dies umfasst neben einem ausreichendem Platzangebot einen entsprechenden Witterungsschutz (Hitze, Wind, Regen), Sitzmöglichkeiten, eine ausreichende Beleuchtung des Haltestellenbereichs, Informationen über Ankunft- und Abfahrtszeiten sowie ggf. Verspätungen (akustisch sowie visuell), Bepflanzungen und eine barrierefreie Ausgestaltung der gesamten baulichen Anlage und der Informationseinrichtungen.

6.3.2 Multimodale Mobilitätsknoten schaffen, ausbauen und vernetzen
Die Förderung des Zu-Fuß-Gehens umfasst auch den Zugang zu anderen umweltschonenden Verkehrsmitteln möglichst einfach und niederschwellig zu gestalten, z.B. zum Radverleihsystemen Nextbike oder zu Carsharing Standplätzen
Die Schaffung multimodaler Mobilitätsknoten, abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort, ist ein erklärtes Ziel des Landes Kärnten im Mobilitäts Masterplan Auch im Mobilitätskonzepts Klagenfurt 2035 wird die Schaffung von attraktiven Umsteigeknoten, insbesondere in Verbindung mit multimodalen Mobilitätsknoten an allen Bahnhaltestellen sowie Bus-Hauptlinien (insbesondere an Umsteigepunkten zwischen Stadt- und Regionalbusverkehr), als Grundelement des Linienkonzepts genannt Im Rahmen des Smart City Projekts „hi Harbach“ entstand ein Mobilitätsknoten mit Bushaltestelle, Fahrradverleihstation sowie weiteren mobilitätsbezogenen Services. Ähnliches wurde auch im Bereich des Lakeside Parks umgesetzt Zudem stehen derzeit insgesamt vier E-Carsharing Standplätze in Klagenfurt zurVerfügung: im Bereich der Alpe Adria Universität/Nautilusweg, dem P&R Minimundus, der Lindwurm Garage und im Bereich Wurzelgasse/SPAR Welzenegg.


Abbildung 6 2 links: Nextbike Verleihstation Klagenfurt (Quelle: nextbike.at) rechts: Übersicht der Mobilitätsangebote am Mobilitätsknoten Klagenfurt Harbach In Klagenfurt sollen weitere Mobilitätsknoten an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs (wichtige Umsteigerelationen) entstehen, attraktiv ausgestattet und Mobilitätsformen im Umweltverbund miteinander verknüpft werden. Um sämtliche zur Verfügung stehenden Mobilitätsangebote einfach und problemlos nutzen und buchen zu können ist die Kooperation mit öffentlichen Verkehrsträgern („reibungslose Mobilitätskette“) und die Entwicklung einer vernetzten, digitalen Informations- und Buchungsplattformen nötig. Die KlagenfurtMobil App der Klagenfurt Mobil GmbH bietet bereits jetzt Informationen zu den aktuellen Abfahrten und alternativen Mobilitätsformen wie Bike- und e-Carsharing. Die App bietet zudem Routenauskünfte und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Kauf von Tickets.
6.3.3 Multimodalität in der Flächenverteilung
Zum Thema Multimodalität kann auch auf die vorhandene Ungleichverteilung der Verkehrsflächen für Zu-Fuß-Gehende, Radfahrer, den ruhenden sowie fließenden motorisierten Individualverkehr hingewiesen werden. Der Fußverkehr ist die bei weitem flexibelste Mobilitätsform und benötigt dabei von allen Verkehrsarten die wenigste Fläche. Den Zu-Fuß-Gehenden sollen daher nicht die Restflächen zugeteilt werden, die nach der Zuordnung für die anderen Verkehrsarten übrig bleiben.

Die gemeinsame Inanspruchnahme von Flächen unter gegenseitiger Rücksichtnahme wird beispielsweise in Begegnungsräumen aber auch in Fußgängerzonen, in denen das Radfahren erlaubt ist, bereits praktiziert Konflikte zwischen dem Rad-, Scooter- und dem Fußverkehr haben sich in den letzten Jahren verschärft. Teilweise wurde dies von der Stadtverwaltung aufgegriffen, z.B. im Bereich der Fußgängerzone in der Innenstadt mit der Informationskampagne „Miteinånd - statt mir egal“ Seitens der Verwaltung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass keine Maßnahmen ohne Abwägung für die anderen Verkehrsträger umgesetzt werden, welche zu Lasten einzelner Verkehrsarten gehen. Insbesondere sollten die Bedürfnisse von Kindern, älteren sowie mobilitäts-, seh- oder hörbehinderten Menschen in der Diskussion berücksichtigt werden
Oftmals wird eine generelle Trennung des Fuß- und Radverkehrs gefordert sowie geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen auf unvermeidbar gemeinsamen benutzen Verkehrsflächen Im Wartebereich von Haltestellen sowie bei Radschnellverbindungen oder stark von Zu-Fuß-Gehenden oder Radfahrenden beanspruchten Bereichen ist eine Entflechtung jedenfalls zu empfehlen und auch entsprechend sichere Querungsmöglichkeiten für die einzelnen Verkehrsarten vorzusehen.
Mit dem Masterplan Radfahren der Stadt Klagenfurt liegt bereits eine umfassende Empfehlung vor, in welcher straßenrechtliche Maßnahmen für die Radweginfrastruktur erläutert werden. Darin werden die Rahmenbedingung der gemeinsamen Nutzung sowohl von Fußgängerzonen als auch wenig befahrener Fußgängerflächen und Begegnungsräumen behandelt
Zur Erhöhung des Modal-Split Anteils zu Gunsten des Umweltverbundes können auch restriktive Regelungen für den motorisierten Individualverkehr getroffen werden. Das beinhaltet u.a. auch eine Prüfung der vorhandenen Flächen für den ruhenden Verkehr und eine Interessensabwägung hinsichtlich deren Nutzung Instrumente wie die Parkraumbewirtschaftung können die Kosten der Flächeninanspruchnahme nur teilweise abfedern. Solche Flächen könnten für die Erhöhung der Aufenthaltsqualität oder für eine Verbesserung der Fuß- und/oder Radwegeinfrastruktur genutzt werden.
6.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
Um das Zu-Fuß-Gehen als Alltagsverkehrsmittel in den Mittelpunkt zu rücken, gilt es bewusstseinsbildende Maßnahmen zu setzen, welche mehr oder weniger fest verankerte Strukturen und Denkmuster im Verkehrsverhalten der Menschen lösen. Zu-Fuß-Gehen soll als das begriffen werden, was es ist, nämlich die ursprünglichste, einfachste und gesündeste Fortbewegungsart, die uns zur Verfügung steht.
Die Entwicklung des Masterplan Gehen ist ein wichtiger Schritt, um die Bedeutung des Zu-Fuß-Gehens in der Stadt Klagenfurt nach außen hin sichtbar zu machen. Dabei geht es nicht darum, sich als „die Stadt für Fußgänger“ zu etablieren, sondern einfach darum, Zu-Fuß-Gehen als prioritäre, urbane Fortbewegungsart zu behandeln und bei allen Vorhaben und Planungen mit einzubeziehen.
Vielfach werden messbare Ziele herangezogen, um den Erfolg einer Maßnahme zu messen. Für den Masterplan Gehen können die Ziele bestehender Strategien auf lokaler Ebene (siehe Kapitel 3.3) herangezogen worden, wie eine Verschiebung des Modal-Split in Richtung Umweltverbund

6.4.1 Image und Bewusstsein für den Fußverkehr aufbauen und pflegen
In Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen der Stadtverwaltung, vor allem jedoch der Abteilungen Straßenbau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz und Stadtplanung soll ein Bewusstsein für den Fußverkehr, den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr aufgebaut und gepflegt werden Das Stadtmarketing und der Tourismusverband wie auch andere betroffene Interessensverbände können dazu miteinbezogen werden, um gemeinsam dieses Bewusstsein nach außen in die Öffentlichkeit zu tragen.
Imagekampagne und Marketingstrategien umfassen auch bewusstseinsbildende Maßnahmen für verschiedene Zielgruppen und zu unterschiedlichen Themen. Dies können zeitlich begrenzte Maßnahmen wie die Umwandlung von Stellplätzen in Aufenthaltsbereiche (z.B. temporäre Nutzung als Gastgärten, für alternative Nutzungen, …) oder mobilitätsbezogene Kampagnen, ebenso wie Informationsveranstaltungen für einzelne Zielgruppen sein. Die gezielte und abgestimmte Information verschiedener Nutzergruppen ist dabei ebenso wichtig wie eine laufende Information Die Vorbildwirkung der politischen Entscheidungsträger darf dabei ebenso nicht unterschätzt werden, wie die tatsächlich gesetzten Maßnahmen.
Im Rahmen der Imagekampagne und Marketingstrategie erscheint es vor allem auch wichtig, jene internen Akteure, Organisationen und Gremien für das Thema Zu-Fuß-Gehen zu sensibilisieren, welche einen maßgebenden Einfluss innerhalb der Stadt Klagenfurt haben. Dies sind neben den Magistratsabteilungen selbst vor allem größere Wohnbaugenossenschaften und Bauträger. Da das Zu-Fuß-Gehen viele Anknüpfungspunkte in der Praxis besitzt, ist für die strategische Förderung auch eine breite Vernetzung erforderlich Externen Planern wie auch internen Fachleuten soll bewusst werden, dass es ein Ziel der Stadt Klagenfurt ist, das Zu-Fuß-Gehen zu fördern. Sie sollen auf das Thema Zu-Fuß-Gehen sensibilisiert und ihnen die jeweils individuellen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie in ihrem eigenen Wirkungsbereich die Stadt Klagenfurt bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen können (z.B. Durchgangsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit durch Siedlungen, …).
6.4.2 Fußverkehr richtig kommunizieren
Der beste Weg, das Bewusstsein für Zu-Fuß-Gehen zu steigern, ist es sichtbar zu machen. Obwohl der Verlauf des Hauptwegenetzes aufgrund einer konsequent qualitativen und großzügigen Ausgestaltung weitgehend selbsterklärend sein sollte, ist die Installation eines Leitsystems (insbesondere für Ortsfremde) in Form von Schildern oder Bodenmarkierungen empfehlenswert. Die Angabe der Entfernungen in Metern oder Gehminuten zu wichtigen Zielen mit Richtungspfeilen (speziell an Knotenpunkten und Abzweigungen) und die Verwendung einer einheitlichen, farblichen Gestaltung haben sich in der Praxis bewährt. Das Design soll einen hohen Wiedererkennungswert haben und auch im Sinne der Multimodalität andere Mobilitätsformen miteinbeziehen und berücksichtigen. Die Wegweisung zu Fahrradverleihstationen soll dabei ebenso inkludiert werden wie zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle. Eine schlüssige und durchdachte Wegweisung animiert zum Gehen und macht neugierig darauf, auch neue Wege und Routen durch das Stadtgebiet zu entdecken. Insbesondere für Besucher einer Stadt – sei es privat im Urlaub oder beruflich für einen Kongress- oder Tagungsbesuch – sind gedruckte Stadtpläne aus Papier nach wie vor sehr beliebt. Die Gestaltung des Stadtplans für diese Besuchergruppe mit Fokus auf den Fußverkehr (z.B. Fußgängerzonen, Begegnungsräume, Grünräume, …), den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr (Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Liniennetzplan) an-

statt für den motorisierten Verkehr (Zufahrtsstraßen, Tiefgaragen, Kurzparkzonen, …) zeigt die Prioritätensetzung einer Stadt deutlich. Zahlreiche Touristen sind auch zu Fuß unterwegs. Insofern sollten zumindest in den touristisch interessanten Bereichen (Innenstadt, Ostbucht, …) nicht nur die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden, sondern auch die der Touristen (z.B. Fußgänger-Leitsystem).
6.4.3 Gesundheit fördern
Der Erhalt der Gesundheit und der Mobilität bis ins hohe Alter nehmen in der Bevölkerung einen zunehmend höheren Stellenwert ein. Eine entsprechende Stadtgestaltung und -entwicklung kann durch eine Reduzierung des Autoverkehrs und eine Verbesserung der Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit dem Bewegungsmangel im Alltag entgegenwirken. In den Gesundheitswissenschaften wird der direkte Einfluss von bebauter Umgebung auf die menschliche Gesundheit immer bewusster wahrgenommen und somit auch die zentrale Bedeutung der Umwelt, die einen gesundheitsfördernden Lebensstil der Bevölkerung unterstützt, betont. Mit Ausrichtung auf die Gesundheitsförderung werden als Siedlungsstrukturmerkmale die Dichte, Vielfalt (Diversität), Gestaltung (Design), Zugänglichkeit zu den Zielen sowie die Entfernungen als wesentlich angeführt.
Die Attraktivität des Zu-Fuß-Gehens hängt nicht nur vom Wegeverlauf, sondern auch von den Zielen ab. Im Alltag sind diese in der Regel durch Arbeitsplatz, Ausbildungsstätte, Einkaufsmöglichkeiten, usw vorgegeben. In der Freizeit werden andere Ziele angestrebt, z.B. ein Gasthaus, ein Spielplatz oder auch ein schöner Park mit Sitzgelegenheiten. Bewegung macht auf „grünen“ Wegen oder entlang von Wasserläufen, auf markierten Routen oder auf Wanderwegen mehr Spaß (Parcours, Lehrpfade, …). Wichtiger als gemeinhin bedacht, sind – selbst im digitalen Zeitalter – dabei Wegweisungen und Karten, die Entfernungen in Gehzeiten angeben. Teilweise warten aus mangelndem Wissen über die Gehzeiten Menschen an Bushaltestellen länger als sie an Zeit für den Weg zu Fuß zu ihrem Ziel benötigen würden.
Die verschiedensten Sportarten (Nordic Walking, Laufen, Joggen, …) sind bei Jung und Alt beliebt und können entlang von Freizeitwegen durchgeführt werden (Halbmarathonstrecke, …). Kinder benötigen überschaubare interessante Objekte wie Mauern zum Balancieren, bewegliche Teile, usw., Jugendliche nutzen auch verschiedenste Geräte für verschiedene Sportarten (Freerunning, Calasthenics, …). Günstig sind deshalb kleine, öffentliche Sport- und Spielplätze, welche an das zentrale Wegesystem angeschlossen sind (z.B. im Bereich des Europaparks, im Stadtgraben, …).
6.4.4 Lokale Wirtschaft stärken
„Wer im Auto sitzt, sitzt auf seiner Brieftasche und kann nichts ausgeben“, dieser Satz wird dem ehemaligen Klagenfurter Stadtrat Frank Frey nachgesagt. Tatsächlich zeigen einige Studien, dass die Fußgängerdichte ein Kriterium der Urbanität und Attraktivität eines städtischen Zentrums und Ausdruck der wirtschaftlichen Kraft der Stadt ist. Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, kommen häufiger und beleben damit die Straßen. Dennoch unterschätzen vor allem Geschäftsleute die Wichtigkeit der Fußgänger (und Radfahrer) als Kunden. Zur Förderung der lokalen Wirtschaft sind Verbesserungen für die „LaufKundschaft“, wie z.B. Wegführungen, Sitzgelegenheiten (ohne Konsumzwang), öffentliche Toiletten und gute Anbindungen von Einkaufsgelegenheiten durch den öffentlichen Verkehr wichtig.

6.4.5 Öffentlichkeit einbinden
Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum sind oft stark emotional beladen, treffen doch hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Bedürfnissen und Begehrlichkeiten aufeinander. Sobald ein grundsätzliches Leitbild wie der Masterplan Gehen vorhanden und abgestimmt ist, ist es deshalb empfehlenswert die Öffentlichkeit zu bestimmten Themen miteinzubeziehen. Der künftige Stellenwert des Zu-Fuß-Gehens in der Stadt Klagenfurt sowie die vorgesehenen Handlungsfelder sollen klar kommuniziert werden. Ziel ist es im besten Fall eine grundlegende Identifizierung mit dem Thema Zu-Fuß-Gehen in Klagenfurt zu erreichen, ohne konkrete Baumaßnahmen setzen zu müssen.
Im weiteren Verlauf und bei Planungen ist insbesondere dann eine Einbindung und Beteiligung der Öffentlichkeit zu empfehlen, wenn es um die Ausarbeitung und Umsetzung eines konkreten Projektes geht, da Anrainer und Nutzer die beste Kenntnis der Situation vor Ort haben. Wichtig ist, alle Nutzerund Interessensgruppen einzubeziehen. Die Vielfalt der möglichen Beteiligungsprozesse ist enorm und ist auf die jeweiligen Umstände abzustimmen, wie dies z.B. im Rahmen der Umgestaltung des Pfarrplatzes erfolgte.
Gemäß dem Masterplan Gehen Österreich können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit z.B. „FußgängerInnenchecks“ durchgeführt werden, um im Sinne einer Qualitätssicherung die reale Situation vor Ort zu erheben und Schwachstellen des Fußwegenetzes zu identifizieren. Im Rahmen des Checks machen verschiedene Bevölkerungsgruppen (z.B. geteilt nach Kinder, ältere Personen, sonstige Zielgruppe) gemeinsam mit Fachexperten eine Begehung ausgewählter Orte im Stadtgebiet und entwickeln gemeinsam einen Maßnahmenkatalog, der dann in Abstimmung mit der Verwaltung und den Fachexperten nach Prioritäten gereiht wird. Vor allem die Einbeziehung verschiedener Interessenvertretungen (z.B. Blinden- und Sehbehindertenverband, …) im Zuge von Planungen erscheint einfach. Meist können durch geringe Adaptionen erhebliche Verbesserungen für einzelne mobilitätseingeschränkte Personengruppen erzielt werden. Durch die „FußgängerInnenchecks“ werden konkrete Bedürfnisse von Zu-FußGehenden vor Ort ermittelt und Vorschläge zur Verbesserung von Problemstellen gemacht. Meistens können nach den Checks erste Resultate rasch und mit geringem finanziellen und personellen Aufwand umgesetzt werden (z.B. Hindernisse entlang von Gehwegen beseitigen, Müll entfernen, …).
Auch außerhalb der Verwaltung sollten strategische Partner gefunden und eingebunden werden, die das Thema tragen und weiterentwickeln können. Mitunter sind diese Partner von außen auch hilfreich, um die Aspekte in andere Verwaltungsstellen einzubringen und integrativ zu wirken. Besondere Bedeutung kommt dabei der politischen Willensbildung zu, insbesondere in den mobilitätsrelevanten Fachausschüssen. Politische Entscheidungsträger sind in der Position, die notwendigen Voraussetzungen anzuregen, im besten Fall zu schaffen und die entsprechenden Beschlüsse in die Wege zu leiten
6.4.6 Finanzierungsmöglichkeiten finden Finanzknappheit stellt meist einen zwingenden Hinderungsgrund für die Umsetzung konkreter Projekte dar. Dies gilt nicht nur für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Zu-Fuß-Gehen. Geld ist zwar in den meisten Budgets vorhanden und Fördermittel können auf unterschiedlichen Ebenen akquiriert werden, herausfordernd ist jedoch in den meisten Fällen die Prioritätenreihung einzelner Maßnahmen. Dies gilt gleichermaßen für den Personaleinsatz in den Fachabteilungen, wie auch für die Infrastrukturkosten. Fußverkehrsförderung ist nicht zum Nulltarif erhältlich, aber in Bezug auf die Effizienz meistens anderen Infrastrukturen überlegen Verglichen mit anderen Investitionen, wie zum Beispiel in die Infrastruktur für

den motorisierten Verkehr, sind die Kosten der Fußverkehrsmaßnahmen in der Regel gering. Die Stadt sollte ein Zeichen setzen und einen eigenen Budgetposten für Maßnahmen zur Förderung des Fußund Radverkehrs verankern.
In der Regel lassen sich Infrastrukturmaßnahmen zur „Förderung des Fußverkehrs“ zumindest teilweise in den Förderprogrammen der Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Städtebau und Stadterneuerung, Barrierefreiheit und Inklusion, Klimaschutz oder der Gestaltung städtischer Freiräume gleichzeitig einordnen.
6.4.7
Betrieb, Instandhaltung und Pflege
Die Attraktivität und Sicherheit der Fußgängerinfrastruktur soll zu allen Tageszeiten gegeben sein Daher ist eine gute Beleuchtung notwendig - vor allem im Umfeld von Schutzwegen, Schutzinseln und Querungsstellen. Die Herstellung einer gefühlten und tatsächlichen, sozialen Sicherheit ist eine große Herausforderung. Eine möglichst einsichtige, offene Raumgestaltung wirkt freundlich und kriminalitätsmindernd.
Eine gute Fußwegeinfrastruktur muss dauerhaft gepflegt und instand gehalten werden und sollte zu allen Jahreszeiten benutzbar sein. Vor allem im Winter sind Fußwege von Schnee zu räumen und bei Glatteis zu streuen. In die Fußgängerwege hereinhängende Äste, Hecken, … stellen genauso ein Ärgernis bei der Benutzung der Fußwege dar, wie mangelnde Sauberkeit. Vor allem die Sauberkeit von Straßen und Plätzen sowie die Pflege von Grünflächen, Parks und Bepflanzungen (Straßenreinigung, Hundekotentfernung, Müllentsorgung, …) sind ein wesentliches Kriterium dafür, ob sich Zu-Fuß-Gehende wohl fühlen. Gerade Grünflächen und Bepflanzungen, die Fußwege und Aufenthaltsflächen attraktiv machen, müssen entsprechend gepflegt werden.
Abbildung 6 3 Negativbeispiel eines bedingt benutzbaren Gehsteiges, 3 Tage nach Schneefall


7
Leitprojekte und konkrete Maßnahmen
Im Kapitel 6 wurden auf genereller Ebene Handlungsschwerpunkte und Strategien zur Förderung des Fußgängerverkehrs in Klagenfurt definiert. Diese sollen im Nachfolgenden durch konkrete Maßnahmen bzw. Leitprojekte ergänzt werden, welche kurz-, mittel- und langfristig in Klagenfurt umgesetzt werden. Vor allem den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen kommt hier eine hohe Wertigkeit zu, weil sie bereits in den nächsten Jahren sichtbar machen, dass der Stadt Klagenfurt die Förderung des Zu-FußGehens ein starkes Anliegen ist.
7.1 Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
7.1.1 Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende
Bisher erfolgte die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen für Fußgänger in Klagenfurt punktuell an aktuellen Problemstellen oder im Rahmen von laufenden Projekten bzw. erforderlichen Sanierungsarbeiten im öffentlichen Raum. Zur strategischen Förderung des Zu-Fuß-Gehens in Klagenfurt soll zukünftig eine systematische Betrachtung der Fußgängerbelange, der Fußwege und deren Netzstruktur erfolgen. Ziel soll es sein
▪ Hauptrouten innerhalb und zwischen den Stadtbezirken, die wichtige Quellen und Ziele der Zu-FußGehenden verbinden und von einer starken Nachfrage an Zu-Fuß-Gehenden geprägt sind, zu identifizieren, zu definieren und regelmäßig zu evaluieren
▪ mehrere innerstädtische Freizeitwege (Flanierrouten, Boulevards, …) zu entwickeln bzw. angebotsorientiert zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens weiterzuentwickeln
▪ für die Hauptrouten und Freizeitwege jeweils eine Mängelanalyse durchzuführen, auf deren Grundlage zukünftig ein Maßnahmenkonzept sowie ein Investitionsprogramm festgelegt werden kann.
Die Hauptrouten sollen ein nachfrageorientiertes Netz bilden, welches sich aus den Quell- und Zielverbindungen der Zu-Fuß-Gehenden ableitet. Dieses Hauptnetz soll durch Freizeitwege (Flanierrouten, Boulevards, …) ergänzt werden, welche eher ein angebotsorientiertes Netz darstellen, deren Wege zum Zu-Fuß-Gehen einladen und attraktive Alternativen zum Hauptwegenetz bieten. Hauptwege und Freizeitwege sollen einander ergänzen, vorhandene Lücken im Fußverkehrswegenetz schließen und zusammen ein Gesamtnetz über das gesamte Stadtgebiet ergeben.
Im Rahmen des Masterplans Gehen wurde in Abstimmung mit den Abteilungen Stadtplanung, Klimaund Umweltschutz und Straßenbau und Verkehr aus den Daten der Abteilungen Vermessung und Geoinformation und Stadtgarten ein Netz an Korridoren für das Hauptwegenetz in Klagenfurt vorgeschlagen und dargestellt. Durch eine kontinuierliche Umsetzung soll als langfristiges Ziel ein sicheres, komfortables Hauptwegenetz mit hoher Aufenthaltsqualität und ausreichend dimensionierten Flächen für Fußgänger in der gesamten Stadt entstehen, wobei die Bedürfnisse und Prioritäten in regelmäßigen Abständen zu evaluieren sind (z.B. im Rahmen der Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes, ) Dabeisoll auch eine regelmäßige Abstimmung und Koordination der Schnittstellen im Gehwegenetz mit den Umlandgemeinden bzw. den überregionalen Verbindungen des Landes Kärnten erfolgen.

Der in Abbildung 7.1 dargestellte Vorschlag für das Hauptwegenetz von Klagenfurt unterscheidet drei unterschiedliche Weg- bzw. Korridorkategorien:
▪ Korridore für das Hauptwegenetz von Klagenfurt (in der Abbildung „rot“ dargestellt)
▪ Korridore für das Hauptwegenetz in den Stadtteilen (in der Abbildung „blau“ dargestellt)
▪ Freizeit- und Wanderwege (in der Abbildung „grün“ dargestellt)

Abbildung 7 1 Vorschlag für das Hauptwegenetz von Klagenfurt

Das Hauptwegenetz in Bezug auf Klagenfurt unterscheidet dabei 7 Korridore, die radial auf die Innenstadt zuführen und teilweise entlang ihrer Route einzelne Stadtteile verbinden
▪ Korridor A: Wölfnitz - Feldkirchner Straße - Aichelburg-Labia-Straße - Innenstadt
▪ Korridor B: Walddorf - Annabichl - St. Veiter Straße - Innenstadt
▪ Korridor C: Welzenegg - An der Walk - Elisabethinen - Innenstadt
▪ Korridor D: Ebenthal/Harbach - Fischl - Ostbahnhof - Mießtaler Straße - Innenstadt
▪ Korridor E: Gewerbezone Süd - St. Ruprecht - Innenstadt
▪ Korridor F: Viktring - Waidmannsdorf - Innenstadt
▪ Korridor G: Lendkanal – Innenstadt und 3 Verbindungsspangen, welche tangentiale Verbindungen innerhalb Klagenfurts darstellen
▪ S1: Waltendorf - Annabichl - Welzenegg
▪ S2: Glanbegleitweg
▪ S3: Sportspange - Lakeside Park - Universität - Klagenfurt West und um die Infrastruktur rings um die Innenstadt (Innenstadtring) ergänzt werden. Da die Gehwegbreite ein wichtiger Faktor für die Attraktivität für Zu-Fuß-Gehende und deren Sicherheitsempfinden ist, sollten für das Hauptwegenetz keine Mindestmaße angesetzt werden. Abhängig von der Frequenz an Zu-Fuß-Gehenden sollten 2,50 m, bei intensiver Seitenraumnutzung auch 3,50 bis 4,50 m an Breite für Zu-Fuß-Gehende zur Verfügung gestellt werden (frei von Hindernissen, wie Parkscheinautomaten, Mistkübeln, Werbetafeln, temporären Hindernissen, …). Erfolgt eine Kombination mit Radwegen so sind die Breiten für gemischte Geh- und Radwege entsprechend aufzuweiten. Das Hauptwegenetz sollte dabei auch entsprechend einladend gestaltet sein, vor allem in der Innenstadt oder in den Stadtteilzentren sollte dieses durch entsprechende Plätze aufgewertet werden; qualitative Grünflächen, ausreichende Ruhemöglichkeiten und eine barrierefreie Gestaltung sollten für das Hauptwegenetz sichergestellt werden. Hierzu werden auch die nachfolgend beschriebenen Infrastrukturprojekte beitragen, welche in den nächsten Jahren in Klagenfurt umgesetzt werden sollen.
7.1.2 Umgestaltung Pfarrplatz
Das Verkehrssystem im Bereich des Pfarrplatzes soll nach seiner Umgestaltung eine hohe urbane Lebensqualität bieten und auf dem Grundgedanken basieren, den Menschen stärker in den Mittelpunkt der Planung des öffentlichen Raumes zu rücken. Dies entspricht den allgemeinen Zielsetzungen des Aktionsplans Mobilität, des Stadtentwicklungskonzeptes von Klagenfurt sowie diverser EU-Förderprogramme, an denen Klagenfurt teilnimmt und unterstützt die Stadt in ihrem Bemühen sich in eine künftige Smart City zu wandeln. Notwendige Fahrvorgänge mit Kraftfahrzeugen können mit langsamer Fahrgeschwindigkeit in klar definierten Bewegungsräumen für den Fließverkehr stattfinden, ebenso die erforderlichen An- und Ablieferungen. Verkehrstechnisch liegt dabei der Fokus neben der Verbesserung der Aufenthaltsqualität primär auf der Wiedereroberung des Stadtraumes für Fußgänger und Radfahrer. Für Fußgänger wird einerseits die zukünftig bedeutsame Achse von den City-Arkaden über den Pfarrplatz und das Landhaus zum Heiligengeistplatz geöffnet, andererseits wird durch die Fokussierung auf einen offenen Begegnungsraum auch die Möglichkeit geschaffen, die angrenzenden Innenhöfe zu attraktiveren und deren Durchgängigkeit zu erhöhen. Die Umgestaltung des Pfarrplatzes entspricht in vielfältiger

Weise den Zielen und Handlungsschwerpunkten des Masterplans Gehen (z.B. Plätze und Fußgängerbereiche/-zonen angemessen gestalten, Durchwegung sichern und ausbauen, Multimodalität in der Flächenverteilung, …). Im Innenstadtbereich wird es durch die Verdrängung des ruhenden Verkehrs von der Südseite des Platzes zu einer Ausdehnung der Fußgängerzone kommen; auf der Nordseite kann durch die attraktive Gestaltung ein Erlebnis- und Begegnungsraum entstehen.
Abbildung 7 2
Pfarrplatz Klagenfurt, Vorentwurf von Kastner ZT-GmbH, Baumschlagger & Hutter und Rajek Barosch
7.1.3 Neugestaltung Heuplatz

Ähnlich wie die Umgestaltung des Pfarrplatzes ist auch die Neugestaltung des Heuplatzes als Aufwertung eines innerstädtischen Aufenthalts- und Begegnungsraumes zu sehen. Durch den Entfall der Stellplätze für den ruhenden Verkehr erfolgt im nordwestlichen Bereich des Heuplatzes eine Öffnung in Richtung Justizanstalt bzw. der dahinterliegenden Grün- und Parkflächen im Achterjägerpark, Schubertpark und Goethepark. Die unter 5.2.1 beschriebene „Trennung“ zwischen innerstädtischer Kernzone und am Rand gelegenen Grünund Parkflächen kann dadurch vermindert werden, wodurch gemeinsam mit der Durchwegung durch die Stadtgalerie eine verbesserte und offene Verbindung realisiert wird.
Abbildung 7 3
Heuplatz Klagenfurt, Vorentwurf von Rajek Barosch


7.1.4 Umgestaltung Kardinalsplatz
Im Bereich des Kardinalsplatzes ist zur Aufwertung und Revitalisierung des Kardinalsviertels die Verlagerung der oberirdischen Stellplätze für den ruhenden Verkehr in eine Tiefgarage sowie die Umgestaltung des Platzes geplant. Dieses Projekt wird ähnlich wie die Umgestaltung des Pfarrplatzes und die Neugestaltung des Heuplatzes zu einer verbesserten Aufenthaltsqualität in der Innenstadt beitragen. Da derzeit unterschiedliche Interessen zwischen Projektentwicklern und Objektbesitzern bestehen, welche in Summe nicht zu einer optimalen Lösung der Verkehrsthematik im Bereich des Kardinalsplatzes beitragen würden (zwei Tiefgaragenein-/ausfahrten, Dominanz der Tiefgarageninfrastruktur am Platz) ist nicht wie bei den bereits dargestellten Projekten am Pfarrplatz und Heuplatz mit einer kurzfristigen Umsetzung zu rechnen. Insgesamt wird jedoch mittel- bis langfristig auch im Bereich des Kardinalsplatzes eine Umverteilung der Flächen zu Gunsten der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer stattfinden, wodurch bestehende Barrieren in diesem Bereich abgebaut und eine engmaschige Durchwegung ermöglicht wird
7.1.5 Verkehrsberuhigung und Gestaltung Bahnhofstraße
Zur Belebung und Attraktivierung der Klagenfurter Innenstadt und zur Erhöhung der Lebensqualität für die Innenstadtbewohner soll der Kfz-Verkehr in der Bahnhofstraße eingedämmt werden und in gewissen Straßenzügen zu Gunsten anderen Nutzungen verbannt werden (Umverteilung der Flächen zu Gunsten nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer oder anderer Nutzungen). Analog zum Pfarrplatz soll zur Belebung der Bahnhofstraße ein Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung und unter Einbeziehung der Wirtschaftstreibenden gestartet werden. Dabei soll ausgelotet werden, wie sich z.B. die Reduktion der Verkehrslichtsignalanlagen oder ein temporäres Fahrverbot entlang der Bahnhofstraße auswirken. Idealerweise sollen auch andere Straßenzüge in der Innenstadt miteinbezogen werden. Die Bahnhofstraße mit den umgebenden Nutzungen könnte dadurch zu einer hochwertigen, innerstädtischen Flaniermeile aufgewertet werden.
Ähnlich wie die Umgestaltung des Kardinalsplatzes ist die Umsetzung eines alternativen Flächennutzungskonzeptes in der Bahnhofstraße als mittel- bis langfristige Maßnahme zur Förderung des Zu-FußGehens in der Innenstadt von Klagenfurt zu sehen. Ein entsprechender Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung soll kurzfristig gestartet werden.
7.1.6 Barrierefreie Gestaltung der Lendquerung Heinzelsteg
Der Heinzelsteg stellt eines der wichtigen Infrastrukturelemente in der fußläufigen Verbindung der Stadtteile St. Martin und Waidmannsdorf dar. Ausgehend von St. Martin im Norden wird über die Gösseling Brücke sowohl der Zubringer zur A2 Süd Autobahn, wie auch die Bahnstrecke gequert. Über die Heinzelgasse wird die Verbindung zwischen Gösseling Brücke und Heinzelsteg hergestellt, welcher den Lendkanal quert. Während die gesamte Achse (inkl. Gösseling Brücke) derzeit barrierefrei gestaltet ist, besteht auf der Nordseite des Heinzelsteges derzeit für mobilitätseingeschränkte Personen (Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollator, Familien mit Kinderwägen, …) keine Zugangsmöglichkeit zum Heinzelsteg. Die nächsten barrierefreien Querungsmöglichkeiten liegen jeweils rund 500 m östlich oder westlich entlang des Lendkanals. Die westlich gelegene Paternioner Brücke verläuft entlang der 4-streifig geführten Villacher Straße und ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wenig einladend für Zu-Fuß-Gehende. Anders ist dies im Bereich der östlich gelegenen Steinernen Brücke, wo ein sehr

hohes Aufkommen an nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern herrscht, jedoch aufgrund des schützenswerten Charakters der Brücke (Denkmalschutz, …) keine Umgestaltungsmöglichkeit für eine angemessene Fußgängerinfrastruktur besteht. Aus diesem Grund soll der Heinzelsteg barrierefrei gestaltet und an die Bedürfnisse der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer bzw. der Achse St. Martin – Waidmannsdorf angepasst werden. Die barrierefreie Ausbildung des Heinzelsteges soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden (kurz- bis mittelfristiger Realisierungshorizont).

7 4 Systemskizze Heinzelsteg

Abbildung
Gösseling Brücke
Heinzelsteg
7.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
Ein attraktiver Stadtteil oder ein attraktives Stadtquartier vereint zeitgemäße Wohnflächen, angemessen dicht verbaut, mit einer attraktiven Mischung an Dienstleistungen, Gewerbe, Kultur- und Freizeitangeboten. Die Gebäude formen großzügige Freiflächen und bieten in der Erdgeschoßzone eine große urbane Vielfalt an Gewerbe, Dienstleistungen, Gastronomie und sonstigen Nutzungen und erlauben eine direkte Durchwegung für Fußgänger und Radfahrer Entsprechend der Smart City Strategie von Klagenfurt bzw. dem Stadtentwicklungskonzept 2020+ können dadurch Stadtviertel mit kurzen Wegen entstehen, welche motorisierten Individualverkehr weitgehend reduzieren und umweltfreundliche Mobilitätsformen begünstigen, eine hohe Durchlässigkeit haben und mit der Umgebung vernetzt sind In den nächsten Jahren sind aus stadtplanerischer Sicht vor allem in den nachfolgenden Bereichen größere Vorhaben vorgesehen, für welche entsprechende städtebauliche Verträge abgeschlossen werden, um eine engmaschige Durchwegung und Öffnung für die Allgemeinheit zu erreichen.
7.2.1 Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse West Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes für den Lakeside Park soll ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt und umgesetzt werden, das sowohl Pilot- als auch Demonstrationscharakter hat, ein verbessertes Angebot für nachhaltige Mobilitätslösungen unterstützt und zu einer Stärkung klimaschonender Maßnahmen führt. Zentrales verbindendes Element der unterschiedlichen Technologie-, Forschungsund Bildungseinrichtungen im Westen von Klagenfurt soll dabei eine Achse, ausgehend vom Lakeside Park über die Universität, Minimundus, dem neu geplanten Technologiepark (auf den ehemaligen Rohrer Gründen) zur S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West sein. Die Achse erstreckt sich über eine Liftliniendistanz von rund einem Kilometer und bindet an den öffentlichen Verkehr (S-Bahn, Regionalbus, Stadtbus), die Geh- und Radwegachse entlang des Lendkanals (in Richtung Wörther See bzw. Innenstadt, Hauptkorridor G) und die Universitätsstraße (als Querverbindung innerhalb des Universitätscampus) an. Durch eine entsprechend attraktive Gestaltung der Achse kann die Verbindung der im Westen von Klagenfurt angesiedelten Technologie-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen innerhalb einer Gehzeit von maximal 15 Minuten erreicht werden, wodurch auf kurzem Wege zu Fuß (oder mit dem Fahrrad) eine schnelle Durchwegung innerhalb des Gebietes gegeben ist. Entsprechend dem Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende kann die Achse im Süden an die „Sportachse“ in Richtung Stadion, neuem Hallenbadstandort und Leichtathletikarena angebunden werden. Zusammen bilden die Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse West sowie die Sportachse die Hauptwegeverbindung S3 innerhalb des Hauptwegenetzes von Klagenfurt.
Zur besseren Verbindung der Universität sowie des Lakeside Parks mit der Ostbucht soll im Schnittpunkt zwischen Universität und Lakeside Park eine niveaufreie Querungsmöglichkeit der WörtherseeSüdufer-Straße für Zu-Fuß-Gehende und Radfahrer geschaffen werden (als Verlängerung des Gehund Radweges von der Kranzmayerstraße mit Anbindungsmöglichkeit an den Lorettosteg). Dies kann neben einer direkten Verbindung der Universität und des Lakeside Parks mit der Ostbucht auch den gesamten Siedlungsbereich entlang der Kranzmayerstraße direkt und konfliktfrei an die Ostbucht anschließen und die zentrale Geh- und Radwegachse entlang des Lendkanals (aus der Innenstadt in die Ostbucht, Hauptkorridor G) entlasten.

Die Entwicklung der niveaufreien Querung der Wörthersee-Südufer-Straße sowie der Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse soll mittel- bis langfristig jeweils hochattraktive Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer sicherstellen, wofür abschnittsweise eine entsprechende Umverteilung der vorhandenen Flächen (z.B. von Flächen des ruhenden Verkehrs zu Flächen für Fußgänger, Radfahrer, Parkanlagen oder sonstige Nutzungen) erforderlich ist. Kurz- bis mittelfristig ist die Adaptierung und Neugestaltung des Nautilusweges (im Abschnitt zwischen der Universität bis zum Lendkanal), der Lendquerung (Gert-Jonke-Steg), der Parkanlage im Bereich des Planetariums bzw. Reptilien Zoos und der Stellflächen am Minimundus Parkplatz umzusetzen, um einen ersten Impuls für die Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse West zu setzen
7.2.2 Ringquartier
Vor mehreren Jahren erhielt die Kollitsch & Wohnwelt Bauträger GmbHden Zuschlag für die Verwertung des Areals des ehemaligen Kucherhofs. In einem integrativen Verfahren wurde seitdem in enger Abstimmung mit der Abteilung Stadtplanung eine innovative Projektidee entwickelt. Das Konzept sieht sechs Gebäudekörper vor, welche im rechten Winkel zueinander ausgerichtet sind und sich in der Höhe an den angrenzenden Gebäuden orientieren. Rund ⅓ des Areals wird bebaut, die verbleibenden ⅔ sind Freifläche. Mehr als 50 % sind als Grünflächen geplant. Die Anordnung vernetzt die Baukörper mit dem angrenzenden Stadtraum und schafft eine Abfolge von sogenannten Wohnhöfen – das sind öffentliche Flächen vornehmlich den Fußgängern gewidmet. Die wesentlichen Rollen tragen dabei das Zusammenspiel von Architektur und Außenraum sowie der gelungene Mix aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Der Innenbereich ist autofrei gehalten und schafft attraktiven, großzügigen Raum für urbanes Leben. Die hohe Durchlässigkeit des offenen Innenbereichs lässt die Bewegung in alle Richtungen fließen und setzt positive Impulse Richtung Innenstadt Für die Umsetzung des Ringquartieres wurde mit den Bauwerbern ein entsprechender städtebaulicher Vertrag entworfen, welcher einerseits die Durchlässigkeit (zentrale Radfahrachse, engmaschige Durchwegung, …) sichert und andererseits entsprechende Qualitäten in Bezug auf die Ausgestaltung der Flächen vorgibt. Das Projekt soll mittel- bis langfristig in Abstimmung mit den Bauträgern umgesetzt werden, ermöglicht eine fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung, schafft ein attraktives Wohnumfeld und baut durch die engmaschige Durchwegung bestehende Barrieren im unmittelbaren Bereich bzw. auch dem Umfeld ab, wodurch es in mehreren Punkten den Handlungsschwerpunkten des Masterplans Gehen entspricht.
7.2.3 Wohnquartier „An der Glan“ – Entwicklungsgebiet An der Walk
Auf dem ehemaligen Neuner Areal soll nach einer umfassenden Altlastensanierung ein neuer Stadtteil für smartes, urbanes Wohnen, mit Wohnungen, Mobilitätsknotenpunkt und neuen Verkehrswegen entstehen Dafür wurde in Abstimmung mit den Wohnbauträgern ein städtebaulicher Wettbewerb ausgerufen Das Siegerprojekt war Grundlage für ein integriertes Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren, in welchem entsprechende Bebauungsbestimmungen festgelegt wurden (wie hoch darf gebaut werden, welche Baulinien sind einzuhalten, wie ist die Grünraumausstattung, wie wird der Verkehr intern bzw. auch über das Gebiet hinaus organisiert, …) Wohnungen in verschiedenen Größen, soziale Einrichtungen und Nahversorger sowie alternative Arbeitsformen sollen sich in dem Bereich ansiedeln (Kindertagesstätte, Familienwohnungen, Wohngemeinschaften sowie betreute Einheiten, aber auch Kleinkinder- und Kinderspielplätze, Erlebnisräume für die Jugend, Generationengärten, …). Es soll ein städtisches Gefüge, das durch seine Lage an der Grünachse Glan besondere Qualitäten hat, entstehen



Abbildung 7 5 Städtebauliches Gestaltungskonzept (Quelle: Arch. Barbara Frediani-Gasser)
Durch die Stellung der Baukörper sind alle Wohnungen nach Süd-West orientiert; in den Erdgeschoßzonen befinden sich die Sonderflächen. Zur Weiterführung des grünen Netzes (Alleen, Parkanlagen, Spielplätze u.ä.) im Stadtquartier werden entlang der Glashüttenstraße und der Lederfabrikstraße innerhalb der Wohnanlage und im Bereich der Allgemeinflächen (Spiel‐, Sport‐, Parkplätze), Bepflanzungsmaßnahmen umgesetzt. Die Flächen östlich und westlich der Lederfabrikstraße bis zu den künftigen Gebäudefronten dienen als Begegnungszone und werden entsprechend ihrer Funktion qualitätsvoll gestaltet. Des Weiteren wird im Knotenpunktsbereich Glashüttenstraße / Lederfabrikstraße ein Mobilitätsknoten errichtet, welcher einen witterungsgeschützten Aufenthaltsbereich für die Bushaltestelle, Radabstellanlagen inkl. Lastenräder, Paketboxen und E-Carsharing Angebote umfasst. Das Projekt ermöglicht eine fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung, schafft ein attraktives Wohnumfeld, ermöglicht eine multimodale Verknüpfung und gewährleistet durch die engmaschige Durchwegung kurze Wege im unmittelbaren Bereich bzw. auch im Umfeld, wodurch es in mehreren Punkten den Handlungsschwerpunkten des Masterplans Gehen entspricht.

Das Wohnquartier „An der Glan“ soll kurz- bis mittelfristig in Abstimmung mit den Bauträgern umgesetzt werden, wobei die Anbindung in die rund 800 m entfernte Innenstadt (Luftlinie) aufgrund der Barrierewirkung der Eisenbahntrasse noch im Detail betrachtet werden soll (über die Zwanzigerstraße, evtl. durch das Gelände der Elisabethinen, …), um nicht nur eine hochwertige interne, sondern auch eine hochwertige externe Vernetzung in alle Richtungen zu erreichen. Durch die Anbindung an den Hauptwegekorridor C (Welzenegg - An der Walk - Elisabethinen - Innenstadt) kann dies gewährleistet werden.
7.2.4 Bahnhofsviertel
Im Zuge des Europan-16-Ideenwettbewerbs wurden in Klagenfurt nach Lösungen für die Gestaltung des rund sieben Hektar großen Areals zwischen „altem“ Hallenbad und Hauptbahnhof gesucht. Im Siegerprojekt werden fünf unterschiedliche Plätze „5 Squares of Learning“ in Form von Markt-, Kultur- und Eventplätzen, verteilt am Areal und untereinander vernetzt vorgeschlagen. Diese werden mit Parkanlagen und zahlreichen Grüninstallationen aufgewertet. In Bezug auf die Gebäudenutzung soll ein vielfältiges Angebot für Wohnungen, Büros und Gastronomie entstehen, sodass innerhalb des Gebietes auf kurzen Wegen alle notwendigen Erledigungen getätigt werden können. Neben der Realisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ erfolgt durch die Aufwertung und Umgestaltung auch die Erhöhung der Durchlässigkeit und eine engmaschige Durchwegung. Dies ermöglicht eine fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung und schafft ein attraktives Wohnumfeld, zudem ist durch die Nähe zum Hauptbahnhof eine umfassende, multimodale Verknüpfung (Fernzüge, S-Bahn, Fernbusse, Regionalbusse, Stadtbusse, Carsharing, Fahrradverleih, …) gewährleistet. Insgesamt entspricht das Projekt bzw. die Projektvorgaben vielfach den Handlungsschwerpunkten und Zielvorstellungen des Masterplans Gehen. Das Projekt soll mittel- bis langfristig in Abstimmung mit den Grundbesitzern umgesetzt werden

Abbildung 7 6 Siegerprojekt, Europan 16, 5 Squares of new learning (Quelle: europan.at)

7.2.5 Messeareal
Langfristig können auf dem bestehenden Messeareal verschiedenste Flächenpotentiale einer städtebaulich adäquaten Nutzung zugeführt werden. Dies betrifft vor allem die Flächen im Anschluss an die Rosentaler Straße / Florian-Gröger-Straße (Gaudepark, Fertighauszentrum) sowie die Flächen im Bereich St. Ruprechter Straße / Valentin-Leitgeb-Straße (Strasser Parkplatz). Wie bei größeren Bauvorhaben und Nutzungsänderungen üblich, sollte hierfür von Seiten der Stadt Klagenfurt ein städtebaulicher Wettbewerb ausgerufen werden, wobei das Areal aufgrund seiner Nähe zur Innenstadt bzw. zum Messegelände als Wohn- und Arbeitsquartier qualifiziert ist. Die Innenstadt wäre in rund 200 bis 400 m Luftliniendistanz zu erreichen und könnte direkt an den Hauptwegekorridor E (Gewerbezone Süd - St. Ruprecht - Innenstadt) angeschlossen werden.
7.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes
Zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens soll der Zugang zu anderen umweltschonenden Verkehrsmitteln (z.B. zum Radverleihsystemen Nextbike, zu Haltestellen des öffentlichen Verkehr, zu Carsharing Standplätzen, …) möglichst einfach und niederschwellig gestaltet werden. Kurze, direkte und attraktive fußläufige Verbindung zur nächsten Bus- oder S-Bahn-Haltestelle erhöhen maßgeblich die Attraktivität und Qualität des Umfeldes Vielfach ist eine Erhöhung des Anteils an Zu-Fuß-Gehenden an ein entsprechend leistungsfähiges und attraktives Angebot im öffentlichen Verkehr gebunden. Knotenpunkte im öffentlichen Verkehr müssen somit strategisch gut gelegen, fuß- und radfreundlich angebunden sowie attraktiv ausgestaltet werden.

Abbildung 7.7 Gestaltung Baumbachplatz
Multimodale Knoten können dabei neben der verbindenden Funktion zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln auch die Funktion von Aufenthalts- und Erholungsflächen einnehmen, welche an ein entsprechendes Wegenetz für Zu-Fuß-Gehende angebunden sind und dadurch wesentlich zu Attraktivität der Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende beitragen. Dadurch können multimodale Knoten zu Kernelemen-

ten des Wegenetzes für Zu-Fuß-Gehende werden, mit entsprechender Frequenz und einer entsprechenden Bedeutung für das unmittelbare Umfeld. Multimodale Knoten sollten deshalb adäquat gestaltet werden und zum Verweilen von Menschen einladen, wodurch sie eine wesentliche Grundlage für eine lebenswerte und urbane Stadt bilden In Klagenfurt wurden in den letzten Jahren einige multimodale Knotenpunkte umgesetzt (im Bereich „hi Harbach“, im Lakeside Park, am Baumbachplatz). Zur Verknüpfung der Verkehrsmittel und als Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot sollen weitere Mobilitätsknoten errichtet und attraktiv ausgestaltet werden. Insgesamt ist über ganz Klagenfurt hinweg ein Netz an multimodalen Knotenpunkten geplant, welche vor allem an wichtigen Umsteigerelationen im öffentlichen Verkehr (an S-Bahn-Haltestellen, Endhaltestellen der Bus-Hauptlinien, …) errichtet werden sollen. In der Abbildung 7 7 ist die Gestaltung des Baumbachplatzes als Beispiel für die Aufwertung des Umfeldes (durch Bepflanzung, Sitzgelegenheiten, attraktive Beleuchtung, …) dargestellt.
7.3.1 Klimafitte Gestaltung des Heiligengeistplatzes
Der Heiligengeistplatz gilt seit Jahrzehnten als „Dreh- und Angelpunkt“ des öffentlichen Personennahverkehrs im Herzen von Klagenfurt. Der innerstädtische KMG- Busbahnhof ist ein belebter Verkehrsknotenpunkt mit zahlreichen Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten. Die Attraktivierung des Busliniennetzes in Klagenfurt (Einführung eines 10- Minuten Taktes auf den fünf Hauptlinien im innerstädtischen Verkehr, 20- Minuten Takt auf den Nebenlinien, Umstellung auf eine abgasfreie Elektrobusflotte) erfordert die Neugestaltung des zentralen, innerstädtischen Umsteigepunktes am Heiligengeistplatz. Dazu ist eine neue Verkehrsorganisation notwendig.
Gleichzeitig erfolgt durch die Lilihill-Gruppe die Sanierung des als Quelle- oder Woolworth-Gebäude bezeichneten Gebäudes auf der Westseite des Platzes (Projekttitel „The Holly“). Die Synergien zur Großbaustelle der Lilihill-Gruppe möchte die Landeshauptstadt Klagenfurt bzw. die KMG (Klagenfurt Mobil Gmbh) nützen, um die Umgestaltung des Heiligengeistplatzes in Angriff zu nehmen Der Heiligengeistplatz soll im Zuge der Umgestaltung an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst und klimafit gestaltet werden. Versickerungsfähige Oberflächen, Grünflächen anhand des Schwammstadtprinzips sowie Dach- und Fassadenbegrünungen sollen für eine Qualitätserhöhung sorgen. Gleichzeitig soll der Platz auch als Aufenthaltsbereich für die Bevölkerung aufgewertet werden und die derzeit eher „ausladende“ Wirkung der versiegelten Flächen in eine nachhaltige urbane Qualität übergeführt werden, welche zukünftig auch als Aufenthalts- und Freizeitfläche genutzt werden kann (Aufenthaltsbereiche für alle Generationen, Sitzgelegenheiten, Spielbereiche, …)
Bei der Neugestaltung des Heiligengeistplatzes verschneiden sich die interdisziplinären Themen Klimawandel (mit -anpassung und -schutz) mit den Themen der Mobilität und der Grünraumgestaltung mit gesellschaftlichen Fragestellungen zur Erreichung einer hohen Lebensqualität, einer Attraktivierung des Platzes und einer Erhöhung der Nutzung durch die Bevölkerung. In die Planung des Platzes fließen zudem die Planungen der Bushaltestellen, die Planung des motorisierten Individualverkehrs (dieser wird weiter reduziert, da Straßen nur noch für Busse genutzt werden) und vor allem die Planung multimodaler Angebote am Platz und eine entsprechende Infrastruktur mit Durchwegungen für Fuß- und Radverkehr mit ein. Der geplante Mobilitätsknoten bietet Fahrradverleihsysteme, Paketboxen und Fahrradabstellanlagen an und soll ein zentrales Element am neugestalteten Platz sein.

Abbildung 7 8
Konzept für die Neugestaltung des Heiligengeistplatzes

Neben der Möglichkeit zur multimodalen Verknüpfung und Stärkung des Umweltverbundes kann die Neugestaltung des Heiligengeistplatzes auch eine Verbesserung der Fußgängerbeziehungen zwischen dem Kernbereich der Innenstadt und den Grün- und Parkflächen am Rand der Innenstadt bewirken. Durch die Sicherung der fußläufigen Beziehungen zwischen dem Alten Platz, dem Neuen Platz über die Park- und Grünfläche südlich des Landhauses (mit dem Kiki-Kogelnik-Brunnen) und den Heiligengeistplatz kann die unter 5.2.1 beschriebene „Trennung“ zwischen innerstädtischer Kernzone und am Rand gelegenen Grün- und Parkflächen vermindert werden. Gemeinsam mit der Umgestaltung des Pfarrplatzes und der Neugestaltung des Heuplatzes kann dadurch im Nordwesten der Innenstadt eine attraktive Durchwegung für Zu-Fuß-Gehende geschaffen werden Insgesamt entspricht das Projekt somit mehrfach den Zielsetzungen und Handlungsschwerpunkten des Masterplans Gehen.
7.3.2 Unterführung Ostbahnhof
Die Unterführung des Ostbahnhofes von Klagenfurt und damit die direkte Verbindung von der Mießtaler Straße in den Ortsteil St. Peter mit seinen Schulstandorten und Siedlungsbereichen stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme im Rahmen des Hauptkorridors D für die Zu-Fuß-Gehenden in Klagenfurt dar (von Ebenthal/Harbach über Fischl bzw. St. Peter, den Ostbahnhof und die Mießtaler Straße in die Innenstadt). Durch die Unterführung des Ostbahnhofes wird die Zugänglichkeit des Ostbahnhofes für die östlich der Bahn liegenden Schulstandorte (neue Mittelschule 6 und 10, Volksschule 8, zweisprachige Volksschule 24, adventistische Privatschule, Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für

Slowenen, zweisprachige Bundeshandelsakademie, …) und die umgebenden Nutzungen (SAK Fußballplatz, Beachvolleyballplatz, Sporthalle St. Peter, …) sowie die unterschiedlichen Siedlungsbereiche geschaffen bzw. erheblich verbessert. Dadurch sind keine Umwege mehr über die Unterführung in der St. Peter Straße oder über die Unterführung in der Völkermarkter Straße notwendig, welche vor allem in Richtung Ostbahnhof nur über eine mangelhafte Infrastruktur (entlang des Rudolfbahngürtels) verfügen.
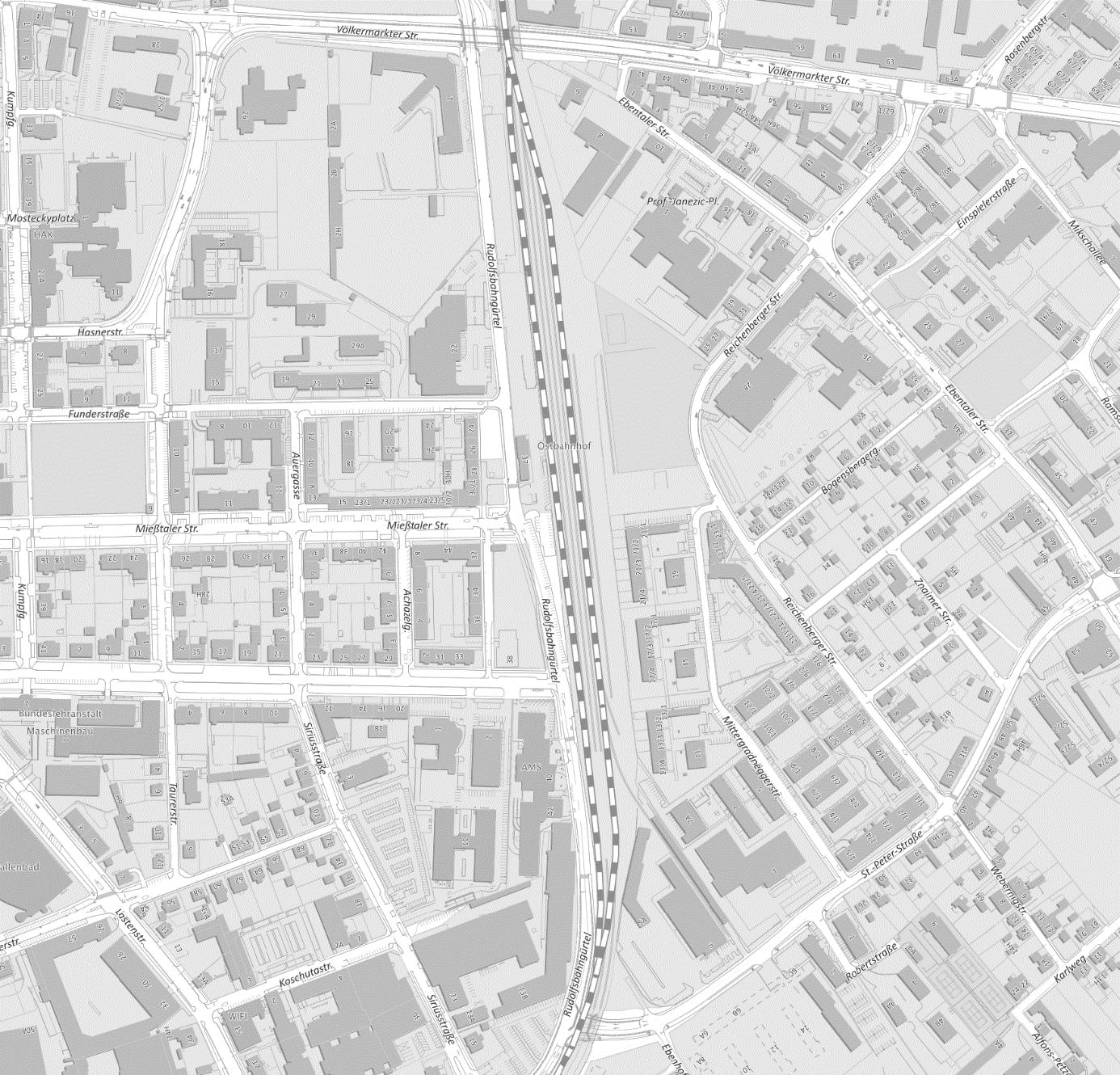
Unterführung Ostbahnhof
Abbildung 7 9 Systemskizze Unterführung Ostbahnhof
Neben der Aufschließung des zusätzlichen Fahrgastpotentials für den Ostbahnhof, kann durch die Unterführung für den nicht motorisierten Verkehr eine erhebliche Abkürzung zwischen den Ortsteilen St. Peter und Fischl (im Weiteren auch für den neuen Stadtteil „hi Harbach“ und die Nachbargemeinde

Unterführung Völkermarkter Straße
Unterführung St. Peter Straße
Schulstandorte
Ebenthal) erzielt werden. Um das Potential der Unterführung des Ostbahnhofes darzustellen und Verhandlungen mit den ÖBB, dem Land Kärnten bzw. sonstigen Förderstellen aufnehmen zu können, soll von Seiten des Magistrats Klagenfurt kurzfristig eine Potential- und Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Die konkrete Infrastrukturmaßnahme ist abhängig von den Gesprächen und den finanziellen Rahmenbedingungen mittel- bis langfristig zu erwarten.
7.3.3 Anbindung S-Bahn-Haltestelle Ebenthal
Die S-Bahn-Haltestelle Ebenthal liegt in unmittelbarer Nähe (Luftlinie rund 100 m) neben einem der größten Siedlungsgebiete in Klagenfurt (Fischl-Siedlung). Zukünftig wird über die Rosenegger Straße auch der Smart City Stadtteil „hi Harbach“ erschlossen. Die S-Bahn-Haltestelle ist derzeit jedoch nur über eine niveaugleiche Querung der Ebentaler Straße erreichbar. Der nächste Übergang (Schutzweg) liegt rund 250 m nordwestlich der S-Bahn-Haltestelle.

Siedlungsbereich Fischl
Siedlungsbereich „hi Harbach“
Schutzweg
Anbindung S-Bahn-Haltestelle
Abbildung 7 10 Systemskizze Anbindung S-Bahn-Haltestelle Ebenthal
Zur besseren Erreichbarkeit und leichteren Zugänglichkeit soll eine Fußgänger- und Radfahr- Brücke über die Ebentaler Straße errichtet werden, welche den direkten, barriere- und konfliktfreien Zugang zur S-Bahn-Haltestelle Ebenthal sichert. Derzeit ist eine Vorstudie (statische Prüfung, Kostenschätzung, …) in Ausarbeitung. Eine Umsetzung wird in den nächsten Jahren angestrebt, wodurch die Zugangsmöglichkeit zur S-Bahn-Haltestelle Ebenthal erheblich erleichtert wird. Das Projekt entspricht in mehreren Punkten den Zielsetzungen des Masterplans Gehen, da ein bestehendes Hindernis bzw. eine bestehende Barriere abgebaut, die Zuwegung zur S-Bahn-Haltestelle verbessert und verkürzt sowie eine multimodale Verknüpfung hergestellt wird. Des Weiteren kann die niveaufreie Anbindung als wichtige

Querungsmöglichkeit innerhalb des Hauptkorridors D (von Ebenthal/Harbach über Fischl bzw. St. Peter, den Ostbahnhof und die Mießtaler Straße in die Innenstadt) gesehen werden.
7.3.4 Verbindung S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West – Ostbucht
Ausgehend von der S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West können verschiedene Technologie-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen (Universität, Lakeside Park, …) sowie Freizeiteinrichtungen (Minimundus, Europapark, Ostbucht, …) aufgeschlossen werden (Hauptwegekorridor S3). Durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn wird die S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West zunehmend an Bedeutung gewinnen, da auch aus weiter entfernten Landesteilen bzw. der Steiermark mit sehr kurzer Fahrzeit zum Wörthersee zugefahren werden kann. Um das hohe Freizeitpotential in der Ostbucht aufzuschließen, soll eine barrierefreie Verbindung zwischen der S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West und der Ostbucht geschaffen werden, welche abseits der Hauptverkehrsroute (Villacher Straße, Anschlussstelle Minimundus, Südring, …) geführt wird und primär Zu-Fuß-Gehenden und Radfahrern zu Verfügung steht. Dazu ist im Westen der Haltestelle (bzw. des Bahnsteiges) ein direkter Zugang (Rampe, Stiege, …) auf die dort angrenzenden Grundstücke bzw. von diesen ein Zugang in die Unterführung des Autobahnzubringers erforderlich (siehe Systemskizze in Abbildung 7 11)

Abbildung 7 11 Systemskizze Verbindung S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West – Ostbucht
Im Rahmen der geplanten Verbauung der Grundstücke zwischen Villacher Straße und Bahntrasse wird mit Hilfe des abzuschließenden, städtebaulichen Vertrages die Freihaltung der Achse gesichert. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen am Ende des Bahnsteiges sollen gemeinsam mit den ÖBB er-

Verbindung S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West– Ostbucht
folgen, wobei zusätzlich auch eine direkte Verbindung in die Unterführung (über eine Stiege) anzudenken ist, da durch die derzeit bestehende Rampenführung teilweise längere Umwege in Kauf genommen werden müssen (Abbau von Hindernissen, …).
7.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
Um den Stellenwert, das Bewusstsein und die Präsenz des Zu-Fuß-Gehens in der Öffentlichkeit zu steigern sind bewusstseinsbildende Maßnahmen erforderlich Dabei geht es neben der reinen Information über die Vorteile des Zu-Fuß-Gehens auch um die Motivation und das Image des Zu-Fuß-Gehens.
Durch eine zielgruppengerechte Kommunikation und das Bewerben neuer Mobilitätsdienstleistungen in Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen der Stadtverwaltung, vor allem jedoch der Abteilungen Straßenbau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz und Stadtplanung soll ein Bewusstsein für den Fußverkehr, den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr aufgebaut und gepflegt werden Die Einbindung des Stadtmarketings, des Tourismusverbandes sowie anderer betroffener Interessensverbände (z.B. Blinden- und Sehbehindertenverband, Sportverbände …) kann dazu beitragen, das Bewusstsein in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl und das Mobilitätsverhalten sowie in Bezug auf Bewegung und Gesundheit zu steigern. Damit kein ein Beitrag zur vermehrten Nutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbunds sowie zur generellen Akzeptanz des Zu-Fuß-Gehens geleistet werden
7.4.1 KlagenfurtMobil App
Mit der KlagenfurtMobil App bietet die KMG (Klagenfurt Mobil GmbH) eine multimodale und flexible Routenauskunft an Neben aktuellen Informationen zu den Abfahrtszeiten der KMG Busse sind Routenauskünfte über die Verkehrsauskunft Österreich (VAO), der Kauf von Tickets sowie Informationen zu alternativen Mobilitätsformen wie dem Fahrradverleihsystem Nextbike oder zu Carsharing Angeboten verfügbar. Die KlagenfurtMobil App bietet darüber hinaus auch individuelle Anpassungsmöglichkeiten bei der Routenwahl, wie etwa die Festlegung der persönlichen Gehgeschwindigkeit und unterschiedliche Sortierungsmöglichkeiten bei der Routenauswahl (etwa auch den CO2-Ausstoß oder die Dauer).
Im Rahmen des Masterplans Gehen ist eine Integration der Hauptkorridore sowie der Freizeitwege in die KlagenfurtMobil App anzustreben. Dabei soll das Netz auch hinsichtlich seiner Barrierefreiheit klassifiziert werden, wodurch in weiterer Folge die Grundlagen für Routenvorschläge für verschiedene Nutzergruppen (Personen mit Rollstuhl/Gehhilfen, Kinderwagen, Sehbeeinträchtigung, Freizeit-Sparziergänger, Hundebesitzer, …) aufbereitet werden können
In Abstimmung mit dem Stadtmarketing und dem Tourismusverband ist zu diskutieren, ob z.B. Themenwanderwege (Altstandwanderung, …) bzw. Informationen zu lokalen Sehenswürdigkeiten in die KlagenfurtMobil App aufgenommen werden, damit für Besucher der Stadt neben einem umfangreichen Fußgängerrouting auch ein Mehrwert an Informationen geboten werden kann.
7.4.2 Beschilderung des Hauptwegenetzes
Um den Verlauf des Hauptwegenetzes vor Ort sichtbar zu machen, soll das bestehende Leitsystem (gelbe Hinweistafeln des Stadtgartenamtes) entlang der Hauptkorridore ergänzt werden Dabei sollen verstärkt auch Verknüpfungen zu anderen Mobilitätsformen miteinbezogen und berücksichtigt werden (Hauptbahnhof, S-Bahn-Haltestellen, …).

Insbesondere für Besucher sollten in Kooperation mit dem Stadtmarketing, dem Tourismusverband wie auch anderen betroffenen Interessensverbände gedruckte Stadtpläne aus Papier aufgelegt werden und den Beherbergungsbetrieben zur Verfügung gestellt werden. Die Gestaltung des Stadtplans für die unterschiedlichen Nutzergruppen soll dabei vor allem den Fokus auf den Fußverkehr (z.B. Fußgängerzonen, Begegnungsräume, Grünräume, …), den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr (Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Liniennetzplan) anstatt auf den motorisierten Verkehr (Zufahrtsstraßen, Tiefgaragen, Kurzparkzonen, …) legen und durch die Prioritätensetzung einen neuen Blickwinkel auf die Stadt Klagenfurt ermöglichen In den Stadtplänen soll in Bezug auf das Zu-Fuß-Gehen das beschilderte Hauptwegenetz abgebildet sein
7.4.3 Instandhaltung und Pflege
Um das Gehwegenetz für alle Nutzergruppen (vor allem jedoch mobilitätseingeschränkte Personen) ständig zugänglich zu halten, erfolgen regelmäßige Inspektionen und Instandhaltung, wodurch evtl. Gefahrenstellen oder Gefahrenpotentiale (z.B. in den Gehweg hereinhängende Äste, Müll, …) beseitigt werden können. Auch das Netz an Wegweisern wird regelmäßig inspiziert und aktualisiert, wobei hier auf die verschiedensten Kommunikationskanäle (über Apps, lokale Wegweiser, …) Rücksicht genommen wird. Diese Tätigkeiten werden im Rahmen der üblichen Inspektions- und Instandhaltungstätigkeiten durchgeführt.

8
Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Masterplan Gehen Klagenfurt, welcher in Abstimmung bzw. aufbauend auf dem Masterplan Radfahren Klagenfurt (PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH, 2018) bzw. dem Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV (Traffix Verkehrsplanungs GmbH, 2019) erstellt worden ist, sollen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein weiteres Verkehrsmittel im Umweltverbund zu stärken und dadurch den motorisierten Individualverkehr zu verringern.
Der Masterplan Gehen beschäftigt sich neben der Beschreibung wichtiger Rahmenbedingungen in Bezug auf das Zu-Fuß-Gehen, der Ableitung von Zielvorgaben auf regionaler bzw. lokaler Ebene, der Darstellung von Good-Practice-Beispielen und der Analyse der bestehenden Situation in Klagenfurt mit der Definition von allgemeinen Handlungsschwerpunkten und generellen Strategien sowie konkreten Maßnahmen und Leitprojekten zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens in Klagenfurt.
Handlungsschwerpunkte und generelle Strategien
Mit den Handlungsschwerpunkten und generellen Strategien wird ein allgemeines Leitbild für das ZuFuß-Gehen in der Stadt Klagenfurt vorgegeben und allgemeine Möglichkeiten zur Förderung des ZuFuß-Gehens beschrieben Viele Bereiche sind unmittelbar miteinander verknüpft oder bedingen einander sogar. Die allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Strategien sollen bei konkreten Projektumsetzungen, bei „Sanierungen“ im Bestand aber auch grundsätzlich zur Förderung des ZuFuß-Gehens in Klagenfurt immer und laufend berücksichtigt werden. Das übergeordnete Ziel der in vier Handlungsfelder unterteilten Handlungsschwerpunkte und generellen Strategien ist die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für das Zu-Fuß-Gehen in Klagenfurt
Tabelle 8 1 Handlungsschwerpunkte und generelle Strategien zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
Definition eines Hauptwegenetzes für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt
Hauptwegenetz entlang der Wunschlinien des Verkehrs; Flaniermeilen und Boulevards für Aufenthalt und Freizeit, z.B. Sportachse, Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse West, Bahnhofstraße, Hindernisse und Barrieren entschärfen
Vermeiden von Umwegen oder Steigungen, komplizierten Verkehrslösungen, langen Wartezeiten durch natürliche und/oder künstliche Hindernisse, z.B. Unterführung Ostbahnhof, Verbindung zwischen Haltestelle Klagenfurt West und Ostbucht, Anbindung Haltestelle Ebenthal an FischlSiedlung, barrierefreie Gestaltung des Heinzelstegs, Plätze und Fußgängerbereiche/Fußgängerzonen angemessen gestalten
„schöne“ Gestaltung unter Miteinbeziehung des angrenzenden Raumes, anderer Verkehrsträger und Nutzungsansprüche an Aufenthalt, Erholung, Grünraum, Kinderspiel, usw., Nutzungen umverteilen, z.B. im Bereich der Innenstadtplätze, bei Plätzen und Grünanlagen in Wohn- und Siedlungsbereichen,
Durchwegung sichern und ausbauen öffentliche Durchgangsrechte, Wunschlinien aus Trampelpfaden, Planungs- und Genehmigungshoheit nutzen, z.B. durch Öffnung der Höfe im Bereich der Innenstadt, durch Öffnung „privater“ Wohn- und Siedlungsbereiche, städtebauliche Verträge, …
Sicherheit erhöhen, Unfallfurcht vermindern

Verkehrsunfälle reduzieren, Unfallfurcht vermindern, Übersichtlichkeit herstellen, Angsträume beseitigen, Querungswege verkürzen, z.B. Ringquerung im Bereich der Döllingerstiege, Verbindung zwischen Lidmanskygasse und Funderstraße über den Völkermarkter Ring,
Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
Fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung ermöglichen
Stadterweiterungs- und Entwicklungsgebiete auf Umweltverbund ausrichten, verkehrsberuhigende Maßnahmen setzen, Aufenthaltsfunktion im öffentlichen Raum gewährleisten, z.B. durch städtebauliche Verträge, Verkehrsberuhigung in dörflichen Strukturen, attraktives Wohnumfeld schaffen
Begegnung ermöglichen, Flächen nutzungsgerecht gestalten, Straßenkreuzungen überschaubarer machen, z.B. durch städtebauliche Verträge im Bereich Ringquartier, Wohnquartier „An der Glan, Bahnhofsviertel, Messeareal, Grünzüge vernetzen grünes Netz schaffen, fußläufige Erreichbarkeit und Vernetzung der Grünräume sichern, z.B. durch städtebauliche Verträge, Berücksichtigung der Grünzüge im Stadtentwicklungskonzept,
Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes Zuwegung zu Haltestellen optimieren und Aufenthaltsqualität erhöhen
komfortable Erreichbarkeit herstellen, attraktiven ÖV anbieten, z.B. durch Taktverdichtung im Busverkehr, Sicherung eines komfortablen Zugangs zu Haltestellen, z.B. zur Haltestelle Siebenbürgengasse vom neuen Geschäftszentrum in Viktring aus, Neugestaltung des Heiligengeistplatzes multimodale Mobilitätsknoten schaffen, ausbauen und vernetzen
Erweiterung des Netzes an multimodalen Knoten, Ermöglichung einer reibungslosen Mobilitätskette, Erweiterung der Klagenfurt Mobil App, z.B. städtebauliche Verträge, Nextbike-Stationen, Multimodalität in der Flächenverteilung
Begegnungsräume schaffen, Fußgängerzonen schaffen, Parkplätze reduzieren, Raum wiedergewinnen, z.B. im Bereich Pfarrplatz, Heuplatz, Kardinalsplatz, durch alternative Nutzungen von Stellplatzflächen, Flächenumverteilung z.B. in der Abstimmungsstraße, Am Birkengrund sowie allgemein bei überbreiten Straßenquerschnitten, Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
Image und Bewusstsein für den Fußverkehr aufbauen und pflegen
verwaltungsinterne Strukturen schaffen, abteilungsübergreifende Gremien, Weiterbildung und Information, z.B. durch Teilnahme an Fachtagungen, Walk Space, Mobilitätswoche, Fußverkehr richtig kommunizieren
Installation eines Leitsystems, schlüssige und durchdachte Wegweisung, Stadtpläne für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Verkehr, z.B. durch Beschilderung des Hauptwegenetzes, Stadtplan/-karte für Verkehrsmittel im Umweltverbund, Tourismuspläne, Gesundheit fördern Bewegung unterstützen, Bewegung im öffentlichen Raum ermöglichen, Alltags- und Freizeitwege kombinieren, z.B. im Bereich von Park- und Grünanlagen, öffentlichen Spielplätzen, … lokale Wirtschaft stärken
Einkaufen erleichtern, einladende Wegführungen (Boulevards, …), Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang, öffentliche Toiletten, … Öffentlichkeit einbinden
Kenntnisse von Anrainern und Nutzern berücksichtigen, Interessenverbände miteinbeziehen, Öffentlichkeit frühzeitig informieren, Akteure und Multiplikatoren aktivieren, z.B. durch Beteiligungsprozesse, wie bei der Gestaltung der Bahnhofstraße, …
Finanzierungsmöglichkeiten finden eigene Budgetmittel einsetzen, Fördermittel nutzen, z.B. im Rahmen des Förderprogramms klimaaktiv mobil Fußverkehr, … Betrieb, Instandhaltung und Pflege
Beleuchtung, Straßenreinigung, Hundekotentfernung, Müllentsorgung,

Leitprojekte und konkrete Maßnahmen
Aufbauend auf der Zustandsanalyse, der Zieldefinition und den allgemeinen Handlungsschwerpunkten und Strategien wurden in Abstimmung mit den zuständigen Planungsabteilungen (Klima- und Umweltschutz, Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr) konkrete Maßnahmen und Leitprojekte dargestellt, welche kurz-, mittel- und langfristig in Klagenfurt umgesetzt werden sollen Gleichzeitig wurden Umsetzungsprioritäten und entsprechende Rahmenbedingungen für die Umsetzung (z.B. finanzielle Mittelverfügbarkeit, Abstimmung mit Bauträgern, …) definiert, welche in Tabelle 8 2 zusammengefasst dargestellt sind. Vor allem den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen kommt hier eine hohe Wertigkeit zu, weil sie bereits in den nächsten Jahren sichtbar machen, dass der Stadt Klagenfurt die Förderung des Zu-Fuß-Gehens ein starkes Anliegen ist. Deutliche Verbesserungen für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt werden durch jene Projekte erreicht, welche eine hohe oder sehr hohe Umsetzungspriorität und somit einen hohen oder sehr hohen Stellenwert in Bezug auf die Förderung des Zu-Fuß-Gehens haben.
Tabelle 8.2 Leitprojekte und Prioritätenreihung durch die Fachabteilungen in Bezug auf die Dringlichkeit der Umsetzung zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens in Klagenfurt
Priorität Umsetzungszeitrahmen
Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende
Hauptwegenetz für Zu-Fuß-Gehende hoch
kurz- bis mittelfristige Etablierung und laufende Ergänzung bzw. Ausdehnung
Umgestaltung Pfarrplatz sehr hoch kurzfristig nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
Neugestaltung Heuplatz sehr hoch kurzfristig nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
Umgestaltung Kardinalsplatz mittel mittel- bis langfristig in Zusammenarbeit mit Bauträger
Verkehrsberuhigung und Gestaltung Bahnhofstraße
mittel
barrierefreie Gestaltung Heinzelsteg sehr hoch
Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege
Technologie-, Forschungs- und Bildungsachse West sehr hoch
mittel- bis langfristig zur Verbesserung der Lebens- und Umfeldqualität
kurz- bis mittelfristig nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
mittel- bis langfristig zur Verbesserung der Standort- und Umfeldqualität
Ringquartier hoch mittel- bis langfristig in Zusammenarbeit mit Bauträger und Projektwerber
Wohnquartier „An der Glan“ hoch kurz- bis mittelfristig in Zusammenarbeit mit Bauträger und Projektwerber
Bahnhofsviertel
mittel mittel- bis langfristig in Zusammenarbeit mit Bauträger und Grundeigentümer
Messerareal mittel mittel- bis langfristig
sehr hoher Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, sehr hohe Umsetzungspriorität hoher Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, hohe Umsetzungspriorität mittlerer Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, mittlere Umsetzungspriorität nach Maßgabe der finanziellen Mittel, Umsetzungswunsch bei Finanzierbarkeit

Priorität Umsetzungszeitrahmen
Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes
Klimafitte Gestaltung des Heiligengeistplatzes sehr hoch kurzfristig nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
Unterführung Ostbahnhof sehr hoch mittel- bis langfristig mit ÖBB, nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
Anbindung S-Bahn-Haltestelle Ebenthal hoch kurzfristig nach Maßgabe der finanziellen Mittelverfügbarkeit
Verbindung Klagenfurt West - Ostbucht hoch mittelfristig in Zusammenarbeit mit ÖBB, Bauträgern und Grundeigentümer
Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing
KlagenfurtMobil App hoch mittel- bis langfristig zur Verdeutlichung des Stellenwerts des Zu-Fuß-Gehens
Beschilderung des Hauptwegenetzes mittel mittel- bis langfristig, jedoch nicht prioritär
Instandhaltung und Pflege hoch laufend
sehr hoher Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, sehr hohe Umsetzungspriorität hoher Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, hohe Umsetzungspriorität mittlerer Stellenwert für die Fußverkehrsförderung in Klagenfurt, mittlere Umsetzungspriorität nach Maßgabe der finanziellen Mittel, Umsetzungswunsch bei Finanzierbarkeit
Im Rahmen der prioritäreren Leitprojekte soll verstärkt Wert darauf gelegt werden, das Zu-Fuß-Gehen im Bewusstsein der Klagenfurter Bevölkerung zu verankern. Letztendlich ist es das übergeordnete Ziel des Masterplans Gehen, das Zu-Fuß-Gehen als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren und „wiederzuentdecken“. Der beste Weg, das Bewusstsein für das Zu-Fuß-Gehen zu steigern, ist es sichtbar zu machen, durch entsprechend ausgestaltete Infrastruktur und Berücksichtigung in der Planung Da die Verkehrsmittelwahl zu einem großen Teil angebotsinduziert ist, kann davon ausgegangen werden, dass je nachdem wie gut und konkurrenzfähig (schnell, komfortabel, sicher, günstig und zuverlässig) das Angebot für die Zu-Fuß-Gehenden in Klagenfurt ist, desto stärker wird sich auch die Nachfrage entwickeln Dies kann auch von den Entscheidungsträgern in Klagenfurt aufgegriffen werden, um das Zu-Fuß-Gehen mit all seinen Vorteilen für die individuelle Gesundheit, die Umwelt, die Raumnutzung und auch die lokale Wirtschaft zu positionieren und dadurch langfristig eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens in Klagenfurt zu erreichen.
Dr. Wolfgang Hafner
Abt. Klima- und Umweltschutz Magistrat Klagenfurt
DI Robert Piechl
Abt. Stadtplanung Magistrat Klagenfurt
DI Alexander Sadila
Abt. Straßenbau und Verkehr Magistrat Klagenfurt

DI Thomas Klocker Geschäftsführer Triagonal GmbH
9
Anhang
9.1 Literatur- und Quellenverzeichnis
▪ Aktionsplan Mobilität Klagenfurt am Wörthersee: IBV-Fallast [2014]
▪ Masterplan Radfahren Klagenfurt: PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH [2018]
▪ Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV: Traffix Verkehrsplanung GmbH [2019]
▪ Mobilitätsverhalten in Kärnten – Mobilitätsstudie 2009: DI Erwin Franzl, DI Alexander Risser [2009]
▪ Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035 – MoMaK 2035: Amt der Kärntner Landesregierung [2016]
▪ Smart City Strategie Klagenfurt am Wörthersee: Magistrat der Stadt Klagenfurt [2019]
▪ Stadtentwicklungskonzept 2020+: Magistrat der Stadt Klagenfurt [2014]
▪ Weißbuch: Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem: Europäische Kommission [2011]
▪ Aktionsplan urbane Mobilität – Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Europäische Kommission [2009]
▪ Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen [2015]
▪ Landeshauptstädte Ranking – Ein Vergleich anhand sieben verkehrsrelevanter Kriterien: Greenpeace [2017], [2020]
▪ Fuß- und Radverkehrskonzept Bregenz: Besch und Partner KG [2019]
▪ Masterplan Gehen - Ein Wegweiser für Gemeinden: Land Salzburg [2021]
▪ Masterplan Gehen - Stadt Salzburg: Komobile Gmunden GmbH, Walk Space Mobilität [2021]
▪ Mobilitätsreport Wien: Mobilitätsagentur Wien GmbH [2019]
▪ Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie [2021]
▪ Masterplan Gehen - Strategie zur Förderung des FußgängerInnenverkehrs in Österreich: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie [2015]
▪ Schritte zur Einführung einer kommunalen Fußverkehrsstrategie - Handlungsleitfaden: Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e.V. [2018]
▪ Schulstraßen in Bozen: Metamorphosis. PowerPoint-Präsentation [2020]
▪ Leitfaden „Standards Fußverkehr“ - Teil 1 Trottoirbreiten: Stadt Zürich - Tiefbauamt [2020]
▪ Pontevedra – Better on foot: Concello de Pontevedra [2013]
▪ Fußverkehr in Zahlen - Daten, Fakten und Besonderheiten: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Walk-space.at [2012]
▪ Wie Städte die Mobilitätswende voranbringen: VCÖ – Schriftenreihe „Mobilität mit Zukunft“ [2019]
▪ Integrierte Flächenwidmungs‐ und Bebauungsplanung Wohnquartier „An der Glan“, Kundmachung Mag. Zl.:PL-34/869/2021, Lfd. Nr. 26/D5/2018: Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee [2022]
▪ Deliverable 4.4: Mobilitätskonzept: SLIKH- Smart Living in Klagenfurt Harbach, Smart Cities Demo 2016 – 8. Ausschreibung: FGM Forschungsgesellschaft Mobilität [2018]

▪ Projektbeschreibung für Förderansuchen des Programms Leuchttürme für resiliente Städte 2014 –Programm der Smart Cities Initiative des Klima- und Energiefonds, Projekt „Klimafitter HGP“ - Klimafitte Gestaltung des Heiligengeistplatzes zur Erhöhung der Resilienz und Aufenthaltsqualität: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Klima- und Umweltschutz et al. [2021]
▪ Vorentwurf Pfarrplatz Klagenfurt: Kastner ZT-GmbH, Baumschlagger & Hutter und Rajek Barosch Landschaftsarchitektur [2021]
▪ Konzept Heuplatz Klagenfurt: Rajek Barosch Landschaftsarchitektur [2020]
▪ Projekt Baumbachplatz, Lageplan: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Straßenbau und Verkehr [2021]
▪ Präsentation HI Harbach - Park und Promenade, Generationsübergreifender Erlebnisraum: Winkler Landschaftsarchitektur [2021]
Online-Quellen:
▪ Schulstraße - Wien zu Fuß: Mobilitätsagentur Wien https://www.wienzufuss.at/schulstrasse/
▪ Metrominuto - Pontevedra: https://metrominuto.pontevedra.gal/
▪ 15-Minute-Neighbourhoods in Ottawa: Ecology Ottawa https://www.ecologyottawa.ca/15minute_neighbourhoods
▪ 20-Minute Neighbourhoods in Melbourne: The State of Victoria Department of Environment, Land, Water and Planninghttps://www.planning.vic.gov.au/policy-and-strategy/planning-for-melbourne/plan-melbourne/20-minute-neighbourhoods
▪ Ljubljana und Gent: Da geht noch viel – Stadtmobilität im Wandel: Bernhard Hachleitner https://www.vcoe.at/news/details/da-geht-noch-viel-stadtmobilitaet-im-wandel
▪ Living Streets in Ghent: Citychangers, https://citychangers.org/the-streets-are-alive-in-ghent/
▪ 5 Squares of new learning: https://www.europan.at/e16/klagenfurt/winner.html, abgerufen am 18.01.2022
▪ Medieninformation Projekt Ringquartier, Mai 2020, https://www.kollitsch.eu/presse, abgerufen am 17.01.2022
▪ Online-Zeitungsartikel zu „metrominuto Pontevedra“: www.diariodepontevedra.es, abgerufen am 10.12.2021


Firmensitz Reininghauspark 5/3, 8020 Graz
Niederlassung Klagenfurt Markweg 4, 9073 Klagenfurt a. W.
