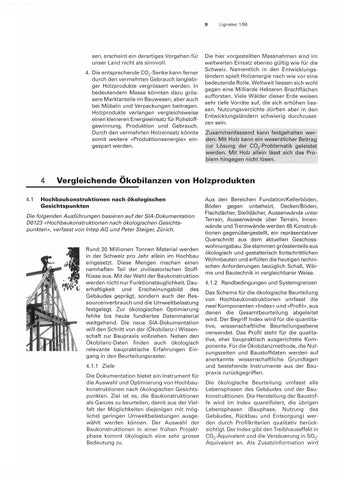9
sen, erscheint ein derartiges Vorgehen für unser Land nicht als sinnvoll. 4. Die entsprechende CO2-Senke kann ferner durch den vermehrten Gebrauch langlebiger Holzprodukte vergrössert werden. In bedeutendem Masse könnten dazu grössere Marktanteile im Bauwesen, aber auch bei Möbeln und Verpackungen beitragen. Holzprodukte verlangen vergleichsweise einen kleineren Energieeinsatz für Rohstoffgewinnung, Produktion und Gebrauch. Durch den vermehrten Holzeinsatz könnte somit weitere «Produktionsenergie» eingespart werden.
4 4.1
Lignatec 1/96
Die hier vorgestellten Massnahmen sind im weltweiten Einsatz ebenso gültig wie für die Schweiz. Namentlich in den Entwicklungsländern spielt Holzenergie nach wie vor eine bedeutende Rolle. Weltweit liessen sich wohl gegen eine Milliarde Hektaren Brachflächen aufforsten. Viele Wälder dieser Erde weisen sehr tiefe Vorräte auf, die sich erhöhen liessen. Nutzungsverzichte dürften aber in den Entwicklungsländern schwierig durchzusetzen sein. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Mit Holz kann ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der CO--Problematik geleistet werden. Mit Holz allein lässt sich das Problem hingegen nicht lösen.
Vergleichende Ökobilanzen von Holzprodukten
Hochbaukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten
Die folgenden Ausführungen basieren auf der SIA-Dokumentation D0123 «Hochbaukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten», verfasst von lntep AG und Peter Steiger, Zürich.
Rund 20 Millionen Tonnen Material werden in der Schweiz pro Jahr allein im Hochbau eingesetzt. Diese Mengen machen einen namhaften Teil der zivilisatorischen Stoffflüsse aus. Mit der Wahl der Baukonstruktion werden nicht nur Funktionstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Erscheinungsbild des Gebäudes geprägt, sondern auch der Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung festgelegt. Zur ökologischen Optimierung fehlte bis heute fundiertes Datenmaterial weitgehend. Die neue SIA-Dokumentation will den Schritt von der (Ökobilanz-) Wissenschaft zur Baupraxis vollziehen. Neben den Ökobilanz-Daten finden auch ökologisch relevante baupraktische Erfahrungen Eingang in den Beurteilungsraster. 4.1.1 Ziele Die Dokumentation bietet ein Instrument für die Auswahl und Optimierung von Hochbaukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, die Baukonstruktionen als Ganzes zu beurteilen, damit aus der Vielfalt der Möglichkeiten diejenigen mit möglichst geringen Umweltbelastungen ausgewählt werden können. Der Auswahl der Baukonstruktionen in einer frühen Projektphase kommt ökologisch eine sehr grosse Bedeutung zu.
Aus den Bereichen Fundation/Kellerböden, Böden gegen unbeheizt, Decken/Böden, Flachdächer, Steildächer, Aussenwände unter Terrain, Aussenwände über Terrain, Innenwände und Trennwände werden 65 Konstruktionen gegenübergestellt, ein repräsentativer Querschnitt aus dem aktuellen Geschosswohnungsbau. Sie stammen grösstenteils aus ökologisch und gestalterisch fortschrittlichen Wohnbauten und erfüllen die heutigen technischen Anforderungen bezüglich Schall, Wärme und Bautechnik in vergleichbarer Weise. 4.1.2 Randbedingungen und Systemgrenzen Das Schema für die ökologische Beurteilung von Hochbaukonstruktionen umfasst die zwei Komponenten «Index» und «Profil», aus denen die Gesamtbeurteilung abgeleitet wird. Der Begriff Index wird für die quantitative, wissenschaftliche Beurteilungsebene verwendet. Das Profil steht für die qualitative, eher baupraktisch ausgerichtete Komponente. Für die Okobilanzmethode, die Nutzungszeiten und Baustoffdaten werden auf anerkannte wissenschaftliche Grundlagen und bestehende Instrumente aus der Baupraxis zurückgegriffen. Die ökologische Beurteilung umfasst alle Lebensphasen des Gebäudes und der Baukonstruktionen. Die Herstellung der Baustoffe wird im Index quantifiziert, die übrigen Lebensphasen (Bauphase, Nutzung des Gebäudes, Rückbau und Entsorgung) werden durch Profilkriterien qualitativ berücksichtigt. Der Index gibt den Treibhauseffekt in CO2-Äquivalent und die Versäuerung in SO2Äquivalent an. Als Zusatzinformation wird