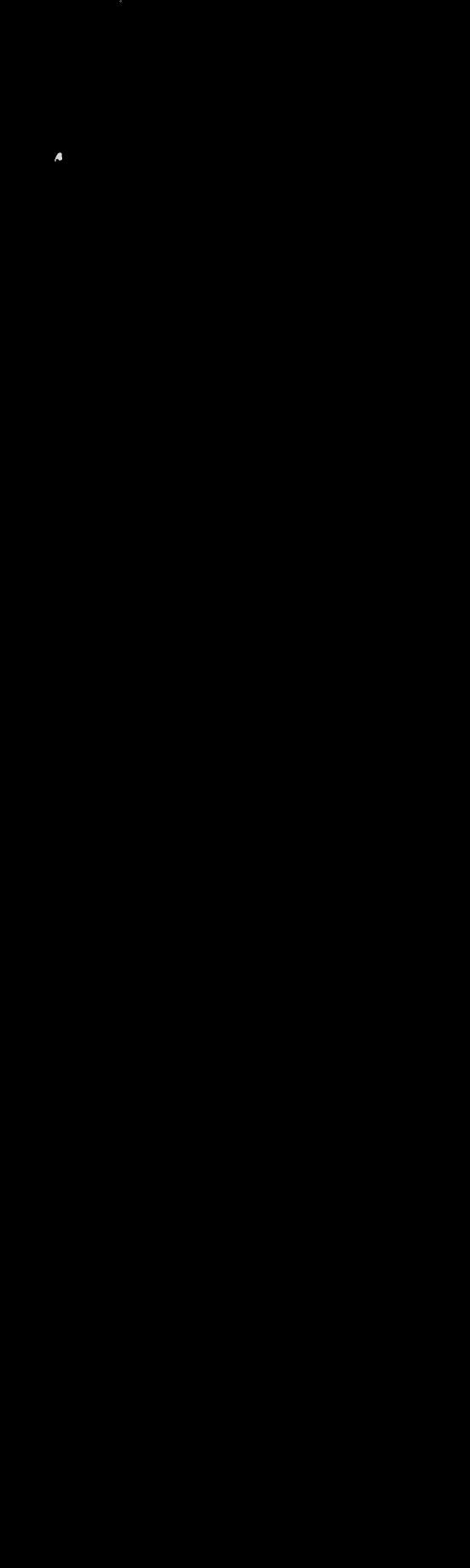
FLIEGEN LERNEN
Unsere neue Berufswahlrubrik
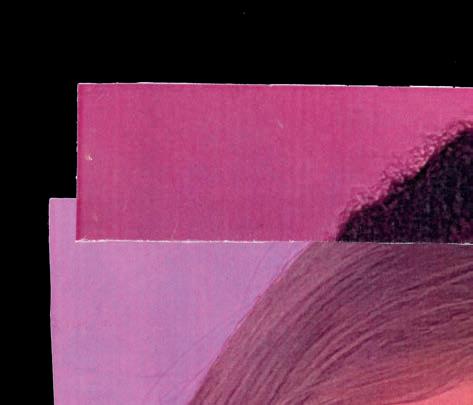
AUSSER KONTROLLE
Faktenchecker-Aus beim Meta-Konzern


TRUMP-LAND
Über den Wert der Demokratie
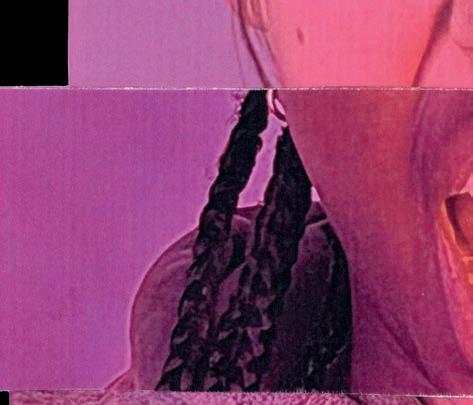
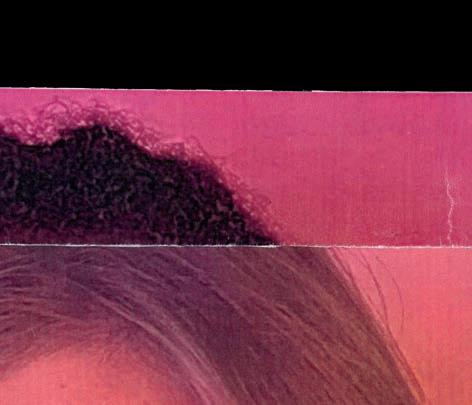


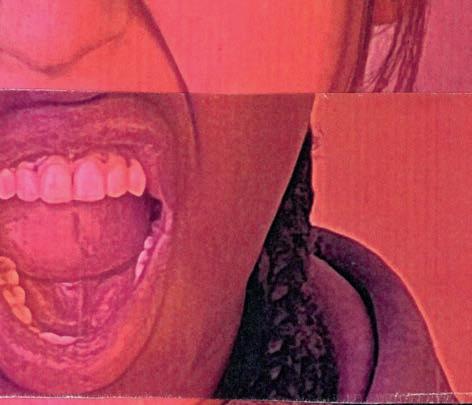

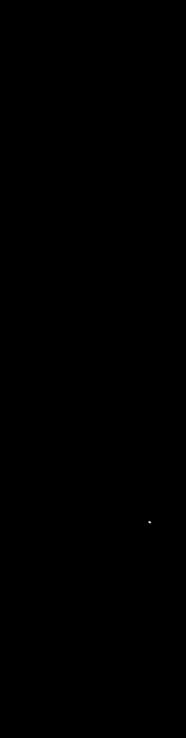

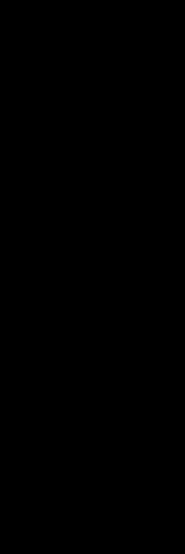
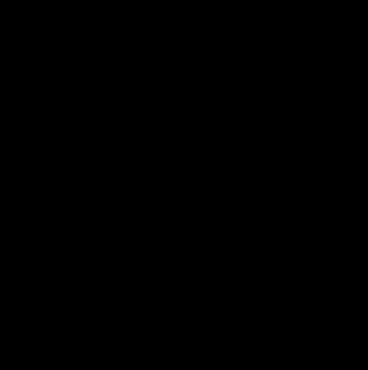
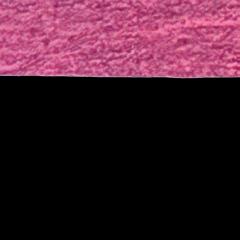
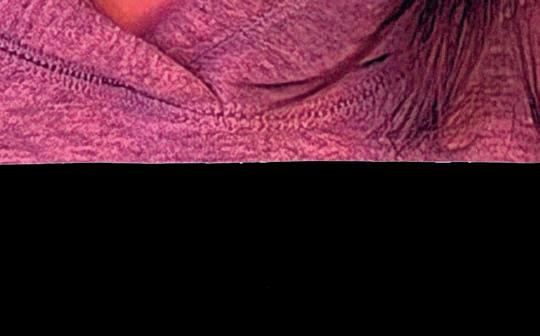
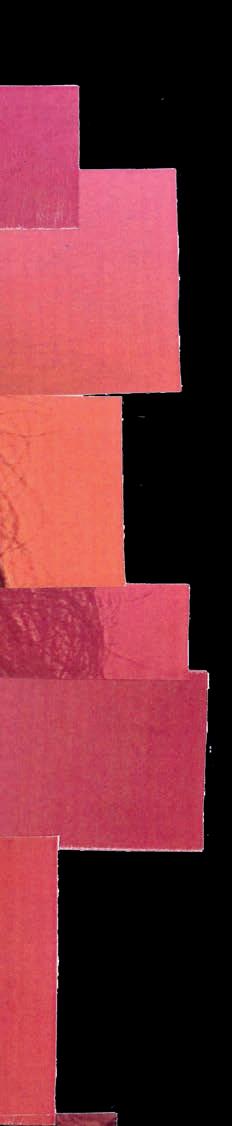

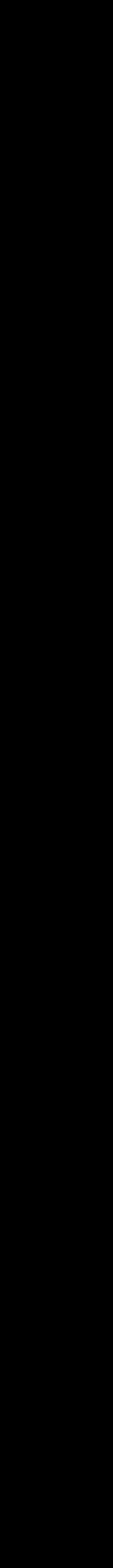

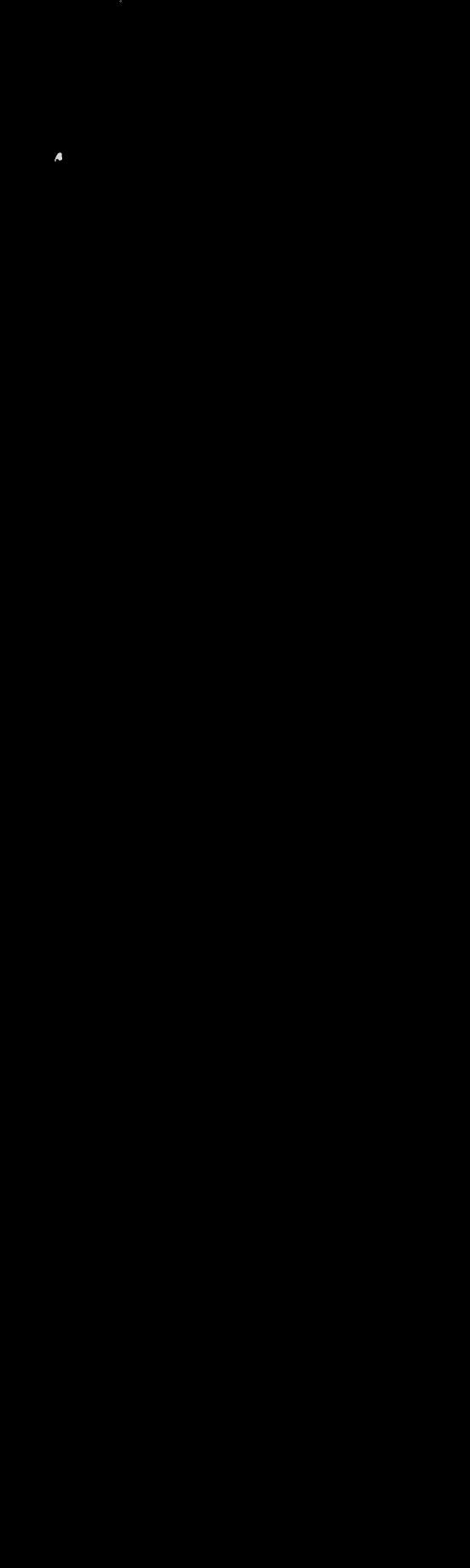
FLIEGEN LERNEN
Unsere neue Berufswahlrubrik
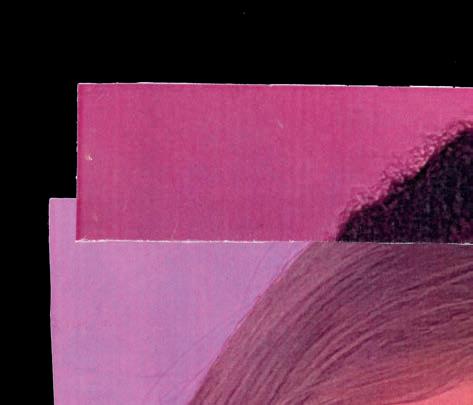
AUSSER KONTROLLE
Faktenchecker-Aus beim Meta-Konzern


TRUMP-LAND
Über den Wert der Demokratie
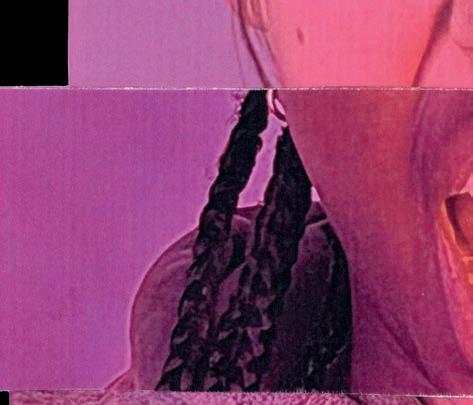
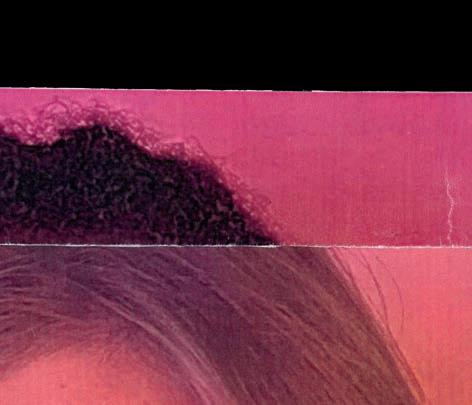


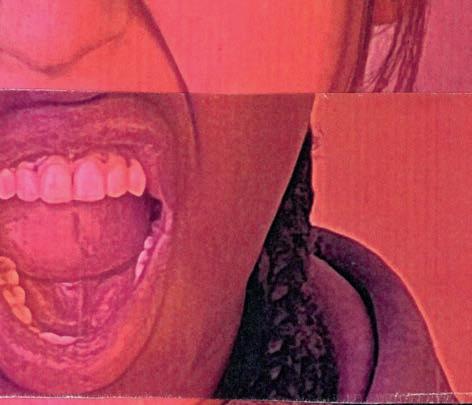

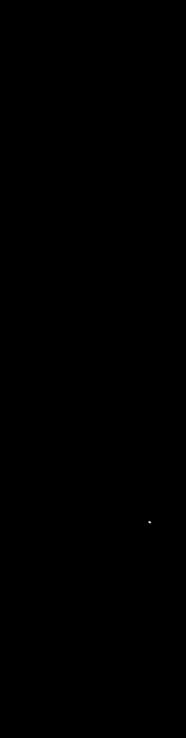

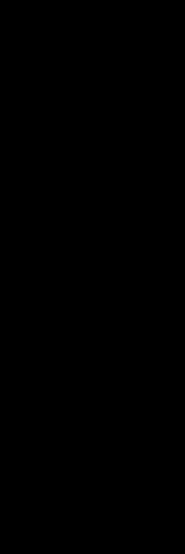
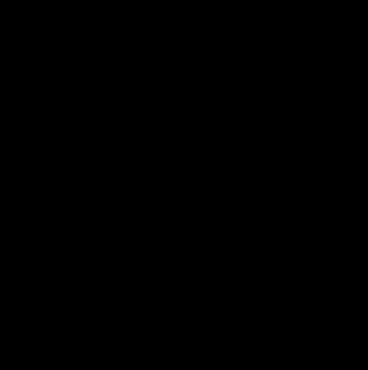
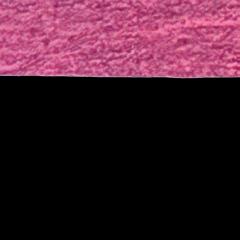
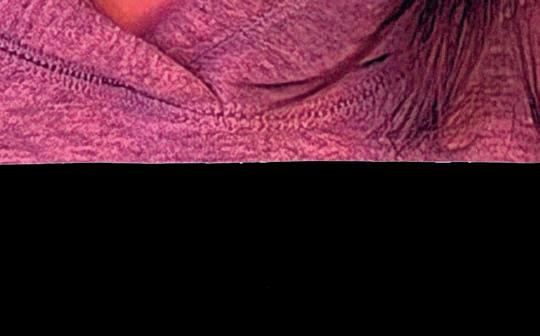
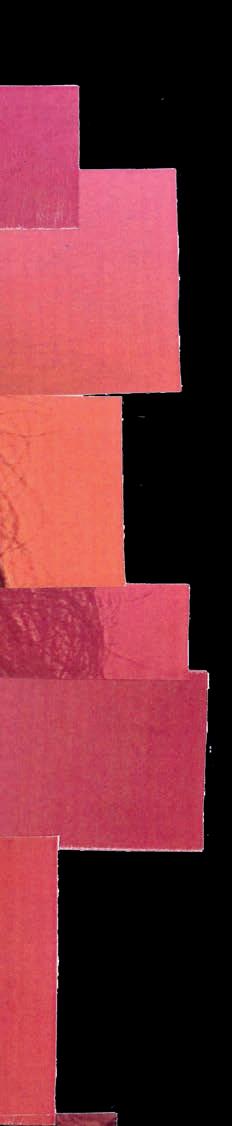

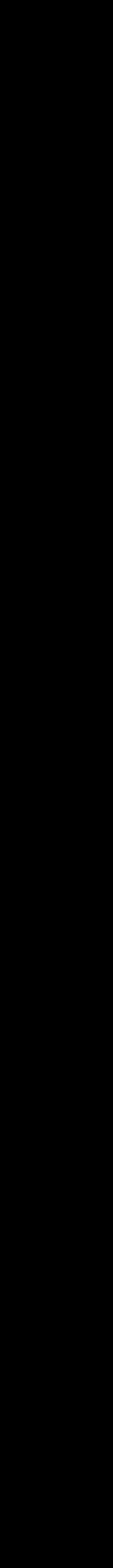
Dank der Beiträge, Spenden und dem Engagement unserer Mitglieder und Sponsoren konnte der Förderverein in den vergangenen Jahren zahlreiche kleinere und größere Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen des Schullebens unterstützen.
So helfen wir beispielsweise bei der Anschaffung von Lehrmaterialien und Veranstaltungstechnik, unterstützen Arbeitsgemeinschaften und Exkursionen und fördern mit regelmäßigen Zuwendungen die Schülerbibliothek sowie das Schülermagazin Leonarda.
Die vom Förderverein bereitgestellten Gelder kommen also direkt den Schülerinnen und Schülern des Leonardo-da-Vinci Gymnasiums zu Gute. Wir vom Förderverein laden Sie herzlich ein, mit uns zusammen für eine lebendige, moderne und attraktive Schule zu sorgen.




Wir freuen uns auf eine gemeinsame Unterstützung unserer Schule!

Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Köln-Nippes e.V. Blücherstraße 15-17, 50733 Köln
... , wo Angst, Lügen und Polarisierung Raum bekommen. Hass wird stets verwendet, um Ausschreitungen, Radikalisierung und Hetze anzutreiben und nimmt nicht ganz freiwillig einen immer größeren Platz in unserer Gesellschaft und somit auch in unserem Leben ein. Gerade weil Hass so präsent ist, müssen wir über ihn sprechen. Wir müssen verstehen, warum er entsteht, wer ihn nutzt und wie wir ihm begegnen können. Ignoranz ist keine Lösung. Wenn wir schweigen, überlassen wir das Feld denjenigen, die fragmentieren und manipulieren. Wir müssen Fronten abbauen und den Dialog lernen!
Anlässlich unserer letzten Ausgabe zum Thema „Liebe“ haben wir uns diesmal ganz bewusst dem Thema „Hass” gewidmet. Während Liebe oft idealisiert wird, bleibt Hass ein Tabuthema. Jedoch lässt sich Hass nicht nur als Gegenstück zur Liebe verstehen, sondern auch als ihr untrennbarer Begleiter. Besonders während unserer Schulzeit sind wir immer öfter mit Hass und Liebe konfrontiert. Zwei natürliche Aspekte, mit denen der Umgang in jungen Jahren schwerfallen kann. Hass hatte schon immer auch eine politische Dimension, die sich im aktuellen Diskurs immer öfter zeigt und die Gesellschaft spaltet, wobei soziale Medien keine unwichtige Rolle spielen. Diese Polarisierung verunsichert viele Jugendliche und führt unter anderem zu einem wachsenden politischen Interesse. In einer Gesellschaft, in der das gegenseitige Zuhören zunehmend an Relevanz verliert, darf Schwarz-Weiß-Denken nicht die Oberhand gewinnen.
Alle Menschen teilen, unabhängig ihrer Identität und politischen Ausrichtung, die gleichen Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Freiheit und Respekt. Lediglich die Vorstellungen darüber, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden können, gehen auseinander.
Trotz abweichender Weltanschauungen sollte man versuchen, andere Standpunkte und Perspektiven nachzuvollziehen, um eine zivilisierte Diskussion zu ermöglichen.
GESELLSCHAFT
Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2024/2025
In diesem Heft beleuchten wir unter anderem, wie Hass auf sozialen Medien verbreitet wird, wie man Fake News erkennt und wie das Faktenchecker-Aus bei META diese befeuert, was Jugendliche über die derzeitige Situation in den USA denken und warum sich „Gastarbeiter” in Deutschland heimatlos fühlen.
In einer Gesellschaft, wo Hetze oft lauter ist als Vernunft und Verständnis, ist es wichtig, ein gemeinschaftliches Umfeld zu fördern und im Einklang mit Menschlichkeit und Mitgefühl zu handeln.
Somit braucht es Solidarität und Zivilcourage. In Gesprächen, in sozialen Netzwerken, im Alltag. Unser Ziel ist es nicht, einfache Antworten zu liefern. Wir wollen eine Debatte anstoßen. Eine, die uns alle betrifft. Denn die Wahl zwischen Liebe und Hass ist keine abstrakte Frage. Sie begegnet uns in jeder Interaktion, jedem Wort, jeder Handlung.
Eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen.




01/2025
6 Wir stellen uns vor
8 Hass ist keine Meinung!
Eine Aktion des Kunst-GKs Q2
9 Unsere Demokratie braucht uns alle Rechtsextremismus-Ausstellung am LdV

Verantwortung
Wie sich Hassbotschaften in sozialen Medien verbreiten
12 Schon mal Hass erlebt?
Wir haben uns auf unserem Sommerfest umgehört
14 Just for fun?!
Vandalismus an unserer Schule
15 Falschnachrichten
Wie du sie erkennst
16 Bühne frei für Fake News
Zum Faktenchecker-Aus bei META
19 Werde ich gerade manipuliert?
Einblick in die Arbeit des #Faktenfuchs 3
22 Blicke in den Abgrund
Aktuelle Werke unseres KunstLKs zum Thema Hass
28 Stop hate!
Die Siegerinnen unseres diesjährigen Projekt-Wettbewerbs
30 Kein innerer Frieden
Wir sind nicht machtlos gegen Hass
32 Schulprojekt „aula“
Was kaputte Schultoiletten mit Demokratie zu tun haben
34 Heimweh und Schuften
Warum Deutschland für viele „Gastarbeiter“ nicht zur Heimat werden konnte
36 Zerrissenes Land
Live von den US-Wahlen
39 Trump-Land
Liam (19 J.) aus Virginia über die USA nach den Wahlen
41 Kinderrechteschulen
Schon mal gehört?
COURAGE
42 Mut zeigen
Das neue Fach Zivilcourage
43 Mehr als spielen
Die Courage-AG am Schulfest
44 DazugeHören
Hip-Hop gegen Diskriminierung
POLITIK UND GESELLSCHAFT
46 Politik ist langweilig? Von wegen!
Die Juniorwahlen 2024 und 2025 am LdV
48 Leben und Wirken eines Revolutionärs Thomas Sankara aus Burkina Faso
50 Cool oder gefährlich?
Zum Trend von E-Zigaretten
52 Endstation Sucht Interview mit einer Anonymen Alkoholikerin
54 KVB in der Dauerkrise
Unser Autor erklärt, wie auch Fahrgäste dazu beitragen

55 Klauen statt kaufen Kriminalität in Nippeser Läden und Julia wegen Aulasperrung
60 Galerie Leonardo 2025
Die diesjährige Vernissage der Kunstkurse
62 Für Leseratten

Zwei geheimnisvolle Fortsetzungsgeschichten WAS IST...?
66 ... eigentlich ein Reichsbürger?
Unser Autor klärt auf KOLUMNE
67 Teuer, teurer, Profifußball
68 Doch den richtigen
Job gefunden!
Frau Czarnetzki im Interview
SCHULFAHRTEN UND AUSTAUSCHE
70 Ein Schul(halb)jahr in der weiten Welt Vier von uns haben es gewagt!
74 Wie die alten Römer
Tagesausflug nach Xanten
75 Savoir vivre à Paris
Eine Woche in Frankreich
76 Abenteuer
Südafrika
Zwei Wochen in Pretoria
77 Bienvenidos a Barcelona
Fünf Tage in Spanien
78 Wie das Unbegreifliche begreifen?
Nachdenkliche Tage in Dachau und München

80 Tod aus Kummer
Ein Nashorn als Zeuge der NSTötungsmaschinerie
82 Mit dem Leben bezahlt
Eine Ausstellung über Held:innen des Widerstands gegen das NS-Regime
84 Wie entstehen Nachrichten?
Ein Webinar mit Logo!
86 Brücken bauen
Die Interreligösen Feiern am LdV
88 Jecke Friedenstauben Das LdV beim Nippeser Zug

89 Gestalte unsere Schule mit!
Jahresbericht und Pläne der SV
90 Zeit für Grünes
Die Garten-AG des LdV
91 Proben für den Ernstfall
Die Sani-AG des LdV
93 Elektroschrott ist nichts für die Tonne
Die 7C hat E-Waste gesammelt

LK-WAHLOMAT
94 Wie gestern und morgen zusammenhängen
Der Geschichts-LK
EX-LEOS – WAS JETZT?
96 Macht euch nicht den Mega-Stress!
Im Gespräch mit Laura Rynkiewicz, Lars Beier und Nino Nicodemo
WEGE IN DEN BERUF
100 Chancen des Neuanfangs Medizinstudium
101 Auf Augenhöhe im Flugkontrollzentrum Flugdatenbearbeiterin
MITMACH-SEITE
102 Rätsel
QUELLENVERZEICHNIS
103 Quellennachweise
Die Leonarda ist mehr als nur ein Heft! Du findest uns außerdem in deinem Browser und auf Instagram über die unten angegebenen Links. Schickt uns gerne auch Feedback, Fragen oder Anregungen über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite.

leonarda.koeln

instagram.com/ leonarda.ldv
Impressum
ANSCHRIFT
Leonarda - Schüler:innenmagazin
Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Nippes
Blücherstraße 15-17
50733, Köln
E-Mail: info@leonarda.koeln
Internet: www.leonarda.koeln
GRÜNDUNG
September 2021
CHEFREDAKTION
Jana Stojceska, Veit Brungs, Luc Aydogan Müller-Harmandali, Jannis Ihmels
REDAKTION
Emily Zeinar, Klara Dörrwächter, Ayda Savluk, Marta Brungs, Mina Njio, Hanna Vollmer, Anton Schwinden, Ceyda Nur Taka, Rifat Taka, Leni Pooth, Mieke Oetzel, Marlene Katharina Küppers, Alva Wergen, Tami von Cysewski
BERATER/ EX-LEO
Nino Nicodemo (Gründungsmitglied), Lars Beier
KOORDINATION
Dr. Julia Gramberg de Mendoza, Ricarda Langen
VERANTWORTLICHE/AUTOR:INNEN DES RESSORTS
TITELTHEMA: Kunst-GK (Toen), Leni Bodenstein, Veit Brungs, Hanna Vollmer, Ayda Savluk, Tim Luca Unger, Maren Königs, Tami von Cysewski, Kunst LK Q2 (Klu), Adeline Neuhaus, Ayla Basar, Hannah Mans, Erina Jasari, Jonas Stollwerk, Seval Naldelen, Emily Zeinar, Mina Njio
COURAGE: Ida Stüwe, Inela Sogorovic, Hannah Mans, Ayla Basar
POLITK UND GESELLSCHAFT: Anton Schwinden, Rifat Taka, Mieke Oetzel, Marlene Katharina Küppers, Jana Stojceska, Leni Pooth, Alva Wergen, Sashanth Dev Saravanan, Celina Hentschel, Dalelta Isaac
KUNST UND KULTUR: Emily Zeinar, Hannes Gawron, Kunstkurse des LdV, Luc Aydogan Müller-Harmandali, Pia Lehmbruck, Lena Große, Franziska Cichon, Eda Aksel, Violetta Krämer
WAS IST...?: Kaan Savluk
KOLUMNE: Jannis Ihmels, Ceylin Eroglu, Elisa Schiel
IM GESPRÄCH: Mieke Oetzel, Marlene Katharina Küppers
SCHULFAHRTEN UND AUSTAUSCHE: Emily Zeinar, Luc Aydogan Müller-Harmandali, Julia Heinicke, Charlotte von Mörs, Leni Neuefeind, Nellie Tesmer, Malina Bruning, Leni Pooth, Hannes Gawron, Mathilde Tödt, Anna Brunner, Lilo Schwetzel, Clara Schiel, Kian Cuhadaroglu,Tami von Cysewski
SCHULLEBEN: Lucia Oechelhaeuser, Seval Naldelen, Jana Stojceska, Veit Brungs, Jannis Ihmels, Luc Aydogan Müller-Harmandali, Agnes Burauer, Tim Luca Unger, Mieke Oetzel, Ceyda Nur Taka, Marlene Katharina Küppers, Anton Schwinden, Mathilda May, Lola Lucidi LK-WAHLOMAT: Klara Dörrwächter
EX-LEOS: Jana Stojeska, Laura Rynkiewicz, Lars Beier, Nino Nicodemo
WEGE IN DEN BERUF: Kaan Dinc, Lotte A. L. Matull
MITMACH-SEITE: Mieke Oetzel, Marlene Katharina Küppers
ANZEIGENKOORDINATION
Klara Dörrwächter
LEKTORAT
Dr. Julia Gramberg de Mendoza, Ricarda Langen
LAYOUT
Marta Brungs, Ayda Savluk, Ricarda Langen, Marcus Schmidt (Elternengagement)
Wir danken Pia Tönnesmann und Christof Klute für die anhaltende künstlerische Unterstützung der Leonarda, Jennifer BegicBetke für das Lektorat des englischsprachigen Interviews und der Übersetzung, Maximilian Guth für das Anwerben von Autor:innen sowie unserem Hausmeister Stefan Nowak für die Unterstützung unseres Projekts seit 2021. Ein ganz besonderer Dank gilt auch dem Förderverein!
Chefredaktion











Redaktion












Redakteurin im Auslandsjahr

Koordinierende Lehrkräfte und Elternengagement

Berater / Ex-Leo






Gründungsmitglied/ Berater


Fotos: Eigene Aufnahme
Eine Aktion vom Kunst-GK (Toen) | Q2
Im Arbeitskreis „Gemeinsam gegen Diskriminierung!“ entstand die Idee, ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Die Teilnehmer:innen des Kunst-Grundkurses 2 der Q2 sammelten hierzu verschiedene Sprüche, dessen Botschaften sie in der aktuellen Zeit als besonders wichtig empfinden. Inspiriert wurden die Sprüche auch von den Demos gegen Rechts, die in Köln in den letzten Wochen stattfanden. Es entstanden drei Banner, die im Endgeschoss unserer Schule in die Fenster gehängt wurden, sodass sie auch vom Leipziger Platz aus gut erkennbar sind.
Der Spruch verweist auf die historische Verantwortung, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und in der Gegenwart gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und andere Formen von Menschenfeindlichkeit einzutreten. Er spielt auf das Versprechen an, das nach den Verbrechen des Nationalsozialismus formuliert wurde: „Nie wieder“ – also nie wieder Faschismus, nie wieder Holocaust.
Der Spruch betont, dass Hassrede nicht unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit fällt. Während demokratische Gesellschaften unterschiedliche Meinungen schützen, endet dieser Schutz dort, wo Äußerungen andere Menschen oder Gruppen abwerten, diskriminieren oder zu Gewalt aufrufen. Die Aussage kritisiert insbesondere die Rechtfertigung von Hass als vermeintlich legitime Meinungsäußerung und unterstreicht die Verantwortung, gegen menschenfeindliche Rhetorik und Hetze vorzugehen.
Der Spruch betont die Bedeutung von Zusammenhalt und aktivem Engagement für demokratische Werte. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert die Beteiligung und den Einsatz aller, um Grundrechte, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Die Aussage ruft dazu auf, sich gegen antidemokratische Strömungen zu stellen und sich für eine offene, pluralistische Gesellschaft einzusetzen. Sie signalisiert, dass Demokratie nur durch gemeinsames Handeln und gegenseitigen Respekt gestärkt und verteidigt werden kann.


Foto: Eigene Aufnahme
RECHTSEXTREMISMUS GEHT UNS ALLE AN!
von Leni Bodenstein | 9A
Wir sprechen im Geschichtsunterricht von Zeiten, in denen Ausgrenzung, Verfolgung und Diktatur zum Alltag gehören. Doch könnte so eine Zeit wiederkommen? Gehen wir schon darauf zu? Das sind Fragen, die mir während der Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ durch den Kopf gegangen sind. Die Ausstellung mit Informationstisch, Informationsbannern und Vortrag hat mir nochmal deutlich gezeigt: Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich und es sollte uns alle interessieren, sie zu schützen und zu verteidigen. Menschen werden wegen ihrer Meinung, Herkunft oder Religion angefeindet. Im Internet bekommen rechtsextreme Videos über 900.000 Likes. Hate Speech wird im Netz verbreitet.
Kann man auf rechtsextreme und intolerante Meinungen überhaupt gut und mit Respekt reagieren?
Eine mögliche Antwort wurde uns von dem Philosophen Karl Popper in einem Video präsentiert: Seiner Meinung nach sollte eine tolerante Gesellschaft nicht alles akzeptieren, auch keine intoleranten Meinungen. Toleranz bedeutet, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Das nennt man auch das „Paradoxon der Toleranz“ und hat mich auch
nachdenken lassen, ob wir es als tolerante Menschen immer völlig schaffen, gegen Intoleranz und Rechtsextremismus vorzugehen. Wie oft ignorieren wir Hassnachrichten im Netz? Wie oft schauen wir weg, wenn jemand ausgeschlossen oder beleidigt wird? In der Präsentation wurden auch Beispiele von jungen Menschen dargestellt, die so etwas schon erlebt haben.
Die Ausstellung hat mich nochmal daran erinnert, dass wir mehr über Themen dieser Art informieren und nachdenken sollten. Sind wir - auch als junge Generation - schon fähig, etwas zu verändern? Wie viel Verantwortung haben wir gegenüber der Demokratie?
Demokratie und Werte betreffen nicht nur Politiker und Erwachsene. Sie betreffen uns alle und wenn wir nicht für Werte wie Respekt, Vielfalt und Gleichberechtigung einstehen, kann die Demokratie, wie wir sie heute kennen, später vielleicht nicht mehr funktionieren. Auch wir können unsere Zukunft mitgestalten – und es nicht denen überlassen, die Hass und Ausgrenzung verbreiten.
Denn eine bestehende Demokratie benötigt Menschen, die dafür kämpfen.








von Veit Brungs | 10D

In einem Zeitalter, in dem praktisch jede:r ein digitales Medium nutzt, jede:r Zugriff auf eine Welt hat, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem eigenen Leben steht, ist eine massenhafte Nutzung von sozialen Netzwerken schwer vermeidbar geworden. Doch neben positiven Einflüssen wie zum Beispiel Videos, die zur Fortbildung dienen, Katzenvideos oder „Memes“ werden Konsumenten allzu oft sowohl indirekt als auch direkt mit negativen Inhalten konfrontiert.
WIE ENTSTEHEN NEGATIVE BEITRÄGE IN SOZIALEN MEDIEN?
Soziale Netzwerke und Plattformen werden von immer größeren und vor allem immer jüngeren Teilen unserer Gesellschaft genutzt. Der anfänglich positive Aspekt, dass sie einen großen Einfluss auf die charakterliche Entwicklung und Bildung der nächsten Generationen haben, vor allem wenn bei Einzelnen in bestimmten Themen ein Bildungsbedarf besteht, nimmt eine drastische Wendung, wenn nicht nur informativen oder zur Unterhaltung dienenden Kanälen eine Plattform geboten wird, sondern sich auch Hetze, Radikalität und Gewalt in enorm schneller Geschwindigkeit und in einem optimal für die Zielgruppen aufbereiteten Rahmen verbreiten und etablieren können. Was also normalerweise in einem viel kleineren Umfeld bleiben würde, kann sich hier erst vollständig entfalten und die Erschaffer der Inhalte dürften sich durch die Aufmerksamkeit auch noch in ihrem Handeln bekräftigt fühlen.
WAS SPIELEN KOMMENTARSEKTIONEN BEI DER POLARISIERUNG DER GESELLSCHAFT FÜR EINE ROLLE?
Doch nicht nur in medialen Beiträgen finden sich immer öfter spaltende und von Hass getriebene Inhalte. Auch in Kommentarsektionen oder Chatfunktionen auf verschiedensten Plattformen bieten sich Räume für Gruppierungen, die eine große Gefahr für Jugendliche darstellen können, welche ein für sie vermeintlich geeignetes Umfeld suchen. Die suchenden Jugendlichen fühlen sich dann in diesen Gruppierungen willkommen und als Teil eines größeren Ganzen. Zugleich zeigen sie sich oft empfänglich für die Werte, die dort vermittelt werden. Bestimmte Kommentarspalten können sich von einer neutralen Diskussion in eine von Hass gezeichnete Ansammlung von Botschaften verwandeln. Bei Jugendlichen und auch Kindern, die dies im ersten Moment nicht kritisch hinterfragen und das Gefühl
von Zugehörigkeit suchen, kann dies ein falsches Machtgefühl vermitteln. Diese Bedingungen können stabile und besonders extremisierte Gruppenkonstrukte schaffen.
Etwas in irgendeiner Form Anstößiges, Konträres, Widriges im Netz wiederzugeben, fällt in einer solchen Gruppe “Gleichgesinnter” leichter als offline. Sich genau gegen diesen Mechanismus zu stellen, ist wichtiger denn je.
WIE BEEINFLUSSEN MEDIEN DIE MODERNE GESELLSCHAFT UND WELCHE VERANTWORTUNG
GEHT DAMIT EINHER?
In der heutigen Zeit kann wortwörtlich jeder seine Meinungen und Ideale im Netz hinterlassen und andere, vor allem jüngere Nutzer beeinflussen. Ich durfte in den letzten Jahren miterleben, wie die Sprache und auch diverse Handlungen in meinem Umfeld immer ausfallender, diskriminierender und grundsätzlich dissozialer geworden sind. Mir persönlich erschien es, als ob es zwischen meinem Umfeld vor der Pandemie und dem danach eine starke Entwicklung von einstigem Respekt hin zu Hetze gegeben hätte.
Laut aktueller Statistik der Tagesschau vom März 2025 gab es einen Anstieg in der Mediennutzung von 126 Prozent im Zeitraum zwischen 2019 und 2024. Durchschnittlich verbringen Jugendliche somit 157 Minuten pro Tag in sozialen Medien - ungefähr eine halbe Stunde mehr als vor der Pandemie.
Hinsichtlich dieser sich immer weiter zuspitzenden Problematik und dem Wachstum an Konsumenten wäre es dringend notwendig, Inhalte besser zu überwachen und für die Nutzer sicherer zu machen.
Außerdem wird es immer relevanter, Medienkompetenz in der Schulbildung so früh wie möglich zu etablieren, damit Kinder und Jugendliche sich gegenüber medialen Inhalten eine gesunde, vernünftige und kritische Haltung aneignen können. Möglicherweise sollte dies in Form eines neuen Unterrichtsfachs geschehen, das sogar schon in der Grundschule eingesetzt werden könnte. Neben dem Schulsystem sollten aber auch Eltern aufmerksamer werden. Denn die unbedachten Nutzer der digitalen Welt werden immer jünger und negative Konsequenzen für die Einzelnen und die Gesellschaft dürften leider nicht auf sich warten lassen…
Auf unserem Sommerfest am 07.09.2024 haben wir unsere Mitschüler:innen und ihre Familien zum Thema Hass und Beleidigungen befragt. Hier seht ihr, was sie geantwortet haben:
Wie alt bist du?
Warst du schon einmal von Hassrede oder Beleidigungen im Netz betroffen?














Glaubst du, dass es im Internet leichter fällt, Hass oder beleidigende Kommentare zu äußern?


Findest du, dass sich der Umgangston in deinem Lebensumfeld in den letzten Jahren verändert hat?






Was denkst du, aus welchen Gründen entsteht Hass vor allem?



























Möchtest du noch etwas zum Thema sagen?
Niemand sollte Hass verbreiten
Seid lieb zueinander
Macht das nicht!
Nicht hinter vermeintlicher Anonymität verstecken!
Gesamtgesellschaftlich ist der Umgangston rauer
mehr Respekt und Freundlichkeit wären wünschenswert
Hass verbreitet sich leider schneller als Liebe, weil er einfacher zu empfinden ist
Individualisierung ok, aber Solidarität darf nicht darunter leiden
möglichst immer neue und andere Menschengruppen kennenlernen, um Vorurteile abzubauen
Hass ist meiner Meinung nach eine normale Emotion, doch diese durch Diskriminierung auszudrücken ist nicht okay/ normal. Es gibt verschiedene Formen von Hassgesunde und ungesunde
Hass dient meist dem Verlangen, Unglück zu kompensieren
Mitwirkung für besseren Umgang miteinander
mehr mit dem Thema in der Schule arbeiten/ nicht nur ITG, auch "Kommunikationsbildung"
Denke, dass ihr über das Thema nachdenkt und euch damit auseinandersetzt
um gegen Hass zu kämpfen, müssen wir lernen, miteinander statt gegeneinander zu reden -> gibt nur noch wenig Diskurs zwischen Menschen verschiedener Meinungen und wir müssen wieder lernen, uns gegenseitig zuzuhören
Die Sprache hat sich grundsätzlich verändert, nicht unbedingt zum Besseren
omnia vincit amor (Verg. Ekl. 10,69)
Übersetzung: Die Liebe besiegt alles
traurige Entwicklung Courage!
TikTok ist ein Problem
von Hanna Vollmer | 7D

Unser Titelthema ist Hass. Hass kann in vielen Variationen auftreten.
Es kann ein Ausdruck von Hass sein, wenn Personen sich gegenseitig beleidigen, wenn Leute sich hinterhältig verhalten oder wenn jemand etwas mutwillig zerstört.
Auch an unserer Schule bleibt man von solchem Verhalten leider nicht verschont. Ich schreibe und erzähle euch jetzt von den mutwilligen Zerstörungen am Leo.
Ich starte aus der Sicht des Standortes Gustav-Nachtigal-Straße, denn dort bin ich als Schülerin selbst vor Ort und habe alle Vorfälle selbst miterlebt.
Zuerst möchte ich die Beschmierungen bzw. Bekritzelungen von Schulgegenständen benennen. Meist sind es nur harmlose Zeichnungen (was auch schon nicht in Ordnung ist, schließlich muss alles sauber gemacht werden und man darf nicht vergessen, dass Tische Geld kosten). Leider entdeckt man zwischen den Schmierereien auch Hakenkreuze. Viele Schüler:innen wissen nichts über den Hintergrund der deutschen Geschichte oder wollen ihn nicht wahrhaben. Sie denken, es wäre lustig und cool, Hakenkreuze auf die Tische zu malen. Doch warum??? Die Welt wird ohnehin schon immer rechtsextremer. Wir haben Kriege (sogar einen in Europa), Diktaturen usw. Es geht um große und schlimme Themen, über die man nicht aus Spaß an einer Schule, die eigentlich ein Wohlfühl- und Lernort sein sollte, rumschmieren sollte. Es ist weder lustig noch cool. Denn unter Kriegen und Diktaturen haben viele Menschen gelitten und leiden immer noch!
Kritzeleien findet man auch, wenn wir den Blick auf die Schultoiletten werfen. Dort wird von den Schüler:innen an die Wände geschrieben. Es ist oft nichts Nettes. Oft sind es sogar Beleidigungen oder Drohungen. Doch dies ist leider nicht das Schlimmste, was auf dem Mädchenklo vorzufinden ist. Oft liegen vor den Kabinen nasse, dreckige Tücher herum, die eigentlich dazu da sind, sich die Hände abzutrocknen. Der Höhepunkt ist allerdings, dass manche Toilettendeckel zerbrochen wurden oder die kleinen Mülleimer in den Kabinen. Schülerinnen klettern von einer Kabine zur anderen. Dadurch werden die Mülleimer und Toilettendeckel kaputt gemacht. Hier fragt man sich wieder nach dem Grund! Reicht es nicht, normal, ohne Beschädigungen auf Toilette zu gehen?! Sehr schlimm war auch noch eine weitere Sache. In einer ersten großen Pause kam ein Knall aus der Jungentoilette. Kinder, die Tischtennis davor spielten, rannten weg. Lehrer:innen schauten nach, was los war. Es war ein Polenböller, der von jemanden in der Kabine gezündet worden war. Und schon wieder stehen wir vor der Frage, die so kurz ist, aber auf die wir schwer eine Antwort finden. Warum??? Warum wird so etwas getan? Was denken sich die handelnden Personen dabei? Wollen die nicht auch normal auf die Toilette gehen, ohne dabei auf Trümmer und Dreck zu stoßen oder sogar einen Trommelfellriss zu riskieren?!
Ich glaube, mir und anderen Schüler:innen oder vielleicht auch den Lehrer:innen würden noch mehr mutwillige Zerstörungs-
fälle einfallen, aber das würde diesen Artikel sprengen...
Ich will aber noch einen Blick auf die Zerstörungen im Hauptgebäude (Standort Blücherstraße) werfen. Ich kann darüber zwar nicht so viel schreiben. Dort bin ich schließlich noch keine Schülerin. Folgendes wurde mir aber berichtet. Vielleicht entdeckt ihr eine Gemeinsamkeit.
Hier geht es nämlich auch um einen Böller auf den Toiletten. Dies passierte im Januar 2025. Ein Böller wurde im Klo gezündet. Eine Schülerin vom Hauptgebäude berichtete mir, dass der Knall so laut war, dass sie dachte, es wäre ein Amoklauf. Die Klasse hatte sich unter den Tischen versteckt.
Bei den Toiletten am Hauptgebäude kam es sogar so weit, dass man sich beim Sekretariat einen Schlüssel für die Toiletten holen musste, da die Zerstörung ein so großes Ausmaß angenommen hatte.
All dies muss nicht sein. Jeder soll und darf sich hier am Leo wohl fühlen. Ihr selbst wollt doch auch nicht auf zerstörte Toiletten gehen?! Bitte, liebe Schüler:innen, macht nichts kaputt und helft uns lieber dabei, dass das Leo in Zukunft von mutwilliger Zerstörung verschont bleibt! Denn das Leo war schon immer und bleibt hoffentlich auch in der Zukunft eine schöne Schule!!! Eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage!
„Nach seiner Meinung entsteht das ganze Unglück der Welt von den vielen Lügen, den absichtlichen und unabsichtlichen.“ (Zitat aus dem Kinder- und Jugendbuch Momo von Michael Ende.)
Egal ob auf Social Media oder bei einer Unterhaltung es entstehen Lügen. Diese Lügen kennen die meisten unter dem Namen: „Fake News“. Im Fall von Fake News sind die Lügen absichtlich erfunden, um Schaden an gezielten Personen zu verursachen. Doch warum erkennen wir nicht, ob manche Nachrichten Fake News sind und warum verbreiten sie sich so schnell? Oft sind Fake News gegen einzelne Personen oder sogar ganze Gruppen gerichtet. Fake News verbreiten Hass, Hetze und noch vieles mehr. Zudem wollen sie, dass du denkst,
Nach Vorfällen mutwilliger Zerstörung stellt man sich immer wieder die gleiche Frage: Warum vollführen Schüler:innen diese Taten? Ich habe Schüler:innen aus dem 7. Jahrgang dazu befragt:
„Ich glaube, die Schüler denken, es wäre witzig.“
„Vielleicht haben sie auch zu Hause Probleme, sodass sie dann ihre Wut oder Trauer damit rauslassen.“
„Aus Frust oder als Rache, wenn ein Lehrer ihnen doof kam.“
„Haben sich vielleicht ein Beispiel an älteren Personen wie Geschwistern genommen.“
„Wenn sie viel Social Media gucken, wo ihnen so etwas vorgemacht wird, denken sie, wenn sie es nachmachen, sind sie cool.“

dass sie tatsächlich wahr sind. Auf Social Media verbreiten sie sich schneller, da sie viel Aufmerksamkeit erregen, oft geteilt werden und sehr glaubhaft scheinen.
Tipps für das Erkennen von Fake News:
1. Überprüft die Quelle: Ist die Webseite glaubwürdig? Gibt es mehrere Webseiten, die die Informationen auch nennen?
2. Hinterfragt die News: Von woher kommt die Nachricht? Welche Absicht steckt hinter der Nachricht?
3. Leite nicht alles weiter!!! Überlege: Könnte die Nachricht jemandem schaden? Sprich mit deinen Freund:innen, wenn sie Fake News weiterleiten.

von Tim Luca Unger | Q2
Am 08. Januar dieses Jahres kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg an, in Zukunft auf seinen Plattformen WhatsApp, Instagram und Facebook auf Moderationen sowie Zensur verzichten zu wollen und begründete dies mit einer „Wiederkehr zur Meinungsfreiheit“, da aktuell zu viele Beiträge fälschlicherweise gelöscht, also der Zensur zum Opfer fallen würden.
Im Klartext bedeutet dies, dass zukünftig professionelle Faktenchecker auf Facebook, Instagram und WhatsApp durch sogenannte Community Notes ersetzt werden sollen. Diese professionellen Faktenchecker sind in Deutschland aktuell noch die Deutsche Presse-Agentur und das Recherchenetzwerk COLLECTIV, die als Meta-unabhängige Unternehmen für Meta gegen Hassrede und Falschnachrichten vorgehen und entsprechende Inhalte löschen.
Als Alternative will Zuckerberg nun aber auf Community Notes setzen, also die Möglichkeit eines jeden Nutzers eine Nachricht, die er als falsch oder beleidigend betrachtet, als solche zu markieren. Ob sie dann gelöscht wird, entscheidet Meta selbst. Generell will der Konzern aber weitestgehend darauf verzichten, Konten oder Nachrichten zu sperren
und viel mehr Freiheiten einräumen, bspw. durch geringere Veröffentlichungsbeschränkungen oder mehr Toleranz bei politischer Meinungsmache.
Damit folgt Zuckerberg dem Kurs von Donald Trump und dessen zukünftigem Präsidentschaftsberater Elon Musk und seiner Plattform X.
X schaffte Faktenchecker im Gegensatz zu Meta schon vor einem halben Jahr ab und das nicht nur in den USA, sondern weltweit und begründete dies ebenfalls mit einer angestrebten größeren Meinungsfreiheit. Die EU sah den Schritt kritisch und klagte X wegen „illegaler Inhalte“ an, da X seit Abschaffung der Faktenchecker zu wenig gegen die Verbreitung von Hassrede, Hetze und Falschinformationen, entsprechend dem Digital Service Act der EU getan habe, der eigentlich Social Media Plattformen dazu anhält, entsprechende Inhalte schnellstmöglich zu löschen.
X verteidigte sich und verwies auf die neu geschaffenen Community Notes, durch die einerseits ein von der EU selbst gefordertes Beschwerde-Tool für Nutzer kreiert worden sei und man andererseits seither keine signifikante Steigerung von Hassrede oder Fake News zu verzeichnen habe.

Während das Unternehmen selbst also nichts von gestiegenen Zahlen von Falschmeldungen oder Hassrede wissen will, schreibt Ferda Ataman, die Chefin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „Durch den enormen Anstieg von Trans- und Queerfeindlichkeit, Rassismus, Misogynie1, Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Inhalten ist X für eine öffentliche Stelle kein tragbares Umfeld mehr.“ Daraufhin zog sich ihr Ministerium im Januar 2025 von der Plattform zurück.
Das Faktenchecker-Aus scheint sich also doch nicht so folgenlos zu gestalten, wie X diesen Schritt darstellen will. Doch warum plant Meta nun ähnliches, wenn der Internetkonzern doch von drohenden juristischen und Imagefolgen weiß?
Viele Experten sehen diesen Schritt als politisch motiviert, da Zuckerberg 2021 nach dem Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger, Trumps Account sperren ließ, woraufhin dieser gegen Meta wetterte und den Konzern als „Feind des Volkes“ deklarierte. Da Trump aber für die nächsten vier Jahre erneut Präsident sein wird, will Zuckerberg wohl seine damalige Entscheidung wieder gut machen und sich mit dem Verfolgen von Trumps Kurs klar zu ihm bekennen. Diese Schmeichelei scheint gewirkt zu haben, denn Trump sagte bereits wenige Stunden nach Zuckerbergs Ankündigung, Meta habe sich gut entwickelt. Meta scheint also wirtschaftlich nur zu profitieren von dem Schritt, denn gleichzeitig bedeutet das Faktenchecker-Aus auch weniger Kosten für das Unternehmen. Doch hat die Entscheidung wirklich etwas mit Meinungsfreiheit zu tun,
1 Misogynie: Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass
wie Zuckerberg behauptet? Profitieren also auch die Nutzer von dem Schritt? Oder öffnet er lediglich Hassrede und Desinformation Tür und Tor?
Wenn man mal von den Positionen unserer Antidiskriminierungsbeauftragten und dem Chefankläger der EU ausgeht und Hassrede und Falschnachrichten wirklich so signifikant zunehmen, hat das wohl wenig mit Meinungsfreiheit zu tun. Außerdem: Kann man überhaupt sagen, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt war, wenn die Faktenchecker lediglich bei klaren Verstößen gegen Verfassung und Strafgesetzbuch Beiträge und Kanäle löschen durften und gelöscht haben?
Wohl kaum! Wer profitiert also neben den Tech-Unternehmen am Ende von den fehlenden Faktencheckern, wenn es nicht die Nutzer sind, die nunmehr genauer hinsehen müssen? Die Antwort lautet: Menschen wie Trump, die nun keine Konsequenzen mehr aufgrund von offenen Falschnachrichten, Hetze oder Propaganda fürchten müssen und fern jeder Wahrheit andere in ihrem eigenen Interesse beeinflussen können.
Dies führt zu massiven Problemen in der digitalen Debattenkultur und Informationsvermittlung: Musste man sich früher in einer Debatte mit wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen, kann man diese jetzt einfach mit einer gewissen Anzahl an willigen Menschen oder Bots2 per Community Notes als falsch kennzeichnen und eine Diskussion unbemerkt abseits von Fakten führen. Und selbst wenn Menschen sich nicht ausschließlich über Social Media informieren oder die Falschnachrichten sogar klar als solche erkennen, kommt es bei der Menge an Falschnachrichten zum „Flood The Zone With Shit”- Effekt oder deutsch „Inforauschen“- Effekt.
Dieses maßgeblich durch Trump und dessen Berater Bannon entstandene neuartige Phänomen, das aktuell von führenden Soziologen bspw. des Leibniz-Instituts untersucht wird, funktioniert in etwa wie folgt: Gibt man einfach so viel Absurdes und Aufsehenerregendes von sich und betreibt so lange Falschnachrichten, bis man selbst informierte politische Gegner verwirrt oder angeheizt hat, dann erzeugt man Aufmerksamkeit und Medienpräsens für sich selbst (auf Social Media auch noch durch Algorithmen unterstützt, die emotionalen und kontroversen Content bis hin zum Trend pushen). Man erreicht so einerseits die künstliche Emotionalisierung von Themen und Debatten und andererseits evtl. neue oder alte Meinungsteilende und somit eine höhere Reichweite in öffentlichen Debatten und schlussendlich der öffentlichen Meinung. Während die Faktenchecker uns wenigstens noch vor solchen polarisierenden Falschnachrichten warnten, werden nun viele Menschen unbemerkt entweder beeinflusst oder zumindest abgelenkt von echten Themen und Inhalten, unabhängig davon, ob sie einem Beitrag Glauben schenken oder ihn für lächerlich erachten. Ein gutes Beispiel dafür ist Trumps Zitat: „They are eating the dogs“, was klar als Falschnachricht zu erkennen war und ihm doch Aufmerksamkeit verschafft hat und von der
2 Bots: Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein
Bild: Unsplash / Shyam Mishra

eigentlichen Debatte und den eigentlichen Argumenten abgelenkt hat.
Du glaubst nicht, dass das bei dir funktionieren würde? Dann frage dich mal selbst, ob du noch wüsstest, was der Zusammenhang des Zitats war.
Mit Hass verhält es sich natürlich ähnlich: Was am meisten polarisiert, wird am meisten verbreitet und kann nun ebenfalls ungehindert Debatten und Informationsvermittlung beeinflussen. Besonders gut funktioniert dabei Framing: Man braucht nur verbildlichende Begriffe wie „Messermänner“ oder „Kopftuchmädchen“ zu verwenden und schon sind Emotionen und Vorstellungen wach. Ohne jeglichen nötigen Kontext kann man eine starke Reaktion hervorrufen und die Wenigsten schaffen es dann noch, sachlich zu argumentieren.
Wenn dann in Debatten der gegenseitige Respekt und eine gemeinsame Faktengrundlage verloren gegangen sind, kann man nicht mehr diskutieren und genau das wollen die Leute erreichen, die Hass und Falschnachrichten verbreiten. Sie wollen nicht in der Diskussion mit faktenbasierten Argumenten überzeugen, denn das könnten sie nicht. Sie wollen spalten und von Ängsten und Verwirrung profitieren. Deswegen glaube ich, dass das einzig Hilfreiche ist, sich dem entschieden entgegenzustellen und entsprechende Debatten zu führen.
Dabei ist bei aller Emotion Menschlichkeit gefragt, denn das unreflektierte Verurteilen von Meinungen, die auf falschen Behauptungen basieren, führt nicht zur Einsicht derer, die sie von sich geben, sondern fördert viel mehr die oft von Populisten propagierten Narrative der verlorenen Meinungsfreiheit. Doch am Ende steckt hinter jeder Aussage, ja selbst der von überzeugten Populisten, eine Angst oder ein Problem, über das man sachlich und respektvoll reden kann, wenn man eine gemeinsame Faktenbasis hat.
Deswegen müssen wir jetzt als Mehrheit auf Social Media gemeinsam Scheinargumente aufdecken und für Fakten eintreten, bevor diese verschwimmen. Wir müssen uns selbst bewusst machen, was wir teilen, um nicht Hass und Desinformation weiter zu fördern.
Wir müssen versuchen, respektvoll das Gespräch auf Augenhöhe zu suchen, egal wie schwer das ist und versuchen, die andere Person in irgendeiner Weise anzuerkennen und ihre Haltung nachzuvollziehen.
Wir dürfen nicht nur Meinungsbestätigung betreiben und andere Meinungen abtun, nur weil sie auf falschen Informationen basieren, sondern müssen ihnen begegnen. Wir dürfen bei Hass nicht wegsehen, sondern müssen ihn klar verurteilen und die Opfer von Hass und Falschnachrichten unterstützen, egal wie banal oder unwichtig es in einem Chat oder einer Kommentarsektion mit tausenden anderen Usern scheint.
Wir führen am LdV ja den Titel „Schule mit Courage“ und genau die braucht es jetzt auch auf Social Media, wenn es keine Faktenchecker mehr gibt, damit wir auch in Zukunft noch Debatten und Diskussionen führen können.


geführt von Maren Königs, Tim Luca Unger und Tami von Cysewski | Q2 (Foto v.l.n.r.)
Guten Tag Frau Heigl. Stellen Sie sich erstmal vor?
Gerne. Ich heiße Jana Heigl und leite im Bayerischen Rundfunk den BR24 #Faktenfuchs. Dort bin ich für die Teamleitung zuständig und koordiniere ein Team von insgesamt acht Personen.
Jeden Tag checken wir Fakten, schreiben Faktenchecks und setzen diese für die verschiedenen Ausspielwege um. Also zum Beispiel fürs Radio oder für Tiktok oder Instagram.
Ich bin Anfang 2021 zum Faktenfuchs gekommen, nachdem ich an der Deutschen Journalistenschule meinen Master und meine Ausbildung gemacht habe. Davor habe ich unter anderem Amerikanistik studiert.
Beim Faktenfuchs kümmern wir uns einerseits um Faktenchecks, aber wir sind auch die Verifikationseinheit1
Wir prüfen, ob Bilder und Videos, die im Netz kursieren, echt sind. Ich gebe auch MedienkompetenzWorkshops, einerseits für Schüler, aber auch häufig für Lehrer und andere Interessierte. Das ist alles Teil meines Jobs.
Wie sieht Ihre alltägliche Arbeit aus? Welche Tools nutzen Sie und wie lange dauert es durchschnittlich? Es ist nicht die Regel, dass wir einen Faktencheck an einem Tag umsetzen können, weil unsere Checks sehr aufwendig sind, wir da mit verschiedenen Experten sprechen wollen und uns die Studienlage anschauen. Auch Behördenanfragen usw. dauern ihre Zeit. Es gibt durchaus einige Fälle, wo wir mindestens zwei Wochen an dem Faktencheck sitzen, einfach weil dann die Thematik sehr komplex ist. Dazu kommt, dass wir sehr aufwendige Ab-
nahmeprozesse haben. Bevor ein Text veröffentlicht wird, lesen ihn mindestens drei Personen, eine davon ist aus der jeweiligen Fachredaktion. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Bei uns ist es total wichtig, dass jedes Wort stimmt.
Wir nutzen sogenannte Open Source Intelligence Tools. Das sind frei zugängliche Tools, die jeder nutzen kann. Dazu zählt auch Google Maps. Wenn wir zum Beispiel ein Bild aus der Ukraine haben und feststellen wollen, ob die Angaben zum Ort stimmen, können wir uns die Umgebung anschauen und mit dem Bild vergleichen. Daraus können wir Schlussfolgerungen ziehen.
Ganz wichtig für uns sind zum Beispiel Internetarchive. Wir haben es häufig mit Social Media Posts zu tun, die wir archivieren und auf die wir mit
einem speziellen Link auch zugreifen können, wenn sie gelöscht sind. Das ist der bessere Screenshot. Screenshots können manipuliert werden, ein archivierter Link ist der saubere Beweis. Wir testen auch KI-Erkennungstools.
Ein Verifikationsschritt ist es, festzustellen, ob ein Video von einem Menschen aufgenommen wurde oder ob es künstlich generiert oder manipuliert ist. Das wird immer wichtiger, weil wir immer häufiger solche Fakes sehen.
Wie wird ausgewählt, was gecheckt wird? Und was sind die Sachen, die gecheckt werden?
Wir haben verschiedene Kriterien, nach denen wir Behauptungen auswählen. Als erstes muss es eine überprüfbare Tatsachenbehauptung sein. Wir überprüfen keine Meinung. Und die Behauptung muss eine Relevanz haben. Wir sind der BR24 #Faktenfuchs, das heißt, wir sind Teil der Nachrichtenmarke des Bayerischen Rundfunks. Unser Publikum ist ein bayerisches Publikum. Das bedeutet, wir setzen die Themen um, die relevant sind für die Nutzer in Bayern. Das bedeutet aber nicht, dass es ausschließlich Themen aus Bayern sein müssen.
Ein ganz großer Punkt ist, dass wir eine Falschbehauptung nicht größer machen wollen, als sie eigentlich ist. Deshalb prüfen wir vorher sehr sorgfältig, wie stark sich eine Behauptung bereits verbreitet hat. Dafür nutzen wir unser Social Listening Tool, mit dem wir hunderte Millionen von Quellen im Netz durchsuchen können, um rauszufinden, was die User beschäftigt und worüber sie diskutieren. Wenn wir einen Faktencheck veröffentlichen, hat das natürlich auch eine gewisse Verbreitungsmacht.
Gibt es Bereiche, die besonders schwer zu überprüfen sind?
Nicht in einem Faktencheck zu überprüfen ist alles, was zu Meinungsäußerungen zählt. Schwierig wird es, wenn die Überprüfung einer Behauptung eher ins Investigative2 gehen müsste und wir das mit unseren FaktencheckMitteln nicht überprüfen könnten. Ich
habe ein Beispiel, das zeigt, was wir leisten können und was nicht: Als im Gazastreifen ein Krankenhaus mit einer Rakete beschossen wurde und die Frage war, von wem kommt sie, von der Hamas oder von Israel? Es gab nur wenig Bildmaterial. Das haben wir analysiert. Wir haben dafür Open Source Intelligence Tools genutzt. Das Problem ist nur, dass es zum Beispiel Google Street View im Gazastreifen gar nicht gibt. Wenn man da nicht vor Ort ist, hat man nur eine begrenzte Möglichkeit, solches Material zu überprüfen.
Wir haben gemacht, was uns möglich war. Wir haben dokumentiert, was wir rausfinden konnten, aber wir haben eben auch deutlich gemacht, wo die Grenzen unserer Recherchen sind, weil man dafür z.B. noch mehr Bildmaterial bräuchte.
Das haben wir dann so aufgeschrieben. Ich glaube, auch das kann zur Aufklärung beitragen.
Ansonsten kann man grundsätzlich zu allem Faktenchecks machen. Themen, mit denen wir uns häufig beschäftigen, sind Migration oder Klimawandel, aber auch Wahlen. Es gibt einfach so ein paar Dauerbrennerthemen, zu denen sich viele Falsch- und Desinformationen verbreiten. Desinformation bezieht sich hauptsächlich auf Themen, die die Gesellschaft spalten und versuchen diese Spaltung weiterzutreiben.
Wie gehen Sie mit Kritik und auch Vorwürfen um, parteiisch zu sein oder nicht neutral zu berichten? Wie kann man dem entgegentreten? Zum einen sind wir Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Alleine dadurch verpflichten wir uns zur unparteiischen Berichterstattung. Wir sind außerdem Teil des International Fact-Checking Networks (IFCN). Das ist ein Faktencheck-Netzwerk, in dem sich Faktencheck-Teams weltweit vernetzen. Um zertifiziertes IFCN-Mitglied zu sein, muss man hohe Standards erfüllen. Dazu gehört auch, dass wir unparteiisch berichten müssen und das wird jedes Jahr unabhängig überprüft.
Außerdem kann man alle unsere Quellen nachprüfen. Wir verlinken alles und machen unseren Rechercheweg transparent.
Wie stellen Sie sicher, dass die Faktenchecks auch in unserer polarisierten Welt möglichst viele, unterschiedliche Menschen erreichen?
Es gibt kognitive Effekte – so was wie confirmation bias, also der Bestätigungseffekt – die dazu führen, dass wir alle, sei es jetzt in irgendeiner GoogleTrefferliste oder wo auch immer, das auswählen, was am Ehesten unserer Meinung entspricht.
Wir versuchen, so viele Leute wie möglich über verschiedene Ausspielwege zu erreichen. Das sind einmal Onlineartikel und Radiobeiträge, aber wir sind auch auf den Social Media Plattformen vertreten. Gerade Social Media ist für uns sehr wichtig. Wir wollen den Fakes und Lügen, die sich auf Social Media verbreiten, etwas entgegensetzen.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist unsere Medienkompetenz-Arbeit. Wir geben Workshops, zum Beispiel an Schulen, um auch eine gewisse Quellenkompetenz zu vermitteln. Denn das Wichtige ist ja, dass man selbst in der Lage ist, einzuschätzen und kritisch zu beurteilen: Ist das jetzt gerade eine gute Quelle oder sogar eine sehr schlechte Quelle?
Was wären denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Tipps, wie man sich vor Falschnachrichten schützen kann und was man vielleicht auch tun sollte, wenn man welche entdeckt? Also der wichtigste Tipp ist einmal durchatmen, bevor ich was teile und überlege: Kann das wirklich stimmen? Welche Belege habe ich dafür? Wer hat es gepostet? Von welcher Quelle kommt das? Warum wurde es gepostet? Ist diese Person z.B. wirklich im betreffenden Krisengebiet? Warnhinweise können auch sein, wenn ich wütend werde, wenn ich das lese, und Angst kriege. Da sollte ich einen Schritt zurück machen und mich fragen: Soll ich da jetzt gerade manipuliert werden? Denn das sind genau die
2 investigativ: nachforschend; enthüllend, aufdeckend
Gefühle, die Des- und Falschinformationen oft ansprechen wollen. Andersherum gilt aber auch: Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, also zu sehr meine Weltsicht bestätigt, dann sollte ich aufpassen und lieber doppelt checken.
Wenn man etwas selbst nicht überprüfen kann, dann gibt es ja eine ganze Reihe an Faktencheck-Organisationen, die sich total freuen, wenn sie sowas weitergeleitet bekommen, denn die schauen da gerne drauf.
Welche Quellen nutzen Sie und welche halten Sie für besonders aussagekräftig?
Wir nutzen in erster Linie sogenannte Primärquellen. Beim Klimawandel sind das zum Beispiel methodisch gut gemachte wissenschaftliche Studien. Solche Studien müssen auch peer-reviewed sein, also von anderen Fachleuten überprüft worden sein. Aber wir sprechen auch mit Experten, um uns die Studienergebnisse einordnen zu lassen: Wie kommt man zu diesen Fakten? Wo sind vielleicht noch Unsicherheiten usw.?
Auch Behördeninfos sind häufig wichtige Quellen für uns. Zum Beispiel dann, wenn ich wissen will, wie sich die Feinstaubbelastung in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Dann ist das Bundesumweltamt eine seriöse Quelle dafür, weil die die Daten erheben.
Im Moment sieht es ja bei Facebook und X ein bisschen schwierig aus für Faktenchecker. Die wollen ja in den USA die ganzen Faktenchecker abschaffen und vielleicht auch später in Europa. Wie sehen Sie die Zukunft von Faktencheckern generell? Das, was Meta gemacht hat, fand ich sehr bedenklich. Nicht mal nur diese Entscheidung, Faktenchecker auszuschließen, sondern die Begründung,
die ja Faktencheckern unterstellt hat, zu zensieren usw. und das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Diese Entscheidung zeigt einmal mehr, dass Plattformbetreiber nur das machen, was in ihrem wirtschaftlichen Interesse ist.
Wir sind nicht Teil von Metas FactChecking Programm gewesen. Alle Faktenchecker, die mit Meta zusammengearbeitet haben, waren übrigens Kollegen aus dem International Fact Checking Network, also nur Kollegen, die diese sehr, sehr hohen Standards einhalten. In den USA hat das natürlich riesige Auswirkungen, weil das auch ein Finanzierungsmodell war für viele.
Das heißt, einige Faktencheck Organisationen gibt es bald wahrscheinlich nicht mehr. Bislang bezieht sich das nur auf die USA. Ob es in Europa auch kommen wird, weiß ich nicht. Wir haben in Europa noch mal Gesetzgebungen wie den Digital Services Act, den DSA, der das vielleicht etwas erschwert, aber am Ende kann es ebenso kommen wie in den USA. Umso wichtiger ist es, dass es Faktencheck-Organisationen wie uns beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, die unabhängig von dieser Finanzierung durch Facebook, X etc. arbeiten können.
Es bedeutet also nicht das Ende aller Faktenchecks, nur weil Mark Zuckerberg sagt, er will mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Aber die Realität ist halt auch, dass es für viele superschwierig wird, sich zu finanzieren. Es wird dazu führen, dass es weniger Faktenchecker gibt. Und das wird dazu führen, dass das Diskursklima auf diesen Plattformen nicht gerade besser wird, wie man ja bei X jetzt schon sehen kann..

Jana Heigl
Jana Heigl leitet den BR24 #Faktenfuchs. Sie ist seit 2021 Teil des Teams Social Listening und Verifikation1 bei BR24 und gibt Workshops zum Erkennen von Desinformation und zur digitalen Verifikation1. Sie hat Amerikanistik, Außenpolitik und Journalismus an der LMU München und der American University in Washington, D.C. studiert. Absolventin des 57. Jahrgangs der Deutschen Journalistenschule.
1 Verifikation: durch Überprüfen die Richtigkeit einer Sache bestätigen
Foto und Informationen: #Faktenfuchs BR24

LARA TATAS
„Weggehämmert?“
Erläuterung: gesprochen (vɛk) oder (ve:k)


AVA LAMERS
„Todesengel“
In meiner Collage ist in der Mitte ein Mann zu sehen. Er trägt eine Art Maske und guckt den Betrachtenden mit leidendem Blick an. Um ihn herum ziehen sich filigrane Fäden, welche an dem einen Ende an seinem Körper und an dem anderen Ende in den Händen von fünf monsterartigen Wesen liegen. Diese Wesen (Todesengel) befinden sich im schwarzen Hintergrund des Bildes, um das Düstere zu verdeutlichen.
Meine Collage soll die Angst vor dem Tod und Wut angesichts des Todes darstellen. Der Mann als der Hasserfüllte. Der Tod ist nicht fair und zieht Leute aus dem Leben, bevor sie es gelebt haben. Der ältere Herr ist nicht bereit zu sterben und kämpft. Die Maske, welche ich als Art Folter interpretiert habe, zeigt, dass der Tod mit uns spielt. Der Titel „Todesengel“ entstand aus dem Gedanken, dass der Tod gebracht wird. Der Tod sucht sich seine Engel, welche die Menschen ins Reich der Toten führen.
LARA TATAS
„Zange und Draht“
Erläuterung: Es war nur ein römischer Gruß.
Anmerkung der Redaktion: Nach Trumps Amtseinführung provozierte Elon Musk mit einer Armbewegung, die wie ein Hitlergruß aussah. Das Foto ging um die Welt und löste eine weltweite Debatte aus. Die Anhänger von Musk argumentieren, es sei lediglich ein römischer Gruß des italienbegeisterten Musk‘ gewesen.


JOONAS MIKA MANSFELD
Hass ist für mich eine starke Emotion, die sich aus Trauer, Unrechtsempfinden oder auch Feindseligkeit bilden kann. Hass kann sich gegen Personen, Gruppen sowie andere Sichtweisen und Ideen äußern – aufgrund von Ängsten, Vorurteilen, Ideologien oder anderen Einflüssen. Durch Hass entstehen schnell Konflikte.

Meiner Meinung nach ist Hass eine zerstörerische Emotion, die zu Spaltung und Konflikten führt. Er entsteht oft aus Angst oder Vorurteilen, löst aber keine Probleme, sondern verstärkt sie. Stattdessen sollten wir versuchen, einander besser zu verstehen und ins Gespräch zu kommen.
Das Wort „Hass“ löst in mir ein Unwohlsein aus. Das spiegle ich in meiner Ideenskizze wider. Hass ist machtvoll und zerstörerisch. Er kann Welten zerstören und Leben auch. Kriege werden als Machtspiele mit Hass als Antrieb geführt.
Durch Zweifel und Depressionen verfällt man schnell in Selbsthass und verletzt sich. Das dauerhafte Streben nach dem Besseren macht Selbstbewusstsein kaputt und spielt so lange mit deinem Kopf, bis er zerbricht.
Durch die verschiedenen Dimensionen ergibt sich für mich ein vielfältiges Farbschema. Rot (Feuer, Blut), blau (Trauer, Unbehagen) und schwarz (düster, Tod).


In meiner Ideenskizze bewegt sich Hass in einem Spannungsfeld von Menschenhass. Dazu zählen Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, religiöser Hass etc. - aber auch Selbsthass. Dazu gehören für mich Gründe wie Unzufriedenheit, Neid und Unsicherheit.
Hass verbinde ich einzig und allein mit etwas Negativem. Dementsprechend habe ich mich für düstere Farben wie schwarz und dunkelblau entschieden. Die Zeitungspapiere an den Rändern verbinde ich mit den weltweit hasserfüllten Nachrichten, die man alltäglich sieht/ sehen muss.

Wir und Die!
Täglich müssen Menschen durch ihre Mitmenschen Hass erfahren. Besonders trifft es dabei Menschen, die der LGBTQIA+ Community angehören. Sie werden angefeindet und müssen mit diesem Hass leben. Dabei sind wir alle Menschen.
LUCIA OECHELHAEUSER
Hass ist eine starke Emotion. Ein Gefühl der Ablehnung, das in unserer Welt zu viel Raum einnimmt. Es führt uns in Streit, Krieg und Spaltung. Im Großen und im Kleinen.


In meiner Ideenskizze zum Thema „Hass“ habe ich meine Assoziationen und Gedanken eng miteinander verknüpft. Besonders setzte ich mich mit den Aspekten „Selbsthass“, „Neid“ und „Armut“ auseinander.
In der heutigen Zeit spielt Hass eine bedeutende Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Krieg und Extremismus, wie es sich in zahlreichen Konfliktgebieten zeigt.
Die übrigen Schlüsselbegriffe ordnete ich in Form eines Feuers an, das die zerstörerische Kraft sowie die Negativität und Böswilligkeit des Hasses symbolisieren soll. Um diese Wirkung zu verstärken, dominieren im unteren Teil des Bildes vor allem düstere Farben.
In meiner Collage habe ich mich mit der Frauenfeindlichkeit und mit den daraus resultierenden Problemen, eine Frau zu sein, auseinandergesetzt. Ich wollte zeigen, dass eine Frau zu sein bedeutet, sich daran zu gewöhnen, dass alle Blicke auf einen gerichtet sind, eben weil man eine Frau ist.


Bild: KI-generiert
Formen von Hass gibt es überall – im Alltag, in den sozialen Medien und leider auch manchmal in der Schule. Doch jetzt hat die Leonarda dazu aufgerufen, sich eine Möglichkeit zu überlegen, dem aktiv im Rahmen eines Wettbewerbs entgegenzuwirken. Dieser Wettbewerb bot euch die Chance, innovative Konzepte und Ideen zu entwickeln, um Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung jeglicher Art hier an unserer Schule zu bekämpfen und vorzubeugen.
Hier seht ihr die beiden besten eingereichten Konzepte.
und Klang verbindet“
STOP HATE
Wir haben uns das Projekt „Kunst und Klang verbindet“ ausgedacht, das sich gegen Hass stellt, den Menschen Hoffnung schenkt und ihnen bewusst macht, dass sie nicht alleine sind.
„Kunst und Klang verbindet“ stärkt den Zusammenhalt und die Freude beim gemeinsamen Erschaffen eines Kunstwerkes im Miteinander.
Dafür überlegten wir uns in Kooperation mit dem asambura ensemble ein kreativ-interdisziplinäres Konzept, das darin besteht, dass wir Musik verschiedener Religionen miteinander verbinden und dies in Kunst übertragen. So entsteht ein musik- und kunstübergreifendes Kunstwerk.
KONZEPTIDEE:
Es wird drei verschiedene Musikgruppen geben, die gemeinsam - in einer bestimmten Reihenfolge, aber jede Person darf immer nur einen Ton spielen - je Melodien aus den verschiedenen Religionen Judentum, Islam und Christentum auf Metallophon, Glockenspielen und Xylophone musizieren. Alle Gruppen teilen ihre Melodie auf verschiedene Zeitabschnitte im Kollektiv auf. Im Zusammenspiel mit den Abschnitten der anderen Melodien entsteht dann eine
neue, gemeinsame, interreligiöse Melodie, ein gemeinsames Klangbild.
Zudem gibt es je Gruppe einzelne Personen, die die musikalischen Klänge in Kunst umsetzen, als Aquarell und Tusche auf einem mit Wasser benetzten Papier. Jede Gruppe wird durch eine Farbe symbolisiert, die Kunstgruppen dürfen das Papier nur mit Farbe berühren, wenn die zugehörige Gruppe einen Ton erklingen lässt.
Die Farbe wird auf das Aquarellpapier übertragen, je nachdem wie man sich fühlt, kann man sich überlegen, ob man ganz nah ans Papier geht. Dies würde den Effekt auslösen, dass sich eine Art Schatten einer aufgehenden Blütenknospe entwickelt.
Alternativ könnten von weiter oben kleine Farbtropfen auf das Kunstwerk fallen, die sich nicht auf dem Papier vermischen.
Das ganze entstehende Gemeinschaftskunstwerk wird von einem Stativ, das sich über den Schüler:innen befindet, aufgezeichnet und live zur Musik auf eine Leinwand projiziert. Die entstehenden Farbmuster können dann von allen individuell interpretiert werden.
asambura ensemble (geleitet von Maximilian Guth)






Klares Regelwerk: - Gerechtigkeit
Stop hate Konzept gegen Hass von Adeline Neuhaus | Q2
- Bewusstsein schaffen, dass man nicht alles tun und lassen darf, was man möchte
- Unterstützung der Opfer
- Täter :innen zu einem gewissen Maß a n Einsicht zwingen („Ich habe etwas falsch gemacht“)
Problem Diskriminierung (Mobbing):
- Bodyshaming
- Rassismus
- Sexismus (Mädchen sind schwächer…, andere Benotung Kleidung)
➔ Von Schüler:innen und Lehrkräften ausgehen
Wer profitiert: Zuerst das Opfer und in langer Sicht auch der Täter :innen (Einsicht und Erkenntnis fürs spätere Leben)
Konkrete Umsetzung: 2 Kategorien
Schlimm ist etwas, das jemanden verletzt
Täter:innen : Gespräch mit Lehrkraft und Eltern
Schriftliche Entschuldigung an das Opfer mit genauer Erklärung, warum es falsch war → Entschuldigung
Lehrkräfte:
+ Gespräch mit der Schulleitung
Grundsätzlich/+ gesetzlich falsch
Täter:innen : Gespräch mit der Schulleitung + Eltern + Lehrkraft + „Nachsitzen“ / Teilnahme an der Courage -AG und Erstellung eines Projektes passend zum Thema (Klasse 5 - 8) (Klasse 9 - 13) → Projekt erstellen und dies in irgendeiner Art vorstellen
Erneutes Vorkommen: Disziplinarverfahren
➔ Teilnahme an externen Workshop → Nachweis vorlegen
- Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ermöglichung eines Kurswechsels für das Opfer
Ergebnisse:



weniger Hass, Einsicht der Täter:innen , Unterstützung der Opfer Prävention , dass es nicht nochmal passiert in diesem Fall
Wir suchen:
Grafiker:innen
Wir suchen:
Autor:innen und Redakteur:innen
Wir suchen: Social Media Creator
DU WILLST EINEN ARTIKEL SCHREIBEN, LAYOUTEN ODER DICH UM UNSEREN SOCIAL MEDIA ACCOUNT KÜMMERN?
Dann komm einfach zur Leonarda-Redaktionssitzung in Raum 113 (Zeiten hängen im Foyer der Blücher Straße aus). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und wir unterstützen dich gerne.
Du lernst bei uns journalistisch zu arbeiten, bildest dich politisch und bist Teil unseres tollen Teams.
Interesse geweckt?
Komm vorbei und melde dich bei Emily Zeinar, Jana Stojceska, Luc Aydogan MüllerHarmandali, Anton Schwinden oder Jannis Ihmels. Als Lehrerinnen kannst du Frau Gramberg de Mendoza oder Frau Langen ansprechen.



von Jonas Stollwerk | 10B
Was ist Hass und wie entsteht er?
Hass ist ein starkes Gefühl, das Feindseligkeit und Abneigung verkörpert. Er geht mit vielen negativen Emotionen wie Wut, Angst und Neid einher. Hass kann sich gegen Einzelpersonen aber auch ganze Gruppen richten, etwa in Form von Rassismus oder Sexismus. Er zeigt sich in vielen Bereichen unseres Lebens und hat weitreichende Folgen. Eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen ist oft der Auslöser für Hass, insbesondere Angst, Verachtung und emotionale Verletzung. Aber auch Vorurteile und die generelle Weltanschauung spielen eine Rolle. Soziale Einflüsse wie Familie, Freunde oder Medien können Hass zusätzlich fördern. Bei Hass gibt es oft ein bestimmtes Feindbild.
Folgen von Hass
Betroffene von Hass haben mit vielschichtigen Folgen zu kämpfen. Hass kann überall vorkommen - in der Schule, auf der Arbeit, unter Freunden oder in der Familie, im Internet, in der Politik und sogar als Selbsthass. Er hat eine sehr negative Auswirkung auf unser Wohlbefinden und das von anderen. Wer selbst hasst, ist oft gereizt, angespannt und feindselig. Der Körper kann keinen inneren Frieden finden.
Hass auf andere hat tiefgreifende Auswirkungen. Betroffene erleben emotionale Belastung, die das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit beeinträchtigen können. Außerdem löst Hass oft eine Eskalation aus. Hass gegenüber ganzen Gruppen führt sogar zu gesellschaftlicher Spaltung und Diskriminierung. Der Hass verhindert gegenseitiges Verständnis. Außerdem belastet er nicht nur andere, sondern sogar den, der hasst.
Was können wir gegen Hass tun?
Es ist wichtig, entschlossen gegen Hass vorzugehen. Der erste Schritt ist, Hass zu erkennen und ihn nicht einfach hinzunehmen. Ein wirksames Mittel gegen Hass ist der Dialog. Oft können dadurch Missverständnisse und Unsicherheiten geklärt werden. Doch das reicht nicht immer aus. Manchmal ist es wichtig, klar Stellung zu beziehen und sich aktiv gegen Hass zu positionieren. Es ist besonders wichtig, den Betroffenen von Hass emotionale Unterstützung zu geben. Außerdem sollten wir auch unser Verhalten hinterfragen, insbesondere gegenüber anderen Menschen. Auch Aufklärung ist ein wichtiger Schritt, um Hass entgegenzutreten.
Politischer Hass
Heutzutage gibt es zu jeglichen Themen etliche Meinungen. Leider rückt der sachliche Austausch dabei immer mehr in den Hintergrund. Statt konstruktiver Debatten werden politische Diskussionen zunehmend mit Empörung, Emotionen und Egoismus geführt. Besonders in den sozialen Medien verbreiten sich Hass und Hetze schneller. Langfristig kann politischer Hass unsere Demokratie gefährden, weil die Fähigkeit zu Kompromissen schwindet. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es wichtig, im politischen Diskurs respektvoll zu bleiben.
Titelthema
von Tami von Cysewski | Q2
Ist die Schule ein demokratisches System? Oder anders: Wird die Schule ihrem Anspruch gerecht, mündige Bürger:innen in die Welt zu entlassen? Demokratie und Schule – vielleicht denken hier einige an den Politikunterricht. Aber stärkt das stumpfe Lernen von Gewaltenteilung wirklich das demokratische Selbstverständnis? Und was hat Vandalismus auf den Schultoiletten mit all dem zu tun?
Marina Weisband, Psychologin, Pädagogin, Politikerin und Publizistin, möchte, dass Schule zu einem demokratischen Ort wird. Sie ist überzeugt: Demokratie muss erlernt werden. Daher gründete sie 2014 „aula“, ein digital-gestütztes demokratisches Beteiligungsprojekt für Schulen. Ganz einfach gesagt, bekommen Schüler:innen damit die Möglichkeit, aktiv mitzubestimmen, was an ihrer Schule passiert.
2024 erschien Weisbands Buch „Die neue Schule der Demokratie“, in dem sie unter anderem über die Erfahrungen mit „aula“ berichtet. Dabei geht sie von der Grundthese aus, dass die Schule heute alles andere sei als ein demokratischer Ort: „Wir bringen Kindern bei, sich in ein autoritäres System zu fügen“, sagte Weisband in einem Interview. Ein autoritäres System mit dem Anspruch, lupenreine Demokrat:innen zu erziehen – so ganz passt das nicht. Etwas überspitzt formuliert ist es vielleicht, aber es ist nun mal so, dass sich unser Schulsystem eher durch starre Strukturen auszeichnet als durch wirkliche Mitbestimmung. Und dies hat zur Folge, dass Schüler:innen lernen, sich an das System anzupassen und eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Für einige funktioniert das besser als für andere. Die Belohnung: Noten. Leistungsvergleich als Grundlage unserer Leistungsgesellschaft. Und immer die Botschaft: Wer gute Leistungen erbringt, wer in diesem System funktioniert, der ist gut vorbereitet aufs Leben, dem stehen alle Türen offen. Doch irgendwann kommt eigentlich jeder an einen Punkt, an dem man realisiert, dass im „echten Leben“ ganz andere Fähigkeiten gefragt sind.
Leistungsdruck und fehlende Mitbestimmung münden im schlimmsten Fall in Resignation und Passivität. Marina Weisband nutzt dafür einen Begriff aus der Depressionsforschung: die „erlernte Hilflosigkeit“. Erlernte Hilflosigkeit ist laut Wikipedia die „aufgrund negativer Erfahrung entwickelte Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation verloren zu haben“. Dies trifft,
so Weisband, auf viele Schüler:innen zu, die die Motivation und Fähigkeit verloren haben, etwas zu verändern, eine Art Schutzmechanismus vor Frust. Die Schule führe zu kollektiver erlernter Hilflosigkeit.
Begünstigt durch hierarchische Strukturen im Schulsystem entsteht bei vielen jungen Menschen eine Frustration, die sich bis ins Erwachsenenalter zieht. „Die da oben“, denen man sich ausgeliefert fühlt, die Entscheidungen treffen, während man selbst machtlos ist. Vielleicht klingt das jetzt drastisch, überspitzt, aber dieses Denken fängt bei vielen unterbewusst schon während der Schulzeit an. Man hat das Gefühl, eh nichts ändern zu können, man fühlt sich machtlos, unfähig etwas zu verändern oder auch nur zu widersprechen. Natürlich, es gibt Institutionen wie die SV, wo man sich engagieren kann, aber besonders niederschwellig ist diese Art der Beteiligung nicht. In der Schule steht die Vermittlung von Faktenwissen im Mittelpunkt. Der allgegenwertige Leistungsdruck und Fokus auf die nächsten Klausuren, Arbeiten, Tests, Prüfungen, Abnahmen etc. hat zur Folge, dass Kompetenzen wie kreatives Denken, Problemlösung oder kritisches Hinterfragen weniger vermittelt werden.
Dabei sind Selbstwirksamkeit und Gestaltungswille so zentrale und wichtige Pfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens. Demokratie erfordert, dass Menschen aktiv werden und handeln und nicht nur konsumieren. Etwas, was in einer Konsumgesellschaft, die auf Wachstum und Beschleunigung ausgerichtet ist, nicht so selbstverständlich funktioniert, wie viele denken. Demokratie ist nicht einfach da. Sie muss erlernt werden. Und die Schule ist hierfür ein sehr geeigneter Ort. Wenn man es richtig angeht.
Genau hier setzt das Projekt aula an. Jede teilnehmende Schule bekommt eine eigene Beteiligungsplattform, auf der Schüler:innen ihre Ideen sammeln und schrittweise zu Projekten weiterentwickeln. Grundlage für alle Entscheidungen ist ein Vertrag, der eine Art Verfassung darstellt und in dem sich die Schulkonferenz verpflichtet, mehrheitlich beschlossene Projekte mitzutragen. In ihm wird auch festgelegt, was konkret verändert bzw. beschlossen werden darf und was nicht.
Der Prozess läuft folgendermaßen ab: Auf der Plattform kann jeder seine Idee teilen. Egal was es ist - veränderte Pausenzeiten, neue Handyregeln oder ein Klassen-Hamster - alles wird erst einmal ernst genommen. Moderator:innen (Lehrkräfte) und Junior-Moderator:innen (Lernende)
sorgen dafür, dass nur konstruktives Feedback erfolgt. Alle Ideen werden in der ersten Phase diskutiert und dann zusammengeführt, angepasst und weiterentwickelt. Das alles findet nicht nur im digitalen Raum statt. In sogenannten aula-Stunden präsentieren und diskutieren die Schüler:innen die Projekte. Dann kommt es zur Abstimmung, wobei das Projekt mit den meisten Stimmen in die konkrete Umsetzung geht. Eine „wilde Idee“ zu einem konkreten Projekt zu entwickeln, ist viel komplexer, als viele anfangs denken. Wenn Schüler:innen lernen, mit dieser Komplexität umzugehen, sind sie weniger anfällig für Populismus und politische Vereinfachung. Zudem werden auch die Kompromissfähigkeit und Meinungsbildung gestärkt. Um mit einem Projekt Erfolg zu haben, muss man früher oder später lernen, Widerspruch und Zweifel auszuhalten, was die Resilienz fördert. Durch die klaren Regeln auf der Onlineplattform lernen die Schüler:innen demokratische Kompetenzen im digitalen Raum, was Emotionalisierung und Radikalisierung vorbeugen kann.
Das Projekt aula ist vielleicht kein Wundermittel, aber es kann dazu beitragen, Kompetenzen, die im normalen Schulalltag nicht so zentral sind, zu stärken und damit die Schüler:innen besser auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Ich bin überzeugt, dass es am effektivsten ist, wenn die Schülerschaft sich selbst Grenzen und Regeln setzt. Denn wenn sie als sinnvoll und wichtig erachtet und vor allem selbst erarbeitet wurden, dann werden sie viel eher befolgt.
Kommen wir nun dazu, was Schultoiletten mit all dem zu tun haben: „Es klingt absurd“, schreibt Marina Weisband in ihrem Buch „Die neue Schule der Demokratie“, „aber es sind die einzigen Räume, in denen [die Schüler:innen] unbeobachtet sind und etwas verändern können, die einzigen, in denen sie sich als wirksam erleben. Es sind sozusagen politische Orte.“ Den Vandalismus an vielen Schulen interpretiert sie als einen Wunsch, „den Verhältnissen einen Stempel aufzudrücken“. Ein Ausweg könnte es sein, Schüler:innen echte Wege der Mitgestaltung in der Schule zu bieten – zum Beispiel im Rahmen des aula-Projektes.
„Noch ein weiteres Projekt, das bedeutet doch nur noch mehr Arbeit für uns Lehrkräfte.“ Ein Einwand, der angesichts des Pensums, welches Lehrer:innen zu stemmen haben, nicht von der Hand zu weisen ist. Jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass für eine erfolgreiche Umsetzung von aula nur wenige Lehrkräfte notwendig sind, die das Projekt mittragen und unterstützen. Klar, in der Anfangsphase bedarf es Engagement auch seitens der Lehrkräfte aus, aber langfristig führt es eher zu mehr Selbstständigkeit. Der Hauptakteur bleibt die Schülerschaft, Lehrkräfte haben nur eine unterstützende Rolle.
Eine weitere Sorge könnte ein Gefühl des Kontroll- und Autoritätsverlusts sein. „Was sollen wir denn tun, wenn die Schüler:innen das nicht ernst nehmen und wir das dann mitttragen müssen?“ Eine weitere verständliche Sorge, bei der man sich aber auch die Frage stellen sollte, ab wann junge Menschen denn bereit sein sollen, Verantwortung zu
übernehmen, wenn sie es nie richtig erlernt haben. Je früher man Demokratie direkt erlebt, desto besser. Und meist handeln Schüler:innen als Kollektiv dann auch verantwortungsvoller als befürchtet. Denn am Ende müssen sie ja auch dafür Sorge tragen, das Beschlossene umzusetzen.
Kommen wir zum Schluss zu der wohl wichtigsten Frage: Warum für uns? Oder anders: Wieso würde es sich für unsere Schule lohnen, eine aula-Schule zu werden?
Als ich vor knapp einem Jahr durch einen Podcast das erste Mal von dem Projekt gehört habe, fand ich es sofort interessant. Ich habe mich mehr informiert, das Buch “Die neue Schule der Demokratie” gelesen und Marina Weisband auch live auf der PhilCologne gehört. Dazu kam dann der Unmut, den ich unter meinen Mitschüler:innen wahrgenommen habe. Die Art und Weise, wie die Handyregelungen zustande gekommen sind, hat für viele Diskussionen gesorgt und vor allem hat sich ein Gefühl der Machtlosigkeit ausgebreitet. In dieser Zeit ist mir aula wieder eingefallen, da ich mir sicher bin, dass die Schüler:innen gerne mehr Mitspracherecht bei der Entwicklung einer Handyregelung gehabt hätten. Ein sehr gutes Projekt für aula. Ich hoffe wirklich, mit diesem Artikel etwas bewegen zu können. Dass ihr, die ihr das hier lest, das Projekt genauso interessant findet wie ich, euch weiter informiert und es vielleicht in Zukunft ein Teil unserer Schule wird.



März 1969
5 Monate bevor mein Dede nach Deutschland kam. Am 12.08.1969 kam er an und am 18.08 hieß es „an die Arbeit“.
ziell besser aufbauen zu können. Was der Künstler damals jedoch nicht wusste, ist, dass dieses Lied nicht nur bei den Arbeitern, sondern auch bei deren Kindern und Enkelkindern ankommen wird. Obwohl das Lied eine relativ positive Melodie trägt, ist der Text, der oben übersetzt wurde, umso bedrückender. Eine Welle der Nostalgie übermannt einen meistens. Hier bin ich als die Enkelin meines Dedes die Ausländerin, aber zurück in der Heimat die Almanci, also die Deutsche. Trotzdem sind viele wie ich mit Geschichten aus der Heimat aufgewachsen. Schon als Kind pflegten wir eine Verbindung zu dieser Kultur. Lebenslanges Fremdsein in die Wiege gelegt also. Und trotzdem füllen sich unse-


re Augen mit Tränen, wenn wir an diese Lieder, an diese Gedichte und an die Geschichten aus der Heimat denken. Vierte Generation hier und wir sind immer noch nicht willkommen. Heimweh und das Gefühl eines fehlenden Zugehörigkeitsgefühls prägen bis heute auch mein Leben.

Erste Mietwohnung nach Gastarbeiterunterkunft (Severinstraße)


Auch ich nenne es Gurbet, weil ich leider nichts anderes kennenlernen durfte. Die ständige Existenz zwischen zwei Welten. Die Almanci und die Ausländerin. Eine Rolle der Diplomatin zwischen zwei Kulturen, die weiterhin auch für die kommenden Generationen eine Last darstellen wird. Es ist eine Kunst für sich, in diesem Heimweh eine eigene Heimat für sich zu finden.
Gurbet ist ein Teil meiner Kultur. Sei es in meiner Musik, in meinen Filmen oder in meinen Gedichten. Meine Generation findet die fehlende Heimat in Gurbet.
Genau deshalb bleiben wir hartnäckig. Mein Dede ist nicht umsonst hierhergekommen. Mein Dede hat nicht all das durchgemacht, damit ich als ein Teil der deutschen Gesellschaft mir ansehen muss, wie wir kurz davorstehen, eine dunkle Vergangenheit zu wiederholen. Wir bleiben hier, einige meiner Wurzeln habe ich nämlich auch hier verankert. Für uns, für unsere Familien, für die nächste Generation. Wir bleiben, weil wir Hoffnung haben – Hoffnung darauf, dass unsere Stimmen irgendwann lauter werden als die des Hasses.
Folgendes Zitat möchte ich euch allen noch mitgeben: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen” - Musa Deli
1 Dede: Großvater
2 Gurbet: stammt ursprünglich vom türkischen Wort für „auswandern” ab; Synonym für das fremde Land Deutschland
Fotos: Eigene Familienaufnahmen
von Emily Zeinar | EF
Während meines Auslandsjahres habe ich an zwei verschiedenen Orten in der sogenannten „Bay Area“ gewohnt. Bis zum Wahltag lebte ich in der Kleinstadt Benicia, die direkt an der Westküste liegt, als äußerst sicher gilt und relativ wohlhabend ist. Später zog ich nach Vacaville, das ländlicher gelegen ist und meinem Empfinden nach etwas konservativer wirkt. Obwohl in beiden Orten zu ca. 60 % demokratisch gewählt wird und sie nur 30 Minuten auseinander liegen, konnte ich dennoch einen großen Unterschied in der Mentalität wahrnehmen. Die Disparitäten1 in diesem Land sind sehr hoch, weshalb man meine Beobachtungen und Gespräche keinesfalls verallgemeinern kann.
September 2024 – Der Wahlkampf ist in vollem Gange, von Tag zu Tag werden mehr Plakate aufgehängt und Wahlwerbespots laufen im Fernsehen rauf und runter. An meiner Highschool fällt jedoch kein einziges Wort darüber. Politikunterricht, wie es ihn an deutschen Schulen seit der 5. Klasse gibt, ist hier nicht zu finden. Fast krampfhaft wird dem Thema aus dem Weg gegangen. Ich komme mit mehreren Jugendlichen ins Gespräch und frage sie, warum das so ist: „Zu kontrovers, zu emotional und niemand glaubt wirklich daran, dass politische Bildung neutral vermittelt werden kann.“
Jugendliche und Nationalstolz
US History-class am Donnerstagmorgen. Überall hängen US-Flaggen, frühere Präsidenten und „Uncle Sam“, ein Maskottchen in Form eines klassischen amerikanischen Opas, das dich dazu einlädt, dem Militär beizutreten.
Überall Zeichen des Nationalstolzes und des „American Dream“ - aber wie sehr glauben meine Mitschüler:innen wirklich daran? Nationalstolz, Militär und ein Mann an der Spitze - ist das wirklich der Kern der Vereinigten Staaten?
„All clichés about America are true, it’s a hate-love relationship“ (Alle Klischees über Amerika sind wahr, es ist eine Hassliebe), sagt der sechzehnjährige Juno.
„Bist du stolz auf die USA?“ frage ich Eric, dessen Eltern beim Militär arbeiten.
„Of course.“ (Natürlich.)
„Gehören die USA zu den besten Ländern der Welt?“, will ich anschließend wissen.
Eric erwidert: „Yes, we are the richest country, we have a lot of freedom and privileges and if you work really hard, you can make it here.“ (Ja, wir sind das reichste Land, haben viele Freiheiten und Privilegien und wenn man hart arbeitet, kann man hier Erfolg haben).
1 Disparitäten: Ungleichheit; Verschiedenheit
Die größten Sorgen
Ich frage die verschiedensten Leute immer wieder, was das Erste wäre, das sie in den USA verändern würden, wenn sie könnten. Fast immer wird Obdachlosigkeit als ein großes Problem genannt. Ich stimme zu – wenn man durch Oakland und San Francisco fährt, sieht man überall Zeltstädte. Auch Inflation ist ein häufig genanntes Problem. Egal, ob Demokraten oder Republikaner – viele finden, dass die Einwanderungspolitik besser reguliert werden sollte. Obwohl viele eher liberal eingestellt sind, kritisieren sie, wie die Demokraten mit dem Thema umgehen.
Kalifornien vs. der Süden
Kalifornien gilt als besonders liberal. Morgens interessiert sich kaum jemand dafür, den Treueeid, der an den meisten Schulen auf der Tagesordnung steht, aufzusagen oder die Flagge anzusehen. Viele Lehrer:innen haben Pride-Flaggen in ihren Klassenräumen und meiner Erfahrung nach gibt es mehr offen(sichtliche) trans- oder nicht-binäre Menschen als an deutschen Schulen. Schüler:innen kleiden sich auffälliger, ohne dass es jemanden stört.
Meine Freunde in den Südstaaten hingegen erleben eine völlig andere Realität. Die Mehrheit ist dort christlich und republikanisch. Nicht an Gott glauben? Besser schweigen, um nicht mit Anfeindungen konfrontiert zu werden. Lehrer:innen verlieren ihre Lizenz, Schüler:innen können suspendiert werden, wenn sie über Homosexualität oder Abtreibung sprechen.
Eigenverantwortung statt Sozialstaat Immer wieder versuche ich zu verstehen, warum Dinge, die für mich als Deutsche selbstverständlich sind, hier so unfassbar kontrovers sind. Die Sorgen um Krankenversicherungen und Studiengebühren gibt es in Deutschland nicht, weil wir uns an ein System von staatlicher Fürsorge und Versicherungen gewöhnt haben, dass es in den USA nicht gibt.
Schon seit der Gründung der Vereinigten Staaten spielt Eigenverantwortung eine große Rolle. Besonders Konservative sehen die individuelle Freiheit durch einen großen Sozialstaat, wie es ihn in Deutschland gibt, bedroht. Immer wieder haben Demokraten versucht, eine gesetzliche Krankenversicherung durchzusetzen und sind gescheitert – zuletzt Obama. Die Vorstellung, dass man selbst für die eigene Gesundheit und die seiner Familie sorgt und somit auch die Verantwortung für das eigene Verhalten trägt, ist ein fester Bestandteil der amerikanischen Tradition.
2 Area 51: militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada im Besitz der United States Air Force und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Fotos im Artikel: Eigene Aufnahmen
Politik und Misstrauen
In jedem Gespräch, egal ob mit Demokraten oder Republikanern, Jugendlichen oder Erwachsenen - immer schwingt ein gewisses Misstrauen gegenüber der Politik in Washington D.C. mit. Mir wird immer bewusster, dass da etwas ist, dass die US-Regierung auszeichnet und sie für mich als Europäerin fremd erscheinen lässt. Während ich durch Washington D.C. laufe, durch die Flure des Senats und schließlich vor dem imposanten weißen Kapitol stehe, das an einen antiken Tempel erinnert, verstehe ich, was es ist: Alles wirkt irgendwie mysteriöser. Die Geheimhaltungskultur durch Geheimdienste wie die CIA, das präsidentielle System, das Entscheidungen auf eine einzelne Person konzentriert, geheime militärische Projekte wie Area 512 oder Hyperschallwaffen – all das verstärkt das Gefühl von Verschwiegenheit und Machtkonzentration. Natürlich bin ich mir bewusst, dass auch die deutsche Regierung Dinge geheim hält, aber alles wirkt transparenter. Die gesamte Inszenierung ist einfach eine andere.
Der Staat als Unternehmen – „He is a businessman.“
Ich frage Personen, von denen ich einen eher konservativen Eindruck bekomme, nie direkt, ob oder warum sie Trump wählen, sondern welche Qualität ihn aus ihrer Sicht zu einem guten Präsidenten macht. Mindestens ein Dutzend Mal höre ich: „He is a businessman.“

Das impliziere, er könne mit Zahlen umgehen, pragmatisch, clever und logisch sein, während man aus Washington immer nur “Diversität” und “LGBTQ-Rechte” höre. Kritisiert wird, dass Bidens Regierung sich auf Minderheiten fokussiere statt auf die Interessen der Mittelschicht. Man möchte, dass das Land wie ein Unternehmen geführt wird, mit Fokus auf nationale Sicherheit und wirtschaftliches Wachstum. Damit verknüpft ist der Wunsch, das Eingreifen des Staates in das Leben des Einzelnen klein zu halten.
„Wir gegen die“
Themen wie Waffenbesitz, Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe bestimmen oft die Parteizugehörigkeit. Ein großer Teil davon, sich bspw. als Demokrat zu identifizieren, ist es, kein Republikaner zu sein – das schafft eine „Wir gegen die“-Mentalität.
Laut Studien des Pew Research Centers reden Menschen zunehmend aggressiver über Anhänger der jeweils anderen Partei. 62 % der Republikaner halten Demokraten für „faul“. 60 % der Demokraten halten Republikaner für „unmoralisch“ und „unehrlich“. Gut die Hälfte beider Lager hält die jeweils andere Seite für „dumm“.
Die Debatte Präsidentschaftsdebatte – Dienstag, 10. September, 17:45 Uhr in Benicia. Ich sitze in einem Wohnzimmer mit Blick auf die Bucht. Drei ältere Damen (Cheryl, Wanda und Gail) schauen gespannt CNN, als der Countdown für die
Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris läuft. Die Moderatorin fragt Trump nach seiner Haltung zur Abtreibung. Er weicht aus und behauptet stattdessen, die Demokraten würden Abtreibungen im neunten Monat legalisieren und Babys nach der Geburt töten – eine glatte Lüge. Die Damen lachen bitter. Sie wissen: Für viele in diesem Land sind Trumps Worte Fakten.
Alles wird live faktengecheckt, doch seine Anhänger:innen prüfen es nicht nach. Für sie ist sein Wort Gesetz. Dennoch sind die drei Frauen hoffnungsvoll.
Cheryl schüttelt den Kopf: „I believe in Kamala’s strength and that she is ready for this.“ (Ich glaube an Kamalas Kraft und dass sie bereit ist).
Gail fügt hinzu: „I will send out postcards to Pennsylvania to convince people to vote.“ (Ich werde Postkarten nach Pennsylvania schicken, um Leute zum Wählen zu bewegen).
Wanda lacht trocken: „Even my dog hates Trump.“ (Selbst mein Hund hasst Trump).
Cheryl hebt ihr Weinglas: „You know who’s gonna save us? It is going to be women.“ (Weißt du, wer uns retten wird? Es werden Frauen sein).
Fragile Demokratie
Trump gewinnt die Wahl. In meiner High School ist das mulmige Gefühl am Tag nach der Wahl deutlich zu spüren. Manche feiern, manche haben Angst.
Am 20. Januar wird Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident vereidigt. Mein Tag endet damit, dass ich sehe, Ich ...


wie Elon Musk im nationalen Fernsehen einen Hitlergruß macht. Niemand holt ihn von der Bühne.
„Das war kein Hitlergruß.“
„Das war ein Versehen.“
Selbst deutsche Medien sprechen von einem „vermeintlichen“ Gruß. In Deutschland wäre er sofort von der Bühne geholt worden und hätte eine Anzeige bekommen.
Der Wahlkampfpopulismus und Trumps neue Regierung haben dieses Land verändert und als Demokratin, als Europäerin, ist es hart, das mit anzusehen. In ein paar Monaten verlasse ich dieses Land wieder, aber auch Europa wird anders sein, als ich es zuletzt vorgefunden habe. Trumps
neue Regierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Europa zu spalten und sowohl Musk als auch J.D. Vance, der Vizepräsident, werben für die AfD. Ob in den USA oder in Deutschland - Demokratie ist nicht selbstverständlich, die Geschichte liefert genügend Beweise dafür, wie schnell sie in Schutt und Asche liegen kann. Wir haben die Verantwortung, das zu verhindern. Wir müssen darauf achten, wie wir über und miteinander sprechen, und sind nach unserem Grundgesetz sogar dazu verpflichtet, damit die Würde des Menschen für immer unantastbar bleibt.













„The
Am 17. Dezember 2024 wurde Donald Trump zum 47. Präsidenten und JD Vance zum 50. Vizepräsidenten gewählt. Doch wie geht es eigentlich den Jugendlichen und jungen Erwachsenen damit?
Ich habe mit Liam Mason, einem entfernten Familienmitglied, über die politische Situation und die Ergebnisse der Wahl gesprochen. Liam hat meine Fragen schriftlich beantwortet; ich habe ihm die Fragen im Dezember 2024 geschickt. Liam ist 19 Jahre alt und studiert an der Universität.
What is your name and can you briefly introduce yourself to us?
I’m Liam Mason, a 19-year old from Arlington, Virginia.
Where do you study and what type of school/college is it?
I’m a Music Major in my second year at Wesleyan University. Wesleyan is a small liberal arts college with an open curriculum.
Do you discuss the political situation in class (at home, with your friends)? What are your experiences?
Despite being a music major, I have taken many classes throughout the humanities, in departments such as History, Sociology, and African American studies. We discuss contemporary politics frequently, as many sensational events in American politics have occurred concurrent with related classes. For example, in a class focusing on the colonial role of universities called Abolitionist University Studies, we discussed American universities’ collaborations with Israeli universities in the genocide of the Palestinian people as well as the impact the election of Donald Trump would have on the obligations of schools to police student protest.
We had a „Junior-Election“ at our school. It was a simulation of the real elections. It was fun and interesting to get to know the political interests of my classmates. Are there similar programs in the US you know about?
I have heard of similar things in the United States, where middle school students simulate ongoing elections, however



KI-generiert
I have never experienced such a program during my schooling. I recall a civics class in my freshman of high school where the teacher had each student first determine where they think they fall politically, and then fill out an online “political compass” test. The test would place you on a point in a “political compass” with an x axis of Left Wing to Right wing and a y axis of Authoritarian to Libertarian. This test was the first time I was confronted with certain political ideas, and I think it’s interesting that my answers based on instinct to lofty political questions pertaining to such things as, for example, the right to private ownership of land, align now with answers I’ve reached after much more research on these topics.
In 2024 for the first-time voters aged 16 and over were able to vote in the European Elections. The goal was more political participation for young people. What do you think would be the right age for voting in the US? Do you think that the interests of young people are currently being taken into account enough?
I think that sixteen marks a generally good voting age. I think that the United States takes an especially authoritarian, discriminatory stance when it comes to the treatment of young people across the board. Children, rather than being seen as people by the government, are effectively the property of their parents. We’ve seen how something as simple as allowing younger people to drink with their family in Europe can prevent some of the binge drinking that occurs in America when young people come of age, and I think changing voting laws could have a similar effect. If Americans, at a younger age, were taught to responsibly vote, not only would their personhood be respected but they would learn to participate in electoral politics more responsibly as they grow older. I mean, in America, a 16-year old can drive a three ton lifted pickup truck and join the ROTC to prepare to enlist in the army, but cannot vote. Clearly the interests of young people are not taken into account in America—for example, the youth are the most pro-Palestinian segment of









the population, and yet neither viable party in America has ceased unequivocal support of Israel. Other issues young people care about, like raising the minimum wage, providing universal healthcare, free college and so on are spat on my politicians across party lines.
In the European elections, there was a significant shift to the right, especially among young people. What is the mood among young people in the United States regarding the results of the elections?
While I can’t speak for the mood of the entire country, I can say that on my left-leaning campus most people were rather despondent following the election. There was a mood of tragic defeat, though most people were unsurprised. Many young people in America, especially men, are turning to the right wing, as conservatives appeal to men’s despair by pointing their anger towards minority groups and women. Young men are promised that the state of their lives isn’t their fault, but that their deserved jobs have been taken by immigrants, their women by Feminism, and so on. Unemployed men, for example, can thereby be made furious at immigrants rather than at predatory employers or a government/economy which fails to provide them work, and so the system can continue operation without opposition.
I don’t think too many young people will be radicalized to the left wing by the results of this election as they were in 2016, seeing as Trump has already been president once and Biden + Kamala completely failed to galvanize the youth, but we will have to see if certain brutal policies change the attitudes of young people.
What do you think about how the U.S. election went?
I think that this was bound to be the result of a continued Democratic support of establishment neoliberalism. As the spokesperson of a terribly unpopular moderate Democrat administration facing a populist Republican, Kamala continued to reinforce her support for the rule-of-law and a harsh border policy, refusing to embrace any left-wing policy. The


election’s results are tragic, as Trump will endanger marginalized people (Transgender people, Black people, Indigenous people, Palestinian people, immigrants, women, etc.), however ultimately unsurprising as the Democrat alternatives hardly presented any material support of those marginalized people which might have generated a passionate base. It’s important to consider that Trump didn’t get many more votes than he did in 2020, just that Kamala got many fewer votes than Biden did in 2020. The ultimate failure was a conservative attempt by Democrats to court moderate Republicans rather than undecided potential voters as Kamala promised to maintain order rather than change anything in a year where people demanded change. I would argue that this came because the Democratic establishment is just as beholden to corporate interests (as corporate entities donate millions to their campaigns through dark money channels like SUPERPACS) as the Republican establishment, and so will never actually argue for the left-wing economic upheaval that would galvanize struggling non-voters.
What issues do you think the new U.S. government should address in the future?
I would contend that there is no new U.S. government, just another uglier figurehead helming the same machine. As the previous administration did not address my concerns, and this administration is more conservative, I am not especially hopeful that the U.S. government will address the issues I take seriously. Those issues include but are not limited to housing homeless people, providing universal healthcare and a strong social safety net, protecting women and transgender people through ensuring access to healthcare (including protecting abortion and gender reassignment), the abolition of a horrific prison system which maintains slave labor while rejecting rehabilitation, the abolition of a violent police system which continues to terrorize Black Americans, and the protection of those facing genocide globally.

Bild: KI-generiert

von Ayda Savluk | 5A
Kinderrechteschulen sind Schulen, die eine Ausbildung gemacht haben. Doch was ist eigentlich diese Ausbildung? Die Ausbildung ist für Grundschulen. In diesen Grundschulen wird mehr auf die Meinung von Kindern aufgepasst. Dadurch wird die Schule durch die Meinung der Kinder verändert. An den Schulen werden die Vorschläge der Schüler:innen in die Realität umgesetzt. Natürlich funktioniert nicht alles, aber die Schulen versuchen, das meiste umzusetzen. In Deutschland gibt es Kinderrechteschulen seit 2015. Es sind insgesamt 190 Schulen. Unter anderem die Grundschule “Freiherr Spiegel” in Halberstadt, die FriedrichWöhler-Schule in Kassel, die Grundschule an der Marie in
Berlin und noch ein paar andere. Es gibt insgesamt 54 Kinderrechte, die in solchen Schulen umgesetzt werden. Die wichtigsten sind das Recht auf Gesundheit und Bildung. Es ist vor allem wichtig, dass es Kindern an den Schulen gut geht. Leider ist das nicht immer der Fall. Viele Kinder leiden unter Mobbing, weil sie zu dick sind, keine Freunde haben oder anderes. Ich finde es nicht in Ordnung, andere Kinder zu mobben oder runterzumachen, nur um cool zu sein. Man sollte zueinander nett sein. Denn Mobbing ist ein Teil von Hass, der leider immer wieder in der Schule auftaucht.
In einer Welt, in der oft Ungerechtigkeit und Konflikte auftreten, ist es wichtig, dass Menschen nicht einfach wegschauen, sondern auch aktiv eingreifen. Genau das möchte das neue Schulfach „Zivilcourage“ vermitteln. Es geht darum, jungen Menschen beizubringen, wie sie in schwierigen Situationen das Richtige tun und Verantwortung übernehmen können. Ziel ist es, Schüler:innen zu ermutigen, sich für andere einzusetzen und nicht nur tatenlos zuzusehen, wenn etwas Ungerechtes passiert.
Was lernen wir im Fach Zivilcourage?
Wir lernen, wie wir uns in verschiedenen Alltagssituationen verhalten können. Dabei geht es aber um mehr als Theorie - wir sollen Fähigkeiten entwickeln, die wir tatsächlich im Leben nutzen können.
Was sind die wichtigsten Themen?
1. Verantwortung übernehmen: Wir sollen verstehen, wie wichtig es ist, sich für andere Menschen einzusetzen und zu helfen, wenn jemand in Not ist.
2. Konflikte lösen: Wir lernen, wie man in schwierigen Momenten ruhig bleibt, gut kommuniziert und Konflikte löst.
3. Projekt zum sozialen Engagement: Wir beschäftigen uns mit den Menschen oder Institutionen, die Zivilcourage zeigen, und helfen bzw. engagieren uns in dem sozialen Bereich. Ein Beispiel dafür sind die Edelweißpiraten.
Was ist das Ziel?
Das Hauptziel ist es, den Schüler:innen zu zeigen, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und aktiv etwas zu tun. In einer Welt, in der oft über Mobbing, Diskriminierung sowie Gewalt gesprochen wird, ist es besonders wichtig, dass junge Menschen lernen, nicht einfach zuzusehen, son-
EIN NEUES SCHULFACH FÜR EINE STARKE UND FRIEDLICHE GESELLSCHAFT
von Ida Stüwe und Inela Sogorovic | 9B

dern zu handeln. Zivilcourage bedeutet, für das Richtige einzutreten, auch wenn es manchmal schwierig oder unangenehm ist. Wir Schüler:innen sollen verstehen, dass wir nicht machtlos sind, sondern durch unser Handeln einen Unterschied machen können.
Das Projekt:
Ein besonders wichti- ges Beispiel für Zivilcourage sind die Edelweiß- piraten, eine Gruppe von Jugendlichen, die im Zweiten Weltkrieg gegen das Nazi-Regime kämpfte. Die Edelweißpiraten stellten sich gegen die Ge- walt und Unterdrückung der Nazis, obwohl dies ge- fährlich für sie war. In dem Projekt haben wir also die Institution, die sich für die Erinnerung an die Edelweißpiraten engagiert, unterstützt. Dafür ha- ben wir Spenden gesammelt, Interviews geführt, Präsentationen gemacht usw. Es gab natürlich auch andere Gruppen, die sich mit anderen Institutionen auseinandergesetzt haben wie z.B. Hilfe im Altersheim, Hilfe bei Hungersnot. Es wurden auch Videos, die einem Theaterstück ähnelten, aufgenommen und dann vorgetragen.
Im Rahmen des Unterrichts lernen wir, wie Jugendliche in einer schwierigen Zeit mutig Widerstand geleistet haben. Wir erfahren, warum Zivilcourage auch damals so wichtig war, und was jeder von uns heute tun kann, um gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung zu kämpfen.



(nachbearbeitet):












von Hannah Mans | 7B
In der Courage-AG beschäftigen wir uns wöchentlich mit Themen wie Rassismus, Sexismus und Vorurteilen in der Gesellschaft. Wenn man sich unsere Schule vorstellt, gehört dies auch fest dazu. An unserem Stand haben wir mit unterschiedlichen Stationen versucht einen Zugang zu diesen Themen zu schaffen. Unsere Besucher:innen und die Kinder hatten unterschiedliche Möglichkeiten sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Von kreativ bis interaktiv war alles dabei:
Die nächste Station beschäftigte sich mit den Herausforderungen, die Menschen haben, wenn sie in einem neuen Land ankommen. Den Teilnehmer:innen wurden verschiedene Mathe-Aufgaben auf Alt-Arabisch vorgelegt, die sie lösen mussten. Als einzige Hilfestellung stand ein arabisch-deutsches Wörterbuch zur Verfügung. Dies führte meist zu Verwirrung oder auch zur Verzweiflung. Die Teilnehmer:innen bekamen so ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, in einem Land lernen und arbeiten zu wollen, wenn man die Sprache noch nicht beherrscht.
An der letzten Station wurden unterschiedliche Bilder, die Sexismus oder Rassismus verdeutlichten, mit einer Oberstufenschülerin besprochen und erklärt. Ziel war es, die Teilnehmer:innen für Situationen zu sensibilisieren, in denen Menschen Diskriminierungserfahrungen machen. So schafften wir es insgesamt, an diesem Tag einen spielerischen Zugang zu diesen komplexen Themen zu ermöglichen und Menschen zum Nachdenken anzuregen.
Begrüßt wurden die Kinder an einer Station, die sich mit der Herkunft und Bedeutung ihrer Namen beschäftigt hat. Dies diente zum einem dazu, eine vertrauliche Basis zu schaffen und bot zum anderen Platz für die Individualität der Kinder. Sie nannten uns ihren Namen, daraufhin wurden dessen Bedeutung ermittelt und gefragt, ob sie bereits Vorurteile aufgrund ihres Namens erlebt haben. Nach der Begrüßung konnten die Kinder wählen, welche Station sie als nächstes besuchen mochten. Wurde die kreative Station gewählt, wurde erstmal erklärt, worum es dort geht. An dieser Stelle konnte man Miniatur-Denkmäler für die Edelweißpiraten gestalten. Diese orientierten sich an dem Denkmal, das bald am Leipziger Platz errichtet wird. So nahmen sie eine Erinnerung an den Widerstand dieser wichtigen Kölner Gruppe mit nach Hause. Der nächste Schritt war die Station mit verschiedenen Vorurteilen. Konkret mussten die Teilnehmer:innen verschiedenen Namen Adjektive zuordnen, die sie mit diesen in Verbindung brachten. Dies zeigte, wie jeder Mensch Vorurteile hegt, und schuf einen Raum für Selbstreflexion. Zudem schärfte es das Bewusstsein dafür, dass wir alle oft unbewusst Vorurteile haben.

von Ayla Basar | 7B
Songkonzept: Warum haben wir diesen Song geschrieben?
Der Song behandelt verschiedene Formen von Diskriminierung, darunter rassistische Diskriminierung, Geschlechterdiskriminierung sowie Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Herkunft. Wir möchten darauf aufmerksam machen, wie sich Diskriminierung in all ihren Facetten auf Betroffene auswirken kann. Unser Ziel ist es, eine Botschaft des Zusammenhalts und des Widerstands zu vermitteln. Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die sich hilflos fühlen, und ihnen zeigen: Ihr seid nicht allein! Viele Menschen müssen sich in ihrem Leben mit Vorurteilen und Verurteilungen auseinandersetzen. Doch damit ist Schluss! Wir lassen uns nicht länger unterkriegen. Wir sind hier und wir verschaffen uns Gehör!
Texterstellung: Wie entstand der Songtext?
Die Lyrics setzen sich intensiv mit verschiedenen Formen der Diskriminierung auseinander. Wir haben mit Betroffenen gesprochen, die uns ihre Geschichten erzählt haben, und eigene Erfahrungen, Ängste und Gefühle in den Songtext einfließen lassen. Dadurch liegt uns dieser Song besonders am Herzen. Wir verstecken uns nicht mehr – wir zeigen, dass wir da sind und dass wir immer wieder aufstehen, auch wenn es schwierig wird. Im Refrain betonen wir, dass niemand allein ist und es immer Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann. Niemand sollte in Angst leben oder sich für sein Aussehen oder seine Individualität schämen. Auch wenn man manchmal denkt, dass niemand einen so akzeptiert, wie man ist, gibt
es immer jemanden, der sich freut, dass du in seinem Leben bist – glaubt uns!
Ein großer Dank gilt allen, die mit uns an diesem Song gearbeitet und ihre Geschichten geteilt haben. Der Song handelt von Unterstützung und Zusammenhalt – genau das war auch bei der Produktion entscheidend. Es gab natürlich Diskussionen, aber am Ende haben wir gemeinsam etwas Großartiges geschaffen: einen Song, ein besonderes Erlebnis und eine starke Gemeinschaft.
Musikalische Komposition: Welches Genre hat der Song?
Unser Song lässt sich keinem bestimmten Genre zuordnen. Tatsächlich haben wir eine Art eigenes Genre geschaffen, das jedoch am ehesten dem Hip-Hop zuzuordnen ist. Die Musik transportiert die Botschaft mit besonderem Ausdruck und Stil. Der Song ist klar strukturiert. Die Hook wiederholt sich mehrmals und dient als Anker, indem sie darauf hinweist, dass wir in unseren Herzen alle gleich sind. Dann gibt es die Strophen, die jeweils eine andere Perspektive auf das Thema Diskriminierung bieten. Eine Person schildert aus ihrer Sicht, wie sich Diskriminierung anfühlt: „Du weißt doch gar nicht, was das mit mir macht, wenn du diese Worte zu mir sagst. Eigentlich sagst du mir, es ist schlimm, so zu sein, wie ich bin.“ Dadurch wird das Thema vertieft und aus verschiedenen Lebensrealitäten beleuchtet. In den verschiedenen Strophen werden zudem Rap-Passagen eingebaut, die sich mit Themen wie Homophobie1, Antifeminismus und Rassismus beschäftigen.



Scannt den QR-Code für die Audiodatei unseres Songs


Unseren Auftritt findet ihr auch als Video unter: https://t1p.de/vlvuo
Produktion
Hinter der Produktion stehen drei engagierte Lehrkräfte, die uns von Anfang an unterstützt und ermutigt haben, weiterzumachen. Ein großer Dank geht an Herrn Guth, Frau Röder und Herrn Knepel. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen.
Der Song wurde von Schüler:innen der heutigen Jahrgangsstufen 7 und Q2 (zum Zeitpunkt der Entstehung noch 6 und Q1) geschrieben, gesungen und umgesetzt. Dabei erhielten wir auch Unterstützung aus anderen Jahrgängen. Die Ent-
stehung des Songs war ein gemeinschaftlicher Prozess, der von Kooperation und gegenseitiger Inspiration geprägt war.
Veröffentlichung und Wirkung
Unser Song wurde im Rahmen des kreativen Wettbewerbs „Dissen – nicht mit mir!“ anlässlich des Jugend- und Schülergedenktages am 29.01.25 in der IGIS (Integrierte Gesamtschule Innenstadt Köln) präsentiert.






von Anton Schwinden und Rifat Taka | 7D
Politik? Ist doch voll langweilig. Oder...?



Letztes Jahr zeigten allerdings die Schüler:innen des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums großes Interesse an diesem Thema! Für viele war es bisher eine ferne Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche wählen - seit dem Jahr 1999 aber ist genau dies möglich: Die Juniorwahl ist eine Wahl, die extra für Schüler:innen ab der siebten Klasse organisiert wird. Die Juniorwahl will das Interesse der Jugendlichen für die Politik fördern. Sie soll auch den Schüler:innen die Funktionsweise von Wahlen vermitteln und diese sollen sich durch die Juniorwahl ihre eigene Meinung bilden.
Wie lief die Wahl 2024 ab?



Mit jeder gründlichen Besprechung im Unterricht rückte der Tag der Wahl immer näher.






Zuerst mussten noch Wahlhelfer:innen gefunden werden. So bekamen wir alle die Chance, am großen Schulprojekt mitzuwirken.
Dann kam der Tag der Wahl. Die Schüler:innen wurden klassenweise aufgerufen und dann zur Wahl begleitet. Nach dem Vorlegen des Schulausweises bekam jeder einen Stimmzettel, konnte die Wahlkabinen betreten und wählen. Nach Einwurf des Stimmzettels in die Wahlurne konnten die Schüler:innen gehen. Die Juniorwahl war natürlich frei und geheim.



Nun war die Juniorwahl für die Wähler:innen zu Ende, doch für die Wahlhelfer:innen begann gerade erst die Arbeit. Im Gebäude der Blücherstraße kamen alle Stimmzettel an. Nun begann das Auszählen der Stimmen. Gruppenweise wurden die Parteien ausgezählt.



Fandest du, dass deine Stimme wichtig oder eher unwichtig bei der Juniorwahl war?






Muhammed: Ja, eher wichtig, weil die Meinung der Kinder wichtig ist und wir Kinder sind die Zukunft.
Würdest du dir wünschen, die Juniorwahl nochmal durchzuführen?
Muhammed: Ja, wenn die Wahl ernst genommen wird.


Würdest du nächstes Mal gerne Wahlhelfer sein?
Muhammed: Nein, eher nicht. Es könnte vielleicht spannend sein, aber es ist mir zu viel Arbeit.



Was war das Beste als Wahlhelfer:in?


Antwort erste Person: Mir hat es am meisten Spaß gemacht, die Stimmen auszuzählen.
Antwort zweite Person: Mir hat die Zeit beim Wählen Spaß gemacht, das heißt die Stimmzettel auszuteilen und die Kinder, die gewählt haben, abzuhaken.

Wie hat es sich angefühlt, ein Teil der Juniorwahl zu sein?


Antwort erste Person: Es hat sich gut angefühlt, dass man zur Demokratie beiträgt und dass man Verantwortung für die Wahl übernimmt.
Antwort zweite Person: Es war eine besondere Ehre, die auch am Ende mit einer Urkunde versehen wurde.
Würdest du es weiterempfehlen, Wahlhelfer:in zu sein und wieso?



Antwort erste Person: Ja, weil es Spaß macht, der Demokratie hilft und weil man danach genau weiß, wie eine Juniorwahl abläuft.


Antwort zweite Person: Ja, weil es eine Chance ist, die nicht jeden Tag kommt und da dies ein wichtiger Grundstein der Demokratie ist.

Vorbereitung zur Wahl
Wir sitzen im Raum 023 und machen eine Namenslernrunde. Herr Müller-Sun betreut uns. Wir fangen heute erstmal damit an, die Wahlberechtigungen für alles Schüler:innen zu schreiben. Für eine Klasse dauert es echt sehr lange und es gibt ungefähr 950 Schüler:innen an dieser Schule und jede:r bekommt eine persönliche Wahlbenachrichtigung. Auf der steht, wann und wo man zum Wählen hingehen muss.
Die Wahl
Heute ist es so weit: Die Juniorwahlen finden statt. Während alle Schüler:innen Mathe, Deutsch oder Englisch haben, arbeiten wir (die Wahlhelfer:innen) in der GNS oder in der BLÜ. Es ist 8:00 Uhr, die ersten Klassen dürfen wählen. Wir müssen für alle Schüler:innen im Wahlverzeichnis eintragen, ob sie wählen, nicht wählen wollen oder krank sind. Dann bekommen alle einen Stimmzettel und warten, bis die Wahlkabinen frei sind. Die Wahlen sind geheim. Deswegen achten wir darauf, dass die Schüler:innen, die vor der Wahlkabine warten, auch hinter der Linie stehen. Nachdem sie ihre Erst- und Zweitstimmen eingetragen haben, legen sie sie in die Wahlurne. Während es langsam heller wird und die Schüler:innen nach der Pause in ihre Klassenräume gehen, helfen wir immer noch bei den Wahlen. Die Zeit vergeht schnell, zwischen den Schichtwechseln sind wir konzentriert dabei. Als alle Klassen gewählt haben, ist der Wahltag zu Ende.
Für fast alle Schüler:innen:
Am Nachmittag
Die Wahlhelfer:innen, die die Wahl den ganzen Tag begleitet haben, und ein paar Freiwillige fangen an, die Stimmen auszuzählen. Als erstes haben wir die Stimmzettel in gültig und ungültig aufgeteilt. Das bedeutet, wir haben geguckt, welche Stimmzettel auf jeder Seite ein Kreuz haben. Wenn zum Beispiel irgendetwas darauf gemalt wurde oder mehrere Kreuze gemacht wurden, ist der Stimmzettel ungültig. Das allein hat soooo lange gedauert. Als wir damit fertig waren, haben wir die Zettel eingeteilt in „Die Stimmen sind auf beiden Seiten gleich“ und „Die Stimmen sind unterschiedlich gesetzt“. Das war echt anstrengend. Dann haben wir so riesige Zettel bekommen, auf denen wir dann hingeschrieben haben, wie oft welche Partei gewählt wurde. In den Feldern mussten wir einen Strich machen. Das hat ebenfalls ziemlich lange gedauert, sodass wir ungefähr 1-1,5 Stunden dort gesessen haben. Danach mussten wir alles noch mal überprüfen und in den gleichen Kästchen einen Strich in die andere Richtung machen, um zu schauen, ob es aufgegangen ist. Das ist relativ schnell gegangen.
Nach dem Auszählen wussten wir, dass die Partei Die Grünen mit 35,1 % der Stimmen die Wahl gewonnen hat. Die Partei Die Linke hat mit 22,3 % den zweiten Platz belegt, gefolgt von der SPD mit 15,0 %. Das war’s. So läuft am Leonardo-da-Vinci die Juniorwahl ab.
Ergebnisse der Juniorwahl
zur Bundestagswahl 2025
Wahlergebnisse insgesamt:
Zweitstimme
Ergebnisse der Juniorwahl
zur Bundestagswahl 2025
Wahlergebnisse insgesamt:
Zweitstimme

Wahlergebnisse an Ihrer Schule:
Zweitstimme

Statistiken: https://portal.juniorwahl.de/onlineportal/wahlergebnisse/
Wahlergebnisse an Ihrer Schule:
Zweitstimme
von Jana Stojceska | 10B
In Burkina Faso, ehemals Obervolta, herrschte Anfang der 1980er Jahre große Armut. Doch als Thomas Sankara 1983 mit 33 Jahren Präsident des westafrikanischen Binnenstaates wurde, veränderte er mit revolutionärem Eifer den Kurs der Nation und sollte das Land trotz seiner kurzen Amtszeit nachhaltig prägen. Ein Eindruck, der bis heute in ganz Afrika und darüber hinaus nachhallt.
Thomas Isidore Noël Sankara wurde am 21. Dezember 1949 in Yako, Obervolta geboren. Mit 17 trat er der Militärakademie von Kadiogo bei, wo er erstmals mit revolutionär-marxistischen Ideen konfrontiert wurde. Später erhielt er als Leutnant nationale Anerkennung für seine Leistungen im Grenzkonflikt mit Mali. Der Krieg stärkte seine panafrikanischen Ansichten und später bezeichnete er ihn als nutzlos und ungerecht. Während seiner militärischen Laufbahn verband ihn eine tiefe Freundschaft mit Blaise Compaoré, der später zu Sankaras Verhängnis wurde. 1981 wurde er Informationsminister und förderte die freie Presse, wodurch Korruptionsskandale öffentlich wurden. 1982 trat er aus Protest gegen die arbeiterfeindliche Politik zurück und verkündete: „Wehe denen, die das Volk zum Schweigen bringen!“ (Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple!). Nach dieser Distanzierung vom Regime wurde er inhaftiert. 1983 wurde Thomas Sankara Premierminister. Diese Position hatte er lediglich vier Monate inne, denn im Mai, einen Tag nach dem Besuch des Sohnes des französischen Präsidenten, wurde Sankara abrupt wegen Landesverrats festgenommen; viele vermuten, dass die einstige Kolonialmacht Frankreich dabei Einfluss nahm. Die Lage spitzte sich zu. Seine Verhaftung löste eine Welle von Unmut unter der Bevölkerung aus, die Sankara als Reformfigur sah. Für sie war er Hoffnungsträger, jemand, der die lange unterdrückte Veränderung bringen konnte. Sankara war ihr Symbol für eine bessere Zukunft. Der Widerstand wuchs und äußerte sich am 4. August 1983 in Form eines erneuten Staatsstreiches, der gemeinsam von Thomas Sankara, Offizieren und seinem langjährigen Freund Blaise Compaoré organisiert wurde. So wurde Sankara zum fünften Präsidenten Obervoltas. Die Devise des sozialistischen Revolutionärs lautete: „Vaterland oder Tod, wir werden siegen“ („La Patrie ou la Mort, nous vaincrons“). Sein Ziel war ein demokratischer, autarker Staat, frei von Korruption und dem Westen. Jedoch ging seine Vision weit über das eigene Land hinaus: Er hatte einen globalen Blick auf soziale Gerechtigkeit und die Befreiung der Menschen, die wegen ihrer Herkunft oder Identität unterjocht wurden. Hier spiegeln sich seine panafrikanischen Ansichten wider. Am ersten Jahrestag der August-Revolution benannte er das damalige Land Obervolta in Burkina Faso um, was auf Moore, der Sprache der größten ethnischen Gruppe des Landes, den Mossi, „das Land der aufrechten Menschen“


heißt. Des Weiteren verpflichtete er sein Kabinett dazu, den Renault 5, das billigste Auto im Land, als Dienstwagen zu fahren. Er kürzte sich und seinen Ministern das Gehalt und verbot ihnen die Beanspruchung von Chauffeuren und Flugtickets erster Klasse. Eine seiner Leitlinien war: „Produzieren, was wir konsumieren und konsumieren, was wir produzieren“. Eine große Agrarreform wurde initiiert, um das Land unabhängiger von Nahrungsmittelimporten zu machen und um landwirtschaftliche Erträge zu steigern. Durch die Einführung von Düngemitteln und Bewässerungssystemen konnte die Weizenproduktion innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt werden. Maßnahmen wie diese führten letztlich dazu, dass Burkina Faso sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen konnte, was im postkolonialen Afrika eine Seltenheit war. Die landwirtschaftliche Produktion stieg zwischen 1983 und 1986 um 75 %.
Angesichts der Desertifikation1, für die Burkina Faso aufgrund seiner Nähe zur Sahara anfällig war, wurden heimische Pflanzen wiederaufgeforstet. Afrikas Grüne Mauer in der Sahel-Zone nahm hier teilweise ihren Ursprung. Innerhalb von 15 Monaten wurden zehn Millionen Bäume gepflanzt.
Frauenrechte waren Sankara ebenfalls ein großes Anliegen. Für sein Kabinett ernannte er erstmalig fünf Ministerinnen. Laut Joséphine Ouédraogo, der damaligen Ministerin für Familienentwicklung und nationale Solidarität, eine Premiere. Auffallend war, dass er sie nicht nur “klassischen Frauenressorts“ zuteilte. Nein, es gab zusätzlich zu Joséphine Ouédraogo eine Finanz-, eine Umwelt-, eine Gesundheitsund eine Kulturministerin. Mitgift und Polygamie2 wurden gesetzlich eingeschränkt, Genitalverstümmelung, Frühund Zwangsheiraten sowie Prostitution wurden verboten. Er förderte die Bildung von Mädchen und Frauen und ermutigte sie, ins Militär zu gehen. In seiner bekannten Rede am Weltfrauentag 1987 äußerte Sankara: „Kameraden, es gibt keine wahre soziale Revolution ohne die Befreiung der Frau. Ich sehe keine Gesellschaft, werde durch keine Gesellschaft gehen, in der die Hälfte der Bevölkerung zum Schweigen gezwungen ist. […].“
Zusätzlich stieß Thomas Sankara umfassende Alphabetisierungs- und Impfkampagnen an. Die Alphabetisierungsrate stieg bis 1987 um 60 %. 1984 wurden in zwei bis drei Wochen rund zwei Millionen Kinder gegen Krankheiten wie Gelbfieber und Meningitis geimpft, was die WHO lobte. Er sicherte die Wasserversorgung durch den Bau von Brunnen und Staubecken und ließ zahlreiche Schulen bauen. Sankara lehnte darüber hinaus die Rückzahlung von Schulden an westliche Länder ab, da er ihren Ursprung im Kolonialismus sah. Insgesamt setzte sich Sankara mit seiner Regierung erfolgreich für ein autonomeres Burkina Faso ein, för-

derte Bildungschancen und Frauenrechte, verbesserte die Wirtschaft und Gesundheitsversorgung und kämpfte aktiv gegen Armut, Korruption und Hunger. Er wurde zum Symbol einer neuen Ära, was ihn bereits zu Lebzeiten zu einer Legende machte.
Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und jede Entwicklung zieht ihre Kritiker nach sich. Sankaras Amtszeit war auch von Repressionen gezeichnet. Der nicht demokratisch gewählte Präsident verbot politische Oppositionsparteien und Gewerkschaften, um vorzubeugen, dass jemand sich gegen seine Vorhaben quer stellen könnte. Als Reaktion darauf begann ein landesweiter Lehrerstreik. Über 1000 teilnehmende Lehrkräfte wurden daraufhin entlassen. Zahlreiche Kritiker der Revolution flohen ins Exil, während Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International der Regierung Menschenrechtsverletzungen, wie z.B. Folter an Gefangenen vorwarfen. Streiks wurden fortwährend unterdrückt und vor Gericht wurden Schauprozesse mit sogenannter Beweislastumkehr durchgeführt, bei denen die Angeklagten ihre Unschuld beweisen mussten, anstatt dass die Anklage ihre Schuld nachwies. Wohlhabenderen Bewohnern Burkina Fasos, zu denen Staatsbeamte, Teile des Militärs und die „wirtschaftliche Elite“ zählten, gefiel die jüngst eingeführte militärische Ordnung des Staates ebenso wenig, da sie jeglichen Autoritätsanspruch verloren. Ganz zu schweigen von den Oppositionsparteien und Gewerkschaften.

ner Distanzierung von Sankara und seiner Politik sind nicht sicher geklärt, viele vermuten persönliche sowie wirtschaftliche Ambitionen oder Machtbestreben.
Am 15. Oktober 1987 ereignete sich ein erneuter Putsch in Burkina Faso, doch diesmal stand Blaise Compaoré nicht an Sankaras Seite, sondern gegen ihn. Während Sankara eine Kabinettssitzung abhielt, stürmte eine militärische Einheit den Sitzungssaal und erschoss ihn sowie zwölf seiner Vertrauten. Noch in der gleichen Nacht wurden die Leichen hastig vergraben. Thomas Sankara starb mit 37 Jahren. In seiner Sterbeurkunde wurde zunächst ein „natürlicher Tod“ vermerkt. Erst 28 Jahre später, im Jahr 2015, wurde dies als Mord korrigiert.

Ab 1986, dem dritten Jahr der Revolution, machte sich Unmut in der Bevölkerung gegenüber der Revolution breit. Sie beklagten zu viele Restriktionen und forderten ein liberaleres Regime. Blaise Compaoré, Vizepräsident und Justizminister, nutzte die derzeitige Unbeliebtheit des Regimes für sich und verleugnete unterdessen Sankara und die Revolution. Er argumentierte, dass sein einstiger Freund das Land wirtschaftlich isolieren würde. Die Beweggründe sei-

Blaise Compaoré wurde für die nächsten 27 Jahre Präsident und setzte alles daran, Sankaras Andenken auszulöschen. Er machte nahezu alle Reformen rückgängig, hob Nationalisierungen auf und stellte alte Geschäftsbeziehungen wieder her. Das Land trat dem IWF3 und der Weltbank bei, erhielt unter strikten Auflagen Kredite und privatisierte viele Unternehmen. Investitionen in den Sozialstaat wurden reduziert und unter globalem Druck, sich zu demokratisieren, wurden 1991 eine neue Verfassung und ein Mehrparteiensystem eingeführt. 2014 wollte Compaoré die Verfassung ändern, um seine Amtszeit zu verlängern. Massive Proteste führten zum Sturz durch das Militär, er floh an die Elfenbeinküste. 2022 verurteilte ihn ein Militärgericht wegen Sankaras Ermordung zu lebenslanger Haft. Er bleibt bis heute im Exil.
Auch Jahrzehnte nach seinem Tod bleibt Thomas Sankara eine Schlüsselfigur der afrikanischen Geschichte und ein Symbol für revolutionären Wandel. Seine Vision inspiriert bis heute viele, insbesondere die Jugend, für die er ein Idol bleibt. Sein Erbe geht weit über seine Person hinaus und er steht stellvertretend als Idee, als Hoffnungslicht für ein selbstbestimmtes Afrika.

von Leni Pooth und Jana Stojceska | 10B

E-Zigaretten haben sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Lifestyle-Produkt entwickelt, insbesondere unter Jugendlichen. Doch was steckt hinter diesem Hype? Sind Vapes eine sichere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten oder verbergen sich hinter den bunten Dampfgeräten ernsthafte Gefahren? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Ursachen, Auswirkungen und Folgen dieses Trends.
Vapes, auch Vaporizer oder E-Zigaretten genannt, sind batteriebetriebene Geräte, die das sogenannte Liquid verdampfen. Diese Flüssigkeit enthält vor allem Nikotin, Aromen und chemische Stoffe wie Propylenglykol oder Glycerin. Anders als bei herkömmlichen Zigaretten findet kein Verbrennungsprozess statt. Seit 2018 erfreuen sich zudem Einweg-Vapes einer immensen Beliebtheit, die immer weiter zunimmt.
Einweg-Vapes müssen bereits nach 600 bis 800 Zügen entsorgt werden, da das Liquid sich nicht neu befüllen lässt und der integrierte Akku nicht wiederaufladbar ist. Sie sind kompakt, benutzerfreundlich und erstmal günstig, was sie attraktiv für Neueinsteiger ausmacht. Herkömmliche E-Zigaretten hingegen kann man über einen sehr langen Zeitraum hinweg benutzen, da man das Liquid beliebig oft auffüllen kann und der integrierte Akku wiederaufladbar ist. Man hat die Möglichkeit, die Vape mit ver-
schiedenen Liquids und Aromen zu befüllen. Außerdem ist sie auf lange Sicht günstiger und umweltfreundlicher als Einweg-Vapes.
Der Aufstieg von Vapes begann in den frühen 2000er Jahren. Im Jahr 2003 entwickelte der chinesische Apotheker Hon Lik die moderne E-Zigarette, die 2004 erstmals auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde. In den folgenden Jahren verbreiteten sich diese Geräte weltweit und wurden als weniger schädliche Alternative zum traditionellen Rauchen vermarktet.
Gesundheitsmäßig betrachtet werden Vapes häufig als weniger schädlich wahrgenommen als konventionelle Zigaretten, da beim Dampfen keine Verbrennungsprodukte entstehen. Jedoch kann eine einzige Vape das Nikotin von ca. 3-5 Päckchen Zigaretten enthalten und der Dampf wird, da er viel kälter ist, besonders intensiv über die Lunge aufgenommen. Darüber hinaus werden beim Verdampfen von E-Liquids schädliche Substanzen wie Formaldehyd, Acrolein und verschiedene Metalle freigesetzt, die das Risiko für Krebs, Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Bronchitis und Asthma erhöhen können. Die Inhalation von Nikotin in der Jugend kann die Hirnentwicklung beeinträchtigen, die noch bis etwa zum 25. Lebensjahr andauert und ebenso die Lernfähigkeit, das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit negativ beeinflussen. Nikotin kann zusätzlich
den Blutdruck erhöhen und Thrombosen und Schlaganfälle begünstigen. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung kann das Verschlucken des Liquids zu einer lebensgefährlichen Vergiftung führen. Die Langzeitfolgen sind noch nicht vollständig erforscht, weshalb uns schlimmere Erkenntnisse erst in einigen Jahren bevorstehen könnten.
Die umweltschädlichen Aspekte dürfen ebenfalls nicht vernachlässigt werden. E-Zigaretten müssen aufgrund der Lithium-Ionen-Batterien im Sondermüll entsorgt werden, landen jedoch oft im Hausmüll oder in der Natur. Wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können gefährliche Chemikalien in den Boden und das Grundwasser abgegeben werden. Zudem bestehen die meisten Vapes aus Kunststoff, der schwer recyclebar ist. Auch die Produktion und der Transport dieser Produkte verursachen CO2-Emissionen, was zur globalen Erwärmung beiträgt.

Viele Jugendliche werden durch gezieltes Marketing von E-Zigaretten und Vapes angesprochen. Die Produkte werden ihnen durch süße, fruchtige Geschmacksrichtungen wie „Blueberry Ice“ oder „Triple Mango“ schmackhaft gemacht. Sorten mit Namen wie «Cool» oder «Ice» enthalten synthetische Kühlmittel, die zu einem höheren Konsum anregen. Jegliche Abschreckungsfaktoren, die einen vom Vapen abhalten könnten, werden geschickt kaschiert, ohne völlig zu verschwinden. Beispielsweise wird das unangenehme Gefühl eines „Kratzens im Hals“ dank der Verwendung von Nikotinsalzen oder synthetischem Nikotin abgeschwächt, wodurch eine größere Menge an Nikotin inhaliert werden kann. 2023 war die E-Zigarette erstmals das Rauchprodukt, mit dem Kinder und Jugendliche am häufigsten Erfahrungen gemacht haben: Fast jeder Vierte hat bereits eine E-Zigarette probiert. Die größte Gefahr von Vapes liegt in der Abhängigkeit. Viele Jugendliche beginnen mit Vapes und steigen später auf herkömmliche Zigaretten oder sogar härtere Substanzen um. Ein Phänomen, das als „Gateway-Effekt“ bekannt ist.
Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass bestimmte Maßnahmen den Tabakkonsum wirksam reduzieren und präventiv wirken. Die Erhöhung der Preise gilt als die wirkungsvollste Maßnahme, da sie insbesondere Jugendliche abschreckt, die oftmals wenig Geld haben. Auch eine Regulierung oder ein Verbot von Werbung oder die Pflicht zur unattraktiven Gestaltung der Produkte können die Attraktivität deutlich senken. Ein umfassender Schutz vor Passivrauch und Passivdampf ist ebenso wichtig wie gezielte Informationen und Aufklärung über die Risiken des Konsums. Über Ansätze wie das Verbot der Geschmacksrichtungen wird aktuell auch diskutiert. In den Niederlanden wurde eine solche Maßnahme bereits umgesetzt. Dort dürfen seit Oktober 2023 nur noch E-Zigaretten verkauft werden, die nach Tabak schmecken. Vapes mögen auf den ersten Blick eine moderne und scheinbar harmlose Alternative zu herkömmlichen Zigaretten sein, doch ihre Risiken sind nicht zu unterschätzen. Neben der gesundheitlichen Belastung durch Nikotin und Schadstoffe besteht die Gefahr einer frühen Abhängigkeit, insbesondere bei Jugendlichen. Zudem stellen Einweg-Vapes eine ernsthafte Umweltbelastung dar. Trotz ihrer Popularität ist der langfristige Einfluss auf die Gesundheit noch nicht vollständig erforscht. Präventive Maßnahmen wie Preissteigerungen, Werbebeschränkungen und Aufklärung könnten helfen, den Konsum einzudämmen.

Im Januar 2024 hatte die gesamte Jahrgangsstufe 8 die Suchtpräventionstage - drei Tage, an denen Lehrer:innen, Expert:innen und auch selbst Betroffene mit uns über Drogen, Alkohol und die Gefahren, die diese mit sich bringen, geredet haben. Eine Person, die uns ihre Geschichte erzählt hat, war Dominique, die sich freundlicherweise dazu bereit erklärt hat, mir meine Fragen für die Schüler:innenmagazin zu beantworten.
Willst du dich zuerst vorstellen?
Mein Name ist Dominique. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Die sind 23, 16 und 14 Jahre alt. Ich bin verheiratet und meine Lieblingsbeschäftigung ist Beachvolleyball spielen.
In welchem Alter hast du angefangen, Alkohol zu trinken?
Ich habe schon als kleines Kind die Schnapsgläser mit dem Eierlikör ausgeschleckt und mochte dieses warme und wohlige Gefühl, das der Alkohol ausgelöst hat.
Als ich 12 oder 13 war, habe ich das erste Mal bewusst Alkohol getrunken. Das war mit ein paar älteren Jugendlichen auf einem Spielplatz.
Ich habe von Anfang an keine Kontrolle darüber gehabt, WIE VIEL ich trinke. Sobald ich nur einen Schluck Alkohol getrunken habe, musste ich bis zum Blackout trinken. Da sind dann viele schlimme Sachen passiert, bei denen ich auch hätte sterben können. Zum Beispiel habe ich so viel getrunken, dass ich mich nachts übergeben musste und es nicht gemerkt habe. Zum Glück lag ich auf der Seite und bin nicht an meinem Erbrochenem erstickt. Ich habe nicht jeden Tag getrunken, aber wenn, dann immer mit Kontrollverlust. Ich habe dann im Laufe der Jahre gelernt, kurz vor dem Blackout aufzuhören und ins Bett zu gehen. Am Ende war es so, dass ich am liebsten allein getrunken habe und gar nicht mehr unter Menschen wollte.
von Alva Wergen | 9B
Woran hast du gemerkt, dass du ein Problem mit Alkohol hast?
Dass ich ein Problem habe, das war mir schon mein ganzes Leben lang klar. Ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt. Ich habe mich einfach falsch auf dieser Welt gefühlt. Der Alkohol war zuerst meine Lösung - er hat das Problem gelöst. Mit dem Alkohol konnte ich mich entspannen und ein warmes Gefühl in mir erzeugen. Er war meine Medizin. Ein trügerischer Freund, der irgendwann zum Feind wurde. Ich habe aber erstmal versucht, in der Welt klarzukommen. Ich dachte, wenn ich eine gute Schulausbildung habe, dann wird alles gut. Hat leider nicht funktioniert. Auch meine Kindheit aufzuarbeiten, hat nicht funktioniert. Ein netter Mann und süße Kinder waren auch nicht die Lösung. Als ich 27 Jahre alt war und meine Tochter gestillt habe und das erste Mal nach vier Jahren wieder Alkohol getrunken hatte, musste ich gleich wieder sehr viel trinken und meine Tochter hat sich nach dem Stillen übergeben. Da war mir klar, dass etwas nicht stimmt.
Wie bist du mit der Erkenntnis umgegangen?
Zuerst habe ich versucht den Alkohol zu kontrollieren. Ich habe gedacht, dass ich einfach nur andere Dinge finden muss, die mir Entspannung verschaffen und dann könnte ich auch noch weiter trinken. Ich habe noch zwei weitere Jahre mit dieser Idee rumexperimentiert. Und dazu gehörten folgende Einfälle: Wenn ich eine Therapie mache und meine Kindheit aufarbeite, dann wird alles besser. Wenn ich Yoga mache, dann kann ich mich besser entspannen und muss nicht mehr so viel trinken. Wenn ich eine lange Reise mache, dann entspannen wir uns als Familie und es wird alles besser. Wenn ich erst ab 18:00 Uhr trinke, ist es ja okay. Wenn ich nur am Wochenende trinke, ist es kein Problem. Wenn ich nur Bier trinke, werde ich nicht so stark betrunken und so weiter und sofort. Ich konnte mir nicht vorstellen,
ohne Alkohol und Drogen zu leben, weil ich dachte, dass man mir dadurch den Spaß im Leben nehmen würde. Die Abstände zwischen den Besäufnissen wurden aber immer kürzer, bis ich nur noch an den Tagen nicht getrunken habe, wenn der Kater ganz schlimm war.
Wann und wie hast du dir Hilfe geholt?
Als nichts davon funktioniert hat, war ich am Ende. Ich wollte sterben. Ich konnte weder mit noch ohne Alkohol Leben. Ich hatte bis dahin schon viele Therapien gemacht und wusste, dass dieser Weg für mich auch keine Option mehr war. Durch Zufall habe ich von den Anonymen Alkoholikern erfahren. Jemand hat mir ein Video geschickt, in dem junge Frauen in meinem Alter über ihren Alkoholismus sprechen. Ich konnte mich mit den Symptomen, die sie beschrieben haben, identifizieren und wusste sofort, dass ich Alkoholikerin bin. Bis dahin hatte ich mir das noch nicht eingestanden. Daraufhin bin ich sofort in mein erstes Meeting gegangen.
Was hat dir geholfen, mit dem Alkoholtrinken aufzuhören?
Das Wichtigste war erst mal, dass ich akzeptiert habe, dass ich Alkoholikerin bin und dass ich keinen Alkohol trinken kann ohne diesen krassen Kontrollverlust. Dauerhaft nüchtern zu bleiben, ist nicht einfach, weil der Alkohol ja das Medikament war. Daher brauchte ich etwas, was mindestens genauso stark ist wie der Alkohol. Und für mich ist das die Gemeinschaft der Anonyme Alkoholiker (AA) und das damit verbundene zwölf-Schritte-Programm, mit dem ich lernen kann, in ein neues Leben zu starten.
Was machst du heute an Tagen, an denen es dir nicht gut geht?
Für mich ist heute Alkohol trinken oder Drogen nehmen keine Option mehr. Wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich viele Werkzeuge, um damit umzugehen. Zum Beispiel gibt es täglich AA-Meetings, sowohl online als auch Faceto-Face, in die ich gehen kann. Ich gehe oft in Meetings. Oder ich rufe einen AA-Freund oder eine AA-Freundin an und frage, wie’s ihm oder ihr geht. Eins der Hauptprobleme einer alkoholkranken Person ist, dass sie immer nur über sich selbst nachdenkt und so wie in einem inneren Gefängnis sitzt. Daher ist es für mich total hilfreich zu überlegen, was ich für eine andere Person tun kann. Das kann auch meine Familie sein, zum Beispiel einfach ein leckeres Essen für meine Familie zu kochen. Gebet und Meditation gehören heute genauso zu meinen Werkzeugen dazu.
Wie gehst du mit den Fragen um, wenn du zum Beispiel bei Feiern keinen Alkohol trinkst?
Ich wurde noch nie überredet, Alkohol zu trinken. Ich bin auch sehr selten auf Partys oder Feiern, wo Alkohol getrunken wird, weil mein Freundeskreis sich total verändert hat. Ansonsten gehe ich aber auch total gerne aus. Ich gehe gerne tanzen oder mit meinem Mann Dart spielen. Da hab’ ich
einen Grund, warum ich hingehe, und deshalb stört mich das überhaupt nicht, wenn Leute trinken. Ich weiß einfach, dass es bei mir eben nicht nur bei einem Bier bleibt, sondern dass daraus eine Katastrophe wird. Das ist wie mit einer Nussallergie. Wenn du weißt, Nüsse essen führt zum Ersticken, dann isst du halt keine mehr und so ist es mit dem Alkohol bei mir auch.
Würdest du es für sinnvoll halten, Alkohol weniger einfach zugänglich zu machen?
Ich denke, dass es total wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und dass Menschen, die davon Ahnung haben und dazu forschen, sich Dinge überlegen, wie man präventiv vorgehen kann. Das ist aber nicht mein Thema. Ich bin eine suchtkranke Person. D.h. ich hab’ eine chronische Veränderung meiner Leber und meines Gehirns. Menschen wie mich wird es immer geben und deshalb konzentriere ich mich darauf, wie ich selbst mit dieser Krankheit ein zufriedenes, ja nützliches Leben leben kann und wie ich anderen Suchtkranken helfen kann. Und für mich ist es eben möglich durch die zwölf Schritte der AA.
Möchtest du Leser:innnen noch einen Rat geben?
Gerne.
Alkoholismus beginnt nicht erst, wenn man von morgens bis abends trinkt. Das ist die Endstation. Wenn du darüber nachdenkst, deinen Konsum zu kontrollieren, dann ist das schon ein Zeichen für missbräuchlichen Konsum. Wenn du anfängst, etwas zu konsumieren und du kannst nicht aufhören und hast sofort einen Kontrollverlust, dann könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass du ein Problem hast mit Alkohol oder der Substanz (das kann auch Onlinegaming sein).
Nur weil du für ein paar Tage, Wochen oder Jahre aufhören kannst, heißt das nicht, dass du kein Alkoholiker bist. Die Krankheit beginnt meist schleichend und wird im Laufe der Jahre immer heftiger. Man kann auch mit 13 schon Alkoholiker:in sein, so wie ich es auch schon war.
Bei AA gibt es sehr viele verschiedene Gruppen - auch für junge Leute. Falls jemand sich durch diesen Beitrag angesprochen fühlt und Hilfe haben möchte oder sich ein bisschen über die Symptomatik austauschen will, kann sich diese Person jederzeit bei mir melden! Außerdem gibt es sehr viele Onlinemeetings, an denen man teilnehmen kann, ohne sich zeigen zu müssen.
Hier die Telefonnummer Dominique 0176- 23265560 und die Emailadresse der AA in Düsseldorf: aa-duesseldorf@anonyme-alkoholiker.de

VERSPÄTUNGEN UND AUSFÄLLE BELASTEN KÖLNER:INNEN
Köln – Für tausende Schülerinnen und Schüler in Köln ist die KVB das tägliche Transportmittel zur Schule. Doch statt pünktlicher Ankunft prägen in letzter Zeit Verspätungen und Ausfälle den Alltag. Eine Analyse zeigt: Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex, doch ein oft unterschätzter Faktor sind die Fahrgäste selbst.
Verkehrssituation und fehlendes Personal als Hauptursachen
Der Kölner Straßenverkehr hat sich nach den Corona-Jahren wieder deutlich verdichtet. Staus und Behinderungen betreffen nicht nur Autos, sondern auch Busse und Bahnen der KVB. Falschparker und Fahrzeuge in den Gleisen verschärfen die Situation zusätzlich und sorgen immer wieder für massive Verzögerungen im Betriebsablauf. Doch nicht nur äußere Umstände setzen der KVB zu. Wie viele andere Unternehmen in Deutschland leidet auch der Verkehrsbetrieb unter akutem Personalmangel. Fehlende Fahrer:innen sowie ein hoher Krankenstand führen zu Engpässen im Fahrbetrieb. Um größere Ausfälle zu vermeiden, sah sich die KVB gezwungen, den Fahrplan auszudünnen - ein Zustand, der für viele Fahrgäste, insbesondere Personen, die täglich mit der KVB fahren, unbefriedigend ist.
Technische Defekte
Neben den genannten Faktoren spielen auch technische Probleme und defekte Fahrzeuge eine Rolle bei den Verspätungen. Wenn eine Bahn ausfällt, wirkt sich dies kaskadenartig auf den gesamten Fahrplan aus. Die Modernisierung der Fahrzeugflotte schreitet zwar voran, doch bis alle alten Bahnen ersetzt sind, wird noch Zeit vergehen.
Der Fahrgast spielt auch eine Rolle
Die KVB kämpft mit Verspätungen und neben bekannten Ursachen wie Personalmangel und Verkehr gibt es einen oft
übersehenen Faktor: das Verhalten der Fahrgäste. Bei Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen durch Zögern oder Gedränge verpasst man schnell das Abfahrtsignal und das kostet Zeit. Besonders problematisch sind große Gepäckstücke, Kinderwagen oder Fahrräder. Auch blockierte Türen durch Gespräche oder abgestellte Gegenstände behindern den Ablauf. Unnötiges Drängeln und Schubsen, Unachtsamkeit oder unberechtigte Notbremsungen verschlimmern die Situation zusätzlich. Vandalismus und Beschädigungen führen zu weiteren Stillständen. Ein rücksichtsvolleres Verhalten aller Fahrgäste könnte somit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der KVB-Pünktlichkeit leisten.
Gemeinsam für pünktliche Bahnfahrten: So können wir helfen!
• Tür frei: Achte beim Ein- und Aussteigen darauf, dass du dich nicht im Türbereich aufhältst, da die Tür aufgrund der Lichtschranke nicht zugeht und somit auch nicht andere Fahrgäste behindert werden, die Ein- und Aussteigen wollen.
• Große Sachen sicher verstauen: Große Taschen, Koffer oder Kinderwagen sollten so verstaut werden, dass sie niemanden behindern.
• Fahrräder sicher befestigen: Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, achte darauf, dass es sicher im Fahrrad-/Kinderwagenabteil ist.
• Notbremse nur im Notfall: Betätige die Notbremse nur, wenn eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Unnötige Notbremsungen führen zu erheblichen Verspätungen und beeinträchtigen den Betriebsablauf.
Mein Fazit:
„Die KVB ist ein wichtiger Bestandteil unserer Stadt. Ich danke für den bisherigen Einsatz und hoffe auf weitere Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr.”
von Celina Hentschel, Dalelta Isaac, Sashanth Dev Saravanan | 9C

Nippes ist bekannt für seinen vielfältigen Einzelhandel: von Inhabern geführte Boutiquen, kleine Feinkostläden und traditionsreiche Handwerksbetriebe prägen das Bild des Veedels. Doch gerade diese kleinen, oft familiären Geschäfte rücken zunehmend in den Fokus krimineller Aktivitäten. Einbrüche, Taschendiebstähle und Betrugsversuche verunsichern Ladenbesitzer und Kunden. Es geht um mehr als nur um Bargeld: Diebe haben es auch auf Waren abgesehen. „Besonders an den Wochenenden steigt die Zahl der Diebstähle”, berichten viele Einzelhändler: „Schnell eingesteckt und unbemerkt verschwundendas passiert leider immer wieder.“
Leichter gemacht durch Selbstbedienungskassen! Einige Geschäfte setzen mittlerweile auf Selbstbedienungskassen, was einerseits effizient ist, andererseits aber auch neue Möglichkeiten für Diebstähle schafft, wie uns der REWE-Mitarbeiter aus dem REWE City-Markt in der
Nähe der Haltestelle Florastraße erklärt: „Diebstahl gab es schon immer, es wurde aufgrund der Selbstkassen leichter.“
Jugendliche als Täter:innen: Ein wachsendes Problem Ein besorgniserregender Trend ist die steigende Zahl von Jugendlichen, die in Einzelhandelsgeschäften stehlen oder Sachbeschädigungen verursachen. „Oft sind es Gruppen junger Leute, die gezielt nach Geschäften Ausschau halten, in denen sie unbemerkt etwas mitgehen lassen können“, so ein betroffener Ladenbesitzer.
Die Gründe, warum Jugendliche stehlen, sind vielfältig. Oft spielen Gruppendruck, fehlende Perspektiven aber auch der Wunsch nach Anerkennung oder nach Aufregung eine Rolle.
Soziale Medien verstärken diesen Trend, da Jugendliche dort oft mit einer Konsumwelt konfrontiert werden, die sie sich nicht leisten können.

von Emily Zeinar | EF
Warten, viel zu lang, dann in der Masse eine winkende Hand. Laufen, viel zu schnell. In die Arme gerannt, tanzen davon, das Gespräch, die Musik. Früher und heute, alles ausgepackt. Der Kaffee, viel zu heiß, hast mal wieder recht gehabt.
Gott, die Welt und Pizzakartons. Reden und sehen, die Sonne geht unter, immer noch auf dem Balkon. Stille Straßen darunter. Du ziehst, wir stoßen an, mit Blitz fotografiert, weil ich das nicht gehen lassen kann.
Spazieren in kühlen Morgenstunden zu den Gleisen hin, summen das gleiche Lied, aus Zufall gefunden. Kommt angefahren, schwere Sekunden. Drücken uns fest: „Auf Wiedersehen“, obwohl ich nicht weiß, wann wir uns wiedersehen. Der Zug fährt ab, ich renne ihm nach, viel zu schnell. Waren wir nicht gestern noch Kinder?

Gestilltes Fernweh, übertönt von Heimweh, obwohl ich doch zu Hause bin. Momente vergehen, und ich hänge ihnen nach, versuche ununterbrochen, Zeit zu ziehen. Sie reißt an mir, ich reiße an ihr, reise bald aus und reiße mich und mein Leben aus dem Kontext heraus.
Die Sonne geht unter, ich hol’ sie zurück, und dann soll sie für immer da scheinen. Schönste Sekunde, ich sammle sie auf, dann können wir für immer hierbleiben. In dieser Erinnerung müssen sie halten. Lass uns ein bisschen Zeit ziehen, nicht nach vorne sehen, vielleicht kann sie dann nicht vergehen?
Wir hängen zusammen aneinander dran, stehen auf ewig im Zusammenhang. Ich spreche mit halben Versprechen, obwohl ich gar nichts weiß, nur dass jetzt so sein soll wie gleich. Komm ich wieder, hab’ ich alles erreicht, wenn zwischen uns alles so bleibt.
Ein bisschen schwer, drüber zu reden, wenn zwei Individuen sich zwischen Gefühl und Gesellschaft bewegen. Ein so verletzlich, so zerbrechlich schmaler Grat, weil „einfach“ miteinander sprechen so viel offenbart. Reden über Ängste, Träume und Scham, Wut und Reue und Trauer, eine Frage: „Bist du einsam?“
Unangenehmes bleibt meistens ungesagt, liegt auf den Lippen, wird dann vertagt, dem Zweck entfremdet, unterdrückt oder vom Ego überragt.
Schon klar, Emotionen sind messerscharf, unbequemes, intimstes Kommunizieren ist hart, aber letztlich sind sie des Gesprächs Pulsschlag und das, was Nähe zwingend bedarf.
Unter dicken Wolkenschichten
Keine Sonne hier zu sichten.
Meeresrauschen, leichter Wind
In der Ferne lacht ein Kind.
Kaltes Wasser, warmer Sand Zusammen liegen wir am Strand.
Mit Boogieboards unter dem Arm,
Das Wasser doch nicht mehr so warm. Salzgeruch und hohe Wellen, Grauer Himmel, Beinchen stellen, Untertauchen, dunkles Wasser, Meine Haare immer nasser. Zusammen schwimmen wir hinaus Heimat, aber nicht zuhaus‘.

von anonym | 9

Anzeige
Kunst und Kultur

Interview mit Frau Glocksin über das Theaterstück des Kunst-Theaterkurses
Stufe 10, geführt von Hannes Gawron | 10B


Aus welchen Gründen haben Sie sich für das Theaterstück Romeo und Julia entschieden?
Diese Tragödie berührt alles, was euch jugendliche Menschen beschäftigt: die Naturkatastrophe des ersten Verliebtseins, den Wunsch nach unbedingter Freundschaft und die Gewalt untereinander, die völlig haltlose Feindschaft und der sinnlose Hass zwischen Familien, Häusern, Staaten und Menschen, zwischen denen alles Unschuldige kaputt geht.
Wie wurden die Rollen verteilt und sind alle Schüler:innen damit zufrieden?
Ob alle zufrieden sind, weißt du eher als ich. Wie sie verteilt wurden: nach Wunsch der einzelnen, gepaart mit meiner Einschätzung auf Belastbarkeit.
Wie funktioniert das Proben im Kurs und gab es schon lustige Momente dabei?
Theaterunterricht hat immer lustige oder besser witzige Momente - das ist einfach so. Das Proben funktioniert erfahrungsgemäß schwer, wenn der Text noch nicht auswendig gelernt wurde. Das gibt sich, je ernster die Lage wird, sprich, je näher die Aufführungstermine kommen.
*Anmerkung der Redaktion: Am 19. März wurde die Aula aufgrund von kurzfristig festgestellten Brandschutzmängeln auf unbestimmte Zeit – vermutlich für mehrere Jahre! – durch die Stadt gesperrt.

Können Sie uns eine kleine Preview zu der Aufführung geben?
Wie soll es gehen, dass in unserer Inszenierung drei bis vier Romeos und Julias auf der Bühne spielen, alle verkörpern einen anderen Charakterzug Romeos und Julias?
Wer könnte damit was anfangen? Oder dass wir mit vielen Choreografien arbeiten? Wem sagt das etwas, wenn er nicht selbst tanzt oder Theater spielt? - Ich denke, was richtig spannend wird und daher unbedingt sehenswert, ist erstens, dass über 40 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 in einem großen Theaterstück auf der Bühne stehen, und zweitens, dass alter Text gesprochen wird: Shakespeare [aus dem Englischen] übersetzt: großer, alter, schwerer Text in jugendlichem Spiel, das gar nicht groß und schwer wirkt. Das gab es bisher noch nicht.
Wann findet die Ausführung statt?
Die Aufführungen sind am Mittwoch, den 2. Juli und Donnerstag, den 3. Juli jeweils um 18:30 Uhr in der Aula.

Bild: Unsplash / Maksym Harbar

von Luc Aydogan Müller-Harmandali | EF
Dieses Jahr am 7. April fand die jährliche Kunstausstellung des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums statt, bei der jede:r eingeladen wurde, sich die Werke unserer Schülerschaft anzusehen. Hauptsächlich konnte man Werke des Kunst-LKs der Q2 betrachten, jedoch gab es unter anderem auch Werke des Fotografie-Projektkurses (Q2), des Kunst-Theaterkurses (10. Klasse) und sämtlicher weiterer Kunstkurse der 8. bis 13. Stufe. Ausgestellt wurden Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien, darüber hinaus abstraktere Werke wie Videos oder Audios, die alle in zwei Fluren der Schule präsentiert wurden.
Organisiert wurde diese Ausstellung von Lehrer:innen der Kunstfachschaft, dem Kunst-LK und sämtlichen weiteren Schüler:innen oder Lehrer:innen, die sich freiwillig für diese Aktion eingesetzt haben. Ich finde, dass es als Schüler interessant war zu sehen, was man im Kunst-LK für Dinge machen kann, da diese Ausstellung zeigte, wie viel Freiheit und Vielfalt man in seinen Werken ausdrücken kann. Es war auch eine sehr gute Möglichkeit für Schüler:innen, ihr Talent zu zeigen und sich zu beweisen. Meiner Meinung nach ist es nur zu empfehlen, sich die Kunstwerke unserer Schüler:innen anzuschauen, da unsere Schule viele talentierte Künstler:innen beherbergt.
Collagiertes Selbstportät

Projekt zum Höhlengleichnis

Collagiertes Selbstportät

Kunst und Kultur
Projekt zum Höhlengleichnis


Der Arbeitsplatz
Kölner Dom
Ausschnitte aus dem Fotoprojekt von Tami von Cysewski | Q2
Ausstellungswand


Kurzgeschichte von Pia Lehmbruck und Lena Große | 5B
illustriert von Franziska Cichon | Q2
Ein eisiger Wind gefolgt von prasselndem Regen peitschten gegen das Fenster der 5b. Kalte Schauer zogen sich über das Land. Lily saß auf ihrem Platz und starrte auf das Fenster. Tausende kleine Tropfen liefen wie ein langer Schleier die Regenrinne hinunter. Sie konnte sich nicht entscheiden, was schlimmer war: eine eisige Pause oder eine Doppelstunde lang die Namen von irgendwelchen Sternen auswendig zu lernen? Naja, Sterne auswendig zu lernen war so ziemlich das Langweiligste, was passieren konnte. Seufzend ließ sie den Kopf auf ihre Arme sinken. Sie entschied sich für die Sterne, aber jetzt wo sie darüber nachdachte, war die eisige Pause doch um Längen besser als hier drinnen zu hocken und verständnislos auf das Blatt zu starren. „Wann endet dieser Tag endlich ?!?“, dachte sie. In diesem Moment schellte die Pausenglocke. Lilly hob den Kopf. Mit einem lauten Quietschen flog die Tür auf und einer nach dem anderen purzelte aus dem Türrahmen. Nur Lilly blieb zurück. Sie ließ ihr Buch langsam in ihren Ranzen gleiten. Sie schulterte ihren Rucksack und betrat den Flur. Viele kleine Gruppen säumten den Flur. Eine große Schülerschar drängelte sich am Eingang. Langsam wurden es immer weniger Schüler. Darunter auch Lilly. Sie schlurfte zum Pausenhof. Plötzlich schritt ihr ein großer Junge in den Weg. Er war schlaksig, hatte blondes Haar und grüne Augen. Er trug ein weites graues T-Shirt, eine grün-weiß gestreifte Jacke und eine dazu passende Jogginghose. Bedrohlich beugte er sich über sie. „Ooohh, die kleine Braunhaarige!“, höhnte er. „Mal wieder alleine unterwegs, was? Solltest dir mal ein paar Freunde beschaffen. Aber was rede ich da, das schaffst du sowieso nicht, wahrscheinlich bleibst du eeewig alleine! Naja, was schert mich das denn, die kleine Tusse soll das schon alleine machen, wenn sie dabei nicht kümmerlich vergeht!“ Lilly stöhnte innerlich. „Oh nein“, dachte sie, „der Mobber.“

Dieser Junge mobbte alle und jeden, besonders Lilly. Doch es stimmte, sie hatte keine Freunde. Normalerweise stellte sie sich taub und ging weiter, doch dieses Mal war es anders. Sie warf ihre Haare zurück und funkelte ihn böse an. „Lass mich verdammt noch mal in RUHE!“, schleuderte sie ihm entgegen. Verdutzt schaute er sie an, aber vorbei ließ er sie immer noch nicht. Kühl schaute sie ihm in die Augen. Gleichgültig blickte er zurück. Er hatte sich nun so weit heruntergebeugt, dass seine Nasenspitze fast die Lillys berührte. „Hör mir mal gut zu,“ flüsterte er, „wenn du willst, dass ich dich in Ruhe lassen soll, dann lüfte doch mal das Geheimnis der flüsternden Blume!”

Verdutzt schaute Lilly ihn an. Der Junge lachte. Er schlurfte zurück zu seinen bulligen Freunden. Lilly blieb einen Moment lang ratlos stehen, bevor sie unter johlendem Gelächter weiter ging. Bis ein weiterer Junge sich ihr in den Weg stellte. Er hatte braunes Haar, das ihm in kurzen Strähnen in die Stirn fiel. Lilly stöhnte. „Nicht schon wieder“, dachte sie, würde sie überhaupt noch in die Pause kommen? Ein schwarzhaariger Junge stellte sich zu ihnen. Er lächelte. Lillys Mundwinkel zuckten, was wohl eine Art Lächeln darstellen sollte. „Hi, ähm ich bin Dean und das ist mein Freund Jim,“ sagte der Junge mit den braunen Haaren. „Danke
Kunst und Kultur
Dean, ich kann mich aber auch selbst vorstellen“, sagte der andere mit einem ein wenig beleidigten Ton. „Egal, Spaß beiseite“, beschloss der Junge namens Dean mit einer wegwischenden Handbewegung. „Zufällig haben wir von eurem Gespräch eben mitbekommen.“ „Ja ganz zufällig,“ erwiderte sie ihm beiläufig. Böse blickte Lilly die beiden an. Schnell sprach Dean weiter: „Wir wollen dir helfen, denn zufällig wissen wir etwas über die flüsternde Blume.“ Spöttisch hob Lilly die Augenbrauen. „Aha, das glaubt ihr doch selber nicht. Die flüsternde Blume ist ein Märchen, MÄRCHEN, klingelt’s?“
„Ja schon, aber es wär´n cooles Abenteuer“, erwiderte Dean bedrückt. „Ja, vergiss es“, meinte Lilly spöttisch. „Ok, dann nicht. War nur ein Vorschlag“, meinte Jim, der sich erst jetzt in das Gespräch einmischte. „Ups“, dachte Lilly, „war sie etwa zu zickig geworden? Das passierte schnell, wenn sie unsicher war.“ Also beeilte sie sich zu sagen: „Na, na gut, ihr könnt mir helfen.“ „Ja!“, freute sich Dean und auch Jim jubelte. Verlegen unterdrückte sie ein leises Kichern. „Ok, wir treffen uns nach der Schule bei mir, Crosslandstreet 63“, sagte Dean. Freundschaftlich lächelte er sie an, doch ohne zu überlegen giftete Lilly ihn an. „Hey, damit das klar ist: Wir sind keine Freunde.“ Dean fuhr zusammen. Er nickte ihr kurz zu und verschwand dann in Richtung Schulkiosk. Im Unterricht konnte Lilly sich nun nicht mehr konzentrieren, denn ständig musste sie an die Pause denken und hoffte fieberhaft auf das Ende des Unterrichts. Doch als die Glocke klingelte, war sie die Erste, die den Klassenraum verließ und lief schnurstracks zum Schultor. Dean und Jim warteten dort schon auf sie. Ohne ein Wort zu sagen, sahen sie sich an und machten sich dann schweigend auf den Weg in die Crosslandstreet. Sie kamen an vielen Häusern und Wohnungen vorbei, bis sie in einem Park landeten, hinter dem man einen großen, breiten Kiesweg erkannte. Er führte zu einer großen Ansammlung von Schrebergärten. Dean und Jim führten Lilly mitten hinein. Vor einem besonders prachtvoll aussehenden Garten machten sie halt. War dies Deans Garten? Sie sah sich um. Da erblickte sie die beiden Jungen, die auf der anderen Seite des Weges standen und auf eine alte, wacklig aussehende Hütte starrten. Eine dicke Staubschicht lag auf der Fußmatte. Missmutig sah Lilly auf das alte Gebäude. Dean hatte offenbar bemerkt, dass ihr diese Sache nicht geheuer war, denn er sagte: „Kein Sorge, wir waren da schon tausendmal drin und du siehst, wir stehen immer noch lebendig vor dir.“ Lilly schauderte. Würden sie jetzt da rein gehen?
Langsam näherte sie sich dem verrosteten Tor. Die eine Seite hing schief in den Angeln. Lilly riss sich zusammen. Sie war kein Angsthase. Sie ging näher. „Man nennt sie auch die heulende Hütte“, verkündete Jim.

FORTSETZUNG FOLGT...
illustriert von Violetta Krämer | 10A
„Ja, Mama, ich weiß: nicht zu spät nach Hause, keinen veräppeln, nicht sprayen und keinen Unfug!“, erklärte Tinka genervt. „Komm, Toni, lass uns schnell raus, bevor Mutter uns noch ganz verbietet, rauszugehen!“
„Ey, das habe ich gehört, Mädels!“ Doch die beiden Mädchen hörten Tinkas Mama nicht mehr – sie waren nämlich schon längst durch die Tür. Das Einzige, was Tinkas Mutter vor ein paar Sekunden noch gehört hatte, war ein dumpfer Schlag in den Türrahmen.
„Was holst du dir vom Weihnachtsmarkt?“, hakte Tinka neugierig nach, als sie einen großen, prachtvollen Marktplatz betraten. Den Platz schmückten kleine, niedliche, bunte Stände und als Höhepunkt stand ein riesiger, aber wirklich gigantischer Christbaum in der Mitte des Platzes. Er war mit blauen, roten, grünen, gelben, silbernen, goldenen und rosa Kugeln dekoriert. Außerdem hingen noch kleine, süße Engel und Sterne am Baum, die in der Dämmerung erglommen.
„Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich gebrannte Mandeln oder sollte ich doch lieber einen warmen Punsch nehmen? Boah, ich weiß nicht. Hier gibt es so viele Sachen, ich kann mich gar nicht ent… .“ Mitten im Satz stoppte Toni plötzlich, weil sie wie aus dem Nichts ein mittelgroßes, zierliches Mädchen sah, das sich ziemlich auffällig verhielt. Sie trug einen rötlichen Umhang, der mit außergewöhnlichen Schriftzügen versehen und dessen Kapuze ihr ins blasse Gesicht gezogen war. Ihre bräunlichen Haare lugten gerade noch so aus der Kapuze heraus. Auch waren ihre Haare eigenartig mit bunten Bändern und Perlen geschmückt. Jetzt wisperte Toni leise zu Tinka: „Siehst du auch dieses Mädchen, Tinka?” „Ja, aber was ist denn mit ihr?”, fragte Tinka. „Siehst du denn nicht, dass sie sich ständig umschaut und auffällig verhält? Und guck dir doch mal ihren komischen Umhang an und ihre Haare erst!”, erzählte Toni, ohne den Blick vom mysteriösen Mädchen abzuwenden. Tinka gab Toni recht: “Stimmt, sie ist wirklich ziemlich komisch.” Eine ganze Weile schwiegen die beiden Freundinnen. Dabei beobachteten sie das merkwürdige Mädchen mit bohrenden Blicken. „Ahh, was ist das???!!!”, schrie Toni plötzlich schrill auf. Tinka erschrak sich und zuckte zusammen. „Was ist Toni?”
„Irgendetwas hat mich am Bein gestreift!” „Bist du dir sicher? Da ist nichts”, sagte Tinka misstrauisch. „Doch, doch, da war etwas!”, entgegnete Toni. „Ich sehe da aber nichts! Sind meine Augen irgendwie kaputt?”, sorgte sich Tinka.
Toni berichtigte Tinkas Aussage: „Ja, du hast ja Recht, aber mich hat etwas am Bein gestreift. Keine Sorge deine Augen sind nicht kaputt, denn ich sehe auch nichts.”
Plötzlich erklang aus dem Busch ein leises Fiepsen. „DA. Hast du das auch gehört?”, lauschte Toni interessiert und zugleich neugierig. “Diesmal hast du Recht. Da ist wirklich etwas. Es klang wie eine Maus. Aber es gibt zig andere Tiere, die diese Laute von sich geben.” „Tinka, guck mal. Das Mädchen ist weg.” „Oh nein, du hast Recht.”
„Da schimmert doch etwas”, bemerkte Toni aufmerksam, „so golden.”
„Dann lass uns doch schnell hingehen. Komm schon!”, drängte Tinka, als sie schon fast da war. Jetzt holte auch Toni Tinka ein. Sie fand ihre Freundin vor dem goldenen Ding hocken, das auf dem Boden lag und in der Dunkelheit glitzerte. „Das sieht irgendwie wie ein Käfer aus. Aber welcher???”, grübelte Tinka. „Naja”, fand auch Toni, „ich hab’s! Es sieht aus wie ein Marienkäfer, wie ein goldener.” Tinka freute sich. „Wir haben’s! Der schimmert ja so. Um ihn herum ist ganz viel Glitzer. Der Glitzer umhüllt den Marienkäfer ja fast.” „Schlau, schlau, Tinka”, lobte Toni ihre Freundin, „aber was machen wir jetzt mit dem Teil?” „Ich weiß es nicht. Lass uns ihn doch einfach einstecken –das merkt schon keiner”, schlug Tinka zögerlich vor. Toni erwiderte bestimmt: „Auf gar keinen Fall, Tinka! Siehst du nicht die ganzen Leute? Sie starren uns schon an. Lass uns einfach abhauen!” „Toni, das ist unsere Chance. Dieser Marienkäfer ist der Schlüssel zu einem Geheimnis. Das spüre ich in mir.” „Na gut”, gab Toni seufzend auf. Tinka war einfach zu stur, um sie von einer Idee abzubringen. „Wie machen wir das denn?”, flüsterte Toni Tinka zu. „Vertrau mir! Ich weiß schon wie!”, wisperte Tinka ausgefuchst zurück. Sie holte plötzlich ihre Flöte raus, die sie beim Rausgehen noch eingepackt hatte, doch den Grund wusste Tinka auch nicht. Sie liebte ihre Flöte und nahm sie überall hin mit. Es ertönte auf dem Weihnachtsmarkt eine bekannte und hohe Melodie. Auf einmal starrten alle auf dem Weihnachtsmarkt auf Tinka, die mit ihrem Flötenspiel ein Lächeln in die Gesichter brachte.
„Na, nana na na na naaaa …“, erklang es aus dem Holzbläser. Das war die Chance, dachte sich Toni, was Tinka dann auch noch mit ihrem raschen Blick zu versichern schien. Mit einer abrupten Bewegung griff Toni vorsichtig aber schnell nach dem Käfer.
„Jahh!“, jubelte sie feierlich, als sie das goldene Ding in der Hand hielt. Fast hätte sie sich zu laut gefreut, zum Glück hatte es keiner gehört. Jetzt drehte sie sich zu Tinka um, die

nun noch mehr Leute angelockt hatte, und warf ihr einen kurzen hastigen Blick zu. Als Toni genauer hinguckte, sah sie, dass Tinka einen Hut auf den Boden gelegt hatte. Vermutlich hatte sie ihr Ziel erreicht, denn der Hut war nun mit lauter Münzen und Scheinen befüllt. Ihre Freundin fing an zu prusten. Wie immer hatte Tinka einen Weg gefunden, schnell und einfach an Geld zu kommen. Das war ja typisch für sie.
Endlich beendete Tinka ihr Weihnachtsständchen und ein lautes Gejubel und Pfiffe erfüllten den Platz. Anschließend ging Tinka mit einem Strahlen im Gesicht zu Toni hinüber und wedelte mit ihrem vollen Hut, der nur so überquoll.
„Guck mal, ich habe richtig abgesahnt!”, gab Tinka an. „Du hast nichts außer Geld im Sinn, aber ist ja jetzt auch egal. Hauptsache wir haben jetzt das Teil”, mahnte Toni ihre Freundin, die nun schuldbewusst guckte.
„Was nun?“, fragte Tinka neugierig. Toni erwiderte daraufhin: „I don’t know, oder? Lass uns doch nach Hause, da können wir erstmal einen Plan aushecken.”
Auf dem Weg nach Hause schwiegen die beiden, anscheinend dachten sie an dasselbe.
FORTSETZUNG FOLGT...

Auch in diesem Heft erklären wir wieder einen Begriff, der einem immer wieder im öffentlichen Diskurs begegnet, von dem man aber vielleicht gar nicht weiß, was er bedeutet. Unsere Redaktion hat den Begriff des/der “Reichsbürgers/in” ausgewählt, weil er im Zusammenhang mit unserem Titelthema hochaktuell ist: Anfang März 2025 sind vier Reichsbürger und eine Reichsbürgerin zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie einen Umsturz geplant haben mit dem Ziel, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen – ein Ausdruck von Hass auf das demokratische System und auf unsere Gesellschaft!
Kaan Savluk hat sich für euch informiert und erklärt euch den Begriff.
von Kaan Savluk | 9B
Ein Reichbürger ist eine Person, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ablehnt und die Meinung vertritt, dass das Deutsche Reich weiterhin fortbestehe. Viele meinen damit das NS-Regime vor und während des Zweiten Weltkrieges, während andere sich auf das Deutsche Kaiserreich von 1871 beziehen. Die Bewegung setzt sich aus verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen zusammen, die oft eigene „Regierungen“, „Personalausweise“ und „Gesetze“ erfinden.
Reichsbürger lehnen die deutsche Verfassung, Behörden und das Rechtssystem ab. Manche vertreten Verschwörungstheorien oder antisemitische sowie rechtsextreme Ansichten.
In Deutschland gelten Reichsbürger als verfassungsfeindlich, da viele Waffen besitzen und zu Widerstand gegen den Staat aufrufen. Dadurch sind sie eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie.


Hier geht es jetzt ausnahmsweise mal nicht um die ganzen Krisen, die es auf unserem Planeten gibt, sondern um das schön entspannte Thema Fußball.
Nein, Spaß, ganz so entspannt wird es dann doch nicht, weil Fußball längst nicht mehr nur Sport ist, sondern vor allem Geld - ganz viel Geld. Ein deutscher Fußballfan gibt im Jahr durchschnittlich 387 € aus, ergab eine Rechnung des Deutschen Instituts für Sportwissenschaft. Aber das alles ist natürlich nicht mit den Spielerablösen zu vergleichen, die in den letzten Jahrzehnten zu exorbitanten Summen angestiegen sind. Für den Brasilianer Neymar gab der französische Verein Paris-Saint-Germain 2017 die unglaubliche Summe von 222 Millionen Euro aus und ist damit fast so teuer wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt der Marshallinseln, das bei 253 Millionen US-Dollar liegt. Komischer Vergleich, ich weiß, aber ich dachte, irgendwie muss ich euch klar machen, wie viel Geld das ist. Dass man ein ganzes Landesvermögen mit einem Spieler gleichstellen kann!
Man kann auch nicht wissen, ob diese Rekordablösesumme in den nächsten Jahren noch übertroffen werden kann, wenn man bedenkt, dass die Ablösesummen immer krasser werden. Aber in den letzten Jahren hat ein neuer Akteur angefangen, den Transfermarkt mächtig aufzumischen: Saudi-Arabien. Dass die guten Saudis ein bisschen unnötiges Geld auf Lager haben, ist schon länger bekannt, aber
dass diese jetzt auch im Fußball mitmischen, ist neu. Der Plan Saudi-Arabiens ist es, sich bis zur Heim-WM 2034 als echte ,,Fußballnation“ zu präsentieren. Mit Wahnsinnsgehältern locken sie Top-Stars wie Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. oder Karim Benzema. In der Saudi Pro League spielen mittlerweile so viele Top-Stars, dass diese richtig gut ist. Man hat schon fast das Gefühl, dass der Weltfußballverband FIFA und Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Damit die WM 2034 auch ganz sicher in Saudi-Arabien stattfindet, hat die FIFA es so gemacht: Es darf nicht vorkommen, dass auf einem Kontinent mehr Turniere ausgetragen werden als auf anderen. Eigentlich kann jeder Kontinent deswegen nur alle 24 Jahre ein Turnier ausrichten, außer ein Turnier wird auf mehreren Kontinenten ausgerichtet, so wie es im Jahr 2030 sein wird. Dieses Turnier wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden und einzelne Spiele werden auch in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. So kann 2034 das Turnier nur noch in Asien ausgerichtet werden und die einzige Bewerbung kam aus Saudi-Arabien. Ich finde es alles andere als schön, dass der Fußball, der immer noch ein Sport ist, so von Geld, Unternehmen und Ländern missbraucht wird, um von politischen Themen abzulenken und Macht zu erlangen. Diese Unsummen von Geld könnte man in andere, wichtigere Sachen investieren als in Sport.

Foto: Eigene Aufnahme
Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag am Leo? Wenn ja, wie war er?
Mein erster Arbeitstag am Leo liegt leider schon etwas zurück und deshalb ist meine Erinnerung an diesen konkreten Tag, um ehrlich zu sein, schon etwas verblasst (was ja rückblickend vielleicht nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeutet, denn anscheinend gab es immerhin keine verletzten Schüler:innen im Kunstunterricht). Woran ich mich allerdings noch sehr gut erinnern kann, ist die technische Einführung bei Herrn Scheel an einem meiner ersten Tage am Leo. Die war sehr ausführlich und hat mich gut auf den Umgang mit den Smartboards vorbereitet. Herr Scheel hat außerdem schon an diesem Tag durch sein einerseits sehr professionelles Auftreten und sein auf der anderen Seite etwas grummeliges Wesen (sowie im weiteren Verlauf unter anderem durch sein unheimlich leckeres Tiramisu-Rezept oder durch sein jederzeit geöffnetes Ohr für allerlei Fragen meinerseits) einen nachdrücklichen Eindruck bei mir hinterlassen, der mich noch heute zum Schmunzeln bringt.
Welche besonderen Momente haben Sie am Leo erlebt? Oh, da gibt es einige! Denn als ich am Leo angefangen habe, hatte ich kaum praktische Unterrichtserfahrung als Lehrkraft, weshalb fast alles neu und aufregend für mich war. So habe ich zum Beispiel das erste Mal zwei 5. Klassen (damals unter der Leitung von Herrn Krieger und Herrn Müller-Sun, die mich beide in dieser Zeit sehr unterstützt haben) in Deutsch unterrichtet und dabei gemerkt, wie viel Verantwortung es bedeuten und wie viel Freude es bereiten kann, solch jungen Menschen zu helfen, gut an ihrem neuen Lernort anzukommen und sich dabei wohlzufühlen und
zurechtzufinden.
Außerdem fand ich die Kunsträume des Hauptgebäudes, ganz oben unterm Dach, immer sehr besonders. Dort konnte man so schön ins Weite schauen, Gedanken fließen lassen und sich vom architektonischen Stadtbild des Veedels für den Kunstunterricht inspirieren lassen.
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Das ist eine Frage, die ich lange nicht so richtig gerne beantwortet habe, weil ich mir nicht immer sicher war, ob ich diesen Job überhaupt machen möchte. Lehrerin werden zu wollen, war nämlich kein Wunsch, den ich schon seit meiner Kindheit gehegt habe. Vielmehr hat er sich erst während des Studiums und besonders in der anschließenden Praxis (zum Beispiel in der Zeit am Leo) herausgebildet. Heute bin ich froh, es ausprobiert zu haben! Denn auch wenn ich aktuell immer noch Berufsanfängerin bin, weiß ich, dass dieser Job der Richtige für mich ist, weil mir die Arbeit mit den Schüler:innen Spaß macht (auch wenn das natürlich nicht für die 8./9. Std. zutrifft :D). Ich erkläre Dinge gerne und finde den Austausch mit anderen Menschen einfach spannend. Schüler:innen dabei zu unterstützen, ihr Selbstbild (weiter-) zu entwickeln und zu stärken oder sich zu gewissen Fragen zu positionieren und mich darüber mit Kolleg:innen auszutauschen, empfinde ich als sehr sinnstiftend. Welche Fächer haben Sie unterrichtet?
Deutsch und Kunst hauptsächlich. Zudem habe ich auch ein bisschen Erdkunde, PP und sogar Englisch unterrichtet. Die letzten drei Fächer fachfremd, wodurch ich einerseits gemerkt habe, was das für tolle Fächer sind und andererseits wie eingerostet meine Englischkenntnisse doch sind.
Wo arbeiten Sie jetzt?
Seit dem 01.11.2025 arbeite ich fest am Gymnasium Kreuzgasse und bin bis Sommer 2026 an die Grundschule Trierer Straße teilabgeordnet1
Wie lange waren Sie am Leo tätig?
Am Leo habe ich ein knappes Jahr gearbeitet. Mir kommt es allerdings länger vor, wenn ich darüber nachdenke.
Was würden Sie einer Ihrer alten Klassen mit auf den Weg geben?
Vielleicht einen Spruch, der gerade an meiner Haustür klebt: Das Gedächtnis schreibt mit Bleistift. Darüber lässt sich bestimmt streiten, aber ich glaube, manchmal kann es bei all dem technischen und digitalen Input sicherlich guttun, etwas bewusst und handschriftlich zu notieren, innezuhalten und ggf. zum Brainstormen eine der besagten „Ideenskizzen“ von Herrn Klute anzulegen.
Sind Sie noch mit Lehrer:innen vom Leo in Kontakt? Leider nicht wirklich. Häufig nimmt man sich ja vor, in Kontakt zu bleiben und einen Kaffee trinken zu gehen, aber
dann kommt doch der Alltag dazwischen… Ich beobachte aber mit großem Interesse die regelmäßig stattfindenden Kunstausstellungen der genialen Kunstfachschaft und ihren Schüler:innen! Die waren und sind immer sehr sehenswert und inspirierend.
Und ganz allein bin ich mit meiner Leo-Vergangenheit an der Kreuzgasse dann doch nicht. Ich habe mit Frau Ebbinghaus (die ich schon aus meinem Studium kenne) und Herrn Kombrink-Detemble Kolleg:innen an der Kreuzgasse, mit denen ich mich gerne an gemeinsame Tage am Leo zurückerinnere.
Warum sind Sie vom Leo weggegangen? Ich wäre damals tatsächlich gerne am Leo geblieben. Leider war das durch mein anstehendes Referendariat und die damit verbundene Schulzuweisung allerdings nicht möglich. Aus heutiger Sicht bin ich froh, weitergezogen zu sein, denn an meiner jetzigen Schule bin ich auch sehr glücklich und erinnere mich stattdessen gerne an die Zeit am Leo und die Menschen, die ich dort getroffen habe, denn sie haben es für mich zu einem ganz besonderen Lebensabschnitt gemacht.
1 teilabgeordnet: Manche Lehrer:innen arbeiten für eine bestimmte Zeit an zwei Schulen gleichzeitig.





Anzeige



Schulfahrten und Austausche
Interview mit Emily Zeinar, geführt von Luc Aydogan Müller-Harmandali | EF
Wo und wie lange bist du im Ausland?
Ich bin für insgesamt 10 Monate in den USA, in Kalifornien, Vacaville, ungefähr 40 Minuten von San Francisco entfernt.
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?
Um ehrlich zu sein, war mir das Land gar nicht so wichtig. Ich bin hier, weil der Deutsche Bundestag Vollstipendien vergibt für ein Auslandsjahr in den USA. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es nicht wichtig ist, wo genau man ist, weil man überall coole Leute findet und die Menschen, mit denen man sich umgibt, deine ganze Erfahrung ausmachen.

Wie bist du auf die Idee gekommen ein Auslandsjahr zu machen und wie hast du dieses dann anschließend bekommen?
Seitdem ich wusste, dass man ein Auslandsjahr machen kann, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das machen muss. Einfach mal komplett raus aus meiner Komfortzone und alles aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich denke auch, dass die Erfahrungen, die man sammelt, wenn man allein in ein fremdes Land zieht, mehr wert sind als jede Unterrichtsstunde. Mir war von Anfang an klar, dass ich mich auf Stipendien bewerben will. Schlussendlich habe ich dann auch das PPP1 bekommen und bin unfassbar dankbar dafür.
Ich wollte so viel wie möglich aus meinem Auslandsjahr rausholen und das PPP hat für mich einfach perfekt gepasst. Ich muss auch sagen, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man sich sein Auslandsjahr selbst erarbeitet hat und es gibt einem irgendwie auch mehr Durchhaltevermögen. Dieses Stipendium hat mein Leben verändert. Ich durfte so unfassbar viel lernen und sehen und habe unter den anderen Stipendiat:innen beste Freunde gefunden, ohne deren Unterstützung und Rat ich es nicht geschafft hätte.
Nenne mir einen deiner skurrilsten Kulturschocks, den du bei deinem Auslandsjahr erlebt hast.
Es gibt viele kleine Sachen, von denen ich überrascht war, aber richtig geschockt würde ich sagen, haben mich die stereotypischen „Country“-Leute, hier „hicks“ genannt. In meiner Stadt wohnen viele Farmerfamilien, die Landwirtschaft betreiben, und deren Kinder sehen das teilweise als Teil ihrer Identität an. Was ich damit meine sind Cowboy Boots, karierte Hemden, bootcut-Jeans, einen Truck fahren und am Wochenende jagen gehen. Eine konkrete Situation, in der ich auf jeden Fall einen Kulturschock hatte, war als unsere Lehrerin uns fragte, was wir täten, um Stress abzubauen. Einer der so genannten „Hicks“ antwortete „I just love messing around with bulls“ (Ich liebe es, mit Bullen rumzutoben).
Was waren bis jetzt die größten Herausforderungen, denen du in deinem Auslandsaufenthalt begegnen musstest?
Auf jeden Fall mein Gastfamilienwechsel.
Hast du Tipps oder Empfehlungen für Schüler:innen, die auch gerne ein Auslandsjahr machen möchten?
Sei mutig und probier’ alles Neue aus, was geht, um dein Gastland wirklich kennen zu lernen. Versuch richtig zuzuhören, denn andere Menschen sind das, was deine ganze Erfahrung ausmacht.
Sei so offen, wie es geht, vom ersten Tag an und sprich so viele Leute wie möglich an. Ich dachte, ich wäre schon ziemlich offen, als ich in Deutschland war, bis ich dann hierhin kam.
Am Anfang muss man sich einfach jeden Tag neu überwinden und sich daran gewöhnen, permanent aus der eigenen Komfortzone heraus zu sein, aber das ist ja auch der Grund, warum man hier ist.
Nichts hätte mich auf das hier vorbereiten können und man muss sich klarmachen, dass man wirklich von zu Hause auszieht und keine Ahnung hat, was auf einen zukommt, wenn man aus dem Flugzeug steigt.
Mein Auslandsjahr war teilweise wirklich hart, aber gleichzeitig die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.
Ich bin mit 16 Jahren wortwörtlich ans andere Ende der Welt gezogen und das hat mich und mein Leben für immer verändert. Ich will damit niemandem Angst machen, aber für mich war es eine extrem emotionale und persönliche Erfahrung. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass das das richtige für dich ist und du die Chance hast, dann mach es aber auf jeden Fall! Ich bereue nichts und durfte so viel erleben, so viele tolle Orte sehen, Menschen kennenlernen, habe unfassbar viel Spaß und bin wirklich sehr dankbar hierfür! Kalifornien wird für immer ein Zuhause für mich sein.
Was sind deine bisherigen Highlights?
Im November waren wir mit den anderen Stipendiat:innen in Washington D.C. und es war richtig schön, meine Freunde wiederzusehen.
Wir haben auch die Chance bekommen, direkt eine Woche nach der Präsidentschaftswahl mit Kongressabgeordneten zu sprechen, was super interessant war. Ein besonderer Moment war aber definitiv, als J.D. Vance, Trumps zukünftiger Vizepräsident, an uns vorbeigelaufen ist.
Ein weiteres Highlight war, als meine Gastfamilie und ich die Winterferien in Lake Tahoe verbracht haben und sie mir mehr oder weniger Ski fahren beigebracht hat.
Was ich auch definitiv nie vergessen werde, ist, als ich bei einem Sacramento Kings (bekanntes NBA-Team) - Spiel in der 5. Reihe im Loungebereich saß.


1 PPP = das Parlamentarisches Patenschaftsprogramm ist ein beidseitiger Jugendaustausch, der 1983 zwischen dem Kongress der Vereinigten Staaten und dem Deutschen Bundestag vereinbart wurde.
Fotos: Eigene Aufnahmen
























von Luc Aydogan Müller-Harmandali | EF
Auch Julia Heinicke, Charlotte von Mörs, Leni Neuefeind sind Schülerinnen der Jahrgangsstufe EF, die den Schritt gewagt haben und fünf bis acht Monate des Schuljahres im Ausland verbringen. Egal ob Norwegen, Australien oder die USA, sie haben alle ihre Erfahrungen gemacht und berichten uns von Herausforderungen und Kulturschocks. Dabei haben sie noch den ein oder anderen Tipp verraten.





Wo und wie lange bist du im Ausland?


Ich bin in den USA in Minnesota und bin hier seit dem späten August und komme im Mai oder Juni 2025 zurück, ich bin also ca. 8 Monate hier.
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?
Ich wollte vor allem in ein englischsprachiges Land. Ich schätze mal, das war mein Hauptfokus. Ich war auch neugierig, wie die USA wirklich sind.
Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Auslandsjahr zu machen und wie hast du dieses dann anschließend bekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall schon länger etwas, worüber ich nachgedacht hatte. Ich habe mich bei einer Organisation beworben und mich vorgestellt und ab da begann dann der Vorbereitungsprozess.
Nenne mir einen deiner skurrilsten Kulturschocks, den du bei deinem Auslandsjahr erlebt hast.
Ich würde sagen, es hat mich erstaunt, wie unterschiedlich Städte hier aufgebaut sind. Alles ist darauf ausgerichtet, dass es mit dem Auto erreichbar ist. Deswegen gibt es kaum kleine Läden, sondern größtenteils große Ladenketten.
Was waren bis jetzt die größten Herausforderungen, denen du in deinem Auslandsaufenthalt begegnen musstest?
Eine Herausforderung ist definitiv, dass man sich daran gewöhnen muss, ein Fremder zu sein. Jeder hat schon einen Alltag und lebt in dieser Welt, aber man selbst ist so weit von seinem eigenen Zuhause entfernt. Das kann schon sehr isolierend sein. Manchmal will man einfach nur zuhause sein und sich zugehörig fühlen.
Hast du Tipps oder Empfehlungen für Schüler:innen, die auch gerne ein Auslandsjahr machen möchten?
Ich würde jedem sagen, der überlegt, ein Auslandsjahr zu machen, dass es viel Arbeit und Zeit benötigt, aber dass es sich lohnt für all die Erfahrungen. Wenn du so ein Projekt angehen möchtest, mach es auf eine Art, die dich glücklich macht und genieße es!
Bilder (nachbearbeitet): Unsplash / Basma Alghali





Wo und wie lange bist du im Ausland?


Ich bin 5 Monate in Norwegen in Røyse, ein kleiner Ort in der Nähe von Hønefoss.
Warum hast du dich für dieses Land entschieden?
Ich wollte nach Skandinavien oder in die nordischen Länder gehen, weil ich nicht so weit wegwollte und ich Winter sehr gerne mag. Norwegisch ist deutsch sehr ähnlich und Norwegen hat eine superschöne Natur, also habe ich dieses Land genommen. Und im Nachhinein bin ich sehr froh über meine Wahl.
Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Auslandsjahr zu machen und wie hast du dieses dann anschließend bekommen?
Ich wollte meine Chance nutzen, einen anderen Alltag und eine andere Kultur zu sehen und auch eine neue Sprache zu lernen vor der Q1. Ich habe mein Programm durch eine deutsche Organisation gefunden, die dann für mich eine norwegische Organisation gefunden hat.
Nenne mir einen deiner skurrilsten Kulturschocks, den du bei deinem Auslandsjahr erlebt hast.
Ich würde sagen, wie krass streng das Schulsystem mit Fehlstunden ist. Wenn man mehr als 10% der Zeit von einem Fach fehlt, kriegt man keine Note. Also kann mal nur so 2-mal in jedem Fach fehlen.
Was waren bis jetzt die größten Herausforderungen, denen du in deinem Auslandsaufenthalt begegnen musstest? Alles allein zu planen. Fahrten, Treffen, Flug usw. Auch wenn man einfach nur einkaufen will, muss man vorher planen. Man ist komplett auf sich gestellt.
Hast du Tipps oder Empfehlungen für Schüler:innen, die auch gerne ein Auslandsjahr machen möchten?
Man sollte sich nicht isolieren und auch von sich aus auf andere zugehen, auch wenn man schüchtern ist.





Wo und wie lange bist du im Ausland?
Ich bin für 6 Monate in Australien.


Warum hast du dich für dieses Land entschieden?
Ich wollte gerne irgendwohin, wo es warm ist und natürlich viele Strände sind. Australien hat einfach ganz gut mit meinen Vorstellungen zusammengepasst.
Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Auslandsjahr zu machen und wie hast du dieses dann anschließend bekommen?
Ich kann mich gar nicht so wirklich erinnern, wann und
wie ich das erste Mal auf die Idee gekommen bin, so etwas wie einen Auslandsaufenthalt zu machen. Aber ich fand die Idee gut und habe mit meinen Eltern gesprochen. Nach und nach haben wir dann recherchiert und es dann tatsächlich gemacht.
Nenne mir einen deiner skurrilsten Kulturschocks, den du bei deinem Auslandsjahr erlebt hast?
Wahrscheinlich, dass die Leute hier nicht abschließen und du einfach bei deinen Freunden rein und raus gehen kannst.
Was waren bis jetzt die größten Herausforderungen, denen du in deinem Auslandsaufenthalt begegnen musstest? Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, das erste Mal gewisse Dinge allein zu machen oder organisieren zu müssen. Das ist nicht immer so einfach.
Hast du Tipps oder Empfehlungen für Schüler:innen, die auch gerne ein Auslandsjahr machen möchten?
Sei offen für alles und versuche, so viel wie möglich aus deiner Zeit mitzunehmen!!
Schulfahrten






von Nellie Tesmer, Malina Bruning und Leni Pooth | 10B
Liebe „Lateinbegeisterte“ dieser Schule, im Juni 2024 haben wir den Archäologischen Park Xanten und das Römermuseum besucht und einen Eindruck davon bekommen, wie die Römer damals lebten. Zu dieser Zeit war Xanten unter dem Namen Colonia Ulpia Traiana bekannt und zählte zu den größten Städten nördlich der Alpen.
Nun nehmen wir auch euch mit in eine vergangene Zeit.
Wir wurden zu Beginn unseres Aufenthalts in Xanten in zwei Gruppen über das Gelände geführt. Als Erstes wurde uns das eindrucksvolle Amphitheater gezeigt, in dessen Gängen uns das Leben der Gladiatoren nahegebracht wurde. Auch dessen Tribünen haben wir besichtigt und wurden über die verschiedenen Bevölkerungsschichten im Amphitheater aufgeklärt. Entlang der Stadtmauern ging es für uns weiter zu den Thermen und Herbergen. Besonders im Kopf geblieben ist uns die Information, dass die Römer





während ihres Toilettengangs tatsächlich geschäftliche Gespräche führten – woher übrigens der Begriff „ein Geschäft machen“ stammt. Als letzten Punkt der Führung haben wir uns einen Teil eines echten Fundaments des alten Xanten angesehen.



Danach konnten wir uns frei bewegen und sind unter anderem zu einem nachgebauten Tempel gegangen. Nach einem Mittagessen sind wir in das Museum des Parks gegangen und haben uns viele Artefakte angesehen, die vor allem Themen rund ums Kämpfen behandelten. Wir hatten die Möglichkeit, nachgebaute Gladiatorenhelme anzuprobieren, und haben gemerkt, dass diese unglaublich schwer sind und dass man unter ihnen kaum Luft bekommt oder etwas sehen kann.


Abschließend kann man sagen, dass wir einen amüsanten, schönen und lehrreichen Tag hatten und einen Besuch jederzeit weiterempfehlen können!









Schulfahrten und Austausche
Wie ist der Austausch grundsätzlich abgelaufen?
Zunächst sind wir für eine Woche nach Frankreich gefahren (Juni 2024). Die Franzosen sind dann im November 2024 für eine Woche zu uns nach Köln gekommen. Im Rahmen des Austausches gab es ein vielfältiges Programm: In Paris z.B. eine Rundfahrt auf der Seine, die Erkundung verschiedener Stadtviertel, der Besuch der Orangerie, wo wir die Seerosen von Monet bewundern konnten, die Besichtigung des Schlosses von Versailles und einiges mehr.
In Köln haben wir u.a. den Dom im Rahmen einer Führung besichtigt und die Stadt sowie unser Veedel „Nippes“ gemeinsam erkundet. Die Französinnen und Franzosen waren darüber hinaus auch im Museum Ludwig. Außerdem waren wir alle zusammen im Haus der Geschichte in Bonn und in der dortigen Innenstadt. Abschließend haben wir im Haus „Schnackertz“ in Nippes lokale Spezialitäten verkostet.
Wie wurde die Zuteilung mit den Gastfamilien organisiert und waren die Schüler:innen damit zufrieden?
Die Zuteilung der einzelnen Schüler:innen, das sogenannte „partnering“, erfolgt immer in Kooperation mit unserer Partnerschule und deren Lehrkräften. Zunächst füllen alle Schüler:innen Steckbriefe aus, in denen es u.a. um Interessen und Hobbies geht. Ich habe zunächst die Steckbriefe aus Frankreich erhalten und mit Hilfe unserer Steckbriefe und diversen Absprachen mit unseren Schüler:innen eine Zuordnung vorgenommen.
Bei uns kommen die Schüler:innen aus unterschiedlichen Klassen (a-d), anders als in Frankreich, wo die teilnehmenden Schüler:innen aus einer Klasse stammen.
Wie kamen die Austauschschüler:innen miteinander klar und gab es Komplikationen?
Insgesamt lief es gut, wobei es in diesem Jahr, anders als beim Austausch im vergangenen Jahr, einige Kom-

plikationen gab, die aber besprochen und geklärt worden sind.
Anders als bei uns wohnen die Familien in einem weiteren Umkreis der Schule, so dass es nicht zwangsläufig möglich ist, dass man sich am Wochenende miteinander treffen kann. Vielmehr geht es bei dem Austausch darum, an den geplanten Familienaktivitäten teilzunehmen.
Was war das Schönste oder Interessanteste, das ihr in Frankreich bzw. Deutschland mit den Französ:innen unternommen habt?
Ein Highlight des Austausches war für uns sicherlich die Erkundung von Paris mit den vielen Sehenswürdigkeiten und der faszinierenden Atmosphäre dieser wunderschönen Stadt. Von französischer Seite weiß ich, dass die Schüler:innen es sehr genossen haben, bei uns in Köln und in Nippes zu sein.
Was kann man bei dem Französischaustausch lernen und wieso lohnt es sich mitzumachen?
Man lernt eine andere Kultur, andere Gewohnheiten sowie verschiedene Abläufe innerhalb der Gastfamilien kennen und kann so ein besseres Verständnis füreinander gewinnen. Man muss sich arrangieren, verständigen und gegebenenfalls auch mit möglichen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Darüber hinaus wird die Sprachkompetenz gefördert und das Gefühl, dass man auch gut klarkommen kann, selbst wenn man die Sprache nicht perfekt beherrscht. Vielmehr geht es ja darum, etwas zu lernen und sich zu verbessern. Eine solche Erfahrung stärkt das Selbstbewusstsein und ist in meinen Augen durchaus gewinnbringend für die Persönlichkeitsentwicklung.



von Luc Aydogan Müller-Harmandali | EF






Seit ein paar Jahren pflegt unsere Schule eine Partnerschaft mit der Deutschen Internationalen Schule Pretoria (DSP) und seitdem gibt es einen Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen und damit die Möglichkeit, die jeweils andere Kultur kennen zu lernen.
Der Austausch wird finanziell von der Initiative “Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH) und dem Förderverein ermöglicht. Im Jahr 2016 fand nach langer Pause (seit der Gründung durch die ehemalige Schulleiterin Frau Prinz 1998) der Südafrikaaustausch erstmals wieder statt. Nach einer weiteren Zwangspause durch Corona lief der Austausch 2022 wieder zwischen den beiden Schulen an. Ich selbst war 2024 dabei und werde euch in diesem Artikel darüber berichten.
Der Austausch besteht aus zwei Phasen: Zunächst der Aufenthalt der Schüler:innen des Leos in Südafrika, der immer im Herbst stattfindet, und dann die Anreise der Schüler:innen des DSP nach Deutschland im Sommer. Jede:r Beteiligte des Austausches hat eine:n Schüler:in der anderen Schule als Austauschpartner:in. Während des Austausches zieht man bei seiner Austauschpartnerin oder seinem Austauschpartner ein und lernt die Familie und damit auch die Kultur des Landes hautnah kennen. Beide Phasen des Austausches dauern jeweils zwei Wochen und beinhalten unter der Woche tägliche Aktivitäten mit beiden Gruppen. Als wir letztes Jahr in Südafrika waren, gab es Aktivitäten wie mehrere Museumsbesuche, die uns nicht nur über die Kultur des Landes, sondern auch über seine Geschichte aufgeklärt haben. Es gab auch Ausflüge








zum Freizeitpark und natürlich einen Tag, an dem man als Schüler:in am Unterricht der DSP teilnehmen konnte. Ein besonderes Highlight war das erste Wochenende des Austausches, das wir alle im Warthog Inn, einer Art Camp mitten im Marakele Nationalpark, verbracht haben. Im Warthog Inn gingen wir auf Safaris, mussten Parcours durchlaufen und zahlreiche weitere abenteuerliche Aufgaben erfüllen. Aber natürlich hatte man auch am Wochenende Zeit, unabhängig vom Austausch, das Land eigenständig mit der Gastfamilie oder Freund:innen zu erkunden. Diesen Sommer werden dann unsere Austauschpartner:innen in Deutschland ankommen und die deutsche Kultur hautnah erleben. Der gesamte Südafrikaaustausch war eine einmalige, unvergessliche Erfahrung, bei der ich viel über Südafrika gelernt habe. Ich kann ihn euch empfehlen und ihr könnt, solltet ihr 2026 Schüler:in der EF oder Q1 sein, hoffentlich selbst mitmachen!






Schulfahrten und Austausche




„Der perfekte Mix zwischen dem Kennenlernen einer neuen Kultur, viel Freizeit, Spaß und lustigen neuen Leuten machte die Barcelonafahrt zu einem Highlight unserer Schullaufbahn.“
von Mathilde Tödt und Anna Brunner | 10B mit Kommentaren von Lilo Schwetzel, Clara Schiel und Kian Cuhadaroglu | 10C
Vom 18.-22.3.2025 war ein Teil des Spanischkurses der aktuellen 10er für einen Austausch in Spanien. Wir sind mit sieben Schüler:innen, Frau Gramberg und Herr Winter nach Barcelona geflogen. Von da aus sind wir etwa eine Stunde lang mit dem Zug in unseren Austauschort, Mataró, gefahren. Dort haben wir unsere Austauschschüler:innen kennengelernt. Wir wurden herzlich aufgenommen und haben den ersten Nachmittag mit unseren Gastfamilien verbracht. Die nächsten zwei Tage sind wir mit der Austauschgruppe nach Barcelona gefahren und haben verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht. Wir hatten außerdem auch ausreichend Zeit, in der wir die Stadt frei erkunden konn-
„In so wenig Zeit ist so viel passiert, dass man das gar nicht richtig zusammenfassen kann, aber durch die herzlichen Gastfamilien und Austauschpartner, die Aktivitäten, Feiern & Sport hat sich für uns bisher wenig so sehr gelohnt wie dieser Austausch!“

ten. Dabei haben wir verschiedene Früchte in der Boqueria probiert, waren auf den Ramblas shoppen und haben den Park Güell sowie die Bauwerke des berühmten Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) besichtigt. Abends haben wir in Mataró beim Training der sogenannten Castells zugeguckt. Das sind Menschenpyramiden, die in Katalonien eine lange Tradition haben und bei verschiedenen Festen aufgeführt werden. Wir durften sogar beim Stützen des Menschenturms mitmachen. Am Freitag waren wir dann mit unseren Austauschpartnern in einer Kletterhalle klettern und abends haben wir eine gemeinsame Abschlussfeier mit Tapas und spanischer Musik organisiert.
„In nur fünf Tagen in Spanien haben wir so viele Erinnerungen gesammelt wie bei keiner anderen Fahrt bisher.“




Schulfahrten und Austausche
von Tami von Cysewski | Q2
21.01.2025 - 24.01.2025 | DER ZUG FÄHRT AN, ES GEHT LOS NACH MÜNCHEN. ES FÜHLT SICH KOMISCH AN, SICH AUF DIESE FAHRT ZU FREUEN. IM GEPÄCK HABE ICH EINIGE AUSGEDRUCKTE DOKUMENTE ÜBER MEINEN URUR -
GROSSVATER, EINEN WIENER JUDEN. ZWEI BRIEFE, DIE NIEDERGESCHRIEBENE ERINNERUNG MEINER OMA UND AUCH EINE ENTLASSUNGSKARTE AUS DEM KZ DACHAU. DIE REISE WIRD PLÖTZLICH SEHR PERSÖNLICH.

Das Programm für Dienstag und Mittwoch ist gut ausgewählt. Wir setzen uns gedanklich mit der Stadt und ihrer Vergangenheit auseinander. Das Jüdische Museum ist sehr beeindruckend. Klein, aber tiefgehend. Es geht um jüdisches Leben, nicht nur um jüdischen Tod. Jüdinnen und Juden nicht nur als Opfer der Shoa zu sehen, sondern etwas über jüdische Kultur und Tradition mitzunehmen – eine wichtige Ergänzung für diese Fahrt. Ich finde es sehr schön, mit den anderen ins Gespräch zu kommen, uns über Religion und Identität auszutauschen. Und dennoch bleibt bei mir vor allem hängen, dass die meisten kaum etwas über das Judentum wissen. Jüdische Menschen und jüdisches Leben werden viel zu häufig auf die Schrecken der Shoa reduziert.
Am Donnerstag besuchen wir die KZ Gedenkstätte Dachau. Alleine in einen Zug mit dem Ziel „Dachau Hbf“ zu steigen, fühlt sich ganz komisch an. Busfahrt durch den Ort Dachau. Vorbei an Geschäften, die Dachau in ihrem Namen tragen. Eine erschreckende Normalität. Genauso wie die Nähe zu dem Ort, an dem unzählige Menschen ermordet wurden. In den 1980er Jahren baute man sogar Häuser, die direkt an die Gedenkstätte grenzen. Die Mauer eines ehemaligen Konzentrationslagers als Gartenmauer. Auf mich wirkt das verstörend. Wir werden wie immer in zwei Gruppen aufgeteilt. Es regnet. Der Guide beginnt zu erzählen. Über das Gelände und was davon heute Teil der Gedenkstätte ist. Eine Sache schockiert uns besonders: Wo früher SS-Männer ausgebildet wurden, werden jetzt Polizist:innen ausgebildet. Teilweise höre man sogar die Schießübungen. Wie kann das sein? Wirkliche Antworten hat der Guide nicht. Nur der Hinweis, das Leben müsse weitergehen. Ich bin irritiert. Einen Ort des Gedenkens stelle ich mir anders vor. Wir gehen weiter. Betreten den Appellplatz. Hinter uns das
Tor „Arbeit macht frei“. Unwirklich. Irgendwas stört mich an der Art und Weise, wie der Guide erzählt. Sehr unemotional und für meinen Geschmack zu locker. Aber wie soll man sonst an so einem Ort arbeiten? Vielleicht ist es nur möglich, wenn man es nicht an sich ranlässt. Und trotzdem scheint es mir unpassend. Wir gehen durch das Museum. Schauen uns das Lagergefängnis an. Gehen wieder raus auf den Appellplatz.
Mich schockiert meine eigene emotionale Distanz.
Ich fühle mich nicht in der Lage, das Geschehene, die Bilder, die Berichte mit diesem Ort zu verbinden, der auf mich so unwirklich wirkt. Doch als der Guide erzählt, dass es die Wiener Juden, die in Folge der Novemberpogrome deportiert wurden, besonders schwer hatten, spüre ich ein Ziehen in meinem Herzen.
Mittagspause. Wir gehen noch nicht direkt in die Cafeteria. Es gibt noch etwas zu beobachten. Es ist der 23. Januar – vier Tage vor dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Es findet eine vorgezogene Kranzniederlegung statt. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist angekündigt. Wir sehen ihn nicht. Interessant zu beobachten ist die Szene dennoch. Das ist also die Gedenkkultur der „Weltmeister des Erinnerns“. Ein paar verzierte Kränze, dunkle Kleidung, traurige Blicke, Hände schütteln. Untermalt von wehmütigen Klängen einer Tuba. Alles begleitet von Kameras. Absurd.
Langsam mache ich mich mit einer Mitschülerin auf den Weg zur Cafeteria im Besucherzentrum. Die anderen sind schon vorgegangen. Die Cafeteria sieht aus wie eine Schuloder Unimensa. An langen Tischen essen wir Pommes mit zu wenig Salz. Wohin gehen wir zum Abendessen? Die

ganz wichtigen Fragen werden besprochen. Nach der Mittagspause begeben wir uns in einen anderen Teil der Gedenkstätte. Laufen an den Baracken vorbei, die in den 1960er Jahren abgerissen wurden. Ihre Grundrisse sind nachgebaut und mit Kies gefüllt. Gehen auf eine katholische Kirche zu. Sie thront über allem. Ich bin irritiert und, ja, auch ein bisschen entsetzt. Das komische Gefühl, das mich schon länger begleitet, breitet sich weiter aus. Der Guide erklärt, dass die katholische Kirche als erstes erbaut wurde. Dann deutet er auf zwei kleinere Gebäude links und rechts von ihr. Eine evangelische Kirche und eine jüdische Gedenkstätte – Gedenken getrennt nach Religion und Konfession. Wieso war es nicht möglich, einen Gedenkort für alle zu schaffen?
Mir wird langsam klar, was mein Problem mit dem Ort ist. Warum es sich so komisch, fremd und fern anfühlt. Woher meine Irritation kommt. Der Ort erzählt Geschichte. Aber aus der Perspektive einer Nachkriegsgesellschaft, die mit all dem am liebsten nichts zu tun haben wollte.
Wir stehen vor dem Krematorium. Unvorstellbar dieses Ausmaß. „Denket daran, wie wir hier starben“. Nein, die Menschen sind hier nicht gestorben. Sie wurden ermordet. Die Inschrift aus dem Jahr 1950 zeugt von einer Nachkriegsgesellschaft, die nicht fähig war, das Ausmaß wahrzuhaben.

Ich beschließe, früher zurückzugehen und noch den jüdischen Gedenkort zu besuchen. Zwei Mitschülerinnen begleiten mich. Ich suche den schönsten Stein, den ich finden kann, und lege ihn nieder. Es ist zwar kein wirkliches Grab, aber es fühlt sich trotzdem gut an.
Die anderen tun es mir gleich. Ein schöner Moment. Wir gehen zurück und reden. Das Reden tut gut. Es hilft gegen

die Überforderung, die dieser Ort mit sich bringt. Als Abschluss machen wir noch eine Gruppenarbeit. Wirklich sinnvoll erscheint uns das allen nicht. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Die meisten können sich die Ausstellung nicht komplett anschauen. Bevor wir unsere Ergebnisse präsentieren, stehen wir noch vor dem zentralen Mahnmal. Auch hier müssen wir leider feststellen, dass nicht aller Häftlinge gedacht wird.
Die Sonne geht unter. Wir verlassen den Appellplatz. Gehen durch das Tor „Arbeit macht frei“. Der Himmel sieht so schön aus. Auch über diesem Ort, den ich immer noch nicht ganz fassen kann.
Wieder im Bus. Und was essen wir jetzt heute Abend?

von Lucia Oechelhaeuser | Q2
Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten Armee wurde in unserer Schule das Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zaunes schaute“ des Kindertheatermachers und Autors Jens Raschke durch den Regisseur Klaus Prangenberg und seine vierköpfige Theatergruppe präsentiert. Das Theaterstück erzählt die Geschichte von einem Zoo. Einem kleinen Zoo, vor etwas mehr als 80 Jahren an einem Zaun. Einem “summenden, brummenden” Zaun, der die kleine Tiergemeinschaft von dem qualmenden Gefängnis der Gestreiften und der heilen Welt der Gestiefelten trennt. Und an diesem Zaun liegt eines kalten Morgens das einzige Nashorn des Zoos. Es ist tot.
Neben den Rückblicken in die Nacht, in der das Nashorn starb, wird parallel ein zweiter Handlungsstrang rund um einen kleinen Bären aufgebaut, der von Jägern von seiner Familie getrennt und wie die Gestreiften mit Viehwagons an den Ort des Zoos gebracht wird.
Seine Reaktion auf die Gefangenschaft der Tiere und das von der Autorität der Gestreiften geprägte Umfeld, sowie die Vorgänge im nebengelegenen Gefangenenlager regen einige der anderen Zoobewohner zum Nachdenken an, stoßen jedoch auch auf Widerstand bei denen, die sich nicht trauen, die ihnen aufgezwängte Lebensweise auch nur im Ansatz kritisch zu hinterfragen.
Die aus der unwissenden Sicht des jungen Bären naiv geschilderten Vorgänge komplettieren nach und nach ein gesamtheitliches Bild der damaligen Gesellschaft.
Die Paviane, die - nur auf den eigenen Vorteil bedacht - sich den Gestiefelten unterwerfen und sich gegen alle stellen, die Zweifel haben. Das Murmeltier, welches in dem gegebenen System aufgewachsen ist und weder den Zaun noch die qualmenden Schornsteine des Nachbarlagers als unge-
wöhnlich ansieht, auch wenn es durchaus im Laufe des Stückes beginnt, sich Gedanken zu machen. Und natürlich der Bär, der überwältigt und tief getroffen von seiner ausweglosen Situation, von der Trauer um den Verlust seiner Familie, die er nur mehr am Himmel als Sternbild des großen und kleinen Bären betrachten kann, und von dem Umgang mit den inhaftierten Gestreiften, den nicht einmal mehr wirklich als Menschen erkennbaren KZ-Häftlingen durch die Gestiefelten, schier verrückt zu werden scheint.
Angefangen wie eine für Kinder aufbereitete Theatervorlage [...] wandelt sich das Stück schnell hin zu tief bedrückenden und unerwartet explizit beschriebenen Geschehnissen.
Beispielsweise der Moment, in dem ein kleiner Junge, ein Kind der als gestiefelt betitelten NS-Leute, den Zoo besucht und durch den Zaun hindurch einen anderen kleinen Jungen mit dem Gewehr seines Vaters erschießt. Oder auch der in einem Nebenstrang angeschnittene Traum des Bären, in dem ein völlig verbrannter Junge, unfähig zu sprechen, vor Gott steht und in der Menge der verbrannten Kinder seine Schwester erblickt, jedoch nicht zu ihr kann.
Spätestens hier zeigt sich, dass es sich keinesfalls um ein Stück für kleinere Kinder handelt.
Auch das Ende, an dem der Bär in seiner Verzweiflung am Schornstein hochklettert und unter Schüssen der NS-Wachen hineinstürzt, woraufhin der Schornstein zusammenbricht oder der Tod der anderen Zootiere, die trotz ihrer Folgsamkeit den Gestiefelten zum Opfer fallen oder durch feindliche Flugzeuge ihr Ende finden, lässt einen mit einem




Fotos: Eigene Aufnahmen

tief bedrückenden Gefühl zurück, welches noch lange nachhält. Immer wieder werden einem die Schreckenstaten des NS-Regimes sowie die Gefahr der bedingungslosen Regime- und Ideologietreue ohne den Ansatz zur eigenen Verstandes- und Moralanwendung vor Augen geführt.
Das Stück wirkt wie ein Aufruf für die Demokratie. Eine Warnung, so etwas niemals wieder zuzulassen.
Die Umsetzung durch die Schauspielgruppe, die nur zu viert alle Figuren verkörpert und die im ständigen Rollen-, Kostüm- und Perspektivwechsel agierte, war dennoch nicht nur leicht verständlich, sondern auch sehr eindrücklich. Lediglich die etwas in die Länge gezogene Diskussions- und Fragerunde mit dem Schauspielteam nach der Aufführung
HISTORISCHE HINTERGRUNDINFORMATION



war aus meiner Perspektive etwas zähflüssig. Es hätte meiner Meinung nach ausgereicht, dass Regisseur und Schauspielende für einzelne Rückfragen zur Verfügung gestanden hätten. Kleine freiwillige Gesprächsrunden hätten sich aus meiner Sicht hier etwas besser angeboten.
Trotzdem halte ich diese Inszenierung besonders an Schulen für sehr sinnvoll. Das Theaterstück hat bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und stellt damalige Mechanismen auch für jüngere und nicht in das Thema eingearbeitete Menschen gerade durch die aus Tierperspektive geschilderte Geschichte sehr verständlich dar. Nur mit jüngeren Kindern würde ich dieses Stück nicht besuchen, da es trotz der zunächst kindlich angedeuteten Geschichte wirklich erschreckende und brutale Szenen enthält.
Dennoch eine klare Empfehlung von mir, das Stück zu besuchen und zu erfahren, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zaunes schaute.
Der Schauplatz des Theaterstücks ist ein historisch belegter Zoo. Der erste Lagerkommandant, Karl Koch, ließ den Zoo im Frühjahr 1938 von Häftlingen unmittelbar neben dem elektrisch geladenen Lagerzaun des KZ-Buchenwald errichten. Es gab dort u.a. Affen, Braunbären und Hirsche. Der Zoo sollte den SS-Angehörigen und deren Familien „in ihrer Freizeit Zerstreuung und Unterhaltung zu bieten und einige Tiere in ihrer Schönheit und Eigenart vorzuführen, die sie sonst in freier Wildbahn zu beobachten und kennen zu lernen kaum Gelegenheit“ bieten. Die Bärenburg, die damalige Attraktion des Zoos, war nur etwa fünf Schritte vom „summenden, brummenden“ Zaun und nur einige Meter vom Krematorium mit seinem Schornstein entfernt.
von Lucia Oechelhaeuser | Q2

in beiden Artikeln: Eigene Aufnahmen
Bei der im Januar an unserer Schule zur Verfügung gestellten Wanderausstellung mit dem Titel „Was konnten sie tun?“ handelt es sich um eine 26-teilige Sammlung von Einzelschicksalen von Menschen, die sich genau diese Frage – Was können wir tun? - während des Nationalsozialismus in Deutschland stellten. Herausgegeben von der Stiftung 20. Juli 1944 und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand beleuchtet die Ausstellung die unterschiedlichsten Formen des Widerstands, den Menschen zwischen der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 und Deutschlands Kapitulation im Zweiten Weltkrieg 1945 leisteten.
Der Ausstellung vorangestellt ist ein kurzer Informationstext, der eine kurze Einordnung der folgenden Tafeln in die damalige Zeit, den Zweiten Weltkrieg von 1939-1945, bietet. Zudem ist hier ein QR-Code mit der zugehörigen Website abgebildet. Beides trägt meiner Meinung nach zu einem besseren Verständnis der Ausstellung bei und erleichtert es allen Besucher:innen, ihr Grundwissen zu diesem Thema noch einmal aufzufrischen. Die restliche Ausstellung besteht aus 25 identisch aufgebauten Bannern. Sie zeigen die unterschiedlichsten Formen des Widerstands in eindrucksvoller Art und Weise auf. Darunter öffentliches Vorgehen wie die Ausübung von Attentaten auf Adolf Hitler selbst, die Verweigerung von militärischen Pflichten oder das Streuen von Informationen in der Ge-
sellschaft, aber auch die im Geheimen ablaufenden Handlungen des Widerstands werden gezeigt. So zum Beispiel das Schmieden von Umsturzplänen, das Verstecken von Verfolgten oder der Verrat geheimer Informationen.
Jede dieser Taten wird einem durch die Aufbereitung auf verblüffend nahbare und reale Art vor Augen geführt. Die großen Fotografien auf der rechten Seite der Tafeln geben den Erzählungen ein Gesicht. Die Zitate und die Beschreibung der Taten von Menschen, die Widerstand geleistet haben, zeigen ihre Zweifel an einem Regime, das keine Zweifel zuließ. Das wird besonders bei der Betrachtung der Biografien deutlich, die nur in drei Fällen nicht mit der Ermordung der Widerstandskämpfer:innen durch das NS-Regime endeten.
Neben der enormen Brutalität dieser Zeit schafft es die Ausstellung auch darzustellen, in wie vielen Formen sich Widerstand äußern kann. Besonders die Diversität der Widerstandskämpfer:innen, die sich trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten alle für dieselbe Sache engagiert haben, wird deutlich.
Unter ihnen sind Jugendliche, Wohlhabende und vergleichsweise Mittellose, Militärfunktionäre, Hausfrauen und einfache Soldaten und sie alle zeigen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten etwas tun konnten.
Mich hat an dieser Ausstellung berührt, zu sehen, wer die Menschen waren, die diesen Widerstand geleistet haben. Die Menschen, die den Mut hatten, sich zu wehren und für ihre Ansichten einzustehen. Durch die ausgewählten Einzelschicksale lässt sich meiner Meinung nach der Realitätsbezug viel besser herstellen und zeitgleich auch die Angst nachvollziehen, die andere davon abhielt, sich dem Widerstand anzuschließen. Der enorme Anteil jener, die für ihr Engagement und ihre Werte mit dem Leben bezahlen mussten, zeigt wieder einmal die Grausamkeit des NS-Regimes. Um diese mutigen Widerstandskämpfer:innen zu würdigen und sich immer wieder vor Augen zu führen, warum es so wichtig ist, dass Deutschland ein freies und demokratisch regiertes Land ist und bleibt, konnte man es auch anlässlich der bevorstehenden Wahlen im Februar nur empfehlen, die Wanderausstellung in jedem Fall zu besuchen.
Auch Seval hat die Ausstellung besucht. Ihre Betrachtungen und Gedanken ergänzen Lucias Artikel. Sie hat sich einige Einzelschicksale genauer angeschaut und auch die Podiumsdiskussion mit Zweitzeug:innen zur Ausstellungseröffnung am 16.01.25 besucht.
Der Widerstand im Zeitraum zwischen 1939 und 1945 lässt sich mit den Wörtern “Mut, Vielfalt, Kreativität” charakterisieren. Trotz brutaler Repressionen, absoluter Überwachung des Alltags durch die Diktatur gab es Menschen, die sich aktiv widersetzten und bereit waren, ihr Leben für ihre Überzeugungen aufs Spiel zu setzen. Die Formen des Widerstands waren dabei so unterschiedlich wie die Menschen, die ihn ausübten.
Eine dieser bemerkenswerten Persönlichkeiten, die in dieser Ausstellung dokumentiert ist, ist Eva-Maria Buch. Sie wurde 1921 in Berlin geboren und wuchs vorerst in ihrem Elternhaus auf. In Kontakt kam sie mit der aktiven Form des Widerstandes durch Wilhelm Guddorf. Diesen lernte sie während ihres Studiums kennen, sie arbeitete damals in einem Antiquariat. Ihre Aufgabe während des Widerstandes war es, Beiträge für die illegale Zeitschrift “Die innere Front” ins Französische zu übersetzen. Am 11. Oktober 1942 wurde sie festgenommen und am 3. Februar 1943 zum Tode verurteilt. Ihre Hinrichtung fand am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee statt.
Ein weiteres Beispiel ist das Ehepaar Greta und Helmuth von Moltke. Sie bildeten einen Teil des sogenannten Kreisauer Kreises. Es handelte sich hierbei um eine oppositionelle Gruppierung, die über verschiedene Möglichkeiten der gesellschaftlichen Neuordnung nach dem Nationalsozialismus nachdachte und diese in die Welt setzte. Frau von Moltke diente als Unterstützung für ihren Ehemann Helmuth von Moltke. Sie überbrachte der Widerstandsgruppe geheime Nachrichten und nahm an den geheimen Treffen teil. Helmuth von Moltke wurde 1944 verhaftet und im Januar des Folgejahres kurz vor Kriegsende hingerichtet. Seine Ehefrau Greta von Moltke überlebte den Krieg und setzte sich auch danach weiterhin für die Ideale des katholischen Widerstandes ein. Nicht weniger bedeutsam ist unter anderem Hans Leipelt. Als Student in München - auch “die Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung” genannt - half er dabei, Flugblätter der Widerstandsgruppe “Weiße Rose” zu verbreiten. Somit leistete er einen bedeutsamen Beitrag zur Arbeit gegen das nationalsozialistische Regime. Nach der Hin-



richtung der beiden Geschwister Hans und Sophie Scholl schrieb er außerdem einen Spendenaufruf für die Familie eines weiteren hingerichteten Mitglieds der “Weißen Rose”. Seine Verhaftung fand am 8. Oktober 1943 statt und im Januar 1945 wurde er zum Tode verurteilt. Wenige Tage später wurde er hingerichtet.
Diese drei Beispiele sind nur wenige von vielen Individuen, die sich gegen Hitlers Nazi-Deutschland einsetzten und die dieser Mut das Leben gekostet hat.
Im Anschluss an die Ausstellung in unserer Aula haben im Rahmen einer Podiumsdiskussion vier Nachkommen von Aktivist:innen und Widerstandskämpfer:innen vom Engagement ihrer Eltern oder Großeltern berichtet. Sie haben damit der begehbaren Ausstellung Leben eingehaucht und die auf den Aufstellern dokumentierten Lebensgeschichten noch stärker wirken lassen.
Die Ausstellung betont, wie mutig und zum Teil selbstlos solch eine aktive Form des Widerstandes ist. Es ist der reine Wunsch, gegen Rassenideologie anzugehen, auch wenn man dadurch in den meisten Fällen seinen eigenen, sicheren Tod durch eine Hinrichtung riskierte.
Dieses mutige Handeln bleibt ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und ein Symbol dafür, dass der Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit niemals umsonst sein wird.
Auch die an der Podiumsdiskussion teilnehmenden Familienmitglieder der Widerstandskämpfer:innen betonen die aktuelle Dringlichkeit des Widerstandes gegen rechtsextreme Strömungen und ermutigen ihre Zuhörerschaft, in der heutigen Zeit genauso standhaft und hartnäckig zu bleiben. Abschließend kann man sagen, dass es eine gelungene Ausstellung war, die der vorliegenden Thematik mit der nötigen Sensibilität und dem nötigen Respekt begegnet. Wünschenswert meinerseits wäre es jedoch, nach Möglichkeit auch Videomaterial in solch eine Ausstellung zu integrieren, weil es der ganzen Thematik des Widerstandes zur Zeit des Nationalsozialismus eine noch größere Intensität verliehen hätte.






Ein
von Veit Brungs | 10D, Jana Stojceska | 10B und Jannis Ihmels| 7C
Am 4. Februar fand in unserem Redaktionsraum ein Webinar (ein online- Seminar) mit der ZDF-Redakteurin von logo!, Frau Petra Röhr statt. Unsere Redaktion konnte das Webinar für alle Interessierten organisieren und wir haben zu 20 Personen teilgenommen, darunter außer unseren Redaktionsmitgliedern auch weitere interessierte Oberstufenschüler:innen sowie zwei unserer ehemaligen Redakteur:innen. Herr Frido Koch, Leiter der IQES-Netzwerke (Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen) war aus der Schweiz zugeschaltet und hat das Ganze technisch begleitet.
Worum ging es? Um Medienkompetenz. Frau Röhr hat uns erklärt, wie die Reporter: innen von Logo! ihre Nachrichten aus dem großen Pool von Tagesnachrichten für die jeweilige Sendung nach bestimmten Kriterien auswählen und ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Es gibt auch sogenannte ,,Dauerbrenner-Themen“, wie z.B. die Krisenherde in der Welt, der Klimawandel, aber auch verschiedenste Trends, wie aktuell z.B. Dubaischokolade.
Das Webinar war aber kein Vortrag, sondern ein interaktives Seminar. In verschiedenen Phasen haben wir über einen QR-Code aktiv mitgewirkt. Zu Beginn hat jede:r von uns aufgeschrieben, was wir unter „Nachrichten“ verstehen und über welche Quellen und Kanäle wir uns informieren. Unsere Ergebnisse wurden auf dem Smartboard in Echtzeit angezeigt, wir haben sie verglichen und mit der logo!Redakteurin besprochen. Es war interessant zu sehen, wie breit gefächert unsere Quellen waren – Frau Röhr war beeindruckt!
In einer späteren Phase wurden uns aktuelle Themen vorgegeben, aus denen wir dann in einer Arbeitsphase in Kleingruppen überlegen sollten, welche Themen wir für eine tagesaktuelle Nachrichtensendung auswählen würden und warum. Daraus entstand eine rege Debatte über die Bedeutsamkeit von einzelnen Themen und darüber, wie sich eine gute Nachrichtensendung zusammensetzt.
Alle Teilnehmer: innen des Webinars fanden den Einblick in professionellen Journalismus sehr interessant und aufschlussreich!

















Fotos: Eigene Aufnahmen
von Luc Aydogan Müller-Harmandali | EF
Normalerweise findet am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium zum Anlass des Osterfestes jährlich ein Schulgottesdienst statt, doch dieses Jahr verliefen die Pläne im Vergleich zu den vorherigen Jahren etwas anders. Dank des Bedarfs an unserer Schule, auch andere Religionen und Kulturen als das Christentum zu zelebrieren, entstand die Idee eines interreligiösen Schulfestes. Ein künstlerisches Fest, das dazu dienen sollte, Brücken zwischen den vielen Religionen und Kulturen zu schaffen und diese zu feiern.
Aus dieser Idee entstand sehr schnell eine umfangreiche und komplexe Veranstaltung, an der viele Lehrer:innen, Schüler:innen und Kurse mitgearbeitet haben. Das Fest, welches in der dunklen Aula stattfand, die nur von dem bunten Licht der mit farbigen Sticky Notes abgedeckten Handytaschenlampen der Mitwirkenden beleuchtet wurde, beinhaltete Zeremonien wie religiöse Volkslieder, Reden über Frieden, Gemeinschaft, Vielfalt und weitere Elemente wie Stimmenaufnahmen in verschiedenen Sprachen zum Thema Frieden, die verzerrt im Hintergrund abgespielt wurden, um eine vielfältige Atmosphäre zu schaffen. Zu-
dem gab es auch noch eine Klangcollage, die aus einem islamischen und einem jüdischen Lied und zusätzlichen Improvisationen gestaltet wurde.
Die Hauptattraktion des Festes war jedoch ein bunter Papierbaum, der in der Mitte der Aula stand und von mehreren Sitzkreisen umgeben war. An diesen Baum konnte jeder Beteiligte auf Sticky Notes eigene Fürbitten schreiben und diese anschließend an den Baum hängen.
Zu den hauptsächlichen Beteiligten gehörten Lehrer:innen wie Herr Guth, Herr Buse, Herr Knepel und Frau Feldmann. Von Seiten der Schüler:innen beteiligte sich vor allem der evangelische Religionskurs der Q1 (2023/2024), der einen Großteil des Festes wie die Reden und den Ablauf gestaltet hat. Auch hat der Oberstufenchor und ein Mitglied des Unterstufenchores Lieder aus vielen verschiedenen Kulturen vorgesungen. Die 6A (2023/2024) hat die Fürbitten geschrieben und diese anschließend vorgetragen.
Das Fest wird jedoch kein einmaliges Ereignis sein! Es hat viel Lob von Zuschauer:innen erhalten.


von Seval Naldelen | Q2
Am 25. März durften wir Teil einer ganz besonderen interreligiösen Feier in der Lutherkirche sein – ein Moment, der uns allen gezeigt hat, wie viel Kraft in einer Gemeinschaft steckt, wenn wir einander mit Liebe, Hoffnung und Akzeptanz begegnen.
Es ging an diesem Tag nicht darum, Unterschiede zu betonen, sondern darum, sie als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen. Die verschiedenen Religionen – mit ihren ganz eigenen Traditionen, Liedern und Botschaften – wurden nicht nebeneinandergestellt, sondern miteinander verwoben. Es fühlt sich ehrlich gesagt mehr nach Verbindung als nach Vergleich an.
Zu Beginn der Feier wurden kurze, nachdenkliche Texte vorgelesen, die uns daran erinnert haben, wie sehr dieselben Grundwerte uns Menschen trotz all unserer Unterschiede verbinden: Liebe, Hoffnung, Akzeptanz. In allen Religionen finden sich genau diese Begriffe wieder – sei es in Gebeten, in Geschichten oder im täglichen Zusammenleben. Diese Texte haben nicht belehrt, sondern berührt. Ein besonders schöner Moment war die Klangbild-Aktion. Mit einem Xylophon wurden Töne gespielt und zu jedem Ton entstand eine Farbe – am Ende formten sich daraus zwei Bilder. Es war faszinierend zu sehen, wie Klang und Farbe, zwei eigentlich sehr unterschiedliche Ebenen, so har-
monisch zusammenfinden konnten. Es war fast schon sinnbildlich dafür, was passiert, wenn verschiedene Stimmen, Perspektiven und Kulturen in einen gemeinsamen Dialog treten – etwas Neues, Einzigartiges, Schönes entsteht. Musikalisch war die Feier ebenfalls sehr bewegend. Zuerst sangen wir gemeinsam das jüdische Volkslied Donai Donai, dessen Melancholie und Tiefe viele im Raum spürbar ergriffen hat. Danach folgte „People Help the People“ von Birdy – ein Lied, das wie ein Appell wirkte: Wir dürfen uns gegenseitig nicht vergessen. Gerade in einer Welt voller Konflikte und Unsicherheiten war dieser Moment ein Aufruf zur Solidarität.
Besonders still und zugleich eindrucksvoll war der Beitrag des Unterstufenchors, der das türkische Lied „Üsküdara gideriken“ summte. Ohne Worte – nur durch Klang und Gefühl – entstand eine Verbindung, die sprachliche und religiöse Grenzen überwand. Es war fast, als würde das Summen uns alle auf einer tieferen Ebene zusammenführen. Was bleibt nach dieser Feier? Für mich ganz klar das Gefühl, dass wir – trotz aller Unterschiede – viel mehr gemeinsam haben als wir oft denken. Der interreligiöse Aspekt war nicht nur ein Thema der Veranstaltung, sondern er wurde gelebt. Und genau das hat diesen Tag so besonders gemacht.






















von Agnes Burauer | Q2
Auch dieses Jahr hat unsere Schule traditionell am Nippeser Kanevalszug am Karnevalsdienstag teilgenommen. Dieses Mal unter dem Motto: „Es och de janze Welt am dräume - mer wulle vum Fridde dräume!“.
Ein paar Wochen zuvor hatten wir uns in der Schulmensa getroffen, um gemeinsam das Kostüm zu basteln. Der wichtigste Teil des diesjährigen Kostüms war der „Hut“, der eine Papptaube mit zwei entgegengesetzten Köpfen darstellt und auf eine Idee von Ceyda Taka aus der 7D zurückgeht. Die eine Seite ist dabei eine jecke Karnevalstaube, die andere eine Friedenstaube - unserem Motto entsprechend.
Alle haben ihre Kostüme zusätzlich auf eigene Weise verziert und angemalt.
Eine Woche vor dem Zug haben wir dann gemeinsam die unzähligen Süßigkeitentüten gepackt, in denen nicht nur das klassische Wurfmaterial, sondern auch kleine selbst ge-





bastelte Geschenke waren.
Zum Aufstellplatz sind wir gemeinsam hingegangen.
Für Musik war auch gesorgt. Wir haben zwei große Boxen in Bollerwägen mitgebracht, die stets für Stimmung sorgten und nach etwas Verspätung ging der Zug auch endlich los. Es ist immer wieder schön, die vielen lachenden Gesichter und verschiedensten Kostüme aus einer anderen Perspektive zu sehen und selbst diejenigen zu sein, die mehrere Stunden das Wurfmaterial zu den Menschen werfen. Dabei merkt man auch, dass man doch mehr Menschen aus Nippes kennt als bisher gedacht.
Nur leider geht die Zeit viel zu schnell vorbei, die schönen Erinnerungen bleiben aber.
Wenn ich kann, werde ich nächstes Jahr als Ex-Leo wieder mit dabei sein.






von Tim Luca Unger | Q2
Das Schuljahr ist in vollem Gange und wir als Schülervertretung waren alles andere als untätig. In diesem Sinne wollen wir euch einen Überblick darüber geben, was wir in letzter Zeit gemacht haben und auch darüber, was wir dieses Jahr noch vorhaben.
Die Fünftklässler:innen werden sich bestimmt daran erinnern, dass wir gegen Ende des letzten Schuljahres mit einigem Erfolg den Leocup organisiert und uns um die Betreuung desselbigen gekümmert haben. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb der fünften Klassen in verschiedenen Kategorien wie Wissen, Sport und Kreativität. Dabei soll vor allem die Klassengemeinschaft aufgebaut bzw. gefördert und ein spaßiger Ausklang für das Schuljahr geboten werden. Auch dieses Jahr wollen wir als SV dafür sorgen, dass die neuen Schüler:innen eine ebenso gute Erfahrung haben. Des Weiteren haben wir am Tag der offenen Tür im Dezember mit großer Mithilfe der gesamten Schülerschaft im Zuge der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ fleißig Spenden für die Tafel gesammelt. Dabei sind insgesamt über 350 Schuhkartons liebevoll befüllt, mit Geschenkpapier eingepackt und schließlich gespendet worden. Dies machen wir als Schule schon seit Jahren und jedes Mal schafft es unsere SV, das alles reibungslos zu organisieren und Spenden in einem wirklich beachtlichen Ausmaß für die zu sammeln, die es gerade zu Weihnachten am nötigsten haben. Auch ist eine Aktion der Schülervertretung zum Weltfrauentag am 08. März geplant, um ein Zeichen für das anhaltende Streben nach endgültiger Gleichberechtigung zu setzen und um weiterhin gegen systemische Ungerechtigkeiten anzukämpfen.
In einer etwas eigennützigeren Angelegenheit engagieren sich Mitglieder der Schülervertretung bei der Ausarbeitung einer neuen Handyordnung. Wie ihr euch vielleicht erinnert, gab es zu Beginn des Schuljahres einen großen Aufschrei, als die Schulleitung nach wiederholtem Missbrauch von Handys auf dem Schulgelände die bis dato angewandte Nutzungsverordnung durch diejenige ersetzt hat, die tatsächlich auf der Schulwebsite zu finden ist. Da diese allerdings äußerst repressiv ist und die Nutzung von Handys nur für die Oberstufe in Freistunden gestattet, haben sich nun Vertreter:innen der Lehrer-, Eltern- und Schülervertretung zusammengetan und den Arbeitskreis Handyordnung gegründet, in dem eine solche ausgearbeitet und von der Schulkonferenz in Kraft gesetzt werden soll. Unsere Vertreter:innen setzen sich dafür ein, dass die Handynutzung auf dem Schulgelände für Schüler:innen eingeschränkt gestattet wird, aber dennoch genug reguliert, sodass es nicht zu Missbrauch dieses Privilegs kommt. Voraussichtlich wird es gegen Ende des Schuljahres einen ersten Entwurf dazu


geben. Was bis dahin auf jeden Fall stattfinden soll, ist der Blücherjam. Das ist ein Talentwettbewerb, der bis vor einigen Jahren regelmäßig an unserer Schule stattgefunden hat, inzwischen aber schon seit einigen Jahren nicht mehr. Dort konnten Schüler:innen alles mögliche vorstellen: von Tanzeinlagen über Zaubertricks bis hin zu Stand-up-Comedy ist alles denkbar. Für dieses Schuljahr hat sich die SV vorgenommen, den Blücherjam wieder aufleben zu lassen und auch schon Anstrengungen in diese Richtung unternommen. Wenn alles nach Plan läuft, wird er also dieses Jahr erstmalig wieder stattfinden und eine schöne Möglichkeit bieten, entweder zu zeigen, was man so drauf hat oder einen netten Nachmittag/Abend mit seinen Freund:innen zu verbringen und sich das Spektakel anzuschauen. Abschließend würden wir noch gerne einen Appell an die Schülerschaft, vor allem in den höheren Jahrgängen, richten. Die Mitarbeit in der SV ist wichtig, einerseits da nur dadurch die Interessen der Schülerschaft in irgendeiner Form umgesetzt werden können und andererseits bietet es eine gute Möglichkeit, sich als aktives Mitglied einer Demokratie zu erproben, was gerade in Zeiten wie den aktuellen, in denen antidemokratische Kräfte auf dem Vormarsch sind, durchaus wichtig ist.



Also überlegt euch doch mal, ob ihr euch nicht zur Klassenbzw. Stufensprecherwahl aufstellen wollt, um euch dann an unserem Zusammenleben in unserer Schule aktiv zu beteiligen.
von Mieke Oetzel, Marlene Katharina Küppers | 7C und Ceyda Nur Taka | 7D
Gartenarbeit, wer kennt sie nicht? Wie du es richtig machst, erfährst du in der Garten-AG. Wir haben ein Interview mit Frau Gaab und Frau Lucidi geführt
Warum haben Sie die Garten-AG ins Leben gerufen?
Frau Gaab: Ich habe die Mint-AG geführt (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), aber die ist dann „eingeschlafen“. Außerdem hat mich Frau Lucidi gefragt nach einem besseren Kontakt zu den Schülern
Frau Lucidi: Früher habe ich gedacht, dass dieser Platz ein guter Platz für einen Schulgarten wäre. Frau Gaab schien mir als guter Kontakt zu den Schülern und der Schule.
Was macht Ihnen am meisten Spaß in der Garten-AG?
Frau Gaab: Mir macht am meisten Spaß, Beikräuter (Unkraut) zu jäten.
Frau Lucidi: Wenn Kinder zur Garten-AG kommen und ich sehe, wie viel wir schon gelernt haben.
Was ist Ihr Ziel?
Frau Gaab: Dass wir bei dem Wettkampf Kölner VielfaltGärten mitmachen. Außerdem finde ich es wichtig, dass der Garten schön gestaltet ist. Natürlich finde ich auch ganz wichtig, dass wir die Pflanzen pflegen und Leben erhalten.

Frau Lucidi: Dass wir viele Experimente machen und die Natur kennenlernen. Wie Frau Gaab schon gesagt hat, finde ich es auch sehr wichtig, dass der Garten schön aussieht.
Wie finden Sie die Projekte?
Frau Gaab: Also ich finde die Projekte super. Am besten gefiel mir das Bienenprojekt und die Apfelbäume zu schneiden. Was ich auf jeden Fall als Projekt noch machen will, ist die Vogelhäuser zu bauen.
Frau Lucidi: Ich finde die Projekte toll. Ich fand es super, als wir mit dem BUND zusammengearbeitet haben. Außerdem möchte ich noch als Projekt die Unigärten besuchen.
Haben Sie noch Informationen, die Sie uns mitteilen möchten?
Frau Gaab: Ich finde auch noch sehr interessant, dass wir eine seltene Schmetterlingsart hier haben. Das Taubenschwänzchen, dies ist auch auf unserem Logo zu sehen.
Frau Lucidi: Ich freue mich immer, wenn sich Schüler freuen und sich um die Pflanzen küm- mern so wie ein „lebendiges Labor“.

von Anton Schwinden | 7D
Stell dir vor, dort liegt eine Person - wahrscheinlich bewusstlos!
In dieser Situation bist du vielleicht die einzige Hoffnung für diesen Menschen. Schnell jetzt zählt jede Sekunde!
Doch was soll man tun? Die Herzdruckmassage, doch wie lang?
Die Sani-AG am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium bietet einem den perfekten Einstieg. Im Jahr 2017/2018 durfte Frau Brauweiler sich als Gründerin der Sani-AG verzeichnen lassen. Die AG lief super, bis etwas passierte, wovon Schüler:innen noch ihren Kindern erzählen werden: Das Coronavirus.
Das Virus und die ganzen Lockdowns machten eine Weiterführung der AG unmöglich. Auch danach schien die Geschichte der Sani-AG schon in der Schulchronik zu Ende geschrieben zu sein.
Doch wie ihr unschwer an der Länge des Artikels, der noch vor euch liegt, erkennen könnt, war dies noch nicht das jähe Ende der Sani-AG.
Die von so vielen Schüler:innen geliebte Projektwoche könnte man als Wiedergeburt der Sani-AG bezeichnen. Denn nachdem als Projekt ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten wurde, führte Frau Brauweiler die AG wieder ein.
Was ist das Beste an der Sani-AG?
Das Beste ist, anderen helfen zu können.
Was macht am meisten Spaß?
Seit der Elternzeit von Frau Brauweiler unterrichtet Herr Müller-Haseke nun die rettungsbereiten Schüler:innen ab Klasse 7, wie man Leben rettet oder wie man einen Wundschnellverband (Pflaster) perfekt anlegt.
Im Kurs wird häufig auch geprobt, damit es im Ernstfall schnell geht. Was tun, wenn eure Freundin, euer Freund oder irgendein anderer Mensch Diabetes hat?
Hier lernt ihr es!
Zum Training hat die Sani-AG sogar zwei Puppen zur Verfügung, an denen man z.B. die Herzdruckmassage üben kann. Doch um eine möglichst realistische Übung zu haben, kommen die Sanis selbst show-verletzt und lassen sich dort von ihren Kollegen:innen verarzten.
Die Jugendlichen wären aber doch keine echten Sanitäter:innen, wenn sie nur im Raum Übungen machen würden. An Schulfesten und anderen Anlässen sorgen sie sich um die Leute, die sich verletzt haben oder denen es nicht gut geht. Dafür begeben sie sich, bewaffnet mit einem super ausgerüsteten Rucksack, in dem sich zwischen Sofort-Kühlakkus, Wundschnellverbänden und Dreieckstüchern (Multifunktionsverband) auch Beatmungsmasken befinden, auf Patrouille.
Dass man mit anderen arbeitet und dass die lebenswichtigen und alltäglichen Themen häufig wiederholt werden.
An wen würdest du sie weiterempfehlen?
Ich würde sie an alle weiterempfehlen, denen das Spaß macht und ich finde alle Altersklassen sind gut, da man in jedem Alter helfen kann.
















• Schüleraustausch
• Ferienprogramme im Ausland
• Freiwilligendienst im Ausland
• Gastfamilienaufenthalt in Deutschland
• Homestay / Ranchstay
• Praktikum im Ausland
• Demi Pair
• Work & Travel

ZU MACHEN!
von Mathilda May und Lola Lucidi | 7C
Im Biounterricht hat Frau Gaab uns, die 7c, dazu aufgefordert, einen Unterschied zu machen und E-Waste (auf Deutsch: Elektroschrott) zu sammeln. Wir bekamen Taschen, in denen wir den ganzen gesammelten E-Schrott aufbewahren konnten.
Wieso das Ganze? Weil wir einen Unterschied machen wollten. In Elektroschrott sind viele wichtige und seltene Erden (also Metalle) enthalten wie Kupfer, Nickel oder sogar Gold, wie wir in dieser Stunde gelernt haben. Fast alle schmeißen diese wertvollen Metalle weg. Doch sie können wiederverwertet werden, was gut für die Umwelt ist. Denn wenn diese Metalle nicht wiederverwertet werden, dann werden sie verbrannt. Das wiederum stößt Kohlenstoffdioxid aus und verschlechtert unser Klima. Deshalb wollen wir einen Unterschied machen und sie nicht wegschmeißen, um unser Klima zu schützen!
Nachdem alle Schülerinnen und Schüler aus unserer Klasse fleißig gesammelt hatten, haben wir alle unseren Elektroschrott mitgebracht und sind zusammen zum Wertstoffhof



in der Niehler Straße gelaufen, um dort alle unsere Tüten abzuladen. Wir haben alles Mögliche an E-Schrott gesammelt wie elektrische Zahnbürsten, Kabel, CD-Spieler, alte Handys, Küchenmaschinen und sogar ein alter Drucker war dabei! Mir persönlich und bestimmt auch ganz vielen anderen aus meiner Klasse hat das gezeigt, dass wir auch mit wenig Leuten eine Wirkung erzielen können, auch wenn es eine kleine Wirkung ist. Man muss also nicht viel haben, um die Umwelt zu schützen: Eigentlich nur eine Tasche und ein bisschen Motivation unsere Zukunft zu retten… Wir haben nun den Anfang gemacht und gemeinsam E-Schrott gesammelt. Insgesamt haben wir ungefähr zwölf volle Tüten gesammelt. Abschließend kann ich wohl für meine gesamte Klasse sagen, dass es eine inspirierende Erfahrung war, mit der wir auch noch eine gute Tat getan haben.
Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, E-Schrott zu sammeln, dann los geht’s! Ihr könnt irgendeine Tasche nehmen und einfach loslegen.



Dein LK-Wahl-O-Mat-Ergebnis: 100% Geschichte?
Gleich in der ersten LK-Stunde, daran erinnere ich mich noch gut, wurden wir gefragt, ob wir glauben würden, Geschichte sage die Zukunft voraus.
Puh. Kollektives Schweigen. Darauf wussten unsere Köpfe, die allesamt irgendwo in den Sommerferien stehen geblieben waren, so schnell keine Antwort. Und die Frage ist natürlich auch nicht eindeutig zu beantworten.
Klar ist, bestimmte Muster wiederholen sich immer wieder. Momentan kann man an den erschreckenden politischen Entwicklungen sehen, wie Hass und Rechtspopulismus wieder zunehmen, ähnlich wie es in der Weimarer Republik auch passierte. Wir müssen feststellen, dass wir unsere Demokratie nie wieder so leichtfertig hergeben dürfen, wie es in den Jahren vor 1933 geschah.
Auf der anderen Seite kann man sich an einigen historischen Charakteren auch ein Beispiel nehmen. An den berühmten Gesichtern des Widerstands zum Beispiel. Denjenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzten für Menschenrechte, Demokratie und Frieden wie die Geschwister Scholl, die sich dem brutalen NS- Regime widersetzten, oder Clara Zetkin, die als eine der Ersten für die gesellschaftliche Gleichberechtigung und ökonomische Unabhängigkeit der Frauen kämpfte.
Wer also denkt, über Geschichte zu reden, sei Zeitverschwendung, alles doch eh nur alter Kram, der liegt ziemlich falsch.
Und wenn ihr Lust habt, verstärkt darüber zu reden, was damals war, aber auch darüber, was heute ist und wie das vielleicht zusammenhängt, dann ist der Geschichts-LK genau das Richtige für euch.
Zeitlich bewegen wir uns im LK, genauso wie auch die Grundkurse, in der Zeit von der französischen Revolution bis zur Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Dass man also nochmal ein paar Jahrtausende zurück-
springt, und über Römer und Germanen spricht, wie in der EF (falls das jetzt ein Spoiler war, tut es mir sehr leid), wird euch im LK nicht passieren, keine Sorge!
Gestartet sind wir mit der „Deutschen Revolution“ von 1848/49, haben dann darüber gesprochen, wie die ersehnte Vereinigung Deutschlands durch die Gründung des Kaiserreichs doch noch geschah. Wir sind die Industrialisierung und die Epoche des Hochimperialismus durchgegangen und natürlich auch, wie imperialistische Konkurrenzkämpfe und der Wunsch nach „Weltgeltung“ schließlich den Ersten Weltkrieg hervorriefen.
Eins meiner Lieblingsthemen war dann die Weimarer Republik. Wir haben uns ziemlich ausführlich mit der Frage beschäftigt, was die junge Republik denn nun zum Scheitern brachte. Woran es lag, dass die Nazis in den folgenden Jahren Schritt für Schritt am Rechtsstaat vorbei agieren konnten und sich so viele Menschen gleichzeitig von der hassgefüllten, hetzerischen Propaganda der Nazis begeistern ließen.
Fast das gesamte erste Halbjahr der Q2 haben wir uns dann mit dem Nationalsozialismus beschäftigt.
Mit diesem gesammelten Vorwissen sind wir dann im Januar mit weiteren Geschichtskursen nach Dachau gereist, wo wir hautnah Geschichte erleben durften, was uns ziemlich nachdenklich gestimmt hat.
Was uns in Dachau erschreckend klar wurde, was aber auch ziemlich viele Menschen vergessen, ist, dass die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeht. In Dachau haben wir erfahren, dass die Baracken, in denen KZ-Insassen auf winzigem Raum zusammenleben mussten, später als Flüchtlingslager und Auffangstation für die, die während des Krieges aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, genutzt wurden. Zum Teil mussten Menschen, die hier einmal von den Nazis brutal misshandelt wurden, nun am selben Ort ausharren, bis sie nach Hause zurückkehren konnten. Diese Baracken, die so viel grausame Geschichte erzählen, wurden später abgerissen. Heute ist nur noch das ehemalige Krematorium als Gedenkort erhalten. Ganz nach dem Motto „Verdrängen und Vergessen“. Genau das thematisie-
ren wir auch im LK, die Erinnerungskultur nach 1945. Als letztes Thema, das wir - die wir gerade kurz vor dem Vorabi stehen-, noch durchnehmen, ist der Ost-West-Konflikt. Wir beschäftigen uns mit dem „Eisernen Vorhang“ durch Deutschland und den Auswirkungen des Kalten Krieges auf der ganzen Welt.
Das klingt jetzt erstmal ganz schön viel, aber ihr müsst bedenken, dass sich diese Themen über zwei ganze Schuljahre erstrecken. Insgesamt waren die anderthalb Jahre, die ich jetzt hinter mir habe, dann doch nicht so stressig.
Die Klausuren sind, finde ich, ziemlich entspannt, weil man eigentlich immer das gleiche machen muss. Man bekommt einen Text, den man zuerst zusammenfassen, dann in den historischen Kontext einordnen und später beurteilen muss. Wenn ihr euch die Zusammenhänge gut einprägt, könnt ihr in den Klausuren ziemlich einfach gute Noten erzielen. Mir persönlich hilft es immer am meisten, mir einen Zeitstrahl anzulegen, der die gesamte klausurrelevante Zeitspanne einschließt und mit Pfeilen Zusammenhänge zu markieren. Das wäre mein Tipp, doch wie ihr euch auf Klausuren vorbereitet, ist in der Oberstufe einfach total von eurem Lerntyp abhängig.
METHODISCHES
Das Schöne am Geschichtsunterricht ist, dass man mit den unterschiedlichsten Quellen arbeiten kann: mit Zeitungsartikeln, Tagebucheinträgen, Postkarten, Wahlplakaten…, es ist also ziemlich abwechslungsreich. Zu großen Teilen besteht unser Unterricht aus Gruppenarbeiten, wobei wir uns zuerst gemeinsam Inhalte erarbeiten (zum Beispiel etwas aus Quellen herausarbeiten) und diese dann der Klasse vorstellen und vertiefen. Es gibt aber auch mal Stunden, in denen wir fast die ganze Zeit im Plenum über ein Thema oder eine bestimmte Frage diskutieren. Die Gestaltung des Unterrichts ist aber auch hier, wie bei jedem Fach, total von der Lehrperson abhängig.
Zu unserem Glück ist Herr Puntigam (genauso wie die meisten Geschichtslehrer) ein Riesenfan von Mirko, alias
MrWissenToGo, dessen Videos wir öfters mal schauen und die uns wahrscheinlich allen das Abitur retten werden.
„Geschichte hat sich vor unseren Haustüren abgespielt“, sagt Herr Puntigam immer. Tatsächlich wirkt Geschichte oft sehr distanziert und abstrakt, obwohl uns super viel Geschichte in unserem Viertel begegnet.
So haben wir an einem nebeligen Wintertag während unserer Unterrichtsreihe zur Industrialisierung einen Ausflug ins Clouth-Quartier direkt um die Ecke gemacht, früher eines der bedeutendsten Kölner Gummiwarenunternehmen, die aus Kautschuk Reifen, Zelte und Tauchanzüge herstellten. Wir haben eine Führung durchs El-De Haus, ehemalige Gestapo-Zentrale und heute Kölner NS-Dokumentationszentrum am Appellhofplatz, gemacht oder sind auf die Suche nach Gründerzeitarchitektur durch Nippes gegangen. So haben wir also nicht stumpf den Lehrplan durchgeackert, sondern haben auch mal über den Tellerrand geschaut, uns mit regionaler Geschichte beschäftigt oder mit Themen, die uns besonders interessiert haben. So zum Beispiel die russischen Revolutionen von 1917 und die vergessenen Diktaturen in Europa in Spanien oder dem ehemaligen Jugoslawien, die durch die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Lehrpläne auf die grausamen Verbrechen der Nazis in Deutschland heute im Geschichtsunterricht oft in den Hintergrund rücken.
Schlussendlich kann ich euch nur sagen, lasst euch nicht von dem Klischee des vielen Auswendiglernens davon abhalten, Geschichte LK zu wählen. Das war der Grund, warum ich fast ein anderes Fach gewählt hätte, das mich dann in der Q1 aber selbst als Grundkurs so gelangweilt hat, dass ich es Ende des Jahres abgewählt habe. Heute bin ich echt froh, dass es das nicht geworden ist.
Wenn ihr Interesse an Geschichte habt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es geht nicht darum, alle Daten und Namen zu wissen, sondern die wichtigen Zusammenhänge zu verstehen und zu kennen.
Egal, welchen LK ihr nun wählt, wünsche ich euch viel Spaß in der Qualiphase!

Interviews geführt von Jana Stojceska | 10B
EX-LEOS I: LAURA RYNKIEWICZ

War deine Abizeit so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Am Anfang habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich mir meine Abizeit vorstelle. Am Anfang war ich an der Realschule schon sehr gestresst, da mir von Lehrern gesagt wurde, dass es ganz anders von der Schulform und dem Lernaufwand her sein wird. Deswegen bin ich da eher mit Angst reingegangen, aber sonst habe ich mir da ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken darüber gemacht.
Wie ging es für dich nach dem Abi weiter?
Für mich war klar, dass ich studieren werde, auch dass ich kein Gap Year mache. Deswegen habe ich mich dann für Lehramt an den Unis in Köln und Bonn beworben. Die Fächer waren für mich eine kleine Schwierigkeit, da ich mir unsicher war, ob ich mir Biologie zutraue, da ich keinen Leistungskurs hatte. Ich habe mich dann doch dafür entschieden. In Köln wurde ich z.B. nicht angenommen, weil ich einen 1,7er Schnitt hatte und für Bio-Lehramt hätte man 1,1 gebraucht. In Bonn wurde ich zum Glück angenommen. Es dauert außerdem sehr lange, bis man die Unterlagen für die Immatrikulation zusammen hat. Und der Bafög-Antrag war auch eine kleine Qual...
Wie empfandest du den Wechsel von der Realschule hin zur gymnasialen Oberstufe?
Anstrengend, angsteinflößend, stressig. Eigentlich schon, wie ich’s mir vorgestellt habe, nur in den Klausurenphasen dann doch ein bisschen schlimmer. Es kommt auch auf die individuellen inneren Einstellungen an. Ich habe mir am Anfang viel Stress gemacht, aber nach der Umstellung war es machbar.
Gibt es rückblickend etwas, was du während deiner Schulzeit anders gemacht hättest?
Ich hätte mir definitiv weniger Stress gemacht, vor allem in der EF, da dort die Noten noch nicht fürs Abi gezählt haben und ich hatte teilweise Angst davor, den Anschluss zu verlieren bzw. nicht zu finden nach der Realschule. Ich hätte auch offener reagiert und wäre mehr auf die Leute aus meiner Stufe zugegangen und, als ich dann Freunde gefunden habe, hätte ich mehr mit ihnen unternommen und mich nicht ausschließlich auf die Schule fokussiert.
Was vermisst du bzw. was vermisst du nicht an der Schule?
Ich vermisse auf jeden Fall bestimmte Lehrer:innen, die Leute aus meiner Stufe nicht so sehr, aber teilweise natürlich enge Freunde. Klar, auch den geregelten Ablauf und
Bild: Unsplash / Engin Akyurt
den Stundenplan und dass man nicht vor dieser Planlosigkeit steht, was man mit dem gesamten Tag anfängt. Es hat mich am Anfang nach den Abiprüfungen extrem überfordert, dass ich aufgestanden bin und gar keinen Plan hatte - teilweise über Monate hinweg. Ich musste die Zeit schon gut füllen, aber das war anfangs auf jeden Fall eine Umstellung.
Kannst du das Abitur weiterempfehlen?
Auf jeden Fall! Es bietet einem extrem viele Möglichkeiten. Man muss natürlich schauen, ob das persönlich für einen passt. Man muss auch sagen, das Abi ist nicht für jeden was. Es gibt Leute, die – sag‘ ich mal - nicht so die kognitiven Fähigkeiten dazu haben. Das soll jetzt auch nicht wertend klingen, aber es kommt natürlich auch darauf an, was für Ziele man im Leben hat. Es gibt ja auch Leute, die voll zufrieden mit einer Ausbildung sind und mit dem späteren Gehalt. Es gibt ja auch Berufe, in denen man “trotz“ Ausbildung gut verdient. Es muss einem schon bewusst sein, dass man mit einer Ausbildung kein Arzt werden kann. Aber prinzipiell würde ich’s schon weiterempfehlen. Ich hatte auch sehr lange Angst, dass ich nicht klug genug bin für das Abi oder generell für das Studium später. Hätte ich jetzt Abitur gemacht und eine Ausbildung angefangen, dann wäre für mich dieses Abi in dem Sinne nichts wert gewesen, weil ich dann nichts damit angefangen hätte. Es gibt Ausbildungen, wo man ein Abitur braucht, aber für die allermeisten reichen Haupt- oder Realschulabschluss voll aus. Deswegen war für mich klar: Wenn ich diesen Schritt wage und aufs Gymnasium gehe, dass ich danach auf jeden Fall studiere.
Welche Rolle spielen Freundschaften aus der Schule in deinem aktuellen Leben?
Schon eine große Rolle. Klar sieht man sich nicht mehr so häufig. Ein Kumpel von mir ist auch weggezogen und macht ein FSJ1 in Baden-Württemberg. Da sieht man sich nicht jede Woche oder telefoniert oder schreibt jeden Tag, aber man versucht natürlich trotzdem, Kontakt zu halten auf beiden Seiten. Man merkt schon, dass es einem persönlich hilft, wenn man weiß, dass man noch mit alten Freunden Kontakt hat.
Was ist dein Tipp für künftige Abiturient:innen?
Das ist jetzt leicht zu sagen, aber dass man versucht, sich nicht so sehr verrückt zu machen und man schöne Phasen genießt und wertschätzt, dass man eine Balance zwischen Schule und Freizeit oder privatem Leben findet.
1 FSJ: Freiwilliges soziales Jahr
War deine Abizeit so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Ja. Ich war nie der beste Lerner, das können alle aus meiner Stufe bestätigen. Ich habe dann fürs Abitur zum ersten Mal gelernt, wie ich lerne und es waren drei bis vier Wochen Stress. Ich würde allen vor dem Abitur empfehlen, sich ab den Winterferien schon mal ein paar Themen zusammenzuschreiben. Es tut nicht weh und ihr dankt euch später dafür, sonst musst du in drei bis vier Wochen alles machen und wenn du dann z.B. für Fächer wie Bio lernst, knallt das halt.
Wie ging es für dich nach dem Abi weiter?
Ich bin gestresst aus der Prüfungsphase gegangen und habe auch die Abifeier mitgeplant. Danach habe ich erstmal eine Radtour gemacht. Ich bin den kompletten Rhein runtergefahren. Ich kann jedem empfehlen, dann wirklich mal Urlaub zu machen, weil man nach dem Abitur ausgebrannt ist.
Danach hab’ ich bis Oktober pausiert, das würde ich niemandem raten. Ich habe sechs Monate 20 Stunden die Woche gearbeitet und bin nach 2 Monaten Pause für ein Praktikum nach Berlin gegangen. Dort war ich bei einem Bundestagsabgeordneten und habe in seinem Büro gearbeitet und den politischen Alltag in Berlin beobachtet. Das war eine spannende Erfahrung, die ich jedem empfehle, der sich für Politik interessiert.
Gibt es rückblickend etwas, was du während deiner Schulzeit anders gemacht hättest?
Ich hätte schon früher ein bisschen sozialer sein sollen. Ich war aus meiner Stufe ausgekapselt und hab’ das auch gemerkt. Ich hätte mich früher vernetzen sollen, dann wäre es eine noch bessere Zeit geworden. Aber so konnte ich mich mit allen Gruppen gut unterhalten. Das hat mir gut gefallen.
Was vermisst du bzw. was vermisst du nicht an der Schule?
Man sollte sich etwas suchen, was man danach macht. Wenn man aus der Schule rauskommt und keine Ahnung hat, was man tun soll, kein Auslandsjahr macht, keine Arbeit hat, dann hat man das Problem, dass man planlos
ist. Das ist sehr schlimm. Man muss wirklich was machen, sonst stehst du um 13 Uhr auf und der Tag ist ruiniert. Man muss sich ganz dringend eine Struktur aufbauen. Wenn man das nicht kann, sollte man irgendeinen Job anfangen, wo man regelmäßig hinmuss. Das ist sehr wichtig, zumindest irgendwas zu machen. Sport oder Hobbys sind super, sonst verwahrlost man, auch psychisch. Bei mir wird es langsam besser. Ich komme in eine Struktur rein. Aber diese Planlosigkeit ist ein ganz typisches Phänomen unter vielen Abiturient:innen.
Kannst du das Abitur weiterempfehlen?
Ja klar. Man lernt in drei, vier Wochen, echt viel Inhalt in sich zu stopfen. Und wenn du dann an eine Uni gehst, wird das noch viel besser. An der Uni wird das noch viel mehr. Aber die Abizeit ist eine sehr coole Zeit.
Was hast du während deiner Schulzeit über Gemeinschaft und das Leben gelernt, was dich bis heute begleitet?
Ich war in der SV und bei der Leonarda. Aktiv sein, sich in Gruppen zu engagieren, sie zu leiten und auch zu sehen, wie so ein Arbeitskreis funktioniert, ist für meine Ausbildung sehr hilfreich und prägt mich bis heute. Ich empfehle allen, sowas mal zu probieren. Man muss es nicht mögen, aber probieren kann man’s.
Was ist dein Tipp für künftige Abiturient:innen?
Macht mündlich mit und guckt, dass ihr da gut seid, dann sind auch die Klausuren einfacher. Das würde ich allen mitgeben. Ansonsten guckt, was eure Ziele sind. Wenn euer Ziel ist, im Schnitt 1,0 zu stehen und in Köln Medizin oder Psychologie zu studieren, viel Spaß beim Leiden. Viel Spaß beim Schreiben und beim Lernen, Lernen, Lernen. Wenn euer Ziel ist, eine Ausbildung zu machen oder etwas anderes zu studieren, dann macht euch nicht den Megastress. Aber überlegt euch vorher, was ihr machen wollt und nicht erst am Ende der Q1. Sonst kommt ihr ins Hintertreffen und habt Stress. Setzt euch einfach realistische Ziele und schaut, ob ihr die einhalten könnt. Und wenn nicht, ist das nicht schlimm. Die Abiturnote interessiert, abgesehen vom NC, niemanden. Man ist 16-18 Jahre alt! Who cares?


War deine Abizeit so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Meine Abizeit war schon sehr besonders. So vorgestellt habe ich mir das - vielleicht gerade mit Blick auf die Zeit, in welcher ich mir immer wieder die Frage stellte, ob ich das Abitur überhaupt noch versuchen solle - sicherlich nicht.
Wie ging es für dich nach dem Abi weiter?
Nachdem mich die Nachricht erreichte, ich hätte das Abitur bestanden, holten mich in der Zeit danach zunächst mal eine ganze Reihe gemischter Gefühle ein. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, das Kapitel nach 14 aufregenden Jahren endlich abgeschlossen zu haben. Gleichzeitig sind es auch 14 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisierung, Freundschaften und Erfahrungen, die man irgendwie sehr plötzlich fast vollständig hinter sich lässt, um in ein neues Kapitel des Lebens überzugehen. Für mich war das zu Beginn ein schwer zu greifendes Gefühl.
Wie empfandest du den Wechsel von der Realschule hin zur gymnasialen Oberstufe?
Da ich vom LdV nach der zum zweiten Mal nicht bestandenen achten Klasse auf die Realschule wechseln musste, war ich gezwungen, mich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, ob ich mich überhaupt noch mal bei einem Gymnasium bewerben möchte, um das Abitur zu versuchen.
Ich habe mich dann zusammengerauft und beschlossen, zum LdV zurückzukehren.
Vor diesem Hintergrund war der Wechsel von der Realschule hin zur gymnasialen Oberstufe für sich allein genommen bereits eine riesige Errungenschaft. Ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, wieder zurück zu sein in den mir vertrauten Gebäuden, bei den Lehrern und Schulkollegen, die ich kenne.
Gibt es rückblickend etwas, was du während deiner Schulzeit anders gemacht hättest?
Ich glaube, jeder kennt es, wenn man über Vergangenes nachdenkt und sich fragt: „Was wäre gewesen, wenn ich statt diesem jenes getan hätte?” Ich bin sicher, ich hätte einiges anders machen können, und würde es trotzdem genauso wieder tun. Die Erkenntnis, bei welchen Dingen ein Handeln, das von dem vergangenen eigenen Handeln abweicht, sinnvoll ist, kann man eben auch nur erlangen, wenn man zuvor so gehandelt hat, wie man gehandelt hat.
Was vermisst du bzw. was vermisst du nicht an der Schule?
Schule ist so viel mehr als nur das Lernen und Bestehen oder Nichtbestehen von Prüfungen. Ich finde, das durch
gesellschaftliche Konventionen geprägte Bild von Schule wird dem gesamten Umfang dessen, was Schule wirklich ausmacht, nicht gerecht. Ich vermisse es zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler ein Gefühl für Gemeinschaft entwickeln und sich gemeinsam außerhalb des Unterrichts für Projekte, gegenseitige Belange und ehrenamtliche Tätigkeiten engagieren - ich fand das immer toll und es hat mir große Freude bereitet, dies mit all den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen zu unterstützen.
Auch die unschönen Seiten, wenn man sich im Rahmen der SV mit Lehrkräften oder gar dem Direktor in Streitgesprächen auseinandersetzen musste, vermisse ich irgendwie.
Kannst du das Abitur weiterempfehlen?
Ich empfehle jedem, sich intensiv mit den eigenen Vorstellungen fürs Leben auseinanderzusetzen und darauf aufbauend vielleicht im Rahmen der EF zu überlegen, ob das Abitur etwas für einen ist. Abgesehen davon würde ich behaupten, dass es in Deutschland keine bessere Grundlage gibt als das Abitur, gerade wenn man sich noch nicht sicher ist, wie es im Leben weitergehen soll. - Also ja, grundsätzlich ist es empfehlenswert, das Abitur zu machen, würde ich meinen.
Wie bist du mit dem Übergang von der Schule zum Berufsleben/ Studium umgegangen?
Da ich bereits in der EF volljährig und schon im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung neben der Schule berufstätig war, ist das in dieser Hinsicht kein großer Umschwung für mich gewesen. Ich habe meinen Arbeitsvertrag nach Abschluss der Schule auf einen Vollzeitvertrag erhöht und nach ein paar Monaten ein Fernstudium begonnen.
Was ist dein Tipp für künftige Abiturient:innen?
Versucht, ein gutes Gleichgewicht bei der Priorisierung zwischen dem, was andere meinen, das gut für euch sei, und dem, wovon ihr selbst überzeugt seid, dass es gut für euch ist, zu finden. Ein sehr gutes Abitur muss nicht, aber kann sehr wichtig sein, wenn ihr beispielsweise auf jeden Fall ein ganz bestimmtes Studium an einer ganz bestimmten Uni wollt. Dann solltet ihr euch dafür ins Zeug legen.
In der Schule bekommt man sehr oft ein Problem mit je einem richtigen Lösungsweg und je einer richtigen Lösung vorgelegt. Ich würde jedem raten, stets eine gesunde Distanz zu dieser Logik zu wahren. Am Ende des Tages ist die Welt bunt und nicht schwarz-weiß, und wenn Probleme auftreten, gibt es unendliche Möglichkeiten, um einen Weg zur gewünschten Lösung zu finden.

Unser junges Magazin ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, hat sich weiterentwickelt und darf sich bereits mit zwei großen Preisen schmücken! Damit die Leonarda in gewohnter Qualität auch zukünftig bestehen kann, sind wir jedoch auf Unterstützung angewiesen, denn alleine durch den Verkauf können wir Druck, Grafikprogramm und Website nicht finanzieren.
Wir sind für jede Unterstützung sehr dankbar! Jede Spende hilft uns bei unserer Arbeit!
Eure Leonarda-Redaktion

von Kaan Dinc | EX-Leo
Vielleicht habt ihr schon mal was von mir gehört. Die Chancen liegen gar nicht so schlecht, zumal ich erst seit zwei bzw. drei Jahren nicht mehr Schüler dieser Schule bin und ab und zu auch mal was für euch schreibe. Hab’ ich euch? Vielleicht erinnert ihr euch ja genauer an meinen Text, in dem ich darüber geschrieben habe, wie es ist, in seiner „Post-Abi“-Phase zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr noch nie von mir gehört - tut nichts zur Sache. Jedenfalls hat sich mein Leben seitdem ganz schön verändert.
Ich bin mittlerweile im dritten Semester meines Medizinstudiums und konnte meine anfänglichen Unsicherheiten
zum Glück überwinden. Und natürlich könnte ich jetzt stundenlang übers Studium reden. Ich glaube aber, dass es für euch hilfreicher ist, genau diese Phase des Überbrückens und meinen Weg ins Studium zu beleuchten. Nach dem Abitur ging es erst einmal langsam zu. Viel Zeit, sehr viele Gedanken und vor allem viele Leute, die einen gerne gefragt haben, was man denn jetzt so machen wolle. Das hat mich nicht nur überfordert, es hat mich vor allem auch gestresst. Irgendwo auch berechtigt der ganze Stress, schließlich geht es bei der Berufswahl um nichts Geringeres als die eigene Zukunft, die einzige Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, oder? So dachte ich zumindest. Doch ge-

nau dieses sich unter Druck setzen hat dafür gesorgt, dass ich jede aufkommende Idee gleich im Keim erstickt habe. Ich konnte keine Vor- und Nachteile abwägen. Jeder noch so kritische Gedanke hat mich gestört. In meinen Augen sollte ich ein Studium auch nur dann in Betracht ziehen, wenn alles stimmig ist und nichts dagegen spricht. Das war ein großes Missverständnis. Ich glaube, dass das viele von euch auch kennen. Ich glaube aber, dass man diese Ängstlichkeit zulassen muss. Es ist okay, eine Entscheidung zu treffen und trotzdem ängstlich zu sein. Ich will nicht wie irgendein Mentor aus einem Selbsthilfebuch klingen. Aber ich finde das wirklich entscheidend. Angst ist in Ordnung, die darf man zulassen. Es sollte nur nicht dazu kommen, dass die Angst einen lähmt. Das war und ist für mich mit die wichtigste Erkenntnis. Mittlerweile fühle ich mich im Studium angekommen. Das Umfeld ist einfach super, ich habe meine feste Clique gefunden, mit der ich rundum viel Zeit verbringe. Wir lernen zusammen, gehen „mensen“ (eine Wortneuschöpfung, bedeutet so viel wie in der Mensa essen und rumhängen) und haben einfach eine gute Zeit. Auch meine Bedenken bezüg-
Bild: Pixabay / DarkoStojanovic
lich der theoretischen Inhalte des Medizinstudiums haben sich nicht bewahrheitet. Kurz zum Hintergrund: Als ich damals Schüler in der Mittelstufe war, hatten wir ziemlich viele Lehrerausfälle und -wechsel, was zur Folge hatte, dass ich - und ich glaube, es ging vielen so - überhaupt keine Ahnung von Physik oder Chemie hatte. Ich dachte, ich würde jämmerlich scheitern und untergehen unter all diesen ach so naturwissenschaftlich begabten Leuten. Blödsinn. Das Studium ist nämlich wirklich wie ein Neuanfang. Nach 19 Jahren hatte ich also zum ersten Mal die Chance, mich explizit in diesen Fächern zu beweisen. Und siehe da, es hat geklappt.
Ich hoffe, ich hab’ euch noch. Mir liegt es nämlich wirklich am Herzen, ein möglichst realistisches Bild vom Medizinstudium abzugeben, weil ich weiß, wie viele von euch auch gerne Medizin studieren würden. Glaubt an euch, wirklich. Gerade diejenigen, die eher zum Selbstzweifel neigen. Das Studium folgt dem Tabula-Rasa-Prinzip. Eure Noten, euer bisheriger schulischer Erfolg, auch euer Weg ins Studium, der ja bei manchen deutlich länger sein kann (FSJ1, TMS2, etc.), spielen keine Rolle mehr. In dem Sinne: Go for it!
1 FSJ: Freiwilliges soziales Jahr
2 TMS: Test für Medizinische Studiengänge
Wege
von Lotte A. L. Matull | EX-Leo

Was will ich eigentlich mal machen? Die Frage aller Fragen! Ich habe es für mich jetzt herausgefunden und werde euch kurz berichten, wie wir hierhin gekommen sind: Schon in der Schulzeit gibt es öfters Möglichkeiten in verschiedene Berufsbereiche einzutauchen, beispielsweise das dreiwöchige Praktikum, Girls oder Boys Day, Ausbildungsund Studienmessen, etc. Ganz klar ein guter Ansatzpunkt. Dort bin ich auf den Beruf gestoßen, bei dem ich mich als Erstes im Januar 2024 beworben habe: Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung (DFS). Nach der Bewerbung, dem Onlinetest und dem Auswahlverfahren in Hamburg wurde im April leider abgelehnt. Natürlich schade, aber ich war nicht zu enttäuscht, da ich stolz darauf war, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe und die Wahrscheinlichkeit, angenommen zu werden, eh sehr gering war. Also ging es weiter: Bundespolizei und ein duales Studium im Industriekundengeschäft bei der AXA. (Falls man es noch nicht merkt, der Sicherheitsbereich hat’s mir irgendwie angetan).
Die Absage der Bundespolizei kam nach etwa zwei Monaten aus gesundheitlichen Gründen - aka ich habe Asthma. Naja, blieb ja noch die AXA… Nach einem netten Kennenlerngespräch hat sich das Team für den anderen Bewerber entschieden. Rückblickend wäre ich dort nicht glücklich geworden, aber in dem Moment hat sich das trotzdem nicht gut angefühlt.
Also waren wir wieder bei Stand Null. Ein Arbeitskollege meinte zu mir, dass er denkt, ich würde gut als Kriminalkommissarin ins BKA (Bundeskriminalamt) passen. Davon hatte ich noch nie was gehört, aber nach ein wenig Recherche fand ich die Berufsbeschreibung sehr interessant und habe mich prompt beworben. Gleichzeitig hat sich die DFS bei mir gemeldet und mir eine Ausbildung zur Flugdatenbearbeitung angeboten bzw. gesagt, dass ich mich doch gerne darauf bewerben soll. Etwas verdutzt habe ich das dann auch gemacht und da ich meine Fähigkeiten beim Fluglotsen-Auswahlverfahren schon unter Beweis gestellt hatte, musste ich dort dann nur noch die Arbeitsproben machen.
Zwischendurch kam auch ein Anruf vom Ausbildungsleiter der AXA, der mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse am dualen Marketingstudium hätte. Äh, danke, aber nein.
(Deshalb immer schön nett sein und auch auf Absagen freundlich antworten. Daran erinnern sich die Leute und guckt, was dann noch alles passieren kann.)
Nun hieß es also vorbereiten: Sporttest und Interview beim BKA, Regeln und Anforderungen für die Arbeitsproben bei der DFS auswendig lernen. Dann ging es nach Wiesbaden zum BKA. Ich sag mal so: Sporttest war nicht so schlimm, wie ich dachte. Den hab’ ich auch bestanden. Das Gespräch danach war einfach meine persönliche Hölle. Die Fragen waren wie erwartet aus dem Beamtenkatalog, aber die Stimmung war recht… herablassend? Angespannt? Ich kann es gar nicht gut erklären, nur kann ich ganz klar sagen, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe und es genauso war, wie man sich eine Behörde verkörpert vorstellt. Das heißt natürlich nicht, dass, nur weil ich eine negative Erfahrung hatte, ich jetzt nichts mehr von dem Beruf oder der Behörde im Ganzen halte, sondern einfach, dass ich für mich entschieden habe, diesen Beruf nicht mehr in Erwägung zu ziehen.
Danach war mein Vorstellungsgespräch bei der DFS ein großes Aufatmen. Auf Augenhöhe, sympathisch und persönlich. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich dann auch den Ausbildungsplatz bekommen habe, yay! Eine riesige Erleichterung, denn nach so vielen Absagen hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf dieses ganze Bewerben.
Da wahrscheinlich nicht allen bekannt ist, was eine Flugdatenbearbeiterin macht, fasse ich kurz zusammen: Flugroutenüberwachung- und anpassung bezüglich Wetter, Verspätungen etc. und nein, man arbeitet nicht am Flughafen, sondern im Center, dem Flugkontrollzentrum.
Alles in allem will ich damit nur zeigen, dass man am Ende irgendwo landet, wo man glücklich ist, auch wenn es nicht das ist, was man erwartet hat. Wenn man echt keine Ahnung hat, was einen interessiert, macht überall Praktika oder schließt aus, was ihr echt nicht machen wollt (bei mir bspw. Jura, Medizin, Lehramt, …). Also, nicht aufgeben, das wird schon!
Finde alle gesuchten Begriffe.
BUCHSTABENSALAT
















Bild: Pexels / Leeloo the first
1. Welcher ist der Monat nach August?
2. Wie bezeichnet man Rot, Gelb, Grün und Blau?
3. Wie heißt der Freizeitpark in der Nähe von Brühl?
4. Wie heißt ein Körperteil mit N?
5. Wie nennt man das Grüne auf der Wiese?
6. Wie nennt man das Gegenteil von Anfang?
7. Wie heißt das Beste an der Schule im Sommer, Herbst, Winter und zu Ostern?
Welche Rolle spielen Soziale Medien bei der Verbreitung von Hass?
• Tagesschau, 12. März 2025: DAK-Studie zu Online-Nutzung. Ein Viertel der jungen Menschen hat ein Medienproblem, online verfügbar unter: https://www. tagesschau.de/inland/gesellschaft/soziale-medien-kinder-jugendliche-mediensucht-100.html.
UNESCO, 2022: Media an Information Literacy, online verfügbar unter: https:// www.unesco.org/en/media-informationliteracy.
• RAND: Radicalisation in the digital era, online verfügbar unter: https:// www.rand.org/randeurope/research/ projects/2013/internet-and-radicalisation.html#:~:text=Research%20 Findings&text=The%20internet%20 creates%20more%20opportunities,accelerates%20the%20process%20of%20 radicalisation.
• Magdalena Obermaier/ Desirée Schmuck, Juli 2022: Youths as targets: factors of online hate speech victimization among adolescents and young adults, in: Journal of Computer-Mediated Communication 27, online verfügbar unter: https://academic.oup.com/jcmc/article/27/4/zmac012/6648458.
• Richard Wike u.a., 6. Dezember 2022: Views of social media and its impacts on society, online verfügbar unter: https://www.pewresearch.org/ global/2022/12/06/views-of-social-media-and-its-impacts-on-society-in-advanced-economies-2022/.
Fake News
bpb: #StopFakeNews – Fake News erkennen, online verfügbar unter: #StopFakeNews - Fake News erkennen | Themen | bpb.de.
Faktenchecker-Aus bei Instagram:
• Emma Mack, 9. Januar 2025: Meta beendet Faktenchecks in den USA. Wie arbeiten Faktenchecker in Deutschland?, online verfügbar unter: https://www.mdr. de/nachrichten/deutschland/panorama/ meta-kein-faktencheck-zuckerberg-100. html.
• Europäische Kommission: Paket zum Gesetz über digitale Dienste, online verfügbar unter: https://digital-strategy. ec.europa.eu/de/policies/digital-services-act-package.
Leibniz-Institut für Wissensmedien, März 2023: Info-Rauschen: Untersuchung der kognitiven Auswirkungen verrauschter Informationsumgebungen, online verfügbar unter: https://www.iwm-tuebingen.de/ www/de/forschung/projekte/projekt. html?name=Info-Rauschen. Tagesschau, 18. Dezember 2023: Hetze und Falschinformationen im NetzEUKommission eröffnet Verfahren gegen X, online verfügbar unter: https://www. tagesschau.de/ausland/eu-kommissionx-100.html.
• Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 11. Oktober 2023: Antidiskriminierungsstelle des Bundes verlässt Online-Plattform „X“, online verfügbar unter: https:// www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/aktuelles/DE/2023/20231011_ ADS_verlaesst_X.html.
• CORRECTIV, 8. Januar 2025: Faktencheck. CORRECTIV-Stellungnahme zu Metas Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Faktencheck-Redaktionen zu beenden, online verfügbar unter: https://correctiv.org/in-eigener-sache/2025/01/08/ correctiv-stellungnahme-zu-metas-entscheidung-die-zusammenarbeit-mit-faktencheck-redaktionen-zu-beenden/.
• ZDFheute, 7. Januar 2025: Wie Trump Tech-Milliardäre auf Linie bringt - Zuckerberg schafft Meta Faktencheck ab | ZDFheute live, online verfügbar unter: https://www.youtube.com/ watch?v=Ou3wCijMBZg.
Gemeinsam gegen Hass
• Maria Alejandra Morgado Cusati, 15. November 2022: Was ist Hass und warum empfinden wir ihn, online verfügbar unter: https://bessergesundleben.de/was-
ist-hass-und-warum-empfinden-wir-ihn/. Dr. Doris Wolf, 22. Juli 2024: Hass vergiftet das Leben, online verfügbar unter: https://www.palverlag.de/lebenshilfeabc/hass.html.
• Jannis Fughe, 25. November 2024: Hass als Teil des politischen Klimas: Ein Weckruf für unsere Demokratie, online verfügbar unter: https://www.bistum-muenster. de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/ news_detail/hass_als_teil_des_politischen_klimas_ein_weckruf_fuer_unsere_demokratie.
• Team von Toleranz im Netz ,14. August 2024: Woher kommt der Hass?, online verfügbar unter: https://www.toleranzim-netz.de/allgemein/woher-kommthass/.
„aula“ - Die neue Schule der Demokratie
• Webseite zum Projekt aula online verfügbar unter: https://www.aula.de/.
• Timo Grampes, 11. April 2021: Mitbestimmung von Jugendlichen. „Schule heute ist ein autoritäres System“, online verfügbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/mitbestimmung-vonjugendlichen-schule-heute-ist-ein-100. html.
Was die USA mich über Demokratie gelehrt hat
• Arthur Landwehr: Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte - ein Land kämpft um seine Identität, München 2024.
• Pew research center, 10. Oktober 2019: How partisans view each other, online verfügbar unter: https://www.pewresearch.org/politics/2019/10/10/how-partisans-view-each-other/.
Kinderrechteschulen
• Deutsches Kinderhilfswerk, 2025: Das sind Kinderrechteschulen. Hier werden Kinderrechte gelebt, online verfügbar unter:
• https://www.kinderrechte.de/kinderrechtebildung/kinderrechteschulen/dassind-kinderrechteschulen.
Unicef, 2025: Schulen leben Kinderrechte. Ein UNICEF Programm für Schulen, online verfügbar unter: https://www. unicef.de/informieren/einsatz-fuer-kinderrechte/kinderrechteschulen.
Juniorwahl
Kumulus e.V.: Juniorwahl, Wahlergebnisse 2025 online verfügbar unter: https:// portal.juniorwahl.de/onlineportal/wahlergebnisse/.
Thomas Sankara
• Carina Ray, 18. Februar 2025: Thomas Sankara, president of Burkina Faso, online verfügbar unter: https://www. britannica.com/biography/Thomas-Sankara?utm_source=chatgpt.com.
• Films For Action: Thomas Sankara: The Upright Man (2006), online verfügbar unter: https://www.filmsforaction. org/watch/thomas-sankara-the-uprightman-2006/.
James Brooke, 26. Oktober 1987: A friendship dies in a bloody coup, online verfügbar unter: https://www.nytimes. com/1987/10/26/world/a-friendshipdies-in-a-bloody-coup.html.
• Paul Dziedzic, 16. November 2021: Die Idee eines freien Afrikas. Drei Jahrzehnte Autoritarismus konnten das Erbe Thomas Sankaras in Burkina Faso nicht verdrängen, sagt Hamado Dipama, online verfügbar unter: https://www.akweb.de/ politik/burkina-faso-prozess-zum-mordan-thomas-sankaras-die-idee-eines-freienafrikas/
• Katrin Gänsler, 23.11.2021: Volksheld in Burkina Faso. Wer ermordete Thomas Sankara?, online verfügbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/ burkina-faso-thomas-sankara-100.html
• Fiona Faye: Thomas Sankara im Podcast „Geschichte der kommenden Welten“, online verfügbar unter: https://www. thomassankara.net/thomas-sankara-impodcast-geschichte-der-kommenden-welten/?lang=de. Declan Walsh, 9. März 2022: Assassi-
nated in His Prime, an Iconic African Leader Haunts a Trial and His Country, online verfügbar unter: https://archive.is/ VCxVc#selection-543.0-543.12.
• Katrin Gänsler, 10. Oktober 2021: Gerechtigkeit für Thomas Sankara, online verfügbar unter: https://www. dw.com/de/burkina-faso-gerechtigkeitf%C3%BCr-thomas-sankara/a-59448066. Maxime Quijoux/ Hadrien Clouet, 15. Oktober 2021: Der Thomas Sankara, den ich kannte, übers. V. Thomas Zimmermann/ Alexander Brentler, online verfügbar unter: https://jacobin.de/artikel/ thomas-sankara-ouedraogo-ministerin-interview-revolution-che-guevara-afrika-kolonialismus-sklaverei-befreiung-burkinafaso-staatsstreich.
• Katrin Gänsler, 14. Oktober 2021: Thomas Sankara. Von Vertrauten verraten und bis heute verehrt, online verfügbar unter: https://www.woz.ch/2141/thomas-sankara/von-vertrauten-verratenund-bis-heute-verehrt.
Bruno Jaffré, Oktober 2007: Thomas Sankara ou la dignité de l’Afrique, online verfügbar unter: https://www. monde-diplomatique.fr/2007/10/JAFFRE/15202?utm_source=chatgpt.com.
• Mohamed Keita, 31. Mai 2015: Why Burkina Faso’s late revolutionary leader Thomas Sankara still inspires young Africans, online verfügbar unter: why-burkina-fasos-late-revolutionary-leader-thomas-sankara-still-inspires-young-africans
• Sylvie, Kandé: Sankara, Thomas, in: F. Abiola Irele/ F. Biodun Jeyifo (Hrsg.): The Oxford Encyclopedia of African Thought Bd. 2, Oxford 2010, S. 304, online verfügbar unter: https://books.google.de/ books?id=hF_xjFL6_NEC&pg=RA1PA304#v=onepage&q&f=false.
• Susi Kessler u.a.: Speeding up child immunisation, in: World Health Forum Vol. 8 (1987), online verfügbar unter: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/48240/WHF_1987_8(2)_p216220.pdf.
Bruno Jaffré, 2015: Facts about Thomas Sankara in Burkina Faso, online verfügbar unter: https://www.thomassankara.net/ facts-about-thomas-sankara-in-burkinafaso/?lang=en.
• DW, Januar 2014: Massenprotest gegen Verfassungsreform, online verfügbar unter: https://www.dw.com/ de/gro%C3%9Fdemonstration-gegengeplante-verfassungs%C3%A4nderung/a-17372265.
• ntv.de, 6. April 2022: Blaise Compaoré. Burkina Faso: Ex-Präsident wegen Mordes an Vorgänger zu lebenslanger Haft verurteilt, online verfügbar unter: Burkina-Faso-Ex-Praesident-wegen-Mordesan-Vorgaenger-zu-lebenslanger-Haft-verurteilt-article23250583.html. Capitainethomassankara.net: Thomas Sankara. Chronologie der Ereignisse, online verfügbar unter: https://www. capitainethomassankara.net/pages_deu/ sankara_Chronologie.html.
• Simone Schwarz, 31. Mai 2015: Burkina Faso nach dem Volksaufstand: Sankaras hoffnungsvolle Erben – und Erbinnen, online verfügbar unter: https://www. fairquer.net/weitblick/weitblick/burkinafaso-nach-dem-volksaufstand-sankarashoffnungsvolle-erben-%E2%80%93-underbinnen.
E-Zigaretten
Vape Free Info, 2024: Alles, was Sie über Vapes wissen müssen, online verfügbar unter: https://www.vapefree.info/de/.
• BVL: E-Zigaretten und E-Liquids, online verfügbar unter: https:// www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/03_Verbraucherprodukte/02_Verbraucher/05_Tabakerzeugnisse/04_EZigaretten_ELiquids/ bgs_EZigaretten_ELiquids_Tabakerzeugnisse_node.html;jsessionid=A7F760702AE7B7EAEC08986A C6B8B301. internet982?cms_thema=E-Zigaretten+und+E-Liquids.
Barbara Metz, 25. März 2024: Bunt, süss, beliebt: So schädlich sind E-Zigaretten und Vapes für Gesundheit und Umwelt,
online verfügbar unter: https://www. brisant.de/gesundheit/drogen/rauchen/ vape-114.html.
• Max von Schwartz, 31.05.2023: Mit und ohne Nikotin: Sind Vapes eine Einstiegsdroge?, online verfügbar unter: https:// www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ hannover_weser-leinegebiet/Mit-und-ohne-Nikotin-Sind-Vapes-eine-Einstiegsdroge,vapes106.html.
• Feelok.de: Vapes, Nikotin und Umwelt, online verfügbar unter: https://www.feelok.ch/de_CH/jugendliche/themen/vapes/infos-tools/vapes/fakten/vapes.cfm.
KVB in der Dauerkrise
KVB, 13. März.2018: Bahnfahren für Dummies, online verfügbar unter: https://www.youtube.com/ watch?v=QJglAlNPyBg.
• KVB, 25. Mai 2016: Ein Tag im Leben eines KVB-Stadtbahnfahrers, online verfügbar unter: https://www.youtube.com/ watch?v=SdLMOFlCH8k.
KVB, 14. November 2016: Ein Tag im Leben einer KVB-Busfahrerin, online verfügbar unter: https://www.youtube.com/ watch?v=5OyqEOw3epE.
• KVB, 02. Juli 2019: Ein Tag in der KVBLeitstelle, online verfügbar unter: https:// www.youtube.com/watch?v=_vhyjfYfR18
Radio Köln, 24. Oktober 2024: Personalmangel: KVB dünnt ab dem 16. November Fahrplan ordentlich aus, online verfügbar unter: https://www.radiokoeln.de/artikel/personalmangel-kvb-duennt-ab-dem-16-november-fahrplan-ordentlich-aus-2139150.html.
KVB, 19. September 2018: Wenn die Sicherheit gefährdet ist, dann radel doch bitte!, online verfügbar unter: https://www. youtube.com/watch?v=6kjXHeTqUPw.
• KVB, 24. Februar 2015: Das tut Ihr unseren Fahrern an, wenn Ihr bei Rot geht!, online verfügbar unter: https://www. youtube.com/watch?v=vz_MPM7Rbqo.
Was ist eigentlich ein Reichsbürger?
DPA - Tagesschau, 22.03.2023: Wie gefährlich sind Reichsbürger?, online verfügbar unter: Wie gefährlich sind „Reichsbürger“? | tagesschau.de.
• Bundesamt für Verfassungsschutz: „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“, online verfügbar unter: Bundesamt für Verfassungsschutz - Begriff und Erscheinungsformen - Begriff und Erscheinungsformen.
• Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 2021: Reichsbürger, online verfügbar unter: ReichsbürgerIdeologie - Hintergründe | LpB BW.
Teuer, teurer, Profifußball Stadionwelt, 31. Januar 2024: Studie: Die Kosten für Fantreue steigen weiter, online verfügbar unter: https://www.stadionwelt.de/news/72985/studie-die-kostenfuer-fantreue-steigen-weiter.
• Chaled Nahar, 29. November 2023: Einziger Bewerber bei der FIFA. Wie sich Saudi-Arabien die WM 2034 sicherte, online verfügbar unter: https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2034-saudiarabien-100.html.
• Worldometer: Marshall Islands GDP, online verfügbar unter: https://www. worldometers.info/gdp/marshall-islandsgdp/.
Was das Nashorn sah... Info-Box:
• Jan Kunigkeit, 23. April 2019: Sonntag ist Zootag, online verfügbar unter: Sonntag ist Zootag | UNGLEICH MAGAZIN.
• Junges Theater Freiberg/ Döbeln: Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Von Jens Raschke. Materialmappe, online verfügbar unter: Nashorn_Materialmappe_JUT.pdf.
Was konnten sie tun? Widerstand im NS
• Webseite zur Wanderausstellung: Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939–1945, online verfügbar unter: https://www.was-konnten-sie-tun.de/


