Monthly Market Monitor
Dezember 2022
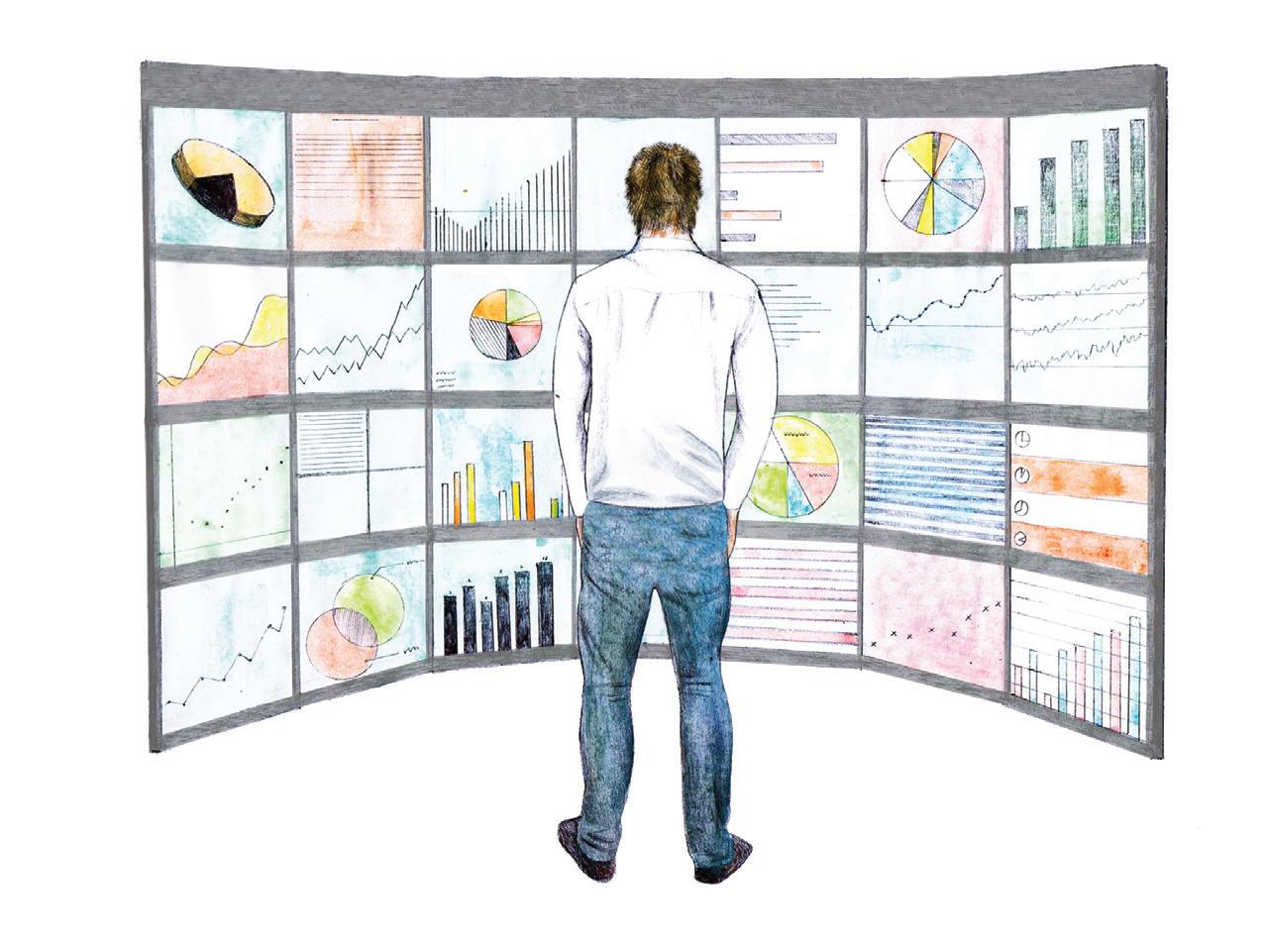

Dezember 2022
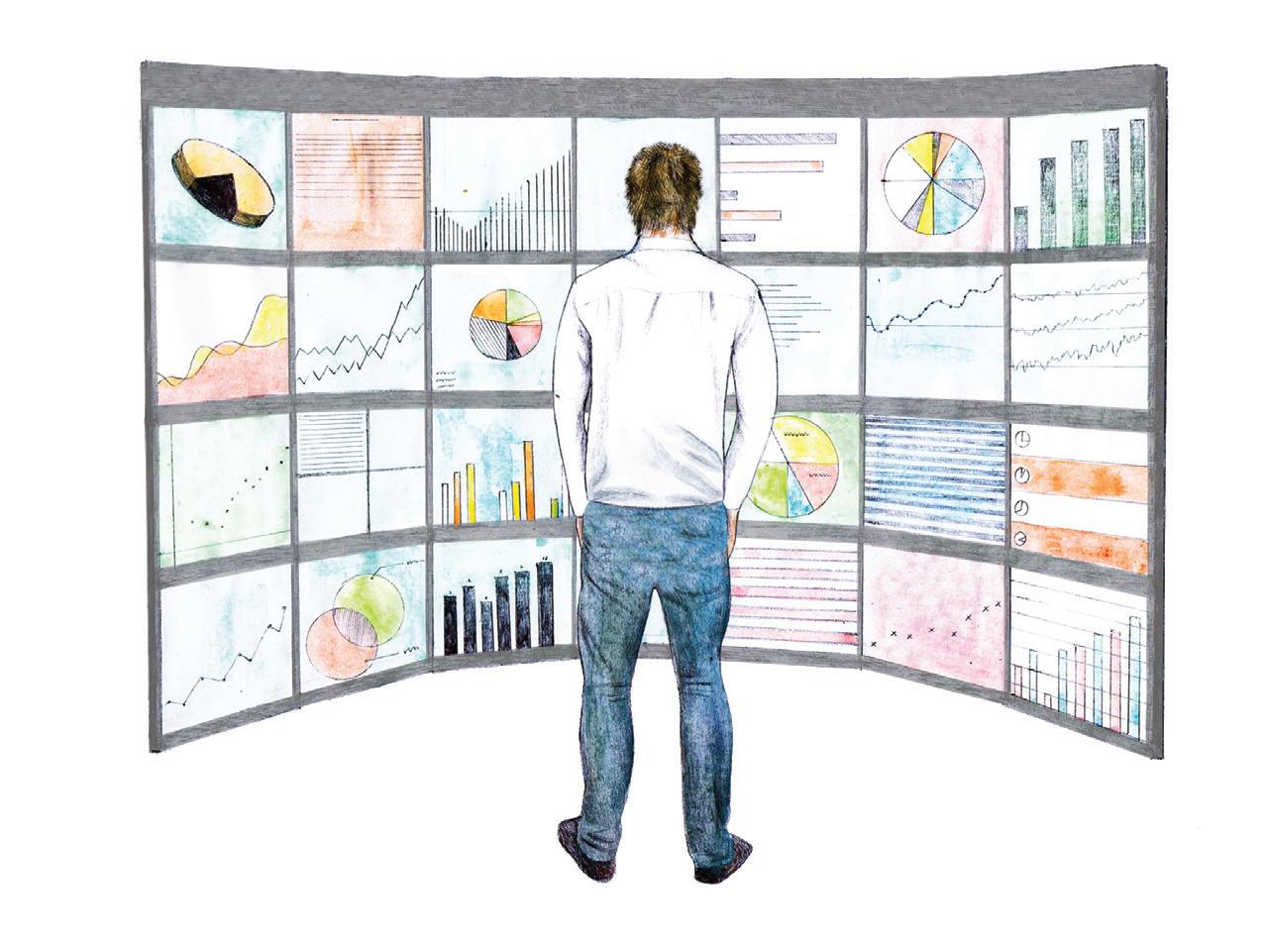
Auf einen Blick
Unsere Sicht auf die Märkte 04
Konjunktur-Radar Am Puls der Wirtschaft 06
Die geopolitische Heatmap 08
Thema im Fokus Über Schuldenberge… und Steuern
Was unsere Kunden (und die Finanzmärkte) bewegt
Anlageklassen und Agenda
Hürden für die (Bärenmarkt-)Rally Dank starker Herbstrally endet 2022 für Aktionäre im roten, nicht aber im tiefroten Bereich. Das Ende des Bärenmarktes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aber noch nicht erreicht. Denn bei den Gewinnschätzungen besteht angesichts der sich eintrübenden Konjunkturlage noch Anpassungsbedarf. Die Bären dürften in den nächsten Monaten zumindest einen Angriff auf die bisherigen Tiefstände starten. Auch das Anlagejahr 2023 dürfte volatil werden.
Licht am Ende des Corona-Tunnels
Rekordhohe Covid-19-Fälle und zunehmender Unmut in der Bevölkerung haben in der chinesischen Regierung zu einem Umdenken geführt. Es mehren sich die Anzeichen für eine schrittweise Abkehr von der Null-Covid-Politik. Kombiniert mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmassnahmen sowie Bestrebungen einer Stabilisierung des Immobilienmarkts erhöht dies die Chancen für einen temporären Wachstumsschub in China im zweiten Halbjahr 2023. Dieser würde sich auch positiv auf die europäische Konjunktur auswirken.
Die Schnittstelle zwischen Raumfahrt und Geopolitik wird von den meisten Ökonomen und geopolitischen Analysten noch kaum beachtet. Doch die «Astropo-
litik» wird in Zukunft immer wichtiger werden. Dies veranschaulicht nicht zuletzt der Ukraine-Konflikt. Kollisionen, Waffen, Cyber-Attacken und Weltraumschrott stellen erhebliche Bedrohungen und könnten zukünftig zu einem abrupten Anstieg von geopolitischen Risiken führen.
Die Staatsschuldenberge wachsen infolge multipler Krisen in immer weitere Höhen. Ist ein Abbau noch möglich? Schliesslich gelang dies nach dem zweiten Weltkrieg schon einmal. Heutzutage sind die Rahmenbedingungen für ein zweites Schuldenwunder allerdings merklich schlechter. Gesündere Staatsfinanzen gibt es zumindest nicht kostenlos.
Ask the experts
Und noch mehr Fragen: Was bedeutet der «geteilte» US-Kongress nach den Zwischenwahlen? Droht ein Gasengpass in Europa im übernächsten Winter? Wie weit werden die Notenbanken die Leitzinsen noch anheben? Sind festverzinsliche Anlagen nun wieder attraktiv? Werden Substanzaktien weiter outperforman? Und wie schütze ich mich gegen (weitere) Anlageverluste im kommenden Jahr? Unsere Antworten finden sie im quartalsweise erscheinenden Frage-und-Antwort-Format.
Die Frage, ob es in den USA bald eine Rezession gibt, bleibt auch Ende 2022 eine der wichtigsten. Denn die Antwort hat vielfältige Implikationen, unter anderem für Arbeitsmarkt, Geldpolitik und nicht zuletzt für die Finanzmärkte. Einer der statistisch zuverlässigsten Rezessionsindikatoren – die US-Zinskurve – hat diesbezüglich bereits ein Urteil gefällt. Die zwei wichtigsten Zinsdifferenzen (10 Jahre minus 2 Jahre bzw. 3 Monate) sind mit mehr als -70 Basispunkten inzwischen sowohl tief als auch nachhaltig im roten Bereich. Auch nahezu alle anderen Zinskombinationen sind negativ. Die «inverse» Zinskurve lässt mit fast 100%-iger Sicherheit den Beginn einer Rezession in den nächsten 6 bis 24 Monaten erwarten. Es könnte als noch bis 2024 dauern – oder doch ganz anders kommen (als in der Vergangenheit). Für die Aktienmärkte wäre das R-Szenario indes wohl das Beste. Nur dieses würde schon nächstes Jahr wieder Zinssenkungen bringen.


US-Rezession – fast sicher, aber wann? Nicht nur die US-Zinskurve lässt in den kommenden Quartalen eine Rezession erwarten. Auch der Leading Economic Index des Conference Boards gibt inzwischen ein klares Warnsignal und lässt demnächst eine Schrumpfung der amerikanischen Wirtschaft erwarten. Umfragen bestätigen diese Erwartungen: In der traditionsreichen Survey of Professional Forecasters der Federal Reserve Bank of Philadelphia erwartet ein rekordhoher Anteil der Befragten (knapp 50%) eine Rezession in den kommenden 12 Monaten. Noch ist der US-Konsument eine Konjunkturstütze, die dank der Konjunkturprogramme angehäuften Zusatzersparnisse neigen sich aber langsam dem Ende.
EU-Rezession – noch sicherer, aber weniger tief
In Europa ist eine Rezession zumindest im EU-Schnitt sowie in einigen besonders von Inflation und/oder Energiekrise betroffenen Ländern wie Deutschland und Grossbritannien eine ausgemachte Sache. Allerdings hat
BIP-Wachstum (in %)
Schweiz 2.2 0.7 1.6 Eurozone 3.2 -0.1 1.5 Grossbritannien 4.2 -0.8 1.0 USA 1.8 0.4 1.3 China 3.3 4.9 4.9
Inflation (in %)
Schweiz 2.9 2.0 1.2 Eurozone 8.5 5.9 2.1 Grossbritannien 9.0 7.0 2.6 USA 8.1 4.3 2.5 China 2.2 2.3 2.1
Leitzinsen (in %)
sich die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen in den letzten zwei Monaten dank eher milden Temperaturen, gefallenen Gaspreisen und nicht zuletzt staatlichen Hilfsmassnahmen etwas aufgehellt. Bleiben neue Negativüberraschungen aus, könnte der Konjunkturabschwung schwächer ausfallen als bisher befürchtet.
Langsamer, aber nicht am Ende Das letzte Fed-Protokoll sowie Äusserungen diverser Fed-Vertreter lassen demnächst eine langsamere Gangart bei weiteren Zinserhöhungen (und somit «nur» einen 50bp-Schritt im Dezember) erwarten. Dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und die Fed erst einen klaren Sieg über die (träge und nachlaufende) Inflation verkünden möchte, scheint aber ebenso deutlich. Das Risiko eines neuen geldpolitischen Fehlers ist weiterhin real. Womöglich unterschätzt die Fed die zeitverzögerten Reaktionen ihrer bisherigen Taten (siehe Grafik).
Licht am
Nachdem die täglichen Fallzahlen von Covid-19 in China Ende November neue Rekordhöhen erreichten und sich in den letzten Wochen zunehmend Unmut in der Bevölkerung breit machte, mehren sich die Anzeichen für eine schrittweise Abkehr von der Null-Covid-Politik. Kombiniert mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmassnahmen sowie Bestrebungen einer Stabilisierung des Immobilienmarkts erhöht dies die Chancen für einen temporären Wachstumsschub in China im zweiten Halbjahr 2023. Dieser würde sich auch positiv auf die europäische Konjunktur auswirken.
Billiges Geld adé | Das monetäre Umfeld hat sich in Rekordzeit eingetrübt GS US Financial Conditions Index (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
2012 1992 1996 2000 2004 2008
Quellen: Bloomberg,
Eine Rezession ist 2023 je nach (Industrie-)Land mehr oder weniger sicher. Die Notenbanken sind sich der Konjunkturrisiken überwiegend bewusst und dürften ihren Zinserhöhungskurs zumindest verlangsamen. China könnte Anfang nächsten Jahres indes zur Abwechslung einmal für positive Überraschungen sorgen.
Die Schnittstelle zwischen Raumfahrt und Geopolitik wird von den meisten Ökonomen und geopolitischen Analysten noch kaum beachtet. Doch die «Astropolitik» wird in Zukunft immer wichtiger werden. Dies veranschaulicht nicht zuletzt der UkraineKonflikt.
Steigende wirtschaftliche und militärische Relevanz… Der Weltraum zieht immer mehr Akteure an. Im Jahr 2022 wurden bereits mehr Raketenstarts verzeichnet als zu den Hochzeiten der Mondraumfahrt in den 1970er Jahren. In den letzten Jahren ist es zunehmend auch die Privatindustrie, die im All mitmischt. So planen die US-Unternehmen SpaceX und Amazon tausende Mini-Satelliten im erdnahen Orbit zu platzieren, um schnelles Internet in jeden Winkel der Welt zu bringen. Aber auch das Interesse von Regierungen und Militärs nimmt stetig zu. Deren Anteil an den aktiven Satelliten stieg von 10% zum Beginn des Millenniums auf 29% Ende 2020. Sowohl kommerzielle als auch militärische Satelliten spielten im Ukraine-Konflikt dieses Jahr eine wichtige Rolle. Dank der Starlink-Satelliten von SpaceX konnten Bevölkerung und Militär mit Breitbandinternet versorgt werden. Und dank amerikanischer Satellitenaufklärung war das ukrainische Militär in der Lage punktgenaue Angriffe auf russische Positionen zu lancieren.
…sorgt für Platzknappheit und steigende Risiken Wer im Zeitalter zunehmender geopolitischer Rivalitä ten relevant bleiben möchte, muss auch im Weltraum «mitspielen» können. Entsprechend viele Ressourcen stecken daher insbesondere die Vereinigten Staa ten und China in die Eroberung des erdnahen Raums. Auch die Gründung der unabhängigen US Space Force im Jahr 2019 ist vor diesem Hintergrund zu betrachten. Das zunehmende militärische Engagement geht allerdings auch mit einem steigenden Risiko für Unfälle einher. Diese können beispielsweise aus dem Einsatz von Anti-Satellitenwaffen resultieren. Russland, China und die USA haben den Einsatz solcher Waffen bereits erprobt. Cyber-Angriffe auf Satelliten werden derweil
schon heute täglich registriert. Risiken ergeben sich nicht nur aus möglichen militärischen Fehlkalkulationen, sondern auch aufgrund der exponentiell steigenden Mengen an Weltraumschrott und inaktiven Satelliten (Ende 2020 waren mehr als 50% von 5'800 Satelliten als «Schrott» klassifiziert). Die Internationale Raumstation ISS und die Raumstation Chinas mussten aufgrund von Kollisionsgefahr bereits Ausweichmanöver fliegen. Trotz der Weite des Weltalls ist der Platz im erdnahen Raum begrenzt. Ende des Jahrzehnts könnten bis zu 50'000 mehr Satelliten um die Erde kreisen als heute. Kollisionen, Waffen, Cyber-Bedrohungen und Weltraumschrott können erhebliche Schäden an Satelliten und Raumstationen verursachen und Astronauten oder Menschen auf der Erde das Leben kosten. Da die Länder derzeit nicht ausreichend kooperieren beziehungsweise diese Risiken nicht angehen, könnten die geopolitische Risiken zukünftig infolge eines katastrophalen Ereignisses im Weltraum abrupt steigen.


Dank starker Herbstrally endet 2022 für Aktionäre im roten, nicht aber im tiefroten Bereich. Das Ende des Bärenmarktes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aber noch nicht erreicht. Die Bären dürften in den nächsten Monaten zumindest einen Angriff auf die bisherigen Tiefstände starten. Auch das Anlagejahr 2023 dürfte volatil werden.
- + - +
Aktien Festverzinsliche Anlagen Global Staatsanleihen Schweiz Unternehmensanleihen Europa Mikrofinanz Grossbritannien Inflationsbasierte A. USA Hochzinsanleihen Schwellenländer Schwellenländeranleihen Alternative Anlagen Versicherungsbasierte A. Gold Wandelanleihen Immobilien Laufzeiten 11/2022 Hedgefonds Währungen Strukturierte Produkte US-Dollar Private Equity Schweizer Franken Euro Britisches Pfund
Liquidität
Aktien: Hürden für die (Bärenmarkt-)Rally
• Mit einem Anstieg von rund 15% in den USA und teils mehr als 20% in Europa haben die Aktienmärkte seit Mitte Oktober eine eindrückliche Jahresendrally aufs Parkett gelegt. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, klassifizieren wir diese jedoch als Rally in einem intakten Bärenmarkt. Neue Kurstiefs, zumindest aber ein erneuter Test der Jahrestiefstände, stehen im Bärenmarktszenario in den nächsten Quartalen auf der Agenda. Kurzfristig dürfte die Luft für weitere unmittelbare Kursgewinne in jedem Fall dünner werden. Mit der 200-Tage-Linie und dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn steht S&P 500 Index vor grösseren technischen Hürden. Zudem hat sich die überverkaufte Lage bei den Momentum-Indikatoren komplett abgebaut, sie sind inzwischen eher etwas heissgelaufen. Die Unterinvestierung der Marktteilnehmer hat sich indes ebenso normalisiert wie der Volatilitätsindex VIX, welcher bei einem Level von zeitweise «nur» noch 20 Punkten Ende November fast schon etwas zu viel Sorglosigkeit anzeigte.
• Eine gewisse Sorglosigkeit widerspiegelt sich bisher auch in den Gewinnschätzungen der Analysten für 2023. Zwar sind die Prognosen zuletzt schon spürbar gefallen, für ein «echtes» Rezessionsszenario – selbst für eine milde Variante – sind sie aber noch zu hoch und haben weiteren Revisionsbedarf. Auch für die Aktienmärkte zeichnet sich damit weiterer Korrekturbedarf ab. Selbst im positiven Makroszenario erwarten wir nächstes Jahr bestenfalls einen volatilen Seitwärtsmarkt. Bleibt eine
Rezession nämlich aus, dann dürfte die Fed die Leitzinsen für längere Zeit im restriktiven Bereich halten. Tröstlich ist die Tatsache, dass der mutmassliche Bärenmarkt wohl weiterhin ohne Panik vor sich hinplätschern wird. Dafür dürfte schon das negative Sentiment sorgen, welches sich nicht nur bei den Umfragen unter US-Privatanlegern, sondern auch aus den eher konservativen Indexkurszielen der Analystengemeinde ablesen lässt. Gegen zu viel Pessimismus spricht folgende Statistik: Auf negative Zwischenwahljahre folgten seit 1950 in 8 von 8 Fällen positive Aktienjahre.
Konjunktur Geld- und Fiskalpolitik Unternehmensgewinne Bewertung Trend Anlegerstimmung
- +
Anleihen: Bessere Perspektiven im nächsten Jahr • Nach einem verheerenden 2022 sind die Aussichten für Anleiheinvestoren im Jahr 2023 deutlich besser. Wenn man das Potentialwachstum der US-Wirtschaft als Gradmesser für den «fairen» Wert von 10-jährigen US-Treasuries verwendet, dann sind diese mit einer Rendite von knapp 4% derzeit so günstig bewertet wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Ist nun also der ge-
eignete Zeitpunkt für den Einstieg in (US-)Staatsanleihen? Für Anleger mit längerem Zeithorizont durchaus. Denn nicht nur kann man mittlerweile einen attraktiven Realzins und somit einen echten Wertzuwachs einloggen (10-jährige inflationsbasierte Anleihen (TIPS) rentieren bei 1.5%). Auch dürften Staatsanleihen im Falle einer Rezession rückgängige Renditen und somit steigende Kurse verzeichnen. Damit wären sie eine günstige Portfolioversicherung. Kosten würde diese Absicherung – in Form von temporären Kursverlusten – nur dann etwas, wenn die Renditen am langen Ende der Zinskurve über die bisherigen Tops aus dem Oktober stiegen. Treiber dafür könnte beispielsweise ein zu langsamer Rückgang der Inflation sein, welche die Fed nicht von ihrer restriktiven Politik abrücken lässt. Auch der fortgesetzte Abbau der Notenbankbilanzen und die erhöhte Anzahl an Staatsanleiheemissionen (welche das Angebot an Staatspapieren erhöhen) könnten im Falle einer stabil bleibenden Konjunkturlage für noch etwas höhere Renditen sorgen. Ein taktisches Übergewicht von Staatsanleihen mit hoher Duration sollte daher besser graduell aufgebaut werden.
Alternative Anlagen: Immobilienmärkte unter Druck
• Der aggressive Zinserhöhungskurs der Notenbanken kommt auch an den Immobilienmärkten an – in Form fallender Preise. In Ländern wie Australien, Neuseeland oder Schweden sind die Häuserpreise bereits stark unter Druck und haben teils schon mehr als -10% an Wert eingebüsst. Auch in bisher resilienten Märkten wie den USA oder Deutschland scheint der Anstieg der Preise für Wohnimmobilien endgültig beendet. Dies geht auch an den Privatmarktanlagen im Immobilienbereich nicht spurlos vorbei. Nachdem sie 2022 – entgegen der Entwicklung in den meisten anderen Anlageklassen – nochmals deutlich zulegten, nahmen Anleger zuletzt Gewinne mit. Einige Privatmarktfonds haben daher die Rücknahme von Fondsanteilen bereits begrenzt. Da Privatmarkt-
fonds zumeist in den resistenten Segmenten (z.B. Logistik, Rechenzentren) investiert sind, sehen wir momentan keine Crashgefahr. In den nächsten Quartalen ist aber mit einer Bewertungskorrektur zu rechnen. Anleger sollten nicht überreagieren und ohne Not ihr Immobilienexposure abbauen. Als Inflationsschutz bleiben diversifizierte Privatmarktimmobilien langfristig interessant.
Der Franken bleibt auch 2023 stark
• EUR/USD: Seit Ende September konnte der Euro zwischenzeitlich um 10% bis auf 1.05 USD zulegen. Dass der Abwärtstrend seit Frühling 2021 trotz kräftiger Rally immer noch intakt ist, zeigt wie stark der vorherige Einbruch war. Bisher ist der Rebound nicht mehr als eine technische Korrektur. Damit der Euro 2023 den Abwärtstrend überwindet sind einige Bedingungen zu erfüllen: Die Fed muss ihre Zinserhöhungen stoppen, das Wachstum in Europa muss positiv überraschen und der Ukraine-Konflikt müsste «gelöst» werden.
• GBP/USD: Auch beim GBP/USD-Kurs ist der jüngste Anstieg von 15% nicht mehr als eine technische Reaktion. Inflation, Rezession und die auf das künftige Wachstum drückende fiskalische Rosskur unter dem neuen Schatzkanzler dürften das britische Pfund in den kommenden Monaten weiter belasten. Nach dem Brexit ist das Pfund noch abhängiger von ausländischem Kapital als zuvor und dürfte eine volatile Währung bleiben.
• EUR/CHF: Der Euro stabilisierte sich zuletzt unterhalb der Parität zum Franken – eine nachhaltige Überwindung dieser psychologischen Hürde ist nicht in Sicht. Zwar ist die nominale Zinsdifferenz für den Euro positiv, die relevantere Realzinsdifferenz spricht aber klar für einen stärkeren Franken. Auch hat die Schweizer Währung in der Vergangenheit häufig als «Rezessions-Hedge» fungiert. Dies spricht mit Blick auf den verhaltenen globalen Konjunkturausblick ebenfalls für Frankenstärke.
Nicht nur vis-à-vis Euro, Pfund und Franken hat der US-Dollar in diesem Jahr deutlich zugelegt. Auch gegenüber einem breiten Korb der wichtigsten Handelspartner der USA hat der Greenback stark aufgewertet. Mit Abstand betrachtet besteht der Aufwärtstrend des Dollars bereits seit mehr als einer Dekade. Der dynamische Aufschwung der letzten zwei Jahre hat die US-Währung nun aber endgültig in den stark überteuerten Bereich gesteuert. Der reale effektive Wechselkurs, welcher die Inflationsdifferenzen zwischen den USA und ihren Handelspartnern berücksichtigt, ist inzwischen höher als zum Hochpunkt der letzten Dollar-Hausse im Jahr 2002. Verschiedene Bewertungsmodelle indizieren derzeit eine Überbewertung von 20% bis 30%. Zwar ist diese Erkenntnis für taktische Entscheide wenig hilfreich, langfristig ist aber eine «Mean Reversion» – also ein schwächerer US-Dollar – zu erwarten. Für europäische Anleger könnten US-Aktien damit unattraktiver werden.
Historisch teuer?! | Der Greenback ist überbewertet Realer effektiver Wechselkurs US-Dollar
Vermögensmanagertest TOPS 2023 der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Die Kaiser Partner Privatbank konnte beim diesjährigen Qualitätstest der renommierten FUCHS | RICHTER Prüfinstanz auf ganzer Linie überzeugen. Mit der Gesamtbewertung «sehr gut» gehört sie zu einem von nur sieben Instituten, welche die absolute Höchstnote erhielten. Mit sehr guten Leistungen erzielte sie den ersten Platz aller geprüften Institute in Liechtenstein.

Seit 2003 prüft die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz jährlich fast 100 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Geprüft werden auf Basis von anonym durchgeführten Kundengesprächen die Kategorien Beratungsgespräch, Anlagevorschlag, Beauty-Contest, Anlagekompetenz sowie Transparenz. Der vom traditionsreichen deutschen Verlag Fuchsbriefe initiierte Qualitätstest ist das wichtigste Private-Banking-Ranking im deutschsprachigen Raum.
Bei der diesjährigen 20. Ausgabe des Wettbewerbs wollte die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz wissen, welche Vermögensverwalter am überzeugendsten auf das Kundenanliegen «Megatrends» eingehen. Mit überdurchschnittlich guten Bewertungen in allen Kernkompetenzen konnte die Kaiser Partner Privatbank nicht nur in allen Bereichen überzeugen. Mit einem als «sehr gut»
beurteilten Anlagevorschlag sowie ausgezeichneter Investmentkompetenz konnte sie sich zudem gegenüber den Mitbewerbern abheben. «LGT und Kaiser Partner auf Augenhöhe», so das Fazit der Fuchsbriefe. Als eines von 2 Instituten aus Liechtenstein zeichnete die Fachjury die Kaiser Partner Privatbank für ihre hervorragenden Leistungen mit dem Prädikat «sehr gut» aus.
Christian Reich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) der Kaiser Partner Privatbank, zeigt sich sehr erfreut über das sehr gute Feedback der unabhängigen Prüfinstanz: «Die Auseinandersetzung mit globalen Treibern des Wandels und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte sind seit jeher Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie. Dass wir diese Kompetenz zusammen mit unserer Nachhaltigkeitsexpertise im diesjährigen Testfall der Fuchsbriefe unter Beweis stellen konnten und mit einem sehr guten Ergebnis ausgezeichnet wurden, freut und ehrt uns zugleich. Ganz besonders erfreulich ist es, dass uns die Prüfinstanz eine exzellente Anlagekompetenz attestiert und wir als Boutique das beste Resultat in Liechtenstein erzielen konnten. Gleichzeitig bestärkt es uns darin, unseren Weg, bei dem die Kundschaft und deren individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, konsequent weiterzugehen.»
Der Trend zeigt nach oben. In den meisten Industrieländern sind die Staatsschulden im letzten Jahrzehnt stetig weiter angestiegen. In mehr und mehr Ländern überwiegt der Schuldenberg inzwischen die Wirtschaftsleistung. USA: 134%, Frankreich: 115%, Grossbritannien: 105% - die Liste wird immer länger. Nach der Pandemie ist es (insbesondere in Europa) nun die für die Staaten kostspielige Energiekrise, welche noch mehr Schulden erwarten und die notwendige Haushaltskonsolidierung vielerorts in weite Ferne rücken lässt. Doch ist das Abschmelzen der Schuldenberge noch möglich? Der Blick ins Geschichtsbuch zeigt, dass dies bereits einmal gelungen ist.
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg (1946) betrug die Staatsverschuldung in den USA 121%, im Vereinigten Königreich 270% und in der Schweiz 75%. Dreissig Jahre später waren es nur noch 34%, 49% beziehungsweise 47%. Ursache für dieses «Schuldenwunder» war vor allem zwei Faktoren: hohes Wirtschaftswachstum und gleichzeitig weitgehend solide Haushaltsführung. In den auch «trente glorieuse» genannten drei Jahrzehnten verdoppelte (USA) oder verdreifachte (Westeuropa) sich das reale Pro-Kopf-Einkommen. Zu verdanken war dies nicht nur dem enormen Nachholbedarf nach zwei Weltkriegen und der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, sondern auch der Liberalisierung des Aussenhandels und grossen Produktivitätsfortschritten. Mit Blick auf die Staatsfinanzen konnten durch die Demobilisierung der Armee einerseits grosse Spareffekte erzielt werden. Andererseits wurden die Spitzensteuersätze, welche in den USA und im Vereinigten Königreich während des zweiten Weltkriegs bis auf über 90% hochgeschleust wurden (Stichwort: «Kriegssteuer»), noch für Jahre auf oder nahe Kriegsniveau belassen. Selbst Ende der 1970er Jahre lagen sie in diesen Ländern noch bei 70% oder mehr, bevor in den 80er Jahren die Phase der grossen Steuersenkungen begann. Dank überwiegend ausgeglichenen Haushaltssaldos und entsprechend stagnierenden Schulden (konstanter Zähler) und gleichzeitig stark steigender Wirtschaftsleistung (höherer Nenner) konnte die Schuldenquote eindrücklich gesenkt werden. Hilfreich war dabei nicht zuletzt auch eine dritte Zutat: Durch phasenweise hohe Inflationsraten erhielt das (nominale) Bruttoinlandsprodukt einen zusätzlichen Schub, was das Verhältnis aus Schulden und Wirtschaftskraft zusätzlich schrumpfen liess.
Wie es nicht funktioniert (oder: Anschauungsunterricht in Downing Street 10)
Eine Wiederholung dieses Haushaltskonsolidierungszaubers ist heutzutage schwer denkbar. Denn an der ersten
Stellschraube (Wachstum) lässt sich kaum drehen, zumindest nicht ohne Nebenwirkungen. Alternde Bevölkerungen, abnehmendes Produktivitätswachstum und zunehmende Einkommensungleichheit tragen dazu bei, dass das Wachstumspotential in den Industrieländern stetig sinkt. Die OECD schätzt das durchschnittliche reale Trendwachstum im laufenden Jahrzehnt nur noch auf 1.7% in den USA, 1.8% im Vereinigten Königreich und 1.2% im Euroraum. Auch mit fiskalischen Stimuli lässt sich dieser Gravitationskraft nicht auf Dauer entkommen, wie das Experiment in der britischen Finanzpolitik diesen Herbst eindrücklich aufzeigte. Dort hatte das fehlgestrickte Mini-Budget von Ex-Premierministerin Liz Truss und ihrem Schatzkanzler (aka Finanzminister) Kwasi Kwarteng in kürzester Zeit einen Maxi-Schaden angerichtet. Team Truss beabsichtigte das Königreich mittels massiver
Heute: Ohne Grenzen? | Die Schuldenberge wachsen in den Himmel Staatsverschuldung (in % des Bruttoinlandsprodukts), ab 2000
Die Staatsschuldenberge wachsen infolge multipler Krisen in immer weitere Höhen. Ist ein Abbau noch möglich? Schliesslich gelang dies nach dem zweiten Weltkrieg schon einmal. Heutzutage sind die Rahmenbedingungen für ein zweites Schuldenwunder allerdings merklich schlechter. Gesündere Staatsfinanzen gibt es zumindest nicht kostenlos.
Königreich Vereinigte
Quellen: IWF, Kaiser Partner Privatbank
Damals: Den Schulden entwachsen | Nach dem zweiten Weltkrieg halfen hohe Wachstumsraten Staatsverschuldung (in % des Bruttoinlandsprodukts), 1900-2000
Königreich Vereinigte Staaten
Quellen: IWF, Kaiser Partner Privatbank
0
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
-0.5%
-1%
01/07/2022 01/08/2022 01/09/2022 01/10/2022 01/11/2022 vs Deutschland vs USA
«Deppen-Risikoprämie» | Fehlgestrickte Finanzpolitik erfordert Risikoaufschlag Risikoaufschläge 10-jähriger britischer Staatsanleihen Quellen: Bloomberg, Kaiser Partner Privatbank
Steuersenkungen zu einem Niedrigsteuerland zu machen und das Trendwachstum dauerhaft auf 2.5% zu hieven. Allein die Ankündigung dieser nicht gegenfinanzierten Steuergeschenke genügte, um das Pfund in den Keller zu stürzen und Chaos am Anleihemarkt auszulösen. Dort wurde bei langlaufenden britischen Staatsanleihen von Mitte September bis Mitte Oktober eine gehörige «Deppen-Risikoprämie» eingepreist. Die Renditeaufschläge gegenüber deutschen Staatsanleihen stiegen deutlich an, während die Aufschläge gegenüber amerikanischen Staatspapieren entgegen der Norm zeitweise positiv wurden. Die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte sorgte dann für eine abrupte finanzpolitische Kehrtwende, und letztlich auch für den Rücktritt von Liz Truss. Deren Programm wurde vom neuen Finanzminister Jeremy Hunt mittlerweile fast komplett rückabgewickelt.
Auch an der Ausgabenschraube lässt sich nicht beliebig drehen, ganz im Gegenteil. So steigen die Verteidigungsausgaben angesichts einer zunehmend multipolaren Welt seit einiger Zeit wieder an und dürften dies mit Blick auf den Ukraine-Konflikt auch zukünftig tun. Auch die demografischen Entwicklungen, die nötigen massiven Investitionen in grüne Energietechnologien sowie die teure Adaption an den Klimawandel erfordern steigende Staatsausgaben und dürften das Führen solider Staatsfinanzen für viele Regierungen erschweren.
In der heutigen, von tiefem Trendwachstum geprägten, Welt gibt es einen klaren Zielkonflikt. Gemäss einem kürzlich publizierten Arbeitspapier des Center for Research in Economics and Statistics (CREST)1 können in einem solchen Umfeld längerfristig nur zwei von drei wünschenswerten Zielen erreicht werden – tiefe Inflation, Vollbeschäftigung und/oder eine nachhaltige Staatsverschuldung. Letzteres meint Haushaltsdefizite, welche so gering sind, dass sie in der Zukunft glaubwürdig durch höhere Steuereinnahmen oder Ausgabenkürzungen zurückgezahlt werden können. Ein Paradebeispiel für nicht nachhaltige Staatsfinanzen ist Japan. Zwar sind Inflation und Arbeitslosigkeit dort sehr tief. Dafür gleicht die Schuldenpolitik aber einem Ponzi-Schema: Die Regierung häuft jahrein, jahraus Haushaltsdefizite von 6%-8% an und muss neue Schulden aufnehmen, um die
alten Schulden zu bedienen. Der Schuldenberg wächst unendlich und ist inzwischen auf 260% der Wirtschaftsleistung angewachsen. Doch das «Modell Japan» funktioniert allein, weil das Land konstant hohe Leistungsbilanzüberschüsse produziert und global betrachtet ein grosser Netto-Gläubiger ist. Ganz anders als beispielsweise Grossbritannien…
Noch haben sich die USA und Europa davor gehütet den japanischen Weg zu beschreiten. Aktuell werden die EU-Fiskalregeln zwar gerade etwas aufgeweicht beziehungsweise an die Realität angepasst. Dennoch bleiben nachhaltige Staatsfinanzen eines der Grundprinzipien der Währungsunion. Aber wenn man bei den Ausgaben nicht viel kürzen kann oder möchte, dann bleibt über kurz oder lang nichts anderes übrig als die Einnahmen zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngsten Diskussionen in Deutschland zu verstehen. Dort hatte sich der Wirtschafts-Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, Anfang November für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, einen Energie-Solidaritätszuschlag für Besserverdienende sowie die Verschiebung der geplanten Entschärfung der kalten Progression bei der Einkommenssteuer ausgesprochen. Wohlgemerkt zeitlich begrenzt und zuallererst mit dem Ziel dem sozial ungerechten Giesskannenprinzip der Energiepreisbremsen entgegenzuwirken, durchaus aber auch mit Verweis auf die steigende Schuldenlast infolge des 200 Milliarden Euro schweren «Doppelwumms». Während sich Vertreter von SPD und Grünen über die ungewohnte Rückendeckung durch den bisher stets der Ordnungsökonomie verpflichteten Sachverständigenrats freuten, gab es von Seiten der FDP und aus der Wirtschaft den erwartbaren Widerspruch. Für erneuten Diskussionsstoff in der kriselnden deutschen Ampelkoalition war damit gesorgt. Ungeachtet von der kurzfristigen Entwicklung dürfte das Reizthema Steuererhöhungen mittelfristig immer wieder einmal auf der Agenda auftauchen. Dies nicht nur in Deutschland, wie auch der abschliessende Blick auf die britischen Inseln zeigt. Dort dürften die Einkommenssteuergrenzwerte für Jahre eingefroren bleiben, was angesichts der massiven Teuerung einer drastischen (versteckten) Steuererhöhung gleichkommt.
Ein anderer möglicher Weg das oben dargestellte Trilemma der Niedrigwachstums-Ökonomie handzuhaben und gleichzeitig der Schuldenproblematik zu begegnen wäre es, einfach mit höheren Inflationsraten zu leben. Doch auch diese «Lösung» hätte Risiken und Nebenwirkungen, namentlich insbesondere eine schwache Währung und noch grössere Einkommens- und Vermögensungleichheit. Abschliessend bleibt festzustellen: Auch mit Blick auf Schuldenberge und das makroökonomische Trilemma gibt es wie so oft Ausnahmen von der Regel. Und so gibt es mit der Schweiz und dem angrenzenden Liechtenstein auch Länder, die den Dreiklang von tiefer Inflation, Vollbeschäftigung und soliden Staatsfinanzen bisher vereinen konnten und in Kombination mit einer starken Währung nach wie vor einen attraktiven Standort für Arbeit und Kapital darstellen.
1Jean-Baptiste Michau (2022): «The Trilemma for Low Interest Rate Macroeconomics»

Unseren Kundinnen und Kunden stehen wir jederzeit für Anliegen und Fragen zu ihren Portfolios zur Verfügung. Stellvertretend dafür fassen wir einmal pro Quartal die häufigsten Kundenfragen sowie die Antworten unserer Experten zusammen und geben Ihnen damit direkte Einblicke in unsere Vermögensverwaltung und Anlageberatung.
Geopolitik: Die US-Zwischenwahlen gingen knapper aus als erwartet – die «rote Welle» blieb aus. Was sind die Implikationen für Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte?
Kaiser Partner Privatbank: Der Wahlerfolg Joe Bidens lässt sich nicht kleinreden. Der US-Präsident musste nicht nur gegen die Wahlstatistik antreten, gemäss der die Präsidentenpartei bei Zwischenwahlen traditionell grössere Verluste verzeichnet. Auch seine historisch schwachen Beliebtheitswerte waren eine Bürde und die hohen Benzinpreise, die generell viel zu hohe Inflation und die schwächelnde Konjunktur eine zusätzliche Hürde. Dennoch konnten die Demokraten ihre Position im Senat verteidigen. Inklusive der Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris haben sie dort weiterhin die faktische Mehrheit. Gewinnen sie auch noch die Stichwahl in Georgia am 6. Dezember stünde es 51:49, dann hätten sie auch in den Ausschüssen die Oberhand. Das Repräsentantenhaus haben zwar die Republikaner erobert. Allerdings ist ihre Mehrheit dort viel niedriger als im Vorfeld der Wahlen erwartet beziehungsweise von den Wahlprognosen projiziert wurde. Zu den Wahlverlierern zählen Ex-Präsident Donald Trump (was ihn nicht von einer erneuten Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 abhielt), das Lager der «MAGA-Republikaner» und die sogenannten Wahlleugner. Letztere konnten in kei-
nem Bundesstaat den wichtigen Innenministerposten erobern, was für die nächsten Präsidentschaftswahlen ein schlechtes Omen gewesen wäre. Durchaus berechtigt wird das Ergebnis der Zwischenwahlen daher auch als «Sieg der Demokratie» gedeutet.
Die politische Unsicherheit dürfte nun kurzfristig erst einmal sinken. Andererseits: nach den Zwischenwahlen 2022 ist vor den Präsidentschaftswahlen 2024 – mit Blick auf die kommende Wahlschlacht ist auch ein geteilter Kongress nicht ohne Risiko. Erfolge bei der Inflationsbekämpfung oder die Vermeidung einer Rezession würden Bidens Chancen einer Wiederwahl erhöhen. Den Republikanern dürfte an echten Lösungen daher nicht viel gelegen sein, eher droht Obstruktionspolitik und ein wiederholtes Spiel mit dem Feuer beim Thema Schuldengrenze. Ihre eigene Agenda – beispielsweise Deregulierung von Wirtschaft und Energiesektor, mehr Geld für Militär, Polizei und Grenzsicherheit, gleichzeitig aber auch Ausgabenkürzungen – werden die Republikaner hingegen kaum vorantreiben können. Nur eines scheint sicher: Mit ihnen wird es keine (weiteren) Steuererhöhungen geben. Die effektiven Unternehmenssteuern dürften tief bleiben, was für die Gewinnmargen und Investoren marginal positiv ist. Die Demokraten wiederum werden weder beim sozialen Sicherheitsnetz einsparen noch Bidens bereits verabschiedete Gesetzesinitiativen beschneiden wollen. Das Defizit im US-Staatshaushalt dürfte vor diesem Hintergrund konstant hoch bleiben oder gar noch ansteigen. Eine Haushaltskonsolidierung ist im bevorstehenden «Gridlock»-Szenario jedenfalls nicht in Sicht.
Was bedeutet das Wahlresultat für die Finanzmärkte? Bei der Antwort auf diese Frage ist Vorsicht angebracht. Nicht nur weil die Wichtigkeit von Wahlen und Politik im Allgemeinen überbewertet wird, sondern auch weil die historische Analyse des Zusammenhangs verschiedener Machtkonstellationen im Kongress und damit verbundener Performance an den Märkten wenig über die Zukunft verrät. Mehr als die Farben rot, blau und lila in Washington, D.C. sind es nämlich Makro- (Wachstum, Inflation, Zinsen) und Mikrovariablen (Gewinne, Bewertungen), welche die Kurse bestimmen. Die unter vielen Anlegern herrschende Annahme, «Gridlock» sei positiv für den Aktienmarkt, gilt zwar seit der Ära von Ronald Reagan Anfang der 1980er Jahre, nicht aber für die von hoher Inflation geprägte Phase 1966 bis 1982. Wer zwingend eine Orientierung an historischen Schablonen benötigt, der sei an den Präsidentschaftszyklus verwiesen. Dieser sieht für das Aktienjahr nach den Zwischenwahlen bezie-
hungsweise vor den Präsidentschaftswahlen – unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Kongress – eine überdurchschnittliche Performance vor.
Tatsächlich ist es vor allem der Verlauf der Inflation in den nächsten Monaten und Quartalen, welcher den Aktienmarkt als Ganzes demnächst am stärksten beeinflussen dürfte. Die Pattsituation im US-Kongress ist diesbezüglich kurzfristig leicht disinflationär (kein neues Konjunkturprogramm), mittelfristig aber eher inflationstreibend (anhaltende Tendenz zu Ausgabensteigerungen). Der Job der Inflationsbekämpfung wie auch der Konjunkturankurbelung im Falle einer Rezession liegt damit bei der US-Notenbank. Mit Blick auf einzelne Branchen könnte die geteilte Regierung aber durchaus Gewinnern und Verlierer produzieren. Sektoren wie «schmutzige Energie» (v.a. Öl und Kohle) oder Pharma, die unter demokratischer Mehrheit mit grösseren regulatorischen oder legislativen Hindernissen konfrontiert gewesen wären, werden wahrscheinlich eine Gnadenfrist erhalten. Andererseits könnten Sektoren wie erneuerbare Energien oder Infrastruktur etwas an Momentum verlieren. Mehr aber auch nicht – denn bereits verabschiedete Gesetze wie der «Inflation Reduction Act» können von den Republikanern nicht rückgängig gemacht werden. Dafür fehlt ihnen die erforderliche Zweidrittelmehrheit.
Energie: Die Energiespeicher in Europa sind gut gefüllt und der kommende Winter scheint kein Problem mehr –droht dafür ein Gasengpass im Winter 2023/2024?
Kaiser Partner Privatbank: Dank des milden Herbstwetters und der erheblichen (und teuren) Bemühungen um Gasimporte in den letzten Monaten sind die Erdgasspeicher in Europa aktuell sehr gut und weit über der Norm gefüllt. EU-weit betrug der Füllstand Mitte November mehr als 95% der Kapazität, in Deutschland waren die Speicher fast zu 100% gefüllt. Für die komfortable Situation sorgte nicht zuletzt auch eine reduzierte Nachfrage. In Reaktion auf die hohen Preise haben Unternehmen und Haushalte Gas gespart, auf alternative Energiequellen gewechselt und/oder die Produktion reduziert. So hat die deutsche Industrie im Oktober beispielsweise 27% weniger Gas verbraucht als gewöhnlich. Da sich das Risiko von Gasknappheit im bevorstehenden Winter merklich verringert hat, sind auch die Erdgaspreise deutlich gefallen. Seit der Preisspitze von knapp 350 EUR/MWh Ende August sind sie um rund zwei Drittel zurückgegangen und haben sich oberhalb von 100 EUR/MWh stabilisiert. Für den Konjunkturausblick im Euroraum hat dies positive Konsequenzen: Die unvermeidliche Winterrezession wird weniger tief ausfallen (wir rechnen mit einem kumulativen Wachstumsrückgang zwischen -1% und -2% von Q4 2022 bis Q2 2023) und die Haushalte beziehungsweise Unternehmen benötigen etwas weniger Unterstützung (was die Staatshaushalte etwas entlastet).
So weit, so gut. Doch nach dem Winter 2022/2023 ist vor dem Winter 2023/2024. Unsere Szenarioanalyse für die übernächste Kältesaison zeigt, dass ein gewisses
Risiko für Gasknappheit bestehen bleibt – allerdings nur im nachteiligsten und unwahrscheinlichsten Szenario. Im Basisszenario eines (1) «normal» kalten Winters, (2) Gaseinsparungen bei Haushalten und Industrie von 10% bis 15% gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre und (3) weiterhin erhöhten beziehungsweise leicht steigenden (nicht-russischen) Gasimporten dürften die Erdgasvorräte in der EU im Frühling 2024 noch zu mehr als 60% gefüllt sein. Selbst wenn Russland den Gashahn in Richtung Westen komplett abstellen würde, dürfte die Vorratssituation unter diesen Voraussetzungen mit gut 40% immer noch beruhigend deutlich über den Minimum-Füllständen seit 2015 (rund 20%) sein. Die Risikoszenarien sehen hingegen einen überdurchschnittlichen kalten Winter und/oder stagnierende nicht-russische Importe (limitiertes Flüssiggasangebot) vor. Unserer Einschätzung nach dürfte es nur dann zu Engpässen und zur Notwendigkeit von Rationierungen kommen, wenn beide dieser nachteiligen Effekte zusammenkommen. Doch auch wenn der «worst case» wahrscheinlich ausbleibt – eines erscheint sicher: Die Zeiten des billigen Gases in Europa sind vorbei. Die Industrie wird sich in den kommenden Quartalen an die neue Realität anpassen müssen und der aus den hohen Energiepreisen resultierende inflationäre Druck dürfte noch eine Weile erhalten bleiben.
Komfortabel | Der kommende Winter ist (noch) kein Problem Füllstand der Erdgasspeicher in der Europäischen Union
100%
80%
60%
40%
20%
0
aktuell Durchschnitt 2015-2020 Maximum Minimum 10/2022 01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022
Quellen: AGSI, Kaiser Partner Privatbank
Geldpolitik: Wie weit werden die Notenbanken die Leitzinsen noch anheben?
Kaiser Partner Privatbank: Zwischen den aktuell noch sehr hohen Inflationsraten und den zunehmenden Konjunkturrisiken müssen die Notenbanken weiterhin einen schwierigen Balanceakt vollführen. Mit Leitzinsen von zuletzt 2% im Euroraum und 4% in den USA hat die Geldpolitik von EZB und Fed unserer Meinung nach bereits eine klar restriktive Wirkung. Die bisherigen Zinserhöhungen von 200 beziehungsweise fast 400 Basispunkten sind für viele Teilmärkte (Immobilien, Un-
ternehmensfinanzierung, etc.) ein Schock, der seine Wirkung naturgemäss nur mit Verzögerung entfaltet. In den letzten Wochen scheinen mehr und mehr Notenbanker diese Einschätzung zu teilen; es überwogen die Stimmen, die demnächst eine langsamere Gangart beim Drehen an der Zinsschraube befürworteten. Auch die Protokolle der letzten Notenbanksitzungen weisen in diese Richtung.
Rückgängige Inflationsraten würden es den Notenbanken erleichtern den von den Finanzmärkten erhofften «Pivot» einzuleiten. In den USA dürfte der Prozess der «Disinflation» längst im Gange sein. Die Teuerungsdaten für Oktober überraschten mit 7.7% (Erwartung: 8.0%) klar auf der Unterseite. Klammert man die volatilen Komponenten Energie und Nahrungsmittel sowie die träge Mietkomponente aus, dann gingen die Preise im Monatsvergleich sogar zurück. Es würde uns nicht überraschen, wenn die US-Teuerung auch in den kommenden Monaten überrascht und viel schneller zurückgeht als erwartet. Dafür sprechen neben dem berühmten «Basiseffekt» auch die fortgesetzte Entspannung in den Lieferketten, steigende Lagerbestände, eine sich abschwächende Nachfrage und die deutlich nachlassende Dynamik bei den Mietpreisen, welche sich ab dem Frühling auch in den Inflationszahlen zeigen dürfte. In der Eurozone wird der Inflationshöhepunkt indes zwar später erreicht, wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Monaten – allerdings ist eine Rezession hier bereits eine ausgemachte Sache und das wirtschaftliche Umfeld fragiler. Entsprechend ist auch für die EZB der Raum für noch höhere Zinsen begrenzt. Unter dem Strich sehen wir bei den zwei wichtigsten Notenbanken noch Potential für weitere Zinserhöhungen von 50 bis 100 Basispunkten. Damit sehen wir die finalen Leitzinsen im Frühling 2023 bei 2.5% bis 3% (EZB) beziehungsweise 4.5% bis 5% (Fed). Mit 1.5% bis 2% dürfte der Leitzins in der Schweiz auf einem etwas tieferen Niveau enden. Allerdings hat die SNB mit dem Schweizer Franken ein weiteres Werkzeug um dem Inflationsdruck zu begegnen und dürfte dieses aktiv einsetzen.
Die langsam, aber sicher vorsichtiger werdende Rhetorik der Notenbanken widerspiegelt sich auch an den Zinsmärkten. Dort sind die Erwartungen an den Zins-Höhepunkt seit dem sehr falkenhaften Auftritt von Fed-Chef Powell bei der letzten Notenbanksitzung am 2. November bereits deutlich gesunken. Schwieriger als die Frage nach dem Hochpunkt der Leitzinsen ist indes die Frage nach dem dann folgenden Zinspfad zu beantworten. Die Zinsmärkte erwarten für die zweite Hälfte 2023 bereits wieder Zinssenkungen und preisen damit einen geldpolitischen Fehler der Notenbanken ein, also eine zu forsche Gangart, welche bald wieder korrigiert muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist aus heutiger Sicht tatsächlich hoch. Wenn eine Rezession in den USA ausbleibt, könnten die Leitzinsen dort allerdings auch für längere Zeit auf deinem sehr restriktiven Niveau zwischen 4% und 5% verharren. Denn eine zu schnelle und konjunkturell nicht erforderliche Lockerung der Geldpolitik dürfte die Fed vermeiden wollen. Sie würde das Risiko einer Inflations-Schaukel wie in den 1970er Jahren nämlich deutlich erhöhen.
Aktien: Substanzaktien («Value») haben Wachstumsaktien («Growth») in diesem Jahr deutlich outperformt –wird sich dies 2023 fortsetzen?
Kaiser Partner Privatbank: Die Performancedifferenz zwischen Value und Growth seit Jahresbeginn ist beträchtlich. Während Substanzaktien gemessen am MSCI World Value Index zuletzt «nur» noch rund -10% im Minus liegen, beträgt der Abschlag bei Wachstumstiteln circa -25%. Grösster Treiber für die massive Growth-Underperformance in diesem Jahr sind die Zinsen. Noch vor einem Jahr wurden für 2022 von der US-Notenbank nur zwei kleine Zinserhöhungen von lediglich 25bp erwartet. Für den Euroraum wurde keine einzige Zinserhöhung eingepreist. Tatsächlich hat die Fed seitdem sechs Zinsschritte vorgenommen, darunter vier übergrosse von 75bp. Auch am langen Ende war die Zinsverschiebung massiv: Noch vor einem Jahr hatten ein Viertel aller Staatsanleihen eine negative Rendite, heute erhalten Anleger bei 10-jährigen Treasuries wieder rund 3.8% Zins und lediglich japanische Staatsanleihen weisen teils noch negative Renditen auf. Für die Bewertungen von Wachstumsaktien waren diese Bewegungen fatal. Denn die Umsätze und Gewinne, die bei Wachstumsunternehmen naturgemäss erst weit in der Zukunft realisiert werden (hohe Duration), müssen nun mit einem viel höheren Zinssatz abdiskontiert werden.
Doch auch darüber hinaus hat sich das Makroumfeld auf den Kopf gestellt. In den Jahren seit der Finanzkrise war «Growth» angesichts geringen nominalen Wirtschaftswachstums (und tiefer Inflation) sowie niedrigen Gewinnwachstums in anderen Sektoren überdurchschnittlich attraktiv. Hier waren die Gewinnzuwächse ausserordentlich hoch, insbesondere in den USA. Auch die tiefen Kapitalkosten waren ein positiver Treiber und haben die Bewertungen von Aktien mit langer Durati-
on überproportional nach oben getrieben. Traditionelle «Value»-Sektoren verspürten derweil Gegenwind (beispielsweise strengere Regulierung bei Banken oder fallende Rohstoffpreise bei Rohstoffunternehmen). Attraktiv aussehende Dividenden wurden so zu «Value Traps». Heute stellt sich das Makrobild gänzlich anders dar. Das nominale Wirtschaftswachstum ist (aufgrund hoher Inflation) hoch und die Gewinne von klassischen Substanzaktien sind stark, während sie bei grossen Tech-Unternehmen enttäuschen. Die Kapitalkosten sind merklich angestiegen. Aus «Value Traps» werden nun «Value-Opportunitäten», da höhere Zinsen und Rohstoffpreise in hohen Gewinnen, hohem Free Cashflow und letztlich attraktiven, zuverlässigen Dividenden resultieren. Sektoren mit direktem Bezug zu Inflation (Rohstoffe) oder Profiteure höherer Zinsen (Banken) haben zuletzt entsprechend gut performt.

Wie geht es nun weiter? Eine Rückkehr zum Nach-Finanzkrisenumfeld wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Die ultralockere Geldpolitik dürfte nicht schnell wiederkehren und die Inflation selbst im positiven Szenario oberhalb der von den Notenbanken anvisierten 2%-Marke verharren. Auch ein dauerhaftes Comeback der Einzigartigkeit von «Growth» ist daher nicht realistisch. Allerdings heisst dies nicht, dass Wachstumsaktien künftig dauerhaft underperformen werden. Für die taktische Perspektive sind es einmal mehr die (Langfrist-)Zinsen, welche mit Blick auf 2023 entscheidenden Einfluss haben werden. Mit Blick auf unsere weiter oben gegebenen Einschätzungen zu den Anleiherenditen (Hochpunkt möglicherweise bereits erreicht) und den Leitzinserwartungen («Pivot» der Notenbanken in Sicht), dürfte der Druck auf die Bewertungen im Wachstumssegment deutlich nachlassen. Sollte die Fed im Falle eines sich rapide eintrübenden Wirtschaftsumfelds schon im zweiten Halbjahr 2023 zurückrudern und die Leitzinsen senken, wäre zumindest ein kurzzeitiges Revival des GrowthStils denkbar.
Langfristig orientierte Anleger sollten künftig dennoch nicht mehr allein durch die Wachstums-Brille schauen beziehungsweise binär zwischen «Growth» und «Value» unterscheiden. In Zeiten höherer Zinsen wird Umsatzwachstum nicht nur weniger wertvoll, höheres Wirtschaftswachstum macht es zugleich weniger selten. Gleichzeitig drücken höhere Inputkosten (Energie und Arbeitskraft) auf die Margen. Gefragt sind daher Unternehmen, die nachhaltig jahrein, jahraus Umsätze und Gewinne steigern können. Im Vordergrund stehen künftig Qualitäten wie hohe, stabile Margen, solide Unternehmensbilanzen und konstantes Dividendenwachstum. Auch der Diversifikation kommt künftig wieder grössere Bedeutung zu. Nachdem Investitionen ausserhalb von US-Tech im letzten Jahrzehnt tendenziell eher Rendite gekostet haben, dürfte sich regionale und sektorale Diversifikation im neuen makroökonomischen Umfeld der Zukunft wieder auszahlen.
Ein ungewohntes Bild | «Growth» liegt 2022 deutlich hinten MSCI World Value vs. MSCI World Growth
110
100
90
80
70
60
11/2022 01/2022 03/2022 05/2022 07/2022 09/2022
MSCI World Value MSCI World Growth
Quellen: Bloomberg, Kaiser Partner Privatbank
Erfahren Sie mehr auf unserem Blog: Sie möchten stets auf dem aktuellen Stand sein? Dann melden Sie sich zu unserem Newsletter an oder folgen Sie uns auf Linkedin.
Performance per 30. November 2022
Anlageklassen seit Jahresbeginn
1 Monat 1 Jahr 3 Jahre Liquidität
CHF 0.0% -0.2% -1.6%
Festverzinsliche Anlagen
-0.2% 0.2% 1.9% 0 -10.9% -17.0% 1.8% -14.8% -9.8% -18.5% -4.1% -17.1% 0 -11.5% -14.0% -9.2% 8.7% -14.8% -21.1% 0 17.0% -3.3% -16.4% -4.5% 0 -8.5% -5.2% -10.9% Monthly Market Monitor - Dezember 2022 | Kaiser Partner Privatbank AG 20
EUR 0.2% 0.2% -0.8% USD 0.4% 1.9% 2.9%
Staatsanleihen 1.9% -11.7% -9.4% Unternehmensanleihen 5.4% -16.8% -10.4% Mikrofinanz 0.3% 2.3% 7.6%
Inflationsbasierte Anleihen 2.7% -15.9% -1.7% Hochzinsanleihen 2.2% -7.9% 0.6% Schwellenländeranleihen 7.9% -17.3% -13.8% Versicherungsbasierte Anl. 1.5% -3.7% 7.2% Wandelanleihen 3.2% -17.3% 20.7% Aktien
Global 5.7% -8.0% 27.5% Schweiz 2.7% -8.7% 9.1% Europa 8.4% -4.7% 11.0% Grossbritannien 7.1% 13.9% 15.8% USA 5.4% -11.5% 33.8%
Schwellenländer 14.6% -19.8% -6.5% Alternative Anlagen
Rohstoffe 2.4% 21.1% 50.5% Gold 8.3% -0.3% 20.8% Immobilien Schweiz 1.6% -13.2% 0.5% Hedgefonds 0.0% -4.0% 7.1% Währungen
17.0% -3.3% -16.4% -4.5% 0 -8.5% -5.2% -10.9%
-0.2% 0.2% 1.9% 0 -10.9% -17.0% 1.8% -14.8% -9.8% -18.5% -4.1% -17.1% 0 -11.5% -14.0% -9.2% 8.7% -14.8% -21.1% 0 17.0% -3.3% -16.4% -4.5% 0 -8.5% -5.2% -10.9%
-0.2% 0.2% 1.9% 0 -10.9% -17.0% 1.8% -14.8% -9.8% -18.5% -4.1% -17.1% 0 -11.5% -14.0% -9.2% 8.7% -14.8% -21.1% 0 17.0% -3.3% -16.4% -4.5% 0 -8.5% -5.2% -10.9%
-0.2% 0.2% 1.9% 0 -10.9% -17.0% 1.8% -14.8% -9.8% -18.5% -4.1% -17.1% 0 -11.5% -14.0% -9.2% 8.7% -14.8% -21.1% 0 17.0% -3.3% -16.4% -4.5% 0 -8.5% -5.2% -10.9%
Vom Einzelhandel erfundene «Feiertage» gibt es reichlich. In die Kategorie «unnützes Wissen» gehört der «Green Monday». Der zweite Montag im Dezember hat stets mindestens zehn Tage Abstand zum Heiligabend und galt einst als letzter Tag, an dem eine Online-Bestellung sicher unter dem Weihnachtsbaum landete.
15. Dezember: Geldpolitische Lagebeurteilung der SNB
Im globalen Zinserhöhungswettlauf der Notenbanken dürfte die Schweizerische Nationalbank im Dezember nachziehen – alles andere als ein Zinsschritt von mindestens 50 Basispunkten wäre eine Überraschung. Doch alles ist relativ – und im internationalen Vergleich bleibt das Zinsniveau in der Schweiz relativ niedrig.
31. Dezember: Silvester




Überdurchschnittliche Inflation, unterdurchschnittliche Anlagerenditen, geopolitische Unsicherheiten und konjunkturelle Bremsspuren – das Jahr 2022 dürften viele nur zu gern abhaken. Wir wünschen allen Lesern einen guten Rutsch und blicken mit Optimismus ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!


Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse oder Werbung dar, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Die darin enthaltenen Informationen begründen kein Angebot oder eine Empfehlung seitens der Kaiser Partner Privatbank AG zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes oder zu anderen Handlungen bezogen auf diese, und stellen auch keine Anlageberatung dar. Allfällige Hinweise auf die frühere Performance garantieren keine positiven Entwicklungen in der Zukunft. Kaiser Partner Privatbank AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig und aktuell sind, noch für allfällige Verluste oder Schäden, die durch den Gebrauch dieser Informationen verursacht werden. Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes ist immaterialgüterrechtlich, insbesondere urheberrechtlich, geschützt. Die vollständige oder teilweise Verwendung, unabhängig ihrer Art und Mittel, für öffentliche oder kommerzielle Zwecke, ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung seitens Kaiser Partner Privatbank AG untersagt.
Herausgeberin: Kaiser Partner Privatbank AG Herrengasse 23, Postfach 725 FL-9490 Vaduz, Liechtenstein HR-Nr. FL-0001.018.213-7
T: +423 237 80 00, F: +423 237 80 01 E: bank@kaiserpartner.com
Redaktion: Oliver Hackel, Senior Investment Strategist Roman Pfranger, Head Private Banking & Investment Solutions
Design & Druck: 21iLAB AG, Vaduz, Liechtenstein