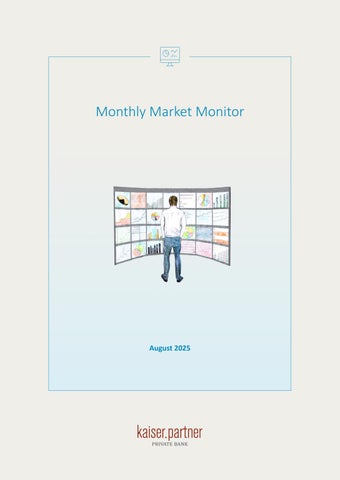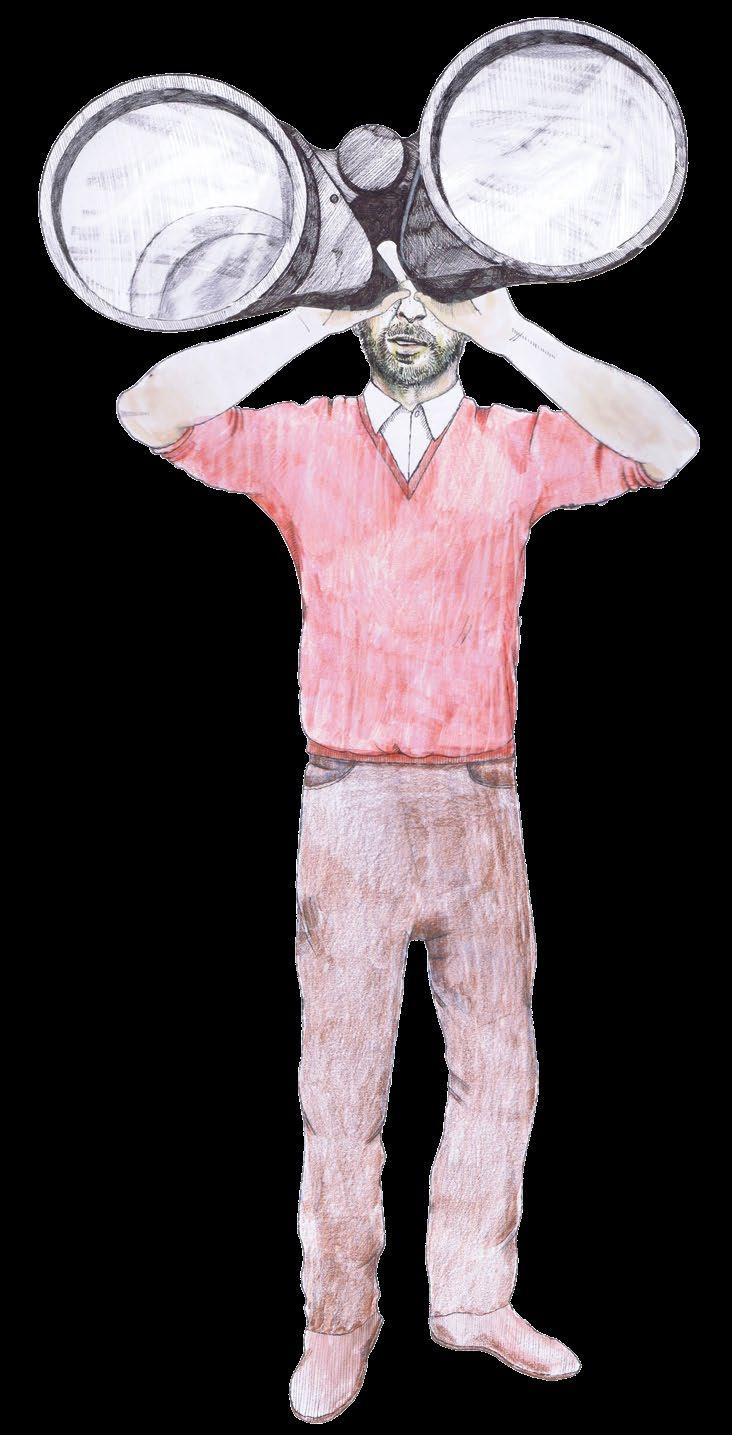Anlagestrategie
Notizen vom Investment-Komitee
Aktien
Fixed Income Global
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Mikrofinanz
Schweiz
Europa
Grossbritannien
Inflationsbasierte A. USA
Hochzinsanleihen
Schwellenländeranleihen
Versicherungsbasierte A.
Japan
Schwellenländer
Alternative Anlagen
Wandelanleihen Gold
Laufzeiten
Währungen
07/2025
Hedgefonds
Strukturierte Produkte
US-Dollar Private Equity
Schweizer Franken Private Credit
Euro Infrastruktur
Britisches Pfund
Aktien: Meme-Stock-Manie 2.0
• US-Aktien entwickelten sich auch im Juli positiv. Seit dem Tiefpunkt im April konnten sie in der Spitze knapp 30 % zulegen. Unter der bereits sehr soliden Oberfläche ging es aber noch rasanter (und spekulativer) zu. Sogenannte Micro-Caps (mit einer Marktkapitalisierung kleiner als 300 Millionen US-Dollar) stiegen seiher um rund 40 %, unprofitable Tech-Aktien gar um 70 %. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem das spekulative Interesse von US-Kleinanlegern, welches fast schon mit der Meme-Stock-Manie im Jahr 2021 (Stichwort: GameStop Short-Squeeze) vergleichbar ist. Auch in den letzten Wochen gab es bei Aktien fragwürdiger Qualität (u.a. Kohl’s, GoPro, Krispy Kreme) heftige Kursbewegungen. Als Timing-Signal für ein sofortiges Ende der Aktienrally taugen die Anzeichen einer spekulativen Blase nicht. Sie sind aber ein Warnsignal und geben Anlass bei den Renditeerwartungen auf Sicht von 12 – 24 Monaten etwas konservativer zu werden.
• In der Berichtssaison für das 2. Quartal überraschten bisher rund drei Viertel der US-Unternehmen positiv. Im Grunde genommen läuft diese „Earnings Season“ aber so ab wie es schon zur Gewohnheit geworden ist. Denn zuvor wurden die Gewinnerwartungen und somit die Hürde für positive Überraschungen von den Analysten deutlich gesenkt. Unter Ausklammerung der „Magnificient 7“ wurde für den Rest des S&P 500 Index gar nur ein Ge-
Immobilien
Scorecard
Konjunktur
Geld- und Fiskalpolitik
Unternehmensgewinne Bewertung
Trend
Anlegerstimmung
07/2025
07/2025
winnwachstum von 1 % erwartet. Allerdings waren die besser als erwarteten Zahlen nach der jüngsten Rally bereits zum grossen Teil eingepreist. Entsprechend bestraft wurden zuletzt jene Unternehmen, die zu wenig Gewinn lieferten. Negative Gewinnüberraschungen führten am Tag der Ergebnisveröffentlichung relativ zum Gesamtmarkt zu Kursverlusten von im Schnitt –5 %. Wie immer sind die Augen der Analysten in der Berichtssaison bereits auch nach vorn gerichtet. Diesbezüglich gibt es mit Blick auf die noch nicht gänzlich verzogene Unsicherheit über die Auswirkungen der US-Handelspolitik und den schwächelnden US-Konsum in einigen Branchen vereinzelte Schlechtwetterwolken.
• Schwellenländeraktien sind seit Jahresbeginn überproportional gestiegen und liegen mehr als 5 % vor dem MSCI-Welt-Index. Aus unserer Sicht muss dies noch nicht das Ende der Fahnenstange sein – einige Argumente sprechen für auch künftige überdurchschnittliche Performance (und ein leichtes
Wie immer sind die Augen der Analysten in der Berichtssaison bereits auch nach vorn gerichtet.
Der anhaltende Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank erzeugt am Anleihemarkt derweil nur noch ein müdes Gähnen, aber keine Kursreaktionen mehr.
Übergewicht in unserer taktischen Asset Allocation). Allein seit 2021 haben Schwellenländer massiv underperformt und relativ rund 50 % schlechter abgeschnitten als Industrieländer, insbesondere China gilt für viele institutionelle Anleger inzwischen als strukturelles Untergewicht. Auch ein weiterhin tendenziell schwächerer US-Dollar und die Aussicht auf US-Zinssenkungen sprechen für einen positiven Ausblick. Bezüglich China sind die schlechten Nachtrichten eingepreist, während positive Entwicklungen ausgeblendet werden. Nicht zuletzt sind Schwellenländeraktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 × noch immer günstig bewertet.
Anleihen: In ruhigeren Fahrwässern
• Der Anleihemarkt ist in den letzten Wochen in ruhigeres Fahrwasser eingekehrt. Der Move-Index –ein Indikator für die erwarteten Schwankungen bei US-Staatsanleihen – ist seit dem Kursgewitter rund um den „Liberation Day“ Anfang April von 140 Punkten auf unter 90 Punkten gefallen. Die Rendite für 10-jährige US-Treasuries pendelte im Juli nur noch zwischen 4.2 % und 4.5 %. Damit hat sie sich auch deutlich vom Jahreshoch aus dem Januar (4.8 %) und der 5 %-Schallmauer entfernt. Letztere galt für manchen Marktbeobachter als Marke, die bei Überschreiten eine Kurskorrektur der Trump-Regierung ausgelöst hätte. Diese Kurskorrektur blieb bisher aus – inzwischen hat der US-Präsident den „One Big, Beautiful Bill“ unterschrieben und die US-Staatsschulden auf einen noch weniger nachhaltigen Pfad geschickt. Der anhaltende Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank erzeugt am Anleihemarkt derweil nur noch ein müdes Gähnen, aber keine Kursreaktionen mehr. Entscheidend für die künftige Tendenz bei den Anleiherenditen werden die klassischen Treiber Wachstum, Inflation und Geldpolitik sein. Aktuell halten sich diese Faktoren in etwa die Waage, so dass ein fortgesetzte Seitwärtstendenz in nächster Zeit nicht ungewöhnlich wäre. Auf Sicht von 6 – 12 Monaten steigen allerdings die Chancen auf tiefere Leitzinsen der Fed – ob mit oder ohne Druck, einfach weil es die Fundamentaldaten erlauben und erfordern. Auch die langfristigen Renditen dürften daher auf mittelfristige Sicht eher sinken.
Alternative Anlagen: Bitcoin auf neuem Hoch
• Auch beim Goldpreis ist in den letzten Wochen Ruhe eingekehrt. Die Pendelbewegung mit immer kleineren Preisausschlägen könnte sich aus charttechnischer Sicht demnächst aber als trendbestätigende Flagge nach oben auflösen. Die derzeitige Verschnaufpause ist nicht ungewöhnlich und durchaus gesund. Mehr Bewegung gab es im Juli bei den Kryptowährungen. Der Bitcoin-Kurs markierte ein neues Allzeithoch oberhalb von 120‘000 US-Dollar, überdurchschnittlich zulegen konnten indes alternative Coins wie Ether und Ripple. Die Kryptos folgen damit weiterhin dem Pfad, den die Expansion der Geldmenge M2 vorgibt – nach oben. Als Warnsig-
nal muss dennoch betrachtet werden, dass immer mehr Unternehmen dem Beispiel des US-Unternehmens Strategy (zuvor: MicroStrategy) folgen und Bitcoins oder andere Kryptowährungen kaufen, um den Unternehmenswert zu steigern. Es wird sich in den nächsten 1 – 2 Jahren zeigen, ob diese Art der Mittelverwendung nicht doch ein Anzeichen von Exzess und Spekulation ist. Genau mit diesen Anzeichen für erhöhte Spekulation, die wie oben erwähnt auch am US-Aktienmarkt zu beobachten sind, hatten viele marktneutrale Aktienstrategien in den vergangenen Woche Probleme. Diese setzen in der Regel darauf, dass sich die Aktien von fundamental starken Unternehmen langfristig besser entwickeln als die schwächere Konkurrenz. Einen Teil der aufgelaufenen Gewinne seit Jahresbeginn mussten sie zuletzt wieder abgeben.
Währungen: US-Dollar mit (temporärem) Boden?
• EUR / USD: Der Aufwärtstrend bei EUR / USD hat Anfang Juli bei 1.18 USD vorübergehend eine Pause eingelegt. Für Gewinnmitnahmen sorgte zuletzt insbesondere der asymmetrische Handelsdeal mit den USA. Der zu erwartende Wachstumsdämpfer könnte die EZB in den kommenden Monaten zu einer weiteren Zinssenkung veranlassen, was den Zinsnachteil des Euros vergrössern würde. Bisher ist der jüngste Kursrückgang aber als gesunde Korrektur zu betrachten. Ein Anlauf auf die Marke von 1.20 USD scheint in der zweiten Jahreshälfte durchaus möglich. Auf diesem Level dürften die Bauchschmerzen bei einigen EZB-Vertretern dann aber zunehmen.
• GBP / USD: Auch gegenüber dem britischen Pfund konnte der US-Dollar im letzten Monat aufwerten –und auch hier ist diese Entwicklung zunächst einmal nur als technische Gegenbewegung zu werten. Dies insbesondere, weil das Pfund im Gegensatz zum Euro gegenüber dem Greenback keinen Zinsnachteil hat. Die Tatsache, dass Grossbritannien mit den USA offensichtlich einen besseren Deal verhandelt hat (Basiszoll 10 % anstatt 15 %), dürfte den Währungskurs langfristig hingegen nicht nachhaltig beeinflussen. Auch bei GBP / USD sehen wir langfristig noch Potential für höhere Kurse.
• EUR / CHF: Auch im Juli bewegte sich der EUR / CHFKurs in einer äusserst engen Bandbreite von kaum mehr als 50 Basispunkten. Der Schweiz dürfte es kaum gelingen einen deutlich besseren Handelsdeal als konkurrierende Exportländer zu schmieden. Da sich der relative Vor- oder Nachteil somit kaum verändern dürfte, ist auch auf den Franken kein nennenswerter Einfluss zu erwarten. Relevanter ist die Erkenntnis, dass die SNB nur im äussersten Notfall auf Negativzinsen zurückgreifen wird. Die Gravitationskraft bei EUR / CHF dürfte auch in den kommenden Monaten gross bleiben.
Der US-Dollar hat seit Jahresbeginn stetig an Boden verloren und inzwischen gemessen am US-DollarIndex mehr als 10 % abgewertet – in den vergangenen 50 Jahren war er zur Mitte des Jahres selten schwächer. Zwar war der Dollar seit Langem überbewertet und reif für eine Korrektur, ein solches Ausmass an Schwäche hatten aber die wenigsten Analytiker auf dem Prognoseschirm. Insbesondere Währungsmodelle, die auf Zinsdifferenzen basieren, haben in den letzten Monaten versagt. Trotz hohen Zinsvorteils war der Greenback unter Druck. Was in den meisten Prognosemodellen fehlte, war die Komponente Trump: Ergänzt man Regressionsmodelle um Variablen für handelspolitische Unsicherheit, lässt sich die Dollarabwertung gut erklären. US-Präsident Trump hat sich seinen Wunsch nach einem schwachen Dollar somit selbst erfüllt und anhaltend Freude am Resultat. Denn (O-Ton Trump): „Now it doesn’t sound good, but you make a hell lot of more money with a weaker dollar – not a weak dollar, but a weaker dollar”. Tatsächlich ist der Greenback trotz der jüngsten Verluste noch nicht wirklich schwach oder gar unterbewertet. Bisher haben die präsidialen Manöver allein zu einer überfälligen – wenn auch unkonventionellen – Korrektur vorhandener Ungleichgewichte am Währungsmarkt geführt.
Chart unter der Lupe
Gewünscht und geliefert | Trump beschert sich einen schwachen Dollar US-Dollar-Index seit Jahresbeginn
Quellen: Bloomberg, Kaiser Partner Privatbank
Der Unterschied zur Zahnmedizin liegt darin, dass der Markt sich nicht an präzise Regeln hält, sondern den Launen der Wahrscheinlichkeit folgt.
Thema im Fokus
Im Schatten der Wahrscheinlichkeiten –Wie Zufall die Finanzwelt prägt
Zufall, Glück und unvorhersehbare Ereignisse beeinflussen unser Leben oft viel stärker als wir wahrhaben wollen. Im Rückblick wirkt vieles logisch und folgerichtig, doch unser Blick ist trügerisch. Wir blenden die grosse Zahl der Gescheiterten aus und suchen bei den Erfolgreichen nach Mustern, wo oft nur Glück war. Während achtbarer Erfolg häufig auf Können beruht, ist spektakulärer Erfolg nicht selten das Ergebnis einmaliger, nicht wiederholbarer Umstände.
Warum Finanzprofis keine Zahnärzte sind In der Zahnmedizin hängt der Erfolg fast ausschliesslich vom Können der Behandelnden ab. Wer einen kariösen Zahn entfernt, arbeitet mit präzisen Werkzeugen, unter kontrollierten Bedingungen und nach erprobten Verfahren. Ursache und Wirkung stehen hier in einem klaren Zusammenhang. Der medizinische Eingriff führt –bei korrekter Anwendung – zu einem vorhersehbaren, messbaren Resultat. Noch dazu lässt sich dieses Resultat unter den gleichen Bedingungen immer wieder erzielen. Im Finanzwesen hingegen liegt die Sache anders. Auch hier gibt es Expertise, Methoden, Modelle und Werkzeuge, doch das Ergebnis finanzieller Entscheidungen ist selten linear oder direkt kontrollierbar. Selbst fundierte Strategien können scheitern, während waghalsige Manöver zu Gewinnen führen können. Der Unterschied zur Zahnmedizin liegt darin, dass der Markt sich nicht an präzise Regeln hält, sondern den Launen der Wahrscheinlichkeit folgt. Kurz: Finanzprofis operieren in einem Umfeld, das stark vom Zufall geprägt ist. Nassim Nicholas Taleb, Mathematiker, Fondsmanager und Autor, bringt dieses Spannungsfeld provokant auf
Schlechter als die Benchmark | Fondsmanager scheinen den Markt nicht schlagen zu können
Anteil aktiver Large-Cap-Aktienfonds (USA), die den S&P 500 nicht schlagen konnten
den Punkt: Viele Erfolge an den Märkten sind nicht Ausdruck überlegenen Könnens, sondern bloss das Produkt von Glück. Der Unterschied ist nur schwer zu erkennen und wird in der Rückschau oft falsch interpretiert. Diese Perspektive rüttelt am Selbstverständnis vieler Finanzprofis und stellt den Mythos vom „Marktbesieger“ infrage. Was, wenn viele dieser Ikonen lediglich zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren?
Wenn Glück wie Können aussieht… Kurzfristige Erfolge im Finanzbereich werden oft als Beweis für Genialität gewertet. Doch das kann täuschen. Denn auch Zufallstreffer sehen im Rückblick meist aus wie kluge Entscheidungen. Der Erfolg wird damit zur Geschichte und nicht zur objektiven Messlatte. Ein markantes Beispiel ist die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende. Zahlreiche Fondsmanager, die auf Technologieaktien setzten, galten als visionär. Ihre Fonds erzielten spektakuläre Renditen, was sie zu medial gefeierten Stars machte. Doch als die Blase platzte, stellte sich heraus: Viele von ihnen hatten nicht strategisch gehandelt, sondern waren einfach dem Trend gefolgt. Der Erfolg war weniger das Ergebnis überlegener Kompetenz als vielmehr das Produkt günstiger Umstände. Auch die SPIVA Scorecard von S&P Dow Jones Indices zeigt regelmässig, dass die meisten aktiv gemanagten Fonds den Markt langfristig nicht schlagen. Trotzdem werden kurzfristige Ausreisser schnell als Beleg für besondere Fähigkeiten gefeiert. Hier hilft ein simples Gedankenexperiment: Was wäre, wenn wir unser Leben tausendmal durchspielen könnten? In stabilen Berufen wie der Zahnmedizin würde das Ergebnis meist ähnlich aussehen – vergleichbares Einkommen, ähnlicher Lebensstil. In Berufen mit hohem Risiko, etwa als Unternehmer oder Trader, wären die Ergebnisse dagegen extrem unterschiedlich. Einige Leben enden im Reichtum, andere im Ruin. Genau diese Spannbreite macht sichtbar, wie stark das Ergebnis vom Zufall geprägt ist. Wer sich in einem Umfeld mit grosser Ergebnisstreuung bewegt, sollte sich bewusst sein, dass spektakuläre Erfolge häufig Glücksprodukte sind.
…und Können wie Glück
Und doch neigen wir dazu, Erfolge vor allem unserem eigenen Können zuzuschreiben, während wir Misserfolge gerne als Pech verbuchen. Diese selektive Sichtweise ist menschlich, führt aber zu gefährlichen Fehlschlüssen. Denn wer ausschliesslich das Ergebnis betrachtet, ignoriert den eigentlichen Kern einer Entscheidung: Den Prozess, der zu ihr geführt hat. Wirklich beurteilen lässt sich eine Entscheidung nur im Hinblick auf die Informationen, Wahrscheinlichkeiten und Risiken, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung bekannt waren. Auch eine kluge Entscheidung kann zu einem schlechten Ergebnis führen. Und umgekehrt kann ein fragwürdiger Entschluss durch Zufall belohnt werden. Hinzu kommt: Entscheidend ist nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch der Zeitraum, über den es betrachtet wird. Nehmen wir einen exzellenten Investor, der ein durchdachtes Portfolio mit einer erwarteten Jahresrendite von 15 % und einer Volatilität von 10 % aufstellt. Könnte man dieses Portfolio über 100 unterschiedlich verlaufende Jahre hinweg beobachten, so würden etwa 95 dieser Jahre mit einer Rendite zwischen minus 5 % und plus 35 % enden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Portfolio in einem beliebigen Jahr tatsächlich positiv abschneidet, liegt sogar bei rund 93 % – ein ausgesprochen optimistisches Szenario. Doch das Bild ändert sich dramatisch, wenn man den Betrachtungszeitraum verkleinert. Stellen wir uns dieses Portfolio auf einem modernen Trading Desk vor, mit sechs Bildschirmen und blinkenden Kursen in Echtzeit. In einem Zeitfenster von einer einzigen Sekunde ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Portfolio ein positives Ergebnis zeigt, plötzlich kaum noch von einem Münzwurf zu unterscheiden. Genauer gesagt: Die Chance auf ein „Plus“ in genau diesem Moment liegt bei gerade einmal 50.02 %.
Das bedeutet: Je kürzer der Betrachtungshorizont, desto dominanter wird der Zufall. Und je dominanter der Zufall, desto geringer ist der Informationswert dessen, was wir gerade sehen. Wer sein Urteil zu früh fällt oder zu sehr auf kurzfristige Schwankungen starrt, läuft Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, obwohl die zugrunde liegende Strategie langfristig solide ist. Gerade hier liegt ein oft unterschätzter Vorteil von Anlagen im Bereich Private Markets. Diese Investments werden nicht sekündlich bewertet, ihre Preise erscheinen nicht auf blinkenden Bildschirmen, und sie fordern keine ständige Reaktion auf Marktgeräusche. Das Fehlen kurzfristiger Kurse kann für viele Anleger, insbesondere für jene, die dazu neigen, impulsiv zu handeln und sich durch überhastete Reaktionen selbst zu schaden, ein Segen sein.
Zeit ist der beste Investor | Erfolg braucht Geduld Erfolgswahrscheinlichkeit über verschieden Zeiträume (Anlagestrategie mit Rendite 15 % und Volatilität 10 %)
Quellen: Nassim Nicholas Taleb, Kaiser Partner Privatbank 1
Verliere niemals Geld | Verluste wiegen schwerer als Gewinne Asymmetrisches Profil von Renditen
Erholungsrendite
Quelle: Kaiser Partner Privatbank
Asymmetrie: Warum 50 % Minus schwerer wiegt als 50 % Plus Ein häufig unterschätzter Faktor im Umgang mit Risiko ist die Asymmetrie zwischen Verlusten und Gewinnen. Fakt ist: Wer fünfzig Prozent seines Kapitals verliert, muss danach einhundert Prozent Gewinn erzielen, um lediglich wieder auf den Ausgangswert zurückzukehren. Der Weg nach unten ist kurz und steil, der Wiederaufstieg hingegen lang und beschwerlich. Diese Asymmetrie ist nicht nur mathematisch relevant, sondern auch emotional und strategisch entscheidend. Verluste sind nicht nur finanziell, sondern auch emotional schwerer zu verkraften. Sie führen häufig zu irrationalen Entscheidungen, etwa dem vollständigen Ausstieg aus dem Markt zur falschen Zeit. Wer Vermögen aufbauen will, muss nicht nur auf Chancen achten, sondern auch auf den Preis des Scheiterns. Wohl kaum ein Investor versteht diesen Grundsatz besser als das Orakel von Omaha – Warren Buffett. Eines seiner bekanntesten Zitate bringt es auf den Punkt: „Regel Nummer 1: Verliere niemals Geld. Regel Nummer 2: Vergiss niemals Regel Nummer 1.“
Fakt ist: Wer fünfzig Prozent seines Kapitals verliert, muss danach einhundert Prozent Gewinn erzielen, um lediglich wieder auf den Ausgangswert zurückzukehren.
Extremrisiko | unwahrscheinliche aber fatale Ereignisse
Asymmetrische Ergebnisse
Ereignis Wahrscheinlichkeit Ergebnis Erwartungswert
A
Quellen: Nassim Nicholas Taleb, Kaiser Partner Privatbank
Positiver Marktausblick | negativer Erwartungswert
Erwartungswertanalyse
Ereignis Wahrscheinlichkeit Ergebnis Erwartungswert
Quellen: Nassim Nicholas Taleb, Kaiser Partner Privatbank
Viele Entscheidungen wirken auf den ersten Blick harmlos, weil sie mit sehr hoher Eintrittswahrscheinlichkeit zu einem kleinen Gewinn führen.
Beim Thema Risiko wird neben der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses oft die Wucht seiner möglichen Auswirkungen unterschätzt. Viele Entscheidungen wirken auf den ersten Blick harmlos, weil sie mit sehr hoher Eintrittswahrscheinlichkeit zu einem kleinen Gewinn führen. Doch wenn selbst ein extrem unwahrscheinlicher Ausgang mit einem dramatisch negativen Ergebnis verbunden ist, kann das den Erwartungswert kippen. Die Entscheidung wird dann erst im Nachhinein als offensichtlich fatal entlarvt. Ein einfaches Beispiel macht das deutlich: Stellen wir uns ein Szenario vor, in dem man mit einer Wahrscheinlichkeit von 999 zu 1000 einen kleinen Gewinn von einem Dollar erzielt (Ereignis A). Klingt erstmal vernünftig, doch der Haken: in dem einen verbleibenden Fall droht ein Verlust von zehntausend Dollar (Ereignis B). Obwohl das Risiko verschwindend gering erscheint, ergibt sich ein durchschnittlicher Erwartungswert von minus neun Dollar und eine Entscheidung, die langfristig Vermögen vernichtet. Gerade in der Finanzwelt, in der komplexe Risiken oft nur in Form von Wahrscheinlichkeiten kommuniziert werden, ist diese Art der Asymmetrie besonders tückisch. Sie führt dazu, dass Risiken, selbst wenn sie existenzielle Auswirkungen haben, unterschätzt werden, wenn sie selten auftreten. In der Sprache der Statistik zählt nicht nur, wie oft etwas geschieht, sondern vor allem, was passiert, wenn es geschieht.
Bullen und Bären
Diese Art der asymmetrischen Risikoverteilung ist kein theoretisches Konstrukt, sondern spiegelt sich in einer realen und oft missverstandenen Problematik wider: Die Frage, ob man sich für einen Bullen- oder Bärenmarkt positionieren sollte. Oder lapidar gesagt: Geht der Markt nach oben oder unten? Auf den ersten Blick erscheint es logisch, sich entsprechend der eigenen Markterwartung zu positionieren. Wer davon ausgeht, dass der Markt steigen wird, wird geneigt sein, auch entsprechend optimistisch zu investieren. Doch diese Herangehensweise greift zu kurz. Entscheidend ist nicht nur, wie wahrscheinlich ein Szenario ist, sondern auch, wie gravierend dessen Auswirkungen sein können. Ein einfaches Zahlenbeispiel zeigt das Dilemma. Angenommen, der Markt steigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % um 1 %. Gleichzeitig besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30 %, dass er um 10 % fällt. Auch wenn die überwiegende Meinung bullisch ist, ergibt sich daraus ein negativer Erwartungswert von -2.3 %. Die Statistik zeigt klar: In diesem Fall ist eine defensive, also bärische Positionierung langfristig sinnvoller, selbst wenn das Basisszenario auf steigende Kurse hindeutet.
Ähnlich wie im vorherigen Beispiel mit den Ereignissen A und B ist auch hier die Meinung, dass der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen wird. Trotzdem ist es unter Umständen sinnvoll, sich gegen den Markt zu positionieren. Denn wenn der weniger wahrscheinliche Fall eintritt und der Markt fällt, kann dieser Rückgang heftig ausfallen. Die Verluste in diesem Szenario sind so gravierend, dass sie die moderaten Gewinne in den übrigen Fällen deutlich überwiegen. Viele Anleger fokussieren sich zu sehr auf die Wahrscheinlichkeiten und blenden die Stärke möglicher Extremereignisse aus. Doch gerade an den Finanzmärkten ist es entscheidend, nicht nur zu fragen, was wahrscheinlich ist, sondern vor allem, was passieren kann, wenn das Unwahrscheinliche eintritt. Wer diese Perspektive versteht, trifft klügere Entscheidungen und schützt sein Kapital dort, wo andere sich in trügerischer Sicherheit wiegen.
Die Psychologie der Überheblichkeit…
Die grösste Schwäche des Menschen im Umgang mit Zufall ist seine Unfähigkeit, Zufall als solchen zu akzeptieren. Dazu kommen weitere, tief verwurzelte, kognitive Verzerrungen. Der sogenannte Hindsight Bias lässt uns glauben, wir hätten Entwicklungen „kommen sehen“. Die Narrative Fallacy zwingt uns, aus zufälligen Abläufen Geschichten zu machen. Wir wollen Zusammenhänge erkennen, wo keine sind. Und der Overconfidence Bias führt dazu, dass wir unsere Fähigkeiten überschätzen – gerade in komplexen, zufallsgeprägten Systemen. Wer scheitert, sieht sich als Opfer widriger Umstände. Doch genau diese Denkweise verstellt den Blick auf das, was wirklich zählt: Den gut strukturierten Entscheidungsprozess, nicht nur das blosse Ergebnis.
…und der Wert der Demut
Im Finanzkontext führt das häufig zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen. Wer glaubt, den Markt „verstanden“ zu haben, ist anfälliger für riskante Manöver, weil er seine Schutzmechanismen vernachlässigt. Umgekehrt schützt die Einsicht in die eigene Begrenztheit –also echte Demut – vor solchen Fehlern. Erfahrene Anleger, die sich langfristig behaupten, zeichnen sich nicht durch hellseherische Fähigkeiten aus, sondern durch systematisches Denken. Sie verlassen sich nicht auf Intuition oder kurzfristige Trends, sondern auf robuste Prozesse, klare Prinzipien und ein tiefes Verständnis für Risiko. Sie wissen: In einer Welt voller Münzwürfe ist es sinnlos, auf das nächste „Kopf“ zu wetten. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie viele Fehlwürfe man sich leisten kann, ohne aus dem Spiel zu fliegen. Ein nüchterner Blick auf langfristige Daten zeigt, worauf es tatsächlich ankommt. Studien zu grossen Pensionsplänen belegen, dass über 90 % der Renditeunterschiede auf die strategische Asset Allocation zurückgehen, nicht auf taktische Wetten oder Einzeltitelauswahl.1 Wer also dauerhaft erfolgreich investieren will, sollte sich weniger auf punktuelle Marktmeinungen verlassen und stattdessen die Struktur des Gesamtportfolios in den Mittelpunkt stellen. Es sind nicht einzelne brillante Entscheidungen, die den Unterschied machen, sondern
Casino Monte-Carlo
In unserer täglichen Arbeit setzen wir gezielt MonteCarlo-Simulationen ein, um die Tragfähigkeit von Anlagestrategien unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Ein Portfolio kann auf dem Papier sehr überzeugend wirken. Erwartete Renditen, klare Risikoparameter und solide Grundannahmen lassen alles planbar erscheinen. Doch in der Realität verlaufen Investments selten geradlinig. Gewinne und Verluste treten nicht gleichmässig auf, sondern in unvorhersehbarer Reihenfolge. Genau diese Reihenfolge entscheidet oft darüber, ob ein Plan aufgeht oder ins Wanken gerät. An dieser Stelle kommt die Monte-Carlo-Simulation ins Spiel. Sie erlaubt es, nicht nur mit Einzelwahrscheinlichkeiten zu arbeiten, sondern hunderte, teils tausende mögliche Zukunftsverläufe zu simulieren. Jeder dieser Verläufe folgt denselben Grundannahmen aber jeder entwickelt sich auf eigene Weise. Was daraus entsteht, ist mehr als Statistik. Es ist ein realitätsnaher Blick in alternative Zukunftsbilder. Manche dieser Pfade führen zu beeindruckendem Vermögenszuwachs, andere enden nahe der Nulllinie oder gar im Minus. Jeder dieser Pfade ist hypothetisch und doch zeigt jeder eine mögliche Geschichte, die ein Anleger tatsächlich erleben könnte. Gemeinsam mit unseren Kunden schreiben wir nicht die eine Geschichte, sondern helfen ihnen, auf viele

Zufall schreibt Geschichte | Monte Carlo Simulationen
100 hypothetische Jahre (Anlagestrategie mit Rendite 15 % und Volatilität 10 %)
Struktur statt Spekulation
Zufall lässt sich nicht eliminieren. Doch seine Wirkung lässt sich begrenzen – durch Struktur, Disziplin und eine kluge Allokation von Risiko. Genau hier liegt der eigentliche Mehrwert eines modernen Private Bankings. Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusehen oder den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Es geht darum, Anleger so zu begleiten, dass sie langfristig am Markt bestehen und eine möglichst hohe Chance auf langfristige, nachhaltige Gewinne erhalten. Ein professionelles Private Banking bietet Orientierung in turbulenten Zeiten. Es hilft, emotionale Impulsentscheidungen zu vermeiden, die oft teuer bezahlt werden. Es ermöglicht den Aufbau von Strategien, die auf Resilienz statt auf Prognosen setzen. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl einzelner Produkte, sondern um ein umfassendes Risikomanagement, das Zufall und Asymmetrie systematisch berücksichtigt. Ein Leuchtturm verhindert nicht den Sturm. Aber er verhindert, dass das Schiff an den Klippen zerschellt. Genauso wenig kann ein Berater die Märkte kontrollieren, aber er kann helfen, klüger durch sie zu navigieren.
1 Brinson, G. P., Hood, L. R., & Beebower, G. L. (1986). Determinants of Portfolio Performance. Financial Analysts Journal, 42(4), 39 – 44.