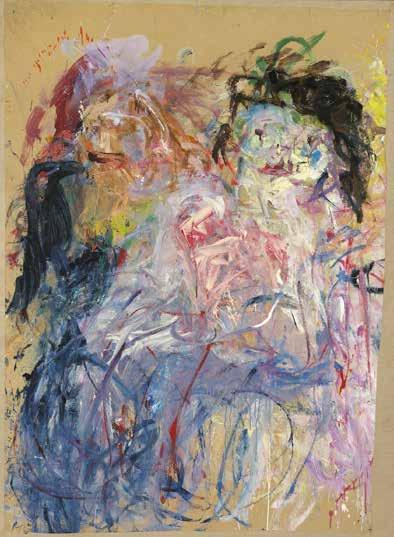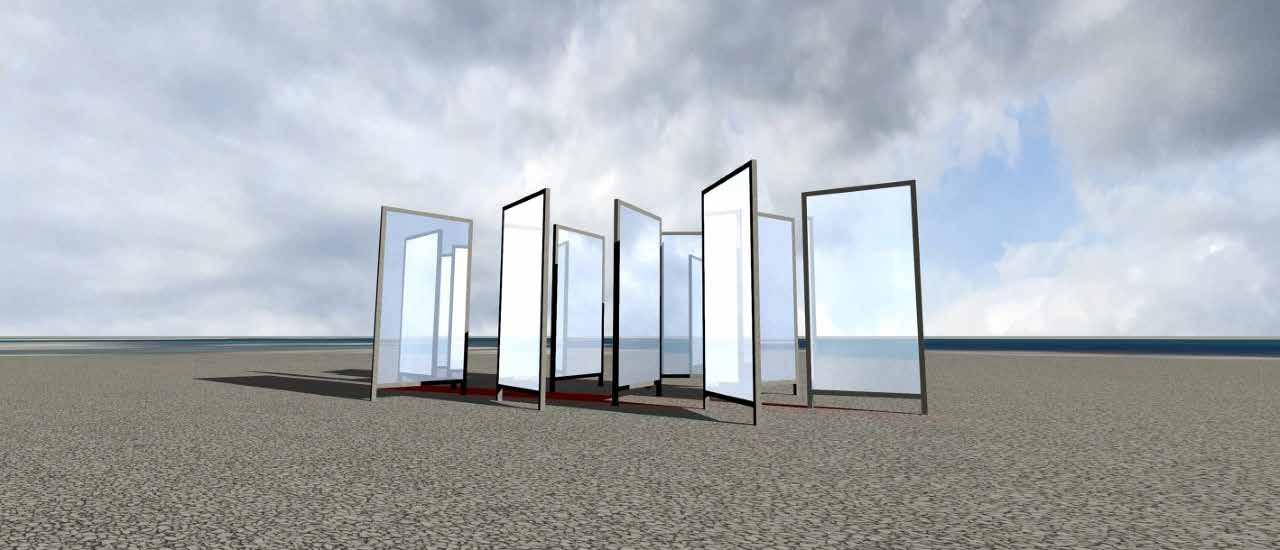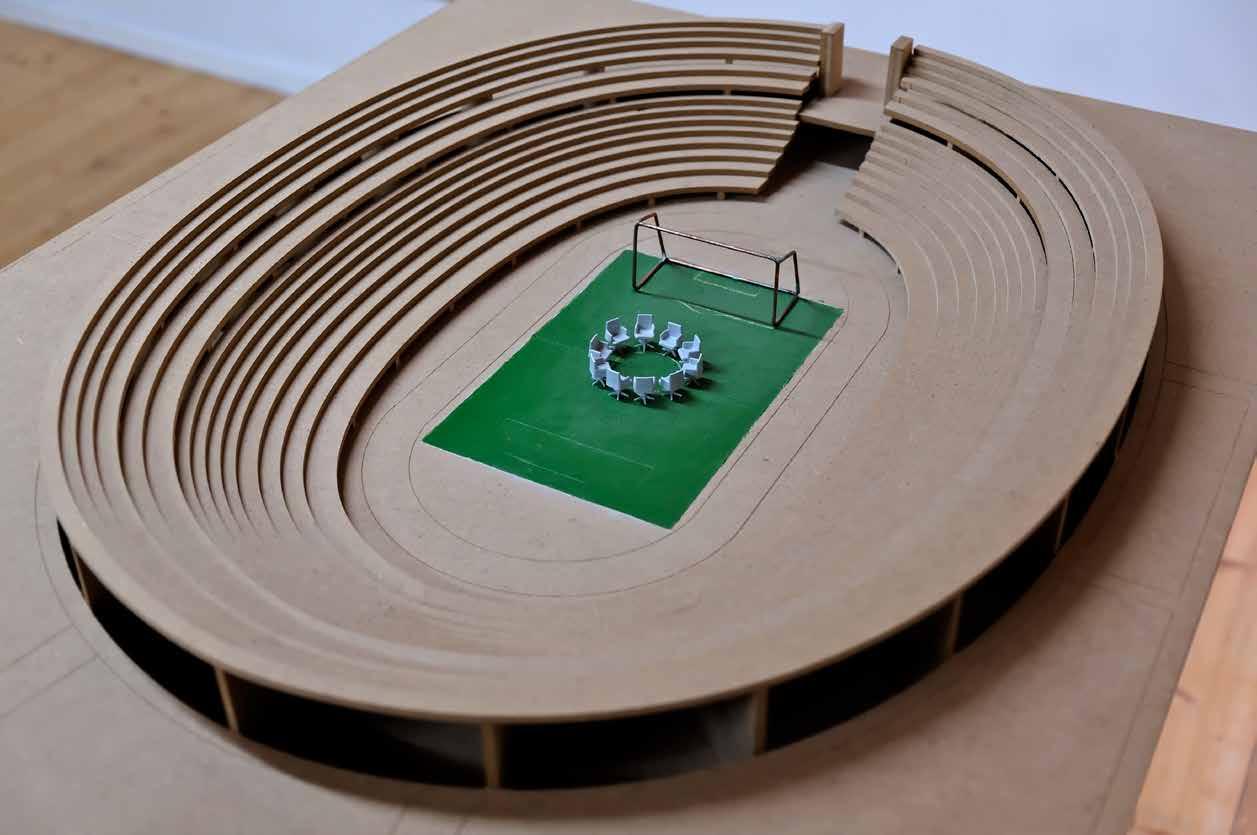3 minute read
Als die Priester gehen mussten
Vor bald 120 Jahren schrieb sich ein kleiner Kärntner Landpfarrer in eine Reihe mit René Descartes, Heinrich Heine und Immanuel Kant. Zumindest im nega tiven Sinne, aus Sicht seiner Chefs in Rom. „Nostra maxima culpa!“, „Unsere große Schuld!“, man beachte das Ausru fezeichen, hieß ein Traktat des Leiflinger Seelsorgers Anton Vogrinec, das es als eines von ganz wenigen Büchern eines katholischen Geistlichen auf den berüchtigten Index librorum prohibitorum, das Verzeichnis der verbotenen Bücher schaffte. Die Inquisitoren in Rom verfügten, dass brave Katholikinnen und Katholiken die Griffel von dem Buch zu lassen hätten, schon Lesen wäre Sünde.
Einen „slowenischen Revoluzzer“ nennt der Klagenfurter Kirchenhistoriker Augustin Malle Vogrinec. Heute würde er als moderater Linkskatholik durchgehen, viele seiner Anregungen sind längst katholischer Mainstream. Vogrinec plädierte für ein entspannteres Verhältnis der Kirche zu den Protestant*innen sowie zur Sozialdemokratie (für die er selbst vermutlich gewisse Sympathien hegte), für weniger Latein in der Predigt und einen entstaubten Religionsunterricht in der Schule. Was die Mächtigen in Rom aber besonders auf die Palme versetzte, war sein Lästern über den Zölibat, den er als „Zwangsjacke“ bezeichnete. Junge Pries ter würden sich diese anziehen, ohne zu wissen, was sie erwarte. „Es ist gerade so unüberlegt, als wenn sich jemand in der Fülle seiner Kraft verpflichten würde, das ganze Leben eine Aufgabe zu leisten, die er eben nur zur Zeit des Gelübdes leisten kann.“ Im Übrigen würden sich viele ohnehin nur an das Gebot Ehelosigkeit halten, auf die sexuelle Enthaltsamkeit aber pfeifen. Das war Anno 1904 zu viel Ehrlichkeit eines Landpfarrers.
Advertisement
Vogrinec musste widerrufen und ver sprechen, sich künftig mit Wortmeldungen zurückzuhalten. Tatsächlich gehörte er einige Jahre später, als das Gros der slo wenischsprachigen Pfarrer in der Abstimmungszone auf Konfrontationskurs mit der Kirchenführung in Gurk ging, zu den leiseren Stimmen. Aber auch Vogrinec machte kein Geheimnis daraus, dass er einen Anschluss an Jugoslawien befür worte. Nach dem Plebiszit bekam er die Rechnung serviert. Wie Dutzende andere slowenische Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer musste er das Land verlassen.
Der Ausgang der Volksabstimmung 1920 führte zu einem beachtlichen intellektuellen Aderlass im Klerus des gemischtsprachigen Gebiets. An die vierzig Priester, die sich zuvor allzu deutlich für Jugoslawien ausgesprochen hatten, verloren ihren Posten. Sie wanderten entweder freiwillig nach Slowenien aus oder wurden gewaltsam deportiert wie der Probst von Tainach, Gregor Einspieler, der von aufgebrachten Deutschkärntnern in einen Wagen gezerrt, an die Grenze gebracht und auf die anderer Seite gestoßen wurde. Auch Xaver Meschko, populärer Pfarrer in Maria Gail und Autor von Kinderbüchern („Das Paradies auf Erden“, „Der kleine Zigeuner“) musste das Land verlassen – gegen den Willen seiner Kirchengemeinde, wie Mal le zu berichten weiß.
„Vertreibung aus dem Paradies.“ Wäh rend sich die Kirchenführung in Gurk und Klagenfurt im Zuge der Volksabstimmung für den Verbleib Unterkärntens bei Österreich stark machte, mobilisierte der slowenische Landklerus im Abstimmungsgebiet durch die Bank für Jugoslawien. Laut Malle ging es ihnen zum einen um den Erhalt der slowenischen Sprache im Unterricht – eine Errungenschaft, die sich durch deutschnationale Tendenzen bedroht sahen. „Sie befürchteten, dass mit dem Verlust der Muttersprache der Verlust des Glaubens einhergehen könnte“, so Kirchenhistoriker Malle. Ebenso stark standen viele aber unter dem Einfluss zahlreicher Überfälle der Deutschkärntner Volkswehr auf Pfarrhöfe im slowenischsprachigen Gebiet.
Eines der Opfer aufgebrachter Milizen war beispielsweise der Eberndorfer Pfar rer Matthias Randl. Im Juni 1919 wurde seine Kirche von Deutschnationalen geplündert: Nebst allerhand anderer wert-
voller Gegenstände seien „sieben silberne vergoldete Reliquienkreuze samt Reliquien“ sowie „drei Kelche, zwei davon ganz in Silber und erst neu vergoldet“ geraubt worden. Mit den Kelchen hätten die Unholde daraufhin im Wirtshaus angestoßen und Todesdrohungen gegen slowenische Priester ausgestoßen, denen man „den Kopf abschneiden und Riemen vom Leibe ziehen“ sollte.
In ihrer Klage über die Untaten der österreichischen Truppen saßen viele slowenische Pfarrer ironischerweise einem fatalen historischen Irrtum auf. So kam laut Malle in den Kirchenchroniken dieser Zeit immer wieder die Warnung vor dem Kommunismus auf – wohlgemerkt für den Fall des Verbleibs Unterkärntens bei Österreich. Tatsächlich kam es bekanntlich umgekehrt.
Und viele Pfarrer, die nach der Volks abstimmung nach Slowenien emigrierten, wurden zeit ihres Lebens nicht mehr so recht froh. Vor allem die weniger promi nenten Geistlichen seien als Flüchtlinge jenseits der Karawanken recht kühl empfangen worden und in die hintersten Teile des Landes versetzt worden. Malle: „Einige haben erzählt, dass sie aus dem Paradies vertrieben worden sind.“ ● Wolfgang Rössler 39, aus Steindorf am Ossiacher See, lebt in Wien, ist Korrespondent der NZZ am Sonntag.