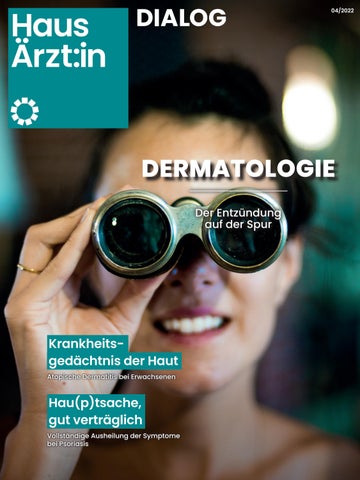3 minute read
Aktinische Keratosen
Ein allgegenwärtiger Befund in der zweiten Lebenshälfte – die Behandlungsmöglichkeiten
© Mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Schulte-Beerbühl, Dortmund
Aktinische Keratosen (AK), auch solare Keratosen genannt, gehören zu den häufigsten Hautveränderungen ab etwa 50 Jahren. Die rötlichen, hautfarbenen oder bräunlichen Rauigkeiten bis hin zu hyperkeratotischen oder krustösen Hautläsionen sind ein Zeichen einer deutlichen Lichtschädigung und finden sich neben weiteren Zeichen des Photoageing in lichtexponierten Arealen. Besonders betroffen sind Gesicht, Kopfhaut, Handrücken und Unterarme. AK gelten als sehr frühe, nicht invasive Form eines weißen Hautkrebses, dem Plattenepithelkarzinom. Die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung solarer Keratosen stellen die chronische kumulative UV-Exposition in Kombination mit einem hellen Hauttyp und höherem Alter dar. Entsprechend der Bevölkerungsstruktur wird in den nächsten Jahren ein weiterer Anstieg der Häufigkeit erwartet.1 Angaben zur Progression einzelner AK in ein Plattenepithelkarzinom variieren stark und werden mit 0,03 % – 20 % pro Läsion und Jahr angegeben. Ein beträchtlicher Teil der Patienten weist jedoch eine Vielzahl von Keratosen in einem Areal auf. Es zeigt sich eine sogenannte Feldkanzerisierung. In diesem Patientengut mit multiplen AK wird das Gesamtrisiko innerhalb von 10 Jahren ein oder mehrere Plattenepithelkarzinome zu entwickeln mit 6–10 % angenommen.1 Für alle Patienten mit andauernder Immunsuppression, medikamentös oder bei Immundefizienz etwa im Rahmen einer chronisch lymphatischen Leukämie, ist dieses Risiko deutlich höher.² Andererseits können sich AK auch klinisch zurückbilden. Je nach Studiendesign werden Spontanremissionen von 15–60 % angegeben und Sonnenschutzmaßnahmen führen bereits ohne weitere therapeutische Maßnahmen zu einem signifikanten Rückgang solarer Keratosen.3 Da es jedoch keine belastbaren Daten für die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von AK in ein Plattenepithelkarzinom gibt, wird ein beobachtendes Abwarten kritisch gesehen und die Behandlung aller AK empfohlen.1
Therapie1
Je nach Ausdehnung und Lokalisation stehen verschiedene Therapien zur Verfügung. Diese können in lokal ablative Verfahren, topisch medikamentöse Therapien und die photodynamische Therapie (PDT) kategorisiert werden. Die Ablation mit flüssigem Stickstoff (Kryotherapie), Chirurgie oder Laser sind etablierte Verfahren bei isolierten oder stark hyperkeratotischen AK. Topisch medikamentöse Therapien erfordern eine Therapieadhärenz von 5 Tagen bis zu 12 Wochen. Für die flächenhafte Anwendung eignen sich 3 % Diclofenac-Natrium Gel und das topische Zytostatikum Fluoruracil. Fluoruracil 0,5 % Lsg. mit Salicylsäure 10 % Lsg. ist zur Therapie isolierter AK oder Feldtherapie bis 25 cm² geeignet. Imiquimod ist für die AK-Therapie von Gesicht und Kopfhaut zugelassen. Im Juli 2021 erfuhr Tirbanibulin 1 % Salbe (Klisyri®) die EMA-Zulassung zur AK-Therapie solarer Keratosen von Gesicht und Kopfhaut. Hierbei handelt es sich um einen topischen Mikrotubuli-Inhibitor, der den apoptotischen Tod proliferierender Zellen induziert. Das kurze Behandlungsschema mit einmal täglicher Anwendung über 5 Tage bietet Behandlern und Patienten eine effektive Therapiealternative. Die Erstattungsfähigkeit in Österreich wird dieses Jahr erwartet. Das Prinzip der PDT beruht auf der Induktion einer selektiven Zellschädigung und Zelltod in oberflächlich kanzerösen Veränderungen durch Auftragen eines Lichtsensibilisators (5-Aminolävulin oder Methylaminolävulinat) und anschließender Beleuchtung mit Licht geeigneter Wellenlänge. Gesunde Haut wird dabei geschont. Die PDT ist besonders für die Feldtherapie geeignet, jedoch ist während der Beleuchtung eine ausgeprägte Schmerzhaftigkeit möglich. In vielen Fällen bietet hier die Tageslicht-PDT eine Alternative. Die Therapie ist an regenfreien Tagen bei Temperaturen über 10 °C möglich. Im Vergleich zur konventionellen PDT wird bei ähnlicher Effektivität eine deutlich geringere Schmerzhaftigkeit angegeben.
Fazit für die Praxis
AK sind ein allgegenwärtiger Befund ab der zweiten Lebenshälfte. In der dermatologischen Praxis wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Besondere Bedeutung haben die Schaffung einer Awareness in der Risikopopulation (Outdoor-Berufe, höheres Alter, Immunsuppression), die primäre Prävention durch geeignete Sonnenschutzmaßnahmen und die sekundäre Prävention durch Eigenuntersuchung und frühzeitige ärztliche Vorstellung.
© zVg
AUTORIN: OÄ Dr.in Christin Kronschläger
Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Universitätsklinikum St. Pölten, Karl Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften, St. Pölten Literatur: 1 Berking C et al., Deutsche S3-Leitlinie Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut. Stand: 03/2020. 2 Willenbrink TJ et al., Field cancerization: Definition, epidemiology, risk factors and outcomes. J Am Acad Dermatol. 2020 Sep;83(3):709-717. 3 Thompson SC, Jolley D, Marks R. Reduction of solar keratoses by regular sunscreen use. N Engl J Med. 1993 Oct 14;329(16):1147-51. BEZAHLTE ANZEIGE