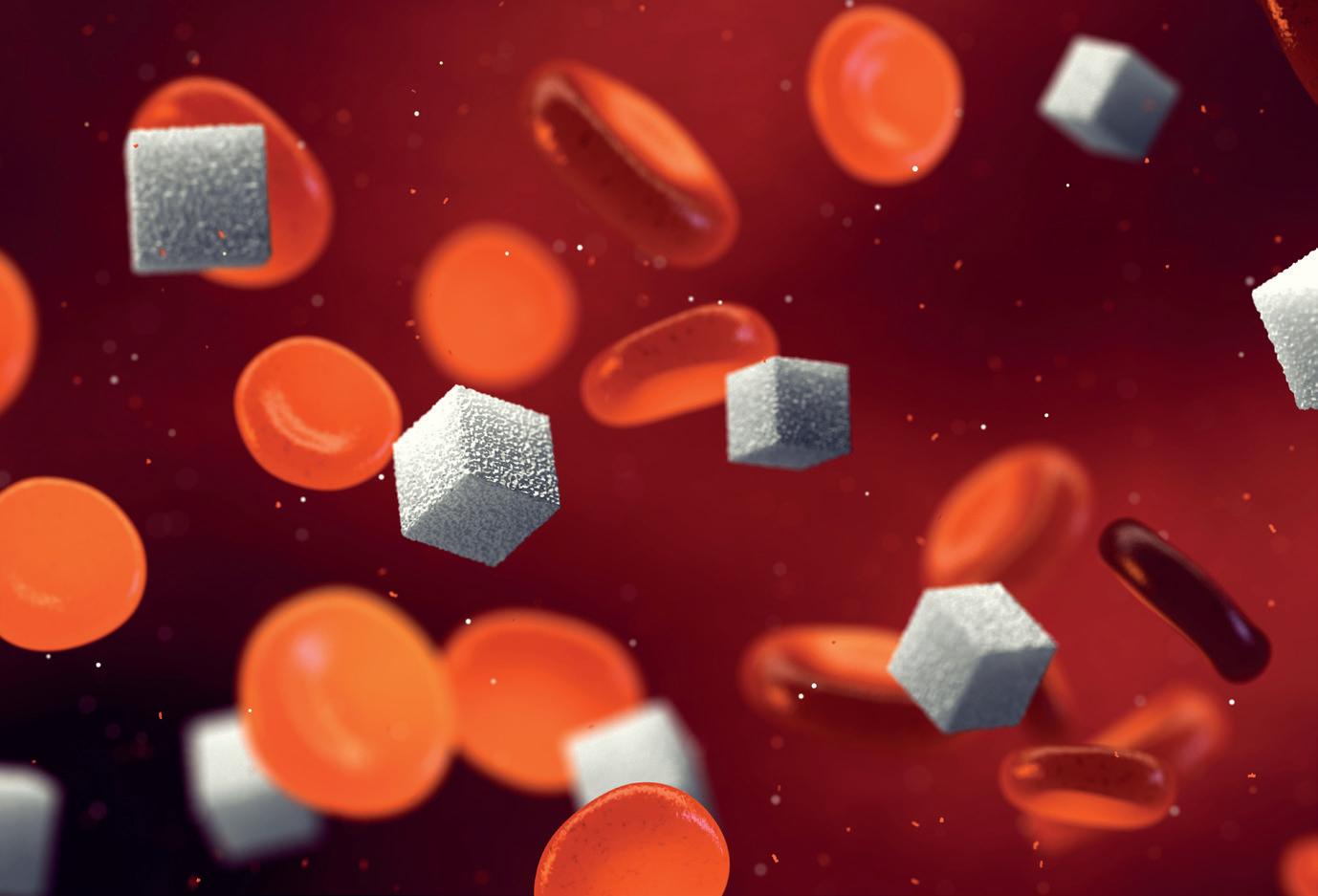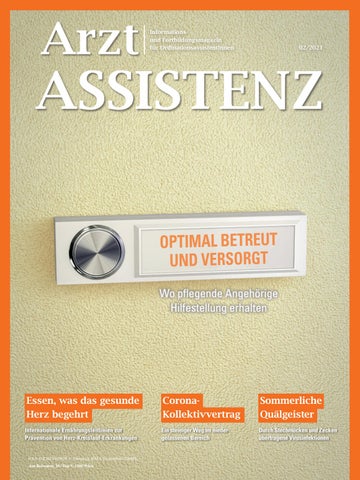2 minute read
Sommerliche Quäl geister
Sommerliche Quälgeister
Durch Stechmücken und Zecken übertragene Virusinfektionen
Weitere Infektionskrankheiten
Zecken können eine Reihe von Bakterien, Viren oder Protozoen (einzellige Lebewesen, die als Parasiten leben) übertragen. Die Liste der möglichen Erkrankungen reicht von AlkhurmaHämorrhagischem-Fieber über Rocky-Mountains-Fleckfieber bis hin zu Queensland-Zeckentyphus. Manchmal beherbergt eine Zecke mehre Arten von Krankheitserregern.
Steigende Außentemperaturen machen das Leben nicht nur für uns Menschen angenehm, sondern auch für die unliebsamen Begleiter des Sommers – die Gelsen und Zecken. Deren Stiche sind nicht nur unangenehm und schmerzhaft, sie können auch zu Virusinfektionen führen. Von den Stechmücken kann beispielsweise das West-Nil-Virus aus der Familie der Flaviviren übertragen werden. Bei den meisten Menschen verläuft eine Infektion asymptomatisch. Bei einem Viertel der Infizierten treten fieberhafte, grippeähnliche Symptome auf. Einer von 140 entwickelt eine Enzephalitis (Gehirnentzündung) oder Meningitis (Hirnhautentzündung). Ein weiteres durch Gelsen übertragbares Virus ist das Usutu-Virus, das seit 2001 auch hierzulande bekannt ist und zu einem Amselsterben führte. Ab 2004 wurden keine weiteren Infektionen registriert, die Vögel waren immun. Seit 2016 zeigten sich allerdings wieder einzelne Fälle. Auch dieses Virus kann auf Menschen übertragen werden, es führt aber nur sehr selten zu Symptomen. Beide Viren werden vor allem durch die bei uns häufig vorkommenden Gelsen der Gattung Culex übertragen, vor allem durch Culex pipiens, die „Gemeine Stechmücke“. Jedoch breiten sich auch exotische Gelsenarten immer mehr in Österreich aus, zum Beispiel die Asiatische Buschmücke Aedes japonicus, die auch tagsüber sticht.
Achtbeinige Quälgeister
Zecken gibt es sehr lange. 100 Millionen Jahre alte Fossilien belegen dies. Bekannt sind Zecken vor allem als Überträger der Viruserkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Die besonders stark gefährdeten Gebiete sind in Österreich seit 20 Jahren mehr oder weniger dieselben. Jedoch hat sich der Lebensraum der Zecken aufgrund der Klimaerwärmung mittlerweile auf Lagen bis zu 2.000 Metern erweitert. Eine „Zeckenlandkarte“ ist beispielsweise auf zecken.at zu finden. Übrigens: Zecken beißen nicht, sie stechen. Zu einer FSME-Infektion kann es allerdings auch durch den Konsum von roher Milch oder Rohmilchkäse kommen. Die gute Nachricht: Vor FSME kann man sich durch eine Impfung schützen. Die schlechte Nachricht: Weitaus häufiger übertragen Zecken die Borreliose, gegen die es noch keine Impfung gibt. So ist etwa jede vierte Zecke mit Borrelien infiziert, mit dem FSME-Virus hingegen nur jede 1.000. Ein Anzeichen der Borreliose ist die Wanderröte, die jedoch nur bei circa der Hälfte der Betroffenen auftritt.
Exoten im Vormarsch
Als häufigster Vertreter der Zeckenfamilie gilt in Österreich der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus). Aufgrund des Klimawandels fühlt sich zusehends auch eine exotische Riesenzecke (Hyalomma marginatum) hierzulande recht wohl. Diese zählt im Gegensatz zu den „Lederzecken“ zu jenen, die mit einem Rückenschild ausgestattet sind, den sogenannten „Schildzecken“. Sie wird bis zu drei Zentimeter lang, hat gelb-braun gestreifte Beine, kann sehr schnell laufen und „verfolgt“ den Menschen. Hyalomma marginatum kann das gefährliche Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber übertragen. Dieses wird sich vermutlich in den nächsten Jahrzehnten auch in Österreich ausbreiten.
Theresia Albrecht
Experte zum Thema: Prof. Dr. Norbert Nowotny
Institut für Virologie, Veterinärmedizinische Universität Wien