BASSENGE









MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST












30. Mai 2025
Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin
Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: modernart@bassenge.com . www.bassenge.com



Barbara Bögner Leitung
Telefon: +49 (0)30-88 62 43 13
E-Mail: b.boegner@bassenge.com

Katharina Fünfgeld
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 90
E-Mail: k.fuenfgeld@bassenge.com
Simone Herrmann
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 93
E-Mail: s.herrmann@bassenge.com

Miriam Klug
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 92
E-Mail: m.klug@bassenge.com
Sonja von Oertzen
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 91
E-Mail: s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 94
E-Mail: l.weisser@bassenge.com
Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.

Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.
MITTWOCH, 28. Mai 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 15.00 Uhr
Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5236
Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5237-5331
Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5332-5467
Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5468-5720
DONNERSTAG, 29. Mai 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 14.00 Uhr
Abend 18.00 Uhr
FREITAG, 30. Mai 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6217 Rahmen Nr. 6218-6239
Portraitminiaturen Nr. 6301-6450
En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen Nr. 6500-6681
Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6700-6925
Nachmittag 15.00 Uhr Moderne und Zeitgenössische Kunst I
SONNABEND, 31. Mai 2025
Vormittag 11.00 Uhr
MITTWOCH, 4. Juni 2025
Nachmittag 15.00 Uhr
VORBESICHTIGUNGEN
Moderne Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8210 Post War & Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8220-8437
Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4074 Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4075-4300
Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts und Portraitminiaturen Erdener Straße 5A, 14193 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Montag, 26. Mai, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 27. Mai 10.00–17.00 Uhr
Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 10.00–18.00 Uhr,
En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen in der Galerie F37, Fasanenstraße 37, 10719 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 11.00–18.00 Uhr
Schutzgebühr Katalog: 20 €
Umschlag: Los 7269, Andy Warhol, Innenseite links: Los 7160, Renée Sintenis
Innenseite rechts: Los 7102, John Hoexter. Seite 6 und 7: Los 7270, Roy Lichtenstein (© Estate of Roy Lichtenstein / VG Bild-Kunst, Bonn 2025)
Geschäftsführung | Management
Graphik, Zeichnungen und Gemälde des 15.–19. Jahrhunderts
David Bassenge
Dr. Ruth Baljöhr – Leitung
+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com
+49 (0)30-893 80 29-22 15th to 19th Century Prints, Drawings and Paintings r.baljoehr@bassenge.com
David Bassenge
Eva Dalvai
+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com
+49 (0)30-893 80 29-80 e.dalvai@bassenge.com
Lea Kellhuber +49 (0)30-893 80 29-20 l.kellhuber@bassenge.com
Nadine Keul
Moderne und Zeitgenössische Kunst
+49 (0)30-893 80 29-21 n.keul@bassenge.com
Harald Weinhold +49 (0)30-893 80 29-13 h.weinhold@bassenge.com
Barbara Bögner – Leitung
+49 (0)30-88 62 43 13 Modern and Contemporary Art b.boegner@bassenge.com
Katharina Fünfgeld +49 (0)30-88 91 07 90 k.fuenfgeld@bassenge.com
Simone Herrmann +49 (0)30-88 91 07 93 s.herrmann@bassenge.com
Miriam Klug +49 (0)30-88 91 07 92 m.klug@bassenge.com
Sonja von Oertzen +49 (0)30-88 91 07 91 s.v.oertzen@bassenge.com
Laetitia Weisser +49 (0)30-88 91 07 94 l.weisser@bassenge.com
Photographie
Jennifer Augustyniak – Leitung +49 (0)30-21 99 72 77 Photography jennifer@bassenge.com
Giovanni Teeuwisse +49-(0)30-88 91 08 55 giovanni@bassenge.com
Wertvolle Bücher und Handschriften
Dr. Markus Brandis – Leitung +49 (0)30-893 80 29-27
Rare Books and Manuscripts m.brandis@bassenge.com
Harald Damaschke +49 (0)30-893 80 29-24 h.damaschke@bassenge.com
Stephan Schurr +49 (0)30-893 80 29-15 s.schurr@bassenge.com
Naomi Schneider +49 (0)30-893 80 29-48 n.schneider@bassenge.com
Autographen | Autograph Letters
Logistik Management | Logistics
Verwaltung | Office
Repräsentanzen | Representatives
München
Rheinland
Dr. Rainer Theobald +49 (0)30-4 06 17 42 r.theobald@bassenge.com
Ralph Schulz +49 (0)30-893 80 29-16 r.schulz@bassenge.com
Anja Breitenbach +49 (0)30-893 80 29-12 a.breitenbach@bassenge.com
Jenny Neuendorf +49 (0)30-893 80 29-33 j.neuendorf@bassenge.com
Harald Weinhold
+49 (0)151-1202 2201 muenchen@bassenge.com
Dr. Mayme Francis Neher +49 (0)175-204 63 23 info@mayme-neher.de
Erdener Straße 5a, 14193 Berlin
Vorbesichtigung Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai 2025
Die Kataloge Moderne Kunst II und Post War & Zeitgenössische Kunst II erscheinen nur online, die Auktion findet als Präsenzveranstaltung statt

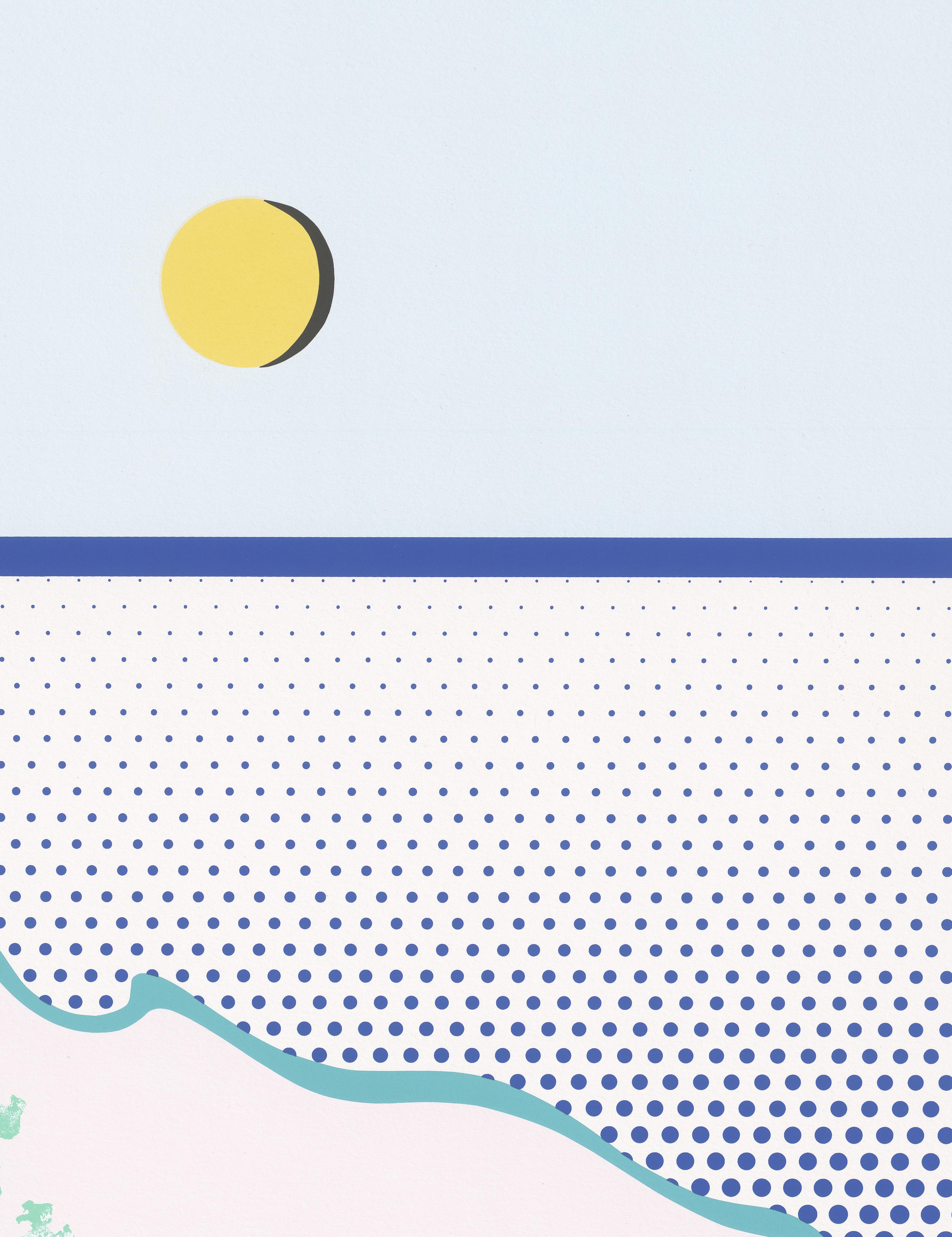

7140, Originalgröße
edouard vuillard
(1868 Cuiseau – 1940 La Baule)
7000 Maternité
Farblithographie auf Chine volant. 1896. 19 x 22,5 cm (30 x 34 cm).
Roger-Marx 30 vor III.
2.500 €
Zustandsdruck, noch ohne die hellbraunen Partien. Roger-Marx nimmt an, dass die Graphik in 110 num. Ex. der Vorzugsausgabe der Zeitschrift PAN beigegeben wurde, was jedoch nicht stimmen kann, da Vuillard in der Zeitschrift überhaupt keine Arbeit veröffentlichte, vgl. hierzu auch „Pan Prospect-Buch, Inhalts- und Mitgliederverzeichnis der drei Jahre 1895, 1896, 1897 der Zeitschrift Pan“, Leipzig 1898. Die Allgemeine Ausgabe des PAN erschien in mindestens 1100 Exemplaren, die Vorzugsausgabe in 75 num. Ex., und die Künstler-Ausgabe in 37 bzw. 38 num. Ex. Wahrscheinlich verwechselte Roger-Marx die Zeitschrift PAN mit der PAN-Presse und hatte (sein Buch erschien 1948) damals noch keine Möglichkeit zur genaueren Recherche. Auch die Zustandsbeschreibungen bei Roger-Marx sind, wie er selbst einräumt, unklar („Il est possible qu‘il ait été tirés un ou deux essais d‘un état intermédiaire entre le second et l‘état définitif.“). Brillanter, samtiger Druck mit breitem Rand. Sehr selten.
Provenienz: Ehemals Sammlung Maurice Houdayer, Paris

camille pissarro (1830 Saint-Thomas-des-Antilles – 1903 Paris)
7001 Grand-mère (effet de lumière)
Radierung und Aquatinta auf Frères-Bütten. 1889/23. 17,4 x 25,7 cm (22,8 x 27,6 cm).
Mit dem schwarzen Monogrammstempel „C.P“. Auflage 18 num. Ex.
Delteil 80/7 e.
1.500 €
Aus der posthumen, numerierten Auflage von 1923. Kräftiger Abzug mit Rand.
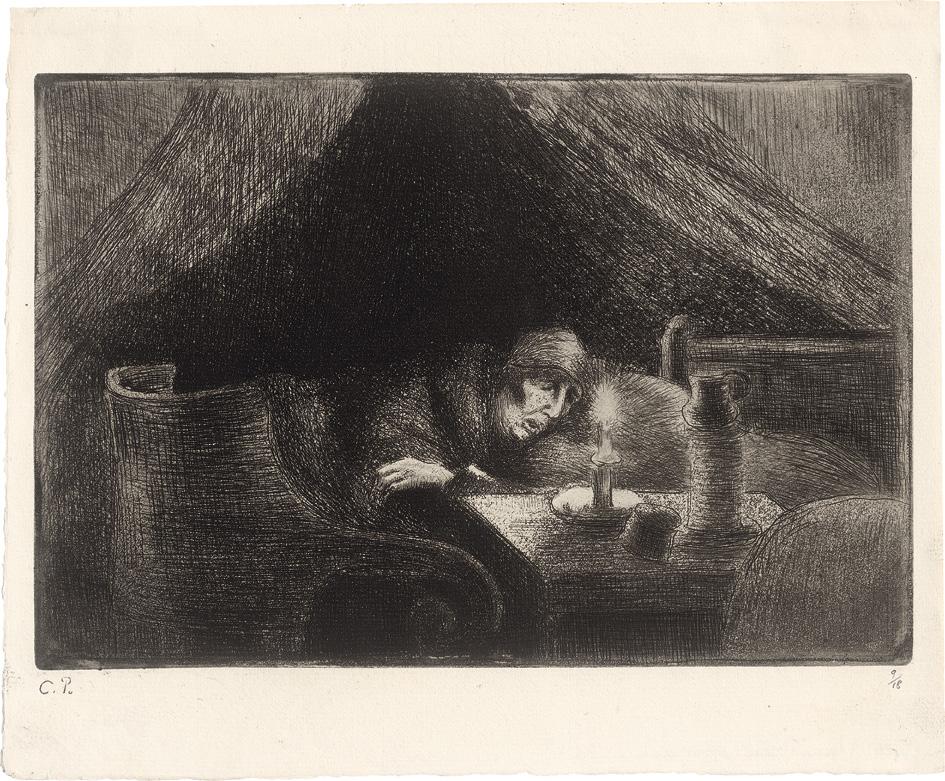

heinrich vogeler (1872 Bremen – 1942 bei Karaganda/Kasachstan)
7002 Die Nacht
Radierung in Schwarzblau auf Bütten. 1897.
23,5 x 18 cm (40 x 30,8 cm).
Signiert „HVogeler“.
Rief 21 II c (von d).
900 €
Prachtvoller, tiefdunkler Druck von der noch unverstählten Platte mit sehr breitem Rand, oben mit dem Schöpfrand.
heinrich vogeler
7003 Die Märchen
5 (von 6) Radierungen auf Velin sowie 2 Bl. Titel und Text. Lose in Kartonmappe. 1924.
28,7 x 23 cm (Blattgröße).
Die Radierungen jeweils signiert „HVogeler“.
Rief 1 II c, 4 e, 9 II d, 11 f und 15 f.
1.500 €
Mit einem Vorwort und kurzem Text von der jüdischen Schriftstellerin Erna Regina Löwenwarter, die Anfang der 1920er Jahre nach Worpswede kam. Erschienen und gedruckt bei Carl Frye & Sohn, Münster 1924. Die Platten wurden 1924 vernichtet. Die Mappe erschien nur in kleiner, nicht numerierter Auflage. Vorhanden sind die Motive „Am Quell“ (Vogelers erste Radierung), „Die Schlangenbraut“, „Die Hirtin“, „Tod und Alte“, „Die Sieben Raben“ und „Froschbraut“. Ausgezeichnete, teils gute Drucke mit dem vollen Rand.


dora hitz
(1856 Altdorf – 1924 Berlin)
7004 Waldstück
Pastell auf gräulichem Velin. Um 1900. 45,5 x 53 cm.
Unten rechts mit Kreide in Rot signiert „Dora Hitz“.
1.200 €
Frühlingshaft flirrendes Licht und frisches Grün erfüllen die baumbestandene Wiese. Souverän erfasst die Künstlerin das Spiel von Licht und Schatten im Grün der Bäume und akzentuiert nur hier und da Äste und Stämme mit dunklen Konturen. Sie „vertrat in Deutschland als eine der ersten den reifen Impressionismus mit durchgeistigtem Vortrag und blonder, farbenfreudiger, leuchtender Palette.“ (Thieme-Becker S. 153). Bereits als Mädchen, mit 13
Jahren, studierte Dora Hitz an der Münchner „Damenmalschule Frau Staatsrat Weber“ und wurde anschließend in Bukarest rumänische Hofkünstlerin der Königin Elisabeth von Rumänien, Carmen Sylva. Ab 1880 lebte Hitz in Paris, im Künstlerviertel Montmartre, und studierte u.a. bei Luc-Olivier Merson, Jean-Joseph BenjaminConstant und Eugène Carrière. 1892 siedelte sie nach Berlin über, betrieb bald eine eigene Damenmalschule und besaß ein Atelier am Lützowplatz. Hitz war Gründungsmitglied der Vereinigung der XI und der Berliner Sezession.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 45, 27.05.1995, Lot 567 Privatsammlung Berlin

louis valtat
(1869 Dieppe – 1952 Paris)
7005 Façade de l‘église, effet de lumière Öl auf Leinwand.
25,5 x 35 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „L.V“.
8.000 €
Das kleinformatige Gemälde illustriert eindrucksvoll Valtats Beeinflussung durch den Impressionismus und seine Experimentierfreude, mit bunten Farbtupfern ein wechselhaftes Licht- und Schattenspiel auf einer Fassade darzustellen. Laut einer Bestätigung des Enkels Louis-André Valtat vom 24.06.2005 ist das Gemälde im Archiv des Künstlers verzeichnet und wird in ein Werkverzeichnis aufgenommen. Bitte Zustandsbericht erfragen.
Provenienz:
Christie‘s, London, Auktion 27.06.1986, Lot 449
Christie‘s, London, Auktion 01.04.2004, Lot 36
Privatbesitz Berlin

curt herrmann (1854 Merseburg – 1929 Erlangen)
7006 Astern Öl auf Karton. 1907.
40,5 x 30,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Hellblau monogrammiert „C.H.“, verso auf dem Abdeckkarton (von fremder Hand?) mit Farbstift in Rot betitelt und bezeichnet „No. IV ‚Astres‘“ sowie mit der Berliner Künstleradresse.
8.000 €
Schillernd finden sich hell leuchtende Nuancen von Grün und Violett, Rosa- und Gelbtöne nebeneinander. Aus kurvigen Bewe-
gungen des Pinsels artikulieren sich die geschwungenen Formen von Asternblüten und Vase in einer dichten, ausgewogenen Komposition, wie sie charakteristisch für die Blumenstilleben Herrmanns sind. Im Berliner Kunstleben um 1900 spielte Curt Herrmann eine zentrale Rolle, nicht nur als Künstler, sondern auch als Sammler. Er war 1898 Gründungs- und Vorstandsmitglied der Berliner Sezession, lernte 1897 in Brüssel Henry van de Velde kennen, und durch ihn den Neoimpressionismus und dessen wichtigste Vertreter wie Paul Signac, Théo van Rysselberghe und Maurice Denis. Bald wurde Herrmann zu einem wichtigen Vermittler des französischen Neoimpressionismus in Deutschland.
Provenienz: Familie des Künstlers Berlin

august gaul (1869 Großauheim – 1921 Berlin)
7007 Fressender Bär
Bronze mit schwarzbrauner Patina auf Bronzeplinthe, auf dunkelgrauen Marmorsockel montiert. 1895.
Ca. 10,2 x 8 x 10,8 cm.
Seitlich auf der Plinthe signiert „A. Gaul“, hinten am Rand mit dem Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“. Gabler 20-1.
4.000 €
Der „Fressende Bär“ zählt neben dem „Sitzenden Bären“, 1894 (Gabler 8-1) zu Gauls wenigen frühen eigenständigen Plastiken, die er hat gießen lassen. „Sicher wurden nur wenige Bronzegüsse hergestellt. Eine größere Verbreitung fand die Plastik erst nach Gauls Tod, dann jedoch in Porzellan- und Keramikausformungen. Vermutlich besaß Heinrich Zille ein Exemplar in Gips (...).“ (Josephine Gabler, August Gaul, Das Werkverzeichnis der Skulpturen, Berlin 2007, S. 48). Gabler kann insgesamt neun Güsse nachweisen, drei davon in öffentlichen Sammlungen. Prachtvoller Guss mit homogener Patina. Gesamthöhe mit Sockel: 13 cm.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

7008
edward cucuel
(1875 San Francisco – 1954 Pasadena)
7008 „Brunnenpromenade im Krollschen Garten, Berlin“ Feder und Pinsel in Schwarz sowie Deckweiß und Bleistift auf Velin, auf Velinkarton aufgezogen. 1901.
30 x 48,5 cm.
Unten links in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert „CUCUEL“ und datiert, verso auf kaschiertem Velin mit Bleistift betitelt.
900 €
Der elegante, sichere Strich Cucuels zeigt sich in der frühen Arbeit des US-amerikanischen Malers, der bereits 1896 als Zeitungsillustrator in New York arbeitete, sich in Paris fortbildete und sich zunächst als Illustrator in Berlin und 1907 schließlich in München niederließ, wo er sich der Künstlergruppe „Scholle“ um Leo Putz anschloss. In der frühen Berliner Zeit entstand die charmante Zeichnung des Vergnügungspalastes im Berliner Tiergarten.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden

richard ranft (1862 Plainpalais/Genf – 1931 Coubert)
7009 Das Mädchen im Kahn
Farbige Aquatinta auf Bütten (Wz. Kreis mit Linien). 1903. 21,6 x 32,5 cm (25,8 x 37,6 cm).
Signiert „Richard Ranft“ und bezeichnet „Epreuve d‘essai retouchée“ sowie „1/70“.
1.200 €
Als „Vorkämpfer der modernen farbigen Graphik“ machte Ranft sich primär um die Farbradierung verdient und galt unter den Zeitgenossen als begabter Kolorist (Clément-Janin, S. 43). Die Kolorierung des vorliegenden Blattes scheint sowohl au repérage als auch à la poupée erfolgt zu sein, die stellenweise Glättung der Aquatintakörnung bewirkt darüber hinaus mezzotintoähnliche sanfte Abstufungen wie auf dem Kleid des Mädchens. Die roten Akzente sind in Aquarell aufgetragen worden. Ganz ausgezeichneter Probedruck mit Rand. Beigegeben: Ein weiterer Abzug des Druckes in Dunkelbraun, ebenfalls Zustandsdruck.
Literatur: Clément-Janin, Richard Ranft und die farbige Radierung, in: Die graphischen Künste, 1903, S. 46, Nr. 26

marie hager
(1872 Penzlin – 1947 Burg Stargard)
7010 Allee am Schloss Dargun Öl auf Malpappe.
72 x 83 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „MHager“.
2.000 €
In spätimpressionistischer Malweise, mit breitem Pinsel und in herbstlich-warmen Farben erfasst Hager die stimmungsvolle Szenerie. Häufige Motive in ihrem malerischen Schaffen waren Dargun und ihre Wahlheimat Burg Stargard in MecklenburgVorpommern, meist in Pleinair-Malerei erfasst. Ausgebildet von Max Uth, später von Eugen Bracht, Hans Licht und Ernst Kolbe, konnte Hager bereits 1910 an einer Ausstellung in Hannover und 1911 in Berlin teilnehmen.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

max liebermann
(1847–1935, Berlin)
7011 Schulgang in Laren
Kreide in Schwarz auf dünnem Velin. 1898.
11 x 19 cm.
4.500 €
Wie ein Reigen reihen sich die identischen Hüte und langen Schürzen der Schulmädchen aneinander, die im hellen Sonnenlicht auf das Schulportal zuströmen, auf dem Weg zum Unterricht. In seinem treffsicheren, impressionistischen Duktus stellt Liebermann die berühmte Szene in überzeugender Stilisierung dar. Bei dem aus einem Skizzenbuch stammenden Blatt handelt es sich um eine der Vorstudien, die der Künstler 1898 im nordholländischen Dorf Laren als Vorbereitung für das gleichnamige, in zwei Fassungen existierende Gemälde anfertigte (vgl. Max Liebermann in seiner Zeit, Ausst.-Kat. Berlin/München 1979-80, S. 564f., Nr. 295).
Provenienz: Ehemals Kunsthandlung Osper, Köln
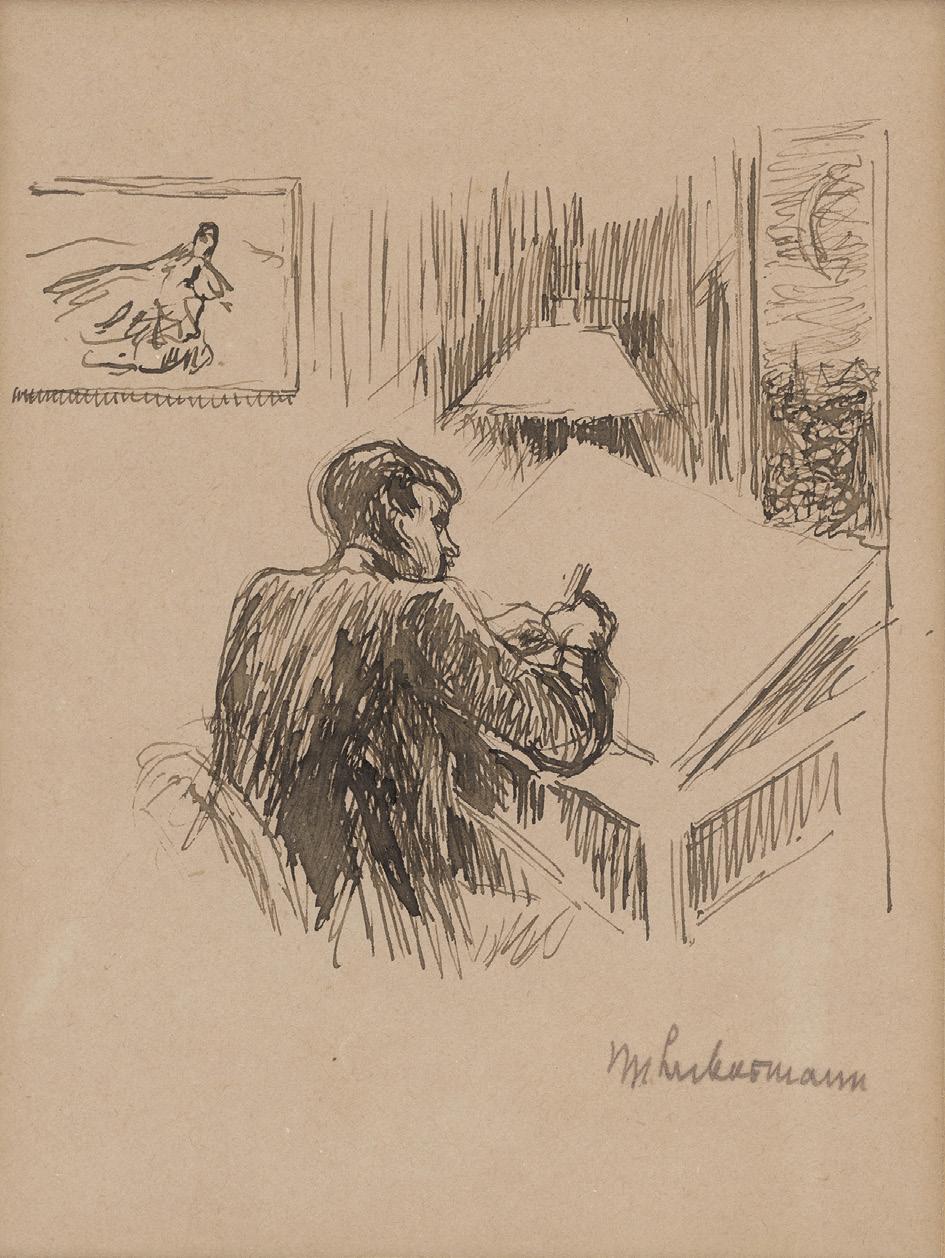
7012
max liebermann
7013 Major bei der Toilette
Feder in Braun und Bleistift auf Velin (wohl mit Briefkopf). Um 1922.
Ca. 29 x 21 cm.
Mittig rechts mit Feder in Braun signiert „MLiebermann“.
1.500 €
Ein Major am Frisiertisch bei der Morgentoilette: Liebermann nähert sich dem Thema auf verschiedene Weise und vereint unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten des Motivs auf einem Bogen - mal mit dichtem virtuosen Federstrich, mal mit zartem Bleistift. So ist das Skizzenblatt ein wertvolles Beispiel für den Bildfindungsprozess des großen Meisters.
Provenienz:
Jeschke, Greve & Hauff, Berlin, Auktion 25.04.2003, Lot 528
Privatsammlung Berlin
max liebermann
7012 Am Schreibtisch
Feder in Schwarz auf Velin. 13,5 x 10 cm (Passepartoutausschnitt). Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „MLiebermann“.
900 €
Mit einem Netz dichter Schraffuren erfasst Liebermann die Figur des am Tisch sitzenden Zeichners. Einem auf der Rahmenrückseite montierten Zeitungsausschnitt zufolge wurde die bis dahin unbekannte Zeichnung veröffentlicht in der Zeitung „Telegraf“ am 08.02.1955.
Provenienz: Privatbesitz Baden-Württemberg
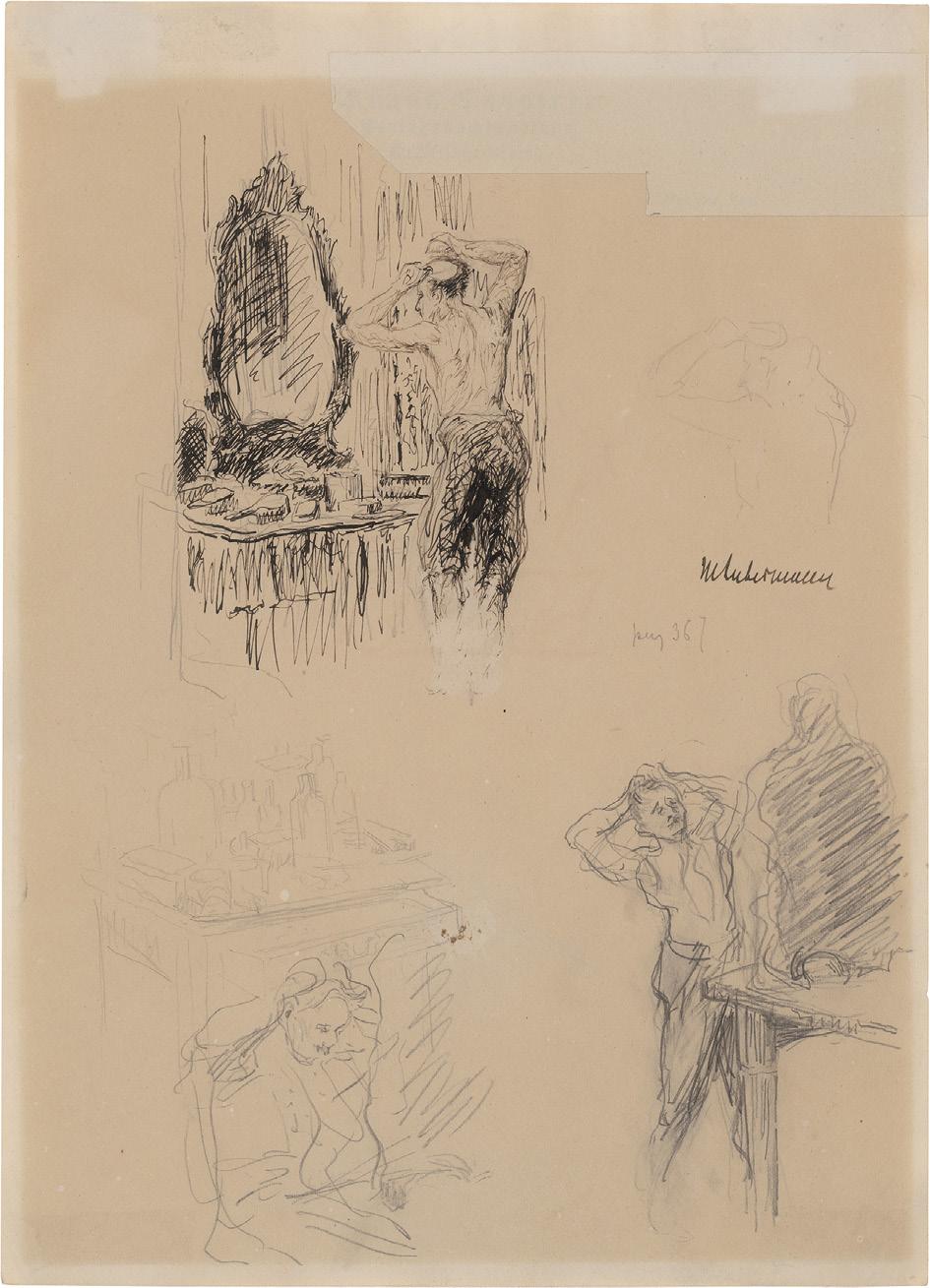
7013

max liebermann
7014 Tiergarten
Kaltnadel auf handgeschöpftem Velin. 1914. 19,5 x 26,5 cm (35 x 48,8 cm).
Signiert „MLiebermann“. Auflage 40 Ex. Schiefler 158 III c.
1.000 €
Aus der Auflage von 40 Exemplaren erschienen bei Bruno Cassirer, Berlin, mit dem Blindstempel unten links. Prachtvoller, klarer Druck mit feinem Stempelglanz, deutlich zeichnender Plattenkante und dem vollen Schöpfrand.
Provenienz:
Sammlung Werner Eberhard Müller, mit dem rotem Sammlerstempel unten links (Lugt 5075)
Privatsammlung Berlin

karl hagemeister (1848–1933, Werder a. d. Havel) 7016 Windfänger an der See – Lohme auf Rügen Kohle auf Velin. Um 1910-15. 48,5 x 62 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „K Hagemeister“. 1.200 €
Windzerzaustes Geäst, mühsam wachsende Vegetation auf steinigem Untergrund, „die einsamen Protagonisten einer hier ausdrücklich inszenierten Konfrontation mit Wind und Wetter am Meer. (...) Die im Spätwerk dringlich gewordene Grenzüberschreitung zum Wildfremden im Sinne einer inneren Reise zum ‚Ursprung‘ konnte er im nicht sehr fernen Lohme offenbar auf
eine ihn zufriedenstellende Art verwirklichen.“ (Katrin Arrieta, in: Karl Hagemeister, Ausst.-Kat. Potsdam Museum u.a., Hrsg. Jutta Götzmann und Hendrikje Warmt, Köln 2020, S. 119). Aus elegant reduzierten Konturen und kraftvoll schraffierten Flächen entsteht eine ausdrucksstarke Naturstudie, deren akzentuierte Helldunkelkontraste die perspektivische Wirkung des Blattes unterstreichen. Die Zeichnung ist Dr. Hendrikje Warmt, Berlin, bekannt.
Provenienz:
Privatbesitz Berlin Galerie Bassenge, Berlin, Auktion 103, 31.05.2014, Lot 8097 Sammlung Henning Lohner, Berlin
theo von brockhusen (1882 Markgrabowa, Ostpr. – 1919 Berlin) 7017 Ostseebad Öl auf Leinwand. Um 1907. 70 x 88 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Theo von Brockhusen“, verso auf dem Spannrahmen Fragment eines Klebeetiketts, dort bezeichnet „Brockhusen Nr. 8360“ sowie Fragment eines Klebeetiketts „2. Deutsche Künstlerbund Ausstellung 1905, Nr. 989“. 15.000 €
Wie ein heiterer Reigen zieht die Schar der Badegäste über die Seebrücke im Vordergrund. In sommerlich-heller Farbpalette und mit pastosem, vielfach plastisch modellierendem Farbauftrag gestaltet Brockhusen die Strandszene. Die Konstruktion der hölzernen, für die Ostseeküste charakteristischen Seebrücke dominiert den Vordergrund der Komposition, während die Figuren weitestgehend schematisch erfasst sind und eine zweite, ebenso
belebte Brücke weiter hinten den Blick in die Tiefe lenkt. Der aus Ostpreußen stammende Impressionist hatte bis 1903 an der Königsberger Akademie studiert und lebte anschließend, bevor er 1905 nach Berlin zog, in Klein Kuhren an der samländischen Küste. In Berlin dann trat er bereits 1905 in Kontakt mit der Berliner Sezession, im Jahr darauf begann Paul Cassirer, ihn zu unterstützen. Auf der zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes, Berlin 1905, war Brockhusen dem Katalog zufolge mit einem Gemälde vertreten, „Landschaft“, Kat.-Nr. 14 (ohne Abb.).
Provenienz: Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin
Literatur:
Theo von Brockhusen: Ein Maler zwischen Impressionismus und Expressionismus, Ostdeutsche Galerie Regensburg 1999, Kat.Nr. 3, Abb. S. 44

lovis corinth
(1858 Tapiau – 1925 Zandvoort)
7018 Sitzender Akt
Öl auf Leinwand, auf dicke Malpappe kaschiert. 1886. 80 x 44 cm.
Seitlich links mit Pinsel in Schwarz signiert „CORINTH.“, unten rechts mit Pinsel in Schwarz eine zweite, auf den Kopf gestellte Signatur (die letzten beiden Buchstaben teilweise überstrichen).
Nicht bei Berend-Corinth/Hernad.
18.000 €
Delikat erfasst Corinth die weichen Körperformen und unterstreicht mit feinsten Schattierungen und naturalistischer Farbgebung im makellosen Inkarnat die Sinnlichkeit des weiblichen Aktes. Ganz ohne Accessoires sitzt das junge Modell seitlich auf dem hohen Atelierschemel, das Gesicht mit den geröteten Wangen leicht aus dem Profil weggedreht. Von links oben fällt
das Licht auf ihren Körper, der vor dem dunklen Hintergrund hell schimmert. Zu den äußeren Rändern hin lässt der Künstler den Farbauftrag ausdünnen, so dass dort einzelne Pinselstriche auf der ungrundierten Leinwand sichtbar werden, die in ihrer impressionistischen Lockerheit in schönem Kontrast zur Perfektion der Aktdarstellung stehen. Bereits während seiner Ausbildung an der Kunsthochschule in München und anschließend in Paris an der Académie Julian spielte für Corinth die Aktmalerei eine große Rolle. Das vorliegende Gemälde entstand wohl in jener Pariser Zeit. Die ursprüngliche Fassung der Leinwand wurde mit Ölfarbe breit übermalt und bei der Wiederverwendung auf den Kopf gestellt. Mit einer Fotoexpertise von Prof. Dr. Günter Busch, Bremen, 02.01.1995.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 43, 26.05.1995, Lot 7 Privatsammlung Berlin


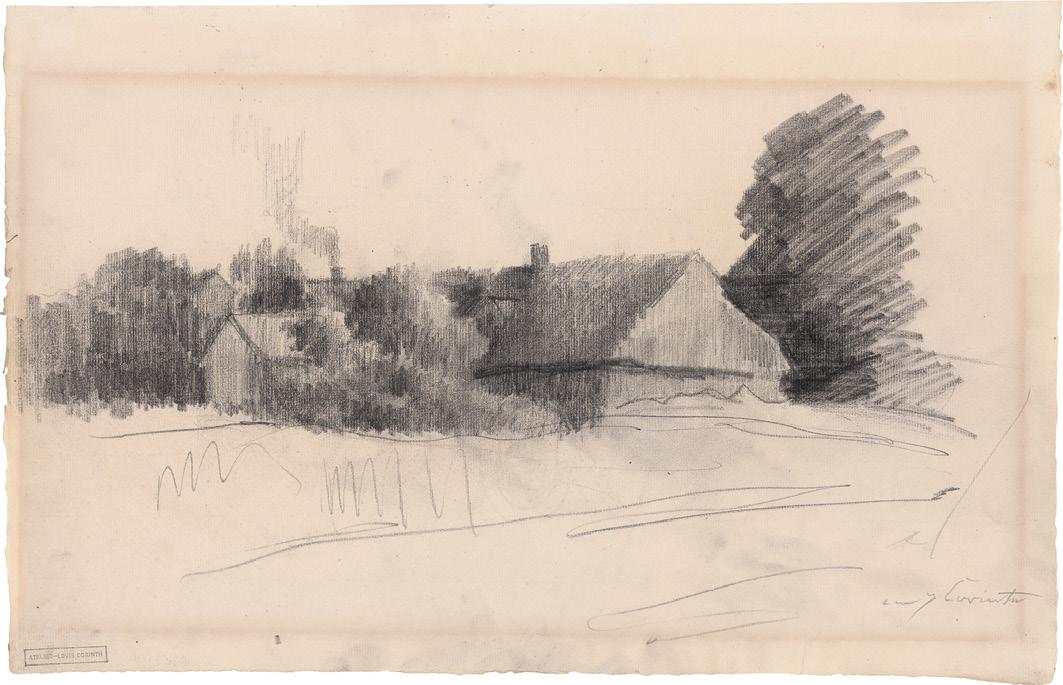
lovis corinth
7019 Liegende
Bleistift auf Velin. Um 1907.
26,8 x 38,9 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“ und (unleserlich) bezeichnet.
900 €
Fein nuancierte Details in Gesicht und Händen der liegenden Frau stehen in schönem Kontrast zur lockeren, summarischen Linienführung in der Gestaltung der unbekleideten Figur.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 27.05.2006, Lot 515 Sammlung Henning Lohner, Berlin
Ausstellung:
Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2008/6 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)
7020 Haus zwischen Bäumen
Bleistift und Zimmermannsbleistift auf Bütten.
30,5 x 47 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“, unten links mit dem Nachlaßstempel „Atelier Lovis Corinth“.
1.200 €
Still liegt das Haus zwischen Bäumen und dichtem Buschwerk, der aus dem Schornstein aufsteigende Rauch zeugt von einem wohligen Herdfeuer. Vertikale Parallelen, schräge und gerade gesetzte Schraffurenfelder in unterschiedlichen Dunkelheitswerten liegen so dicht beieinander, dass sich ein flirrender Effekt ergibt, der einer Naturimpression frappierend nahekommt. Der Vordergrund bleibt hingegen in sparsamen, lockeren Bleistiftschwüngen angedeutet.
Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 16.10.2004, Lot 1082 Privatbesitz Hessen

lovis corinth
7021 Beim Walchensee Bleistift auf Velin. Um 1920.
9,7 x 15,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“.
2.400 €
Souverän variiert Corinth die Intensität seiner Bleistiftlinien, setzt tiefdunkle neben ganz zarte Schraffuren und lässt ein charakteristisches Bild der Walchenseelandschaft entstehen. Der Künstler kaufte 1919 ein Grundstück in Urfeld am Walchensee, auf dem seine Frau Charlotte Berend ihm ein Haus baute. Nach den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges wurde es zum bevorzugten Rückzugsort des Künstlers.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 10.06.2004, Lot 77 Kastern, Hannover, Auktion 21.09.2019, Lot 127 Sammlung Henning Lohner, Berlin

lovis corinth
7022 Radierplatten
9 Kupferplatten. 1912-18. Bis ca. 27 x 19 cm. Schwarz 87, 117, 168, 206, 307, 331, 333 und 334 und 1 Platte nicht bei Schwarz.
1.800 €
Druckplatten aus dem Verlag Fritz Gurlitt, eingeschlagen in die entsprechenden Probedrucke. Enthalten sind: „Sitzender männlicher Akt, nachdenkend“ (Schwarz 86), „Kind im Bett und Mutter“ (Schwarz 117), „Joseph und Potiphars Weib I“ (Schwarz 168), „Knabe mit Badehose und Strohhut“ (Schwarz 206), „Interieur mit Frau“ (Schwarz 307), „Unter dem Weihnachtsbaum“ (Schwarz 331), „Das kranke Kind“ (Schwarz 333), „Mutter und Kind mit Hund“ (Schwarz 334) und ein bei Schwarz nicht verzeichnetes, wohl frühes Motiv „Sitzende Frau auf der Terrasse, Brustbild“ (wohl Charlotte).
Provenienz: Ehemals Nachlass Wolfgang Gurlitt, München
lovis corinth
7023 Drei Grazien
Radierung mit Kaltnadel auf Similijapan. 1920. 34,2 x 26,2 cm (45,8 x 33,3 cm).
Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 100 num. Ex. Schwarz 394 II.
1.200 €
Es handelt sich bei dem Motiv um eine spiegelverkehrte Wiederholung des Gemäldes von 1902. Druck des endgültigen Zustandes mit dem ausgesparten Feld und der Aufschrift im oberen Darstellungsrand. Ganz prachtvoller, in den Schwärzen samtiger und herrlich gratiger Druck mit dem wohl vollen Rand.

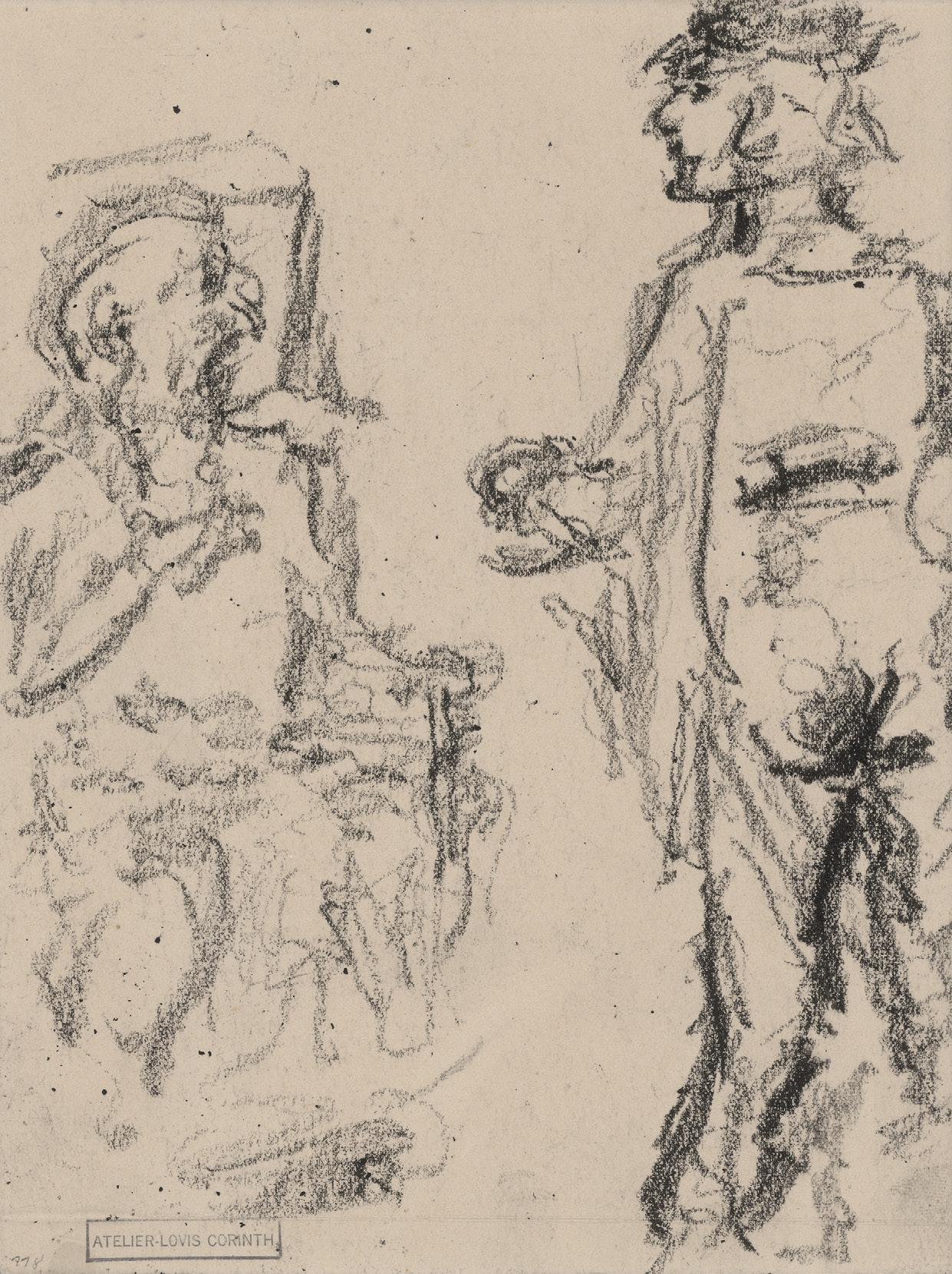
7024
lovis corinth
7024 Zeichnungen zu Wilhelm Tell
5 Zeichnungen auf 3 Blättern. Kreide in Schwarz auf festem Velin. Um 1923.
Je ca. 23,5 x 18 cm.
Jeweils unten mit dem roten bzw. schwarzen Stempel „Atelier - Lovis Corinth“, dort von Wilhelmine Corinth signiert und bezeichnet „11-191-A Tell“, „118“ bzw. „183“. 1.500 €
Die in weichen, lockeren Linien gezeichneten Entwürfe Corinths illustrieren Friedrich Schillers Drama; die Mappe mit Lithographien erschien 1923 bei Karl Nierendorf, Berlin. Zwei Blätter mit Zeichnungen recto und verso, vorhanden sind die Motive „Attinghausen und Rudenz“ (zu Müller 778, drei Zeichnungen), „Der Tell-Sprung“
(zu Müller 783) und „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“ (zu Müller 785). „Kennzeichnend für Corinths Auseinandersetzung mit dem Tell-Thema ist, dass er den Betrachter ganz nahe an das in engen, geradezu intim wirkenden Ausschnitten dargestellte Geschehen hineinführt und weitläufige Szenen und alles damit verbundene Theatralische vermeidet (...) Über die historische Bedeutsamkeit der Geschehnisse hinaus geht es Corinth darum, die menschlichen Aspekte des Dramas zu vergegenwärtigen“ (Alfred Kuhn, Vorwort zur Tell-Mappe).
Provenienz:
Privatbesitz Rheinland Bassenge, Berlin, Auktion 109, 28.05.2017, Lot 8038 Sammlung Henning Lohner, Berlin

7025
lesser ury
(1861 Birnbaum – 1931 Berlin)
7025 Holländische Dorfstraße Kohle auf Velin. 1912/13.
49,3 x 32,5 cm.
Unten links mit Kohle signiert „L. Ury“.
7.000 €
Das helle, klare Nordseelicht findet sogar im Schwarzweiß von Urys Kohlezeichnung seinen Ausdruck. Souverän setzt er helle und dunkle Flächen sowie verschiedene Strukturen gegeneinander und erzeugt ein stimmungsvolles Bild der dörflichen Szenerie. Wohl während seiner Reise nach Holland 1912/13 entstand das kontrastreich komponierte Blatt. Wir danken Dr. Sibylle Groß, Berlin, für die freundlichen Hinweise vom 22.04.2025.
Provenienz: Dr. ing. Carl (auch: Karl) Schapira, Berlin Carlos Soria, New York Kunsthandel Deutschland
Grisebach, Berlin, Auktion 28, 28.11.1992, Lot 134
Tiroche, Herzelia Pituah, Auktion 11, 09.10.1993, Lot 58 Montefiore, Tel Aviv, Auktion 25, 03.07.2014, Lot 193
Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Lesser Ury, Zauber des Lichts, Käthe-Kollwitz-Museum, Berlin 1995/96, S.105 (Schapira-Verzeichnis Nr.93, dort unter dem Titel „Holländisches Dorf/Dorfstraße“, um 1910)
lesser ury
7026 Regennasse Tiergartenallee mit Pferdedroschken: Dame mit Schirm überquert die Straße Radierung auf Bütten. 1921.
19,6 x 13,8 cm (28,3 x 21,7 cm).
Signiert „L. Ury“. Rosenbach 49.
1.200 €
Wohl Zustandsdruck vor der Auflage von 110 numerierten Exemplaren, erschienen im Verlag Max Perl, Berlin. Prachtvoller, tiefdunkler Druck mit breitem Rand.
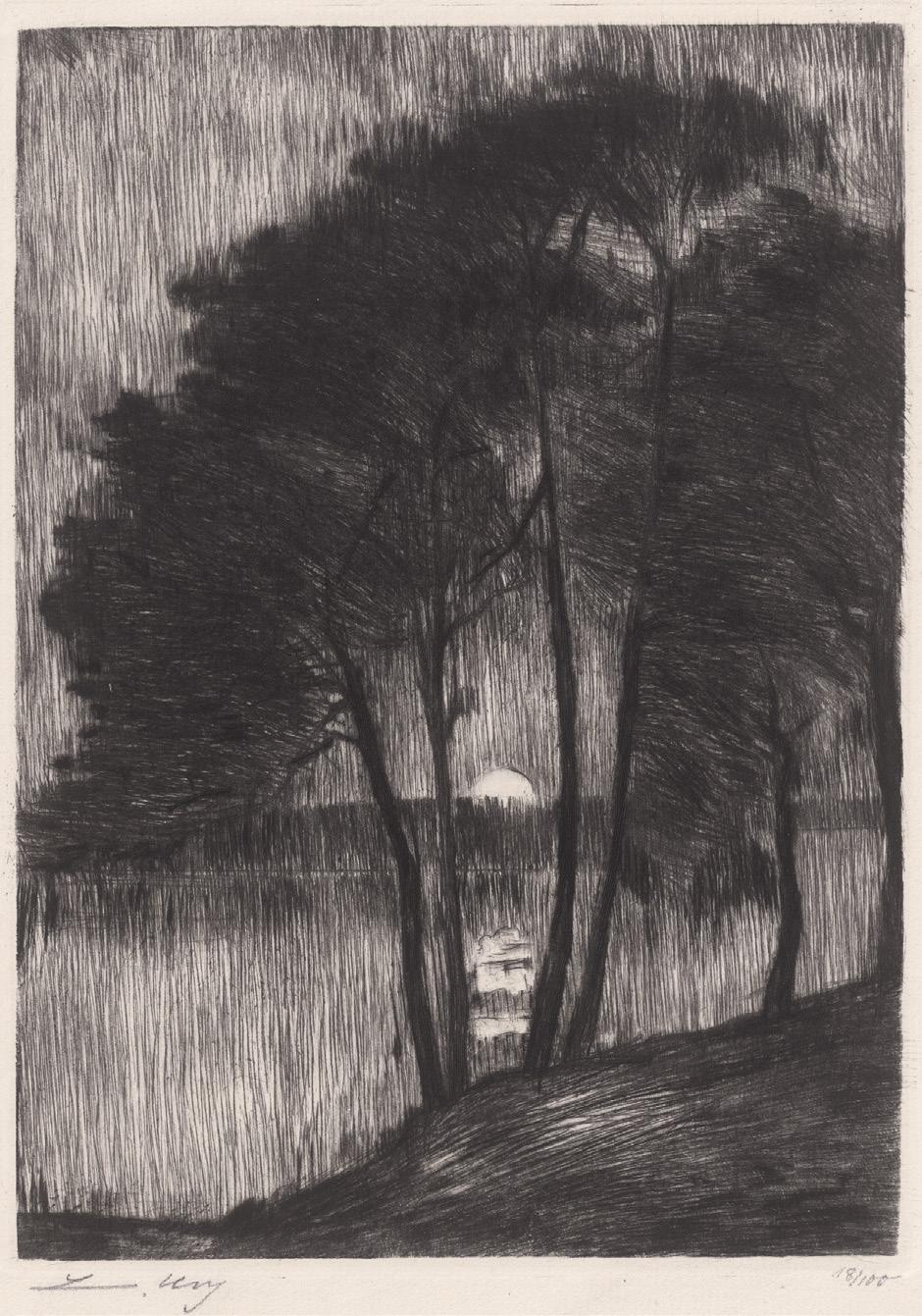
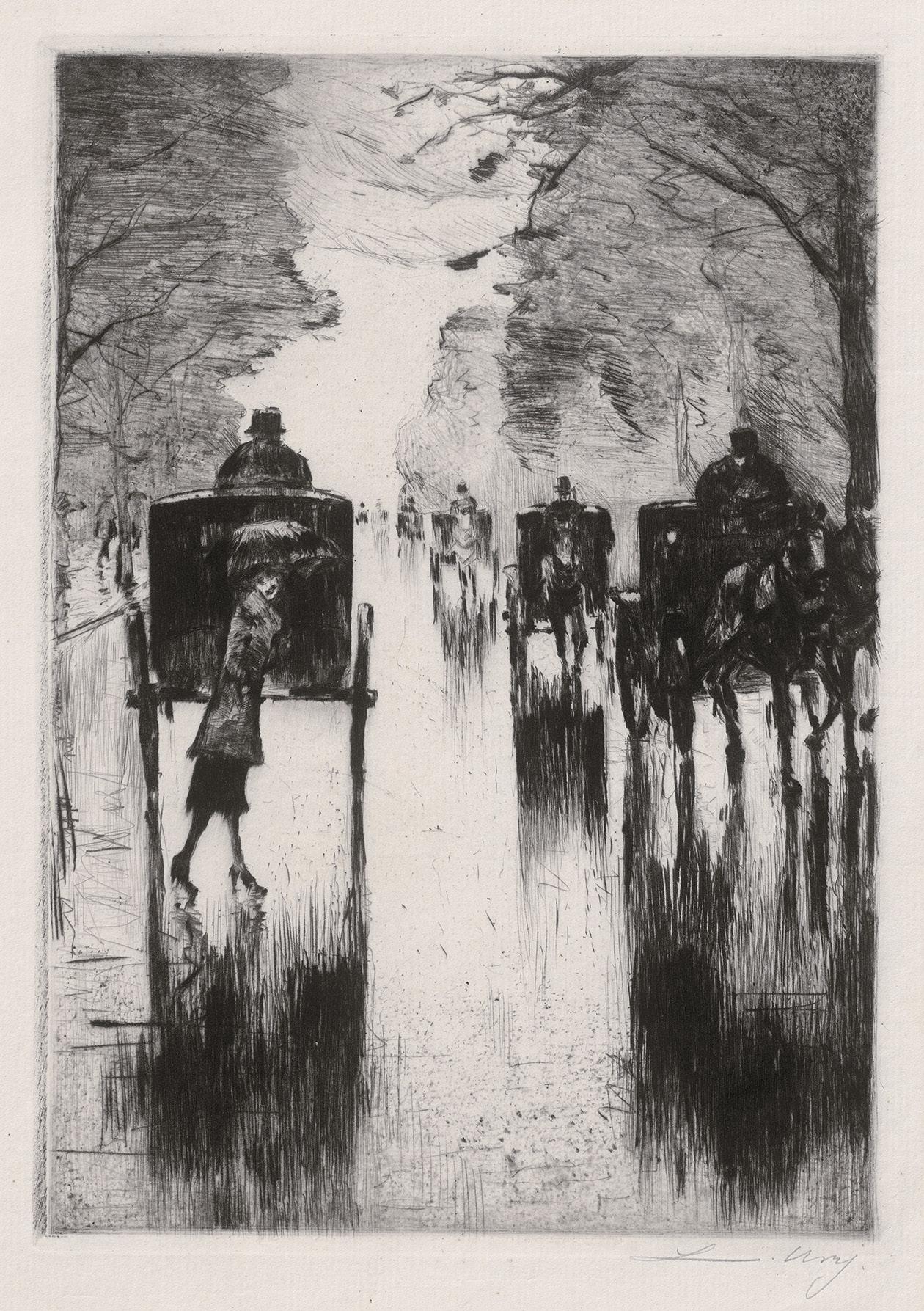
lesser ury
7027 Sonnenuntergang am Grunewaldsee Kaltnadel auf Bütten. 1924. 20,8 x 15,6 cm (35 x 26,8 cm).
Signiert „L. Ury“. Auflage 100 num. Ex. Rosenbach 26.
1.500 €
Die Gesamtauflage von 130 Exemplaren erschien 1924 im Euphorion Verlag, Berlin, hier ohne den Trockenstempel des Verlages. Blatt der Folge „Berliner Impressionen“ aus der Werkreihe I. Prachtvoller, klarer Druck mit Rand, unten mit dem Schöpfrand. Beigegeben: Eine weitere Radierung von Lesser Ury, „Holländische Windmühle“ (1919/82, Rosenbach 40, posthumer Druck der Griffelkunst).
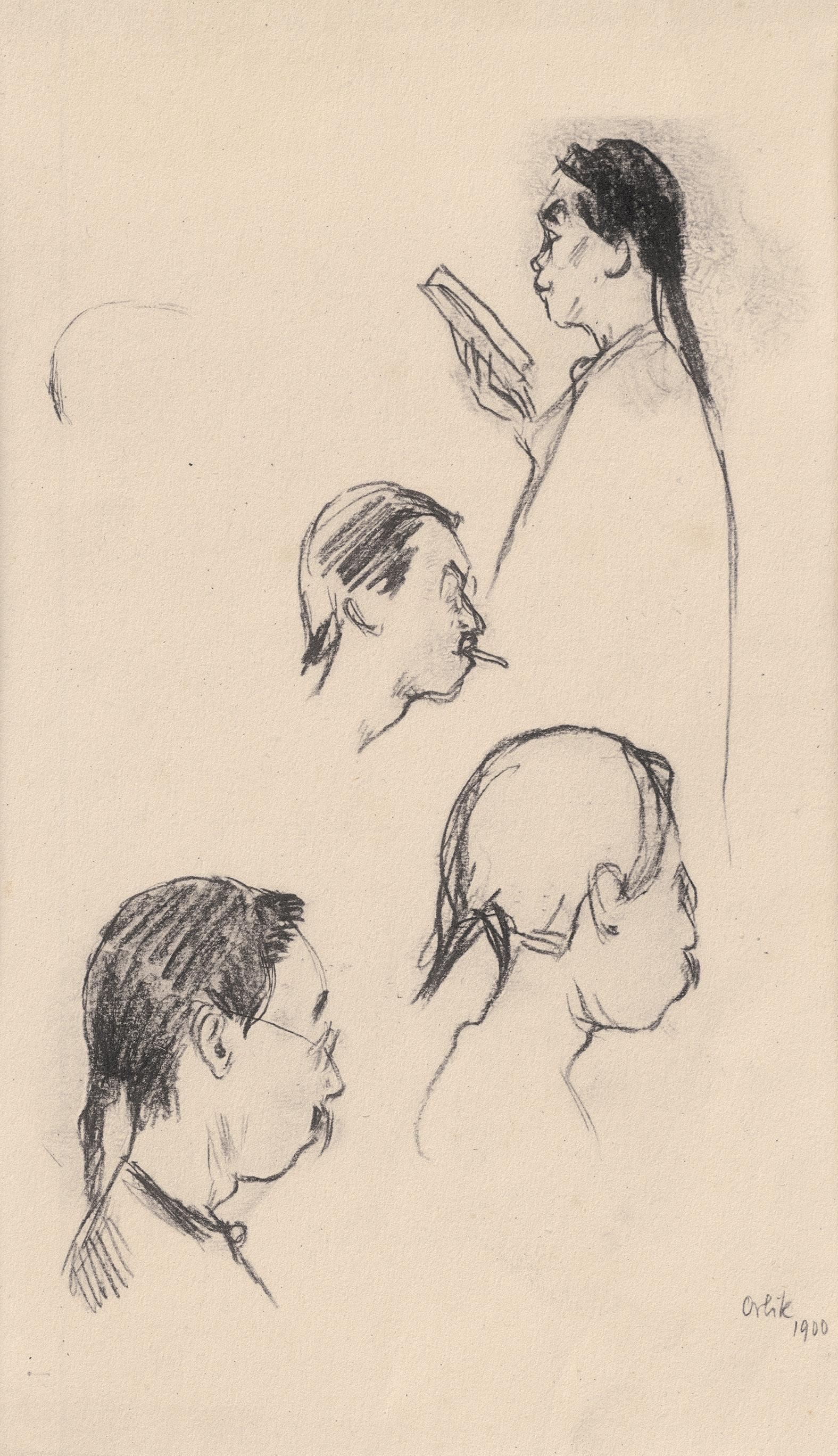

emil orlik
(1870 Prag – 1932 Berlin)
7028 Vier Chinesen
Kreide in Schwarz, teils gewischt, auf Velin. 1900. 24,5 x 15 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“ und datiert.
300 €
Im Zusammenhang mit Orliks erster Japanreise entstanden wohl in China die reizvollen Kopfstudien, in denen sich die zeichnerische Raffinesse des Künstlers zeigt: Wenige summarische Konturlinien und Schraffuren reichen, um ein lebendiges Bild der im Profil gesehenen Männer entstehen zu lassen.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
7029 Rast im Gebirge
Farbholzschnitt auf Japanbütten. 1901.
21,8 x 30,9 cm (25,5 x 34 cm).
Signiert „Emil Orlik“ und datiert sowie bezeichnet „Tokio“ und „5“.
Voss-Andreae H 63 a.
4.000 €
Zwischenzustand zwischen Voss-Andreae H 63 und H 63 a mit einigen roten Details, beim vorliegenden Exemplar abweichend von H 63 a: im runden Zeichen an der Rückentrage des Mannes in Dunkelblau und in der Schärpe der stehenden Frau rechts im Vordergrund. Entstanden vermutlich kurz nach Orliks Japanreise vom Februar 1900. Im Kunsthandel lassen sich in den letzten 25 Jahren nur fünf Exemplare dieses Blattes nachweisen. Ausgezeichneter, in seinen feingliedrigen, linienbetonten Holzstegen herrlich ausgearbeiteter Druck mit Rand. Sehr selten

7030 Straße in Tokio
Farblithographie auf Bütten. 1900. 20 x 24 cm (23,3 x 27,5 cm).
Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 74.
900 €
Erschienen als Blatt 2 der Mappe „Aus Japan“. Die Mappe enthielt insgesamt 16 Graphiken, die während Orliks erster Japanreise im Februar 1900 entstanden und die er 1904 in einer Mappe zusammenfasste. Die geplante Auflage von 50 Exemplaren wurde jedoch laut der Galerie Glöckner nicht ausgedruckt oder teils zerstört. „Straße in Tokio“ wurde, ebenso wie die anderen Farblithographien der Mappe, in Japan abgezogen, während der Künstler die Radierungen erst nach seiner Rückkehr in Deutschland druckte. Prachtvoller, schön nuancierter Druck mit kleinem Rand.
Selten
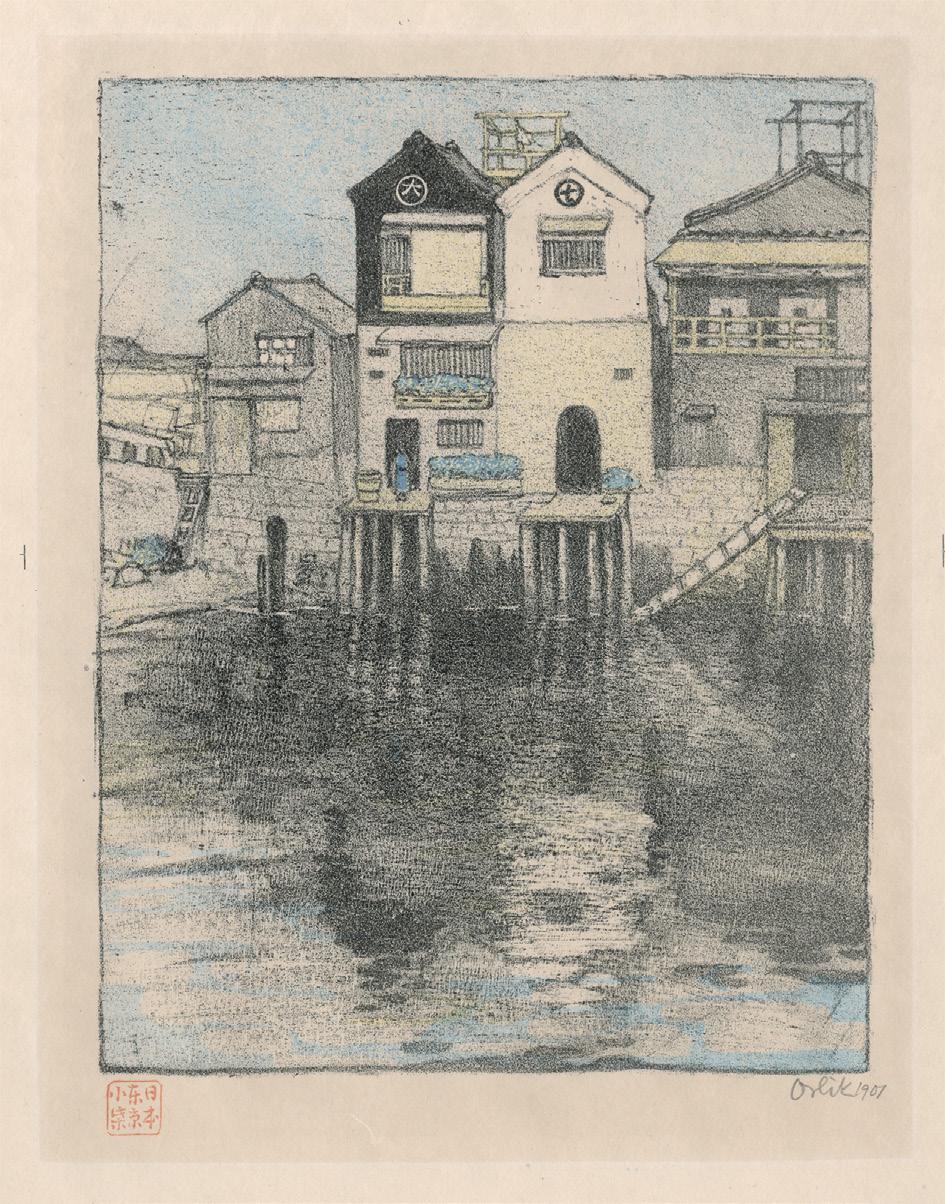
7031 Yeddo-Bashi, Tokio
Farblithographie auf Japan. 1900/01. 20,5 x 16 cm (29,7 x 26,5 cm).
Signiert „Orlik“, datiert „1901“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 75.
800 €
Erschienen als Blatt 3 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, klarer Druck mit dem vollen Rand. Selten

7032
7032 Ein Theater Theehaus Farblithographie auf Bütten. Um 1900. 17,7 x 23,4 cm (21,3 x 27,2 cm).
Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 76.
1.200 €
Das 1878 nach einem Brand wiedereröffnete Kabuki-Theater Shintomi-za im Stadtviertel Tsukiji, in dem auch Orlik im Hotel Metropole wohnte. Die Kabuki- und Nô-Aufführungen dort besuchte der Künstler begeistert und setzte sich künstlerisch mit den dort gewonnenen Eindrücken auseinander. Erschienen als Blatt 4 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, in den Farben frischer Druck mit Rand. Selten
7033 Das Fest der Knaben Farblithographie auf Japan. 1900.
24,1 x 12 cm (28,6 x 15,7 cm).
Signiert „Orlik“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 78.
900 €
Erschienen als Blatt 6 der Mappe „Aus Japan“. Die karpfenförmigen Fahnen werden zum Fest der Knaben am 5. Mai gehisst und gelten als Symbol für Mut und Erfolg im Leben (vgl. Voss-Andreae S. 94). Prachtvoller, differenzierter und farbfrischer Druck mit Rand. Selten

7033


7034 Am alten Burgwall
Farblithographie auf Similijapan. 1900.
24 x 38 cm (30,3 x 44 cm).
Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio, sowie mit dem ovalen Nachlaßstempel.
Voss-Andreae L 79.
1.500 €
Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand. Sehr selten
7035 Wasserstraße in Tokio (Landungsplatz in Tokio)
Lithographie in Blaugrün über gelblicher Tonplatte auf Similijapan. 1900/01.
33 x 23,4 cm (38 x 26,5 cm).
Signiert „Emil Orlik“, datiert und bezeichnet „Tokio“ sowie mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 80.
600 €
Voss-Andreae kennt lediglich Abzüge in Schwarz sowie einen Probedruck in Braun. Dargestellt ist das Uogashi-Ufer, das nördliche Ufer des Nihonbashi-Flusses zwischen Nihonbashi und Edo-bashi (Kuwabara S. 76). Das Blatt entstand während Orliks erster Japanreise im Jahr 1900/01. Prachtvoller Druck mit Rand. In dieser Fassung äußerst selten

7036 Kuruma-Ya (Japanischer Wagenzieher, Ruhender Rikschazieher)
Farblithographie auf Bütten. 1900. 23 x 25,7 cm (30,8 x 36,4 cm).
Signiert „Emil Orlik“ und datiert sowie bezeichnet „Probedr.(uck)“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio. Voss-Andreae L 81, Kuwabara L-7, Abb. 50. 1.400 €
Eine von Orliks ersten druckgraphischen Arbeiten seiner Japanreise. Ganz prachtvoller, klarer Probedruck mit breitem Rand. Sehr selten.
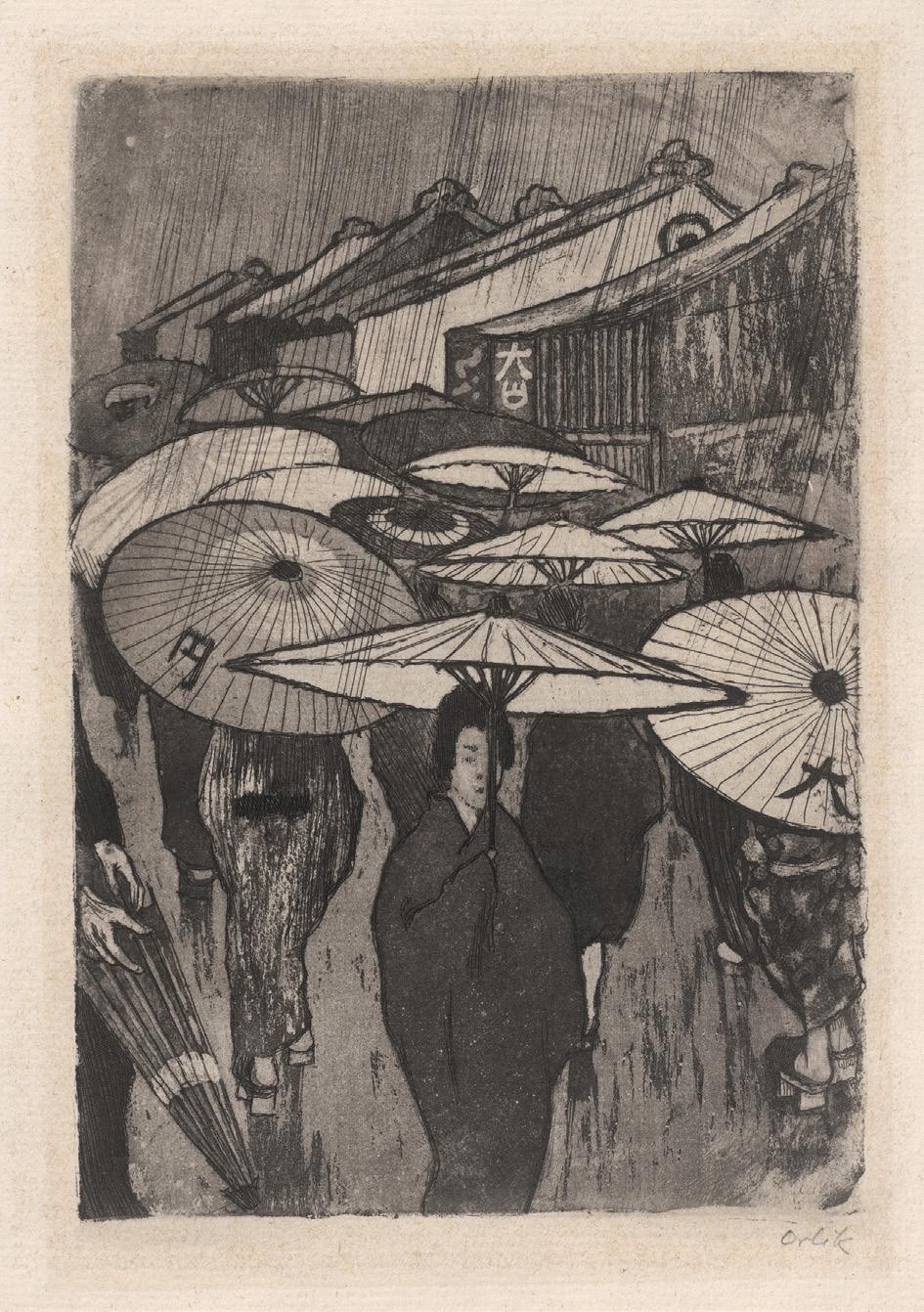
7037 Ein Regentag
Radierung mit Aquantinta auf Bütten. 1901.
16,2 x 11,2 cm (26,5 x 20 cm).
Signiert „Orlik“.
Voss-Andreae R 113.
800 €
Einer der bei Voss-Andreae erwähnten Abzüge in Schwarz außerhalb der farbig gedruckten Mappenauflage, die als Blatt 8 der Mappe „Aus Japan“ erschien. Ausgezeichneter, differenzierter Druck mit dem wohl vollen Rand, links mit dem Schöpfrand.
7038 Japanische Bäuerin
Radierung mit Kaltnadel, Roulette und Aquatinta auf Bütten. 1902.
20 x 9,8 cm (29,3 x 25 cm).
Signiert „Orlik“.
Voss-Andreae R 145.13.
400 €
Voss-Andreae zufolge entstanden die Drucke in Schwarz als Probedrucke außerhalb der Mappenauflage. Die farbig gedruckte Version erschien als Blatt 13 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, in den Schattierungen zart nuancierter Druck mit fein zeichnender Plattenkante und dem wohl vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand. Selten

7038
7039 Am Abend (Dämmerung)
Kaltnadel mit Roulette und Mezzotinto in Braun auf Bütten. 1901/02.
16,3 x 11,7 cm (29,2 x 22,1 cm).
Signiert „Orlik“.
Voss-Andreae R 115.
600 €
Die Abzüge in Schwarz und Braun erschienen Voss-Andreae zufolge außerhalb der Mappenauflage. Dort war das Motiv als Blatt 12 der Mappe „Aus Japan“ enthalten, unter dem Titel „Am Abend“, sonst jedoch auch betitelt „Dämmerung“. Ausgezeichneter, wunderbar differenzierter und tiefdunkler Druck mit breitem Rand.

7040 Mutter und Kind, Japan
Radierung mit Aquatinta auf festem Velin. 1901/02.
13,4 x 9,5 cm (23 x 17,2 cm).
Signiert „Orlik“ und (schwer lesbar) datiert „02“ sowie bezeichnet „Probedr.(uck)“.
Voss-Andreae R 112.
700 €
Probedruck , außerhalb der Mappenauflage, diese wurde farbig gedruckt als Blatt 7 der Mappe „Aus Japan“. Die Radierung druckte Orlik erst in Deutschland, nach der Rückkehr von seiner Reise.
Prachtvoller Druck mit Rand. Selten



7041 Am Westsee bei Hang-chou II
Farbradierung mit Roulette auf festem Velin. 1912.
19,7 x 24,8 cm (29,8 x 39,8 cm).
Signiert „Emil Orlik“, bezeichnet „Probedruck“ sowie gewidmet und dort (später) datiert.
Voss-Andreae R 229.
400 €
Ausgezeichneter, sehr schön differenzierter Probedruck mit partiell mitdruckender Facette, feiner Farbigkeit und breitem Rand.
7042 Am Westsee bei Hang-chou
Kaltnadel mit Roulette auf Van Gelder Zonen-Bütten. 1913.
19,8 x 29,7 cm (29,5 x 46,8 cm).
Signiert „Orlik“ und datiert.
Voss-Andreae R 288.
300 €
Die Radierung entstand im Jahr 1913 beim heutigen Hangzhou. Ausgezeichneter, feiner Druck mit breitem Rand, rechts mit dem Schöpfrand.
7043 Am Meer
Radierung mit Roulette auf Japan. 1921. 32 x 27,3 cm (33 x 29,2 cm).
Signiert „Orlik“. Auflage 30 röm. num. Ex.
Voss-Andreae R 446 bzw. 446 a.
750 €
Voss-Andreae ist lediglich ein Zustandsdruck in Schwarz, noch ohne die Schraffuren im Hintergrund, bekannt (R 446 a); daneben erschien eine Auflage von 130 wohl zumeist farbig gedruckten
Exemplaren (R 446). Ganz prachtvoller, tiefdunkler und wunderbar differenzierter Druck mit Rand. Äußerst selten
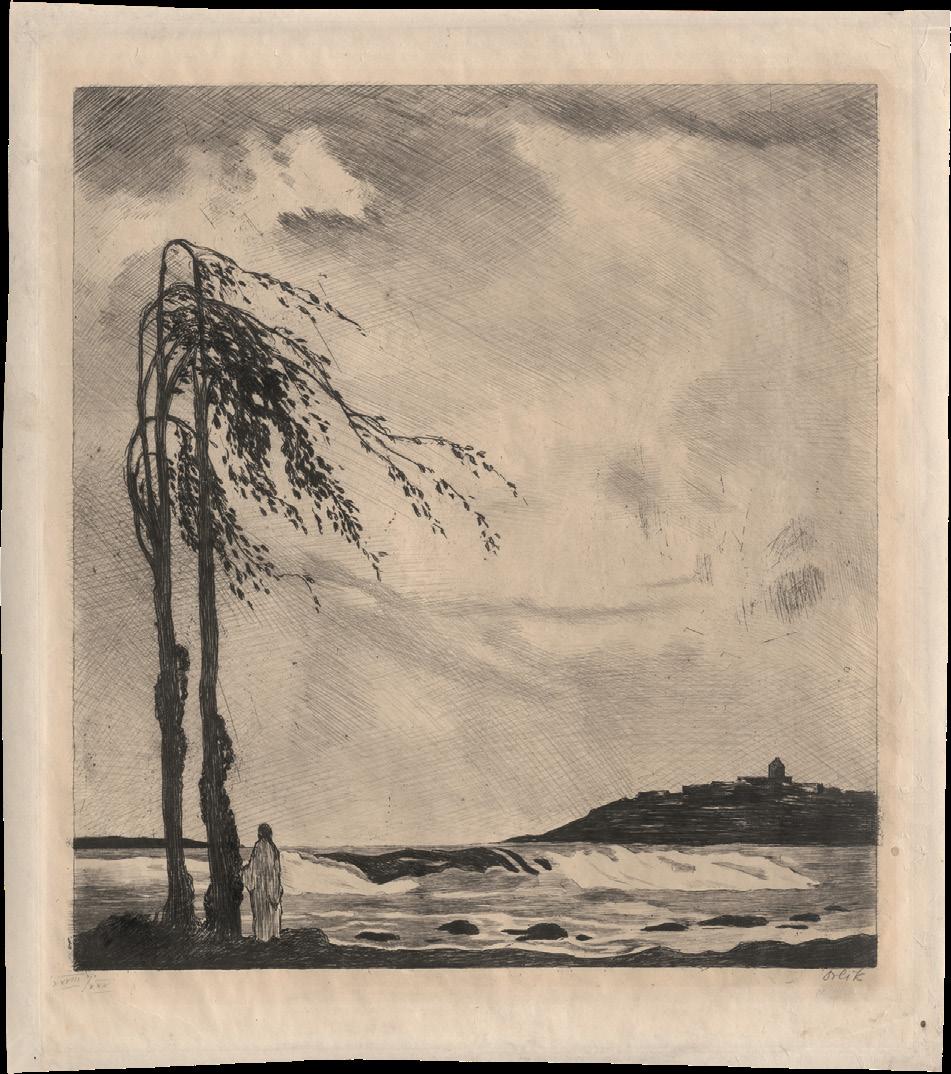
7044 Japanerin im Winterkleid
Kaltnadel mit Aquatinta auf Bütten. 1902/20. 23,9 x 16 cm (35,2 x 23,3 cm).
Signiert „Orlik“.
Voss-Andreae R 413, Kuwabara L-12.
400 €
Einer der Abzüge von 1920 in einem prachtvollen, klaren Druck mit hauchzartem Plattenton und breitem Rand.


7045 Die Reise nach Japan 12 Kaltnadelarbeiten, teils mit Roulette, und 1 Doppelbl. radierter Titel und Impressum auf Van Gelder ZonenBütten. Unter Orig.-Passepartouts, lose in Orig.-Pergamentband mit lithographierter Vignette. 1921.
35,5 x 29 cm.
Die Radierungen sämtlich signiert „Orlik“, das radierte Titelblatt signiert „Emil Orlik“, im Impressum abermals signiert. Auflage 100 num. Ex. Voss-Andreae R 431-443.
900 €
Die hier vollständig vorliegende Mappe umfasst Orliks Eindrücke von seiner zweiten großen Asienreise 1911 und enthält „nicht nur japanische Motive, sondern wir begleiten Orlik auf seiner Reise von Genua über Ägypten, Ceylon, Singapore, Hongkong und Shanghai nach Japan.“ (Glöckner 2008, S. 74). Erschienen bei Bruckmann in München. Neben dieser Ausgabe entstanden 10 weitere Exemplare für die Vorzugsausgabe A. Prachtvolle, gratige Drucke mit zartem Plattenton und deutlich zeichnender Plattenkante, mit vollem Rand, teils mit dem Schöpfrand.
7046 „London“
Kreide in Schwarz auf strukturiertem Velin. Um 1898.
20,2 x 25,4 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“, unten links betitelt.
800 €
1898 führte Orlik eine mehrmonatige Studienreise gleich zu Beginn für längere Zeit nach London. Vermutlich auf dieser Reise entstand die vorliegende, schnell und sicher ausgeführte Zeichnung, der die karierte Struktur des Papiers einen interessanten, in seiner Wirkung vergleichsweise modernen Aspekt verleiht.
Provenienz:
Dorotheum, Prag, Auktion 02.10.2004, Lot 202 Privatbesitz Süddeutschland
7047 New York Rivoli
Kreide in Schwarz und Aquarell auf Velin. 1924.
21,1 x 27,5 cm.
2.000 €
Das Stadtbild von New York mit seinen Straßenschluchten wurde zu seinem Hauptmotiv, als sich Orlik im Januar und Februar 1924 während seiner Amerikareise in der Metropole aufhielt, bevor er nach Cleveland, Ohio, weiterreiste. Unten rechts ist der Schriftzug „RIVOLI“ erkennbar. Das Theatergebäude in South Fallsburg wurde 1923 errichtet; es diente, betrieben von Israel und Arch Kaplan, sowohl als Kino als auch für Theateraufführungen und erlebte seine beste Zeit in der Blüte der Catskill Mountains als Urlaubsziel vor allem jüdischer Erholungssuchender. Orlik zeichnet das mit Backsteinen verblendete Gebäude in zügigen Linien und ziegelfarbiger Lavierung.
Provenienz: Bassenge Berlin, Auktion 96 27.11.2010, Lot 8205
Privatbesitz Süddeutschland



7048 Bildnis einer Dame
Pastellkreiden und Bleistift auf Malpappe.
65,3 x 49,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“.
900 €
In gelassener Haltung und mit abwartendem Ausdruck zeichnet
Orlik die sitzende Dame.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

7049 Bildnis Hildegard Meissner
Ölkreiden auf Malpappe. Um 1925.
69,5 x 49,5 cm.
Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Orlik“.
1.500 €
Vor lebhaft changierendem Hintergrund zeigt Orlik sein sitzendes Modell in der leicht abgewandten Halbfigur, das zarte Inkarnat, die Gesichtszüge und den Perlenschmuck mit großer Delikatesse wiedergebend. Der Künstler war vor allem bekannt für seine Bildnisse von Schauspielern, Berühmtheiten wie Tilla Durieux, Emil Jannings oder Heinrich George standen ihm Modell.
Provenienz:
Grisebach, Berlin, Auktion 27.05.1995, Lot 134
Grisebach, Berlin, Auktion 29.11.2014, Lot 1198
Privatbesitz Süddeutschland
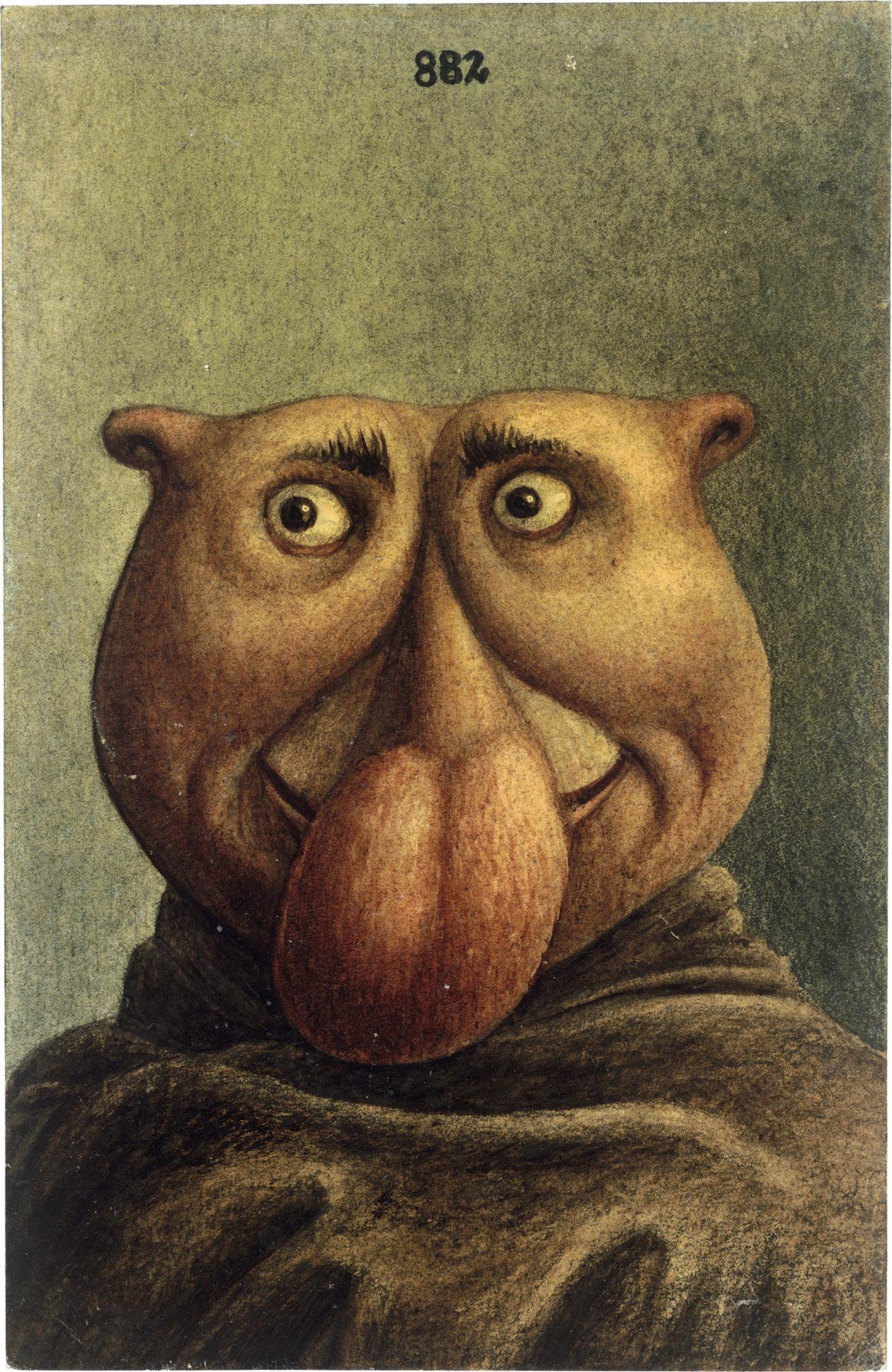
leopold löwy (1871–1940, Wien)
7050 Kopf mit Knollennase Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-1920. 14,2 x 9,2 cm.
Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „882“. 800 €
Aus einem jüdisch-österreichischen Industriellenhaushalt kommend, umgab der exzellente Karikaturist und Schachspieler Löwy, über den nur wenige biographische Details bekannt sind, sich in den Wiener Kaffeehäusern mit vielen Prominenten der Zeit. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.
Provenienz: Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien Privatbesitz Wien Galerie bei der Oper, Wien Privatbesitz Wien
Literatur: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023, LW 207 (mit ganzs. Abb.)


leopold löwy
7051 Grüner Kopf
Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 14 x 9 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz bezeichnet „962“.
800 €
Löwys Karikaturen seiner Zeitgenossen wurden in verschiedenen Wiener illustrierten Zeitschriften veröffentlicht. Des weiteren illustrierte er 1920 eine Sammlung eigens verfasster Tierfabeln. Um der Deportation in ein Konzentrationslager zu entkommen, entschied sich Leopold Löwy 1940 zum Freitod und hinterließ ein umfangreiches Werk kleiner, ungemein feiner und geistreicher Zeichnungen, die spitzfindig und phantasievoll seine Zeitgenossen in den Blick nehmen. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
7052 Phantasiewesen mit Bart
Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 14,2 x 9,3 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz bezeichnet „956“.
800 €
Eine skurrile Kreatur, der unerschöpflichen Phantasie des Künstlers entsprungen und detailreich ausgestaltet: In den Proportionen verzerrt und verschoben, zeigt sich das Wesen dennoch mit menschlichem Blick, das Gesicht und der Körper ausgehend von der menschlichen Erscheinung. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien


leopold löwy
7053 Phantasiewesen frontal Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920.
14,9 x 9,5 cm.
Oben mittig mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und bezeichnet „1066“.
800 €
Frontal blickt das seltsame Wesen aus dem Bild. Auf dem Kopf sitzt ein gescheiteltes Haarbüschel, der Mund mit lückenhaften Zähnen ist geöffnet, der Ausdruck von Augen und hängenden Schultern melancholisch. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
7054 Kopf mit Beinen Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 17,8 x 12,8 cm.
Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „1017“.
800 €
Phantastische Kreatur mit verschobener Anatomie, das Gesicht direkt zwischen den Beinen sitzend, von Löwy feinsinnig gezeichnet und mit subtilen Schattierungen plastisch durchgestaltet. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
Literatur:
Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023, LW 234 (mit ganzs. Abb.)


7056
emil nolde
(1867 Nolde/Schleswig – 1956 Seebüll)
7055 Brunnenplatz (Der Lützowplatz in Berlin) Radierung in Schwarz-Grün auf festem Velinkarton. 1905. 12,8 x 18,1 cm (ca. 20,5 x 29,3 cm).
Signiert „Emil Nolde“, datiert und gewidmet.
Schiefler/Mosel 4 I (von IV).
2.000 €
Eine der frühesten Graphiken von Emil Nolde. Das zweite Exemplar des ersten Zustandes, wie bei Schiefler/Mosel beschrieben und vor allen Veränderungen in der Platte. Einer von insgesamt lediglich sieben Probeabzügen, in einem kräftigen Druck in GrünSchwarz mit differenziertem, fein schimmerndem Plattenton, die Blattränder unregelmäßig beschnitten. Äußerst selten
7056 Beim Absinth Radierung und punktierter Plattenton auf festem, genarbtem Velin. 1911. 10,2 x 14,5 cm (36,8 x 30,5 cm).
Signiert „Emil Nolde.“. Schiefler/Mosel 175.
1.800 €
Selten, Schiefler/Nolde führen lediglich 20 Exemplare der frühen Radierung auf, in der Nolde mit nur wenigen zarten Strichen ein Paar beim Absinthtrinken auf die punktierte Platte skizziert. Delikater Druck mit zartem Plattenton und breitem Rand.

otto mueller (1874 Liebau – 1930 Breslau)
7057 Zwei Mädchen und ein Jüngling (Drei Akte)
Lithographie auf Bütten. 1909. 26,9 x 21,3 cm (34 x 26,3 cm).
Signiert „Otto Müller“ und verso von Erich Heckel monogrammiert „E.H.“.
Karsch 12.
4.000 €
Wohl einer von circa 50 ungezählten Abzügen, unser Exemplar mit einem mit Bleistift eingezeichneten Auge im Gesicht des Jünglings (vgl. das Exemplar der Galerie Nierendorf, Kunstblätter 4/5, 30. Juni 1964). Kräftiger, fein differenzierter Druck mit Rand.

otto mueller
7058 Acht Badende (2)
Lithographie auf Van Gelder Zonen-Bütten. Um 1922. 41,2 x 31,3 cm (46,2 x 35 cm).
Karsch 117.
4.000 €
Wohl neben den bei Karsch erwähnten ca. 25 ungezählten Exemplaren auf glattem Kupferdruckpapier und Werkdruckpapier. Prachtvoller Druck des einzigen Zustandes mit Rand. Selten.
ernst ludwig kirchner
(1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch bei Davos)
7059 Zwei liegende Akte und eine Sitzende Kreide in Schwarz auf Velin. Um 1910.
32,7 x 42,8 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „E L Kirchner“. 25.000 €
Ein ungezwungenes Miteinander und die blühende Sinnlichkeit der drei weiblichen Modelle bestimmen die dichte Komposition. Wenige geschwungene, leicht kantige und äußerst bestimmt gezogene Linien der schwarzen Kreide umfahren die Körperkonturen, die Physiognomien der drei Gesichter sind ebenfalls nur schemenhaft angedeutet, während das Konstrukt von Geraden im Hintergrund einen Bildraum definiert. Hierin spiegelt sich die stilistische Verfestigung von Kirchners Arbeiten seit dem Winter 1909/10. „Kirchners Zeichnung vertraut allein der Linie. Diese leistet Kontur, Fläche, Raum und Volumen. Wischungen und Schattierungen erscheinen nur selten und nicht Volumen modulierend, sondern Flächen bildend.“ (Wolfgang Henze, Kirchner der Zeichner. Am Beispiel seines Menschenbildes 1909-1936, in: Galerie Henze & Ketterer, Kat. 78, Bern 2009, S.11). Kirchner und die anderen Brücke-Künstler beschäftigten sich zu dieser Zeit vornehmlich mit dem Motiv des weiblichen Aktes in ihrem Dresdner Atelier, in diesen Jahren ebenso Lebens- und Arbeitsraum der Künstler, als auch Treffpunkt weiblicher Modelle wie Dodo und anderen. Die drei Frauen sind in betont lockeren Posen und selbstbewusstem Ausdruck dargestellt und scheinen ganz entspannt in sich zu ruhen. Kirchner wie auch die anderen Künstler der Brücke suchten im Aktstudium nicht starre Posen, sondern betonten die sinnliche Ausstrahlung ihrer Modelle durch eine entspannte, ungezwungene Körperhaltung.
Die Arbeit ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, dokumentiert.
Provenienz:
Sammlung Dr. Walter Kaesbach (1879-1961), Berlin/Erfurt/Düsseldorf/Hemmenhofen (vor 1914 vom Künstler erworben)
Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf (1995)
Galerie Vömel, Düsseldorf
Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (1998 vom Vorgenannten erworben, mit dem Sammlerstempel Lugt 6032)
Ketterer, München, Auktion 533 (Sammlung Hermann Gerlinger), 10.12.2022, Lot 456
Ausstellung:
Galerie Remmert und Barth, Überblick 1995, Düsseldorf 1995, Kat.-Nr. 73 (mit Abb.) E. L. Kirchner. Ölbilder, Arbeiten auf Papier, Galerie Vömel, Düsseldorf 1998, S. 14 (mit Abb.)
Expressiv! Die Künstler der Brücke. Die Sammlung Hermann Gerlinger, Albertina Wien 2007, Kat.-Nr. 140 (mit Abb.)
Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, bis 2017) Kirchner im KirchnerHAUS. Originale aus Privatbesitz in seinem Geburtshaus, KirchnerHAUS Museum, Aschaffenburg 2015, Kat.Nr. 16 (mit Abb.)
Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022)
Literatur:
Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, SHG-Nr. 707, S. 311 (mit Abb.)


7060
ernst ludwig kirchner
7060 Tellerjongleur
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1911.
20,7 x 16 cm.
Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 58“.
1.200 €
Äußerst sparsame, sichere Linien konturieren die Figur des Jonglierenden in eleganter, schwungvoller Bewegung. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch Kirchners entnommen, vgl. die Bleistiftzeichnung „Jonglierender Chinese“, 20,5 x 16,2 cm, 1913(?), in: E. L. Kirchner, Zeichnungen, Pastelle, Aquarelle, Aschaffenburg 1980, S. 381, Nr. 56. „Ich lernte den ersten Wurf schätzen, sodass die ersten Skizzen für mich den größten Wert hatten“, schrieb
Ernst Ludwig Kirchner. Das Skizzenbuch ist der Geburtsort seiner kompositorischen Entscheidungen, Formulierungen und Chiffren, die er „Hieroglyphen“ nannte: „Heilige Zeichen“. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 06.04.2025.
Provenienz:
Lise Gujer, Davos
Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin
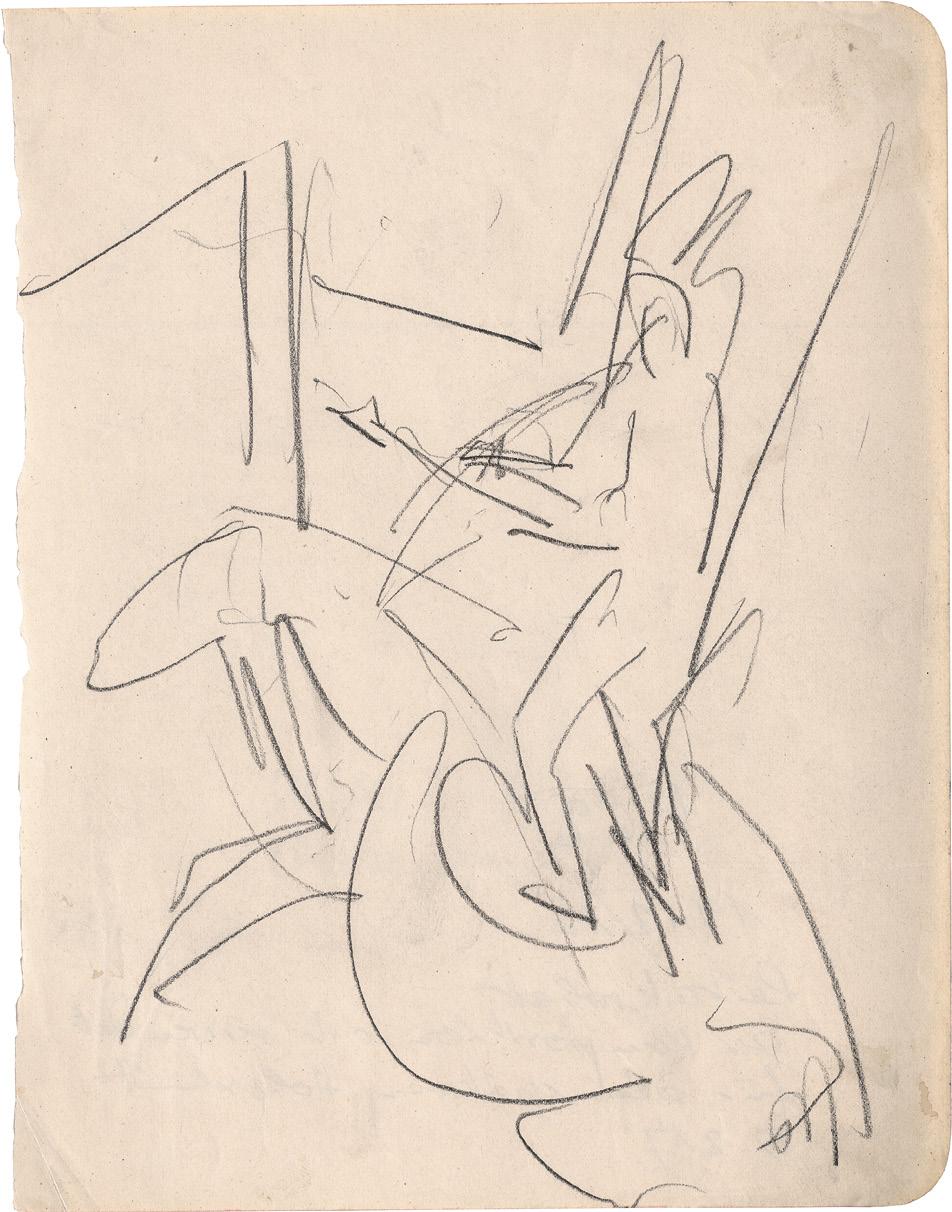
7061
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1910/12. 20,5 x 16 cm.
Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 62“.
1.200 €
Verso von fremder Hand bezeichnet: „Die Komposition ist verwendet für den späteren Holzschnitt DH 271.“ Ernst Ludwig Kirchner hinterließ 181 Skizzenbücher mit ca. 12.000 Zeichnungen. Schon früh wurden diesen Skizzenbüchern und -heften Blätter entnommen, wohl um die 1.000 - 2.000. Was er im Skizzenbuch niederlegte, war gekennzeichnet von der „Ekstase des ersten Sehens“, einer schöpferischen Energie, die bei ihm so nur hier zu finden ist. In beiden vorliegenden Skizzenbuchblättern (vgl. auch Kat.-Nr. 8060) ging es Kirchner um „Bewegung“: Wo erlebte er sie intensiver als im Zirkus; im rasenden Rhythmus eines Teller jonglierenden Chinesen und einer Pferdedressur? Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, vgl.: Presler Skb 10-33,3941; Skb 15-50-54 und Skb 17-39-42. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 06.04.2025.
Provenienz:
Lise Gujer, Davos
Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336
Privatbesitz Berlin
ernst ludwig kirchner
7062 Beim Mähen
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1919. 21,5 x 17,4 cm.
Presler Skb 73, Seite 4.
1.200 €
Wunderbar charakteristisches Blatt für Kirchners Davoser Zeit. Im Oktober 1918 zieht der Künstler, nach seiner Entlassung aus dem Nervensanatorium in Kreuzlingen, in das Haus „In den Lärchen“, einen Bauernhof auf der Längmatte bei Frauenkirch. Der ländliche Vorort von Davos blieb Kirchner bis zu seinem Selbstmord im Jahr 1938 eine neue Heimat. Die schräg zueinander gesetzten Linien sind, ebenso wie die vereinfachte Formgebung, charakteristisch für Kirchners ab 1919 in den Graubündener Bergen, rund um die Stafelalp, entstandene Blätter. Die Zeichnung ist dem Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, bekannt.
Provenienz:
Ketterer, München, Auktion 364, 23.04.2010, Lot 472
Sammlung Henning Lohner, Berlin
Ausstellung:
Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/3 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)

7063 Kälbchen
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1919. 17,3 x 21,6 cm.
Presler Skb 73 / Seite 9.
1.200 €
Um 1919 lebte Kirchner in den Graubündener Bergen, wo rund um die Stafelalp zahlreiche Zeichnungen entstanden. Der vehemente, etwas schroffe Strich und die vereinfachte Formgebung dieser Zeit findet sich auch im vorliegenden Blatt. Die Zeichnung ist dem Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, bekannt.
Provenienz:
Ketterer, München, Auktion 364, 23.04.2010, Lot 484
Sammlung Henning Lohner, Berlin
Ausstellung:
Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/5 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)
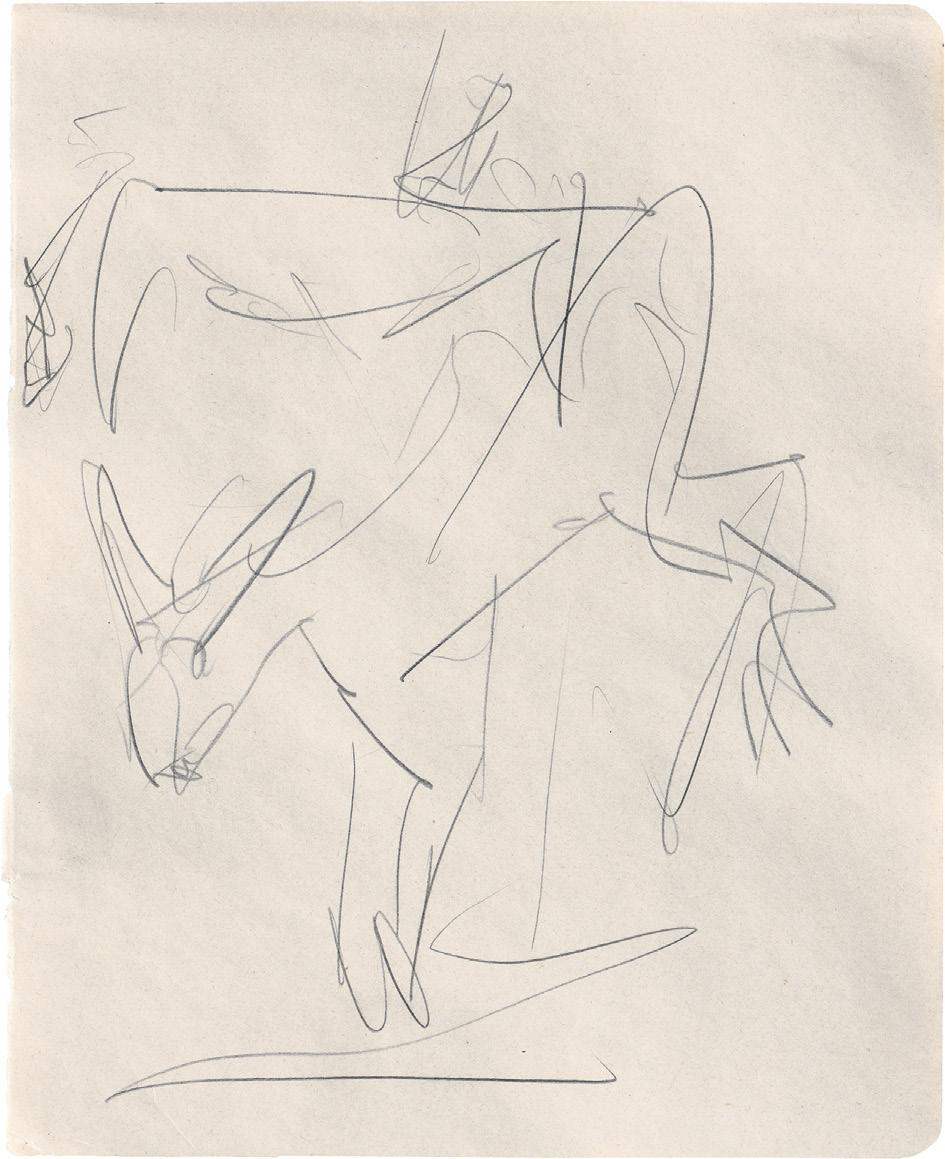

ernst ludwig kirchner
7064 Kohlenhandlung
Lithographie auf dünnem Velin, alt auf Karton kaschiert. 1907.
39,5 x 33 cm (41,8 x 34,3 cm).
Verso auf dem Karton mit Bestätigungsstempel von Walter Kirchner, Bruder des Künstlers, dort von diesem signiert, datiert „30.9.50“ und bezeichnet „Katalog K 80“. Gercken 197, Dube L 43.
2.400 €
Eine der frühesten Lithographien Kirchners aus den Anfangsjahren der Brücke. Meist arbeitete der Künstler damals mit Feder, Pinsel oder Kreide direkt auf den Stein und experimentierte auch mit weiteren Techniken; seine Graphiken druckte er selber, mit
der Hand oder auf seiner eigenen Presse, so dass die Exemplare sich fast immer unikatär voneinander unterschieden. Im Jahr 1907 entwickelte Kirchner die sogenannte „Terpentinätzung“ als ganz eigene lithographische Technik, die es ihm erlaubte, Blätter mit der Hand, ganz ohne Presse, direkt vom Stein abzuziehen. „So sind Kirchners Lithographien sehr charakteristisch und leicht zu erkennen an den oft hauchzarten Tonflächen, die nur auf diese neue Art der Technik erzielt werden konnten.“ (Gustav Schiefler, Die Graphik Ernst Ludwig Kirchners, Berlin 1931, S. 34). Ganz prachtvoller, mit seinen tiefen Schwärzen und den zartgrauen Partien wunderbar differenzierter Druck, teils mit kleinem Rändchen. Gercken sind außer dem vorliegenden lediglich vier weitere Exemplare des Blattes bekannt. Rarissimum
Provenienz: Galerie Matthias Hans, Hamburg

7065
ernst ludwig kirchner
7065 David Müller
Holzschnitt auf Japan. 1919. 34 x 29,6 cm (48 x 40 cm).
Mit dem Signaturstempel „EL Kirchner“.
Gercken 1094 IV B 2, Dube H 409 II B, Söhn HdO 105-6.
3.000 €
Kirchners kleinteilige, splittrige Schnittführung im Holzschnitt „David Müller“ formt ein differenziertes Bild des langgestreckten Männerkopfes mit der Kappe. Figur und Hintergrund sind mit Hilfe der zumeist linearen Strukturen komplex miteinander ver-
zahnt. Die feinen Linien schnitt Kirchner mit dem Geißfuß. David Müller war der dritte Sohn der Eigentümer der Hofgruppe „In den Lärchen“ in Frauenkirch. „Kirchner war die Darstellung so wichtig, dass er sie 1921, aufgefordert sich an den Bauhaus-Mappen zu beteiligen, in einer Auflage von 110 hierfür zur Verfügung stellte.“ (staatsgalerie.de, Zugriff 23.09.2024). Exemplar aus der Auflage mit dem Monogramm im Druckstock, gedruckt für Bauhaus Drucke, Neue Europäische Graphik, 5. Mappe: Deutsche Künstler, Weimar 1921. Es muss sich um einen der nach 1920 entstandenen Drucke handeln, da erst ab diesem Jahr Kirchners Signaturstempel Verwendung fand. Ausgezeichneter Druck mit breitem Rand.
erich heckel (1883 Döbeln – 1970 Radolfzell)
7066 Handstand (Akrobatin)
Farblithographie auf festem Japan. 1921. 27 x 21,7 cm (49,8 x 30,4 cm).
Signiert „Erich Heckel“ und datiert.
Ebner/Gabelmann 774 Lb, Dube L 266b.
20.000 €
„Jetzt hat ein kleiner Wanderzirkus uns, besonders Heckel, ganz gefangen. Er ist allerdings so gut wie wir selten, eigentlich nie einen sahen. Wir sind oft dort und Heckel zeichnet da und zu Haus und versucht darnach zu malen. Der Cirkus kommt übrigens aus Hamburg und hat den schönen Namen Beketow und Männe und wird wohl der Anlaß zu ein paar graphischen Blättern werden.“ So schrieb Siddi Heckel in einem Brief an Gustav Schiefler vom 16.12.1922 (Kopie im NL-Archiv; zit. nach Ebner/Gabelmann 775, S. 136). Das Blatt „Handstand“, auch bekannt unter dem Titel „Akrobatin“, entstand laut Ebner/Gabelmann ebenso wie die Lithographie „Zirkus (Weisse Pferde)“ (Ebner/Gabelmann 775 L) anlässlich einer Versteigerung bei dem Fest der „Freien Secession Berlin“ 1922. Heckel machte, wie bereits in zahlreichen Gemälden der Brücke-Zeit, die Welt des Zirkus, der Akrobaten, Clowns und Artisten zu seinem Bildthema. Eines von insgesamt neun kolorierten Exemplaren, die sich alle farblich unterscheiden, da Heckel vor jedem Abdruck die Farben erneut auf den Stein aufgetragen hat. Prachtvoller, monotypieartiger Druck in drei Farben mit dem vollen Rand, links mit dem Schöpfrand.
Provenienz:
Galerie Günther Franke, München Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Erich Heckel. Druckgraphik 1905-1967, Galerie Günther Franke, München 1967/68, Kat.-Nr. 106


erich heckel
7067 Liegende
Farbholzschnitt auf hauchdünnem Chinabütten. 1913.
Ca. 18,1 x 10,6 cm (35,6 x 21 cm).
Signiert „Erich Heckel“ und datiert.
Ebner/Gabelmann 583 H, Dube H 159 II B, Söhn HdO 115-2.
2.800 €
Farbiger Druck von dem zersägten, in zwei Teilen eingefärbten
Stock in Schwarz und Rot. Abzug der Vorzugsausgabe, erschienen in „Ganymed. Ein Jahrbuch für die Kunst“, 5. Band, München 1925. Kräftiger, farbfrischer Druck wohl mit dem vollen Rand.

erich heckel
7068 Tübingen
Kreidelithographie auf Velin. 1920. Ca. 48,6 x 38,2 cm (59,7 x 45,7 cm).
Signiert „Erich Heckel“ und datiert.
Ebner/Gabelmann 767 L IV, Dube L 264 IV.
2.400 €
Eines von 80 Exemplaren des endgültigen Zustandes mit dem bei Ebner/Gabelmann beschriebenen grauen Ton über der gesamten Darstellung. Das Motiv entstand im Zuge von Heckels erster Reise an den Bodensee im September 1920. Dargestellt ist der Blick auf die Neckarfront von Tübingen mit dem Hölderlin-Turm im Bildzentrum. Prachtvoller, kräftiger Druck mit Rand. Bitte Zustandsbericht erfragen.

hermann max pechstein (1881 Zwickau – 1955 Berlin) 7069 „Entsagung“
Lithographie auf festem Japan. 1908. 40,5 x 33,5 cm (54,5 x 37,3 cm).
Signiert „M. Pechstein“, datiert und betitelt. Krüger L 27.
1.800 €
Nach seinem Studium an der Dresdner Akademie lernte Pechstein in Frankreich die aktuellen künstlerischen Entwicklungen kennen, und insbesondere die vereinfachten Formen und die Gestik der Fauves inspirierten seine eigene künstlerische Arbeit. Das Blatt „Entsagung“ zählt zu Pechsteins frühesten Lithographien, entstanden nur zwei Jahre nach seinem Eintritt in die Künstlergemeinschaft Brücke. Krüger ist keine Auflage bekannt, er nennt lediglich Drucke auf Velin, von denen einige als Eigendruck bezeichnet sind. Prachtvoller, wunderbar kreidiger Druck mit Rand. Äußerst selten
hermann max pechstein
7070 Fischerkopf IX
Holzschnitt auf handgeschöpftem Bütten. 1921. 40 x 32,2 cm (50,6 x 37,8 cm).
Signiert „HMPechstein“. Auflage 100 Ex. Krüger H 245, Söhn HdO 105-10.
1.500 €
Erschienen als Blatt 10 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Prachtvoller, kräftiger und dennoch ausgewogen differenzierter Handabzug mit dem vollen Schöpfrand.


hermann max pechstein
7071 Selbstbildnis mit Pfeife
Holzschnitt auf weichem rauen Blotting-Papier. 1921. 34,1 x 28 cm (41,3 x 30,9 cm).
Signiert „HMPechstein“ und bezeichnet „#18.“. Krüger H 250.
1.500 €
Reiberdruck vor der Auflage von insgesamt 125 Exemplaren, erschienen in „Die Schaffenden“, IV. Jahrgang, 1. Mappe. Unser Exemplar ohne den Trockenstempel des Euphorion Verlages unten links. Prachtvoller, seidig schimmernder Abzug mit dem vollen, kleinen Rand.

christian rohlfs
(1849 Niendorf/Holstein – 1938 Hagen/Westfalen)
7072 Hockender weiblicher Akt
Holzschnitt in Rotbraun auf hauchdünnem Japanbütten. Um 1913.
Ca. 39 x 17,5 cm (39,5 x 19,5 cm).
Signiert „Chr. Rohlfs“, numeriert „47“ und verso wohl von fremder Hand bezeichnet „Christian Rohlfs“. Utermann 80.
1.200 €
Das seltene Blatt in einem kräftigen Abzug, wie so typisch bei Rohlfs etwas schräg und teils bis zu den Blatträndern gedruckt.
christian rohlfs
7073 Zwei Tanzende
Linolschnitt auf gelblichem Velin. Um 1913.
28,8 x 30,6 cm (37 x 38 cm).
Signiert „Chr. Rohlfs“. Utermann 84, Vogt 70, Söhn HdO 105-11.
2.500 €
Erschienen als Blatt 11 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Entgegen Vogt und Utermann stellte Söhn zu Recht fest, dass es sich um einen Linolschnitt, nicht um einen Holzschnitt handelt. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, oben mit dem Schöpfrand.
august macke
(1887 Meschede – 1914 Perthes-les-Hurlus)
7074 Begrüßung
Linolschnitt auf Japanbütten. 1912.
24,2 x 19,7 cm (38 x 28 cm).
Verso von Elisabeth Erdmann-Macke betitelt und bezeichnet „August Macke: Begrüssung, bestätigt: Elisabeth Erdmann“.
Peters III/8, Wingler III/8, Söhn HdO 103-8.
1.200 €
Erschienen als Blatt 8 der III. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Ausgezeichneter, stellenweise ganz minimal trockener Druck mit Rand.
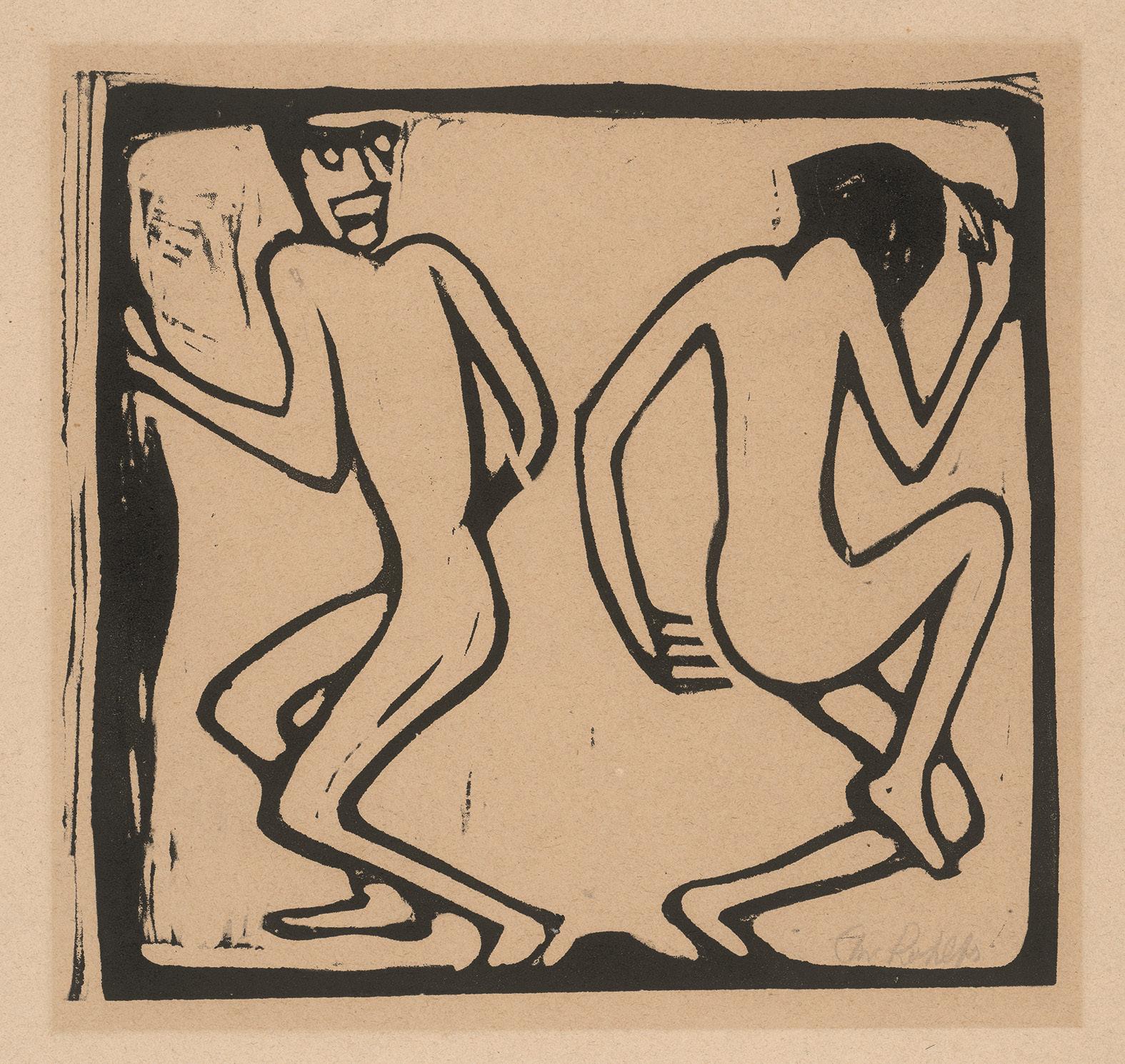

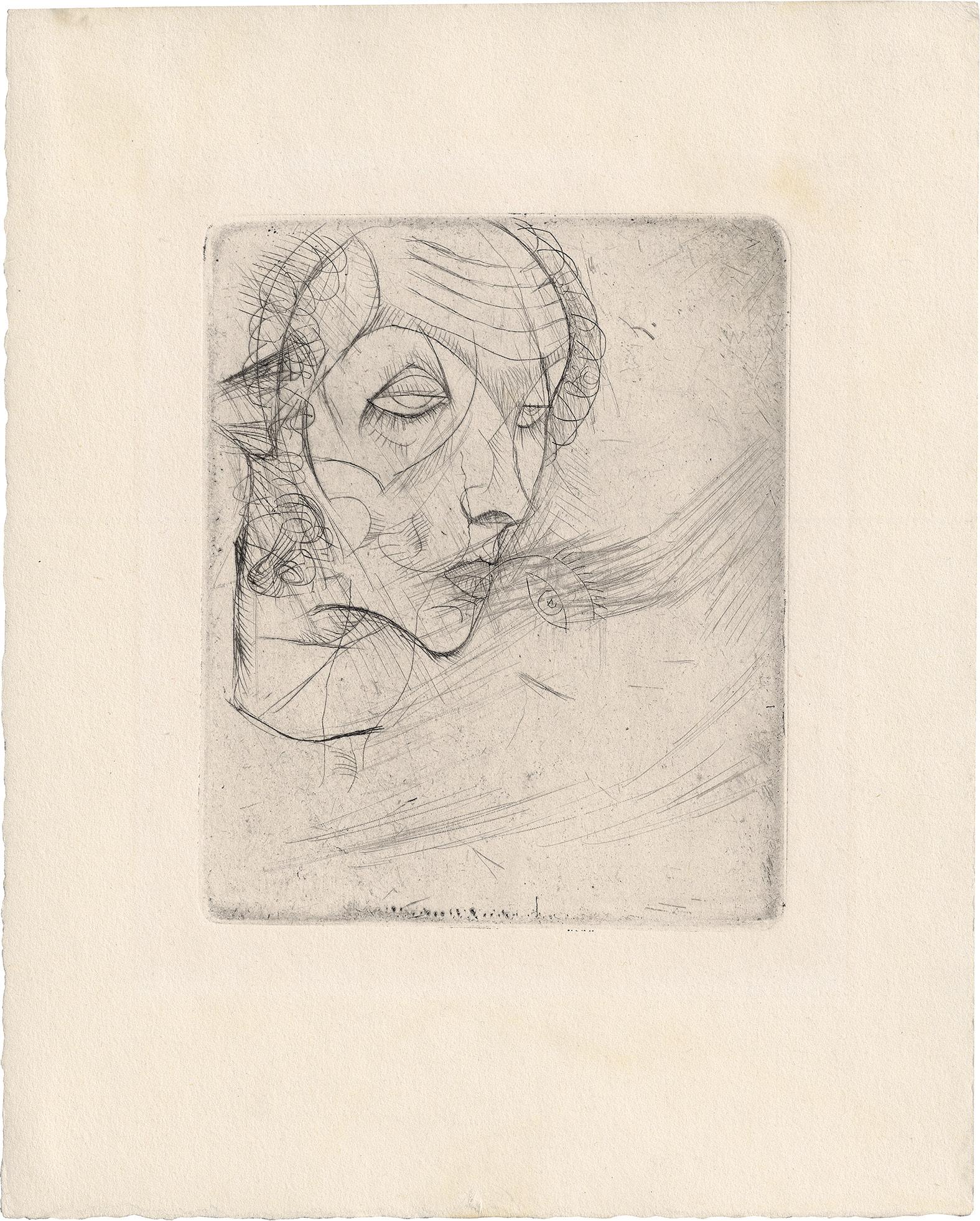
7075
egon schiele
(1890 Tulln a.d. Donau – 1918 Wien)
7075 Selbstbildnis
Kaltnadel auf gelblichem Kupferdruckkarton. 1914/22. 12,7 x 10,5 cm (21,8 x 17,5 cm).
Kallir 4 b (von c 2).
3.000 €
Das Selbstbildnis ist eine der ersten Radierungen Schieles, entstanden bereits im Frühjahr 1914. Arthur Roessler stellte dem Künstler die notwendigen Mittel zur Verfügung, und Robert Philippi unterwies ihn in der Technik des Radierens. Kallir sind keine zu Lebzeiten des Künstlers abgezogenen Exemplare bekannt, und er erwähnt lediglich zwei Drucke von der unverstählten Platte. Aus der Auflage von 80 Drucken von der verstählten Platte, erschienen in der acht graphische Blätter umfassenden Mappe „Das graphische Werk von Egon Schiele“ im Rikola Verlag, Verlag Neuer Graphik, Wien u.a. 1922. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand.
oskar kokoschka
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)
7076 Männerbildnis
Bleistift und Kohle auf bräunlichem Packpapier. Um 1918. 20 x 16,5 cm.
2.400 €
Charakteristische frühe Zeichnung. Aus den für diese Zeit typischen dichten Parallelschraffuren und feinsinnig gezeichneter Gesichtspartien lässt der Künstler das frontal ausgerichtete Antlitz eines jungen Mannes entstehen. Mit beimontierter Kopie eines späteren Briefes des Künstlers, in dem er sich auf die Zeichnung bezieht, sie um 1913 datiert und irrtümlich vermutet, es handele sich bei dem Dargestellten um Nijinsky. Die Authentizität der Zeichnung wurde von Prof. Alfred Weidinger, Wien, am 08.12.2024 anhand eines Fotos bestätigt. Sie wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.
Provenienz: Privatbesitz Österreich


7077
max oppenheimer (gen. Mopp, 1885 Wien – 1954 New York)
7077 August Strindberg Radierung auf festem Japan. 1911. 15,3 x 13,2 cm (40,7 x 28 cm).
Signiert „MOPP“. Auflage 25 num. Ex. Pabst 2, Stix/Osborn 7.
800 €
Mit besonderer psychologischer Dichte zeichnet Oppenheimer den schwedischen Dramatiker, beinahe en face, den durchdringenden Blick direkt zum Betrachter gerichtet. Die kleine Auflage erschien bei Fritz Gurlitt, Berlin. Ganz prachtvoller, klarer und fein differenzierter Druck mit tief eingeprägter Plattenkante und dem vollen Rand, unten und links mit dem Schöpfrand.
mappenwerke
7078 Sema. 15 Originalsteinzeichnungen 15 Lithographien auf Similijapan sowie 3 Bl. Titel/Impressum, Begleittext und Inhaltsverzeichnis. Lose in Orig.Halbleinenmappe. 1912. 45 x 40 cm (Blattgröße).
Die Lithographien jeweils signiert. Auflage 200 num. Ex. Söhn HdO 355-1 bis 15. 18.000 €
Das seltene, einer modernen Kunstauffassung verpflichtete Mappenwerk ist in kompletter Erhaltung nahezu unauffindbar. Erschienen in einer Gesamtauflage von 215 numerierten Exemplaren im Delphin-Verlag, München 1912. Kurz vor der Gründung des Blauen Reiters fand sich im Sommer 1911 eine Gruppe Münchner Künstler zur Vereinigung „Sema“ (griechisch: „Zeichen“) zusammen. Ihre Mitglieder entstammten nicht nur der Bildenden Kunst, sondern auch der Literatur, Architektur und Musik. Parallel zu ihrer ersten Ausstellung im April 1912 in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser in München erschien das vorliegende Mappenwerk mit Beiträgen von Carl Caspar, Maria Caspar-Filser, August Fricke, Robert Genin, Frank S. Herrmann, Fritz HofmannJuan, Gustav Jagerspacher, Paul Klee (Kornfeld 42 B b), Alfred Kubin (Raabe 43), Max Oppenheimer (Pabst L2), Edwin Scharff, Egon Schiele (Kallir 1 b 2), Adolf Schinnerer, Julius Wolfgang Schülein und Carl Schwalbach. Für Schiele (es handelt sich um sein erstes graphisches Selbstbildnis), Klee, Kubin und Oppenheimer waren dies jeweils die ersten Lithographien, die sie schufen. Die sämtlich unter Aufsicht der Künstler abgezogenen Platten wurden nach dem Druck abgeschliffen. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand, jeweils unten links mit dem gedruckten Signet der SemaVereinigung.
Provenienz: Privatbesitz Berlin





otto heinrich (1891 Berlin – 1967 Potsdam)
7079 Kanal an der Fischerinsel Öl auf Leinwand. 1912.
60,5 x 67,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „Otto Heinrich“ und datiert.
1.800 €
Otto Heinrich, ausgebildet u.a. von Philipp Franck, widmete sich immer wieder dem Motiv der Berliner Fischerinsel, wie in dieser Ansicht von Schiffen in der sonnenbeschienenen Friedrichsgracht, dargestellt vermutlich auf Höhe der Fischerbrücke.
Provenienz:
Van Ham, Köln, Auktion 21.11.2008, Lot 944
Privatsammlung Potsdam
7080 „An der Fischerbrücke in Alt-Berlin“
Öl auf Leinwand. 1914/43.
80,5 x 88 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun über Blau zweifach signiert „Otto Heinrich“ und in Braun datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz betitelt.
2.000 €
Auf der winterlichen, von Eisschollen bedeckten Spree wird den Kähnen die Fahrt erschwert. Der Blick fällt im Hintergrund rechts vermutlich auf die von 1891 bis 1893 neu erbaute Fischerbrücke, die zwei Türme links könnten zur Nikolaikirche gehören. In eindrucksvoll großem Bildformat erschuf Heinrich 1914 diese Ansicht seiner Heimat in Alt-Berlin, die er im Jahre 1943 noch einmal überarbeitete.
Provenienz:
Dannenberg, Berlin, Auktion 05.12.2015, Lot 3748
Privatsammlung Potsdam
Ausstellung:
Große Berliner Kunstausstellung 1914 (verso auf dem Keilrahmen mit deren fragmentarischem Klebeetikett)


otto heinrich
7081 „Alte Zugbrücke in Rügenwaldermünde a.d. Ostsee“ Öl auf Leinwand.
31 x 58,8 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Otto Heinrich“, verso auf dem Keilrahmen zweifach mit Bleistift bzw. Kugelschreiber betitelt und bezeichnet „(a.d. Wipper)“ sowie von fremder Hand bezeichnet und mit Kreide in Weiß numeriert „69“.
1.000 €
Die Rügenwaldermünde, mit polnischem Namen Darówko, an der Ostsee gelegen, war das älteste Seebad Preußens. Otto Heinrich erfasst hier die Hafeneinfahrt auf der Wipper, die von einer Schiebebrücke überspannt wird und nur von Fußgängern passierbar ist.
Provenienz:
Leo Spik, Berlin, Auktion 13.06.2013, Lot 69 Privatsammlung Potsdam

robert hermann sterl (1867 Großdoberitz – 1932 Naundorf)
7082 Ruderboot am Anleger Öl auf Holz.
23 x 30,3 cm.
Seitlich rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „R. St.“, verso (von fremder Hand?) mit Kreide in Blau bezeichnet „A 193“ und „11“. Wohl nicht bei Zimmermann/Popova
3.000 €
Ein warmer, brauner Grundton dominiert das stimmungsvolle Gemälde, aufgelockert von hellen Akzenten sowie Nuancen von

Rot und Blau. Mit lockerem Duktus trägt Sterl die pastosen Farben auf, lässt dabei aber vielfach die hellbraune Grundierung durchscheinen. „Er hat in der Dresdner Galerie gelernt, daß Kunst von Können kommt und daß nicht der Intellekt, sondern der sinnliche Eindruck den Maler macht. Gerade heutzutage, wo die Achtung vor dem Metier fast geschwunden ist und jeder Stümper sich ein Kulturfaktor dünkt, ist es nicht hoch genug anzuerkennen, daß ein Künstler von Sterls Format nur Maler, nicht mehr und nicht weniger sein will.“ (Max Liebermann über Robert Sterl, 1928, zit. nach robert-sterl-haus.de, Zugriff 11.03.2025).
Provenienz: Privatbesitz Berlin
7083 Arbeiter im Steinbruch
Kohle auf Velin. 1914.
38 x 48,3 cm.
Unten rechts mit Kohle monogrammiert „R. St“ und datiert.
1.000 €
Um 1897 tauchten erste Darstellungen aus den Steinbrüchen im Elbsandsteingebirge in Sterls Werk auf, und von 1905 an wurde die Steinbrucharbeit zum bedeutendsten Thema in seinem malerischen Werk. Die vorliegende Kohlezeichnung zeigt die Mühen der Steinbrucharbeiter, einen großen Quader mit einer Karre zu transportieren. Die Steinblöcke vorne und im Hintergrund, die expressive Bewegtheit der Arbeiter und technische Gerät im Vordergrund links verleihen der Komposition eine Schroffheit, die ihre Entsprechung in der vehementen Strichführung findet.
Provenienz:
Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg, 30.06.1947
Privatbesitz Berlin
käthe kollwitz (1867 Königsberg – 1945 Moritzburg)
7084 Mütter gebt von euerm Überfluß! Kreidelithographie auf Velin. 1926. 34,4 x 32,1 cm (61 x 50 cm). Signiert „Kollwitz“. Knesebeck 227 I wohl d (von III b).
1.200 €
Fürsorglich und hingebungsvoll widmet sich die junge Mutter ihrer Aufgabe, die Kleinsten der Gesellschaft, die Säuglinge, zu ernähren. Behutsam nimmt sie eines an sich, während das andere noch wohlig in ihrem Schoß liegt. Mit unserem Blatt, das im Auftrag der Kinderärztin Marie-Elise Kayser entsteht, unterstützt Kollwitz das Ziel, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr hohe Säuglingssterblichkeit zu bekämpfen. Kayser eröffnet 1919 die erste Frauenmilch-Sammelstelle Deutschlands. Im Unterschied zu anderen Kliniken wirbt sie aber auch außerhalb von Krankenhäusern und Wöchnerinnenheimen um Spenderinnen, um eine möglichst große Milchmenge zu erreichen. Da Kollwitz diesen Stein vermutlich mit Schrift zu Kayser gab, sind jene Drucke ohne Schrift die frühesten, und bei ihnen handelt es sich um die zum freien Verkauf vorbehaltenen Abzüge. Knesebeck verzeichnet von diesen Exemplaren vor der Schrift unter I.d lediglich drei Exemplare auf Velinkarton, mit unserem taucht nun ein weiteres auf dünnerem Velin auf. Prachtvoller, kräftiger Druck des äußerst seltenen ersten Zustandes vor der Schrift, mit sehr breitem Rand. Bitte Zustandsbericht erfragen.

7085 Heimarbeit
Kreide- und Pinsellithographie auf dünnem Affichenpapier. 1925.
68,5 x 45 cm (71,5 x 48 cm). Knesebeck 217 B II. 1.800 €
Exemplar des Plakatdrucks von einem zweiten Stein, mit dem Plakattext in Schreibschrift, der endgültige Zustand mit der lithographierten Signatur oben rechts und dem durchgehenden, leicht welligen Strich oberhalb der Darstellung, vermutlich vom Steinrand. Prachtvoller Druck mit kleinem Rand. Selten

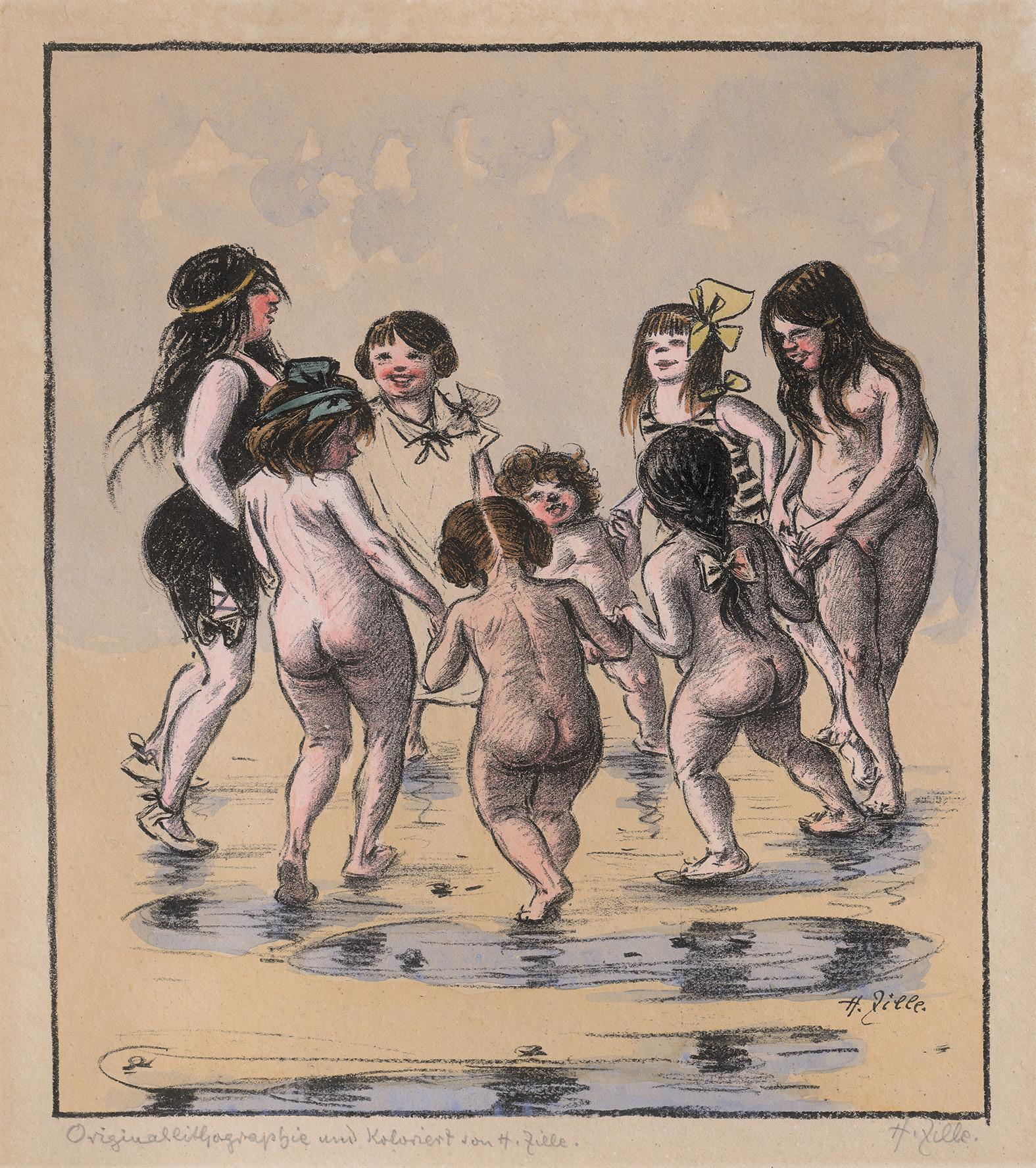
heinrich zille
(1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)
7086 Ferienkolonie
Lithographie und Aquarell auf festem Velinkarton. 1919. 24,4 x 21,1 cm (39,5 x 29,8 cm).
Signiert „H. Zille.“ und vom Künstler bezeichnet „Originallithographie und koloriert von H. Zille.“. Rosenbach 97 II.
1.200 €
Die Lithographie entstand als Blatt 39 des Zyklus „Zwanglose Geschichten und Bilder“. Unser Exemplar ohne die lithographierte Schrift, aber vor allen Auflagen auf festem, genarbtem Karton gedruckt und großflächig mit Aquarellfarben handkoloriert. Das Motiv zeigt acht fröhliche und zwanglose Kinder aus allen Altersklassen beim Ringelreihen in einem Ferienlager am Meer.
Provenienz:
Galerie Pels-Leusden, Berlin (dort erworben 2005)
Privatbesitz Berlin
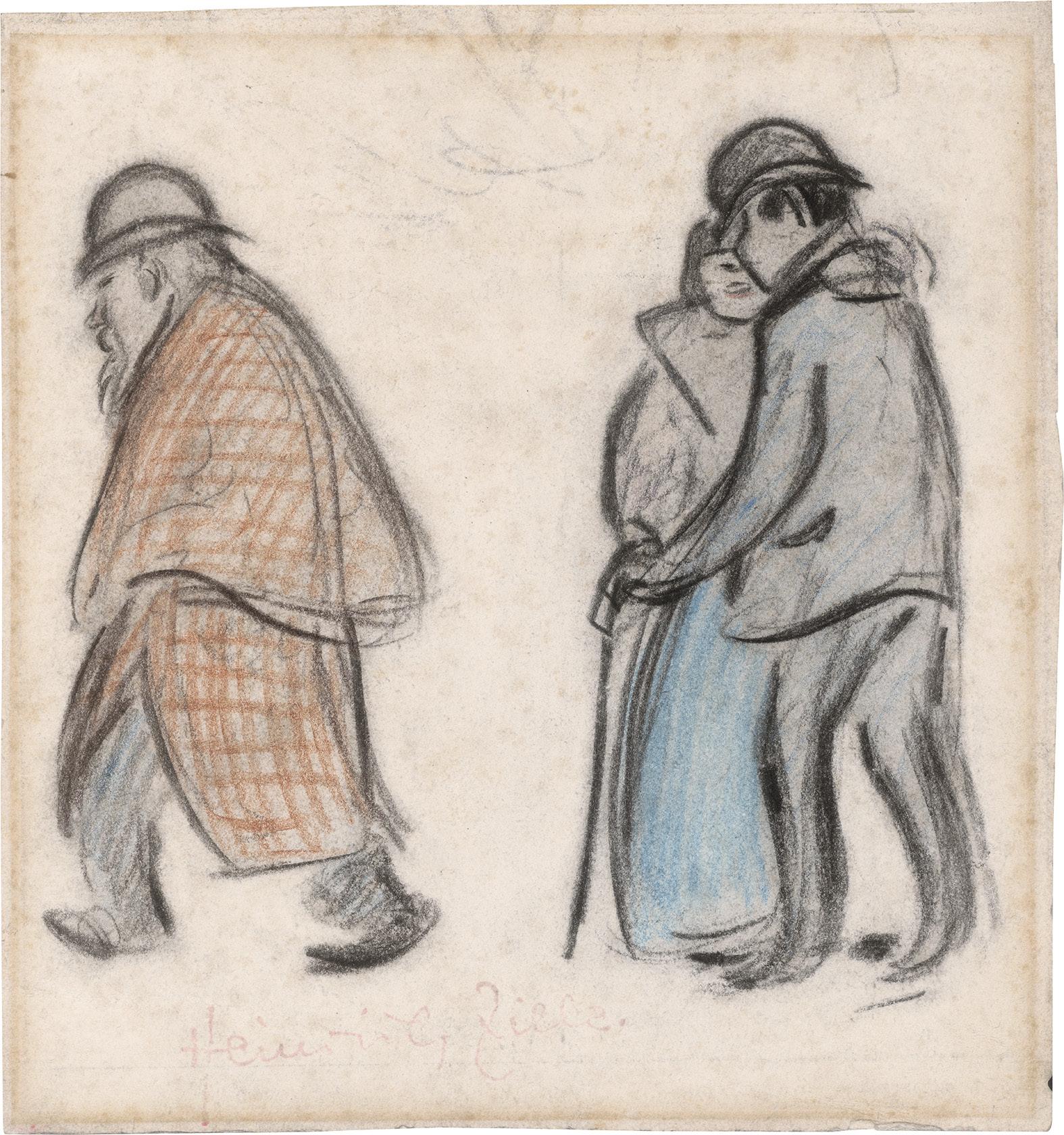
heinrich zille
7087 Alter Mann und Paar Farbige Kreiden auf dickem, festem Büttenkarton.
Ca. 23 x 21,2 cm.
Mit dem roten Nachlaßstempel „Heinrich Zille.“ (Lugt 2676 b, Rosenbach 1).
2.500 €
Schnellen Schrittes entfernt sich ein älterer Herr im karierten Umhang von einem jungen Paar rechts im Bild. Ausschnitthaft und fast zusammenhangslos skizziert Zille die für ihn so typischen Figuren des Berliner Alltagslebens mit sicherem Strich und in dezentem, teils kräftigem Kolorit. Verso das Fragment einer weiteren Zeichnung von Heinrich Zille, ebenfalls mit dem roten Nachlaßstempel.
Provenienz:
Grisebach Berlin, Auktion 54, 30.11.1996, Lot 113 Galerie Pels-Leusden Berlin (dort erworben 2008)
Privatbesitz Berlin

george grosz (1892–1959, Berlin)
7088 Straßenszene
Lithographie auf Velin. 1919/20.
38,7 x 26,5 cm (52,3 x 38 cm).
Signiert „GROSZ“.
Dückers E 60, Söhn HdO 105-4.
1.200 €
Erschienen als Blatt 4 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, laut Impressum gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Entgegen der offiziellen Angaben im Impressum vermutet Dückers eine Fotolithographie, gedruckt von Hermann Birkholz. Etwas trockener und dennoch ausdrucksstarker Abzug mit deutlicher Steinkante und dem vollen Rand.
otto dix
(1891 Untermhaus bei Gera – 1969 Singen)
7089 Selbstporträt im Profil
Lithographie auf dünnem glatten Velin. 1922.
21 x 14,9 cm (37,4 x 27,5 cm).
Signiert „Dix“. Karsch 50.
900 €
Das ausdrucksstarke Selbstbildnis in einem ausgezeichneten Druck mit breitem Rand.


max beckmann (1884 Leipzig – 1950 New York)
7090 Modell
Lithographie auf JWZanders-Bütten. 1911.
33,8 x 26,8 cm (44,3 x 36,2 cm).
Signiert „Beckmann“ und datiert. Auflage 40 num. Ex. Hofmaier 35 B.
1.200 €
Beckmann selbst betitelte die Arbeit einst in seiner Liste als „Sitzende dekolletierte Frau“. Die frühe Lithographie in einem ausgezeichneten, kräftigen Druck mit dem vollen Rand.

andreas gering (1892–1957, Nürnberg)
7091 Im Schützengraben Bleistift und Farbstifte auf dünnem Bütten, kaschiert auf schwarzem Unterlagepapier. Um 1916.
30,3 x 42,3 cm.
900 €
Eine von Gerings eindrücklich prägnanten, dichten Zeichnungen, die er mit Bleistift und Farbstiften vermutlich direkt an der Front skizzierte: Die Ecken des Papiers zeigen vom Fixieren Nadellöchlein, anschließend wurde es wohl zum Transport in der Mitte gefaltet. Von einer Anhöhe aus staffelt Gering den Bildraum nach hinten und richtet den Blick an die Frontlinie, hinweg über mehrere mit Männern gefüllte Schützengräben, aus denen in Massen die Soldaten auf das tosende Schlachtfeld stürmen. Die am Horizont leuchtend rot explodierenden Geschütze akzentuiert Gering zusätzlich noch mit leichten Hieben auf dem Papier, so dass man sich als Betrachter, wie so oft in seinen Zeichnungen, noch intensiver in das grauenvolle Kriegsgeschehen hineinversetzen kann.
Provenienz: Nachlass Andreas Gering, Nürnberg

andreas gering
7092 Auf dem Schlachtfeld Kreide in Schwarz auf JWZanders-Bütten. Um 1916.
44,5 x 56,7 cm.
Verso mit dem schwarzen Nachlaßstempel.
1.000 €
Dynamische, kompositorisch wohldurchdachte, bis zu den Rändern hin ausgearbeitete Zeichnung Gerings mit einer für ihn typischen Szene auf einem Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg. Gering, der selbst nach einem Bombenangriff verschüttet und schwer verletzt geborgen wurde, setzt sich in weiten Teilen seines Schaffens mit den Gräueltaten des Krieges auseinander.
Provenienz: Nachlass Andreas Gering, Nürnberg
karl hofer (1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)
7093 Lot und seine Töchter Öl auf Eternit, auf Holz aufgeblockt. 1912.
40,5 x 40,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „CH.“ (ligiert).
Wohlert 232.
15.000 €
Sinnlich, in lockerer, unbefangener Natürlichkeit bewegen sich Lot und seine Töchter. Ein großes, zwischen Bäumen aufgespanntes Tuch schirmt die Szene im Vordergrund von der umgebenden Landschaft ab. Ohne jede Schwülstigkeit und frei von aller Wertung stellt Hofer das Miteinander seiner biblischen Figuren dar. Die Arbeit entstand vermutlich in Paris, wo Hofer auf Anregung von Julius Meier-Graefe von 1908 bis 1913 lebte und wo seine malerische Frühphase endete. Das Gemälde zeigt in seiner geschlossenen Komposition die Auseinandersetzung mit dem Vorbild Hans von Marées und mit dem Spätimpressionismus Paul Cézannes, ohne bereits die überlängte Schlankheit der Figuren späterer Jahre aufzuweisen. Es ist formal etwas aufgelöst und vereinfacht; in einem flüssigen Malstil mit locker gesetzten, kurzen Pinselstrichen gestaltet, behält die Szene ihre Erkennbarkeit. Die Palette von zarter, gedämpfter Farbigkeit unterstreicht die Sinnlichkeit der Szene. Mehrfach beschäftigte sich Hofer mit dem
Motiv: Eine Vorstudie in Kohle befindet sich in der Graphischen Sammlung der Albertina, Wien, und eine große Fassung im Kunstmuseum Hannover. „Alfred Flechtheim und Karl Hofer hatten sich in Paris kennengelernt und waren sich im legendären Café du Dôme begegnet. Es entwickelte sich eine viele Jahre währende Freundschaft zwischen dem damaligen Sammler Flechtheim und dem jungen Künstler Hofer. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges – Hofer war mehrere Jahre in Frankreich in Kriegsgefangenschaft – waren seine Werke ein fester Bestandteil des Galerieprogramms. Flechtheim vertrat den Künstler exklusiv und stellte dessen Werke zwischen 1919 und 1933 regelmäßig und mehrfach pro Jahr aus. Zudem präsentierte er Hofer in den Jahren 1928 und 1931 in Einzelausstellungen.“ (alfredflechtheim.com, Zugriff 20.08. 2024). Ausgezeichnete Arbeit mit herausragender Provenienz.
Provenienz:
Privatbesitz Wien
Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf (1933)
Privatbesitz Bayern
Galerie Bassenge, Berlin, Auktion 64, 1994, Lot 6351
Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Karl Hofer, Schloss Cappenberg, 1991, S. 71 (mit Abb.)



fritz ehlotzky
(1886 Mistek, Mähren – vermutlich 1942)
7094 Scherenschnitte
27 Bl. Scherenschnitte auf Velin sowie 6 Bl. Titel. Lose in 6 Orig.-Kartonumschlägen und 4 Orig.-Kartonmappen in Orig.-Schuber.
50 x 44 cm (Blattgröße).
Jeweils signiert „Ehlotzky“, die Titelblätter alle monogrammiert „F.E.“.
1.800 €
Von Spiritualität erfüllte Darstellungen, in großer Klarheit expressionistisch aufgefasst und souverän im Scherenschnitt umgesetzt. Das hier vorliegende Portfolio umfasst vier Mappen mit den Titeln „Du und Ich“ (5 Scherenschnitte), „Mutter“ (5 Scherenschnitte), „Wandlung“ (5 Scherenschnitte) und „Welt“, diese wiederum unterteilt in die Mappen „Seele“, „Geist“ und „Gestalt“ (jeweils 4 Scherenschnitte). Der Graphiker und Autor Ehlotzky gestaltete auch mehrere Brettspiele der Elo-Reihe, darunter 1927 den Klassiker „Fang den Hut“. Äußerst selten, eine Auflagenhöhe ist nicht bekannt.

walter helbig (1878 Falkenstein – 1968 Locarno)
7095 „Die Hirten“ Öl auf Leinwand. Um 1919. 85 x 66 cm.
Verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz signiert „Helbig“ und betitelt.
1.500 €
Die Engel oder ihre inneren Stimmen führen die Hirten zu Jesus. Den geistigen Aspekt dieser Bewegung macht die flirrende Durchlichtung der Komposition sichtbar. Seine expressive, abstrahierende Formgebung spiegelt Helbigs Nähe zum Expressionismus. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wandte sich Helbig in seinem Schaffen vermehrt religiösen, spirituellen und mythischen Themen zu; diesem Werkkomplex ist auch das Gemälde „Die Hirten“ zuzu-
rechnen. Helbigs Biographie liest sich wie ein Kompendium der künstlerischen Avantgarde: Er gründete mit Hans Arp und Oscar Lüthy den „Modernen Bund“, dem u.a. Cuno Amiet und Giovanni Giacometti angehörten, und beteiligte sich 1912 an der zweiten Ausstellung der „Redaktion der Blaue Reiter“ bei Hans Goltz in München; in Berlin zeigte Herwarth Walden 1913 im Ersten Deutschen Herbstsalon drei Ölbilder Helbigs, und im Jahr darauf nahm er an der ersten Dada-Ausstellung in der Galerie Coray in Zürich teil. 1919, im Entstehungszeitraum des vorliegenden Gemäldes, schloss er sich der Berliner Novembergruppe an.
Provenienz: Sotheby‘s, München, Auktion BE/00017, 29.05.1992, Lot 24 Privatsammlung Berlin

lou albert-lasard (1891 Metz – 1969 Paris)
7096 Kleiner Bison
Bronze mit goldbrauner Patina. 1922. 14 x 27 x 10 cm.
Unten auf der Standfläche monogrammiert „LAL“ sowie mit dem Gießerstempel „W. Füssel Berlin“.
1.200 €
Während ihrer Zeit in Berlin von 1920 bis 1928 wurde Lou AlbertLasard Mitglied der Novembergruppe. 1920 und 1923 hatte sie Einzelausstellungen in der Galerie I.B. Neumann und der Galerie Nierendorf. In dieser Zeit entstand unsere wunderbar expressive, auf wesentliche Grundformen reduzierte Bronze eines liegenden Bisons. Prachtvoller Guss mit lebendiger Oberflächengestaltung und warmer Patina mit Fokus auf der Gestaltung des Gesichts.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
Literatur:
Thomas Schelper (Hrsg.), Wilhelm Füssel - Charlottenburger Bronzegießer, Ausst.-Kat. Georg-Kolbe-Museum, Berlin 2011 (Abb. S. 22)
franz marc
(1880 München – 1916 vor Verdun)
7097 Schöpfungsgeschichte I
Holzschnitt auf dünnem Japanbütten. 1914/22. 24 x 20 cm (35 x 25 cm).
Verso mit dem Stempel „Handdruck vom Originalholzstock bestätigt“, dort signiert von Maria Marc. Lankheit 842.2, Söhn HdO 103-9.
1.200 €
Das Blatt war von Franz Marc ursprünglich vorgesehen für eine nicht verwirklichte Illustrationsfolge zum Buch Genesis (vgl. Lankheit 840, 841 und 843) und erschien in einer ersten, nicht veröffentlichten Auflage als Handdruck des Künstlers sowie in der hier vorliegenden zweiten posthumen Auflage als Druck des Staatlichen Bauhauses Weimar. Erschienen als Blatt 9 der III. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, unten und links mit dem Schöpfrand.

heinrich campendonk (1889 Krefeld – 1957 Amsterdam)
7098 Sitzender weiblicher Akt in Landschaft mit Bauernhaus Holzschnitt auf Bütten. 1920/21. 21,9 x 21,7 cm (37,5 x 31,8 cm). Signiert „Campendonk“. Engels/Söhn 51 b (von c), Söhn HdO 103-3. 1.200 €
Erschienen als Blatt 3 der III. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, unten und oben mit dem Schöpfrand.

henri laurens (1885–1954, Paris)
7099 Tête
Collage, Farbstifte und Feder in Schwarz auf bräunlichem Maschinenpapier, auf Karton aufgezogen. 1915. 18,2 x 13 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz (berieben) signiert „H. Laurens“ und datiert sowie gewidmet „a Josette Gris“. 28.000 €
Kontrastierende Formen und fragmentierte Flächen, Rund und Eckig, Hell und Dunkel setzt Laurens gegeneinander und evoziert so die Gestalt eines Kopfes, beinahe mit dem räumlichen Effekt eines Flachreliefs. Indem er gewöhnliche Materialien verwendet wie einfaches, helles und dunkles Papier, reduziert er die Farbwerte auf Schwarz und Beige, mit wenigen subtilen Akzenten in Blau und Rosa sowie gepunkteten Strukturen. Der elementare Gegensatz von Licht und Schatten bestimmt die komplexe und mit äußerster Genauigkeit konstruierte Komposition. Die spielerischen Kringel, rechts und links mit der Feder hinzugefügt, verleihen ihr Anmut und deuten möglicherweise stilisierte Seitenlocken an, wie auch Josephine Baker sie damals trug. Laurens‘ Freundschaft
mit Georges Braque brachte ihm ab 1912 die Prinzipien des synthetischen Kubismus nahe, die er in der vorliegenden Collage exemplarisch umsetzt. Er beschäftigte sich insbesondere während seiner kubistischen Phase zwischen 1916 und 1920 mit der Collagekunst und schuf sowohl räumliche als auch flächige Werke Das Werk „Tête, 1915“ ist Josette Gris gewidmet, der Ehefrau von Juan Gris.
Provenienz:
Sammlung Josette Gris
Galerie Knoedler, Zürich 1965
Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf 1969
Privatbesitz Düsseldorf
Literatur:
Henri Laurens. Constructions et papiers collés 1915–1919, Paris, Centre Pompidou 1985, S. 39
Galerie Wilhelm Grosshennig, Deutsche und Französische Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, Ausst.-Kat. Düsseldorf 1968/69, S. 84
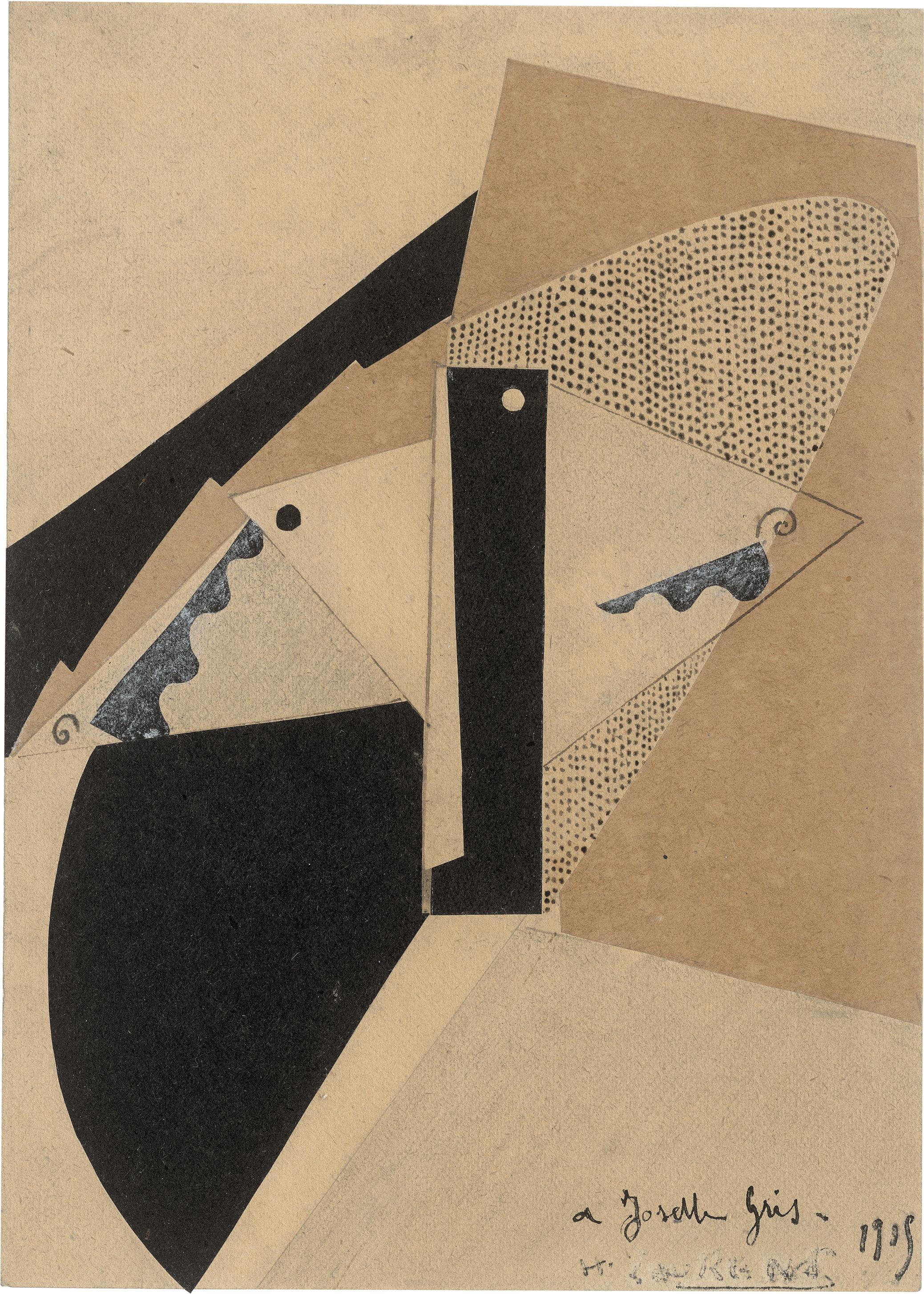
7099, Originalgröße
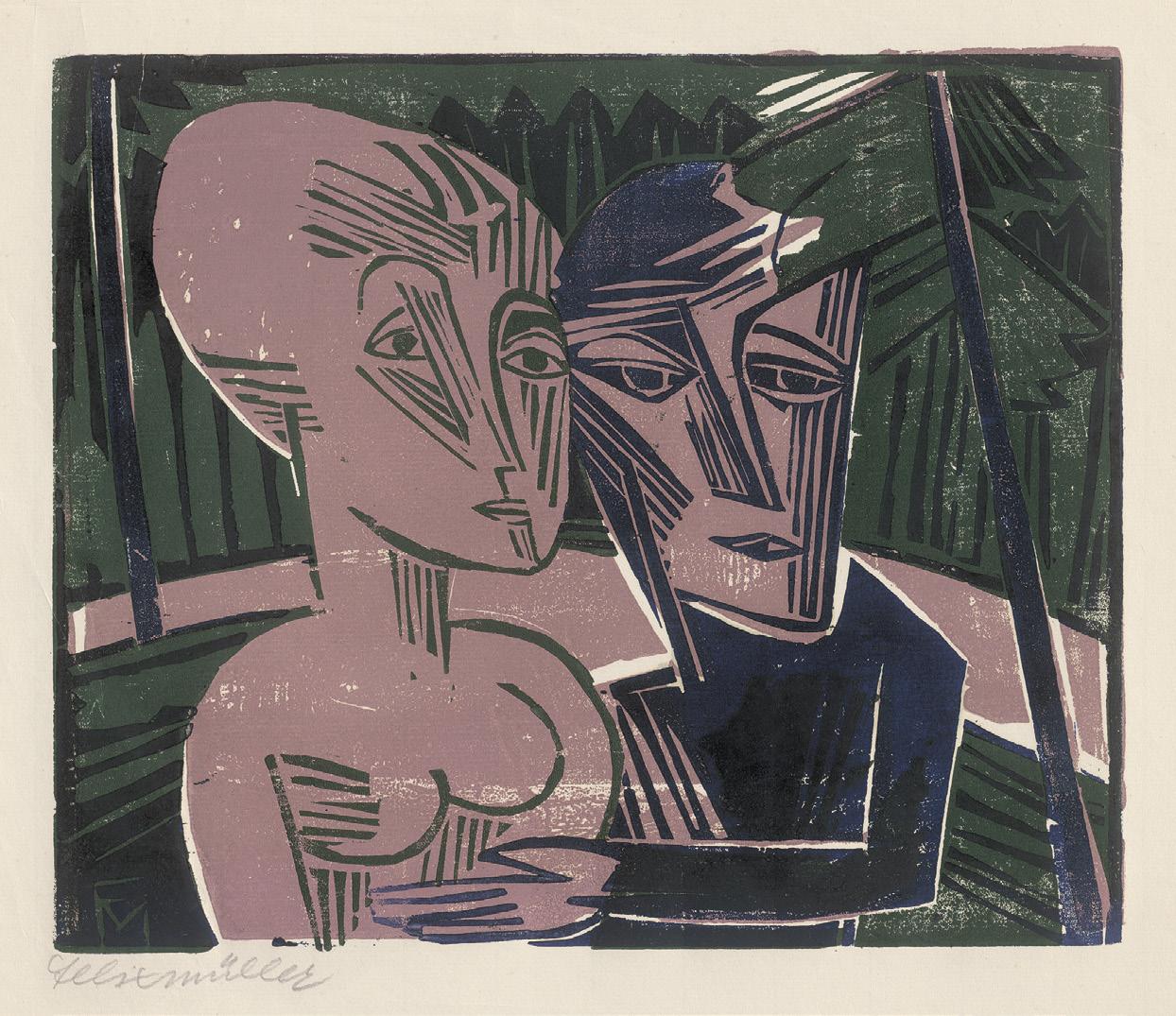

conrad felixmüller (1897 Dresden – 1977 Berlin)
7100 Menschen im Wald Farbholzschnitt auf dünnem Maschinenbütten. 1918. 25,4 x 30,2 cm (35,2 x 42,3 cm).
Signiert „Felixmüller“.
Söhn 135 b.
2.000 €
Einer von ca. 75 Handabzügen für den Frauenbund zur Förderung neuer deutscher Kunst, Hamburg, gedruckt in Schwarz, Grün, Rosa und Blau bei Voigt, Berlin. In den Farben prachtvoller, kräftiger und nahezu monotypieartig gedruckter Abzug mit breitem Rand.
7101 Der Sohn (Meine Frau und mein Sohn)
Kupferstich in Rotbraun auf festem Velinkarton. 1919/45. 24,5 x 15,8 cm (37 x 28,4 cm).
Signiert „C. Felixmüller“, datiert und bezeichnet „Kupferstich“.
Söhn 172 wohl c.
1.500 €
Wohl Exemplar aus einer kleinen, nach 1945 erschienenen Auflage, gedruckt von den Staatlichen Graphischen Werkstätten (VEB –moderne Kunst). Kräftiger, klarer Druck mit tief eingeprägter Plattenkante, nuanciertem Plattenton und mit breitem Rand.

john hoexter (1884 Hannover – 1938 Berlin)
7102 Herr mit Zylinder an der Bar Tempera und japanische Tusche über Kohle auf Karton. 48,7 x 35,8 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „HŒXTER“. 2.500 €
John Hoexter war ein Maler und Schriftsteller des Expressionismus und Dadaismus, Kaufmannssohn und Schüler des Malers Leo von König, Teil der Berliner Bohème und der Kunstszene. Zu seiner zweiten Heimat wurden die berühmten Berliner Cafés, Begegnungsstätten von Künstlern, die wesentlich zur Entstehung des deutschen Expressionismus beitrugen; das Café des Westens,
Café Monopol, dann auch das Café Josty und das Romanische Café. Bekannt war der Bohémien Hoexter dort als morphiumabhängiger, sich offen zu seiner Homosexualität bekennender „Edelschnorrer“. Er zeichnete Schauspielerportraits, schrieb Glossen und Gedichte. Ab 1911 arbeitete er für Franz Pfemferts „Aktion“ und gründete 1919 die Dada-Zeitschrift „Blutiger Ernst“, die bald von Carl Einstein und George Grosz weitergeführt wurde. Ab 1933 durfte der jüdische Künstler seine geliebten Cafés nicht mehr betreten. Nach der Pogromnacht 1938 nahm er sich das Leben (vgl. auch stolpersteineberlin.de).
Provenienz: Privatsammlung Berlin
dorothea maetzel-johannsen (1886 Lehnsahn – 1930 Hamburg)
7103 Stilleben mit Topfpflanze
Radierung mit Kaltnadel auf Velin. 1921.
23,7 x 17,6 cm (46 x 32,5 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“ und datiert. Nicht bei Hans.
900 €
Prachtvoller, gratiger Druck mit kräftigem Plattenton und breitem Rand.


dorothea maetzel-johannsen
7104 Anbetung
Radierung mit Kaltnadel auf Velin. 1921.
27,8 x 16,5 cm (46,1 x 30 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“ und datiert. Hans S. 76.
900 €
Prachtvoller, gratiger Druck mit eindrucksvollem Plattenton und breitem Rand.
dorothea maetzel-johannsen
7105 Kniender weiblicher Akt mit erhobenen Armen
Radierung mit Kaltnadel auf Kupferdruckpapier. 1921.
27,8 x 17,4 cm (48 x 29,2 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“ und datiert. Nicht bei Hans.
900 €
Prachtvoller, kontrastreicher Druck mit schönem Plattenton und breitem Rand.


dorothea maetzel-johannsen
7106 Kinder
Radierung mit Kaltnadel auf Velin. 1921.
27,9 x 17,5 cm (49,8 x 32,5 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“ und datiert. Hans S. 81.
900 €
Prachtvoller, sehr schön gratiger Druck mit wirkungsvoll eingesetztem Plattenton und breitem Rand.
lili gräf
(1897 Weimar – 1975 Eutin)
7107 Reh
Bronze mit rötlich-brauner Patina, auf grün-schwarzen Marmorsockel montiert. 1924.
36 x 28,5 x 9,5 cm.
Hinten auf der Plinthe monogrammiert „L.G.“ und datiert, hinten seitlich mit dem Gießerstempel „H. Noack Berlin Friedenau“.
5.000 €
Ruhig und leicht scheu steht das Reh aufrecht, die Ohren aufmerksam nach hinten gerichtet, auf seinen dünnen Beinen. Eine große und derart grazile Tierbronze wie dieses reizende Reh aus dem Jahr 1924 ist in Gräfs Werk einzigartig. Lili Gräf hatte ihr Studium 1916 in Weimar bei Richard Engelmann begonnen, lernte bei Hans Schwegerle in München und später am Bauhaus Weimar Holzbildhauerei bei Gerhard Marcks. In Berlin war sie Mitglied des Vereins der Berliner Künstlerinnen und schuf insbesondere Büsten, Plaketten und Statuen, überwiegend in Holz, Ton und Zement. „Im Rückblick ist die Besonderheit der 1920er- und frühen 1930er-Jahre die enorme künstlerische Vielfalt, welche die Bildhauerinnen, bedingt durch die oft erzwungenen Umwege zum Beruf, in ihren Werken zeigten.“ (Arie Hartog, Leere Sockel: eine vorläufige Geschichte der Bildhauerinnen in Deutschland, in: Bildhauerinnen in Deutschland, Ausst.-Kat. u.a. Gerhard-MarcksHaus, Bremen 2019, S. 175). Solche frühen Bronzen weiblicher Bildhauerinnen sind generell eine Rarität auf dem Kunstmarkt. Ausdrucksstarker, früher Guss mit leicht rötlich-brauner Patina und differenzierter Oberflächengestaltung. Gesamthöhe mit Sockel: 39,5 cm. Wir danken Dr. Arie Hartog, Bremen, für freundliche Auskünfte vom 25.03.2025.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland


gerhard marcks
(1889 Berlin – 1981 Burgbrohl/Eifel)
7108 Hohe Herrschaften
Holzschnitt auf Velin. 1922. 29 x 22,5 cm (55,7 x 38,7 cm).
Signiert „G Marcks“. Lammek H 62.
2.500 €
Auch betitelt „Die Herrschaften“. Einer der frühen Handabzüge, entstanden noch während Marcks‘ Zeit als Lehrer am Bauhaus in Weimar. Durch seine dortige Freundschaft mit Lyonel Feininger wurde er angeregt, sich mit der Technik des Holzschnitts zu beschäftigen. Auf beeindruckende Weise verschränkt der Künstler die Gestalten der beiden Katzen mit ihrer Umgebung. Exemplar vor den 1972 erschienenen Neudrucken, eine Auflagenhöhe ist Lammek nicht bekannt. Prachtvoller, klarer, ganz vereinzelt minimal trockener Druck mit dem wohl vollen Rand, unten mit dem Schöpfrand. Sehr selten
7109 Die Katzen (auch: Katzen im Dachboden)
Holzschnitt auf bräunlichem Velin. 1921. 38,8 x 25,7 cm (38,3 x 55,3 cm).
Signiert „Gerhard Marcks“ und datiert. Lammek H 27, Söhn HdO 101-7.
1.200 €
Erschienen als Blatt 7 der I. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, rechts und links mit dem Schöpfrand.


gerhard marcks
7110 Die Eule Holzschnitt auf bräunlichem Velin. 1921. 28,2 x 23,9 cm (38,4 x 28 cm).
Signiert „Gerhard Marcks“ und datiert. Lammek H 28, Söhn HdO 101-8.
1.500 €
Erschienen als Blatt 8 der I. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Prachtvoller, klarer Druck mit dem vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.

peter august böckstiegel (1889–1951, Arrode-Werther i.W.) 7111 „Tauwetter in Arrode“ Aquarell auf Bütten. 1923.
48,3 x 61 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „PA. Böckstiegel“, mittig nochmals signiert, datiert und bezeichnet „Arrode“, verso ebenfalls datiert und betitelt.
5.000 €
Eine Vision von Vorfrühling: Warmes Glühen scheint von unten her die Erde zu durchdringen, während der Himmel sich noch in
winterlich-düsterem Schwarz zeigt. Wässrig laufen Blau, Orange und Pink im Aquarell ineinander und verdeutlichen den Prozess des Zerfließens, der mit dem Tauwetter einhergeht. Kräftige schwarze Pinselstriche konturieren die Farbflächen und unterstreichen die Dynamik der Komposition. „Gerade seine Aquarelle beweisen die stete Suche nach Adäquatheit von Form und Inhalt. (...) Der Künstler fügt naturwahre, scharf charakterisierende Wiedergabe der äußeren, sichtbaren Wirklichkeit in der Zeichnung mit expressiv überhöhter Farbgebung als Visualisierung empfundener, innerer Wahrheit zusammen.“ (Ernst W. Uthemann, in: P. A. Böckstiegel, Ausst.-Kat. Münster 1989, S. 52f.).

peter august böckstiegel
7112 „Bauernkinder“
Farblithographie auf Velin. 1920.
70,3 x 53,8 cm (75,5 x 56,8 cm).
Signiert „P.A. Böckstiegel“, betitelt und bezeichnet „Org. Steinzeichnung Handdruck“. Matuszak 95.
1.000 €
Großformatiger Druck in Rot, Dunkelgelb, Beige und Grün. Eine von zehn Lithographien der Mappe „Bauernleben“, erschienen 1921 in einer kleinen Auflage von 15 Exemplaren. Ganz ausgezeichneter, klarer Druck in harmonisch abgestimmter Farbigkeit, mit kleinem Rand.
peter august böckstiegel
7113 „Bauern im nächtlichen Gewitter“
Farblithographie auf Velin. 1920.
70,7 x 54,5 cm (76,7 x 56 cm).
Signiert „P.A. Böckstiegel“, betitelt und bezeichnet „Org. Steinzeichnung Handdruck“. Matuszak 92.
2.000 €
Der Künstler selbst ist es, der uns durch das Fenster aus stahlblauen Augen entgegenblickt, vorne im Raum sitzen seine Eltern. Gedruckt wurde das Blatt für die Mappe „Bauernleben“, das einzige Mappenwerk des Künstlers, erschienen 1921 in einer kleinen Auflage von 15 Exemplaren, mit zehn Lithographien. Die großformatigen Motive in expressiv leuchtender Farbigkeit entstanden meist wohl nach im Sommer 1920 in Arrode angefertigten Zeichnungen und Aquarellen. Ganz ausgezeichneter, klarer Druck in leuchtender Farbigkeit, mit kleinem Rand.

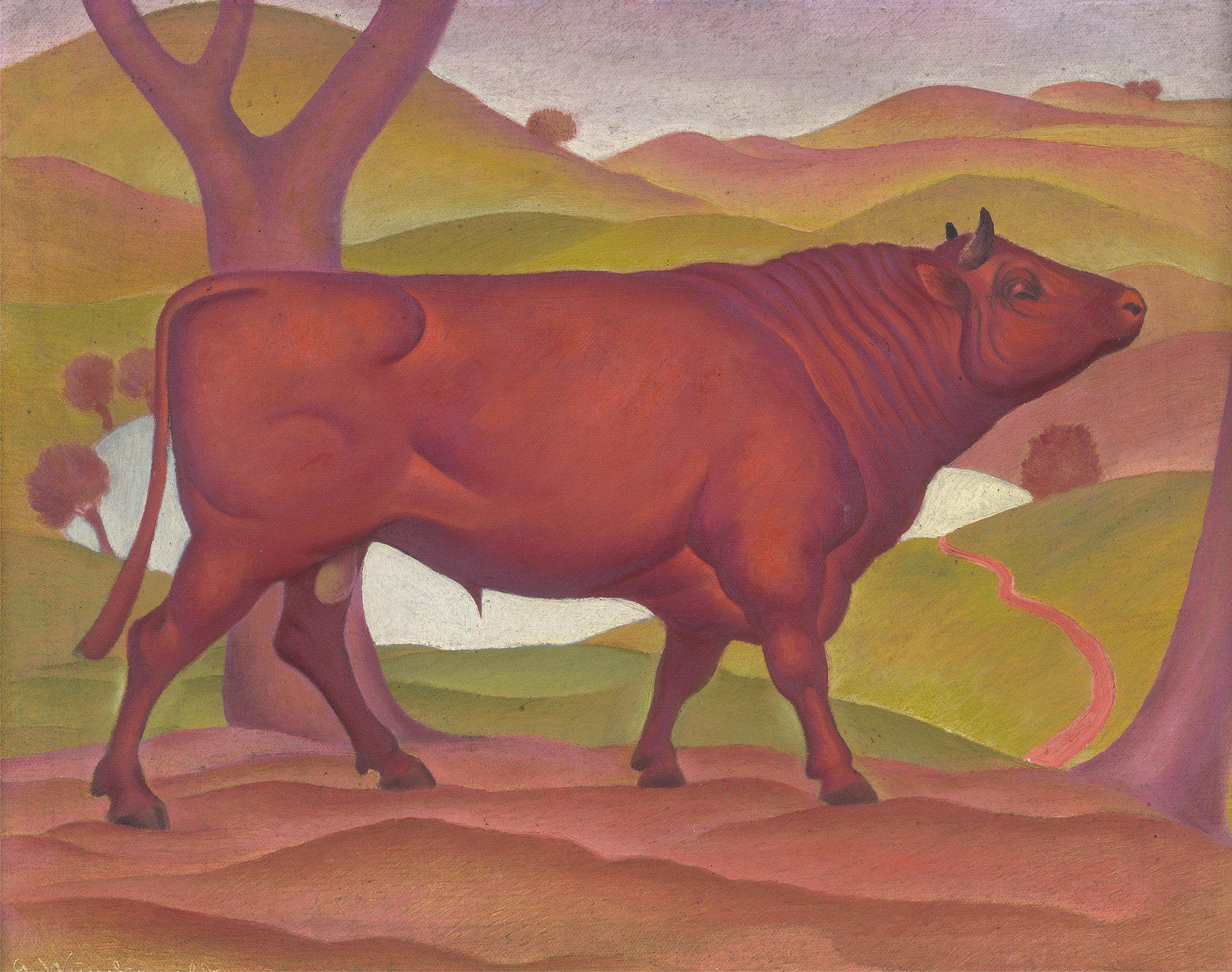
gustav wunderwald (1882 Köln – 1945 Berlin)
7114 „Roter Stier“ Öl auf Leinwand. Um 1920. 40 x 51 cm.
Unten links signiert (in die feuchte Farbe geritzt) „G. Wunderwald“, verso auf dem Keilrahmen nochmals signiert sowie auf Klebeetikett, dort zudem betitelt. Reinhardt 56.
3.500 €
Monumental und überlebensgroß, wie auf einer Bühne, bereit für eine Prämiierung oder einen Wettkampf steht der mächtige rote Stier im Vordergrund der menschenleeren, märchenhaft-paradie-
sischen Landschaft. In seiner lebensvollen Färbung und der plastischen Durchgestaltung des Körpers erscheint er als ein Sinnbild der animalischen Kraft. Ein Mittelgrund ist kaum vorhanden, während die hügeligen Wiesen im Hintergrund mit ihrem pastellig abgemischten Kolorit wie von einem zarten Schleier verhangen wirken und der sich nach hinten hindurchwindende Weg der Tiefenraumgestaltung dient. Die frühlingshaften, zart abgestuften Licht- und Farbwerte in Nuancen von Lila, Grün und Hellblau sind sensibel protokolliert, das Motiv mit einer leichten Neigung zur Abstraktion wiedergegeben.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 35, 27.11.1993, Lot 221 Privatsammlung Berlin
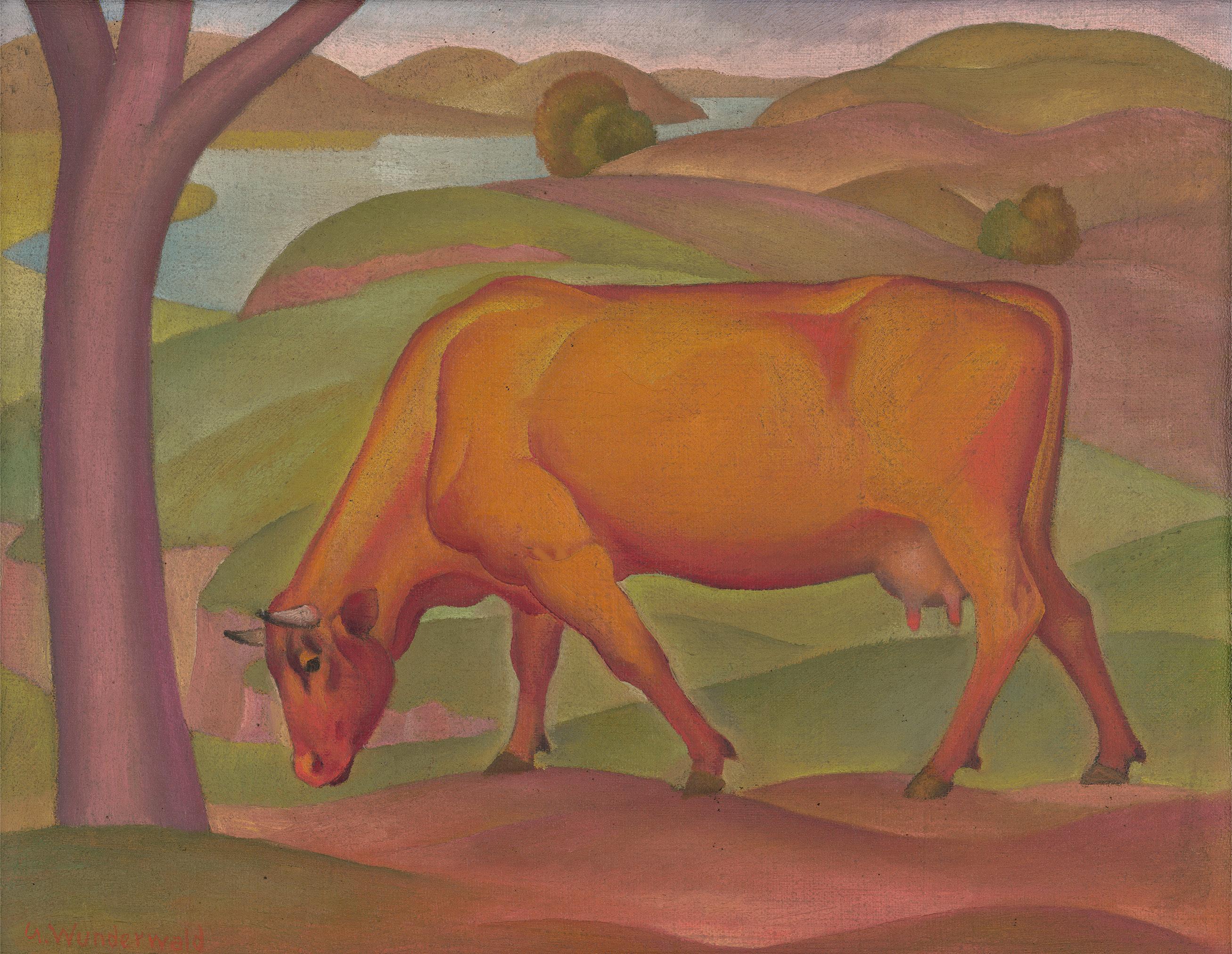
gustav wunderwald
7115 „Gelbe Kuh“ Öl auf Leinwand. Um 1920. 40 x 51 cm.
Unten links mit Pinsel in Rot signiert „G. Wunderwald“, verso auf dem Keilrahmen nochmals signiert sowie auf Klebeetikett, dort zudem betitelt. Reinhardt 57.
3.500 €
Eine Bilderbuchkuh. Grasend durchzieht das leuchtend gelbe Tier die idyllische Landschaft mit Hügeln und Seen. Sanfte Farbkontraste von zart schimmernden Violett- und Grüntönen dominieren die Umgebung. Wunderwald löst sich soweit von der Lokalfarbe und stilisiert die Formen derart, dass die Szenerie einen phantastischen, traumartigen Charakter erhält.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 35, 27.11.1993, Lot 221 Privatsammlung Berlin

gustav wunderwald
7116 Märkisches Dorf Öl auf Holz. Um 1930.
50 x 70 cm.
Unten rechts signiert (in die feuchte Farbe geritzt) „G. Wunderwald“, verso (wohl von fremder Hand) mit Bleistift betitelt und zweifach mit dem Nachlaßstempel. Reinhardt 167.
9.000 €
Ein anonymes und zugleich vollkommen charakteristisches märkisches Dorf unter grau verhangenem Himmel, der dennoch die Häuser und kahlen Bäume in hellem, klarem Licht erscheinen lässt. Ganz ohne figürliche Staffage erstreckt sich die sandige, ungepflasterte Dorfstraße zentral und bestimmend von vorne nach hinten durch die Komposition. Mit akribischer Gründlichkeit des feinen Pinsels, pastosem Farbauftrag und zurückhaltendem Kolorit widmet sich der Künstler den unterschiedlichen Beschaf-
fenheiten der schlichten Wohnhäuser, ihrer Fassaden, Fenster und Zäune ebenso wie der Natur. „Die Redlichkeit und Akribie der Schilderung des Vorgefundenen, die Wunderwalds Berlin-Berichte auszeichnen, findet man auch in den Sommer- und Winterlandschaften Ostpreußens und der Mark.“ (Reinhardt S. 29).
Provenienz:
Nachlass Gustav Wunderwald Ehemals Galerie Gunzenhauser, München Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Neue Sachlichkeit - 12 Maler zwischen den Kriegen, Galerie Gunzenhauser, Köln 1975, Kat.-Nr. 35 (Abb. S. 21) Gustav Wunderwald. Gemälde, Handzeichnungen, Bühnenbilder, Berlinische Galerie, Berlin, und Städtische Galerie Albstadt 1982/83, Kat.-Nr. 86

erich borchert
(1907 Erfurt – 1944 im KarLag bei Karaganda)
7117 Bauernhäuser
Aquarell und Feder in Schwarz auf feinem faserigen Japan. 1930.
31 x 41,5 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „E.B“ und datiert.
1.200 €
Kurz vor dem Entstehen der vorliegenden Zeichnung hatte Borchert von 1926 bis 1929 Wandmalerei am Bauhaus Dessau studierte und war Schüler bei Paul Klee, Wassily Kandinsky und Lyonel Feininger. Schon dort war er der Kommunistischen Zelle beim Bauhaus beigetreten. Anschließend gehörte er zu den etwa 30 Bauhäuslern, 7117
die in die Sowjetunion reisten, um sich im Rahmen gewaltiger Industrialisierungsprojekte am dortigen Aufbau des Landes zu beteiligen. Durch die Vermittlung seines Mentors Hinnerk Scheper übersiedelte er 1930 nach Moskau und war in der Entwicklungsabteilung für Farbgestaltung der Architektur und im Städtebau tätig. Möglicherweise entstand bereits dort die Zeichnung der niedrigen, dicht an den Boden gedrängten Bauernhäuser. Borchert starb, nachdem er zur Roten Armee eingezogen worden war, in einem Zwangsarbeitslager des Gulag bei Karaganda in der Kasachischen SSR.
Provenienz: Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 11.06.2010, Lot 141 Privatbesitz Hessen
gustav heinrich wolff (1886 Barmen – 1934 Berlin)
7118 Sternenguckerin
Bronze mit goldbrauner Patina auf Bronzeplinthe. Wohl um 1925.
Ca. 49,7 x 13 x 13 cm. Hinten seitlich auf der Bronzeplinthe mit dem Gießerstempel „H. Noack Berlin“. Nicht bei Holthusen.
5.000 €

Mit Blick in den Himmel hat die Dargestellte den Kopf in den Nacken gelegt, ihre Hände halten zu beiden Seiten ihr Kopftuch. Die Pose erinnert an Ernst Barlachs Skulpturen mit emporgewandtem Blick, u.a. „Sterndeuter II“ von 1909 bzw. 1920. Auch in unserer Bronze findet sich eine ähnliche geschlossene, blockhafte Form. Zunächst in Rom, unternahm Wolff seit 1906 Studienreisen u.a. nach Russland, Spanien und Nordafrika und ließ sich ab 1908 in Paris nieder. 1931 wurde er als Leiter der Bildhauerklasse an die Staatliche Kunstakademie von Leningrad berufen, jedoch kehrte er schon ein Jahr später nach Berlin zurück, wo er 1934 starb. Bronzen des Künstlers sind selten auf dem Auktionsmarkt zu finden.
Provenienz:
Galerie Bassenge, Berlin, Auktion 74, 27.11.1999, Los 6635 Privatzbesitz Belgien
adolf hoelzel
(1853 Olmütz/Mähren – 1934 Stuttgart)
7119 Abstrakte Komposition
Farbige Kreiden und Zimmermannsbleistift auf Velin. 11 x 14 cm.
Verso mit dem Nachlaßstempel (Lugt 1258 f).
1.200 €
Glänzend liegt der kräftige, mit dem Bleistift gezeichnete Ring inmitten der samtigen Oberfläche der leuchtend farbigen, zersplitterten Kreideformen. Hoelzel, Gründungsmitglied der Wiener sowie der Münchner Sezession, gründete mit Ludwig Dill und Arthur Langhammer die „Dachauer Malschule“ und gilt als einer der ersten Vertreter der Künstlerkolonie Dachau. Berühmt wurden auch Hoelzels Glasfenster und deren Entwürfe, wie sie ab 1920 entstanden und an die auch unsere Zeichnung erinnert.

7120 Figürliche Komposition (Sitzende)
Bleistift und Farbstift auf bräunlichem Briefumschlag. Um 1921.
23,5 x 18,7 cm.
1.500 €
Charakteristische, kompakt komponierte Zeichnung des Künstlers. Von Goethes Farbenlehre ausgehende Studien führten Adolf Hoelzel früh zu einer abstrakten Farbflächenmalerei. In seinen Werken tritt das Figürliche immer weiter zugunsten starkfarbiger, entfernt realitätsbezogener Bildelemente in der Gestaltung zurück. Die samtige Oberfläche der Farbstiftfelder und die fein abgestimmte Wirkung der Farben vereinen sich zu einem charakteristischen Farbformmosaik in avantgardistischer Gestaltung. Verso mit einer weiteren abstrakten Bleistiftzeichnung des Künstlers mit der Künstleradresse, sowie zwei Briefmarken, gestempelt 06.02.1921.
Provenienz:
Karl & Faber, München, Auktion 208, 16.06.2005, Lot 757
Privatbesitz Hessen
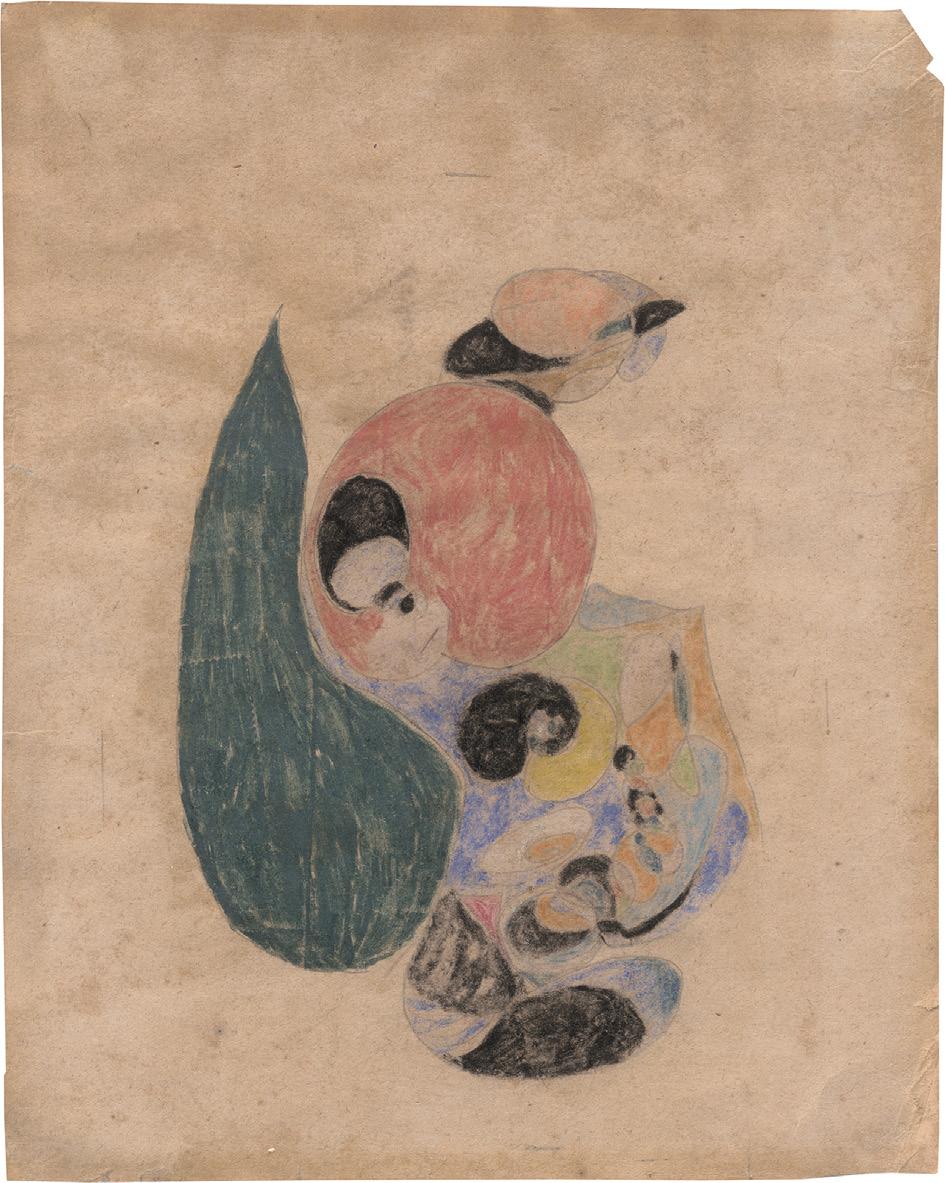
sulamith wülfing

(1901 Elberfeld – 1989 Wuppertal) 7121 „Zigeunerlied“ Aquarell, Deckweiß und Bleistift auf Velin, auf Unterlagepapier kaschiert. 1923.
22,8 - 18,6 x 14,3 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Sulamith Wülfing“ und datiert, unten links auf dem Unterlagepapier betitelt.
1.200 €
Barfuß und in dünnem, zerrissenem Kleid spielt die junge Frau ihre Geige, hinter ihr lassen drei transparent gezeichnete Geistwesen silbrigweiß schimmernden Feenstaub in die Luft schweben. Mit
großer Feinheit erfasst und aquarelliert, zeigt das Blatt ein über die materiellen Erscheinungen hinausgehendes geistiges Bild der Musizierenden in einer kargen Hügellandschaft. Die bezaubernde Zeichnung ist ein charakteristisches Beispiel für das Schaffen Sulamith Wülfings. Ihre ausgeprägte Intuition und Sensibilität ließen sie immer wieder feinsinnige Ausdrucksformen für Spirituelles, für die feinstofflichen, geistigen Welten in ihren Bildern finden. Sie illustrierte Gedichte von Christian Morgenstern und Rainer Maria Rilke und war mit den Familien Fidus und Vogeler befreundet. Die persönliche Begegnung mit Jiddu Krishnamurti hat ihr künstlerisches Gespür für das Übersinnliche sicherlich gestärkt.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

7122 my ullmann
(d.i. Maria Anna Amalie, auch: Marianne, 1905 Wien – 1995 Konstanz)
7122 Ohne Titel
Aquarell und Goldbronze auf dünnem Velin. Um 1926. 26,8 x 19,3 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „My.“.
3.500 €
In rhythmischer Bewegtheit lässt Ullmann Pinsel und Feder über das Papier tanzen, spielt mit Positiv- und Negativformen, mit leeren Flächen und kleinen, feinen Anklängen einer Ornamentik, von der sich die Künstlerin zu dieser Zeit bereits wieder weitgehend gelöst hatte, nachdem sie in Franz Cizeks Klasse für Ornamentale Formenlehre ihre Begabung für dekorative Rhythmik
geschult hatte. Der experimentelle Unterricht sensibilisierte die Studierenden für ihre innersten Gefühle und ihre Intuition und nutzte dafür auch Techniken der rhythmischen Gymnastik und des Ausdruckstanzes. Diese Bewegtheit, bei Ullmann kein Tanz auf dem Vulkan, sondern eine schwingende Heiterkeit, zeigt sich reizvoll in den gekurvten Linien unserer transparenten, feinsinnigen Komposition.
Provenienz: Privatbesitz Wien
Literatur: Barbara Stark und Lilli Hollein (Hrsg.), My Ullmann - Bilder, Bühne, Kunst am Bau, Ausst.-Kat. MAK Wien und Städtische WesenbergGalerie Konstanz, Petersberg 2023, Vortitel mit ganzseitiger Abb.
paul klee

(1879 Münchenbuchsee/Bern – 1940 Muralto bei Locarno)
7123 Hoffmanneske Szene
Farblithographie auf festem Velin. 1921. 31,6 x 22,8 cm (35 x 26,4 cm).
Signiert „Klee“, datiert und mit der handschriftlichen Werknummer „123“.
Kornfeld 82 II c, Söhn HdO 101-6.
10.000 €
Eines der Hauptblätter des Künstlers, das seine schöpferische Phantasie und Verspieltheit zeigt, entstanden in der Frühzeit des Bauhauses. Paul Klee schuf für die Erste Bauhaus-Mappe seine beiden frühesten Farblithographien, „Die Heilige vom innern Licht“ (Kornfeld 81) und die „Hoffmanneske Szene“. In die von rechteckigen
Farbfeldern bestimmte Komposition setzt er um ein dreischiffiges Gebäude herum skurrile Figuren, wuchernde Pflanzen und geheimnisvolle Symbole. „Seine Begeisterung für E.T.A. Hoffmann äußerte Klee bereits am 26. Februar 1906 gegenüber seiner Freundin und späteren Frau Lily Stumpf: ‚so nahm ich wieder Hoffmanns Erzählungen vor und las aus den ‚Phantasiestücken‘ den ‚Magnetiseur‘ (grossartig)‘“ (Staatsgalerie Stuttgart, staatsgalerie.de, Zugriff 05.03.2025). Die farbige Lithographie wurde gedruckt von zwei Farbsteinen in Gelb und Violett. Erschienen als Blatt 6 der I. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558 b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.

alexej von jawlensky (1864 Torschk – 1941 Wiesbaden)
7124 Kopf
Lithographie auf Maschinenpapier. 1921. 17,2 x 12,2 cm (29,1 x 23,3 cm).
Signiert „a.jawlensky.“ (ligiert).
Rosenbach 17, Söhn HdO 104-7.
4.000 €
Erschienen als Blatt 7 der IV. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Italienische und russische Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b).
Schöner, differenzierter Abzug wohl mit dem vollen Rand.

andreas jawlensky (1902 Prely – 1984 Barga)
7125 Dorfstraße Farbstift auf Velin. 1922. 24 x 32,8 cm.
Unten links mit Farbstift in Rotbraun monogrammiert „A.N.J. A.A.M.G.“, unten rechts datiert.
900 €
Phantasievoll und beinahe märchenhaft gestaltet der junge Künstler die dörfliche Szenerie. Vermutlich entstand die Zeichnung in Ascona oder in Wiesbaden, wo Jawlensky 1922 lebte. Zu dieser Zeit bestand eine intensive Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn. Andreas Jawlensky zeigte sich anfänglich von van Gogh beeinflusst, ging aber später zum Expressionismus über. Vorwiegend beschäftigt er sich mit russischen Motiven, Traumvisionen einer Heimat, die er selber nie erlebt hatte.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 04.06.2016, Lot 1159
Privatbesitz Wiesbaden

lyonel feininger (1871–1956, New York)
7126 „Teltow, 1“ Zinkätzung auf Bütten. 1914. 17,8 x 23,7 cm (25 x 34,1 cm).
Signiert „Lyonel Feininger“, datiert und betitelt.
Prasse E 53 A (von B).
4.000 €
Die Graphik entstand nach dem Gemälde „Teltow I“ von 1912. Eines von etwa fünf bekannten Exemplaren dieses Zustands und eines von zwei Prasse bekannten Blättern auf cremefarbenem Bütten und mit dem Blindstempel des Staatlichen Bauhaus Weimar (Lugt 2558 b). Prachtvoller, klarer Druck mit deutlich zeichnender Plattenkante und Rand.
lászló moholy-nagy
(1895 Bácsborsód/Ungarn – 1946 Chicago)
7127 Kreis und Flächen
Linolschnitt auf Velin. 1922. 11 x 8,3 cm (29 x 22,6 cm).
Signiert „Moholy=Nagy“ und gewidmet.
15.000 €
Dreiecke, Rechtecke und ein Kreis gruppieren sich in der Bildkomposition zueinander und sind verbunden sowie durchdrungen von filigranen Linien. Die Spannung besteht in einer interessanten Wechselwirkung einander durchscheinender Flächen, die der Komposition eine transparente Tiefe verleihen. „Moholy-Nagy entdeckte gleichzeitig – um die Jahreswende 1921/22 – die kristallene Schönheit der Werke von Malewitsch und die Glasarchitekturtheorie von Adolf Behne. Aus beiden entstand seine Glasarchitekturmalerei. Die schwingenden Quadrate und Rechtecke von Malewitsch inspirierten seine schöpferische Phantasie – er ordnete die Formen vor- und hintereinander an, aber so, dass sie durchscheinend blieben und ihr Struktursystem sich klar abzeichnete. Die innere, irreale Klarheit der suprematistischen Bilder bewahrte er, ordnete aber das freie, ungebundene Schweben der Elemente in eine rationale Form und verlegte die Betonung auf das neue Element: auf ungestörte Schönheit, Harmonie und Dekorativität.“ (Krisztina Passuth, Moholy-Nagy, Weingarten 1986, S. 31). Kurz darauf, im Jahr 1923, wurde Moholy-Nagy als Nachfolger Johannes Ittens von Walter Gropius ans Bauhaus berufen. Prachtvoller, reliefartiger Druck, tiefschwarz und klar in den Details, mit sehr breitem Rand.
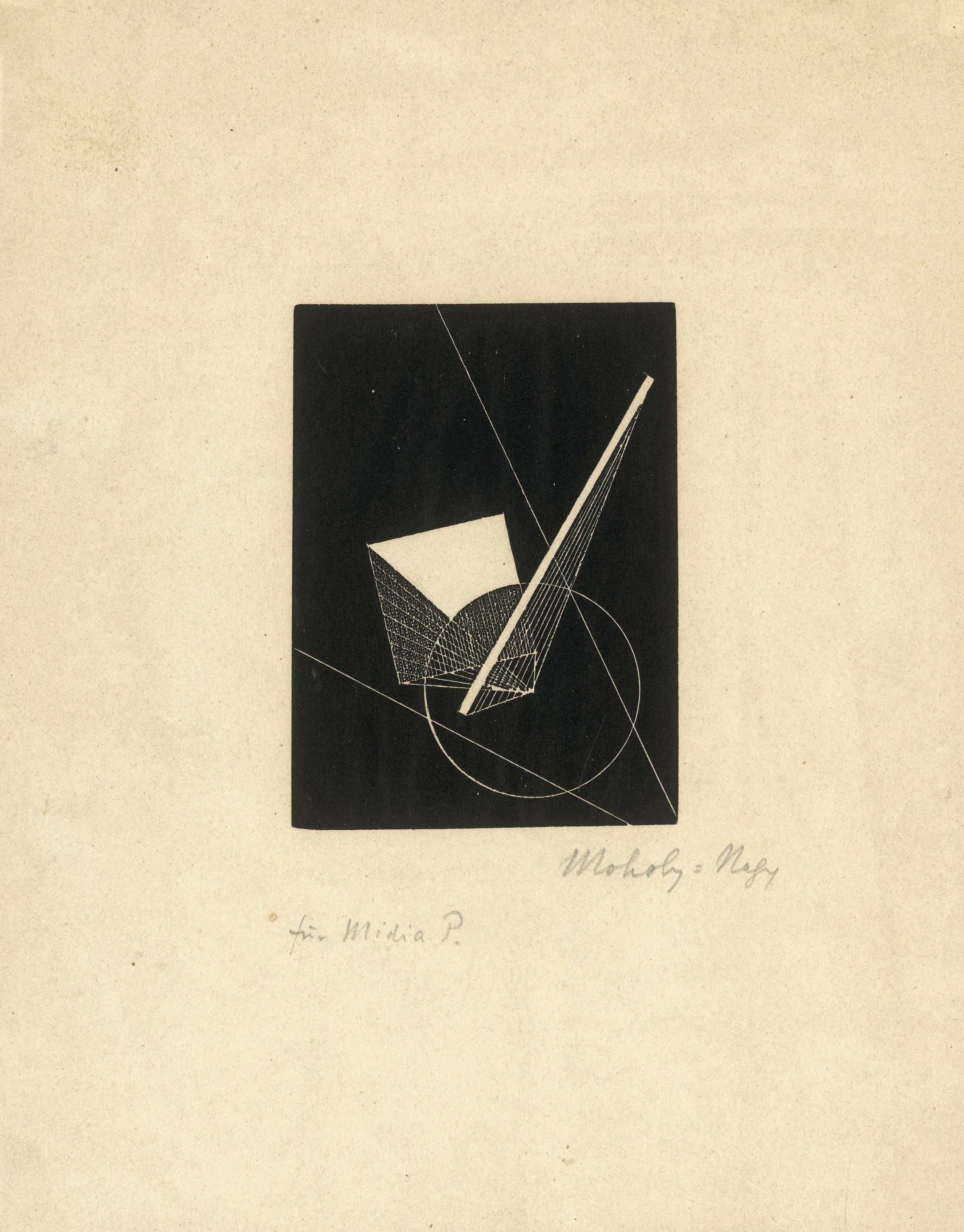

7128
lena meyer-bergner
(1906 Coburg – 1981 Bad Soden)
7128 „entwurf für doppelgewebe (hohlgewebe)“
Aquarell über Bleistift auf Maschinenpapier. Um 1928.
29,8 x 21 cm.
Unten rechts mit Bleistift betitelt und bezeichnet „kette: weiss“, 5
900 €
Nach ihren Studien am Bauhaus im Vorkurs bei Albers sowie in den Kursen von Klee, Kandinsky, Moholy-Nagy, Schlemmer und Joost Schmidt schloss Lena Meyer-Bergner 1930 ihr Bauhausdiplom ab, nachdem sie insbesondere in der Weberei und der Reklamewerkstatt tätig gewesen war. Im selben Jahr folgte sie Hannes Meyer, den sie später heiratete, in die Sowjetunion, wo sie für die Textilindustrie Entwürfe erarbeitete. Insbesondere der Gestaltungsunterricht von Paul Klee spiegelt sich im Schaffen der Textilkünstlerin wider, wobei sie sich in erster Linie auf Gebrauchsstoffe konzentrierte, was sie zu einer typischen Vertreterin der Bauhausorientierung unter Hannes Meyer werden ließ.
Provenienz:
Nachlass Lena Meyer-Bergner Schneider-Henn, München, Auktion Mai 1991, Lot 476
Privatbesitz Hessen

7129
7129 „entwurf für jaquard“
Aquarell über Bleistift auf Maschinenpapier. Um 1928. 29,8 x 21 cm.
Unten rechts mit Bleistift betitelt und bezeichnet „kette: gelb / schuss: orange, braun“, verso unten rechts mit Bleistift signiert „lbergner“.
900 €
In ihrer Zeit am Bauhaus in Dessau, um 1928, schuf Lena MeyerBergner die Textilentwürfe, die ihr Leben lang aufbewahrte. In Winter 1928/29 hatte sie die Färbereischule in Sorau besucht und leitete danach die Färbereiabteilung am Bauhaus Dessau. Ab 1929 arbeitete sie in der Textilwerkstatt unter der Leitung von Gunta Stölzl und zählt neben dieser, Anni Albers, Otti Berger und Benita Koch-Otte zu den wichtigsten Textilkünstlerinnen des Bauhauses.
Provenienz:
Nachlass Lena Meyer-Bergner
Schneider-Henn, München, Auktion Mai 1991, Lot 476
Privatbesitz Hessen
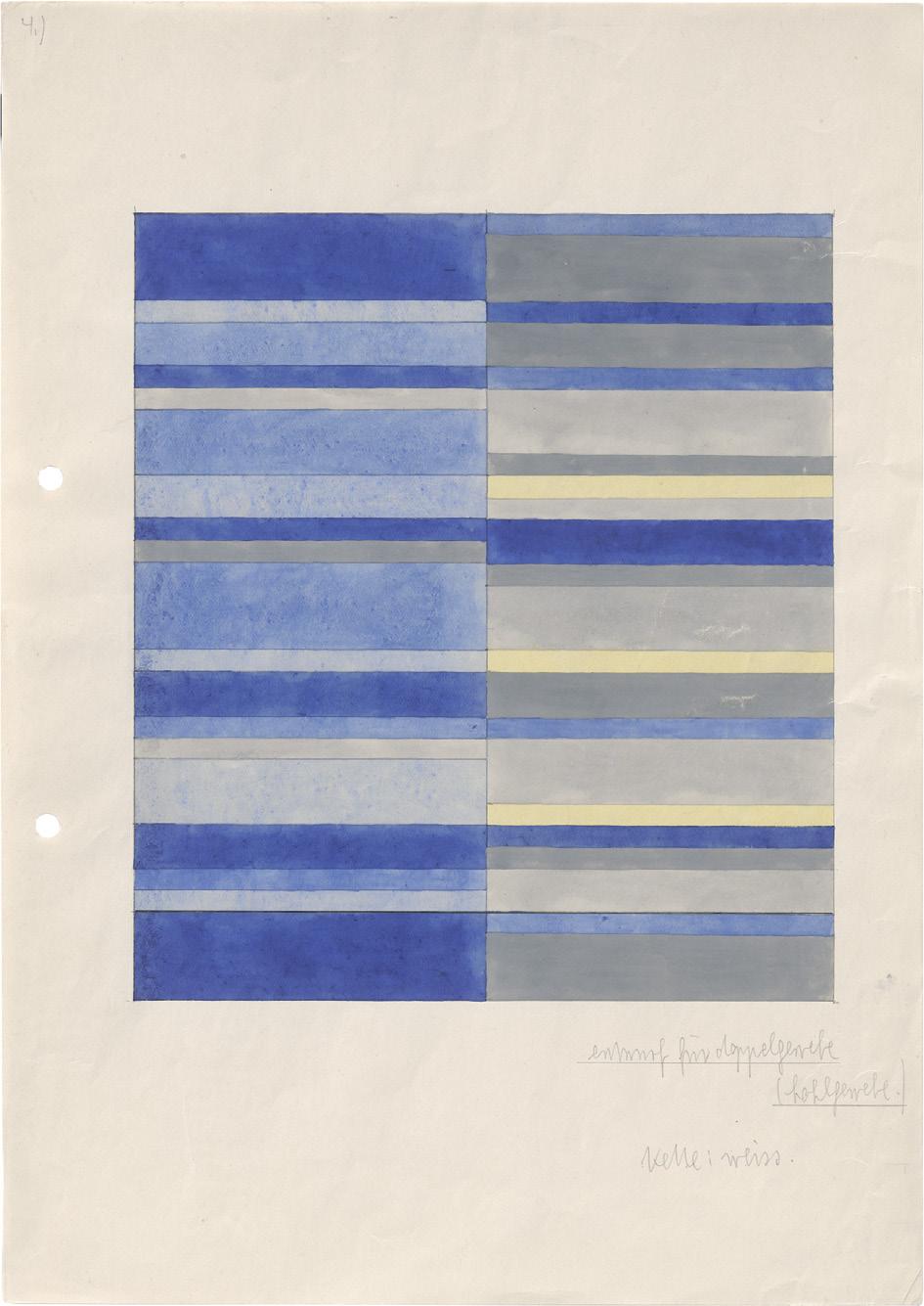
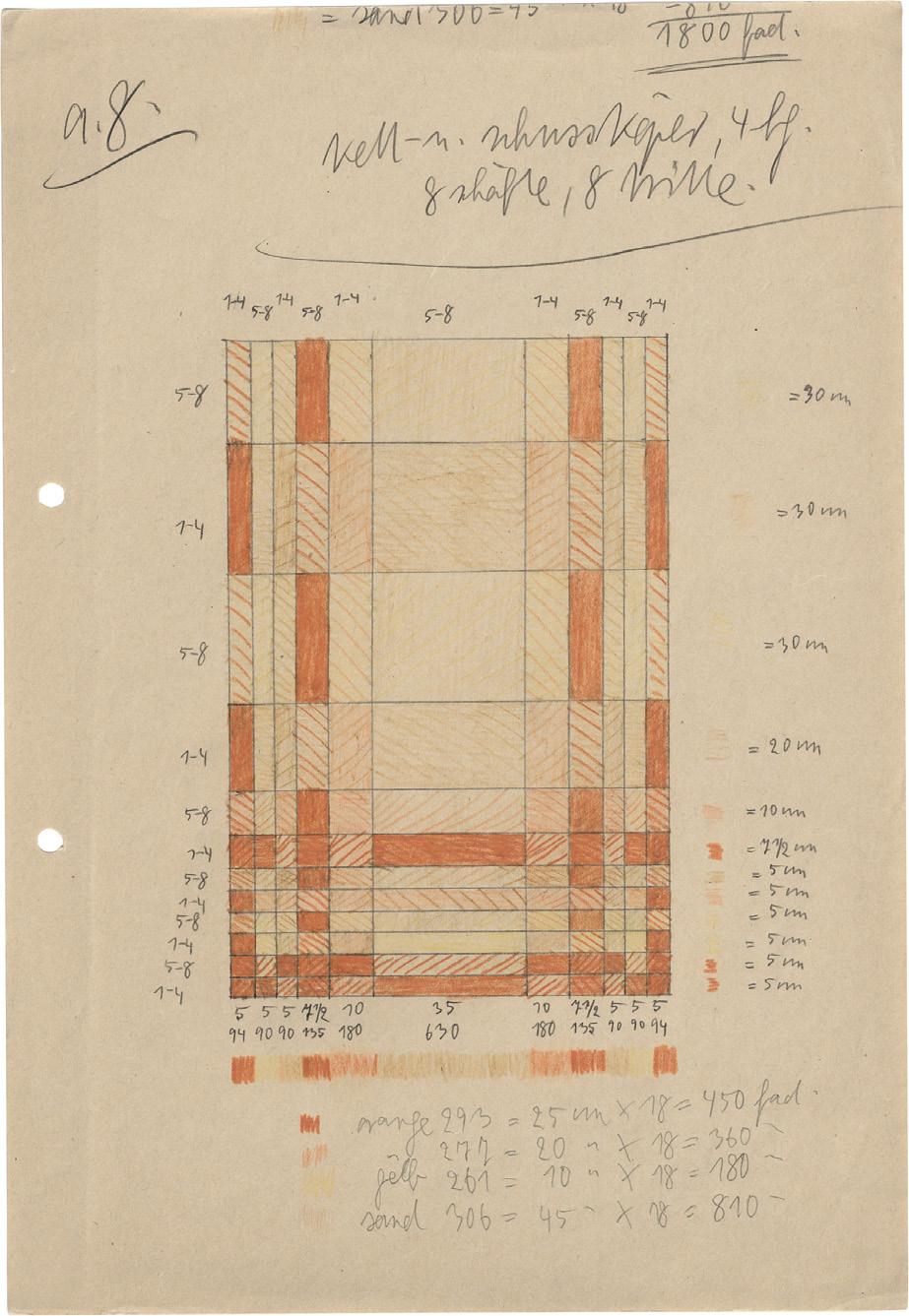
lena meyer-bergner
7130 „entwurf für doppelgewebe (hohlgewebe)“
Aquarell über Bleistift auf Maschinenpapier. Um 1928. 29,8 x 21 cm.
Unten rechts mit Bleistift betitelt und bezeichnet „kette: weiss“, verso unten rechts mit Bleistift signiert „lbergner“.
900 €
Meyer-Bergner, eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Textilkunst am Bauhaus, entwirft eine geometrisch gestaltete, vertikal geteilte Stoffbahn in Schattierungen von Blau, Grau und Gelb.
Provenienz:
Nachlass Lena Meyer-Bergner
Schneider-Henn, München, Auktion Mai 1991, Lot 476 Privatbesitz Hessen
7131 Zwei Textilentwürfe
2 Bl. Farbstifte und Bleistift auf Maschinenpapier. Um 1928. Je 30 x 20,5 cm.
Beide in den Rändern mit Bleistift mit Web- und Farbanweisungen bezeichnet sowie „a.7.“ bzw. „a.8.“.
800 €
Spiegelsymmetrisch angelegte, geometrische Entwürfe, möglicherweise für Wandbehänge. „Die Bild- oder Gobelinweberei hat ihren Sinn insofern, als sie innerhalb des modernen, vom Ornament erlösten Raumes eine Möglichkeit gibt, Gegenstand zweckentbundener, reiner Betrachtung zu sein.“ (Helene Nonné-Schmidt, d.i. Lena Meyer-Bergner, Das Gebiet der Frau im Bauhaus, in: Vivus voco, Bd. V, Heft 8/9, Leipzig 1926, zit. nach: Hans M. Wingler, Das Bauhaus, Bramsche 1962, S. 126).
Provenienz:
Nachlass Lena Meyer-Bergner
Schneider-Henn, München, Auktion Mai 1991, Lot 476
Privatbesitz Hessen

walter dexel
(1890 München – 1973 Braunschweig)
7132* Köpfe (Indianer)
Zimmermannsbleistift und Gouache auf dünnem Briefpapier. Um 1933.
Ca. 29,8 x 21 cm.
Unten rechts mit dem Blindstempel „Nachlass Walter Dexel“.
3.000 €
Vorstudien in Form verschiedener Kompositionsalternativen zu dem stilisierten Kopf „Ein Indianer“ von 1933 (vgl. Wöbkemeier Nr. 419), das endgültige Motiv mittig unten dann schon in dem monochromen Rot des späteren Gemäldes koloriert. Anfang der 1930er Jahre schuf Dexel eine ganze Serie typisierter Köpfe, die er mit Zirkel und Lineal entwarf und in der er es trotz der geometrischen Abstrahierung schaffte, den Typus des jeweiligen Zeitgenossen bildhaft zu machen. Auf der Rückseite eines Briefbogens von Grete Dexel mit dem typographischen Briefkopf und der Adresse in Jena.
7133 Der Jesuit
Bleistift und Pinsel in Rot auf Manila-Schreibmaschinenpapier. Um 1930-33.
20,8 x 16,8 cm (gefaltet).
Unten links mit dem Blindstempel „Nachlass Walter Dexel“, seitlich und verso mit Bleistiftannotationen.
1.000 €
Wie mit dem Lineal entworfene und in klarer Formensprache geometrisch abstrahierte, ganz im Sinne der „Neuen Reklame“ oder der „Neuen Typografie“ gestaltete Typisierung eines Ordensmannes, die das Wesentliche des Menschenstyps mit den Mitteln des Konstruktivismus pointiert erfasst. Auf gefaltetem Briefbogen mit dem typographischen Briefkopf von Grete Dexel zeichnet Dexel die Studie zur gleichnamigen, 1933 entstandenen Temperaund Tuschearbeit (Wöbkemeier 410), nach der er wiederum 1968 eine Serigraphie schuf (veröffentlicht als Blatt 2 der Dexel-Mappe 2, Vitt 25). „Diese Arbeiten sind ganz sicher ein wichtiges und einmaliges Zeugnis der Ausdrucksmöglichkeiten des Konstruktivismus.“ (Walter Vitt, Walter Dexel, Köln 1971, S. 10).
Provenienz:
Nachlass des Künstlers
Galerie Meißner, Hamburg
Privatbesitz Hessen

dexel
7134 Quadrate 1925
Holzschnitt, aquarelliert, auf Japanbütten. 1925. 23,1 x 21,6 cm (48 x 34,8 cm).
Signiert „W DEXEL“. Auflage 40 num. Ex. Vitt 16.
1.300 €
Handdruck des Künstlers, erschienen als Eigenedition. Prachtvoller Druck mit leuchtend aquarellierten Partien, mit sehr breitem Rand.

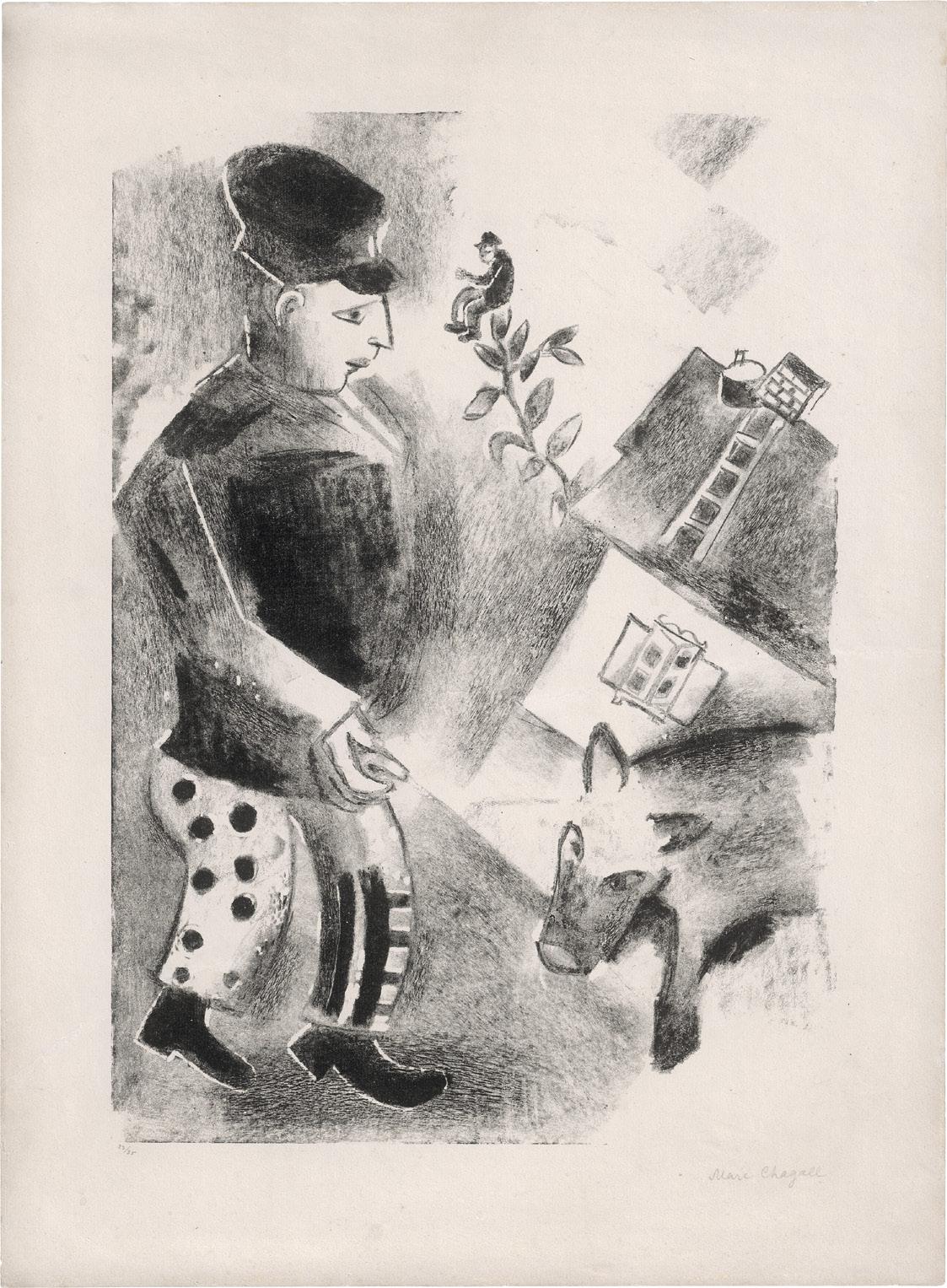
marc chagall (1887 Witebsk – 1985 St. Paul-de-Vence)
7135 L‘homme au cochon Umdrucklithographie auf Bütten. 1922/23. 46,3 x 32,4 cm (57,5 x 32,3 cm).
Signiert „Marc Chagall“. Auflage 35 num. Ex. Mourlot 21.
3.000 €
Das äußerst seltene Blatt in einem transparenten, fein differenzierten Druck mit breitem Rand. Die feine, mechanisch wirkende Rasterung im Druck entstand laut den Angaben Mourlots durch die Verwendung eines geleimten Umdruckpapiers, dessen Oberfläche sich im Druck abbildet: „Diese Lithographie und die Nr. 20 [Akrobat] gaben Anlass zu Diskussionen; sie war nämlich auf Papier angefertigt, dessen Leimgrund von feinen Quadraten durchrastert war. Dies erzeugt einen mechanischen Aspekt, der bei einigen Spezialisten Zweifel erweckte, obwohl es sich um eine Originalarbeit handelte, die mit der Handpresse abgezogen wurde“ (zit.n.
Fernand Mourlot, Chagall Lithograph, 1960, S. 51). Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass die Übertragung auf den Stein in Form einer Autographie erfolgte (vgl. Christofer Conrad, in: Marc Chagall. Die Lithographien. La Collection Solier, Stuttgart 1998, S. 39). Die Lithographie entstand nämlich in den Jahren 1922-23 in Berlin, kurz nachdem Chagall von Russland in die deutsche Hauptstadt übergesiedelt war. Angeregt von Paul Cassirer, schuf Chagall eine Reihe von Radierungen und Holzschnitten sowie eine Gruppe von 24 Lithographien, zu der die hier vorliegende zählt. Anders als in seinen späteren Arbeiten, zeichnete Chagall seine Vorlagen für diese Gruppe alle auf Umdruckpapiere, die von Cassirer wiederum zum Druck in eine Druckerei gebracht wurden. Die Arbeit auf dem Umdruckpapier war typisch für die Inflationsjahre, denn Lithosteine waren knapp, und aus Kostengründen war man darauf bedacht, potentielle Schäden bei der direkten Arbeit auf den Stein zu vermeiden (vgl. Christofer Conrad, in: Marc Chagall. Die Lithographien. La Collection Solier, Stuttgart 1998, S. 41). Bitte Zustandsbericht anfragen.

alexander archipenko (1887 Kiew – 1964 New York)
7136 Zwei weibliche Akte
Lithographie auf Bütten. 1921/22. 36 x 29 cm (49,5 x 33,5 cm).
Signiert „Archipenko“. Karshan 25, Söhn HdO 104-1.
900 €
Erschienen als Blatt 1 der IV. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Italienische und russische Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b).
Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
gino severini
(1883 Cortona – 1966 Paris)
7137 Die Familie des Harlekin
Lithographie auf Maschinenpapier. 1922/23. 30,5 x 20,6 cm (46,2 x 29,8 cm).
Signiert „GinoSeverini“.
Meloni 14, Söhn HdO 104-11.
1.000 €
Erschienen als Blatt 11 der IV. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Italienische und russische Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b).
Prachtvoller, klarer Druck mit dem wohl vollen Rand.


franz radziwill
(1895 Strohausen – 1983 Wilhelmshaven)
7138 Häuser vor dunklem Himmel
Aquarell auf hauchfeinem pergaminartigen Velin. Um 1920.
24,8 x 32 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „FR“. Seeba 1905.
3.000 €
Eindringlich hell und zugleich traumverloren leuchten die mit feinen linearen Ornamenten gestalteten Häuser unter tiefdunklem Himmel. Rot- und Blautöne dominieren die menschenleere Komposition. Im Jahr 1920 tritt Radziwill als jüngstes Mitglied in die Freie Sezession in Berlin ein; er schließt Bekanntschaft mit Dix, Grosz, Pechstein, Heckel, Schmidt-Rottluff und Schlichter.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 41, 26.11.1994, Lot 206 Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Franz Radziwill und Bremen, Kunsthalle Bremen 2017, Kat. Nr. 19

chris hendrik beekman (1887 Den Haag – 1964 Blaricum)
7139 Ohne Titel
Bleistift und farbige Kreiden auf Velin, aufgezogen auf Karton. 1920.
Ca. 34 x 45 cm.
Unten links mit Kreide in Schwarz signiert „Christ B“ und datiert.
5.000 €
Der niederländische Künstler Chris Beekman studierte an der Kunstakademie in Den Haag und begann bereits in frühen Jahren, im Stil der Haager Schule zu malen. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Paris kehrte Beekman 1916 in die Niederlande zurück und pflegte Freundschaften mit linksradikalen Künstlern wie Bart van
der Leck, Peter Alma und Robert van ‚t Hoff. In dieser Zeit begannen seine Gemälde und Zeichnungen, flache, stilisierte figurative Motive zu zeigen. Beeinflusst von einer Begegnung mit Piet Mondrian, wird sein Werk zunehmend von den Prinzipien der De Stijl Bewegung geprägt, und die Suche nach Abstraktion wird in den Vordergrund gerückt. 1919, nach einem Disput mit Theo van Doesburg, dem führenden Kopf der De Stijl-Bewegung, brach Beekman mit der Gruppe. Obwohl der Künstler anfangs weiterhin abstrakte Werke schuf, wandte er sich mehr und mehr einer figürlichen, sozial engagierten Kunst zu. Der hier vorliegende Kopf ist stilistisch noch ganz im Stil seiner frühen abstrakten Arbeiten gehalten.
Provenienz: Privatbesitz Italien
kurt schwitters (1887 Hannover – 1948 Ambleside)
7140 Ohne Titel (Scheveningen-Voorburg) Merzzeichnung. Collage, verschiedene Papiere und Stoff auf leichtem Karton, auf Unterlagekarton montiert. 1926. 14,7 x 11,2 cm.
Unten links auf dem Unterlagekarton mit Bleistift signiert „Kurt Schwitters“ und datiert. Orchard/Schulz (2003) 1447.
70.000 €
Fundstücke und Abfallprodukte, banale Fragmente und unbrauchbare Materialien transformiert Schwitters auf revolutionäre Weise zu Kunstwerken und erfüllt sie mit seinem persönlichen Geist, seinem Charme und seiner Poesie. Ein Eisenbahnbillett von Scheveningen nach Voorburg springt unten rechts ins Auge, oben links steht in Beziehung dazu ein Fahrscheinfragment aus Schwitters‘ Heimatstadt Hannover. Beides bildet eine Art Klammer um die kantigen, mehrfarbigen, in rhythmischer Komposition zusammengesetzten Materialien. Schwitters‘ frühe, nach 1922 entstandene Collagen weisen häufig eine geradlinige Anordnung auf, zeigen oft ein ausgeprägtes Gespür für Rhythmus und geometrische Muster und spiegeln sowohl seine Verbundenheit zum russischen Konstruktivismus als auch seine Freundschaft mit El Lissitzky wider Sie sind zudem deutlich vom Geist des Dada geprägt. Schwitters,
einer der individuellsten Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und damit bald Bürgerschreck, nahm früh aktiv an DadaAusstellungen teil und arbeitete mit Künstlern wie Raoul Hausmann und Hannah Höch zusammen. Er distanzierte sich jedoch von den destruktiven und kommunistisch-revolutionären Aspekten des Dadaismus und verstand Kunst nicht vorrangig als Instrument für politische Botschaften, sondern betonte das kreative Potenzial von „Merz“, das er sowohl mit seiner Kunst als auch mit Texten begründet. Das Wortfragment „Merz“, abgeleitet von „Commerzbank“, entstand zufällig im Prozess des Collagierens und steht für eine Weltanschauung der Ästhetisierung von scheinbar zufälligen Beziehungen. Schwitters‘ Verbindung zu Theo van Doesburg und de Stijl beeinflusste wahrscheinlich seine Verwendung geometrischer Formen und Muster in seinen Collagen dieser Zeit. Er entwickelte eine intensive Beziehung zu den Niederlanden und knüpfte Kontakte zu dortigen Künstlern wie Piet Mondrian und Vilmos Huszar. Schwitters‘ frühe Collagen der Jahre 1924 bis 1926 stellen eine entscheidende Phase seiner künstlerischen Entwicklung dar.
Provenienz:
Galerie Vömel, Düsseldorf 1971
Privatsammlung Düsseldorf
Privatsammlung Düsseldorf (durch Erbschaft von der Vorbesitzerin)

7140, Originalgröße

erich wolfsfeld
(1884 Krojanke/Westpreußen – 1956 London)
7141 Marokkanisches Mädchen
Pinsel in Graubraun auf faserigem Japanbütten. Um 1923. 62 x 45,3 cm.
Unten links mit Pinsel in Graubraun signiert „Erich Wolfsfeld“ und bezeichnet „Tetuan“.
1.500 €
Seit seinen ersten Reisen in die Türkei im Jahr 1905 blieb Wolfsfeld der Kultur Südeuropas und des Nahen Ostens immer verbunden. In den 1920er Jahren reiste er nach Marokko (1923), nach Ägypten und Palästina (1928). Das Bildnis eines stehenden jungen Mädchens entstand, Wolfsfelds Bezeichnung entsprechend, in Marokko. Genaue Beobachtung und präzise Formgebung lassen das Bildnis des Mädchens zeitlos und naturnahe erscheinen, während die Kleidung skizzenhaft angedeutet bleibt. Die ausdrucksstarke Zeichnung lässt den Einfluss seiner Vorbilder Rembrandt und Menzel erahnen.
Provenienz:
Privatsammlung Berlin Bassenge, Berlin, Auktion 100, 01.12.2012, Lot 8407 Sammlung Henning Lohner, Berlin
Ausstellung: „Übersehene Bilder“, Kunstmuseum Solingen, 2006/07, Abb. S. 202

fritz bleyl
(1880 Zwickau – 1966 Iburg)
7142 „Zuckerhof bei Sayda, Erzgebirge“ Kreide in Schwarz auf halbtransparentem Skizzenblockpapier. 1924.
32,5 x 43,3 cm.
Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Fritz Bleyl“ und datiert, unten links betitelt.
800 €
Mit charakteristischer Lockerheit und Ungezwungenheit im Strich zeichnet Bleyl die ländliche Szenerie zügig und klar. Der in Sachsen geborene Künstler verbrachte einige Jahre seiner Kindheit im Erzgebirge. Nach Gründung der Künstlergruppe „Brücke“ 1905 beteiligte sich Bleyl sehr aktiv an den gemeinsamen Ausstellungstätigkeiten der Gruppe, trat aber schon 1907 wieder aus, da er sich für ein bürgerlicheres Leben entschieden hatte.
Provenienz:
Lempertz, Köln, Auktion 792/793, 11.11.2000, Lot 686a
Privatbesitz Hessen

7143
heinrich (hein) steiauf
(1908 Groß-Zimmern – 1968 Frankfurt am Main) 7143 Parklandschaft Öl auf Leinwand.
48 x 31 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Hein Steiauf“.
1.000 €
Die Bäume scheinen miteinander in schwingender Rhythmik zu tanzen, die Natur zeigt der Künstler auf ganz eigentümliche Weise
bewegt und in seinem individuellen neusachlichen Stil. Steiauf, ausgebildet an der Frankfurter Städelschule und der Frankfurter Künstlergesellschaft, bei Johann Vincenz Cissarz und ab 1931 als Meisterschüler bei Max Beckmann, muss 1933, nach der Auflösung der Meisterklasse durch die Nationalsozialisten, seine Ausbildung abbrechen und arbeitet fortan abseits des öffentlichen Kunstbetriebs (vgl. Museum Kunst der Verlorenen Generation, verlorenegeneration.com, Zugriff 28.01.2025). Verso Reste einer weiteren Komposition.
karl hofer (1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)
7144 Stilleben mit Kürbis Öl auf Holz. Um 1925.
36 x 46 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weinrot monogrammiert „CH“ (ligiert) und datiert. Wohlert 671.
15.000 €
In der Schlichtheit ihrer Auffassung und der unübertroffenen malerischen Delikatesse gehören Hofers Stilleben zweifellos zu den Höhepunkten seines künstlerischen Schaffens. Das herbstliche Arrangement von Kürbis, Mohrrübe, Rettichen und Gurke, locker drapiert auf dem dunklen Tisch, gestaltet er in delikat abgemischten Nuancen von Grün-, Braunviolett- und Orangetönen. Gemüse und Früchte stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, während der Hintergrund in unbestimmtem Dunkel bleibt. Die Formen sind vereinfacht, der Duktus weich und locker, die Komposition wirkt geschlossen und, dank der Mohrrübe im Vordergrund, zugleich spannungsreich. Die Stilleben Hofers, entstanden seit den 1920er
Jahren, stellen einen fast intimen Bereich innerhalb des Schaffens des Künstlers dar. Sie sind gleichsam malerische Fingerübungen, die dem Künstler die erforderliche Kraft und Konzentration für die monumentalen Figurenkompositionen gaben.
Provenienz:
Stuttgarter Kunstkabinett R. N. Ketterer, T. 1, S. 47, Lot 195, Abb. Taf. 150 (hier: Stilleben mit Kürbissen, Rettichen und Rübe) (mit dessen Klebeetikett verso, dort bezeichnet „195“)
Kunsthaus Lempertz, Köln, Auktion 508, 1969, Lot 4486, Abb. Taf. 7 (hier: Gemüse-Stilleben)
Galerie Pels-Leusden, Berlin
Galerie Bassenge, Berlin, Auktion 65, 27.05.1995, Lot 6419 (hier: Stilleben mit Kürbis, Gurke, Rettich und Rübe)
Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Neue Kunst am Oberrhein Freiburg 1926, S. 10, Nr. 46
Das Stilleben in der Kunst des 20. Jh., Galerie Pels-Leusden, Berlin 1974, S. 5, Nr. 33


oskar behringer (1874–1956, Leipzig)
7145 Stilleben
Öl auf Malpappe. 1920.
47,7 x 34,7 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Schwarzbraun monogrammiert „B.“ und datiert.
900 €
Ausschnitthaft, mit klarer Schärfe und in teils leuchtendem Komplementärkontrast schildert Behringer die Gegenstände auf dem runden braunen Tisch. Eine blaue Obstschale mit gelben Äpfeln, daneben eine geschwungene grüne Blumenvase und im Vordergrund die türkisgrüne Tasse. Der Rest des behaglich wirkenden Umraums in warmen, erdigen Farben bleibt dagegen unklar. Behringer, der heute als einer der wichtigsten Vertreter des Leipziger Expressionismus gilt, wirkte im Umkreis von Christian Rohlfs, Rüdiger Berlit und Max Schwimmer und gehörte zum engeren Bekanntenkreis von Max Beckmann. Gemälde Behringers aus dieser frühen Zeit Anfang der 1920er Jahre sind auf dem Kunstmarkt sehr selten
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
robin christian andersen (1890–1969, Wien)
7146 Stilleben mit Äpfeln und Maiskolben Öl auf Malpappe.
41,5 x 25,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „R. C. Andersen“. 900 €
In kraftvollem Gestus und naturnaher Farbwahl schildert Andersen das dank der Schräge im Hintergrund besonders spannungsvoll komponierte Stilleben. Ab 1911 zählte er zu den Mitgliedern der Neukunstgruppe in Wien, der u.a. auch Egon Schiele, Albert Paris Gütersloh, Anton Kolig und Anton Faistauer angehörten. Im März 1918 nahm Andersen an der legendären, von Egon Schiele organisierten 49. Secessionsausstellung teil und wurde Mitglied der von Egon Schiele initiierten Neuen Secession Wien.
Provenienz: Privatbesitz Wien


franz radziwill (1895 Strohausen – 1983 Wilhelmshaven)
7147 „Stilleben mit Büchern“ Aquarell und Feder in Schwarz über Bleistift auf festem Skizzenblockpapier. 1924/25. 37 x 49 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Franz Radziwill“, mit Bleistift monogrammiert „FR“ und datiert „25“, verso nochmals signiert, datiert „1924“ und betitelt sowie bezeichnet „K. 999“ und auf Klebeetikett „117“. Seeba 2539.
5.000 €
Die beinahe übernatürliche Transparenz der Glasflaschen und die warme Materialität der Bücher und der Pflanze stellt Radziwill in
einen reizvollen Kontrast zueinander, indem er in meisterlicher Aquarelltechnik die unterschiedlichen Oberflächenwirkungen der Objekte auf der roten Tischplatte schildert. Harmonisch korrespondieren Rot- und Grüntöne miteinander, präzise Federstriche akzentuieren einige Konturen und unterstreichen die Klarheit der Bildgegenstände.
Provenienz: Nachlass des Künstlers Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin (in den späten 1960er Jahren direkt aus dem Nachlass erworben)
Ausstellung: Franz Radziwill, Rathaus Wilmersdorf, Berlin 1967 (Abb. S. 96)

franz heckendorf (1888 Berlin – 1962 München)
7148 Werder im Schnee Öl auf Leinwand. 1920.
75 x 90 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „F. Heckendorf“ und datiert.
8.000 €
Schräg fallen die Sonnenstrahlen aus der aufreißenden, tiefdunklen Wolkendecke und beleuchten die verschneiten Wege und Wiesen bei Werder. Die frühe, stimmungsvolle Szenerie im Havelland beeindruckt mit den sensibel und atmosphärisch dicht gesetzten Kontrasten. Mit großzügigem, schwungvollem Duktus sind die Farben pastos aufgetragen und verleihen der kurvenreich bewegten, tiefenräumlich wunderbar durchgestaffelten Landschaft
ebenso wie dem wolkendurchzogenen Himmel einen besonderen Schwung. „Stets hat Heckendorf die Motive wie von einer nicht vorhandenen Anhöhe herab geschildert. Er musste sich erheben, um einen möglichst großen Überblick zu haben und aus dieser Sicht das Ganze im Bilde zusammenzubinden. Für viele seiner Landschaften könnte man zutreffend sagen: ‚Wie ein Vogel flog er drüber hin‘.“ (Horst Beyer, in: Franz Heckendorf, Galerie Michael Haas, Berlin 1984). 1919 bezog Franz Heckendorf in Geltow bei Potsdam die Villa Auf dem Franzenberge 7, das Haus der Künstlerin Hannah Schreiber-de Grahl, bald umbenannt in Villa Heckendorf; Havellandschaften zählten nun zu seinen bevorzugten Motiven. Die Echtheit wurde von Trautl Jährling, Pfungstadt, am 31.03.2025 telefonisch bestätigt.
Provenienz: Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin

franz heckendorf
7149 Südfranzösische Küste Öl auf Holz. 1932.
75 x 95 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „F. Heckendorf“ und datiert.
5.000 €
Seit 1933 galt Heckendorfs Malerei als „entartete Kunst“. Das vorliegende Gemälde entstand kurz zuvor, noch unbeeinflusst von der kommenden Erniedrigung. Heckendorf gestaltet die mediterrane Landschaft in nuancenreich differenziertem Blau, Grün und
Rotbraun. Die in ihrem unbefangenen, dynamischen Duktus und Kolorit lebendige und frische Arbeit intensiviert den Natureindruck durch das Nebeneinander von kräftigen, leuchtenden Lokalfarben mit klaren Konturen. Die stimmungsvolle südliche Szenerie beeindruckt mit den sensibel und dicht gestaffelten Bildgründen, die der Maler von seinem typischen, leicht erhöhten Standpunkt aus schildert und die der Komposition eine besondere Tiefe verleihen. Die Echtheit wurde von Trautl Jährling, Pfungstadt, am 31.03.2025 telefonisch bestätigt.
Provenienz: Privatbesitz Österreich
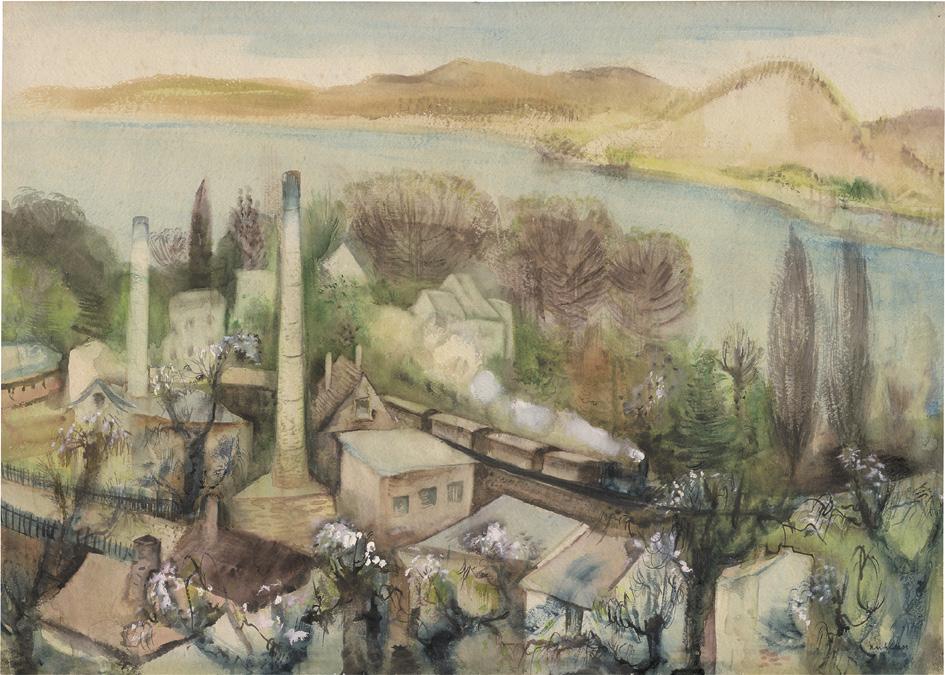

paul kuhfuss (1883–1960, Berlin)
7150 Rüdersdorfer See mit Kalkwerk Aquarell und Deckweiß über Bleistift auf Aquarellkarton. 1932.
51 x 71 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Kuhfuss“. Hellwich/Röske 32/44.
1.000 €
Durchstrahlt von Kuhfuss‘ eigenwilliger, gelblichgrüner Tonalität, erfüllt die märkische Industrielandschaft ein fast magisches Leuchten. „Paul Kuhfuss hat nun seine unverwechselbare Handschrift gefunden. Seine phantasievollen, poetischen, bisweilen traumhaften Bilder entziehen sich weitgehend einer Zuordnung zu Stilrichtungen oder Strömungen seiner Zeit“ (Peter Röske, in: Hellwich/ Röske, S. 14).
Provenienz: Bassenge, Berlin, Auktion 59, 06.05.1992, Lot 6781
Privatsammlung Berlin
7151 Blick auf den Achensee Öl auf Leinwand.
80 x 98 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „KUHFUSS“. Nicht bei Hellwich/Röske.
1.600 €
Paul Kuhfuss studierte bei Philipp Franck in der Landschaftsklasse der Königlichen Kunstschule zu Berlin, anschließend bei Anton von Werner an der Königlichen Akademischen Hochschule für bildende Künste. Das Motiv des Achensees malte Kuhfuss häufiger während seiner Tirolreisen 1926 und 1927. Unser Bild ist stilistisch vergleichbar mit Zeichnungen des Künstlers von 1926 und 1927 (vgl. Hellwich/Röske 26/8, 27/17-19) und den im Jahr darauf entstandenen Aquarellen vom Hallstätter See (Hellwich/Röske 27/21-23).
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

ernst fritsch (1892–1965, Berlin)
7152 Sanssouci
Öl auf Leinwand. 1927. 60 x 73 cm.
Unten links mit Pinsel in Rot signiert „E. Fritsch“ und datiert, verso mit Kreide in Rot bezeichnet „50“.
4.500 €
Eine völlig undramatische Szene: Vorbei am Bahnhof Sanssouci mit seinem alten Bretterzaun und wehenden Fahnen spaziert die junge Frau und ist in der Rückenansicht mit deutlicher Distanz zum Betrachter in einer unprätentiösen, kühlen und herben Formensprache gezeichnet. Schattenlos, in leuchtend heller Farbig-
keit und ganz im Stil der Neuen Sachlichkeit erfasst Fritsch, dessen frühes Schaffen noch von einem kubistisch-expressionistischen Stil dominiert war, die sommerliche Szenerie. Der Berliner Maler war seit 1919 Mitglied der damals von Lovis Corinth geleiteten Berliner Sezession und der Novembergruppe. Seit 1925 war er bei Ausstellungen der Neuen Sezession in München vertreten, 1946 wurde er Professor an der Berliner Hochschule für Bildende Künste. Heute wird er der „Verlorenen Generation“ zugerechnet.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 41, 26.11.1994, Lot 215 Privatsammlung Berlin

georg schrimpf (1889 München – 1938 Berlin)
7153 Zwei Frauen im Gespräch Aquarell über Bleistift auf festem bräunlichen Velin. 1930. 33 x 31,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „G. Schrimpf“ und datiert.
3.500 €
Selbstvergessen, in einer zeitlosen Ruhe und mildem Licht schildert Schrimpf die beiden Frauen in einträchtiger Gemeinschaft mit dem Kleinkind - und doch stehen sie in der Modernität ihres Habitus eindeutig im Kontext ihrer Zeit. Mit trotz all ihrer Zart-
heit klaren, schlichten Konturen und fein changierenden Lavierungen zeichnet der Künstler die stille Gartenszene. Das Sujet der zwei jungen Frauen in landschaftlicher Umgebung ist eines seiner typischen Bildmotive. Den nüchtern-reduzierten Stil der Neuen Sachlichkeit hatte sich Schrimpf als künstlerischer Autodidakt selbst angeeignet. Er nahm in den 1920er Jahren an zahlreichen Ausstellungen der Novembergruppe teil und stellte in der bedeutenden Münchner Galerie Hans Goltz aus.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 42, 26.11.1994, Lot 214 Privatsammlung Berlin

georg schrimpf
7154 Dorfstraße
Aquarell über Bleistift auf Velin. 1927. 24,3 x 34 cm.
Unten links mit Pinsel in Braun signiert „G. Schrimpf“ und datiert.
1.200 €
Weitgehend schattenlos, in hellem Licht und warmem Kolorit zeichnet Schrimpf die menschenleere und doch vom Menschen geprägte dörfliche Szenerie. Malerisch souverän erzeugt der Künstler eine Luftperspektive und die damit verbundene atmosphärische Stimmung der Landschaft. Die ausgeprägte Differenzierung durch gekonnten Einsatz des Kolorits in zarten sowie in kräftigeren Partien zeugt von seiner meisterhaften Beherrschung der malerischen Mittel. Beigegeben: Eine signierte Zeichnung von E. Hoffmann, „Bahnsignal“, 1924.
Provenienz:
Sotheby‘s, New York, Auktion 24.02.1995, Lot 44 Grisebach, Berlin, Auktion 47, 25.11.1995, Lot 277
Privatsammlung Berlin


bruno voigt
(1912 Gotha – 1988 Berlin)
7155 „Zuhälter u. Dirne“ Aquarell und Feder in Schwarz auf bläulichem Bütten. 1932. 60,5 x 46 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „-V-“ und datiert, auf dem Unterlagepapier mit Bleistift betitelt und bezeichnet „58“.
1.800 €
Zu Beginn seines Studiums an der Akademie für Bildende Künste in Weimar entdeckte Bruno Voigt seine Liebe zu Milieuzeichnungen. Im Jahr 1932, in dem unsere Zeichnung entstand, erhielt er einen Honorarvertrag vom Bavaria-Verlag in München für Karikaturen, Lithographien und Gouachen. Dieser wurde 1933 bereits wieder aufgelöst, da sein Stil als „entartet“ galt. In Voigts Frühwerk, zu dem das vorliegende Aquarell zählt, zeigt sich deutlich der Einfluss von Dix, Grosz und Schlichter. Angeprangert wird auch hier mit lockerem Strich die Verlogenheit der bürgerlichen Welt.
7156 Kapitalistentraum
Feder in Schwarz, Kohle und Graphit auf Bütten. 1932. 47 x 41 cm. Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „-V-“ und datiert.
1.800 €
In Grosz‘scher und Dix‘scher Manier stellt Bruno Voigt hier die Empathielosigkeit und Dekadenz der Reichen dar. Auf einem Tablett wird dem nackten Kapitalisten mit Zigarre, in Begleitung einer entblößten Frau, der Kopf eines Kommunisten präsentiert. Klerus, Wissenschaft, Militär und Handel stehen personifiziert hinter ihm und schauen gelangweilt. Voigt deckt die Diskrepanzen der gesellschaftlichen Zustände der Weimarer Gesellschaft auf, die Militarisierung sowie das Aufkommen des Faschismus beschäftigen ihn. Im folgenden Jahr wurde Voigts Atelier von der SA und der NSDAP durchsucht und viele seiner Werke zerstört.


bruno voigt
7157 Dreigroschenoper („Mein Auge gab ich dem König“)
Aquarell und Feder in Schwarz auf leichtem Karton. 1933. 32,5 x 25 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „-V-“ und datiert.
1.500 €
Dargestellt ist hier Brechts 1928 entstandene Dreigroschenoper. Ihr zentrales Thema ist die Entlarvung der korrupten Bourgeoisie. Auf der einen Seite erscheint der Bettlerkönig Peachum, Geschäftemacher, für den Not und Armut der anderen nicht mehr ist als ein Mittel zum Zweck. Gegenpart ist der Sympathieträger und skrupellose Verbrecher Mackie Messer. Im 3. Akt mobilisiert Peachum die Bettlermassen zum Aufbruch. Durch eine Demonstration des Elends beabsichtigt er, den Krönungszug zu stören, und so den Polizeichef „Tiger“ Brown zu zwingen, Mackie Messer zu verhaften.
7158 „Dreigroschenoper 2“ („Firma Bettlers Freund Peachum & Co“)
Aquarell und Feder in Schwarz auf leichtem Karton. 1933. 32,5 x 25 cm.
Verso am Unterrand mit Bleistift signiert „Bruno Voigt“, betitelt und datiert.
1.500 €
Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann mit Musik von Kurt Weill blieb bis 1933 die erfolgreichste deutsche Theateraufführung. Die Firma „Bettlers Freund“ gehört Jonathan Jeremiah Peachum, einem skrupellosen Geschäftsmann, der Londons Bettler organisiert und ausstattet, damit ihr Anblick die Herzen erweicht. Dafür verlangt er die Abgabe der Hälfte ihrer Einnahmen. Satirisch-kritische Illustration, die auch die schwierige gesellschaftliche Situation des Jahres 1933 widerspiegelt.
werner scholz
(1898 Berlin – 1982 Schwaz/Tirol)
7159 Mackie Messer Öl auf Karton. 1928.
49 x 37 cm.
Unten mittig mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „WS“ und datiert, verso von fremder Hand betitelt, bezeichnet „No. 5“ sowie mit den Maßangaben.
12.000 €
Die Dreigroschenoper: Im August 1928 uraufgeführt im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin, wurde sie sofort zu dem erfolgreichsten Bühnenstück der Weimarer Republik. Schemenhaft, mit kantig vergröberten Formen zeigt Scholz‘ im selben Jahr entstandene, grotesk und fast comicartig überspitzte Szene Polly Peachum und Mackie Messer, die berühmten Figuren Bertolt Brechts, in einer fast brutalen Ausdruckskraft. Allenthalben bleibt im Hintergrund, der flüchtig gemalt erscheint, die braune Malpappe sichtbar, wie es häufig in Scholz‘ Gemälden vorkommt. Charakteristisch ist auch das Figurenpaar in seiner Gegenüberstellung als Zweierkonstellation. In der Typisierung der Gestalten zeigt sich Scholz‘
Nähe zur Neuen Sachlichkeit. „Ausdrucksstark und empathisch widmete sich Scholz Kleinbürger- oder Halbweltexistenzen und schaute auf die eher dunklen Seiten der Zwischenkriegsjahre: Mittellose und Trauernde, Flüchtende und Zurückbleibende sind seine Protagonisten würdevolle Gestalten von eindringlicher Präsenz.“ (Karsten Müller, in: Werner Scholz. Das Gewicht meiner Zeit, Ausst.-Kat. Ernst Barlach Haus, Hamburg 2024, S. 61). Im Jahr 1937 wurde sein Schaffen durch die Nationalsozialisten als „entartet“ gebrandmarkt, 1944 verbrannten nach einem Bombeneinschlag in seinem Berliner Atelier alle darin versteckten Bilder; so blieb sein Frühwerk lange zu weiten Teilen unbekannt.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 51, 08.05.1996, Lot 433 Privatsammlung Berlin
Ausstellung: Werner Scholz, Musée des Beaux-Arts, Lyon 1970, Kat.-Nr. 9, Abb. 4 (mit deren Klebeetikett verso, dort handschriftlich bezeichnet)

renée sintenis
(1888 Glatz – 1965 Berlin)
7160 Der Boxer Hartkopp
Stucco, hellbraun gefärbt. Um 1927/30.
Ca. 40 x 30 x 11 cm.
Auf der Plinthe neben dem linken Fuß signiert „Sintenis“. Vgl. Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 115.
3.000 €
Die Dynamik der Vorwärtsbewegung, die aufs Höchste angespannte Konzentration des damals populären Boxkämpfers schildert die Bildhauerin mit dieser pointierten Darstellung des Athleten, in der zudem die Sportbegeisterung der Weimarer Republik

ihren Ausdruck findet. Lebendig durchmodelliert ist die Oberfläche des jugendlichen, trainierten Körpers. Die Figur des Boxers Helmut Hartkopp entstand als Bronze, daneben schuf Sintenis noch Exemplare in Stucco, deren Anzahl Berger/Ladwig/Wenzel-Lent jedoch nicht bekannt ist. In den 1920er Jahren bis 1933 schuf Sintenis mehrere Skulpturen berühmter Boxer, wohl auf Anregung des Galeristen Alfred Flechtheim. Äußerst selten. Bitte Zustandsbericht erfragen.
Provenienz: Privatbesitz Großbritannien Bassenge, Berlin, Auktion 70, 01.12.1997, Lot 6511 Privatsammlung Berlin

7161
rudolf möller
(1881 Schmiedefeld/Thüringen – 1968 Lörrach)
7161 Sitzender Mann
Öl auf Leinwand. Um 1920-25. 98 x 73 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert „Rudolf Möller“.
1.200 €
In expressiv abstrahierter Formensprache erfasst, kontrastiert die klar umrissene Figur des sitzenden Mannes mit dem vegetabilornamental ausgestalteten roten Hintergrund. Möller zählt zu den Künstlern der sogenannten Verschollenen Generation, seine
Arbeiten werden dem Expressiven Realismus zugerechnet. Der Schüler Lovis Corinths studierte zwischen 1905 bis 1907 an der Akademie in Berlin, 1918 war er an der Gründung der Novembergruppe beteiligt und nahm bis ins Jahr 1931 regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden seine Werke als „entartete Kunst“ diffamiert. 1943 wurde er aus Dresden vertrieben und musste einen Großteil seiner Arbeiten dort zurücklassen.
Provenienz: Privatsammlung Berlin

7162
werner heldt
(1904 Berlin – 1954 San Angelo/Ischia)
7162 Straße in Berlin am Abend, bei angehenden Later nen / Straße mit Litfaßsäule und leerer Kutsche 2 Kompositionen, recto/verso. Öl auf Holz. Um 1927. 30 x 39 cm.
Seel 55/56.
8.000 €
Menschenleer liegt die Stadtkulisse in der Dunkelheit des Abends, die nur spärlich von einzelnen Lichtern und einem Hauch Dämmerlichts erhellt wird. Blaue und braune Valeurs bestimmen die Szenerie, Dynamik erhält die Komposition insbesondere durch die vehementen Schräglagen der deutlich sichtbaren Pinselstriche, die kühn den Himmel überspannen und die Flächen durchziehen. In den vier Jahren bis 1928 zog Werner Heldt, gerne auch gemein-
sam mit dem verehrten Heinrich Zille, samstagabends durch die Stadt: „Mit Zille studiert er das Milieu der kleinen Leute, ein ‚Berlin von unten‘.“ (Seel S. 24). Während dieser Zeit entstanden die vorliegenden Kompositionen.
Provenienz:
Bassenge, Berlin, Auktion 15, 1970, Lot 1160 Privatsammlung Berlin Bassenge, Berlin, Auktion 105, 30.05.2015, Lot 8102 Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Werner Heldt 1904-1954, Galerie Michael Haas, Berlin 2017, Abb. S. 12

werner heldt
7163* Alt-Berlin mit Kutsche Öl auf Holz. 1927.
39,2 x 50,1 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „WH“ und datiert. Seel 44.
8.000 €
Gesichtslose Nachtschwärmer, schematisch angedeutet, bevölkern die Straßenecke mit der einladend geöffneten Restauranttür. Das Spiel der spärlichen Lichtquellen belebt die Darstellung und lässt aus einem dunklen Grundton heraus das gesamte Kolorit sich entwickeln, lässt Figuren und Farben nur en passant aufleuchten und betont das Atmosphärische der Darstellung. Die groben Pinselstriche verleihen den Bildgegenständen, den Häusern und dem Himmel interessante, schraffurähnliche Strukturen.
Provenienz:
Ehemals Sammlung Kurt Brandes, Berlin Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (Nachlass Brandes) Grisebach, Berlin, Auktion 203, 30.11.2012, Lot 442 Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Gedächtnis-Ausstellung Werner Heldt. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Haus am Waldsee, Berlin 1954, Kat.-Nr. 5 Werner Heldt, Kestnergesellschaft, Hannover 1957, Kat.-Nr. 3 (verso mit dem Klebeetikett)
Werner Heldt, Kestnergesellschaft, Hannover 1968, Kat.-Nr. 9 (verso mit dem Klebeetikett)
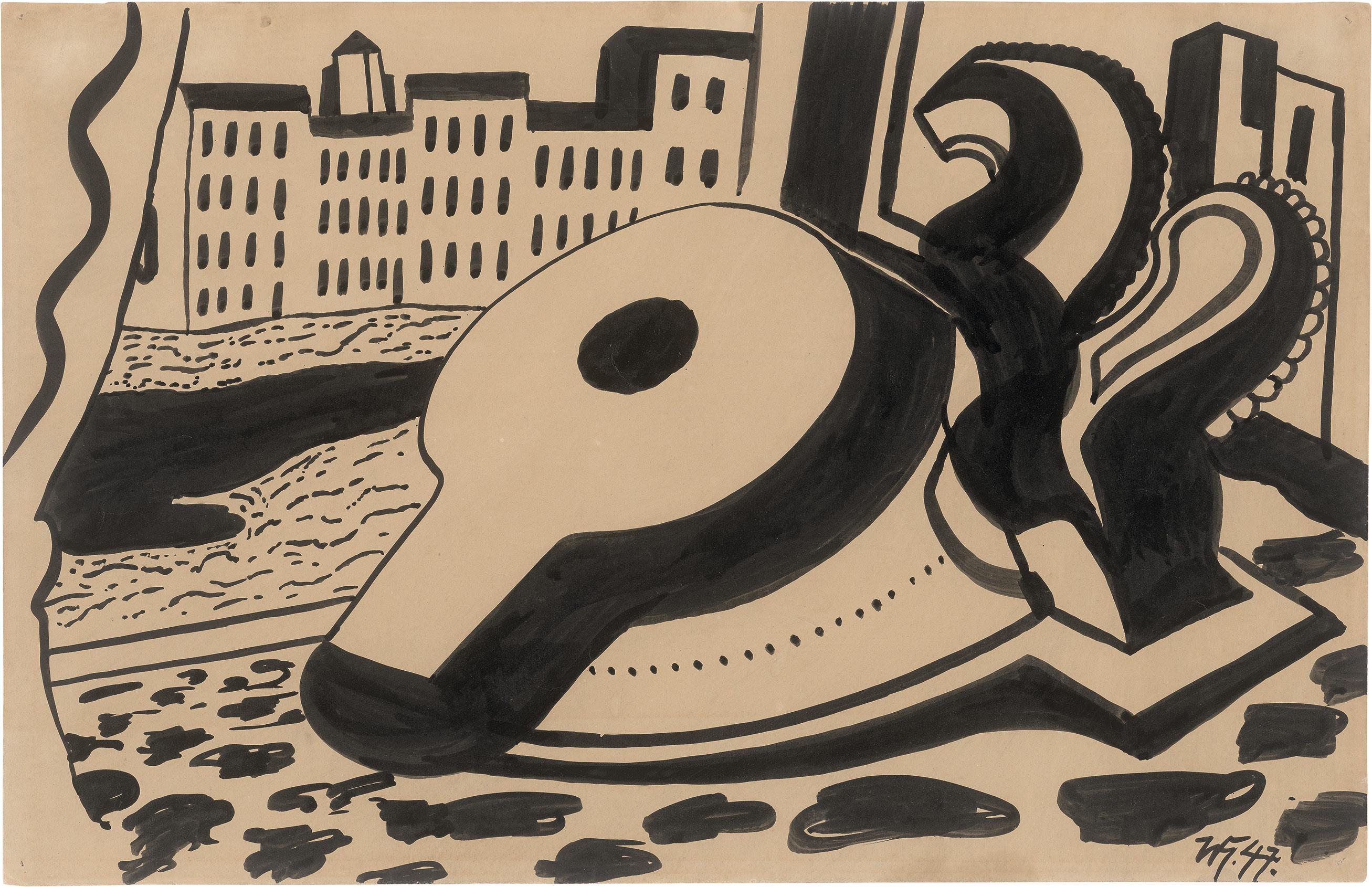
werner heldt
7164 Blick aus einem Fenster auf Berliner Stadtkulisse
Pinsel in Schwarz auf Velin. 1947.
32,5 x 50 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz monogrammiert (ligiert) „WH.“ und datiert. Seel 453.
6.000 €
Von 1946 an entstehen Heldts Tuschzeichnungen zum Motiv der Fensterausblicke, die das Gesehene in eine chiffrierte, zeichenhafte Form bringen. Es gibt hier nur Schwarz und Weiß, keine Dämmerzonen, keine Übergänge, nur Kontraste. Mit vereinfachten, geometrisierten Formen zeichnet Werner Heldt die Szenerie mit
der Gitarre im Zentrum. „Werner Heldt erfährt das Berlin von 1945 als existentiellen Ort, an dem deutsches Schicksal sichtbar wird. Vielleicht konnten Ruinen und Trümmer, das Zerstörte und das in der Zerstörung Gebliebene tatsächlich nur hier so kühl, so unsentimental gemalt werden wie in der Reihe der Fensterausblicke zwischen 1945 und 1950.“ (Wieland Schmied in: Werner Heldt, Köln 1976, S. 62).
Provenienz:
Ehemals Dr. Friedrich Bleckenwegner, Berlin
Privatbesitz Berlin
Dannenberg, Berlin, Auktion 21.03.2020, Lot 3646
Privatbesitz Berlin

louis schrikkel (1902 Amsterdam – 1995 Den Haag) 7165 Straßenmusiker Öl auf Holz. 1927. 66 x 43,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Hellgrau signiert „LOUIS SCHRIKKEL“ und datiert, verso mit Kreide in Weiß (wohl) nochmals signiert.
2.500 €
Die im Vordergrund lehnende Laute lässt das Grundmotiv des Gemäldes sofort ins Auge springen: In der dichten, vertikal gestaffelten Komposition geht es um Musik. Die Szene scheint von den Klängen der Instrumente der drei Straßenmusiker erfüllt. Geometrisch vereinfachte Formen und klar voneinander abgegrenzte Farbflächen mit pastos getüpfeltem Farbauftrag verleihen der frühen Arbeit Schrikkels eine charakteristische Modernität und Rhythmik. Schrikkel studierte an der Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 1931 hatte er im Alter von 31 Jahren seine erste Einzelausstellung und wurde Mitglied mehrerer Künstlervereinigungen (vgl. museumhelmond.nl, Zugriff 10.02.2025).
jeanne mammen (1890–1976, Berlin)
7166 Siesta
Lithographie auf weichem Japan. Um 1930/32.
44 x 34,5 cm (50 x 35,3 cm).
Signiert „J Mammen“.
Vgl. Döpping/Klünner D 23.
2.400 €
Die Gesamtauflage ist unbekannt, Döpping/Klünner können lediglich sieben Exemplare nachweisen (diese dort numeriert PA 1 bis PA 7), sie kennen jedoch das vorliegende Blatt nicht. Mammens
Lithographie entstand für eine deutschsprachige, vom Berliner Galeristen Wolfgang Gurlitt geplante Ausgabe der „Lieder der Bilitis“, ein Meisterwerk der erotischen Literatur von Pierre Louys (1870-1925). Von allen für diese Buchausgabe geschaffenen Lithographien sind jedoch nur wenige vereinzelte Probedrucke erhalten, da die geplante Auflage aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 nie erschien. Prachtvoller, zarter Druck mit dem vollen Rand. Extrem selten

7167

7166
jeanne mammen
7167 Musikantinnen
Bleistift, stellenweise mit farbigen Kreiden überarbeitet, auf dünnem Skizzenpapier. Ca. 1947.
29,8 x 21 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „JM“ (ligiert). Nicht bei Döpping/Klünner.
900 €
Mit schnellem Bleistiftstrich und nur wenigen Farbakzenten skizziert Mammen eine ihrer typischen Momentaufnahmen: Während sie die Tätigkeit der sitzenden jungen Dame vorne rechts nur vage umreißt, schildert sie umso deutlicher die mit Hingabe Akkordeon spielende Figur links im Bild.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 07.06.2002, Lot 1664
Privatbesitz Berlin

7168
jean cocteau (1892 Maison-Laffitte – 1963 Paris) 7168 Jean Desbordes endormi Feder in Schwarz auf gewalztem Velin. 1930. 27,2 x 20,9 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Jean“, mit dem Künstlersignet, datiert sowie bezeichnet „Montargis“.
3.000 €
Beredtes Zeugnis einer großen Liebe ist Cocteaus innige, sparsame Zeichnung des schlafenden Freundes, hingeworfen mit leichter Hand in geradezu schlafwandlerischer Sicherheit. Klaus Mann zufolge „interessiert das Phänomen Jean Desbordes vor allem im Zusammenhang mit dem Phänomen Jean Cocteau. Denn
Desbordes (...) ist, literar-historisch betrachtet, Cocteaus Geschöpf.“ (Klaus Mann, in: Neue Schweizer Rundschau, Heft 4, 1929, S. 316, zit. nach e-periodica.ch, Zugriff 14.01.2025). Beide lebten von 1926 bis 1929 miteinander, Cocteau schrieb das Vorwort zu Desbordes‘ 1928 erschienenen „J‘Adore“ (1928), einem Liebesgedicht an Cocteau. Auch nach ihrer Trennung versuchte Cocteau einzugreifen, als Desbordes während der Besetzung von Paris durch die Nazis inhaftiert wurde. Er scheiterte jedoch und konnte nicht verhindern, dass der Freund 1944 wegen seiner Widerstandsaktivitäten hingerichtet wurde.
Provenienz:
Piguet, Genf, Auktion 24.01.2021 (Collection Jean-Claude Gauteur), Lot 4654
Sammlung Henning Lohner, Berlin


Provenienz: Privatsammlung Frankreich Aguttes, Paris u.a., Auktion 05.-19.05.2022, Lot 14 Sammlung Henning Lohner, Berlin 7169
raoul dufy (1877 Le Havre – 1953 Forcalquier)
7169 Copenhagen, Christiana, Helsinki; Ottawa, Luxembourg, Stockholm 2 Bl. Bleistift auf Velin. 10 bzw. 9 x 27 cm. Jeweils unten rechts mit Bleistift monogrammiert „RD“ und bezeichnet.
1.200 €
Beide Blätter vereinen jeweils drei fein gezeichnete Stadtimpressionen, entstanden wohl auf Reisen Dufys.
raoul dufy
7170 Fleurs
Feder in Schwarz auf Makulaturpapier.
32,3 x 24,6 cm.
Unten mittig mit Bleistift signiert „Raoul Dufy“.
900 €
Felder von Parallelschraffuren überlagern und kreuzen einander in unterschiedlichen Winkeln und verleihen der floralen Komposition einen kristallinen Charakter.
Provenienz:
Matsart, Jerusalem, Special Hanukkah Auction, 24.11.2021, Lot 66
Sammlung Henning Lohner, Berlin

olaf rude (1886 Rakvere, Estland –1957 Frederiksberg)
7171 Blick aus dem Künstlerstudio in Allinge, Bornholm Öl auf Leinwand. Wohl 1930er Jahre.
75 x 92,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Orange-Rot signiert „Olaf Rude.“, verso jeweils auf Leinwand und Keilrahmen mit unleserlichem Stempel (mit S und Schlangen) und auf dem Keilrahmen mit Kreide in Blau alt numeriert „157 a“ . 2.000 €
Mit schnellem und expressivem Duktus erfasst Rude den Ausblick aus seinem Atelier auf Bornholm: Ein immer wiederkehrendes Bildthema in seinem späteren Œuvre. Fast skizzenhaft und ohne Ablenkung durch Details, scheint ihm das Einfangen der Atmosphäre an der Küste besonders wichtig. Alles wirkt zeitlos und noch heute typisch für Dänemarks Küstenlandschaft: das strahlend weiße Haus mit leuchtend rotem Dach, der leuchtend blaue Himmel, dessen Fläche ein weißer Fahnenmast senkrecht durchbricht, und im Vordergrund ein üppiges Blumenmeer. Rude, der sich 1930 auf Bornholm niederließ, wird immer wieder als Matisse von Dänemark bezeichnet. Spätestens seit seinem Besuch in Paris 1911 und durch den Einfluss von Paul Cézanne konzentrierte er sich mit einem reduzierten Stil auf Form, Farbe und Fläche.
Provenienz:
Bruun Rasmussen, Auktion 16.01.2017, Lot 528
Privatbesitz Berlin


paul paeschke (1875–1943, Berlin)
7172 Drachensteigen auf dem Tempelhofer Feld Öl auf Holz. Um 1920.
45 x 30,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Blau signiert „Paul Paeschke“, verso mit Bleistift nochmals signiert und betitelt sowie auf Klebeetikett mit dem roten Nachlaßstempel, dort betitelt, bezeichnet und auf der Platte bezeichnet „276“.
3.000 €
Munter schweben die bunten Drachen hoch über dem Tempelhofer Feld, unten auf dem weiten Grün, gesäumt von Mietshäusern und qualmenden Fabrikschloten, vergnügen sich Eltern und spielende Kinder. Eine heitere, entspannte Atmosphäre und strahlende Leichtigkeit gehen von Paeschkes lebendigem BerlinBild aus. Auch wenn der Ur-Berliner Studienreisen durch ganz Europa unternahm, fand er die Mehrzahl seiner Motive in seiner Heimatstadt. Der Künstler gestaltet die beschwingte Szenerie in heller Farbpalette, lasierendem Auftrag und mit impressionistisch lockerem Pinselduktus, die Figuren vielfach nur schematisch andeutend. Es zeigt sich hier die „sehr feine, lichte, oft etwas dunstig erscheinende Helligkeit, die für viele seiner Darstellungen zum typischen Merkmal werden sollte.“ (Irmgard Wirth, in: Paul Paeschke, einem Berliner Maler zum 100. Geburtstag, Ausst.-Kat. Berlin-Museum 1975, S. 8). In seiner motivischen und darstellerischen Leichtigkeit steht Paeschkes Gemälde in einer Reihe mit den Arbeiten der Berliner Sezessionisten wie Max Liebermann, Max Slevogt und Lesser Ury.
Provenienz:
Nachlass Paul Paeschke
Grisebach, Berlin, Auktion 38, 28.05.1994, Lot 229 Privatsammlung Berlin

7173 „Frl. Globig, Davoser (...) Skiausrüstungen zum Andenken Klosters“
Pastell und Bleistift auf bräunlichem Velin. 1930. 26 x 33,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Paul Paeschke“, unten links betitelt und datiert und mit Ortsangabe.
900 €
Im Schweizerischen Klosters im Kreis Davos fing Paeschke diese bezaubernde kleine Ansicht im Winter ein: Hinter vier Skifahrern im Tal erhebt sich eine gewaltige Kulisse schneebedeckter Gipfel, links ein typisches Schweizer Chalet. In impressionistisch raschem, lockerem Strich skizziert Paeschke die Szene direkt en plein air. „Dem schnellen Festhaltenwollen von Eindrücken kam die Pastellmalerei entgegen, denn Paeschke hat wohl nur selten nach Notizen in Skizzenbüchern und Studien erst im Atelier seine Bilder gestaltet und vollendet, schien doch die kürzere Methode unmittelbar vor der Natur die für ihn einzig richtig zu sein.“ (Irmgard Wirth, in: Paul Paeschke, einem Berliner Maler zum 100. Geburtstag, Ausst.-Kat. Berlin Museum 1975, S. 10).
Provenienz: Privatbesitz Berlin

hermann hesse (1877 Calw – 1962 Montagnola/Schweiz)
7174 Heißer Mittag
2 Bl. Aquarell und Feder in Schwarz bzw. Feder in Sepia auf Velin. Um 1933. Je 28 x 22 cm.
1.500 €
Auf einem Blatt Hermann Hesses handgeschriebenes Gedicht: Heißer Mittag
Im trocknen Grase lärmen Grillenchöre./ Heuschrecken flügeln am verdorrten Rain,/ Der Himmel kocht und spinnt in weiße
Flöre/ Die fernen bleichen Berge langsam ein./ Es knistert überall und raschelt spröde,/ Auch schon im Wald erstarren Farn und Moos,/ Hart blickt im dünnen Dunst der Himmelsöde/ Die Julisonne weiß und strahlenlos./ Einschläfernd laue Mittagslüfte schleichen./ Das Auge schließt sich müd. Es spielt das Ohr/ Im Traum sich die ersehnten, gnadenreichen/ Tonfluten kommender Gewitter vor.
Der Schriftsteller Hermann Hesse schuf ein umfangreiches Werk an Aquarellen, die häufig wie hier als Gedichtillustrationen dienten.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

gert heinrich wollheim (1894 Loschwitz – 1974 New York) 7175 Großes Blumenstilleben Öl auf Hartfaser. 1931. 119 x 100 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Wollheim“ und datiert, verso zweifach bezeichnet „497“.
1.500 €
Mit impressionistischer Leichtigkeit im Duktus und in klassischer Anordnung erfasst der Künstler den üppigen Strauß aus Gartenund Feldblumen mit duftigen Gräsern. Der Hintergrund bleibt unbestimmt in natürlichen Grün- und Brauntönen. Typisches Beispiel für Wollheims bisweilen völlig unpolitische Malerei in den
Berliner Jahren um 1930. Gert Wollheim, ein hochbegabtes Multitalent, gehörte zu den Denkern und Propagandisten der neuen Kunst im Rheinland. Nach seinen Studien bei Egger-Lienz an der Kunstschule in Weimar und bei Lovis Corinth in Berlin erlangte er Bekanntheit in der Phase der „wilden Jahre“ zwischen 1919 und 1925, als er Mitglied der Künstlervereinigung „Junges Rheinland“ war. 1925 schloss er sich der Novembergruppe in Berlin an. Im Dritten Reich als „entartet“ diffamiert, floh er nach Frankreich, 1947 emigrierte er in die USA.
Provenienz: Privatbesitz Berlin (mit dessen Klebeetikett verso) Bassenge, Berlin, Auktion 67, 08.06.1996, Lot 6813 Privatsammlung Berlin

erich lindenau (1889 Bischofswerda – 1955 Dresden) 7176 „Verwelkte Sonnenblumen“ Öl auf Hartfaser. 1935. 77 x 60 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Beige monogrammiert „EL“ (ligiert) und datiert, verso mit Feder in Schwarz signiert „E. LINDENAU“, betitelt „Verw. Sonnenblumen“ und bezeichnet „Dresden“.
2.500 €
Das Vergänglichkeitsmotiv der verwelkten Sonnenblumen findet sich immer wieder im Schaffen Lindenaus, eines der bedeutendsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit in Dresden. In fast hyperrealistischer Manier und gestochener Schärfe zeichnet der Künstler die festen braunen Samenstände der Blütenköpfe vor einem tiefdunklen Hintergrund, der die Komposition mit einer tiefen, in Kombination mit der Vanitassymbolik fast metaphysischen Stille erfüllt. Ab 1933 stellte Lindenau regelmäßig bei den Dresdener Kunstausstellungen aus.
Provenienz: Privatbesitz Berlin


otto modersohn
(1865 Soest – 1943 Rotenburg/Wümme)
7177 Dunkler Tag im Moor Kohle und farbige Kreide auf der Rückseite eines Briefumschlags. Um 1942.
14 x 19,2 cm.
Auf dem Unterlagepapier vom Sohn des Künstlers mit Bleistift bestätigt „Für Otto Modersohn, Chr. M.“. 900 €
Zeichnung auf der Rückseite eines an Modersohn adressierten, am 02.12.1941 abgestempelten Briefumschlags. Seit 1936, als Modersohn auf dem rechten Auge erblindet war, malte er ausschließlich im seinem Atelier. Bei der vorliegenden Studie handelt
es sich also um eine Naturerinnerung, um ein inneres Bild, und so konzentriert der Künstler sich auf das Wesentliche: Die flache Landschaft mit ihren feuchten Wiesen und kahlen Bäumen, das dicht an den Boden geduckte Haus schildert er mit vehementem Duktus und sicheren Linien der dunkeltonigen Kreiden.
Provenienz: Familie des Künstlers
Galerie Rosenbach, Hannover (1980) Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 11.12.2015, Lot 374 Privatbesitz Hessen

7179
leo von könig
(1871 Braunschweig – 1944 Tutzing)
7178 Pfauen / Tiere am Bauernhof 2 Kompositionen, recto/verso. Öl auf Holz. Um 1923. 23,8 x 29,5 cm.
Verso unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „L. V. König“ und (unleserlich) gewidmet. Nicht bei Bechter.
2.500 €
Tiermotive finden sich immer wieder in Leo von Königs malerischem Schaffen, und mit dem Motiv der Pfauen befasste er sich auch deshalb häufiger, weil er selber einige der prachtvollen Vögel in seinem Garten am Berliner Schlachtensee hielt. Mit breitem Pinselstrich und pastosem Farbauftrag erfasst der Künstler die charakteristische Haltung der Tiere, die in ihrer Haltung ganz natürlich wirken und deren Federkleid in dunklen, warmen Nuancen schimmert.
7179 Josepina Gräfin Schlippenbach Öl auf Leinwand. Ca. 1935. 87 x 66 cm.
Oben links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „L.K.“. Bechter 1935/16.
4.000 €
Einer der bedeutenden Vertreter der Berliner Sezession war Leo von König, vor allem aber ein begnadeter Portraitist. Die Dargestellte Josepina Gräfin von Schlippenbach, geb. Stienen, in zweiter Ehe mit Hans Graf von Schlippenbach verheiratet, wurde von ihrem Schwiegersohn Leo von König portraitiert. Er zeigt sie als elegante, wohlsituierte Dame in Trauerkleidung. In großem Ernst und einer gewissen Strenge ist sie dargestellt, die sich sowohl in den malerischen Mitteln wie der charakteristischen, zurückgenommenen Farbigkeit niederschlägt, als auch in ihrer Haltung und dem herben Ausdruck. Leo von Königs immense Fähigkeit, die Erscheinungen seiner Zeitgenossen zu erfassen, trug ihm stets ausreichend Portraitaufträge ein.
Provenienz: Aus der Familie des Künstlers


walt disney studio
7180 Mickey‘s Kangaroo
Blei- und Farbstift auf Skizzenpapier. 1935. 24 x 30,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift bezeichnet „217“.
700 €
Animationszeichnung für den Kurzfilm, der am 13. April 1935 Premiere hatte. Mickey entdeckt hier, dass zwei Känguruhs bei ihm angekommen sind, Hoppy und ihr Sohn Joey. Die Zeichnung schildert die Szene um die 3:35-Marke. Dieser Kurzfilm erschien als der letzte komplett schwarz-weiße Mickey-Mouse-Cartoon des Disney-Studios unter der Regie von Dave Hand. Im Unterrand mit den charakteristischen verstärkten Lochungen.
Provenienz:
Heritage Auctions, Houston, Auktion 26.12.2016, Lot 14165
Sammlung Henning Lohner, Berlin
7181 Mickey Mouse on Skates
Blei- und Farbstift auf Skizzenpapier. 1935. 24 x 30,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift bezeichnet „24“.
800 €
Die schwungvoll angelegte Produktionszeichnung, entstanden für den achtminütigen Kurzfilm „On Ice“ in den Disney-Studios, lässt den Entstehungsprozess anhand der feinen Vorzeichnungen beispielhaft erkennen. Die Regie dieses 79. Mickey Mouse-Kurzfilms führte Ben Sharpsteen, und Walt Disney selber sprach die Rolle der Mickey Mouse. Im Unterrand mit den charakteristischen verstärkten Lochungen.
Provenienz:
Heritage Auctions, Houston, Auktion 01.01.2017, Lot 11179
Sammlung Henning Lohner, Berlin
renée sintenis (1888 Glatz – 1965 Berlin)
7182 Zwei spielende Hunde Bronze mit grünlicher Patina. 1937. 10,2 x 15,3 x 6,5 cm.
Auf dem Bauch des rechten Hundes monogrammiert „RS“ sowie mit dem Gießerstempel „H.Noack Berlin“. Buhlmann 104, Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 158. 12.000 €
Wild und ausgelassen tollen die zwei jungen Hunde herum. Die Schnauze nach oben gerichtet, springen sie sich so verspielt an, dass sich ihre Vorderpfoten in der Luft ineinander verhaken. Hunde

hat Renée Sintenis immer wieder gerne zum Motiv ihrer Kleinbronzen gewählt, sie stellte jedoch zumeist nur einen einzelnen Terrier in verschiedenen Posen dar: im Sitzen, auf den Hinterbeinen, beim Schlafen, im Liegen, beim Bellen und beim Spielen (vgl. u.a. Berger/Ladwig/Wenzel-Lent Nr. 71, 88, 96-99, 110, 118). Im Jahr 1928 entstanden die meisten Hundebronzen. Unserer Arbeit am ähnlichsten ist allerdings der „Junge Hund“ von 1934, der erwartungsvoll nach oben schaut. Ein Exemplar der „Zwei spielenden Hunde“ befindet sich laut Berger/Ladwig/Wenzel-Lent in der Neuen Nationalgalerie, Berlin. Prachtvoller Guss mit lebendiger Patina, die Hundeköpfe, Ohren und Hinterbeine sind sehr schön plastisch modelliert.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

t. lux feininger
(1910 Berlin – 2011 Cambridge, MA)
7183 „Cutter carrying spinnaker, balooner & ringtail“ Farbige Kreiden, Feder in Schwarz und Bleistift auf Velin, auf Karton kaschiert. 1929-30. 21 x 29,8 cm (37 x 49,8 cm, Karton).
Unten rechts auf dem Unterlagekarton mit Feder in Schwarz betitelt.
2.000 €
Kutter unter Spinnaker, Ballon- und Leesegel. Beeinflusst vom künstlerischen Blick seines Vaters und doch in ganz eigenem Stil zeigt T. Lux Feininger das maritime Motiv. Die dramatisch geblähten Segel verleihen der Komposition Spannung, die wogende See bleibt eine tiefdunkle abstrahierte Farbfläche, während die Details des Schiffes mit großer Genauigkeit erfasst sind. Bereits mit 16 Jahren studierte er bei Oskar Schlemmer in der Bühnenklasse am Bauhaus in Dessau, widmete sich jedoch ab 1929 vornehmlich der Malerei maritimer Themen. Die Zeichnung ist im Online-Werkverzeichnis der Zeichnungen von T. Lux Feininger registriert (kunstarchive.net/de/wvz/t_lux_feininger; ohne Nr., Zugriff 26.03.2025)
Ausstellung:
Theodor Lux, Kunstverein Erfurt 1931, Nr. 13
Sonderausstellungen, Vierte Reihe im Haus der Juryfreien, Berlin 1931, Nr. 3
Welten-Segler. T. Lux Feininger zum 100. Geburtstag, Werke 19291942, Kunsthalle Kiel u.a. 2010, S. 40 (Abb.) 100 Jahre Bauhaus. T. Lux Feininger 1910-2011, Bauhaus Archiv Berlin 2019, Nr. 7
moriz melzer
(1877 Albendorf, Riesengebirge – 1966 Berlin)
7184 Segelnder Fischer Öl auf Leinwand, auf Hartfaser kaschiert.
60 x 40 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Dunkelbraun signiert „M. Melzer“.
8.000 €
Die rhythmische Bewegtheit der See durchdringt die gesamte Komposition. Die Figur des Seglers, sein Boot und die Motive im Hintergrund, Wasser, Wolken und andere Segelboote, verschränken sich miteinander durch ihre Zerklüftung und Aufsplitterung in wuchtige, scharfkantige Formen, so dass sie sich gegenseitig in der Kraft ihres Ausdrucks verstärken. Durch die Varianten der Formgebung und die Farbverteilung entsteht eine ruhige Zone in der unteren Bildhälfte des Vordergrundes und eine vehement bewegte Partie oben im Hintergrund. Melzer „knetet die Welt des Sichtbaren gewaltig um und formt sie nach seinen Gesetzen.“ (Gerhard Leistner, Streben nach reiner Kunst, in: Moriz Melzer. Werke von 1907 bis 1927, Ausst.-Kat. Ostdeutsche Galerie Regensburg 2007, S. 95). Nach seiner Teilnahme an der Berliner Sezession gründete der aus Böhmen stammende Melzer zusammen mit Pechstein, Tappert und anderen die revolutionäre Novembergruppe.
Provenienz: Privatsammlung Berlin


willy jaeckel (1888 Breslau – 1944 Berlin)
7185 Bildnis einer jungen Frau
Pastellkreiden auf Malpappe. Um 1940. 29,2 x 29,2 cm (Passepartoutausschnitt).
Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „W. Jaeckel“. 800 €
Das streng zurückgekämmte Haar und ein konzentrierter Blick kontrastieren mit den weichen, rundlich herausgearbeiteten Gesichtspartien wie Wangen, Nase und Mund ebenso wie mit den entblößten Schultern und verleihen der Portraitierten, vermutlich einer Schauspielerin, eine sanfte Ernsthaftigkeit.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
max ackermann
(1887 Berlin – 1975 Bad Liebenzell)
7186 „Komposition 2“
Zimmermannsbleistift auf Velin. 1941. 24,8 x 16 cm.
Unten links mit Bleistift monogrammiert „M.A.“, unten rechts datiert, verso mit Feder in Schwarz signiert „Max Ackermann“, betitelt und bezeichnet „Stuttgart“. 900 €
Bei Adolf Hoelzel in Stuttgart, wo Ackermann ab 1912 an der Akademie studierte, lernte er den Zugang zur abstrakten Malerei. Hoelzel lehrte ihn, dass es die eigentliche Aufgabe des Künstlers sei, auf der Fläche des Bildes und auf der Grundlage der aus der Natur entnommenen Formen autonome Kompositionen zu schaffen. Um 1941 entschloss sich Ackermann zur allmählichen Aufgabe des Gegenstandes zugunsten der Abstraktion. Aus dieser Phase stammt die vorliegende Zeichnung.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 305, 05.06.1975, Lot 1
Privatbesitz Hessen

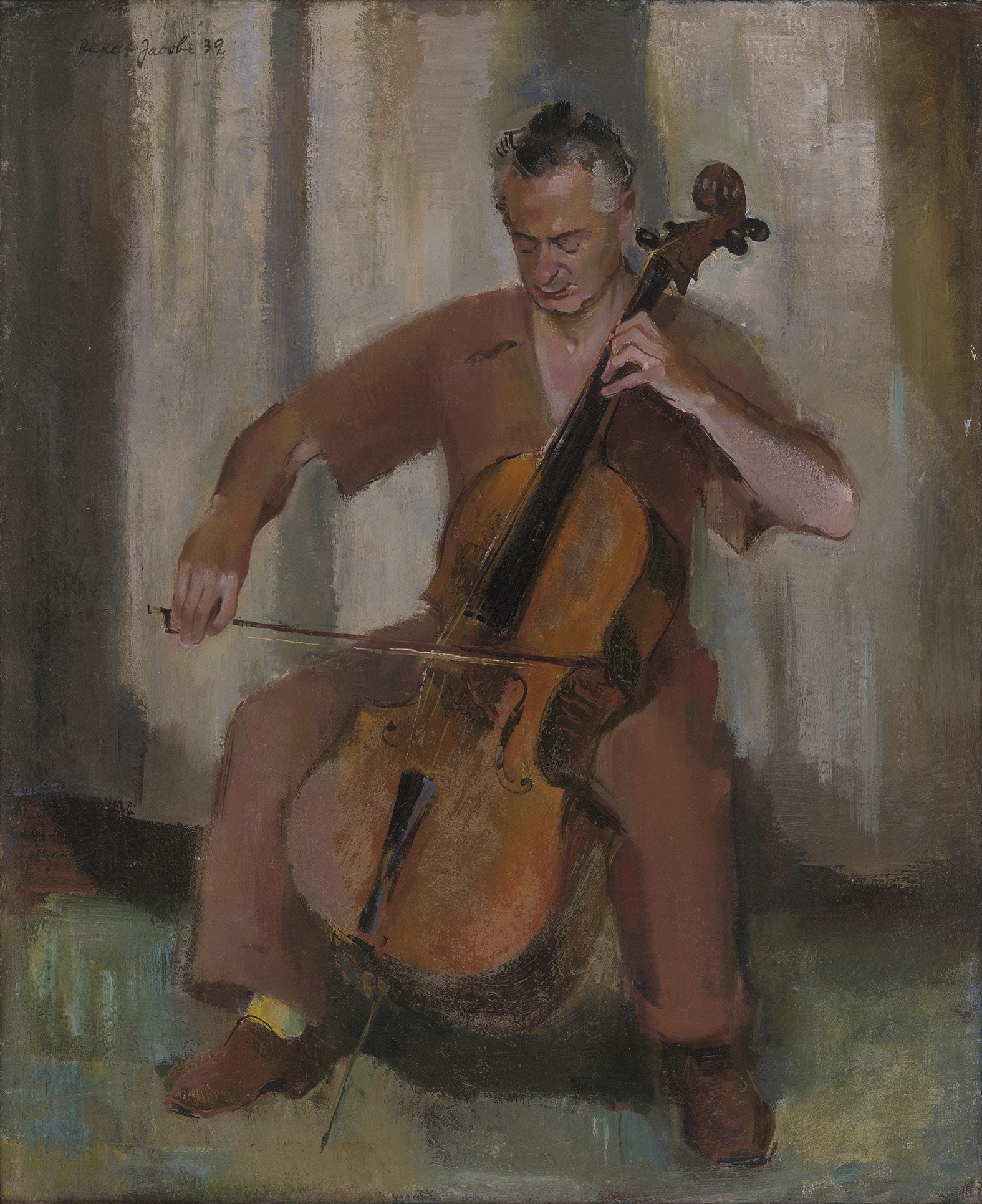
rudolf jacobi (1889 Mühlhausen – 1972 München)
7187 Boris Hamburg spielt die Bach Bourrée Öl auf Leinwand, doubliert. 1939. 100 x 82 cm.
Oben links mit Pinsel in Schwarzgrün signiert „Rudolf Jacobi“ und datiert.
1.200 €
Im Portrait des in Russland geborenen Cellisten Boris Hamburg gelingt es Jacobi, nicht nur die physische Präsenz, die Konzentration und Hingabe des Musikers einzufangen, sondern auch die innere Welt der Musik und das Verschmelzen des Künstlers mit seinem Instrument hin zu einer untrennbaren Einheit.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

august wilhelm dressler (1886 Bergesgrün/Böhmen – 1970 Berlin) 7188 „Frühschnee in der Rhön“ Öl auf Sperrholz. 1928. 50 x 60 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz mit dem Künstlersignet „WD“ und datiert, verso signiert „Aug Wilh Dreßler“ und betitelt.
1.500 €
Einsam durchquert ein Mann den Ort, ein leichter Schneeschimmer liegt über den Flächen, warme, abgetönte Farbwerte dominieren die Komposition. Dressler, einer der stilprägenden Vertreter der Neuen Sachlichkeit, studierte 1906-1913 an den Akademien
in Dresden und Leipzig. Anschließend zog er als freischaffender Künstler nach Berlin und schloss sich der Novembergruppe an. 1924 wurde er Mitglied der Berliner Sezession. Max Osborn nennt Dressler 1927 „einen der besten und redlichsten der Neurealisten“ (zit. nach Gerhard Leistner, s.u.). „Sparsam geht Dressler auch mit seiner Farbpalette um, wenn er die Figuren in stumpfen, weichen und abgestuften Tonwerten mit wenigen Aufhellungen malt, was zur Entstofflichung der Gegenstände führt, die die Welt noch stärker anorganisch macht.“ (Gerhard Leistner, in: August Wilhelm Dressler, Ausst.-Kat. Galerie Nierendorf, Berlin 2007, S. 2).
Provenienz: Privatsammlung Berlin

august wilhelm dressler
7189 „Zirkus auf dem Seil “ Öl auf Leinwand. 1952.
59 x 50 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz mit dem Künstlersignet „AWD“, verso mit Faserstift in Rot datiert und betitelt.
2.500 €
Die graziöse Akrobatin hält inne. Sie scheint erstarrt im Scheinwerferlicht, inmitten der Bewegung auf der Leiter hoch ins Zirkus-
zelt, und verharrt mit ihrem winkenden Arm im Moment. Den blassen, langgestreckten Körper stellt der Künstler nicht wie eine reale, lebensvolle junge Frau dar, sondern sie wirkt starr wie eine Schaufensterpuppe, geschildert in makelloser Plastizität. In Dresslers Spätwerk finden sich zunehmend Sujets aus - vielfach artistischen - Randgruppen der Gesellschaft, wie Revuegirls, Gaukler, Balletteusen und Artisten.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

werner gilles
(1894 Rheydt – 1961 Essen)
7190 Der Kirchhof Öl auf Leinwand. 1926. 60 x 79 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Beige signiert „WGilles“, verso auf dem Keilrahmen von fremder Hand datiert, betitelt und bezeichnet „Kt. 3“. Schwengers G 65.
3.500 €
Mit expressiv gesteigerter Farbgebung in leuchtenden Tönen und kräftigen Kontrasten intensiviert Gilles den Ausdruck des Kirchhofs derart, dass alle Bildelemente gleichwertig erscheinen. Die
kleinteilige Formensprache, der nervöse Duktus, ein pastoser Farbauftrag und der Detailreichtum verleihen der Komposition eine für diese Schaffensphase charakteristische Üppigkeit. In den Jahren 1925 und 1926, in der Düsseldorfer Zeit, schuf Gilles mehrere Gemälde zum Motiv des Friedhofs (vgl. auch Schwengers G 60, 62 und 64). In diesen Jahren bewegte sich Gilles nach wie vor im Umkreis der Künstlergemeinschaft bei Mutter Ey und zeigt sich in seinem Schaffen von der französischen Malerei inspiriert.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 41, 16.11.1994, Lot 269 Privatsammlung Berlin

werner gilles
7191 „Sant‘ Angelo“ Aquarell auf Bütten, auf Velin montiert. 1958. 22 x 32,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „Gilles“ und datiert, auf dem Unterlagepapier nochmals signiert „Werner Gilles“, datiert, betitelt und gewidmet. 900 €
Der Fischerort Sant‘ Angelo im Süden der Insel Ischia diente Gilles als unerschöpfliche Inspirationsquelle für seine typischen Inselund Gartenlandschaften. In einer Kombination aus Abstraktion und Figuration unterstreicht die Aneinanderreihung kubischer Formen mit ihrer Ordnung das reizvolle Durcheinander von architektonischen und vegetabilen Elementen. Die Helligkeit des Lichts findet einen treffenden Ausdruck in dem leichten, transparenten Farbauftrag des Aquarells, der die Wärme der südlichen Landschaft verdeutlicht.
Provenienz: Privatbesitz Belgien

jacques lipchitz
(1891 Druskininkai/Litauen – 1973 Capri)
7192 Pastorale
Gouache, Pinsel in Schwarz, Tusche und Kohle auf grauem Ingres-Bütten. 1933. 63 x 48 cm.
Oben rechts mit Feder in Schwarz signiert „JLipchitz“ (ligiert).
2.400 €
Charakteristisch abstrahierte Komposition, in der Helldunkelwirkung von skulpuraler Plastizität. Mit seiner ausgeprägten Nase ruft der Kopf Assoziationen an einen Tier- oder vielleicht einen Schweineschädel hervor. In den Jahren 1933 und 1934 schuf Lipchitz einige Arbeiten, dabei auch Plastiken, zum Thema der „Pastorale“, die sich meist auf das Motiv des auf einer Hand ruhenden Kopfes beziehen.
Provenienz:
SAKS Galleries, Denver (2004)
Marlborough Gallery, New York, Nr. N 36.977 (2007) Bonhams, London, Auktion 17.-27.09.2021, Lot 2
Sammlung Henning Lohner, Berlin
Ausstellung:
Jacques Lipchitz. Skulpturen und Zeichnungen 1911-1969, Neue Nationalgalerie, Berlin 1970, Nr. 85
Jacques Lipchitz at Eighty. Sculpture and Drawings 1911-1971, Tel Aviv Museum und The Israel Museum, Jerusalem 1971, Nr. 84
Jacques Lipchitz. Small Sculptures, Maquettes and Drawings 1915-1972, Marlborough Gallery, New York 1979, Nr. 10
Lipchitz and the Avant-Garde. From Paris to New York, Krannert Art Museum and Kinkead Pavilion, Urbana-Champaign 2001, Nr. 54
Lipchitz. Dibujos/Drawings, Valencia, Institut Valencià D‘Art Modern 2002
Jacques Lipchitz. Sculpture and Drawings 1912-1972, Marlborough Gallery, New York 2004, Nr. 48
Literatur:
H. H. Aranson & J. Lipchitz, My Life in Sculpture, New York 1972 (Abb. S. 126)

jacques lipchitz
7193 Le Minotaure
Gouache, Aquarell, Pinsel in Schwarz, Tusche und Bleistift auf bräunlichem Velin. Um 1950-60.
36,3 x 30,5 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „JLipchitz“ (ligiert).
2.200 €
Das der griechischen Mythologie entstammende Sujet von Theseus und dem Minotaurus beschäftigte Lipchitz bereits in den 1940er Jahren in verschiedenen künstlerischen Gattungen, jeweils in
variierenden psychologischen Ausdeutungen. Hier scheinen die beiden Kämpfer, der Mann und das Mischwesen, zu einer einzigen, hochdynamisch bewegten Figur zu verschmelzen, und der Künstler verdeutlicht damit sein eigentliches Thema eines inneren Kampfes.
Provenienz:
Privatsammlung Kansas City (ca. 2005)
Marlborough Gallery, New York, Nr. NON 44.354 (2007) Bonhams, London, Auktion 17.-27.09.2021, Lot 3
Sammlung Henning Lohner, Berlin

pablo picasso (1881 Málaga – 1973 Mougins)
7194 Peintre au travail observé par un modèle nu Radierung auf Japon nacré. 1927-28. 19,2 x 27,7 cm (25 cm x 32,7 cm).
Mit Farbstift in Rot signiert „Picasso“. Auflage 65 Ex. Bloch 89, Geiser/Baer 130 c (von d).
5.000 €
Blatt 8 der Folge „Le chef-d’œuvre inconnu“, von Balzac, Paris 1931, herausgegeben von Ambroise Vollard. Wohl aus der bei Geiser/ Baer unter c erwähnten Auflage von 65 zum Teil in Rot signierten Abzügen auf Japon nacré, gedruckt nach Verstählung der Platte bei Crommelynck, Paris. Prachtvoller, klarer und filigraner Druck mit tief eingeprägter Plattenkante, mit dem wohl vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand.
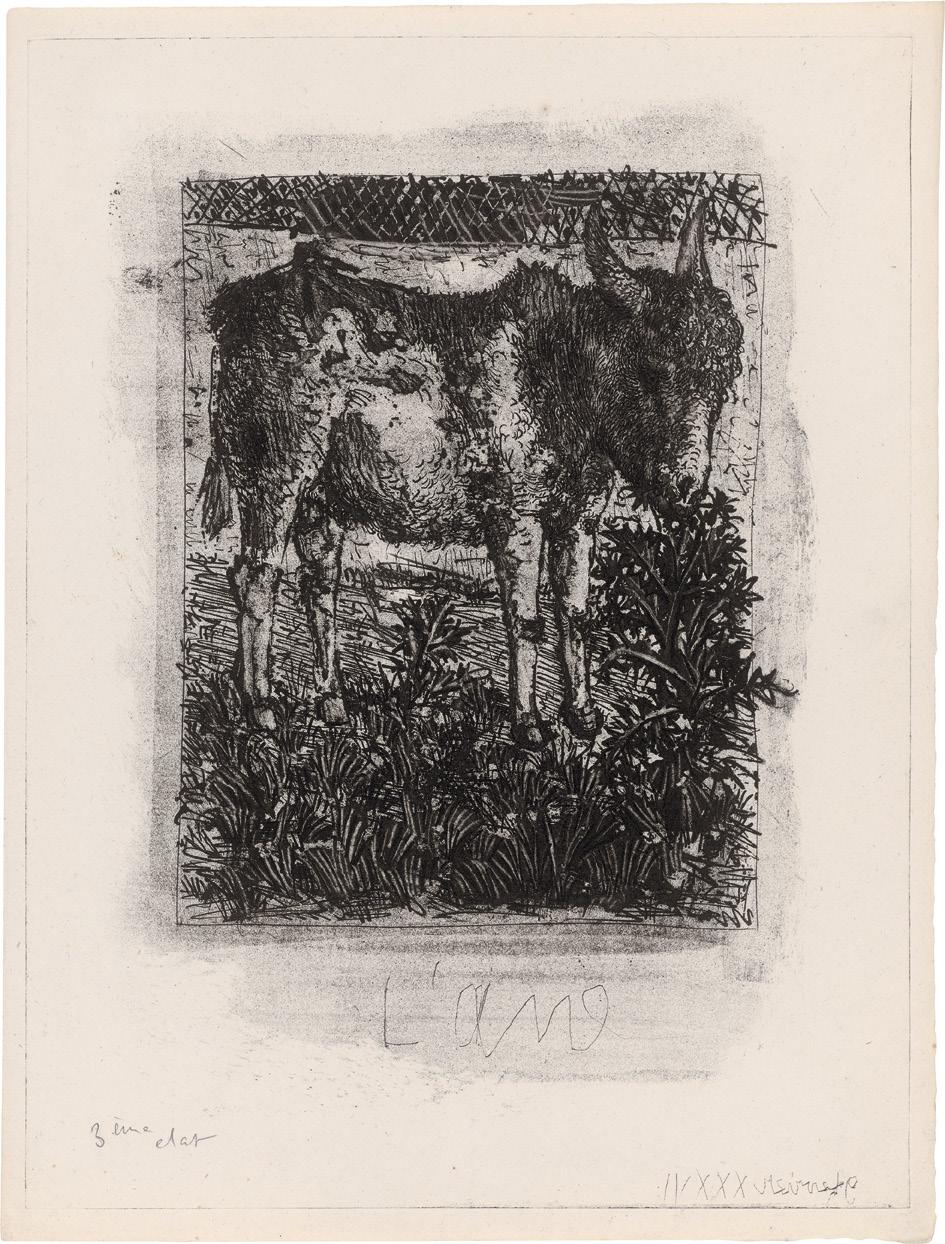
pablo picasso
7195 L‘Âne
Aquatinta mit Kaltnadel auf kräftigem Montval-Velin. 1936.
41,5 x 31,5 cm (44 x 33,3 cm).
Wohl vom Drucker Lacourière bezeichnet „3ème etat“. Bloch 329, Baer 576 IV A (von C).
5.000 €
Eines von lediglich vier Exemplaren des vierten, endgültigen Zustandes, von der noch unverstählten Platte, jedoch noch mit dem Datum im Unterrand der Platte. Vor der Auflage in: Eauxfortes originales pour les textes de Buffon, herausgegeben von Martin Fabiani, Paris 1942. Prachtvoller, kräftiger und nuancenreicher Druck, rechts und unten mit dem Schöpfrand.
pablo picasso
7196 Le Singe
Aquatinta mit Kaltnadel und Roulette auf kräftigem Montval-Velin. 1936.
41,5 x 31,5 cm (44 x 33,3 cm).
Bloch 339, Baer 586 II B a (von C).
1.500 €
Exemplar des zweiten, endgültigen Zustandes, von der bereits verstählten Platte, jedoch noch mit dem Datum im Unterrand der Platte. Außerhalb bzw. vor der Auflage in: Eaux-fortes originales pour les textes de Buffon, herausgegeben von Martin Fabiani, Paris 1942. Baer erwähnt 47 Drucke dieses Zustandes. Prachtvoller, nuancenreicher Druck, rechts und unten mit dem Schöpfrand.
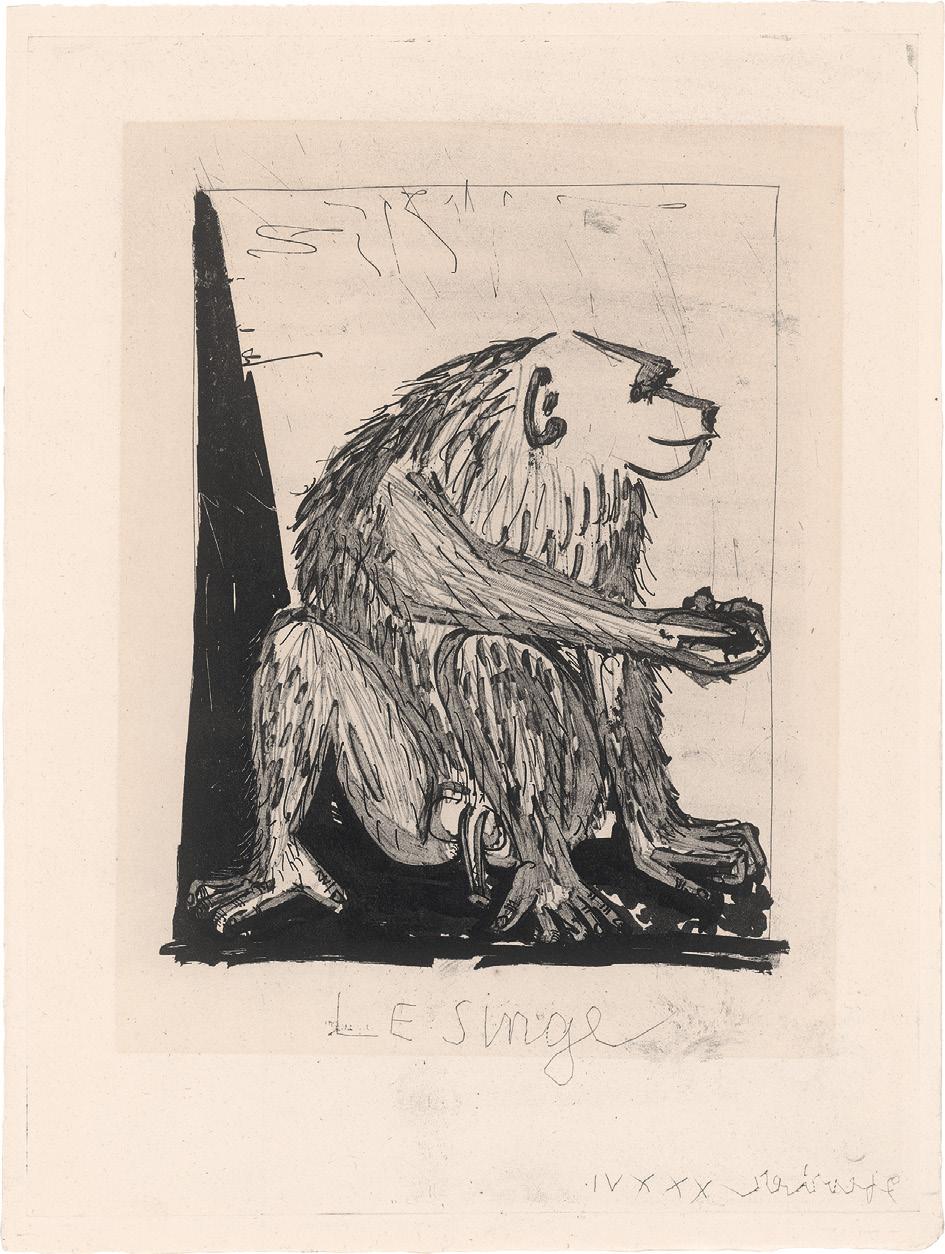
7196
pablo
7197 Nu à la chaise
Farblithographie auf Arches-Velin. 1954.
24 x 16 cm (50 x 38 cm).
Signiert „Picasso“. Auflage 50 num. Ex. Bloch 763, Mourlot 261.
2.000 €
Erschienen in einer Gesamtauflage von 550 Exemplaren. Prachtvoller Druck mit breitem Rand, unten mit dem Schöpfrand.


7198
7198 Composition
Farblithographie auf Arches-Velin. 1957. 60 x 46,5 cm (66,5 x 50,4 cm).
Bloch 838.
3.000 €
Wohl außerhalb der Auflage von 200 signierten und numerierten Abzügen, mit den mitgedruckten Markierungen in den Rändern. Prachtvoller, kräftiger Druck mit breitem Rand, oben und unten mit dem Schöpfrand.

pablo picasso
7199 Jeune couple, vieux couple, spectateur, avec un carrosse au fond
Mezzotinto und Schabeisen mit Kaltnadel auf BFK RivesVelin. 1968.
31,4 x 41,6 cm (45,5 x 56,5 cm).
Signiert „Picasso“. Auflage 50 num. Ex. Bloch 1584, Baer 1600 B b 1 (von C).
3.500 €
Blatt 104 der Folge „347 gravures“. Herausgegeben von der Galerie Louise Leiris, Paris 1969. Gedruckt bei Crommelynck, Paris, in einer Gesamtauflage von 76 Exemplaren in unterschiedlichen Zuständen. Ganz prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, unten mit dem Schöpfrand.
georges braque
(1882 Argenteuil – 1963 Paris)
7200* Théogonie d‘Hésiode (Suite Vollard, Blatt o) Kupferstich auf kräftigem Van Gelder Zonen-Velin. 1930-32. 36,9 x 29,9 cm (53 x 38 cm).
Vallier 20, Blatt o.
1.200 €
Auf Vorschlag von Ambroise Vollard begann Georges Braque Anfang der 1930er Jahre mit zahlreichen Illustrationen zur „Theogonie“ von Hesiod, die er alle mit einer Bordüre umrandete. 1932 wählte man 16 Radierungen aus dieser Gruppe aus, die anschließend bei Galanis in Paris in einer Auflage von 50 Abzügen gedruckt werden sollten. Bis zum Tode von Vollard 1939 war die Auflage allerdings noch nicht fertig ausgedruckt. 1954 verlegte Aimé Maeght die Blätter dann in Buchform, jedoch ohne die frühe Bordüre. Unser Exemplar vermutlich ein unsignierter Frühdruck vor der Auflage und späteren Buchform. Prachtvoller Abzug mit Grat, tief eingeprägter Plattenkante und seidigem Plattenton, mit dem vollen Rand, unten und rechts mit Schöpfrand. Selten


7201
georges braque 7201* Theogonie IV Farblithographie auf Auvergne-Bütten. 1954. Ca. 44 x 27,7 cm (57,2 x 46,3 cm).
Signiert „GBraque“. Auflage 25 num. Ex. 1.200 €
Die dreifarbige Lithographie in Schwarz, Ocker und Weiß, in kleiner Auflage von nur 25 Exemplaren von Mourlot gedruckt und erschienen bei Maeght, Paris. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand, links mit Schöpfrand.

georges braque
7202* Le signe (Das Zeichen)
Lithographie in Grau und Gold auf Arches-Velin. 1954.
30 x 19,5 cm (50 x 38,3 cm).
Signiert „GBraque“. Auflage 30 num. Ex. Vallier 92.
1.200 €
Aus der Auflage von 30 Abzügen auf goldenem Grund neben weiteren 30 Exemplaren auf gelbem und goldenem Grund, 30 auf gelbem Grund und 30 auf ockerfarbenem Grund, sowie weiteren signierten und unsignierten „hors commerce“ und Künstlerabzügen. Gedruckt bei Mourlot und verlegt von Maeght, Paris. Prachtvoller Druck von intensiver Farbigkeit, mit dem vollen Rand.

georges braque
7203* Le char III
Farblithographie, auf festem Arches-Velin. 1955.
32,2 x 42,2 cm (50 x 65 cm).
Verso mit Bleistift bezeichnet „7“. Vallier 98.
2.000 €
Seltener Zustandsdruck vor der gelben Tonplatte und dem Überdrucken mit einer gravierten Kupferplatte, wie Mourlot es erwähnt. Die spätere Auflage von 75 Exemplaren wurde außerdem vom Künstler von Hand überfirnisst. Gedruckt von Mourlot und verlegt von Maeght, Paris. Prachtvoller, kräftig glänzender Abzug mit dem vollen Rand.
7204 La petite tasse
Farblithographie auf Japan. 1962. 13,5 x 16,5 cm (31 x 44,2 cm).
Signiert „G Braque“. Auflage 70 num. Ex. Vallier 173.
1.500 €
Herausgegeben von Adrien Maeght, Paris, Druck Mourlot, Paris. Ganz prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand.
7205 Fenêtre II: Oiseaux gris
Schutzblatt aus: Si je mourais là-bas. Farbholzschnitt auf genarbtem Velin, Wz. „LB“. 1962. 39,3 x 63,5 cm (46,8 x 72,2 cm).
Signiert „G Braque“. Auflage 70 num. Ex. Vallier 181.
1.500 €
Entstanden als Illustration zu Guillaume Apollinaires Werk „Wenn ich dort stürbe“, herausgegeben in einer Gesamtauflage von 180 Exemplaren von Louis Broder, Paris, Druck Féquet et Baudier, Paris. Die doppelblattgroßen Farbholzschnitte dienten als Schutzblätter zu Anfang und Ende des Buches. Prachtvoller Druck mit Rand.



7206
joan miró (1893 Montroig – 1983 Calamajor)
7206 La Bague d‘Aurore Radierung und farbige Kreiden auf Velin. 1957. 14 x 11,3 cm, Plattenrand (37,7 x 28,2 cm).
Signiert „Miró“. Auflage 12 röm. num. Ex. Dupin 122.
7.000 €
Unikat und Radierung verschränken sich, lebendig schwingt sich die Kolorierung um die Kanten der Radierplatte, in deren Mitte Miró einen Stern zeichnet. So spielt er mit dem Konzept von Bild und Rahmen. Das Blatt entstand als Umschlagradierung zu Mirós
Suite für „La Bague d‘Aurore“ des französischen Schriftstellers René Crevel, der zur ersten Riege der Surrealisten um André Breton und Louis Aragon gehörte. Herausgegeben von Louis Broder, Paris 1957. Die Buchausgabe, für die lediglich sechs der 23 Radierungen Verwendung fanden, erschien in einer Gesamtauflage von 130 Exemplaren, daneben zudem insgesamt 99 Exemplare der kompletten Suite der 23 Radierungen, davon die kleine Luxusedition von lediglich zwölf Exemplaren des hier vorliegenden Schwarz-Zustandes, die jeweils von Miró koloriert wurden. Druck Crommelynck & Dutrou, Paris. Prachtvoller Druck mit deutlich zeichnender Plattenkante und lebhafter, raumgreifender Kolorierung.
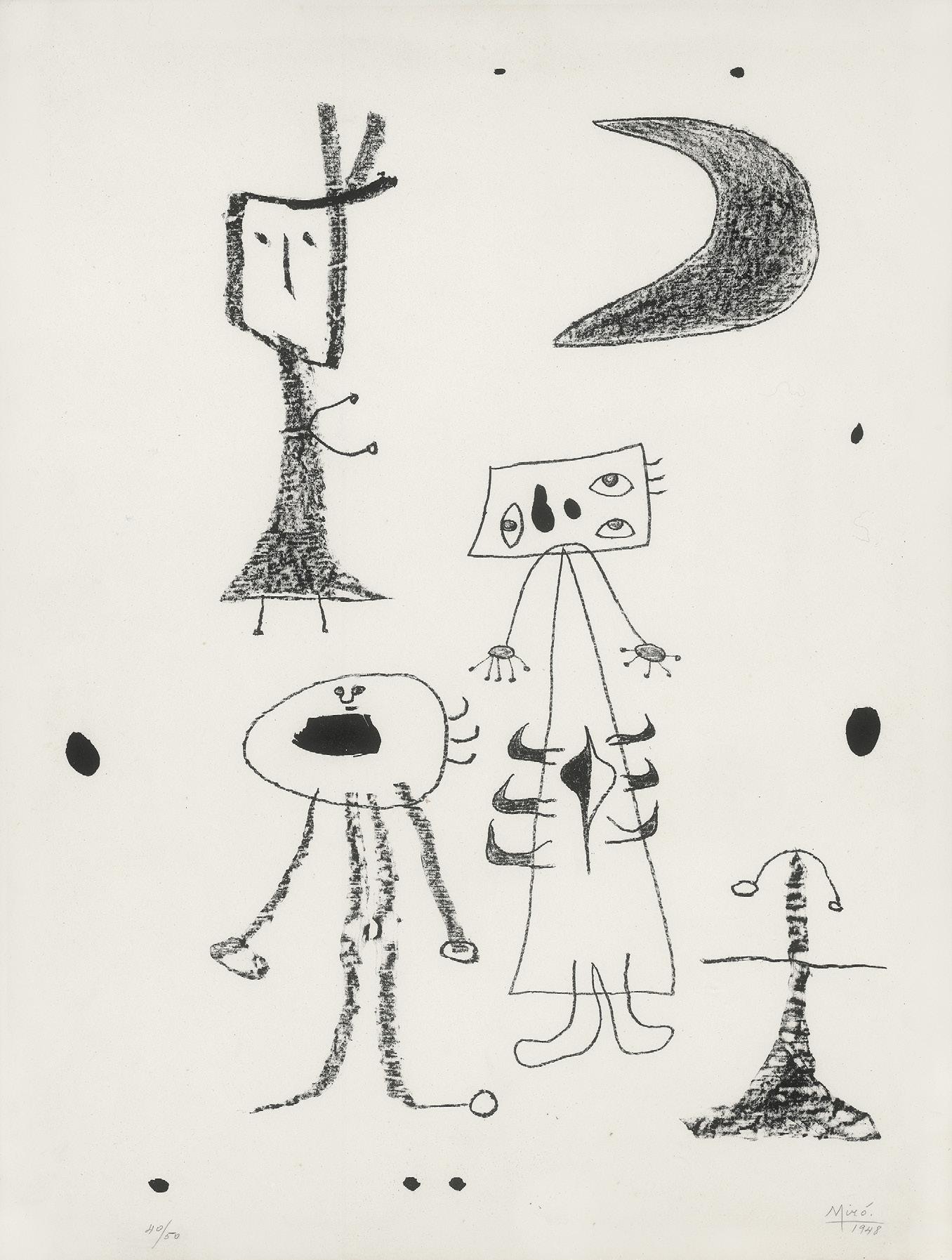
joan miró
7207 Les Femmes
Lithographie auf festem Arches-Velin. 1948. 56,2 x 41 cm (65 x 50 cm).
Signiert „Miró“ und datiert. Auflage 50 num. Ex. Mourlot 60.
1.200 €
Erschienen in einer Gesamtauflage von 55 Exemplaren bei Maeght, Paris. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, oben und unten mit dem Schöpfrand.

joan miró
7208 Personnage dans le soleil
Lithographie auf Marais-Velin. 1948. 22,5 x 30,5 cm (38 x 56,5 cm).
Signiert „Miró“ und datiert. Auflage 50 num. Ex. Mourlot 61.
1.200 €
Neben der kleinen Auflage von 50 Exemplaren nennt Mourlot sechs weitere hors commerce erschienene Drucke. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, links und unten mit dem Schöpfrand.
7209 Jeune fille aux deux oiseaux
Radierung mit Aquatinta auf Velin. 1967/71.
34,6 x 31,4 cm (49,5 x 39 cm).
Signiert „Miró“ und bezeichnet „H.(ors) C.(ommerce)“. Dupin 549.
2.400 €
Miró schuf die Radierung bereits 1967 und steuerte sie zum Album „Gérard Cramer. Trente ans d‘activité“ bei, erschienen bei Cramer in Genf 1971, hier ein Exemplar außerhalb der Auflage von 125 Exemplaren. Druck Adrien Maeght, Paris. Brillanter, äußerst klarer und in der Aquatinta fein differenzierter Druck mit dem wohl vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.


joan miró
7210 Homenatge à Joan Prats
Lithographie auf Velin. 1971.
54,5 x 74,5 cm (64,5 x 84 cm).
Signiert „Miró“. Auflage 75 num. Ex. Maeght 711.
2.500 €
Blatt 4 (von 15) der Serie, die Miró dem katalanischen Unternehmer und Kunstsammler Joan Prats (1891-1970) widmete. Herausgegeben von Polígrafa, Barcelona, in einer Gesamtauflage von 113 Exemplaren. Prachtvoller Druck mit Rand.

joan miró
7211 Homenatge à Joan Prats
Lithographie auf Guarro-Velin. 1971. 55 x 74,5 cm (75 x 100 cm).
Signiert „Miró“. Auflage 25 röm. num. Ex. Maeght 715.
2.500 €
Blatt 6 (von 15) der Serie für Joan Prats. Dieser war eng mit Max Ernst, Paul Klee, Joan Brossa und Joan Miró befreundet, und er war ein leidenschaftlicher Verfechter der katalanischen Kunst. Herausgegeben von Polígrafa, Barcelona, in einer Gesamtauflage von 113 Exemplaren. Prachtvoller Druck mit dem vollen, sehr breiten Rand.

joan miró
7212 L‘Escalier de la Nuit Farbaquatinta und Carborundum auf Chiffon de Mandeure-Velin. 1970.
49,2 x 57,4 cm (61,6 x 81,4 cm).
Signiert „Miró“ und bezeichnet „H.(ors) C.(ommerce)“. Dupin 536.
4.000 €
Druck außerhalb der Auflage von 75 signierten und numerierten Exemplaren. Herausgegeben von Maeght, Paris. Ganz prachtvoller, farbkräftiger Druck mit dem vollen Rand.

joan miró
7213 Aus: Ubu auf den Balearen Farblithographie auf Arches-Velin. 1971. 42 x 58 cm (50,3 x 66 cm).
Signiert „Miró.“. Auflage 120 num. Ex. Maeght 782.
1.200 €
Blatt 17 (von 23) aus dem Album „Ubu auf den Balearen“, das Miró rund um das absurde Theaterstück „König Ubu“ von Alfred Jarry schuf. Gedruckt bei Mourlot, Paris, herausgegeben von Tériade, Paris, 1971. Prachtvoller, farbintensiver Druck mit dem vollen Rand, rechts und links mit dem Schöpfrand.

joan miró
7214 A toute épreuve
Farbholzschnitt auf BFK Rives-Velin. 1958.
37,4 x 33,2 cm (51,8 x 38,4 cm).
Signiert „Miró“ und bezeichnet „H.(ors) C.(ommerce)“.
Dupin 235, Picazo 9.
900 €
Druck außerhalb der Auflage von 125 Exemplaren vor der Schrift; die „H.C.“-Exemplare jedoch bei Dupin und Picazo nicht erwähnt. Der Holzschnitt entstand für das Plakat zur Ausstellung des Buches „A toute épreuve“ in der Galerie Berggruen, Paris. Herausgeber Gérald Cramer, Paris, Druck Lacourière, Paris. Prachtvoller, ausdrucksstarker und klarer Druck mit dem vollen Rand.

serge poliakoff (1906 Moskau – 1969 Paris)
7215 Composition grise, jaune, rouge et bleue Farblithographie auf Velin. 1959.
19 x 17,5 cm (22 x 20 cm).
Signiert „Serge Poliakoff“. Rivière 26.
1.800 €
Eines von den nur wenigen bei Rivière erwähnten signierten Exemplaren außerhalb der Auflage von 200 Drucken, die Verwendung als Glückwunschkarte fanden. Prachtvoller Druck mit dem wohl vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.

willi baumeister (1889–1955, Stuttgart)
7216 Salome IV (Variante): Der Prophet schmäht Herodias
Kreide, Feder in Schwarz und Kohle auf halbtransparentem Velin. 1946. 20 x 30,8 cm.
Baumeister 1372.
2.000 €
Zeichnung zur Lithographie gleichen Titels, ebenfalls 1946 entstanden als Blatt 6 der Mappe „Salome und der Prophet“ (Spielmann/Baumeister 59). Das Spätwerk Baumeisters beherrscht „ein Vokabular von amorph-figürlichen, zeichenhaft überlieferten archaischen Reliefstrukturen, dialogisch, landschaftlich, schwebend, in Bewegung“ (Dietmar J. Ponert, Willi Baumeister, Stuttgart 1988, S. 28). Sowohl die Abstraktion in den typischen weichen, vereinfachten Formen als auch die Verrätselung erkennbarer Bildinhalte zeigt sich in unserer Arbeit. Die kräftigen Konturen der Figuren stehen in einem schönen Gegensatz zu den in Frottagetechnik gestalteten, wabenförmigen Untergrundmustern.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 259, 07.06.1985, Lot 94
Privatbesitz Hessen
7217 Montaru mit Gondel Farbserigraphie auf Leinen. 1954.
56 x 48 cm (59 x 50,5 cm).
Signiert „Baumeister“. Auflage 200 Ex. Spielmann/Baumeister 234.
2.500 €
Nach dem gleichnamigen Gemälde von 1954 (Beye/Baumeister 2002, Nr. 1969). Herausgegeben vom Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, in einer Folge, in der auch auf die gleiche Weise von der Pausa AG, Mössingen bei Tübingen, hergestellte Strukturdrucke von Cavael, Fietz, Geitlinger, Trökes, Winter und Zimmermann erschienen. Prachtvoller, farbkräftiger Strukturdruck auf Leinen.
7218 Aru mit Punkten Farbserigraphie auf Velin. 1955.
34,3 x 50,5 cm (50 x 70 cm).
Signiert „Baumeister“. Auflage 50 num. Ex. Spielmann/Baumeister 215 a (von b).
1.500 €
Nach einem entsprechenden Gemälde mit dem Titel „Aru 4 (Variante)“, 1955 (Beye/Baumeister 2002). Herausgegeben vom Kunstverlag Fingerle, Esslingen. Prachtvoller, farbintensiver Druck mit dem vollen Rand.



7219
karl hofer
(1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)
7219 Frauenkopf II
Lithographie auf Velin. 1950.
34 x 23 cm (50 x 40 cm).
Signiert „KHofer“ und gewidmet „s.(einem) l.(ieben) Kaus“. Auflage 20 Ex. Rathenau 126.
300 €
Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
7220 Kopf (Doppelportrait) Öl auf Leinwand. Um 1951.
38,5 x 30,7
Oben links monogrammiert „CH“ (ligiert).
Wohlert 2390.
20.000 €
Max Kaus und Karl Hofer waren nicht nur Malerkollegen, sondern beide Mitbegründer und Lehrer an der Hochschule für Bildende Künste Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1953 war Kaus unter Hofer stellvertretender Direktor. Durchaus denkbar ist, dass Hofer ebendieses Gemälde als Geschenk für Kaus auswählte, da es sich vermutlich um ein Doppelportrait bzw. eine Doppelspitze der beiden handelt. In expressiver Farbigkeit erfasst, wird die Nähe zwischen den zwei Dargestellten deutlich, die Figuren scheinen regelrecht eins zu werden. Beide Köpfe sind jeweils zur Hälfte zu sehen - einer im Profil leicht gedreht, der andere halb verdeckt frontal dargestellt. Ihre Blicke sind nach innen gerichtet, so als wären sie eine Einheit. Ähnliche Doppelbildnisse des Künstlers aus dem Jahr 1951 finden sich u.a. bei Wohlert unter der Nr. 2402. In einem vermutlich von Max Kaus gestalteten Künstlerrahmen.
Provenienz:
Max Kaus, Berlin (Geschenk Karl Hofers)
Privatsammlung Berlin



max kaus (1891–1977, Berlin)
7221 Zwei Akte
Aquarell über Kreide in Schwarz auf Skizzenblockpapier. 1934.
30 x 22 cm.
Unten mittig mit Pinsel in Braun monogrammiert „MK“ und datiert.
900 €
Seit den frühen 1920er Jahren entstanden im Werkkomplex von Max Kaus immer wieder Folgen von Aktdarstellungen. Es sind wie hier Kompositionen nackter Menschen, die sich scheinbar beiläufig einander zuwenden und begegnen. Sehr harmonische, farblich dezent gehaltene Zeichnung.
7222 „Amrum Fischerboote Wittdün“
Pinsel in Schwarz auf genarbtem Velin. 1956.
48,8 x 60,7 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „MKaus“ (ligiert), datiert und betitelt.
1.000 €
Die dynamische Darstellung zeigt mit kalligraphischer Sicherheit geführte Linien. In ihrem Kontrastreichtum und der Reduktion auf Schwarz und Weiß, ohne Zwischentöne, steht die Zeichnung dem druckgraphischen Werk des Künstlers nahe.

max kaus
7223 „Felsenküste III (Ischia)“ Öl auf Leinwand. 1961.
103 x 123 cm.
Unten links mit Pinsel in Grün signiert „Kaus“ und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt.
Schmitt-Wischmann 447.
3.500 €
Schmitt-Wischmann war damals der Verbleib des Gemäldes noch unbekannt; ihre Maßangaben weichen leicht von den tatsächlichen ab. Seit 1955 führten Reisen den Künstler immer wieder nach Ischia. Tiefe, gesättigte Rottöne und ein dunkles Blaugrün dominieren das großformatige Gemälde, die Formen der Felsenküste werden derart zu amorphen Formen abstrahiert, dass die Landschaft jede Wiedererkennbarkeit verliert und Kaus‘ Darstellung vielmehr den vulkanischen Ursprung der Felsformationen herauszuarbeiten scheint.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
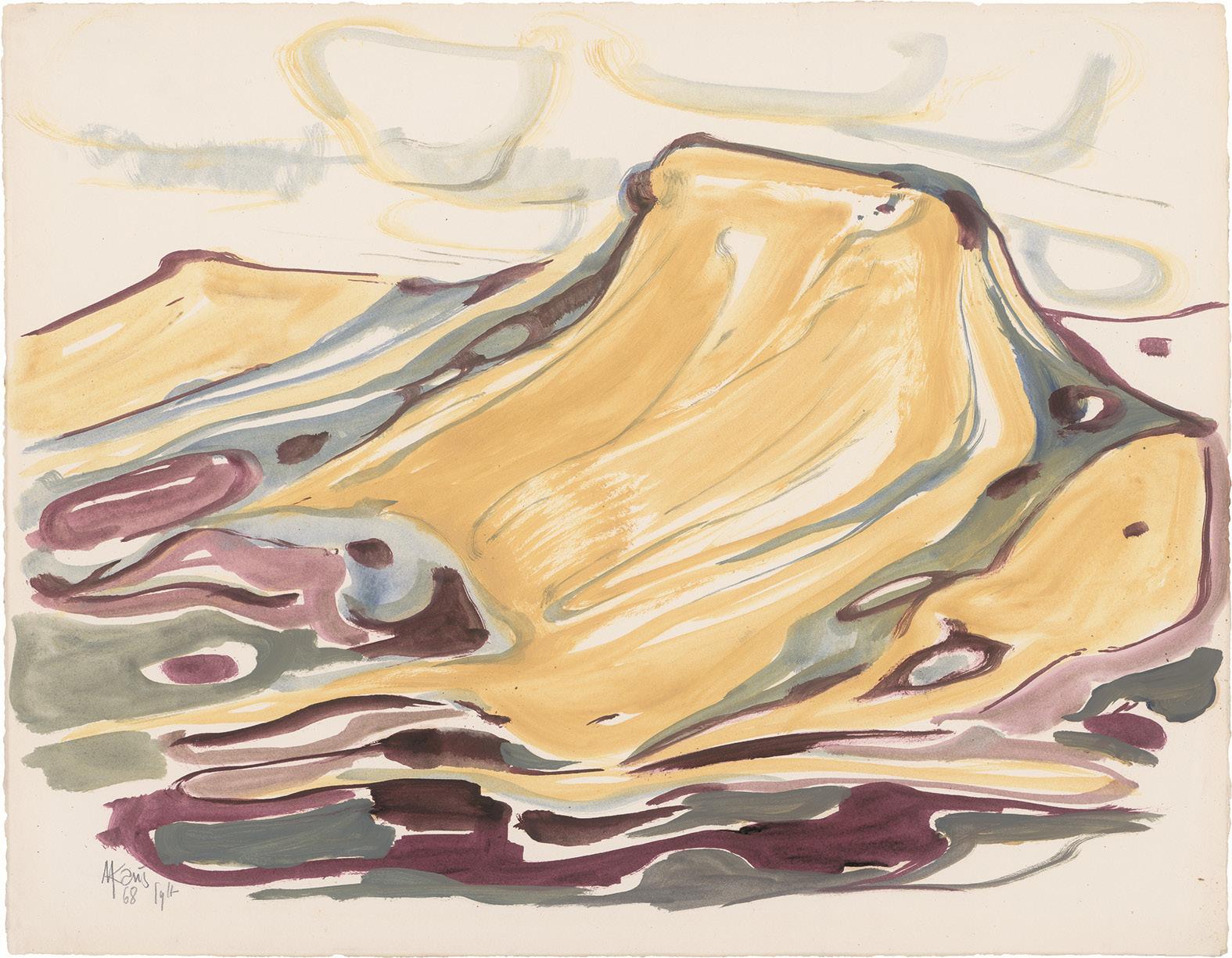
max kaus
7224 „Sylt “
Tempera auf Arches-Velin. 1968.
50,9 x 65,5 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „MKaus“ (ligiert), datiert und betitelt sowie verso mit Kugelschreiber in Schwarz von Sigrid Kaus signiert.
1.000 €
Seit 1961 fuhr das Ehepaar Kaus meist im Frühjahr nach Sylt. Hier entstand die farbige Tempera, die mit dynamischen Schwüngen des Pinsels und großzügigen Farbflächen die Küstenlandschaft wunderbar einfängt.

max kaus
7225 „Sylt “
Gouache auf festem Velin. 1969.
54 x 75,8 cm.
Unten links mit Pinsel in Rot signiert „MKaus“ (ligiert), datiert und betitelt.
1.000 €
Ob es verwitternde Granite im Fichtelgebirge oder eben bewachsene Dünen auf Sylt sind - die schräg gesetzten, quaderförmigen, aus Stein oder Sand bestehenden Elemente beherrschen die Komposition und finden sich in Kaus‘ Landschaftsdarstellungen seit den 1950er Jahren immer wieder. Kaus abstrahiert die Dünen zu organischen Formen und erfasst Himmel, Sand, Vegetation und Erde in gedeckten Beige-, Grün- und Blautönen. Die Farbflächen werden durch Konturen in Rot gegliedert und von strukturbetonenden Linien durchzogen.
ida kerkovius (1879 Riga – 1970 Stuttgart)
7226 Städtebild
Öl auf Leinwand, an zwei Seiten randdoubliert. 1951. 63 x 68 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz mit dem Künstlersignet „IK.“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Klebeetikett der Künstlerin, dort typographisch datiert, betitelt, mit den Maßangaben, der Werknummer „127“ und Fragment des roten Nachlaßstempels, zudem mit Kreide in Rot bezeichnet „129/6 (?)“.
6.000 €
Eine Stadt in turbulenter Bewegung. Farbig konturierte Flächen in intensiv leuchtenden Nuancen sitzen nebeneinander, groß und klein, so dass eine exakte Bestimmung der Motive nur stellenweise möglich ist. Die pastos aufgetragene Farbe verleiht der Komposition eine partiell reliefhafte Wirkung. Expressionismus, Kubismus und Abstraktion finden ihren Niederschlag in Kerkovius‘ malerischem Werk der Nachkriegszeit. „So findet man in Kerkovius’ Werken die verschiedensten Mischungsverhältnisse von beflügelter Phantasie und genauer Beobachtung der erschauten Umwelt. Auf Hölzels Farben- und Kompositionslehre aufbauend, schafft Kerkovius sich einen eigenständigen, freien Raum für ihre Farbphantasien und Formerfindungen.“ (Katharina Hadding, ida-kerkovius. net, Zugiff 29.01.2025).
Provenienz:
Ehemals Kunsthaus Schaller, Stuttgart (mit Fragment eines Klebeetiketts verso auf der Leinwand) Grisebach, Berlin, Auktion 41, 16.11.1994, Lot 272 Privatsammlung Berlin



edmund kesting
(1892 Dresden – 1970 Birkenwerder)
7227 „auftauchende Stämme“ Aquarell und Feder in Schwarz auf P.M. Fabriano-Velin. 1953.
52,5 x 71,5 cm.
Unten rechts mit Feder in Rot signiert „Kesting“, verso mit Feder in Schwarz signiert „EdKesting“, datiert, betitelt und mit Ortsangabe.
1.500 €
Baumstümpfe in schimmernd blauem Wasser, mit feinen Linien umzogen und auf Papier von Kesting festgehalten, eventuell am Boddensee oder Brisee in Birkenwerder, wo Kesting seit 1948 bis zu seinem Tod lebte. Hier inspirierte die Landschaft den Künstler zu zahlreichen Werken.
Provenienz: Nachlass Peter Keler, Weimar
heinz trökes (1913 Hamborn – 1997 Berlin)
7228 Rondo draußen
Aquarell und Farbkreide über Bleistift auf Bütten. 1959.
49 x 62 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Dunkelgrün signiert „Trökes“ und datiert.
900 €
Landschaftliche Elemente in rhythmischer Reihung und graphische Strukturen fügen sich in dem feinsinnig gestaffelten und spannungsreich austarierten Bildraum zu einer abstrakten, zeichenhaft stilisierten Komposition. „Trökes, der Augenmensch, feierte in seinen Bildern, so abstrakt sie teilweise scheinen mögen, doch immer die Schönheit der Wirklichkeit.“ (Markus Krause, Heinz Trökes. Werkverzeichnis, München 2003, S. 16).
Provenienz: Galerie Pels-Leusden, Berlin (dort 1998 erworben)
Privatbesitz Berlin
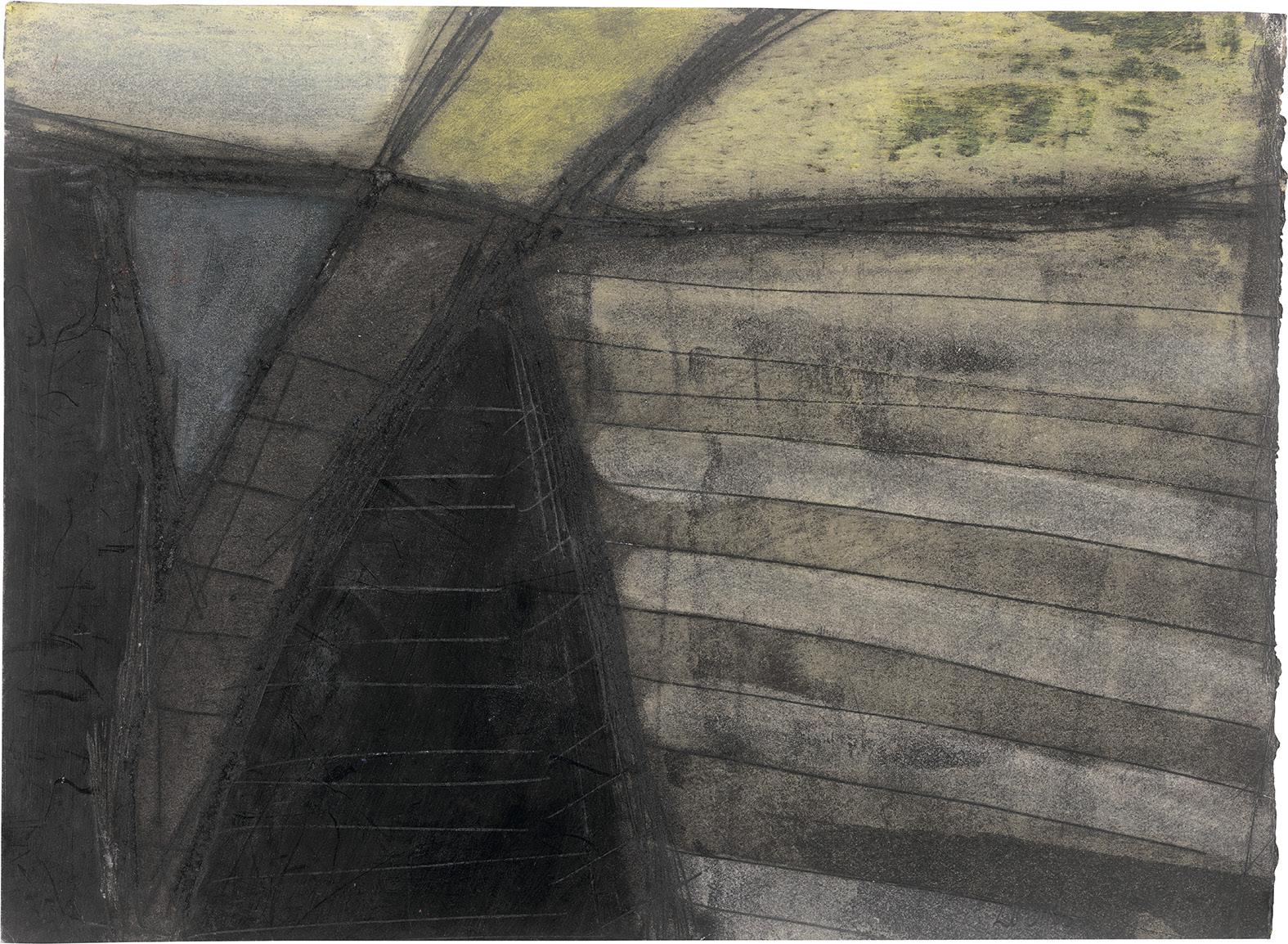
lourdes castro
(d.i. Maria de Lourdes Bettencourt de Castro, 1930–2022, Funchal)
7229 Ohne Titel
Ölkreide und Gouache auf eingeritztem Velin. 1957. 17,7 x 24,3 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „LOURDES“, datiert sowie links bezeichnet „33A“.
2.400 €
Wie viele portugiesische Künstler ihrer Generation floh Lourdes Castro in den 1950er Jahren vor der Salazar-Diktatur nach Paris, wo sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner René Bertholo zwischen 1958 und 1963 das Kunstmagazin KWY herausgab. Kerngruppe um das Magazin waren Christo, der deutsche Maler Jan Voss und die Portugiesen António Costa Pinheiro, José Escada and João Vieira Gonçalo Duarte. Die Gruppe sah sich nicht als Künstlergruppe, stellte aber mehrfach gemeinsam aus. Nachdem Castros Werk anfangs unter dem Einfluss des Fauvismus stand, waren ihre Arbeiten später, neben ihrer lebenslangen Beschäftigung mit Schatten und menschlichen Silhouetten, auch von der lyrischen Abstraktion geprägt.
Provenienz: Nachlass Galerie Otto Stangl, München Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

fritz kuhr
(1899 Lüttich – 1975 Berlin)
7230 Ohne Titel (Huckepack)
Gouache auf Velin. 1953.
53 x 67,5 cm.
Unten rechts mit Kreide in Weiß signiert „Fritz Kuhr“.
2.000 €
Der Einfluss seines Lehrers Paul Klee ist in der experimentellen Arbeit Kuhrs spürbar. Der Künstler nutzt zufällig und intuitiv entstandene Strukturen und konstruiert phantasievolle Formen, die er mit markanten Kontrasten plastisch ausformuliert. „nach fritz kuhr ist kunst ein einmaliger akt, der zu einem einmaligen ergebnis führt. dem künstler bleibt oft verschlossen, wie er zu dieser oder jener lösung gefunden hatte. ein kunstwerk ist nicht reproduzierbar.“ (Hermann Famulla, fritz-kuhr-bauhausler.de/ kuhrkreis, Zugriff 01.04.2025).
Provenienz:
Nachlass Fritz Kuhr, Hermann Famulla, Berlin (dort 2020 erworben) Privatbesitz Berlin

hans arp
(1886 Straßburg – 1966 Basel)
7231 Cœur de fruit
Bleistift auf festem Velin. Um 1960.
32 x 22,8 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „Arp“.
2.000 €
Runde Formen und geschwungene Kurven umschließen das eckige Element in der Mitte. Arps Linien umschreiben immer wieder Uraltes, zeitlos Menschliches, Wandel und Wachstum, ein stetes Werden und Vergehen. Möglicherweise handelt es sich um eine Vorzeichnung für eine um 1960 entstandene Skulptur.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 214, 02.-04.06.1976, Lot 724 Privatbesitz Hessen

hubert berke
(1908 Buer/ Westphalen – 1979 Köln)
7232* „Schwermütig“
Gouache auf braunem Velin. 1954.
49 x 61,5 cm.
Unten mittig rechts mit Feder in Schwarz signiert „Hubert Berke“ und datiert sowie rechts mit Bleistift betitelt, verso nochmals signiert „Berke“, datiert und betitelt.
1.200 €
Hubert Berke, einer der letzten Schüler Paul Klees, schloss sich 1951 der Künstlergruppe ZEN 49 an. Bereits nach dem Krieg entwickelte Berke seine eigene dynamische Abstraktion und wurde hauptsächlich als Maler des lyrischen Informel bekannt. Rund um diese Zeit entstand die vorliegende Komposition, die besonders hervorsticht durch das intensive Strahlen der blauen Fläche, das in seiner Wirkung durch schwarze, stumpf-krümelige Farbakzente unterbrochen wird. In seine Arbeiten dieser Zeit lässt Berke sowohl die geistige Haltung der östlichen Philosophie als auch die rhythmischen und improvisierten Gestaltungsformen der Jazzmusik einfließen.
fred thieler
(1916 Königsberg – 1998 Berlin)
7233 Ohne Titel
Öl und Gouache auf festem strukturierten Velin. 1956.
68,8 x 95,6 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „FThieler“ und datiert, verso signiert „Fred“, datiert und gewidmet.
3.500 €
Diese energiegeladene Komposition aus den 1950er Jahren wirkt förmlich wie eine Explosion der Materie. Durch das experimentierfreudige Auftragen von öl- und wasserlöslicher Farbe mit verschiedenen Viskositäten entstehen physische Reaktionen an der Farboberfläche, die Thieler sich zu Eigen macht. Es ist die Dynamik, das Sichtbarmachen des unsichtbaren Kräfteverhältnisses und die Auseinandersetzung des Künstlers mit Rhythmus und Bewegung als Mittel der kompositorischen Bearbeitung, die diesem Werk einen besonders eindringlichen Ausdruck verleiht.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
Mischtechnik auf festem Velin. 1961.
67 x 95 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „F. Thieler“ und datiert.
3.500 €
Explosiv-abstrakte Komposition in Schwarz und Weiß, gestaltet in einer Kombination von gestischen Farbspuren, aufplatzenden Oberflächen und marmorierend ineinanderlaufenden Farbpartien. Es entsteht eine Zeichnung von vehementer Dynamik. Die Arbeit entstand in einer Phase im Œuvre Fred Thielers, in der er verstärkt mit Farbe und Malwerkzeugen experimentierte. Dieses Interesse an der Farbe als Material brachte er um 1959 von seinen Reisen nach Paris und in die Niederlande mit. Seine gedämpfte Farbwahl orientiert sich an Pierre Soulages und Fritz Winter. Unsere Arbeit entstand in Thielers früher Zeit in Berlin, wo er von 1959 bis 1981 an der Hochschule für Bildende Künste unterrichtete.


ewald mataré

(1887 Aachen – 1965 Büderich)
7235 Liegende Kuh (nach rechts)
Farbholzschnitt auf Bütten. 1958. 13,6 x 16,5 cm (19 x 19 cm).
Signiert „Mataré“ und datiert. Auflage 125 num. Ex. Mataré/de Werd 403, Peters 325.
900 €
Die erste Variante von insgesamt drei dieses Motivs. Prachtvoller, differenzierter Druck in Schwarz und Rot mit Rand.
gunta stölzl
(1897 München – 1983 Männedorf)
7236 Der Blick aus dem Flugzeug. Gobelin
Wolle, gefärbt und gewebt, oben und unten mit Metallstangen vernäht. 1950er Jahre.
68 x 53 cm.
Oben rechts mit dem eingewebten Künstlersignet „GS“.
3.500 €
Kunstvoll und abstrahiert sind hier vorbeiziehende Vögel, Wolken und Landschaftsfragmente gewebt, Eindrücke der Künstlerin von einem Flug nach Tel Aviv. Gunta Stölzl gilt als Erneuerin der Handwebkunst und wurde nach ihrer Ausbildung am Bauhaus in Weimar die erste Meisterin am Bauhaus in Dessau, wo sie von Georg Muche die Webereiwerkstatt übernahm. Nach ihrer Emigration in die Schweiz 1930 betrieb sie in Zürich eine Handweberei und produzierte dort in den 1950er Jahren vor allem Gobelins. Stölzls hoher Anspruch an die Kunst der Weberei äußert sich auch in ihren Schriften: „Stoffe im Raum sind ebenso wesentliche Glieder der großen Einheit Architektur wie Wandfarbe, Möbel, Geräte. (...) Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Erkenntnis und Einfühlung in die geistigen Probleme des Bauens wird uns den konsequenten Weg zeigen.“ (Gunta Stölzl, Die Gebrauchsstoffe der Bauhausweberei, in: bauhaus, Dessau 1931, zit. nach: Hans M. Wingler, Das Bauhaus, Bramsche 1962, S. 178).
Provenienz: Nachlass Jakob Wittwer (Sohn des Dessauer Bauhauslehrers Hans Wittwer)
Privatbesitz Frankfurt/Main


josef albers
(1888 Bottrop – 1976 New Haven)
7237 Strukturale Konstellation
Gravur in schwarz beschichtetem Resopal. Wohl 1953-58. 8,5 x 10,3 cm.
Verso geritzt monogrammiert „A“ und gewidmet „für Renate Wingler“, dort später datiert „1967“.
7.000 €
Irritierend in ihrer Wirkung sind die strukturalen Konstellationen, mit denen sich Josef Albers zwischen 1953 und 1958 beschäftigte. Diese ersten graphischen Entwürfe solcher Konstellationen waren als Gravuren in Resopal geritzt. Die Darstellungen geradliniger geometrischer Flächen erscheinen auf den ersten Blick als Schrägansichten dreidimensionaler verschachtelter Körper. Der zweite Blick offenbart, dass diese Körper so in Wirklichkeit nicht existieren können, es sich also um Vexierbilder handelt. Albers experimentiert mit der Wirkung von Formen, Linien und Flächen aufeinan-
der, mit der Subjektivität der optischen Wahrnehmung. Mit seinen Zeichnungen auf der Grundlage von optischen Täuschungen gehört er neben Victor Vasarely zu den Begründern der Op-Art. The Josef and Anni Albers Foundation bezeichnet die vorliegende Arbeit als „uneditioned multiple‘, d.h. es gibt mehrere Arbeiten mit diesem Motiv, entsprechend dem Werk „Structural Constellation U-8 „von 1955 in unterschiedlichen Größen.
Ausstellung: Bauhaus Sachsen, Grassi Museum für Angewandte Kunst, Leipzig 2019, Kat.-Nr. 016, Abb. S. 47
Literatur: François Bucher, Josef Albers. Trotz der Geraden, Bern 1961, S. 83 (mit Abb.)

josef albers
7238 „GB 1“
Farbserigraphie auf leicht strukturiertem Aquarellkarton. 1969.
35 x 35 cm (54,4 x 54,5 cm).
Mit dem Künstlersignet „A“, datiert und betitelt. Auflage 125 num. Ex. Danilowitz 187.
3.500 €
Um 1950 begann Albers mit seiner Serie „Homage to the Square“ die ihn für den Rest seines Lebens beschäftigte. In unterschiedlichen künstlerischen Medien untersuchte er, wie benachbarte Farben aufeinander wirken und welche Raumillusionen sie in der Nebeneinanderstellung erzeugen können. Gedruckt von Sirocco Screenprints, New Haven, herausgegeben von Ives-Sillman, Inc., New Haven 1970. Brillanter, farbintensiver Druck mit dem vollen Rand.

henryk stazewski (1894–1988, Warschau)
7239* „Nr. 19“
Tinte in Schwarz und Acryl auf Pappe, auf dünne Metallplatte kaschiert und auf Hartfaserplatte montiert. 1977. 22,2 x 22,1 cm.
Verso mit Faserstift in Grün signiert „H. Stazewski“, datiert und betitelt, mit einem roten unleserlichen Stempel und mit Faserstift in Schwarz bezeichnet.
4.000 €
Der Künstler Henryk Stazewski gilt als wichtiger Vertreter der polnischen Avantgarde der 1920er und 1930er Jahre. In dieser Zeit prägte er gemeinsam mit namhaften Kollegen wie Piet Mondian den Konstruktivismus und die geometrische Abstraktion im osteuropäischen Raum und war Mitglied der Gruppen „Cercle et Carré “ und „Abstraction-Création“. Die vorliegende Arbeit spiegelt eindrucksvoll seine künstlerische Entwicklung in den 1970er Jahren wider. In dieser Schaffensperiode legt Stazewski besonderen Wert auf die Rhythmisierung der weißen Fläche, die er durch gezielte Unterbrechungen mit schwarzen Linien dynamisch gestaltet.
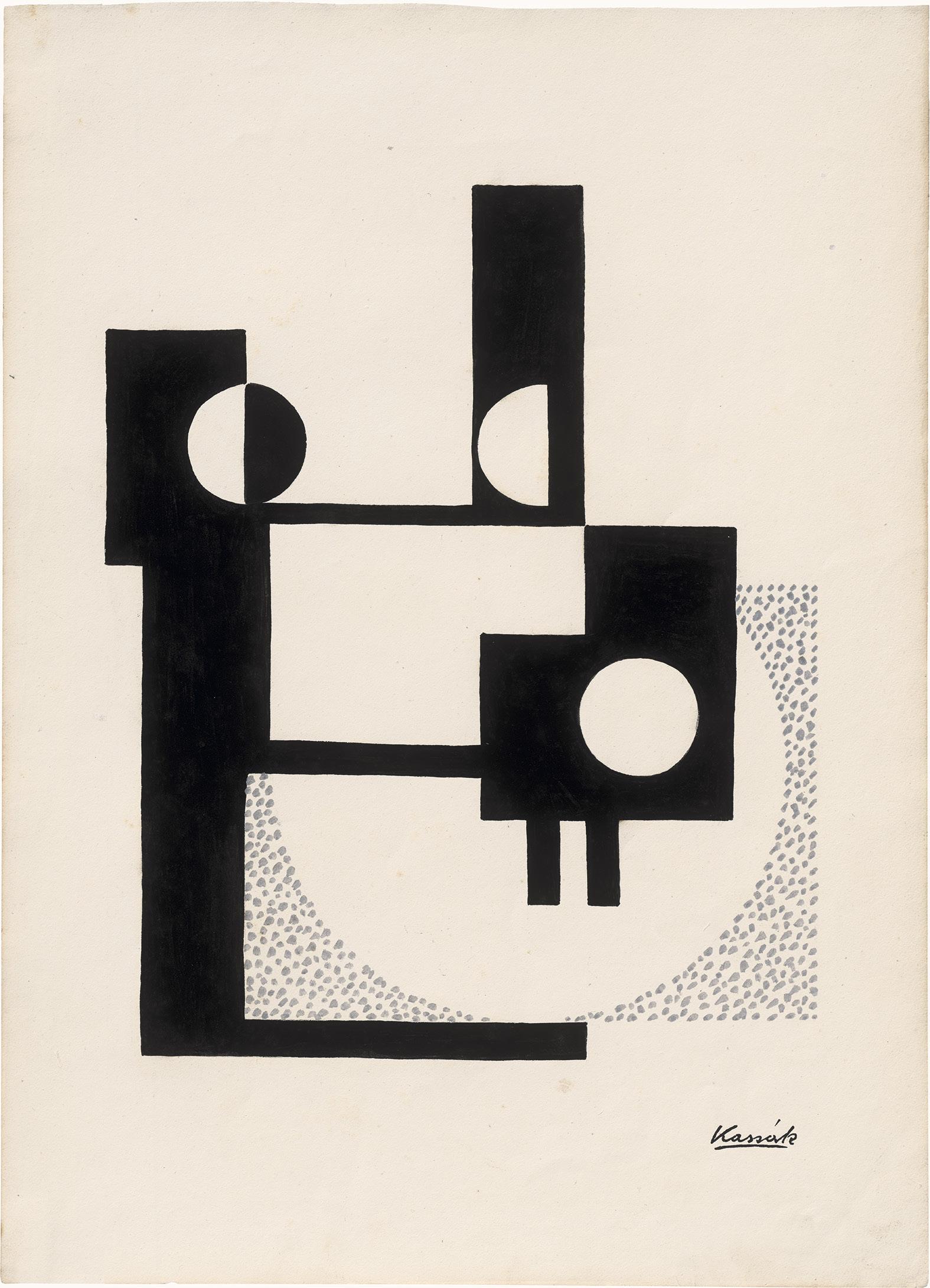
lajos kassák (1887 Érsekújvár – 1967 Budapest)
7240 Konstruktive Komposition
Tempera auf Velin. Wohl 1960er Jahre. 43 x 31,2 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Kassák“.
2.000 €
Lajos Kassák gilt als wichtiger Vertreter der ungarischen Avantgarde. Schon früh entwickelte er eine Leidenschaft für Kunst und Literatur und begann, sich im Alter von 20 Jahren autodidaktisch mit Malerei und Poesie auseinanderzusetzen. Während Kassák zu Beginn stark vom Dadaismus beeinflusst war, wandte er sich nach seiner Bekanntschaft mit dem Bauhaus-Lehrer László MoholyNagy zunehmend dem Konstruktivismus zu. Nachdem seine im
Jahr 1915 zusammen mit Emil Szittya gegründete Avantgardezeitschrift A Tett („Die Tat“), aufgrund ihrer pazifistischen und antimilitaristischen Haltung verboten wurde, gründete Kassák 1916 die ebenfalls avantgardistisch geprägte Zeitschrift Ma („Heute“), die sich mit Kunstströmungen wie dem Dadaismus, Expressionismus, Futurismus, Konstruktivismus und Kubismus auseinandersetzte. In „MA“ formulierte er 1921 das theoretische Programm des ungarischen Konstruktivismus und trug so maßgeblich zur Weiterentwicklung dieser Strömung bei.
Provenienz: Karl&Faber, München, Auktion 149, 29.05.1979, Lot 1552 Privatbesitz Hessen
gustav seitz (1906 Neckarau bei Mannhein – 1969 Hamburg)
7241 Brecht mit Zigarre (Statuette I)
Bronze mit schwarzer Patina auf Bronzeplinthe. 1957/58.
49,5 x 16,5 x 14,5 cm.
Verso hinter dem rechten Bein auf der Plinthe signiert „Seitz“.
Grohn 121.
9.000 €
Der runde Kopf, die etwas schiefe Nase und die eng zusammenstehenden Augen machen die charakteristische Gestalt Bertolt

Brechts auf den ersten Blick erkennbar. Mit leichter Stilisierung und Reduktion der Formen verleiht Seitz der Figur eine fast monumentale Einfachheit. Nachdem er 1949, in der Zeit des Kalten Krieges, den Nationalpreis der DDR entgegengenommen hatte und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin (Ost) wurde, suspendierte man Seitz von seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule für bildende Künste und erteilte ihm mit sofortiger Wirkung Hausverbot. Er zog in den Ostteil der Stadt um, 1958 weiter nach Hamburg. In dieser Zeit der Umbrüche entstand die Figur des stehenden Dichters. „Den Bildhauer verband mit dem Dichter eine lange vertrauensvolle Freundschaft und der gemeinsame Kampf gegen die Gängelung durch die Obrigkeit der DDR, die die Lehrtätigkeit an der Akademie argwöhnisch überwachte. Dennoch begann er die Arbeit an seinem

Porträt erst nach dem Tod Brechts im Jahr 1956. Über 11 Jahre hinweg beschäftigte ihn das Bildnis. Die zahlreichen Zeichnungen, die Statuetten, Masken und Köpfe, die alle aus dem Gedächtnis entstanden, sind Zeugnis seines intensiven geistigen Dialogs mit dem Dichter und dem privaten Brecht (...) Die Statuetten von 1957/8 scheinen die Wiedergabe eines alltäglichen Erlebnisses einer Theaterprobe zu sein, die Brecht leitete und der Seitz häufig zusah. Die starke Reduzierung aber aller narrativen Details zeigt, dass Seitz hier keinen vorübergehenden Moment festhalten wollte, sondern das Typische, das Gültige in der Haltung des verehrten Freundes.“ (Brigitte Heise, in: Gustav Seitz. 50 Köpfe, Hamburg 2013, S. 18). Grohn sind elf Güsse bekannt. Prachtvoller Guss mit homogener Patina.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
curt querner (1904 Börnchen bei Possendorf – 1976 Kreischa) 7242 „Im Hemd (Sommer-Abend)“ Aquarell auf dickem genarbten Velin. 1960. 58 x 44 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „Qu“ und datiert, verso mit Bleistift signiert „Querner“, datiert, betitelt und bezeichnet „Aquarell“ und „bleibt!“.
1.200 €
In der für Querner typischen Nass-in-Nass-Technik und mit markanten Umrisslinien erfasst der Künstler die sitzende Frau mit erhobenen Armen, nur mit Hemd bekleidet.

wilhelm schnarrenberger (1892 Buchen – 1966 Karlsruhe)
7243 Lilien Öl auf Leinwand. 1955.
85,4 x 36,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Grau signiert „Schnarrenberger“ und datiert, mittig rechts nochmals mit Pinsel in Hellgrau signiert, darunterliegend monogrammiert und datiert „Sch 55“.
Nedo 479 (ohne Abb).
2.500 €
Wilhelm Schnarrenberger begann seine künstlerische Laufbahn mit einem Studium der Graphik an der Kunstgewerbeschule in München, in Folge dessen er vor allem als Gebrauchsgraphiker arbeitete. Zeitgleich fing er an zu malen. Zunächst vom Expressionismus beeinflusst, wurden seine Werke zunehmend klarer, so dass 1925 sechs seiner Bilder in der wegweisenden Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ in Mannheim gezeigt wurden. Eher verhalten wirkt dagegen unser Stilleben aus den frühen Nachkriegsjahren. Schnarrenberger hatte sich gerade in Karlsruhe niedergelassen, wo er an die Akademie berufen wurde. In dezenten Farben passt er seine ausgewogene Komposition in ein schmales Hochformat: bildprägend der kranzförmige Strauß aus pastelligen Blütenkelchen der hochgewachsenen Lilie und den verwelkten, sich leicht nach vorne neigenden Schnittblumen. Beides in einer viel zu kleinen Vase und kontrastreich durchsetzt von Zweigen mit dunkelroten Blättern. Davor gruppiert der Künstler ausschnitthaft ein paar wenige Alltagsgegenstände auf dem Tisch, die das Arrangement nach vorne hin kunstvoll abrunden.
Provenienz:
Privatbesitz Mannheim (Geschenk des Künstlers)
Privatbesitz Berlin (durch Erbschaft)
Ausstellung:
Wilhelm Schnarrenberger. Ölbilder - Aquarelle - Graphik, Städtische Galerie, München 1956, Kat.-Nr. 44

otto niemeyer-holstein (1896 Kitzeberg/Kiel – 1984 Koserow/Usedom)
7244 Zakopane Öl auf Malpappe. 1957.
49,5 x 66 cm.
Verso auf dem Karton mit Faserstift in Blau (von fremder Hand?) bezeichnet „WV 0584“.
3.500 €
Hell, in zarten Farben schimmert die Winterlandschaft. Mit einem strichelnden Pinselduktus und stellenweise trockenem Farbauftrag gestaltet der Künstler das Motiv, er findet zarteste Nuancen, um die Stimmung, das Dämmerlicht, das Atmosphärische in seiner Landschaft zum Ausdruck zu bringen. „Das Motiv ist in der Sprache der Farben vergeistigt. Obgleich die Naturbeobachtung sicht-
bar bleibt, verliert das Objekt seine gegenständliche Direktheit zugunsten einer Aussage, in der eine feingeistige Interpretation dominiert.“ (Lothar Lang, in: Malerei und Grafik in Ostdeutschland, Leipzig 2002, zit. nach atelier-otto-niemeyer-holstein.de, Zugriff 26.03.2025). Mehrfach hielt sich der Künstler in Zakopane auf, auch aus den Jahren 1961-65 sind einige dort entstandene Arbeiten im Werkverzeichnis registriert. Das Werk ist unter der Nummer 0584 im Werkverzeichnis Otto Niemeyer-Holstein registriert. Wir danken dem Atelier Otto Niemeyer-Holstein, Koserow, für freundliche Hinweise vom 19.03.2025.
Provenienz: Staatlicher Kunsthandel der DDR Privatbesitz Brandenburg
franz radziwill
(1895 Strohausen – 1983 Wilhelmshaven)
7245 Allein vorn Öl auf Leinwand, auf Holz kaschiert. 1969. 49 x 61 cm.
Unten links mit Pinsel in Beige signiert „Franz Radziwill“, verso mit Pinsel in Grün mit der Werknummer „611“. Firmenich/Schulze 815.
24.000 €
Wie ein Zuschauer am Rand der Rennstrecke blickt man auf den Radsportler: Grell ausgeleuchtet von einem kalten, surreal wirkenden Sonnenschein wird der Rennradler auf der Landstraße gleich vorbeizischen, geradewegs nach vorne, verfolgt von einem tieffliegenden Hubschrauber. Der spitze Winkel der scharf angeschnittenen Straße zieht mit seinen weiß leuchtenden Markierungen den Blick des Betrachters schnell ins Bild hinein und könnte ihn mit derselben Dynamik zügig wieder entlassen, doch der bühnenhaft inszenierte, trotz der Landschaftsszenerie geschlossene Bildaufbau mit der niedrigen Horizontlinie hält den Blick in der fein austarierten Komposition fest. Den phantastischen Charakter der Szenerie unterstreichen die überspitzt geformten Landschaftsele-
mente. In differenzierter Palette und mit pastosem Farbauftrag gestaltet Radziwill die dynamische Szene. Bekannt wurde der Künstler mit seinen sachlichen Industrielandschaften und Endzeitszenarien des Magischen Realismus, einer Form der Neuen Sachlichkeit mit surrealistischen Anklängen, inspiriert durch Giorgio de Chirico und die Pittura Metafisica.
Provenienz: Ehemals R. Buchrucker, München (so verso auf Fragment eines Ausstellungsetiketts) Schloß Ahlden, Auktion 80/81, 1993, Abb. 124 Privatsammlung Berlin
Ausstellung: Franz Radziwill. Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Kunsthalle Bremen 1970, Nr. 66
Franz Radziwill, Kunstverein Hannover 1971, Nr. 66
Franz Radziwill, Staatliche Kunsthalle NGBK, Berlin 1981, Nr. 180 Inszenierte Bildräume, Franz Radziwill Haus, Dangast 2020, Kat.Nr. 23 (Abb. S. 84)


italo valenti
(1912 Mailand – 1995 Ascona)
7246 Ohne Titel
Tonpapier, gerissen und collagiert, auf festem Velin.
7,2 x 15,8 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „VALENTI“, verso gewidmet, dort nochmals signiert.
1.500 €
Freie Komposition von schwebender Leichtigkeit. In den 1950er Jahren hatte Valenti, in der Schweiz lebend, intensiven Kontakt zu Hans Arp, Ben Nicholson, Remo Rossi und Jules Bissier. In dieser Zeit, befreit von der gegenständlichen Kunst, wandte sich der Künstler dem Informel und der Abstraktion zu, was ihn zu einer Phase der „informellen lyrischen Abstraktion“ führte. Er widmete sich immer mehr der Erforschung von Farben und räumlichen Effekten und besonders der Collage.
Provenienz:
Privatbesitz Bayern Bassenge, Berlin, Auktion 78, 01.12.2001, Lot 6461
Privatbesitz Hessen

7247
jules bissier
(1893 Freiburg i. Br. – 1965 Ascona/Tessin)
7247 „11. Dez. 60“ Aquarell auf Bütten. 1960. 17 x 24 cm.
Unten links mit Pinsel in Braun signiert „Jules Bissier“ und datiert.
9.000 €
Meisterhaft abstrahierte Komposition mit horizontal gestaffelten Gefäßformen. Die auf das Wesentliche vereinfachten, aneinandergereihten Gegenstände zeigen sich charakteristisch für Bissiers Werk voll symbolhafter, vielfach ungegenständlicher und oft kryptischer Zeichen, die häufig an die Kalligraphie fernöstlicher Tusch-
malerei erinnern. Spürbar wird der lyrische, meditative Charakter seines Schaffens, das insbesondere in den berühmten Miniaturen von äußerster Konzentration geprägt ist. Die vorliegende Arbeit ist im Archivio Bissier, Ascona, registriert.
Provenienz: Lefebre Gallery, New York (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)
Christie‘s, Beverly Hills CA, Auktion 05.12.2001, Lot 1 Germann, Zürich, Auktion 25.11.2002, Lot 46 Kaupp, Sulzburg, Auktion 10.-12.05.2007, Lot 2136
Privatbesitz Hessen

hap grieshaber
(1909 Roth b. Leutkirch – 1981 Achalm)
7248 Prinz und Prinzessin
Farbige Kreiden auf Japan. Um 1960/61.
52,2 x 38,6 cm.
1.200 €
Entwurf für Grieshabers Holzschnitt in dem 1961 bei der Edition Rothe, Heidelberg, erschienenen Mappenwerk „Der Feuervogel“ (Fürst 61/12). Die stilisierten Figuren gestaltet Grieshaber mit vehementem Strich deutlich abstrakter und zugleich lebendiger als den Holzschnitt. Verso Fragment einer weiteren Entwurfszeichnung.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 369, 07.12.2002, Lot 679
Privatbesitz Hessen
hap grieshaber
7249 Zarewitsch
Farbige Kreiden auf Japan. Um 1960/61.
52,2 x 38,7 cm.
1.200 €
Als Gestalt von archaischer Anmutung in kraftvoller Tanzbewegung zeichnet Grieshaber den Zarewitsch, eine der Hauptfiguren in Strawinskys Ballett „Der Feuervogel“. Der Entwurf für Grieshabers Farbholzschnitt in dem 1961 bei der Edition Rothe, Heidelberg, erschienenen Mappenwerk „Der Feuervogel“ (Fürst 61/8) verzichtet auf die dekorativen Elemente des Holzschnitts.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 369, 07.12.2002, Lot 676
Privatbesitz Hessen


7250
rolf hans
(1938 Frankfurt a.M. – 1996 Basel)
7250 „Der Morgen“ 2 Kompositionen, recto/verso. Acryl auf Leinwand. 1966. 100 x 80 cm.
Verso unten links sowie auf dem Keilrahmen zweifach mit Pinsel in Schwarz signiert „R. Hans“, datiert und betitelt. 1.500 €
Rolf Hans, Jazzmusiker, Maler, Fotograf, Objekt- und Collagekünstler, schuf in den Jahren 1966 und 1967 seine abstrakten Streifenbilder. „Gleich der Musik reiht Hans in ihnen ausnahmslos vertikal oder horizontal ausgerichtete Linien, Streifen und Balken aneinander. Deren jeweiliger Farbton ergibt den Klang, die Ausbreitung das Tempo und die Abfolge den Rhythmus. Dabei werden die
Farbfelder unterschiedlich behandelt: Sie können fest umrissen sein oder an ihren Rändern ausufern; sie können hart aneinander stoßen oder sich kaum berühren; sie können sich überlappen oder überlagern. Aus diesem Zusammenspiel entspringt die bildimmanente Energie. Um diese zu erschließen, müssen wir genauer hinschauen. Erst dann werden wir die Korrelation von Bewegung und Gegenbewegung sowie die Spannungsverhältnisse zwischen Farben und Formen erkennen. Die Gesamtkomposition visualisiert schließlich den Akkord, mittels dessen Hans uns seine inneren Reflexionen kundtut.“ (rolf-hans.de, Zugriff 24.03.2025). Verso eines der „Fleckenbilder“ des Künstlers, deren Mehrzahl vor 1965 entstanden.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
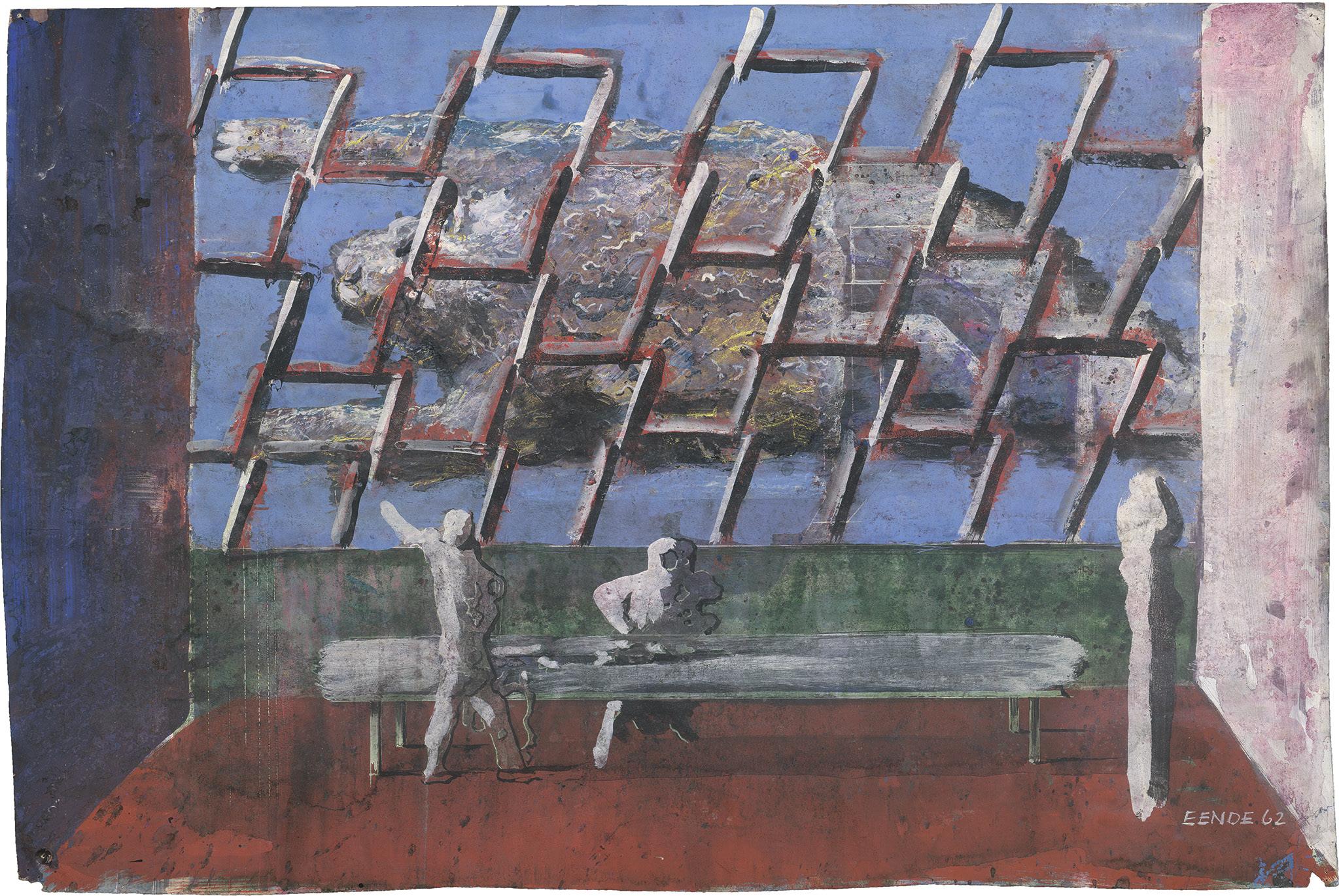

edgar ende (1901 Hamburg – 1965 München)
7251 Das große Gitter Gouache auf Aquarellpapier. 1962.
49,5 x 73,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „EENDE“ und datiert, verso (von fremder Hand / Lotte Schlegel?) mit Kugelschreiber in Schwarz betitelt und bezeichnet „Schlegel 33“ sowie mit Bleistift zweifach „4180“.
2.000 €
Logik und Naturgesetze scheinen aufgehoben in dieser dicht komponierten, phantastischen Komposition. Vielfach erscheinen Endes Arbeiten als Ergebnisse innerer Visionen. „Sein Werk ist deshalb der Tradition der so genannten visionären Kunst zuzuordnen und weist Entsprechungen zum Magischen Realismus und zur Neuen Sachlichkeit auf, auch wenn sein Werk diesen Richtungen, wie im übrigen dem Surrealismus, nicht zuzuordnen ist. (...) Für Edgar Ende waren seine Bilder ‚prälogisch‘, wie er es selbst nannte. Sie stammten für ihn aus einer Schicht des Bewußtseins, das vor dem Gedanken existiert: Edgar Endes Malerei stellt keine Auseinandersetzung mit der realen Welt und ihren kulturellen, sozialen oder historisch bedingten Strukturen dar, sondern ein Eindringen in den Kosmos geistiger Welten.“ (edgarende.de, Zugriff 03.03.2025).
Ausstellung:
Edgar Ende. Melancholie und Verheißung, Haus Opherdicke, Unna 2018, Kat.-Nr. 184

georges spiro
(1909 Warschau – 1994 Nizza)
7252 Le miroir bleu Öl auf Leinwand. Um 1968.
61 x 50 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „Spiro“, verso auf dem Keilrahmen mit Faserstift in Rot betitelt und mit den Maßangaben sowie (von fremder Hand) in Schwarz bezeichnet „8996“.
1.200 €
In leuchtender Farbigkeit gestaltete phantastische Komposition. Der an der Wiener Kunstgewerbeschule ausgebildete Künstler war zunächst Journalist, Autor und Spielzeughersteller, widmete sich jedoch nach seiner Flucht aus dem besetzten Österreich nach Frankreich zunehmend der Malerei. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte Spiro auf seiner ersten, äußerst erfolgreichen Ausstellung in der L’Arcade Gallery, London, fast alle Werke und lebte nun ausschließlich von seiner Malerei.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
7253 La femme renversée Öl auf Leinwand. Um 1968.
81 x 100 cm.
Unten links mit Pinsel in Weiß signiert „Spiro“, verso auf dem Spannrahmen mit Kugelschreiber und Faserstift in Schwarz zweifach betitelt und zweifach bezeichnet „No. 46“.
3.000 €
In einer schier endlos weiten Ebene voll surrealistischer Elemente steht zentral die titelgebende phantastische Frauengestalt, deren unvollständiger Körper einem irritierenden Wechselspiel von Vorder- und Rückenansicht unterworfen ist. Mit subtilen Farbabstufungen und akribischer Feinheit umgesetzt, entfaltet die Szenerie einen für Spiro charakteristischen skurrilen Reiz. Georges Spiro verband eine langjährige Freundschaft mit Jean Cocteau.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

arthur köpcke (1928 Hamburg – 1977 Kopenhagen)
7254 „Efeu in die Augen“ Acryl auf Pappe. 1960.
101 x 71 cm.
Verso mit Farbstift in Blau signiert „AKöpcke“, datiert und betitelt.
2.800 €
Addi Köpcke, autodidaktisch ausgebildet, stand in engem Austausch mit der internationalen Fluxus-Bewegung und den Nouveaux Réalistes. Er war besonders tätig im Bereich Malerei und Literatur und wurde bekannt mit seinem Manuskript der 128 „Reading-Work-Pieces“, einem Konvolut von Zeichnungen, Schriften und Collagen aus den Jahren 1963 und 1965. Unsere Arbeit entstand kurz nach Köpckes Umzug 1957 nach Kopenhagen, wo er von 1957 bis 1963 eine eigene Galerie leitete.
karl godeg

(d.i. Karl Goldberg, 1896 Reichenbach – 1982 Berlin)
7255 Goldwolke
Öl, Lack sowie Gold- und Silberpigmente auf Leinwand. 1964.
130 x 94 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Gold signiert „Godeg“ und datiert, verso mit Kreide in Schwarz numeriert „19/10“ und mit Maßangaben.
1.500 €
Karl Godeg studierte Bildhauerei in Dresden und später in Berlin bei César Klein, um sich dann ausschließlich der Malerei zuzuwenden. Vor allem durch seine Goldbilder, die sich mit ihren unbestimmten Formen, zentriert von der Mitte der Leinwand aus ergeben, erlangte er größere Bekanntheit. In Paris fanden diese Arbeiten bereits in den 1960er Jahren großen Anklang; so waren sie 2012 in der Galerie Margaron in Paris ausgestellt.

heimrad prem (1934 Roding, Oberpfalz – 1978 München)
7256* Ohne Titel
Gouache bzw. Öl auf Velin. 1965.
44,5 x 68,2 cm.
Unten mittig mit Bleistift signiert „H. Prem“ und datiert.
2.000 €
Leuchtend farbige, stark abstrahierte Komposition, entstanden wohl während Prems Zeit in Schweden. Nach einem Malereistudium an der Münchener Akademie der bildenden Künste und einem Studium der Bildhauerei an der Berliner Hochschule für bildende Künste bei Ernst Schumacher gründete Heimrad Prem 1958 mit H.P. Zimmer, Lothar Fischer und Helmut Sturm die avantgardistische Gruppe „Spur“, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die durch ihre anarchistischen Proklamationen gegen Staat und Gesellschaft rebellierte. Im Jahr 1965/66 lebte Heimrad Prem in Südschweden. Hier zeigten seine Arbeiten zunehmend Einflüsse der Pop Art, und nach seiner Rückkehr verband Prem nur noch wenig mit der ehemaligen Gruppe „Spur“. Verso Fragment einer weiteren Kompositionsskizze.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

heimrad prem
7257 „Die Sekretärin“ Tempera, Lackfarben und Collage auf Nessel. Im Künstlerrahmen. 1966.
55 x 75 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Blau signiert „H Prem“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz betitelt.
4.000 €
Leuchtende Lack- und Temperafarben treten in einen effektvollen Gegensatz zur groben, stumpfen Struktur des Nesselgewebes.
Immer wieder vereint Prem mit der Wahl seiner Materialien solche Gegensätze und beschreibt seine Technik: „Ich werde mit einem System vorgehen, das sehr der Collage entspricht. Nur daß ich mit den verschiedenen Stofflichkeiten der Farbe arbeite und nicht mit verschiedenen anderen Materialien, wie das bei der Collage gemacht wird. Verschiedene Stofflichkeiten der Farbe sind Lackfarben – im Gegensatz zu Temperafarben.“ (Heimrad Prem, Tagebucheintrag 29.05.1963, zit. nach fresko-magazin.de, Zugriff 25.03.2024) Das vorliegende Gemälde entstand während Prems Zeit in Südschweden, als er zunehmend unter dem Einfluss der Pop Art stand.
Provenienz: Privatsammlung Schweden

johannes grützke
(1937–2017, Berlin)
7258 Mönche
Pastell auf grünlichem Bütten. 1967.
49 x 62 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Johannes Grützke“ und datiert.
1.200 €
Der virtuose Zeichner Grützke setzt die Mönche voller Ironie in Szene: Ein Turm aus bunten Bauklötzen stürzt zusammen, die Dramatik der Gesten bei den Klerikern ist groß. „Grützkes weitgehend dialektischer Umgang mit Gegensätzen, die Steigerung und Bestätigung der einzelnen Elemente in ihrem Widerspruch löst sich letztlich erst im Betrachter zur sinnvollen Einheit.“ (Ekkehard Schenk zu Schweinsberg, in: Johannes Grützke, Werkverzeichnis der Gemälde, Frankfurt/Main 1977, S. 13).
Provenienz: Privatsammlung Berlin
werner tübke
(1929 Schönebeck a. d. Elbe – 2004 Leipzig)
7259 Ohne Titel (Studie)
Bleistift auf Velin. 1961.
23,2 x 12,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Tübke“ und datiert. Tübke-Schellenberger Z 19/61.
2.200 €
In altmeisterlicher Akkuratesse zeichnet Tübke die Studie, dazu im Bild handschriftlich notierte Farbangaben. Immer wieder vermischt der Künstler Epochen: „Tübke kann in Einzelfiguren oder Gruppen von stabilen, fast akademischen Renaissanceformen ausgehen, die sich unter der Hand in ein morbides oder sprühendes Rokoko mit zerbröselnden, verwehenden Formen verwandeln. Sein analytisches Zeichnen verfolgt die Gegenwart in die Vergangenheit, entrückt Zeitgenössisches in historische Ferne (...).“ (Eduard Beaucamp, in: Ausst.-Kat. Kunsthandlung Fichter, Frankfurt/Main 2004, S. 10).
Provenienz: Privatsammlung Nordrhein-Westfalen Privatsammlung Berlin (seit 1993)


matthias koeppel (1937 Hamburg, lebt in Berlin)
7260 Schöne Musik Öl auf Leinwand. 1968. 170 x 209 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Blauweiß signiert „M KOEPPEL“ und datiert.
2.400 €
Wie eine surreale Bühnenszene voller ironisch-satirischer Anspielungen erscheint das großformatige Gemälde: In leuchtendem Weiß hebt sich die stehende fratzenhafte Männerfigur vor dem verschieden gemusterten Grund der 1960er-Jahre-Inneneinrichtung ab, am Boden ein skurriles schlafendes Paar - eine entkleidete Dame und bekleideter Herr. Das bildmittig liegende alte Tonbandgerät steht ironisch für den gewählten Bildtitel.
Koeppel wurde 1960 Meisterschüler an der HfbK Berlin und gleichzeitig mit dem Preis der Großen Berliner Kunstausstellung ausgezeichnet. Er betätigte sich in dieser Zeit auch als Bühnenmaler für Oper und Fernsehen. Mit Grützke, Bluth und Ziegler gründete er 1973 die Künstlergruppe „Schule der neuen Prächtigkeit“, die sich gegen die abstrakte Malerei wandte und für einen neuen, von Ironie und Satire geprägten Realismus stand.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
Ausstellung: Große Berliner Kunstausstellung, Ausstellungshallen am Funkturm (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett, o.J.)

renato guttuso (1912 Bagheria – 1987 Rom)
7261 Ohne Titel (Aktstudie)
Gouache, Tuschfeder und -pinsel auf Schoellers-ParoleVelin. 1966.
50,5 x 73 cm.
Unten mittig mit Bleistift signiert „Guttuso“ und datiert. Nicht bei Crispolti.
2.600 €
Vitale Farbkontraste von Rot, Schwarz und Weiß unterstreichen die Üppigkeit der weiblichen Körperformen und verleihen der Komposition einen dramatischen Reiz. Im Mailand der 1930er Jahre schloss Guttuso Bekanntschaft mit Emilio Vedova, Aligi Sassu, Renato Birolli und Giacomo Manzù, bereits 1938 fand in Rom seine erste Einzelausstellung statt. Der politisch aktive Künstler war ab 1943 aktiv im antifaschistischen Widerstand engagiert und zählte 1947 zu den Mitbegründern der Künstlerbewegung „Fronte nuevo delle Arti“. Er nahm mehrfach an der Biennale in Venedig teil. 1966, im Entstehungsjahr der Zeichnung, trat Guttuso eine Professur an der Accademia di Belle Arti di Roma an.
Provenienz: Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin
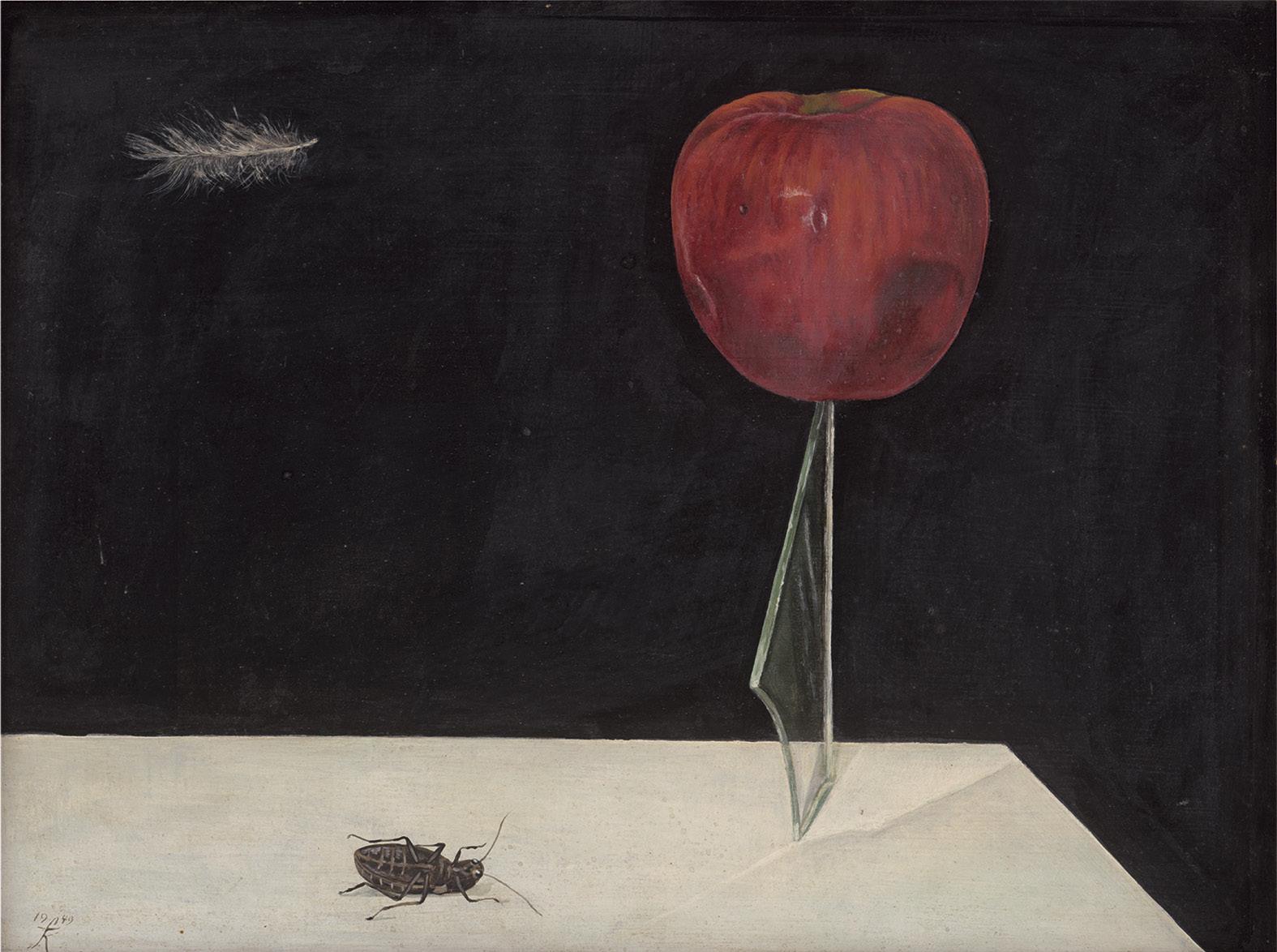
fritz köthe (1916–2005, Berlin)
7262 Apfel und Glasscherbe Tempera und Öl auf Hartfaser. 1949. 30,3 x 40 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „K“ und datiert.
1.500 €
Frühes Gemälde des Künstlers, in der Motivwahl inspiriert vom Surrealismus. Die Bildgegenstände erfasst er in fotorealistischer Manier mit sorgsamem Pinselstrich und pastosem Farbauftrag. Lebendige Farbkontraste und eine spannungsreiche Verteilung von Hell und Dunkel zeichnen die Komposition aus. Fritz Köthe, der seine Ausbildung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und der Graphischen Fachschule Berlin erhielt, war in den 1950er Jahren in Berlin für mehrere Jahre als Graphiker für Verlage und Werbeagenturen tätig.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Deutscher Künstlerbund, 15. Ausstellung, Karlsruhe 1967 (mit deren Klebeetikett verso, dort typographisch und handschriftlich bezeichnet)
Literatur:
Heinz Ohff, Fritz Köthe. Monographie und Werkverzeichnis, Berlin 1976, S. 227 (Tafel 11 mit Abb.)
hans-jürgen diehl
(1940 Hanau, lebt in Berlin und New York)
7263 Revolutionärin Öl auf Leinwand. 1969. 150 x 115 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „di“ und datiert, verso auf Klebeetikett typographisch bezeichnet, datiert und betitelt. Online-WVZ (unnumeriert).
900 €

Großformatige frühe Arbeit des Berliner Künstlers. Diehl, Vertreter eines kritischen und sozialkritischen Realismus, ist Gründungsmitglied der Berliner Ausstellungsgemeinschaft und Selbsthilfegalerie Großgörschen 35. Gemeinsam mit Ulrich Baehr, Werner Berges, Peter Sorge, und anderen vertrat Diehl ab 1966 ein kritisches künstlerisches Programm. „Hans-Jürgen Diehls Bilder demonstrieren eine prekäre Balance, die uns nachdenklich machen sollte. Sie handeln - freilich ganz ohne penetrant didaktischen
Impuls - vom status quo des gegenwärtigen Lebens und seinen Gegensätzen, von einer Ganzheit als Vereinigung von Widersprüchen.“ (Karlheinz Nowald, 17.01.2002, hansjuergendiehl.de, Zugriff 18.02.2025). Das Verzeichnis der Arbeiten Hans-Jürgen Diehls wurde online eingesehen am 18.02.2025 (ohne Nr.; hansjuergendiehl.de/arbeiten-bis-1989).
Provenienz: Privatsammlung Berlin

mappenwerke
7264 Berlin-Prospect Grafik
31 meist farbige Druckgraphiken (teils beidseitig gedruckt) und 1 Zeichnung sowie 6 Bl. Titel, Impressum und Text, jeweils mit Trennfolien, diese teils mit Farbsiebdruck. Verschiedene Techniken auf unterschiedlichen Papieren. Lose in Orig.-Plexiglaskassette. 1968. 38 x 64 cm (41 x 67 cm, Kassette). Die Graphiken sowie die Zeichnung jeweils signiert und meist datiert. Auflage 30 röm. num. Ex.
1.200 €
Das komplette Kompendium aktueller künstlerischer Positionen im Westteil des geteilten Berlin. Berlin Prospect Grafik erschien in einer Gesamtauflage von 130 Exemplaren, hier eines der 30 Belegexemplare für die Mitarbeiter, mit einer Farbkreidezeichnung von Markus Lüpertz. Herausgegeben von Walter Aue und Otto Mertens, hergestellt in der Graphischen Werkstatt O. Mertens, Berlin. Parallel erschien zudem eine Buchausgabe. Die Mappe vereint Texte von 16 Berliner Autoren und Arbeiten von 32 Berliner Künstlern: Peter Ackermann, Otmar Alt, Bettina von Arnim, Ulrich Baehr, Werner Berges, KP Brehmer, Gernot Bubenik, Bernd Damke, Hans-Jürgen Diehl, Paul Uwe Dreyer, Karl Horst Hödicke, Günther Isleib, Wolf Kahlen, Siegfried Kischko, Franz Rudolf Knubel, Bernd Koberling , Fritz Köthe, Markus Lüpertz, Christiane Maether, Jobst Meyer, Werner Pelzer, Heinz Trökes, Heinrich Richter, Christian Rickert, Wolfgang Rohloff, Wolfgang Petrick , Peter P.J. Sohn, Peter Sorge, Hans-J. Spessardt, Walter Stöhrer, Fred Thieler und Lambert Maria Wintersberger 7264
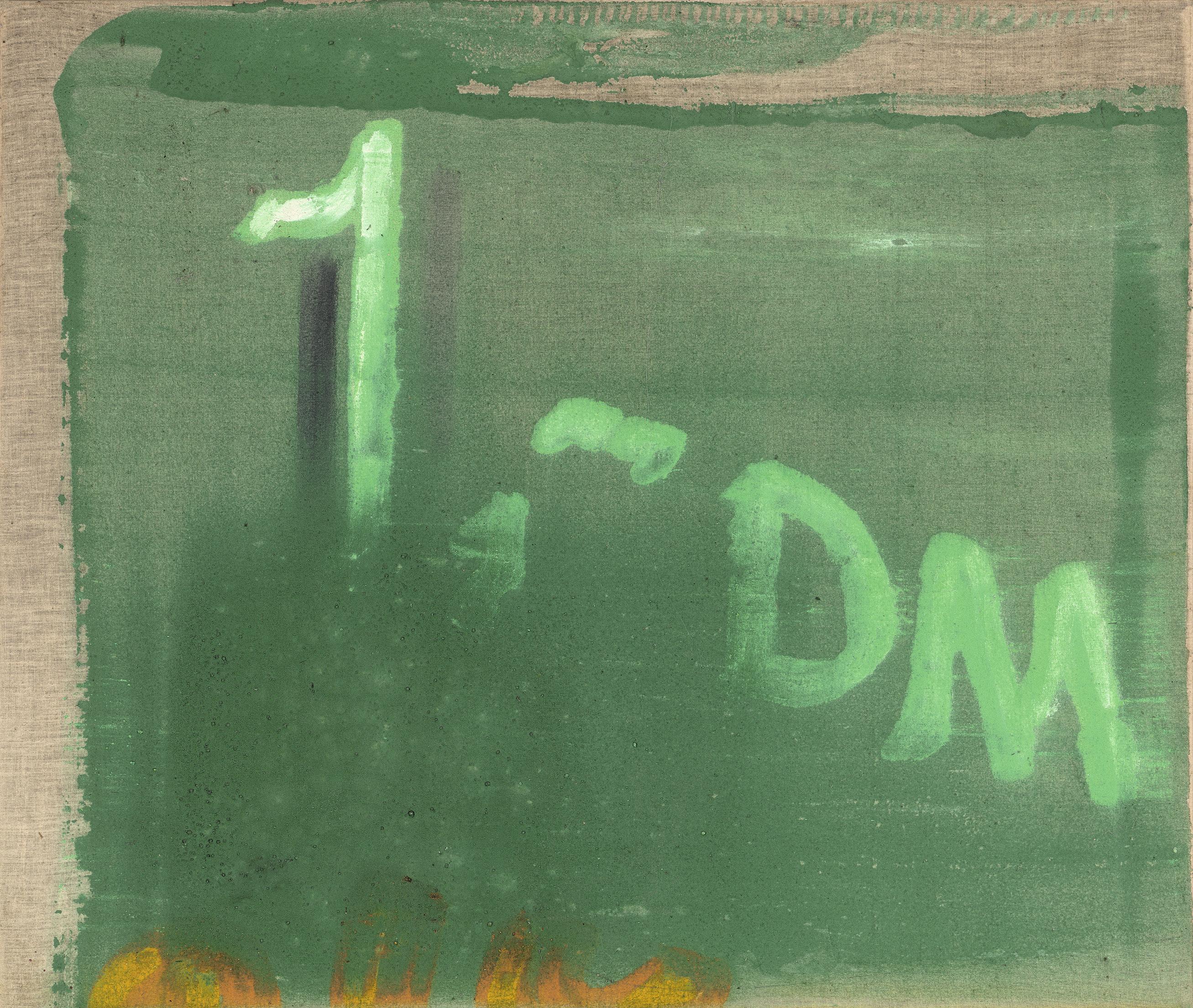
7265
karl horst hödicke (1938 Nürnberg – 2024 Berlin)
7265 1,- DM Öl auf Tuch. 1966. 60 x 70 cm.
Verso mit Farbstift in Blau signiert „Hödicke“.
8.000 €
In breiten, zügigen Bahnen und mit gestischer Bewegung rollt Hödicke die teils wässrige, kräftiggrüne Farbe auf den unbehandelten Malgrund, auf dem stellenweise Orange und Gelb durchschimmern. Souverän bewegt er sich mit seiner Darstellung sowohl kompositorisch als auch technisch im Bereich der Abstraktion, setzt darüber jedoch die leuchtend helle Schrift wie eine Preisauszeichnung, eine in diesem Zusammenhang rätselhafte Chiffre. Hödicke gilt als einer der Wegbereiter des deutschen Neoexpres-
sionismus und als engagierter Professor an der Berliner Hochschule der Künste; er war zudem einer der wichtigsten Anreger der sogenannten Neuen Wilden. „Die ruppig-schnell gemalten Bilder sind kühl konstruiert - das ist kaum zu merken, erst der zweite und dritte Blick erkennen das; darum ermatten Hödicke-Bilder nicht, fallen nach der Überraschung des ersten Augenblicks nicht in flaue Langeweile, Spontaneität aus dem Kopf des Malers.“ (Hermann Wiesler, in: Hödicke Stadtbilder, Ausst.-Kat. München 1994, o. S.). Hödicke hielt sich von 1966 bis 1967 in Amerika auf, wo er experimentelle Kurzfilme produzierte, die zumeist seinen New-YorkAufenthalt reflektieren.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 41, 26.11.1994, Lot 334 Privatsammlung Berlin
andy warhol (1928 Pittsburgh/Pennsylvania – 1987 New York)
7266 Campbell’s Soup I 10 Farbsiebdrucke auf Velin. 1968.
81,1 x 48,1 cm (88,9 x 58,5 cm).
Jeweils verso mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Andy Warhol“. Auflage 250 num. Ex. Feldman/Schellmann 44-53.
450.000 €
Campbell‘s Soup: das berühmteste Emblem der Pop-Art, hier die komplette Folge in farbfrischer Erhaltung. Warhols Portfolio entstand sechs Jahre nachdem seine ersten Campbell’s Soup-Gemälde 1962 in der Ferus Gallery debütierten. Die ikonische Suppendose, einer der bedeutendsten amerikanischen Konsum- und Exportartikel der Nachkriegszeit, gilt als Warhols erstes großes Pop-ArtMotiv. Seine Wahl fiel tatsächlich wegen seiner eigenen Ernährungsgewohnheiten auf die Suppendosen: „I used to drink it. I used to have the same lunch every day, for twenty years, I guess, the same thing over and over again. Someone said my life has dominated me; I liked that idea” (Andy Warhol, zit. nach: Kenneth Goldsmith, I’ll Be Your Mirror: The Selected Andy Warhol Interviews, Boston 2004, S. 18). Die so angeeigneten, effektiv zur bildenden Kunst erhobenen Suppendosen dienten ihm nicht nur als Symbol für den Massenkonsum der amerikanischen Gesellschaft sowie
die repetitiven Eigenschaften der Werbung, sondern, in einen neuen Kontext eingebunden, auch als Kommentar zum Status quo der Kunst. Die scheinbar unpersönliche und mechanisierte Ästhetik der Siebdrucke stellt die künstlerische Subjektivität in Frage, während zugleich Wiederholung und Variation des Grundmotivs die Allgegenwärtigkeit, die Monotonie und die Fülle der alltäglichen visuellen Kultur verdeutlichen. In der Aneinanderreihung der zehn Motive des kompletten Portfolios entsteht ein Ganzes, das mehr wiegt als die Summe seiner Teile. Noch heute beherrschen Warhols ikonische Campbell‘s Soup-Drucke die Welt der Pop-Art, die klassische, schlichte Serie Campbell‘s Soup I ist jedoch eine der ersten, bei der er sich der Siebdrucktechnik bediente, und eine der ersten Veröffentlichungen von Factory Additions, einer Firma, die Warhol selber zum Vertrieb seiner Drucke gegründet hatte. Neben der Auflage von 250 Exemplaren erschienen weitere 26 Artist’s Proofs, jeweils alphabetisch numeriert. Herausgegeben von Factory Additions, New York, Druck Salvatore Silkscreen Co., New York. Verso mit der Gummistempel-Numerierung. Prachtvolle, farbsatte Drucke mit dem vollen Rand.
Provenienz:
Galerie S Ben Wagin, Berlin (dort vor 1972 erworben) Privatsammlung Berlin

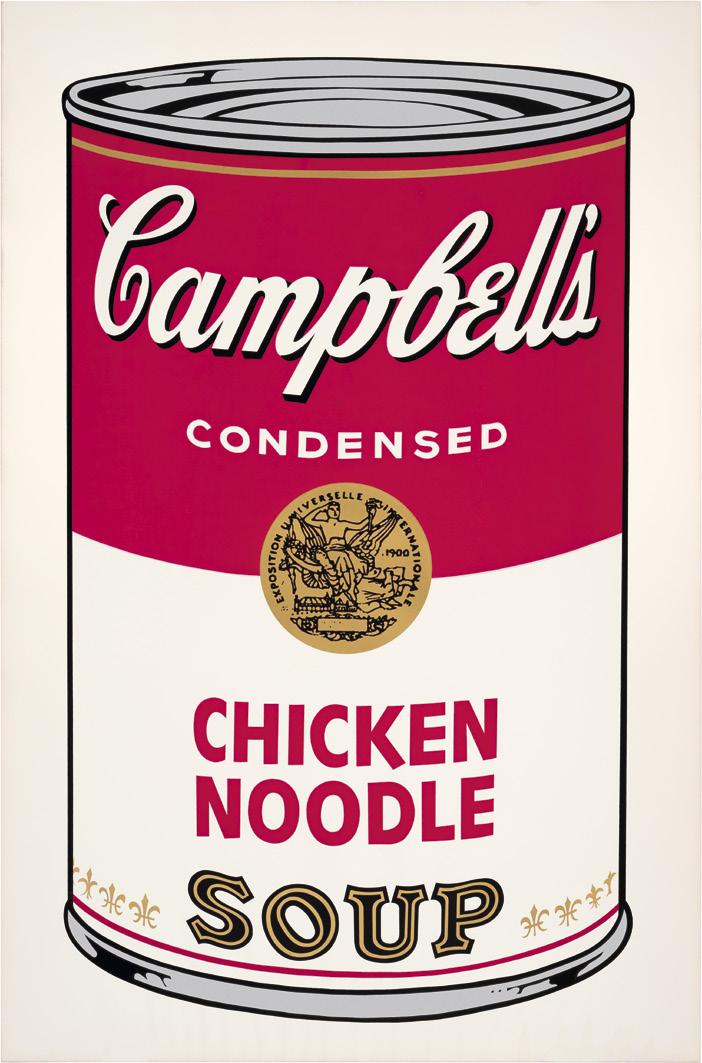


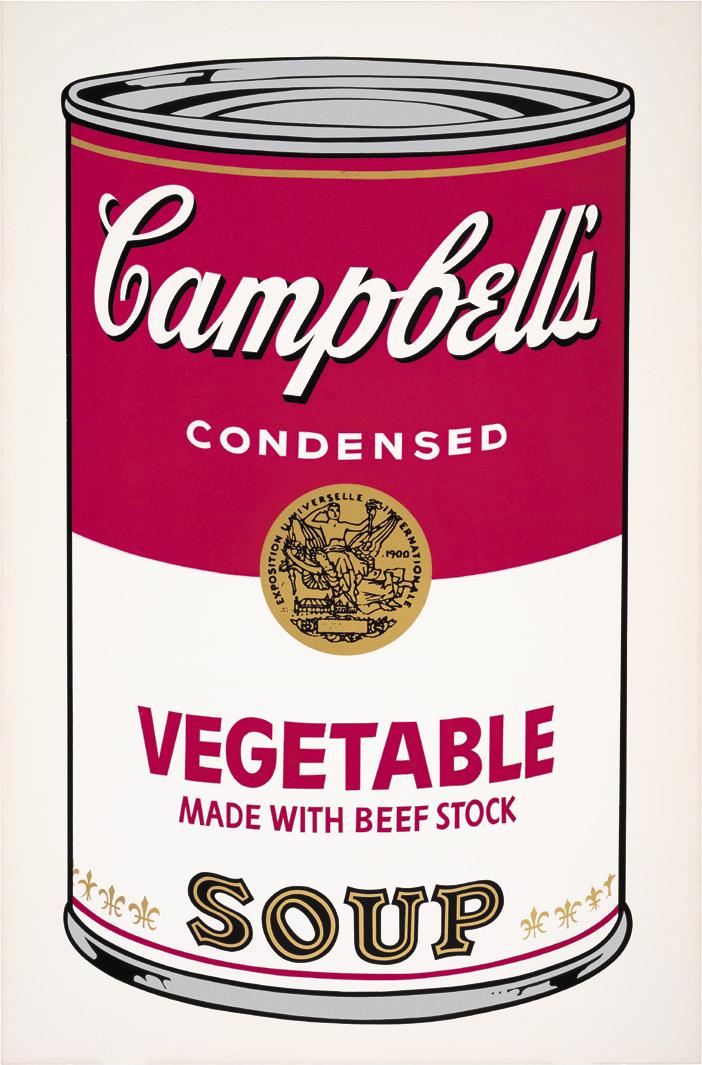
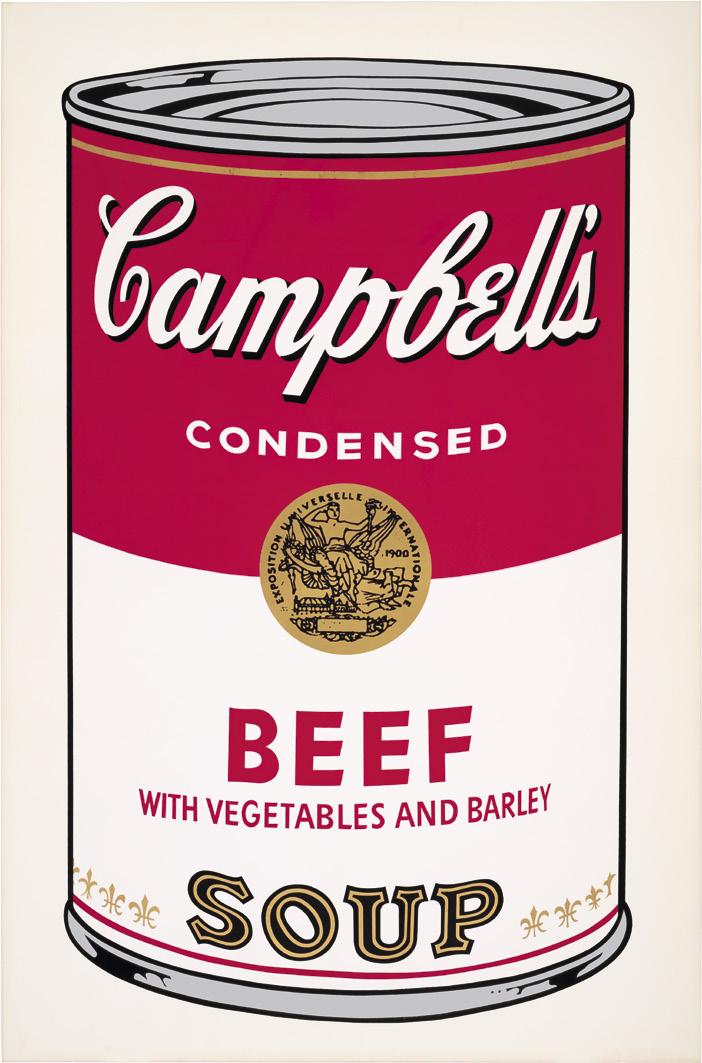
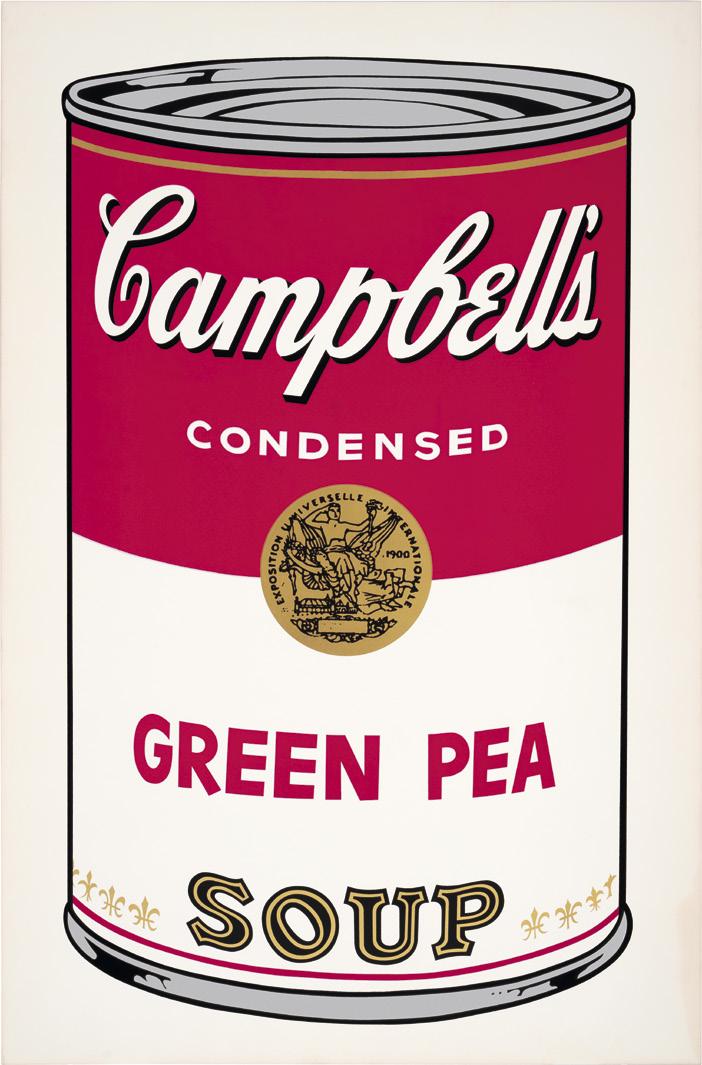



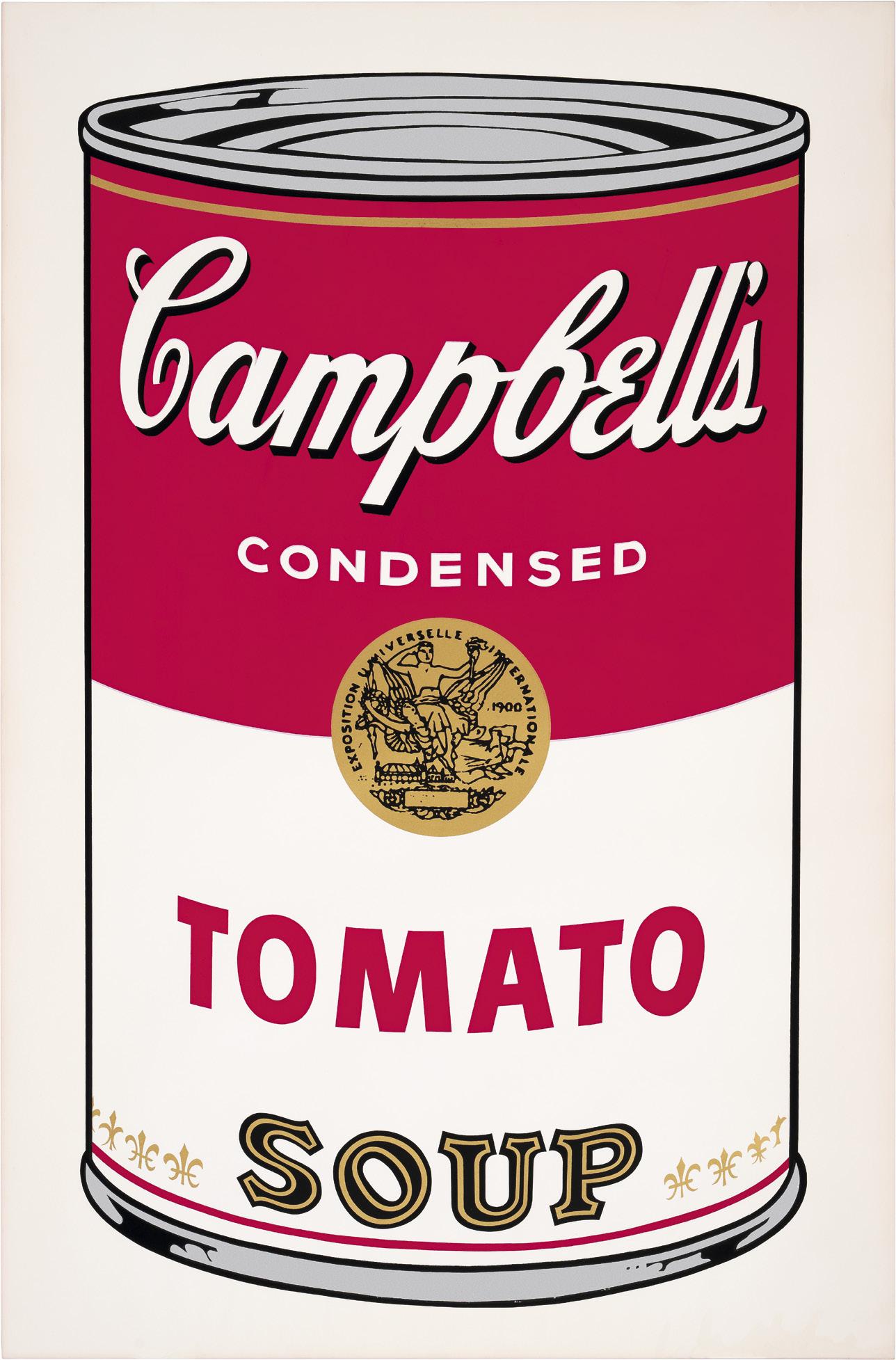
roy lichtenstein (1923–1997, New York)
7267 Bicentennial Print aus America: The Third Centur y portfolio
Farblithographie und Farbserigraphie auf festem Velin. 1975/76.
63,6 x 45,9 cm (76,2 x 56,7 cm).
Signiert „rf Lichtenstein“ und datiert. Auflage 200 num. Ex. Corlett 136.
12.000 €
Herausgegeben von APC Editions, division of Chermayeff & Geismar Associates, New York (and underwritten by Mobil Oil Corporation) und gedruckt von Styria Studio, New York, mit deren Blindstempel unten rechts. Erschienen 1976 in einer Mappe von insgesamt 13 Werken verschiedener Künstler wie zum Beispiel Christo, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, James Rosenquist, Edward Ruscha. Die Erlöse aus dem Verkauf der Mappe wurden an eine vom jeweiligen Künstler ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Diese Organisationen sind mit dem Namen des Künstlers und dem Titel des Werks auf den Titel-/Kolophon-Seiten der Mappe aufgeführt. Lichtenstein entschied sich für die American Civil Liberties Union, die New York Civil Liberties Union und Change, Inc., eine von Rauschenberg gegründete Wohltätigkeitsorganisation, die aufstrebende Künstler finanziell unterstützen sollte. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.

roy lichtenstein
7268 Titled
Farbserigraphie auf Velinkarton. 1996.
61,3 x 82,8 cm (80 x 100,8 cm).
Signiert „rf Lichtenstein“ und datiert. Auflage 175 num. Ex. Corlett 307.
20.000 €
Herausgegeben vom Künstler und Ronald Feldman Fine Arts, Inc., New York, gedruckt bei Norbert Serigraphie, New York in Zusammenarbeit mit Jean-Yves Noblet. Das Blatt „Titled“ wurde im Wahljahr 1996 unter der Schirmherrschaft von „Artists for Freedom of Expression“ (Künstler für Meinungsfreiheit) zugunsten von Kandidaten und Organisationen produziert, die die staatliche Finanzierung der Künste unterstützen. Andere Künstler, die Arbeiten zur Unterstützung der Kampagne 1996 produzierten, waren u.a. Ida Applebroog, Jenny Holzer, Ellsworth Kelly, Bruce Nauman, Robert Rauschenberg und Richard Serra. Der Titel dieses Werks wird in einer von der Organisation Artists for Freedom of Expression herausgegebenen Broschüre mit „Untitled (Sea)“ angegeben. Prachtvoller Druck mit breitem Rand.

kenneth armitage
(1916 Leeds – 2002 London)
7269* Ohne Titel
Kohle auf halbtransparentem Velin. 1969.
41 x 32,6 cm.
Unten rechts mit Kohle monogrammiert „KA“ und datiert.
1.200 €
Archaisch in ihrer Wirkung und von beeindruckender Könnerschaft in der Abstraktion und der bestimmten Linienführung ist die vorliegende Zeichnung des britischen Bildhauers. Bereits Armitages Frühwerk zeigt sich von ägyptischen und kykladischen Skulpturen wie auch vom Werk Henry Moores beeinflusst. Ab 1967 hielt sich der Künstler für zwei Jahre in Berlin auf, wo möglicherweise die charakteristische Zeichnung einer frontal stehenden menschlichen Figur entstand.
Provenienz:
Venator & Hanstein, Köln, Auktion 22.09.2012, Lot 832
Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
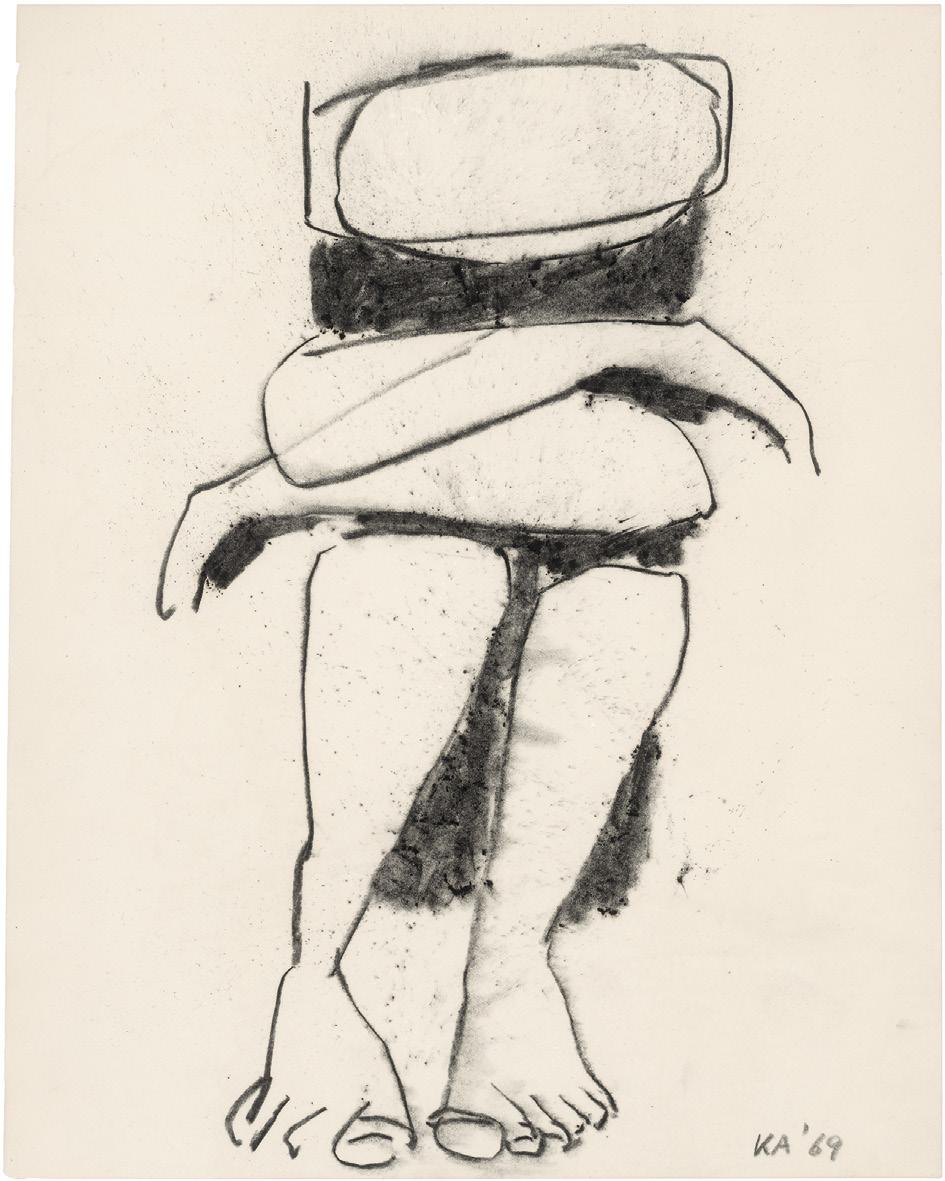

7270
volkmar haase (1930–2012, Berlin)
7270 „kubisch-blockhafte Form“ Stahl auf Holzsockel. 1968/70.
23 x 20 x 19 cm.
Unter dem Holzsockel auf Karton mit Faserschreiber in Schwarz signiert „Haase“, datiert und betitelt sowie mit Kugelschreiber in Schwarz mit der Künstleradresse.
1.000 €
Nach dem Studium bei Hans Uhlmann und Max Kaus war Volkmar Haase seit 1958 freischaffend als Maler, Graphiker und Bildhauer tätig. Seine abstrakten Skulpturen, meist aus Edelstahl, sind deutschlandweit, besonders in Berlin, auf vielen öffentlichen Plätzen zu finden. Bis in die 1980er Jahre waren seine Werke, wie unsere Skulptur, von kantigen, geometrischen Formen geprägt, erst später entwickelte Haase einen kurvigeren Stil. Gesamthöhe mit Sockel: 27 cm.
Provenienz: Privatbesitz Münster 7269
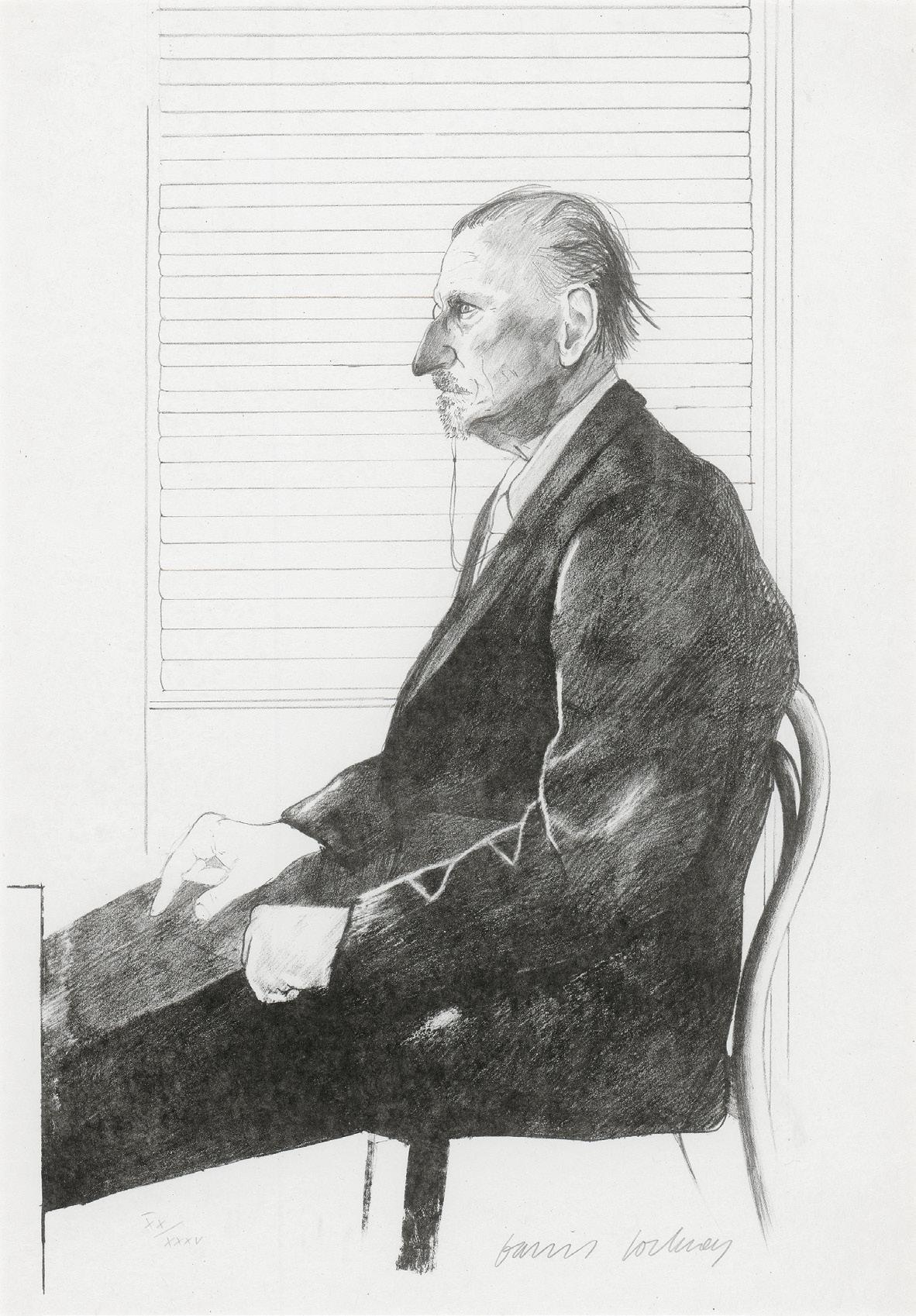
david hockney (1937 Bradford, lebt in Bridlington)
7271 Portrait Felix Man (The Print Collector) Lithographie auf Japan. 1969.
71,5 x 46,8 cm (72,5 x 52 cm, Passepartoutausschnitt).
Signiert „David Hockney“. Auflage 35 röm. num. Ex. Scottish Arts Council 113.
1.200 €
Nr. 2 aus der Mappe „Europäische Graphik VII (Englische Künstler)“, erschienen in der Edition Galerie Wolfgang Ketterer, München 1971, in einer Gesamtauflage von 100 Exemplaren. Felix H. Man hegte eine große Leidenschaft für die Fotografie, seine Verdienste für den Fotojournalismus waren bahnbrechend. Ausgezeichneter Druck der nahezu blattfüllenden Darstellung.
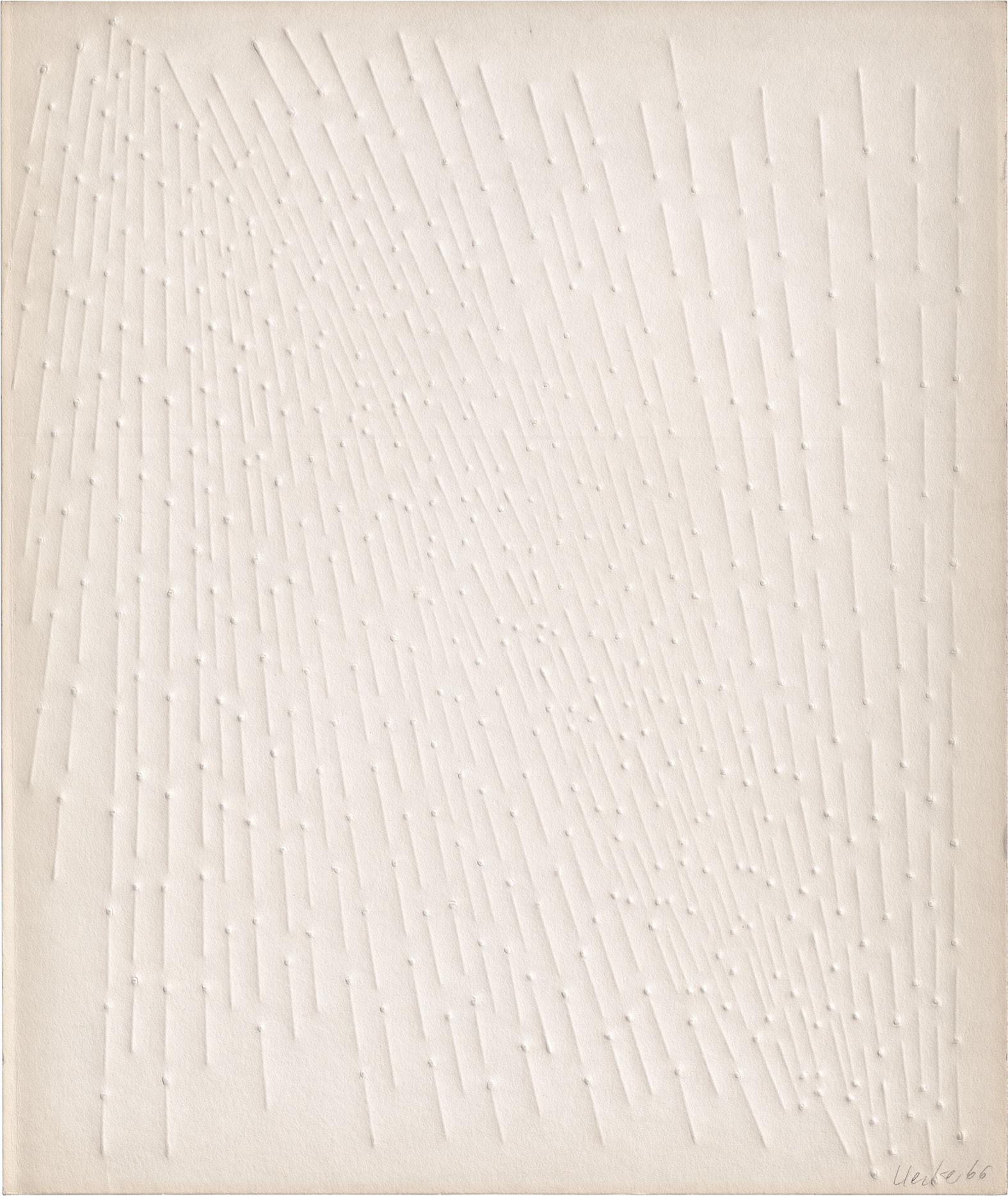
7272
mappenwerke
7272 ZERO - Kassette. Mack-Piene-Uecker
3 Prägedrucke (1 mit Farboffset, aquarelliert) auf unterschiedlichen Papieren sowie Heft mit Titel, Impressum und Textblättern. Lose in Orig.-Halbleinenmappe mit broschiertem Heft und Schuber. 1966. Ca. 63,8 x 53,5 cm (Blattgröße).
Die Graphiken jeweils signiert und datiert. Auflage 250 num. Ex.
Dombrowe L 6603, Mack 33, Rottloff 21.
1.500 €
Das vollständige Mappenwerk, herausgegeben von der KestnerGesellschaft, Hannover 1966, anlässlich der ZERO-Ausstellung ebendort. Enthalten ist jeweils eine Arbeit der ZERO-Gründer Heinz Mack , Otto Piene und Günther Uecker sowie Texte der Künstler und von Wieland Schmied. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.
heinz mack
(1931 Lollar, lebt in Mönchengladbach und auf Ibiza)
7273 Silbervibration
Reliefdruck auf Aluminium-Folienkarton. 1967.
41 x 28 cm (42,8 x 30 cm).
Signiert „mack“ und datiert. Auflage 150 num. Ex. Mack 43.
900 €
Prachtvoller Reliefdruck dieser nahezu blattfüllenden Darstellung.
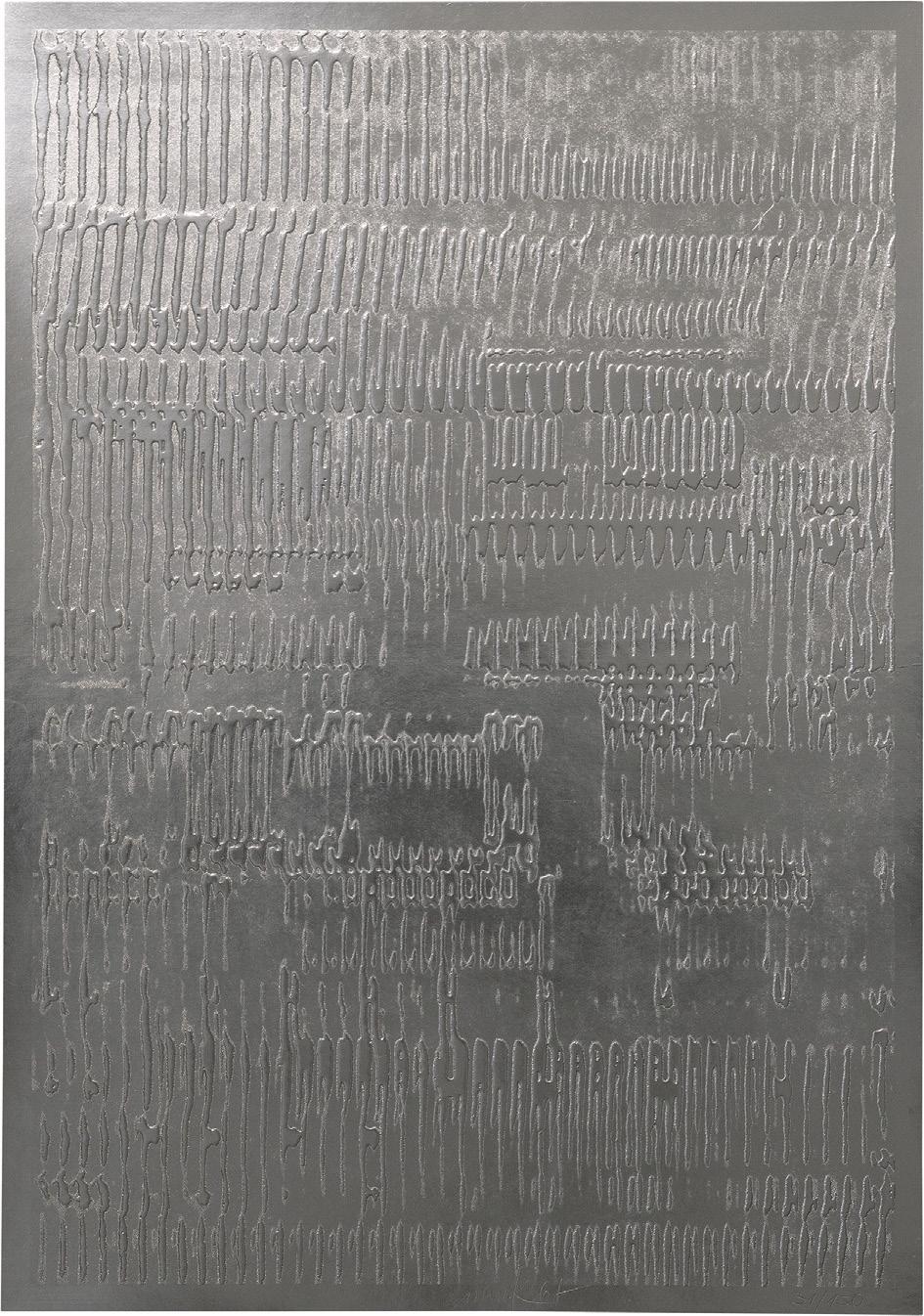

heinz mack
7274 Strahlung
Farbserigraphie auf Aluminium-Folienkarton. 1973. 49 x 43,3 cm (55 x 48,7 cm).
Signiert „mack“ und datiert. Auflage 100 num. Ex. Mack 47.
900 €
Herausgegeben vom Kunstverein Braunschweig, mit dessen Blindstempel unten links. Ausgezeichneter, wenngleich in der Farboberfläche stellenweise etwas unregelmäßiger Druck in differenzierter Farbigkeit, mit breitem Rand.

otto piene
(1928 Laasphe/Westfalen – 2014 Berlin)
7275 Schwarze Sonne auf Rot Farbserigraphie auf Velinkarton. 1970.
76 x 61,5 cm (80 x 65 cm).
Signiert „OPiene“ (ligiert) und datiert. Auflage 30 num. Ex. Rottloff 87.
1.200 €
In der Numerierung von den Angaben bei Rottloff abweichend (dort 15-20 signierte und numerierte Exemplare). Aus der fünfteiligen Serie „Sonnen“, herausgegeben von der Edition Rottloff, Karlsruhe. Prachtvoller Druck in leuchtender Farbigkeit, mit dem vollen Rand.


7276 Mushroom
Farbserigraphie auf festem Velinkarton. 1976.
98 x 69,6 cm.
Signiert „OPiene“ (ligiert) und datiert. Auflage 75 num. Ex. Rottloff 215.
900 €
Herausgegeben von der Galerie Schöller, Düsseldorf, in einer Gesamtauflage von 90 Exemplaren. Prachtvoller Druck der formatfüllenden Komposition mit leuchtendem Rot.
7277 Mushroom Man
Farbserigraphie auf Velinkarton. 1976.
97,9 x 70 cm.
Signiert „Piene“ (ligiert) und datiert. Auflage 75 num. Ex. Rottloff 216.
900 €
Herausgegeben von der Galerie Schöller, Düsseldorf, in einer Gesamtauflage von 90 Exemplaren, Druck Rottloff, Karlsruhe. Prachtvoller Druck der formatfüllenden Komposition.


gerhard richter (1932 Dresden, lebt in Köln)
7278 Schweizer Alpen I Farbserigraphie auf weißem Karton. 1969. 69,4 x 69,4 cm.
Signiert „Richter“ sowie verso mit dem Editionsstempel. Auflage 300 Ex. Butin 20, B 1.
15.000 €
Druck der Variante in Schwarz und zwei Graublautönen, herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg, gedruckt von Hans H. Hotze, Essen. Prachtvoller Druck der formatfüllenden Darstellung.
7279 Prisma II
Prisma aus farblosem Schwertflintglas. Lose in leinenbezogenem Orig.-Klappetui. 2003. 12 x 4,7 x 4,1 cm (20 x 6 x 6 cm).
Auf der Innenseite des Etuis signiert „Richter.“. Auflage 88 num. Ex. Butin 121.
1.800 €
Herausgegeben von Wako Works of Art, Tokyo, in einer Gesamtauflage von 100 Exemplaren, mit deren Bezeichnungen auf dem Etui. Hergestellt von Helma Optik, Jena, und Berliner Glas, Berlin. Das Objekt entstand in Kooperation der Wako Art Gallery, Tokio, und der Deutschen Guggenheim anlässlich der Ausstellung „Acht Grau“ (2002/03). Es vereint die beiden zentralen Werkkomplexe der Grauen Bilder Richters und seiner Spiegel-, Glas- und Prismenarbeiten. Prachtvolles Exemplar, mit Orig.-Packpapier, dort gestempelt und nochmals numeriert. 7279
hede bühl
(1940 Haan, lebt in Düsseldorf)
7280 Kleiner Wächter II
Bronze mit schwarzbrauner Patina. 1976.
14,5 x 20 x 8 cm.
An der Unterseite mit dem Monogrammstempel „B“. Auflage 20 num. Ex. Kraft 1976.3.
1.800 €
Auf einfache Grundformen reduziert Hede Bühl die frontal ausgerichtete Halbfigur mit weit ausladenden Schultern. Eine kleine Gruppe ähnlich angelegter und doch stets variierter Arbeiten betitelt die Künstlerin als „Wächter“. Hede Bühl studierte 1958-63

Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys und arbeitete danach zwei Jahre im Atelier von Ewald Mataré. Fast ausschließlich beschäftigt sie sich mit der menschlichen Figur. Ernst, verschlossen und schweigsam, fast wie in einen Kokon versponnen erscheint die Halbfigur des Kleinen Wächters, wie es charakteristisch für Hede Bühls Gestalten und Köpfe ist. Sie „sagen uns immer wieder dasselbe, nämlich dass sie auf uns warten, um von unseren Blicken gestürmt und eingenommen zu werden wie Festungen. (...) So wie die Figuren und Köpfe geformt sind, sind sie mit statischer plastischer Energie geladene Körper im Raum.“ (Karlheinz Norwald, in: Hede Bühl. Köpfe, Ausst.-Kat. Museum für Kunst und Kulturgeschichte Lübeck 1995, S. 39). Prachtvoller Guss mit homogener Patina.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
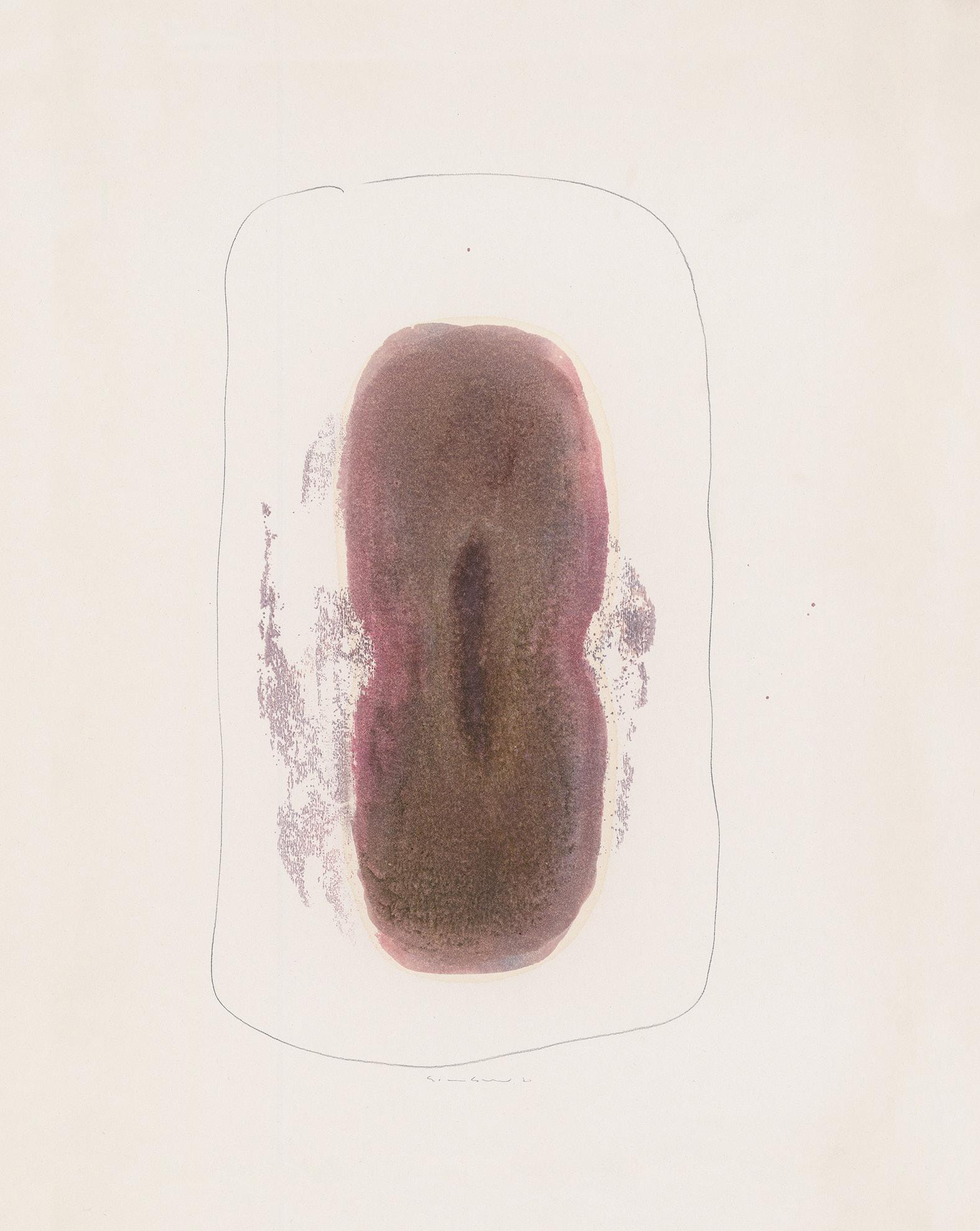
gotthard graubner (1930 Erlbach – 2013 Neuss)
7281 Ohne Titel
Öl und Bleistift auf Velin. 1970.
64 x 50 cm.
Unten mittig mit Bleistift signiert „Graubner“ und datiert.
2.000 €
Zarte Farbschichten scheinen ein Eigenleben zu entwickeln und wirken vielmehr durch ihre Überlagerung und die Transluzenz, anstatt durch Form oder Begrenzung. Den Raum für diese intensive, beinahe pulsierende Wirkung stellt die feine Bleistifteinfassung bereit. Um 1970 entstehen nicht mehr Kissenbilder, sondern vor allem Nebelräume und Farbraumkörper. Die Zeichnung ist Kitty Kemr, Archiv Gotthard Graubner, Düsseldorf, bekannt.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
judit reigl
(1923 Kapuvár – 2020 Marcoussis)
7282 Presence
Serigraphie auf Velinkarton. Um 1970.
47 x 36 cm (60 x 43 cm).
Signiert „J. Reigl“. Auflage 40 num. Ex.
900 €
Herausgegeben von van der Loo, München, mit deren Blindstempel unten links. Beeinflusst durch die École de Paris und die Écriture automatique, entwickelte sich Reigl in Richtung einer lyrischen Expression. Ähnlich wie Pollock und Frankenthaler in New York, legte sie größere Leinwände auf den Boden und bearbeitete sie gestisch mit Pinsel, Fingern oder Instrumenten. Ausdrucksstarke, dynamische Komposition in einem kräftigen Druck mit Rand.
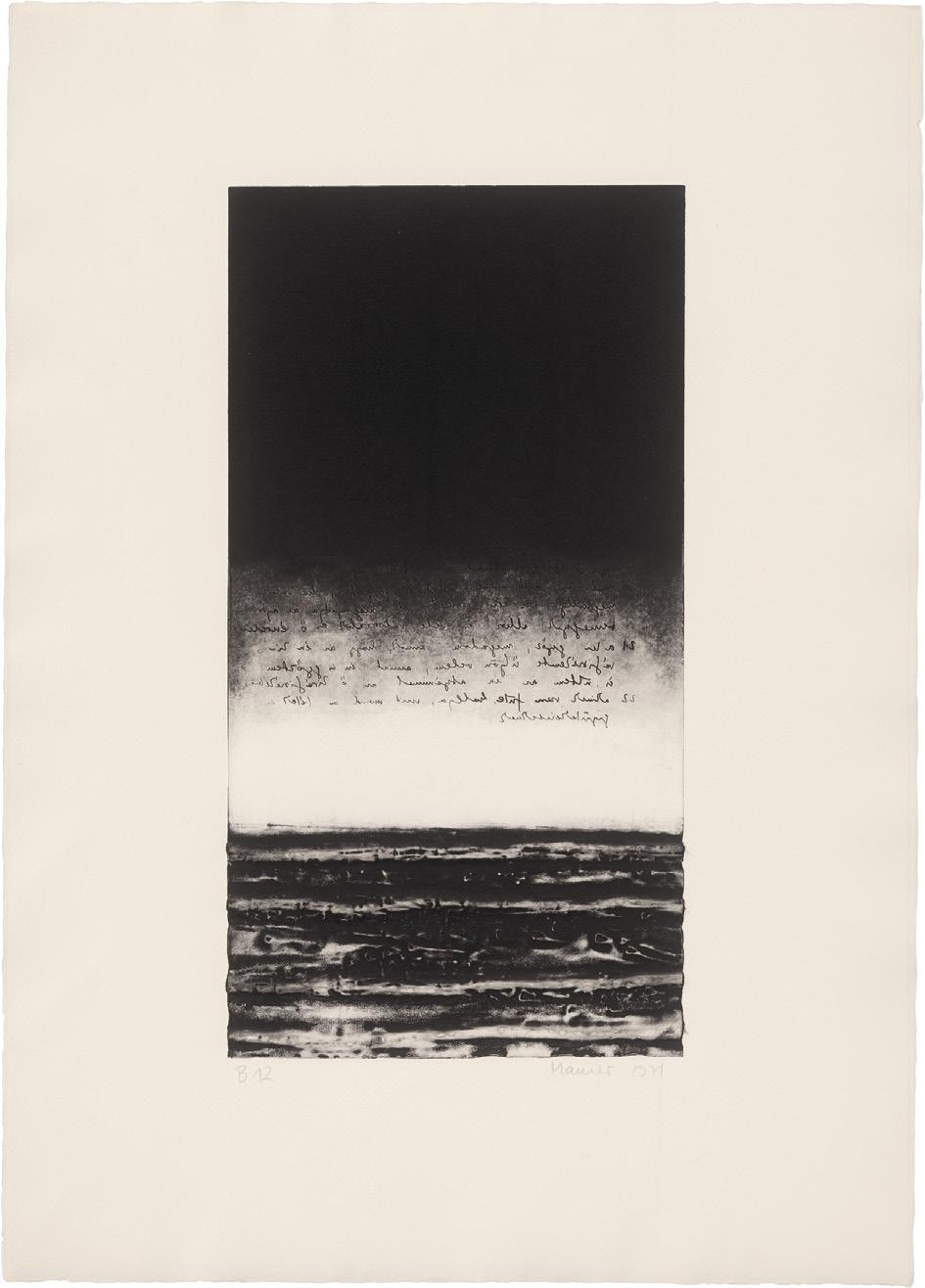
7283

(1937 Budapest)
7283 „B 12“
Aquatinta und Radierung auf Velin. 1971.
47 x 25 cm (69,5 x 50 cm).
Signiert „Maurer“, datiert und betitelt.
Griffelkunst 190 A1.
800 €
Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. Prachtvoller, kräftiger Druck mit dem vollen Rand, an zwei Seiten mit dem Schöpfrand.
dóra maurer
7284 „B 5“
Aquatinta auf weichem Velin. 1970.
36,5 x 46,7 cm (69,5 x 50 cm).
Signiert „Maurer“, datiert und betitelt.
Griffelkunst 190 A2.
800 €
Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. Prachtvoller, kräftiger Druck mit dem vollen Rand, an zwei Seiten mit dem Schöpfrand.

7285 „P 6“
Aquatinta und Radierung auf weichem Velin. 1970.
40,4 x 40 cm (70 x 50 cm).
Signiert „Maurer“, datiert und betitelt.
Griffelkunst 190 A3.
800 €
Herausgegeben von der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg. Prachtvoller, kräftiger Druck mit dem vollen Rand.


vlastimil benes (1919–1981, Prag)
7286 „Zizkov“
Aquarell auf genarbtem Aquarellkarton. 1953.
32,4 x 31,5 cm.
Unten links mit Bleistift unleserlich bezeichnet, verso mit Pinsel in Grau betitelt, bezeichnet „S KOPCE SV. KRÍZE“ und datiert „6. XII. 1953“.
2.400 €
Eines der unverwechselbaren Vorstadtmotive des tschechischen Künstlers. Der Blick richtet sich vom Hügel „Das Hohe Kreuz“ aus
über die Dächer von Zizkov, einem Stadtteil von Prag. Rechts im Mittelgrund ragt der Glockenturm der neogotischen Kirche des Heiligen Prokop empor, im Vordergrund weisen drei kahle Bäume auf natürliche Vegetation. Ansonsten wirkt die Szene wie eingefroren im luftleeren Raum. Spuren von menschlichem Leben sucht man vergebens, vielmehr konzentriert sich Benes ganz auf die akribische Aneinanderreihung der unterschiedlichen Häuser mit allerlei farbigen Schattierungen der Fassaden im Licht der sanften Abenddämmerung.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

vlastimil benes
7287 „Weiße Bude“ Öl auf Hartfaser. 1975. 10 x 15 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Benes“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz mit unleserlicher Ortsangabe sowie Datumsnotizen, auf dem Rahmen nochmals signiert und betitelt sowie bezeichnet „6.“.
2.200 €
Bekannt wurde Benes mit seinen kargen Landschaften, Vorstadtund Industriemotiven, oft lokalisiert in der Prager Peripherie, gemalt in einem reduzierten Flächenstil. In originaler Rahmung des Künstlers, verso mit seinen handschriftlichen Notizen zur Entstehung des Gemäldes: Mehrere Arbeitstage zwischen 1973 und 1975 vermerkte er für die Arbeit an dem kleinformatigen, charakteristischen Gemälde. Anknüpfend an den sozialen Realismus und an die Poetik der konstruktivistischen Avantgarde, steht Benes‘ Malerei für einen geometrisierenden poetischen Realismus. Charakteristisch ist auch die körnige, etwas grobe Struktur der stets von ihm selber angerührten Farben.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

vlastimil benes
7288 Portrait eines Herrn Öl auf Karton, auf Kapa-Platte montiert. 1976.
22,2 x 16,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Dunkelbraun signiert „Benes“ und datiert.
1.800 €
Formatfüllend und in extremer Nahsicht erfasst Benes den Herrn mit Schieberkappe und karierter Weste über weißem Hemd. Benes Werke sind häufig geprägt von kontemplativer Stille und Melancholie – gerade auch in seinen Portraits finden sich eine besondere Subtilität und Verletzlichkeit.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland 7289
vlastimil benes
7289 Portrait einer Dame
Öl auf Karton, auf Kapa-Platte montiert. 1976.
19,2 x 16,2 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Hellblau signiert „Benes“ und datiert.
1.800 €
Mit verträumtem Blick und leicht melancholischem Ausdruck zeigt Benes die Bauersfrau, deren rotes Kopftuch eindrucksvoll mit ihrem blauen Kleid und dem türkisen Hintergrund kontrastiert. Seine Portraits sind stark aufgeladen von innerem Ausdruck und großer Intimität.
holmead

(d.i. Clifford Holmead Phillips, 1889 Shippensburg/Pennsylvania – 1975 Brüssel)
7290 Männerkopf Öl auf Holz. 1970.
38,7 x 28,6 cm
Unten links mit Pinsel in Rot signiert „Holmead“, verso mit Kreide in Grün nochmals signiert, datiert und bezeichnet „HPinx“ und mit Kreide in Schwarz bezeichnet „toile sur triplex hydrofugé“ sowie mit Faserschreiber in Schwarz (von fremder Hand) „M 70/22“ und mit den Maßangaben.
3.000 €
Der dynamisch-pastose Farbauftrag verleiht der Darstellung des Männerkopfes einen reliefartigen Charakter. „In den Jahren 1970 bis 1972 malt Holmead nahezu nichts anderes als Köpfe. Auf einem seiner Notizzettel heißt es von seinen Portraits: ‚Es sind Charakterstudien von wirklichen Menschen in einer stenographischen Malweise.‘ Nichts war Holmead mehr zuwider als täuschende Beschönigungen. So sind alle seine ‚Köpfe‘ anschauliche Enthüllungen der menschlichen Natur (...)“ (Rainer Zimmermann, in: Holmead - Leben und Werk, Stuttgart 1987, S. 143).

marcel janco
(1895 Bukarest – 1984 Tel Aviv)
7291 Roter Kopf Öl auf Leinwand.
62 x 65 cm.
Unten links mit Pinsel in Grün signiert „M. Janco“.
1.200 €
In leuchtenden Farben abstrahierte figurative Komposition des Dadaisten-Urgesteins Janco. Er gehörte mit Hans Arp, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Hugo Ball und Emmy Hennings zu den Begründern des Cabaret Voltaire und der Züricher Dada-Bewegung. In Bukarest rief er 1922 die bedeutende Zeitschrift „Contimporanul“ ins Leben. Aufgrund seiner jüdischen Wurzeln emigrierte Janco während des Zweiten Weltkrieges nach Palästina; im Norden Israels gründete er die Künstlerkolonie Ein Hod.

john piper (1903 Epsom – 1992 Fawley Bottom)
7292 Englisches Landhaus mit Garten
Feder in Schwarz, Aquarell und Gouache auf Zeichenblockpapier. Wohl 1970er Jahre.
35,2 x 25,5 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „John Piper“.
2.500 €
Skizzenhaft detaillierte, feingliedrige Federzeichnung, teils zart mit dem Pinsel, zum Unterrand hin teils mit dem bloßen Finger,
kräftig koloriert. Der englische Maler, Graphiker und Bühnenbildner Piper besuchte ab 1926 zuerst die Richmond School of Art, danach das Royal College of Art. Anfang 1930 reiste er nach Paris, wo ihn Arbeiten von Constantin Brâncusi, Hans Arp und Alexander Calder inspirierten. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1938 in der London Gallery. Im Zweiten Weltkrieg wurde Piper offizieller Kriegsmaler und erlangte mit Darstellungen bombenzerstörter Kirchen und Landschaften Bekanntheit, später gestaltete er auch Glasfenster für Kirchen und Keramik. Große Teile seiner Zeichnungen sind heute Bestandteil der Tate Modern in London.
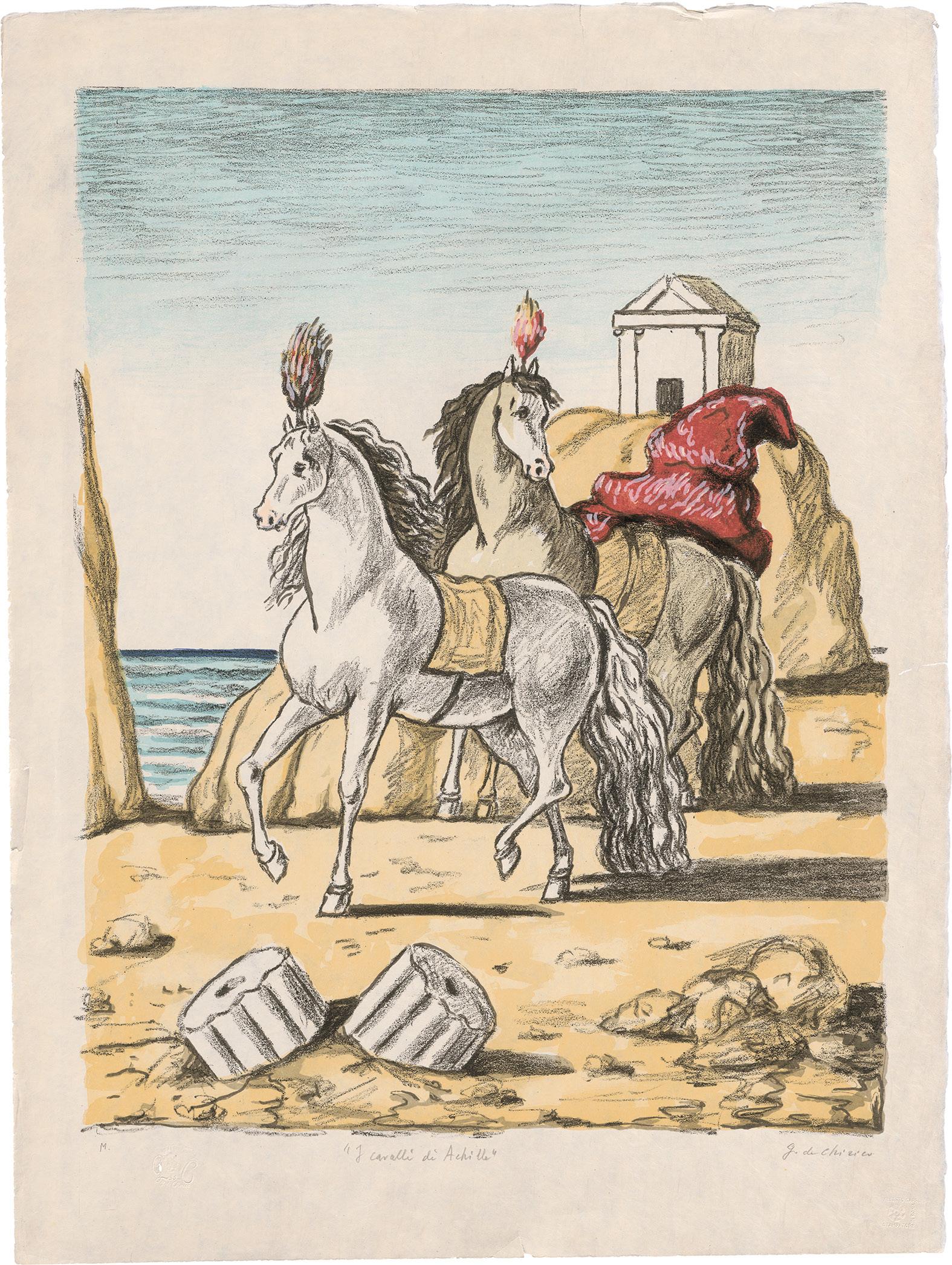
7293
giorgio de chirico (1888 Volo – 1978 Rom)
7293 „I cavalli di Achille“ Farblithographie auf Japan. 1971. Ca. 59 x 46 cm (70,6 x 52,7 cm).
Signiert „G. de Chirico“ und betitelt. Brandani 128.
1.500 €
Mit den Blindstempeln des Künstlers und des Druckers „Alberto Caprini/Stampatore in Roma“. Einer von 21 alphabetisch bezeichneten Abzügen auf Japan, neben der Auflage von 95 arabisch numerierten und 25 römisch numerierten Exemplaren und weiteren 12 Künstlerabzügen. Die dritte Fassung von drei Darstellungen desselben Sujets in einem prachtvollen, farbfrischen Druck mit dem wohl vollen Rand, oben und rechts mit Schöpfrand.
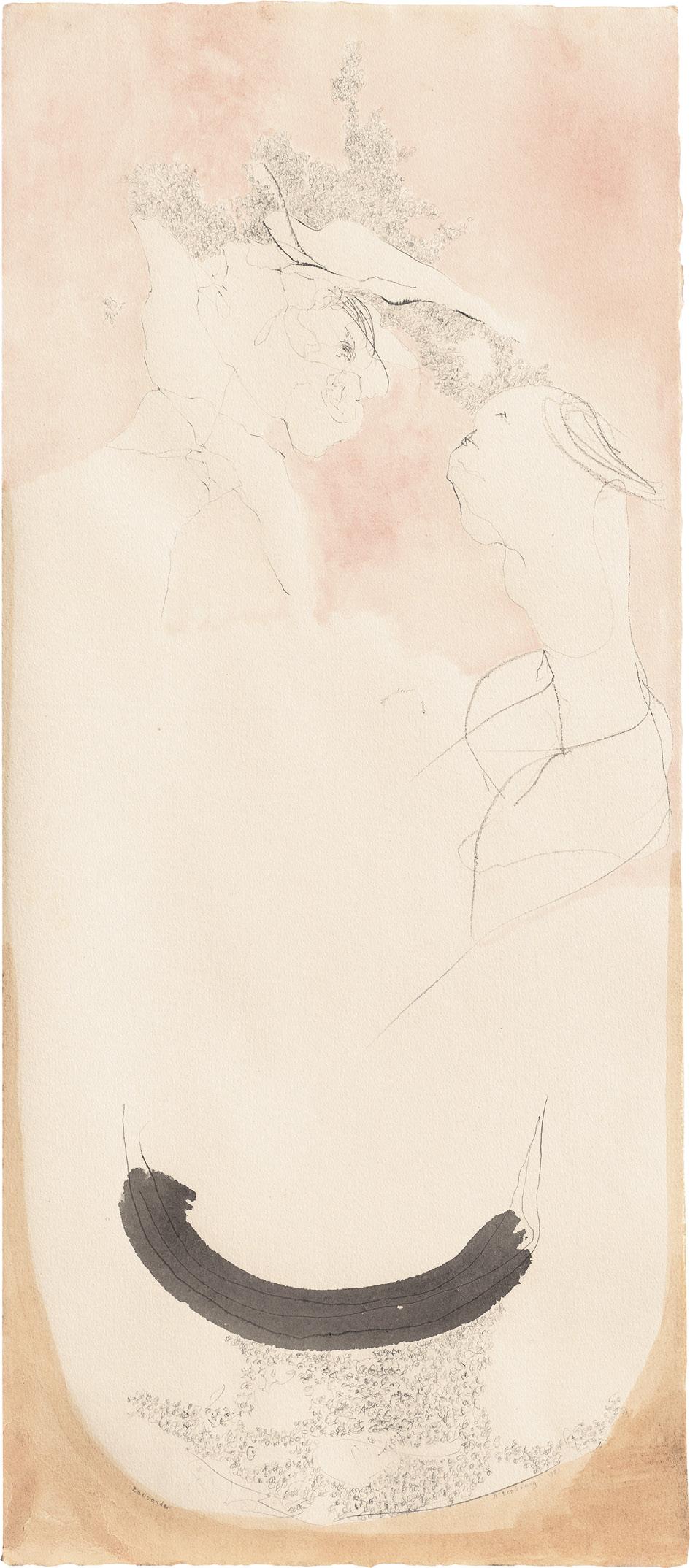
gerhard altenbourg (1926 Rödichen-Schnepfenthal – 1989 Meissen)
7294 „Zueinander“
Bleistift, Aquarell, chinesische Tusche und Kasein-Wachsseife-Tempera auf Velin. 1981.
61 x 26,7 cm.
Unten rechts in der Darstellung mit Bleistift signiert „Altenbourg“ und datiert, unten links betitelt. Janda 81/18.
3.000 €
Beinahe scheinen sich die beiden Figuren in ihrer ganz zart aquarellierten Umgebung aufzulösen, während wie luftiger Schaum oben und unten im Bild Altenbourgs unzählige Kringel von ihnen fortziehen. In dieser poetischen Begegnung schimmert die freundliche Erfindungskraft des Künstlers hervor. Nach Malunterricht bei Erich Dietz war Altenbourg zunächst als Schriftsteller und Journalist tätig, studierte dann von 1948 bis 1950 an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar. Danach lebte er freischaffend in Altenburg und nahm Mitte der 1950er Jahre den Künstlernamen Altenbourg an. 1951 zeigte er in Begleitung von Erich Dietz seine Arbeiten dem Westberliner Galeristen Rudolf Springer, der sein erster Kunsthändler wurde. Da sich Altenbourg konsequent der offiziellen Kunstpolitik der DDR verweigerte, wurde er bis in die 1980er Jahre in seinem Wirken durch Verbot und Schließung von Ausstellungen behindert.
Provenienz:
Atelier des Künstlers (1981 dort erworben)
Galerie Brusberg, Berlin (1991 dort erworben)
Privatbesitz Berlin

7295
jean-jacques sempé
(1932 Bordeaux – 2022 Draguignan)
7295 Ohne Titel (Geiger mit Einkaufstasche)
Bleistift und Farbstifte auf festem Velin. 1981.
60 x 69 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Sempé“ und datiert.
7.000 €
Großformatige Zeichnung Sempés, entstanden als Entwurf für das Plakat zu der Einzelausstellung des Künstlers, „Sempés Musiker“, in der Galerie Bartsch & Chariau, München 1981. Die korpulente Herrenfigur mit großer Nase ist charakteristisch für Sempés Gestalten, und er lässt den Mann mit dem Violinkasten zwar
einen Schatten werfen, verzichtet aber auf jede Art von Szenerie oder Hintergrund. Ab 1978 arbeitete der Künstler für den „New Yorker“. Im Jahr 1979 widmete Sempé der Musik, der er seit Kindertagen zugetan war, ein eigenes Buch, bald darauf entstand unsere Zeichnung. Verso mit einer weiteren Zeichnung des Künstlers, Federstudie „Stehender Mann“, wohl zur Figur recto.
Provenienz:
Ehemals Galerie Bartsch & Chariau, München 1981 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)
Privatbesitz Süddeutschland
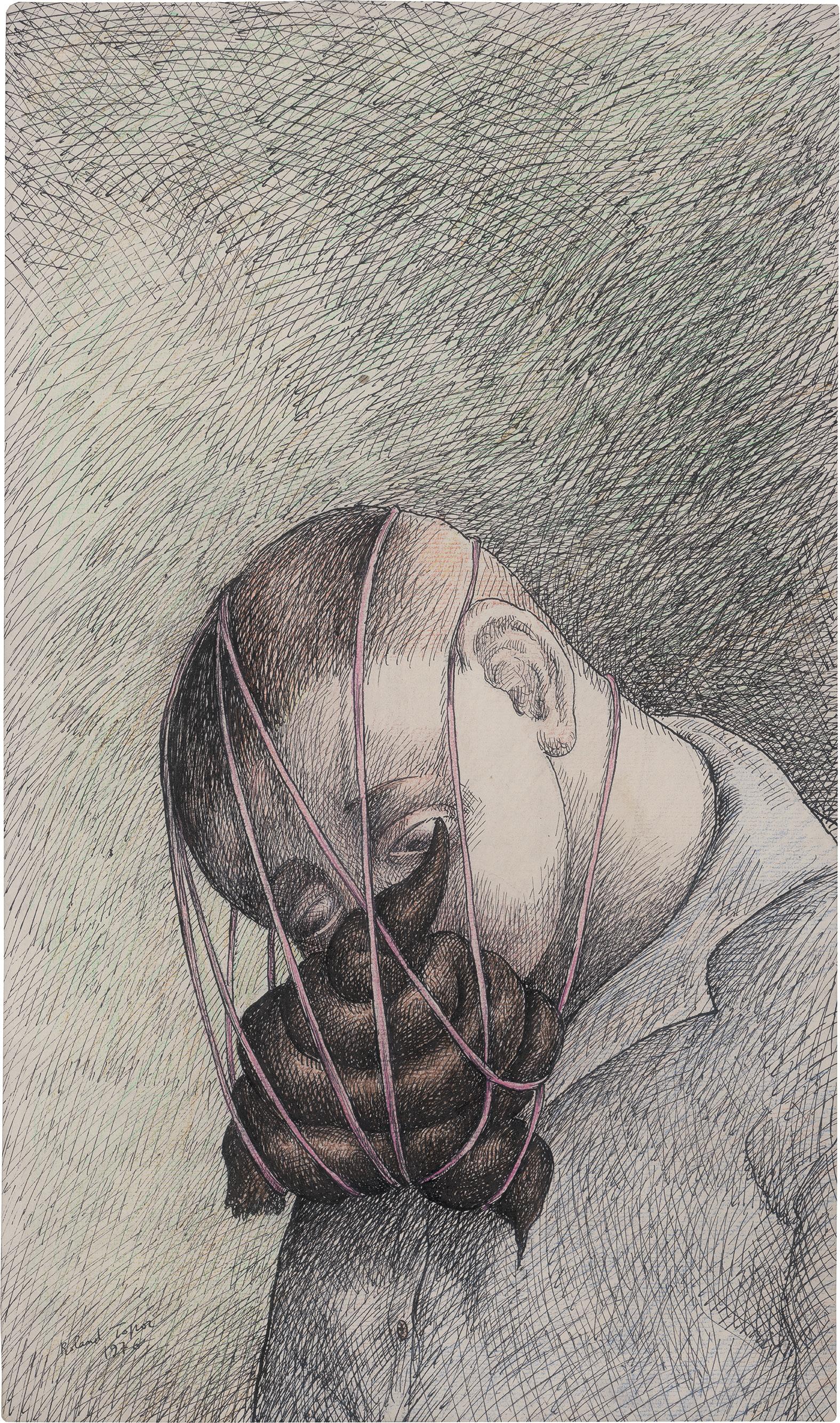
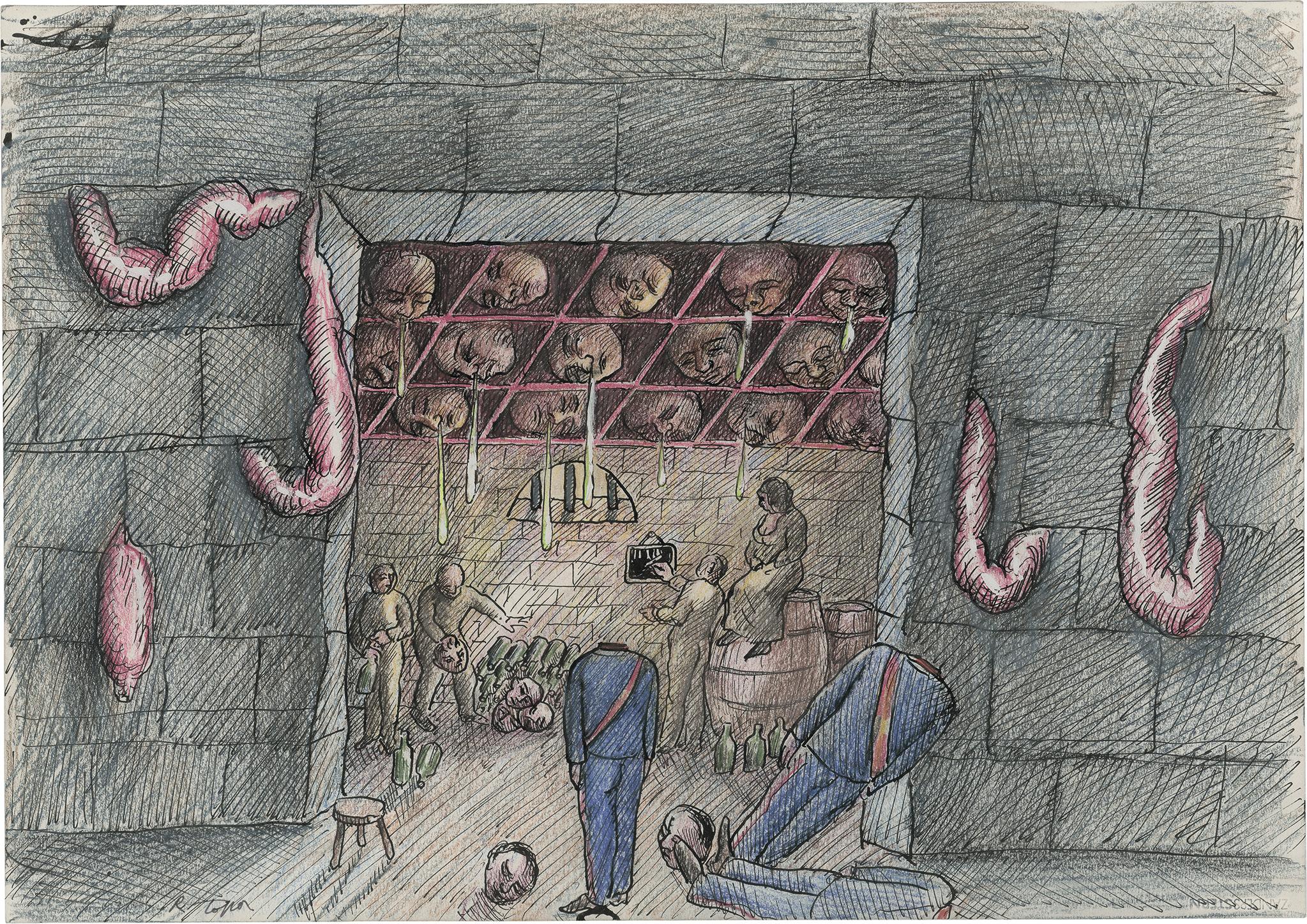
roland topor (1938–1997, Paris)
7296 Chanel no 5
Feder in Schwarz und farbige Kreiden auf Velin. 1976. 47 x 27,5 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Roland Topor“ und datiert.
2.000 €
Zeichnung zu Topors Lithographie gleichen Titels, veröffentlicht in der Revue Kamikaze Nr. 1, Christian Bourgeois, Paris 1976. Das Multitalent Topor war nach Studien an der École des Beaux-Arts in Paris Maler, Dichter, Zeichner, Bühnenbildner, Dramatiker, Regisseur, Schauspieler, Liedermacher, Trickfilmer und Plakatgraphiker. „Roland Topor ist ein menschliches Feuerwerk, das in alle Richtungen sprüht, krachend und aufrüttelnd, unterhaltsam und erschreckend.“ (Ronald Searle, zit. nach diogenes.ch, Zugriff 01.04.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
7297 Ohne Titel
Feder in Schwarz, Deckweiß und farbige Kreiden auf Zanders-Stern-Velin. 1976.
29,6 x 41,7 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „R Topor“.
1.800 €
Scheinbar empfindungslos zeichnet Topor eine Art Schlachthaus, hält das Unfassbare im Bild fest, die monströsesten Gedanken. „Diese Welt kennt eine Rettung nur durch den Witz und Topors Freude an der Komik. Er ist kein Exhibitionist, der sich seinen einsamen Übungen in der Öffentlichkeit hingibt, sondern ein empfindsamer Einzelgänger, der die Brüchigkeit unseres Geistes aufzeigen will.“ (Ronald Searle, in: Topor Tod und Teufel, Ausst.Kat. Müchen u.a. 1985, S. 42).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

paul flora
(1922 Glurns/Südtirol – 2009 Innsbruck)
7298 „Old Hemingway in den Lagunen“
Feder in Schwarz auf rauem Bütten. 1984.
28 x 31,5 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „FLORA“ und datiert, unten links betitelt.
1.500 €
Eine kristalline Welt entsteht aus den charakteristischen Schraffuren des großen Karikaturisten. „Hell und licht ist sein Universum, von ausgelassener Schwebelust erfüllt und zugleich ein Paradies der Schatten. (...) Und immer wieder die Landschaft am Meer, mysteriös und klar, klirrend, dunstig, darin die unendliche Linie der Natur, Horizont und Ufer, die alles trennt und alles miteinander verbindet.“ (Benedikt Erenz, Nachruf Paul Flora, in: Die Zeit, 18.05.2009, zeit.de, Zugriff 01.04.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

paul flora
7299 „Säuferasyle mit weißen Mäusen“
Feder in Schwarz und farbige Kreiden auf rauem Bütten. 1984.
30 x 40 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „FLORA“ und datiert, unten links betitelt.
2.200 €
Melancholie und Humorvolles halten sich die Waage in Paul Floras Zeichnung. „Über allem aber die Heiterkeit des Weisen, mit skeptischer Menschenfreundschaft, und zuweilen beißender Schärfe.“ (Norbert Denkel , Die Zeit, 19.05.2009, zeit.de, Zugriff 01.04.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
paul flora
7300 „RABENELTERN (III)“


Feder in Schwarz und farbige Kreiden auf rauem Bütten. 1985.
30 x 40 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „FLORA“ und datiert, unten links betitelt.
2.200 €
Phantastisch verschmelzen Figuren und Vogelvolieren miteinander, es scheinen die üppigen Körper der Rabeneltern aus dünnem, durchscheinendem Drahtgeflecht zu bestehen, in dem die munteren Raben gefangen sitzen. Die Figur des Raben mit großem Schnabel gehört zum festen Personal in Paul Floras Bilderfindungen.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
7301 „EIN KILLER“
Feder in Schwarz und Graphit auf rauem Auvergne-Bütten 1986.
33 x 42 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „FLORA“ und datiert, unten links betitelt.
2.200 €
Neben seinen Arbeiten für Die Zeit seit den 1960er Jahren machte sich Paul Flora auch als freier Zeichner einen Namen. „Hier scheint die Linie des Lebens und der Schönheit (und der Kunst) zu verschwimmen und sich aufzulösen. Tod und Leben gehen ineinander über, der Tag erlischt, die Nacht beginnt zu leuchten.“ (Benedikt Erenz, Nachruf Paul Flora, in: Die Zeit, 18.05.2009, zeit.de, Zugriff 01.045.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
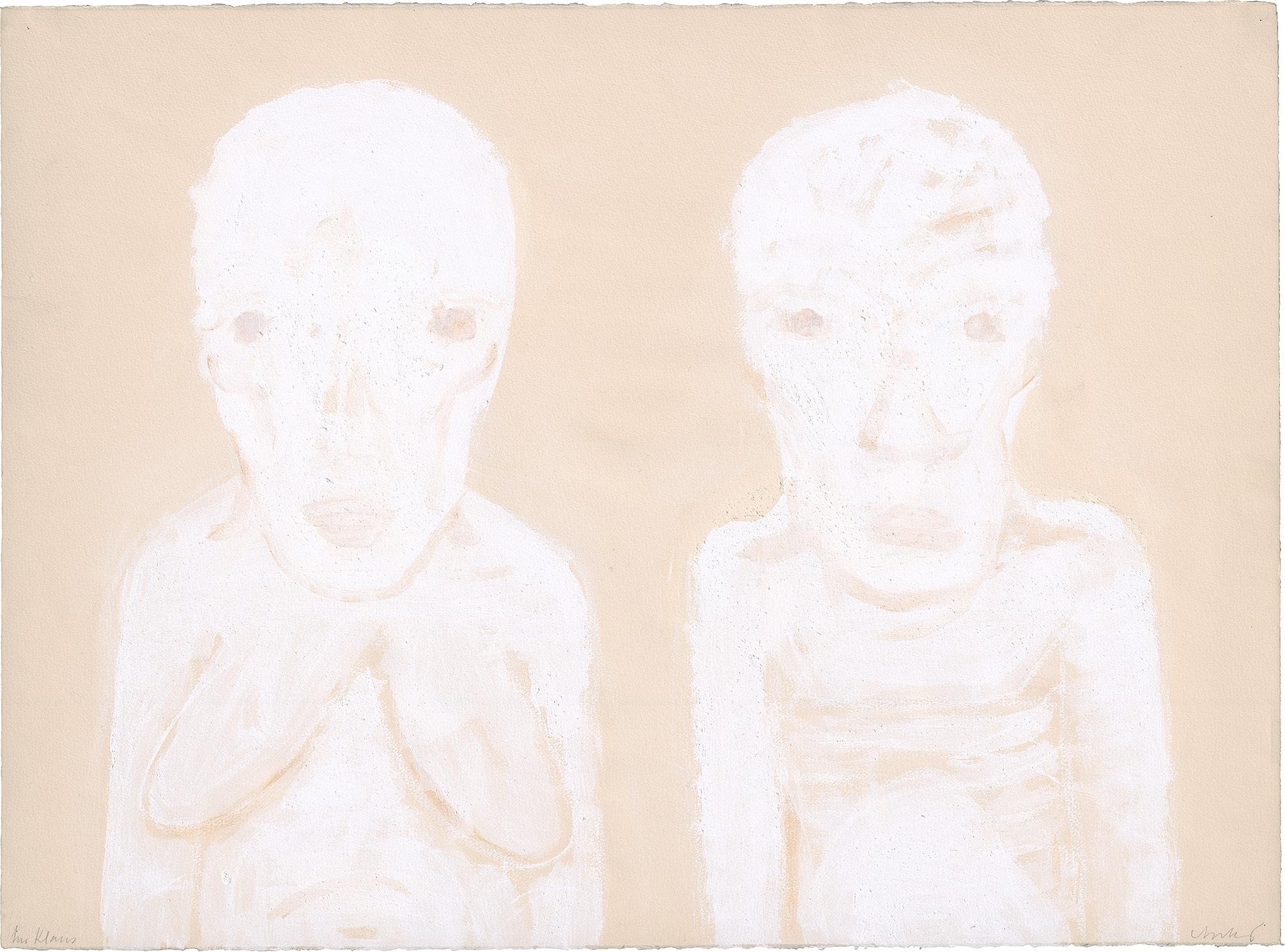
horst antes
(1936 Heppenheim, lebt in Berlin, Karlsruhe und Florenz)
7302 Doppelportrait
Gouache auf dickem Arches France-Velin. 1985.
56,5 x 76,2 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Antes“, unten links gewidmet „für Klaus“, verso datiert und mit der Ortsbezeichnung „Sicellino“.
2.500 €
Antes gilt als Mitbegründer der neuen figurativen Malerei in Deutschland. In dieser zarten frühen Arbeit eines Doppelportraits von Mann und Frau lassen sich teils realistische, teils maskenhafte Züge erkennen, die ein wenig an seine typischen Kopffüßler erinnern.
Provenienz:
Sammlung Klaus Kanstinger, Freiburg (als Geschenk vom Künstler erhalten)
horst antes
7303 Figur nach links
Bleistift und Faserstift in Schwarz mit collagierter PVCFolie auf Velin.
32 x 24 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Antes“.
1.200 €
Charakteristisch für Antes‘ Gestalten steht die männliche Figur auf soliden, überproportionierten Beinen, die an seine Kopffüßler denken lassen. Die Betonung des Profilkopfes verstärkt sich durch die darüberliegende, mit gelblichem Flüssigklebstoff zentral auf der Wange befestigte transparente Folie.
Provenienz:
Lempertz, Köln, Auktion 617, 10.12.1986, Lot 17
Privatbesitz Hessen


horst antes
7304 Weiblicher Akt nach links
Bleistift auf glattem Maschinenpapier. 1972.
35 x 25 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Antes“.
1.200 €
Charakteristische Figur des Künstlers, mit ihrem gedrungenen Körperbau an seine Kopffüßler erinnernd. Linear erfasst Antes den stehenden weiblichen Akt, dessen Kopf er, wie immer, im Profil zeigt, so dass die Unnahbarkeit der Gestalt gewahrt bleibt. Auf der Linie, die den Raum andeuten könnte, scheint die Figur zugleich wie auf einem Seil zu balancieren.
Provenienz:
Galerie Beyeler, Basel (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet und mit der Nummer 7573) Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 292, 25.06.1992, Lot 10 Privatbesitz Hessen

klaus fussmann
(1938 Velbert, lebt in Berlin und Gelting)
7305 Ohne Titel („Käuzchensteig H.“) Öl auf Velin. 1974.
69,5 x 71 cm.
Oben mittig mit Bleistift signiert „Fußmann“, rechts datiert und bezeichnet „Berlin“, links betitelt „Käuzchensteig H.“.
4.000 €
Das Motiv der Hella K. im Atelier Käuzchensteig fand auch in Fußmanns Druckgraphik Verwendung; 1975 entstand die Radierung „Hella K. in Gelb“, die in Motiv und Komposition weitgehend dem Gemälde entspricht (Fußmann 47). Nach einem Studium an der Folkwangschule in Essen ging Klaus Fußmann von 1962 bis 1966 an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Er ließ sich
von der lebendigen, außergewöhnlichen Atmosphäre, die in der geteilten Stadt in den 1960er und 1970er Jahren herrschte, inspirieren. Tristesse und Existenzialismus, denen er in verlassenen Wohnungen und leeren Räumen begegnete, fanden Einzug in seine Gemälde. Das vorliegende frühe Interieur von 1974, entstanden im berühmten Künstleratelier im Dahlemer Käuzchensteig, atmet diese Phase des Künstlers. Der karge Raum ist allein durch die Figur der gelb gekleideten Frau belebt. In pastos gestalteten Flächen formuliert Fußmann mit den charakteristischen, schräg und mit fast gestischer Heftigkeit gesetzten Pinselstrichen feinste Abstufungen von Grau, die lebendig und fast sinnlich wirken. Fußmann schloss sich nie einer Strömung an, sein Werk blieb autark.
Provenienz:
Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin (direkt beim Künstler erworben)

klaus fussmann
7306 „Grunewald“
Öl und Bleistift auf festem Velin. 1974.
61,5 x 71 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „Fußmann“ und datiert „Berlin, März 74“ sowie betitelt.
2.500 €
Vom Wind gepeitscht zeigt sich der Berliner Grunewald im Vorfrühling in Fußmanns früher Arbeit von kühler Schlichtheit: Der dynamische Pinselduktus und die zurückhaltende Tonalität verdeutlichen das kalte, unwirtliche Wetter, während die mit hauch-
feinen Farbnuancen abgemischten Grautöne doch einen zarten Hauch von Frühling erahnen lassen. Silbrige Bleistiftlinien akzentuieren die im fahlen Licht schimmernden, kahlen Äste und zeugen von Fußmanns meisterlicher Erfassung der Naturerscheinungen. Bereits 1974, im Entstehungsjahr der vorliegenden Arbeit, trat der Künstler seine Professur an der Berliner Hochschule der Künste an.
Provenienz: Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin (direkt beim Künstler erworben)


pavel feinstein (1960 Moskau, lebt in Berlin)
7307 Stilleben mit Flieder auf Rot Öl auf Leinwand. 1984.
65 x 81 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „PAVEL“ und datiert, verso erneut mit Filzstift in Schwarz signiert „Pavel“, datiert und dreifach mit der Werknummer „195“. 1.000 €
Feinstein legt einen besonderen Fokus auf Farbe und deren Ausdruck sowie die Wirkung von Hell-Dunkel-Kontrasten, wie im vorliegenden Bild zu beobachten. Der Künstler war 1980 nach Berlin emigriert und hatte bis 1985 an der Hochschule der Künste studiert, später als Meisterschüler von Gerhart Bergmann. Seine erste Einzelausstellung fand 1986 in der Berliner Galerie Taube statt.
7308 Stilleben mit Flieder und roten Früchten Öl auf Leinwand. 1984.
60,5 x 80 cm.
Unten links mit Pinsel in Weinrot signiert „PAVEL“ und datiert, verso erneut mit Filzstift in Schwarz signiert „Pavel“, datiert und mit der Werknummer „158“.
1.000 €
Farbstark, vorwiegend Rot und Blau, sowie impulsiv im Pinselstrich präsentiert sich dieses frühe Stilleben Feinsteins. Sein großes Vorbild von Cézannes Stilleben und dessen Farbmodulation wird hier in den fließend veränderten Farbtonübergängen, etwa im Obst oder der Kanne, sichtbar.
marcel mouly (1918–2008, Paris)
7309 „Le Chevalet bleu“ Öl auf Leinwand. 1976.
35 x 24 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Blau signiert „M. Mouly“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals signiert, datiert, betitelt und bezeichnet „Paris“.
1.800 €
In der abstrahierten Komposition zeigt sich Mouly als großer Kolorist. In seinem malerischen Schaffen als Autodidakt ist er beeinflusst vom Kubismus Jacques Lipchitz‘ und Pablo Picassos sowie von den tiefen, kräftigen Farben, die typisch für Matisses fauvistische Werke waren. 1945 wurden Moulys Gemälde neben denen von Matisse im Salon d‘Automne in Paris ausgestellt. Im folgenden Jahr zog er nach La Ruche, wo er sich mit Picasso, Chagall und Klein anfreundete und im Salon du Mai ausstellte.
Provenienz: Privatbesitz Schweden

7309

7310
harald metzkes
(1929 Berlin, lebt in Wegendorf bei Berlin)
7310 Ländliche Gastwirtschaft
Öl auf Leinwand. 1969.
60 x 80 cm.
Oben links mit Pinsel in Rot signiert „Metzkes“ und datiert, darunter (unter UV-Licht erkennbar) helle weitere Signatur und Datierung, verso auf dem Keilrahmen nochmals datiert „12.6.69“.
4.500 €
Sonderbar und leicht verschoben erscheinen die Proportionen und Physiognomien der dargestellten Personen, beinahe naiv aufgefasst und jedenfalls irritierend. Der anheimelnde, sich zum Freien hin öffnende Innenraum der ländlichen Gastwirtschaft

schimmert und entfaltet sich um sie herum in delikat abgetönten, warm leuchtenden Farbnuancen, deren Konturen weich erscheinen und der Darstellung einen traumartig-dunstigen Charakter verleihen. „Zum einen artikuliert sich so der ästhetische Aspekt seines Tuns als ethischer Anspruch, zum anderen wird das Bildverständnis auf seiner ganz elementaren Ebene durchgeführt: Form ist Mitteilung. Die Magie eines Bildes entsteht nicht mit dem, was darauf, sondern primär, wie etwas dargestellt ist. Zuspitzend sagt Metzkes, das ‚Wie‘ sei der ‚Träger des Wahns‘ im Bilde.“ (harald-metzkes.de, Zugriff 27.03.2025).
Provenienz:
Atelier des Künstlers (1989 dort erworben)
Privatsammlung Berlin Privatsammlung Berlin (seit 2020)
7311 Wüste
Öl auf Leinwand, auf Hartfaserplatte kaschiert. 1977. 47,5 x 81,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Metzkes“ und datiert.
1.500 €
„Die Arbeit nach der Natur ist kein Hilfsmittel, sie dient der Objektivierung der Vorstellung.“ (harald-metzkes.de, Zugriff 28.03.2025) Auf einer Reise in die Mongolei erfasste Metzkes in diesem frühen Gemälde mit breitem, schwungvollem Pinselduktus die Weiten der Wüste Gobi unter verschiedenen Lichteinwirkungen.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
harald metzkes
7312 Stilleben mit Teekanne Öl auf Hartfaser. 1982.
35,5 x 50,3 cm.
Oben links mit Pinsel in Türkis signiert „Metzkes“ und (schwer lesbar) datiert.
2.200 €
Hell schimmern die Bildgegenstände auf dem dunklen Untergrund, die Kanne mit ihren asiatisch anmutenden Mustern, das geheimnisvoll in Papier eingewickelte Objekt rechts und die grüne Pflanze in der Bildmitte dazwischen in ausgewogener, harmonischer Komposition angeordnet. Lebendig ist dagegen die Farboberfläche durchgestaltet, so dass das einfallende Licht die Bildfläche in Bewegung zu setzen scheint.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
7313 Picknick an der Quelle Öl auf Leinwand. 1987.
60 x 70 cm.
Oben links mit Pinsel in Hellgrau signiert „Metzkes“ und datiert.
3.500 €

Harald Metzkes, früherer Meisterschüler von Otto Nagel in Berlin, gilt als Begründer und Hauptvertreter der sogenannten „Berliner Schule“ und hat sich niemals vom Sozialistischen Realismus der DDR-Kunstpolitik vereinnahmen lassen.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

friedensreich hundertwasser
(d.i. Friedrich Stowasser, 1928 Wien – 2000 auf einer Schiffsfahrt im Pazifik)
7314 Good Morning City Farbserigraphie mit Metallprägung auf CM FabrianoVelinkarton. 1969.
76,2 x 49,2 cm (84,6 x 55,7 cm).
Signiert „Friedensreich“ sowie datiert und mit der Ortsbezeichnung „am 13. November in Rom“. Auflage 10000 num. Ex. Koschatzky 41.
1.200 €
Eines von 8000 Exemplaren der Normalausgabe in 40 Farbvarianten zu je 200 Abdrucken. Die Gesamtauflage von 10.000 Exemplaren wurde in drei Auflagen geteilt, neben zwei Normalausgaben erschien zudem eine Phosphorausgabe. Gedruckt bei Studio Quattro, Campalto-Venedig, verlegt von Dorothea Leonhardt, München, unten mit deren vier Prägestempeln. Mit den beiden japanischen Rotstempeln (inkan). Unser Blatt aus der Serie B B, Blue Yellow. Prachtvoller Druck in leuchtender Farbigkeit, mit dem vollen Rand, links mit dem Schöpfrand.
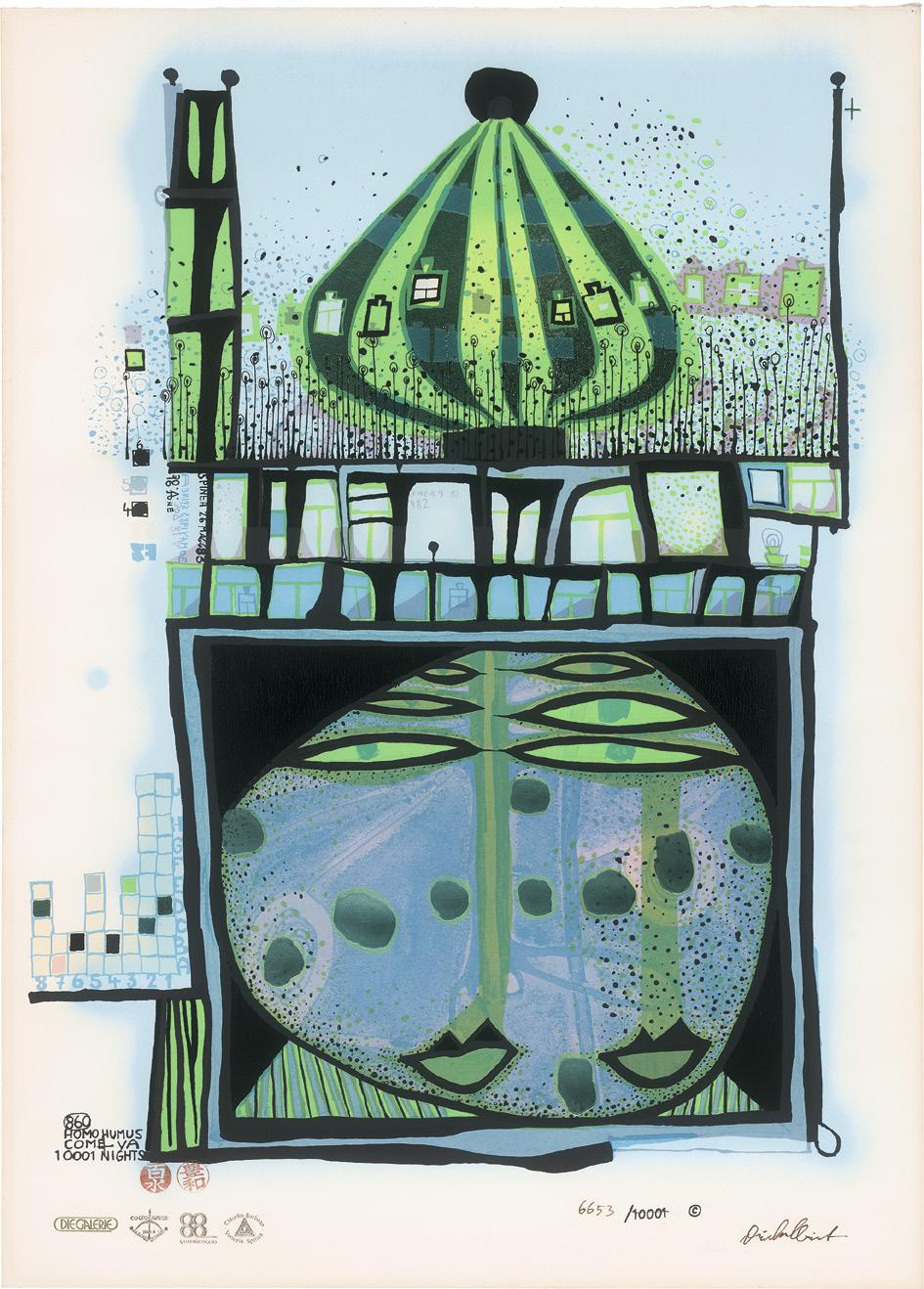
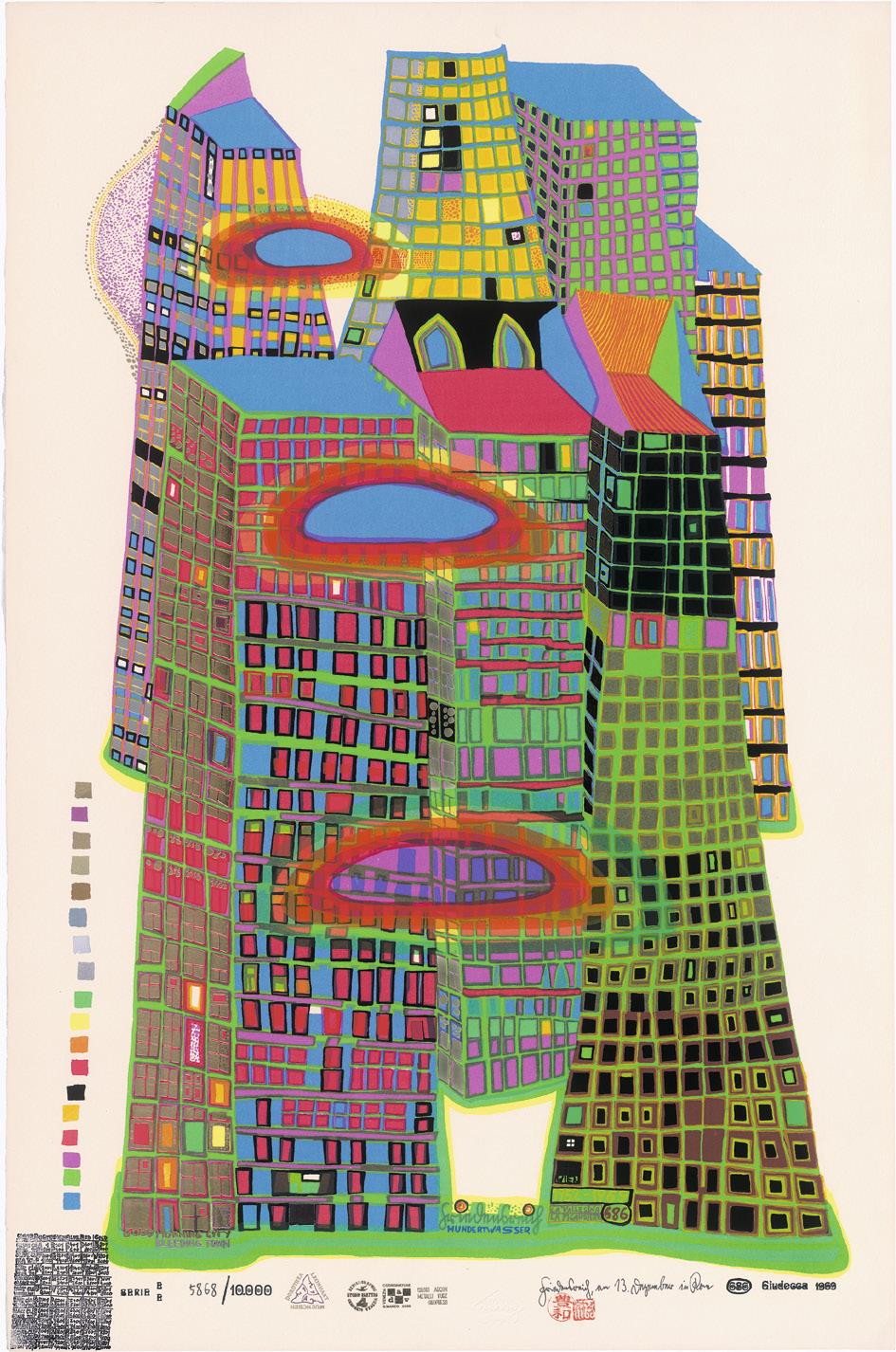
friedensreich hundertwasser
7315 10 002 nights Homo Humus come va how do you do Fotolithographie und Farbserigraphie mit Metallprägung auf festem Fabriano-Velin. 1984.
63 x 43,5 cm (69 x 49,9 cm).
Signiert „Dunkelbunt“. Auflage 10002 num. Ex. Koschatzky 83.
1.000 €
„Die Idee, 10 000 verschiedene Varianten herzustellen, von jeder Farbkomposition also nur eine, faszinierte den Künstler. Es war wie eine Erfüllung seiner Wunschvorstellung von Graphik, möglichst viele Blätter als Unikate zu schaffen und an möglichst viele Menschen heranzubringen.“ (Koschatzky S. 194). Gedruckt bei Quattrifoglio, Claudio und Giuseppe Barbato, Spinea-Venedig, verlegt von Die Galerie, Offenbach am Main. Mit zwei japanischen Rotstempeln (inkan) unten mittig. Verso mit der gedruckten Auflistung der Arbeitsvorgänge und Varianten. Der technisch höchst anspruchsvolle Farbdruck, hier in der Variante Grün/Blau/Schwarz/ Rosa, in einem prachtvollen Druck mit dem vollen Rand, oben mit dem Schöpfrand.

friedensreich hundertwasser
7316 Pazifikdampfer
Farbholzschnitt auf festem Japanbütten. 1985.
52 x 39,5 cm (57,2 x 43 cm).
Signiert „Regentag Dunkelbunt“, datiert und mit der eingekreisten Werknummer „868 A“. Auflage 999 num. Ex. Koschatzky 85.
2.000 €
Entstanden nach dem in Tahiti geschaffenen Aquarell „Pacific Steamer“, 1984, das die Werknummer „868“ trägt. Gedruckt bei Akio Shimizu, Uchida Moto Han, Kyoto, verlegt von Gruener Janura, Glarus. Mit den fünf japanischen Stempeln (inkan). Prachtvoller, fein nuancierter Druck in 30 Farben, verso ein leichtes Relief erzeugend, mit dem vollen Rand, an drei Seiten mit dem Schöpfrand.

friedensreich hundertwasser
7317 Fluss unter Dach Farbholzschnitt mit Metalldruck auf Japan. 1985/87. 50,2 x 37,5 cm (56,5 x 43,2 cm).
Signiert „Hundertwasser“, datiert, bezeichnet „Wien“ und mit der Werknummer „763A“. Auflage 200 num. Ex. Koschatzky 86.
3.000 €
Mit zwei japanischen Stempeln (inkan) sowie Farbauszugspunkten rechts. Gedruckt von Matashiro Uchikawa, Tokio, geschnitten von Horishi Maeda, Tokio, und herausgegeben von Gruener Janura, Glarus. Prachtvoller, klarer Druck in harmonisch abgestimmter, leuchtender Farbigkeit mit dem vollen Rand, an drei Seiten mit dem Schöpfrand.
friedensreich hundertwasser
7318 Die Hüte tragen die japanischen Kaiser Farbholzschnitt auf Japan. 1985/87.
49,5 x 40,5 cm (57 x 42,5 cm).
Signiert „Hundertwasser“, datiert, bezeichnet „Vienna“ und mit der Werknummer „844A“. Auflage 300 num. Ex. Koschatzky 89.
3.000 €
Exemplar der „White Sky“-Auflage, neben der weitere 150 Exemplare in der „Red Sky“-Edition erschienen. In der Numerierung von den Angaben bei Koschatzky abweichend, hier 300 statt 200 Exemplare. Mit zahlreichen japanischen Stempeln (inkan) und 22 Farbauszugspunkten links. Prachtvoller Druck in leuchtender Farbigkeit mit dem vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.


friedensreich hundertwasser
7319 In Gamba
Fotolithographie und Siebdruck mit Metallprägung auf festem glatten Fabriano-Velin. 1990.
66,9 x 45,5 cm (69,9 x 50 cm).
Signiert „Regentag“, datiert und bezeichnet „Wien“. Auflage 905 num. Ex. Koschatzky 104.
1.200 €
Eines von 905 Exemplaren gedruckt bei Claudio Barbato, Spinea (Siebdruck), Quattrifoglio (Fotolithographie) and Giuseppe Barbato (Metallprägungen) Spinea/Venice, koordiniert von Alberto della Vecchia, Venedig, mit deren vier Prägestempeln. Mit den beiden japanischen Rotstempeln (inkan). Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
jirí anderle
(1936 Patlikov, Böhmen, lebt in Prag)
7320 Quid sit futurum cras, fuge quaerere I Farbradierung mit Roulette und Vernis mou auf Hahnemühle-Velin. 1976/83.
93 x 63 cm (95,8 x 65,3 cm).
Signiert „Anderle“ und bezeichnet „e.(preuve d‘)a.(rtiste)“ sowie betitelt „HORATIUS: Strèz septat, co bude zitka!! (I) (...)“. Auflage 30 röm. num. Ex. Spangenberg 79 (WV 258).
1.100 €
„Hüte dich zu fragen, was morgen sein wird!“ lautet der lateinische Ausspruch übersetzt; er stammt von dem Dichter Horaz und gab dem Zyklus Anderles seinen Titel. Die Gesamtauflage betrug 100 Exemplare. Prachtvoller Druck mit schönem Plattenton und dem vollen, kleinen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.


jirí anderle
7321 Turm zu Babel, oder: Hommage to Milan Sládek Farbradierung mit Vernis mou auf Velin. 1985. 66 x 48,3 cm (81 x 64 cm).
Signiert „anderle“. Auflage 50 num. Ex. Nicht bei Spangenberg (WV 303).
800 €
Großformatiges Blatt, gewidmet dem Pantomimen, Regisseur und Autor Milan Sládek. Prachtvoller, farblich fein abgestimmter Druck mit dem vollen Rand.

jirí anderle
7322 „Andromeda und Perseus“ Öl, Goldbronze, Feder, Rötel und Gips auf Leinwand, auf Leinwand collagiert. 1981. 110 x 90 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Anderle“ und datiert bzw. mit der Werknummer „67/81“, verso mit Kreide in Schwarz betitelt sowie bezeichnet „31“ und „67/81“. 8.000 €
In einer dicken Gipsschicht modelliert Anderle reliefhafte Strukturen, die auf der Leinwand sitzen und ihr stellenweise eine krümelige Oberfläche verleihen, teils auch mit Rissen und Ausbrüchen die Leinwand wieder freigeben. Mit der Federspitze kratzt er ein Gespinst mäandernder weißer Linien in die dunkle Farbe, das von der oberen, dunklen Bildhälfte seine Ausläufer in Rötel bis zu den beiden Gestalten von Andromeda und Perseus im hellen unteren Bereich zieht. Die raffinierte technische Gestaltung ebenso wie die
souveräne Erfassung der Figuren betonen im Wechselspiel miteinander die psychologische Tiefe der Darstellung. Jiøí Anderle wurde in eine Generation hineingeboren, die das Trauma des Zweiten Weltkriegs erlebte und unter dem anschließenden streng kommunistischen Regime in Tschechien lebte und arbeitete. Aufgrund seiner Tätigkeit für das Schwarze Theater in Prag hatte der Künstler die Möglichkeit, das Land zu verlassen und die Welt zu bereisen. So kam Anderle in Kontakt mit der internationalen Kunstgeschichte und rezipierte die Meister der Kunstgeschichte vielfach in seinem Werk. Mit den Figuren Perseus und Andromeda beschäftigte sich Anderle im Jahr 1981 auch in seinem Radierwerk im Rahmen des Zyklus „Antiquity“ (vgl. Spangenberg 63 und 64, WV 185 und 186).
Provenienz:
Baukunst Galerie, Köln (mit deren Klebeetikett auf der Spannrahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet)
Nachlass Milan Sladek, Köln

albin brunovsky (1935 Zohor – 1997 Bratislava)
7323 Sny (Chvála Zamotanych Snov)
8 Radierungen und Begleittext auf 6 gefalteten Bögen Velin sowie 2 Bögen Titel und Impressum. Lose in Orig.Kartonmappe. 1985. 48 x 32 cm (Blattgröße, gefaltet).
Die Radierungen jeweils signiert „Brunovsky“, im Impressum bezeichnet „aut 3“.
3.500 €
Surrealistisch-traumhafte Kompositionen von großer Komplexität und technischer Virtuosität. Seine souverän gehandhabte Radiertechnik ermöglicht Brunovsky feinste Details und überzeugende Übergänge und Schattierungen. Sieben Gedichte slowakischer Autoren ergänzen die Radierungen. Das Mappenwerk erschien in einer deutschen und einer tschechischen Ausgabe in unbekannter Auflagenhöhe mit variierenden Radierungen. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand. Selten
Provenienz: Nachlass Milan Sladek, Köln

jacek yerka
(d.i. Jacek Kowalski, 1952 Torún) 7324 „Wieza Babel III“ Öl auf Leinwand. 1989. 65 x 73,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „Jerka“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Filzstift in Schwarz signiert „Jacek Jerka“ und betitelt.
9.000 €
Jacek Yerka ist ein erfolgreicher zeitgenössischer Künstler aus Polen, der seit 1980 als Maler tätig ist. Seine Bildmotive sind stets surrealistisch und von bedeutenden niederländischen Altmeistern des Spätmittelalters bzw. der Renaissance wie Hieronymus Bosch,
Pieter Bruegel, Jan van Eyck und Hugo van der Goes geprägt. Es finden sich phantastisch-surrealistische, meist unbelebte Traumlandschaften mit außergewöhnlicher Architektur neben Darstellungen skurriler Tiere und von Orten seiner Kindheit, wie etwa der Küche seiner Großmutter. Nach freundlicher Auskunft von Konrad Szukalski, Warschau, begann Jacek Yerka um das Jahr 1992 herum, mit Y zu signieren. Unser eindruckvolles Gemälde widmet er dem biblischen Thema des Turmbaus zu Babel: Menschenleer und vor bedrohlicher, dunkler Gewitterwolkenkulisse erstrahlt der brennende Turm in wunderbar expressivem Kontrast.
Provenienz: Galerie Conen, Oberhausen (dort in den 1980er Jahren erworben) Privatbesitz Berlin

aliute mecys (1943 Koblenz – 2013 Hamburg)
7325 Maskenball Öl auf Spanplatte. 1984.
70 x 50 cm.
Unten links mit Pinsel in Grau signiert „MECYS“ und datiert.
4.000 €
Aliute Mecys bezeichnet ihren Stil selbst als „Irrealismus“. In ihren verstörenden Bildwelten rüttelt sie den Betrachter mit ihrer poe-
tischen Einbildungskraft immer wieder erneut auf. Dabei sind Tod und Krieg allgegenwärtige Motive im Schaffen der Künstlerin. Auch in dieser Komposition wandeln marionettenhafte Gestalten über ein Schlachtfeld, in welchem sich bereits die Ratten ausgebreitet haben.
Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)

aliute mecys
7326 „Kinderspiel“
Acryl, Tempera und Öl auf Karton, auf Hartfaser kaschiert 1986.
70,4 x 49,8 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „MECYS“ und datiert.
4.000 €
„Das Thema Krieg wird auch in dem Bild mit dem bezeichnenden Titel ‚Kinderspiel‘ von 1986 noch einmal aufgegriffen. - Der Titel erinnert zugleich an Pieter Bruegels Bild ‚Kinderspiele‘, die sich dagegen harmloser ausnehmen. Auf dem Bild von Aliute Mecys erscheint eine kindliche Puppe wie ein junger Kriegsgott gerüstet. Ein verkleidetes Vogelgerippe ist ihr als unheimlicher Begleiter zugestellt. Die Handgranate, die der ausstaffierte Held schwingt,
und der große zerschossene Helm sind wie Vorzeichen seines künftigen Schicksals. Auch hier könnte man wieder an konkretes Geschehen aus deutscher Vergangenheit denken. Doch zugleich wird eine Tendenz zur Allegorisierung erkennbar, die der Hauptfigur eine übergeordnete Funktion zuweist. Was als ‚Kinderspiel‘ begann, wird zum Spiel mit dem Feuer, so könnte man die Aussage des Bildes umschreiben.“ (Gerd-Wolfgang Essen, in: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990. o.S.).
Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg
Ausstellung: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990 (mit Abb., o.S.)
fritz koenig
(1924 Würzburg – 2017 Ganslberg)
7327 Paar
Medaille. Silber, massiv, geschwärzt. Wohl um 1980.
Durchmesser 7 cm.
Auf der Rückseite monogrammiert „FK“. Nicht bei Clarenbach.
1.000 €
International zählt Fritz Koenig zu den namhaftesten deutschen Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Besondere Anziehungspunkte sind seine monumentalen Skulpturen, die sich weltweit im öffentlichen Raum finden: Sein Hauptwerk ist die über 20 Tonnen schwere, fast acht Meter hohe Bronzeskulptur „Große Kugelkaryatide N.Y“ von 1967-1971, die bis zu den Terroranschlägen am 11.September 2001 zwischen den Zwillingstürmen auf dem Vorplatz des World Trade Centers in New York City stand. Charakteristisch für Koenigs Werke ist die stilisierte Darstellung der menschlichen
Form mit feinen, linienartigen Gliedmaßen wie in unserem kleinen feinen Medaillon eines liegendes Paars. Prachtvoller Guss, der Hell-Dunkel-Kontrast von Figuren und Grund eindrucksvoll herausgearbeitet.

7327
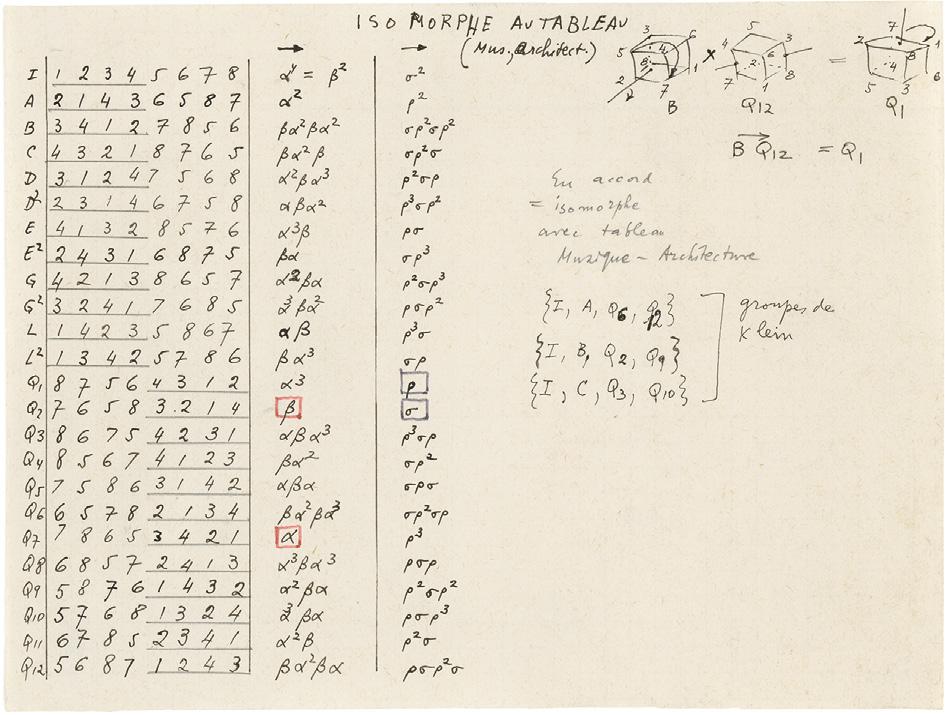
iannis xenakis
(1922 Braila, Rumänien – 2001 Paris)
7328 ISOMORPHE AU TABLEAU
Feder in Schwarz und Rot sowie Bleistift auf Velin. 1986. 13,7 x 18,5 cm.
900 €
Aufzeichnungen zur Symmetrie- bzw. Isomorphiegruppe des Würfels und zur Kleinschen Vierergruppe. Auf die Musik ebenso wie auf die Architektur bezieht Xenakis seine Berechnungen zu isomorphen Erscheinungen. Isomorphie herrscht in der Musik beispielsweise zwischen Notenschrift und gespielter Musik, da sich beider Strukturen wechselseitig abbilden. Aus zufälligen Phänomenen wie Regen, einer Menschenmasse oder einem Bienenschwarm entwickelte Xenakis ab 1954 die stochastische Musik als ganz eigenen Musikstil. Mathematische, geometrische, architektonische oder philosophische Prinzipien wie Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Zufallsverteilungen oder die Chaostheorie fließen in seine Kompositionen, elektronischen Skulpturen und Installationen ein.
Provenienz: Geschenk des Künstlers
Sammlung Henning Lohner, Berlin

frédéric benrath
(d.i. Philippe Gérard, 1930 Chatou – 2007 Paris) 7329 „Abstraction dominante bleue“ Öl auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 1983. 99,5 x 99,5 cm.
Verso mit Faserstift in Blau signiert „F. Benrath“ und datiert, auf dem Keilrahmen mit dem Stempel des Künstlers, dort mit Bleistift betitelt und bezeichnet.
1.200 €
Im nahezu monochromen, fein abgestuften und abgetönten Blau entwickelt der Bildraum eine frappierende Tiefe, er impliziert das Schwebende einer Wolkenformation, eine flirrende Weite. Völlig abstrakt gehalten, scheint das Gemälde eine fast geisterhafte, jedenfalls vielmehr mentale als reale Landschaft darzustellen. Eine lyrische Abstraktion und der Einfluss des Informel prägen Benraths malerisches Werk ebenso wie der Geist der deutschen Romantik.
Provenienz: Privatbesitz Schweden

mappenwerke
7330 Die Freiheit erhebt ihr Haupt 20 Bl. Druckgraphik, teils farbig. Verschiedene Techniken auf unterschiedlichen Papieren sowie 1 Doppelbl. Titel, Text und Inhalt. Lose in Orig.-Leinenportfolio. 1988. Ca. 70 x 50 cm (Blattgröße).
Jeweils signiert, meist datiert. Auflage 50 num. Ex. 3.000 €
Die Mappe erschien zum 70. Jahrestag der Revolution in Bayern und der Proklamation des Freistaates, herausgegeben von der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und dem Kunstbau München 1988. Enthält Arbeiten von Herbert Achternbusch, Hans M Bachmayer, Hans Baschang , Ugo Dossi, Günther Förg , Rupprecht Geiger, Albert Hien, Franz Hitzler, Karl Imhof, Clemens Kaletsch, Wolfram Kastner, Stefan Kern, Thomas Lehnerer, Urs Lüthi, Peter Mell, Gerhard Merz, Johannes Muggenthaler, Aribert von Ostrowski, Dagmar Rhodius und Bernd Zimmer

robert schad (1953 Ravensburg, lebt in Frankreich und Portugal)
7331 Ohne Titel
Vierkantstahl, geschwärzt, und Tuch. Um 1983.
Ca. 40 x 34 x 23 cm.
1.200 €
Entstanden in der Endphase von Schads Werkgruppe aus Stahl und Stoff. „Dem Maß meiner Hand entspricht das Maß des Stahls, mit dem ich im Innenraum arbeite. Mit massivem, industriell vorgefertigtem, also handelsüblichem massivem Solid square steel schaffe ich Linien. Wo sich die Stababschnitte treffen, entsteht der Eindruck von körperlicher Gelenkigkeit und möglicher Bewegungsfähigkeit. Meine Linien sind Chiffren meiner eigenen körperlichen Befindlichkeit. Sie umschreiben Raum, sind Seismogramm linearer Verläufe.“ (robertschad.eu, Zugriff 24.03.2025).
Provenienz:
Ehemals Sammlung Robert Häusser, Mannheim Privatbesitz Wiesbaden

nam june paik
(1932 Seoul – 2006 Miami)
7332 TV-Gerät mit Foto-Negativen Deckweiß auf dunkelbraunem Karton. 1988.
50 x 70 cm.
1.500 €
Der amerikanisch-koreanische Künstler und Komponist Nam June Paik gilt als Vater der Video- und Medienkunst. Durch Fluxus-Konzerte und Performances erlangte er in den frühen 1960er Jahren internationale Bekanntheit. In der bedeutenden Ausstellung „Exposition of Music - Electronic Television“ in der Wuppertaler Galerie Parnass 1963 thematisierte er den Übergang von Musik zum elektronischen Bild. Zentrales Motiv seiner Werke ist das TV-Gerät als Kunstobjekt, welches er in dieser Zeichnung humorvoll in der Kombination mit vier Fotonegativen darstellt.
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)
7333 Paik Video (Edith Decker)
2 Bl. Kugelschreiber in Blau auf gestrichenem Papier bzw. leichtem Karton. 1988.
44,8 x 64,8 cm; 45 x 63 cm.
Beide mit Kugelschreiber in Blau signiert „PAIK“ und gewidmet, 1 Bl. bezeichnet.
1.200 €
Nam June Paik beschäftigte sich in seinen Video-Installationen mit Plattenspielern und Tonbandgeräten, Fluxus-Objekten, Gemälden und Zeichnungen als erster intensiv mit dem Medium Fernsehen. Mit typisch humorvollen Randskizzen, u.a. Antennen eines alten Fernsehgerätes, versah Nam June Paik diese beiden Andruckbögen für die Buchpublikation „Paik Video“ von Edith Decker, herausgegeben im Dumont Verlag, Köln 1988.
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)
7334 Herzensrechnung; Schnecken
2 Bl. Pinsel in Schwarz und Filzstift in Rot bzw. Pinsel in Schwarz auf Velin. 1988.
Je 29,6 x 41,8 cm.
1.500 €
Das charmante Konvolut zweier phantasievoller Gelegenheitszeichnungen zeugt von Paiks großem Humor und Witz. Darunter die Darstellung einer Rechnung aus zwei addierten Fragezeichen, die ein Herzsymbol ergeben. Beigegeben: Zwei humorvolle Faxe des Künstlers an den Eigentümer der Zeichnungen als Fotokopien.
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)
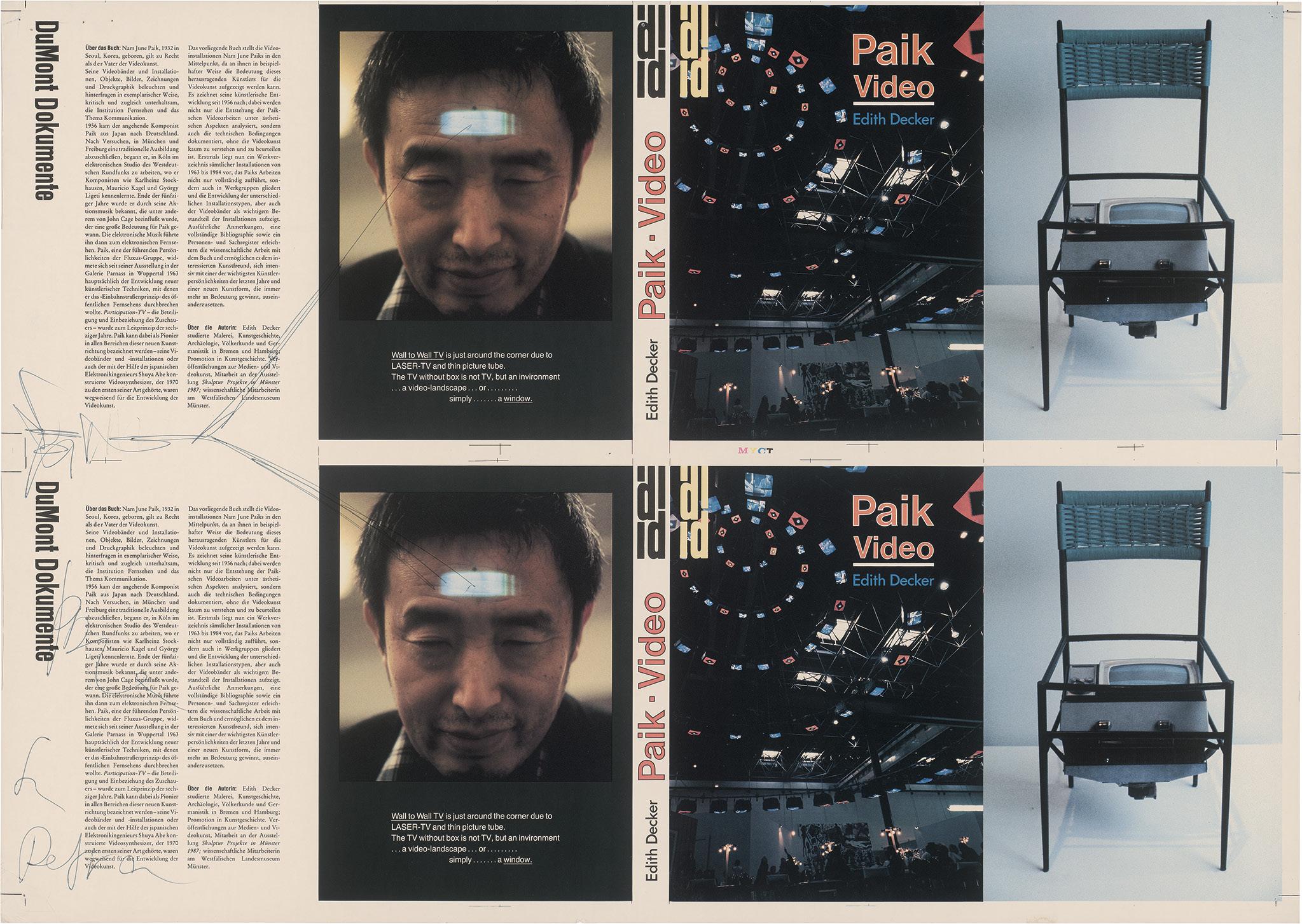


7335
sigmar polke
(1945 Oels/Schlesien – 2010 Köln)
7335 „hands up - ha ha“
Gelstift in Blau auf Maschinenpapier. 1997.
42,1 x 29,8 cm.
Unten mittig mit Gelstift in Blau signiert „Sigmar Polke“, unten rechts erneut mit Kugelschreiber in Schwarz signiert, datiert und am unteren Rand betitelt.
2.000 €
Das Motiv der Hände spielt in Sigmar Polkes Werk immer wieder eine Rolle: Auf einem Arbeitsbogen zur Buchpublikation der Ausstellung „Die drei Lügen der Malerei“, herausgegeben von der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1997, verewigte Polke humorvoll zahlreiche übereinandergelegte Hände der Mitwirkenden. Symbolisch könnte man dies als erfolgreiches Teamwork rund um die erste umfassende Monographie zum Werk des Künstlers deuten.
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)

7336 Hände mit Kleeblatt Filzstift in Rot und Grün über Farboffset auf gestrichenem Papier, auf dicken Karton kaschiert. 1997. 89 x 64 cm.
Unten mittig mit Filzstift in Rot signiert „Sigmar“ sowie u.a. bezeichnet „der erste Andruck!“.
3.000 €
Diese spannende, großformatige Gelegenheitszeichnung Sigmar Polkes entstand im Kontext seiner Ausstellung „Die drei Lügen der Malerei“ in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1997. Auf dem Andruckbogen für den Ausstellungskatalog erfasste er die Abdrücke der Hände verschiedener mitwirkender Museumsleute mit zugehörigen Benennungen.
Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)

sabine moritz (1969 Quedlinburg, lebt in Köln)
7337 Lilie
Kohle auf Velin. 1999.
59 x 42 cm.
Unten links mit Kohle monogrammiert „SM“, unten rechts datiert.
3.000 €
Motivische Serien von Rosen, Lilien und Päonien zeigen die Blumen in verschiedenen Zuständen von Fragilität. Die Lilie ist mit feinnervigen Konturlinien und minimalen Binnenstrukturen erfasst, das hauchfein angedeutete Glas links unten verleiht der Komposition eine dezente Räumlichkeit. Sabine Moritz, seit 1995 mit Gerhard Richter verheiratet, gehörte zu dessen letzter Klasse.
Provenienz:
Sammlung Henning Lohner, Berlin (direkt bei der Künstlerin erworben)
sabine moritz
7338 Lilie 35
Kohle auf Velin. 2001.
29,7 x 21 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „S.M“, unten mittig datiert, verso auf Klebeetikett typographisch bezeichnet sowie mit der Werknummer „06.0017“.
2.000 €
Ein tiefes Schwarz liegt über der zarten Blütenform, deren elegante Schwünge zwischen den festen, senkrecht und waagerecht geführten Schraffuren hindurchschimmern. Die Form scheint sich aus der abstrakten Dunkelheit zu entwickeln oder sich gegen sie zu behaupten. Sabine Moritz zeichnet seit Jahren umfangreiche Reihen von Blumenstilleben, die zum Teil von Schwärze verschluckt werden.
Provenienz:
Sammlung Henning Lohner, Berlin (direkt bei der Künstlerin erworben)


sabine moritz
7339 Rose 16
Kohle und Pastellkreiden auf Velin. 2004. 56 x 42 cm. Unten links mit Bleistift monogrammiert „S.M.“, unten rechts datiert.
3.000 €
Moritz‘ Serien von verschiedenen Blumenmotiven setzen sich mit Werden und Verfall auseinander. Hier steht die tiefschwarz übermalte und gewischte Vase in effektvollem Kontrast zur Zartheit der fein gezeichneten Pflanzen.
Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin (direkt bei der Künstlerin erworben)

cornelia schleime (1953 Berlin)
7340 Porree Öl auf Viskose. 1990–91.
275 x 63 cm.
4.000 €
Die sogenannte „Gemüseserie“ von Cornelia Schleime entstand ab 1990, während ihrer Zeit am PS1 Museum in New York City, wofür die Künstlerin ein Stipendium des DAAD erhalten hatte. Auf der Internetseite der Künstlerin erkennt man die überdimensionalen Porreestangen vor der markanten New Yorker Skyline (cornelia-schleime.de/ausstellung/new-york-1990, Zugriff 13.03. 2025). Die Künstlerin spielt dort mit der seidigen, halbtransparenten Wirkung der ungrundierten Bildträger, die sie den massiven Beton-Bauwerken von New York gegenüberstellt. Pastosität kontrastiert mit glatter Fassade und doch spiegelt sich die äußere Form der Skyscrapers im extremen Hochformat wider. Diese frühe Serie besteht aus 53 Bildern mit Gemüsemotiven, die innerhalb von vier Jahren entstanden. Neben Porrees malte sie u.a. blaue Bananen, Möhren, Auberginen, Gurken, Spargel und Rhabarberstangen. Zwei Werke aus dieser Reihe, eine Porree- und eine Rhabarberstange, wurden 1994 als Förderankauf für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworben.
Provenienz: Privatbesitz Berlin (direkt von der Künstlerin erworben) 7340

werner stötzer
(1931 Sonneberg – 2010 Alt-Langsow)
7341 Kleine Liegende Bronze mit dunkelbrauner Patina auf Bronzeplinthe. 1996. 7,5 x 12,5 x 5 cm.
Auf der Plinthe vorne links mit dem Künstlersignet „WS“ im Kreis, seitlich mit dem (undeutlichen) Gießerstempel „Flierl“. Stötzer 288.
1.200 €
Kleinbronze Werner Stötzers, der sich in seinem Schaffen auf die menschliche Figur und deren existenzielle Daseinsfragen konzentriert. Seine reduzierten, abstrahierten Menschenbilder beschränken sich auf das Wesentliche der Erscheinung und verbildlichen die Würde und Haltung des Menschen. Nach einer Ausbildung zum Keramikmodelleur studierte der Bildhauer und Zeichner
Werner Stötzer 1949-1951 in Weimar, Dresden und an der Akademie der Künste in Berlin bei Gustav Seitz. Die Auflagenhöhe und das genaue Gussdatum ist unbekannt. Prachtvoller Guss mit homogener Patina.

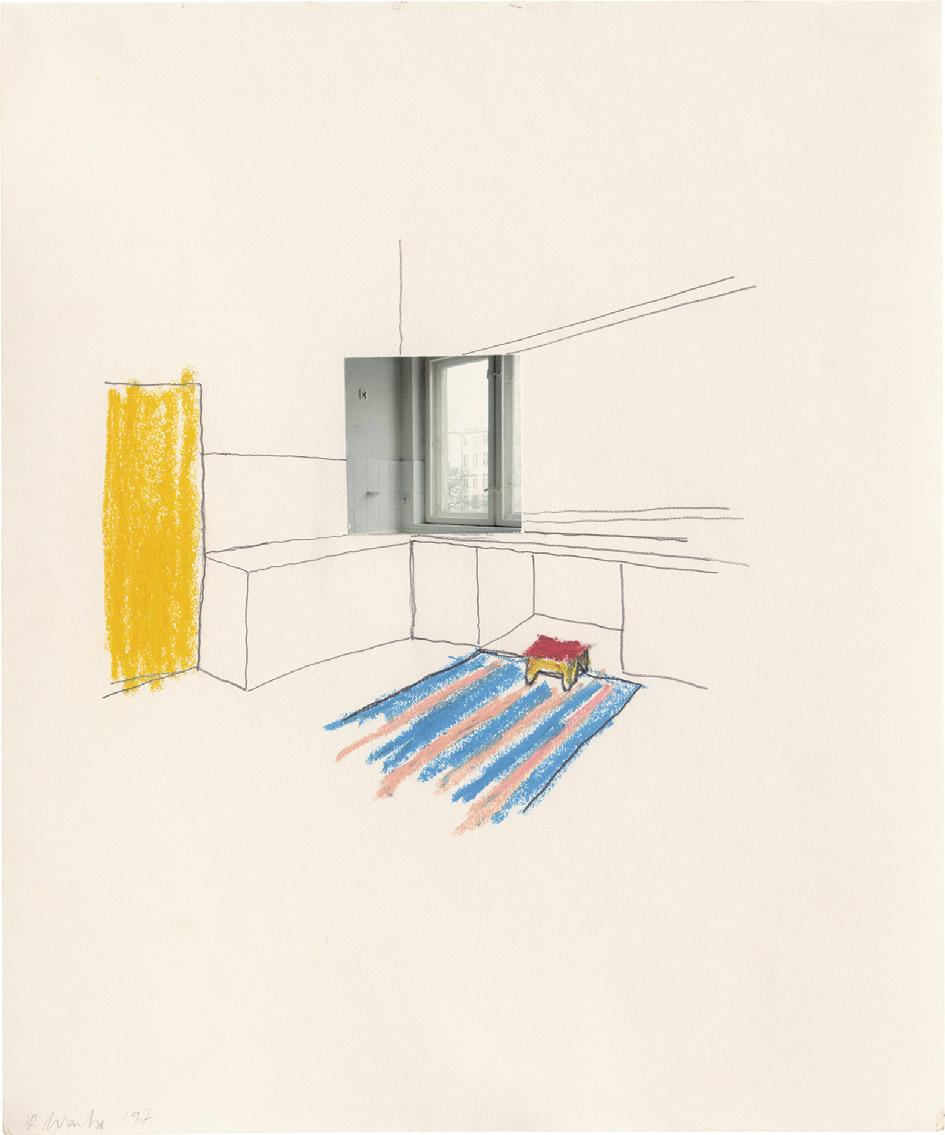
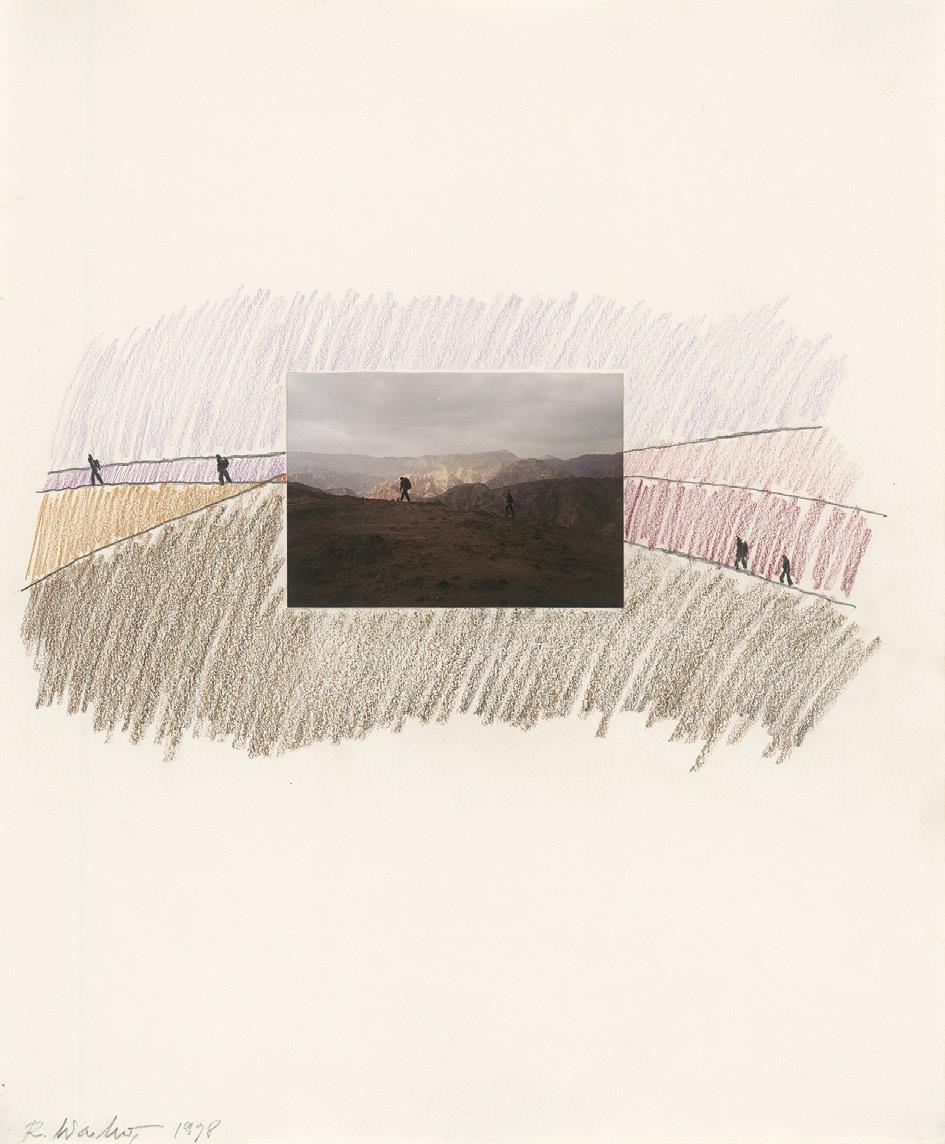


7343
ryszard wasko
(1948 Nysa, lebt in Berlin)
7342 4 Photo-Drawings
4 Arbeiten. Silbergelatinefotos, collagiert, Bleistift und farbige Kreiden auf Velin. 1992-98.
Je 43 x 35,5 cm.
Alle unten links mit Bleistift signiert „R. Wasko“ und datiert.
1.800 €
In den Jahren 1985 bis 2000 entstand eine Reihe von Arbeiten auf Papier, in denen der polnische Konzept- und Multimediakünstler, Fotograf, Filmemacher, Maler und Kurator Wasko das Medium Fotografie mit Zeichnungen kombinierte. Seine Fotos, die Fragmente von Innenräumen oder Landschaften zeigen, finden ihre Fortsetzung oder Erweiterung in kindlich anmutenden Zeichnungen. Drei Kompositionen sind online abgebildet bei der Fundacja Profile (fundacjaprofile.pl, Zugriff 13.01.2024).
Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin
karl bohrmann (1928 Mannheim – 1998 Köln)
7343 Rote Figur mit Dampfer Ölkreide, Aquarell und Kugelschreiber auf kariertem Papier. 1995. 22 x 18,5 cm.
1.000 €
Über das Liniengespinst der Karostruktur und der handschriftlichen Zahlennotizen darin legt Bohrmann großzügig geschwungene Linien, eine lebendige Aquarellierung und die zwei roten Bildgegenstände. Die markant vereinfachten, mit Ölkreide gezeichneten roten Figuren begegnen uns auch in zahlreichen anderen Arbeiten des Künstlers. Karl Bohrmann studierte anfangs in Saarbrücken, 1948-49 an der Kunstakademie Stuttgart bei Willi Baumeister. Später lehrte er an der Städelschule in Frankfurt am Main.
Provenienz: Privatsammlung Nordrhein-Westfalen

johannes brus (1942 Gelsenkirchen, lebt in Essen)
7344 Pferde
2 Bronzen, in Braun bzw. Weiß gefasst. 2002.
Jeweils 26 x 36 x 10 cm.
Das braune Pferd an der Unterseite signiert (eingeritzt) „J. BRUS“ und datiert. Auflage 20 num. Ex.
2.500 €
Brus studierte von 1964 bis 1971 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, die in diesen Jahren stark von Joseph Beuys geprägt war. 1986 bis 2007 war er Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, wo er u.a. Katharina Grosse, Karin Kneffel, Matthias Brock und Tim Berresheim unterrichtete. In Beton, Gips, Bronze oder Silikon erarbeitet Brus als Bildhauer realistische, grob bearbeitete Großplastiken, aber auch Miniaturen, häufig Adler, Pferde, Elefanten und Nashörner. Sein Interesse gilt dem Körperhaften, doch wird der Herstellungsprozess in Form von Fingerabdrücken, Bearbeitungsspuren und Gussnähten bewusst offengelegt. Prachtvolle Güsse.

7345
cornelia thomsen
(1970 Rudolstadt, lebt in New York)
7345 Ohne Titel
Aquarell auf Velin. 2005.
41 x 32 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Cornelia Thomsen“ und datiert.
1.200 €
Aus der im Jahr 2005 entstandenen „Garden“-Serie. Feine, farblich changierende Tupfenstrukturen erzeugen in der Ferne ein unbestimmtes, atmosphärisches Flimmern der Fläche. Ausgebildet an
der Porzellanmanufaktur Meissen und der Hochschule für Gestaltung Offenbach, ließ sich Thomsen 2006 in New York nieder. Ihre Arbeiten wurden in Galerien und Museen in Europa und den USA ausgestellt und befinden sich in öffentlichen Sammlungen, darunter das Ackland Art Museum, das Friedrich Fröbel Museum, das Los Angeles County Museum of Art und das Minneapolis Institute of Art.
Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin (2011 direkt bei der Künstlerin erworben)

franz erhard walther (1939 Fulda)
7346 Ohne Titel („flüssiger Raum“)
Aquarell und Zimmermannsbleistift auf genarbtem Velin. 2004.
14,8 x 17,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Walther“ und datiert, mittig links in der Darstellung betitelt.
1.200 €
Ausgewogene Proportionen, eine differenzierte Balance von Linie und Fläche, von farbigen und weißen Partien sowie die Subtilität der Komposition sind charakteristisch für Walthers Zeichnungen. Zur Entstehungszeit des vorliegenden Blattes (von 1971 bis 2005) hatte Walther eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg inne, wo zu seinen bekanntesten Schülern u.a. Rebecca Horn, Martin Kippenberger und Jonathan Meese gehörten.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
christa dichgans (1940–2018, Berlin)
7347 Ohne Titel
2 Flachreliefs. Geprägte, geschwärzte Kupferbleche. 2007. 57 x 93 cm und 57 x 94 cm. Jeweils signiert „Christa Dichgans“ (gestanzt) und datiert.
4.000 €
Christa Dichgans erhielt 1966 nach ihrem Studium der Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes für eine Reise nach New York, kehrte ein Jahr später zurück und ließ sich kurz darauf in Rom nieder. Ab 1972 wohnte sie in Berlin und in La Haute Carpénée, Südfrankreich. Die Berge achtlos weggeworfenen Kinderspielzeugs und anderer Konsumgüter wecken in ihr die sozialkritisch-wirklichkeitsnahe Kunstpraxis, mit der die Künstlerin sich ihr Leben lang beschäftigen wird und die zum ästhetischen Markenzeichen ihrer Arbeit wird. Ähnlich wie die Campbell-Dosen von Andy Warhol werden bei Dichgans ab 1966 das Spielzeug und ab 1968 die aufblasbaren Gummitiere und Plastikherzen zum Sinnbild von Materialismus, Konsum und sozialer Distanz in unserer Gesellschaft.


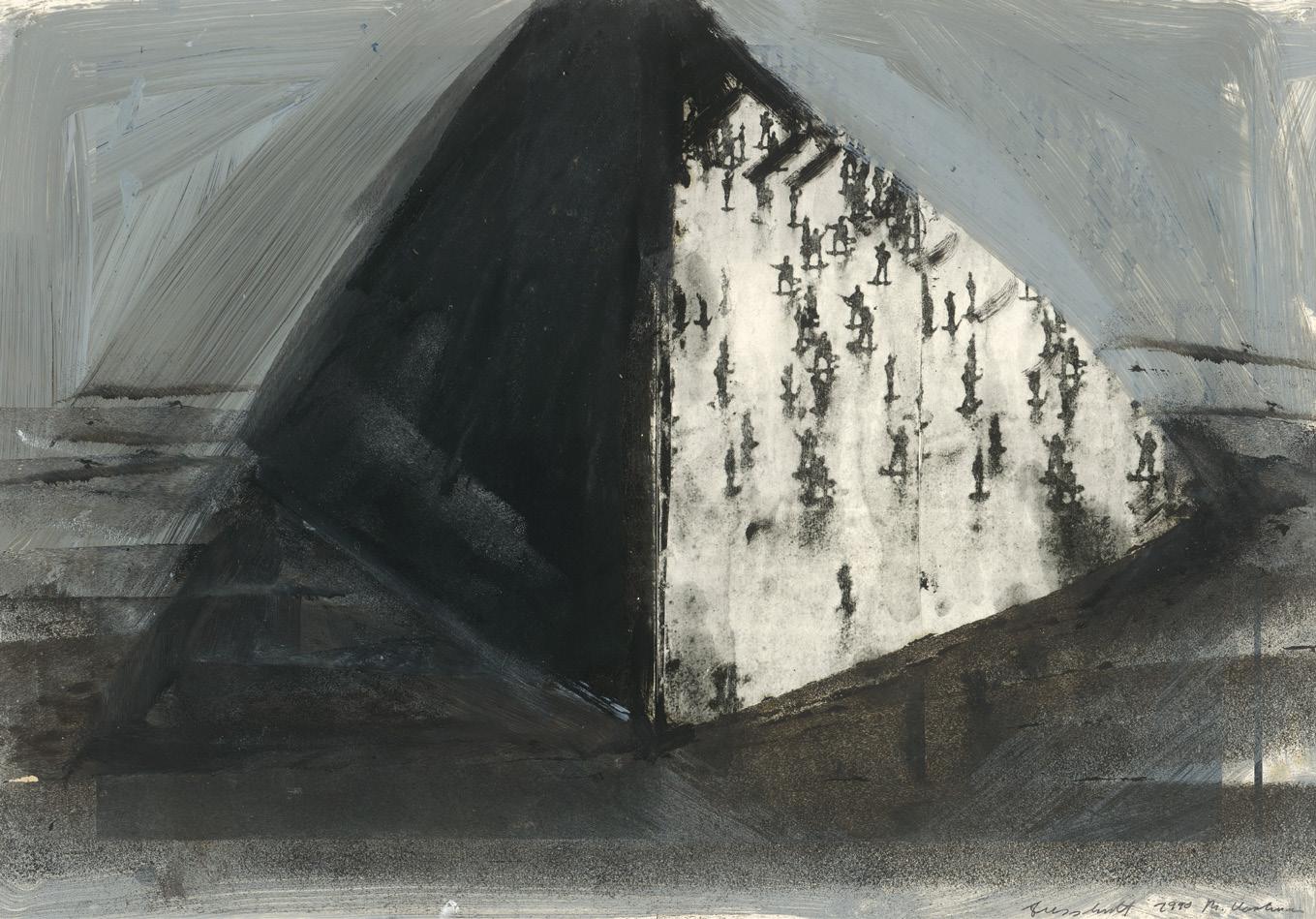
thomas hartmann (1950 Zetel, lebt in Berlin)
7348 „Ausschnitt“ Mischtechnik über Fotografie auf gestrichenem Papier. 1990.
35 x 50 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Th. Hartmann“, datiert und betitelt sowie verso mit Kreide in Schwarz nochmals signiert, datiert und bezeichnet „40“.
800 €
Thomas Hartmann spielt in seinem Werk immer wieder mit dem Ausschnitt. Aus alten Werken wählt er Teilstücke, die durch andere Zentrierung zu völlig neuen Kunstwerken werden.
Provenienz:
Galerie Georg Nothelfer, Berlin (dort erworben) Privatbesitz Süddeutschland
Literatur:
Thomas Hartmann, Viele Einzelne, Aussstellung Stadtmuseum Beckum u.a., Berlin 2004, Abb. S. 117
7349 „Das Boot“ Öl auf Leinwand. 2002-04.
50 x 70 cm.
Verso mit Filzstift in Schwarz signiert „Th. Hartmann“, datiert und betitelt.
1.000 €
Schwungvolle Komposition der Wellen, deren Bewegung durch die starken Pastositäten hervorgehoben wird. Die Wellen reihen sich
teils gestaffelt aneinander, erst bei längerem Hinsehen gerät das Boot in den Fokus, das mittig zum willkürlichen Objekt der tobenden Brandung geworden ist. Von 2005 bis 2018 war Hartmann Professor für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg.
Provenienz:
Galerie von Braunsbehrens, Stuttgart (dort erworben 2006 anlässlich der Kunst 06, Zürich)
Privatbesitz Süddeutschland
7350 „Domino“ Mischtechnik auf Karton. 2004.
57 x 77,5 cm.
Unten rechts mit Faserschreiber in Schwarz signiert „Th. Hartmann“ und datiert, unten links betitelt.
1.000 €
„Für Thomas Hartmann sind Gegensätze der Schlüssel zur Malerei, da sie die Auseinandersetzung des Eigenen mit dem Anderen meinen. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten steht daher die Spannung zwischen dem Ganzen und seinen (einzelnen) Teilen. Wiederkehrendes Kernmotiv in seinen Bildern und Zeichnungen ist das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. In der permanenten Metamorphose seines Werkes, das durch ein weites Panorama geheimnisvoller Motivwelten führt, hat er eine ganz eigene Handschrift entwickelt.“ (galerie-nothelfer.de, Zugriff 20.02.2025).
Provenienz:
Galerie Nothelfer, Berlin (dort erworben 2006)
Privatbesitz Süddeutschland



robert metzkes (1954 Pirna, lebt in Berlin)
7351 Fontane
Bronze mit dunkelbrauner Patina.
21,5 x 11 x 11 cm.
Verso seitlich an der Plinthe monogrammiert „RM“, an der Unterseite mit dem Gießerstempel „GUSS HANN“.
Auflage 7 röm. num. Ex.
2.000 €
In sich ruhend und zugleich konzentriert zeigt Metzkes den Dichter Fontane, die Figur leicht stilisiert und doch realistisch gestaltet.
„Die Ästhetik von Robert Metzkes (...) wurzelt tief in der am klassischen Figurenideal orientierten Bildhauerei des Ostens.“ (Michael Zajonz, in: Der Tagesspiegel, 10.05.2014, S. 28). Der Guss entstand bei Wilfried Hann, Altlandsberg. Prachtvoller Guss mit homogener Patina.
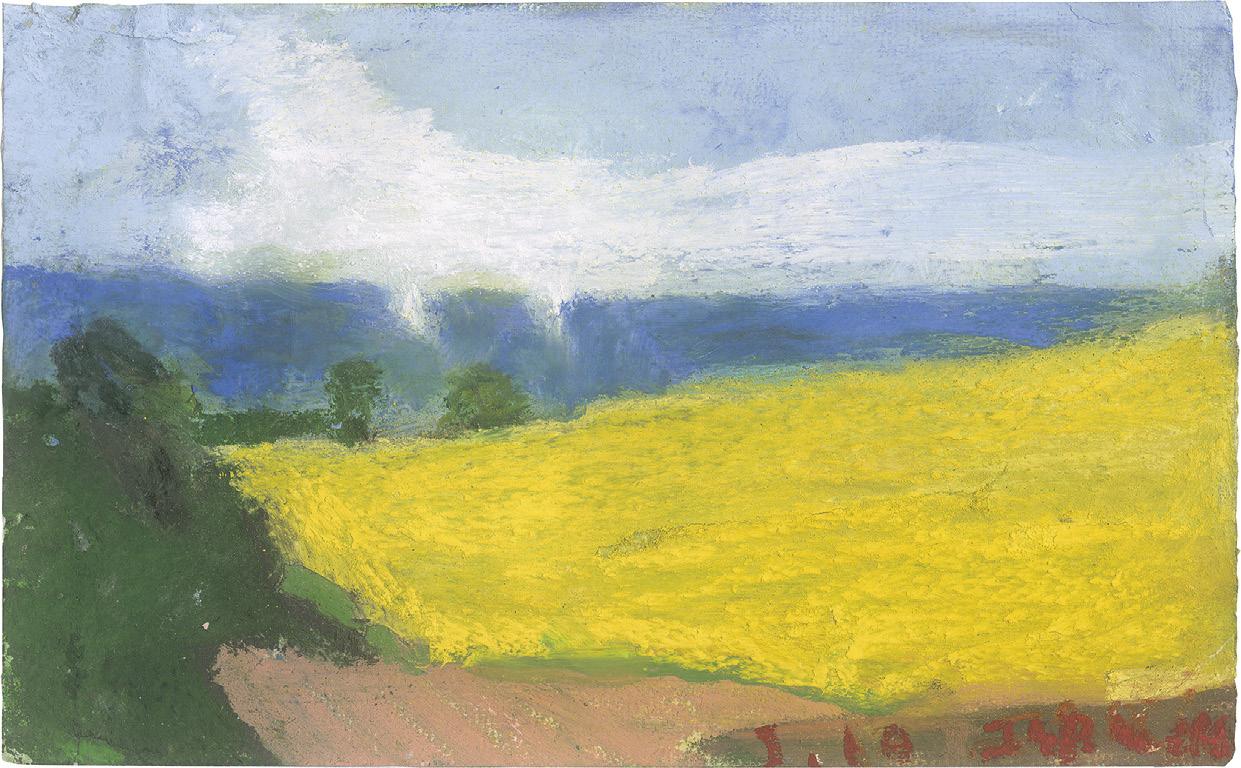

7353
klaus fussmann
(1938 Velbert, lebt in Berlin und Gelting) 7352 Rapsfeld Gouache auf Bütten. 2010. 14,9 x 24 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert „Fußmann“ und datiert.
2.000 €
Strahlend frisch und sommerlich leuchtet das Gelb des Rapsfeldes zwischen dem tiefblauen Meer und saftigen Grün der Wiese. In seiner zweiten Wahlheimat Düstnishy in Gelting, nahe der Flensburger Förde, fängt Fußmann immer wieder begeistert dieses Farbspiel in seinen Zeichnungen und Gemälden ein.
7353 La Cadière, Provence Aquarell, Gouache und Deckweiß auf handgeschöpftem Bütten. 2012.
10,5 x 15,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Violett monogrammiert „Fu“ und datiert.
900 €
Die charmante kleine Landschaftsstudie mit Zypressen vor sanfter Bergkulisse entstand in der Gegend der südfranzösischen Gemeinde La Cadière. Die kräftigen Farben der Bäume werden vom weißen Rauch eines Schornsteins kontrastiert.
matti braun
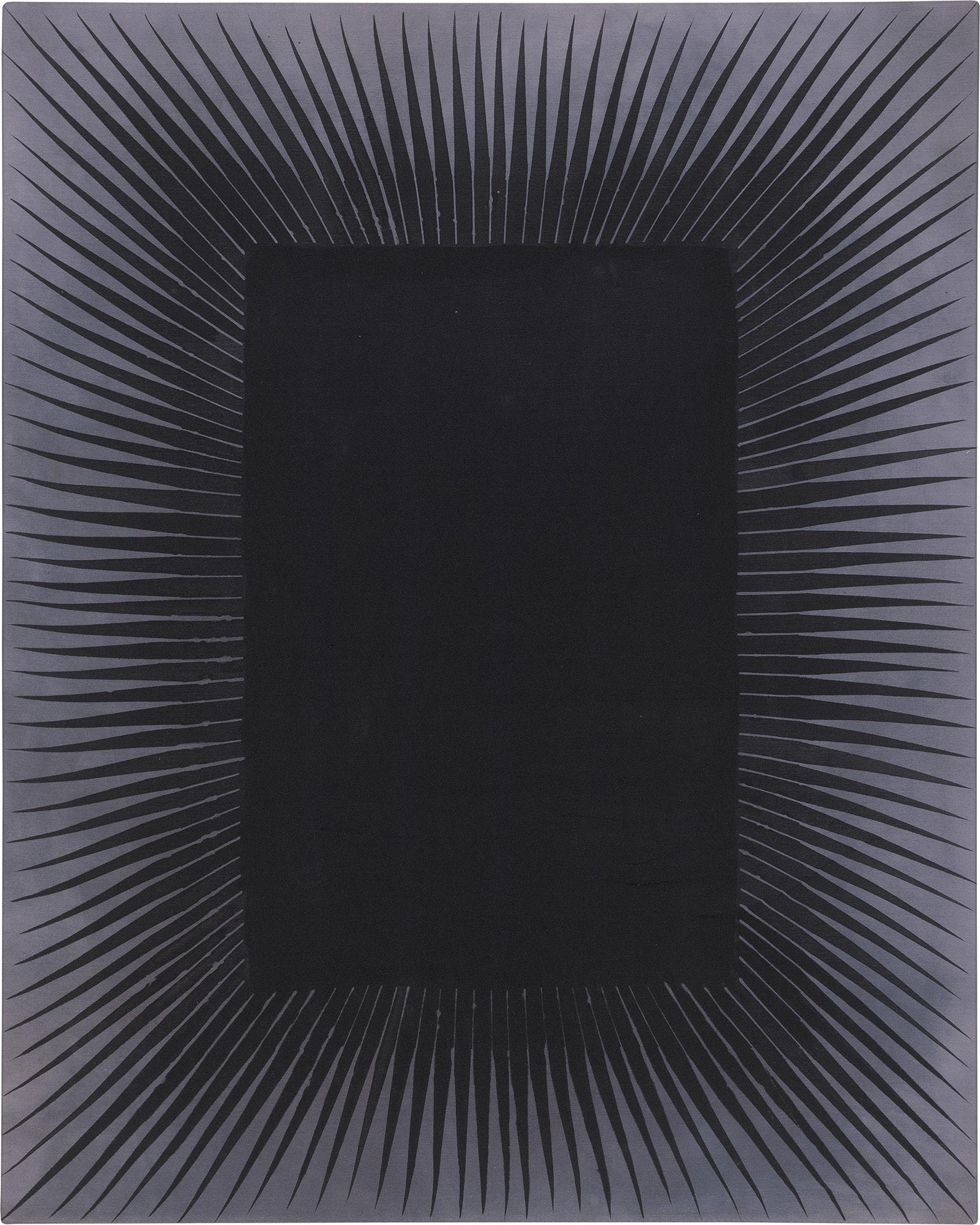
(1968 Berlin, lebt in Köln)
7354 „Atol 10“
Stofffarbe bzw. Batik auf Seide, in weiß gefassten Holzkasten montiert. 2008.
51 x 42 cm (Kasten).
Auf der Rückseite mit Faserstift in Schwarz signiert „M. Braun“ und datiert, bezeichnet „MB 143“ und auf Klebeetikett typographisch bezeichnet und betitelt.
2.400 €
Minimalistische, mehrdeutige Arbeit, changierend zwischen Abstraktion und indonesischer Batikkunst. „Er untersucht die unerwarteten, oft wenig bekannten Auswirkungen kulturübergreifen-
der Dynamiken und macht Muster künstlerischer Migrationen und kultureller Aneignungen sichtbar. (...) Matti Brauns Arbeit mäandert zwischen konkreten Bezügen und allgemeinen Anspielungen, zwischen poetischer Vergänglichkeit und einem feinen Sinn für instinktive Unmittelbarkeit.“ (deichtorhallen.de, Zugriff 18.03.2025). Braun, der in unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen wie Installationen, Objekten, Fotografie und Malerei arbeitet, verwendet immer wieder auch kunsthandwerkliche Techniken wie Keramikbemalung, Batik und Glasbläserei. Ausgebildet wurde er an der Städelschule in Frankfurt und an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
jannis markopoulos (1962 Athen)
7355 „Minocow killed Michael Jackson“ Öl auf Leinwand. 2011.
90 x 60 cm.
Verso auf der Leinwand mit Pinsel in Schwarz signiert „Markopoulos“, datiert, betitelt und mit Werkangaben.
1.500 €
Ein Mischwesen aus Tier und Mensch, eine Kuh mit mittelalterlichem Gewand, blickt den Betrachter gelassen, aber direkt an und trägt in der linken Hand den Kopf des noch kindlichen Michael Jackson, in der anderen das bedrohlich gehobene Schwert. Ein makabres, sehr surreales Werk des griechischen Künstlers, der in seinem Œuvre gerne Referenzen zur Kunstgeschichte und zur Popkultur zieht und diese auf der Leinwand zusammenfließen lässt.
Provenienz: Galerie Irrgang, Leipzig/Berlin
Privatbesitz Potsdam


stefanie hillich (1974 Berlin)
7356 Lose Zeit
Kohle, teils laviert und gewischt, auf Velin. 2018. 46 x 34 cm. Unten rechts mit Kohle signiert „Hillich“.
1.000 €
Zarte weiße Federn, den Körper umspielend, setzen einen schönen Kontrast zu der in schwarz-grauen Tönen schraffierten Frau. Wie häufig in Stefanie Hillichs phantastisch anmutenden Werken wirkt die Figur entrückt und unnahbar. Die Szenerien ihrer Bilder und Zeichnungen laden den Betrachter stets zum Kopfkino ein. Ihre sichere Beherrschung von Farbe, Figur und Komposition, zudem der fast provokant, locker und sicher sitzende Zeichenstrich und Malduktus unterstreichen die Qualität ihrer Arbeiten. Sie studierte bei Wolfgang Peuker Malerei an der Kunsthochschule Weißensee und war Meisterschülerin bei Barbara Müller-Kageler. Mit dem Maler Moritz Schleime gründete sie 2010 das Künstler-Projekt „Secret Stars“. Bis heute entwickelt und produziert das Duo neue Bild- und Kunstprojekte. Hillich ist aktuell in der Jubiläumsausstellung „Berliner Realistinnen. 65 Jahre Haus am Lützowplatz (HaL)“ (bis 9. Juni 2025) vertreten.
rayk goetze
(1964 Stralsund, lebt in Leipzig)
7357 „A“
Öl und Acryl auf Leinwand. 2014.
200 x 125 cm.
Verso auf der Leinwand mit Pinsel in Schwarz signiert „Rayk“, datiert und betitelt.
10.000 €
In seinen Gemälden schafft der Künstler Rayk Goetze eine Art visuelles Abenteuer, das zwischen Abstraktion und Figuration hin und her springt und den Betrachter mit seiner Farbgewalt und intensiven Bildsprache fesselt. Geboren 1984 in Berlin und ausgebildet an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, ist Goetze ein bedeutender Vertreter der jüngeren Generation der Neuen Leipziger Schule. In seinem Werk verwebt der Künstler die Tradition der Neuen Leipziger Schule mit einer Vielzahl antiker bis zeitgenössischer Einflüsse. Goetze schafft so eine Welt, in der verschiedene visuelle Elemente und Bildebenen miteinander verschmelzen und in eine bildnerische Fiktion eintauchen. Die zentralen Figuren in Goetzes Arbeiten sind oft einzelne Protagonisten: Menschenpuppen, Engel, Untiere, mystische Kreaturen; sie erscheinen jedoch in einem Zustand der Fragmentierung. Die Figuren werden durch den Künstler zunehmend in der Darstellung von ihrer Gegenständlichkeit gelöst und in einen mythischen Raum überführt. Die Komposition seines Werkes erinnert an einen Montageroman. In dem Werk „A“ halten sich die Figuren an den Seitenrändern auf und umranken, mitsamt eines wunderbar opulent anmutenden Faltenwurfs, die Bildmitte, in der eine himmelblaue Leerstelle klafft. Die surreale Komposition entzieht sich jeder eindeutigen Erzählung und lässt damit den Ideen und Gedanken freien Lauf.
Provenienz: Privatbesitz Potsdam (direkt beim Künstler erworben, 2014)


harald metzkes
(1929 Berlin, lebt in Wegendorf bei Berlin)
7358 „4 Männer, 4 Frauen, 4 Leitern“ Öl auf Leinwand. 2016.
80 x 70 cm.
Oben links mit Pinsel in Braun signiert „Metzkes“ und datiert, verso mit Pinsel in Braun betitelt.
3.000 €
Ein wahrer Balanceakt: Auf vier Leitern vollführen vier Männer luftige Artistik, gestützt von vier Frauen, im Hintergrund zahl-
reiche Schaulustige. Vielfigurige Zirkusszenen wie diese finden sich immer wieder in Metzkes Werken. Darstellungen von Harlekinen, Artisten und Schauspielern aus dem Theater-, Opernoder Schausteller-Milieu zählen zu seinen beliebtesten Bildmotiven.
Provenienz: Galerie Leo Coppi, Berlin Privatbesitz Berlin

emma grün
(d.i. Johanna Emma Dittrich, 1982 Marburg, lebt in Berlin)
7359 Die Performance Öl auf Leinwand. 2024.
50 x 70 cm.
Verso mit Kohle signiert „Emma Grün“ und datiert.
1.000 €
Emma Grün, Tochter einer Kostümbildnerin und eines Bühnenbildners, wurde bereits früh von einer phantasievollen, dramatischen Welt geprägt. Ihre Zeichnungen erzählen von Figurinen, diese sind oftmals als Charakterstudien angelegt. In ihren Performances lotet sie die Grenzen zwischen Zerbrechlichkeit und Stärke aus. Grün war Teil der Ausstellung „Ngorongoro“ anlässlich des Artist Weekend 2015 auf dem Berliner Ateliergelände von Jonas Burgert. Neben weiteren Teilnahmen bei Kunst-Messen in Berlin sowie bei Festivals (u.a. beim Les Rencontres de la Photographie d’Arles 2016) verweist ihre Vita auf Residenzen und diverse Ausstellungen u.a. Spoiler Berlin und zuletzt im Schloss Gleina.
Die Lose 7000 bis 7373 finden Sie online
A
Ackermann, Max 7186, 8220
Albers, Josef 7237-7238
Albert, Hermann 8221
Albert-Lasard, Lou 7096, 8000
Albitz, Richard 8001
Almond, Darren James 8222
Altenbourg, Gerhard 7294, 8223
Alviani, Getulio 8224
Anderle, Jirí 7320-7322, 8225
Andersen, Robin Christian 7146
Antes, Horst 7302-7304, 8226-8229
Antoine, Otto 8002
Archipenko, Alexander 7136
Armbruster, Ludi 8230
Armitage, Kenneth 7269
Arnold, Christian 8003
Arp, Hans 7231, 8231-8236
B
Bachem, Bele 8237
Balkenhol, Stephan 8238
Bargheer, Eduard 8239-8240
Barlach, Ernst 8004-8007
Batz, Eugen 8008
Bauer, Rudolf 8009-8013
Bauer-Pezellen, Tina 8014
Baumeister, Willi 7216-7218, 8241-8244
Bayrle, Thomas 8245
Beckmann, Max 7090
Beekman, Chris Hendrik 7139
Behringer, Oskar 7145
Bembé, Marion 8246
Benes, Vlastimil 7286-7289
Benrath, Frédéric 7329
Berges, Werner 8247-8248
Berke, Hubert 7232
Bertoia, Harry 8249-8252
Beuys, Joseph 8253
Bissier, Jules 7247, 8254-8255
Bleyl, Fritz 7142
Boccioni, Umberto 8015
Böckstiegel, Peter August 7111-7113, 8016
Bötticher, Walther 8017-8019
Bohrmann, Karl 7343
Borchert, Erich 7117
Braque, Georges 7200-7205
Brass, Hans 8020
Braun, Matti 7354
Breiter, Herbert 8256
Brockhusen, Theo von 7017
Brockmann, Gottfried 8021
Brodwolf, Jürgen 8257-8258
Brunovsky, Albin 7323, 8259-8260
Brus, Johannes 7344
Bruycker, Jules de 8022
Buchholz, Erich 8023-8024
Bühl, Hede 7280
Burchartz, Max 8025
CCalder, Alexander 8261
Campendonk, Heinrich 7098
Carrà, Carlo 8026
Castro, Lourdes 7229
Chabaud, Auguste 8027
Chagall, Marc 7135
Chirico, Giorgio de 7293
Christo 8262
Cocteau, Jean 7168
Corinth, Lovis 7018-7024, 8028-8034
Corradin, Inos 8263-8264
Cucuel, Edward 7008
Dahn, Walter 8265-8267
Dexel, Walter 7132-7134, 8035-8036
Dichgans, Christa 7347
Diehl, Hans-Jürgen 7263
Dine, Jim 8268
Dix, Otto 7089
Dressler, August Wilhelm 7188-7189
Droese, Felix 8270
Droste, Karl Heinz 8271
Dufy, Raoul 7169-7170
E
Eglau, Otto 8272
Ehlotzky, Fritz 7094
Eitner, Ernst 8037-8038
Ende, Edgar 7251
Engst, Georg 8273
Ernst, Max 8274-8277
Evenepoel, Henri 8039
F
Fangor, Wojciech 8278
Feininger, Lyonel 7126, 8040
Feininger, T. Lux 7183
Feinstein, Pavel 7307-7308
Felixmüller, Conrad 7100-7101, 8041-8043
Fiedler, Arnold 8279
Filipkiewicz, Stefan 8044
Fischer, Oskar 8045
Flora, Paul 7298-7301
Förg, Günther 8280
Fraser, Colin 8281
Friedlaender, Johnny 8282
Fritsch, Ernst 7152
Fruhtrunk, Günter 8283
Fuchs, Heinz 8046
Fußmann, Klaus 7305-7306, 7352-7353
G
Gaul, August 7007
Gaul, Winfred 8284
Gazovic, Vladimir 8285
Geiger, Rupprecht 8286-8287
Gering, Andreas 7091-7092, 8047-8050
Gernhardt, Per 8288
Gestering, Hanns Joachim 8289
Gilles, Werner 7190-7191
Giorgi, Bruno 8290
Gleichmann, Otto 8051
Glöckner, Hermann 8291
Godeg, Karl 7255
Goepfert, Hermann 8292
Goetze, Rayk 7357
Gräf, Lili 7107
Graubner, Gotthard 7281
Grieshaber, HAP 7248-7249, 8295-8296
Grosz, George 7088, 8052
Grün, Emma 7359
Grützke, Johannes 7258
Guttuso, Renato 7261
H
Haase, Volkmar 7270, 8297-8298
Haffenrichter, Hans 8053-8054
Hagemeister, Karl 7015
Hager, Marie 7010
Halm, Peter von 8055
Hampel, Angela 8299
Hans, Rolf 7250
Harter, Eric 8300
Hartig, Hans 8056-8057
Hartmann, Thomas 7348-7350
Hauptmann, Ivo 8301-8302
Hazelwood, David 8303
Heckel, Erich 7066-7068, 8058
Heckendorf, Franz 7148-7149
Heemskerck, Jacoba van 8059
Heerich, Erwin 8304
Hegenbarth, Josef 8060
Heiliger, Bernhard 8305
Heinrich, Otto 7079-7081, 8061-8063
Heise, Wilhelm 8064
Heisig, Bernhard 8306-8308
Helbig, Walter 7095
Heldt, Werner 7162-7164
Heller, Marie-Luise 8309
Hennig, Albert 8310-8313
Herbig, Otto 8065
Herbin, Auguste 8314-8318
Herrmann, Curt 7006
Hesse, Hermann 7174
Hillich, Stefanie 7356
Hilsing, Werner 8319
Hitz, Dora 7004
Hockney, David 7271
Höckelmann, Antonius 8320-8321
Hödicke, Karl Horst 7265
Hoelzel, Adolf 7119-7120, 8066
Hoetger, Bernhard 8067
Hoexter, John 7102
Hofer, Karl 7093, 7144, 72197220
Hohlwein, Ludwig 8068
Hohly, Richard 8069
Holmead 7290
Holtz, Karl 8070
Holweck, Oskar 8322
Holz, Paul 8071-8072
Hubbuch, Karl 8073-8077
Hüppi, Alfonso 8323
Huhnen, Fritz 8078
Hundertwasser, Friedensreich
7314-7319, 8324-8326
Hussmann, Albert Hinrich 8079
I J
Indiana, Robert 8327
Ipoustéguy, Jean 8328
Jacobi, Rudolf 7187
Jaeckel, Willy 7185
Jaenisch, Hans 8329
Janco, Marcel 7291
Janssen, Horst 8330
Jawlensky, Alexej von 7124
Jawlensky, Andreas 7125
Johansson, Eric 8080-8082
K
Kassák, Lajos 7240
Katzke, Günther 8083
Kaus, Max 7221-7225
Kelen, Emeric 8084
Kerkovius, Ida 7226, 8331
Kesting, Edmund 7227, 8085-8089
Khakdan, Wahed 8332-8333
Kirchner, Ernst Ludwig 7059-7065
Klee, Paul 7123
Klemke, Peter 8334
Klemm, Walther 8090
Klinker, Emmy 8091
Knap, Jan 8335-8336
Koberling, Bernd 8337
Koenig, Fritz 7327
König, Leo von 7178-7179
Köpcke, Arthur 7254
Koeppel, Matthias 7260, 8338-8339
Köthe, Fritz 7262, 8340
Kokoschka, Oskar 7076, 8092-8093
Kollwitz, Käthe 7084-7085, 8094
Kramer, Jack 8341
Kremer, Alfred 8342-8343
Kronenberg, Fritz 8095
Kruger, Barbara 8344
Kubin, Alfred 8096-8097
Kuhfuss, Paul 7150-7151
Kuhr, Fritz 7230, 8345 L
Laabs, Hans 8346
Lange, Thomas 8347
Larionow, Michail 8098
Laurens, Henri 7099
Lelée, Léo 8099
Lichtenstein, Roy 7267-7268, 8348
Liebermann, Max 7011-7014, 8100-8106
Lindenau, Erich 7176
Lindenberg, Udo 8349-8350
Lipchitz, Jacques 7192-7193, 8351-8353
Loewenthal, Käthe 8107
Löwy, Leopold 7050-7054
Loiseau, Gustave 8108
Lucander, Robert 8354
Luce, Maximilien 8109
Luther, Adolf 8355
Lydis, Mariette 8110
M
Mack, Heinz 7273-7274, 8356-8358
Macke, August 7074
Maetzel, Emil 8111-8114
Maetzel-Johannsen, Dorothea 7103-7106
Mammen, Jeanne 7166-7167
Man Ray 8359
Mappenwerke 7078, 7264, 7272, 7330, 8360-8362
Marasco, Antonio 8115
Marc, Franz 7097
Marcks, Gerhard 7108-7110, 8116-8123
Marcus, Eva Maria 8124
Markopoulos, Jannis 7355
Masjutin, Wassili N. 8125-8126
Mataré, Ewald 7235
Maurer, Dóra 7283-7285, 8363
Mavignier, Almir da Silva 8364
Meckel, Christoph 8365
Meckseper, Friedrich 8366-8367
Mecys, Aliute 7325-7326
Meidner, Ludwig 8127-8128
Melzer, Moriz 7184
Mense, Carlo 8129
Metzkes, Harald 7310-7313, 7358
Metzkes, Robert 7351
Meyer, Jobst 8368
Meyer-Bergner, Lena 7128-7131
Michanek, Hannes 8369
Miró, Joan 7206-7214, 8370
Modersohn, Otto 7177
Möller, Rudolf 7161
Moholy-Nagy, László 7127
Molzahn, Johannes 8130-8131
Moritz, Sabine 7337-7339, 8371
Moser, Koloman 8132
Mouly, Marcel 7309
Muche, Georg 8133-8134
Mühlenhaupt, Kurt 8372-8375
Mueller, Otto 7057-7058
Müller, Richard 8135-8136
N
Nauen, Heinrich 8137-8138
Nay, Ernst Wilhelm 8376
Nesch, Rolf 8377
Neuhaus, Hugo 8378
Neumann, Max 8379
Niemeyer, Jo 8380
Niemeyer-Holstein, Otto 7244
Nolde, Emil 7055-7056
O
Oppenheimer, Max 7077
Oppler, Ernst 8139
Orlik, Emil 7028-7049, 8140-8142
P
Paeschke, Paul 7172-7173
Paik, Nam June 7332-7334
Pankok, Otto 8143-8144
Paolozzi, Eduardo 8381
Pechstein, Hermann Max 70697071, 8145-8146
Pels-Leusden, Hans 8382-8383
Penck, A. R. 8384-8387
Petrick, Wolfgang 8388
Pfrang, Erwin 8389
Picabia, Francis 8147
Picasso, Pablo 7194-7199
Piene, Otto 7275-7277, 8390-8394
Pijuan, Joan Hernández 8395
Piper, John 7292
Pissarro, Camille 7001
Planck, Willy 8148
Poelzig, Hans 8149-8152
Poliakoff, Serge 7215
Polke, Sigmar 7335-7336
Prampolini, Enrico 8153
Prem, Heimrad 7256-7257
Purrmann, Hans 8154
Q
Querner, Curt 7242
Quinte, Lothar 8396
R
Radziwill, Franz 7138, 7147, 7245
Ranft, Richard 7009
Reigl, Judit 7282
Renoir, Pierre-Auguste 8155-8157
Rheinsberg, Raffael 8397
Richter, Gerhard 7278-7279, 8398
Rocke, Dorothee 8399-8402
Rohlfs, Christian 7072-7073
Royen, Peter 8403
Rude, Olaf 7171
Rudolph, Wilhelm 8158
S
Salvo 8404-8405
Schad, Robert 7331
Scharff, Edwin 8159
Schiele, Egon 7075
Schilling, Bertha 8160
Schimansky, Hanns 8406
Schleime, Cornelia 7340
Schlichting, Waldemar 8161
Schnarrenberger, Wilhelm 7243
Schoenholtz, Michael 8407
Scholz, Werner 7159
Schreib, Werner 8408
Schreyer, Lothar 8162-8163
Schrikkel, Louis 7165
Schrimpf, Georg 7153-7154
Schwitters, Kurt 7140
Seitz, Gustav 7241
Sempé, Jean-Jacques 7295
Severini, Gino 7137
Sintenis, Renée 7160, 7182
Slevogt, Max 8164-8166
Spiro, Eugen 8167
Spiro, Georges 7252-7253
Springer, Ferdinand 8168
Stazewski, Henryk 7239
Steiauf, Heinrich (Hein) 7143
Steinitz, Käte 8169
Sterl, Robert Hermann 7082-7083, 8170-8174
Stölzl, Gunta 7236
Stötzer, Werner 7341
Strempel, Horst 8409-8410
Stuckenberg, Fritz 8175-8176
Szym, Hans 8177
T
Tàpies, Antoni 8411
Tappert, Georg 8178-8179
Teltscher, Georg 8180
Tesdorpf-Edens, Ilse 8181
Theunert, Christian 8412
Thieler, Fred 7233-7234
Thomsen, Cornelia 7345, 8413-8416
Tinguely, Jean 8417-8419
Topor, Roland 7296-7297
Topp, Arnold 8182
Trockel, Rosemarie 8420
Trökes, Heinz 7228
Tübke, Werner 7259, 8421-8422
U
Uecker, Günther 8423-8424
Ullmann, My 7122
Ungerer, Tomi 8425
Ury, Lesser 7025-7027
V
Valenti, Italo 7246
Vallotton, Félix 8183-8184
Valtat, Louis 7005, 8185-8189
Vasarely, Victor 8426-8429
Villéon, Emmanuel de la 8190
Vogeler, Heinrich 7002-7003, 8191-8194
Voigt, Bruno 7155-7158
Vuillard, Edouard 7000
W
Wachsmuth, Fritz 8195
Walt Disney Studio 7180-7181, 8269
Waltermann, Susanne 8430
Walther, Franz Erhard 7346
Warhol, Andy 7266
Wasko, Ryszard 7342
Wauer, William 8196
Weinhold, Kurt 8197
Wellenstein, Walter 8198-8199
Wilding, Ludwig 8431-8433
Winsloe-Hatvany, Christa 8200
Wittlich, Josef 8434
Wolff, Gustav Heinrich 7118, 8201
Wolfsfeld, Erich 7141
Wollheim, Gert Heinrich 7175
Wülfing, Sulamith 7121
Wunderwald, Gustav 7114-7116, 8202
Wygrzywalski, Feliks Kazimierz
8203
X Y Z
Xenakis, Iannis 7328, 8435
Yerka, Jacek 7324
Ziezold, Wolfgang 8436
Zille, Heinrich 7086-7087, 8204-8210
Zimmermann, Peter 8437

photography auction june 4 , 2025
gallery & previews | Rankestr. 24, 10789 Berlin
auctions | Erdener Straße 5a, 14193 Berlin photoauktionen gbr

Kunst- und Fotoauktionen 29. bis 4. Juni 2025
GALERIE BASSENGE · ERDENER STRASSE 5A · 14193 BERLIN
Telefon: (030) 893 80 29-0 Fax: (030) 891 80 25 E-Mail: art@bassenge.com Kataloge online: www.bassenge.com
1. Die Galerie Gerda Bassenge KG, nachfolgend Versteigerer genannt, versteigert als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Versteigerung ist freiwillig und öffentlich im Sinne des § 383 III BGB.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht. Erhaltungszustände der einzelnen angebotenen Arbeiten bleiben im Katalog in der Regel unerwähnt. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne und keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheitsangaben. Gleiches gilt für individuell angeforderte Zustandsberichte. Sie bringen nur die subjektive Einschätzung des Versteigerers zum Ausdruck und dienen lediglich der unverbindlichen Orientierung. Alle Gegenstände werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden. Soweit nicht in der Katalogbeschreibung explizit erwähnt, sind Rahmungen nicht bindender Bestandteil des Angebots. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlags seine Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld. Die Haftung des Versteigerers auf Schadensersatz für Vermögensschäden – gleich aus welchem Grund – ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Versteigerer fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Wenn mehrere Personen dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
5. Im Falle eines schriftlichen Gebotes beauftragt der Interessent den Versteigerer für ihn während der Versteigerung Gebote abzugeben. In schriftlichen Aufträgen ist bei Differenzen zwischen Nummer und Kennwort das Kennwort maßgebend.
6. Telefonische Gebote und Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die Bearbeitung übernimmt der
Versteigerer jedoch keine Gewähr. Telefonische und OnlineGebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Für das Zustandekommen einer entsprechenden Telefon- oder Onlineverbindung übernimmt der Versteigerer keine Gewähr. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).
7. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste und Beschädigung auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit vollständigem Zahlungseingang an den Erwerber über.
8. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 30% zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung) oder ein Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung) von z.Zt. 7% (Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Graphiken, Bücher etc.) bzw. 19% (Handschriften, Autographen, Kunstgewerbliche Gegenstände, Siebdrucke, Offsets, Fotografien, etc.). Die im Katalog mit einem * gekennzeichneten Objekte unterliegen in jedem Fall der Regelbesteuerung (Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer von z.Zt. 7% bzw. 19%). Bei den im Katalog mit einem ^ gekennzeichneten Objekten ist Einfuhrumsatzsteuer angefallen.
In diesen Fällen wird zusätzlich zu einem Aufgeld von 27% (Differenzbesteuerung) die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7% auf den Zuschlag erhoben.
Für bundesdeutsche Kunsthändler und Antiquare, die zum Vor steuer abzug berechtigt sind, kann die Gesamt rech nung auf Wunsch, wie bisher nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) und – bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. bei Auftragserteilung als Nachweis der Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen –auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. Alle anderen Käufe aus EU-Ländern unterliegen der Umsatzsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäischen Union wird die Umsatzsteuer erstattet, wenn binnen 4 Wochen nach der Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis und der zollamtliche Einfuhrnachweis des entsprechenden Importlandes erbracht werden. Bei Versand durch uns gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Bei Online-Live-Geboten über Internetplattformen erhöht sich das Aufgeld um die dort anfallende Transaktionsgebühr (i. d. R. 3-5%). Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedür fen einer besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Katalog- und Zusatzabbildungen dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Reproduktionsrechte und digitale Dateien der Abbildungen können gegen Gebühr erworben werden. Gegebenen-
falls noch bestehende Urheberrechte Dritter bleiben davon unberührt und müssen u.U. gesondert eingeholt werden.
9. Die Auslieferung der ersteigerten Stücke erfolgt in unseren Geschäftsräumen gegen Bezahlung. Kreditkarten (Mastercard, VISA, American Express), Schecks sowie andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Bankspesen/ Transaktionsgebühren bzw. Kursverluste können zu Lasten des Käufers gehen. Die Auf bewahrung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Versand wird gegen Vorabrechnung des Rechnungsbetrages ausgeführt. Die Versandspesen sowie die Kosten für Versicherung gegen Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Käufers. Übersteigen die tatsäch lichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Differenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.
10. Bei der Ausfuhr von Kulturgütern ist gem. der EG-Verordnung Nr. 116/2009 bzw. § 24 KGSG abhängig von Kategorie und Wert des Objekts ggf. eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Aus Gründen des Artenschutzes können Objekte aus bestimmten, geschützten Materialien (u.a. Elfenbein, Schildpatt, Perlmutt und einige Korallenarten) besonderen Im- und Exportbeschränkungen unterliegen. Zum Zwecke des Exports (insbesondere außerhalb der Europäischen Union) kann hierfür eine spezielle Ausfuhrgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich sein. Entsprechende Ausfuhrgenehmigungen können nur unter strengen Bedingungen erteilt und ggf. auch gar nicht erlangt werden, auch kann der Import dieser Gegenstände in manche Staaten eingeschränkt oder untersagt sein. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, sich über etwaige Im- und Exportbeschränkungen zu informieren. Export und Import entsprechender Objekte erfolgen allein auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
11. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Der Versteigerer ist berechtigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Versteigerung Zahlung geleistet ist, den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag ohne weitere Fristsetzung zu annullieren, Verzugszinsen in
banküblicher Höhe – mindestens jedoch 1 % auf den Bruttopreis je angebrochenen Monat – zu berechnen und von dem Ersteigerer wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat. Zu einem Gebot wird er nicht zugelassen, auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand im vollkaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UNAbkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
13. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Limite.
14. Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der Interessent entweder telefonisch oder schriftlich (im Sinne der Ziffern 5 und 6) den Auftrag zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. Entsprechende Gebote behalten ihre Gültigkeit für 4 Wochen nach Abgabe.
15. Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Versteigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vorstehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend Zuschläge. Kommissionäre haften für die Käufe ihrer Auftraggeber.
16. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt.
David Bassenge, Geschäftsführer und Auktionator
Dr. Markus Brandis, öffentlich bestellter u. vereidigter Auktionator
Stand: Mai 2025

1. The Galerie Gerda Bassenge KG, subsequently called “the auctioneer” carries on business as commission-agent in its own name on behalf of its voluntary consignors. This auction sale is a public one in the sense of § 383 III BGB.
2. The auctioneer reserves the right to combine, to split, to change or to withdraw lots before the actual final sale.
3. All objects put up for auction can be viewed and examined prior to the sale at the times made known in the catalogue. The items are used and sold as is. As long as not explicitly mentioned in the catalogue description, framing is not an inherent part of the offer. As a rule, the condition of the individual work is not given in the catalogue. Catalogue descriptions are made with as much care as possible, but the descriptions do not fall under the statutory paragraph for guaranteed legal characteristics. The same applies for individually requested condition reports. These also offer no legal guarantee and only represent the subjective assessment of the auctioneer while serv ing as a non-binding orientation. The liability for damage to life, body or health shall remain unaffected. In case of a justified claim, however, he will accept the responsibility to make a claim for restitution on behalf of the buyer against the consignor within a period of 12 months, running from the fall of the hammer. In the event of a successful claim the auctioneer will refund the hammerprice plus premium.
4. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be deemed the buyer. In case of identical bids the buyer will be determined by drawing lots. In the event of a dispute the auctioneer has the absolute discretion to reoffer and resell the lot in dispute. He may also knock down lots conditionally.
5. In the case of a written bid the bidder commissions the auctioneer to place bids on his behalf during the auction. In cases where there is a discrepancy between number and title in a written bid the title shall prevail.
6. Telephone and direct online bidding via the internet must be approved in advance by the auctioneer. The auctioneer cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot. For such bidding the regulations of long distance contracts do not apply (Fernabsatzverträge) [cf § 312g II,10 BGB].
7. On the fall of the auctioneer’s hammer title to the offered lot will pass to the acknowledged bidder. The successful buyer is obliged to accept and pay for the lot. Ownership only passes to the buyer when full payment has been received. The buyer, however, immediately assumes all risks when the goods are knocked down to him.
8. A premium of 30% of the hammer price will be levied in which the VAT is included (marginal tax scheme) or a premium of 25% of the hammer price plus the VAT of 7% (paintings, drawings, sculptures, prints, books, etc.) or 19% (manuscripts, autographs letters, applied arts, screen prints, offset prints, photographs, etc.) of the invoice sum will be levied (regular tax scheme). Buyers from countries of the European Union are subject to German VAT. Items marked with an * are subject to the regular tax scheme (premium of 25% of the hammer price plus the current VAT of 19%). Items marked with an ^ are subject to import duty. In these cases in addition to a premium of 27% (marginal tax scheme), the charged import tax of currently 7% will be added to the hammer price.
Exempted from these rules are only dealers from EU-countries, who are entitled, under their notification of their VAT ID-Number, to buy on the basis of VAT-free delivery within the European Union. Notification of VAT ID-Numbers must be given to the auctioneer before the sale.
For buyers from non EU-countries a premium of 25% will be levied. VAT will be exempted or refunded on production of evidence of exportation within 4 weeks of the auction, or, if appropriate, importation to another country. This is taken as given when the dispatch is effected by us.
Live bidding through online platforms entails a transaction fee stipulated by the platform and will be added to the premium (usually 3-5% of the hammer price).
Due to the work overload of the accounting department during auctions, invoices generated during or directly after an auction require careful revision and possible correction; errors excepted. Catalogue images may not be used without permission. Reproduction rights and digital files can be acquired for a fee. Any copyrights of third parties that may still exist remain unaffected by this and may have to be obtained separately.
9. Auction lots will, without exception, only be handed over after pay ment has been made. Credit cards (VISA, Mastercard, American Express), checks and any other form of non-cash payment are accepted only on account of performance. Exchange rate risk and bank charges may be applicable. Storage and dispatch are at the expense and risk of the buyer. If the shipping costs exceed the lump sum on the invoice the outstanding amount will be billed separately.
10. According to regulation (EC) No. 116/2009 resp. § 24 KGSG, export license may be necessary when exporting cultural goods depending on the type or value of the object in question. For the purposes of wildlife conservation, it is necessary to obtain an export license according to regulation (EC) No. 338/97 when exporting objects made from certain protected materials (incl. ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl and certain corals) out of the territory of the European Community. Export licenses for objects made of
protected materials are only granted under strict conditions or may not be granted at all. The import of such objects may be restricted or prohibited by certain countries. It is the buyer’s responsibility to inform himself, whether an object is subject to such restrictions. Export and import of such objects are at the expense and risk of the buyer.
11. The buyer is liable for acceptance of the goods and for payment. The purchase price shall be due for payment upon the lot being knocked down to the buyer. In case of a delayed payment (two weeks after the sale) the purchaser will be held responsible for all resultant damages, in particular interest and exchange losses. In case of payment default the auctioneer will charge interest on the outstanding amount at a rate of 1% to the gross price per month or part of month. In such an event the auctioneer reserves the right to annul the purchase contract without further notice, and to claim damages from the buyer for non-fulfilment, accordingly he can reauction the goods at the buyer’s expense. In this case the buyer is liable for any loss incurred, the buyer shall have no claim if a higher price has been achieved. He will not be permitted to bid.
12. The place of fulfillment and jurisdiction is Berlin. German law applies exclusively; the UN-Treaty (CISG) is explicitly excluded.
13. The prices quoted after each lot are estimates, not reserves.
14. The after-sales is part of the auction in which the bidder places either by telephone or in written form (as stated in number 5 and 6) the order to bid a set amount. Corresponding bids are binding for 4 weeks after submission.
15. By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of these terms of sale by auction and accepts them. Agents who act on behalf of a third party are jointly and separately liable for the fulfillment of contract on behalf of their principals.
16. Should one or the other of the above terms of sale become wholly or partly ineffective, the validity of the remainder is not affected. In the event of a dispute the German version of the above conditions of sale is valid.
David Bassenge, auctioneer Dr. Markus Brandis, attested public auctioneer

As of May 2025

Moderne und Post War & Zeitgenössische Kunst II online unter www.bassenge.com
Vorbesichtigung und Auktion finden wie gewohnt als Präsenzveranstaltungen statt
Catalogues Modern and Post War & Contemporary Art II online at www.bassenge.com
The preview and auction will take place as usual


GALERIE BASSENGE BERLIN