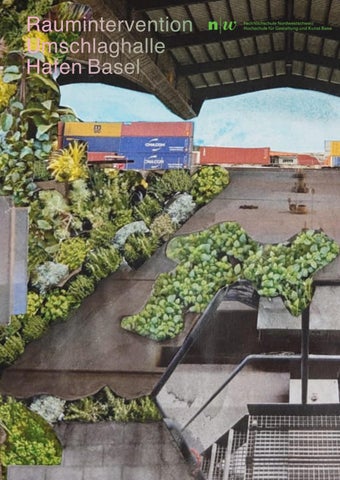Raumintervention Umschlaghalle Hafen Basel

Workshop Raum RAUMINTERVENTION
HGK FHNW
INNENARCHITEKTUR UND SZENOGRAFIE
SEMESTERMODUL GRUNDSTUDIUM Herbstsemester 24/25
DOZIERENDE: Eva Hauck, Stv. Luzia Schuler
ASSISTENZ: Andrea Schorro
STUDIERENDE
Brandenberg Luisa, De Angelis Catalina, Drexler Anja, Fach Stella, Favatà Valeria, Grecu Aaron, Gut Lilly, Hanke Nathalie, Hess Elin, Jost Dominik, Klaiber Seline, Krivokapic Natalija, Kunsch Joel, Margiotta Sebastiano, Nicolini Sofia, Njoki Victoria, Pedrazzi Lisabel, Pun Andree, Rasnayagam Vithura, Rindsfüser Annika, Schmitt Amely Shirin, Stahlberg Timo, Strasky Valentina, Thies Jelle, Turalija Lea, Wassmer Sina, Zheng Xiaoyan
Sich in der Welt zu verorten, für andere Wesen und die Erde mitzudenken, ein Gefühl für Habitat als Lebensraum zu entwickeln befähigt Gestalter*Innen unsere zukünftige Lebenswelt zu denken.
Mein Dank gilt den Studierenden des ersten Semesters und den vielen anderen Helfer*Innen und Expert*Innen, die diese inspirierenden Arbeiten entstehen liessen.
Raumintervention
Ein Ort zum Verweilen für den Hafen Basel
Index
Green Heights
Der grüne Austausch für eine bessere Zukunft
Anja Drexler, Lea Turalija & Valentina Strasky
Chuchi am Hafe
Macht es Sinn das zu entsorgen?
Luisa Brandenberg & Lilly Gut
Trabucco
Zurück zum Wasser
Annika Rindsfüsser & Sebastiano Margiotta
Umschlagpunkt
Gibt es einen sicheren Hafen?
Amely Shirin Schmitt & Stella Fach
FlexDeck
Verschieden Verschieben
Dominik Jost & Jelle Thies
Hafenblicke
Zwischen Umschlag und Ausblick
Elin Hess & Seline Klaiber
Subtract equals Add
Ein Raum der Reflexion
Natalija Krivokapic &Vithura Rasnayagam
Wellen der Veränderung
Nathalie Hanke & Aaron Grecu
Upside Down
Wo Grenzen gesprengt werden
Sofia Nicolini & Timo Stahlberg,
Soft Nest
Wandelbar
Catalina de Angelis & Victoria Njoki
Hotspot
Ein Indoor Grillplatz
Valeria Favatà & Xiaoyan Zheng
Kulturhafen
Coffee, Art and Culture
Sina Wassmer & Lisabel Pedrazzi
RAUMINTERVENTION HAFEN
His(s)tory- die Geschichte des Ortes Annäherung an und Auseinandersetzung mit dem Ort: In zwölf Zweier-Gruppen sind Sie aufgefordert den Ort mit der Kamera, dem Aufnahmegerät und anhand von Skizzen im Überblick aber auch im Detail wahrzunehmen, zu erfahren und zu dokumentieren. Dabei verfolgen Sie nebst der Recherche zur Historie des Ortes Aspekte wie zb: Akustik, Oberfläche, Zwischenräume, versteckte Orte, Raumvolumen, Vertikalität, Horizontalität, Dunkelheit, Nutzungen, Kontext, Sicht. Vielleicht hilft es Ihnen diese Neuentdeckungen in Relation zu Ihrem sehr persönlichen Erinnerungsraum (My-story) zu bringen. Wo finden Sie ähnliche Raumqualitäten oder Atmosphären wieder, wo komplett neue oder andere Qualitäten? Was erinnert Sie hier an diesem Ort an Ihren Erinnerungsraum? Sie ent-decken die vielen Schichten des Ortes. Zoomen Sie immer mehr ein. (Ortsplan, Gebäudeplan, Raumplan, Detailplan).
PLÄNE
Bemühen Sie sich ausserdem um eine Karte, welche den Hafen in seiner urbanen Lage zeigt. Eventuell auch historisches Kartenmaterial. https://map.geo.bs.ch/?lang=de&baselayer_ref=Grundkarte%20farbig&map_x=2611558&map_ y=1270359&map_zoom=5
DETAIL M 1:1 / KONTAKTABZÜGE 1:1
Zum Beispiel: Kontaktabzug des Gebäudes (Latex, Silikon, Gips, Kunstharz, Rubbings Graphite, Kohle...) Dokumentieren Sie den Ort an dem Sie den Kontaktabzug machen photographisch aber auch anhand von Skizzen und Vermassung. Markieren Sie den Ort auf den Plänen des Hafenareals. Überlegen Sie sich gut, was Sie für die 1:1 Kontaktabzüge mitnehmen wollen.
DIAGRAMM
Denken Sie an Aspekte wie Wege und Zirkulation durchs Gebäude. Raum und Volumen, Farbe und Materialität, Übergang von Innen nach Aussen. die Struktur des Gebäudes, Dunkelheit und Licht. Geräusche und Gerüche... Entscheiden Sie was für sie relevant und interessant ist.
MAPPING KONTEXT
Erläuterungen dazu finden Sie auf Handout _08
CONZEPTIONELLE COLLAGE
Erläuterungen dazu finden Sie auf Handout _09
Bringen Sie genügend Arbeitsmaterial mit. Skizzenrolle, Zeichenpapier, Kohle, Graphit, Bleistift, Schnur, 5m Meterband, Klappmeter, Kamera, Tonaufnahmegerät (Handy)
UMSCHLAGHALLE HAFEN BASEL
Industriearchitektur
Bräuning, Leu, Dürig und Aegerter & Bosshardt, 1952/53
Im Umschlaghof am Hafenbecken I (Hafenstrasse 3/ Hochbergerstrasse 162) werden Güter vom Schiff auf die Bahn und auf Camions verladen. Erst aus der Vogelschau erschliesst sich die aussergewöhnliche Dimension der 234 m langen, 50 m breiten und 16 m hohen Halle. Der Blick vom Hafenbecken enthüllt eine ingenieurtechnische Pionierleistung: die erste in der Schweiz im Freivorbau errichtete Tragkonstruktion in vorgespanntem Beton. 32 m ragt die Halle über das Bassin. Die offene Schmalseite zeigt auch die drei Hochbahnkräne, die das Erscheinungsbild des Gebäudes entscheidend prägen. Das Stahlbeton-Skelett – schlanke Pfeiler und Sparren – gliedert den zusammenhängenden Raum der Halle in drei Schiffe mit je einem flachen, mit Welleternit gedeckten Satteldach. Die Wände sind mit Kalksandsteinen ausgefacht. Unterhalb der Laufbahnen ansetzende Fensterbänder aus vorgefertigten Rasterelementen öffnen die Halle dem Licht. An den Fassaden ist die zeitspezifische Vorliebe für plastische Differenzierung ablesbar; deutlich zeigt sich der Zeitstil in der Verwendung der für die 1950er Jahre typischen Leistenstruktur an den Sturzblenden der Tore beim Verladeplatz der Camions. Drei Gleisstränge und zwei Strassen durchqueren die Halle. An diesen liegen der Umschlaghof und der Camionhof, leicht erhöhte Verladeplätze mit Rampen. Der anschliessende, wiederum abgesenkte Lagerhof für Schüttgüter nimmt mit einem Drittel der Gesamtfläche den grössten zusammenhängenden Hallenabschnitt ein. Teil der Anlage ist die auf der Südseite anstossende Halle (Westquaistrasse 2), die die Ausstellung Verkehrsdrehscheibe Schweiz /Schweizerisches Schifffahrtsmuseum beherbergt.
Stephanie Fellmann, 2014 Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Jahresbericht 2014, S.74, 75

FOTO: Archiv Aegerter & Bosshardt, TEC 21 20/ 2016, S.38
Die Luftaufnahme vom März 1926 zeigt das noch intakte Dorf Kleinhüningen. Entlang des Flüsschens Wiese sind die Arbeiten für die Neuanlage der Hochbergerstrasse im Gang, am Hafenbecken I stehen die ersten Silo- und Lagerhaus bauten. Der Westquai verfügt rheinsei-
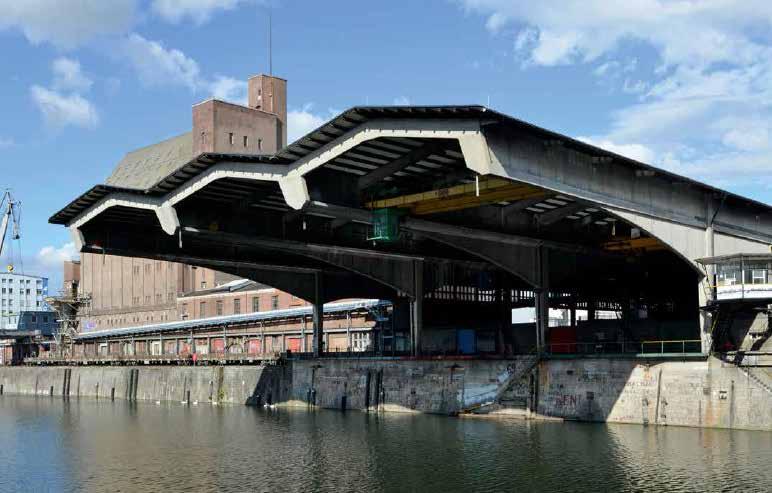
FOTO: Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Jahresbericht 2014, S.74,75
ANNÄHERUNG AN DEN ORT (Vorschlag)
Methode Überlagerung: Fügen Sie Ihren Erinnerungsraum in die Umschlaghalle ein indem Sie die Pläne Ihres Erinnerungsraumes (angepasst an den Massstab der Pläne der Umschlaghalle) über die Pläne des Parkhaus Gebäudes legen. Zoomen Sie ein. Zeichnen S ie im Massstab 1:200 die neue Raumsituation und die Bezüge zum Gebäude.
-welche Geschichte entsteht?
-was für eine Raumintervention wollen Sie schaffen
-welche Materialien scheinen Ihnen sinnvoll und angebrach?
EIN ORT ZUM VERWEILEN
Die Raumintervention soll die Geschichte des Ortes spürbar machen, aufnehmen.
Machen Sie eine konzeptionelle Collage (kein Moodboard!) ihrer Ideen für eine Raumintervention/ eine Atmosphäre. Hierfür benutzen Sie Photokopien Ihrer Zeichnungen und Skizzen, sowie Photos von der Umschlaghalle und ihrer Umgebung, dem Hafenareal. Weitere Materialien stehen Ihnen offen. Die Collage kann auch durch Zeichnung ergänzt oder erweitert werden. Sie soll eine «Vision» des Raumgefühls dar stellen, welches Sie in der Umschlaghalle und Ihrem Kontext erzeugen wollen. Erarbeiten sie per Skizze, Collage, Zeichnung und Modell erste Ideen für eine Raumintervention in der Umschlaghalle
–Welche Materialien wären interessant?
–Welche Bezüge mit dem vorhandenen Raum wollen aufgegriffen oder verstärkt werden?
–Was ist die Funktion Ihres neuen
Raumgefü-g es?
–Welcher Massstab ist der Richtige?
Mi 20.11.2024 | WO 47 Ortsbegehung
Treffpunkt Hafenmuseum
9:00 Uhr
Fr 22.11.2024 | WO 47
Pin up Präsentation Ort
Konzeptionelle Collage
Mental Map/ Mapping
8:30 Uhr, Raum A 2.07
Do 28.11.2024| WO 48
Präsentation 1 Min Film
Input Modell ; Modellbau
8:30 , Raum A -1.09
Ab 11:00 Uhr Tischgespräche
Materialisierung/ Konzept
Fr 29.11.2024| WO 48
Ab 8:30 Uhr Tischgespräche
Materialisierung/ Konzept
Z Zwischenpräsentation
Do 6 12 2024 | WO 49 8:30, Raum A -1 09
Di 17 12 2024 | WO 51 Konzept / Materialität / Modell Intervention
Do 19 12.2024 | WO 51 Tischgespräche
Mo 06 + 07.01.2025 | WO 2 Fotoworkshop
Parallel Tischgespräche laut Miroboard Liste Konzept / Materialität / Modell Intervention
8:30, Raum A 2.07
Do 9.01.2025 | WO 2 Selbständiges Arbeiten
E Endpräsentation
Fr 10 01 2025| WO 2
9:00 Uhr Raum A 2 07
Abgabe
Digitals Doku-Template
Mi 25.01.2023| WO 3


In my collages and conceptual drawings I focused on the character and possible behaviour of spaces not relevant to the conventional needs or habits. I was interested in the relationship of these ‘accidents’ with the ‘meaningful’ spaces and how the one affects the other.
BILD OBEN: Konstantinos Vatanidis
BILD LINKS: Golbahar Adib
„Das Herzstück des
dung von Natur und
Projekts
futuristischem Die Halle wird durch ihre zensäulen und das Zusammenspiel Technik und Grün ein Leuchtturmprojekt urbane Nachhaltigkeit.“
Projekts ist die Verbinfuturistischem Design. ihre markanten PflanZusammenspiel von Leuchtturmprojekt für
Green Heights
« Der Grüne Austausch für eine bessere Zukunft »

Im Umschlaghof am Hafenbecken I (Hafenstrasse 3 / Hochbergerstrasse 162) werden Güter vom Schiff auf die Bahn und auf Camions verladen.Erst aus der Vogelschau erschliesst sich die aussergewöhnliche Dimension der 234 m langen, 50 m breiten und 16 m hohen Halle. Der Blick vom Hafenbecken enthüllt eine ingenieurtechnische Pionierleistung: die erste in der Schweiz im Freivorbau errich-
tete Tragkonstruktion in vorgespanntem Beton. 32 m ragt die Halle über das Bassin. Die offene Schmalseite zeigt auch die drei Hochbahnkräne, die das Erscheinungsbild des Gebäudes entscheidend prägen. Unterhalb der Laufbahnen ansetzende Fensterbänder aus vorgefertigten Rasterelementen öffnen die Halle dem Licht. Drei Gleisstränge und zwei Strassen durchqueren die Halle.
An diesen liegen der Umschlaghof und der Camionhof. Teil der Anlage ist die auf der Südseite anstossende Halle, die die Ausstellung Verkehrsdrehscheibe Schweiz / Schweizerisches Schifffahrtsmuseum beherbergt.

01 Eigene Abbildung, Modellfotografie
Erste Eindrücke
Erste Eindrücke
Als wir die Halle zum ersten Mal betreten haben, ist uns allen die Höhe der Halle aufgefallen. Die Halle bietet nicht nur sehr viel Raum durch ihre Fläche, sondern auch durch den hohen offenen Raum. Uns ist ebenfalls aufgefallen, dass die Halle nicht sehr viel Lichteinstrahlung durch das grosse geschlossene Dach bietet.
Die Halle wirkte eher dunkel. Das Element, welches den Raum am meisten gestaltet und unterteilt, sind die Aluminiumblöcke, welche im Raum gelagert werden. Uns ist aufgefallen, dass das Aluminium das Licht, welches auf sie traf, reflektierte und somit den Raum heller wirken liess. Diese Reflexionen haben wir in den Abbildungen darzustellen versucht. In der Umgebung ist uns aufgefallen, dass es viele Mehrfamilien Häuser gibt. Die meisten dieser Häuser hatten jedoch, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Garten.

Geschäfte
Der Hafen liegt im Industriegebiet Klybeck. In der Umgebung befinden sich zahlreiche Geschäfte unterschiedlicher Branchen, was viele Arbeitsplätze schafft und zahlreiche Mitarbeiter*innen anzieht. Dabei wird schnell deutlich, dass es in diesem Gebiet an Grünflächen fehlt. Eine weitere Auffälligkeit ist die hohe Dichte an Schulen, die den Hafen umgeben. Mit unserer grünen Ausarbeitung schufen wir einen geeigneten Ort.
für Schulausflüge der zahlreichen Schulen im Klybeck. Gleichzeitig war es unser Ziel, der Bevölkerung in dieser Region etwas zurückzugeben – als Ausgleich für die Auswirkungen des Hafens – und einen Ort zu schaffen, von dem alle profitieren können.
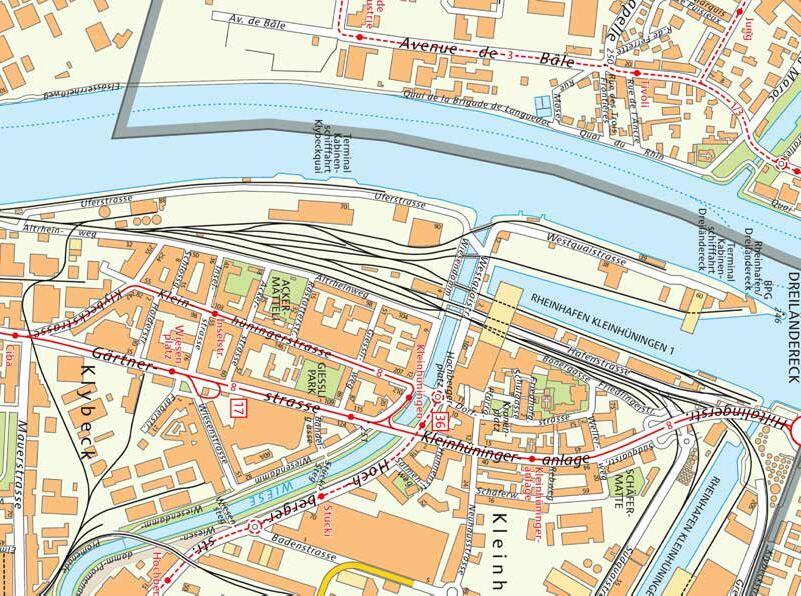




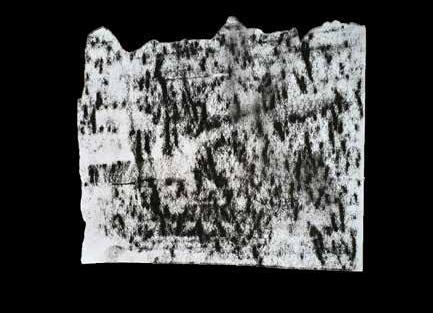

Umschlagshalle


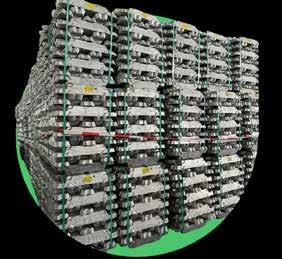


Konzeptideen
Matrosenschule
Da wir uns mit einem Hafen beschäftigen, haben wir zu Beginn die Idee einer Matrosenschule in Erwägung gezogen. Die Grundidee war, dass ehemalige Fischer*innen und Seeleute ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Arbeitsleben teilen, um ihr Wissen weiterzugeben.
Allerdings haben wir diese Idee verworfen, da es an interessierten Zielgruppen mangelte. Ein weiterer Grund war, dass sich der Fokus stark auf das Segeln konzentriert hätte, was aufgrund der Gegebenheiten des Rheins nur schwer umsetzbar wäre.
Matrosenschule
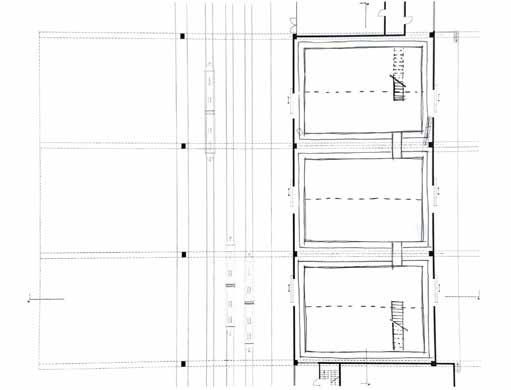

Schrebergarten
Da wir uns in einem Industriegebiet befinden, in dem viele Wohnblöcke stehen und private Gärten eine Seltenheit sind, haben wir die Idee von Schrebergärten in Erwägung gezogen. Unser Ziel war es, der Bevölkerung den Raum zurückzugeben, der ihr durch den Hafen genommen wurde.
Vertical Gardening Aufgrund der chemisch belasteten Böden haben wir uns für vertikales Gärtnern entschieden. So nutzen wir die gesamte Hallenfläche optimal und umgehen die Problematik des kontaminierten Bodens. Da der Ort weiterhin für Schulungen und Wissensvermittlung dient, haben wir ein Podium im Zentrum des Raumes für Workshops und Vorträge integriert.
Vertical Gardening
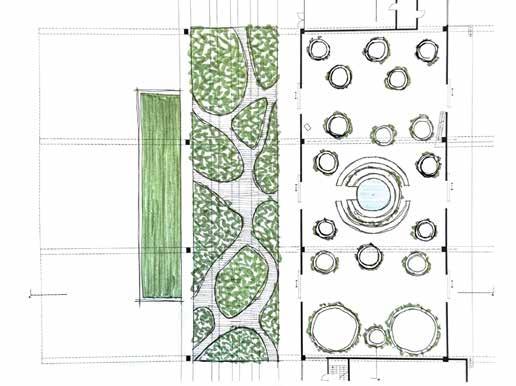
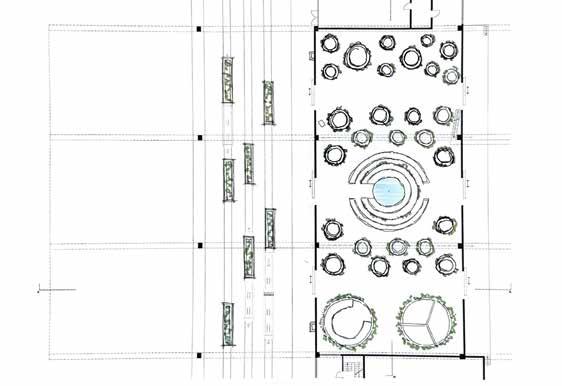
Konzept
Vision
Das Fehlen von Grünflächen und Naturfarben ist in dieser Gegend besonders spürbar. Wir bringen die Natur zurück ins Klybeckgebiet und verwandeln eine industriell geprägte Umgebung in eine nachhaltige, grüne Räumlichkeit.
Durch innovative Anbauweisen, gemeinschaftliches Engagement und Umweltbildung schaffen wir ein generationsübergreifendes Projekt, das sowohl ökologisch als auch sozial einen Mehrwert bietet. Deshalb laden wir alle herzlich ein, an der Gestaltung unserer Hochbeete und der Vertikalen Landwirtschaft mitzuwirken.
Zukunftsziele
Wir wollen in die Begrünung des Klybeckgebietes Nachhaltigkeit und Bildung integrieren. Dieses generationsübergreifende Projekt fördert nicht nur das Miteinander von Jung und Alt, sondern legt auch grossen Wert auf Schulungen zu nachhaltiger Agrarwirtschaft und Alternativen zur konventionellen Agronomie.
Unser Ziel ist es, Wissen über gesunde Ernährung und Selbstversorgung zugänglich zu machen und über den Einfluss unseres Konsums auf die Natur aufzuklären. So möchten wir Nachhaltigkeit für den Einzelnen, die Gemeinschaft und die Umwelt fördern.

Durch die Symbiose von einer traditionelleren und futuristischen Anbauweise möchten wir Austausch anregen. Durch diesen Austausch und den Vergleich können neue Erkenntnisse gewonnen und Stadtpunkte generiert werden.
Unser Projekt bietet Klybecker Schulen einen Bildungsort, fördert den Wissensaustausch und schafft Bewusstsein für Ressourcenknappheit. Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzugestalten, zu lernen und von ihrer Arbeit zu profitieren.

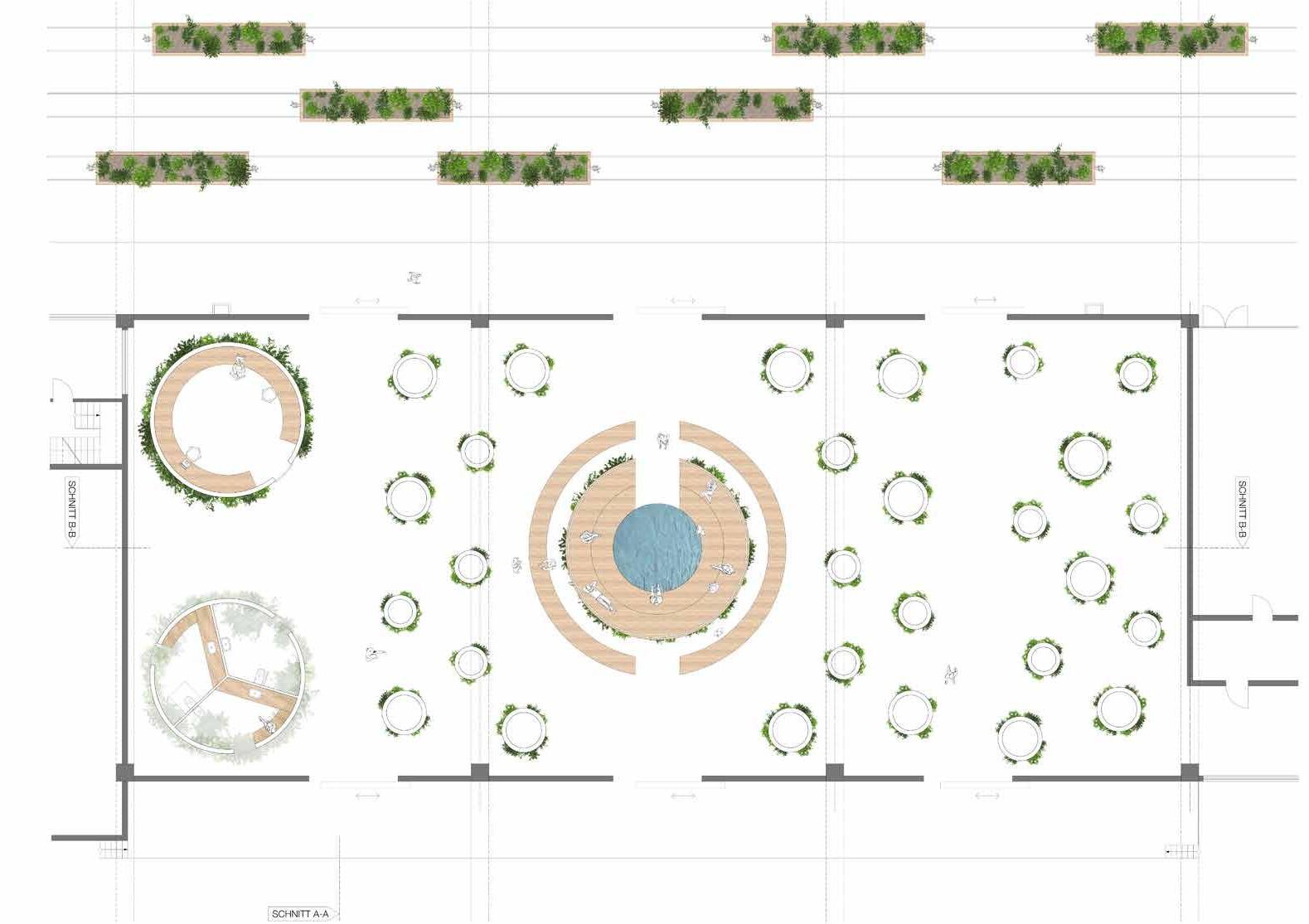
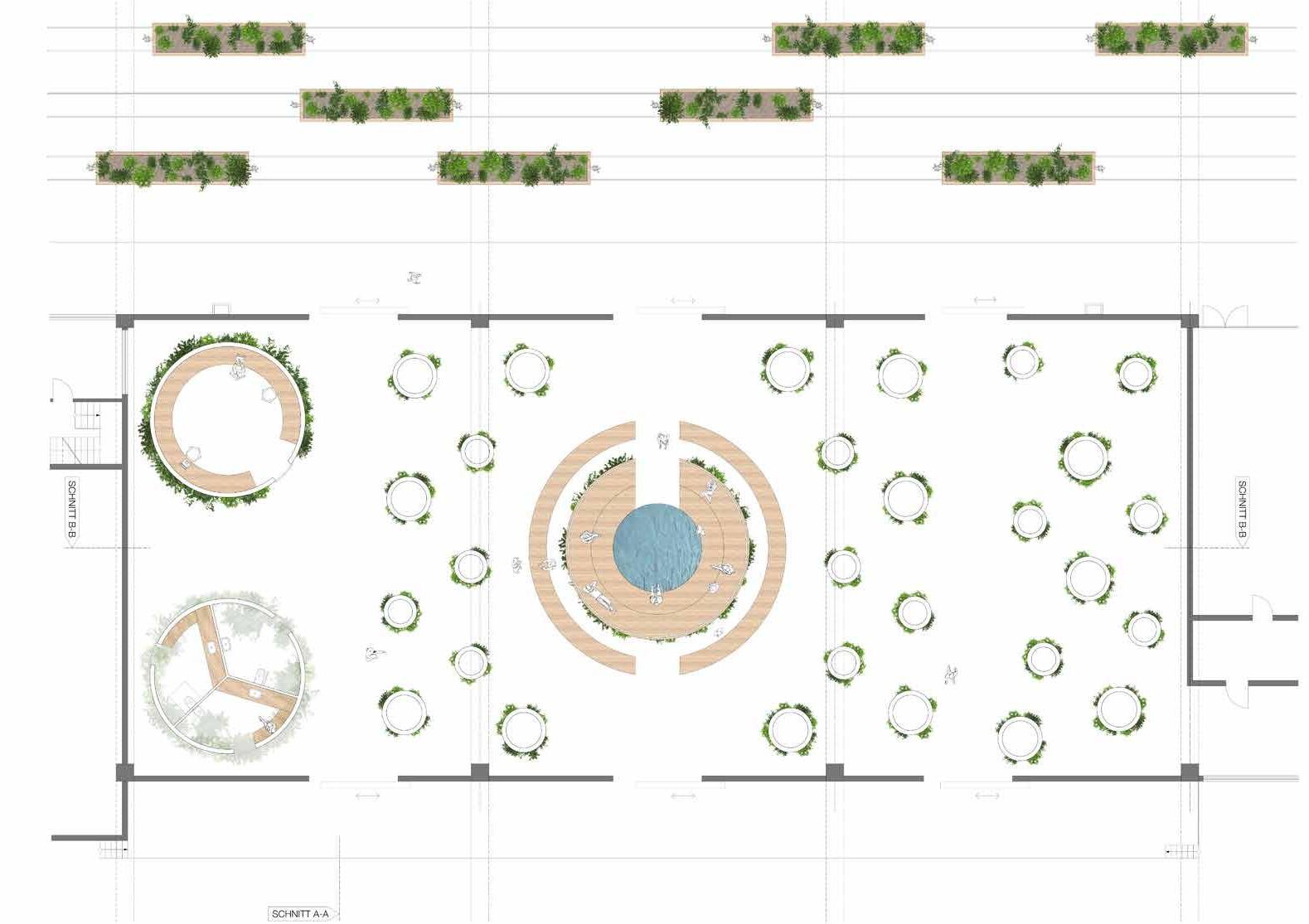


25 Eigene Abbildung, Schnitt A-A
26 Eigene Abbildung, Schnitt B-B


Bildung
Im Zentrum der Halle steht ein futuristischer Versammlungskreis, umgeben von üppigen Pflanzen. Dieser Ort dient als Raum für Schulungen und Vorträge. Wir haben bewusst auf ein Podest verzichtet, um das Gefühl von Hierarchie zu vermeiden. Die Zuhörer*innen haben ausreichend Platz, um sich frei zu bewegen und ihr Lernmaterial bequem auf den Treppen auszubreiten.
Unterhalb des Versammlungskreises befindet sich eine Zisterne, die mit unserem Wassersystem verbunden ist. Die Dozent*innen können ihre Vorträge direkt in der Mitte des Versammlungskreises halten. Zusätzlich lässt sich von der Decke eine Leinwand herablassen, die oberhalb des Eingangs angebracht ist, um allen eine optimale Sicht zu ermöglichen.
Ein angrenzender Marktstand bietet lokalen Produzent*innen die Möglichkeit, ihre Waren anzubieten und so die regionale Wirtschaft zu fördern.









Wassersystem
Für unseren Garten haben wir uns entschieden, Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen zu sammeln. Denn Regenwasser soll besser für die Pflanzen sein, da dieses einen geringeren Kalkgehalt vorweist als Leitungswasser. Denn wenn der Kalkgehalt im Wasser zu hoch ist, können einige Pflanzen schaden davon nehmen. Dies soll zur Optimierung des Gartens bei führen.
Das Wasser wird durch das leicht steigende Dach das Wasser auf eine Seite des Dachs leiten. Dort wird das Wasser über ein Fallrohr in den Boden geleitet, weitergeleitet in Leitungen und fliesst schlussendliach in einer Zisterne inmitten der Halle zusammen. Die Zisterne hat absichtlich ein durchsichtiges Fenster im Boden, um darauf aufmerksam zu machen und über Wasserqualität und Verschmutzung aufzuklären.























WC
Unser rundes WC wurde in drei Bereiche unterteilt. Der grösste Bereich ist für Menschen mit Behinderungen vorgesehen. Nebenan gibt es ein genderneutrales WC. Zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres WC eingebaut, das speziell für Besucher*innen gedacht ist, die keine Medikamente konsumieren müssen.
Die Fäkalien dieser Besucher werden anschliessend zur weiteren Verarbeitung für die Ernte genutzt. Dadurch möchten wir das Bewusstsein der Besucher*innen schärfen, damit sie mitentscheiden können und auf die Auswirkungen aufmerksam gemacht werden.
Labor
Unser integriertes Labor, das sich in einer Ecke des Innenraums befindet, dient dazu, verschiedene Proben zu untersuchen und zu experimentieren. So wird beispielsweise das Anpflanzgut aus dem Vertical Gardening mit dem Gemüse aus den Hochbeeten verglichen. Gibt es Unterschiede oder sind die Merkmale des angewachsenen Gemüses identisch? Darüber hinaus werden die Fäkalien aus unserem WC darauf geprüft, ob sie vollkommen medikamentenfrei und für die Ernte geeignet sind.
Auch unser Labor nimmt eine runde Form an. Es ist aus Glas gebaut, sodass Besucher*innen einen guten Einblick in den Prozess haben und ihn mitverfolgen können. Im Inneren befindet sich ein runder Holztisch, und das Labor wird zusätzlich mit grünen Pflanzen geschmückt.
































































Modellbau
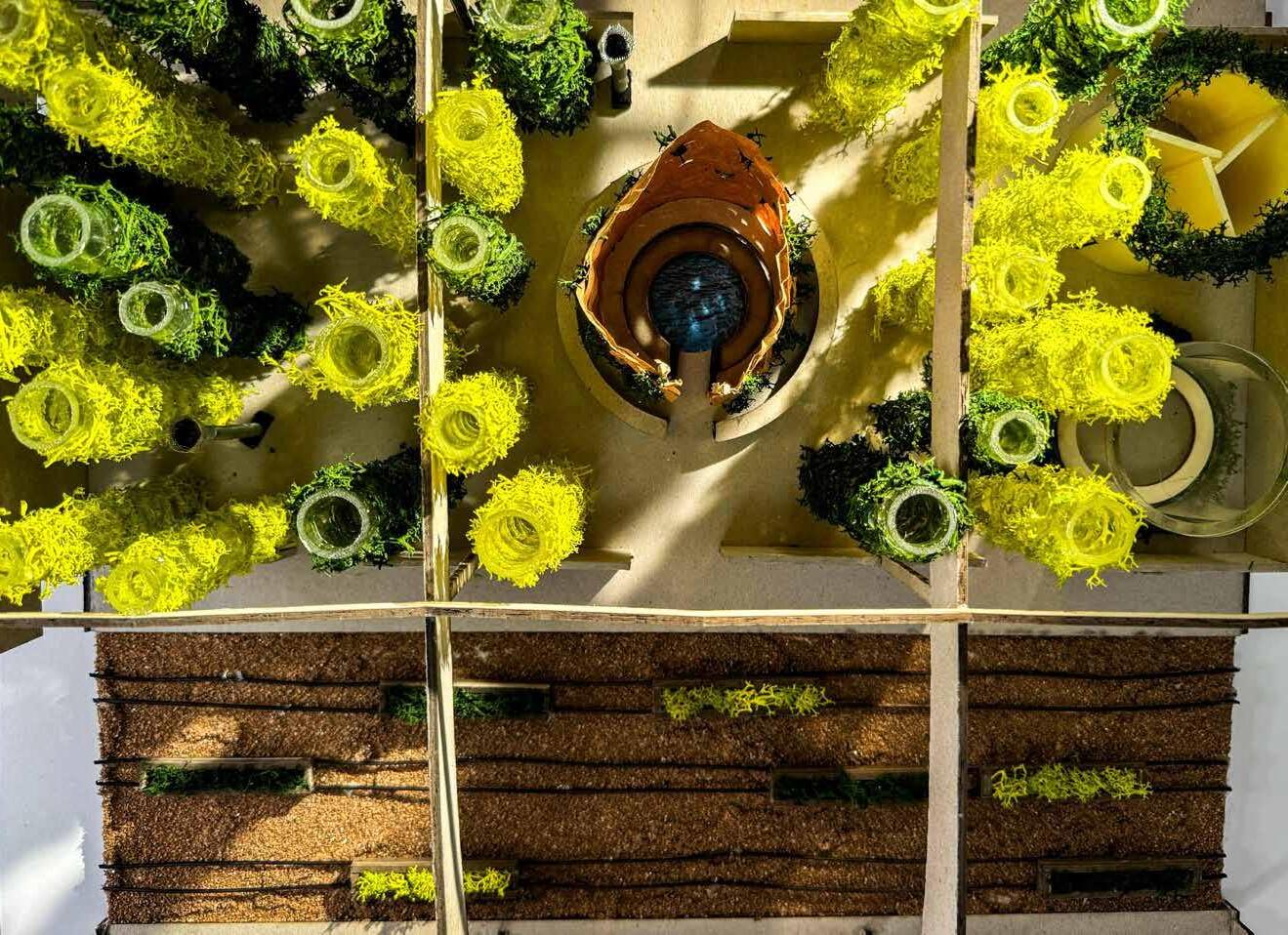
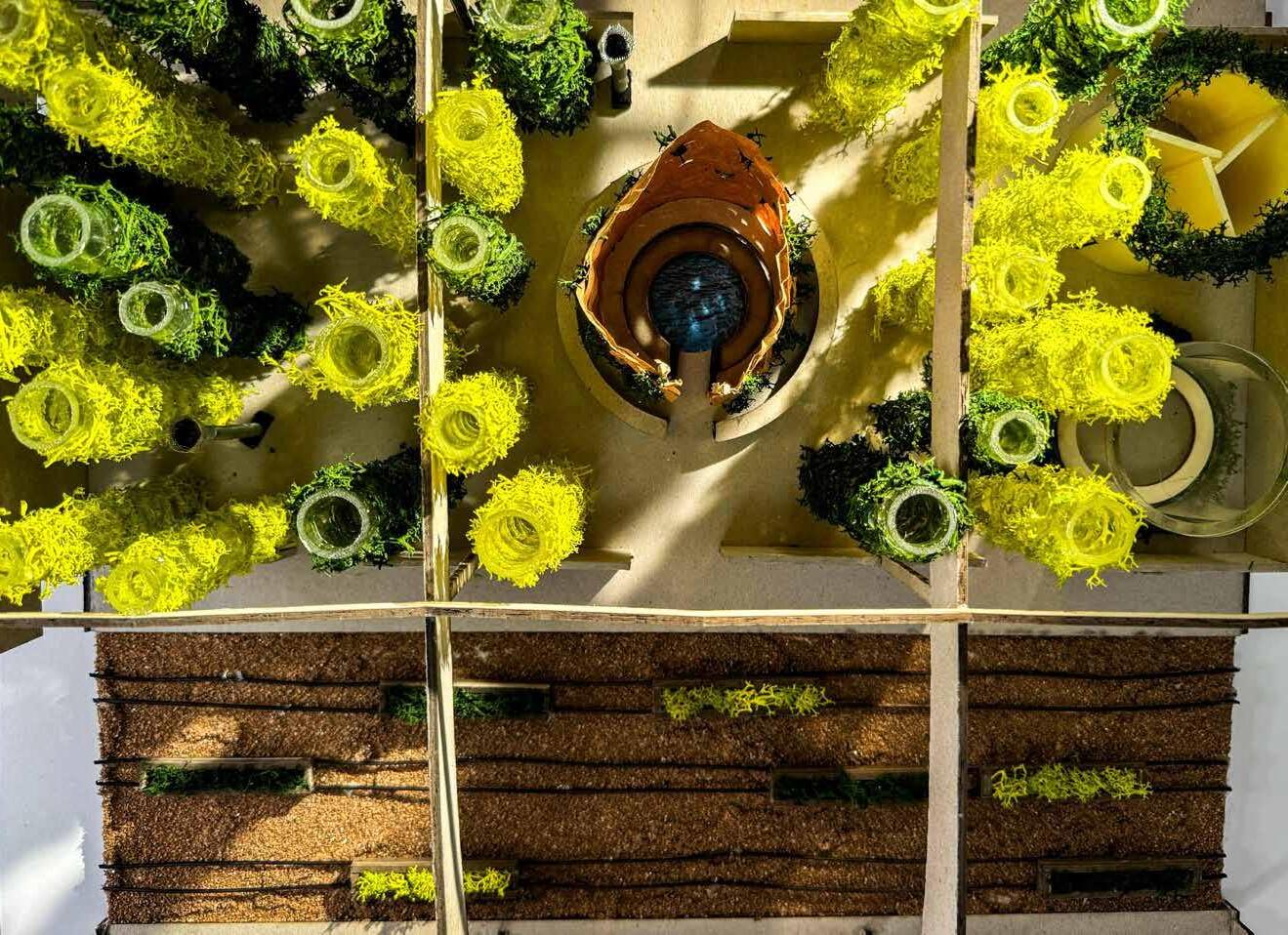
Materialität des Modells
Für die Umsetzung des Modells haben wir verschiedene Materialien verwendet, die die unterschiedlichen Bereiche und Elemente veranschaulichen.
Markt
Um die ovale Bewegung des Marktes darstellen zu können, haben wir Furnier eingesetzt. Dieses Material, bot die notwendige Flexibilität und Stabilität, um die gewünschte Form umzusetzen.
Forum
Das Forum wurde mit Furnier, Zahnstochern und Moos gestaltet. Die Zahnstocher dienten zur Strukturierung und Stabilisierung, während das Moos als gestalterisches Element für eine natürliche Atmosphäre verwendet wurde.
Obst
Die Obstmodelle wurden aus Papier gefertigt und mit Wasserfarben farbenfroh bemalt.
Fenster
Für die Fenster haben wir Plexiglas verwendet, da es eine transparente und stabile Alternative darstellt, die Glas sehr gut nachahmt.
Säulen
Die Säulen wurden aus Plexiglas gefertigt und mit Moos ergänzt, um sie sowohl funktional als auch dekorativ in die Gestaltung einzubinden.
Leinwand
Weisser Stoff sorgt für eine glatte, realistische Projektionsfläche.
Wassersystem
Das Wassersystem wurde mithilfe von Kupferdraht visualisiert, der die Leitungen und Strukturen symbolisiert.
Zisterne
Für die Zisterne haben wir ein Bild verwendet, das durch Plexiglas geschützt wurde, um eine klare und saubere Darstellung zu erzielen.



31-36 Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen







Reflexion
mit dem Endprojekt insgesamt sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf die Säulen, die das Vertical Gardening darstellen, da die Belichtung wie vorgesenachgeahmt werden kann. Jedoch hatten wir einige Schwierigkeiten mit dem Lasercutten, unser erstes Mal war.
Wir sind mit dem Endprojekt insgesamt sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf die Säulen, die das Vertical Gardening darstellen, da die Belichtung wie vorgesehen gut nachgeahmt werden kann. Jedoch hatten wir anfangs einige Schwierigkeiten mit dem Lasercutten, da es unser erstes Mal war.
mit der Raumwirkung als Ganzes sind wir sehr zufrieden. Die grossen Säulen wirken modern, jedoch steril, wie es bei Vertical Gardening oft der Fall ist. runden Formen der verschiedenen Objekte lassen Raum offener wirken und vermitteln das Gefühl, freier darin bewegen zu können. Durch das offene und die Einblicke ins Labor wirkt alles zugängund lädt dazu ein, sich zu beteiligen.
Zusammenarbeit verlief problemlos und hat Spass gemacht. Wir konnten viel voneinander lerjeder konnte seine Ideen ins Projekt einbringen, unsere Kommunikation hat sehr gut funktioniert. zukünftiges Projekt wäre es jedoch hilfreich, Terminplan zu erstellen, um die Planung weiter unterstützen.
Auch mit der Raumwirkung als Ganzes sind wir sehr zufrieden. Die grossen Säulen wirken modern, jedoch nicht steril, wie es bei Vertical Gardening oft der Fall ist. Die runden Formen der verschiedenen Objekte lassen den Raum offener wirken und vermitteln das Gefühl, sich freier darin bewegen zu können. Durch das offene Forum und die Einblicke ins Labor wirkt alles zugänglicher und lädt dazu ein, sich zu beteiligen.
Unsere Zusammenarbeit verlief problemlos und hat viel Spass gemacht. Wir konnten viel voneinander lernen, jeder konnte seine Ideen ins Projekt einbringen, und unsere Kommunikation hat sehr gut funktioniert. Für ein zukünftiges Projekt wäre es jedoch hilfreich, einen Terminplan zu erstellen, um die Planung weiter zu unterstützen.
Abbildungsverzeichnis
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt
Eigene Abbildung, Kontaktabzüge Umschlagshalle
Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt
Eigene Abbildungen, Ortsaufnahmen
Eigene Abbildung, Kontaktabzüge Umschlagshalle
Eigene Abbildungen, Video Stills
Eigene Abbildungen, Ortsaufnahmen
Eigene Abbildungen, Video Stills
Eigene Abbildungen, Planüberlagerungen
Eigene Abbildung, Collage
Eigene Abbildungen, Planüberlagerungen
Eigene Abbildung, Grundriss
Eigene Abbildung, Collage
Eigene Abbildung, Grundriss
Eigene Abbildung, Schnitt A-A
Eigene Abbildung, Schnitt A-A
Eigene Abbildung, Schnitt B-B
Eigene Abbildung, Schnitt B-B
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Forum
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Forum
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung WC
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung WC
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Labor
Eigene Abbildung, Explositionszeichnung Labor
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen
Eigene Abbildungen, Modellfotografien & Visualisierungen
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Eigene Abbildung, Modellfotografie


„warum nicht weiterverwenden?“
weiterverwenden?“






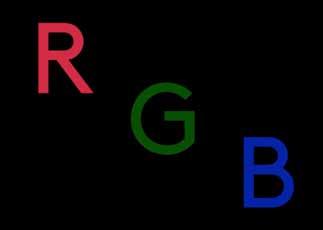










Gassenküche (n.d.)
Chill and Soup (n.d.)
Schweizer Tafel (n.d.)
Gassenküche (n.d.)
Tischlein Deck Dich (n.d.)
Too Good To Go (n.d.)
Wert!stätte (n.d.)
Caritas (n.d.)
FoodAngles (n.d.)
Madame Frigo (n.d.)
FoodSharing (n.d.)

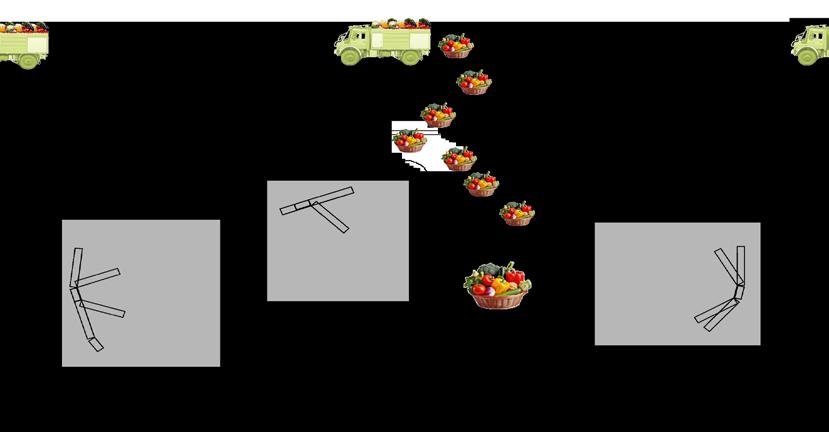




























































































































«Ein Knotenpunkt aus gegnungsort wird, welcher zum Rhein und den Rhein bringt. Der Wal von Kleinhüningen.»
aus Netzen, der zum Bewelcher die Menschen Rhein zu den Menschen Kleinhüningen.»
Trabucco Zurück zum Wasser
Annika Rindsfüser und Sebastiano Margiotta
KONZEPT
Das Hafenbecken 1 in Basel wurde stillgelegt, es wird nur noch das Hafenbecken 2 benutzt. Die grosse Umschlaghalle am Hafenbecken 1 steht leer und wurde ausgeräumt. Damit das Hafenbecken und die Umschlaghalle besser in die Gesellschaft integriert werden können, wollen wir einen Aufenthaltsort schaffen. Wir möchten eine Installation bauen, die über den Rhein ragt, und die Menschen fasziniert und dazu anregt, mehr Zeit am Wasser zu verbringen. Da ein Hafen immer mit Wasser zusammenspielt und es ein wesentliches Element für einen Hafen ist, möchten wir mit dem Element arbeiten. Wir lassen unsere Installation über das Wasser ragen, so dass über dem Wasser verweilt werden kann. Da das Hafenareal nicht von Menschen besucht wurde, während es in Betrieb war, wollen wir das ändern und den Rhein zu den Menschen bringen und die Menschen zum Rhein. Gewässer sind in Kleinhüningen von einer langen Geschichte, genauso wie die Fischerei. Den Gedanken an das ehemalige Fischereidorf greifen wir mit unserer Installation auf. Unsere Installation ist inspiriert von den Trabucchi, den klassischen Fischerhäuschen, mit den aussen hängenden Fischernetzen. Aber auch die Reusen haben uns zu unserer Form inspiriert.
Die Bevölkerung soll nach draussen an den Rhein gelockt werden. Es soll ein Ort zum Verweilen und ein Gemeinschaftsort werden. Das Zusammentreffen der Menschen wird gefördert. Auch werden Ressourcen, die bereits bestehen, genutzt. Die Installation wird nur in die Halle interveniert. Alle Vorteile der Halle werden also genutzt, nämlich hat sie ein Dach und ist trotzdem offen. Man ist also geschützt, aber trotzdem draussen.
Alle Menschen sollen unsere Installation besuchen kommen: Anwohnende, Hafenbegeisterte, Tourist:innen, Kunstbegeisterte, Performancekünstler:innen, Veranstaltungskünstler:innen. Unsere Installation soll ein Knotenpunkt werden. So wie zu Betriebszeiten, ein Ort zwischen Anlieferung, Umschlag und Auslieferung, soll es ein Ort werden, an dem die Menschen zusammentreffen, zusammen Zeit verbringen und das ohne Konsumzwang oder sonstige Anforderungen.


Umschlaghalle und Hafenbecken
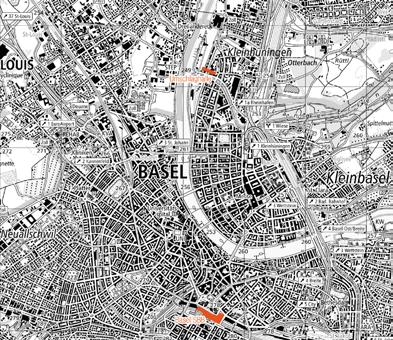

ORTSBEGEHUNG UND INSPIRATION
Als wir die Umschlagshalle besucht haben, empfanden wir sie als kalt und ungemütlich. Es war definitiv kein Ort des Verweilens und wir wollten nicht länger als nötig dort bleiben. Wir machten viele Fotos, machten Kohleabdrücke und versuchten uns so ein Bild des Ortes zu machen.
Erst mit unseren Nachforschungen, da wir beide nicht ortsansässig waren, kamen wir darauf, dass Kleinhüningen ein ehemaliges Fischerdorf war. Dieser Fakt wurde zu unserer grössten Inspiration. Wir kamen so auf die Idee, den Gedanken an das ehemalige Dorf zu gebühren, indem wir die Struktur von Netzen wieder auffassten. Gleichzeitig wollten wir einen Aufenthaltsort schaffen. So kamen wir auf die Idee eine grosse Installation zu bauen, welche aus einer Netzstruktur besteht und gleichzeitig dazu einlädt, an diesem Ort zu verweilen.
KONZEPT EINES ÖFFENTLICHEN ORTES
- Öffentliche Räume stehen allen Menschen unabhängig vom Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialen Status zur Verfügung.
- Öffentliche Räume stehen zur Gemeinnutzung zur Verfügung und fördern soziale Interaktionen, Erholung, Bewegung und kulturellen Austausch.
- Öffentliche Räume können sehr vielfältig in ihrer Nutzung sein. Sie sind multifunktional und können für verschiedene Aktivitäten genutzt werden.
- Öffentliche Orte haben oft eine symbolische Bedeutung und prägen das Gemeinschaftsgefühl.
- Öffentliche Räume unterliegen häufig Regeln und Vorschriften, z.B. durch Gemeinden oder lokalen Behörden, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Die Gestaltung eines öffentlichen Raumes beeinflusst, wie er wahrgenommen und genutzt wird. Attraktiv gestaltete Räume fördern die Aufenthaltsqualität.







Kohleabdrücke der Aluminiumblöcke
Collage Umschlaghalle und Trabucco
Collage
FORMGEBUNG
Bei der weiteren Recherche sind wir auf Fischreusen und die sogenannten «Trabucchi» gekommen, welche heutzutage immernoch von Fischern benutzt werden. Diese Vorrichtungen zum Fischen inspirierten uns zu der Formgebung unserer Installation.



Scan mit Aluminiumnetz zur Findung der Form
Modell mit Referenzperson
SKIZZEN ZUR FORMFINDUNG

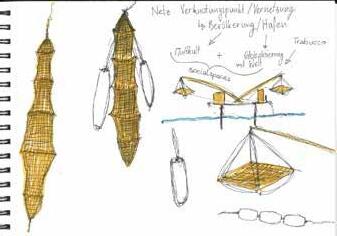




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
Die technischen Zeichnungen wurden im CAD Vectorworks gezeichnet. Ausgedruckt auf einem A0 Plan sind sie im Massstab 1:75.
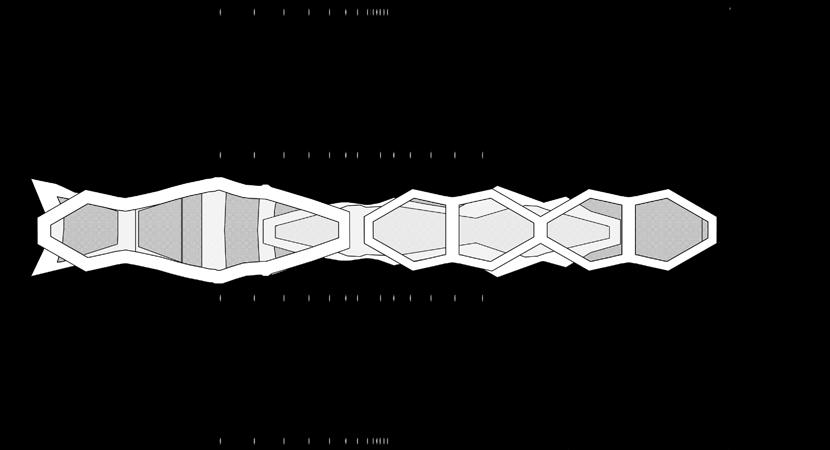
Aufsicht der Installation
Längsschnitt
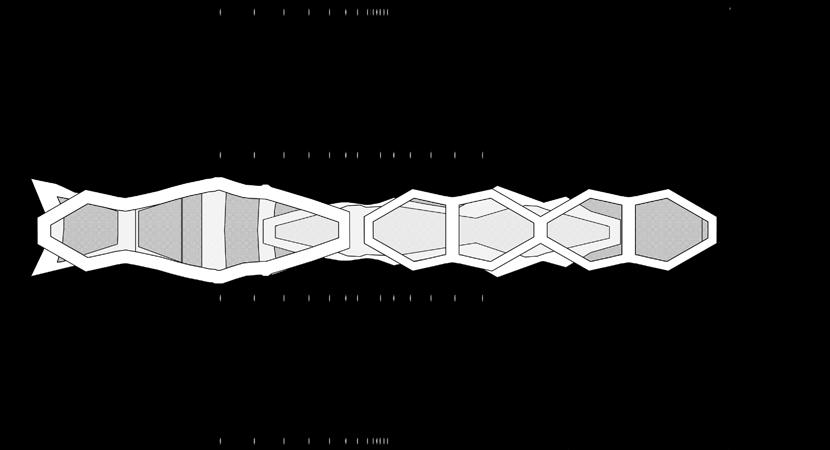

Längsansicht
Querschnitt

Mögliche Zukunftsvision
MATERIALISIERUNG
Das Material, welches wir für die Installation geplant haben, ist weisses Stahlnetz. Dieses ist stabil genug, um Menschen zu tragen und trotzdem arbeitet es gut mit dem Wetter und Temperaturen. Dazu haben wir zwei Referenzbilder gefunden.
Die weisse Farbe würde sich von der grauen, dunklen Halle abheben und einen Kontrast schaffen.


6 Abbildung 7: Weisse Stahlvorrichtung, https://www.okabe-net.com/yuugu-sekourei/3297/ 7 Abbildung 8: Weisse Stahlvorrichtung 2, https://www.okabe-net.com/yuugu-sekourei/3297/

Ansicht Richtung Silo






FAZIT
Mit unserer Installation überragen wir die Umschlaghalle. Wir sprengen den Rahmen und bauen über sie hinaus. Dadurch steht unsere Installation im Vordergrund und nicht die Umschlaghalle. Genau das ist beabsichtigt und gewollt, denn wir wollen die Aufmerksamkeit auf unsere Intervention lenken. Die Installation soll nicht nur in der Umschlaghalle stattfinden und nicht vom Dach der Decke eingeschränkt und überschattet werden.
Trabucco ragt weiter über das Hafenbecken, als die Umschlaghalle selbst, wir denken weiter als nur bis zum Dach der Halle, was unserem Projekt Aufmerksamkeit verleiht.
Den Gedanken an das alte Fischereidorf konnten wir mit den Trabucchi und den Fischreusen aufgreifen, und uns ist eine stimmige Intervention gelungen. Unsere Installation ist für viele Szenarien geschaffen. Ob für Auftritte, Performances, Familientage, gemütliche Treffen mit Freund:innen, oder um die freie Zeit draussen zu geniessen, alles ist möglich.


«Wenn wir etwas am Klima deutlich gemacht werden, muss - Olafur Eliasson
ändern wollen, muss es muss physisch sein.»
Umschlagpunkt
Gibt es einen sicheren Hafen?
UMSCHLAGHALLE
Die erste Annäherung an den Ort begann mit einer Führung von Klaus Spechentauser von der kantonalen Denkmalpflege durch das Hafenareal, die Bernoulli-Silo und zuletzt die Umschlaghalle. Die Studierenden hatten die Möglichkeit, mit Kameras alles für sie Interessante und Relevante festzuhalten. Klaus informierte uns dabei ausführlich über die Geschichte des Ortes.
Bei unserem zweiten Besuch näherten wir uns dem Ort mithilfe von Skizzen, Materialrecherchen, Kontaktabzügen, Diagrammen, Mental Mapping und einer Kontextkarte. Wir machten uns vertraut mit der Atmosphäre, Akustik, dem Raumgefühl, der Nutzung sowie dem Kontext des Ortes und des Raumes.
Die Umschlaghalle in Kleinhüningen diente ursprünglich dem Abtransport von Containern vom Schiff auf die Schiene sowie zur Zwischenlagerung. Heute wird dieser dreischiffige Bau nur noch teilweise für den Güterumschlag genutzt. Aktuell gibt es keine bestätigten Pläne, die Umschlaghalle in Wohnraum umzuwandeln. Allerdings existieren Visionen und Konzepte für eine mögliche Umnutzung. So präsentierte beispielsweise der Architekt Philipp Walker in seiner Arbeit eine Vision für den Umschlaghof des Containerhafens Kleinhüningen, die einen zweistöckigen Aufbau für Wohnnutzung vorsieht, wobei darunter ein öffentlicher Raum für Märkte oder Spielplätze entstehen könnte. 1
Solche Überlegungen spiegeln den allgemeinen Trend wider, industrielle Hafenareale in multifunktionale Stadtquartiere zu transformieren, die den aktuellen Bedürfnissen nach Wohnraum, Arbeit und Freizeit gerecht werden. Ein Beispiel dafür ist das Projekt «klybeckplus», bei dem in den Quartieren Kleinhüningen und Klybeck neue Wohn- und Arbeitsräume geschaffen werden sollen.2



VERORTUNG UMSCHLAGHALLE
Adresse: Hochbergerstrasse, Basel, Schweiz Umgebung:
Die Umschlaghalle liegt nahe der Grenze zu Deutschland und Frankreich, was ihre Bedeutung als logistisches Drehkreuz in der grenzüberschreitenden Region unterstreicht. Sie befindet sich in einem Industriegebiet, umgeben von Hafenanlagen, Bahngleisen und Lagerflächen. Verkehrsanbindung:
Schiff: Direkter Zugang zum Rhein, der eine wichtige Wasserstrasse für den Transport von Gütern zwischen Nordseehäfen und der Schweiz darstellt.
Schiene: Anbindung an das Schweizer und europäische Bahnnetz für den intermodalen Güterverkehr.
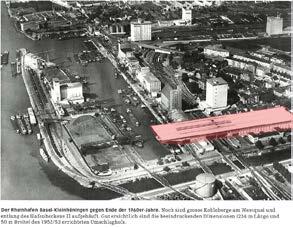
Strasse: Gute Erreichbarkeit über die Hochbergerstrasse und nahegelegene Autobahnen, die den Gütertransport in die Region erleichtern.

Erste Eindrücke




ATMOSPHÄRE DES RAUMES
Unsere erste Wahrnehmung der Umschlaghalle war, sehr offen und kalt. Der raue Winter war deutlich zu spüren und man fühlte sich nicht geschützt. Der Raum ist gross, weit und hoch. Lediglich ein paar wenige Sonnenstrahlen schafften es durch die kleinen Fenster. Er fühlte sich leblos, ungenutzt und unnahbar an. Die Atmosphäre wirkte kühl, grau, verstaubt und düster. Der Raum vermittelte einen Eindruck von Kantigkeit, Härte und Dunkelheit.



MENTAL MAP
Unsere Mental Map haben wir in drei Oberkategorien unterteilt. Diese basierten auf den Eindrücken und Beobachtungen, die uns entweder sofort ins Auge fielen oder die nach unserem Besuch nachhaltig in Erinnerung blieben. Jede Kategorie diente dazu, die Essenz des Ortes aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen und ein umfassendes Bild seiner Atmosphäre, Funktion und Besonderheiten zu zeichnen.




Überlagerung aller Ebenen


SKIZZEN
Bei den Skizzen des Raumes überlegten wir uns, welche Elemente besonders prägnant, auffällig oder für uns von Bedeutung waren. Wir konzentrierten uns darauf, die Details festzuhalten, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Dabei ging es nicht nur um die räumliche Struktur, sondern auch um die Atmosphäre, die Lichtverhältnisse und die akustischen Eindrücke, die den Charakter des Raumes prägten. Diese Skizzen halfen uns, den Ort besser zu verstehen und eine visuelle Grundlage für unsere weitere Arbeit zu schaffen.
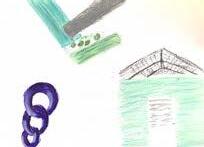

1. Sehen ▶ Strukturen
2. Räumliche Enge / Weite
3. Fühlen ▶ Tempereatur
1 Minuten Film
Human Factor
AUFGABE / INHALT
Die Aufgabe war, einen etwa einminütigen Film zu erstellen, der einen experimentellen Dialog zwischen dem eigenen Körper und dem Raum der Umschlaghalle erzeugt. In unserem Film wird der Körper der Person durch eine Erweiterung ergänzt – einer Art Fühlern. Diese ermöglichen es ihr, den Raum in feinsten Details wahrzunehmen. Mit diesen Fühlern wird eine intensivierte Wahrnehmung des Raumes und eine nahezu mikroskopische Sichtweise möglich. Stück für Stück wird der Raum dadurch greifbarer. Doch je mehr sie sich auf die Details einlässt, desto intensiver werden die Geräusche um sie herum. Erst wenn jede Kleinigkeit erfasst ist, erschliesst sich das Gesamtbild des Raumes, und die gesamte Dimension des Erlebten tritt in den Vordergrund.




Fühler der Person
Endszene
Wahrnehmung von Details
Wahrnehmung von Details
Anfangs Konzept
Green Space
RAUMINTERVENTION
Uns war es wichtig, eine Intervention zu schaffen, die die Wirkung des Raumes transformiert, indem ein einladender, dynamischer und inspirierender Ort entsteht. Ziel war es, eine Atmosphäre zu gestalten, die gemütlich, grosszügig, warm, harmonisch und lebendig wirkt.
Der Raum soll zu einem Treffpunkt und Ort der Begegnung werden, an dem Natur und Zugang dazu den Bewohnerinnen zurückgegeben werden. Die Natur dient dabei als verbindender Faktor, während die Menschen im Mittelpunkt der Nutzung stehen. Unser Konzept basiert auf einem Kreislauf und einer Balance, die von den Menschen vor Ort gestaltet und für sie geschaffen wird.
Die Angebote im Raum sind flexibel und passen sich den Bedürfnissen der Nutzerinnen an, um Vielfalt und Anpassungsfähigkeit zu fördern. Die konkrete Nutzung bleibt bewusst offen, um Raum für Kreativität, Freiheit und Individualität zu schaffen. Unser Konzept liefert Anhaltspunkte und Ideen für die Umsetzung und mögliche Nutzungen, mit dem Ziel, einen inklusiven Begegnungsort zu fördern, der Freiheit und gemeinschaftliches Wachstum unterstützt. Ein zentraler Bestandteil ist die Schaffung einer Grünfläche mit vertikalem Gardening. Durch die Integration von Ebenen wird die Höhe des Raumes optimal genutzt. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Einbindung heimischer Pflanzen, um den Raum nachhaltig und naturnah zu gestalten.

Konzept Collage


Foto von Modell (Vogelperspektive)
Foto von Modell (Innenraum)
Neuanfang
NEUE IDEE
Nach einer ersten Intervention im Modell wurde uns klar, dass ein starkes, zentrales Motiv fehlte. Eine kreative Krise bahnte sich an, und wir beschlossen, mit einem weissen Blatt Papier neu zu starten – ein neues Konzept, das uns die Freude und das Verständnis für diesen Ort zurückgeben würde.
Ein Element, das uns von Anfang an mit diesem Ort verband, ist das Wasser. Wasser ist ein zentrales Element der Halle und des Hafens, ohne Wasser funktioniert es nicht. Gleichzeitig liegt die Halle in einem Industriegebiet und die Industrie, sowie Wasser spielen eine entscheidende Rolle in der Klimakrise. So stellten wir die Verbindung her und eine neue Idee entstand.
Um gegen die Klimakrise anzugehen braucht es radikale Veränderung, also entschieden wir und für radikale Massnahmen - wir fluten die Halle!

Konzept Collage

Konzept
Gibt es einen sicheren Hafen?
Die Umschlaghalle in Basel wird zum Ort einer aussergewöhnlichen Transformation. Das Projekt „Umschlagpunkt. Gibt es einen sicheren Hafen?“ ist eine immersive Installation, in der die dramatischen Folgen des Klimawandels auf eindringliche Weise erfahrbar gemacht werden.
Die vom Rheinwasser geflutete Halle ist gleichermassen faszinierend und bedrohlich. Sie konfrontiert die Besucher*innen mit der Dringlichkeit einer entscheidenden Wende. Licht, Ton und visuelle Effekte verstärken die multisensorische Erfahrung, die zum Nachdenken über unsere fragile Sicherheit in einer von der Klimakrise betroffenen Welt anregt.
Die Atmosphäre betont existenzielle Unsicherheit und lädt das Publikum dazu ein, sich ihrer persönlichen und kollektiven Verantwortung bewusst zu werden. Dies könnte als Grundlage für einen „Umschlagpunkt“ im eigenen Handeln dienen.
Projektionen im Raum beinhalten zusätzliche Informationen und stellen den Kontext her. Ausserdem werden im weiteren Schritt konkrete Handlungsanweisungen, Perspektiven und Visionen erarbeitet.
Die Ausstellung basiert auf der Annahme, dass Kognition und Emotion kohärente physische Prozesse sind. Durch künstlerische Symbolik wird eine emotionale – und damit körperliche – Erfahrung initiiert, die das Verstehen unterstützt. Denn was ich fühlen kann, ergibt “Sinn”.
Das Projekt “Umschlagpunkt. Gibt es einen sicheren Hafen?”, richtet sich an ein breites und diverses Publikum. Ziel ist es, Menschen unterschiedlichster Hintergründe für die Thematik des Klimawandels zu sensibilisieren und zum Umdenken zu bewegen.
Recherche Referenzen
THE WEATHER PROJECT
Bei unserer Recherche fanden wir zwei Künstler, die ähnliche Ansätze und die gleiche Grundidee haben wie wir verfolgen. Zum einen die beiden Ausstellungen von Olafur Eliasson. Seine Installation «The Weather Project» wurde vom 16.10.2003 bis 21.03.2004 im Tate Modern in London ausgestellt. Es handelt sich um eine Lichtinstallation, bei der in der geschlossenen Galerie das Wetter simuliert wurde, indem eine künstliche Sonne erschaffen wurde. Diese Sonne war so intensiv, dass sie die Besucherinnen in eine fast meditative Stimmung versetzte. Zusätzlich war die Halle warm, und die hohe Luftfeuchtigkeit verstärkte den Effekt der Installation, wodurch der Raum zu einem Ort der physischen und emotionalen Erfahrung wurde. Die Besucherinnen waren nicht nur Betrachter, sondern wurden Teil des erlebten „Wetters“. Das Projekt stellte Fragen zu den Themen Klima, Umwelt und die menschliche Erfahrung von Naturphänomenen in städtischen Räumen. Es regte die Besucherinnen dazu an, über ihre eigene Beziehung zur Natur und zur Umwelt nachzudenken – besonders in einer Zeit, in der Themen wie Klimawandel und Umweltschutz immer relevanter wurden.3

Abb. 25 , «The Weather Project», Tate Modern, London, 2003
LIFE
Seine zweite, aktuellere Ausstellung „Life“ wurde 2021 in der Fondation Beyeler präsentiert und beschäftigt sich mit den Themen Natur, Wahrnehmung und der Verbindung zwischen Mensch und Umwelt. Er schuf eine immersive Erlebniswelt, in der die Besucherinnen selbst Teil der Kunst wurden. Dafür wurde die Fassade, die das Gebäude vom umgebenden Garten trennte, entfernt und den vorhandenen Teich in die Galerien erweitert. Besucherinnen konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit auf einem Holzsteg durch die Ausstellung gehen. Durch den Einsatz von Licht, Wasser, Spiegeln und Bewegung wollte er die Wahrnehmung der Besucherinnen herausfordern und eine tiefere Reflexion über den Einfluss der Natur und den Klimawandel anregen. 4


Abb. 26 , «Life», Fondation Beyeler, Basel, 2021
Abb. 27 , «Life», Fondation Beyeler, Basel, 2021
WATERLICHT
Dan Roosegaarde ist der zweite Künstler in unserer Recherche. Mit seinem Projekt „Waterlicht“ hat er ein interaktives Kunstprojekt geschaffen, das 2018 erstmals präsentiert wurde. Diese Installation setzt sich aus einer Vielzahl von LED-Lichtern und Projektoren zusammen, die auf den Boden und in den Raum projiziert werden, um die Illusion von Wasserwellen zu erzeugen. Diese Wellen simulieren Hochwasser und Überschwemmungen, die durch den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels zunehmend drohen. Dabei werden der Klimawandel, Wasserknappheit und die Zukunft der Umwelt thematisiert. Das Projekt soll das Bewusstsein für den Anstieg des Meeresspiegels und die Gefahr von Überschwemmungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, schärfen. Dan Roosegaarde nutzt die visuelle Kraft der Installation, um die Dringlichkeit und die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Existenz zu verdeutlichen. 5


Abb. 28, «Waterlicht», Colombia University, New York City, 2019
Abb. 29, «Waterlicht», New York City, USA, 2019
„Ich denke, dass wir in einer Zeit, in der wir die Welt nicht nur als eine Art von „gegeben“ akzeptieren sollten, sondern als etwas, das wir aktiv gestalten können.“ - Daan Roosegaarde
Kreislauf
KINETISCHER BODEN
Um die Besucher noch direkter in die Ausstellung zu integrieren, kamen wir auf die Ideedie Wege in einen kinetischen Pfad umzuwandeln. Ein kinetischer Boden ist ein spezieller Belag, der die mechanische Energie der menschlichen Schritte aufnimmt und in elektrische Energie umwandelt, die dann zur Stromversorgung von Geräten oder Systemen genutzt wird. Je mehr Menschen auf den Wegen stehen, desto höher steigt das Wasser. Diese gewonnene Energie würde verwendet, um eine Wasserpumpe anzutreiben, die das Wasser in den Raum befördert. Zusätzlich wird der Prozess durch die Solarenergie unterstützt, die bereits auf dem Dach installiert ist. So entsteht ein nachhaltiger Kreislauf aus menschlicher Bewegung und Sonnenenergie.
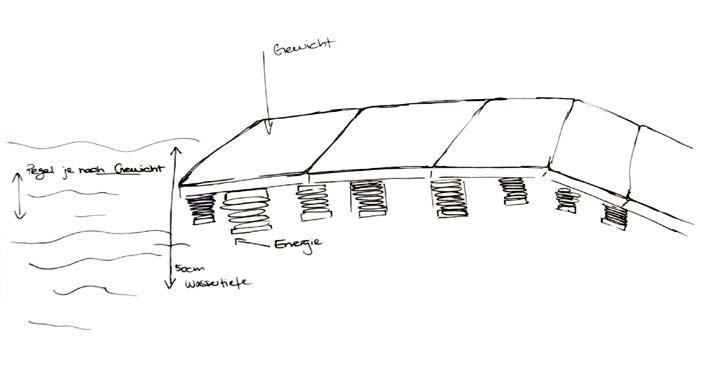

Skizze kinetischer Boden
Skizze Wasserpumpe
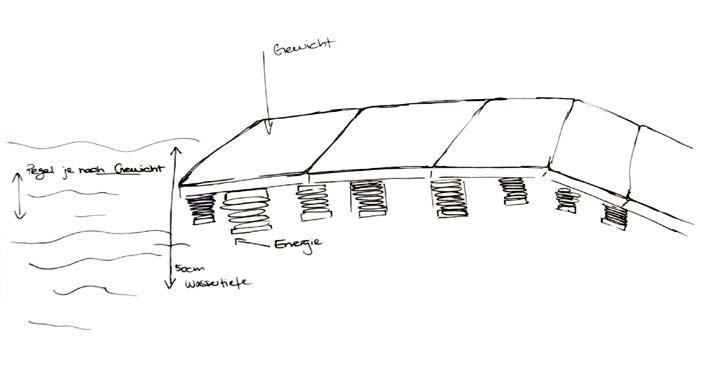

Prozess Umsetzung
MODELLBAU
Nun ging es weiter zur Umsetzung und dem Experimentieren am und mit dem Modell. Da wir bereits die Grundstruktur der Halle als Modell hatten, entschieden wir uns bewusst dazu, das bestehende Modell «aufzubrechen». Dieser Prozess fühlte sich fast wie eine Art Transformation an – das Ausschneiden eines grossen Lochs spiegelte auf kleiner Ebene die radikalen Veränderungen wider, die auch in der Realität nötig sind.

Modell mit Wasserbecken
WEGE
Im nächsten Schritt ging es um die Gestaltung der Wege. Inspiriert von organischen Formen der Natur und dem Wachstum von Pflanzen suchten wir nach einer Balance zwischen Struktur und Offenheit. Die Wege sollten nicht geradlinig und verbunden sein, sondern in eine Art Ungewissheit führen – eine Metapher für die Unsicherheiten unserer Zeit. Trotzdem war uns wichtig, nicht nur Unbehagen zu erzeugen. Angst allein führt selten zu Veränderung. Die Installation sollte zwar die Dramatik der Klimakrise thematisieren, aber gleichzeitig Raum für Hoffnung und Reflexion bieten.
Zuerst mit Skizzen und dann mit Styropor näherten wir uns der Form der Wege an, die das Zusammenspiel von Fragilität und Widerstandskraft verkörpern. Die Wege enden bewusst im «Nichts», ohne jedoch endgültig verloren zu wirken. Dieser Balanceakt zwischen negativen und positiven Gefühlen zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Projekt.

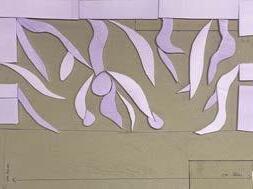

Wege aus Styropor
Wege aus Gips
Skizze der Wege
AGAR AGAR
Anschliessend füllten wir das Becken nach und nach mit Agar Agar und setzten die aus Gips gegossenen Wege hinein. Dieser Prozess war wie eine Art meditative Schichtung, bei der die verschiedenen Materialien miteinander interagierten und sich die Stimmung des Modells immer weiter formte. Um ein harmonischeres Bild zu bewirken und die kühle, harte Atmosphäre zu bestärken, bestrichen wir alles mit einer dünnen Gips Schicht. Es war faszinierend zu beobachten, wie die Feuchtigkeit des «Wassers» und das Gewicht des Gipses immer wieder dazu führte, dass Stellen im Modell aufbrachen. Diese Brüche erzählten ihre eigene Geschichte – eine Geschichte von Zerbrechlichkeit und Veränderung, die perfekt zur Thematik der Installation passte. Trotz der spannenden Dynamik im Modell störte uns der «gebastelte» und unfertige Look. Es wirkte, als wäre das Modell noch mitten in einem Wandel – fast so, als ob die raue Optik selbst ein Spiegelbild der Unsicherheiten und der Fragilität war, die unser Projekt thematisiert. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Erscheinung regte uns erneut zum Nachdenken an: Wie weit dürfen oder sollten solche Unfertigkeiten sichtbar bleiben? Wie viel Perfektion braucht es, um die gewünschte Balance zu halten?

1 Fussnote Variante 1: Bildlegenden, Quellennachweise entsprechend den Zitationsregelungen FHNW HGK.
2 Fussnote Variante 2: Bildlegenden, Quellennachweise entsprechend den Zitationsregelungen FHNW HGK.


Modell 2
VERSION ZWEI
Wir entschieden uns eine zweite Version zu bauen. Diese sollte cleaner wirken, mit einer klareren Formsprache und anderen Materialien, um das Zusammenspiel von Struktur und Atmosphäre präziser zu gestalten. Für die zweite Variante konzentrierten wir uns darauf, die wilde, unberechenbare Struktur des Wassers mit den weichen, positiven Formen der Wege zu verbinden. Durch die bewusste Materialwahl und die Reduktion von Brüchen entstand eine ruhigere, harmonischere Ästhetik, ohne die Dramatik und die Fragilität des Themas zu verlieren. Die fließenden, organischen Wege laden dazu ein, gedanklich durch den Raum zu wandern, während das Wasser als kraftvolles Element die Spannung aufrechterhielt. Die Installation wirkte in sich geschlossener, ohne jedoch ihre Dynamik zu verlieren.
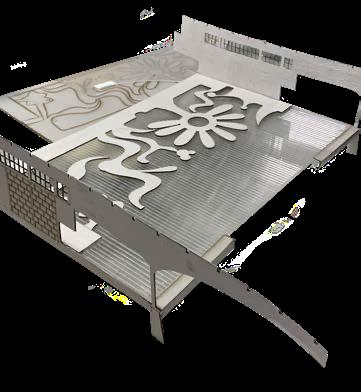
DACH
Das teilweise offene Dach der Halle ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen der Installation und der realen Umwelt. Wenn es regnet, fällt der Regen an neuen Orten in den Raum. Wenn die Sonne scheint, brechen Sonnenstrahlen durch die Halle. Im Winter könnte das Wasserbecken sogar zufrieren oder ein leichter Schneefilm den Raum bedecken.
Diese dynamische Verschmelzung mit dem Wetter und den Jahreszeiten macht die Installation lebendig und ständig im Wandel. So spiegelt sie nicht nur die Themen der Klimakrise wider, sondern entwickelt sich weiter – genau wie die Welt, die sie darstellt.

SITZGELEGENHEITEN - RAUM FÜR HINGABE
Die Sitzgelegenheiten bieten den Besucher*innen die Möglichkeit, die Installation und ihre Wirkung in Ruhe aufzunehmen. Hier können sie verweilen und sich ganz auf den Raum fokussieren. Wer möchte, kann sich genauso gut auf den Boden setzen, sich hinlegen oder sogar die Füße ins Wasser tauchen.
Während man sich auch im Stehen der Atmosphäre hingeben kann, schafft das Sitzen eine andere, intensivere Form der Auseinandersetzung. Zudem ermöglicht es Menschen, die nicht lange stehen können, unsere Installation uneingeschränkt zu erleben und vollständig in die Raumwirkung einzutauchen.

Schnitte Modell
GRUNDRISS
SCHNITT
Raumstudien Installation
Mit dem fertigen Modell begann die spannende Phase der Fotografie und das Testen unserer Projektionen und Installationen. Da die Zeit knapp war, entschieden wir uns, trotz vieler Ideen, uns auf fünf zentrale Installationen zu konzentrieren:


Gelb-orange-rotes Licht füllt den Raum und wird zunehmend intensiver, um die drückende Hitze spürbar zu machen.


HITZE
Nebel strömt in den Raum, zieht Muster und verschlechtert sches Gefühl der Unsicherheit.

verschlechtert die Sicht – ein physi-

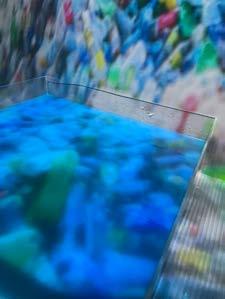

Projektionen von Plastikmüll auf die Wasseroberfläche



Blaues Licht, das immer weiter nach oben wandert, symbolisiert den unaufhaltsamen Anstieg des Meeresspiegels.
ATMOSPHÄRE &
Die Installationen – aus Licht, Wasser – sind bewusst ausdrucksstark Besuchenden stehen mitten ser steigt und schwappt auf treffen direkt auf ihre Körper, schlechtert die Sicht. Diese Elemente schafft die Verbindung stand, also Kognition und der
Akustische Elemente unterstützen runden das Gesamtkörperliche
STORYBOARD
Die Installationen Dramaturgie und Aufbau um die Besuchenden
& WIRKUNG
Licht, Projektionen, Nebel und ausdrucksstark gestaltet. Die mitten im Geschehen: das Wasauf die Wege, Projektionen Körper, und der Nebel verDiese physische Präsenz der Verbindung zwischen dem Verder Physis, Emotion.
unterstützen wir Wirkung und Gesamtkörperliche Erlebnis ab.
erzählen eine Geschichte. Aufbau spielen eine wichtige Rolle in den Bann zu ziehen.
STARKER REGENFALL

Wasser regnet durch Deckenpaneele auf die Flächen – teils auf die Wege, die vorher beleuchtet werden, sodass man Schutz suchen kann

Fakten & Kontext
BEGREIFEN & FÜHLEN
Begleitend zu den immersiven Installationen projizieren wir Fakten an die großen Wände der Halle. Es war uns wichtig, greifbare Vergleiche zu finden, die die abstrakten Zahlen verständlich machen und die Auswirkungen der Klimakrise verdeutlichen. Für viele Menschen sind solche Informationen nicht greifbar, man könnte meinen 1,5 Grad mehr oder weniger macht doch keinen Unterschied? Wir wollten den Besuchenden nicht nur Fakten liefern, sondern ein tiefes Verständnis ermöglichen – etwas, das sie mit dem Verstand begreifen und mit dem Körper fühlen können.
Auch ich muss reflektierend sagen, das Ausmass war mir in vielerlei Hinsicht nicht klar und die Recherche schärfte auch mein eigenes Bewusstsein. Manche der Zahlen und deren reale Auswirkungen haben mich schockiert und auch einen «Umschlagpunkt» in meinem Bewusstsein bewirkt.











Atmosphäre

«Es gibt keine Ausreden mehr, nicht zu handeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren.»
– David Attenborough, A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future, 2020.




Umschlagpunkt
Fazit
STELLA
Unsere Auseinandersetzung mit der Umschlaghalle in Kleinhüningen führte uns durch verschiedene Phasen der Analyse, Reflexion und kreativen Neuausrichtung. Von der ersten Wahrnehmung des Raumes als kalt, kantig und unnahbar bis hin zur Entwicklung einer immersiven Intervention durch die Flutung der Halle haben wir uns intensiv mit der Transformation des Ortes auseinandergesetzt.
Unser Konzept verbindet künstlerische Inszenierung mit gesellschaftlicher Relevanz. Die Flutung als zentrales Element macht die Auswirkungen des Klimawandels nicht nur sichtbar, sondern auch physisch erlebbar. Durch Licht, Ton, Projektionen und Bewegung entsteht eine emotionale und intellektuelle Erfahrung, die Betroffenheit auslöst und zum Nachdenken anregt. Die Installation soll nicht nur informieren, sondern auch einen „Umschlagpunkt“ im Bewusstsein der Besucherinnen schaffen – einen Moment der Erkenntnis, der zu Handlung und Verantwortung inspiriert.
Unser Projekt zeigt, wie künstlerische Interventionen gesellschaftliche Themen aufgreifen und neue Perspektiven auf bestehende Räume eröffnen können. Die Umschlaghalle wird nicht nur als historischer Ort betrachtet, sondern als lebendiger Raum, der Wandel und Zukunft vereint.
AMELY
Die Arbeit an diesem Projekt war eine spannende und intensive Auseinandersetzung mit dem Raum. Ich habe die Umschlaghalle auf vielfältige Weise gespürt und erlebt – sowohl durch ihre physische Präsenz als auch durch die emotionalen und konzeptionellen Prozesse, die sie in mir ausgelöst hat.
Rückblickend habe ich nicht nur viel über den Raum, sondern auch über mich selbst und meinen kreativen Prozess gelernt. Das Verwerfen des ersten Konzepts war eine Herausforderung, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, bei einer Sackgasse oder kreativen Krise offen für neue Ansätze zu sein. Nächstes Mal würde ich früher bereit sein, neu zu denken, und gezielt versuchen, Knotenpunkte zu lösen, anstatt an einer Idee festzuhalten, die nicht weiterführt.
Trotz aller Mühe bin ich mit dem Endergebnis leider nicht zufrieden, da ich all die Möglichkeiten und Optionen sehe, die man hätte erreichen können. Doch gerade das hat mir umso mehr gezeigt, worauf es ankommt – und wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. In der kurzen Zeit habe ich mein Bestes gegeben, aber mit mehr Zeit und Unterstützung hätte ich tiefere Studien gemacht, mehr Visualisierungen und Collagen erstellt und die Installationen präziser ausgearbeitet. Auch würde ich meine Gedanken während des Prozesses festhalten, Ein Logbuch könnte helfen, den Kopf freizumachen und den Prozess besser nachvollziehbar zu gestalten – für mich selbst und andere. Auch wenn ich mit diesem Projekt nicht glücklich bin, freue ich mich darauf, all das Gelernte in zukünftige Arbeiten einfließen zu lassen. Es war eine intensive Erfahrung mit vielen Höhen und Tiefen – und gerade aus den Herausforderungen habe ich am meisten mitgenommen.
Quellenverzeichnis
Gibt es einen sicheren Hafen?
1 https://www ost ch/fileadmin/dateiliste/97_ daten/abstracts/walker p pdf?utm source=chatgpt com (28.1.2025)
2 https://klybeck-kleinhüningen.ch/areal-und-hafenentwicklung/?utm_source=chatgpt.com (28.1.2025)
3 https://lifa-research.org/de/artworks/ the-weather-project/ (27.1.2025)
4 https://musermeku.org/olafur-eliasson-life/ (27.1.2025)
5 https://www.architonic.com/de/project/studio-roosegaarde-waterlicht/20249929 (27.1.2025)
- Abb. 25: https://artlead.net/journal/modern-classics-olafur-eliasson-the-weather-project-2003/
- Abb. 26: https://www.nzz.ch/feuilleton/olafur-eliasson-ld.1611981
- Abb. 27: https://olafureliasson.net/exhibition/life-2021/
- Abb. 28: https://www.architonic.com/de/project/studio-roosegaarde-waterlicht/20249929
- Abb. 29: https://news.columbia.edu/ news/-waterlicht-daan-roosegaarde-art-installation
Prozessdokumentation
Amely Shirin Schmitt & Stella Fach
Dozierende: Eva Hauck
Assistenz: Andrea Schorro
“Die einzige Konstante im – Buddha, Gelehrter
im Leben ist der Wandel.”
FlexDeck verschieden verschieben Dominik Jost

Abb. 1: Umschlaghalle am Hafenbecken
ortsbezogener Kontext
Die Umschlaghalle befindet sich in Kleinhüningen, ein durchmischtes Viertel, welches stark durch den sich dort befindenden Hafen geprägt ist. Das Hafenareal von Basel ist ein Ort voller Dynamik und Lärm, verursacht durch Industrie und Güterumschlag. Das hohe Betongebäude streckt sich mit seinem Vordach über den Rhein und bietet Schiffen die Möglichkeit zum Anlegen. Die beladene Fracht wird mit Kränen in die Halle transportiert, wo diese bis zum Weitertransport oder der Weiterverarbeitung lagern kann. Ausserdem können Güter über das zentral in der Halle gelegene Gleisbett entgegengenommen werden, was das Gebäude zu einem ständig bewegten und sich verändernden Raum lassen lässt.

Abb. 2: Fotografie des Lastenkrans am Hafen

Abb. 3: Situationsplan vom Hafenareal Kleinhüningen mit markierter Umschlaghalle


Raumannäherung durch Untersuchungen


Wir machen Hörproben des Raumes, indem wir uns langsam durch den Raum bewegen und wahrgenommene Geräusche auf einem Grundriss markieren. Obwohl die Halle geschlossener ist als das Gleisbett, wirkt es so, als ob die Geräusche sich in der Halle verfangen und dort dadurch präsent sind. Im überdachten Bereich des Gebäudes nehmen wir weniger Geräusche, wodurch der Raum dort ruhiger wirkt




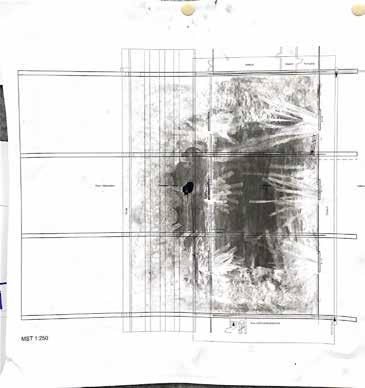



Wir beobachten die Lichtverhältnisse des Gebäudes an einem bewölkten Nachmittag und zeichnen diese auf einem Grundriss der Halle ein.Die Halle selber ist düster, wobei Licht von Fenstern an den Seiten des Gebäudes in den Raum fällt. Auch gehen die Wände der Front- und der Rückseite der Halle, wodurch auch dort Licht hereinfällt.Das Gleisbett des Gebäudes ist auch düster, da das Vordach sich weit über dieses hinaus streckt. Zu den Seiten des Gleisbettes und der Rampen wird der Raum jedoch heller, da keine Wände existieren.


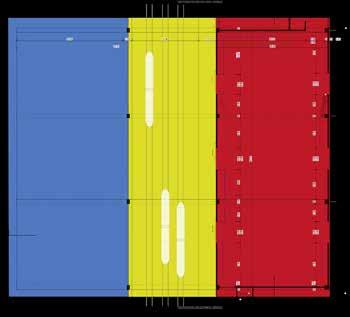

Abb. 6: Grundriss der Umschlaghalle


Wir teilen die Umschlaghalle bei unserer Raumuntersuchung in drei Teile ein, welche alle durch verschiedene Qualitäten ausgezeichnet sind.
Der offene Raum über dem Rheinbecken, welcher noch nicht erschliessbar ist, da nur das Dach besteht, der dadurch aber hell und luftig ist.
Der halboffene Raum, welcher nur eine Wand zum Halleninneren besitzt und der hauptsächlich aus dem 12,5m breiten Gleisbett besteht und daher kaum begehbar ist.
Der geschlossene Raum, also die Halle selber, welche komplett von Wänden umschlossen ist und somit dunkler und beengender wirkt.
offen halboffen geschlossen
Abb. 4: Kontext Map, Höhrprobe
Abb. 5: Kontext Map, Lichteinfall

7:
Raumannäherung durch Videodreh
Zudem drehen wir ein einminütiges Video, wobei wir den Raum perspektivisch untersuchen. Wir befestigen eine Kamera an einer Person an Fuss, Hand und Brust und begehen das Gebäude. Die drei Ansichten setzen wir für das Video nebeneinander, um den Unterschied zwischen den Perspektiven deutlich zu machen.
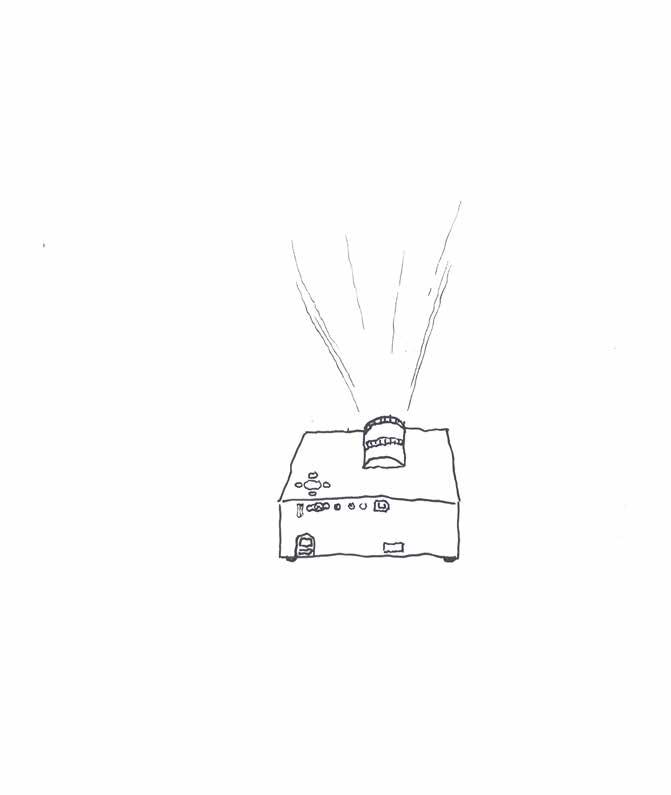
Abb.
Ausschnitt aus dem Video

Konzeptbeginn

Wir merken bei der Begehung der Umschlagshalle, dass uns die Dynamik und die Qualitäten des halboffenen und offenen Raumes am meisten beeindrucken. Zudem reizen uns beide Überlegungen zu einem Veranstaltungsort, welcher jedoch auch ein Ort zum Verweilen sein kann. Aus diesen beiden Ansätzen entsteht die Idee eines modularen Raumes, bei welchem das Zentrum des Geschehens das Gleisbett ist. Cargogüterwagons welche sich in diesem befinden, sollen mit wechselnden Modulen, mit verschiedenen Zwecken bestückbar sein, um so einen Raum zu schaffen, welcher zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bietet. Wir fertigen erste Zeichnungen und Collagen an, um uns einem Konzept anzunähern.





Abb. 8: Erste Konzeptcollage
Abb. 9: Skizze der Halle mit Intervention
Abb. 10: Skizze Modulidee
Abb. 11: Collage eines Parkmoduls

Bühnenkonzept
Da wir uns dafür entscheiden, das Gleisbett als Mittelpunkt des Ortes festzulegen, machen wir uns Gedanken über die Platzierung von Tribünen, welche einerseits die Perspektiven bestimmen, wenn sie genutzt werden, um Veranstaltungen im Gleisbett zu geniessen. Sie sollen jedoch auch als Sitzgelegenheit dienen und die Aufenthaltsmöglichkeiten erweitern, wenn der Ort offen zum Verweilen ist. Unser Tribünenkonzept verändert sich über den Prozess sehr stark. Es beginnt mit einer hängenden Tribüne über dem Rein, wodurch der offene Raum zwar erschlossen wird, aber die Perspektive in die Halle festgelegt wird, was zu Folge hat, dass die Hafenkulisse verloren geht.Daher entwickeln wir ein Konzept mit sechs höhenverstellbaren Tribünen, welche auf beiden Seiten des Gleisbettes positioniert sind. Die Tribünen, welche am Rhein liegen, können nun als Raumtrenner zwischen Gleis und Rhein funktionieren, sie können als Tribüne mit einer Perspektive auf die Gleise genutzt werden oder als Sitzmöglichkeit mit Blick auf den Rhein agieren. Die Tribünen auf der Rhein-abgewandten Seite des Gleisbettes können als Raumtrenner zwischen Halle und Gleis benutzt werden oder zu einer Tribüne mit Perspektive auf die Gleise mit dem Hafen im Hintergrund verändert werden. Das erdachte Konzept bietet so unglaublich viele Möglichkeiten für Veranstaltungen, da Kulissen und Perspektiven frei wählbar sind.






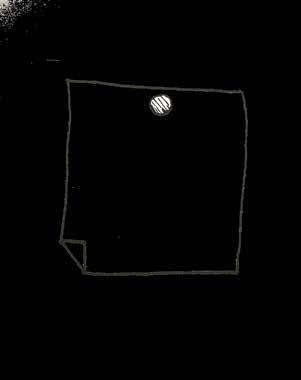


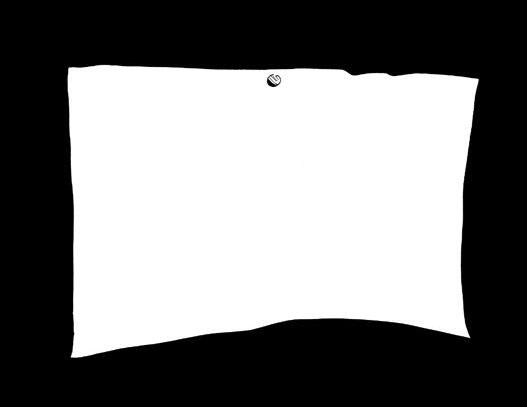
Abb. 12: Testmodell zur Tribünensituation (fixiert)
Abb. 13: Visualisierung im Modell, Blick Richtung Halle
Abb. 14: Skizzen des Tribünenkonzepts
Abb. 15: Testmodell der Tribüne (verstellbar)
Abb. 16: Visualisierung im Modell, Blick Richtung Hafen
Modulentwurf

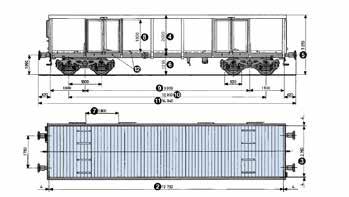

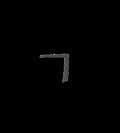
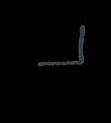


Basismodul


Ein grosser Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist der Entwurf der Module, welche den Raum erschliessen und beleben sollen. Wir orientieren uns an den bei der Begehung in der Halle stehenden Cagro Güterwaggons und machen erste Überlegungen, die Möglichkeit zu schaffen, die Module möglichst flexibel und effizient bewegen zu können. Wir entwerfen ein Basismodul, welches aus einem Sockel und einer damit verbundenen Holzplatte besteht.Diese ist 1/3 des Gleisbettes breit und hat zudem Aufhängungen. Dies ermöglicht, dass die Module später mithilfe von Kränen, welche sich an der Decke der Halle befinden, von oben auf die Güterwagons gesetzt werden können. So können die Module beliebig auf den Wagons verteilt werden und bei Nichtgebrauch zur Lagerung und Bearbeitung in die Lagerhalle hinter der Tribüne verstaut werden. Auf dieser Basis überlegen wir Module mit breiteren oder auch bestimmten Nutzungsmöglichkeiten. Durch dieses Konzept wird später das Kombinieren verschiedenster Module möglich, wodurch immer neue Raumsituationen und dadurch entstehende Raumerlebnisse geschaffen werden können.



Das Basismodul dient einerseits als Basis für alle anderen Module, kann jedoch auch nur als Fläche genutzt werden, wodurch das Gleisbett begehbar gemacht wird und so zusätzliche Flächen zum Verweilen oder bei Veranstaltungen geschaffen werden können.



Abb. 17: Masse eines Euro-Cargo Zuges
Abb. 18: Visualisierung eines Moduls (links und rechts)
Abb. 19: Modul auf Cargo Wagon als Modell







Infrastrukturmodule
Diese Module haben den Nutzen, Infrastrukturen für den Ort zu schaffen. Ein Modul mit einer Sanitäranlage, als auch eine Garderobe ist für Veranstaltungen nötig. Zudem Module, welche die Möglichkeit schaffen, Gäste zu bewirten.





begrünte Module
Diese Module sind fest auf den Waggons montiert und werden bei Nichtgebrauch auf ein Abstellgleis neben der Halle gestellt.Die Module sind mit Pflanzen wie Gras und Bäumen bepflanzt und bieten Sitzgelegenheiten und weitere interaktive Angebote wie Spieloder Sportelemente.

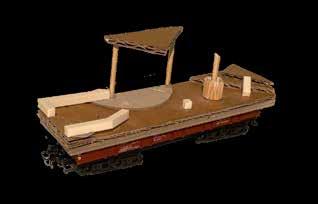







Veranstaltungsmodule

Diese Module werden je nach Zweck für geplante Veranstaltungen wie Theaterinszenierungen, Konzerte oder andere Kulturangebote entwickelt. Dies soll auch Kunstschaffenden ermöglichen, selber Module für eigene Veranstaltungskonzepte zu entwerfen. Diese können möglicherweise auch in der Höhe variieren, wenn sie nicht von Besuchern begangen werden müssen.
Abb. 20: Modulmodelle Infrastruktur
Abb. 21: Modulmodelle Park
Abb. 22: Modulmodelle Theater/Bühne
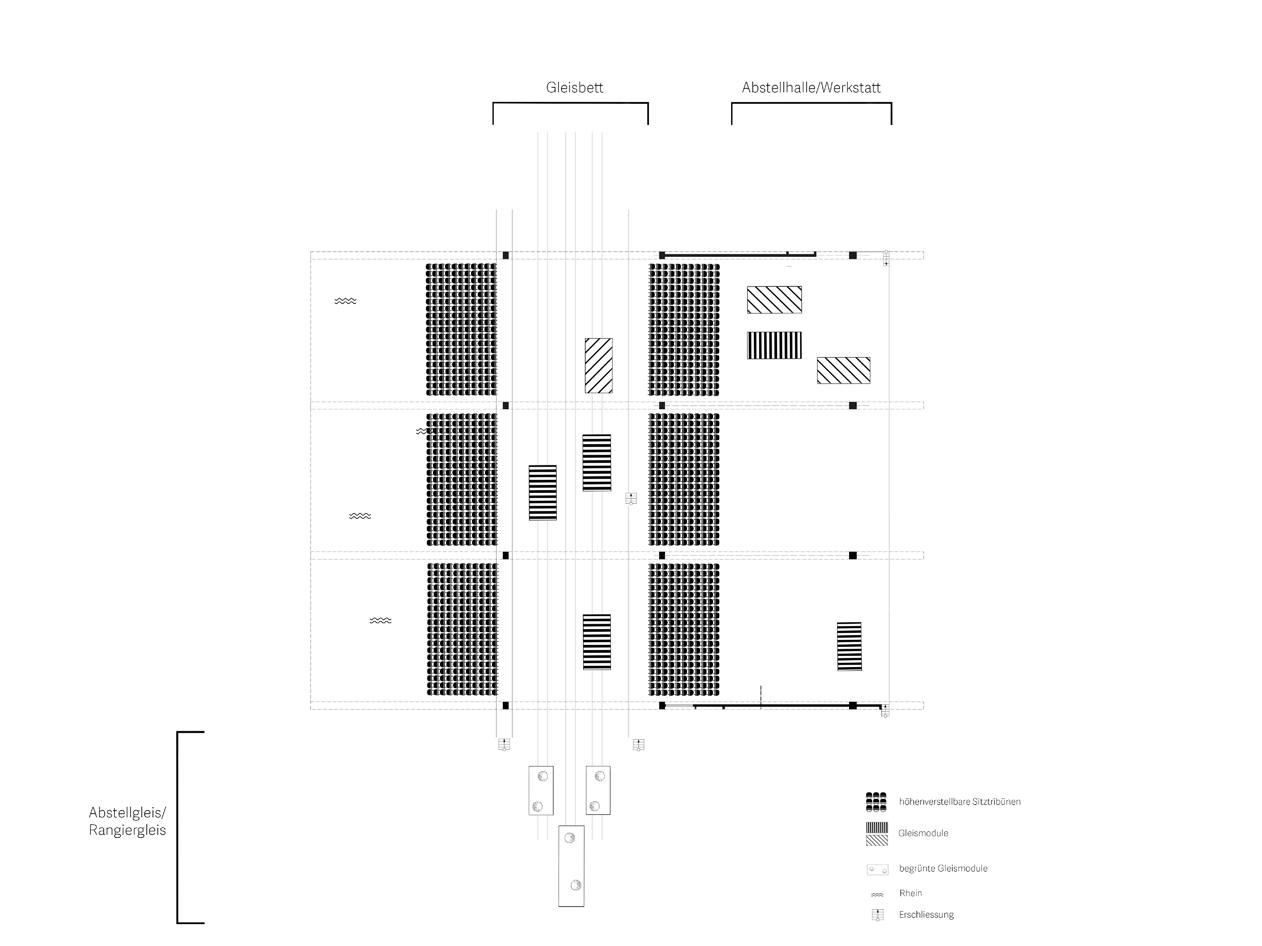



sonstige Eingriffe
Neben den Veränderungen des Raumes durch das Errichten der Tribünen werden die Wände zwischen Gleisbett und Halle entfernt und in das überhängende Dach werden Dachfenster eingebaut, damit der Ort mit mehr Licht gefüllt wird und dieser sich dadurch tagsüber mehr zum Verweilen anbietet. Sonst werden keine Veränderungen an der Umschlagshalle vorgenommen, um die Atmosphäre des Ortes zu belassen.

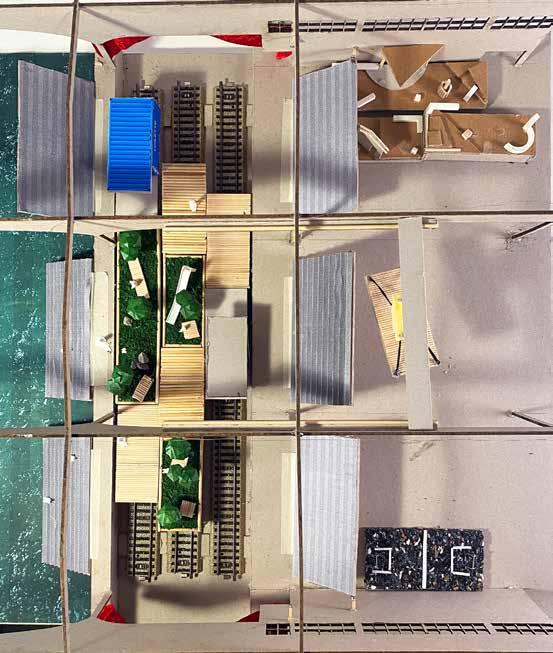



Abb. 25: Draufsicht im Modell









eines Theaterstücks, Zuschauerperspektive

Abb. 26: Visualisierung als Collage, Nutzung in der Freizeit mit Barbetrieb
Abb. 27: Visualisierung









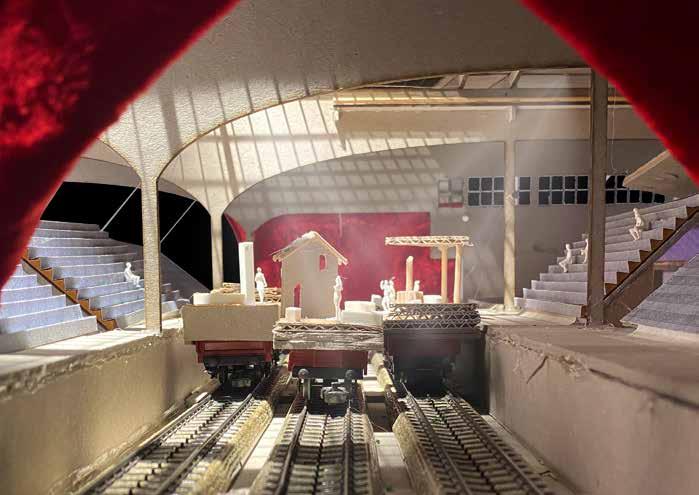


Abb. 28: Zuschauerperspektive im Modell, Theater/Bühnensituation
Abb. 29: Theatersituation mit Blick von Aussen ins Gleisbett


Abb. 30: Perspektivische Ansichten im Modell mit verschiedenen Tribüneneinstellungen (oben unten links rechts)









Fazit
Die Raumintervention «FlexDeck» verwandelt die Umschlaghalle in einen vielseitigen Raum. Das modulare Gleisbett und die verstellbaren Tribünen ermöglichen zahlreiche Szenarien der Raumnutzung und Raumerfahrung. Die Halle kann sich in einen Aufenthaltsort für jede und jeden ohne Konsumzwang verwandeln. Das Gleisbett schafft Nährboden für zahlreiche Veranstaltungskonzepte, da einerseits mit der Anordnung und Kombination von Modulen experimentiert werden kann und andererseits die Zuschauerperspektive als auch die damit verbundene Kulisse verändert werden kann. Die Gestalt der Umschlaghalle bleibt somit authentisch und verkörpert weiterhin die wechselhafte Hafendynamik.


Abb. 31: Perspektivische Ansicht im Modell, Rhein ist erschlossen
Projektreflektion
Mit dem Projekt Raumintervention haben wir beide unsere ersten Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Konzept der räumlichen Umnutzung gemacht. Wir lernten, ein bestehendes architektonisches Objekt und dessen Raum und Umfeld zu analysieren und durch einen passenden Eingriff einen neuen Wert zu kreieren. Die Umschlaghalle im Hafenareal empfanden wir als spannende Ausgangslage, vor allem die Führung und das Erkunden zu Beginn haben uns Eindruck gemacht. Es war wichtig, diese Eindrücke festzuhalten und eine Basis zu legen, um den Raum und dessen Eigenschaften tiefgründiger zu beurteilen. Bei der Ideenfindung hatten wir anfangs jedoch Schwierigkeiten die Angemessenheit und unsere kreative Vorstellungskraft einzuschätzen; wir konnten uns nicht genau vorstellen, wie innovativ oder träumerisch diese fiktive räumliche Intervention im vorgegebenen Rahmen sein darf.
Wir verfolgten - mit Ausnahme einiger Abstecher und Quergedanken - seit dem ersten Moment, als wir auf dem Gleisbett standen, die Idee eines modularen Raumes. Schon bei der Besichtigung inspirierte uns die hektische Dynamik des Hafenareals, denn wir bemerkten, wie sich die Räume durch ankommende Schiffe, bewegende Kräne und einfahrende Züge stetig veränderten. Diese ortsspezifische Eigenschaft wollten wir in unserem Projekt einbetten. Wir lernten schnell, dass es bei einer ansprechenden räumlichen Intervention/Umnutzung genau um das geht, nämlich den Ort mit den bereits vorhandenen Charakteristiken zu erweitern und/oder diese innovativ hervorzuheben. Das Konzept der Modularität passte also inhaltlich sehr gut und bot diverse Möglichkeiten der Gestaltung und Ausarbeitung. Den Nachteil bekamen wir zu spüren, als wir uns für konkrete räumliche Situationen entscheiden mussten. Zwar wollten wir die Diversität des Raumes sichtbar machen und Türen offen lassen, wobei trotzdem gewisse Parameter wie z.B. die Modulmasse oder die Tribünenausrichtung fixiert werden mussten. Es war also nicht einfach, im Konzept des modularen Raumes einen für uns sinnvollen Rahmen zu finden.
Bei der Umsetzung des Modells kamen wir erstmals in Kontakt mit der dreidimensionalen Datenverarbeitung in CAD und lernten den Umgang mit dem Lasercutter. Wir mussten schon zu Beginn wichtige Entscheide zur Ausarbeitung unserer Intervention im Modell treffen.
Ausschlaggebend war die Darstellung und Funktion der Gleise, sodass wir uns für den unkonventionellen Massstab 1:87 entschieden haben, da dieser dem Format der Modelleisenbahn H0 entspricht, deren Schienen wir einbauen wollten. Wir erhofften uns dadurch eine möglichst authentische Funktionalität unseres Konzepts zu erzielen, jedoch entstand viel Umrechnungsarbeit und die schlussendliche Wirkung des Gleisbetts war ernüchternd. Trotzdem steckten wir viel Arbeit in unser Anschauungsmodell und integrierten Dinge wie einen beweglichen Hallenkran, verschiebbare Module und sogar verstellbare Tribünen. Uns war es wichtig, den Betrachter interaktiv miteinzubeziehen, um den Ort näher zu erleben und die Bewegungen zu spüren.
Das Verbesserungspotential sehen wir in der Einbettung des Projekts in einen tieferen Kontext, basierend auf Recherche und gesellschaftlicher Analyse am Anfang. Wir hätten inhaltlich noch weiterspinnen können, um dem Projekt im realen Massstab mehr Bedeutung zu verleihen, wie beispielsweise das Erläutern von statischen Bedenken, Zielgruppen oder Nutzungsplänen. Zudem hätte eine breitere Arbeit mit Planmaterial dazu beigetragen, den Raum und den Massstab eindeutiger festzuhalten und mit den Gegebenheiten abzugleichen.
Abschliessend können wir sagen, dass wir unseren Entwurf als gelungen und angemessen einschätzen und einen lehrreichen Prozess durchliefen. Wir hatten viel Spass und machten diverse gute Erfahrungen sowie persönliche Fortschritte in der gestalterischen Fehlerkultur. Ausgehend von einem existierenden Ort eine konzeptuelle räumliche Auseinandersetzung zu machen, empfinden wir als wertvoll für zukünftige Projekte, denn wir lernten, mit realistischen Problemen umzugehen und kreative Ansätze zu finden. Leider hatten wir grundsätzlich Mühe mit dem Austauschprozess, da der stetige Dozentinnen Wechsel zu viel unterschiedliche Meinungen und Feedbacks mit sich brachte, sodass viele zwischenzeitliche Entscheide ineffizient von uns getroffen oder verworfen wurden. Trotzdem haben wir unseren Weg gefunden, unsere Stärken wahrgenommen und ein einheitliches Projekt abgeschlossen.
«You can observe a lot - Yogi Berra
by just watching.»
Hafenblicke Zwischen Umschlag und Ausblick
Photodokumentation der Umschlaghalle



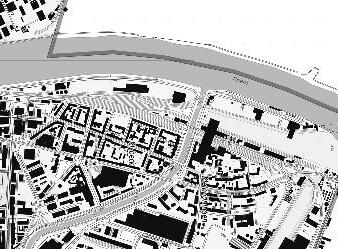

Abb.1,2,4 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Abb.3 Dokument von Eva Hauck
Abb.2 Kran beim Bernoulli Silo
Abb.1 Blick auf die Umschlaghalle von Aussen
Abb.3 Karte
Abb.4 gelbe Akzente
Nach der Einführung in die Geschichte des Hafengeländes hatten wir die Möglichkeit, es zu besichtigen. Besonders beeindruckend war bei der Besichtigung der Umschlaghalle die imposante Deckenhöhe, die uns ins Auge fiel. Ebenso faszinierend war der Blick aus der Halle auf den Hafen. Eindrücklich war das Dach, welches nicht nur die Halle abdeckte, sondern auch einen Teil der Gleise und des Wassers. Überall gab es etwas zu entdecken. Die rissigen Böden und die Kratzer an den Wänden verleihen der Halle einen ganz eigenen Charme.
Kontaktabzüge



Abb.5,6,7
Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Abb.6 Tonabdruck der Wand
Abb.5 Tonabdruck vom Boden in der Umschlaghalle
Abb.7 Tonabdruck vom Boden bei den Gleisen
Analyse der Umschlaghalle

Abb. 8 Bild von unserer Analyse
Abb. 8 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
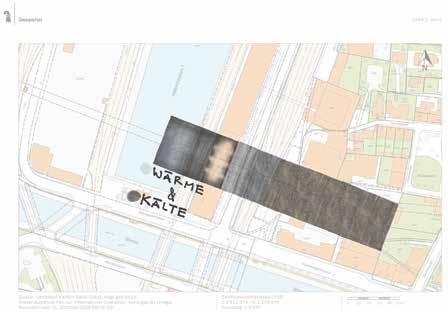
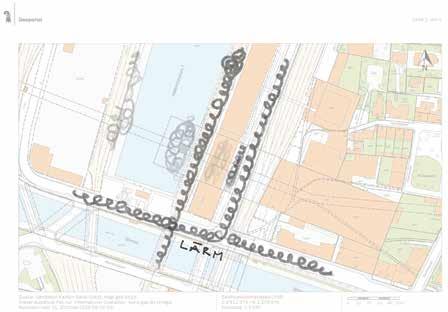

Abb. 11 Licht
Abb. 10 Lautstärke
Abb. 9 Temperatur
Abb. 9,10,11 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
1 Minuten Film Sehnsucht nach oben
Wir stellen im Film die Sehnsucht nach oben dar die wir beim Betreten der Halle verspürten.



Abb. 12 Filmausschnitte
Abb. 13 Filmausschnitte
Abb. 14 Filmausschnitte
Abb. 12,13,14 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber


Erste Konzeptidee
Unser Ziel war es, einen Treffpunkt zu schaffen, an dem Gemeinschaft entsteht und Menschen zusammenkommen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Im Zentrum stand die Idee, die Halle mit allen notwendigen Utensilien auszustatten, die Reparaturen, kreatives Gestalten und gemeinsames Lernen ermöglichen. Innerhalb der Halle sollten Container aufeinandergestapelt werden, die ruhigere Themenbereiche wie eine Bibliothek oder eine Töpferecke beherbergen. Diese Container wären durch eine spiralförmige Rampe miteinander verbunden, die Zugang zu allen Ebenen bietet. Lautere Werkstattbereiche würden außerhalb der Container angeordnet, um ausreichend Platz für handwerkliche Tätigkeiten und den Austausch innerhalb der Community zu schaffen. Hier könnten die Menschen zusammenarbeiten, um Dinge zu reparieren, Neues zu lernen und eigene Projekte umzusetzen.
Modell

Abb. 15,16,17 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Abb. 16 Konzeptmodell
Abb. 15 Konzeptcollage
Abb. 17 Konzeptmodell

Neben unserem ersten Konzept entstand die Idee, in der Halle einen Ort für interaktives und immersives Theater zu gestalten. Diese Theaterform, die das Publikum aktiv einbindet, hatten wir in einem anderen Modul kennengelernt und fanden sie sehr spannend. Wir wollten solchen Formaten eine Bühne bieten und einen Raum schaffen, an dem Neues ausprobiert werden kann.
Im Prozess stellten wir jedoch fest, dass diese Idee ein Bühnenbild erfordern würde und weniger die Gestaltung der Halle im Fokus gestanden hätte. Das war jedoch nicht Ziel der Aufgabe. Deshalb entschieden wir uns, das Konzept nicht weiterzuverfolgen und arbeiteten stattdessen an einem allgemeinere Kulturangebot weiter, das vielseitig genutzt werden kann und auch zum Verweilen einlädt.
Trotzdem fanden wir nicht richtig in den Arbeitsfluss, und das Konzept überzeugte uns nicht.
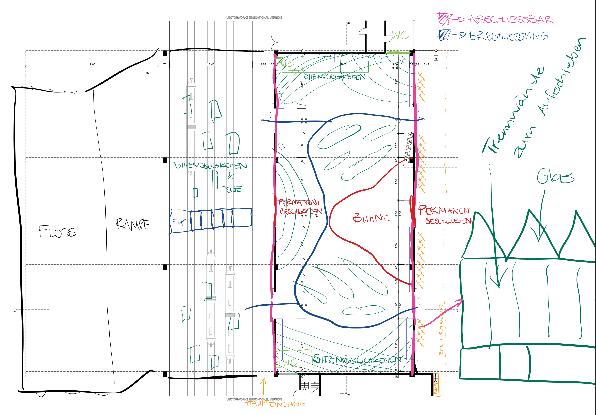
Abb. 19 Übersicht
Abb. 18,19 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Abb. 18 Schnitt
Skizze
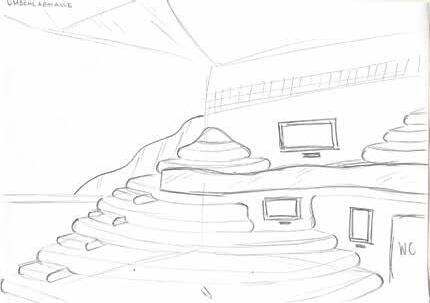
20 Tribühne
Arbeitsmodell

Abb. 21 Arbeitsmodell in der Umschlagshalle

Abb. 22 Arbeitsmodell auf den Gleisen
Abb.
Abb. 20,21,22 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Für unser finales Konzept gingen wir einige Schritte zurück und versetzten uns erneut in die Halle hinein. Ein wiederkehrendes Thema in unseren Überlegungen war die Frage, ob der Hafenbetrieb erhalten bleiben soll. Bei vorherigen Konzepten wäre es nicht möglich gewesen. Daher entschieden wir uns, in die entgegengesetzte Richtung zu denken: Welche Art von Raumintervention könnte geplant werden, ohne die Umschlaghalle ausser Betrieb zu setzen?
Dabei wurde uns bewusst, wie wenig wir über die Abläufe in der Halle und am Hafen kannten. Diese Erkenntnis führte zu einem Perspektivenwechsel. Es braucht kein Konzept, das eine Bühne in die Halle stellt. Der Hafen selbst ist die Bühne.
Unser Ziel ist es, den Hafen zugänglicher und attraktiver für alle zu machen. Besuchende sollten die Möglichkeit bekommen, den Hafen zu erkunden, Fragen
beantwortet zu bekommen und den Ort besser zu verstehen. Gleichzeitig wollten wir einen Treffpunkt schaffen, an dem man sich auch gemütlich aufhalten kann. Um den Betrieb in der Halle so wenig wie möglich zu stören, entschieden wir uns, mit der Höhe der Halle zu arbeiten.
Das Herzstück unseres Konzepts ist eine Plattform, die erhöht in der Halle eingesetzt wird und den Betrieb kaum einschränkt. Die Plattform ist über ein Treppenhaus und einen Fahrstuhl zugänglich.
Was wird derzeit im Silo gelagert?
Von wo kommt das Container Schiff?
Wie viele Lastwagen fahren täglich in den Hafen ein und aus?
Skizze

Abb. 23 Netz Skizze
Grundriss Skizze

Abb. 24 Grundriss Skizze
Abb. 23,24 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Zu Beginn analysierten wir den Grundriss der Halle und deren Umgebung, um die wichtigsten Beobachtungspunkte am Hafen zu identifizieren. Dabei überlegten wir, worauf unser Fokus liegen sollte und wie groß die Plattform sein müsste. Als zentrale Elemente kristallisierten sich das Hafenbecken, der Güterverkehr, die Umschlaghalle und das Bernoulli-Silo heraus.
Daraus entstand die Idee einer großen Plattform, die sich über die gesamte Hallenlänge, aber nur über ein Drittel der Hallenbreite erstreckt. Sie bietet einen optimalen Blick auf das Hafenbecken und die Umschlaghalle. Für einen guten Blick auf das Bernoulli-Silo erweiterten wir die Plattform mit einem Weg bis ans andere Ende der Halle. Um den Güterverkehr besser beobachten zu können, planten wir zusätzlich ein Netz, das direkt über den Gleisen gespannt wird. Auf Grundlage dieser Überlegungen begannen wir mit dem Bau eines Arbeitsmodells im Maßstab 1:100, um unsere Idee greifbarer und realistischer zu machen.

Arbeitsmodell


Abb. 25 Grosse Plattform
Abb. 27 Grosse Plattform
Abb. 26 Sicht von den Gleisen auf die Plattform Abb.




Abb. 28 Sicht in die Umschlaghalle
Abb. 30 mittlere Plattform
Abb. 31 Plattform für das Silo
Abb. 29 Blick von den Gleisen in die Umschlaghalle
Abb. 28 - 31 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Prozessbilder
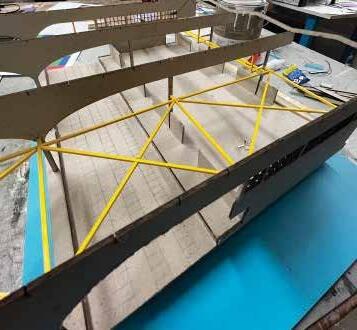
Nach dem Besprechen des Arbeitsmodelles mit Eva, waren wir schon sehr zufrieden, dass es so rüberkam wie wir es uns vorstellten. Eva brachte uns noch auf die Idee ein weiteres Netz einzubauen, welches über dem Wasser steht. Dies zeigt den Blick aufs Wasser, sorgt zudem noch statisch dafür, dass wir weniger Gewicht vorne tragen müssen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam die Idee auf die Plattform nur punktuell mit der Halle zu verbinden, damit wir die Halle nicht zu sehr beschädigen und die Plattform sich optisch mehr ansetzt. Auch brachte sie uns darauf, dass es im Geländer gelbe Linien hat. Welche wir so perfekt auf die ganze Plattform übernehmen können und sich diese durch das Gelb von der Halle absetzt. Bei einem weiteren Besuch des Hafens fanden wir noch mehr gelbe Akzente auf dem Gelände.
Um die Besucher nicht mit dem Gelb zu überrennen, entschieden wir uns den Boden mit Holz zu gestalten und die Sitztmöglichkeiten und die Netze in einem Blau zu gestallten.
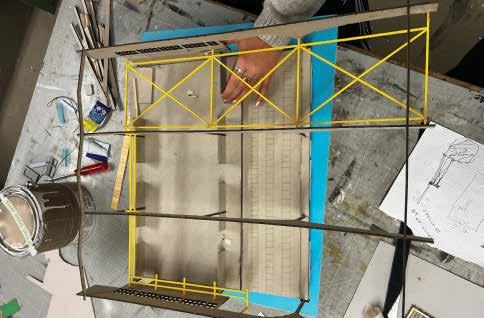

Modell




Abb. 37 Siloplattform
Abb. 35 Eingang oben
Abb. 36 Treppenhaus
Abb. 38 Eingang von der Strasse
Abb. 35 - 38 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber



Abb. 40 Plattform über dem Wasser
Abb. 39 Innenansicht
Abb. 41 Übersicht
Abb. 39,40,41 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 42 Präsentations Modell
Abb. 42 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Situationsplan

Abb. 43 Situationsplan
Abb. 43 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Infotafeln
Die Informationen über den Hafen werden sowohl über analoge als auch digitale Anzeigetafeln vermittelt. Zusätzlich steht auf der Plattform ein interaktiver elektronischer Tisch, der ebenfalls einen grossen Teil der Informationen anzeigt. Auf den analogen Infotafeln werden gleichbleibende Daten angezeigt, wie zum Beispiel das Volumen des Silos. Im Gegensatz dazu zeigen die digitalen Anzeigetafeln tagesaktuelle, sich verändernde Daten an.
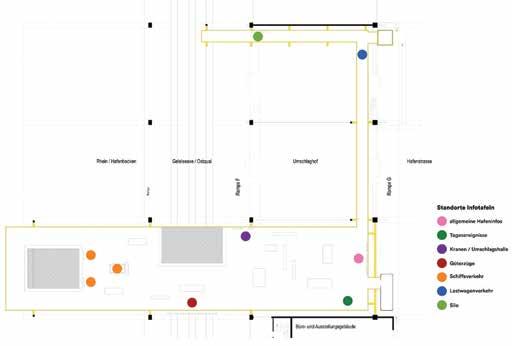


interaktiver Tisch

Abb. 45 Infotafel analog*
Abb. 46 Infotafel digital*
Abb. 47 Interaktiver Tisch*
Abb. 44 Übersicht der Infotafeln im Grundriss
Abb. 44 - 47 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

*die Informationen wurden teilweise von einer KI generiert und entsprechen nicht komplett der Wahrheit
Abb. 48 Text der analogen Infotafel*
Abb. 48 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Signaletik
Für die Signaletik wollten wir die gelbe Linie weiterziehen, welche bereits an der Rampe beim Eingang angezeichnet ist. Diese Linie zeichnet sich bis zu der Tramstation und Bushaltestelle und führt so die Besuchenden zu unserer Plattform, Hafenblicke.

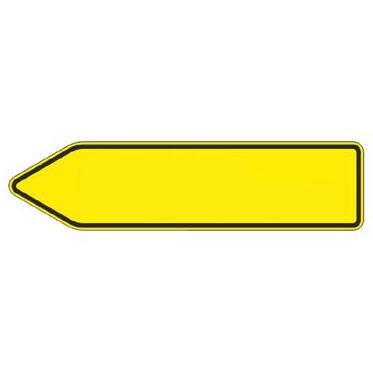

Abb. 50 gelbe Linie vor dem Museum
Abb. 51 Eingang
Abb.49, 50,51 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 53 Übersicht gelbe Linie

Abb. 52 Erschliessungsplan
Abb. 52,53 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
erste Collagen




Abb. 56 Eingang Treppe
Abb. 54 Innenraum
Abb. 55 Sicht von der Strasse auf die Plattform
Abb. 57 grosses Netz im Vordergrund
Abb. 54 - 57 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Collagen

Abb. 58 Blick zum Silo
Abb. 58 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber

Abb. 59 Eigenes Bildmaterial von Elin Hess und Seline Klaiber
Abb. 59 Blick auf die Infotafeln
Fazit
Wir erarbeiteten einige verschiedene Konzepte, mit unterschiedlichen Ansätzen und hatten etwas Mühe in das Projekt hineinzufinden. Wir starteten teilweise etwas zu übereifrig und übersprangen Teilschritte. Das stellten wir auch in Tischgesprächen fest und daher verwarfen wir unsere ersten Konzepte wieder, da ihnen die Basis fehlte. Als wir uns aber nochmals tiefgründiger mit der Recherche befassten, kamen wir dann auf das Konzept, welches sich für uns richtig anfühlte und welches uns motivierte daran zu arbeiten. Was uns sehr positiv in Erinnerung bleiben wird, ist wie hilfreich und wichtig es ist mit Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Sie konnten uns viel Inside Wissen geben und wussten wertvolle Informationen. Es war schön zu sehen, wie gerne die Leute helfen, wenn man sie fragt.
Beim Fotografieren des Modells stellten wir fest, wie wichtig es bereits beim Modellbau ist, sich zu überlegen, wie man schlussendlich fotografieren möchte. Denn wir hatten bei der Umsetzung der Bilder Mühe die wichtigen Standorte unseres Projekts gut fotografieren zu können, da der Raum unter dem Dach begrenzt war. Mit dem Projekt wie es nun ist sind wir zufrieden. Wir würden die Plattform selbst gerne als Besuchende aufsuchen und finden es schade, dass wir nicht an die echten Informationen gelangen konnten. Die Informationen, die wir vermitteln wollten, interessieren uns selbst. Daher finden wir es auch ein sinnvolles Projekt, welches es so noch nicht gibt.
Hafenblicke
Raumintervention IN3
Dozentin: Eva Hauck
Assistenz: Andrea Schorro
Studentinen: Elin Hess, Seline Klaiber
Confucius said: “I wish to speak Zigong said: “Master, if you do how will your followers be able of your teachings?” Confucius heaven speak? The four seasons the creatures continue to be born, heaven speak?”
_Sayings of Confucius
speak no more.” do not speak, able to pass on any Confucius said: “Does seasons turn and all born, but does
Substracts equals Add
Ein Raum der Reflexion
Das Projekt verbindet die industrielle Geschichte Kleinhünigens mit einer Rückkehr der Natur in den urbanen Raum. Durch das Öffnen von Kreisen im Boden und Dach wird die Halle für Pflanzen zugänglich gemacht, die autonom wachsen können. Ein Baum für die Anwohner:innen und ein Strauch für die Arbeiter:innen symbolisieren eine tiefere Verbundenheit zwischen den Menschen und ihrer Umgebung. Diese Pflanzen reflektieren die radikale Trennung zwischen der natürlichen Welt und den von Menschen geschaffenen Strukturen, wodurch das Projekt zur Reflexion über diese Abgrenzung anregt.
Das Spiel von Licht, das durch die Öffnungen im Dach einfällt, verstärkt die meditative Atmosphäre und hebt den Kontrast zwischen Beton und Natur hervor. Gleichzeitig wird das Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen genutzt, und die Solarpanels werden in der Umgebung neu positioniert, um eine nachhaltige Energiequelle zu gewährleisten. Das Projekt bietet einen Raum, der nicht nur den hektischen Hafenalltag unterbricht, sondern auch zur Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Mensch, Natur und Architektur einlädt.



KLEINHÜNINGEN IM WANDEL
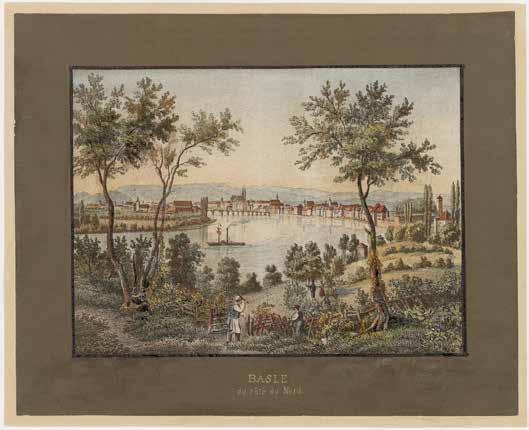
Die Umschlagshalle befindet sich im Südwesten von Basel, am Rand des Quatierteils Kleinhünigen. Dieser Ort hat sich über die Jahre von einem landwirtschaftlich geprägten Hof zu einem wichtigen infrastrukturellen Knotenpunkt entwickelt. Die Umschlagshalle spielt eine zentrale Rolle in der Logistik und im Güterverkehr. Sie dient als Umschlagplatz für Waren, die von einem Transportmittel auf ein anderes umgeladen werden.
Ursprünglich war Kleinhünigen ein traditioneller Hof, der in ländlicher Umgebung gelegen war und hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung fand. Das Gebiet, das damals vor allem von Feldern und Wäldern umgeben war, bot eine willkommene Abwechslung vom urbanen Trubel der Stadt. Mit der Industrialisierung kam es jedoch zu Veränderungen: 1893 nahm die erste Fabrik die Produktion chemischer Erzeugnisse auf; zunächst

insbesondere Farbstoffe für die populäre Textilindustrie. Bald kamen weitere Firmen hinzu, wodurch Basel zu einem Zentrum der chemischen und später der pharmazeutischen Industrie wurde. Zwischen 1850 und 1900 verdreifachte sich die Bevölkerung Kleinhüningens, das bald auch durch eine Strassenbahnlinie erschlossen wurde. Im Jahr 1908 endet schließlich die Geschichte des Dorfes, das zu einem Stadtteil von Basel wurde.1


01 Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt
02 Rheinansicht, Gross- und Kleinbasler Uferpartie
03 Rheinhafen Kleinhüningen, Hafenbecken I 04 Umschlagshalle von innen
Umschlagshalle und Hafenbecken |
UNSERE SINNENWAHRNEHMUNG IN DER UMSCHLAGSHALLE
Sehen: Der Blick fällt auf eine dynamische Szene mit riesigen Containern, die auf Staplern oder Kransystemen bewegt werden. Das bunte Durcheinander der Container, die unterschiedlichen Formen und Größen der Güter und die Maschinen, die unaufhörlich arbeiten, erzeugen ein visuelles Mosaik. Das wechselnde Licht je nach Tageszeit und Wetterbedingungen präsentiert die Farben und Strukturen der Halle in ständigem Wandel.
Hören: In der Halle selbst gab es eine Kakophonie von Geräuschen. Das Rauschen grosser Maschinen und Kräne, das Klirren von Metall, das Hämmern von Containern, die aufeinanderstiessen, und das gleichmässige Brummen von Gabelstaplern schufen eine industrielle Geräuschkulisse. In den Pausen oder bei besonderen Arbeitsvorgängen konnte man auch Gespräche und Anweisungen der Arbeiter hören, die durch das akustische Mosaik hindurchschlugen.
Fühlen: Der Boden vibrierte durch den ständigen Verkehr von Maschinen und das Bewegen von Containerladungen. Man spürte auch die Rillen des Bodens. Zusätzlich konnte man den Durchzug in der Umschlagshalle spüren, der durch die offene Struktur und den ständigen Luftaustausch innerhalb der Halle verursacht wurde und die Luft in Bewegung hielt.
Riechen: Verschiedene Gerüche wehten durch die Halle – der Duft von Schmieröl, Benzin oder Dieselabgasen, die aus den Maschinen und Fahrzeugen strömten. Gleichzeitig war der Geruch von Metall, Eisen oder auch Staub zu riechen, der von den Containern und dem Boden aufstieg.
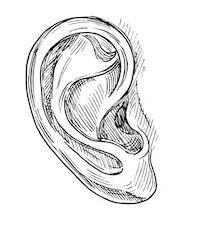



06 Skizzen: Auge, Hand, Nase und Ohr

07 Darstellung von Bewegungen

08 Diagramm der Geräusche

1 MINUTEN FILM
In unserem 1-Minuten-Film versuchen wir, unsere Sinneseindrücke zu vermitteln und gleichzeitig ein neues Verständnis für den Ort zu entwickeln – indem wir die Wahrnehmung umkehren und den Film rückwärts abspielen. Der Titel „Kalte Züge“ ist ein Wortspiel, da dort Züge fahren und gleichzeitig kalte Durchzüge in der Umschlagshalle wehen. So wollen wir den Zuschauer dazu anregen, über die Bedeutung und das Potenzial der Umschlagshalle nachzudenken, jenseits der hektischen und rauen Hafenumgebung. Auf der folgenden Seite sind Bildausschnitte aus dem Film zu sehen. Der Film beginnt in Farbe, um das Potenzial der Halle und ihre mögliche Zukunft darzustellen, und wechselt dann in Schwarz-Weiss, um die gegenwärtige Realität der Umschlagshalle und ihrer Umgebung zu zeigen.






Kontaktabzug vom Boden und der Wand. auf Transparentpapier, bearbeitet mit Kohle. KONTAKTABZÜGE

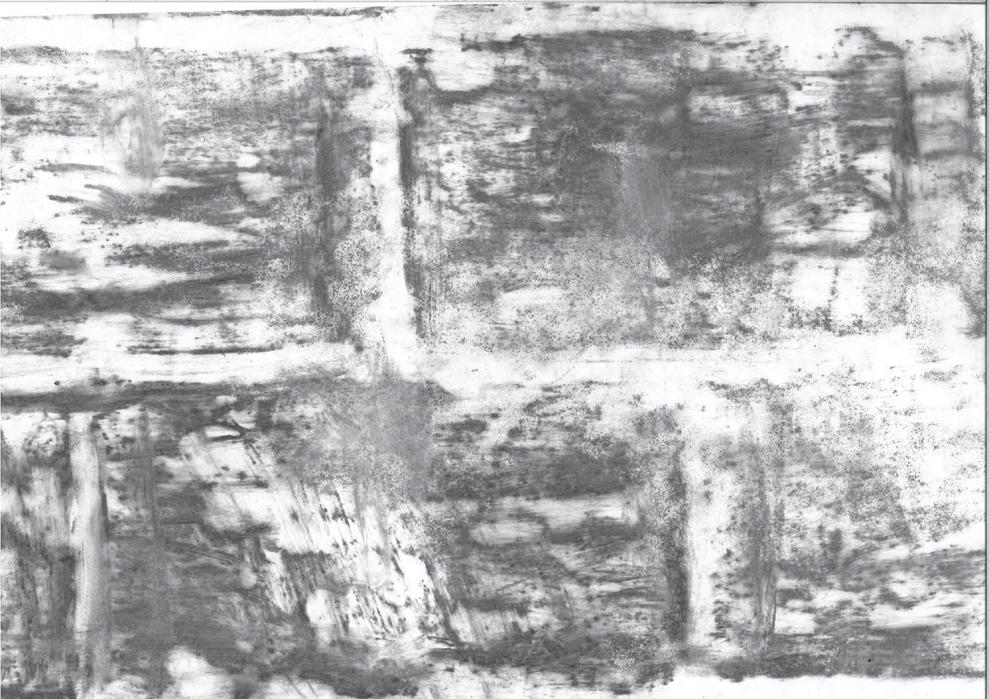
Auf den folgenden Seiten sind unsere fotografischen Eindrücke der Umschlagshalle und ihrer Umgebung zu sehen.




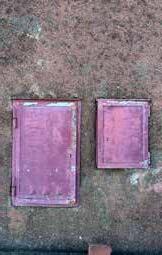







KONTEXTUALISIERUNG
Die historische Bedeutung von Kleinhüningen und der Ursprungszustand des Areals, das einst eine grosse Wiese war, faszinierte uns sehr. Im 19. Jahrhundert war Kleinhüningen für seine idyllische, naturnahe Atmosphäre bekannt, und das Bild eines friedlichen Dorfes wurde besonders durch die zunehmende Beliebtheit als Ziel für Spaziergänge und Fischmahlzeiten geprägt. Die Eröffnung der Tramlinie 1897 brachte jedoch eine verstärkte Urbanisierung, die die ursprüngliche Ruhe des Ortes veränderte.2 Wir überlegten, wie dieser Raum zu einem Ort der Ruhe werden könnte, der mit der Natur und der Geschichte des Ortes verbunden ist. Die Transformation der Umschlagshalle in einen Ort der Entspannung war daher ein zentrales Anliegen in unserer Konzeptentwicklung. Wir stellten uns vor, wie dieser Raum den Besucher von der hektischen Stadt abholen und ihn in eine andere Welt entführen könnte – hin zu einem Ort, an dem er seine Sinne neu ausrichten und zur Ruhe kommen kann.
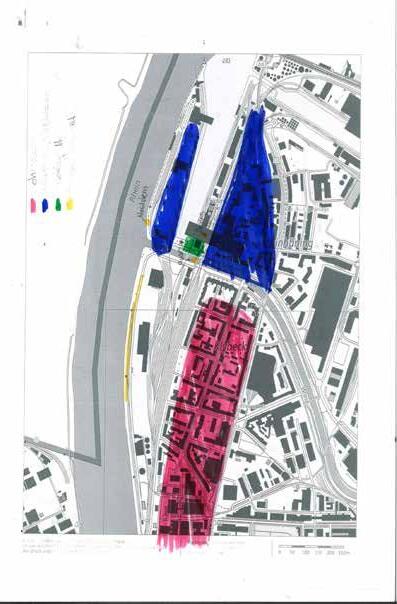
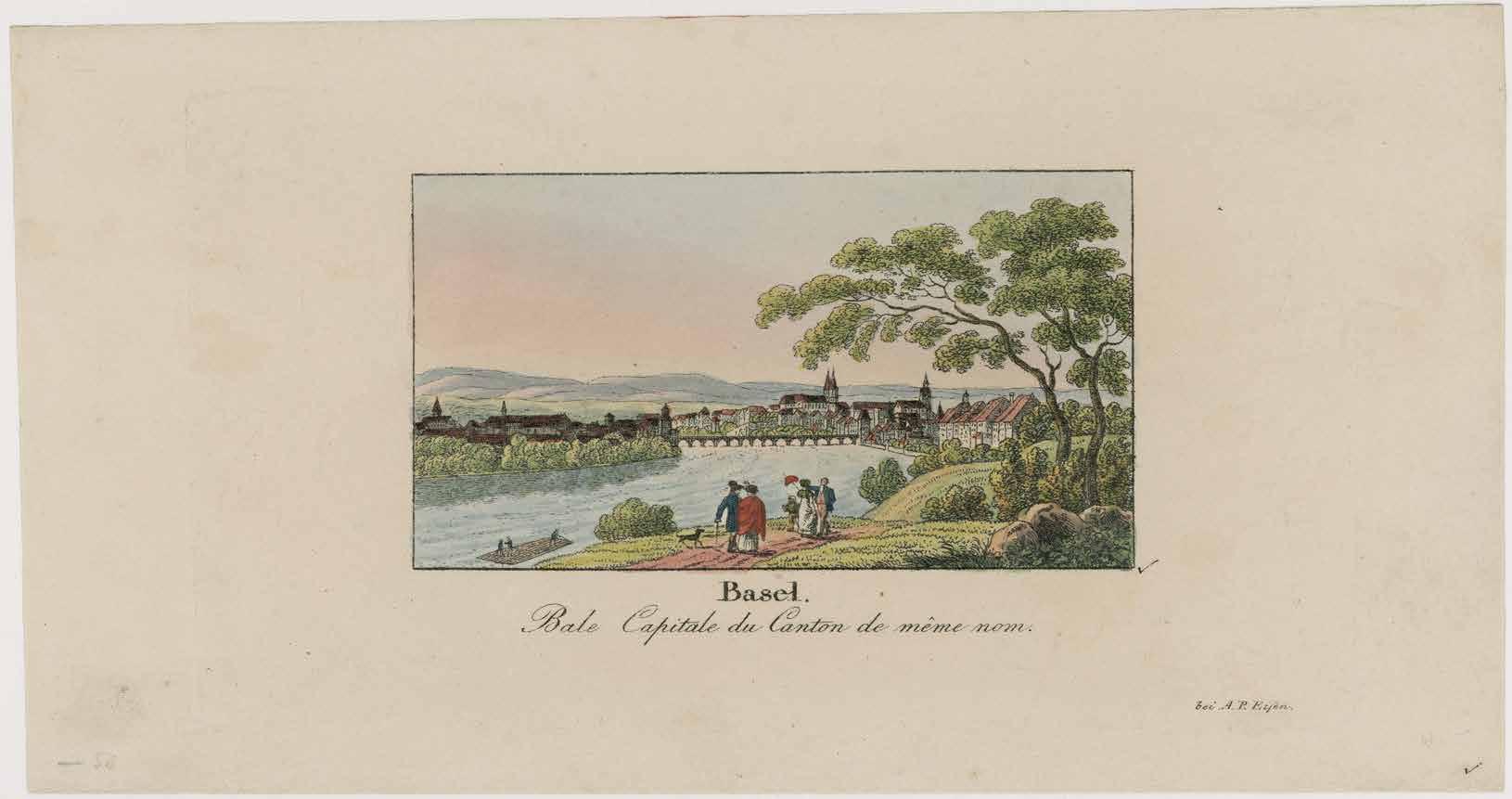
2 Espazium, „Ein Dorf wird Hafenstadt“, https://www.espazium.ch/de/aktuelles/ein-dorf-wird-hafenstadt.
01 Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt
10 Rheinansicht, Gross- und Kleinbasler Uferpartie, rheinaufwärts, 1820/30 NW
09 Lageplan, Rot = Wohnräume Blau = Arbeitsplätze

COLLAGE
Ein erster Schritt zur Visualisierung des Projekts. Der Versuch, eine gestalterische Form um unsere Vorstellung bildlich darzustellen.
INSPIRATION
In einem unserer Tischgespräche fiel der Name des amerikanischen Künstlers Gordon Matta-Clark, und wir begannen, uns intensiver mit seinen Arbeiten auseinanderzusetzen. Matta-Clark ist bekannt für seine „Cuts“, bei denen er Teile bestehender Gebäude oder Strukturen herausschnitt, um neue Perspektiven auf die Architektur zu schaffen. Er entfernte Teile von Wänden oder Decken, um den Raum und seine Nutzung neu zu interpretieren und den Blick des Betrachters auf eine andere Weise zu lenken. Diese künstlerische Herangehensweise inspirierte uns, auch die Architektur der Halle zu hinterfragen und zu verändern. So kam uns die Idee, sowohl im Dach als auch im Boden der Halle Kreise auszuschneiden. Diese runden Aussparungen würden die klaren, rechtwinkligen Formen der Halle aufbrechen

11 «Conical Intersect» Gordon Matta-Clark





Umschlagshalle mit rundem Ausschnitt im Dach Raummodell mit Photoshop bearbeitet
Digitale atmosphärische Skizzen
PROZESS
Um zu bestimmen, wie viele und wie gross die Löcher im Dach sein sollten, haben wir ein Modell erstellt, das verschiedene Grössen und Positionen der Öffnungen zeigte. Mit diesem Modell experimentierten wir, um zu sehen, wie das Licht durch die Löcher einfällt und welche Effekte es im Raum erzeugt. Gleichzeitig analysierten wir den Sonnenverlauf und die Fotodokumentation, um zu verstehen, wie das Licht den Raumes verändert und welche Wirkung es auf die Atmosphäre hat.

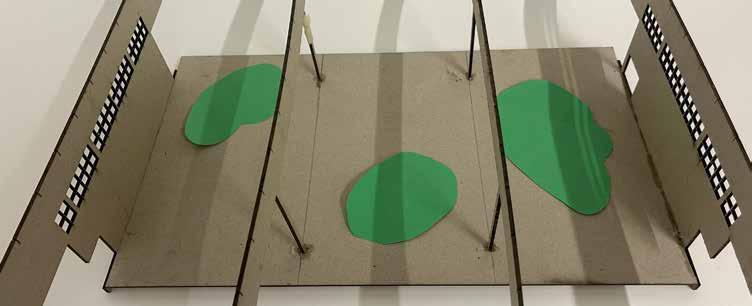





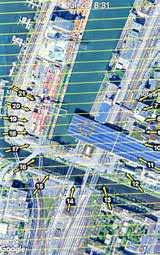

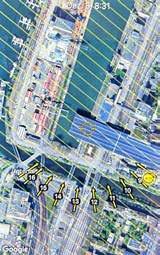
12 Sonnenverlauf












































Die Umschlagshalle wird so umgestaltet, dass Tageslicht und Wasser in den Raum eindringen können, wodurch ein Raum für neues Leben entsteht. Durch Öffnungen im Dach und Boden sollen Pflanzen – ein Baum für die Einwohner und ein Gebüsch für die Arbeiter – selbstständig wachsen. Ein Loch oberhalb des Hafenbeckens ermöglicht es, den Regenfall als klaren, kreisförmigen Schatten auf der Wasseroberfläche zu beobachten. Der Mensch wird dabei zu einem blossen Beobachter. Diese Haltung des Zurückhaltens und Beobachtens verweist auf eine tiefere philosophische Perspektive, wie sie Konfuzius in den folgenden Worten ausdrückt: „Hat der Himmel nicht gesprochen? Die vier Jahreszeiten drehen sich, alle Kreaturen werden geboren, aber spricht der Himmel?“
Der Himmel spricht nicht im traditionellen Sinne – er handelt durch den ständigen Wandel der Jahreszeiten, das Leben, das wächst, ohne dass es laut verkündet wird. Genauso wie die Natur sich ohne Eingreifen fortsetzt, sollen auch die Pflanzen in der Halle ohne menschliche Kontrolle wachsen. Es geht nicht darum, den Zyklus zu beherrschen oder zu lenken, sondern den natürlichen Fluss zuzulassen und ihn zu respektieren.
Die Halle wird dadurch nicht nur ein Raum des Wachsens und Verfallens, sondern auch ein Ort, der den natürlichen Rhythmus des Lebens widerspiegelt, der weder laut noch fordernd ist, sondern sich in seiner eigenen Zeit entfaltet. Somit erschaffen wir einen Raum, der, wie der Standort der Halle einst mal war, eine willkommene Abwechslung vom urbanen Turbel bietet.
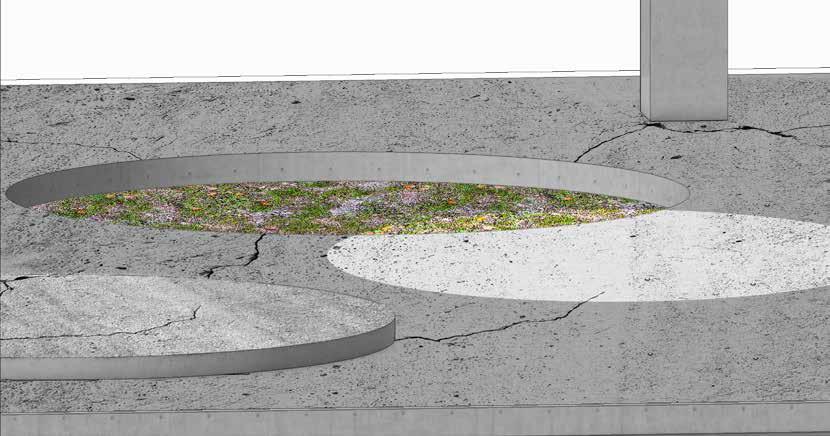
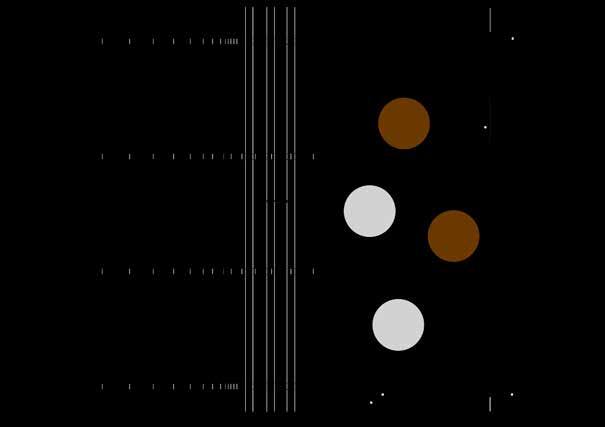
WIEDERVERWENDUNG UND FUNKTIONALITÄT
Das ausgeschnittene Material erhält eine neue Bestimmung. Die beiden herausgenommenen Kreise aus dem Boden werden in der Halle als Sitz- und Liegeflächen für Besucher integriert. Die drei ausgeschnittenen Teile des Dachs, versehen mit Solarpanels, finden ihren Platz an einem sonnigen Ort in der Umgebung und dienen dort weiterhin als Energiespeicher.

13 Lageplan der Solar-Kreise



1. Solar-Kreis : Horburgpark
2. Solar-Kreis: Dreyland Dichterweg
3. Solar-Kreis: Gegenüber






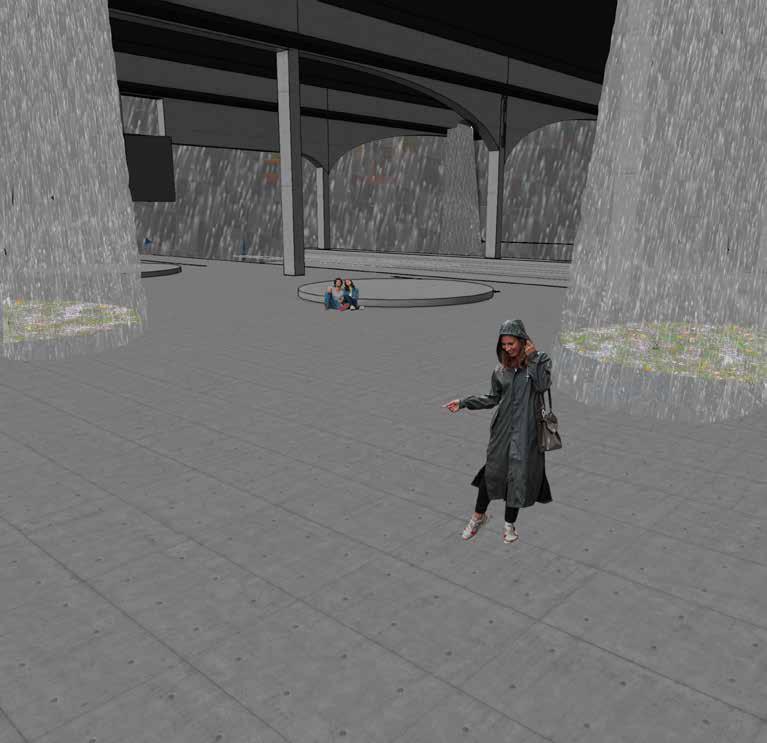




Schlussfolgerung
Die Raumintervention war sehr lehrreich und spannend. Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten, den Raum und seine Qualitäten angemessen zu analysieren. Auch die Entscheidung, in welche Richtung wir das Projekt entwickeln wollten, fiel uns zunächst schwer. Daher entschieden wir uns, dem Prozess selbst zu vertrauen und ihn als Leitfaden zu nutzen.
So nahm der Prozess der Raumintervention seinen Anfang. Besonders hilfreich waren die inspirierenden Tischgespräche, in denen Künstler:innen erwähnt wurden. Diese Gespräche halfen uns, ein klares Konzept zu entwickeln. Beim Ausarbeiten des Konzepts merkten wir schnell, wie viele Faktoren wir berücksichtigen mussten, wie zum Beispiel die Frage, was mit dem herausgeschnittenen Solarpanels passiert oder welche Pflanzen wir warum pflanzen, wie bewegt sich die Sonne? etc.
Es hat Spass gemacht zu entdecken, wie viele Details bei einer Raumintervention berücksichtigt werden müssen. Der gesamte Prozess war abwechslungsreich und bereichernd, und wir haben viel gelernt. Beispielsweise haben wir gelernt, wie man mit dem Lasercutter arbeitet, wie man ein Modell zusammenbaut, wie man Modellfotos macht oder wie man collagiert.
Darüber hinaus haben wir wertvolle Erkenntnisse gewonnen, was wir beim nächsten Projekt noch besser machen können z.B. welche Art von Collage eine intensivere Raumatmosphäre erzeugen kann und welche weniger wirkungsvoll ist. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unsere erste Raumintervention.
Abschliessend können wir sagen, dass das Projekt uns nicht nur als Raumgestalterinnen weitergebracht hat, sondern auch unser Verständnis von der Balance zwischen menschlicher Eingriff und natürlicher Entwicklung vertieft hat. Es war eine wertvolle Erfahrung, die uns ermutigt, zukünftige Projekte mit einer noch stärkeren Sensibilität für die Beziehungen zwischen Raum, Mensch und Natur zu entwickeln
BILDVERZEICHNIS
01 Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt: https:// map.geo.bs.ch (1.1.25)
02 Rheinansicht, Gross- und Kleinbasler Uferpartie : https://dls.staatsarchiv.bs.ch/records/558495 (1.1.25)
03 Rheinhafen Kleinhüningen, Hafenbecken I https://blog. staatsarchiv-bs.ch/strassengeschichten-9-kleinhueningen/ (1.1.25)
04 Umschlagshalle von innen: Eigene Aufnahme
05 Umschlagshalle und Hafenbecken | : Eigene Aufnahme
06 Skizzen: Auge, Hand, Nase und Ohr : https://de.freepik. com/vektoren-premium/sinnesorgane-hand-gezeichneter-mund-und-zunge-auge-nase-ohr-und-handflaeche-gravur-fuenf-sinne-vektor-illustration_7158418.htm (1.1.25)
07 Darstellung von Bewegungen: https://map.geo.bs.ch (1.1.25)
08 Diagramm der Geräusche: Vectorworks Grundriss Umschlagshalle
09 Lageplan, Rot = Wohnräume Blau = Arbeitsplätze: https://map.geo.bs.ch (1.1.25)
10 Rheinansicht, Gross- und Kleinbasler Uferpartie, rheinaufwärts, 1820/30 NW : https://dls.staatsarchiv.bs.ch/ records/558505 (1.1.25)
11 «Conical Intersect,» Gordon Matta-Clark.; https://www. gothamcenter.org/blog/cutting-up-the-city-in-crisis-gordonmatta-clark-and-the-urban-commons (1.1.25)
12 Sonnenverlauf: App: Die Bahn der Sonne
13 Lageplan der Solar-Kreise: https://map.geo.bs.ch (1.1.25)
14-16 Google Maps Street View
Alle weiteren Bilder sind Eigenaufnahmen.
«We need to bridge the differences that divide us and find the that unites us.»
- Gloria Anzaldúa
differences the common ground
HotSpot
Ein Indoor-Grillpark, der Gemeinschaft entfacht und Wärme spürbar macht.
Die Entstehung des Projekts HotSpot war ein aufregender, aber auch anspruchsvoller Prozess. Von der ersten Idee bis zur nalen Umsetzung war der Weg geprägt von Höhen und Tiefen, intensiver Recherche, hitzigen Diskussionen und notwendigen Kompromissen. Jede Entscheidung, die wir getro en haben, war das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung zwischen Idealvorstellungen und realistischen Rahmenbedingungen.
Die ersten Schritte: Von der Idee zur Planung
Am Anfang stand die Vision, einen Ort zu scha en, an dem Gemeinschaft erlebbar wird – unabhängig von kulturellem Hintergrund oder sozialer Stellung. Wir wussten jedoch, dass ein so ambitioniertes Projekt eine solide Grundlage braucht. Deshalb begannen wir mit einer detaillierten Analyse der Umgebung.
Die Umschlaghalle des Hafens im Klybeckquartier bietet großes Potenzial: Sie liegt zentral in einem kulturell vielfältigen Viertel, das jedoch auch mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Recherche vor Ort zeigte uns schnell, dass der Bedarf an einem o enen und einladenden Tre punkt groß ist.
Die umliegende Stadtlandschaft ist geprägt von einer eher kühlen Atmosphäre mit wenigen Grün ächen und kaum ö entlichen Räumen, die zum Verweilen einladen, ohne Konsumzwang. Das Quartier ist sehr dicht besiedelt, mit einer hohen Anzahl von Menschen pro Wohnquadratmeter. Vor allem Menschen mit geringeren nanziellen Mitteln leben hier, da die Mietkosten im Vergleich zu anderen Wohnquartieren sehr günstig sind. Die Bewohner sind hauptsächlich junge Menschen, junge Familien sowie Künstler und angehende Designer.
Ich selbst, Yan, lebe seit zwei Jahren im Quartier Klybeck/Kleinhüningen und habe dort auch gearbeitet. Durch meine eigenen Erfahrungen kenne ich viele Menschen aus der Nachbarschaft. Oft höre ich, wie sie sich einen Ort wünschen, an dem sie zusammenkommen können und die Kinder sich austoben können – besonders im Winter, wenn es für die meisten Outdoor-Aktivitäten zu kalt ist. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt, ohne dass Konsum im Vordergrund steht.



Aus diesen Anregungen heraus möchten wir einen Ort scha en, an dem Menschen zusammenkommen können. Uns schwebt vor allem ein gemeinsames Essen vor, bei dem man gemütlich am Feuer sitzen und Zeit miteinander verbringen kann.
Zusätzlich haben wir festgestellt, dass es in der Gegend kaum Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, insbesondere während der kalten Jahreszeit. Viele Familien wünschen sich einen geschützten Raum, in dem ihre Kinder spielen und sich entfalten können, ohne dass sie dafür weit fahren oder viel Geld ausgeben müssen. Auch für Erwachsene gibt es wenig Möglichkeiten, sich in ungezwungener Atmosphäre zu tre en und auszutauschen.
Unser Ziel ist es, einen Ort zu scha en, der nicht nur als Tre punkt dient, sondern auch die Gemeinschaft stärkt. Wir stellen uns vor, dass dieser Raum exibel genutzt werden kann – sei es für gemeinsame Mahlzeiten, kreative Workshops, Spielmöglichkeiten für Kinder oder einfach als Rückzugsort für alle, die eine Pause vom Alltag brauchen. Besonders wichtig ist uns, dass dieser Ort für alle Bewohner des Quartiers zugänglich ist und keine nanziellen Hürden bestehen.
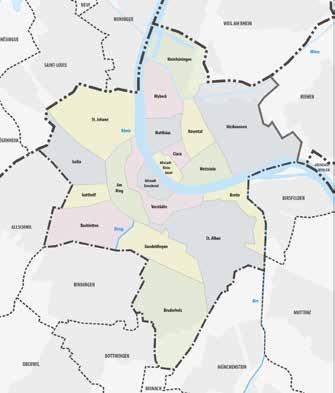


Planung und Herausforderungen: Der Weg zu einem tragfähigen Konzept
Die eigentliche Planung brachte die ersten grossen Herausforderungen. Unser Ziel war es, einen Ort zu scha en, der gleichermassen funktional und atmosphärisch ist, dabei aber für unterschiedliche Bedürfnisse genutzt werden kann – im Sommer wie im Winter.
Ein Beispiel für die vielen Diskussionen war die Gestaltung der Sitz ächen. Ursprünglich hatten wir überlegt, klassische Tische und Stühle zu verwenden, oder gar Paletten, um möglichst vielen Menschen Platz zu bieten. Doch schnell wurde klar, dass wir etwas Einzigartiges schaffen wollten, das nicht nur funktional, sondern auch einladend und gemütlich ist. Die Idee der organisch gestalteten Sitztreppen mit integrierten Öfen entstand, aber sie brachte technische Herausforderungen mit sich.
Besonders das Heizsystem der Öfen erforderte zahlreiche Anpassungen. Das geplante Rohrsystem zur gleichmässigen Wärmeverteilung war komplex und musste mehrfach überarbeitet werden, um sowohl e zient als auch sicher zu sein. Dies führte zu mehreren Verzögerungen.
Wir einigten uns relativ schnell auf organische Formen, um die kalte und kahle Halle mit ein wenig Leben zu erfüllen. Dazu kamen viel Holz und warme Farben, um dies noch weiter zu unterstreichen. Wir wollten eine möglichst vielseitig einsetzbare Landschaft scha en, die die Menschen auf verschiedene Arten nutzen können – zum Stehen, Laufen, Rennen, Sitzen oder Liegen.
Da wir vor allem von den Anwohnern gehört hatten, dass sie im Winter einen Ort zum Verweilen suchen, haben wir uns überlegt, wie wir der Kälte entgegenwirken können. Nützlicherweise ist Feuer sehr vielseitig: Es produziert nicht nur Licht, um den Raum zu erhellen, sondern auch Wärme. Allerdings wird die Wärme der Feuerstellen allein nicht ausreichen, um die riesige und hohe Halle zu heizen. Deshalb ha-
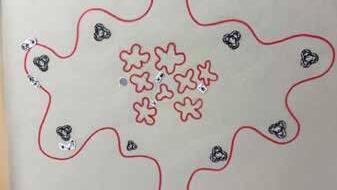
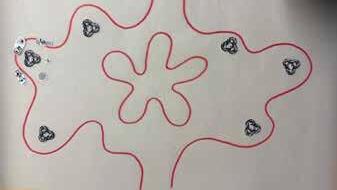


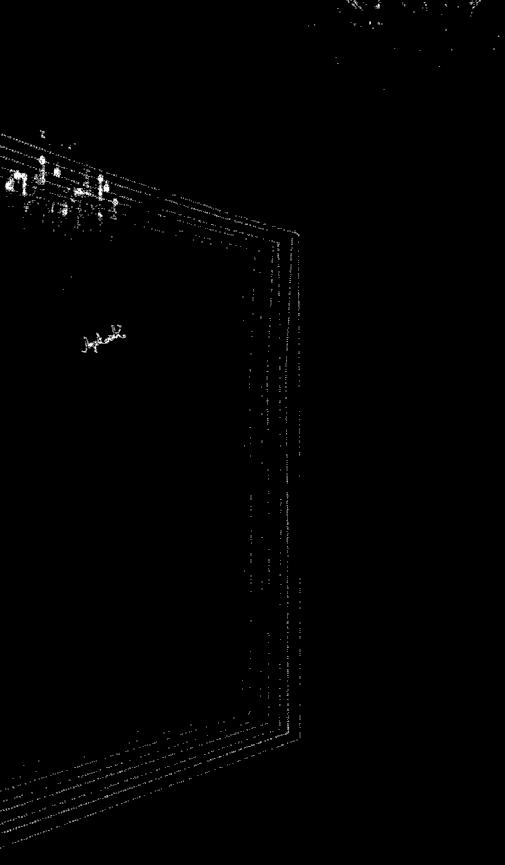


ben wir uns gedacht, dass es am e zientesten wäre, nicht die gesamte Halle zu heizen, sondern nur die Bereiche, in denen sich die Menschen aufhalten – also die Sitzlandschaft.
Um diese zu wärmen, haben wir von den Menschen gelernt, die schon seit jeher mit der Kälte leben. Beispielsweise gibt es in Osteuropa Kachelöfen, die nicht nur Wärme spenden, sondern auch als warme Schlafgelegenheiten, Sitzplätze oder sogar zum Kochen genutzt werden können. Oder die chinesischen Kang-Betten, die durch die Wärme, die beim Kochen entsteht, beheizt werden. Inspiriert von diesen Ideen haben wir uns eine eigene Variante überlegt, mit der wir die Sitzlandschaft heizen und gleichzeitig als Ofen nutzen können.
Wir heizen die Sitz äche, indem wir die Wärme je nach Bedarf direkt ableiten oder durch einen Schiebemechanismus den direkten Weg nach draussen versperren. Dadurch wird die Wärme durch einen längeren Weg geleitet, was die Landschaft e ektiv beheizt. In der Mitte der Halle hatten wir uns zunächst überlegt, eine grosse Feuerstelle zu platzieren. Doch dann el uns auf, dass die Menschen auch Zugang zu frischem Wasser benötigen. Also haben wir auf spielerische Art und Weise eine Wasserstelle konzipiert. Damit sie sich harmonisch in die Landschaft einfügt, hat sie eine organische Form. Am Rand entlang iesst ein kleiner „Fluss“ mit ge ltertem, frischem Wasser, während die Mitte einen Ort zum Verweilen bietet.
Diese Wasserstelle bietet viele Möglichkeiten, die Vielseitigkeit von Wasser zu nutzen: Kinder können damit spielen, man kann das entspannende Geräusch des iessenden Wassers geniessen und die Füsse – oder auch die Gedanken – baumeln lassen. Um die Flächen noch einladender zu gestalten, insbesondere für längeres Verweilen, haben wir uns überlegt, überall Kissen aus Reststo en zu nähen und zu verteilen. Ebenso könnten aus Teppichresten gemütliche Liege ächen gescha en werden – ähnlich wie die Reste, die wir im O cut gefunden haben. Kompromisse und kreative Lösungen






Wie bei jedem grossen Projekt mussten auch wir Kompromisse eingehen. Nicht jede Idee liess sich genauso umsetzen, wie wir sie uns vorgestellt hatten. So war es ursprünglich geplant, den gesamten Boden der Halle mit Holz auszulegen, um eine warme und natürliche Atmosphäre zu scha en. Doch wegen der hohen Feuchtigkeitsbelastung in der Nähe des Rheins entschieden wir uns für einen Mix aus Teppichbereichen und robusten Bodenplatten.
Auch die Idee, den Rhein stärker in das Konzept einzubinden, musste angepasst werden. Ein geplanter Zugang direkt vom HotSpot zum Wasser liess sich aus baulichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht realisieren. Stattdessen schufen wir exible Gestaltungsmöglichkeiten, wie die absenkbare Mittelwand, die die Halle optisch und räumlich mit der Umgebung verbindet.


Zusammenarbeit und Entscheidungen
Ein weiterer zentraler Aspekt des Prozesses war die Zusammenarbeit im Team. Unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen prägten die Diskussionen – besonders die Frage, wie wir den Ort im Winter warm und gleichzeitig energiee zient halten können.
Manche Entscheidungen elen uns schwerer als andere. Oft standen wir vor dem Spannungsfeld zwischen ästhetischen und praktischen Lösungen. Es gab Momente, in denen wir als Team an unsere Grenzen kamen, doch letztlich fanden wir immer wieder Wege, gemeinsam voranzukommen.
Beim letzten Tischgespräch brainstormten wir über weitere Möglichkeiten der Raumgestaltung. Dabei entstand die Idee, dass sich durch das Feuer und die Nähe zum Wasser auch eine Sauna anbieten würde. Im Sommer könnte zudem ein direkter Zugang zum Wasser die Attraktivität des Ortes steigern – insbesondere, da es in der warmen Jahreszeit bereits viele Feuerstellen in der Umgebung gibt.
Da wir unter erheblichem Zeitdruck standen, mussten wir schnell entscheiden, welche dieser neuen Ideen sich kurzfristig umsetzen liessen. Da wir eine Sauna eher als Winteraktivität sehen und unser Hotspot in der kalten Jahreszeit bereits genügend Anziehungspunkte bietet, entschieden wir uns letztlich für den Wasserzugang..






Fazit: Der Weg hat sich gelohnt
Die Entstehung von HotSpot war eine intensive Reise – geprägt von Herausforderungen, kreativen Lösungen und Kompromissen. Jeder Rückschlag zwang uns, neue Wege zu nden, und genau diese Prozesse haben das Projekt letztlich bereichert. Was als Idee begann, wurde durch gemeinsames Engagement zu einem realen Ort der Begegnung.
HotSpot ist mehr als nur ein Tre punkt – er steht für die Kraft der Zusammenarbeit und die Bedeutung von Gemeinschaft. Auch wenn viele Details noch nicht vollständig ausgearbeitet sind, zeigt das Projekt bereits sein Potenzial: Es bietet Raum für Austausch, Wärme und gemeinsame Erlebnisse. Unser Wunsch ist es, diesen Ort weiterzuentwickeln und die o enen Fragen in Zukunft genauer zu betrachten.
Letztlich ist HotSpot nicht nur ein physischer Raum, sondern auch eine Erfahrung, die uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten. In einer Stadt, die oft von sozialen und kulturellen Unterschieden geprägt ist, wollen wir Brücken bauen – zwischen Menschen, Ideen und Möglichkeiten.
Ganz in dem Sinne von Gloria Anzaldúa:

«We need to bridge the di erences that divide us and nd the common ground that unites us.»





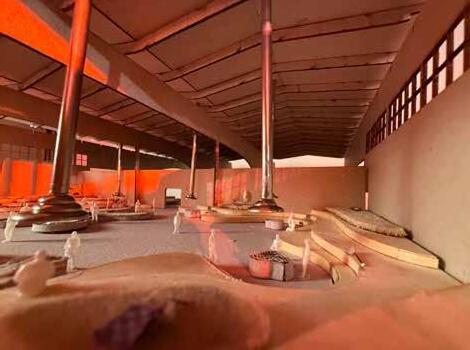
Kurzfilm
«Perspektive im Raum»
In unserem Kurzfilm, der ausserhalb und im Hafen gedreht wurde, kann man diesen aus drei Blickwinkeln betrachten. Wir haben dabei die Vogel-, Frosch- und die Perspektive auf Augenhöhe gewählt. Damit wollten wir erreichen, dass der Raum aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen wird und dadurch unterschiedliche Gefühle und Betrachtungsweisen hervorruft. Es ging für uns auch darum, zu experimentieren und auszuprobieren, wie sich der Körper im Raum bewegen kann – daher auch die Drehungen um die eigene Achse beim Laufen.


13-18 Eigene Abbildungen, Video Stills




«Eine unkonventionelle Art Wasser in Berührung zu kommen»
schaffen, um mit kommen»
Wellen der Veränderung

UMSCHLAGHALLE HAFEN BASEL
Die Umschlaghalle am Basler Hafen ist ein bedeutender logistischer Knotenpunkt. Im Rahmen einer Raumintervention untersuchten wir die Potenziale einer Umnutzung dieses Ortes. Die Halle liegt am ersten Hafenbecken und ist von industrieller Infrastruktur umgeben. Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung war die angrenzende Lagerhalle fast ausschließlich mit Aluminium gefüllt. Diese aufeinander gestapelten Aluminiumblöcke erzeugten in einem das Gefühl in einem Labyrinth zu stehen.



Abb. 1: Umschlaghalle vom Hafenbecken aus
Abb. 2: Standort auf der Karte
Abb. 3: Umschlaghalle hervorgehoben
BESUCH DER UMSCHLAGHALLE
Während der Besichtigung fielen uns verschiedene räumliche und atmosphärische Qualitäten auf. Die Halle zeichnet sich durch ihre Offenheit und Zugänglichkeit aus. Die industrielle Bauweise mit hohen Decken, Stahlträgern und sichtbaren Spuren der Vergangenheit verleiht ihr eine besondere Ästhetik. Trotz ihres ursprünglichen Nutzungszwecks wirkt sie nicht abweisend, sondern flexibel und wandelbar.


Abb. 4 & 5: Grundriss und Schnitte der Umschlaghalle
Abb. 6 & 7: Innenberreich der Umschlaghalle






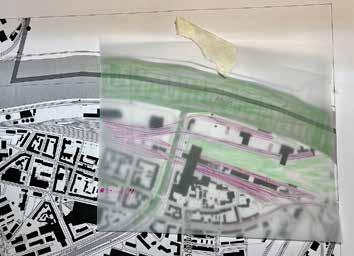


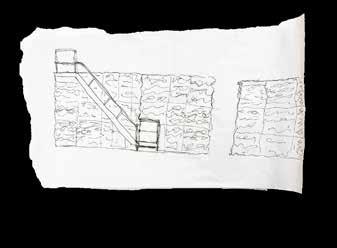

Abb. 8 - 13: Diverse Aufnahmen von der Umschlaghalle
Abb. 14: Gleise, Fluss & Hafenbecken hervorgehoben
Abb. 15: Abdruck Ingot
Abb. 16: Skizze
Human Factor
«AUF DEN SPUREN DES ALLUMINIIUMS»
Bei der Besichtigung des Raumes fielen uns neben räumlichen Qualitäten wie Offenheit und Zugänglichkeit vor allem die Aluminiumblöcke auf, die wir als labyrinthartige Gänge wahrnahmen. Im Boden wurden kleine Aluminiumpartikel gefunden, die das Sonnenlicht reflektieren. Im Rahmen unserer Mission, einen Kurzfilm zu produzieren, der auf einer der drei menschlichen Wahrnehmungen basiert, haben wir uns entschieden, uns auf die auditive Wahrnehmung zu konzentrieren, die oft unterschätzt wird und es schafft eine besondere Atmosphäre.
Während unseres Besuchs fiel uns auf, wie der Raum in der Halle Geräusche verstärkte und veränderte: das Knirschen von Aluminiumpartikeln unter unseren Schuhen, das Echo unserer Schritte, das metallische


Knacken aufeinandertreffender Blöcke und das Knistern von Klebeband auf verschiedenen Oberflächen. Dabei lag der Fokus zunächst eher auf Aluminiumpartikeln, da diese sich jedoch nur schwer erfassen ließen – etwa, weil das Klebeband mehr Schmutz aufnahm als abfing. Partikel - der auditive Aspekt hat zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Deshalb ist unser Film mit einem dominanten akustischen Faden entstanden: Die Reibung der mit Klebeband umwickelten Hände zieht sich durch den Film und verleiht ihm eine konstante, fast rhythmische Komponente. Ergänzt wird dieser Effekt durch die Kratzer, Schrammen und Risse unterschiedlicher Materialien, wodurch eine dichte und immersive Klanglandschaft entsteht, die die Raumwahrnehmung intensiviert.





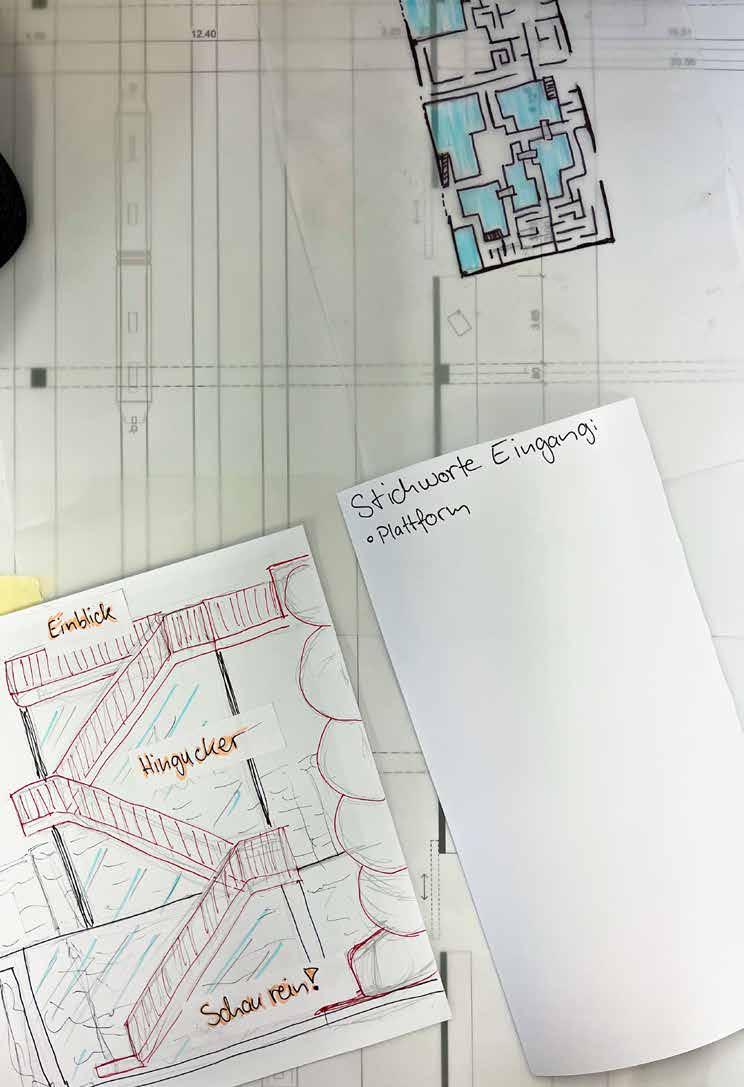
Ideenfindung
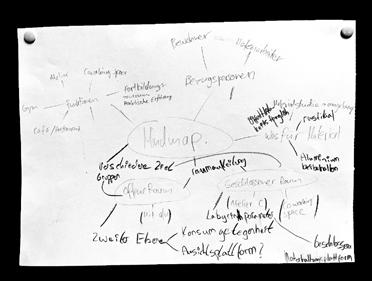
Vom Labyrinth zur interaktiven Wasserinstallation
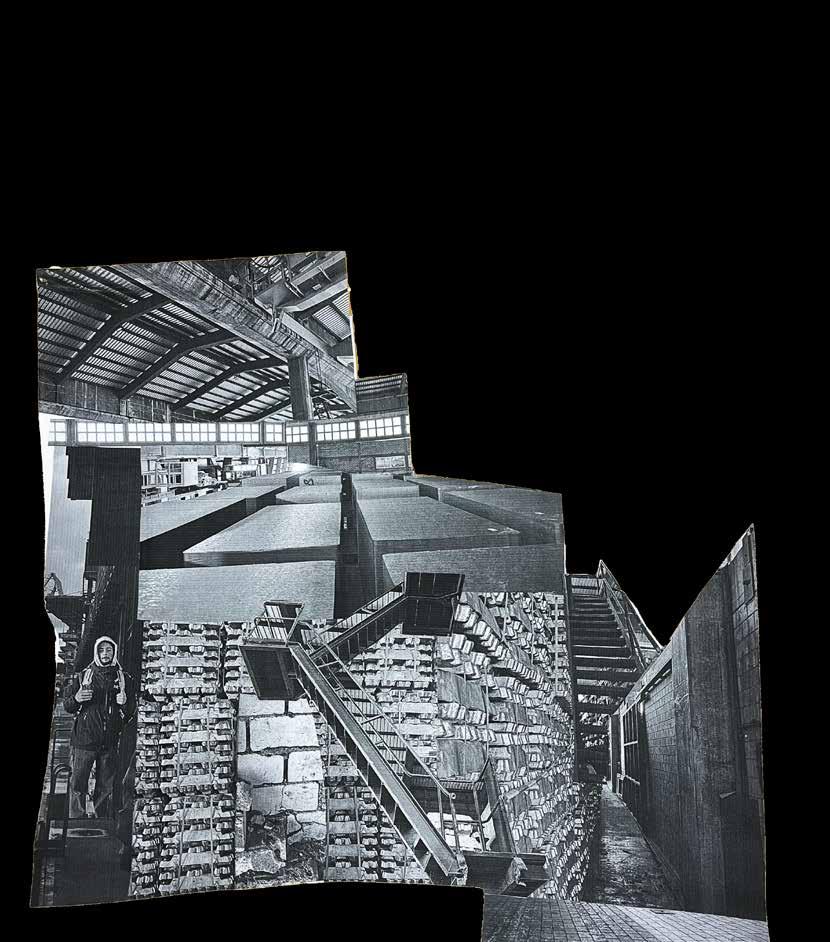
Abb. 18: Mindmap
Abb. 19: Konzeptionelle Collage
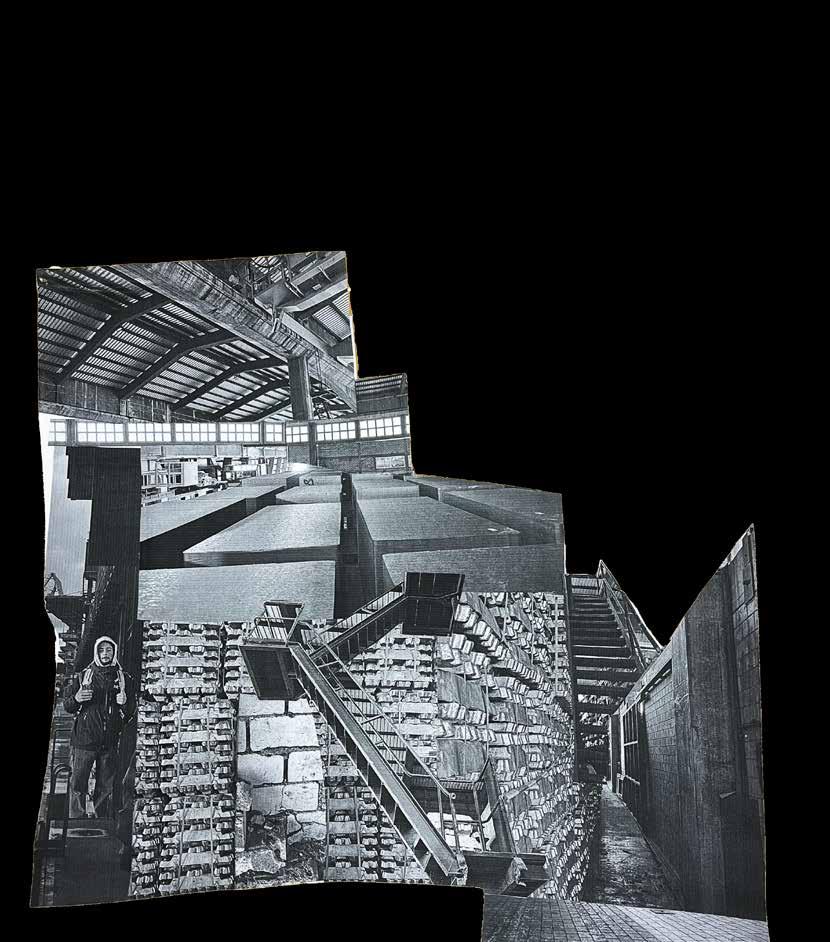



Abb. 20: Skizze Innenbereich
Abb. 21: Skizze Eingang
Abb. 22: Grundriss Entwurf
GESCHICHTLICHER ASPEKT
Der Hafen Basel war über Jahrzehnte ein zentraler Umschlagplatz für Waren, die über den Rhein transportiert wurden. Mit der zunehmenden Containerisierung veränderten sich jedoch die Logistikstrukturen. Die Umschlaghalle hat ihre ursprüngliche Funktion verloren und steht nun vor der Herausforderung einer Umnutzung.
Die historische Entwicklung des Hafens Basel und des Stadtteils Kleinhüningen spielte eine zentrale Rolle. Kleinhüningen war einst ein Fischerdorf und wurde 1908 nach Basel eingemeindet. Die Industrialisierung und der Bau des Hafens verwandelten das Quartier in einen wichtigen Wirtschaftsstandort. Heute stehen viele der historischen Hafenstrukturen vor der Herausforderung einer neuen Nutzung.
VERBINDUNG VON GESCHICHTE, KUNST UND GEMEINSCHAFT
Die Umschlaghalle wird durch die Installation von einem funktionalen Umschlagplatz in einen Ort der Begegnung, Reflexion und Erholung verwandelt. Sie schlägt eine Brücke zwischen Industriegeschichte, Natur und zeitgenössischer Kunst. Durch audiovisuelle Installationen, Klanglandschaften und Lichteffekte werden Besucher:innen in die Vergangenheit des Hafens und dessen Bedeutung für Kleinhüningen eingeführt. Die Wasserinstallation dient als Erinnerungsraum und gleichzeitig als Symbol für Wandel und Erneuerung.
Die erste Konzeptidee drehte sich um ein Labyrinth, das als symbolischer Zugang zum Wasser dienen sollte. Diese Idee wurde weiterentwickelt und mündete in ein Konzept, das industrielle Geschichte mit einer modernen Nutzung verbindet.
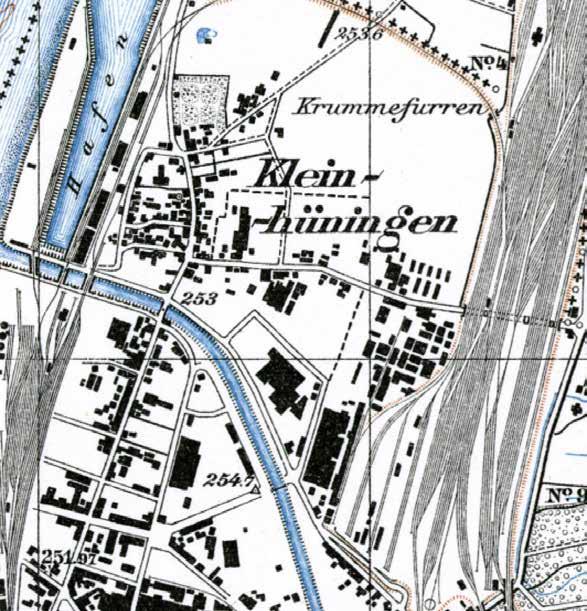


Abb. 23: Kleinhüningen im Jahr 1930
Abb. 24: Kleinhüningen im Jahr 2025

Hafenareal Kleinhüningen
«ZWEI WELTEN»
Kleinhüningen soll als verbindendes Element zwischen der Geschichte des Hafens und dem Quartier wirken. Der Zugang zum Rhein wird wiederhergestellt und Wasser als zentrales Thema in die Gestaltung integriert.
Umsetzung:
Das Areal wird in drei Zonen unterteilt: Niederschlag (Regen), Fliessen (Wasser im Labyrinth) und Verdunstung & Verweilen (Sitzmöglichkeiten und Wasseransammlungen).
Technische Umsetzung: Wasser wird aus dem Rhein entnommen, gefiltert und über das Labyrinth verteilt.
Ziel: Die Intervention soll Besucher:innen zum Nachdenken über den Umgang mit natürlichen Ressourcen anregen und die Balance zwischen Natur und Industrie thematisieren.
Abb. 25: Grundriss Neu
Abb. 26: Schnitt Neu

ZONEN DES WASSERKREISLAUFS
Die Installation gliedert sich in drei klar definierte Zonen, die sich auf die räumliche Struktur der Umschlaghalle beziehen:
Zone 1 – Regen und Wahrnehmung
Im Eingangsbereich werden Besucher:innen von einer Wasserdüsen-Installation empfangen, die einen künstlichen Regen erzeugt. Sensoren steuern das Wasser so, dass es nur dort fällt, wo niemand geht. Die Kombination aus Licht, Spiegelun gen und Bewegung erzeugt ein immersives Erlebnis, das an das unvorhersehba re Wettergeschehen erinnert. Der industrielle Charakter der Halle bleibt dabei er halten – die Stahlträger und offenen Strukturen reflektieren das Licht und verstär ken die Dynamik des Wassers.
Zone 2 – Strömung und Transformation
In der Mitte der Halle wird das Wasser auf geneigte Flächen geleitet, sodass es sich seinen eigenen Weg sucht – eine Hommage an den Rhein als Transport- x
Zone 3 – Im dritten Wasserspielbereich wird Wasser auf kleinem Raum von ca. 15 cm ge speichert, welcher als Ort der Ruhe und Besinnung dient. Das Sitzen auf der Was seroberfläche lädt die Besucher ein, ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen und mit dem Element Wasser in Kontakt zu kommen. Durch Verdunstung entsteht ein deutlich kälteres Mikroklima, wodurch der natürliche Wasserkreislauf gefährdet wird. Dieser Bereich vervollständigt die Intervention durch die Schaffung einer At mosphäre Es schafft eine Verbindung zwischen Wasser, Raum und Nutzern und fördert die Diskussion über die Bedeutung von Wasser im urbanen Raum.
Abb. 27: Zonen Diagramm
KONZEPT & NARRATIVE GESCHICHTE
Der Audioguide begleitet die Besucher:innen durch das Labyrinth und bietet eine immersive, narrative Erfahrung. Mit einer Mischung aus Erzählungen, Geräuschkulissen und Musik wird die Geschichte des Wassers und der Umgebung lebendig. Die Stimmen der Erzähler:innen wechseln zwischen informativ und poetisch, um sowohl Wissen zu vermitteln als auch Emotionen anzusprechen. Interaktive Stationen ermöglichen es den Nutzer:innen, gezielt Inhalte zu erkunden, wie die Geschichte des Rheins, den Wandel des Hafens oder ökologische Zusammenhänge. Der Audioguide schafft so eine persönliche Verbindung zur Intervention und lädt zu Reflexion und Entdeckung ein.
Szene 1: Der Gebirgsbach – ruhiges Rauschen des Wassers.
Szene 2: Der mächtige Fluss – das Wasser trägt Geschichten mit sich.
Szene 3: Die Verdunstung und Rückkehr des Wassers – der Kreislauf des Wassers wird erlebbar.
AUDIOGUIDE TEXTAUSSCHNITT
«Du befindest dich an einem ruhigen Gebirgsbach, der aus den tiefen Alpen hervorsprudelt. Klar und frisch fliesst das Wasser über Felsen und Steine – der Ursprung eines uralten Kreislaufs. Hier beginnt die Reise des Wassers, die sich über Berge, Täler und Flüsse bis zu den grossen Strömen erstreckt, die die Lebensadern von Städten und Handel bilden. Wenige wissen, dass dieser unscheinbare Gebirgsbach seinen Weg bis in den Rhein und schliesslich in den Basler Hafen findet, einem der grössten Binnenhäfen Europas.»

Abb. 28: Wassersystem Diagramm
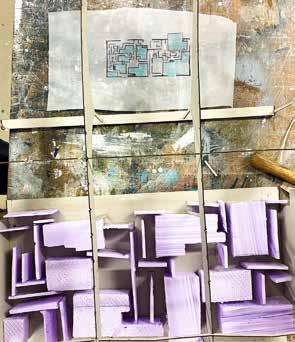







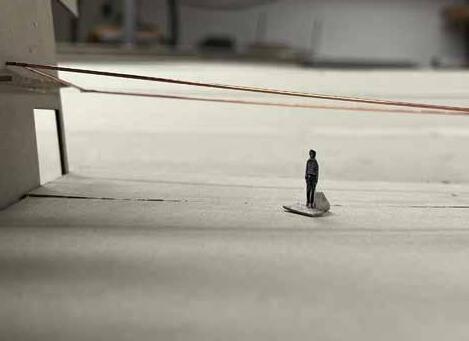







Modell Fotos

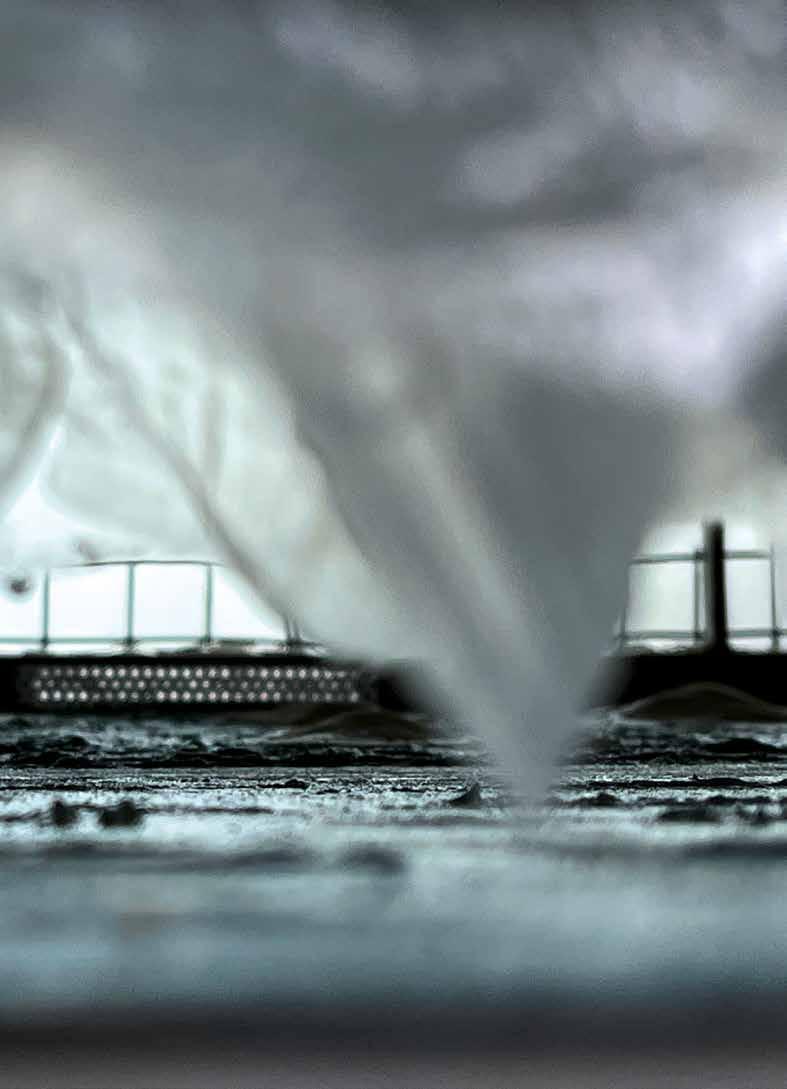







Die Untersuchung der Umschlaghalle zeigte ihr enormes Potenzial für eine neue Nutzung. Der Bezug zum Wasser könnte durch gestalterische Eingriffe gestärkt werden. Die Kombination aus historischer Reflexion, künstlerischer Inszenierung und gemeinschaftlicher Nutzung schafft eine neue Identität für die Halle. Besonders die Teamarbeit und der iterative Designprozess waren lehrreich. Allerdings fiel es uns schwer, von der Theorie in die Praxis zu kommen – insbesondere bei der Umsetzung technischer Aspekte und der Materialwahl. Falls das Projekt erneut durchgeführt würde, wäre eine noch klarere Aufgabenverteilung und eine frühzeitige Strukturierung des Zeitmanagements hilfreich. Insgesamt war die Arbeit eine bereichernde Erfahrung, die neue Perspektiven auf die Nutzung historischer Hafenstrukturen eröffnete.
1
2
Abbildungsverzeichnis
Eigenaufnahme
Geodaten Kanton Basel-Stadt, 31.10.2018, map.geo.bs.ch
3 Zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmaterial
4-5 Zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmaterial
6-22 Eigenaufnahmen
23
Zeitreise-Kartenwerke,1938, https://s.geo.admin.ch/d0x3int6lmhq 24 Karte Kleinhüningen, 29.01.2025, https://s.geo.admin.ch/858txlfqsmu0 25-44 Eigenaufnahmen
«Loslassen, immer wieder
wieder loslassen.»
Upsidedown
Wo Grenzen gesprengt werden
Ein grauer Riese aus Beton, still und monumental. Die Umschlagshalle im Rheinhafenareal von Klybeck-Kleinhüningen ist 232 Meter lang, 50 Meter breit und 15 Meter hoch – ein brutalistisches Zeugnis der Moderne, Vorreiter des Spannbetonbaus.
Einst pulsierender Knotenpunkt für Güter, die kamen und gingen, ein Symbol des Wandels. Heute steht sie leer, gefangen in der Kälte der Zeit. Für die Errichtung musste die Bevölkerung weichen, sie wurde in die Enge getrieben, ihre Lebensräume weggenommen und schliesslich verdrängt für den schnellen industriellen Herzschlag von Basel.1
Wir kehren den grauen Giganten auf den Kopf. Es entsteht ein buntes, lustvoll animierendes Zentrum für Bewegung, Kreativität und Gemeinschaft.
Mit „Upsidedown“ schaffen wir einen Ort, an dem jede Abenteuerlust und Lebensfreude in voller Blüte strahlen kann – ein Spielplatz für «grosse Kinder», der begeistert, auspowert und verbindet. Hier ist der Raum gefüllt von lautem Gelächter, belebter Stimmung und ehrfürchtigem Staunen über die hohe, farbenfrohe Erlebniswelt.
Wir möchten „Upsidedown“ zu einem echten Highlight in der Region machen, um so wieder ein Stück Klybeck an die Anwohnenden zurückzugeben. Dadurch wollen wir Platz schaffen, damit der Raum von den Anwohnenden neu genutzt werden kann. Platz für Veranstaltungen, Performances oder Theateraufführungen, um so zusätzlich eine kulturelle Bereicherung für die Region zu schaffen.



Erste Eindrücke
Schon auf dem Weg zur Umschlagshalle fiel uns auf, wie wenig Menschen uns begegneten – sicherlich auch bedingt durch das eisig kalte Wetter an diesem Tag. Doch unabhängig von der Witterung sehen wir in der Umgebung der Umschlaghalle nur wenige soziale Knotenpunkte, die Begegnungen fördern oder gar zum Verweilen einladen. Wir befinden uns mitten im Hafenindustriegebiet und wenn wir auf Menschen treffen, sind diese meist orange gekleidete Hafenarbeiter:innen. Spürbar ist die alte, vielseitige Geschichte des Ortes. Materialien, die gehen und kommen, wie Wellen, die im Hafenbecken an den Beton schellen.
Eine Aluminiumwand füllt unseren Blickwinkel komplett aus. Das ist das Erste, was wir in der Halle sehen.
Der Blick schweift weiter in die imposante Höhe des Raumes. Die Architektur ist mächtig, wir fühlen uns klein.




02 Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt


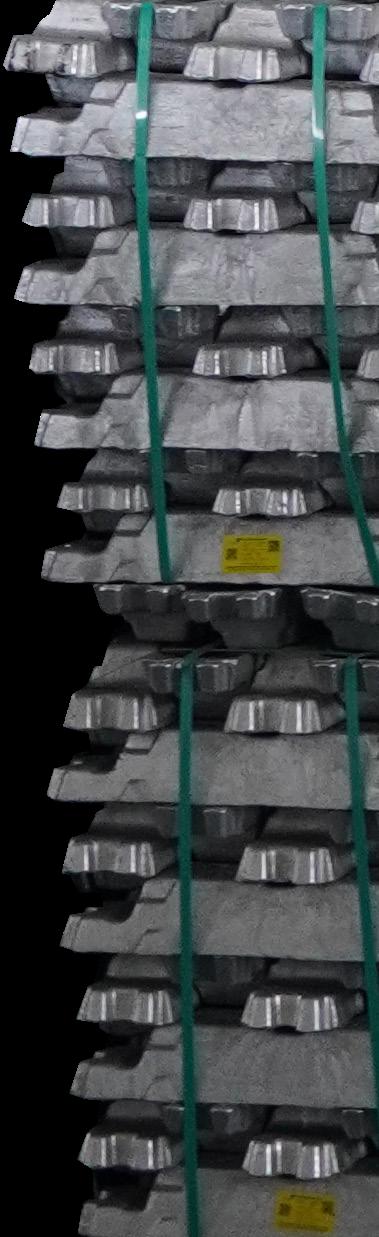
Die Umschlagshalle

Umschlagshalle

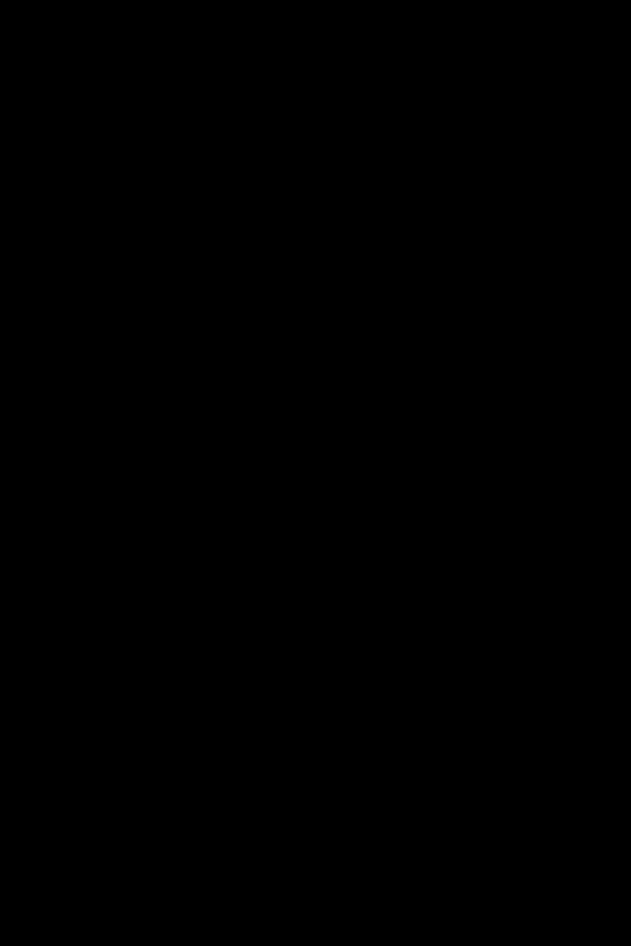
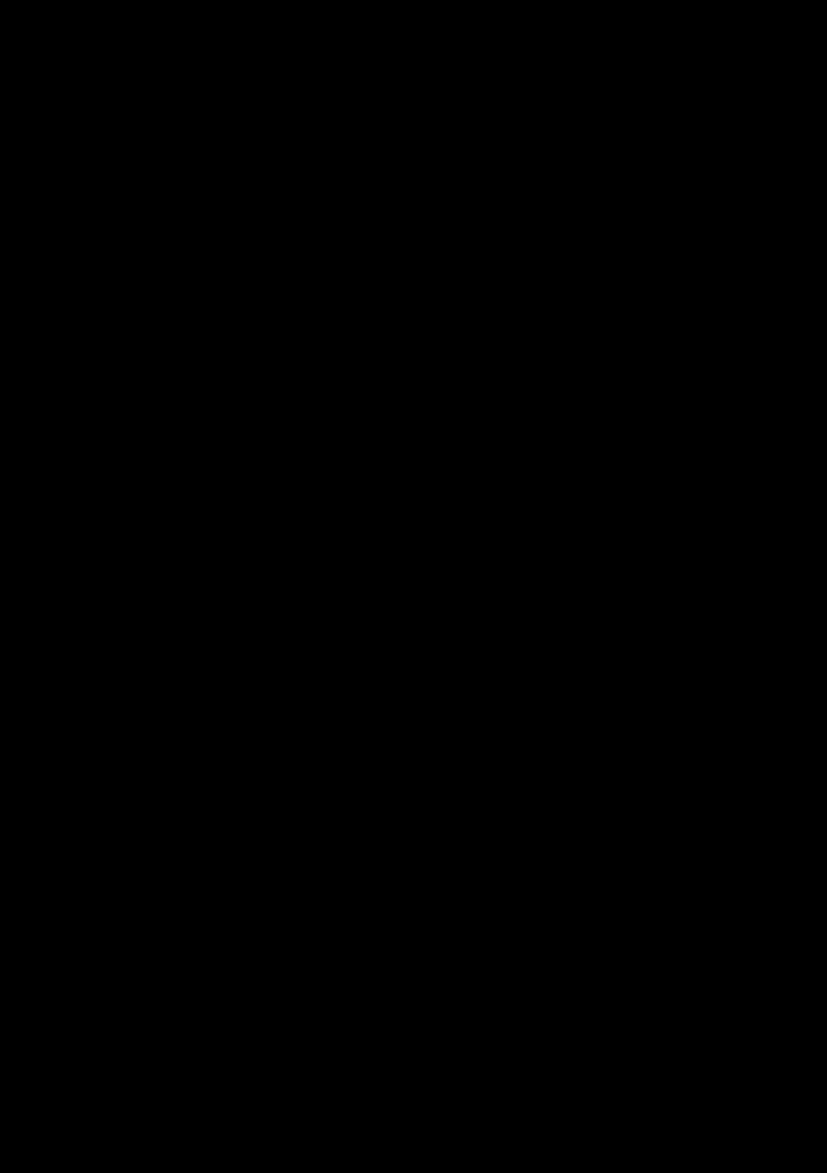




Die Umschlaghalle spiegelt für uns die gleiche Kargheit wider wie die Umgebung und das Wetter:
farblos, kalt, einsam.
Die raumfüllende Leere und schiere Grösse der Halle trägt ebenfalls nicht dazu bei, diese Gefühle zu mildern.
Deshalb haben wir uns beim Drehen des Videos für «Human factors» vor allem auf die obere Hälfte der Halle konzentriert.
Wir haben den Fokus mithilfe von aus Papier geschaffenen Objektivaufsätzen zusätzlich noch verschärft, da gerade in der Höhe so viel ungenutzter Raum vorhanden ist.
«Spielplatz für grosse Kinder.»
In ganz Basel verteilt gibt es bereits viele Spielplätze, doch kaum ein einziger für jugendliche und erwachsene Menschen.
Die Anwohnenden von dem Dorf Kleinhüningen /Klybeck wurden mit der Hafenindustrialisierung durch die massive Umschlagshalle verdrängt und mussten von ihrem Zuhause loslassen. Wir wollen ein Stück Klybeck zurückgeben und die verdrängende Halle zu einer einladenden Halle umschlagen.




Das Konzept
Wie ein Krake lädt die Raumskulptur mit offenen Armen ein, den Ort zu entdecken. Bereits von weiter Distanz aus sind die ausufernden drei Haupteingänge sichtbar.
Durch wenige und äusserst präzise Eingriffe in die schützenswerte Bausubstanz entsteht der raumhohe, gedeckte Spielplatz. Dafür müssen lediglich die kleinen Zwischenwände weichen, um Platz für einen neuen, offenen und einladenden Ort zu schaffen.
Fischernetze, Bojen, Taue, Schiffsschrauben, hier findet ihr sie alle. Der Raum ist zu einem grossen Teil mit Upgecycelten Materialien aus der Hafen-Industrieumgebung gefüllt. So wird aus unserer Sicht ein ressourcenschonender Umgang mit Material und zugleich ein natürlicher Bezug zur Umgebung geschaffen.
Der Spielplatz lädt ein, ihn auf seine eigene Art zu erkunden. Es besteht ein Überfluss an Möglichkeiten, unterschiedlichen Elementen und Wegen, die die Halle prägen. Wie eine bunte Überraschungstüte im überdimensionierten Massstab, die darauf wartet, entdeckt zu werden.
Eine Netzstruktur, die sich wie ein roter Faden durch die Umschlagshalle zieht, hilft dabei, die Orientierung zu behalten. Die Netze hängen, getragen durch eine starke Stahlseilkonstruktion, im Raum. Unter ihnen sind elementfreie Zonen, so kann eine einfache wie sichere Überquerung der Halle und zur Aussichtsplattform gewährleistet werden. Die Struktur ist bekletterbar und integriert in viele der Spielplatz Elemente. So wird ein spannender Dialog zwischen unter dem Netz und über dem Netz geschaffen, zwischen Wild und im Schwung zu stehend und betrachtend. Dieser Blick bietet auch die Möglichkeit, den Spielplatz weiterzudenken und in seiner Nutzung als Tanzperformance oder Freilichttheater zu erweitern.
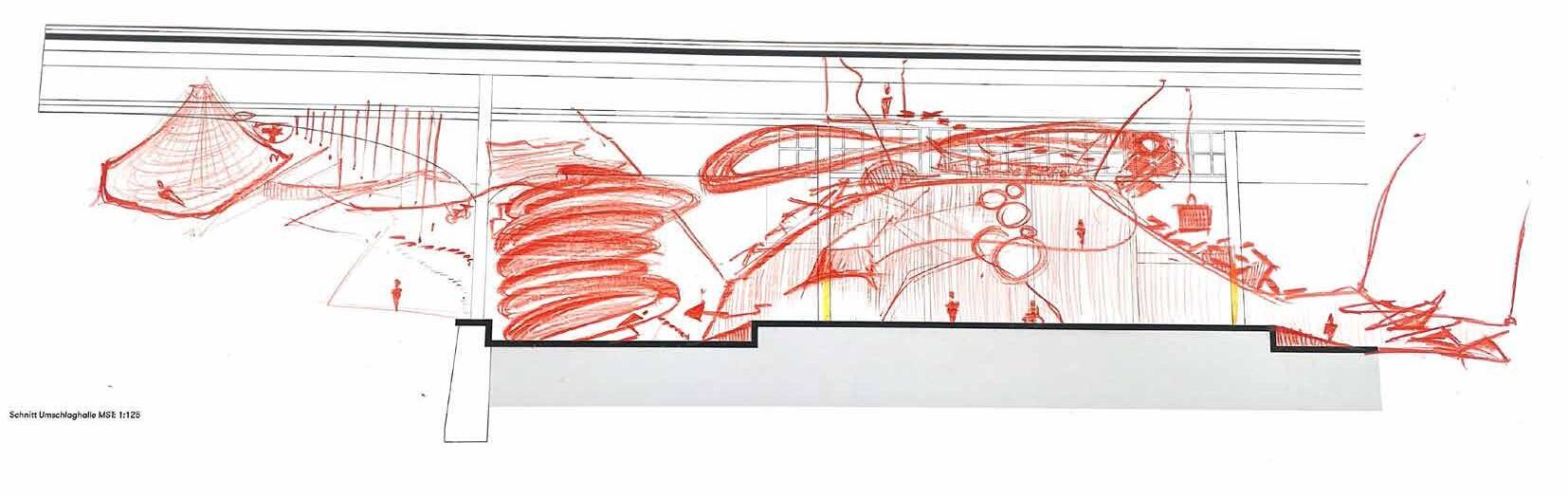



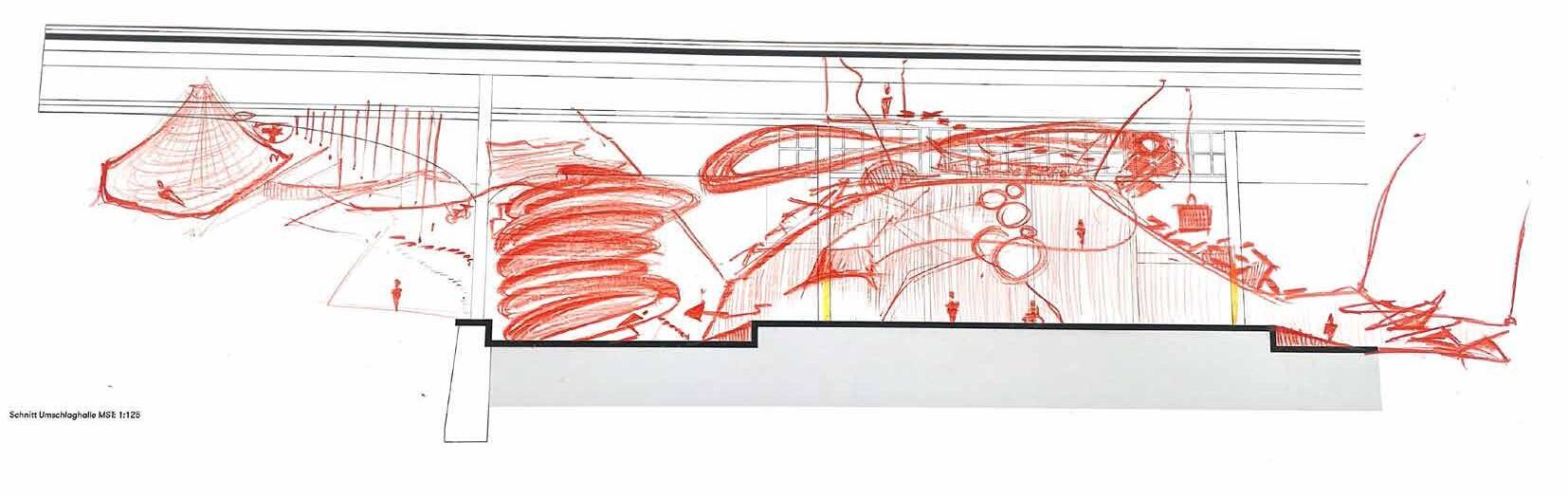
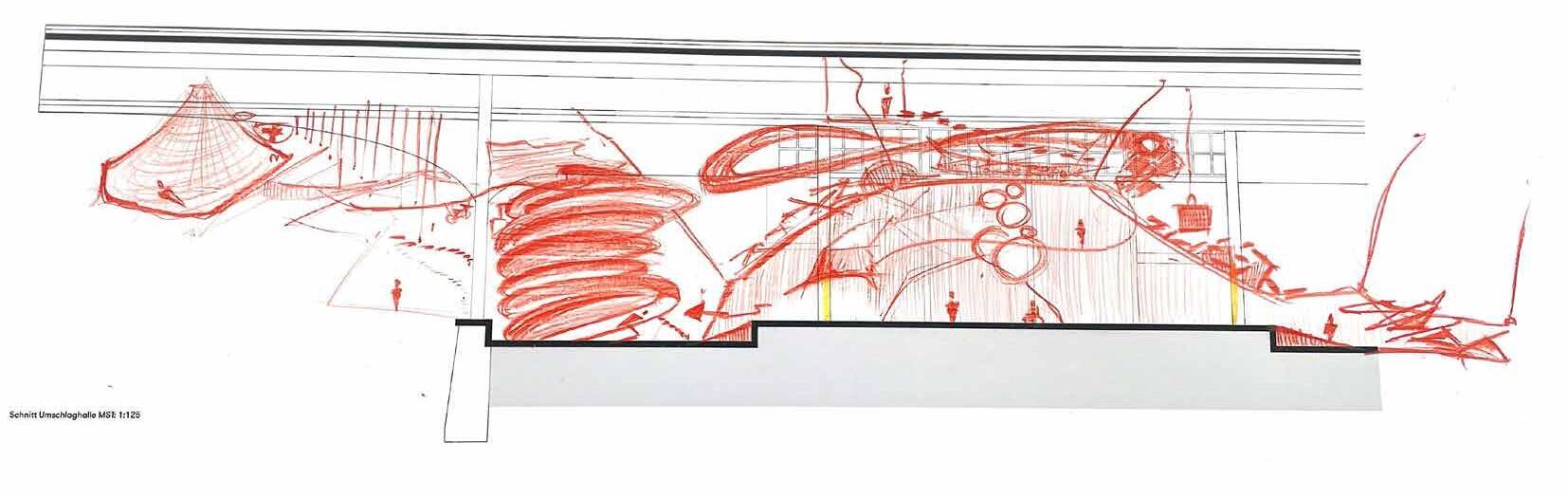
10 Skizze Eingangsprotal der Raumskulptur
Levels
Damit alle besuchenden sich auspowern, fordern, ohne sich zu überfordern können, ist der Spielplatz in drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Übergänge zu den verschiedenen Niveaus sind fliessend. Sie verlaufen jeweils vom Wasser bis zur Strasse einmal längs durch die Halle, so dass es in jedem Schwierigkeitsgrad möglich ist, über dem Wasser zu sein oder die Netze von oben zu erkunden.
Nur die unterfahrbare Netzstruktur, die bis zur Aussichtsplattform reicht, ist rollstuhlgängig.


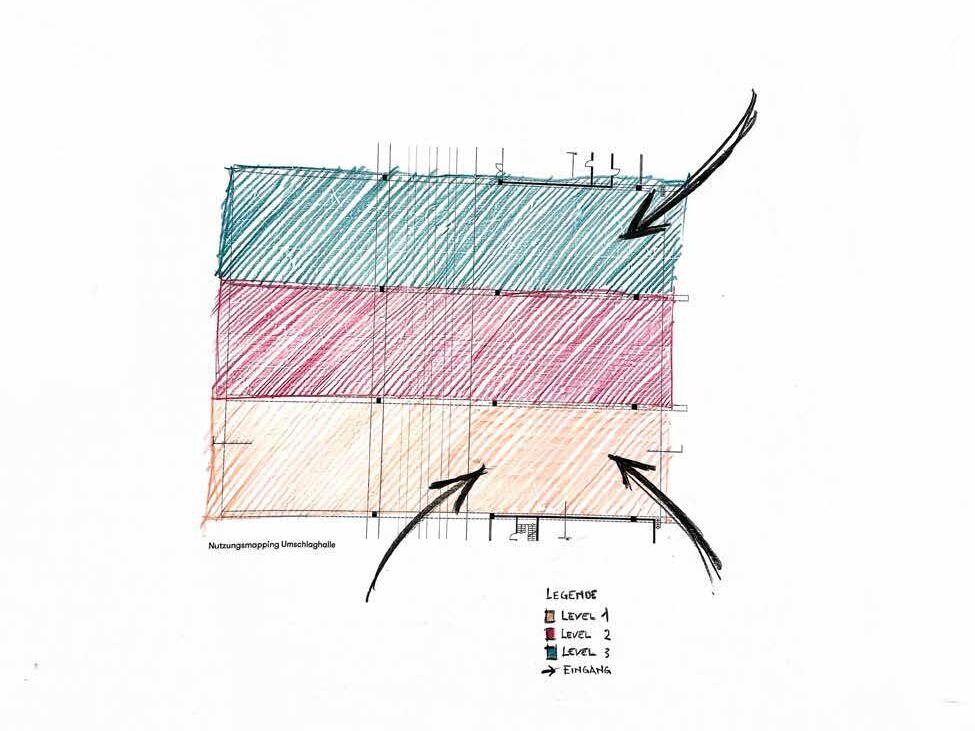
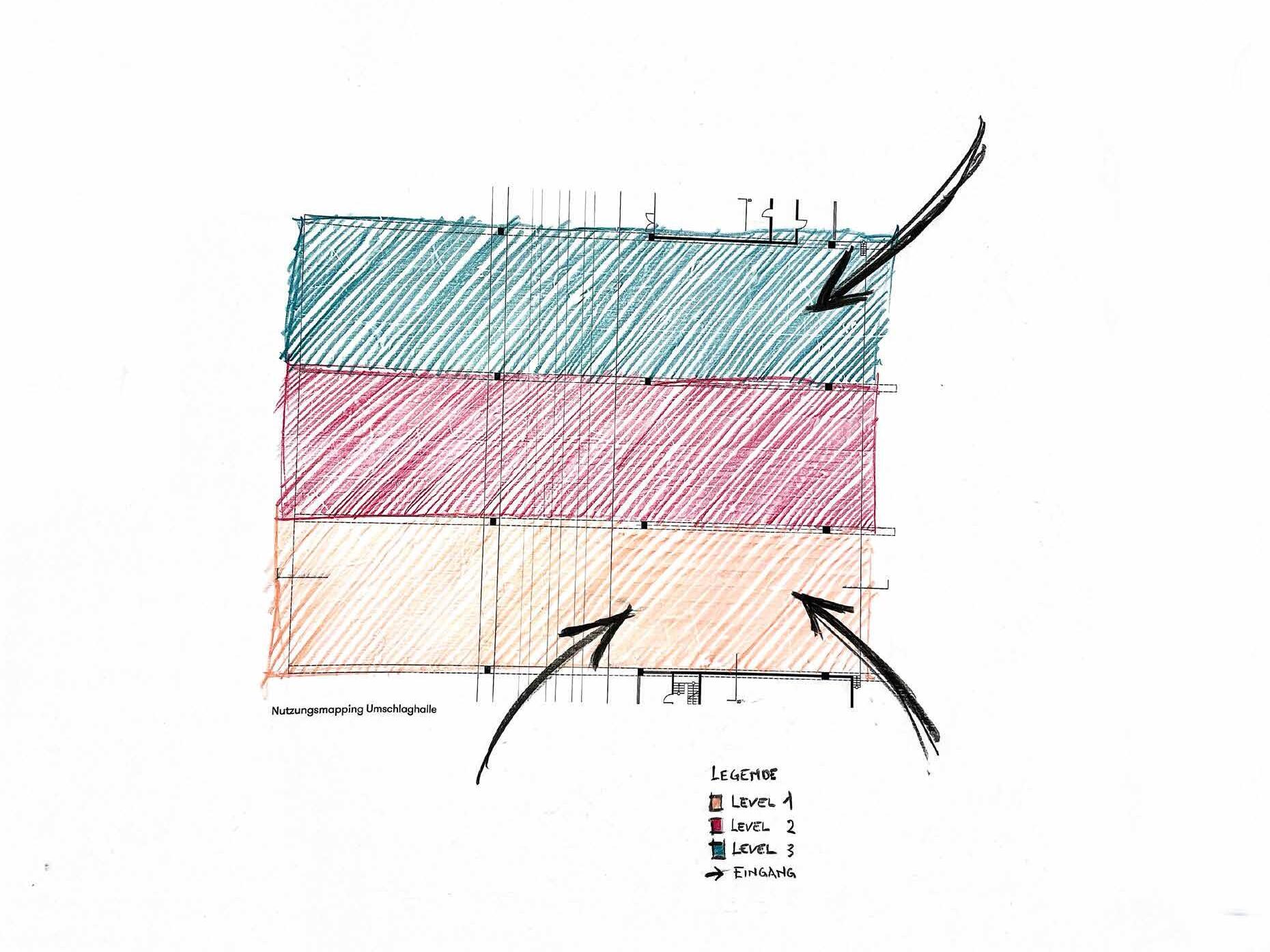



Modellbau

Modellausschnitt
Um die Raumskulptur in ihrer Funktion zu sehen und zu verstehen, haben wir einen Ausschnitt der Umschlaghalle ausgewählt (siehe Bild links).
Diesen Ausschnitt haben wir mithilfe von Graukarton zu einem Präsentationsmodell ausgearbeitet. Dabei war es uns besonders wichtig, die Freude und Lebendigkeit der farbenfrohen Spielwiese zum Ausdruck zu bringen.
Die einzelnen Spielelemente zeigen, wie sie miteinander funktionieren könnten und wie es sich anfühlt, unter dem Netz hindurchzulaufen.
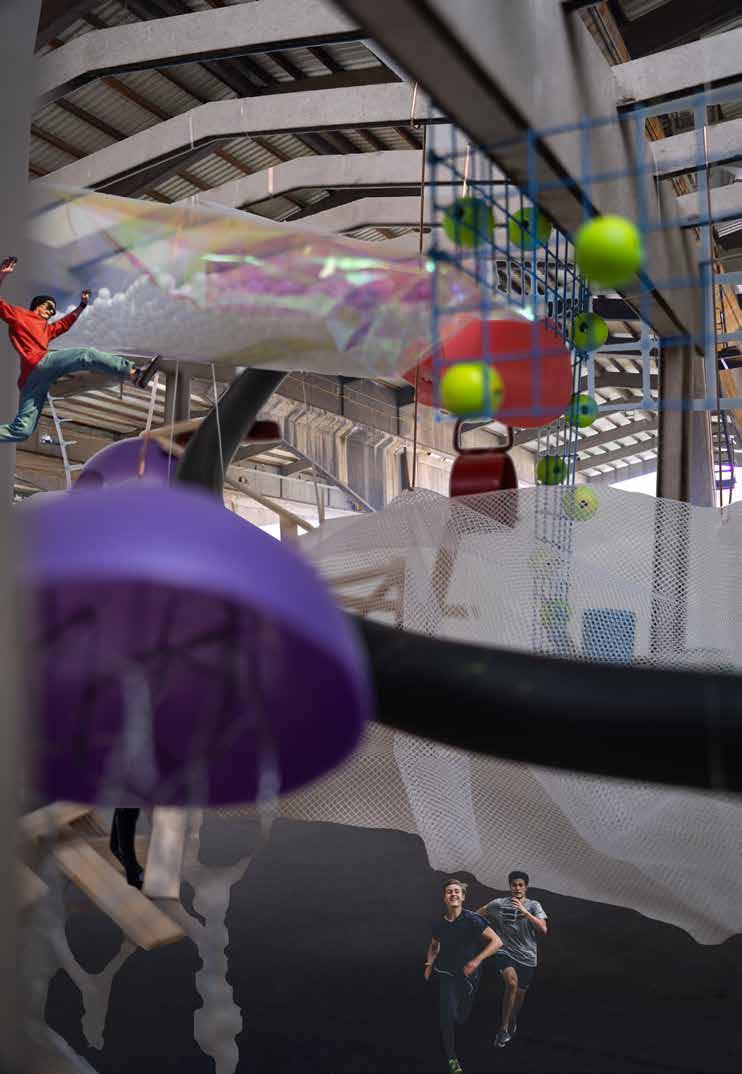


Abbildungsverzeichnis
Eigene Abbildung, Modellfotografie
Unterrichts-Unterlagen, Situationsplan, Geodaten Kanton Basel-Stadt
Eigene Abbildung, Collage
Eigene Abbildungen, Video Stills
Eigene Abbildung, Konzeptskizze
Eigene Abbildung, Grundriss Raumskulptur
Eigene Abbildung, Schnitt A-A Raumskulptur
Eigene Abbildung, Skizze Eingangsprotal der Raumskulptur
Eigene Abbildung, Nutzungsmappings
Eigene Abbildungen, Modellfotos
Unterrichts-Unterlagen, Ausschnitt 1:50 Präsentationsmodell
Eigene Abbildungen, atmosphärische Nahaufnahmen Raumskulptur
Eigene Abbildung, Photoshop Collage 01
Eigene Abbildung, Photoshop Collage 02
Eigene Abbildung, Atmosphärische Nahaufnahme Raumskulptur
Literaturverzeichnis
Beilage zur BZ Basel, 5. September 2015. Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Programmzeitung zum Europäischen Tag des Denkmals.
25 Atmosphärische Nahaufnahmen Raumskulptur


Reflexion
Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Hafenareal und der Umschlaghalle in Kleinhüningen neigt sich unsere Projektarbeit dem Ende zu.
Auch wenn es immer noch mehr zu tun gäbe, ziehen wir unsere Tentakel zurück und blicken nun mit einem gewissen Stolz auf unser Projekt zurück.
Nachdem wir einen vollständigen Gestaltungsprozess durchlaufen haben, können wir viele wertvolle Lektionen für zukünftige Arbeiten mitnehmen: Die Visualisierung einer Idee ist das A und O. Skizzen, Zeichnungen, Collagen, Papiermodelle, Probemodelle und Präsentationsmodelle sind wunderbare Techniken zur Visualisierung, die wir künftig noch intensiver nutzen sollten. Mit viel Material werden die Gespräche mit den jeweiligen Dozent:innen fruchtbarer und spannender. Aber auch wir Studierenden könnten den Austausch untereinander stärker fördern, um noch mehr von den gegenseitigen Expertisen, Inputs und Ideen zu profitieren.
Mit diesen (und vielen weiteren) gesammelten Erkenntnissen freuen wir uns darauf, bewusster und mit viel Freude an die nächsten Projekte heranzugehen.
Ein Tanz aus Textilien, Ein Ort, der Zeit und
Textilien, Licht und Leben. Raum umarmt.
Raumbegegnung
Die erste Begegnung mit der Umschlaghalle am Hafen Basel war geprägt von Kälte und starkem Wind, doch einzelne Sonnenstrahlen durchbrachen die graue Atmosphäre. Vor uns stand ein grosses, mächtiges Gebäude, dessen Ende man kaum ausmachen konnte. Besonders prägnant war das Dach, das mit seiner markanten Zickzack-Form sofort ins Auge fiel. Vom Rheinbecken 1 aus schien die Halle fast zu schweben, obwohl sie von stabilen Stützen getragen wird.
Direkt hinter dem Rheinufer verlaufen Schienen, und gerade in diesem Moment hielt eine Lokomotive langsam an. Hinter den Schienen eröffnet sich für uns der bedeutendste Teil: der Raum der Umschlaghalle. Dieser wird durch halbhohe Wände an Vorder- und Rückseite abgeschlossen, während die Seiten im Gegensatz zum offenen Bereich bei den Gleisen geschlossen sind. Einige dieser seitlichen Bereiche sind durch Büros und kleinere Räume unterteilt.
Der Wind war allgegenwärtig und schien uns überallhin zu folgen, ein unaufhörlicher Begleiter, vor dem es kein Entkommen gab. Im Inneren des Raums türmten sich massive Aluminiumblöcke, die eine beeindruckende, beinahe einschüchternde Präsenz ausstrahlten. Neben diesen Türmen fühlten wir uns klein und unbedeutend. Der Boden der Halle war rissig, und die Linien dieser Risse wirkten wie ein natürlicher Weg, der durch den Raum führte. Die Decke war so hoch, dass allein ein Blick nach oben Schwindel hervorrief.
Draussen, bei den Gleisen am Hafenbecken, hielten wir inne und beobachteten das geschäftige Treiben. Schiffe glitten langsam vorbei, Hafenmitarbeiter:innen waren in ständiger Bewegung, und die Geräusche des Hafens liessen wir auf uns wirken. Wir standen da, in Gedanken versunken, und fragten uns: Welche Geschichten könnten uns die Hafenmitarbeiter:innen erzählen? Welche Erlebnisse verbirgt dieser Ort, dessen raue Schönheit wir gerade erst zu verstehen beginnen?



Abb 3:Ausblick aus der Umschlaghalle auf das Hafenbecken
Abb 2:Ausblick aus die Gleise
Frankreich
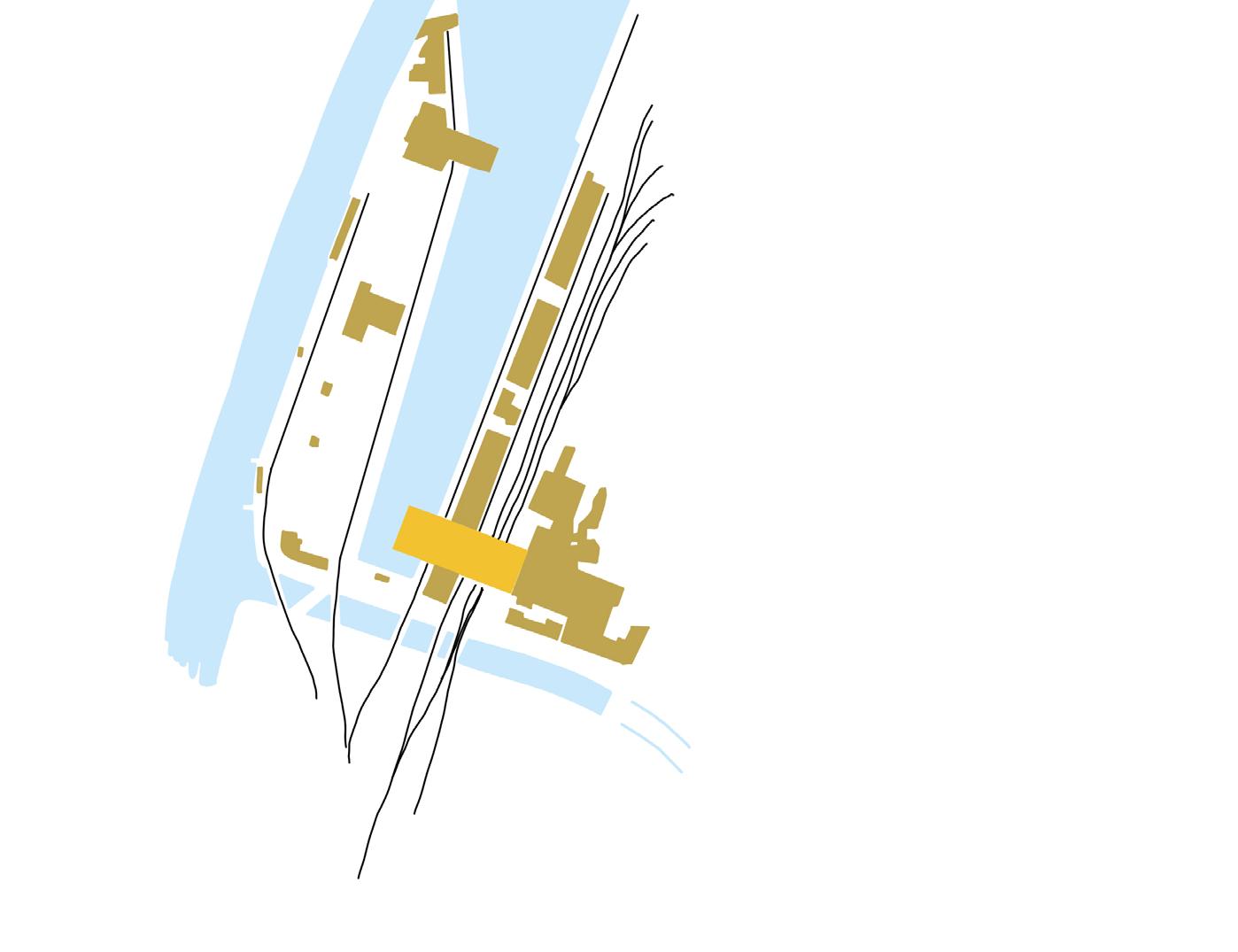
Kleinhüningen
Abb 4: Lageplan
Klybeck
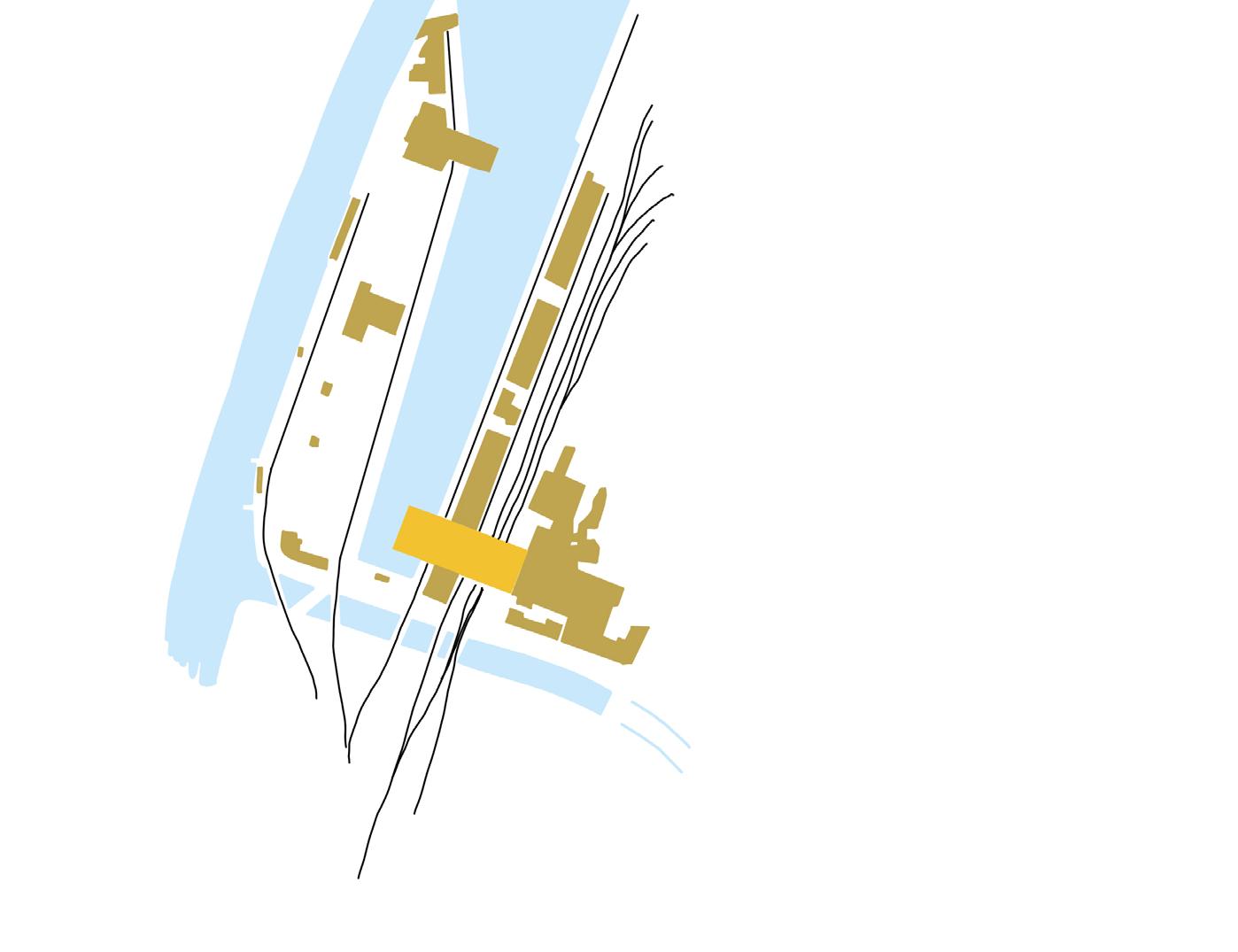


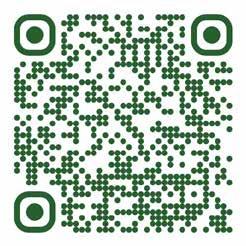




Abb 5: Auschnitt Video
Abb 7: Auschnitt Video
Abb 8: Auschnitt Video
Abb 6: Auschnitt Video


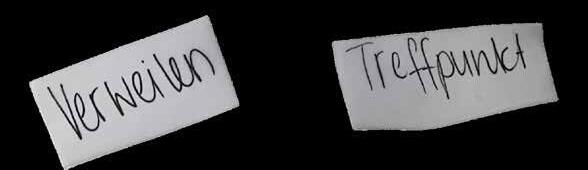

Dem Hafen neues Leben einzuhauchen, das war von Anfang an unser Ziel. Der Hafen ist ein einzigartiger Ort mit Restaurants und einem Nachtclub, doch wo können die Hafenmitarbeiter:innen zur Ruhe kommen? Wie könnte man den Hafen näher an die Menschen in der Umgebung bringen und ihn zu einem zentralen Treffpunkt machen?
Mit unserem ersten Konzept wollten wir einen Raum schaffen, an dem sich Hafenmitarbeiter:innen, Kunstschaffende und die Bewohner:innen der Umgebung begegnen und beteiligen können. Es sollte ein Ort sein, der Kunst und Gemeinschaft verbindet. Geplant war ein Bereich für Kunstausstellungen, ein zentraler Platz, der zum Verweilen einlädt, ausgestattet mit einem Café, jedoch ohne Konsumzwang.
Zusätzlich sollten Workshops angeboten werden: einerseits thematisch zum Hafen, andererseits Yoga- oder Kunstworkshops. An den Wochenenden war geplant, Raves auf den Gleisen zu veranstalten, um Erwachsenen einen weiteren kulturellen und kreativen Raum zu bieten. Unser Ziel war es, einen freien und inklusiven Ort für alle Menschen in der Umgebung zu schaffen, der als gemeinschaftlicher Ankerpunkt funktioniert.
Doch durch erste Tischgespräche und Diskussionen wurde uns klar, dass dieses Konzept zu viele Zielgruppen ansprach und die Umsetzung all dieser Ideen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens kaum realisierbar war. Mit Unterstützung der Dozent:innen entschieden wir uns deshalb, unser Konzept zu überarbeiten und uns auf ein Theater auf Gleisen zu konzentrieren.
Die neue Idee sah vor, modulare Elemente zu nutzen, um Geschichten der Hafenmitarbeiter:innen als Theaterstücke darzustellen.
Ihre Erzählungen sollten im Zentrum stehen, um die Lebensrealität dieses besonderen Ortes auf eine künstlerische und lebendige Weise sichtbar zu machen.
Nach anfänglicher Motivation und Euphorie merkten wir jedoch, dass unser Durchhaltewillen während des Projekts nachliess. Wir drehten uns lange im Kreis und es fehlte an einer klaren, ausschlaggebenden Idee, um das Konzept weiterzuentwickeln. Letztendlich entschieden wir uns, zu den Wurzeln zurückzukehren und unsere ursprünglichen Themen Verweilen, Hafengeschichte und Rave zu verbinden. Aus dieser Kombination entstand ein völlig neues Konzept, das unser Ziel, den Hafen zu einem lebendigen Ort der Begegnung zu machen, in einer klareren und realistischeren Form verwirklicht.
Soft Nest Konzept
Die Umschlaghalle wird in diesem innovativen Projekt nicht nur als Raum für historisches Lernen, sondern auch als interaktiver Erlebnisraum für unterschiedlichste Zielgruppen neu definiert. Das Herzstück des Konzepts bilden textile „Pods“ mobile, leicht zugängliche, hängende Strukturen, die eine aussergewöhnliche Mischung aus Spiel, Bildung und Unterhaltung ermöglichen. Die Pods sind flexibel und können je nach Bedarf hoch- oder runtergelassen werden, was eine individuelle Anpassung an die unterschiedlichen Tages- und Nutzungszeiten erlaubt. Sie bieten so nicht nur ein multifunktionales Design, sondern auch die Möglichkeit, den Raum sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in verschiedene Zonen zu unterteilen.

Abb 9: Workshop mit Projektion im Hauptzelt
Tagsüber Wissens-
und Erlebnisraum
für Kinder
Tagsüber verwandelt sich die Umschlaghalle in einen interaktiven Lernort für Kinder aus der Umgebung. Das zentrale Element ist das grosse Hauptzelt. Dies ist so gestaltet, dass es den Kindern ein sicheres, spannendes und zum Entdecken anregendes Umfeld bieten. In der ganzen Umschlaghalle können sie mehr über den Hafen, seine Geschichte und Bedeutung erfahren. In Form von Erzählungen, interaktiven Spielen und kindgerechten Lernstationen wird den Kindern der Hafen als lebendiger Ort nähergebracht. In regelmässigen Workshops, die an bestimmten Tagen stattfinden, können die Kinder und Schulklassen direkt in das maritime Handwerk eintauchen. Ein Beispiel für einen solchen Workshop wäre das Erlernen eines traditionellen Seemansknotens, der nicht nur das praktische Handwerk vermittelt, sondern auch die Geschichte der Seefahrt lebendig werden lässt. Diese Workshops fördern das Gemeinschaftsgefühl und stärken die Verbindung zur maritimen Kultur.





Abends Die verwandelung zum Rave- und Partyraum
Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich die Umschlaghalle in einen aufregenden Party Ort. Die Pods bieten nun eine intime Atmosphäre, in der Gäste besonders aus der Umgebung feiern können. Die Möglichkeit, die Pods nach Bedarf hoch- oder runterzulassen, schafft dabei unterschiedliche Partyzonen. So bieten die Pods einen „Safe Space“ für die Feiernden, in dem sie sich zurückziehen, entspannen oder unterhalten können, während sie gleichzeitig Teil des grösseren Rave Erlebnisses bleiben.
Die gesamte Atmosphäre wird durch projektierte visuelle Elemente verstärkt. Rund um die Pods werden verschiedene Tücher gespannt, die mit den Bewegungen der Feiernden mitwanken. Musik, Licht und die textile Struktur der Pods verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis, das sowohl für die Teilnehmer als auch für die Umgebung eine unvergessliche Wirkung entfaltet.








Design und Funktionalität der Pods
Die Pods bestehen aus robusten, wetterfesten Textilien, die leicht und flexibel sind, aber auch den Anforderungen eines stark frequentierten Raumes standhalten. Sie sind an Seilen befestigt und können je nach Bedarf hochoder runtergelassen werden. Durch die variable Höhe wird die Nutzung des Raumes immer wieder neu definiert. Tagsüber als Orte des Lernens und des Dialogs, abends als Party Ort.


“Flexibilität ist der Schlüssel Wenn der Plan nicht ändert man den Plan, aber niemals das Ziel.”
Schlüssel zum Erfolg. nicht funktioniert, Plan, Ziel.”
Kulturhafen
Coffee, Art & Culture
Konzept
Der „Kulturhafen“ ist das Konzept, dass den industriellen Raum des Basler Hafens in einen lebendigen Ort der Kultur, Gemeinschaft und Entspannung verwandelt. Mit innovativen Ansätzen, minimalen Eingriffen in die Architektur und einer einzigartigen Gestaltung entsteht ein Raum, der Kunst und Begegnung fördert und zusätzlich die raue Ästhetik des Hafens aufgreift.
Zudem erschafft und verbindet der «Kulturhafen» drei verschiedene variable Aspekte.
Hierbei wurde die Halle in drei, beziehungsweise vier Teile aufgetrennt und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten gestaltet. Dabei handelt es sich um einen Raum für eine offene Bühne für Theaterausführungen, Konzerte oder Lesungen, ein kleines Café mit gemütlichen Sitzplätzen und eine Terrasse für Entspannung pur oder auch einen gemütlichen Co-Working Space, bei der man dem früheren Umschlagsverkehr so nah ist wie noch nie und einem Ausstellungsraum für Kunst und Kulturstücke.
Das Konzept zielt darauf ab, dass diese Einzelelemente komplett flexibel sind und dies aufgrund der 3 Kräne im inneren der Halle. So ist es möglich den Raum, je nach Wunsch und Ermessen umzugestalten. Dies ermöglicht die vielseitige Nutzung der Halle und sorgt zusätzlich dafür, dass die Besucher oft etwas komplett Neues zu Gesicht bekommen, wenn sie die Halle betreten.
Der Hafen und Gefühle
Als wir zum ersten Mal im Hafen standen, spürten wir die kalte Luft, die uns umgab, und sahen die Dunkelheit, die den riesigen Raum noch größer wirken ließ. Die Kräne ragten wie stille Wächter in den Himmel, und die weitläufigen Anlagen strahlten eine raue, fast unnahbare Atmosphäre aus.
Trotz allem fühlten wir uns merkwürdig wohl, fast angezogen von diesem Ort. Es war, als würde er etwas verbergen, das wir entdecken wollten.
Wir wussten, dass sich viele hier wahrscheinlich unbehaglich fühlen würden – vor allem in der Nacht, wo die Leere und die Kälte alles zu dominieren schienen.
Doch gerade deshalb wuchs in uns der Wunsch, diesem Ort etwas Wärme zu schenken. Wir wollten ihn mit Leben füllen, einen Raum schaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen und zusammenkommen können. Ein Ort, der nicht nur groß und dunkel bleibt, sondern auch ein Gefühl von Gemeinschaft und Geborgenheit bietet.

Ausschnitt der Umschlagshalle (Ansicht von Links)

Umschlagshalle Hafen Kleinhüningen-Basel

Nachbargebäude der Umschlagshalle

Inneres der Umschlagshalle



Kontaktabzüge

Konzeptionelle Umsetzung:
Flexibles Design und nachhaltige Materialien
Die Wände der Struktur bestehen aus recyceltem Fischernetz, das nicht nur als nachhaltiges Material überzeugt, sondern auch eine offene, durchlässige Atmosphäre schafft. Diese Wände können mit Kränen bewegt werden – sowohl seitlich als auch in der Höhe – und ermöglichen so eine ständige Anpassung des Raumes an verschiedene Bedürfnisse. Die Flexibilität erstreckt sich auch auf alle anderen Elemente wie die Bühne, die Sitzbereiche und die Ausstellungsflächen, die modular gestaltet sind und leicht umplatziert werden können.
Ein Raum für Kultur und Gemeinschaft
Das Herzstück des „Kulturhafens“ ist die Bühne, die für Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen genutzt wird. Ergänzt wird sie durch ein „Pop-Up Café“, einen Lounge-Bereich, Coworking-Möglichkeiten und spontane Auftritte bietet. Ein weiterer Bereich ist der Ausstellungsraum, in dem Künstler: innen ihre Werke präsentieren können. Die verschiedenen Räume lassen sich flexibel kombinieren, wodurch vielfältige Szenarien – von kulturellen Veranstaltungen bis hin zu privaten Rückzugsorten – ermöglicht werden.


Einladende Atmosphäre & innovative Gestaltung
Obwohl der Hafen industriell und kühl wirkt, wird durch die Gestaltung des Kulturhafens eine warme und einladende Atmosphäre geschaffen. Begrünung und warme Farbtöne kontrastieren mit der rauen Umgebung und sorgen für eine harmonische Verbindung von Natur und Industrie. Recyceltes Holz, energieeffiziente LED-Beleuchtung und Sichtbeton fügen sich perfekt in die Ästhetik des Hafens ein, während sie zugleich eine gemütliche Stimmung schaffen.
Nutzung zu jeder Jahreszeit
Der Kulturhafen ist so gestaltet, dass er sowohl im Sommer als auch im Winter ein angenehmer Ort ist. Die Fischernetz-Wände lassen im Sommer eine leichte Brise durch, während die warmen Beleuchtungselemente und geschützten Bereiche in der kalten Jahreszeit Behaglichkeit schaffen. Durch die flexible Konstruktion können Bereiche geöffnet oder geschlossen werden, je nach Wetter oder Nutzung.
Ein Hafen für alle
Der Kulturhafen richtet sich an Künstler: innen, Musiker: innen und Performer: innen, die eine Plattform suchen, ebenso wie an kunstinteressierte Menschen, Anwohner: innen und Tourist: innen, die den Hafen auf eine neue Weise erleben möchten. Der Ort verbindet kulturelle Aktivitäten mit Gemeinschaft und Entspannung und schafft so einen Raum, der Menschen zusammenbringt und die Identität des Hafens neu definiert.
Mit dem Kulturhafen wird der Basler Hafen nicht nur belebt, sondern auch transformiert – von einem funktionalen Industrieareal zu einem inspirierenden Treffpunkt für Kultur und Gemeinschaft.

Collage der Sicht vom Inneren der Umschlagshalle nach draussen
Kurzfilm: big or small?
Für das Video wollten wir die beeindruckende Größe des Hafens sichtbar machen – etwas, das auf Bildern oft verloren geht. Was im Foto klein und unscheinbar wirkt, entfaltet seine wahre Dimension erst, wenn man selbst dort steht. Um diese Wirkung zu verstärken, haben wir uns bewusst für ein ruhiges Lied im Hintergrund entschieden. Es spiegelt die positive Verbindung wider, die wir zu diesem Ort haben, und setzt einen ersten Schritt, den Hafen aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Das Video beginnt mit kleinen, gezielten Ausschnitten, die einen ersten Eindruck von der Umgebung geben. Diese Szenen sollen den Zuschauer sanft in die Atmosphäre des Hafens eintauchen lassen. Danach folgen Aufnahmen, die nach und nach die beeindruckenden Größenverhältnisse offenbaren ein bewusster Kontrast, um die monumentale Weite dieses Ortes greifbar zu machen.



Bildauszüge aus dem Kurzfilm “big or small”, gefilmt von Lisabel






Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer
Modell & Prozess
Am Anfang des Projektes erstellen wir eine Vorlage der Umschlagshalle für den Lasercutter, welche wir nach dem Lasern zusammenfügten. Damit hatten wir dann die Grundlage für unser Rauminterventionsmodell.
Im nächsten Schritt orientierten wir uns an den Materialien die wir in der Umschlagshalle oder in der Nähe entdecken konnten und sammelten Ideen wir man diese im Modell umsetzen könnte.
Hierbei haben wir uns dann für viel Holz, Fischernetz ähnliches Band und Metall entschieden. Wir starteten ohne festen Plan, nur mit ein paar Rahmenbedingungen was unser Konzept betrifft.


Wir arbeiteten uns Stück für Stück voran und wenn ein Problem auftrat, überlegten wir uns wie wir dies anders lösen konnten oder ob wir dies komplett weglassen sollten.
Wir kümmerten und um den Boden, welcher eine deutliche Dreiteilung deutlich macht. Zudem entwickelten wir die einzelnen Elemente für jede der drei Sektionen als auch für den Schienenbereich. Auch die Kräne, welche sich in den drei Unterteilungen des Daches bewegen konnten, bezogen wir mit ein und achteten dabei darauf, dass jedes einzelne Element unseres Modells umwandelbar und flexibel ist und auch bleibt. Sodass unser Konzept auch im Modell wiederzuerkennen ist.




Prozessfotos: aufgenommen


von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer

Rückansicht

Frontansicht
Modellfotos: aufgenommen von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer





Ansicht von Rechts


Ansicht von Links
Modellfotos: aufgenommen von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer



Schnittzeichnungen
Raumaufteilung:
Die Schnitte zeigen klar die verschiedenen Bereiche wie die Bühne, Ruhezonen und Ausstellungsflächen. Diese sind funktional getrennt, bleiben aber flexibel und anpassbar.
Höhen und Flexibilität:
Die vertikale Gestaltung wird durch die verschiebbaren Netzwände hervorgehoben. Diese können bewegt werden, um den Raum je nach Bedarf zu verändern.
Materialität:
Die Netzwände aus Fischernetz schaffen eine halbtransparente Trennung, die den Raum offen wirken lässt, während sie gleichzeitig Struktur und Begrenzung bieten.
Beleuchtung:
Die Schnitte zeigen, wie Licht eingesetzt wird, um den Raum warm und einladend zu gestalten. Es hebt die unterschiedlichen Bereiche hervor und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.
Verbindung von Innen und Außen:
Der Übergang zwischen Innen- und Außenraum ist fließend. Dadurch wird die industrielle Umgebung des Hafens in das Konzept integriert und erlebbar gemacht.
Querschnitt
POP-UP Café
Bühnenbereich
Ausstellungsraum
Terrasse
Ansicht von Links Frontansicht
Terrasse
Innenräume & Visualisierung
Das Modell des Kulturhafens zeigt einen flexiblen und einladenden Raum, der Kunst, Gemeinschaft und Erholung verbindet. Die Wände aus beweglichen Fischernetzen schaffen offene und anpassbare Bereiche, die für Konzerte, Ausstellungen, Workshops oder als Ruhezonen genutzt werden können.
Die warme Beleuchtung und natürlichen Materialien schaffen eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Offenheit vereint. Der Kulturhafen lädt dazu ein, die industrielle Umgebung neu zu erleben, Begegnungen zu fördern und sich sowohl kulturell als auch persönlich inspiriert zu fühlen.




Innenraumfotos und Studien: aufgenommen von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer

und Studien: aufgenommen
Innenraumfotos
von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer

Innenraumfotos und Studien: aufgenommen
von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer


und Studien: aufgenommen
Innenraumfotos
von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer


Innenraumfotos und Studien: aufgenommen
von Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer

Innenraumcollage: aufgenommen und bearbeitet von
Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer


Innenraumcollage: aufgenommen und bearbeitet von

Lisabel Pedrazzi und Sina Wassmer

Fazit
Schlussendlich ist in der Umschlagshalle am Hafen Kleinhüningen in Ort zum Verweilen entstanden und ein Ort, der immer überraschen kann mit dem, in was man ihn verwandeln kann.
Nun blicken wir auf das Projekt zurück, durch welches wir einiges lernen konnten. Zum einen das Visualisierungen das Wichtigste sind, um jemand anderem das geschaffene am besten zu erläutern. Zum anderen haben wir gemerkt, dass ein Ort zum Verweilen für jeden Menschen etwas anderes bedeutet.
Für uns ist es ein Ort zum Verweilen an dem man Kunst, Kultur und ab und zu einen Kaffee vereinen kann. Für andere mag das vielleicht nicht der Fall sein und dennoch sind wir sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben.
Jedoch lässt sich auch sagen, dass wir, mit mehr Zeit das Projekt noch viel weiter ausarbeiten hätten können und auch noch mehr Visualisierungen und Zeichnungen anfertigen hätten können.
Abschliessend lässt sich deutlich sagen, dass wir bei einer Umsetzung die Umschlagshalle beziehungsweise den Kulturhafen, immer wieder besuchen würden und dies für Kaffee, Kunst und/oder Kultur.
Thank you!