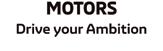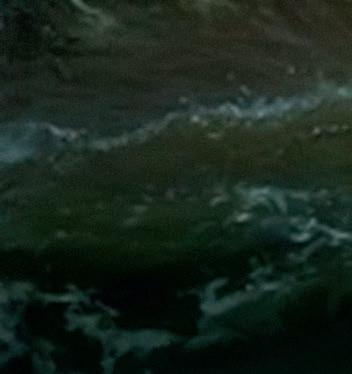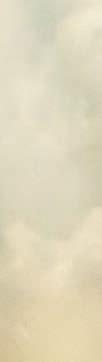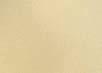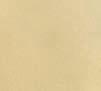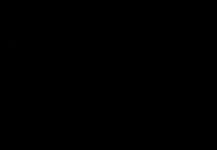
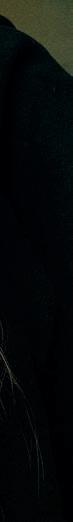

Doch kann dem bleichen Manne Erlösungeinstensnochwerden, fänd’ereinWeib,dasbisindenTod getreuihmaufErden!
(Senta in ihrer Ballade im 2. Aufzug)
5 Vorwort Daniel Serafin
6 Besetzungsliste
7 Vorwort Rico Gulda
8 DerfliegendeHolländer – Handlungserzählung
14 DerfliegendeHolländer – Die Entstehung
20 Besetzung und Produktionsteam
22 Philipp M. Krenn im Interview
27 George Gagnidze im Interview
30 5 Fragen an …
34 Leading Team und Cast
40 Walter Zeh und der Philharmonia Chor Wien
42 Ein Making of in Bildern
48 PIEDRA: Ein Ort mit großer Ausstrahlung
56 Gastronomie
62 Hinter den Kulissen
88 Impressum Inhalt


Romantische Oper in drei Akten Aufführung in deutscher Sprache
Libretto: Richard Wagner, aus Kapitel 7 von AusdenMemoirendesHerrenvonSchnabelewopski von Heinrich Heine
Uraufführung: 2. Januar 1843 im Hoftheater Dresden
Premiere: Bei der Oper im Steinbruch am 9. Juli 2025
Dauer: 2.30 Stunden (exkl. Pause)
Pause: Ca. 30 Minuten, nach dem 2. Akt





Herzlich willkommen in der Oper im Steinbruch, die neben den Festspielen in Verona und Bregenz zu den „Big Three“ der Open-Air-Opernfestivals weltweit zählt!
Wenn hier die ersten Klänge von Richard Wagners Derfliegende Holländererklingen, öffnet sich ein Tor zu einer Welt, in der Sturm und Sehnsucht, Fluch und Erlösung in atemberaubender Intensität aufeinandertreffen. Die Oper entstammt Wagners eigener Erfahrung: 1839 floh er mit seiner Frau von Riga nach London, ausgesetzt dem tobenden Sturm auf der Nordsee, wo die Idee eines verfluchten Seemanns geboren wurde. Ich lade Sie ein, Teil dieses packenden Abenteuers zu werden.
Schon in den ersten Sekunden der Ouvertüre brechen die Naturgewalten und düsteren Schicksale über das Publikum herein. Ein verfluchter Kapitän irrt mit seinem Geisterschiff über die Weltmeere – nur die ewige Treue einer Frau kann ihn erlösen. Als der norwegische Seemann Daland in einer Bucht Schutz sucht, trifft er auf den geheimnisvollen Holländer. Dessen Hoffnung auf Befreiung ist längst erloschen – bis er von Dalands Tochter Senta erfährt. In ihr erwacht eine tiefe Sehnsucht, sie fühlt sich von jeher zu der tragischen Gestalt hingezogen. Entgegen allen Warnungen schwört sie dem Holländer ewige Treue – mit dramatischen Folgen.
Wagners revolutionäre Leitmotivtechnik und sein opulenter
Orchesterklang haben nicht nur die Oper neu definiert, sondern als Inspirationsquelle für Filmmusikkomponisten bis heute Spuren in Hollywood-Soundtracks hinterlassen. Ebenso diente seine Figur des verfluchten Seemanns als Vorlage für Blockbuster wie beispielsweise den Actionfilm Fluch derKaribik .
Regisseur Philipp M. Krenn versteht es gekonnt, Wagners Kompositionen lebendig werden zu lassen. Mit ihren maritimen Entwürfen verleiht Kostümdesignerin Eva Dessecker dem Werk eine unverwechselbare Farbpoesie und Bühnenbildner Momme Hinrichs setzt mit seinem einzigartigen Bühnenbilddesign neue Maßstäbe im visuellen Erzählen. Natur spielt dabei eine Schlüsselrolle – und wo könnte diese Szenerie realistischer dargestellt werden als in der atemberaubenden Kulisse eines UNESCO-geschützten Steinbruchs? Die schroffen Felswände, wo einst das Urmeer tobte, und die karge Landschaft dieser archaischen Arena erinnern bereits stark an die norwegische Küste. Hier entfalten sich raue See, Sturm und Schicksal in voller Wucht.
Unter der musikalischen Leitung von Patrick Lange erleben Sie ein international renommiertes Wagner-Ensemble, welches sein Talent und Können bereits teils mehrmals am grünen Hügel in Bayreuth bewiesen hat. Gemeinsam mit dem Piedra Festivalorchester und dem Philharmonia Chor Wien, der erstmals seit 2019 wieder auf der Bühne steht, setzen sie Wagners

Partitur grandios in Szene: Sentas innige Ballade, die dämonischen Chöre und die dramatischen Duette verwandeln den Steinbruch in einen vibrierenden Resonanzkörper, der jede Nuance weiterträgt – vom Zuschauerraum bis in die weite Welt hinaus. Neben den technischen und musikalischen Highlights sorgt Live Action
Director Ran Arthur Brauns StuntTeam für unvergessliche Effekte.
„Segelauf!Ankerlos!“
Ich wünsche Ihnen einen mitreißenden Opernabend.
Herzlichst
Daniel Serafin
Intendant der Oper im Steinbruch

Der Holländer
Senta
Daland
Erik
Der Steuermann
Dalands
Mary
Musikalische Leitung
George Gagnidze 09.07. | 12.07. | 19.07. | 24.07. | 31.07. | 08.08. | 15.08. | 23.08. James Rutherford 10.07. | 17.07. | 25.07. | 01.08. | 06.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.
Tommi Hakala 11.07. | 18.07. | 23.07. | 26.07. | 02.08. | 07.08. | 14.08. | 22.08.
Elisabeth Teige 09.07. | 12.07. | 25.07. | 01.08. | 07.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.
Johanni van Oostrum 10.07. | 17.07. | 19.07. | 23.07. | 26.07. | 02.08. | 14.08. | 22.08.
Johanna Will 11.07. | 18.07. | 24.07. | 31.07. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 23.08.
Liang Li 09.07. | 11.07. | 17.07. | 19.07. | 24.07. | 26.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 23.08.
Jens-Erik Aasbø 10.07. | 12.07. | 18.07. | 23.07. | 25.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 14.08. | 16.08. | 21.08.
AJ Glueckert 09.07. | 17.07. | 25.07. | 01.08. | 06.08. | 09.08. | 16.08. | 21.08.
Dominick Valdés Chenes 10.07. | 12.07. | 19.07. | 23.07. | 02.08. | 07.08. | 14.08. | 22.08.
Nenad Čiča 11.07. | 18.07. | 24.07. | 26.07. | 31.07. | 08.08. | 15.08. | 23.08.
Jinxu Xiahou
09.07. | 11.07. | 18.07. | 24.07. | 26.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 15.08. | 21.08. | 23.08.
Brian Michael Moore 10.07. | 12.07. | 17.07. | 19.07. | 23.07. | 25.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 14.08. | 16.08. | 22.08.
Roxana Constantinescu 09.07. | 11.07. | 17.07. | 19.07. | 24.07. | 26.07. 01.08. | 06.08. | 08.08. | 15.08. | 21.08. | 23.08.
Lora Grigorieva 10.07. | 12.07. | 18.07. | 23.07. | 25.07. | 31.07. 02.08. | 07.08. | 09.08. | 14.08. | 16.08. | 22.08.
Patrick Lange
Quentin Hindley
09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 23.07. 25.07. | 26.07. | 01.08. | 02.08. | 06.08. | 08.08. | 09.08. | 21.08. 22.08. | 23.08.
24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08.

Als neuer Generalintendant freue ich mich ganz besonders, Sie an diesem spektakulären Ort für Musiktheater unter freiem Himmel begrüßen zu dürfen: bei der Oper im Steinbruch, einem der bedeutendsten Open-Air-Opernspielorte der Welt! Hier verschmelzen große Musik, Naturkulisse und starke Emotionen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Mit Richard Wagners Meisterwerk
DerfliegendeHolländererwartet uns ein Abend voller dramatischer Wucht und Tiefe, zarter Momente und zeitloser, hochaktueller Themen. Es geht um Schuld und Erlösung, Hoffnung – und um die Liebe, die alles verändern kann. Inmitten der monumentalen Felsenlandschaft wirkt dies besonders intensiv und geht unter die Haut.
Mich fesselt dabei besonders die Figur der Senta, eine der faszinierendsten Rollen der gesamten Opernliteratur. Eine mutige Frau, radikal in ihrer Hingabe – bereit, gegen Erwartungen und Konventionen zu leben und zu lieben. In Sentas innerer Welt spiegelt sich nicht nur die stürmische See als Sturm der Seele, sondern stellen sich auch entscheidende Fragen unserer Zeit: Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Woran glauben wir, welcher Kompass leitet uns durchs Leben?
Dass wir hier so mitreißend gemeinsam durch die Oper navigieren können, verdanken wir dem Einsatz und der Leidenschaft vieler Menschen. Mein herzlicher Dank gilt zuerst Intendant Daniel Serafin, der unermüdlich seine ganze Kraft in den Dienst der Suche
nach den besten Stimmen, den besten Akteurinnen und Akteuren stellt, und die Oper im Steinbruch lebt und liebt! Ebenso danke ich dem Leading Team – Regisseur Philipp M. Krenn, Bühnenbildner Momme Hinrichs und Patrick Lange am Dirigentenpult –, das mit kreativer Vision diese Produktion zum Leben erweckt und in Szene gesetzt hat. Dank gebührt dem gesamten Produktionsteam vor Ort, das – oft im Verborgenen – ganz Unglaubliches leistet. Und natürlich danke ich von Herzen unseren Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne, die mit ihrer Kunst und Ausdruckskraft den Steinbruch in eine Welt der Musik verwandeln.
Aber ganz besonders möchte ich Ihnen allen danken, unserem Publikum! Ihre Begeisterung, Ihr Hiersein, Ihre Resonanz machen diesen Ort zu dem, was er ist: ein Kraftort lebendiger Opernkultur in der einzigartigen Naturkulisse des Steinbruchs, unter freiem Himmel!
Ich wünsche uns allen unvergessliche Abende, die noch lange nachhallen mögen – musikalisch, emotional und atmosphärisch!
Ihr
Rico Gulda Generalintendant
Bühnenbildentwurf
VORGESCHICHTE
Vor langer Zeit wollte ein tollkühner holländischer Kapitän bei einem schlimmen Seesturm um jeden Preis das Kap der guten Hoffnung umsegeln. Sein gotteslästerlicher Fluch, er werde es, wenn nötig, bis in alle Ewigkeit versuchen, wird prompt bestraft: Der Holländer ist so lange zur Irrfahrt verdammt, bis ihn eine Frau erlöst – durch treue Liebe bis zu ihrem Tod. Nur alle sieben Jahre darf er an Land gehen und versuchen, eine solche Frau zu finden.
PRE-HISTORY
Along time ago, a reckless Dutch captain decided to sail around a cape in a terrible storm, no matter the cost. His blasphemous curse that he would, if necessary, try for all eternity is promptly punished: the Dutchman is condemned to wander forever until a woman comes to his rescue by demonstrating true love unto death. He may only go ashore once every seven years to try to find such a woman.
STEILES FELSENUFER, STURM.
Nr.1–Introduktion(Matrosen, Daland,Steuermann).
Kurz vor dem Zielhafen hat das Schiff des Handelskapitäns Daland (Bass) in einer Bucht Zuflucht vor einem Seesturm suchen müssen. Daland erkennt die Gegend: Sandwike, sie sind sieben Meilen vom Kurs abgekommen. Die Mannschaft ist erschöpft und darf sich ausruhen, – und der Steuermann (Tenor) hat die erste Wache. Der will sich mit einem Liedchen
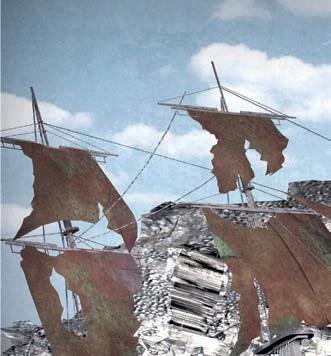
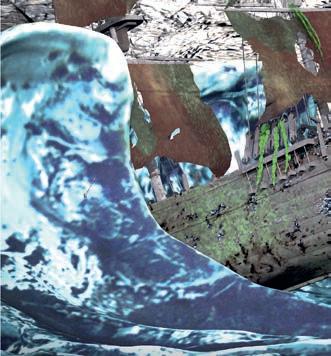

wachhalten („Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer“), schläft aber dennoch bald erschöpft ein. So bemerkt er nicht, wie plötzlich ein unheimliches großes Schiff mit blutroten Segeln die Bucht erreicht und mit furchtbarem Krach vor Anker geht. Der Kapitän des fremden Schiff s geht an Land.
Nr.2–Arie(Holländer). Sieben Jahre sind verstrichen („Die Frist ist um“) – doch hat der Holländer (Bariton) seine Hoff nung auf Erlösung längst aufgegeben. Er wünscht sich nur noch das Ende seiner Qualen herbei, ein Ende, das er trotz verzweifeltem Streben nach dem Tod nicht selbst herbeiführen kann: Erst am Jüngsten Tag, „wann
alle Toten aufersteh’n, dann werde ich in Nichts vergeh’n“.
Nr.3–Szene,DuettundChor (Daland,Steuermann,Holländer, Matrosen).
Daland weckt den schlafenden Steuermann und entdeckt das fremde Schiff und dessen Kapitän. Der stellt sich nur wortkarg als Holländer vor, sagt, dass er schon sehr lange unterwegs sei und Schätze aus aller Herren Länder geladen habe. Da wird der geschäftstüchtige Daland, der nichts Übersinnliches ahnt, hellhörig: Der reiche Holländer will ihm die Aufnahme in sein Heim fürstlich entlohnen („Durch Sturm und bösen Wind verschlagen“) – und als er erfährt, dass Daland eine

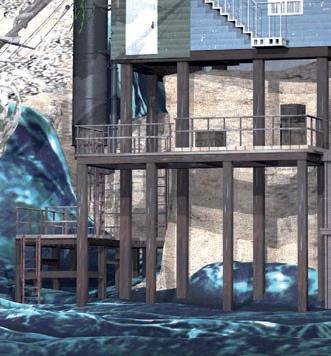

No.1–Introduction(sailors, Daland,helmsman).
Tochter hat, will er sie heiraten! „Wird sie mein Engel sein?“, fragt er sich. Daland ist hoch erfreut, dass der Holländer gleich selbst jenen Gedanken ausspricht, auf den er angesichts all der Reichtümer ebenfalls gekommen ist („Wie? Hör ich recht? Meine Tochter sein Weib?“). Er malt seine Senta in den schönsten Farben – und der Handel ist abgemacht. Der Steuermann meldet Südwind, die See hat sich beruhigt: Daland solle vorausfahren, der Holländer werde ihm mit seinem Schiff folgen. Mit dem fröhlichen Steuermannslied („Mit Gewitter und Sturm“) bereiten die Matrosen die Abfahrt vor und freuen sich, bald wieder mit ihren Lieben zuhause vereint zu sein.
Shortly before reaching the port it was heading for, the ship captained by the merchant Daland (bass) is forced to seek refuge from the storm in a bay. Daland recognises the area: Sandwike; they have drifted seven miles off course. The crew are worn out, and he lets them rest. Daland, too, goes below deck and the helmsman (tenor) takes the first watch. The helmsman sings a ditt y in an attempt to stay awake (‘With tempest and storm on distant seas’) – but soon falls fast asleep, exhausted. He doesn’t notice an eerie, black ship with blood-red sails that suddenly appears in the bay, dropping anchor with a fearful crash. The captain of the strange ship walks ashore, dressed in black in the manner of a Spaniard.
No.2–Aria(Dutchman).
Seven years have elapsed (‘The time has come’) yet the Dutchman (baritone) has long since given up hope of salvation. He simply wishes for an end to his torment – an end that he is incapable of orchestrating despite desperately yearning for death: not until Judgement Day ‘when all the dead shall wake, will I then pass into nothingness’.
Daland goes on deck, wakes the sleeping helmsman and discovers the mysterious ship and its captain. The man tersely introduces himself as a Dutchman, saying that they have been at sea for a long time and that his vessel is loaded with treasures from the four corners of the earth. At this the shrewd Daland, who doesn’t suspect anything supernatural, pricks up his ears. The rich Dutchman intends to reward him handsomely for taking him to his home (‘Cast adrift by storm and evil winds’) and, when he discovers that Daland has a daughter, the stranger asks for her hand in marriage. ‘Will she be my angel?’ he asks. Daland is delighted that the Dutchman expresses the same desire that, with his mind on the man’s enormous wealth, had occurred to him, too. (‘What’s that? Do I hear aright? My daughter shall be his wife?’). He paints a glowing picture of Senta – and the deal is done. The helmsman reports a southerly wind; the sea has calmed. Daland is to sail on ahead while the Dutchman follows after in his ship. The sailors sing a jaunty helmsman’s song (‘With tempest and storm’) as they prepare to depart and look forward to being reunited with their loved ones again very soon. STEEP, ROCKY COASTLINE; STORM.
No.3–Scene,duetandchoir (Daland,helmsman,Dutchman, sailors).
Die orchestrale Einleitung bildet die musikalische Brücke vom Schluss des Ersten Aufzugs mit dem Steuermannslied hin zu Schauplatz und Tätigkeit am Beginn des Zweiten.


Bühnenbildentwurf

Bühnenbildentwurf
Nr.4–Lied,Szene,Balladeund Chor(FrauenundMädchen, Mary,Senta,Erik).
Unter Aufsicht von Mary (Mezzosopran), Sentas Freundin, arbeiten die Mädchen und Frauen und singen ein fröhliches Lied („Summ und brumm, du gutes Rädchen!“). Die junge Senta hingegen hat nur









Augen für das Bild des Holländers. Weil Mary sich weigert, die Ballade vom Fliegenden Holländer zu singen, tut Senta es selbst („Johohohoe! Traft ihr das Schiff im Meere an“). Als sie in der dritten Strophe aus dem Vortrag ausbricht und ihre feierliche Entschlossenheit erklärt, selbst die Erlöserin des Gequälten werden zu wollen, geraten alle in Aufruhr – auch Erik (Tenor), der hereinkommt und den Schluss mitanhören musste. Er bringt die Botschaft , dass Dalands Schiff am Horizont aufgetaucht sei, worauf alle Frauen mit hektischen Vorbereitungen für die Ankunft der Männer beginnen.
Nr.5–Duett(Erik,Senta).
Doch Erik hält Senta zurück und wirbt neuerlich um seine Jugendliebe („Mein Herz, voll Treue bis zum Sterben“). Sie will ihm nicht wehtun, weicht ihm aus, verweist aber auch auf die Qualen des Holländers. Erik ist entsetzt und berichtet von einem prophetischen Traum, den er gehabt habe („Auf hohem Felsen lag ich träumend“): Darin sei Daland mit einem Fremden gekommen, den sie, Senta, als Gatten in die Arme geschlossen habe und dann mit ihm übers Meer verschwunden sei. Senta ist davon entzückt, Erik durch ihre Reaktion am Boden zerstört.
Nr.6–Finale.Arie,Duettund Terzett(Daland,Holländer,Senta).
Die Tür geht auf – und Daland steht mit dem Holländer da. Senta ist so gebannt von dessen stummer Erscheinung, dass sie den Vater kaum begrüßt. Dieser
macht die beiden miteinander bekannt und reibt sich bald die Hände, denn der lukrativen Verbindung der beiden scheint nichts im Wege zu stehen („Mögst du, mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen“). Endlich lässt er die beiden allein.
Im folgenden, groß angelegten Duett („Wie aus der Ferne, längst vergang’ner Zeiten“) sortieren nun beide, zuerst der Holländer, dann parallel dazu Senta, ihre Gefühle. Er hofft, dass sie ihn erlösen könne; sie fühlt instinktiv, dass sie ihre Bestimmung gefunden hat. Erst im darauffolgenden, abschnittsweise immer rascheren und ekstatischeren Teil beginnen die beiden miteinander zu kommunizieren. Am Höhepunkt kehrt Daland zurück („Verzeiht! Mein Volk hält draußen sich nicht mehr“) und erfährt zu seiner Freude, dass beim allgemeinen Fest nun auch die Verlobung zwischen Senta und dem fremden Kapitän gefeiert werden kann.
The orchestral introduction forms the musical bridge from the end of the first act with the helmsman’s song to the staging and activity at the beginning of Act Two.
A large room in Daland’s house; on the wall is a portrait of a pale man in Spanish garb.
No.4–Song,scene,balladand choir(womenandgirls,Mary, Senta,Erik).
Under the supervision of Mary (mezzo soprano), Senta’s friend, the women and girls labour at their spinning wheels and sing, cheerfully (‘Whir and whirl, good wheel!’). The young Senta, however, only has eyes for the portrait of the Dutchman that hangs on the wall. The girls tease her, saying her infatuation is bound to make the huntsman, Erik, jealous! Mary refuses to sing the ballad of the Flying Dutchman, so Senta sings it herself (‘Yo ho ho! Did you encounter the ship at sea’). When, during the third verse, she breaks off the recital and declares her solemn determination
that she will be the tormented man’s saviour, there is uproar. Erik (tenor) joins in the commotion, having come in just in time to hear her declaration. He brings the message that Daland’s ship has been sighted on the horizon, whereupon all the women start to frantically prepare for the arrival of their menfolk.
No.5–Duet(Erik,Senta).
Erik holds Senta back, however, and returns to wooing his childhood sweetheart (‘My heart will stay true to thee unto death’).
Senta doesn’t wish to hurt him. She evades him, referring to the Dutchman’s torment. Erik is horrified and tells her of a prophetic dream he has had (‘I lay dreaming atop a high cliff’): in his dream, Erik sees Daland arriving with a stranger who takes Senta in his arms as his betrothed and then disappears across the seas with her. Senta is entranced – and Erik falls is devastated by her reaction. He hurries away while Senta remains there, spellbound.
No.6–Finale.Aria,duetandtrio (Daland,Dutchman,Senta).
The door opens – to reveal Daland standing there with the Dutchman. Senta is so stunned by his wordless entrance that she hardly notices her father. Daland introduces the two of them and soon starts rubbing his hands together. As he sees it, nothing stands in the way of their lucrative connection (‘Please make the stranger feel welcome, my child’). And he finally leaves the two alone together. In the wide-ranging duet that follows (‘As if from afar, from times long past’), first the Dutchman and then Senta separately explore their feelings.
He hopes that she can save him; she instinctively feels that she has found her destiny. Only in the following section, during which the tempo becomes ever faster and more ecstatic, do the two begin to communicate with each other. At the climax of the song, Daland returns (‘Forgive me, my people will no longer wait outside’) and finds, to his joy, that the general festivities can now be extended to include the betrothal of Senta to the strange captain.
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… sich manche Menschen durch die Länge von Wagners Werken abschrecken lassen? Dabei zeigt der Selbstversuch, dass in den allermeisten Fällen durch die gleichsam in Echtzeit ablaufende Bühnenaktion jedes Aktes die Dauer im Erlebnis zusammenschrumpft. Ganz besonders gilt das für ein Stück wie Der fliegende Holländer , jenes frühe Meisterwerk, dessen explosiv gedrängte, musikalischdramatische Schlagkraft Wagner selbst eigentlich nicht mehr hat überbieten können und wollen.
Nach der Pause bildet das Entr'acte die musikalische Überleitung vom Terzett in die folgende Chorszene.
Bucht und Hafen bei Dalands Haus
Nr.7–Chordernorwegischen MatrosenundEnsemble,Chorder Mannschaft des Holländers. Das Fest ist in vollem Gange, die Seeleute singen und tanzen („Steuermann, lass die Wacht“), die Mädchen und Frauen gesellen sich hinzu. Da sich auf dem Schiff des Holländers nichts rührt, versuchen alle, die vermeintlich Schlafenden zu wecken. Das provoziert eine veritable Spukszene: Nur rund um das fremde Schiff brodelt plötzlich das Meer



und tobt heftiger Wind, seine Mannschaft stimmt einen grauenerregenden Gesang an („Johohohoe! Nach dem Lande treibt der Sturm“). Alle fliehen vor den unerklärlichen Phänomenen – und eine gespenstische Stille kehrt ein.
Nr.8–Finale.Duett(Erik, Senta),Cavatine(Erik)und Schluss(Holländer,Erik,Senta, Daland,Mary,Seeleute,Frauen undMädchen,Mannschaftdes Holländers).
Erik bedrängt Senta ein letztes Mal („Was musst’ ich hören! Gott was musst’ ich sehn?“). Doch seine Liebesbeteuerungen, seine Warnungen und die Forderung nach ihrer Loyalität finden kein Gehör bei ihr („Willst jenes Tags du nicht mehr dich entsinnen“).
Der Holländer allerdings belauscht ihr Gespräch und wähnt sich von Senta betrogen („Verloren! Ach! verloren!“). Nun erst gibt er sich allen als verdammter Fliegender Holländer zu erkennen. Doch Senta beteuert, sie habe ihn im ersten Moment schon erkannt und sei auch entschlossen, ihn durch ihre Treue bis zum Tod zu erlösen: Sie stürzt sich von der Klippe ins Meer. Durch Sentas Opfer kann des Holländers Seele endlich in Frieden ruhen.






Bühnenbildentwurf
The entr’acte forms the musical transition from the trio to the choral dance scene that follows.
Bay and harbour near Daland’s house
No.7–ChoirofNorwegian sailorsandensemble,choirofthe Dutchman’screw.
The celebrations are in full swing, the mariners are singing and dancing alone (‘Helmsman, leave your watch’), the women and girls arrive with food and drink. There is no sign of life from the Dutchman’s ship, and nobody seems hungry or thirsty, so everyone tries to wake
the crew, whom they suppose to be asleep. This gives rise to a truly spectral scene: the sea around the strange ship begins to bubble and seethe, a strong wind springs up and the ship’s crew start singing a bloodcurdling song (‘Yo ho ho! The storm drives us towards land’). They all flee the inexplicable phenomena and a ghostly silence falls.
No.8–Finale.Duet(Erik,Senta), cavatina(Erik)andconclusion (Dutchman,Erik,Senta,Daland, Mary,sailors,womenandgirls,the Dutchman’screw).
Erik pleads with Senta one last time (‘What plagued my ears! Dear God, what assaulted my eyes?’). Yet she
remains unmoved by his assurances of love, his warnings and his appeal to her loyalty (‘Do you no longer wish to bethink yourself of that day?’). The Dutchman, however, overhears their conversation and believes Senta has betrayed him (‘All is lost! Ah! Lost!’). Only now does he reveal himself to everyone as the doomed flying Dutchman. Senta, however, claims that she recognised him at first glance and was determined to redeem him by her faithfulness until death: she throws herself off the top of the cliff into the sea below. Senta’s sacrifice allows the Dutchman’s soul to finally rest in peace.
Brian Michael Moore (Der Steuermann Dalands)

Im Sommer 1839 begaben sich der 26-jährige Richard Wagner und seine vier Jahre ältere Frau Minna, so schreibt der Komponist in seiner Autobiographischen Skizze, „an Bord eines Segelschiffes“, „welches uns bis London bringen sollte“. Die Umstände waren prekär. Wagner hatte seit 1837 als Kapellmeister in Riga gearbeitet und dort namhafte Opern mit einem Orchester von nur 24 Mitgliedern aufgeführt, verlor diese Stellung dann aber. Da das junge Paar Schulden hatte und ihm die Gläubiger schon aus vorangegangenen Stationen wie Magdeburg und Königsberg auf den Fersen waren, schien eine Flucht angeraten.
Heimlich machten sich die beiden also, zusammen mit ihrem großen Neufundländer namens Robber, in die preußische Hafenstadt Pillau davon. Dabei kam es zu einem tragischen Unfall: Minna, die ihren Mann übrigens schon während des ersten Ehejahres einige Monate vorübergehend zugunsten eines Kaufmanns verlassen hatte, dann aber reumütig zurückgekehrt war, erlitt eine Fehlgeburt, als sich der Leiterwagen, in dem sie saß, überschlug. Zeit und Geld für medizinische Versorgung gab es nicht. Am 19. Juli 1837 verließen die Wagners Ostpreußen in Richtung London: als heimliche, undokumentierte Passagiere des kleinen, zweimastigen Frachtseglers
Thetis, etwa 25 Meter lang und mit einer Besatzung von sieben Mann einschließlich Kapitän. Die Route führte unweigerlich aus der Ostsee über Kattegat und Skagerrak in die Nordsee und von dort in die Themsemündung.
Stürmische Überfahrt
„Diese Seefahrt“, schrieb Wagner später, „wird mir ewig unvergeßlich bleiben; sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir von heftigstem Sturme, und einmal sah sich der Kapitän genöthigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen. Die Durchfahrt durch
die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie; die Sage vom Fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigenthümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten.“
Die stürmische, beinah in Schiffbruch endende Fahrt ist verbürgt, nicht aber die kursierende Mär vom Fliegenden Holländer: Dieser Teil von Wagners Bericht ist eher als „romantische Mystifikation des Stoffes als Volkssage“ (Robert Braunmüller) einzustufen. Die Story zählte also damals keineswegs zum allgemein bekannten und beliebten, schon seit Jahrhunderten gesponnenen Seemannsgarn.
Heines Ironie, Pariser Zwänge
Wagner stieß auf die Handlung in Heinrich Heines satirischen MemoirendesHerrenvonSchnabelewopski(1834), befreite sie aber von der dort waltenden Ironie. Das in Heines Buch erwähnte Theaterstück ist „mit Sicherheit eine literarische Fiktion“ (Braunmüller), frühere Belege für Elemente der Geschichte sind etwa ein Gedicht von Thomas Moore aus dem Jahre 1804, in dem ein Geisterschiff mit dem Namen FlyingDutchmanvorkommt, Walter Scotts Gedicht Rokeby(1812) und Frederick Marryats Roman The PhantomShip(1839). In Summe deutet alles darauf hin, dass die Sage sich in der uns bekannten Form erst in der Frühromantik verdichtet hat und populär geworden ist. Wie dem auch sei: Wagner hatte einen Stoff gefunden, der in Verbindung mit dem einschneidenden Erlebnis von stürmischer See, drohendem Schiffbruch und Tod seine Fantasie entzündete. Über London schließlich nach Paris gelangt, in die damalige Welthaupt-
stadt der Oper, wo Wagner sein Glück machen wollte, schrieb er dort innerhalb weniger Tage Anfang Mai 1840 einen Prosaentwurf, also ein Konzept für die Handlung. Und zwar gleich auf Französisch, weil er Eugène Scribe für die Ausarbeitung in Versen gewinnen wollte, den Librettisten des Starkomponisten Giacomo Meyerbeer. Dieser setzte sich tatsächlich für Wagner ein, und um sein Opernprojekt an der Pariser Opéra lancieren zu können, komponierte Wagner als Kostproben die zentrale Ballade sowie die Chöre der Matrosen und der Holländer-Mannschaft. Ihm schwebte ein Einakter vor, gut kombinierbar mit einem am selben Abend gegebenen Ballett. Doch die Opéra war nicht an seiner Komposition interessiert, kaufte ihm aber den Entwurf für 500 Francs ab. Pierre-Louis Dietsch, der spätere Dirigent von Wagners Tannhäuser in Paris, komponierte auf dieser, wenn auch stark umgearbeiteten Vorlage die Oper Le Vaisseau fantôme , die 1842 in Paris uraufgeführt werden sollte.
Von Schottland nach Norwegen
Daraufhin komponierte Wagner die Oper DerfliegendeHolländer sozusagen auf eigene Faust. Im Mai 1840 dichtete er das Libretto, in dem die zuvor Anna genannte Hauptperson nun Senta heißt. Noch im August hatte er die Partitur fertig skizziert, im Oktober die Reinschrift abgeschlossen. Als letztes wurde die Ouvertüre geschrieben, in der zentrale Motive der Oper verarbeitet sind: Sie wurde am 19. November 1840 abgeschlossen. Diese Urfassung spielt, so wie Heines Vorlage, in Schottland, Daland heißt deshalb Donald, der Jäger Erik Georg und die Bucht im ersten Akt Holystrand statt Sandwike. Doch noch vor der Uraufführung änderte Wagner Namen und Schauplatz, um das Geschehen näher an die eigenen Erlebnisse heranzuholen. Die Hafensiedlung Sandvika, die Wagner im Text meint, liegt auf der norwegischen Insel Borøya am Ende des Oksefjorden. Und das Echo der gesungenen Kommandos der Seeleute, das Wagner mitkomponiert

hat, entsteht dort durch den Widerhall am gegenüberliegenden Askeflu, einer 31 Meter hohen Felswand.
Im Zentrum: Sentas Ballade
Das Herzstück der diesjährigen Oper DerfliegendeHolländer , das noch dazu ziemlich genau in der Mitte der Spieldauer erklingt, ist die Ballade der Senta, in der sie die Geschichte des Fliegenden Holländers und seines Geisterschiffs den anwesenden, an ihren Spinnrädern sitzenden Frauen singend erzählt. Diese Ballade, ein Strophenlied, hebt sich also zunächst auch dramaturgisch als Einlage ab, als im Stück vorgetragenes Stück. Musikalisch sind darin wesentliche „Leitmotive“ des ganzen Werks versammelt. Dieser Begriff hat sich eingebürgert, stammt aber nicht von Wagner selbst. Gemeint sind damit Klangsymbole und Melodien, die mit bestimmten Personen, Handlungselementen, Zuständen und Stimmungen assoziiert werden, mehrfach wiederkehren und durch ihre Abwandlungen und Kombi-
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… das Zeitalter der Romantik die Idee eines Gesamtkunstwerks aus einer genialen Hand geboren hat? 1813 schrieb der deutsche Schriftsteller Jean Paul, dass „wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt“. Richard Wagner war der Erste, der Text und Musik gleichermaßen schrieb und auch über Bühnenaktion und die musikalische Ausführung bestimmen wollte.
nationen den Gang der Handlung nachzeichnen. Die leere Quint im Tremolo der Streicher, das über Quart und Quint ansteigende Motiv des Holländers, Sentas halb lautmalerisch vorgetragene, halb Seefahrtskommandos nachahmende Worte „Johohohoe!“, chromatisches Auf und Ab für die Meereswellen, das ruhige „Fänd’ er ein Weib“, das zum Erlösungsmotiv wird: All das steckt in Sentas Ballade. So ein erzählender, ein wesentliches Element des Stücks erklärender Gesang in Strophenform war eine beliebte Technik in der französischen Oper: In François-Adrien Boieldieus LaDameblanche(1825) wird die Geistererscheinung beschrieben, die bald darauf wirklich auftritt; in Giacomo Meyerbeers Robertlediable(1831) gibt es eine ähnliche Nummer, die Wagner in manchen Details als musikalisches Vorbild gedient haben könnte, und sogar in der deutschen Oper, etwa in Heinrich Marschners DerVampyr (1828), einem der viel zitierten Vorbilder für Wagner, erklingt ein solches Strophenlied. Und die Technik einzelner wiederkehrender „Erinnerungsmotive“ hatte sich gleichfalls in der französischen Oper wie auch in Deutschland, etwa bei dem von Wagner verehrten Carl Maria von Weber, etabliert. Wagner hat also in DerfliegendeHolländer und auch anderswo in seinem Frühwerk ganz bewusst Elemente der französischen und der deutschen Operntradition aufgenommen und überhöhend zusammengeführt – etwa in der Verbindung von Binnenformen wie Arie, Duett und Chor zu größeren, durchgehenden Zusammenhängen nach französischem Vorbild sowie in der schwereren, massiveren Instrumentation nach deutschem Vorbild.
Musikalische und dramaturgische Zusammenhänge
Doch geht Wagner dabei auch entscheidende Schritte weiter: Die Motivtechnik baut er so weit aus, dass sie nicht nur punktuell wirksam ist, sondern immerhin wesentliche Teile der Partitur bestimmt – wenn auch noch nicht deren Substanz wie später. Und die zweite, ungemein dramatische, ja bestürzende Neuerung ist: Senta schließt die Ballade am Ende nicht als bloßen Liedvortrag ab, sondern führt sie in die Realität fort, indem sie sich selbst schon als jene Frau identifiziert, die den Holländer erlösen werde. Damit hat Wagner auch eines jener Themen gefunden, die ihn sein ganzes Leben in seinen Musikdramen beschäftigen würden: transzendentale Erlösung durch die Liebe, in der Regel die Erlösung eines Mannes durch die selbstlose Liebe einer Frau. Sentas Ausbruch aus dem Binnengesang in die unmittelbare Lebenswelt ist denn auch ein neuralgischer Moment in der Oper, dem dann wenig später der Eintritt des Holländers in Dalands Haus entspricht.
Senta will aus dem kleinbürgerlichen Dasein in eine herbeifantasierte Traumwelt ausbrechen, der Holländer sprengt die Grenzen von Sentas Realität mit seinem leibhaftigen Auftauchen in Sentas Vaterhaus. In ihrer Beziehung wird eine gegenseitige Anziehung gezeigt, während Menschen- und Geisterwelt einander sonst abstoßen: Das zeigt vor allem der dritte Aufzug mit seinem Zusammenprall von feiernden Matrosen und ihren Freundinnen auf der einen Seite und der düster-gespenstischen Mannschaft des Holländers auf der anderen Seite, für die es nichts Gemeinsames geben kann. Der Holländer selbst verbindet die romantische Figur des rastlos-unbe-


hausten, nirgends eine Heimstatt findenden Wanderers mit einer schuldhaften, trotz Reue nicht ohne Weiteres abzuwaschenden Verstrickung. Er sei „als skeptischverzweifelter Außenseiter und prometheischer Rebell“ dargestellt, legt Braunmüller dar, und führt weiter aus: „Mit der Erlösung des ruhelosen Mannes durch die Frau findet Wagner hier erstmals sein bestimmendes Thema. Liebe wird als Verhängnis erfahren: Der Holländer empfindet ‚düstre Glut‘ und ‚Sehnsucht nach dem Heil‘, aber keinen Wunsch nach sinnlicher Erfüllung. Auch Senta erwartet kein bürgerliches Zusammenleben mit dem Holländer. Ihre Treue ist das Opfer einer Märtyrerin der Liebe: ‚Mit ihm muß ich zugrunde gehen‘. Ihre ‚Treue bis zum Tod‘ ist eine Treue, die sich im Tod erfüllt.“
Zielstrebige Handlung
Die erwähnte Anziehungskraft zwischen Holländer und Senta, die umso stärker wirkt, als zuvor gerade erst Dalands leutselige Buffo-Arie „Mögst du, mein Kind den fremden Mann willkommen heißen“ erklungen ist, findet auch Ausdruck in der Tatsache, dass es keines Rezitativ-Vorgeplänkels bedarf, damit die beiden Charaktere in einem zuerst unbegleiteten, sich dann hymnisch steigernden Duett zusammenfinden können. Der Magnetismus, der zwischen Senta und Holländer herrscht, verweist auch auf die Tatsache, dass die Figuren weniger bewusst handeln, als dass sie aufeinander zutreiben, in diesem Mechanismus aber auch ihr Inneres als verwirklicht erleben. Sein dunkles Gegenbild hat Sentas Ballade im Monolog des Holländers
im ersten Aufzug, der noch stärker als die Ballade dem alten Typus der Doppelarie mit langsamem und raschem Teil, also Cantabile und Cabaletta, verpflichtet ist. Hier wie dort setzt an späterem Punkt der Frauen- bzw. Männerchor mit dort kontemplativem, hier resignativem Unterton ein. Bezeichnend ist, dass der Dramaturgie folgend aber beide Nummern rein auf den Holländer bezogen sind: Er erläutert und beklagt sein Schicksal sowie sehnt sich den Weltuntergang als Ende seiner Leiden herbei; sie stellt sich nicht als eigenständige Person vor, sondern rein als zum Sterben bereite Retterin.
Das, abgesehen von der hinzugefügten Figur des Erik, der Senta vergeblich liebt, ohne weitere Nebenhandlungen und dramaturgische Umschweife zugespitzte
Geschehen lässt die ursprüngliche Konzeption als Einakter (die sogenannte „Balladenfassung“) noch durchscheinen, selbst wenn Wagner auch für die ersten beiden Aufzüge formelle Schlüsse komponiert hat, um die Spielbarkeit auch mit einer oder zwei Pausen zu gewährleisten.
Die Ouvertüre als Summe und Vorwegnahme
Bereits aus dem Jahr 1841, als Wagner noch nicht einmal sein erstes großes Frühwerk Rienziauf die Bühne gebracht hatte, stammen bereits grundlegende Gedanken darüber, wie eine moderne Oper adäquat zu eröffnen sei. In seinem Aufsatz „Über die Ouvertüre“ schreibt er zu Beethovens großer Leonoren-Ouvertüre Nr. 3: „Beethoven, der nie die ihm entsprechende Veranlassung zur Entfaltung seiner ungeheuren dramatischen Instinkte gewann, scheint sich hier dafür entschädigt haben zu wollen, indem er sich mit der ganzen Wucht seines Genie’s auf dieses seiner Willkür freigegebene Feld der Ouvertüre warf, um in eigenster Weise sich aus reinen Tongebilden sein gewolltes Drama zu schaffen, welches er nun, von allen den kleinen Zuthaten des ängstlichen Theaterstückmachers losgelöst, aus seinem riesenhaft vergrößerten Kerne neu hervorwachsen ließ. Man kann dieser wunderbaren Ouvertüre zu Leonore keinen anderen Entstehungsgrund zusprechen: fern davon, nur eine musikalische Einleitung zu dem Drama zu geben, führt sie uns dieses bereits vollständiger und ergreifender vor, als es in der nachfolgenden gebrochenen Handlung geschieht. Dies Werk ist nicht mehr eine Ouvertüre, sondern das gewaltigste Drama selbst.“ Tatsächlich fand Wagner schon damals, dass diese Komposition im Opernhaus ihren Zweck übersteige
und sprenge. Die Ouvertüre solle die „Einbildungskraft der Zuschauer“ anregen, sie „in die höhere Sphäre versetzen […], in welcher wir uns auf das Drama vorbereiten“; er lobte aber etwa an Mozarts Ouvertüre zu DonGiovanni , dass sie, auch durch ihren nahtlosen Übergang in die erste Szene, den Ausgang des Dramas „nur ahnen“ lasse. In Oper undDrama(1850–51), nun um die Kompositionserfahrungen vom FliegendenHolländer , Tannhäuser und Lohengrin reicher, führt Wagner diesen Punkt weiter aus: Das Orchestervorspiel „leitet und erregt […] unsere allgemein gespannte Empfindung zu einer Ahnung, die eine, als nothwendig geforderte, bestimmte Erscheinung endlich zu erfüllen hat“. Ein Fehler sei es jedoch, „die Ahnung schon mit absolut musikalischer Gewißheit über den Gang des
Drama’s erfüllen zu wollen“ – ein Einwand, den man durchaus als Selbstkritik an den Ouvertüren zum FliegendenHolländer und, in geringerem Ausmaß, zu Tannhäuser werten kann.
Denn die Holländer-Ouvertüre verarbeitet, darin etwa den Vorbildern von Beethovens LeonorenOuvertüre Nr. 3 oder auch Webers Freischützfolgend, wesentliche thematische Gebilde in Sonatensatzform – mit einem nach einer spannungsreichen Generalpause erklingenden Jubelschluss, entsprechend der Erlösung des Holländers durch Sentas selbstlosen Tod. Die musikalische Ausformung und die Regieanweisungen für diesen mit damaligen Bühnenmitteln nicht ohne Weiteres darstellbaren Schluss aber sollten wechseln – szenisch in Nuancen der Apotheose der zum

Himmel entschwebenden Gestalten von Senta und Holländer, musikalisch erheblich.
Endete die Oper ursprünglich mit dem nach Dur gewendeten Motiv des Holländers und Tuttischlägen des Orchesters, komponierte Wagner 1860 einen neuen, gleichlautenden Schluss für Ouvertüre und Oper, der die Erfahrung mit der Sehnsuchtschromatik von TristanundIsoldenun, von Harfenarpeggien umrauscht, auf das ältere Werk anwendet. Das mag man als Stilbruch empfinden, entsprach aber Wagners Ringen um eine optimale Gestalt des Holländers
Work in progress?
Überhaupt wurde er, analog etwa zum Tannhäuser , auch mit dem Stück DerfliegendeHolländernie

nominell und tatsächlich „fertig“: Für die berühmte Sopranistin und in der Folge auch bedeutende SentaSängerin Wilhelmine SchröderDevrient transponierte er noch im Umfeld der Uraufführung etwa die Ballade vom sehr hoch liegenden a-Moll einen Ganzton nach g-Moll hinunter und nahm Retuschen an der Instrumentierung vor, indem er vor allem allzu schwer geratene Passagen des Blechs reduzierte. Selbst nach der Komposition des erwähnten Erlösungsschlusses ließ ihn DerfliegendeHolländernoch nicht völlig los: „1864 notierte er eine völlig neue Melodie zu den ersten vier Zeilen der Senta-Ballade. Bis zu seinem Tod erwähnte Wagner mehrfach den Plan einer weiteren Umarbeitung und sprach mit Cosima darüber.“ (Braunmüller)
Heutige Aufführungen müssen sich also im großen Ganzen zwischen der pausenlosen Balladenfassung und dem Einschub von einer oder gar zwei Pausen entscheiden, ferner zwischen Erstfassungs- und Erlösungsschluss – und können darüber hinaus mit Varianten bestimmter Stellen, Mischversionen und üblichen Kürzungen auf spezielle Erfordernisse von Aufführungsort und Ensemble reagieren.
Von holprigen Anfängen zum Zugstück
Noch von Paris aus hatte Wagner sein Werk DerfliegendeHolländer den Opernhäusern von Leipzig und München angeboten, blitzte aber dort mit der Bemerkung ab, das Werk eigne sich nicht für deutsche Bühnen. Auf Meyerbeers Empfehlung hin akzeptierte Berlin die Partitur, doch blieb diese dort wegen eines Intendantenwechsels dann liegen. Wagners großer Erfolg mit seinem Rienzi, der am 20. Oktober 1842 am Königlichen
Hoftheater in Dresden seine Uraufführung erlebte, wiederum durch Fürsprache Meyerbeers, legte den Gedanken nahe, nicht auf Berlin zu warten und auch Derfliegende Holländeran diesem modernen, von Gottfried Semper geplanten und erst 1841 eröffneten Opernhaus herauszubringen.
Doch war der Plan zu ambitioniert, die Zeit für eine adäquate Inszenierung zu kurz und das Publikum durch Wagners neuartige Tonsprache eher überrascht als fasziniert. Trotz der überragenden Schröder-Devrient als Senta wurde die Uraufführung am 2. Jänner 1843 unter Wagners eigener Leitung nicht zu einem rauschenden Erfolg: Nach vier Vorstellungen gab man lieber wieder Rienzi, trotz dessen eklatanter Überlänge von sechs Stunden. Doch noch 1843 kam das Werk zu Wagners Zufriedenheit in Kassel unter Louis Spohr heraus; 1844 dirigierte der Komponist seine Oper im Berliner Schauspielhaus, wo sie freilich gleichfalls nach vier Vorstellungen wieder abgesetzt wurde. Doch über weitere Aufführungen in Zürich und dann 1853 in Weimar unter Franz Liszt, 1865 in Prag, 1860 in Wien und 1864 in München war schließlich der Damm gebrochen. 1901 leitete Felix Mottl die Erstaufführung bei den Bayreuther Festspielen. Seither ist DerfliegendeHolländer das älteste Werk Wagners, das in den Bayreuther Kanon Eingang gefunden hat und dort regelmäßig aufgeführt wird. Seit 1955 hat es dort acht Neuinszenierungen erlebt.
Mittlerweile gilt die Oper als eine Art „Einstiegsdroge“ für künftige Wagner-Begeisterte in aller Welt. Im Steinbruch St. Margarethen wird 2025 eine Kombination aus der Neuen Wagner Gesamtausgabe und der Fassung 1852 aufgeführt.
Musikalische Leitung
Patrick Lange
Inszenierung
Philipp M. Krenn
Bühnenbild
Momme Hinrichs
Kostüme
Eva Dessecker
Lichtdesign
Paul Grilj
Live Action Director
Ran Arthur Braun
Chorleitung
Walter Zeh
Sounddesign
Volker Werner
Video
Roland Horvath
Chor
Philharmonia Chor Wien
Orchester
Piedra Festivalorchester
Stunts
Show Talent Network:
Davide Bertorello*
Vitor Dias de Paiva*
Théo Foucher
Filip Krzisnik*
Frederic Matona*
Quentin Mesquich
Antoni Niechciat
Romain Painset
Blaĉ Slanic*
Der Holländer
George Gagnidze
James Rutherford
Tommi Hakala
Senta
Elisabeth Teige
Johanni van Oostrum
Johanna Will
Daland
Liang Li
Jens-Erik Aasbø
Erik AJ Glueckert
Dominick Valdés Chenes
Nenad Čiča
Der Steuermann Dalands
Jinxu Xiahou
Brian Michael Moore
Mary
Roxana Constantinescu
Lora Grigorieva
Statisterie
Viktoria Becker
Daniel Flassak
Noémi Kovács
Stefan Laner
Emilia Sipöcz
Michael Stark
Jasmin Varga
Dario Scaturro
* Kameramann
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… Frauen nicht nur in seinen Opern, sondern auch in Richard Wagners Leben immer wieder eine zentrale Rolle spielten? Schwestern und Lebensgefährtinnen, Mäzeninnen, Ideale und Idole, Bühnendarstellerinnen: „Die frauen sind eben die musik des lebens: sie nehmen alles offener und unbedingter in sich auf, um es durch ihr mitgefühl zu verschönen“, schrieb er 1849 in einem Brief. Die Schauspielerin Minna Planer wurde 1836 seine erste Gattin und fachkundige Ratgeberin. Wagners Affäre mit der Künstlerin und Mäzenin Mathilde Wesendonck 1857 führte zu Tristan und Isolde sowie zur Scheidung; Minna starb 1866. Schon 1853 hatte Wagner in Paris Cosima kennengelernt, die Tochter von Marie d’Agoult und Franz Liszt. 1856 wurde Cosima die Frau des Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow. Die Bülows besuchten die Wagners 1857 in Zürich, wo Minna, Mathilde und Cosima zusammentrafen. Als Wagner 1865 München hinter sich lassen musste, folgte ihm Cosima als seine Geliebte nach Luzern. 1865 wurde ihrer beider Tochter Isolde geboren, 1867 Eva und 1869 der ersehnte Stammhalter Siegfried. Erst 1870 willigte Bülow in die Scheidung ein, noch im selben Jahr heirateten Richard und Cosima. Wichtig sind noch die Sopranistinnen Wilhelmine SchröderDevrient und Malvine Schnorr von Carlosfeld: Letztere hat zusammen mit ihrem Mann Ludwig die Uraufführung der als unsingbar geltenden Oper Tristan und Isolde geleistet. Anlass eines letzten Ehestreits unmittelbar vor Wagners Tod war Carrie Pringle, ein Blumenmädchen im Parsifal , das Wagner 1883 in den venezianischen Palazzo Vendramin eingeladen hatte.
Musikalischer Assistent und Dirigent
Quentin Hindley
Korrepetition
Irina Buch
Regieassistenz
Sebastian Kranner
Florian Pilz
Evelyn Unbescheiden
Bühnenbildassistenz
Philomena Strack
Kostümassistenz
Elisabeth Hess
Musikalische Assistenz Chor
Thomas Böttcher
Chormanagement
Gerhard Sulz
Künstlerische Produktionsleitung Musik
Katharina Reise
Künstlerische Produktionsleitung Technik
Günther Kittler
Technische Leitung
Edi Edelhofer
Herbert Herl
Leitung Statisterie
Niklas Gasselseder
Inspizienz
Attila Galács
René Bein
Übertitelinspizienz
Thomas Böttcher
Carlon Danner
Chefmaskenbildnerin
Regina Tichy
Maske
Nicole Brunner
Julia Buxbaum
Jessica Graf
Celine Korrak
Birgit Strobl
Rebecca Trink
Anna Vardanyan
Tatijana Drodomirov
Leiterin Schneiderei & Garderobe
Doris Lackner-Schatek
Schneiderei & Garderobe
Laura Denk
Emilie Haidler
Monika Lackner
Julia Lirsch
Lena Meyer
Carmen Postl
Hanja Rothenthal
Benedikt Schatek
David Schuch
Carmen Uhlir
Annika Weber
Anfertigung Bühnenbild
Winter Artservice GmbH
Geschäftsführung:
Christopher Winter
Produktionsleiter:
Stefan Gmainer
Stahlbau
Metallbau Pinterich
Gerüstbauten
Redline Enterprise
Jeff Geiger
Bühnentechnik
Murat Cetin
Máté Varga
Requisite
Zsigmond Fodor
Tonmeister
Fabian Hainzl
Pit Kaufmann
Lukas Lützow
Benedikt Ross
Philipp Treiber
Technisches Equipment Habegger GmbH
Projektleitung
Wolfgang Schmellerl
Statiker
Ziviltechnikbüro
DI Thomas Hanreich
Einreichung Behörden
Thomas Ludwig
Produktionsfahrer
Zsigmond Fodor
Máté Varga

„Regie ist Handwerk!“
NachgetanemTagwerksitzt RegisseurPhilippKrenn–mit sonnenrotenBacken,leuchtenden Augen,StrohhutaufdemKopf undpassendemKaltgetränkin derHand–mittenimSteinbruch, umringtvonFelsenundKulissen fürDer fliegende Holländer,und nimmtsichZeitzumPlaudern: überseineunmusikalischen Anfänge,diepragmatischeSicht aufsRegietheater–undErik,den begehrtestenJunggesellenimDorf.
Was war Ihre erste Erfahrung mit klassischer Musik? Haben Sie den Plattentisch von Ihren Eltern durchkramt …
Meine erste Erfahrung mit klassischer Musik waren die Wiener Sängerknaben.
Sie sind zu den Wiener Sängerknaben gekommen, ohne davor mit klassischer Musik in Berührung gekommen zu sein?
Absolut. Das war für meine Mutter damals eine Möglichkeit, mir eine gute Ausbildung zu gewährleisten, die ich mir quasi mit Singen verdient habe. Dass ich anscheinend eine gute Stimme hatte, das wurde in der Volksschule festgestellt. Da hat es geheißen, sing doch mal bei den Sängerknaben vor – und ich bin genommen worden. Und dort habe ich meine ersten Berührungen mit klassischer Musik und mit der Opernbühne gehabt. Ich habe
gemerkt, was es heißt, Konzerte zu geben, Musik zu machen, Musik zu verstehen. Ich habe Musik dort gelernt: Notenlesen, alles was dazugehört. Ich habe dort angefangen, Klavier zu spielen und später noch Gitarre. Und das hat mich dann eben bis zum Stimmbruch auch begleitet.
Ist es eigentlich verpflichtend bei den Sängerknaben, dass man ein Instrument spielt?
Ja, ist es sogar. Das macht ja auch Sinn und ist etwas ganz Wunderbares. Überhaupt ist Auseinandersetzung mit Musik und auch Auseinandersetzung mit Instrumenten etwas Tolles – gerade wenn ich an meine Kinder denke. Da geht es auch gar nicht darum, dass alle Profimusiker und Sänger oder Instrumentalisten werden oder irgendwo im Bereich der Musik landen, sondern das ist einfach unglaublich persönlichkeitsfördernd und -fordernd. Das finde ich richtig toll.
Wenn man da als Bub singt, wie begegnet man den vielen großen Komponisten?
Schließlich ist es ja sozusagen Arbeit.
Das war einfach alles normal. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Wenn wir jetzt Wagners Parsifal gesungen haben, die Stimmen aus der Höhe, dann hat das etwas mit mir gemacht. Dann bin ich da oben im vierten Rang gestanden und habe runtergeschaut auf die Bühne. Die Musik hat mich mitgerissen und mitgenommen. Aber da war mir überhaupt noch nicht klar, dass Wagner einer der bedeutendsten Komponisten ist. Es war für uns einfach Alltag, jeden Abend auf die Bühne zu gehen, ein Konzert
zu geben und dann in den Bus zu steigen und weiterzureisen und in die nächste Stadt zu fahren.
Wenn man einen solchen natürlichen, selbstverständlichen Zugang zur Musik entwickelt, kommt dann später eine Phase, wo man alles für sich nochmal neu entdeckt?
Ja, das klingt nachvollziehbar. Mein Weg war ein Zick-Zack-Weg, mein ganzes Leben lang. Ich habe nach den Sängerknaben die Chemie HTL gemacht. Also etwas komplett anderes, auch weil ich von Musik und Bühne mal eine Zeit lang überhaupt nichts wissen wollte. Und dann habe ich an der Technischen Universität studiert und paradoxerweise meinen Lebensunterhalt mit Singen nebenbei verdient. Durch Zufall bin ich wieder zurück zur Bühne gekommen, als ein
Regisseur mich fragte, ob ich es nicht mit Schauspiel versuchen wolle. Um mir zehn Jahre später keinen Vorwurf machen zu müssen, es nicht probiert zu haben, habe ich mich also beworben und landete an der Akademie bei Elfriede Ott. Aber dann hat mir als Schauspieler die Musik wieder gefehlt. Und deswegen bin ich zurück und habe den Brückenschlag gemacht: Bühne, Schauspiel, Musik, Technik – wo trifft sich denn das Ganze?
Und so landete ich bei Regieassistenz. Aber um die Frage zu beantworten: Ja, da hatte ich dann auch das Gefühl, ich muss mir die Musik nochmal neu, anders erarbeiten. Was vorher so spielerisch war und nebenbei ging, brauchte jetzt einen ganz anderen Zugriff.
Und wie sind Sie das angegangen? Haben Sie da bestimmte Bücher gelesen, die Sie heute noch wichtig finden, oder Lieblingsaufnahmen gefunden?
… Wagner Tierfreund, zumindest in der Grundtendenz Vegetarier und speziell ein großer Hundeliebhaber war? Im Garten seiner Villa Wahnfried in Bayreuth, unweit des Grabes von ihm und seiner Frau Cosima, haben auch zwei seiner Neufundländer die letzte Ruhestätte gefunden: „Hier ruht und wacht Wagner’s Russ“ steht auf einem Grabstein, „Hier ruht Wahnfrieds treuer Wächter und Freund [,] der gute schöne Marke“, heißt es auf dem anderen. Jagdsport und Tierquälerei, auch medizinische Tierversuche, waren Wagner aus ethischen Gründen verhasst.
Weder noch. Wenn ich Musik höre, wechsle ich gerne zwischen unterschiedlichen Interpretationen. Ich höre mir bewusst möglichst viele verschiedene Aufnahmen an, um nicht an einem Tempo, an einer künstlerischen, gesanglichen Interpretation kleben zu bleiben. Und was Bücherlesen betrifft ... Ich bin nicht der große intellektuelle Typ. Also das heißt nicht, dass ich nicht gern lese oder mich nicht damit beschäftige. Aber für mich war dann Regie tatsächlich immer Handwerk und Handwerk ist etwas, das lernt man nicht mit dem Davorsitzen, sondern mit dem Tun. Und ich durfte mit ganz großartigen Regisseuren und Regisseurinnen arbeiten, wo ich mir unglaublich viel abschauen konnte und wo ich gemerkt habe: So kann man mit Musik umgehen, sie einfangen.
Oder so kann man etwas darstellen, in eine Ordnung bringen.
Sie kommen mit mehr als einem Fuß aus dem Theater, da könnte man davon ausgehen, dass Sie nicht nur aufs Drama schielen, sondern definitiv etwas erzählen wollen. Zugegeben, nicht in jeder Oper steckt wahnsinnig viel Drama, aber Wagner hat mehr, als man in einem Leben abarbeiten könnte. Sie stellen ja nicht nur Leute auf die Bühne und sagen: links, rechts, vorwärts, rückwärts …
Um Gottes Willen, nein! Dadurch, dass ich so stark mit dem Schauspiel verhaftet bin, finde ich es immer toll, wenn die Personen auf der Bühne leben, wenn sie mitgehen mit dem Ganzen, wenn die Musik ihr Handeln beeinflusst und ihr Handeln die Musik, wenn das ein Austausch ist und nicht getrennt voneinander abläuft. Nur zu sagen: Du stehst da und singst deine Arie und so weiter … das macht gar keinen Spaß. Für mich ist das Tolle daran, Musik und Schauspiel zusammenzubringen – und deswegen bin ich auch tatsächlich Musiktheaterregisseur. Beim Schauspiel ist ein Text zwar vorgegeben, aber da kannst du kürzen, umstellen, was und wie du willst. Musik dagegen hat halt diese Form, die ist vorgegeben, da ist schon ein vorgezeichneter Weg des Flussbettes da. Und das dann noch auszugraben und seine Linien zu finden, das finde ich sehr spannend.
Ist es denn interessanter, Opern zu inszenieren, wo dieser Graben schon sehr voll und ausgeprägt ist, die vor Drama nur so strotzen — Janáček oder Britten oder Wagner oder Richard Strauss zum Beispiel. Oder ist es die
Herausforderung, einer Oper, die eher dürftig ist, was das Drama betrifft, neuen oder überhaupt Sinn zu geben?
Ich habe beides gemacht. Und ich finde beides sehr interessant. Aber ich muss gestehen, ich fühle mich mehr zu Hause, wenn das Drama schon da ist. Bei Sachen wie Figaro, ach, das ist einfach toll zu inszenieren. Da sind die Figuren da, da ist das Drama da. Oder Britten, ich habe PeterGrimes gemacht. Das war für mich unglaublich angenehm zu arbeiten, weil er Charaktere und Emotionen komponiert. Das ist unfassbar. Und das ist beim FliegendenHolländerja auch der Fall. Das ist so hochromantisch und unglaublich schöne Musik. Und dann haut er dir da Wellen und Meer und Drama und innere Vorgänge rein, die du ja auch tatsächlich gar nicht darstellen kannst. Durch die Musik werden sie dann erst so groß. Und das in den richtigen Kontext zu bringen, das ist schon mehr das Meine, weil ich doch vom Schauspiel komme.
Jede Regie ist im Endeffekt die Übersetzung einer Lebensrealität aus einem anderen Zeitalter in unser jetziges. Versuchen Sie, das eher so zu machen, wie das damals vielleicht gewesen war, oder wie man sich vorstellt, dass es gewesen sein könnte?
Nein, gar nicht. Zumal da noch mehrere Parameter in dieser Frage stecken. Für mich als Regisseur ist es wichtig, klarerweise, welche Oper mache ich, aber auch, in welchem Kontext mache ich sie? Wo mache ich sie? Für welches Publikum mache ich sie? Das ist einfach eine ganz wesentliche Entscheidungsfindung. Ich bin überzeugt davon, dass ich den FliegendenHolländer an einem tatsächlichen Opernhaus
ganz anders inszenieren würde. Da geht es um Fragen wie: Was bringt die Bühne mit? Was hat es dort schon gegeben? Was möchte das Publikum? Oder was kann das Publikum auch sehen? Was kann man dem Publikum zumuten? Es ist ja eine andere Welt, ob ein Zuschauer schon zehnmal den FliegendenHolländergesehen hat und jetzt zum elften Mal sieht. Er geht mit ganz anderen Erwartungen rein als ein Zuschauer, der sagt, ich möchte jetzt „Oper erleben“. Einmal im Jahr gehe ich in die Oper, DerfliegendeHolländer… wunderbar, habe ich noch nie gesehen. Spannend. Bitte. Das versuche ich immer auch in meiner Arbeit mit einfließen zu lassen. Und gerade beim FliegendenHolländer war das bei uns der Ausgangspunkt, auch wegen dieses Bildes. So wie wir

den Steinbruch gesehen haben, war uns klar: Das ist schon das Konzept! Es war uns klar, wir müssen diesen Steinbruch mit Wasser fluten und ein großes monumentales Bild, so wie es die Musik auch ist, schaffen. Wir wissen auch, dass wir im Hellen anfangen und es geht langsam ins Dunkle. Das beeinflusst zwangsläufig das Konzept.
Woher kennen sich Senta und der Holländer, wenn sie sagen, sie hätten sich schon mal gesehen? Haben sie das wirklich?
Sie haben sich noch nicht gesehen. Sie haben beide plötzlich ihr Traumbild. Eine jeweilige Idealfigur. Die Senta träumt sich in einem Bild, einer Geschichte weg, die sie selbst idealisiert.
Wie ein Teenager, der einen Popstar-Poster an der Wand hat?
Und Geschichten darüber hört. Und diese Geschichten bauen sich ja auch auf. Für uns war es immer schon spannend zu fragen, woher kommt denn diese Geschichte überhaupt, die des Holländers? Sagen haben ja immer irgendwo einen wahren Kern – und was ist denn der wahre Kern hier? Und um diesen Kern wird alles immer mehr aufgebauscht. Und je öfter du es erzählst, umso größer wird die Geschichte. Senta träumt sich in diese Geschichte hinein. Und sie will auch raus, weg von diesem kleinen Dorf, in dem es vielleicht drei heiratsfähige Burschen gibt. Da bietet sich der Erik an, der eigentlich eine super Partie ist. Aber

in Wahrheit sitzt der auch fest. Und Senta geht es um Freiheit, darum, etwas Neues zu finden, und dann ist ein Holländer, der plötzlich auftaucht, natürlich das gefundene Fressen für sie.
Apropos Erik und „beste Partie im Dorf“, weil er der Einzige ist, der nicht auf die See muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und den abzulehnen, das ist eigentlich die wirkliche Chuzpe. Die Entscheidung für den Holländer muss schockieren, oder?
Absolut. Sämtliche anderen Spinnerinnen wären froh, wenn sie ihn abbekämen. Der wird landläufig als ein bisschen doof oder ein bisschen unbedeutend hingestellt, wo man sagt, das ist eigentlich klar, dass sie den nicht will. Aber das ist es nicht. Auch unglaublich spannend, was für ein guter Mensch der ist. Selbst wenn er in der Musik oft Ausbrüche drinnen hat, wo man sagt, eigentlich müsste er jetzt gleich handgreiflich werden – „Erfülltest du nur eine meiner Bitten?“ – da ist ja unglaublich viel an Aggression oder an Verbissenheit in der Musik. Aber wie oft hat er Senta schon gerettet, sie, die sich wegträumt und ins Wasser geht und ihrem Traum nachschwimmt und dann fast absäuft. Und er holt sie aus dem Wasser raus. Und ist einfach da für sie und sagt, „Hey, komm, alles gut. Wir kriegen das hin.“ Der ist ja auch meines Erachtens so ein wirklich guter Mensch. Und schwierig zu singen. Er ist nur zweimal auf der Bühne, aber diese zwei Arien haben es in sich. Einerseits verlangen sie Kraft, aber dann sind sie so unglaublich zart und lyrisch. Und dazwischen auch wieder so aufbrausend. Also, das muss man erst einmal wirklich toll singen.
… der erste WagnerVerein schon 1871 in Mannheim gegründet wurde? Er war das bürgerliche Gegenstück zur Bayreuther Patronatsbewegung, die sich aus wohlhabenden und oft adeligen Kreisen rekrutierte. Ziel war anfangs, die erste Gesamtaufführung des Ring des Nibelungen im extra dafür errichteten Festspielhaus Bayreuth zu ermöglichen, was 1876 bewerkstelligt werden konnte: Unter den finanziellen Unterstützern wurden Kartenanrechte verlost. Durch die sich über die ganze Welt verbreitenden WagnerVereine und Verbände, die bis heute aktiv sind, kam es zum „kulturgeschichtlichen Unikat einer institutionell organisierten, internationalen Künstleranhängerschaft“ (Sven Friedrich).
Ich verbinde St. Margarethen und dergleichen eigentlich mit „Spektakel“. Ist es fair, dieses Wort in dem Zusammenhang?
Das ist fair, denn der Steinbruch ist ein Spektakel! Und deswegen muss man daraus auch ein Spektakel machen. Das ist dermaßen groß und es ist so ein Unterschied, ob man in der zweiten Reihe sitzt oder in der letzten. Man muss es hinkriegen, dass es sowohl als großes Bild funktioniert als auch im Detail, das man vielleicht aus der zweiten Reihe noch gut erkennt. Es geht ganz stark um Unterhaltung, und Oper darf und soll und muss auch unterhalten.
Dazu eine Suggestivfrage:
Gibt es Regietheater? Oder ist der Begriff bedeutungslos, weil es eigentlich nur gutes und schlechtes Theater gibt?
Da müssen wir mal über den Begriff reden. Was bedeutet „Regietheater“? Der Begriff ist heutzutage ja unglaublich negativ belastet – erst recht, wenn vom „modernen“ oder gar „deutschen Regietheater“ die Rede ist. Aber eigentlich ist alles Regietheater. Wenn die Regie nicht stattfindet, dann, mal runtergebrochen, kommt der Sänger von links, singt in der Mitte und geht rechts ab …
Das gibt es aber tatsächlich … Kostümtheater.
Das gibt es. Die Frage ist, unterhält mich das? Will ich das sehen?
Erzählt mir das was? Das ist für mich die Frage. Jeder Eingriff in das Material ist schon Regietheater. Wenn man unter Regietheater natürlich versteht, dass man auf Biegen und Brechen jedes Stück neu denken muss und wenn von einem Schiff die Rede ist, dann darf alles vorkommen, nur ja kein Schiff, dann ist das natürlich ein Regietheater, das ich nicht vertrete. Ich bin schon jemand, der gerne eine Welt neu denkt, das ist gar nicht das Thema. Aber ich möchte das Stück, das ich vor mir habe, schon auch erzählen.
Haben wir ohne den Mut zu scheitern nur langweiliges Theater? Und ist Regietheater nicht eigentlich sogar konservativ, wenn es denn den Anspruch hat, die Essenz einer Oper zu erzählen, zu bewahren … wenn auch vielleicht auf unerwartet neue Art und Weise?
Genau. Oder mit neuen Bildern, mit neuen Gedanken dazu. Das finde ich spannend. Und sei es nur, zum Beispiel, dass selbst solche Sänger und Sängerinnen, die schon so viele Produktionen gemacht haben, sagen: „Das ist ja toll, auf
das wäre ich noch überhaupt nicht gekommen.“ Und da sind wir auch schon beim Regietheater. Das sind oft Kleinigkeiten, die Regietheater sind. Ein Beispiel: Der Holländer löst den Südwind aus – ja, macht Sinn. Der Unsterbliche, der Wind und Wetter ausgesetzt ist, löst ihn eigentlich aus. Ich finde es einfach wichtig, Stücke anzupacken und mutig zu sein und etwas zu probieren. Klar, da ist die Gefahr natürlich größer, dass man scheitert, als wenn man den leichten Weg geht. Aber der große Preis könnte sein: Wenn das gut geht, dann haben wir hier eine tolle Show.
Wenn man den vermeintlich einfachen Weg geht, dann ist das Scheitern vorprogrammiert?
Genau: „Wie wir auch jedem versuchen, es recht zu tun, ist niemandem recht getan.“
Elemente des Bühnenbilds erinnern mich stark an Hokusais DiegroßeWellevor Kanagawa, diesen berühmten Holzschnittdruck.
Es ist auch sehr daran angelehnt. Wir wollten ein Naturereignis bereits auf die Bühne stellen und dabei dieses Naturspektakel des Steinbruchs tatsächlich verwenden. Wir wollten es nicht verbauen, sondern wir wollten das Gefühl erreichen, dass es genau so gehört. Da türmen sich also die Wellen auf. Man sieht die Natur. Man sieht die hohe See. Und man hat dieses Daland-Haus, das auf dem Felsen thront, mitten im Wasser. Wir haben die Dinge genommen, die ohnehin schon da waren, und diese verwendet, um etwas daraus zu machen. Da oben noch einen Leuchtturm draufgesetzt … herrlich.
„Ich kann es kaum erwarten!“

Derinternationalgefeierte Verdi-BaritonGeorgeGagnidze singtdieTitelrolleinRichard Wagners Der fliegende Holländer
Sie sind ein weltbekannter Bariton, dessen musikalische Heimat im italienischen Repertoire liegt. Ist dies nun Ihr erster Ausflug ins Wagner-Fach?
Ich empfinde diese Produktion vom FliegendenHolländer zwar als ein Rollendebüt, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht: Ich habe die Titelrolle schon vor fast zwanzig Jahren erstmals gesungen, am Anfang meiner Karriere. Es war eine wunderbare Erfahrung, ich liebte
Wagner sofort und meine Stimme hat sich in diesem Repertoire wohlgefühlt. Doch als ich dann den Ersten Preis beim berühmten Wettbewerb „Voci Verdiane“ in Busseto gewonnen habe, hat sich bei mir alles in Richtung Verdi entwickelt. Seither bin ich hauptsächlich im italienischen Fach gefragt – desto wichtiger ist diese Neuproduktion der Oper im Steinbruch für mich. Endlich kann ich nach so vielen Jahren zu Wagner zurückkehren und ich freue mich außerordentlich, dass es ausgerechnet hier stattfindet, bei diesem wunderbaren Festival. Nach all den großen Partien Verdis, Puccinis und des Verismo in bedeutenden Opernhäusern
schien mir die Zeit gekommen, das deutsche und insbesondere das Wagner-Repertoire tiefer zu erforschen – während ich selbstverständlich weiter meine italienischen Rollen singe. Der Holländer ist dafür perfekt, dieses neue Kapitel zu beginnen.
Warum gerade der Holländer?
DerfliegendeHolländer ist eine frühe Wagner-Oper und als solche eine faszinierende Mischung. Der Aufbau des Werks ist noch sehr klassisch, man kann den Einfluss Webers bei der Ballade deutlich hören, es besitzt eine theatralische Größe, die an die Grand Opéra erinnert. Einige der lyrischen Passagen sind für mich sogar nahe am Belcanto angesiedelt. Die Musik ist also näher an der italienischen Tradition als seine späteren Werke. Es ist immer noch eine Art von Nummernoper, mit klaren Arien und Duetten, also erscheint es wie ein ganz natürlicher Schritt von Verdi aus. Und vergleicht man das Libretto mit den Texten zu TristanundIsolde oder Parsifal , ist auch alles viel klarer. Sogar für Menschen mit Deutsch als Muttersprache können TristanundIsoldeund Parsifal ziemlich schwierig sein, also bietet DerfliegendeHolländerfür jemand aus einem anderen Sprachgebiet den idealen Start.

Ist Deutsch, verglichen mit anderen Sprachen, schwierig zu singen?
Für mich nicht, denn ich habe etliche Jahre in Berlin gelebt und mein Deutsch ist gar nicht schlecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen schwierig sein kann, denen die Sprache völlig fremd ist. Und ich muss schon zugeben, dass Deutsch auf jeden Fall schwieriger zu singen ist als Italienisch, besonders wegen mancher Schroffheiten in Artikulation und Rhythmus.
Gab es einen bestimmten Moment in Ihrem Leben, in dem Sie Wagners Musik entdeckt haben?
Ich kannte natürlich schon einige Wagner-Opern aus meinen Studien am Konservatorium, aber ich würde sagen, dass ich seine Musik wirklich erst vor 20 Jahren richtig entdeckt habe, als ich die Oper Derfliegende Holländerzu studieren begann.
Verdi und Wagner gelten als die beiden prägenden, widerstreitenden Kräfte in der Oper des 19. Jahrhunderts. Finden Sie das auch? Was ist der Unterschied für Sie als Sänger?
Verdi und Wagner sind wirklich sehr unterschiedlich, aber ich würde sie nicht widerstreitende Kräfte nennen. Verdi hat Wagner bewundert und ließ sich von ihm beeinflussen, besonders in seinen späteren Werken wie Don Carlo und Otello. Die musikalische Sprache der beiden Komponisten war sehr verschieden, aber beide waren absolute Genies. Verdi war bislang meine musikalische Heimat. Die Gesangslinie, das Legato im Belcanto – da fühlt sich meine Stimme am wohlsten. Aber viele Dinge, die für Verdi wesent-
lich sind, sind bei Wagner genauso wichtig.
Ist dennoch eine andere Gesangstechnik nötig?
Nein, die Technik bleibt immer dieselbe. Stimmsitz, Legato, Atemkontrolle – diese Elemente sind bei Wagner genauso wichtig. Ich glaube, die gesündeste und auch beste Weise Wagner zu singen ist es, italienische Gesangstechnik anzuwenden. Dennoch muss man genau wissen, wie man dabei auf Deutsch klar artikuliert, es ist unerlässlich, auch alle Konsonanten klar zu gestalten, nicht nur die Vokale. Da ist schon eine gewisse Meisterschaft nötig, all das hinzubekommen, ohne die Legatolinie zu unterbrechen. Zusätzlich braucht es Durchsetzungskraft, einen metallischen Klang, der durch das dick instrumentierte WagnerOrchester dringen kann. Ich kann es kaum erwarten, als Sänger all das anwenden und umsetzen zu können.
Was ist das Schwierigste an Ihrer Rolle – und, soweit man das schon sagen kann, an dieser Produktion?
Die größte Herausforderung ist es, einen intensiven deklamatorischen Gesang über die ganze Oper durchzuhalten, ohne darüber die lyrischen Nuancen zu vernachlässigen. In dieser Produktion wird es durch die Open-Air-Akustik noch schwieriger – zumal das Orchester ganz woanders spielt als in einem traditionellen Opernhaus.
Haben Sie Lieblingsstimmen aus der Vergangenheit, vielleicht sogar Vorbilder? Sind es für Verdi und Wagner unterschiedliche?
Selbstverständlich! Ich habe die großen italienischen Baritone wie
Bastianini, Cappuccilli, Gobbi und Protti immer bewundert. Bei Wagner ist es ein bisschen anders. Obwohl es manche Sänger gab, die sowohl bei Verdi als auch bei Wagner gut waren, haben sich die meisten auf ein Repertoire konzentriert. Einer, der beides großartig singen konnte, war Franz Grundheber – den verehre ich sehr. Für mich ist er einer der größten Rigolettos und ein fantastischer Holländer. Wir haben uns getroffen, als wir beide an der Metropolitan Opera gesungen haben. Während ich jetzt meinen eigenen Holländer vorbereite, bin ich besonders beeindruckt davon, wie klar und ausdrucksvoll er den Text vorgetragen hat. Ich schätze auch Theo Adam für seine wunderbare Interpretation und seine Diktion. Diese großen Sänger waren mir eine Inspiration für meine eigene Deutung.
Was ist das Besondere an der Oper im Steinbruch und an dieser Inszenierung?
Ich trete hier zum ersten Mal auf, mein guter Freund Daniel Serafin hat mich voriges Jahr eingeladen, die Aidamitzuerleben. Es war umwerfend, eine so schöne Produktion an einem dermaßen pittoresken Ort zu erleben. Die Atmosphäre war großartig und ich war überrascht, so viele junge Leute im Publikum zu sehen, das hat mich sehr glücklich gemacht. Daniel Serafin, Katharina Reise und ihr wunderbares Team haben dieses Festival wirklich fantastisch geplant und organisiert, also war ich sofort Feuer und Flamme, als sie mich eingeladen haben, hier die Titelrolle im FliegendenHolländer zu singen. Schon die Proben im Steinbruch allein sind faszinierend, diese Riesenbühne ist enorm beeindruckend. Es ist doch die größte
Naturbühne Europas, wenn ich mich nicht irre? Und es ist einfach ein atemberaubender Ort, gegraben in den Römersteinbruch mit diesen dramatischen Felswänden unter freiem Himmel. Ich finde, dieser Schauplatz ist einfach perfekt für Wagners elementare Themen von Meer und Sturm.
Lieben Sie persönlich das Meer?
Ja, und wie! Kürzlich erst haben wir eine Wohnung in Batumi gekauft, an der georgischen Schwarzmeerküste. Ich versuche, dort so viel Zeit zu verbringen wie möglich.
… Wagners Werke im 19. Jahrhundert die vehementesten Reaktionen von Für und Wider provoziert haben und dass daraus erbitterte ästhetische Grabenkämpfe erwuchsen? Für die einen war etwa ein Werk wie Tristan und Isolde eine unerhörte und unerträgliche Überschreitung aller Grenzen und eine Zumutung. Die anderen hingegen fühlten sich rein durch die Musik in einen unvergleichlichen, ekstatischen Rauschzustand versetzt. Eine solche körperlich aufputschende Wirkung lässt sich heute eher beim Clubbing beobachten, mit Hilfsmitteln oder ohne. Auch wenn das Publikum heute vielleicht nüchterner und abgebrühter reagiert als seinerzeit: Wagners Musik produziert nach wie vor Glückshormone – ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen.
Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?
Ich habe erst spät mit dem Singen begonnen und war bei meiner ersten klassischen Gesangsstunde schon 25. Ich habe nicht viel über Oper gewusst, ich wollte einfach singen. Deshalb hat mir damals auch der Name Richard Wagner nichts gesagt. Mein Gesangslehrer hat mir die Noten zu Elisabeths „Hallenarie“ aus dem Tannhäuser gegeben. Er sagte, ich solle mir das hin und wieder anschauen, aber es habe keine Eile. Eines Tages wirst du seine Musik singen, meinte er. Ein paar Jahre später hatte ich das Gefühl, es sei die richtige Arie, um für die Opernakademie in Oslo vorzusingen – und ich wurde aufgenommen. Meine allererste komplette Wagner-Partie war 2015 die Senta, also kann man wirklich sagen, dass diese Rolle und diese Figur einen besonderen Platz in meinem Herzen und meiner Seele einnimmt.
Was ist für Sie am aufregendsten, schwierigsten und schönsten an der Partie der Senta?
Ich glaube, alle drei dieser Kategorien treffen auf die Duettszene zwischen Senta und dem Holländer im zweiten Akt zu. Für Senta beginnt es im tiefen Register, und unmittelbar vor diesem
Einsatz ist es fast so, als würde auf einmal alles stillstehen. Das kann ein magischer Moment sein, wenn man rein technisch auf das Folgende gut genug vorbereitet ist. Hier gibt es keinen Grund zur Eile und zum Drängen, weil es bald eine dramatische Wendung nimmt, sobald sie zusammen singen. Dieser erste Teil des Duetts mit der großen Kadenz ist für mich aufregend, schwierig und lohnend!
Hatten Sie als Teenager Poster von berühmten (Pop-)Stars in Ihrem Zimmer? Trugen oder tragen Sie einen Funken Senta in Ihrer Persönlichkeit?
Ich glaube, alle Teenager haben ein bisschen etwas von Senta in sich, Burschen und Mädchen. Als junge Menschen träumen und fantasieren wir, und ich persönlich habe enorm für Kurt Cobain geschwärmt, mein Zimmer war voll mit Postern von ihm und von Nirvana, die auch meine Lieblingsband waren. Es war ganz egal, dass Kurt Cobain schon tot war! Ich glaube, er war mein Holländer …
Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?
Ich habe großen Respekt vor Meeren und Ozeanen. Ich kann schwimmen, bin aber nicht besonders gut darin. Wenn ich an den Strand oder in den Pool gehe,

ist mir lieber, wenn meine Füße den Boden berühren können. Und da ich an Submechanophobie leide [an der Angst vor künstlichen Objekten unter Wasser, Anm.], bade ich nie in offenem Gewässer.
Was gefällt Ihnen an diesem FliegendenHolländerim Steinbruch am meisten?
Die Besetzung ist so großartig und es macht mir große Freude, all den anderen Sängern zuzuhören und herauszufinden, wie toll und dabei auch unterschiedlich sie sind. Ich finde wunderbar, dass die Oper im Steinbruch erstmals Wagner spielt, und freue mich darauf, Teil dieses Abenteuers sein zu können!
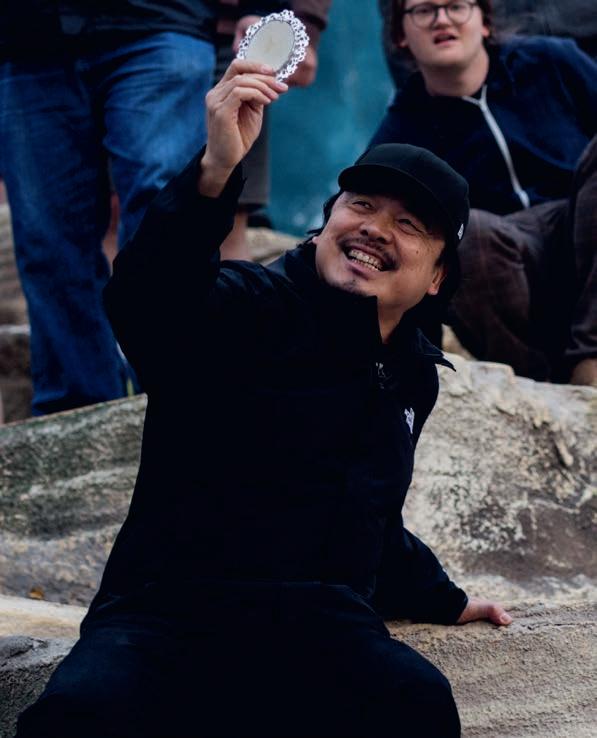
Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?
Mein erstes Wagner-Erlebnis hatte ich als Teenager, durch eine Aufnahme des Rheingold. Der fliegendeHolländer hörte ich ein paar Jahre später. Als Sänger habe ich den Daland bis jetzt in neun Produktionen gesungen und freue mich besonders auf dieses Mal im Steinbruch.
Was ist für Sie die größte musikalische Herausforderung in dieser Oper?
Für Daland ist das Duett mit dem Holländer im ersten Akt absolut am schwierigsten: die tiefen, fast sprechgesangartigen Passagen, die trotzdem Legato klingen müssen. Wagner verlangt hier enorme Kontrolle und Ausdauer.
Sind Sie selbst Vater und wie schätzen Sie Daland in dieser Rolle ein?
Ich bin selbst Vater, und ja, Daland ist einer der schlimmsten OpernVäter! Er verkauft seine Tochter Senta an einen Fremden, nur wegen dessen Reichtums. Das ist so absurd.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?
Ich liebe das Meer! Seine Weite und Kraft passen perfekt zur Stimmung im Fliegenden Holländer, und ein Sturm ist tatsächlich ein beeindruckendes Erlebnis. Seekrank werde ich zum Glück nicht.
Was bedeutet es für Sie, im Steinbruch zu singen?
Die Atmosphäre ist einfach gigantisch! Der Steinbruch als natürliche Bühne gibt der Oper DerfliegendeHolländer etwas Urgewaltiges, das ist ungemein beeindruckend! Ich freue mich sehr auf die Aufführungen!

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?
Eine Wagnerstimme habe ich zum ersten Mal durch meine frühe Liebe zu einer Platte meiner Großeltern gehört: Irische Lieder, gesungen von John McCormack. Ihn zu hören war ein Hauptgrund für mich, ein Interesse für klassischen Gesang zu entwickeln. Meine erste Begegnung mit dem FliegendenHolländer war in meinem ersten Jahr als „Adler Fellow“ in San Francisco, als ich den Steuermann gesungen habe. Als Erik sollte ich dann mein Debüt an der Metropolitan Opera feiern können. In gewisser Weise ist es also die wichtigste Oper meines Lebens.
Was finden Sie musikalisch am herausforderndsten in dieser Oper?
Erik ist als Ganzes die schwierigste Rolle. Er verkörpert die Welt, aus der Senta entkommen will. Eriks Arie im dritten Aufzug werde ich immer herrlich finden, sie ist Wagners Liebesbrief an Bellini!
Glauben Sie, dass Senta sich sofort für den Holländer opfert, weil sonst vielleicht Erik doch noch eine Chance bei ihr hätte?
Ich glaube, der Zauber ist für ihn gebrochen, wenn nach Eriks Arie klar wird, dass sie nicht mehr von dieser Welt ist: Er ist ein Jäger, auf dem Land verwurzelt, und sie hat das Meer gewählt.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?
In meiner Jugend war ich Sportschwimmer und meine Frau und ich haben als Hochzeitsgeschenk von ihrem Chef einen Segelkurs bekommen. In einem großen Sturm war ich noch nie, aber das Wasser habe ich immer geliebt, es gibt mir ein Gefühl von Heimat.
Was bedeutet es für Sie, im Steinbruch zu singen?
Beim FliegendenHolländer mit dabei zu sein, der ersten WagnerProduktion an diesem Ort, umgeben von einer großartigen Besetzung unter der Leitung eines Dirigenten, mit dem ich arbeiten wollte, und eines hervorragenden Regisseurs, ist alles, was man sich als Sänger nur wünschen kann.

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Wagner?
Ich bin in Bukarest geboren und aufgewachsen, das Opernhaus dort wurde vom italienischen Repertoire und von Mozart dominiert. Die erste Wagneroper habe ich in Wien miterlebt, als ErasmusStudentin. Ich war oft auf dem Stehplatz in der Staatsoper, sogar mehrmals pro Woche. Und diese erste Wagneroper war tatsächlich DerfliegendeHolländer – dirigiert von Seiji Ozawa und mit Nina Stemme als Senta und, wenn die Erinnerung nicht trügt, Franz Grundheber in der Titelrolle. Nur drei Jahre später habe ich mein eigenes Wagnerdebüt an der Wiener Staatsoper als Teil des fixen Ensembles gegeben, ich habe eines der Blumenmädchen in Parsifal gesungen.
Was ist für Sie am aufregendsten, schwierigsten und schönsten an der Partie der Mary?
Eine zentrale Herausforderung ist die rhythmische Präzision in den
schnellen Passagen mit dem Chor. Durch den physischen Abstand, die Inszenierung und die Übertragung des Dirigenten per Video besteht die Gefahr, dass Orchester und Singstimmen zueinander leicht verschoben erklingen. Das macht das eigene Zeitgefühl enorm wichtig – und womöglich muss man sogar einen Sekundenbruchteil früher dran sein. Mary ist eine Charakterrolle ohne große Arie, sie hat kurze, prägnante Phrasen, der Ausdruck muss also sofort da sein, durch Stimmfarbe und Vortrag. Was ich an dieser Partie besonders mag, ist die natürliche, zwischen Rezitativ und Cantabile angesiedelte Schreibweise in der mittleren Lage. Das wirkt sehr organisch.
Mary ist ein bodenständiges Gegenstück zu Senta. Welche der beiden Figuren entspricht eher Ihrer eigenen Persönlichkeit?
Ich glaube ohne Übertreibung sagen zu können, dass ich beides in mir habe, je nachdem: Ich kann sehr analytisch sein, Ordnung und Klarheit genießen – und gleich-
zeitig in der Welt von Eingebung und Gefühl leben, meine romantische Ader pflegen und zu impulsiven Reaktionen neigen. Welche Seite gerade die Überhand hat, ist eine Frage des Moments.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Wasser und Meer?
Ich liebe das Meer, ich könnte es ewig anschauen. Aber ich bin keine gute Schwimmerin, eher eine, die sich über Wasser halten kann. In meiner Jugend habe ich in einem See eine erschreckende Erfahrung gemacht, seitdem habe ich Angst vor dem Untergehen. Aber solange ich an der Oberfläche bleiben kann, ist alles in Ordnung. Vor einigen Jahren habe ich eine wunderbare Kreuzfahrt auf der MS Europa gemacht, die von Singapur nach Hongkong geführt hat. Drei Wochen lang sahen wir atemberaubende Landschaften, unberührte Strände, malerische Dörfer, goldene Sonnenuntergänge: großartige Erinnerungen. Einmal wurde ich seekrank, merkwürdigerweise bei langsamem, aber tiefem Wellengang. Ein Anfängerfehler, Wasser zu trinken! Später bekam ich den guten Rat, an Deck zu gehen und den Blick auf den Horizont zu richten – das hat Wunder gewirkt.
Was gefällt Ihnen beim FliegendenHolländerim Steinbruch am besten?
Mich bewegt die unglaubliche Freundlichkeit und Harmonie, die im ganzen Team herrscht. Eine so herzliche Atmosphäre ist alles andere als selbstverständlich. Wunderbare Leute in einem wunderschönen Ambiente – ich habe keinen Zweifel, dass das Resultat atemberaubend sein wird.
Hier geht es zu den Biografien des Casts operimsteinbruch.at/besetzung


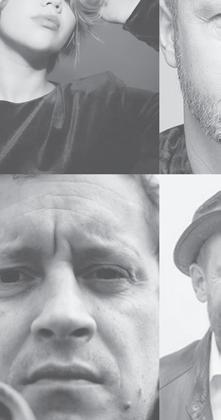
Hier geht es zu den Biografien des Leading Teams operimsteinbruch.at/leading-team













Reihe 1
VON LINKS NACH RECHTS
AJ Glueckert, Erik
Brian Michael Moore,
Der Steuermann Dalands
Dominick Valdés Chenes, Erik
Elisabeth Teige, Senta
George Gagnidze, Der Holländer
James Rutherford, Der Holländer
Jens-Erik Aasbø, Daland
Jinxu Xiahou,
Der Steuermann Dalands
Johanna Will, Senta
Johanni van Oostrum, Senta
Reihe 2
VON LINKS NACH RECHTS
Liang Li, Daland
Lora Grigorieva, Mary
Nenad Čiča, Erik
Roxana Constantinescu, Mary
Tommi Hakala, Der Holländer
Elisabeth Hess, Kostümassistenz
Eva Dessecker, Kostüme
Evelyn Unbescheiden,
Regieassistenz
Quentin Hindley, Musikalischer
AssistentundDirigent
Momme Hinrichs, Bühnenbild
Reihe 3
VON LINKS NACH RECHTS
Patrick Lange, Musikalische Leitung
Paul Grilj, Lichtdesign
Philipp M. Krenn, Inszenierung
Philomena Strack, Bühnenbildassistenz
Ran Arthur Braun, Live Action
Director
Roland Horvath, Video
Sebastian Kranner, Regieassistenz
Volker Werner, Sounddesign
Walter Zeh, Chorleitung
Florian Pilz, Regieassistenz








Reihe 1
VON LINKS NACH RECHTS
Emilie Haidler, Schneiderei
Hanja Rothenthal, Schneiderei
Anna Vardanyan, Maske
Tatijana Drodomirov, Maske
Anna Domashovets, Maske
Jessica Graf, Maske
Reihe 2
VON LINKS NACH RECHTS
Carmen Uhlir, Schneiderei
Julia Lirsch, Schneiderei
Julia Buxbaum, Maske
Carmen Postl, Schneiderei
Doris Lackner-Schatek, Leiterin
Schneiderei
Nicole Brunner, Maske
Monika Lackner, Schneiderei
Rebecca Trink, Maske
Zsigmond Fodor, Requisite& Produktionsfahrer
Reihe 3
VON LINKS NACH RECHTS
Birgit Strobl, Maske
Regina Tichy, Chefmaskenbildnerin
Annika Weber, Schneiderei
David Schuch, Schneiderei
Lena Meyer, Schneiderei
Benedikt Schatek, Schneiderei
Barbara Wayan, Kulturmarketing
Zoltan Hamori, Kulturmarketing
Reihe 4
VON LINKS NACH RECHTS
Ullrike Zeger, Opernlounge, Events & Team-Assistenz
Günther Kittler, Künstlerische Produktionsleitung& Künstlerisches Betriebsbüro
Marina Krispl, Kulturmarketing
Rico Gulda, Generalintendant
Reihe 5
VON LINKS NACH RECHTS
Murat Cetin, Bühnentechnik
Attila Galács, Inspizient
Katharina Reise, Geschäftsführung & Künstlerische Betriebsdirektion
René Bein, Inspizienz
Niklas Gasselseder, Künstlerisches Betriebsbüro&LeitungStatisterie
Herbert Herl, TechnischeLeitung
Máté Varga, Bühnentechnik & Produktionsfahrer
Nicht auf dem Bild:
Edi Edelhofer, TechnischeLeitung
Dietmar Posteiner, Geschäftsführung
Daniel Serafin, Intendant
Patrícia Farkas-Toth, Kulturmarketing


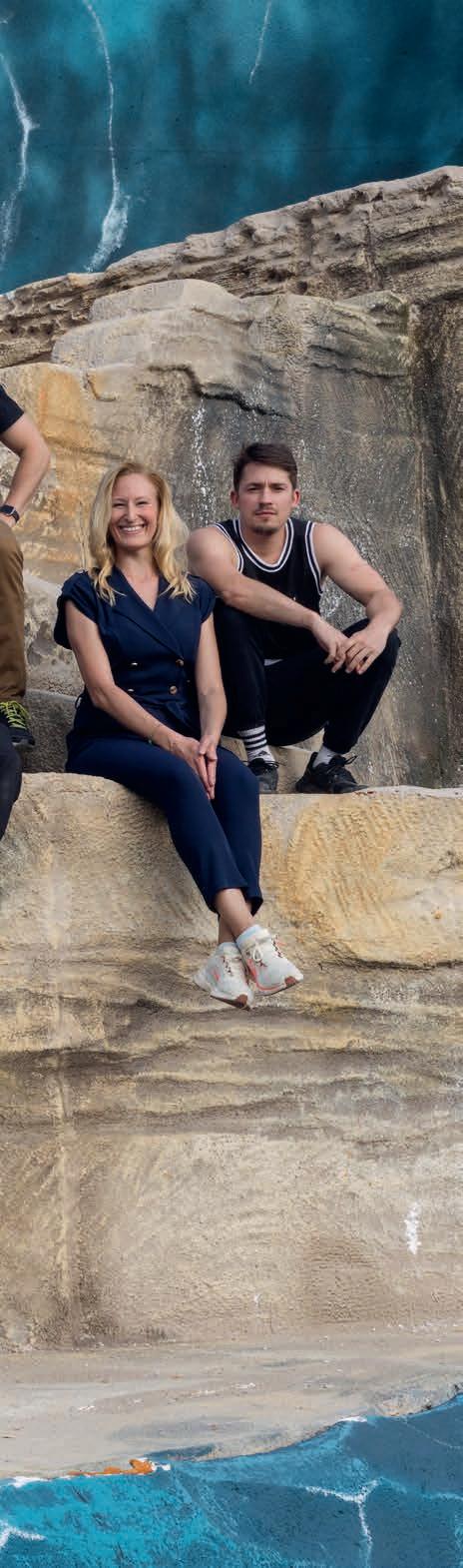
Reihe 1
VON LINKS NACH RECHTS
Antoni Niechciat, Stunt
Frederic Matona, Stunt & Kameramann
Julien Loeb, Stunt
Michael Stark, Statist
Davide Bertorello, Rigger& Kameramann
Reihe 2
VON LINKS NACH RECHTS
Daniel Flassak, Statist
Marie Schmitz, Stunt
Silvia Vena, Stunt
Vitor Dias De Paiva, Rigger& Kameramann
Jasmin Varga, Statistin
Quentin Mesquich, Stunt
Reihe 3
VON LINKS NACH RECHTS
Stefan Laner, Statist
Noémi Kovács, Statistin
Viktoria Becker, Statistin
Dario Scaturro, Statist
Théo Foucher, Stunt
Die wichtigste Information lässt nicht lange auf sich warten: „Wir sind ja heuer wieder auf der Bühne.“
Unüberhörbar groß ist die Freude. Walter Zeh spricht meist von „wir“. Selbstredend. Nächstes Jahr wird der von ihm gegründete und geleitete Philharmonia Chor Wien sein 20-jähriges Bestehen feiern. Unzählige Produktionen hat der Chor bereits miterlebt und bereichert. Auch in St. Margarethen.
Begonnen hat die Zusammenarbeit mit dem Festival im Jahr 2015 bei Robert Dornhelms Tosca-Inszenierung. Seither singt der Philharmonia Chor Wien praktisch jedes Jahr im Steinbruch. Meist hinter der Bühne, im „Orchesterhaus“, wie es Walter Zeh nennt. „Das ist praktisch. Man kann sich hundertprozentig auf das Musikalische konzentrieren, aber trotzdem ist man nicht beteiligt, da man nicht auf der Bühne ist. Gott sei Dank sind wir heuer wieder einmal auf der Bühne und szenisch eingebunden.“ 24 Damen und 40 Herren. Auch bei Giuseppe Verdis Rigoletto im Sommer 2017 agierte der Chor sichtbar auf der Bühne. Wobei Walter Zeh anfangs der Sache eher skeptisch gegenübergestanden ist. „Wie man mir das erste Mal gesagt hat, dass der Chor auf der Bühne sein würde und wir Mikroports bekämen, habe ich mir zunächst gedacht, das funktioniert beim Chor
nicht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es funktioniert! Solange es eine gute Tontechnik gibt, vor allem einen guten Toningenieur, der das auffängt, regelt und den Chor wirklich in der Balance hält.“
Der Probenaufwand ist freilich höher. Auch um diverse Fragen abzuklären. Von wo tritt der Chor auf? Wie müssen die Leute gestellt werden, damit eine gute Balance da ist? „Die Damen sollten beisammen stehen und die Herren sollten beisammen stehen. Das ist die Aufgabe bei den Bühnenproben, die jetzt natürlich mehr sind. Aber es ist viel, viel besser“, betont Chorleiter Walter Zeh. Und auch adäquater. Denn bei der Aidaim Vorjahr waren während der großartigen Herrenchöre weibliche Statisten auf der Bühne: „Das passt ja nicht zusammen.“ Walter Zeh sei immer wieder auch mit der Frage konfrontiert gewesen, ob die Musik nicht vielleicht bloß vom Band käme. Derlei Diskussionen müssen er und das künstlerische Betriebsbüro dieses Jahr nicht führen.
Die Oper DerfliegendeHolländer kennt Walter Zeh in- und auswendig. „In meiner Tätigkeit an der Wiener Staatsoper habe ich das Stück auf der Bühne im Chor oft gesungen, aber einstudiert habe ich es noch nie. Von der Warte aus gesehen ist das eine Premiere.“ Über 30 Jahre war Walter
Zeh im Staatsopernchor, hat dort auch viele Soli gesungen. Nach seiner Pensionierung von der Staatsoper hat Gerard Mortier ihn im Jahr 2002 eingeladen, für die erste Ruhrtriennale einen Chor zu formieren und einzustudieren. Der prestigeträchtige Anfang. „So hat praktisch 14 Tage nach meiner Pensionierung meine nächste Karriere begonnen“, erinnert sich Walter Zeh. Über Mortiers Tod im Jahr 2014 hinaus führt der Chor den bedeutenden Intendanten als Ehrenmitglied.
Der Name des Ensembles wechselte zunächst projektweise – von Produktion zu Produktion, von Festival zu Festival: Chor der Ruhrtriennale, Festspielchor BadenBaden. 2006 wurde schließlich der Name „Philharmonia Chor Wien“ ins Vereinsregister eingetragen. Der international tätige professionelle Opern- und Konzertchor ist aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Ob Salzburger Festspiele, Osterfestspiele BadenBaden, Ravenna-Festival oder St. Margarethen: Das Repertoire ist breitgefächert und schließt auch Uraufführungen mit ein.
Geprobt wird im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in der Lindengasse. „Wenn wir mehr als 60 Personen sind, dann dürfen wir zum Proben in die Kirche.“ Das Alter der Chormitglieder reicht von

20 bis 60. „Otto Schenk und Jean-Pierre Ponnelle haben immer gesagt, im täglichen Leben gibt es ja auch junge, mittelalterliche und alte Menschen. Also, warum sollen auf der Bühne jetzt nur Junge sein? Das habe ich mitgenommen.“ Auf die Frage, ob ihm das Chorsingen denn nicht abgehe, kommt nach kurzem Zögern ein „Jein.“ Opernaufführungen besucht er ohne Wehmut. Zeh ist auch als Gesangspädagoge und Sprachcoach tätig. Bei den Proben singt er viel vor. Dass er immer noch eine gesunde Stimme hat, erfüllt ihn mit Stolz. Er steht nun eben auf der anderen Seite und betreut seinen Chor. Mit großem Erfolg. Die Fluktuation, die es ab und an beim Philharmonia Chor Wien gibt, sieht Walter Zeh im Grunde positiv. „Eigentlich ist es doch ein gutes Zeichen, wenn wir Mitglieder an den Staatsopernchor oder an den Volksopernchor verlieren.“
Wie lautet sein Erfolgsrezept? „Das Geheimnis ist wahrscheinlich meine Erfahrung als aktiver Chorsänger. Ich hatte damals einen der besten Chorleiter als Vorbild gehabt, Norbert Balatsch (1928–2020). Er war legendär, ist auch in Bayreuth tätig gewesen. Er war so wie ich
auch Bariton und hat ebenfalls im Chor gesungen. Das ist eine Erfahrung, die man einfach nicht auf der Universität lernen kann. Die erarbeitet man sich.“ Dazu kommt noch eine zweite Komponente: „Ich habe immer zu den Leuten gesagt, dass wir musikalisch perfekt studiert und diszipliniert sein müssen. Das ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und es muss – egal in welcher Sprache wir singen – textdeutlich sein. Das Publikum hat ein Recht darauf, den Text zu verstehen. Das Singen wird auch viel leichter und angenehmer, wenn man deutlich spricht.“
Diese Punkte gelten für Veranstaltungen drinnen wie draußen gleichermaßen. „Bei Freiluftaufführungen kommt natürlich die Atmosphäre hinzu. Aber rein musikalisch und rein technisch gibt es eigentlich nur einen Unterschied: Wenn man in einem geschlossenen Raum singt, bekommt man ein Echo oder Hall zurück. Das kommt im Freien nur über die Lautsprecher. Man muss sich darauf einstellen.“
Dieses Umgewöhnen passiere problemlos, erklärt Walter Zeh gelassen, „ab der ersten Probe mit Mikroports.“
Bei Richard Wagners Derfliegende Holländerliegen die Herausforderungen in den vielen bekannten Melodien, allen voran „Steuermann, lass die Wacht“: Präzision, Kraft und Klangschönheit sollen optimal zusammenwirken. „Man muss vor allem im Rhythmus bleiben und darf nicht fortissimo brüllen. Trotz der Lautstärke muss man kultiviert singen und dabei bleiben. Das ist die Herausforderung. Von der ersten Probe bis zur letzten Vorstellung. Ja nicht forcieren! Es muss forte gesungen, darf aber nicht übersteuert werden. Ich sage immer zu den Leuten, ihr müsst mit 90 Prozent maximal singen und das Gefühl haben, ihr könntet jetzt noch 10 oder 15 Prozent mehr geben. Dann ist es richtig. Wenn ich ständig am Limit singe, ist es nicht mehr schön. Es muss trotz Fortissimo oder dreifachem Forte kultiviert bleiben. Auf der anderen Seite muss ein Pianissimo auch wirklich ein Pianissimo sein, so dass das Publikum das Gefühl hat, singen die noch, oder ist da nix mehr? Genau das erzeugt Spannung. Und wir brauchen Spannung.“


Der fliegende Holländer wie ein Fantasyfilm funktioniert? Richard Wagner hat letztlich an einer Art von Kunstwerk gearbeitet, das mehr mit dem modernen Kino zu tun hat als mit der Oper vor ihm. Im Festspielhaus Bayreuth, das er für seine Oper Der Ring des Nibelungen errichten ließ, ist das Orchester durch einen Schalldeckel unsichtbar, die Musik wird zu einer Art Soundtrack und verbindet sich dadurch unmittelbar mit der Darstellung der Sängerinnern und Sänger. Es gibt keinen Zwischenapplaus mehr, die Arien, Duette, Szenen und Chöre lösen sich auf in groß angelegten Akten mit einer realistisch anmutenden, durchlaufenden Aktion. Fehlt nur noch Popcorn …

… die klassische große HollywoodFilmmusik letztlich auf Richard Wagners Leitmotivtechnik fußt? Die unmerkliche Zuordnung von Personen, Situationen und Gefühlen zu musikalischen Motiven, die im Laufe der Handlung wörtlich oder verwandelt wiederkehren, ging in den allgemeinen musikalischen Gebrauch und von dort in die Kunst des Soundtracks über, wurde dort etabliert und gepflegt von Komponisten wie seinerzeit Erich Wolfgang Korngold und später, nebst vielen anderen, auch Jerry Goldsmith, John Williams, Henry Mancini sowie Howard Shore (The Lord of the Rings, The Hobbit).














Der Kogelberg von St. Margarethen gilt unter Kennern als einer der eindrucksvollsten Orte im Osten Österreichs. Vor Millionen von Jahren aus dem Sand und Kalk des pannonischen Meeres entstanden, liegt er an der Schwelle von Ost und West. Er trennt und verbindet die pannonisch-ungarische Tiefebene und den Beginn der Alpenketten.
Hier erlebt man ursprüngliche Natur in vielen Formen, von Menschen geschaffene Räume und zahlreiche kulturelle Stätten, die Zeugnis geben von der intensiven Beschäftigung des Menschen mit diesem Ort, vor allem im 20. Jahrhundert.
PIEDRA steht für „Stein“, genauer für Kalksandstein, und Stein ist auch das große Erlebnis, das den Besucher beim Abstieg in den Bruch erwartet. Das grafische Symbol von Piedra stilisiert die Skulptur Joie (DieFreude)von Pierre Székely aus dem Jahr 1962. Sie steht über der kleineren Ruffinibühne. Der ungarisch-französische Bildhauer Székely sieht Joieauch als einen lebensfreudigen Himmelswagen.
Im traditionsreichsten Weinbaugebiet des Burgenlandes, eingebettet in die weite, offene Landschaft zwischen Leithagebirge und Steppensee, überrascht die natürliche Schönheit des Ruster Hügellandes den Besucher der Region Fertő – Neusiedler See. Nicht umsonst hat die UNESCO die Region zum Welterbe erklärt.
Der Steinbruch in der Welterbe-Region
Das Ruster Hügelland ist eine Kette kleiner, flacher Hügel, die sich von Ungarn bis ins Gebiet etwas nördlich von Oggau erstrecken. Dieser Hügelzug lag vor 14 Millionen Jahren noch am Grunde eines Meeres, dessen Küste bis ins Wiener Becken reichte. Der Kalksandstein von St. Margarethen ist durch Lagunenablagerungen wie Muscheln und Korallen geprägt. Schon die Römer kannten die hervorragenden Eigenschaften dieses Materials. Vor 2.000 Jahren wurde damit die bedeutende Grenzstadt Carnuntum erbaut, in deren Mauern Marc Aurel, der letzte große Kaiser des Imperiums, seine philosophischen Selbstbetrachtungen schrieb. Der Steinbruch überlebte den Wandel der Geschichte bei ungebrochener Wertschätzung. Noch heute wird von der sogenannten „Stephanswand“ der Sandstein für Restaurierungen an der Wiener Kathedrale gewonnen. Zu den architektonischen Leistungen, die ihre Existenz dem Werkstein aus dem Steinbruch verdanken, zählen viele Wiener Bauwerke, vor allem die Prunkbauten an der Ringstraße.
Durchwandert man das umliegende Gebiet mit seinen alten Weingärten und Hutweiden, trifft man auf botanische Schätze und eine


einzigartige Tierwelt. Das Ziesel, der Uhu und die Gottesanbeterin finden sich hier ebenso wie der Frühlingsadonis und die Zwergschwertlilie. Die beeindruckende Fernsicht hin zum Schneeberg und über den großen Steppensee
bis weit nach Ungarn lohnt den Aufstieg. Der Kogelberg PIEDRA bietet neben der einzigartigen Landschaft intensive Begegnungen mit Kunst und Kultur.
Einer der großen Visionäre von PIEDRA war der Bildhauer Karl Prantl. Der gebürtige Burgenländer studierte Malerei in Wien und wandte sich später der Bildhauerei zu, der Leidenschaft seines Lebens. Sein erstes Atelier hatte er in der Orangerie im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt. Ab 1958 arbeitete er im Steinbruch von St. Margarethen, wo er die Eigengesetzlichkeiten der Arbeit in freier Landschaft entdeckte, im Gegensatz zur Atelierarbeit. Dieses mit harter handwerklicher Arbeit verbundene Wirken gewann für sein weiteres Schaffen zentrale Bedeutung, Form und Ausdruck seines Gesamtwerkes wurden hier geprägt. Die neue Erfahrung ließ die Idee wachsen, diese Arbeitsform mit Künstlerkollegen zu teilen.
1959 initiierte er gemeinsam mit Friedrich Czagan und Heinrich Deutsch das erste „Symposion europäischer Bildhauer“, bei dem im Steinbruch Jahr für Jahr über drei Monate gemeinsam gelebt und gearbeitet wurde. Bis 1977 hinterließen 110 internationale Künstler im Steinbruch St. Margarethen mit mehr als 150 großteils monumentalen Sandsteinskulpturen einen bleibenden künstlerischen Eindruck. Viele wurden in der Folge auf den Kogel gebracht, wo sie im Gelände besichtigt werden können. Rund 60 Kunstwerke befinden sich noch an den Orten ihrer Entstehung. Einige davon zählen heute zu den Ikonen der sogenannten „Land-Art“. Das Symposion wurde zum Vorbild für unzählige andere Symposien in Europa und weltweit.
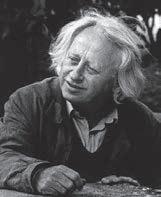
Gustav Hummel, zum Zeitpunkt der Symposionsgründung
Betreiber der Steinabbruchfirma, unterstützte das Symposion mit Material, Transport und der Mithilfe seiner Steinmetze. Von 1962 bis 1967 wurde die Ruine einer alten Kantine nach Plänen von Johann Georg Gsteu zu einer mönchischen Bildhauerunterkunft ausgebaut. Da sich in Sichtweite auch bemerkenswerte Pavillonbauten der Architekten Roland Rainer und Karl Schwanzer befinden, ist das Ensemble heute eine Pilgerstätte für Architektur-, Kunst- und Naturliebhaber.
Zusammen mit dem einzigartigen Panorama an diesem Platz, wo der Blick von Eisenstadt über das Leithagebirge und den Neusiedler See bis nach Rust und hinein in die pannonische Tiefebene Ungarns gleitet, entstand so ein wahrlich magischer Kulturort.
„An uns Bildhauer selber gedacht ist es so, dass wir durch die Erfahrungen von St. Margarethen, durch dieses Hinausgehen in den Freiraum – in den Steinbruch, auf die Wiesen – wieder frei wurden. Um dieses Freiwerden oder Freidenken in einem ganz weiten Sinn ging es. Für uns Bildhauer ist der Stein das Mittel, um zu diesem Freidenken zu kommen – zum Freiwerden von vielen Zwängen, Engen und Tabus.“
Karl Prantl, 1959


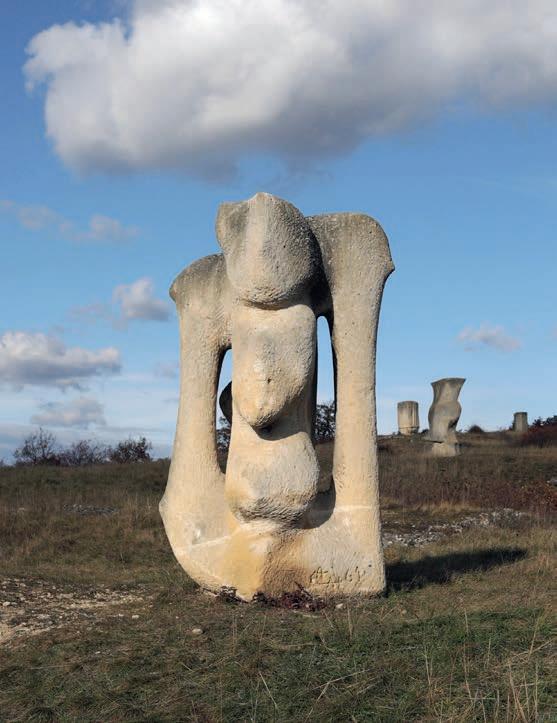



Die Herrschaft Eisenstadt und damit auch der Steinbruch bei St. Margarethen kamen im 17. Jahrhundert in den Besitz der Familie Esterházy. Zwei Weltkriege und eine russische Besatzung später ist die Familie wiederum verantwortlich für die pflegliche Bewirtschaftung und die Erhaltung des kulturellen Erbes. Die großartige Felsenbühne PIEDRA stellt in jeder Hinsicht eine ganz besondere Herausforderung dar. In den späten Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts erkannte Harald Serafin, Intendant der Operette in Mörbisch, als Erster die Möglichkeit, im Steinbruch große Oper zu spielen. Ein Unternehmer aus der Gegend griff die Idee auf und machte die Oper und den Standort weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt.
Der Steinbruch in St. Margarethen ist eine der schönsten und imposantesten Freiluft-Arenen Europas und seit 1996 Schauplatz von Opernaufführungen. Unter der Privatstiftung Esterhazy als Eigentümerin erfuhr diese Location im Jahr 2006 einen umfassenden Ausbau. Die junge, internationale Architektengruppe AWG aus Wien hat es dabei mit Feingefühl verstanden,
dem sensiblen Raum eine sehr spannende Architektur zu geben –einem Raum, der jahrhundertelang eigentlich industrielles Gelände gewesen war. Die Architekten verwendeten dabei Kortenstahl als zentrales Baumaterial, eine Referenz an die lange industrielle Geschichte dieses Ortes.
Der Steinbruch St. Margarethen enthält zwei in Stein gehauene Arenen: die große Bühne mit 7.000 m2, ein riesiger Konzertsaal unter freiem Himmel mit fast 5.000 Zuschauerplätzen, und die kleinere Ruffinibühne mit bis zu 2.200 Plätzen. Seit mehr als 20 Jahren wird nun schon auf der Hauptbühne große Oper dargeboten. Keine andere Freiluftbühne dieses gewaltigen Ausmaßes weltweit versetzt die kulturelle Hochform der Oper in ein solch spannungsgeladenes Verhältnis zum Kreatürlichen, zum Ursprung unseres Seins. Die Opernaufführungen im Steinbruch vereinen Natürliches mit der hohen Kultur, also mit vom Menschen Geschaffenem. So wird auch in den Opern ein Widerhall des Steinbruchs und seiner Geschichte spürbar: Hier wurde gearbeitet, Rohmaterial für große Bauwerke gewonnen. Mensch und Natur waren manchmal im Gegensatz, dann wieder im Einklang mitein-
ander. Wir sehen das Ergebnis: ein respektvolles Geben und Nehmen, in dem der Mensch sich seiner Natur in Demut und Dankbarkeit nähert. Die Opernarena PIEDRA ist heute Anziehungspunkt für ein begeisterungsfähiges Publikum ebenso wie für internationale Opernstars und Musikergrößen.






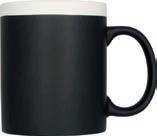


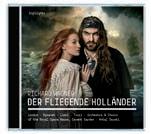
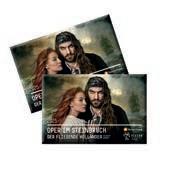









Foyerpark
Im großzügig angelegten Foyerpark werden internationale Spezialitäten und regionale Schmankerln gereicht. Das kulinarische Angebot wird für jede Inszenierung neu angepasst und bietet allen Gästen eine große Vielfalt.
Genießen Sie kulinarische Gaumenfreuden als kleine Snacks und warme Speisen sowie süße
Köstlichkeiten zum Kaffee. Verkosten Sie Spezialitäten der Region, wie Weine vom Weingut Esterházy oder Produkte von PANNATURA am Esterházy Spezialitätenstand.
Winzergemeinschaft
„die st. margarethener“ Acht Winzer:innen aus St. Margarethen im Burgenland sind verbunden durch die
Leidenschaft für Wein und das Streben nach Qualität. Geschmack erleben, Tradition erhalten und mit allen Sinnen genießen – dafür steht die Winzergemeinschaft „die st. margarethener". Für jede Spielsaison der Oper im Steinbruch keltern „die st. margarethener“ einen Opernwein, der exklusiv im Steinbruch und bei den Weingütern vor Ort angeboten wird.
1–4 Buffet Delikate Snacks Gefüllte Weckerln | Antipasti
1 Fidelio Süßer Genuss Eis | Kuchen
2 Aida Würstel von PANNATURA
Sacher Würstel | Käsekrainer | Bratwurst | Kuchen

3 Nabucco
Gruß aus der Opernlounge Rinderbrust | Erdäpfel-Mousseline | Lauch-Speck Bunte Karfiol Trilogie | Erbsensprossen Kaiserschmarrn | Zwetschkenröster
4 Rigoletto Würstel von PANNATURA Sacher Würstel | Käsekrainer | Bratwurst | Kuchen
5 Pagode Esterházy Spezialitäten und Weingut Esterházy PANNATURA Wildvariation | getrocknete Tomaten | Balsamico Zwiebel | Oliven | Bio Pannonier | Käsevariation Marillenlekvar mit Chili | Oliven | Walnüsse Weintrauben | Bio Pannonier
6 Pagode Zum Anstoßen
Sekt | Aperol | Quinquin
7 Pagode Espressomobil
8 Hänger Versorgungsstation für die Pause
9 Koje Winzergemeinschaft „die St. Margarethener“

Die Opernlounge im Steinbruch St. Margarethen verwandelt Ihren Opernabend in ein Erlebnis für alle Sinne! Die einladende Panoramaterrasse bietet eine stilvolle Bühne für repräsentative Events mit Freundinnen und Freunden, Familie oder Geschäftspartnerinnen und -partnern, ungestörte Empfänge oder private Jubiläen. Egal, ob als Paar, in einer kleinen Gruppe oder für Gesellschaften mit bis zu 180 Personen: Unser Küchenchef komponiert für Sie kulinarische Genüsse für jeden Geschmack.
Starten Sie Ihren Opernabend um 18:30 Uhr und genießen Sie von Ihrem Platz aus einen einmaligen Blick über den Steinbruch und die spektakuläre Freiluftbühne! Bis zum Beginn der Oper verwöhnen wir Sie mit einem Gruß aus der Küche sowie Vor- und Hauptspeisen gepaart mit erlesenen Getränken. Das „Flying Dinner“ kommt dabei direkt an Ihren Tisch.
In der Pause servieren wir Ihnen unsere köstlichen Desserts –natürlich mit exklusiven Weinen aus dem Hause Esterházy sowie Kaffee und Tee. Gestärkt können Sie den zweiten Teil der Aufführung in aller Ruhe genießen. Lassen Sie im Anschluss an die Opernaufführung den Abend gemütlich mit Getränken ausklingen, bevor Sie die Heimreise antreten: Unsere „Open Bar“ ist noch eine halbe Stunde nach Vorstellungsende für Sie geöffnet.
Kuvert
Knäckebröd
SKANDINAVIEN
Bio Pannonier | Knäckebrot
Süßkartoffel-Aufstrich | Olivenöl
Gruß aus der Küche
Quiche aux épinards
FRANKREICH
Mini-Quiche | Spinat | Kräuterdip
Vorspeisen
Gravlax
NORWEGEN
Gebeizter Lachs | Frischkäse Jungzwiebel-Asche | Kren
Meersalzkräcker
Bitterballen
HOLLAND
Frittierte Schweinefleischbällchen
Jungspinat | Senf-MayonnaiseDressing | getrocknete Tomatenflocken
Hühnerbrust pochiert
FRANKREICH
Pochierte Hühnerbrust
Knollensellerie | Mandarine
Creme fraiche | Friseé
Sienisalaatti
FINNLAND | VEGAN
Pilzsalat | Schnittlauch
Radieschen | Zitronenöl | Brotchip

Hauptspeisen
Skomakarlada
SCHWEDEN
Sous Vide Rinderbrust | ErdäpfelMousseline | Lauch-Speck Traubenreduktion
Hachee
HOLLAND
Hühnereintopf | Rotkrautspätzle Apfel „Elstar“ | Nelke | Rahm
Truite
FRANKREICH/FINNLAND
Forelle | Dill-Gurken| Sauce Remoulade | geschmorte Zwiebel
Chou-fleur Triologie
FRANKREICH | VEGAN
Bunte Karfiol Triologie fermentierter Pfeffer | Erbsensprossen
Dessert Vispipuuro
FINNLAND
Schaumiger Beerengrieß
Preiselbeere | Krokant | Atsina Kresse
Skolebrød
NORWEGEN
Hefeteiggebäck getoppt mit Vanillecreme | Zimtzucker | Kokos
Bossche Bollen
HOLLAND
Profiteroles | Mandel | Minze

Getränke
Aperitif
Quinquin Esterhazy – Frizzante
Alkoholfreier Holländer-Cocktail
Wein
WEINGUT ESTERHÁZY
2023 Blanche Leithaberg DAC | Bio
2022 Rouge
Bier
GOLSER BRAUEREI
Golser Bio Pils
Golser Bio Nullerl alkoholfrei
Alkoholfreie Getränke
Mineralwasser still | prickelnd
Rauch Fairtrade Orangensaft
Rauch Bio Apfelsaft
Kaffee & Tee (serviert mit Dessert)
Nach der Oper
30 MIN. OPEN BAR
Exkl. Kaffee | Holländer-Cocktail










Generalintendant
Rico Gulda
Intendant
Daniel Serafin
Geschäftsführung
Dietmar Posteiner
Geschäftsführung & Künstlerische Betriebsdirektion
Katharina Reise
Künstlerisches Betriebsbüro
Niklas Gasselseder
Günther Kittler
Opernlounge, Events & Team-Assistenz
Ullrike Zeger
Leitung Kommunikation
Barbara Wagner-Gmeiner
Leitung PR & Social Media
Leonara Skala
PR & Social Media
Katalin Kovacsics
Stefan Millendorfer
Jana Schmidt
Leitung Kulturmarketing
Marina Krispl
Kulturmarketing
Zoltan Hamori
Patrícia Farkas-Toth
Barbara Wayan
Leitung Web/ Kampagnenmanagement
Alin Sav
Web/Kampagnenmanagement
Daniel Aufner
Zsófia Balint
Ewald Bechtloff
Leitung Grafik
Ivo Lubar
Grafik
Lisa Schulcz
Leitung Ticketbüro
David Jacubetz
Ticketbüro
Sanela Ajkunic
Nicole Haschberger
Corinna Scheuhammer
Julia Schwarz
Claudia Unger
Ticketbüro pan.event pan.event GmbH
Tel +43 2682 65 0 65
Fax +43 2682 65 0 65 888
tickets@panevent.at
Esterhazyplatz 4
7000 Eisenstadt www.operimsteinbruch.at
WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… bis heute diskutiert wird, ob Wagners musikalische Werke auch von jenem Antisemitismus geprägt sind, den er in seinem abscheulichen Pamphlet "Das Judenthum in der Musik" vertreten hat? Dabei ist die Frage entweder unbeantwortbar oder überhaupt irrelevant: Das Kunstwerk steht für sich selbst und besagt das, was es als „Maschine zur Erzeugung von Interpretationen“, wie Umberto Eco es definiert hat, als Inhalt auswirft. Das unterliegt aber unserer Deutung. Wagners Antisemitismus greift unselige Zeitströmungen auf und verquickt sie mit einer erheblichen persönlichen Schwäche: Wagner wurde früh von jüdischen Kollegen gefördert, etwa von Giacomo Meyerbeer oder Felix Mendelssohn. Dass das überhaupt nötig war und darüber hinaus auch nicht immer den gewünschten, durchschlagenden Erfolg zeitigte, fügte Wagner eine narzisstische Kränkung zu, aufgrund derer er ihnen die Förderung gleichsam nicht verzeihen konnte.



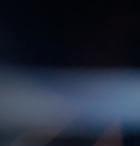



















































Generalintendant
Alfons Haider







10. Juli bis 16. August 2025



Sichern Sie sich hier Ihre Tickets






Weinbar & Shop der Selektion Burgenland zählen seit mehreren Jahren zu den besten im deutschsprachigen Raum. Das umfangreiche Sortiment an regionalen und internationalen Weinen, seltenen Raritäten als auch die große Auswahl an offenen Weinen sprechen für sich. Eine fein abgestimmte Kulinarik bieten eine Reise durch alle Genussregionen des Burgenlandes.
Vis-à-vis Schloss Esterházy in den ehemaligen Hofstallungen gelegen, ist der prominenteste Platz, um Weinbegeisterten das Weinburgenland stilvoll schmackhaft zu machen. Die Terrasse der Selektion gilt als einer der schönsten Plätze des Landes. Die gelungene Verbindung aus historischer Bausubstanz mit modernen Akzenten und der einzigartige Blick auf das Schloss Esterházy garantieren die entspannte Atmosphäre.
SELEKTION
Vinothek Burgenland
Esterhazyplatz 4 7000 Eisenstadt 02682 63345
wein@selektion-burgenland.at
INTENDANT:
JULIAN RACHLIN
JANINE JANSEN ANDRÈ SCHUEN
IGUDESMAN & JOO
JOHN MALKOVICH
SIR ANDRÁS SCHIFF CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE
UND VIELE MEHR ...
10. BIS 21.09.










© 2022 Römerquelle Trading GmbH


Magnesiumhaltiges natürliches Mineralwasser aus den Tiefen Österreichs. Voller Stärke, genau wie du.
Kultur ist systemrelevant. Darum fördert die Wiener Städtische künstlerische Vielfalt und den kulturellen Dialog mit Künstler:innen, Kund:innen und Unternehmen.
#einesorgeweniger
Wir unterstützen das.

Redline investiert in die Zukunft mit dem neuen Beschallungssystem L2 mit der patentierten Progressive Ultra-Dense Line Source (PULS) Technologie von L-Acoustics.
Die L-Serie erweitert die Line-SourceTechnologie und bietet Leistung, Kontrolle und Konsistenz im Line-Array-Design.

Mit Kunst, Kultur und Wissenschaft. Mit Menschen, die sich dafür interessieren. Mit Ermäßigungen für zwei bei 600 Kulturpartnern, dem monatlichen Ö1 Magazin gehört, Freikarten und exklusiven Veranstaltungen.
Alle Vorteile für Ö1 Club-Mitglieder auf oe1.ORF.at/club
















Die Krone wünscht Ihnen einen schönen
Abend!
Mehr Hintergrundinfos und Interviews zu Kunst- und Kulturthemen, klassischer Musik und Theaterveranstaltungen in Ihrem Bundesland lesen Sie in Ihrer Kronen Zeitung und auf krone.at.












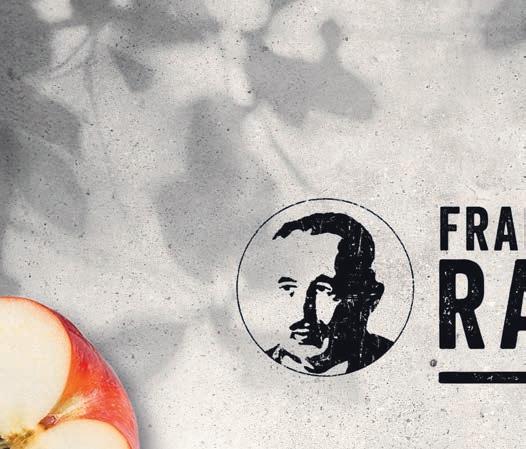






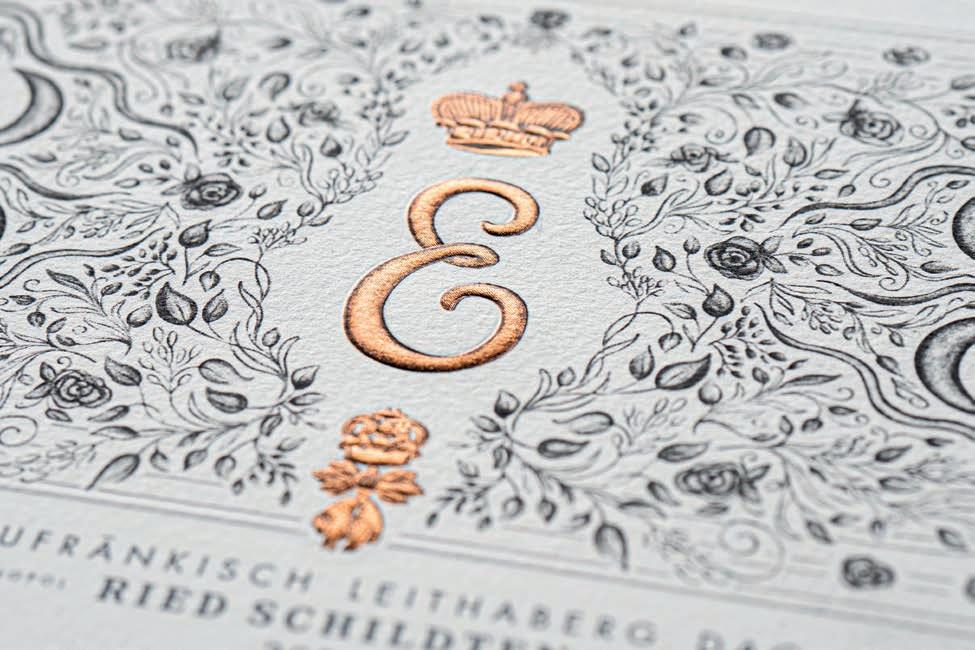
Zur Opernsaison schenken wir Momente der Freude jenseits der Bühne und verlosen ein exklusives Weinpaket im Wert von € 149,–
Jetzt QR-Code scannen, bis 31.08.25 mitmachen & gewinnen.


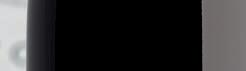
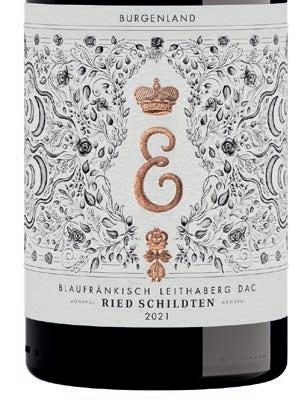
Details unter





Lassen Sie sich durch eine Sinfonie aus Exklusivität und den sanften Wellen des Sees verzaubern – höchster Wohnkomfort im Einklang mit der Natur.
- Sechs lichtdurchflutete Luxus-Apartments
- Privater Seeezugang zum Neufelder See - Nachhaltige Bauweise für modernste Standards

Prok. Martina Jankoschek +43 664 60 517 517 70 martina.jankoschek@riv.at 25-7.immo
Prok. Walter Mitterstöger, MA +43 664 88 73 99 35 walter.mitterstoeger@funk.at funk.at
Sinfonie entdecken

Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.


trifft Bühne. Emotion trifft Eventtechnik.






präsentiert:






Das Flaggschiff ist zurück.

Symbolbild. Kraftstoffverbrauch 0,8 l/100 km, CO2-Emissionen 19 g/km (WLTP gewichtet kombiniert). *Bis zu 8 Jahren Garantie: 5 Jahre Werksgarantie bis 100.000 km, danach bis zu 3-mal je 1 Jahr Mitsubishi Anschlussgarantie (bis max. 160.000 km). 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km. Gültig für Mitsubishi Outlander ab Erstzulassung 2025. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2025. *
12.-21. September 2025
Oggau Gemeindekeller Mörbisch Altes Kino
Andreas VITASEK
Katharina STRASSER*
Benedikt
MITMANNSGRUBER
Joesi PROKOPETZ &
Dieter CHMELAR*


TRICKY NIKI STERMANN & GRISSEMANN
Bernhard MURG & Stefano BERNARDIN*







Tickets auch in den Tourismusbüros Oggau und Mörbisch erhältlich! Nur 50 Minuten von Wien entfernt!



Das unkomplizierteste Abo der Welt.
8 TICKETS
fürs Theater in der Josefstadt und/oder die Kammerspiele.
FREIE WAHL.
Minus 15 %. Totales Service.
JETZT TELEFONISCH BESTELLEN: +43142700-301 ODER ONLINE: www.josefstadt.org







Ausstellungen, Kinderprogramme & Führungen







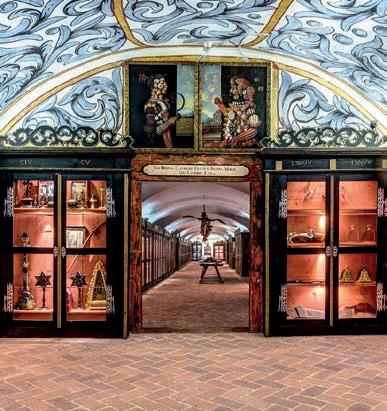
Die trude am Karlsplatz ist das Restaurant im Wien Museum mit großem Schanigarten.
Hier trifft der Geschmack Wiens auf den Zeitgeist der Welt. Bewährte Tradition auf frischen Wind. Altbekannt Schönes auf noch schöneres Unentdecktes.
Aufregend & unaufgeregt.
Einfach anders. Wie die große Fotografin und Namensgeberin Trude Fleischmann. Wie unsere liebste Stadt.
(CAFÉ) (RESTAURANT) (BAR)
DI–SO 9–23 . KÜCHE BIS 22



& töchter laden auf die terrasse
In der & töchter Café-Bar inkl. der wunderbaren Dachterrasse kann man es sich bei Kaffee, Kuchen oder Aperitif, mit Blick auf den Karlsplatz, gutgehen lassen.
(CAFÉ) (BAR)
DI–MI–FR 9–18
DO 9–21
SA–SO 10–18
TODESCO


CAFÉ-BAR 1. STOCK
Feine Torten, Strudel, Kuchen, Näschereien und genussvolle Geschenke
Snacks, feinste Torten und erfrischende Drinks in gemütlicher Atmosphäre

CAFÉ-RESTAURANT 2. STOCK
Gehobene Wiener Küche und Kaffeehausnäschereien, Sonntagsbrunch und exklusive Events in einzigartigem Ambiente
Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker | Palais Todesco Kärntner Straße 51, 1010 Wien gerstner.culinary | www.gerstner.at
KÖNIGLICH GENIESSEN AM KAISERLICHEN HOF

K. u. K. HOFZUCKERBÄCKER SHOW
TÄGLICH 11:00 | 12:00 15:00 | 16:00 UHR



CAFÉ-RESTAURANT IM KAVALIERSTRAKT
Wiener Kaffeehausklassiker, exquisiter Kaffeegenuss und süße Näschereien in Wiener Kaffeehausatmosphäre genießen und imperiales Flair im Gastgarten erfahren.
Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker | Schloss Schönbrunn Kavalierstrakt 52, 1130 Wien gerstner.culinary | www.gerstner.at

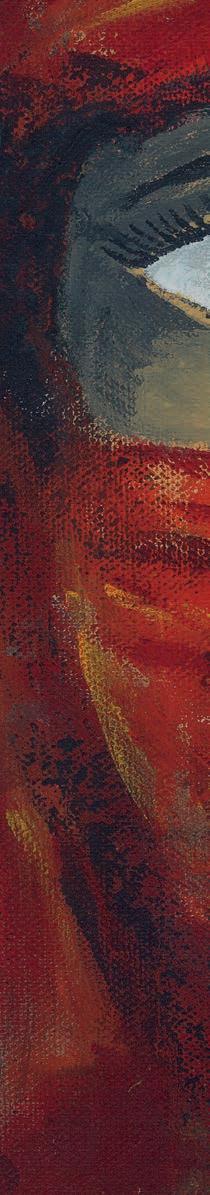

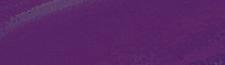
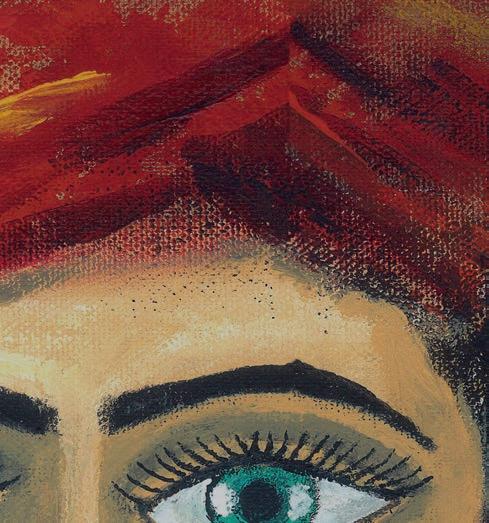
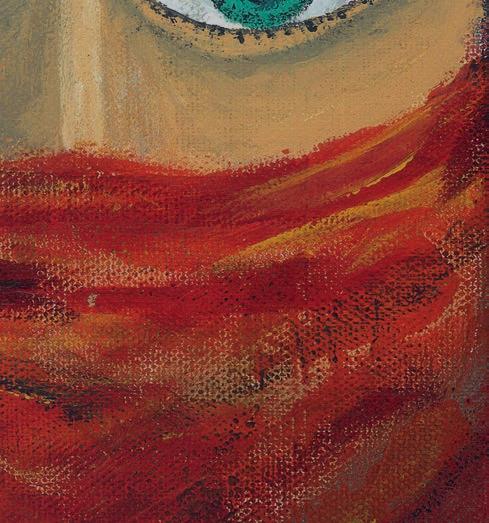





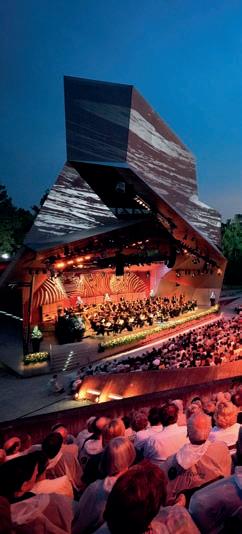



HOCHKARÄTIGE KONZERTE, GLANZVOLLES MUSIKTHEATER, ANREGENDE KULTUR- & LITERATURGESPRÄCHE IN ALLEN MEDIEN DES ORF. ALLE INFOS AUF DER.ORF.AT
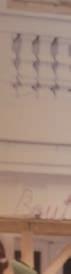






Samstag, 16. August 2025
15.00 Uhr | Schloss Esterházy
Klassische Kammermusik und pannonische Volksmusik im Haydnsaal, Empiresaal, Weinkeller und am Portikus. Orte, wo die Konzerte von Geschichten rund um Pannonien, das Schloss Estherházy und Musik im „Einklang“ umrahmt werden.

TICKETS:
esterhazy.at

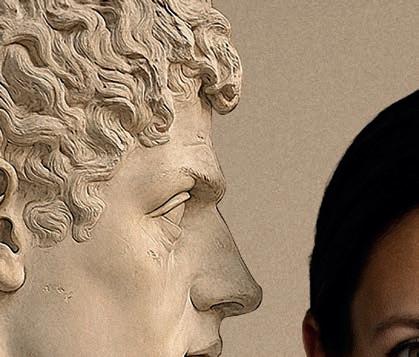

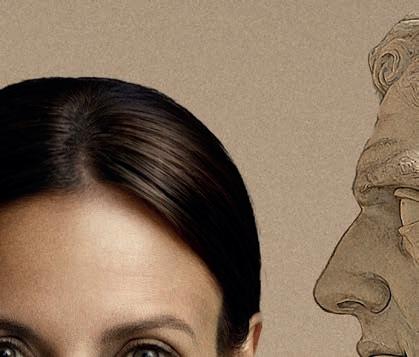








Oper im Steinbruch
Geschäftsführung: Katharina Reise, Dietmar Posteiner Texte und Redaktion: Walter Weidringer
Redaktionelle Mitarbeit: Niklas Gasselseder, Günther Kittler, Marina Krispl, Katharina Reise, Barbara Wayan Textbeiträge: Handlung (S. 8–13), Werkeinführung (S. 14–19), George Gagnidze im Interview (S. 27–29), Fünf Fragen an … (S. 30–33), Wussen Sie schon, dass …: Walter Weidringer, Interview mit Philipp M. Krenn (S. 22–26): Jens F. Laurson, Chordirektor Walter Zeh im Porträt (S. 42–43): Marion Eigl
Alle Texte sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.
Übersetzung der Handlungserzählung: All Languages Alice Rabl GmbH
Lektorat: Elisabeth Kirchmeir
Bühnenbildskizzen: Momme Hinrichs
Gestaltung: PROJEKT 21 Mediendesign GmbH
Fotocredits: Renée Del Missier, Lisa Schulcz, Andreas Tischler, wearegiving, Julia Wesely, Hans Wetzelsdorfer, Tina Zarits, alle anderen unbekannt
Druck: Druckzentrum Eisenstadt, Mattersburger Str. 23, 7000 Eisenstadt
Auflage: 15.000
Aufführungsmaterial: Mit freundlicher Genehmigung von UNIVERSAL EDITION AG, Wien, www.universaledition.com, in Vertretung von Schott Music GmbH & Co KG, Mainz.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Rechteinhaber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechteabgeltung um Nachricht gebeten. © Juli 2025
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SBS Opernbetrieb Burgenland GmbH Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt, FN 644906 t, UID: ATU81727026