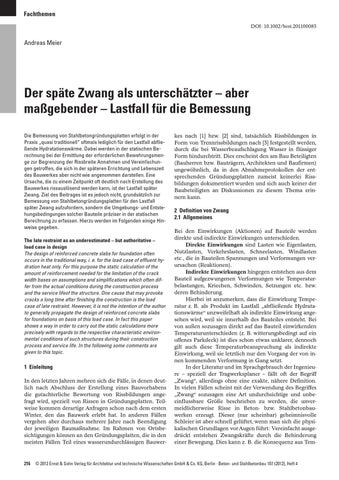Fachthemen DOI: 10.1002/best.201100085
Andreas Meier
Der späte Zwang als unterschätzter – aber maßgebender – Lastfall für die Bemessung Die Bemessung von Stahlbetongründungsplatten erfolgt in der Praxis „quasi traditionell“ oftmals lediglich für den Lastfall abfließende Hydratationswärme. Dabei werden in der statischen Berechnung bei der Ermittlung der erforderlichen Bewehrungsmenge zur Begrenzung der Rissbreite Annahmen und Vereinfachungen getroffen, die sich in der späteren Errichtung und Lebenszeit des Bauwerkes aber nicht wie angenommen darstellen. Eine Ursache, die zu einem Zeitpunkt oft deutlich nach Erstellung des Bauwerkes rissauslösend werden kann, ist der Lastfall später Zwang. Ziel des Beitrages ist es jedoch nicht, grundsätzlich zur Bemessung von Stahlbetongründungsplatten für den Lastfall später Zwang aufzufordern, sondern die Umgebungs- und Entstehungsbedingungen solcher Bauteile präziser in der statischen Berechnung zu erfassen. Hierzu werden im Folgenden einige Hinweise gegeben. The late restraint as an underestimated – but authoritative – load case in design The design of reinforced concrete slabs for foundation often occurs in the traditional way, i. e. for the load case of effluent hydration heat only. For this purpose the static calculation of the amount of reinforcement needed for the limitation of the crack width bases on assumptions and simplifications which often differ from the actual conditions during the construction process and the service lifeof the structure. One cause that may provoke cracks a long time after finishing the construction is the load case of late restraint. However, it is not the intention of the author to generally propagate the design of reinforced concrete slabs for foundations on basis of this load case. In fact this paper shows a way in order to carry out the static calculations more precisely with regards to the respective characteristic environmental conditions of such structures during their construction process and service life. In the following some comments are given to this topic.
1 Einleitung In den letzten Jahren mehren sich die Fälle, in denen deutlich nach Abschluss der Erstellung eines Bauvorhabens die gutachterliche Bewertung von Rissbildungen angefragt wird, speziell von Rissen in Gründungsplatten. Teilweise kommen derartige Anfragen schon nach dem ersten Winter, den das Bauwerk erlebt hat. In anderen Fällen vergehen aber durchaus mehrere Jahre nach Beendigung der jeweiligen Baumaßnahme. Im Rahmen von Ortsbesichtigungen können an den Gründungsplatten, die in den meisten Fällen Teil eines wasserundurchlässigen Bauwer-
216
kes nach [1] bzw. [2] sind, tatsächlich Rissbildungen in Form von Trennrissbildungen nach [3] festgestellt werden, durch die bei Wasserbeaufschlagung Wasser in flüssiger Form hindurchtritt. Dies erscheint den am Bau Beteiligten (Bauherren bzw. Bauträgern, Architekten und Baufirmen) ungewöhnlich, da in den Abnahmeprotokollen der entsprechenden Gründungsplatten zumeist keinerlei Rissbildungen dokumentiert wurden und sich auch keiner der Baubeteiligten an Diskussionen zu diesem Thema erinnern kann.
2 Definition von Zwang 2.1 Allgemeines Bei den Einwirkungen (Aktionen) auf Bauteile werden direkte und indirekte Einwirkungen unterschieden. Direkte Einwirkungen sind Lasten wie Eigenlasten, Nutzlasten, Verkehrslasten, Schneelasten, Windlasten etc., die in Bauteilen Spannungen und Verformungen verursachen (Reaktionen). Indirekte Einwirkungen hingegen entstehen aus dem Bauteil aufgezwungenen Verformungen wie Temperaturbelastungen, Kriechen, Schwinden, Setzungen etc. bzw. deren Behinderung. Hierbei ist anzumerken, dass die Einwirkung Temperatur z. B. als Produkt im Lastfall „abfließende Hydratationswärme“ unzweifelhaft als indirekte Einwirkung angesehen wird, weil sie innerhalb des Bauteiles entsteht. Bei von außen sozusagen direkt auf das Bauteil einwirkenden Temperaturunterschieden (z. B. witterungsbedingt auf ein offenes Parkdeck) ist dies schon etwas unklarer, dennoch gilt auch diese Temperaturbeanspruchung als indirekte Einwirkung, weil sie letztlich nur den Vorgang der von innen kommenden Verformung in Gang setzt. In der Literatur und im Sprachgebrauch der Ingenieure – speziell der Tragwerksplaner – fällt oft der Begriff „Zwang“, allerdings ohne eine exakte, nähere Definition. In vielen Fällen scheint mit der Verwendung des Begriffes „Zwang“ sozusagen eine Art undurchsichtige und unbeeinflussbare Größe beschrieben zu werden, die unvermeidlicherweise Risse in Beton- bzw. Stahlbetonbauwerken erzeugt. Dieser (nur scheinbar) geheimnisvolle Schleier ist aber schnell gelüftet, wenn man sich die physikalischen Grundlagen vor Augen führt: Vereinfacht ausgedrückt entstehen Zwangskräfte durch die Behinderung einer Bewegung. Dies kann z. B. die Konsequenz aus Tem-
© 2012 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · Beton- und Stahlbetonbau 107 (2012), Heft 4