Ernst & Sohn Special
Ausgabe 2
Oktober 2024
ISSN 2750-5030

Ernst & Sohn Special
Ausgabe 2
Oktober 2024
ISSN 2750-5030

– Fassadenwerkstoffe Metall, Beton/Hybridbauweise, Glas, Kohlenstoff- und Glasfasern
– Photovoltaik
– Fassadenbegrünung
– Befestigungstechnik
– Fassadendämmung
– Fassadenentwässerung
Konrad Bergmeister, Frank Fingerloos, Johann-Dietrich Wörner (Hrsg.)
Schwerpunkte: Tunnelbau; Betonbauqualität (BBQ)
- Stand der Technik für Konventionellen Tunnelbau bei geringer Überlagerung und Maschinellen Tunnelvortrieb
- Sensorik und Langzeitmonitoring
- Erläuterungen zum neuen Konzept der Betonbauqualitätsklassen in der DIN 1045er-Reihe

Themenschwerpunkte sind der Tunnelbau und die Betonbauqualität (BBQ) in der Normenreihe DIN 1045 aus 2023. Die Beiträge zum Themenschwerpunkt „Tunnelbau“ umfassen eine breite Palette von Themen, die von technischen Verfahren bis hin zu digitalen Technologien und Nachhaltigkeitsaspekten reichen.

BESTELLEN
+49 (0)30 470 31–236 marketing@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de/3441

Teile 1 + 2, 12/ 2024 · ca. 1000 Seiten · ca. 122 Abbildungen
Hardcover
ISBN 978-3-433-03441-5
Fortsetzungspreis
eBundle (Print + ePDF)
ISBN 978-3-433-03444-6
Fortsetzungspreis eBundle
Bereits vorbestellbar.
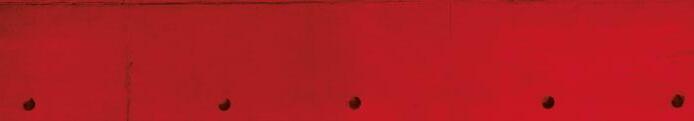
* Der €-Preis gilt ausschließlich für Deutschland inkl. MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
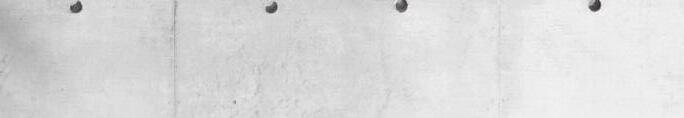

Wenn über Innovative Fassadentechniken und deren Möglichkeiten gesprochen wird, dann ist Glas am Bau ein bedeutendes Thema, das nicht außer Acht zu lassen ist.
Glas steht für Transparenz und vermittelt Gebäuden seit Jahrzehnten Großzügigkeit, Helligkeit und Leichtigkeit. Tageslicht ist ein wesentlicher Faktor, um das Wohlbefinden des Menschen in privaten und öffentlichen Räumen zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Ebenso wichtig sind die funktionalen Eigenschaften von Glas. Glas hat sich zu einem multifunktionalen Werkstoff entwickelt und erfüllt heutzutage dank modernster Beschichtungstechnologien und Veredlungstechniken unterschiedlichste Anforderungen. Sonnenschutz, Wärmedämmung, Absturzsicherung, Schallschutz und Sicherheit sind Funktionen, die, wenn gewünscht, alle in einem Glasaufbau erfüllt werden können. Mehr noch: Zusatzfunktionen wie Selbstreinigung und Glasdesign mittels Bedruckungstechniken gehören heute zum Standard. Bei Verglasungen im Objektbau handelt es sich somit immer um komplexe, höchst individuelle Aufbauten.
Die Entwicklung geht in großen Schritten weiter. Glasinnovationen berücksichtigen heute die wichtigen, gesellschaftlichen Themen: „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“.
Adaptives Glas ist in diesem Zusammenhang ein Schlagwort. Es geht um die Anpassungsfähigkeit des Werkstoffs hinsichtlich der im Tages- und Jahresverlauf wechselnden Sonneneinstrahlung ins Gebäude: viel Tageslicht, wenig Wärmeeintrag im Sommer, Entlastung der Klimaanlage. Jalousie-Isoliergläser, schaltbare Verglasungen und auch Entwicklungen mit speziellen Mikrowabenfilmen im Isolierglas sind neue Lösungen, die mehr und mehr auch im Objektbau Einzug halten.
Photovoltaik ist ein weiteres Thema, das die Fassade erobert. Moderne Photovoltaiktechnik zur Einspeisung von Strom beschränkt sich nicht nur auf Dachlösungen, sie wird zunehmend Bestandteil der Fassade. BIPV steht für Building Integrated PhotovoltaicsGlas und kann als Isolierglas in Fenstern, aber auch als Fassadenmodul in Fassadenplatten und Dächern eingesetzt werden, um eine nachhaltige Energieerzeugung zu gewährleisten. Dünn-
schicht-Photovoltaik für die Fassade ist eine weitere Möglichkeit, die in diesem Zusammenhang zu nennen ist.
Die Reduzierung von CO2-Emissionen ist bekanntermaßen entscheidend, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Gesundheit unseres Planeten zu schützen. Durch den vermehrten Einsatz von CO2-reduziertem Glas – eine weitere Innovation der Glasindustrie – kann ein bedeutender Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet und unsere Umwelt nachhaltig geschützt werden. Da der Bausektor für mehr als ein Drittel der Kohlenstoffemissionen in der EU verantwortlich ist und über 40 % des Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen, hat der Bausektor nun die große Chance, die Fassadenbranche zu verändern und die gebaute Umwelt zu unterstützen, indem kohlenstoffarme Produkte verstärkt eingesetzt werden.
Zur Gesundheit des Planeten gehört zweifelsfrei auch ein intaktes Ökosystem. Jahr für Jahr kollidieren Millionen von Vögeln mit Glasfassaden und sterben. Die Glasindustrie hat spezielle Vogelschutzgläser entwickelt, um das Leben unserer gefiederten Freunde nicht zu gefährden.
Bei aller Begeisterung für diese Neuentwicklungen möchte ich betonen, dass die Auswahl der richtigen Verglasung – gerade im Objektbereich – einer fundierten Beratung bedarf. Es ist für Fassaden-Planende von großem Vorteil, wenn Kompetenzen seitens der Industrie mit der Fertigungstechnik von Isolierglasherstellern in einem großen Netzwerk gebündelt werden. Unser GlasNetzwerk bietet nicht nur ein breites Angebot innovativer Glasprodukte, Planende können zudem auf die Fertigungskompetenz der Mitgliedsunternehmen sowie auf die Beratungsqualität gut ausgebildeter Objektberater vertrauen.

Birgit Tratnik Flachglas MarkenKreis GmbH,
verantwortlich für Presse und
Kommunikation

Ernst & Sohn Special 2024 Innovative Fassadentechnik 2
ISSN 2750-5030
Ernst & Sohn GmbH
Rotherstraße 21
D-10245 Berlin
Telefon: (030) 4 70 31-200
Fax: (030) 4 70 31-270 info@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de
Die Fassade des „Innovationsbogens“ im Innovationspark Augsburg besteht komplett aus recyceltem Aluminium. Die von der Schindler Fenster + Fassaden GmbH geplante, produzierte und am Bau montierte Elementfassade aus Sonderprofilen ist das weltweit erste Projekt aus 100 % recyceltem End-of-Life-Aluminiumschrott. Das 145 m lange Gebäude mit einer Gesamtfläche von 14.800 m2, entworfen von den Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani Architects GmbH, setzt in vielen Bereichen Maßstäbe. Der CO2-Fußabdruck der beim Innovationsbogen verwendeten Aluminiumlegierung CIRCAL 100R des Herstellers HYDRO beträgt weniger als 0,5 kg CO2/kg Aluminium gegenüber 6,7 kg im europäischen Durchschnitt – eine erstaunliche Einsparung von 527 Tonnen CO2 allein für dieses Projekt. (s. Beitrag S. 6–7; Foto: Robert Sprang)
EDITORIAL
Birgit Tratnik
3 Glas am Bau – viel in Bewegung
FASSADENWERKSTOFF METALL
Zum Titel:
6 Zukunftsweisendes Bauprojekt mit echter Recycling-Fassade
7 „Bekannt wie ein bunter Hund“
8 Nachhaltig und ressourceneffizient bauen mit Edelstahl-Rostfrei dasch zürn + partner
10 MODERNES ZUHAUSE IN NEUEM GLANZ NEUBAU ZENTRALES FEUERWEHRGERÄTEHAUS RHEINFELDEN
PHOTOVOLTAIK
Gerd Vaupel
15 Bauwerksintegrierte Photovoltaik (BIPV) – Mit VHF Energiekonzepte realisieren
FASSADENBEGRÜNUNG
17 Begrünte Fassaden: Forschungsprojekt Meadow Wall
FASSADENWERKSTOFF BETON/HYBRIDBAUWEISE
pbr Planungsbüro Rohling AG
20 AUSDRUCKSSTARKE FASSADE SETZT INNERSTÄDTISCHES ZEICHEN NEUBAU DER ERNST-ABBE-BIBLIOTHEK UND DES FACHDIENSTES BÜRGERUND FAMILIENSERVICE IN JENA
25 Rundum durchdacht: Geschäftsgebäude in Bradford stellt Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt
27 Begrünt, langlebig und energieeffizient – Fassadenlösungen für die Zukunft
28 Klimahaus in Berlin
FASSADENWERKSTOFF GLAS
Flachglas MarkenKreis
29 IPANEMA BÜROTURM IN HAMBURG ATTRAKTIVE LANDMARKE MIT AUßERGEWÖHNLICHER GLASFASSADE
32 GEWÖLBTE GLASKUPPEL ÜBERDACHT DAS ATRIUM
NEUBAU FAKULTÄT FÜR TECHNIK DER DHBW STUTTGART
34 Statik für Pfosten-Riegel-Verbinder und Glasauflager – Prüfungen nach EN 16758 und EN 17146 erleichtern die Berechnung
35 Skyscraper mit hocheffizienter Glasfassade prägt Chicagos Skyline
36 Buchtipp: Berliner Jugendstilfassaden
36 Informativer Leitfaden zur Montage von Fassadenplatten und Paneelen
FASSADENWERKSTOFF KOHLENSTOFF- UND GLASFASERN
37 TEXTILES BAUEN: TEXOVERSUM FEIN GESPONNENE FASSADE AUS KOHLENSTOFF- UND GLASFASERN



BEFESTIGUNGSTECHNIK
40 Wohn- und Gewerbebau an der historischen Reismühle in Winterthur
44 EFS 2025
45 Energieeffiziente Dämmstoffbefestigung für WDVS und Holzfaserdämmung
FASSADENDÄMMUNG
46 Neu gedämmte Gebäudehülle für Tropical Islands
48 Holzbaupreis Rheinland-Pfalz 2024
FASSADENENTWÄSSERUNG
49 Design-Entwässerungssysteme bieten Gestaltungsfreiheit





















Eine starke Einheit aus Holz und Aluminium
Die innovative Hybrid-Elementfassade erweitert das Portfolio von Lindner Building Envelope und kommt bereits bei dem neuen Besucherzentrum von WOLF in Mainburg zum Einsatz. Lindner Building Envelope ist Ihr starker Partner für die komplette Gebäudehülle mit langjähriger Erfahrung rund um Fassade und Dach. www.Lindner-Group.com

























Zum Titel:
Im Innovationspark Augsburg entstand ein eindrucksvoller Bürokomplex: der Innovationsbogen. Seine Fassade besteht komplett aus recyceltem Aluminium – das ist weltweit einzigartig. Die von Schindler Fenster + Fassaden GmbH geplante, produzierte und am Bau montierte Elementfassade aus Sonderprofilen ist das weltweit erste Projekt aus 100 % recyceltem End-of-LifeAluminiumschrott.
Eine aufgehende Sonne symbolisiert der bogenförmige Neubau, den die Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani Architects GmbH für den Bauherrn Walter Beteiligungen und Immobilien AG entworfen haben und dabei von den Fassadenberatern PBI aus Wertingen unterstützt wurden. Das 145 m lange Gebäude mit seiner Gesamtfläche von 14.800 m2 setzt in vielen Bereichen Maßstäbe. Absolut wegweisend und gleichzeitig eine Weltpremiere ist hierbei die Fassade aus 100 % recyceltem End-ofLife-Aluminiumschrott. So wird Material bezeichnet, das bereits in einem Produkt verwendet wurde und seinen gesamten Lebenszyklus durchlaufen hat – im Gegensatz zu Recyclingmaterial aus Produktionsabfällen, dem sogenannten Pre-Consumer-Schrott oder Primäraluminium, welches aus Bauxit gewonnen wird. Der CO2-Fußabdruck der beim Innovationsbogen verwendeten Aluminiumlegierung CIRCAL 100R des Herstellers HYDRO beträgt weniger als 0,5 kg CO2/kg Aluminium gegenüber 6,7 kg im europäischen Durchschnitt. Es handelt sich um eine erstaunliche Einsparung von 527 Tonnen CO2 allein für dieses Projekt. Da der Werkstoff Aluminium seine Eigenschaften und Qualität nach der Wiederaufbereitung unverändert beibehält und somit unzählige Male recycelbar ist, wird dies zukünftig ein entscheidender Faktor für nachhaltiges und klimagerechtes Bauen mit diesem Baumaterial sein.
Der geschwungene Neubau führte durch seine Form dazu, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen und somit nicht deckungsgleichen Fassadenelementen erforderlich war. Allein im Bereich des Bogenverlaufs werden ca. 120


verschiedene Fassadenelemente gezählt. Um die Planung dieser Ungleichartigkeit möglichst effizient zu gestalten, wurden die Elemente mit einer 3D-CAD-Planungssoftware parametrisch modelliert. Durch diesen Ansatz konnte eine Ableitung von einem Mastertyp erfolgen und der Aufwand für die Erstellung der Fertigungsplanung optimiert werden – sowohl die CNC-Profilbearbeitungszentren als auch die vollautomatisierte Rotationsstanze der Blechbearbeitung wurden direkt vom parametrischen 3D-Modell aus in digitaler Form versorgt. Auf diese Weise konnte auch ein weiterer, besonderer Wunsch der Bauherren und Architekten realisiert werden. Die vertikal verlaufenden und dreidimensional geformten Lisenen aus Aluminiumblechen, beschichtet mit silberfarbigen Duraflon Nasslack, sollten am oberen Bogen in einer Spitze enden. So war in jeder Achse eine unterschiedliche Länge der Lisenen und des entsprechenden Kantwinkels gegeben.

Bautafel
Innovationsbogen Augsburg
■ Bauherr: Walter Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg
■ Architekt: Hadi Teherani Architects GmbH, Hamburg
■ Fassadenplanung: PBI Entwicklung Innovativer Fassaden GmbH, Wertingen
■ Fassadenbau: Schindler Fenster + Fassaden GmbH, Roding
■ Fertigstellung Fassadenbau: 2024
Die Leistungsanforderungen in Bezug auf Schlagregendichtigkeit, Fugendurchlässigkeit sowie Widerstand gegen Windlast dieser kundenspezifischen Aluminium-
Elementfassade wurden im firmeneigenen Fassadenprüfstand projektbezogen nachgewiesen und vom unabhängigen Institut für Fenstertechnik Rosenheim bestätigt. Dieses Bauvorhaben ist einzigartig und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Design und Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
SCHINDLER FENSTER + FASSADEN GMBH
Mauthstraße 15, 93426 Roding Tel. (09461) 409-0, Fax (09461) 409-100 mail@schindler-roding.de www.schindler-roding.de
„Bekannt wie ein bunter Hund“
Wenn Dachhandwerker Produkte der Häuselmann Metall GmbH verwenden, ist er häufig mit von der Partie: der drollig blickende, bunt gefärbte Häuselmann-Hund. Sein Zuhause hat er zwar in Mannheim, doch mit den Produkten reist er um die Welt …
Wer oberflächenveredeltes Aluminium verarbeitet oder vertreibt, ist mit Sicherheit schon mit den Produkten der Häuselmann Metall GmbH in Kontakt gekommen. Im Stammsitz in Mannheim kümmert sich das Team um die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Dabei wird besonderer Wert auf die maßgenaue Beratung der Geschäftspartner gelegt. Informationen rund um die unterschiedlichen Einsatzanforderungen der zur Verfügung stehenden Metall-Halbfabrikate sind dabei besonders wichtig.
Häuselmann-Kunden profitieren folglich nicht nur von einem breiten Sortiment kurzfristig verfügbarer Produkte, sondern auch von einem zeit- und mengenflexiblen Lieferservice. Eloxierte, pulverlackierte oder nasslackierte Aluminiumbänder sind ebenso schnell verfügbar wie blankes Aluminium, Lochbleche oder Profiltafeln. Verzinkter und farbbeschichteter Stahl sowie Edelstahl runden das Lieferprogramm in sinnvoller Weise ab.
Eine bunte Firmengeschichte
Die Häuselmann GmbH startete im Jahr 1998 als Tochtergesellschaft der bekannten Häuselmann Holding AG auf dem deutschen Markt. Auch das Markenzeichen der Firma – der allseits bekannte bunte Aluminium-Hund mit dem Slogan „Bekannt wie ein bunter Hund“ – stammt aus dieser Zeit. Dabei lag der Schwerpunkt des Unternehmens schon immer im Bereich der Aluminiumwalzprodukte, insbesondere im oberflächenveredelten Zustand. Im Jahr 2000 erfolgte die Erweiterung des Betriebes in Forst bei Bruchsal. Mit entsprechend vergrößerten Büro- und Lagerflächen reagierte Häuselmann auf die steigende Nachfrage. Den letzten großen Umzug vollzog das Unternehmen im Jahr 2014 mit der Verlegung des Firmensitzes von Forst nach Mannheim. Dabei wurden insbesondere der Servicebereich und das Anarbeitungszentrum mit Coil-ServiceCenter in den Fokus gestellt und ein Just-in-time-Lieferkonzept ins Leben gerufen.
Um den Kundenansprüchen auch weiterhin gerecht zu werden und einen möglichst individuellen und schnellen Service anzubieten, verfügt der Standort Mannheim seit 2022 über eine neue Querteilanlage. Seit 2023 ergänzt eine neue Längsteilanlage den Maschinenpark und auch die Lagerfläche wird stetig erweitert. Heute können vor Ort Materialien in Dicken zwischen 0,5 und 4 mm auf Kundenwunsch angearbeitet und quergeteilt werden. Da-
hm-eloflex ®
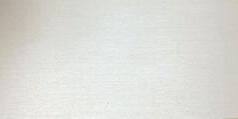

hm-eloflex ® ist eine innovative Form der modernen Bandeloxierung in Aluminium. Für anspruchsvollste Projekte in Optik und Qualität. Fordern Sie Farbmuster an.















Metall-Halbfabrikate aus Stahl, Edelstahl und Kupfer für Dach und Fassade: Nahezu alles ist möglich. (Foto: häuselmann metall GmbH)
bei sind Breiten bis 1.600 mm und Längen bis 10.000 mm möglich. Das maximale Coil-Gewicht beträgt dabei 6 t.
Die farbige Aluminiumwelt
Beim Blick in die Lager- und Produktionshalle in Mannheim wird eines schnell klar: Die Produktpalette – gerade im Bereich des oberflächenveredelten Aluminiums – ist riesig. Geschäftsführer Jens Wedell erklärt: „Wir verfügen über eine umfangreiche Farb- und Oberflächenauswahl in unserem Portfolio. So haben wir unser nasslackiertes Aluminium hm liquid in 40 verschiedenen Farben auf Lager. Sollte die richtige Oberfläche nicht dabei sein, können wir weitere Farben ab einer Abnahmemenge von 500 kg im gewünschten Coil-Format liefern. Mit der Linie hm-falzit bieten wir außerdem Farbaluminium in Doppelstehfalzqualität an. Neben den sieben gängigen Lagerfarben können wir natürlich auch in diesem Bereich Sonderwünsche realisieren. Aber nicht nur Nasslackierungen stehen zur
Verfügung, wir bieten außerdem auch ein pulverlackiertes Produkt an.“
Für außergewöhnliche Projekte etwa im Architekturund Fassadenbereich ist darüber hinaus bandeloxiertes Aluminium mit einer Schichtdicke von 10 bis 12 μm lieferbar. Neben dem Naturton E6EV1 ist das Material u. a. in Gold, Kupfer, Bronze und Schwarz erhältlich.
Generell fällt auf: Das Unternehmen stellt sich speziell auf die ihm vom Fachhandel übertragenen Kundenwünsche ein. Jens Wedell erklärt: „Aufgrund unseres breit aufgestellten Portfolios haben wir die Möglichkeit, viele individuelle Vorstellungen nicht nur im Bereich der Farben und Beschichtungen, sondern auch in der gewünschten Stück- und Mengenzahl zu erfüllen. Auch Sonderfarben, beispielsweise für bunte Spielhausüberdachungen in Pastellblau oder Mintgrün, können wir problemlos realisieren. Die Mindestbestellmenge beträgt zwischen 500 und 1.000 kg. Pulverlackierungen können wir sogar ab einer Tafel realisieren. Dabei sind wir außerdem zeit- und mengenflexibel. Da unsere Ausgangsmaterialien bei verschiedenen Lackierbetrieben eingelagert sind, können auch Sonderfarben rasch geliefert werden. Mit den aktuellen Investitionen in unseren Maschinen- und Anlagenpark sind wir in der Lage, Kundenaufträge noch schneller und präziser auszuführen.“
Mit dabei ist immer der bunte Hund, der nicht nur in einer, sondern in verschiedenen Farben auf den Produkten zu finden ist. Auf dem nasslackierten Aluminium ist er zum Beispiel je nach Materialart in Blau oder Türkis zu finden. Frei nach dem Motto: „Bekannt wie ein bunter Hund“.
Weitere Informationen: häuselmann metall GmbH
Pfingstweidstraße 26, 68199 Mannheim Tel. (0621) 80 39 65-0, Fax (0621) 80 39 65-60 info@haeuselmann.de, www.haeuselmann.de
Der Trend des umweltbewussten Bauens nimmt jedes Jahr an Bedeutung zu. Zweifellos stehen bei der Gebäudeplanung für Nachhaltig und ressourceneffizient bauen
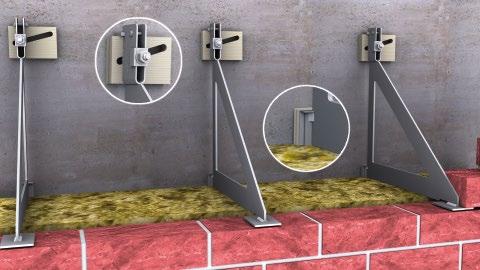
Architekten und Planer die Ressourceneffizienz und der Klimaschutz an vorderster Stelle. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes wird auch auf die Auswahl der Baustoffe und -produkte großer Wert gelegt. Hersteller, Vertreiber und Lieferanten sehen sich angesichts der proaktiven Entwicklung im Hochbau neuen Herausforderungen ausgesetzt, ihr Produktsortiment der zunehmenden Nachfrage an Nachhaltigkeit anzupassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt Edelstahl Rostfrei als bewährter Werkstoff im Bausektor zunehmend an Bedeutung.
Die Vorteile der Nachhaltigkeit beim Einsatz des Werkstoffes Edelstahl Rostfrei lassen sich nachweislich begründen:
– energiesparende Herstellung: Die Emissionen der Stahlindustrie bei der Herstellung von Edelstahl wurden in den letzten Jahren durch die Anwendung des wesentlich energiesparenderen Lichtbogenverfahrens erheblich reduziert.
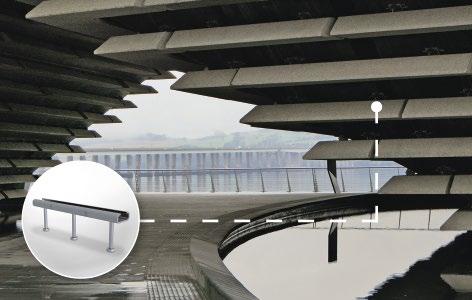

ohne chemischen Zusätze: Edelstahl Rostfrei entsteht durch die Legierung mit Zusatzstoffen wie Nickel, Chrom, Mangan oder Titan.
– Langlebigkeit: Edelstahl Rostfrei ist aufgrund der Materialeigenschaften praktisch unvergänglich. Betrachtet man die Lebensdauer eines aus Edelstahl Rostfrei erzeugten Produkts in Bezug zur umweltbelastenden Herstellung, Weiterverarbeitung und dem Transport weniger haltbarer Produkte, lässt sich aufgrund der unnötigen Nachproduktion eine positive Bilanz für nichtrostende Edelstähle ziehen.
– ressourcenschonend: Edelstahl Rostfrei ist zu 100 % recyclingfähig und kann ohne Qualitätsverluste wiederverwertet werden.
Umweltbewusstsein im eigenen Unternehmen kultivieren
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für die Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG (Teil von Leviat) wichtige Punkte in der Unternehmensführung. Elementare Maßnahmen der Geschäftsführung mit dem Aspekt des Umweltbewusstseins werden bereits seit Jahren bei dem Hersteller und Vertreiber von Fassadenbefestigungssystemen und Sonderanfertigungen aus Edelstahl Rostfrei und Lean Duplex-Stahl umgesetzt. Zuletzt realisierte der Produzent von Bauprodukten und Industriebauteilen in der zugehörigen Fertigung, dass die Prozesswärme ausschließlich über den Strom der hauseigenen Photovoltaikanlage erzeugt wird. Das Spenger Unternehmen, dessen Unternehmenskultur Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in den Fokus stellt, setzt diese Ansprüche auch in ihren Neuentwicklungen und Produkten um.
Nachhaltige und ressourceneffektive Bauprodukte von MODERSOHN
Als beispielhafte Produkte erfüllen die typengeprüften MOSO® Konsolen für Verblendfassaden mit bauaufsichtlich zugelassenen Tragankerköpfen gleich mehrere Aspekte des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens. Zum einen werden die Konsolen ausschließlich aus ressourcenschonendem Edelstahl Rostfrei gefertigt. Zum anderen sorgt auch die schlanke Bauform und der punktuelle Einsatz der Fassadenbefestigungssysteme für wenig Raum, um Wärmebrücken entstehen zu lassen.
Diese Vorteile vorangestellt, hat Modersohn längst an einer Lösung zur Reduktion von Wärmebrücken im Bereich der Fassadenbefestigungselemente gearbeitet und setzt den druckübertragenden Dämmstoff MOSOTherm seit Jahren erfolgreich im Segment der Befestigungselemente für Fassaden ein.
Mit der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.8-1892 von MOSOTherm im System mit den Tragankern von Modersohn wird erstmalig ein Fassadenbefestigungssystem angeboten, das tonnenschwere Gewichte dauerhaft abfangen und nachweislich Wärmebrücken im Bereich der metallischen Befestigungen im Beton und im zweischaligen Wandaufbau reduzieren kann.
Umweltproduktdeklarationen
Der nächste Schritt in die Nachhaltigkeit ist für MODERSOHN mit der Umsetzung der Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für die Standardprodukte des EdelstahlVerarbeiters bereits getan.
EPDs (Environmental Product Declarations) gelten als das wichtigste Informationsmittel zur Nachhaltigkeitsbewertung von Bauprodukten in Gebäuden. Sie nehmen einen festen Platz in den Zertifizierungssystemen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude BNB) ein. Auch für die international führenden Zertifizierungssysteme, wie BREEAM (UK) und LEED (USA) sind diese Deklarationen von großer Bedeutung für die Beurteilung von Nachhaltigkeit.
Die Umweltproduktdeklarationen für die MOSO® Einzel- und Winkelkonsolen sowie für die MOSO® Ankerschiene MBA-CE können direkt von der Webseite des Unternehmens oder beim Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU) heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG (Teil von Leviat) Industriestraße 23, 32139 Spenge
PF 1255, 32133 Spenge
Tel. (05225) 87 99-0, Fax (05225) 87 99-45 info@modersohn.de, www.modersohn.de

dasch zürn + partner
Mit der offiziellen Schlüsselübergabe im April 2024 ging nach zwei Jahren Bauzeit der sowohl für die Feuerwehr Rheinfelden (Baden) als auch für die Rheinfelder Bevölkerung zukunftsweisende Neubau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses in Betrieb. Das Gebäude verfügt über Fahrzeughalle, Werkstätten, Funkzentrale, Schulungsräume, Fitnessraum und Bereiche für die Jugendfeuerwehr. Besonderer „Hingucker“ ist die silbrig glänzende Fassade aus verzinktem Stahlblech.
Das neue Zentrale Feuerwehrgerätehaus in Rheinfelden fügt sich in die Längsorientierung der Umgebungsbebauung ein, setzt jedoch am Ende der Kleemattstraße und von der Landesstraße B316 aus ein Erkennungszeichen am Stadteingang. Der kompakte, größtenteils zweigeschossige Baukörper umschließt die Fahrzeughalle U-förmig. Der 23 m hohe Übungsturm befindet sich abgerückt westlich in der Flucht des Hauptkörpers und ist bereits aus der Ferne wahrnehmbar.
Die Alarmeinfahrt sowie die Alarmausfahrt erfolgen unabhängig und kreuzungsfrei voneinander. Die Alarmparkplätze befinden sich östlich des Neubaus. Bei Alarm wird über eine neu angelegte Straße mit unmittelbarem Anschluss zum äußeren Ring der Landesstraße B316 ausgefahren.
Das städtische Amt für Gebäudemanagement als Bauherr realisierte das ambitionierte Projekt in herausfordernden Zeiten, die von Krisen im Bausektor und Kostensteigerungen geprägt waren. Der „Kraftakt“ ist bestens gelungen, wie das Maßstäbe setzende Bauwerk zeigt.
Gebäudestruktur und Funktionalität
Die sich im Erdgeschoss des südlichen Gebäudeteils befindende Einsatzzentrale hat sowohl den Blick in die Fahrzeughalle sowie den uneingeschränkten Überblick auf die Zu- und Ausfahrten und den Feuerwehrhof.


Die Nutzungsbereiche sind funktional angeordnet, mit Technik und Werkstattbereichen vorwiegend im Erdgeschoss und deren Verschränkung mit Bereitschafts-, Schulungs-, Jugend- und Büroräumen in den oberen Etagen.
Das Erscheinungsbild des Gebäudes zeichnet sich durch die durchgehende Materialität und Formensprache aus, die verschiedene Gebäudeteile und den Übungsturm zu einer Gesamtanlage vereinen. Das Gerätehaus besteht aus großflächigen, massiven Körpern, die einen spannungsreichen Kontrast zu den Verglasungen der Torflächen und des markanten Fensterbandes bilden.

Die Außenanlagen umfassen asphaltierte Parkplatzflächen und einen Feuerwehrhof, wobei Bäume und Sträucher auf Grünstreifen als natürlicher Sichtschutz entlang der Grundstücksgrenze dienen. Im Westen befindet sich der Übungshof mit Turm, während im Nordosten ein eigenständiger Baukörper für Gefahrenstofflager und Mülllager positioniert ist.
Hinsichtlich Nachhaltigkeit präsentiert sich das neue Feuerwehrgerätehaus als kompakter Baukörper mit dem Einsatz langlebiger und nachhaltiger Materialien. Eine extensive Dachbegrünung dient als mechanischer Schutz


INSPIRED BY NATURE steht für die nachhaltigen ROCKWOOL Dämmlösungen aus Steinwolle. Gewonnen aus Basaltgestein, einem nahezu unbegrenzt verfügbaren Rohstoff. Von Natur aus voller einzigartiger Eigenschaften, die unsere Dämmstoffe sicher, langlebig und recycelbar machen – so zirkulär, wie unsere Zukunft es braucht. rockwool.de


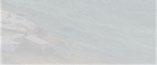




und Regenwasserspeicher. Teilbereiche des Daches sind mit einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch ausgestattet. Schmuckstück und ganzer Stolz der Rheinfelder Feuerwehr ist neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus ein Oldtimer Ford V8. Er ist an exponierter Stelle mit eigenem Stellplatz positioniert und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr in vergangener Zeit. Im angrenzenden Foyer sind dazu weitere Informationen ausgestellt.
Langlebige Fassade mit einzigartiger ästhetischer Qualität
Die Wahl der Metallfassade war eine bewusste Entscheidung, die in enger Abstimmung mit dem Bauherrn getroffen wurde. Die Beweggründe dafür waren vielfältig:
1. Robustheit und Langlebigkeit: Die Metallfassade verkörpert Robustheit und Langlebigkeit, die für ein Feuerwehrgebäude essenziell sind. Der Bauherr wünschte
eine Fassade, die den anspruchsvollen Anforderungen des Einsatzalltags standhält und gleichzeitig eine lange Lebensdauer aufweist.
2. Ästhetische Überlegungen: Eine Stahlfassade, insbesondere aus feuerverzinktem Stahl, bietet eine einzigartige ästhetische Qualität. Die natürliche Marmorierung der Feuerverzinkung erinnert an Beton oder Naturstein und verleiht dem Gebäude ein hochwertiges Erscheinungsbild.
3. Pflegeleichtigkeit: Feuerverzinkte Stahlblechfassaden sind äußerst pflegeleicht und benötigen im Vergleich zu anderen Fassadenmaterialien weniger Wartung, was langfristig Kosten spart und die Funktionalität des Gebäudes sicherstellt.
4. Patina und Alterung: Die Fassade entwickelt mit der Zeit eine Patina, die den anfänglichen Glanz mindert und eine matte, zurückhaltende Oberfläche schafft. Dieser natürliche Alterungsprozess war ein weiterer wichtiger Punkt für den Bauherrn, da er dem Gebäude eine zeitlose Eleganz verleiht.
5. Nachhaltigkeit: Es wurde darauf geachtet, dass keine Verbundmaterialien verwendet wurden und die Fassa-
denelemente später komplett recycelbar sind. Zudem ist die Feuerverzinkung besonders langlebig und wartungsarm.
Visuell attraktive Fassade in Silber
Die Farbwahl spielte eine entscheidende Rolle im gesamten Entwurfsprozess. Ursprünglich wurde im Wettbewerb eine hinterlüftete Fassade mit erdfarbenen Tönen vorgestellt, die an Cortenstahl erinnerte. Während der Entwurfsphase wurden verschiedene Optionen wie Holzfassade, Keramikriemchen und Metallfassade in Betracht gezogen.
Schließlich entschied man sich für eine feuerverzinkte Stahlfassade, deren natürliche Marmorierung und silbriger Glanz in der Anfangszeit eine besondere visuelle Attraktivität boten. Mit der Zeit entwickelt sich eine Patina, die den Glanz mindert und eine matte, zurückhaltende Oberfläche schafft, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist.
Die Fassade wird von den Feuerwehrleuten sehr positiv aufgenommen. Ihre Robustheit und Langlebigkeit werden besonders geschätzt, da sie den Anforderungen des

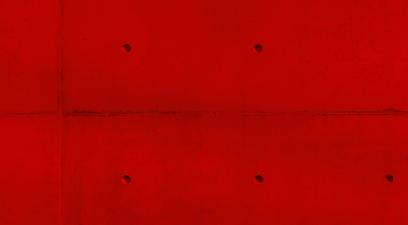



8. Die Robustheit der Fassade wird von den Feuerwehrleuten positiv aufgenommen, da sie den Anforderungen des Einsatzalltags gerecht wird (Ansicht West mit Übungsturm). (Fotos 1–5 und 8: Henrik Schipper)
Einsatzalltags gerecht wird. Auch die ästhetische Qualität und die Pflegeleichtigkeit der feuerverzinkten Stahlblechfassade finden großen Anklang.
Fassade mit dynamischem Erscheinungsbild
Die Metallfassade fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, obwohl sie durch ihre Materialität und Farbe einen bewussten Kontrast zu den benachbarten Gebäuden bildet. Dieser Kontrast war gewünscht, um die Feuerwehr als öffentliches und funktional bedeutendes Gebäude hervorzuheben.
Die Reflexion des Sonnenlichts durch die feuerverzinkte Stahlblechfassade war ein bewusstes gestalterisches Element. Je nach Wetter ändert sich die Materialität des Gebäudes. Wirkt es bei klarem Himmel wie ein deutlicher Solitär, so geht bei bedecktem Wetter die Fassade fast nahtlos in den Himmel über.
Die reflektierenden Eigenschaften der feuerverzinkten Stahlbleche sorgen zudem für interessante Licht- und Schatteneffekte, die je nach Tageszeit und Wetter variieren. Dadurch entsteht ein dynamisches Erscheinungsbild, das das Gebäude lebendig wirken lässt und die Umgebung auf subtile Weise widerspiegelt.
Zudem trägt die helle Fassade sowie deren Reflexion zur Reduktion der Wärmeeinstrahlung bei, was positive Auswirkungen auf das Raumklima im Inneren des Gebäudes sowie auf die Umwelt hat. Gleichzeitig reduziert sich durch den natürlichen Alterungsprozess (Patina) der Glanzgrad und nimmt sich zurück, was das Erscheinungsbild im Laufe der Zeit subtil verändert und harmonischer in die Umgebung einfügt.
Bauphysikalische und technische Herausforderungen
Bei der Gebäudekonstruktion handelt es sich um einen Stahlbetonbau. Die Fassade ist als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) konzipiert. Diese Konstruktionsweise bietet mehrere Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, Schutz vor Feuchtigkeit und eine erhöhte Langlebigkeit der Fassadenmaterialien.
Eine wichtige Rolle bei der Planung und Umsetzung der Fassade spielten bauphysikalische Belange. Die hinter-
lüftete Konstruktion gewährleistet eine effektive Belüftung der Fassade, die Feuchtigkeitsproblemen vorbeugt und die Wärmedämmung verbessert. Zudem sorgt die Feuerverzinkung der Stahlbleche für einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion.
Auch die Herstellung von Kanten, Ecken und Anschlüssen stellte eine gewisse Herausforderung dar. Die präzise Verarbeitung und Montage der feuerverzinkten Stahlbleche war essenziell, um eine einheitliche Optik und eine dauerhafte Funktionalität zu gewährleisten. Die Detailplanung und enge Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen waren hierbei entscheidend, um ein hochwertiges Endergebnis zu erzielen.
Bei der Bearbeitung der Stahlplatten bestand die Gefahr, die Feuerverzinkung zu beschädigen. Aus diesem Grund wurde alles in Einzelelemente geplant, um Schneideund Bearbeitungsarbeiten an den Platten zu vermeiden und die Zinkschicht nicht zu verletzen. Durch diese sorgfältige Planung konnte sichergestellt werden, dass der Korrosionsschutz durch die Feuerverzinkung vollständig erhalten blieb.
Die Maserung der einzelnen Platten kann im Vorhinein nicht vorhergesagt werden. Daher können teilweise dunkle, fleckige Färbungen in den einzelnen Platten auftreten, die sich stark vom restlichen Fassadenbild abheben. Eine gewisse Lebhaftigkeit ist gewollt, diese sollte jedoch nicht zu extrem ausfallen. Um dies zu verhindern, wurde besonderes Augenmerk auf die Ausschreibung der Fassade gelegt. Hierbei wurde besonders auf die Art der Lagerung der Fassadentafeln auf der Baustelle, den Transport und die Art der Hebewerkzeuge geachtet. Auf eine Vorbewitterung wurde aus Kostengründen verzichtet. Es ist anzumerken, dass mit zunehmender Zeit die Farbunterschiede der einzelnen Platten durch die Patina abnehmen und ein harmonisches Gesamtbild entsteht.
Bautafel
Neubau Zentrales Feuerwehrgerätehaus Rheinfelden
■ Bauherr: Stadt Rheinfelden, Amt für Gebäudemanagement
■ Architekt: dasch zürn + partner, Stuttgart I München
■ Energiestandard: KfW 55, Nahwärmeanschluss
■ Photovoltaikanlage auf dem Dach
■ Fassadenbauer: S+T Fassaden GmbH, Owingen
■ Ausstattung im Gebäude: 16 Fahrzeugstellplätze, Funkraum, Besprechungs- und Stabsraum, Wasch- und Aufrüsthalle, KFZ- und LKW-Werkstatt, Lagerflächen für Schläuche, Atemschutzausrüstung und Feuerwehrkleidung, Schulungsräume, Räume für die Jugendfeuerwehr, 8 Büros (Kommandant, Verwaltung, Führungskräfte, Fachgebietsleiter), Übungsturm, Übungsflächen
■ Wettbewerb: 2019, 1. Preis
■ Leistungsumfang: 1–9
■ BGF: 4.450 m2
■ BRI: 21.685 m3
■ Fertigstellung: 2024
Weitere Informationen: dasch zürn + partner architekten Partnerschaft mbB Freudenbergerweg 11, 81669 München Tel. (089) 125 03 06-90, Fax (089) 125 03 06-91 mail@dzpa.de, www.dzpa.de
Die Integration erneuerbarer Energien in die Fassadenarchitektur war noch nie so populär wie heute. Mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) lassen sich Energiekonzepte wie z. B. gebäudeintegrierte Photovoltaik sowohl im Neubau als auch im Bestand sehr einfach entwickeln und realisieren.
Nach den Plänen der Bundesregierung sollen in Deutschland bis 2030 ca. 215 GWp und bis 2040 ca. 400 GWp installiert werden. Das bedeutet, dass zum Erreichen dieses Ziels ca. 22 GWp Leistung aus erneuerbaren Energien benötigt werden. Nach heutigem Kenntnisstand wird insbesondere die Photovoltaik dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Fassaden haben ein enormes Potenzial zur Integration von Photovoltaik, sowohl bei bestehenden als auch bei neu geplanten Gebäuden. Um die Anforderungen der gesteckten Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, kann die Konstruktion der vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit BIPV einen großen Beitrag leisten.
Bauart VHF bietet großen Vorteil
Bei einer bauwerksintegrierten Photovoltaik (BIPV) handelt es sich um Elemente, die neben den klassischen Funktionen einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade wie dem Wärme- und Witterungsschutz auch Strom erzeugen. Die heutzutage hergestellten Module erfüllen auch architektonische Anforderungen. Sie sind flexibel in Bezug auf Formatgrößen, Farben und Oberflächenstrukturen. Aufgrund ihrer Multifunktionalität erbringen diese aktiven Komponenten über ihren gesamten Lebenszyklus ökonomische und ökologische Leistungen, die herkömmliche Komponenten nicht erreichen.
Bei der Integration von PV in Fassaden kann die VHF ihren großen Vorteil ausspielen, da die Solarmodule auch die Funktion eines klassischen Bekleidungsmaterials mit übernehmen. Somit wird das Modul zur Außenhaut der Fassade mit ihren funktionalen, konstruktiven, gestalterischen sowie elektrischen Anforderungen (Bild 1).
Unterschied zwischen VHF-BIPV und herkömmlicher VHF
Eine BIPV-Fassade stellt im Grunde eine klassische VHF mit Verbundglaselementen dar. Zusätzlich erzeugt sie elektrischen Strom durch die Integration von PV-Zellen in die Glaselemente.
Bei der Planung und Erstellung einer vorgehängten hinterlüfteten BIPV-Fassade kommen weitere Komponenten zum Einsatz, welche planerisch und wirtschaftlich zu erfassen sind.
Bauteile und Komponenten einer BIPV (Bild 2)
Für das Fassadensystem:
– Tragfähiger Verankerungsgrund
– Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente
– Unterkonstruktion
– Wärmedämmung
– Bekleidungselemente (PV-Modul inkl. Befestigungselement)
– ggf. Blitzschutzeinrichtungen.

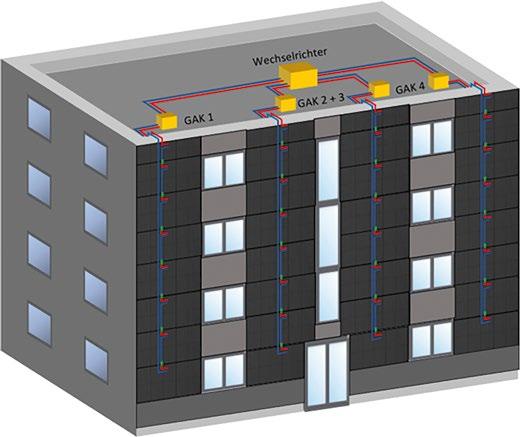
Legende:
GAK – Generatoranschlusskasten
– Stringleitungen
– Stringverbinder (Kupplungen)

Elektrische Komponenten:
– PV-Modul
– String- und Erdungsleitung
– Linienlager zur Kabelführung
– ggf. Generatoranschlusskasten (GAK)
– Wechselrichter
– Anschluss an Übergabepunkt/Haustechnik.
Flächen für den Einsatz einer BIPV
Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzgebiets einer VHF mit Photovoltaik-Fassadenmodulen. Das Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf öffentlichen Gebäuden und Gewerbegebieten. Gerade im Neubau birgt aber auch der mehrgeschossige Wohnungsbau großes Potenzial. Bei der Integration von Photovoltaik in Fassaden kann VHF seine großen Vorteile ausspielen, da Solarmodule die Funktionalität der „klassischen“ Bekleidungsmaterialien von VHF übernehmen. Dies bedeutet aber auch, dass die Funktionsfähigkeit der VHF auch bei einem Austausch/Ausbau weiterhin gewährleistet ist.
Technologien im Bereich der BIPV
Derzeit kommen verschiedene Technologien zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht in PV-Modulen zum Einsatz. Dabei sind Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium (c-Si) mit einem Marktanteil von ca. 95 % am weitesten verbreitet. Davon entfallen ca. 85 % auf monokristallines Silizium und ca. 10 % auf multikristallines Silizium. Auf sogenannte Dünnschichttechnologien entfallen 5 % des Gesamtmarktes. Diese teilen sich wiederum in CdTe (Cadmiumtellurid) und CIGS-Werkstoffe (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) auf.
Im BIPV-Bereich bestehen meist sowohl Frontscheibe als auch Rücksubstrat aus Glas. In seltenen Fällen werden Polymerfolien als Rücksubstrat eingesetzt. Diese Modulaufbauten werden als Glas-Glas- bzw. Glas-Folie-Module bezeichnet.
Bei Glas-Folie-Modulen wird oft ein zusätzlicher Aluminiumrahmen an den Modulen angebracht, um die Kanten zu schützen und die Montage zu ermöglichen. Dies ist bei Glas-Glas-Modulen nicht notwendig. Die Montage von Glas-Glas-Modulen wird meist über sogenannte rückseitig verklebte „Backrails“ oder über eine punkt- bzw. linienförmige Klemmlagerung erreicht.
Hat die Ausrichtung und Neigung Einfluss auf den Ertrag?
Die Auswirkungen der Ausrichtung und Neigung von BIPV-Anlagen lassen sich am besten anhand eines realen Projekts veranschaulichen. In Bild 3 wird der monatliche Ertrag der Dach- und Fassadeninstallation an einem Gebäude der Fa. Sto SE & Co. verglichen. In den Wintermonaten ist der Ertrag der Fassadeninstallationen höher als der Ertrag der Dachinstallationen, was auf die tieferen Sonnenstände zurückzuführen ist. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend über den gesamten Tagesverlauf hinweg bestehen bleibt, wobei höhere Erträge am Morgen und am Abend zu verzeichnen sind.
Bauordnungsrechtliche Anforderungen
BIPV-Anlagen sind im bauordnungsrechtlichen Sinne Bauarten, die aus mehreren Bauprodukten und ggf. sonstigen Produkten zusammengesetzt sind. Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen ergeben sich hierbei in erster Linie aus den Landesbauordnungen (LBO). Im Folgenden wird die Musterbauordnung (MBO) erläutert, die Basis der verschiedenen LBO ist. Die MBO definiert zunächst Schutzziele wie Standsicherheit (§ 12), Verkehrssicherheit (§ 16), Brandschutz (§ 14) etc., welche von jeder baulichen Anlage einzuhalten sind. Für BIPV an der Fassade gelten hier grundsätzlich keine Ausnahmen. Für BIPV in der Bauart einer VHF gelten sinngemäß auch die zusätzlichen Anforderungen, welche sich aus der MBO, der DIN 18516-1 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ergeben. Insbesondere sind hier die konstruktiven Anforderungen im Hinblick auf das Brandverhalten von VHF zu nennen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der VHF-Leitlinie BIPV unter folgendem Link: https://www.fvhf.de/Fassade/Broschuerencenter/? categories%5B%5D=977306977306 oder Sie scannen diesen QRCode:

Weitere Informationen: Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin Tel. (030) 21 28 62-81, Fax (030) 21 28 62-41 Info@fvhf.de, www.fvhf.de
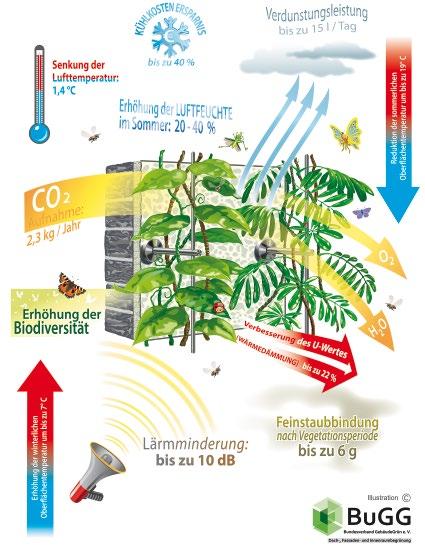
1. Fassadenbegrünung: Leistung eines Quadratmeters. Dargestellte Begrünungsform stellvertretend für verschiedene Fassadenbegrünung. Die genannten Werte sind verschiedenen Untersuchungen zu unterschiedlichen Begrünungen entnommen worden.
Begrünte Fassaden liegen zwar im Trend und werden von Städten wie Frankfurt/Main oder London bei Neubauten vorgeschrieben, sind aber noch die Ausnahme. Nach Angaben des Bundesverbands Gebäudegrün (BuGG) wurde 2021 in Deutschland eine vertikale Fassadenfläche von ca. 87.000 m2 neu begrünt. Wie solche vertikalen Gärten auch für hohe und komplexe Gebäude errichtet werden können, untersucht Fassadenbauer Gartner zusammen mit dem Londoner Start-up Vertical Meadow im Forschungsprojekt Meadow Wall.
Sollen Pflanzen in die Gebäudehülle integriert werden, müssen komplexe Fragen von der Bewässerung bis zum Brandschutz gelöst werden. Deshalb wird das gesamte System an einer 5 m × 5 m großen begrünten Musterfassade mit Unterkonstruktion, Bewässerungs- und Filteranlagen,
Steuerung und Pflanzen in verschiedenen Wachstumszyklen untersucht. In ausklappbare Lochblechkassetten wurden Substrate mit Pflanzensamen gelegt. Wenige Wochen nach Anschluss an die Wasserversorgung spross das erste Grün aus der Wand und Wildblumen lockten Insekten an.
Fassadengrün für ein angenehmes Klima und mehr Artenvielfalt
Flächenversiegelung, verdichtetes Bauen und der Klimawandel führen gerade in Großstädten zu häufigeren Sommertagen und einer zunehmenden Hitzebelastung. Größere Regenmengen können schlechter abfließen und die Artenvielfalt nimmt ab. Viele Kommunen fördern mittlerweile begrünte Fassaden, um Hitzeinseln zu vermeiden und die Biodiversität zu fördern. Sie sollen einen natürlichen Lebensraum für Insekten und Vögel schaffen, Staub und Schadstoffe filtern sowie das Mikroklima durch Verdunstungskälte verbessern. Innenräume sollen sich so weniger stark aufheizen.
Weitere Vorteile einer Fassadenbegrünung sind eine verbesserte Wärmedämmung durch eine Luftpolsterbildung. Der Wärmeverlust wird durch Windabbremsung und Änderung der Strahlungsverhältnisse verringert und die Fassade wird vor starker Temperatur-, UV- und Schlagregenbeanspruchung geschützt.
Nach Angaben des BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V. werden pro Quadratmeter Fassadenbegrünung pro Jahr 2,3 kg CO2 aufgenommen, der U-Wert zur Wärmedämmung verbessert sich bis zu 22 % und die Luftfeuchte erhöht sich im Sommer um 20 bis 40 %. Im Sommer wird die Oberflächentemperatur um bis zu 19 °C reduziert und im Winter um bis zu 7 °C erhöht. Die Lufttemperatur wird um 1,4 °C gesenkt, der Lärm um bis zu 10 dB reduziert und bis zu 6 g Feinstaub nach einer Vegetationsperiode gebunden. Vertikale Gärten verbessern damit vor allem das Mikroklima und sind ein Komfortfaktor. In Wohn- und Bürogebäuden wirken sie positiv auf das Wohlbefinden der Nutzer.
Für die vertikale Begrünung müssen zunächst die statischen Voraussetzungen geklärt werden. Horizontale Gebäudeflächen wie Dächer und Terrassen lassen sich relativ einfach begrünen. Bei der vertikalen Begrünung bieten sich je nach Höhe und Art des Gebäudes boden- und wandgebundene Bepflanzungen an. Im Boden oder in Trögen wachsen angepflanzte Kletterpflanzen an Kletterhilfen von relativ niedrigen Bauten empor. Bei hohen und kom-


plexen Bauten werden wandgebundene Systeme bevorzugt, die keinen Bodenkontakt benötigen. Sie benötigen eine spezielle, auf das Gebäude abgestimmte Konstruktion vor der eigentlichen Fassade, die die Pflanzen aufnimmt und mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Wandgebundene Begrünungen sind bisher relativ selten, da nach Angaben des BuGG 2021 nur eine Fläche von 5.000 m2 so begrünt wurde.
Ganzjährige Begrünung für Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Elementbauweise
Im Forschungsprojekt Meadow Wall wird eine Fassadenkonstruktion entwickelt und erprobt, die für nahezu jede Wand umgesetzt werden kann. Unabhängig von der Unterkonstruktion sollte sie sich sowohl für Pfosten-Riegel-Konstruktionen wie auch für die Elementbauweise eignen und flexibel zu gestalten sein. Das Saatgut sollte je nach Standort und Ausrichtung ausgewählt werden und eine große Artenvielfalt ermöglichen. Um Wände ganzjährig zu begrünen, müssen die Pflanzen frostresistent und wiederkehrend sein.
Das Start-up Vertical Meadow hatte bereits ein kosteneffizientes System mit Substraten entwickelt, bei dem


auf der Baustelle Pflanzen aus Samen wachsen und ein Pflanzentransport vermieden wird. Kontrolliert wird das System über eine Inspektions- und Wartungs-App. Bei der Meadow Wall wurde dieses System erstmals in eine Vorhangfassade integriert, die von Gartner entwickelt wurde. Auf dem Werksgelände in Gundelfingen entstand 2022 eine 5 m × 5 m große Musterfassade, die nach Osten und Süden ausgerichtet ist. In 48 ausklappbare Lochblechkassetten, die jeweils 1.500 mm × 600 mm groß sind, wurden Matten als Substrate eingelegt, die Pflanzensamen aufnehmen. Ein Blech trennt und schützt diese Konstruktion vor der Gebäudehülle, damit die Pflanzen nicht in die Fassade wachsen und diese beschädigen. Mit Ökologen wurden für die Musterfassade einheimische Wildblumen mit unterschiedlichen Blütezeiten ausgewählt, damit die Fassade das ganze Jahr über blüht und Lebensraum für Insekten schafft. Bereits wenige Tage nach Anschluss an die Wasserversorgung, keimten die Samen und wenig später spross das erste Grün aus den Löchern der Kassetten.
Automatische Tropf-Bewässerung mit geringem Wasserverbrauch
Bei einer wandgebundenen Bepflanzung dürfte die Beund Entwässerung eine der größten Herausforderungen sein. Die Wassertechnik muss in die Fassade integriert werden, obwohl die Außenhaut eines Gebäudes vor allem gegen eindringendes Wasser schützen soll. Nach dem aktuellen Stand der Agrikultur wurde eine Bewässerungstechnik entwickelt, die auch im anspruchsvollen Fassadenbau umgesetzt werden kann. Grundsätzlich sollte die Bewässerung begrünter Bereiche bei der Planung, Gestaltung und Einteilung einer Fassade frühzeitig berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Lage zu verglasten Bereichen, die Wasserrückgewinnung und die Pumpen.
Beim Meadow Wall besteht das System aus einer Steuereinheit mit Pumpe, Ventilen, Sensoren sowie Tanks, Zuleitungen, Steigleitungen und Tröpfchenbewässerung. Eine automatische Tropf-Bewässerung fängt überschüssiges Wasser in einer Sammelrinne auf, führt es in den Kreislauf und den Vorratstank zurück, über den es zu den Pflanzen verteilt wird. Seit 2023 wurde die Pump- und Filter-
technik optimiert und der Wasserverbrauch durch ein Kreislaufsystem mit Rinnen und Tank optimiert.
Die Wildblumen werden nur in bestimmten Zeitintervallen bewässert, um den Wasserverbrauch zu minimieren. Etwa zweimal jährlich und nach Ende der Vegetationsperiode müssen diese Pflanzen zurückgeschnitten werden, damit alle Pflanzen genügend Licht erhalten und sich kein Stroh bildet, das die Brandgefahr erhöht.
Vertikale Gärten im nachhaltigen Bauen
2024 hat bereits der dritte Vegetationszyklus dieser immergrünen, vollständig bewachsenen Wand begonnen. Die vorgehängte Konstruktion mit Lochblechkassetten hat sich in einen vertikalen, blühenden Garten verwandelt, der viele Insekten und Vögel anlockt. Selbst freie Gebäudeformen und hohe Häuser lassen sich mit der Meadow Wall


begrünen, da sich das System für jede Wand eignet und für jedes Bauprojekt individuell gestaltet werden kann. Im nachhaltigen Bauen eröffnen vertikale Gärten für Architekten neue Möglichkeiten. Sie bieten ein lebendiges, naturnahes Fassadenbild, da sich die Farben der Blätter und die Pflanzen mit den Jahreszeiten verändern. So lassen sich auch Rechenzentren und Parkhäuser naturnah gestalten. Allerdings sollte die Nähe von Vögeln und Insekten bei Wohn- und Bürobauten beispielsweise zu öffenbaren Elementen berücksichtigt werden.
Weitere Informationen: www.verticalmeadow.com www.gebaeudegruen.info www.josef-gartner.de











pbr Planungsbüro Rohling AG
Mit dem Neubau der Stadtbibliothek und des Bürger- und Familienservices eröffnete das Architektur- und Ingenieurbüro pbr der Stadt Jena die Chance auf die Eigendarstellung als kulturell lebendige und moderne Stadt. Der ausdrucksstarke Neubau erzeugt ein hohes Alleinstellungsmerkmal mit Wiedererkennungspotenzial, das maßgeblich zur Verdichtung und Reorganisation einer funktionierenden Stadtstruktur beiträgt.
Mit dem Ziel, den zentralen Engelplatz im Zentrum von Jena zu reanimieren, aber auch zur Verbesserung der Arbeits- und Nutzungsbedingungen der Ernst-Abbe-Bibliothek und des Fachdienstes Bürger- und Familienservice der Stadt Jena beizutragen, lobte die Stadt, vertreten durch die Kommunale Immobilien Jena, im Jahr 2017 einen Architekturwettbewerb zur Errichtung eines gemeinsamen Neubaus für beide Einrichtungen aus. pbr konnte den Wettbewerb gemeinsam mit Stock Landschaftsarchitekten seinerzeit für sich entscheiden und übergab das Objekt am 22. März 2024 offiziell an die Nutzer.
Reaktion und Aktion
Das urbane Erscheinungsbild des zu beplanenden Areals sowie der unmittelbaren Umgebung ist geprägt von gewachsenen Quartiersstrukturen, die durch unterschiedliche Einflüsse zuletzt weniger einen geschlossenen und funktionierenden Stadtorganismus als vielmehr ein Konglomerat heterogener, aufgebrochener Strukturen darstellten, in dessen Mitte sich mit den Resten des ehemaligen Karmeliterklosters „Zum Heiligen Kreuz“ und den erhaltenen Bauteilen Sakristei, Kapitelsaal sowie der gestalterischen Darstellung des Kreuzgang-Grundrisses zudem ein schützenswertes Kulturdenkmal befindet.
Dem Prinzip „Reaktion und Aktion“ folgend, reagiert der neue Baukörper auf das umgebende Spannungsfeld, umspielt den angrenzenden Bestand, dockt an entscheidenden Punkten an und lässt dort, wo es notwendig ist, bewusst den nötigen Freiraum für Interaktion. So ergänzt der Neubau die Blockränder im Norden und Osten des
Bild 2. Grundriss
Gebiets, definiert die Quartiersabschlüsse im Westen und Süden neu und schafft zugleich die Raumkanten zur Kulturarena und zum Engelplatz.
Der differenzierte Umgang mit dem Bestand setzt sich in der Höhenentwicklung fort, nimmt Bezug und vollzieht durch die Staffelung der Geschosse die vorhandene lebendige Dachlandschaft der Umgebung nach. Gleichwohl setzt sich der neue Baukörper selbstbewusst in Szene, reanimiert auf diese Weise den zentralen Engelplatz und macht ihn als öffentlichen Raum wahrnehmbar. Mit dem Neubau ist es den Architekten von pbr gelungen, eine neue
Aufenthaltsqualität zu ermöglichen, die dieser wichtigen Schnittstelle in der Stadt Jena angemessen ist.
Stringenz und Leichtigkeit
Die ausdrucksstarke Morphologie der Fassaden erzeugt ein Alleinstellungsmerkmal und entwickelt darüber eine besondere Anziehungskraft. Vertikale Lamellenstrukturen bewegen sich in unregelmäßigen rhythmischen Reihungen vor der eigentlichen Gebäudehülle und vermitteln in der Kombination mit größtenteils raumhohen Aluminiumfens-

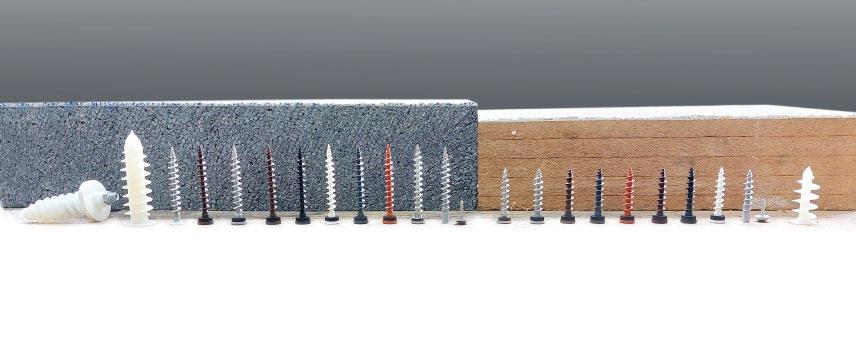
tern zwischen Stringenz und Leichtigkeit. Die vorgehängten Glasfaserbetonelemente sind ca. 20 mm dick und wurden in vorelementierten Breiten auf Geschosshöhe als hinterlüftete Fassaden fugenlos an der Außenwand angebracht. Das gewählte Material, Glasfaserbeton, zeigte sich im Produktionsprozess als fließfähig und ermöglichte so die Herstellung einer Vielzahl zwei- und dreidimensionaler Formteile, was dem Wunsch nach einer spannungsvollen Fassade zugutekam. Dabei wurden die vertikalen Lisenen entsprechend der elementierten Fassadenplatten unregelmäßig vor der Ebene Fassadenplatte angeordnet. Die bis zu 4 m hohen konischen Fassadenteile wurden mittels horizontaler Stahlprofile nach unten und oben optisch geschlossen. Die Lisenen vor den Fensterelementen sind durch ein Edelstahleinschubprofil freispannend über den und oberhalb der Fenster befestigt. Attika und Brüstungen sowie die Sockelbereiche wurden ebenfalls in den dreidi-

mensional geformten Elementen ausgeführt. In ihrer Farbigkeit orientiert sich die bis ins letzte Detail durchdachte und handwerklich aufwendig ausgeführte Fassade an regionalen Gesteinsarten und stellt sich in einem hellen Muschelkalkton dar.
Ausgewogenes Verhältnis
Die Nutzungsarten des neuen Baukörpers sind enorm unterschiedlich. So steht auf der einen Seite mit der Bibliothek als offenes Forum für Lernen und Wissen ein Ort der Kultur mit langer Verweildauer, auf der anderen Seite mit dem Bürgerzentrum ein Ort der Verwaltung mit hohem Durchlauf und kurzer Verweilzeit. Um diese Nutzungsarten nicht nur baulich, sondern auch funktional zu einer Einheit verschmelzen zu lassen, setzen die Architekten von pbr bewusst auf eine kommunikative Struktur mit vielfältiger Vernetzung einzelner Bereiche. Auf diese Weise wird ein dialogisches Verhältnis zwischen Bibliothek und Bürgerservice geschaffen, bei dem das gewählte Konstruktionsraster ein Höchstmaß an Flexibilität erlaubt, sodass gut auf mögliche Veränderungen reagiert werden kann.
Die Bibliothek: Interaktion und Abwechslung statt langer Regalreihen
Ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf kooperatives und lebenslanges Lernen soll sich die neue Bibliothek neben der Dualität von Arbeit und Privatleben künftig als dritter Ort der aktiven und lustvollen Freizeitgestaltung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena etablieren. Der Entwicklung des Raumprogramms und den Grundprinzipien der Innenraumgestaltung lag folglich zugrunde, die Bibliothek nicht nur als Zentrum für Lernen und Wissen zu betrachten, sondern als sozialen Treffpunk anzuerkennen, der Begegnung fördern, Kommunikation unterstützen und zum Verweilen einladen kann. Um dabei mit künftigen gesellschaftlichen, medialen und technologischen Entwicklungen Schritt halten zu können, wurde ein besonderes Augenmerk auf ein
Maximum an räumlicher und technischer Flexibilität gelegt. Mobile Raumeinbauten und Möbelstandorte sowie multifunktionale Elemente, die mit den Besucherinnen und Besuchern interagieren, tragen u. a. dazu bei.
Der Bürger- und Familienservice: mehr Atmosphäre, weniger Verwaltung
Im Bereich des Bürger- und Familienservice verringert sich mit zunehmender Geschosszahl der Anteil öffentlich zugänglicher Flächen. Und so befinden sich im Erdgeschoss der zentrale Empfangsbereich mit sanitären Anlagen, eine Servicetheke, ein Teamleiterbüro sowie der FrontofficeBereich mit 18 Arbeitsplätzen. Die oberen Geschosse sind Teamleiterbüros, dem Büro des Fachdienstleiters, der Stellvertretung und deren Assistenz sowie einem großen Besprechungsraum mit Austritt auf die Dachterrasse vorbehalten.
Freianlagen
Die geringe Freifläche, die inmitten des Zentrums rund um den Neubau zur Verfügung steht, gliedert sich gemäß der Planung von Stock Landschaftsarchitekten in drei öffentlich zugängliche Bereiche:
– den ehemaligen Kreuzgang des Karmeliterklosters – die Platzfläche am Engelplatz mit Zugang zur Bibliothek von Osten – die südliche Querverbindung vom Theatervorplatz zur Neugasse und zwei Innenhöfen als Lesehof.
Mit einer Naturstein-Pflasterung wurde der neue Gebäudekomplex eingefasst, sodass ein homogener Gesamteindruck entsteht. Eine reduzierte Gestaltung im Bereich des historischen Kreuzganges zollt diesem den nötigen Respekt. Der Platz vor dem Fachdienst Bürger- und Familienservice besitzt als Teilbereich des Engelplatzes unterschiedliche stadtprägende Funktionen, dient als Verweilbereich, nimmt zugleich aber auch die Fußgängerströme zwischen

Planung

5. Vorgehängte Glasfaserbetonelemente bilden vertikale Lamellenstrukturen, die in unregelmäßigen rhythmischen Reihungen vor der eigentlichen Gebäudehülle hängen.
Westbahnhof und Innenstadt auf und dient künftig als Zugang für den neuen Bürgerservice sowie als zweiter Zugang zur Bibliothek.
Das Tragwerk
Das Gebäude reagiert auf die vorgegebene unregelmäßige Stadtgeometrie, fügt sich genauestens in diese ein. Diese



9 Herstellung



9 Lieferung

9 Montage










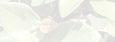
Nachhaltige Betonfassadenlösungen von Hering Architectural Concrete




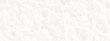


Erhalte weitere Inforamtionen unter www.hering-ac.com oder scan den QR-Code

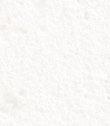
Anomalie der Kubatur schlägt sich auch in der Konstruktion nieder. Und so muss das Tragwerk anspruchsvolle und vielfältige Objektbedingungen aufnehmen, z. B. unterschiedliche Geschosshöhen, wodurch innerhalb einzelner Gebäudeebenen die Geschossdeckenplatten in unterschiedlichen Levels liegen.
Grundsätzlich kommt eine monolithisch errichtete Stahlbetonkonstruktion über einer Flachgründung zum Einsatz. Dabei erfolgt die Aussteifung des Gebäudes durch die Außenwände, die zahlreich vorhandenen Kerne sowie durch die daran anschließenden Geschossdeckenplatten.
Bild 6. Fassadendetail und Fassadenschnitt (Grafiken 2, 3 und 6: pbr)
Der Lastabtrag der prägnanten Auskragungen erfolgt über übereinandergestellte Wandscheiben. Die Sicherung der Bestandsbauten, an welche sich zur Errichtung des Neubaus direkt angenähert wurde, wurde u. a. über Bohrpfahlwände gewährleistet.
Energiekonzept
Der Neubau wird durch hohe ganzjährige Kühllasten dominiert, sodass ein Kühlkonzept entwickelt wurde, bei dem die Kälteerzeugung optimiert und Synergien zwischen


des neuen Baukörpers ist geprägt durch gewachsene Quartiersstrukturen und historische Bebauung.
Heiz- und Kühlbetrieb ermöglicht werden. Der Standardanwendungsfall der Geothermieanlage ist die Wärmeerzeugung mit Unterstützung der passiven Gebäudekühlung für den sommerlichen Wärmeschutz. Durch eine intelligente hydraulische Verschaltung und Automation wurde bei diesem Gebäude zusätzlich die Kälteerzeugung hinsichtlich des Endenergiebedarfs optimiert. Ein Geothermiefeld mit 20 Erdsonden unter dem benachbarten Theatervorplatz dient als Umweltwärmequelle der Wärmepumpe. Weil der Heizbetrieb durch Wärmeentzug zur Reduzierung der Temperatur im Erdreich führt, kann diese Wärmesenke im Sommerhalbjahr zur passiven Kühlung genutzt werden. Bei der Auswahl der Wärmepumpenübertragungssysteme wurde konsequent auf ein niedriges Temperaturniveau im Winter respektive ein möglichst hohes Temperaturniveau im Sommer geachtet, was im Wesentlichen dadurch erreicht wird, dass die Temperierung der Räume über thermisch akustisch wirksame Deckensysteme erfolgt.
Die Lüftungsanlagen wurden in der Bibliothek so strukturiert, dass jede Ebene ein eigenes Zentralgerät erhielt. Auf diese Weise kann eine bedarfsgerechte Fahrweise erreicht werden und der Einsatz kostenintensiver Volumensteuerungen auf ein Minimum reduziert werden, hingegen im Bürgerservice lediglich der Front-Office-Bereich im Erdgeschoss sowie der Besprechungsraum im vierten Obergeschoss mechanisch be- und entlüftet werden. Die restlichen Bereiche werden natürlich über Fenster belüftet.
Frauke Stroman
Weitere Informationen: pbr Planungsbüro Rohling AG Architekten Ingenieure Albert-Einstein-Straße 2, 49076 Osnabrück Tel. (0541) 94 12-0, Fax (0541) 94 12-345 info@pbr.de, www.pbr.de
One City Park im englischen Bradford erregt mit seiner markanten Architektur Aufmerksamkeit. Die geschwungene Form der außergewöhnlichen Gebäudehülle und das vorausschauende Konzept sorgen für Interesse. Bei der Gestaltung standen für Sheppard Robson Architekten Nachhaltigkeit, die Menschen und deren Bedürfnisse im Vordergrund. 1.700 Formteile aus Glasfaserbeton von Rieder setzen ein prägnantes gestalterisches Zeichen an der Fassade des Komplexes. Die sandsteinfarbenen Bauteile aus Glasfaserbeton dienen sowohl als architektonisches Gestaltungselement als auch als wichtige Komponente in Sachen nachhaltiger Ausführung eines visionären Arbeitsumfeldes.
Die Anforderungen an die verbauten Produkte waren für das BREEAM zertifizierte Projekt besonders hoch. So versorgen Photovoltaik-Paneele am Dach den Bürokomplex mit Strom. Die Luftwärmepumpen heizen die Räume be-
sonders ressourcensparend. Die dreidimensionalen Fassadenelemente von Rieder überzeugten die Planenden sowohl durch optische Vorzüge in Bezug auf die Gestaltungsvielfalt als auch durch technische Faktoren wie das vergleichsweise geringe Gewicht sowie die hohen Umwelt- und Gesundheitsstandards. Dadurch eignet sich das Material hervorragend für nachhaltige Gebäudezertifizierungen.
Office-Wahrzeichen für Bradford
Auf über 5.000 m2 bietet One City Park eine Vielzahl an Annehmlichkeiten: hervorragende Verkehrsanbindung, einen eigenen Fahrradkeller mit Duschen, lichtdurchflutete Büros, zahlreiche Aufenthaltsmöglichkeiten, weitläufige Dachterrassen, hohe Räume und viele weitere Vorzüge, welche die Bedürfnisse der Nutzer in den Fokus stellen.

Bild 1. One City Park in Bradford/Großbritannien: die Betonelemente von Rieder schützen als konstruktiver Sonnenschutz vor Temperaturschwankungen.
Ein Ort für alle – Start-ups, große Unternehmen, Einzelhandel und Freizeitanbieter. Das moderne Gebäude im Stadtzentrum stärkt Bradfords Profil als attraktiver Standort für Unternehmen.
Smart und nachhaltig
Die markante Fassade aus Glas und scharfkantigen Betonlisenen lässt das Gebäude herausstechen. Gleichzeitig bieten die Materialität und die beruhigende Optik der Formteile aus Glasfaserbeton die Möglichkeit, sich in die Nachbarschaft gestalterisch einzugliedern. So schaffen die 3D-Elemente nicht nur die Verbindung zum umliegenden Stadtteil, sondern übernehmen neben ihrer optischen Wirkung wichtige funktionelle Aufgaben. Die Architekten wählten bewusst eine leistungsstarke Verglasung, die es erlaubt, die Lichteinträge ins Gebäude zu maximieren. Gleichzeitig schützen die Betonelemente als konstruktiver Sonnenschutz vor Temperaturschwankungen, dadurch


Bild 3. Die beruhigende Optik der Formteile aus Glasfaserbeton bietet die Möglichkeit, sich in die Nachbarschaft gestalterisch einzugliedern.
(Fotos: Rieder Facades/ Ditz Fejer)
wird unerwünschter solarer Eintrag im Sommer reduziert. Die Menschen profitieren von uneingeschränkter Aussicht, gepaart mit effektivem Schutz vor Sonneneinstrahlung. Die feuchteresistente Materialstruktur und geringe Anfälligkeit für Verschmutzungen machen aufwendige Wartungsarbeiten überflüssig und verlängern die Lebensdauer der Fassade erheblich. Die Montage der Elemente erfolgte präzise und effizient dank vorab durchgeführter Vormontage im Werk sowie einer qualitätsorientierten Installation am Bauort. Durch das geringe Gewicht der Formteile sowie ihre hohen Spannweiten ist zudem weniger Unterkonstruktion erforderlich.
Mehr Designmöglichkeiten mit Beton
formparts von Rieder sind ein Teil der breiten Lösungspalette, die der Fassadenspezialist aus Österreich Planenden in Sachen Gebäudehülle an die Hand geben kann. Die maßgeschneiderten Elemente mit einer filigran anmutenden Erscheinung werden je nach Anforderung konfektioniert und schaffen ein fugenloses Erscheinungsbild. Formteile ermöglichen komplexe 3D-Formen mit runden und scharfkantigen Ecklösungen und sind leicht und einfach bei der Installation zu handhaben. Verschiedene Farben, Oberflächen sowie Texturen und eine Vielzahl von unterschiedlichen Formen (von C über L zu U und Sonderlösungen) und Längen unterstützen dabei, eine optimale Lösung an der Gebäudehülle umzusetzen. Fassaden mit anspruchsvollen Geometrien und wirtschaftlichen Vorteilen sind somit unkompliziert realisierbar. Rieder bietet als Systemanbieter perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine ganzheitliche Lösung aus einer Hand.
Weitere Informationen:
Bild 2. Formteile ermöglichen komplexe 3D-Formen mit runden und scharfkantigen Ecklösungen.
Rieder Facades
Glemmerstraße 21, A-5761 Maishofen/Österreich
Tel. +43 6542 690 844 office@rieder.cc, www.rieder.cc
In einer Zeit, in der nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Gebäude mehr als nur Trends sind, werden innovative und ganzheitliche Fassadenlösungen immer wichtiger. Städte weltweit haben bereits damit begonnen, ressourcenschonende Bauvorgaben zu integrieren. Diese neuen Anforderungen fordern Bauherren, Architekten und Planer heraus, zukunftsfähige Gebäude zu realisieren, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional und umweltschonend sind. Eine harmonische und durchdachte Abstimmung der verschiedenen Fassadenkomponenten ist hierbei unerlässlich. Genau hier setzt HERING Architekturbeton an.
Hering Architectural Concrete bietet eine umfassende Lösung, die nicht nur durch ihre Materialqualität überzeugt, sondern auch den ökologischen Fußabdruck des Bauprojekts minimiert, denn mit der Verwendung des R-Betons von HERING kann der ökologische Fußabdruck um 30 % verringert werden. Die Betonfassaden von HERING verbinden Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit mit einem modernen, grünen Designansatz: Begrünte Fassaden, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch funktionale Vorteile bieten. Diese Kombination aus Beton und Begrünung schafft eine Symbiose aus Stabilität und Naturverbundenheit, die sowohl für städtische als auch für private Bauvorhaben attraktiv ist.
Ganzheitliche Fassadenlösungen aus einer Hand
HERING bietet seinen Kunden eine Rundum-Lösung: Von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung und Pflege der Fassaden. Für die Planung und Beratung greift HERING auf Partnerschaften zurück. So berät das Büro CityArc bei der Konzeption der Fassadenlösung, wie zum Beispiel in Fragen der Begrünungsarten und der ökologischen Auswirkungen. Für die Umsetzung und Montage vor Ort arbeitet HERING eng mit dem Partner Leonhards zusammen, der für die fachgerechte Ausführung der Begrünungsfassaden verantwortlich ist.
Die Betonfassaden von HERING Architekturbeton sind bekannt für ihre außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit. Vor allem in Bereichen, in denen eine war-


tungsfreie und widerstandsfähige Fassade notwendig ist, bietet das Material deutliche Vorteile.
Ökologische und ästhetische Vorteile der Fassadenbegrünung
Die Begrünung von Fassaden ist ein wachsender Trend im modernen Städtebau und bietet weit mehr als nur eine Verschönerung des Stadtbildes. Lebendige Fassaden tragen aktiv zur Verbesserung des Stadtklimas bei, indem sie Feinstaub und CO2 aus der Luft filtern. Vor allem in urbanen Gebieten, wo die sommerliche Hitze durch die Verdichtung und den Einsatz von Beton und Asphalt stark zunehmen kann, wirkt eine begrünte Fassade wie eine natürliche Klimaanlage. Sie absorbiert Sonnenenergie und reduziert damit den Kühlbedarf des Gebäudes. Dies führt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs und schont somit nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Auch auf die Biodiversität hat eine begrünte Fassade positive Effekte. Sie schafft Lebensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten und fördert damit die ökologische Vielfalt im städtischen Raum. Insekten, Vögel und Kleintiere finden auf begrünten Fassaden Schutz und Nahrung.
HERING Architekturbeton-Fassaden hat sich durch innovative Lösungen als starker Partner für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen etabliert. Durch die langjährige Erfahrung in der Herstellung und Verarbeitung von Beton sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern gewährleistet das Unternehmen höchste Qualität in allen Phasen eines Bauprojekts.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der ganzheitlichen Betrachtung des Bauvorhabens: Die Fassadenlösungen, wie R-Beton oder Sichtbetonfassade mit PV-Kleinmodulen, von HERING bieten nicht nur optische und funktionale Vorteile, sondern tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei. Von der Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage und der späteren Pflege erhalten Kunden
Fassadenwerkstoff
alle Leistungen aus einer Hand. Dies erleichtert nicht nur die Koordination des Bauprojekts, sondern sorgt auch dafür, dass die Fassade langfristig ihren ästhetischen Wert behält.
Begrünte Betonfassaden sind nicht nur eine moderne Lösung für die architektonische Gestaltung von Gebäuden, sondern auch eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sie vereinen Langlebigkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in einem Gesamtkonzept, das sowohl
Die degewo. mit 80.000 Wohnungen das führende kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin und mit ca. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der großen und leistungsfähigen Unternehmen der Branche, geht mit dem Bau des Klimahauses im Stadtbezirk Berlin Treptow-Köpenick neue Wege. An dem Energieeffizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeitsklasse und mit 112 Wohnungen und einer geplanten Nettokaltmiete ab 7 €/m2 will die degewo Erfahrungen für den zukünftigen klimafreundlichen, nachhaltigen und vor allem bezahlbaren Neubau sammeln. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2025 geplant.
Bei dem von der roedig.schop architekten PartG mbH entworfenen und von der BATEG GmbH realisierten Projekt liegt der Fokus auf nachhaltigen Materialien, grüner Energie, Dachbegrünung sowie E-Mobilität. Der achtgeschossige Bau entsteht in der nachhaltigen Holzhybridbauweise und verfügt über ein offenes Erdgeschoss, das zum großen Teil als Garage mit Stellplätzen für 37 PKW, 3 Motorräder und 140 Fahrräder dient. Die PKW-Stellplätze werden für die Einrichtung von E-Ladesäulen vorbereitet. Ein um bis zu 4 m hervorstehendes Vordach trennt das Erdgeschoss von den darüber liegenden sieben Wohnge-

ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. HERING Architekturbeton bietet hier eine Komplettlösung, die alle Phasen eines Bauprojekts abdeckt – von der Planung bis zur Pflege.
Weitere Informationen: HERING Gruppe
Neuländer 1 Holzhausen, 57299 Burbach Tel. (02736) 27-0 gruppe@hering-bau.de, www.heringinternational.com/de

schossen. Auf dem Dach erzeugen Solarzellen grüne Energie und ein System aus Regenwassermanagement und intensiver Dachbegrünung sorgt für Resilienz gegenüber Starkregenereignissen und eine Verbesserung der Luftqualität und bietet wertvollen Lebensraum für Insekten.
Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, bei der Grundsteinlegung: „Hier wird klimafreundlicher Neubau zu bezahlbaren Preisen und nach den Qualitätsmaßstäben des BMWSB-Qualitätssiegels Nachhaltiges Bauen gezeigt. Dieses Engagement begrüße ich sehr und würde mich freuen, wenn es bundesweit Schule macht.“ Stephan Machulik, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz, Berlin: „Das Ziel Berlins, bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen, rückt durch Projekte wie das degewo-Klimahaus in greifbare Nähe.“
Weitere Informationen: degewo AG
Potsdamer Straße 60, 10785 Berlin
Tel. (030) 264 85 50-00 zkb.degewo.de, www.degewo.de/unternehmen/was-uns-wichtig-ist/ klimaschutz/klimaschutz-fuer-mieterinnen-und-mieter/klimaschutz-imneubau/das-degewo-klimahaus-1

Flachglas MarkenKreis
Zwischen Hamburger Stadtpark und Flughafen ist im Stadtteil Winterhude ein architektonisch einzigartiger 12-geschossiger Büroneubau entstanden. Das Projekt ist Teil des Ipanema – ein neues Quartier zum Wohnen und Arbeiten in der City Nord. Mit seiner imposanten Architektur und in besonderem Maße durch seine gläsernen Fassaden ist der auffallende Ipanema Turm eine attraktive Landmarke der Hamburg City Nord. Farblich aufeinander abgestimmte Sonnenschutzgläser tragen zur gewünschten Fassadenoptik bei und erfüllen alle Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.
Das Ensemble, ein Entwurf des Hamburger Büros kbnk Architekten, vereint Wohnen und Arbeiten. Leitgedanke ist die geschwungene Ausformulierung des ganzen Ensembles in Kombination mit Durchwegungen und einem großzügigen Binnenraum, dem Jardim de Ipanema. So führten kbnk Werner Hebebrands City-Nord Konzept von „Solitären im Grünen“ im positiven Sinne weiter und ließen sich
von der modernen Freiraumarchitektur des Brasilianers Roberto Burle Marx inspirieren. Das Gros der Fläche wird dem Wohnungsbau zugeschrieben, insgesamt wurden 523 Wohneinheiten – davon 157 öffentlich gefördert – realisiert. Markant sind die geschwungenen Linien, die weichen Formen, die üppigen Freiflächen. Die Dynamik der Gebäude mit ihrer Wellenbewegung wird durch eine leichte Verdrehung der Gebäude gesteigert. In der City Nord steht Ipanema – wörtlich übersetzt „aufgewühltes Wasser“ – für die Lebendigkeit und Vielfalt, die entstehen soll, zugleich aber auch für die außergewöhnliche, sinnlich anmutende Gestaltung des Quartiers.
Repräsentativer Solitär
Der ovale Büroturm direkt am Überseering bildet mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 22.000 m2 das Entrée in das neue Quartier. Er ist als „Ring“ ausformuliert und bietet

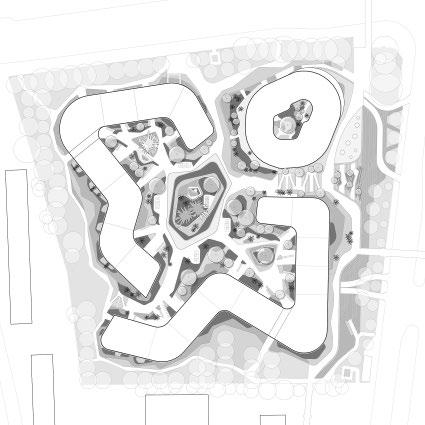
Das Bürogebäude ist als 10- bis 12-geschossiger Solitärbau mit durchgängiger, fallender Attikakante entwickelt. In Richtung Nordosten kragt das Gebäude ab dem 2. OG um jeweils ca. 20 cm je Geschoss aus und bildet so eine markante Ecksituation im Kreuzungsbereich Sydneystraße/Überseering aus.
dadurch kurze Wege, beste Belichtung und spannende Raumfolgen.
In der Erdgeschosszone befindet sich neben dem repräsentativen Haupteingang in das Bürogebäude eine Gewerbeeinheit. Der ebenerdige, repräsentative gläserne Hauptzugang am Überseering weitet sich zu einem weiträumigen 2-geschossigen Foyer, in das ein begrüntes Atrium eingeschnitten ist. Eine großzügige Freitreppe führt auf Straßenniveau des Überseerings in den Jardim de Ipanema.

Auf den einzelnen Büroetagen sind zeitgemäße Arbeitsplätze mit hoher Flexibilität entstanden. Den Neubau zeichnet neben seinen begrünten Terrassen im Innenhof und begrünten Dachflächen die besondere Architektur der einzelnen Geschosse aus. Die verdrehte Fassade des Büroturmes erhält seine lockere Gliederung durch farblich abgestimmte Gläser, die dem Gebäude als äußere Schicht Tiefe und Spiel verleihen.
Die Fassade des Ipanema Turmes wurde vom Ingenieurbüro Reincke aus Rostock geplant und von Feldhaus Fenster + Fassaden errichtet. Die EG-Fassade des Bürogebäudes ist eine großzügige, segmentierte, in der Ansicht geschwungene Pfosten-Riegel-Konstruktion mit einem hohen verglasten Anteil. In die Pfosten-Riegel-Fassade sind, basierend auf Wicona Profilsystemen, Einsatzbauteile wie Türund Fensterelemente angeordnet.
Der Gebäudezugang am Überseering erfolgt über eine Drehtrommeltüranlage sowie ein begleitendes Türelement in der Fassade. Für die Pfosten-Riegel-Fassade wählten die Architekten aufgrund der neutralen Ansicht des Glases und des guten g-Wertes von 25 % das Sonnenschutz-Isolierglas INFRASTOP® Brillant 50/25. Es wurde im Erdgeschoss und im 1. OG zusätzlich mit Alarmfunktion kombiniert.
Die Fassadengestaltung des Bürobaukörpers ist durch ca. 45 cm tiefe, gleichartige und geschosshohe Metallrahmen geprägt. Die verschiedenfarbig in Blau-Grau-Tönen gehaltenen Metallrahmen versetzen sich geschossweise
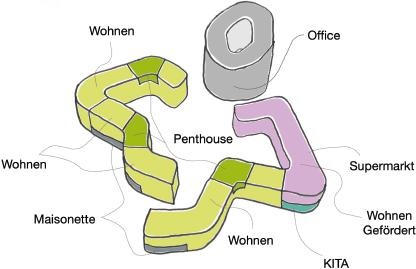
und geben dem Gebäude ein unverwechselbares Äußeres, das sich um den abgerundeten Baukörper spannt und Tiefe sowie Leichtigkeit erzeugt. Die fünf Farben thematisieren die Architektur der 1960er-Jahre, in der die City Nord nach amerikanischem Vorbild konzipiert wurde.
Bei der Fensterbandfassade handelt es sich um eine Elementfassade als Sonderkonstruktion. Aufgrund der besonderen Optik des Gebäudes wurden keine Standardprofile verwendet. Fassadenbauer Feldhaus modulierte die erforderlichen komplexen Geometrien in 3D, welche dann bei Wicona gefertigt wurden. Die einzelnen Fensterelemente wurden mit dem Sonnenschutz-Isolierglas INFRASTOP® Brillant 60/31 ausgestattet. Dieser Sonnenschutzglas-Typ verfügt über eine hohe Lichtdurchlässigkeit von 60 %, was sich vorteilhaft auf die Helligkeit in den Büros auswirkt. Mit seinem g-Wert von 31 % erfüllt er darüber hinaus alle Anforderungen an den hier geforderten sommerlichen Wärmeschutz. Zudem passt er dank seiner neutralen Ansicht gut zu dem in der Pfosten-Riegel-Fassade verwendeten Glastyp, was den Architekten wichtig war. Die Isoliergläser aus Verbundsicherheitsglas (VSG) wur-
den teilweise mit Schallschutz- und Alarmfunktion kombiniert. Insgesamt wurden ca. 5.000 m2 Glas eingebaut. Die Montage der einzelnen Fensterelemente erfolgte vom Inneren des Gebäudes aus. Somit waren keine Baukräne und aufwendigen Gerüste nötig.
Städtebauliches Aushängeschild
Das Ipanema Ensemble ist ein Sinnbild für ausgeprägte Individualität in der City Nord. Der auffällige Büroturm setzt dabei ein markantes selbstbewusstes Zeichen. Mit dem energieeffizienten Gebäude wird der DGNB-Goldstandard für nachhaltiges Bauen angestrebt.
Bautafel
Neubau Ipanema Büroturm, Hamburg
■ Projektentwickler und Eigentümer: Joint-Venture aus Projektentwicklungsgesellschaft PEG Hamburg und Richard Ditting GmbH & Co.Kg
■ Architekten: kbnk Architrekten GmbH, Hamburg
■ Eigentümer Büroturm: IpaCopa Entwicklungsgesellschaft mbH
■ Fassadenplanung: Ingenieurbüro Reincke GmbH, Rostock; Kammeyer Fassadenberatung, Syke
■ Fassadenbau: Feldhaus Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG, Emsdetten
■ Glastechnische Beratung: Flachglas MarkenKreis, Gelsenkirchen
■ Basisglas: Pilkington Deutschland AG, Gladbeck
■ Isolierglas: Flachglas Wernberg GmbH, Wernberg-Köblitz
Weitere Informationen:
Flachglas MarkenKreis GmbH
Birgit Tratnik
Ludwig-Erhard-Straße 16, 45891 Gelsenkirchen
Tel. (0209) 913 29-0, Fax (0209) 913 29-29 info@flachglas-markenkreis.de, www.flachglas-markenkreis.de






Ein lichtdurchflutetes Atrium ist das Herzstück im Neubau der Fakultät für Technik der DHBW Stuttgart. Überdacht wird der zentrale Treffpunkt für die 1.800 Studierenden von einem gewölbten Dach aus Stahl und Glas. Das 1.400 m2 große Freiformdach hat Fassadenbauer Gartner aus 549 unterschiedlichen Elementen konstruiert, die mit einer komplexen Schraublösung verbunden sind. 24 Elemente öffnen sich zum Rauch- und Wärmeabzug tulpenförmig und werden in Gruppen einzeln und abhängig von der Windrichtung gesteuert.
In unmittelbarer Nähe zum Hochschulcampus der Universität Stuttgart entstand in der Innenstadt Stuttgarts der Neubau der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der im Mai 2023 übergeben wurde. Auf sechs Geschossen bietet er eine Nutzfläche von 14.000 m2 für die technisch orientierten Studiengänge, die bisher auf verschiedene Gebäude verteilt waren. Mit seiner gläsernen Dachwelle fügt
sich der dynamisch wirkende Bau elegant in den Stuttgarter Talkessel ein.
Atrium als Campus
Die Bebauung des Blockrands nach einem Entwurf des dänischen Architekturbüros 3XN folgt dem verschobenen Fünfeck des Grundstücks. So entstand ein großer Gebäudekomplex ohne Freiflächen für einen eigenen Campus. Stattdessen bildet das von Tageslicht durchflutete Atrium einen wettergeschützten Campus mit hoher Aufenthaltsqualität in der Mitte des Gebäudes. Von dort erschließt eine stützenfreie Wendeltreppe alle sechs Ebenen mit den Büros, Laboren, Vorlesungsräumen und Werkstätten. Eine Brücke unter dem geschwungenen Glasdach verbindet die beiden Haupteingänge und die Cafeteria. Die Dachsohle liegt 22 m und die Oberkante 29 m über Boden.

dem anspruchsvollen Glasdach erschließt eine stützenfreie Wendeltreppe alle sechs Ebenen des Gebäudes.
Nachhaltige Glaskonstruktion
Die 549 drei- und viereckigen Elemente des Atriumdachs sind Unikate. Die 472 dreieckigen Standardelemente, die durchschnittlich je 160 kg wiegen, haben eine Seitenlänge von ca. 2,5 m und ein Stichmaß von ca. 2 m. In den Randbereichen ergänzen 53 Vierecke die komplexe Geometrie. Dazu kommen noch 24 öffenbare RWA-Elemente. Alle verwendeten Materialien wie der hellgraue beschichtete Stahl RAL 9006 Nasslack, die Gläser etc. wurden nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) zertifiziert. Die Isoliergläser von BGT bestehen aus einem Außenglas aus 10 mm ESG-H Weißglas mit Bedruckung auf Pos.# 2, 10 mm Punkte, 45 Grad Raster, Bedruckungsgrad 40 % sowie Sonnenschutzschicht Ipasol Shine 40/22 ebenfalls auf Pos#2, SZR 16 mm, 90 % Argon, Silikonrandverbund schwarz, Innenglas als VSG aus 2 × 8 mm TVG, Weißglas.
Komplexe Gitterschalengeometrie
Ursprünglich wurde die Dreiecks-Gitterschale des Dachs als Schweißkonstruktion ausgeschrieben. Gartner konnte den Bauherrn aber von einer geschraubten Stab- und Knotenkonstruktion überzeugen, die Schweißverzug und maßliche Unwägbarkeiten vermeidet. Zudem konnte die Montage bei gleicher Geometrie durch eine Schraubkonstruktion beschleunigt werden. Die Knoten der Konstruktion wurden mechanisch bearbeitet und bilden die Grundlage für die Geometrie des Freiformdaches. Da die Komplexität der Geometrie im Knoten aufgenommen wird, konnten die Stäbe mit 90-Grad-Stabenden ausgeführt werden.
Maßgefertigte Lösung für RWA
Für die Anlagen zum Rauch- und Wärmeabzug entwickelte Gartner in Zusammenarbeit mit den Flügel- und Antriebs-

herstellern sowie dem I. F.I.-Institut für Industrieaerodynamik GmbH in Aachen eine komplexe Lösung. Die 24 öffenbaren Elemente wurden in vier Gruppen zu je sechs Elementen zusammengefasst, deren Flügel sich tulpenförmig öffnen. Bei diesen spitzwinkligen Flügeln öffnen sich die Spitzen wie bei einer Blume. Ihr maßangefertigter überhöhter Rahmen gewährleistet konfliktfreies Öffnen und Schließen.
Im Windkanal wurden diese RWA-Öffnungen schließlich getestet, um die praktischen Werte für den tatsächlichen aerodynamischen Querschnitt der sich gegenseitig beeinflussenden Flügel zu ermitteln. An einem 1:10-Modell wurde die ungünstigste Öffnungsgeometrie in verschiedenen Ausrichtungen getestet. Auf dieser Basis konnte eine Steuerungsmatrix erstellt werden, die eine Entrauchung bei allen Windverhältnissen ermöglicht.
Bautafel
Neubau Fakultätsgebäude der DHWB Stuttgart
■ Bauherr: Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd
■ Architekt: Architekturbüro 3XN, Kopenhagen
■ Planung: Wenzel+Wenzel, Freie Architekten Partnerschaft mbB, Stuttgart
■ Structural Engineer: Mayer-Vorfelder Dinkelacker, Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH und Co. KG, Stuttgart
■ Glashersteller: BGT
Weitere Informationen: Josef Gartner GmbH
Gartnerstraße 20, 89423 Gundelfingen
Tel. (09073) 84-0 gartner@permasteelisagroup.com www.josef-gartner.de


Prüfungen an Pfosten-Riegel-Verbindern und Glasauflagern nach EN 16758 und EN 17146 erleichtern Berechnung sowie baurechtliche Anerkennungen (abZ, ZiE und vBg) (Fotos: ift Rosenheim)
Pfosten-Riegel-Verbinder und Glasauflager sind die am stärksten belasteten Bauteile von Vorhangfassaden, Wintergärten und auch Fensterwänden, die enorme Druck-/Sog-Belastungen, hohe Vertikallasten (Eigenlasten) und Torsionskräfte aushalten müssen. Deshalb sind die Dimensionierung und der statische Nachweis von Pfosten-Riegel-Verbindern von zentraler Bedeutung bei der Fassadenplanung. Lastprüfungen nach EN 16758 und EN 17146 sind ideal, um die Grenze der Tragfähigkeit sicher zu ermitteln. Die Prüfergebnisse sind auch als Basis für die Berechnung von Konstruktionsvarianten sowie für baurechtliche Anerkennungen verwendbar, beispielsweise für eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ), eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBg).
Moderne und architektonisch anspruchsvolle Glasfassaden werden durch filigrane Fassadenprofile geprägt. Einen entscheidenden Einfluss auf Design, Konstruktion und Dimensionierung von Vorhangfassaden nach EN 13830 haben dabei die Pfosten-Riegel-Verbindung und das Glasauflager. Deshalb ist der statische Nachweis für die Fassadenplanung von zentraler Bedeutung. Lastprüfungen nach DIN EN 16758 durch eine baurechtlich akkreditierte Prüfstelle sind eine ideale Basis, um die Grenzen der Tragfähigkeit sicher zu ermitteln. Die Prüfergebnisse lassen sich ebenso nutzen, um Anwendungs- und Konstruktionsvarianten sicher und wirtschaftlich zu berechnen sowie baurechtliche Anerkennungen zu erhalten (abZ, ZiE und vBg).
Derzeit sind Zulassungen von Pfosten-Riegel-Verbindern nach DIBt-Mitteilung 4/2005 noch gültig, aber nach
Ablauf der Gültigkeit sind Prüfungen nach EN 16758 und EN 17146 gefordert. Im ift Rosenheim können diese Prüfungen an Pfosten-Riegel-Verbindungen (z. B. an H- oder Doppel-H-Prüfkörpern oder individuellen Sonderaufbauten) sowie auskragenden Auflagern (Glasauflager oder gefüllte Ausfachungen wie z. B. Paneele und Sonderaufbauten) erfolgen. Geprüft werden können Probekörper bis zu einer Größe von 600 mm × 500 mm oder Sonderkonstruktionen mit einer Zug- und Druckkraft bis zu 100 kN.
Die ift-Prüfzeugnisse gemäß EN 16758 und EN 17146 sind eine optimale Unterstützung bei der Abstimmung mit dem Statiker und der sicheren und wirtschaftlichen Berechnung von Anwendungs- und Konstruktionsvarianten. Als europäisch notifizierte Stelle (Notified Body) nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) und bauaufsichtliche Prüfstelle nach Landesbauordnung (LBO) übernimmt das ift Rosenheim die Probekörperauswahl, die Prüfung inkl. Prüfbericht sowie gutachtliche Stellungnahmen. Die Prüfergebnisse sind Grundlage für die CE-Kennzeichnung von Vorhangfassaden nach EN 13830 sowie für einen Antrag auf eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ), eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBg).
Weitere Informationen:
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7–9, 83026 Rosenheim
Tel. (08031) 261-0, Fax (08031) 261-290 info@ift-rosenheim.de, www.ift-rosenheim.de/labor-materialpruefung
Nach oben zu bauen ist in den hochverdichteten Großstädten der USA meist die beste Lösung, um bestehende Stadtviertel weiterzuentwickeln. Der Salesforce Tower in Chicago, Illinois, ist eines der ikonischen Gebäude der Stadt und beweist außerdem: Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen bei neuen gläsernen Skyscrapern nicht zu kurz kommen. Eine entscheidende Rolle spielt hier die hocheffiziente und besonders langlebige Warme Kante Ködispace 4SG des Dicht- und Klebstoffherstellers H. B. Fuller | KÖMMERLING, die in der kompletten Glasfassade des Bauwerks zum Einsatz kommt.
Schon vor 200 Jahren erkannten amerikanische Siedler die Vorteile der attraktiven Lage des Wolf Point westlich vom Ufer des Lake Michigan. Aus den damaligen Blockhütten mit Bars, Hotels und Fähranlegern entstand Chicago – die Stadt des ersten Hochhauses weltweit. Im Rahmen des Wolf Point Masterplans wurde das Areal umgestaltet und weiterentwickelt. Mit der Zeit entstand ein lebendiges Zentrum für Arbeit, Wohnen und Freizeit, direkt angebunden an die gefragtesten Stadtviertel, wichtige Verkehrsadern und das Wasser.
Optischer Blickfang durch komplett verglaste Front
Zentrales Gebäude des Wolf Point Areals ist der 2023 fertiggestellte Salesforce Tower Chicago, Hauptsitz des gleichnamigen Unternehmens. Durch seine komplett verglaste Fassade stellt der Skyscraper mit seinen 57 Stockwerken auf über 260 m einen Blickfang dar und prägt das Areal am Wolfpoint mit seinem imposanten Erscheinungsbild.
Das schlanke Profil des Wolkenkratzers verjüngt sich im obersten Teil durch mehrere Rücksprünge bis zu einer schmalen Spitze. Als vollständig verglastes Rechteck konstruiert, liegt das Gebäude rechtwinklig zum Fluss und wird von zwei verglasten Wohngebäuden mit mehr als

1.000 Wohnungen flankiert. Auf einer Fläche von mehr als 115.000 m2 bietet der direkt am Wasser gelegene Tower Platz für hochmoderne Büroräume, dazu kommen im unteren Gebäudeteil Lobby, Fitnesscenter, Shopping und Gastronomie sowie eine Tiefgarage.
Hocheffiziente Glasfassade setzt Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit
Nicht nur optisch ist der Salesforce Tower ein imposantes Bauwerk: Auch im Bezug auf Nachhaltigkeit setzt der komplett verglaste Skyscraper Maßstäbe – u. a. durch die Wahl der Baumaterialien wurden beim Salesforce-Tower 19 % CO2 eingespart. Im Betrieb nutzt das Gebäude ausschließlich Strom, sodass der Energiebedarf vollständig CO2-neutral aus regenerativen Quellen gedeckt werden kann. Damit erreicht der Salesforce Tower Chicago eine Zertifizierung nach LEED-Standard in Gold. Bewertet wurden nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte wie Energie, Wasser oder Gesundheit, sondern das Zusammenwirken aller wichtigen Elemente im Gesamtbild.
Die hocheffiziente Glasfassade, in der sich die Umgebung widerspiegelt, zeichnet den Salesforce Tower also nicht nur optisch aus: Auch in puncto Nachhaltigkeit des Gebäudes spielt sie eine herausragende Rolle.
Sie sorgt im Inneren für maximalen Tageslichteinfall und blockiert gleichzeitig 15 % des UV-Lichts, was das Aufheizen der Räume minimiert. Der entscheidende Faktor, um das möglich zu machen, ist dass die Isolierglaselemente mit dem äußerst robusten und langlebigen Warme-KanteSystem Ködispace 4SG von H. B. Fuller | KÖMMERLING ausgestattet sind. Dieses reaktive thermoplastische Abstandhaltersystem zeichnet sich durch seine einzigartige Optik, höchste Energieeffizienz und maximale Lebensdauer aus. Grundlage dafür ist der besondere Aufbau: Die Warme Kante besteht aus nur einem Dichtstoff, der per Roboter vollautomatisch appliziert wird und sich chemisch sowohl mit der Glasoberfläche als auch mit der Silikonsekundärversiegelung verbindet. Dadurch „verschmilzt“ der gesamte Randverbund zu einer flexiblen und hochbelastbaren Einheit mit hervorragender Gasdichtigkeit und maximaler Lebensdauer. So bleiben die Isoliergläser auch bei starker thermischer Belastung dauerhaft energieeffizient und schützen das Gebäude vor Hitzeeintrag oder Wärmeverlust.
Langlebige Warme Kante von H. B. Fuller | KÖMMERLING
Dr. Christian Scherer, Head of Business Development Glass, erklärt: „Mit Isolierglaselementen mit einem Randverbund aus Ködispace 4SG wird die Glasfassade des Salesforce Tower auch nach vielen Jahren immer noch eine ausgezeichnete Energieeffizienz aufweisen. Diese Gasdichtigkeit können wir inzwischen messtechnisch mehrfach an konkreten Gebäuden und in extremen Langzeittests nachweisen.“ Damit ist das Warme-Kante-System von H. B. Fuller | KÖMMERLING optimal für den weltweiten Einsatz in nachhaltiger Glasarchitektur mit höchsten Anforderungen geeignet.
Als Partner für nachhaltige Architektur unterstützt H. B. Fuller | KÖMMERLING innovative Bauprojekte mit Forschung, eigenem Know-how und Produkten rund um hocheffiziente Verglasungen bis hin zur unabhängigen Nachhaltigkeitszertifizierung.
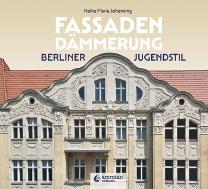
Wer sich für historische Jugendstilfassaden begeistert, muss nicht unbedingt nach Riga oder auf die Darmstädter Mathildenhöhe reisen. Auch Berlin bietet zu diesem Thema architektonischen Anschauungsunterricht. Natürlich: Die Vergangenheit der deutschen Hauptstadt ist geprägt von Kriegen, politischen Umbrüchen und auch so manchen Freveltaten an Mietshäusern, die nicht immer ihre alleinige Ursache in der Sanierung haben. Die „Entstuckung“ und falsch verstandene bzw. eine einseitige, allein vom Preis diktierte „Modernisierung“ der Gebäude veränderten das Gesicht der Stadt und ihren Geist. Trotzdem: Zahlreiche Jugendstilfassaden haben die Zeit überdauert und können noch heute in ihrer ganzen Pracht be-
Weitere Informationen: Kömmerling Chemische Fabrik GmbH Dr. Christian Scherer Zweibrücker Straße 200, 66954 Pirmasens, Tel. (06331) 56-0 marketing.koe@hbfuller.com, www.koe-chemie.de
wundert werden – auch als Gegenpol zur zu Recht kritisierten „Schießschartenarchitektur“. Neben Highlights wie dem ehemaligen Hertie Kaufhaus der Gebrüder Tietz in der Klosterstraße 64, dem Hebbel-Theater (heute das HAU1) und dem U-Bahnhof Bülowstraße in Schöneberg präsentiert das Buch über 70 Häuserfassaden und Hauseingänge, zumeist von Mietshäusern, aus dem gesamten Stadtgebiet. Das Schönste blüht meist im Verborgenen: Zahlreiche farbige Fenster, Pflanzenelemente, Drachen, Fratzen, Maskarone und künstlerisch gestaltete Fliesen in den Eingangsbereichen und Treppenhäusern in den Kiezen von Charlottenburg und Prenzlauer Berg und anderswo lassen sich mit diesem Buch entdecken. Zwei von der Autorin vorgeschlagene Stadtspaziergänge sind dabei ein appetitmachender Anfang.
Heike Maria Johenning: Fassadendämmerung – Berliner Jugendstil. Berlin: ammian Verlag 2023. 282 S., ISBN 978-3-948052-56-0, 28,00 €
Verarbeitungshandbuch



Fassadenplatten und Paneele von Rockpanel bestehen im Kern aus hoch verdichteter Steinwolle, die aus Gestein wie Basalt hergestellt wird. Sie sind deshalb von Natur aus nichtbrennbar, robust und nachhaltig. Darüber hinaus sind sie, weil UV- und feuchtigkeitsbeständig, besonders langlebig. In einem leicht verständlichen Manual fasst der Hersteller Informationen rund um die Montage seiner Platten und Paneele zusammen.
Nach einem Sortimentsüberblick, der die Besonderheiten und technischen Daten zu allen Serien zusammenfasst, werden im Kapitel „Handling und Bearbeitung“ konkrete Anleitungen zur Montage sowie nützliche Hinweise zu Transport und Lagerung gegeben. Das sorgt nicht nur für Qualität in der Verarbeitung, sondern zeigt, wie in der Werkstatt und auf der Baustelle Zeit gespart werden kann. Wichtige Details machen anschauliche Illustrationen verständlich. So werden etwa die verschiedenen Unterkonstruktionen und Befestigungstechniken in Konstruktionszeichnungen dargestellt. Dabei werden Lösungen sowohl
für den Neubau als auch für Modernisierungs- und Renovierungsprojekte gezeigt.
So vielfältig und variantenreich die Oberfläche einer Fassade, die mit Rockpanel gestaltet wurde, im Endergebnis ausfallen kann, so einfach ist dennoch deren Verarbeitung. Rockpanel Fassadenplatten und Paneele sind auf der Baustelle mit Standardwerkzeug so flexibel zu verarbeiten wie Holz, wodurch die Montagekosten überschaubar bleiben. Ohne besondere Vorbehandlung lassen sich die Platten und Paneele biegen. Viele Serien zeichnen sich durch eine homogene Farboberfläche aus, dank derer die Platten und Paneele richtungsungebunden verarbeitet werden können.
„Mit unserem Verarbeitungshandbuch zeigen wir, wie Fassaden und einzelne Bauteile der Gebäudehülle mit Produkten von Rockpanel sehr einfach zu gestalten und zu schützen sind. Als wichtiges Manual für die Praxis gibt es unseren Partnern im Handwerk wichtige Hinweise dazu, wie sie Zeit sparen und sicher montieren,“ erklärt Holger Klomp, Marketing-Kommunikations-Manager bei Rockpanel.
Das Verarbeitungshandbuch von Rockpanel zeigt Wege auf für ein zeitsparendes Handling, die sichere Bearbeitung von Fassadenplatten und Paneelen in der Werkstatt und vor Ort sowie zur passenden Unterkonstruktion und Befestigungstechnik. Das Manual steht zum Download bereit unter: https://qrco.de/RPVerarbeitungshandbuch.

Für die Erweiterung des Campus Reutlingen in Baden-Württemberg wurde als Teil eines Ensembles das Texoversum, ein Lehr-, Forschungs- und Innovationszentrum der Querschnittstechnologie Textil, im Rahmen des Masterplanes entwickelt und umgesetzt. Der Neubau, gespendet vom Arbeitgeberverband Südwesttextil e. V., ist ein kraftvoller und gleichzeitig kommunikativer Baustein im städtebaulichen Gefüge der Hochschule und erhielt im Rahmen des Deutschen Hochschulbaupreises eine Auszeichnung. Seine gesponnene Fassade verleiht dem Gebäude eine einzigartige Optik.
Die TEXOVERSUM Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen hat ein neues Gesicht erhalten. Der im Sommer 2023 fertiggestellte Bau ergänzt das bestehende CampusEnsemble aus Forschungs- und Lehreinrichtungen. Das Entwurfsteam – eine Kooperation der Architekturbüros Allmann Wappner, Menges Scheffler Architekten und Jan Knippers Ingenieure – bringt den Schwerpunkt der Fakultät in der vorgesetzten Fassade zum Ausdruck: Glas- und
Carbonfasern setzen sich – robotisch gewebt – zu einer luftig-transparenten Hülle zusammen, die neben funktionalen Anforderungen vor allem ein visuelles Statement setzt.
Repräsentative identitätsstiftende Gebäudehülle
Das Entwurfsthema textiles Bauen spiegelt sich sowohl strukturell in der internen Verwebung der Funktionen als auch in der repräsentativen identitätsstiftenden Gebäudehülle wider. Die erstmalig so umgesetzte Fassade aus Kohlenstoff- und Glasfasern repräsentiert die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit faserbasierter Werkstoffe und textiler Techniken. In einem robotischen Wickelprozess wird jedes einzelne Fassadenelement individuell an die Erfordernisse der Nutzung angepasst. Ausgehend von fünf Basismodulen transformieren sich die Elemente entsprechend dem Sonnenverlauf und bilden ein einzigartiges, vielschichtiges Erscheinungsbild. Die Elemente sind komplett selbst-


tragend und benötigen keine unterstützende Tragstruktur. Ihre versetzte Anordnung erlaubt freie Durchblicke. Neben den funktionalen Anforderungen wie Absturzsicherung und außenliegendem Sonnenschutz erfüllt die Fassade ästhetische und repräsentative Ansprüche.
Offenes Raumkonzept
Durchlässigkeit und Vernetzung als zentrale Elemente des architektonischen Konzepts setzen sich in der Konzeption des Baukörpers fort. In der inneren Struktur ist das Texoversum als offenes, transparentes Gebäude mit Split-Leveln gestaltet. Die halbgeschossig versetzten Ebenen, die über das Atrium auch visuell miteinander verwoben sind, verbinden die unterschiedlichen Nutzungsbereiche miteinander und bilden ein räumliches Kontinuum, das in einer großzügigen Dachterrasse seinen Abschluss findet. In ihrem Erscheinungsbild sind sie geprägt von einem robusten Werkstattcharakter mit Industrieestrich- und Sichtbetonflächen sowie offen installierten Technikdecken. Das offene Raumkonzept schafft eine gemeinschaftliche Arbeitsatmosphäre für die unterschiedlichen Nutzergruppen und bietet Plattformen für lebendigen Austausch.
Netzwerke aus Carbonfasern
Die fast 2.000 m2 große textilartige Fassade des neuen Gebäudes verbindet die Innovationskraft des Textilstandorts Reutlingen mit produktions- und materialtechnologischer Innovation. Die Fassadenbauteile wurden am Computer entworfen und mit Robotern aus Fasern gewickelt. Für die nötige Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Verbunds sorgt das Polyurethan-Harzsystem Desmocomp von Covestro, in dem die Fasern wie in einer Matrix eingebettet werden. Ähnlich wie Netzwerke in der Natur, etwa in Spinnennetzen, Käferflügeln oder Palmenblättern, sind auch die Faserstrukturen sehr leichtgewichtig und zugleich hoch belastbar. Der erforderliche Materialeinsatz ist auf ein Minimum reduziert.
Im Texoversum übernimmt die gesponnene Fassade gleich mehrere wichtige Funktionen: Sie verleiht dem Gebäude eine einzigartige Optik und stabilisiert die umlaufenden Balkone. Zudem dient sie als Geländer und sorgt
für die nötige Beschattung der dahinter liegenden Glasfront.
Integrativer und digitaler Ansatz bei minimalem Materialeinsatz
Die selbsttragende Hülle besteht aus 476 dreieckigen und trapezförmigen Elementen. Die einzelnen Elemente sind untereinander über Bolzen verbunden – für diese wurden im Wickelprozess Hülsen in die Fasern eingebettet. Für die Herstellung der 476 Fassadenelemente wurden lediglich ein dreieckiges Wickelgerüst für das Regelbauteil und ein trapezförmiger Rahmen für die Eckbauteile benötigt. Zudem ist die Rückverankerung an das Gebäude geschraubt, sodass die gesamte Fassade zerstörungsfrei zurückgebaut werden kann.
Durch den Einsatz dieses einfachen und vielfach wiederverwendbaren Lehrgerüsts kann gegenüber herkömmlichen Herstellungsverfahren, etwa beim Betongießen mit aufwendigen und materialintensiven Schalungen, viel Material eingespart werden. Ein weiterer Vorteil der robotischen Fertigung liegt u. a. auch im Variantenreichtum, mit dem der vorab programmierte Roboter die Fasern wickelt.
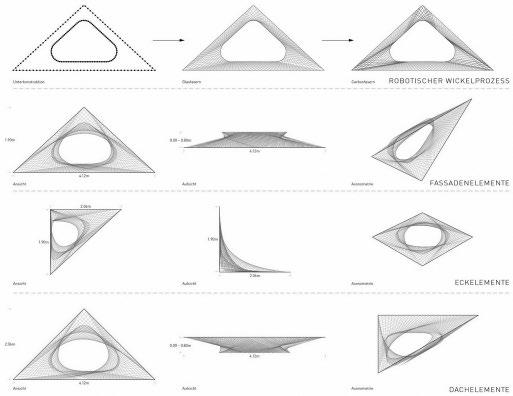
So können Anzahl, Anordnung und Ausrichtung der Fasern punktgenau gesteuert werden, sodass nur ein Minimum an Material benötigt wird und keinerlei Abfall oder Verschnitt entsteht – jeder Zentimeter Faserstrang wird genutzt.
Jedes einzelne Fassadenelement kann individuell an die Erfordernisse der Nutzung angepasst werden: Ausgehend von drei Grundmodulen transformieren sich die Elemente entsprechend der Blickrichtungen und des Sonnenverlaufs. So gibt es Bereiche mit dichter oder weniger dicht gewickelten Fasern sowie Flächen ohne Fasern. Dadurch fungiert die Fassade als außenliegender Sonnenschutz für den rundum verglasten Baukörper und lässt zugleich an bestimmten Stellen Ausblicke auf den Campus zu.
Die algorithmische Generierung des Fassadenverlaufs, also die unterschiedlichen Öffnungsgrade, erfolgte innerhalb einer üblichen CAD-Umgebung durch ein Plug-In. Darin integriert sind die Simulations- und Analyseergebnisse der beteiligten Fachplanerinnen und Fachplaner, darunter der Sonnenverlauf, die erforderlichen Verschattungsgrade und die tragwerksplanerischen Anforderungen.
Europaweiter Leuchtturm für textile Ausbildung und Innovation
Das Texoversum soll sich zum neuen Leuchtturm der Branche entwickeln. Mit Werkstätten, Laboren und ThinkTank-Flächen ist das innovative Gebäude die Zukunftswerkstatt für den „textilen“ Nachwuchs. Und es ist auch ein visionäres Dach für viele Aktivitäten wie Studieren, betriebliche Ausbildung, Forschen, Experimentieren, Zusammenkommen. Der Neubau ist ein echter Hingucker – und erfüllt
neben funktionalen Anforderungen auch höchste ästhetische und repräsentative Ansprüche.
Der über 160 Jahre alte Textilstandort Reutlingen verfügt damit über ein innovatives und identitätsstiftendes Gebäude als Impulsgeber für die Zukunftstechnologie Textil.
Quellen: www.tex.reutlingen-university.de, www.fibr.tech, www.covestro.com, www.allmannwappner.com, www.suedwesttextil.de

Bautafel
Texoversum, Reutlingen
■ Bauherr: Südwesttextil – Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie
■ Architektur: allmannwappner, München; Menges Scheffler Architekten, Frankfurt/M.; Jan Knippers Ingenieure, Stuttgart
Projektbeteiligte:
■ allmannwappner, München (Generalund Objektplanung); Menges Scheffler Architekten, Frankfurt/M. (Objektplanung Sekundärfassade); Jan Knippers Ingenieure, Stuttgart (Tragwerksplanung Sekundärfassade); FibR, Kernen (Herstellung Sekundärfassade); bwp Burggraf + Reiminger, München (Tragwerksplanung Gebäude); Müller-BBM Building Solutions, Planegg (Bauphysik); Glück Landschaftsarchitektur, Stuttgart (Landschaftsplanung)
■ Bruttogrundfläche: 4112 m2
■ Fertigstellung: 2023
Weitere Informationen:
Südwesttextil – Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V. Türlenstraße 6, 70191 Stuttgart
Tel. (0711) 210 50-0, Fax (0711) 23 37 18 info@suedwesttextil.de www.suedwesttextil.de
Fassadenlösungen façade solutions www.schindler-roding.de


Innovationsbogen Augsburg
Hadi Teherani Architects, Hamburg

Bild 1. Das Gebäude-Ensemble auf dem Reismühleareal besteht aus vor- und zurückspringenden viergeschossigen Wohnhäusern mit Staffelgeschoss. Als Balkonkonstruktion dienen vor das Gebäude gestellte Stahlrahmen, die sich mit aluminium-natureloxierten Raffstores und roten Stoffmarkisen von der vorvergrauten Holzfassade des Gebäudes abheben.
Jedes Sommerhalbjahr werkelt sie noch, die historische Reismühle Hegi in Winterthur in der Schweiz. Dann fliegen im Schaubetrieb die Späne und die Museumsbesucher schauen zu, wie die wasserbetriebene Säge aus Baumstämmen Balken sägt. Unweit der historischen Stätte am Reismühle-Kanal hat das atelier ww eine Wohnanlage mit 109 Wohnungen und ca. 1.500 m2
Gewerbefläche realisiert. Der im Dialog mit der Fachgruppe Stadtgestaltung entwickelte Entwurf wurde im Standard SIA Effizienzpfad 2040 ausgeführt. Um die von der Mühle inspirierte Fassade gleichzeitig nachhaltig und schnell zu realisieren, wurde die Schalung mit der REISSER Distanzschraube RDS befestigt. Wohn- und Gewerbebau

Bild 2. Die Holzfassaden der Fünfgeschosser ließen sich mithilfe der REISSER Distanzschraube RDS schnell und präzise montieren.

3. Die vereinfachte, aber hochpräzise Vorgehensweise bei der Montage der Holzverschalung durch provisorisches Befestigen, Ausnivellieren und Fixieren schafft trotz weniger Arbeitsschritte ein perfektes Erscheinungsbild der Fassaden. (Fotos 1–3: Lucas Peters)
Zwischen Reismühle-Kanal, Eulachpark und dem alten Dorfkern von Hegi gelegen, gliedert sich die L-förmige Anlage in fünf gegeneinander versetzte Gebäudetrakte an der Rümikerstraße und einen in zwei Baukörper gegliederten Kopfbau an der Hegifeldstraße. Das viergeschossige Ensemble mi Staffelgeschoss, das durch eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen verbunden ist, passt sich damit der kleinteiligen Bebauung der dörflichen Umgebung an. Gleichzeitig ermöglichen die zusätzlichen Fassadenflächen, die durch die Vor- und Rücksprünge der aneinandergereihten Dreiund Vierspänner entstehen, eine optimale Belichtung der Wohnräume.
Die Wegeführung und die Gartengestaltung des Grundstücks spiegeln die vor- und zurückspringenden Gebäudetrakte wider und gipfeln in mehreren gemeinschaftlichen und privaten Freisitzen. Der gewerblich orientierte Kopfbau im Norden des Grundstücks orientiert sich zur Kreuzung und springt hier zugunsten eines kleinen Vor-
platzes zurück. Alle Wohnungen sind in Ost-West-Richtung durchgesteckt. Die Nebenräume liegen jeweils in der Nähe des Treppenhauses, die Wohnräume sind zum Garten hin orientiert. Jede Erdgeschosswohnung hat Zugang zum eigenen Garten, die Dachgeschosswohnungen verfügen über private Dachterrassen. Als Balkonkonstruktion für die Einheiten in den Obergeschossen dient ein vor das Gebäude gestellter Rahmen aus verzinktem Stahl, der sich mit seinen aluminium-natureloxierten Raffstores und roten Stoffmarkisen deutlich von der vorvergrauten Holzfassade des Gebäudes abhebt.
Holzschalung mit RDS auf Distanz gehalten und schneller verschraubt
Diese setzt in Anlehnung an das benachbarte Sägewerk auf eine vertikal verbaute Fichtenholzschalung, die in den Vor- und Rücksprüngen abwechselnd hell und dunkel gestaltet und mit hellen Fenstern kombiniert ist. Um sie nachhaltig und dabei so schnell wie möglich zu montieren, arbeitete das Holzbauunternehmen zur Befestigung mit der REISSER Distanzschraube RDS aus A4 Edelstahl. Der brandschutzkonforme Werkstoff ist für unsichtbare und nicht mehr zugängliche Verschraubungen von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden gefordert.
Die in der Schweiz seit 25 Jahren bewährte, in Deutschland jedoch noch relativ unbekannte Distanzschraube ist im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben für die Montage von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden zudem mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze ausgestattet. Das Kopfgewinde hält das zu fixierende Profil (Holz oder Aluminium) auf Distanz. Das Dübelgewinde dient der Befestigung im Untergrund mittels Kunststoff-Rahmendübel zur Lastabtragung auf Zug und Druck. So ermöglicht die Schraubenkonstruktion das Nivellieren und Verschrauben großer Fassadenflächen in hoher Geschwindigkeit – eine Anforderung, die auch bei der Wohnanlage an der Reismühle die Wahl des Befestigungsmittels maßgeblich beeinflusste.









4. Mit der REISSER Distanzschraube RDS lassen sich sekundäre Holz-Unterkonstruktionen befestigen, samt der Möglichkeit der Durchsteckmontage ohne arbeitsintensives Ausschneiden der Dämmstoffe.
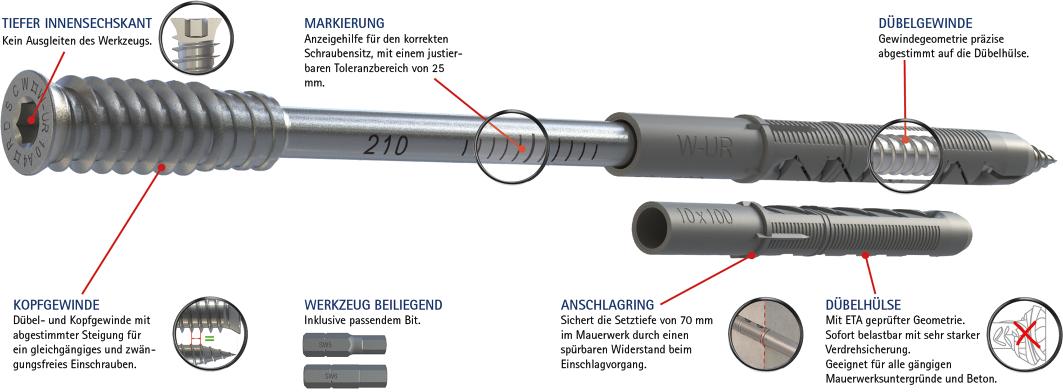
Bild 5. Der multifunktionale Aufbau der REISSER Distanzschraube RDS mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze beschleunigt die Montage von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF): Das Kopfgewinde hält das zu befestigende Profil (Holz oder Aluminium) auf Distanz. Das Dübelgewinde – in Kombination mit Kunststoffrahmendübeln – fixiert die Schraube im Untergrund, belastbar auf Zug und Druck. (Fotos 4 und Grafik 5: REISSER Schraubentechnik GmbH)
REISSER Distanzschraube RDS: Die neue Art der Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)
Die REISSER Schraubentechnik GmbH bietet mit der Distanzschraube RDS ein neues Verbindungsmittel für die einfache, wirtschaftliche und quasi wärmebrückenfreie Montage von VHF. Die neu zugelassene Distanzschraube macht es möglich, VHF schnell und einfach an Beton und Mauerwerk zu montieren. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben ist die REISSER Distanzschraube RDS mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze versehen. Das Kopfgewinde hält das zu befestigende Profil (Holz oder Aluminium) auf Distanz. Das Dübelgewinde in Kombination mit dem Kunststoffrahmendübel verankert das System in der Außenwand. Dieses ist belastbar auf Zug und Druck. Die REISSER Distanzschraube RDS verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) mit der Nummer Z-21.2-2130. Sie kann sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von Bestandsbauten eingesetzt werden.
Da REISSER Distanzschrauben RDS nach der Montage unsichtbar verbaut und nicht mehr zugänglich sind, muss das Verbindungsmittel aus rostfreiem Edelstahl (A4) hergestellt werden – so verlangt es die Richtlinie bei VHF. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit dieses Werkstoffs ergibt sich als positiver Effekt außerdem eine fast wärmebrückenfreie Befestigung. Weiterhin erfüllt die A4-Distanzschraube als brandschutzkonformes Verbindungssystem die gängigen Brandschutzanforderungen und ist damit ein sicheres Verbindungssystem im Bereich der VHF. Es eignet sich auch für tausalzwasserbeständige Fassaden z. B. in Salzzonen und Wellness-Außenbereichen. Und zu guter Letzt ist die REISSER Distanzschraube RDS rundum kompatibel mit allen handelsüblichen druckfesten bzw. druckweichen Dämmstoffen und Profilen, d. h. dank der Durchsteckmontage lassen sich druckfeste Materialien genauso einfach befestigen wie druckweiche, ohne dass die Dämmung umständlich ausgeschnitten werden muss. Dämmstoffabfälle werden somit minimiert und Dämmfehler verhindert. So führt auch die Reduzierung der insgesamt zur Montage notwendi-
gen Arbeitsschritte – die Verarbeitungszeit verringert sich bis zu 50 % – zu einer höheren Kosteneffizienz und damit zu einer besonders wirtschaftlichen Lösung.
Die REISSER Distanzschraube RDS kann gleichermaßen für nachträgliche optische Veränderungen an Fassaden angewendet werden, wie z. B. Elemente aus Maxplatten, Aluminiumverbundplatten, Eternit (Cemprit), Werbetafel-Befestigungen, Holzbeplankungen und nachträgliche Solarpaneele-Befestigungen. Und schließlich gewährleistet die restlose Rückbaubarkeit dieser Systemschraube die 100-prozentige Wiederverwertbarkeit der Materialien und damit die Nachhaltigkeit des Produkts.
Anhand der Fassadenlast ist zudem eine genaue Berechnung der Schraubenanzahl pro m2 möglich, und damit die Ermittlung des Bedarfs an Distanzschrauben für ein ganzes Bauvorhaben. Das Passivhaus Institut in Darmstadt verlieh den REISSER Distanzschrauben RDS-CA und RDS-CW in der Kategorie „Fassadenanker“ Mitte März 2024 ein Zertifikat als Passivhauskomponente vor Mauerwerk oder Beton. Für die Zuerkennung des Zertifikats wurden ein Effizienzkriterium und ein Komfortkriterium bei der Fassade eines Schulgebäudes als Referenzfassade geprüft. Die ermittelten Kennwerte für den jeweiligen Wärmebrückenverlustkoeffizient und die Oberflächentemperaturen erfüllten die notwendigen Anforderungen und sind auf dem Zertifikat dokumentiert
Eine statische Vorbemessung ist seit dem 1. April 2023 online verfügbar. Ein Video zum Montageprinzip der RDS steht unter https://bit.ly/3S0yTWz zur Verfügung.
Bild 6. Der multifunktionale Aufbau der REISSER Distanzschraube RDS mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze beschleunigt die Montage von VHF: Das Kopfgewinde hält das zu befestigende Profil (Holz oder Aluminium) auf Distanz. Das Dübelgewinde – in Kombination mit Kunststoffrahmendübeln – fixiert die Schraube im Untergrund, belastbar auf Zug und Druck. (Foto: REISSER Schraubentechnik GmbH)
Erste Abhebesicherung mit Zulassung für HBV-Decken mit Kervenverbund: Der neue REISSER KVB-Verbinder



Bild 7. Der neue REISSER KVB-Verbinder als Abhebesicherung für Holz-Beton-Verbund-Decken mit Kervenverbund ist aktuell das einzige Verbindungsmittel mit Zulassung in Form einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG). (Foto 7 links: REISSER Schraubentechnik GmbH)
Mit dem neuen KVB-Verbinder bietet REISSER die erste Abhebesicherung mit Zulassung für Holz-Beton-Verbund(HBV)-Decken mit Kervenverbund. Die bis dato über die Norm nicht eindeutig geregelte Tragfähigkeit von Abhebesicherungen solcher HBV-Konstruktionen ist durch die neue allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) des REISSER KVB-Verbinders jetzt erstmalig und eindeutig für ein solches Verbindungsmittel geregelt.
Der neue REISSER KVB-Verbinder mit allgemeiner Bauartgenehmigung für HBV-Decken mit Kervenverbund (aBG Z-9.1-916) ist das erste Verbindungsmittel, das die Tragfähigkeit für den Einsatz als Abhebesicherung eindeutig regelt. Der Verbund zwischen Holzbauteil und Betonplatte erfolgt über sogenannte Kerven (Vertiefungen über die Bauteilbreite) im Holzbauteil. Sie werden mit Beton ausgegossen und verbinden die beiden Bauteile dadurch schubfest miteinander. Für einen kraftschlüssigen Verbund benötigen solche HBV-Decken lediglich Schrauben, damit die Betonplatte nicht vom Holz abhebt. Die senkrecht in die Holzkonstruktion eingedrehten REISSER KVB-Verbinder dienen der Aufnahme von Zugkräften zwischen Betonplatte und Holzbauteil im Bereich der Kerve. Je nach statischem Modell können KVB-Verbinder sowohl in der Kerve, als auch außerhalb davon gesetzt werden. Als Abhebesicherung übertragen sie planmäßig axiale Zugbeanspruchungen rechtwinklig zur Verbundfuge zwischen Beton und Holz. Nach der aktuell gültigen Norm (EC 5) kann eine Decke mit Holz-Beton-Kervenverbund derzeit nicht eindeutig regelkonform bemessen werden, weil der EC 5 hierfür u. a. keine Tragfähigkeitswerte für den Kopfdurchzug aus dem Beton liefert. Gleichzeitig fordert jedoch die noch nicht eingeführte Technische Spezifikation DIN CEN/TS 19103 (für die nächste Generation der Eurocodes) eine Abhebesicherung. An dieser Stelle schafft die aBG Z-9.1-916 des REISSER KVB-Verbinders nun als einziges Verbindungsmittel Abhilfe sowie Planungssicherheit bei der Bemessung und Ausführung von HBV-Decken mit Kervenverbund. So enthält die aBG beispielsweise Tragfähigkeitstabellen, um die Bemessung der Abhebesicherung zu erleichtern. Denn es müssen vier Versagenskriterien untersucht werden, wie Ausziehversagen der REISSER-Schrauben aus dem Holzbauteil, Stahlzugversagen der REISSER-Schrauben, kegelförmiger Betonausbruch und Herausziehen der REISSER-Schrauben aus dem Beton. Mit Hilfe der Tragfähigkeitswerte in den Tabellen lässt sich die Überprüfung einfach bewerkstelligen, ohne dass jedes Versagenskriterium einzeln nachgerechnet werden muss.
Bis zu 6-fach höhere Tragfähigkeit für ein Minimum an
Die Einbindetiefen des REISSER KVB-Verbinders in Holz und Beton garantieren eine bis zu 6fach höhere Tragfähigkeit gegenüber herkömmlichen Tellerkopfschrauben, was die Anzahl der erforderlichen Abhebesicherungen auf ein Minimum reduziert. Dadurch verbessert sich in der Gesamtbetrachtung die Wirtschaftlichkeit von HBV-Decken mit Kervenverbund erheblich. Schon durch die Reduzierung der Verbindungsmittel trägt der REISSER KVB-Verbinder zum effizienten Umgang mit Verbindungsmittel bei und hilft damit, Ressourcen zu sparen.
Der Schraubenkopf des REISSER KVB-Verbinders ist wie ein Betonanker einbetoniert. Um die Zugkraft des Verbinders ausschließlich über den Kopf zu übertragen, ist das Schraubengewinde durch eine Hülse vom Beton getrennt. Diese Hülse unter dem Schraubenkopf bzw. der Unterlegscheibe des Verbinders sorgt „nebenbei“ noch für eine exakte Einbindetiefe sowohl ins Holz als auch in den Beton und damit für Sicherheit bei der Montage. Aktuell ist der KVB-Verbinder mit einem Durchmesser von 8 mm und in 20-mm-Abstufungen in den Längen von 200 mm bis 300 mm erhältlich. Die REISSER KVB-Verbinder sind in der aBG in puncto Einbindetiefen sowohl in Holz als auch in Beton flexibel

Bild 8. Der REISSER KVB-Verbinder kann bei Holz-Beton-Verbund-Bauteilen sowohl in Rippendecken als auch in flächigen Holzelementen aus Brettsperrholz, Brettschichtholz oder Brettstapel eingesetzt werden. (Fotos 7 Mitte und 7 rechts und Foto 8: Brüninghoff Group)
anwendbar. Sie lassen sich an die statischen Anforderungen der jeweiligen HBV-Decke anpassen.
So hat beispielsweise der REISSER KVB-Verbinder 8 × 200 (70/130) verglichen mit einer 8 × 200-Tellerkopfschraube eine nahezu doppelte Tragfähigkeit als herkömmliche Tellerkopfschrauben. Dies wiederum kann die Schraubenzahl halbieren. Die Anzahl der Abhebesicherungen reduziert sich weiter, wenn die HBVDeckenkonstruktion eine größere Einbindetiefe des Gewindes im Holz zulässt.
Top Wirtschaftlichkeit dank „1-2-Mann“-Montage
Da das Montagesystem mit der REISSER Distanzschraube RDS aufgrund der sogenannten „1-2-Mann-Montage“ grundsätzlich einen schnellen Montageablauf ermöglicht, ließ sich die Gebäudehülle – je nach Fassadenwand – mit nur einem Monteur oder maximal zwei Monteuren zügig und in bester Qualität ausführen. Dabei brachte ein Monteur die Fassadendämmung zunächst vollflächig an, steckte ober- und unterhalb der Dämmung entsprechende Hilfswinkel ein und befestigte die Unterkonstruktion für die Außenhaut mit der für alle handelsüblichen Dämmstoffe und Profile geeigneten REISSER Distanzschraube RDS zunächst provisorisch. Auf dieser Unterkonstruktion wurde nun die Schalung befestigt und mit einem Laser exakt ausgerichtet. Die durchgehende Festverschraubung erfolgte erst ganz zum Schluss. Die vereinfachte Befestigungsmethode erfordert insgesamt weniger Arbeitsschritte, da der Dämmstoff für die Verschraubungen nicht ausgeschnitten werden muss. Dies wirkt Konstruktionsfehlern entgegen und führt zu erheblicher Zeit- und Materialersparnis, verbunden mit einer verarbeitungsfreundlichen
Beim Eindrehen der REISSER KVB-Verbinder sind außerdem keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich, was bei der Montage Zeit spart. Eine weitere Zeitersparnis ergibt sich aufgrund der geringeren Menge an einzubauenden Verbindern. Und zu guter Letzt hat man bei der Entwicklung und dann auch in der aBG des REISSER KVB-Verbinders die Themen Kreislaufwirtschaft, Rückbaubarkeit sowie das Trennen von Bauteilen bereits berücksichtigt.
Montage und einer höheren Wirtschaftlichkeit. Und zu guter Letzt ergeben sich wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes A4 über die Verschraubungen mit der REISSER Distanzschraube RDS nur minimale Wärmeverluste.
Bautafel
Wohn- und Gewerbeanlage Reismühle Areal, Winterthur/ Schweiz
■ Bauherr: Asga Pensionskasse Genossenschaft, St. Gallen/ Schweiz
■ Planung: atelier ww Architekten SIA AG, Zürich/Schweiz
■ Ausführung: Gadola Fassaden, Oetwil am See/Schweiz
Weitere Informationen: REISSER Schraubentechnik GmbH Fritz-Müller-Strasse 10, 74653 Ingelfingen-Criesbach/Schweiz Produktkommunikation: Delia Pander Tel. +49 7940 12 73 89 delia.pander@reisser-screws.com, www.reisser-screws.com
Vom 27.–28.02.2025 findet in Wien das European Facade Summit (EFS) als Kongress für intelligente und nachhaltige Fassadenlösungen statt – ein technologieübergreifender Kongress für die gesamte Industrie. Schwerpunkte sind Strategien, Tools und Analysen zu Vorhangfassaden und VHF sowie zukunftsweisende Technologien und Innovationen. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie auf Chancen und Herausforderungen.
Der Kongress gliedert sich in drei Bereiche:
Ökologie und Nachhaltigkeit: Herausforderung Energiewende
– Anforderungen mit Blick auf die Gebäudehülle
– smarte Fassaden / Schnittmengen nachhaltiger Lösungen und intelligenter Systeme
– Forschung, Design, Demontage und Rückgewinnung für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft
– nachhaltiges Bauen im globalen Kontext der Stadtentwicklung
– Leuchtturm-Projekte.
Information und Netzwerk: Bühne, Diskussion und Exkursion
– prominent besetztes Podium.für Hersteller aller Technologien – Planer, Architekten und Zulieferer
– Bühne für Expertenvorträge
Innovation: Technologie und Digitalisierung
– intelligenter Sonnenschutz und KI-basierte Steuerung
– Fassade der Zukunft aus Architektensicht
– Transparenz in der Gebäudehülle
– mit Funktion, Design und Nachhaltigkeit zur dynamischen Gebäudehülle
– Leuchtturm-Projekte.
Weitere Informationen:
IC.Events by Interconnection Consulting
Interconnection Marketing u. Information Consulting GesmbH Franca Kircher
Getreidemarkt 1, A-1060 Wien/Österreich
Tel. +43 1 585 46 23-15 kircher@interconnectionconsulting.com, www.facade-summit.eu/de
Dämmplatten kommen an der Fassade zum Einsatz, um Gebäude zu isolieren und Energieverbrauch und Kosten zu senken. Sollen nachträglich Befestigungen wie Lampen oder Briefkästen angebracht werden, stellt sich die Frage, welche Befestigungsmittel verwendet werden können, ohne Wärmebrücken zu riskieren. Die Dämmstoffdübel und Dämmstoffschrauben von CELO sind genau auf diesen Anwendungsfall spezialisiert und vermeiden Wärmebrücken, verhindern den Eintritt von Feuchtigkeit und reduzieren so Gesundheitsrisiken wie Schimmel oder Schäden an der Bausubstanz.
Als Dübelhersteller mit 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb innovativer Befestigungslösungen in über 80 Länder weltweit hat CELO Befestigungssysteme GmbH ein umfassendes Sortiment an Isolierplattenschrauben und Isolierplattenschraubdübeln für die WDVS-gedämmte Fassade entwickelt. Das zeitsparende Sortiment für die gedämmte Fassade ist schnell, wärmebrückenfrei und selbstdichtend.
Anwender profitieren von wärmebrückenfreien Befestigungsprodukten „Made in Germany“, die durch die integrierte EPDM-Dichtung eine saubere Abdichtung gegen Schlagregen gewährleisten. Dank der scharfen Bohrspitze lassen sie sich direkt durch den Putz in die Dämmung einschrauben. Die zeitsparenden Befestigungen können in EPS Polystyrol-Dämmstoffplatten, XPS-Dämmstoffplatten wie Styrodur oder Perimeterdämmung, Mineralwolle und Rockwool sowie Holzfaserdämmplatten direkt eingeschraubt werden und sparen so wertvolle Montagezeit.
Im Fokus: Schnelle und saubere Befestigung von Regenfallrohrschellen in WDVS mit Isolationsdübel IPL 95DS
Durch die Wahl der richtigen Befestigungsprodukte lassen sich Lasten bis zu 20 kg pro Befestigungspunkt wie bei Regenfallrohren, aber auch leichtere Lasten wie Kappleisten, Briefkästen oder Wandanschlussprofile wärmebrückenfrei und schnell montieren. Der Isolationsdübel IPL 95DS wurde speziell für die Befestigung von Regenfallrohrschellen an der gedämmten Außenfassade entwickelt und zeichnet sich durch eine Vielzahl an Vorteilen aus:
Extrem schnelle Montage
Der Isolationsdübel IPL 95DS beschleunigt die Montage an gedämmten WDVS-Fassaden, da dank der scharfen Schneidspitze kein Vorbohren in Putz (< 7 mm) erforderlich ist. Außerdem ist der Abstand zur Wand um weitere 25 mm mit einem Spezialgewindestift verstellbar. Dieser ist im Dübel vormontiert, was eine extrem schnelle Montage ohne verlierbare Teile ermöglicht.
Hochwertige Materialien
Mit einer Länge von 95 mm ist der Isolationsdübel IPL 95 DS an allen gedämmten Fassaden ab 100 mm verwendbar. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie hartes Polyamid für den Dübelkörper und Zinklamellenbeschichtung bzw. rostfreier Stahl A2 für den Gewindestift macht den Dämmstoffdübel alterungs- und korrosionsbeständig.

1. Das umfassende Sortiment an Dämmstoffdübeln und -schrauben eignet sich für vielfältige Dämmstoffe und Anwendungen ganz ohne Wärmebrücke.

2. Der patentierte Isolationsdübel IPL 95DS: schnelle und saubere Befestigung von Regenfallrohrschellen in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). (Grafiken: CELO Befestigungssysteme GmbH)
Die halbtransparente Farbe ist optisch ansprechend und überstreichbar.
Regendicht und ohne Wärmebrücke
Der integrierte EPDM-Dichtring dichtet dauerhaft ab und ist UV-beständig. Da nachträgliches Abdichten entfällt, wird Montagezeit eingespart und gleichzeitig die Fassade intakt gehalten und Wärmebrücken werden verhindert. Die zuverlässige Abdichtung gegen Schlagregen bis zu Windstärke 11 Beaufort (orkanartiger Sturm) wurde in Tests des Prüfinstituts für Bauelemente Rosenheim in Anlehnung an DIN EN 1027 bestätigt.
Made in Germany
Der alterungs-, witterungs- und UV-beständige Nylondübel „Made in Germany“ wird im CELO Werk in Aichach/Bayern gefertigt, von der Idee über die Produktion bis hin zu Verpackung und Versand. Dank des Einsatzes hochwertiger Materialien hält der Isolationsdübel IPL 95DS Temperaturen von –40 bis +80 °C stand und ist halogenfrei.
Weitere Informationen:
CELO Befestigungssysteme GmbH Industriestraße 6, 86551 Aichach Tel. (08251) 904 85-0 info@celofixings.de, www.celofixings.de
Eine 1999 als Luftschiffhangar errichtete Halle südlich von Berlin wird heute als Freizeit- und Vergnügungspark genutzt. Bis zu 6.500 Gäste pro Tag genießen Tropical Islands, Teil der spanischen Parques Reunidos Firmengruppe. Innen herrscht ganzjährig eine Durchschnittstemperatur von 26 Grad, außen je nach Jahreszeit nicht selten große Hitze oder Kälte – das stellt hohe Anforderungen an die Gebäudehülle und ihre Dämmung. Beides wird aktuell Schritt für Schritt – oder wie der Eigentümer sagt: „Tor für Tor“ – saniert. Die Fertigstellung ist abhängig von den Witterungsbedingungen aktuell für 2027 geplant.
Ein Teil des Energiesparkonzeptes wie des Schutzkonzeptes für die Gebäudesubstanz war eine zeitgemäße Dämmung der zwölf undurchsichtigen Tore der ehemaligen Luftschiffhalle. Diese bestehen innen aus Trapez-Stahlblechen und außen aus Aluminium. Zwischen den beiden Metallschalen sorgen eine Dämmschicht und eine Dampfbremse dafür, dass weder in der Dachkonstruktion Kondensat Schaden anrichten kann noch die feuchtwarme Innenraumluft im Tropical Islands auf eine kalte Gebäudehülle trifft. Denn dann kann die Raumfeuchte kondensieren und Wasser in die Badehalle abtropfen.
Wachsende Kondensatprobleme
Schon der frühere Eigentümer der Halle, das Unternehmen Cargolifter, hatte ein Dicht- und Dämmkonzept umgesetzt. Allerdings erwies sich in den folgenden Jahren, dass die seinerzeit erdachte Konstruktion der Dachaußenhaut den enormen Temperaturunterschieden nicht gewachsen war: Schon die Verschattung durch die Torrandträger sorgt für eine unterschiedliche Ausdehnung der Dachkonstruktion. Die Außenhülle wurde von Cargolifter aus großen, gebogenen Trapezblechen zusammengefügt, die der zum First hin konisch zulaufenden Form der Halle folgten. An Sommertagen mit hoher Sonneneinstrahlung erwärmten sich diese Bleche allerdings enorm und dehnten sich so stark aus, dass ihre Befestigungen unter Spannung gerieten. Einzelne Befestigungspunkte lösten sich,

Bild 1. Eine 1999 ursprünglich für den Bau von Zeppelinen errichtete Halle südlich von Berlin wird heute als Freizeit- und Vergnügungspark genutzt. Bis zu 6.500 Gäste pro Tag genießen Tropical Islands, Teil der spanischen Parques Reunidos Firmengruppe. Innen herrscht ganzjährig eine Durchschnittstemperatur von 26 Grad, außen je nach Jahreszeit nicht selten große Hitze oder Kälte – das stellt hohe Anforderungen an die Gebäudehülle und deren Dämmung.
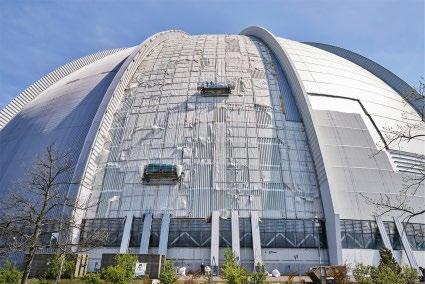
Bild 2. Nach dem Rückbau der Verkleidung aus Aluminiumblechen und der alten Dämmung wurde die 2006 verarbeitete Dampfbremse sichtbar. Auch sie musste rückstandslos von der inneren Trapezblechschale entfernt werden. Pro Tor werden zwei Arbeitsbühnen über ein geprüftes Seilzugsystem vertikal und horizontal so bewegt, dass je drei Mitarbeiter pro Bühne ihre Aufgaben sicher erledigen können.
die Dämmlage war der Witterung ausgesetzt und wurde an immer mehr Stellen schadhaft. Auf der Innenseite der Hangarhülle entstand nun an kalten Tagen Kondensat an den Stahlblechen, wo die warme Raumluft auf kaltes, weil mangelhaft gedämmtes Blech traf.
Schäden unübersehbar
Mehrere Stürme seit der Errichtung räumten letzte Zweifel aus – die Komplettsanierung der zwölf Tore war unausweichlich: Die gebogenen Bleche am Hangar mit seiner Höhe von 107 m hatten unter dem Einfluss der enormen Windsogkräfte von 1,5 kN/m2 zahlreiche Befestiger abgesprengt. Der Blick ins nun offen liegende „Innenleben“ der Gebäudehülle bestätigte die Annahmen des Facility Managements: Teile der Dämmung waren verrutscht und auch die Dampfbremse war schadhaft. „Wir wussten nun, dass nur eine vollständige Sanierung von Dichtebene und Dämmung sowie der äußeren Aluminiumbekleidung das Kondensatproblem in der Tropenhalle lösen und Wärmeverluste im Winter vermeiden würde“, erklärt Mirko Zander, Director Facility Management von Tropical Islands. „Klar war auch, dass wir Veränderungen an der Dachkonstruktion vornehmen müssen, um zukünftig Schäden zu vermeiden.“
Im Vorfeld der Sanierung hatte der Bauherr ein Modell des neuen Dachaufbaus im Windkanal testen lassen. Laut der dort durchgeführten Prüfungen wird die neue Dachhülle Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h standhalten. Das hinzugezogene Architekturbüro Artytech2 Hermoso & Heimannsfeld arquitectos s. l.p aus Madrid, ein langjähriger Partner des Bauherrn, hatte als neue Dämmung die „Fixrock VS“ von ROCKWOOL empfohlen und bat den Hersteller um Stellungnahme hinsichtlich der Eignung dieser Fassadendämmplatte für die geplante Sanierung.

Bild 3. Die erste Lage der alukaschierten Dampfbremse wurde auf die innere Trapezblechschale der Halle aufgeklebt. Darüber werden die Z-Profile montiert, zwischen die „Fixrock VS“ Dämmplatten von ROCKWOOL geschoben werden.
Kann die „Fixrock“ Dämmplatte im Radius der Luftschiffhalle gebogen sicher verlegt werden? Mit welcher Art von Befestigung können die Dämmplatten sicher verlegt werden? Wie kann Wasser in der Bauphase abgeführt werden? Wie lange könnte der Dämmstoff in der Bauphase notfalls einer Freibewitterung ausgesetzt sein? Um die Sicherheit der speziell geschulten Arbeiter an der Halle zu gewährleisten, wird die Montage von Dämmung und Bekleidung sofort abgebrochen, wenn Regen oder Wind aufkommen. Sollten die Monteure einmal nicht mehr die Chance haben, unmittelbar nach der Verlegung der Dämmung das äußere Stahlblech und das Aluminium als äußerste Dachschicht zu montieren, so hätte dies für die Qualität der Dämmung keine negativen Konsequenzen. Die hydrophobierten Platten bleiben formstabil und verlieren auch keine Dämmwirkung.
Technische Spezialisten der DEUTSCHEN ROCKWOOL befassten sich mit den Detailfragen des Bauvorhabens, darunter Architektenberater ebenso wie Produktmanager und Ingenieure aus der Anwendungstechnik. „Besondere Anforderungen, wie sie z. B. mit der Dachsanierung in

Bild 4. Dämmung und Bekleidungsbleche liegen für die Monteure auf der Bühne bereit, damit jedes gedämmte Feld sofort seine Metallbekleidung erhalten kann. Reicht die Zeit dafür nicht, weil z. B. ein plötzlicher Regenschauer einsetzt, ist es von Vorteil, dass eine Dämmung mit „Fixrock VS“ einer Freibewitterung sogar über mehrere Wochen standhalten würde.

Bild 5. Dämmplatten einschieben, Aluminiumbleche montieren – die geschulten Montageteams können bei günstiger Witterung pro Tag ein Feld von ca. 150 m2 fertigstellen.
Krausnick verbunden sind, nehmen wir bei ROCKWOOL sehr ernst“, erklärt Architektenberater Andreas Unger. Erst nach einer umfassenden Prüfung würden Aussagen zur Machbarkeit einer Lösung und zum optimalen Dämmstoff für eine Anwendung getroffen. Für die Anwendung der „Fixrock VS“ zur Dämmung von Tropical Islands gab die DEUTSCHE ROCKWOOL im Frühjahr 2021 grünes Licht.
„Fixrock“ für das Brandenburger Tropenparadies
Seither werden in Krausnick „Fixrock VS“ Dämmplatten in einer Dicke von 180 mm fugenlos zwischen Z-Profile

Bild 6. Am Ende eines Arbeitstages ist deutlich zu erkennen, wie ein Tor auf den Einsatz der Monteure am nächsten Tag vorbereitet wurde. Die Z-Profile im rechten unteren Drittel des Tores warten auf die Dämmung und Bekleidung. Deutlich zu erkennen sind auch die silbern glänzenden Flächen, auf denen bereits die neue Dampfsperre aufgeklebt wurde.

Bild 7. Die Sanierung der Gebäudehülle und deren professionelle Dämmung sind Teil des Konzeptes für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb des Freizeitbades Tropical Islands in Krausnick-Groß Wasserburg und wurden von der Geschäftsführung der Parques Reunidos Firmengruppe mit einer mehrere Millionen Euro großen Investition ermöglicht. Auch der Energiebedarf wird gesenkt werden.
(Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG)
geklemmt, auf die erst Stahlblech und dann Aluminium montiert werden. Materialausdehnungen der metallischen Komponenten bei großer Hitze wird diese neue Konstruktion besser aufnehmen können als die alte. Steinwolle weist bei Temperaturen von 80 und mehr °C keinerlei Längenausdehnung auf. Wird sie dicht gestoßen und fugenlos verlegt, ist eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung einer Kondensatbildung auf der Innenseite erfüllt.
„Wir haben uns sehr darüber gefreut, den Vorschlag der Architekten, die neue Gebäudehülle von Tropical Islands mit der ‚Fixrock‘ zu dämmen, als technisch solide Lösung einstufen zu können“, sagt Daniel Schmidt, Gebietsleiter Leipzig der DEUTSCHEN ROCKWOOL. Er begleitet als zuständiger Fachberater im Außendienst den Baufortschritt.
Der Holzbaupreis Rheinland-Pfalz wurde 2024 zum neunten Mal vom Landesbeirat Holz Rheinland-Pfalz ausgelobt, unterstützt durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität sowie die Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Die Auslober verzeichneten in diesem Jahr mit 84 Einreichungen die bisher größte Beteiligung. Die Jury unter Leitung von Edda Kurz, Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, vergab acht Preise und zwölf Anerkennungen. Unter den Auszeichnungen befanden sich zahlreiche Fassadenlösungen.
Besondere Aufmerksamkeit erzielte die Verleihung des ‚Sonderpreis Flut an der Ahr‘ an den Architekten Fritz Vennemann und seine Initiative „Historisches Ahrtal“ für die Sanierung von Fachwerkbauten in Ahrweiler. Entgegen vieler gutachterlicher Empfehlungen gelang es ihnen, mit koordinierten Freiwilligeneinsätzen und Experten aus dem gesamten Bundesgebiet zahlreiche Bauten zu retten und so einen Teil des historischen Ahrtals zu bewahren.
Preise wurden vergeben an:
– Kulturhalle in Schaidt (AV1 Architekten
– Forstamt in Trier (baurmann dürr Architekten)
Nachschub gesichert
Der enorme Materialbedarf – im Laufe der Bauzeit werden ca. 54.000 m2 „Fixrock“ benötigt – habe 2022 zwar sogar ROCKWOOL gefordert, aber bisher gelinge es durch eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn und dem regionalen Fachhandel, pünktlich die benötigten Mengen Dämmstoff bereitzustellen. „Auch hier ist Engagement und Professionalität gefragt“, betont Schmidt. „Eine technisch ausgereifte Lösung zu finden ist das eine. Aber die Baustelle so zu begleiten, dass stets die benötigte Menge Dämmstoff bereitsteht, damit die Verarbeiter gut vorankommen, wenn das Wetter mitspielt, ist ebenso wichtig für den Erfolg einer so großen Maßnahme.“
Bautafel
Erneuerung der Gebäudehülle für Tropical Islands
■ Bauherr: Tropical Island Asset Management GmbH, Facility Management, Krausnick-Groß Wasserburg, Brandenburg
■ Architekt: Artytech2 Hermoso & Heimannsfeld arquitectos s. l.p, Madrid/Spanien
■ Verarbeiter: Raizquinta, Architectural Roofing and cladding SA, Villabrazaro/Spanien
■ Technische Beratung: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck
Weitere Informationen:
DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Rockwool Straße 37–41, 45966 Gladbeck
Tel. (02043) 408-0, Fax (02043) 408-570 info@rockwool.de, www.rockwool.de
– Kammermusiksaal als Aufstockung in Mainz (mamuth Architekten)
– Einfamilienhaus in Koblenz (Schäfer Architekt)
– Familienzentrum in Gau-Algesheim (Niederwöhrmeier Wiese)
Für Forschung und Innovation wurden ausgezeichnet:
– Halle des Campus Diemerstein (TU KaiserslauternLandau, Prof. Jürgen Graf u. a.)
– Produktionshalle CLTech in Kaiserslautern (HS Trier, Prof. Wieland Becker u. a.)
Zur Dokumentation des Wettbewerbsergebnisses wurde vom Holzbau Cluster RLP eine 72-seitige Broschüre herausgegeben.
Weitere Informationen:
Informationsverein Holz e. V. Humboldtstraße 45, 40237 Düsseldorf
Tel. (0211) 966 55 80 info@informationsdienst-holz.de, www.informationsdienst-holz.de
Das Detail schärft das Gesamtbild – und sorgt für wichtige Effekte. So verhält es sich auch bei Entwässerungsrinnen. Sie stellen bei großen Architekturvorhaben ein meist unauffälliges Element dar, unterstreichen jedoch das Erscheinungsbild in ihrem Design nachdrücklich. Ein Paradebeispiel ist der Neubau der Stadthalle, der „Vilco“, und die Sanierung des Kurhauses in Bad Vilbel. Die Gebäude schmiegen sich an den malerischen Kurpark und bilden ein kulturelles Zentrum. Rund um den Gebäudekomplex wurden die Außenanlagen jetzt ebenfalls erneuert. Die eingebauten Entwässerungssysteme sind hochwertig, optisch ansprechend und fügen sich ausgewogen ins architektonische Gesamtkonzept ein.
Wasser ist für Vilbel ein wichtiges Element, verdankt die Stadt doch den Namenszusatz „Bad“ den vielen Quellen. Für das Niederschlagswasser auf öffentlichen Plätzen, im Umfeld repräsentativer Gebäude, wie beispielsweise entlang von Fassaden, braucht es jedoch ein gutes Konzept. Wie soll das Regenwasser geleitet werden? In diesem Fall: individuell, nach Maß und sehr elegant. Ein maßgeblicher Gebäudeteil ist das „gläserne Foyer“. Hier ist das verbindende Element von Fassade und Außenbereich eine geschlossene Kastenrinne mit einer besonderen Abdeckung, einem Querstabrost. Das Rinnensystem der Fassadenentwässerung wurde maßgefertigt und zieht sich entlang der gesamten Gebäudehülle. Der Gebäudegeometrie folgend, wurden die Rinnen aus Stahl in verschiedenen Abmessungen ausgeführt. Beispielsweise wurden an den Eingängen die Rinnenbreiten jeweils individuell angepasst. Außerdem erforderte die Laibung der Fassade und die darunter liegende Dämmung einen seitlichen Anschluss der Rinnen an das Kanalsystem. Teils wird das Wasser über


einen unterirdischen Stichkanal zum Anschlusspunkt geführt.
Ebenso sind Ecken und Winkel maßgenau angefertigt worden. Bei den Passstücken und Gehrungsschnitten der Rinnen und Abdeckungen kam es auf eine perfekte Zusammenarbeit mit dem ausführenden Bauunternehmen an. Jörg Hutter, Bauleiter bei Immo Herbst GmbH, erinnert sich: „Hier war eine zeitnahe und sehr enge Abstimmung mit Hauraton erforderlich, damit alle Bauteile zur rechten Zeit vor Ort zur Verfügung stehen konnten. Schließlich musste der Einbau zügig vorangehen. Dabei ist Qualität immer der wichtigste Maßstab, denn es gibt hier viel Publikumsverkehr und die Außenanlagen sollen dauerhaft schick aussehen.“
Durch die Vielfalt der Anforderungen waren verschiedene Rinnensysteme erforderlich. Auf dem neuen Vorplatz Design-Entwässerungssysteme


Ernst & Sohn Special: Fassadentechnik 2
Ernst & Sohn GmbH
Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Tel. (030) 470 31-200, Fax (030) 470 31-270 www.ernst-und-sohn.de
Redaktion
Iris Kopf, Neuruppin
Rainer Bratfisch, Berlin
Kunden-/Leserservice
Abonnementbetreuung, Einzelheft-Verkauf, Probehefte, Adressänderungen
WILEY-VCH Kundenservice für Verlag Ernst & Sohn, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Tel. (06201) 606-400, Fax (06201) 606-184, service@wiley-vch.de Einzelheft 25,– € inkl. MwSt. und Versand/Porto
Bestellnummer 2134-2412
Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält folgende Beilage: Ernst & Sohn GmbH, 10245 Berlin
der „Vilco“ – so der Name der neuen Stadthalle – sind Schlitzrinnen zum Einsatz gekommen. Sie sind an der Oberfläche nur durch einen schmalen Einlaufschlitz zu erkennen. Der Rinnenkörper, in dem das Wasser abgeleitet wird, ist unter dem Plattenbelag verborgen. Die Ausführung der Schlitzabdeckung von Hauraton garantiert das dauerhaft elegante Aussehen. Dafür sorgen die konstruktiven Verstärkungen unter der Abdeckung und die Materialstärke. Mit einer separaten Stirnwand für Schlitzabdeckungen wird verhindert, dass Bettungsmaterial in die Rinne rieselt. An der Einfahrt zum Parkhaus wurden Faserfix KS Rinnen mit einem Guss-Längsstabrost in schwarzem Design eingebaut. Dieses Rinnensystem ist für eine Belastung durch ständigen Fahrzeugverkehr ausgelegt und verfügt über ausreichend hydraulische Kapazität, um auch stärkere Regenereignisse zu bewältigen.
Je nach Bedarf fanden also Standardsysteme Verwendung – aber auch viele individuell angefertigte Rinnen wurden eingesetzt und sorgen für Akzente: Ein Architekturhighlight, das sich sehen lassen kann.
Weitere Informationen:
HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13, 76437 Rastatt Tel. (07222) 958 0 info@hauraton.com, www.hauraton.com
Weitere Sonderhefte online bestellen auf: www.ernst-und-sohn.de/sonderhefte
Anzeigenverkauf
Andrea Thieme
Tel. +49 (0) 30 470 31-246, Fax +49 (0) 30 470 31-230 andrea.thieme@wiley.com
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2024.
Bankverbindung
J.P. Morgan AG Frankfurt
IBAN DE55 5011 0800 6161 5174 43 BIC/S.W.I.F.T.: CHAS DE FX
Gestaltung/Satz
LVD GmbH, Berlin
Druck
Westermann DRUCK | pva, Zwickau
2024 Ernst & Sohn GmbH, Berlin
Die in dem Special veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das des Nachdrucks und der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Specials darf ohne vorherige Zustimmung des Verlages gewerblich als Kopie vervielfältigt, in elektronische Datenbanken aufgenommen oder auf CD-ROM vervielfältigt werden. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen in erster Linie die persönliche Meinung der Verfasserin oder des Verfassers dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotografien übernimmt der Verlag keine Haftung.
Hubert Bachmann, Mathias Tillmann, Susanne Urban
- ideale Bauweise für wirtschaftliches, schnelles und BIM-gerechtes Planen und Bauen
Das Buch gibt den aktuellen Stand des Betonfertigteilbaus wieder. Es zeigt die wirtschaftlichen Möglichkeiten auf und konzentriert sich auf die Tragwerks- und Fassadenelemente. Entwurf und Konstruktion sowie Aspekte der Herstellung und Montage werden behandelt. Mit Beispielen.


4. aktualisierte Auflage · 2024 · 336 Seiten · 80 Abbildungen · 42 Tabellen
Softcover
ISBN 978-3-433-03452-1
eBundle (Print + ePDF)
ISBN 978-3-433-03453-8

BESTELLEN
+49 (0)30 470 31–236 marketing@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de/3452

* Der €-Preis gilt ausschließlich für Deutschland. Inkl. MwSt.

Bundesingenieurkammer (Hrsg.)
- die besten aktuellen Projekte von Bauingenieur:innen aus Deutschland
- Beiträge des Ingenieurbaus zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- inspiriert vom Symposium Ingenieurbaukunst –Design for Construction #IngD4C
Das Buch diskutiert die Beiträg des Ingenieurbaus zum Klimaschutz und zeigt wichtige aktuelle Bauwerke von Ingenieur:innen aus Deutschland. Herausgegeben von der Bundesingenieurkammer werden hier die Leistungen des deutschen Bauingenieur wesens dokumentiert.

* Der €-Preis gilt ausschließlich für Deutschland. Inkl. MwSt. BESTELLEN +49 (0)30 470 31–236 marketing@ernst-und-sohn.de www.ernst-und-sohn.de/3457


12 / 2024 · ca. 208 Seiten · ca. 130 Abbildungen
Softcover
Bereits vorbestellbar.

