Ausgabe 08/202521.Juli 2025
3

Prozesse
Martina Nolte spricht über Digitalisierung in den Kommunen und die Bedeutung digitaler Teilhabe.


Ausgabe 08/202521.Juli 2025
3

Prozesse
Martina Nolte spricht über Digitalisierung in den Kommunen und die Bedeutung digitaler Teilhabe.

Gesetze
Die Initiative „Law as Code“ tritt für einen Paradigmenwechsel bei der digitalen Gesetzgebung ein.
Ei nmal m itteilen, mehr fach nutzen. Dieses Prinzip soll d ie deutsche Verwaltung revolutionieren Mit NOOTS entsteht d ie I nfrastruktur für ei ne nachhaltig vernetzte öffentliche Ver wa ltung. Doch der Weg dorthi n ist stei nig und födera l.
Zum ersten J uli 2025 is t die„Gesamtsteuerung Registermodernisierung“ in die operative Umsetzungsphase gestartet. Damit wurde eine entscheidender Schritt auf dem Weg der Verwaltungsdigitalisierung beschritten. Im Zentrum steht dabei das Nationale O nce-Only T echnical S yste m (NOOTS) – eine zentrale technische Infrastruktur, die den sicheren Datenaustausch zwischen Behörden gemäß des Once-OnlyPrinzips ermöglichen soll.
Nein zur
Mehrfacherfassung
Das NOOTS verspricht nicht weniger als eine Revolution für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Daten sollen nur noch ein einziges Mal erfasst werden und können dann – mit Zustimmung der Betroffenen – sicher

und transparent zwischen verschiedenen Behörden ausgetauscht werden. Dadurch sollen Zeit gespart, Aufwände signifikant reduziert und digitale Verwaltungsprozesse erheblich verschlankt werden. „Die Registermodernisierung ist ein zentrales Vorhaben des ITPlanungsrats“, betont Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin in Mecklenburg-Vorpommern und in diesem Jahr Vorsitzende des IT-Planungsrats. „Mit dem Start der Umsetzungsorganisation N OOT S gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer modernen, medienbruchfreien Verwaltung.“
Am 11. Juli 2025 konstituierte sich – auf Grundlage des IT-Planungsratsbeschluss 2025/13 und im Sinne des §3 Absatz 4 des NOOTSStaatsvertrags – die neue Steuerungsgruppe NOOTS, die zentrale Entscheidungen zu Betrieb, Wei-
terentwicklung und Finanzierung treffen soll. Vertreten und stimmberechtigt sind der Bund sowie die Länder Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hamburg und das Saarland. Christian Pfromm, CDO Hamburg und Vorsitzender der Steuerungsgruppe, hebt die strategische Bedeutung hervor: „Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips durch das NOOTS ermöglicht nicht nur den europaweiten Austausch von Nachweisen, sondern treibt auch die Modernisierung der Verwaltung entscheidend voran.“
Drei-Säulen-Struktur für die Umsetzung
Operativ fußt die Umsetzung des NOOTS auf drei Standbeinen Innerhalb der FITKO wird eine fachlich koordinierende Stelle ins Leben gerufen. Diese wird von der

SPEZIAL
Hintergründe und Lösungen rund um Automatisierung und künstliche Intelligenz im Public Sector. 15
Geschäftsstelle NOOTS – ebenfalls in der FITKO verortet – koordiniert. Im Bundesverwaltungsamt hingegen wurde eine betriebsverantwortliche Stelle installiert. Die Gesamtleitung liegt fortan bei der FITKO, während beim BVA die stellvertretende Leitung der Projektleitung vertreten ist.
FITKO-Präsident Dr André Göbel unterstreicht die Bedeutung dieser neu geschaffenen Struktur „Das NOOTS schafft die häufig ignorierten Grundlagen, um komplizierte Verwaltungsprozesse für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ganz grundständig zu vereinfachen.“
BVA-Präsidentin Katja Wilk en kündigt überdies konkrete Schritte zur zeitnahen Umsetzung an. Derzeit liefen die Vorbereitungen für zwei Umsetzungsprojekte, die den Nachweisdatenaustausch über das NOOTS noch i n diesem Kalenderjahr produktiv nutzen sollen.
Rahmenbedingungen
Der NOOTS-Staatsvertrag wird aktuell von Bund und Ländern ratifiziert. Ziel ist der schrittweise Anschluss von Register- und Onlinediensten sowie die Umsetzung des Once-Only-Prinzips auf bundesweiter wie europäischer Ebene. Dabei positioniert sich NOOTS
Bild: Kathleen Friedrich

Dr. André Göbel bekleidet seit November 2023 das Amt des FITKO-Präsidenten. Ku rz gemeldet
Staatsreform – jetzt!
Die Vorstellung des Abschlussberichts der Initiative für einen handlungsfähigen Staat am geschichtsträchtigen 14. Juli war –nach den Worten des Bundespräsidenten – keine Abschlussveranstaltung, sondern eine Staffelübergabe von der Expertise zur praktischen Umsetzung durch die Politik. Die Initiatoren Julia Jäkel, Dr. Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Prof. Dr. Andreas Voßkuhle wollen mit ihrem Bericht „dazu beitragen, Blockaden und Selbstblockaden staatlichen Handelns aufzulösen“. Dafür haben sie bereits in ihrem Zwischenbericht „Gelingensbedingungen“ für Reformen formuliert. Viele die-
ser Empfehlungen haben Eingang in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gefunden. Die Empfehlung zum Bundesdigitalministerium wurde umgesetzt.
Für den Abschlussbericht wurden die Vorschläge – nach intensiven Diskussionen in den Arbeitsgruppen, aber auch mit vielen weiteren Fachleuten, Verbänden, engagierten Bürgerinnen und Bürgern – weiter ausgearbeitet und um fünf weitere Empfehlungen ergänzt. Dazu gehört, die Nachrichtendienste zu befähigen, „unser Land wirksam zu schützen“ und „dem demokratiegefährdenden Einfluss sozialer Medien entgegenzuwirken“. Wie dringend nötig die ange-
mahnten Veränderungen sind, weil das Vertrauen in unsere demokratische Ordnung zu erodieren drohe, machte Bundespräsident Frank Wa lter Steinmeier bereits in seiner Begrüßung klar: In allen Gesprächen werde immer wieder die Sorge formuliert, dass die Handlungsfähigkeit des Staates durch ein „dichtgewobenes Netz aus Regelungen und Vorschriften eingeschränkt“, manche sagten sogar, beschädigt, würde. Es gebe nichts zu beschönigen, befand auch Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger: „Ihr Abschlussbericht nimmt uns in die Pflicht.“ An zu vielen Stellen fehlte und fehle der politische Wille und Mut,
als zentraler Baustein des Deutschland-Stacks und soll die Grundlage für eine proaktive, antragslose öffentliche Verwaltung schaffen, bei der Daten – automatisiert und sicher – behördenübergreifend abgerufen werden können. Und eben jeweils nur ein einziges Mal jk
Weitere Informationen
NOOTS ist wegweisend, einigen Staatsmodernisierern zufolge kommt es allerdings zu spät. Einen stets aktuellen Blick auf die Entwicklungen der Verwaltungsdigitalisierung erhalten Sie auf der Webseite der FITKO. [ fitko.de/foederale-koordination/noots ]
Erkenntnissen auch die notwendigen Taten folgen zu lassen. Sein Ministerium habe diesen Mut und diesen Willen –doch den brauche das ganze Land.
Für das Gelingen der Reformen sei wichtig, dass Bund und Länder an einem Strang zögen, betonen die Initiatoren. Als ermutigend wird daher die Modernisierungsagenda gesehen, auf deren Ausarbeitung sich die Regierungschefinnen und -chefs der Länder und Bundeskanzler Friedrich Merz am 18. Juni verständigt haben. Darin sollen insbesondere Vorschläge der Initiative aufgegriffen werden. nh
voge.ly/Staatsreform
3|Martina Nolte, Teamleitung E-Government bei der Stadt Mönchengladbach, spricht im Interview über digitale Teilhabe, aktuelle Projekte und den „humorvollsten EfA-Dienst Deutschlands“.
4|Ohne Papier ins sanierte Rathaus: Bernd Lehman, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg, erläutert die Gründe dieses hehren Ziels.
Praxis & Innovation
9|Digital statt digitaltauglich: Die Initiative „Law as Code“ der Agentur für Sprunginnovationen fordert eine andere Denkweise.
10|Live aus dem CDO-Zirkel: Andreas Steffen plädiert für fachliches Nachfragen und mehr aktives Zuhören.


5|Das bayerische Ingolstadt setzt auf smarte Technologie und treibt die Umsetzung seiner Digitalagenda voran.
6|Felix Appel erklärt, warum Politik neu denken muss und Wahlkreise als Communities begreifen sollte – mit neuen Beteiligungsformaten, digitaler Nahbarkeit und kontinuierlichem Dialog.
7|Professor Niehaves zeigt in seiner Kolumne auf, dass künstliche Intelligenz den Menschen nicht ersetzt, sondern sogar wertvoller macht.
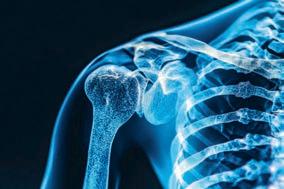
7|Eine aktuelle Studie der Agora Digitale Transformation befasst sich mit Begrifflichkeiten und strukturellen Voraussetzungen rund um „Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks“.
11|Beim eGovernmentWettbewerb von BearingPoint und Cisco läuft derzeit die Abstimmung für den Publikumspreis.
11|MaKI: Der „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ soll künftig auch Ländern und Kommunen offen stehen.
12|Die Module für die Praxisverwaltungssysteme kommen pünktlich zum Start der elektronischen Patientenakte in den Praxen an.
12|Das Ende der EinboxKonnektoren ist eingeläutet,

und mit dem TI-Gateway steht der Nachfolger parat.
13|Übersicht zu anstehenden Terminen für öffentliche Einrichtungen.
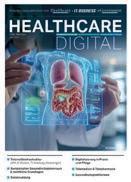
alles neu macht der Mai, auch wenn es in unserem Fall erst mit dieser Ausgabe augenfällig wird Seinerzeit hat sich unser Team nämlich für einen kleinen Frühjahrsputz entschieden, damit das Layout der eGovernment etwas aufgeräumter daherkommt Ganz konkret bedeutet das: mehr Raum für unsere Titelgeschichten, auf dieser zweiten Seite zusätzlichen Platz für ein Editorial und einen Verweis auf unsere E-Paper-Ausgabe (siehe unten) sowie ein strukturierterer Überblick über unsere aktuellen Inhalte – ganz ohne Abstriche bei der inhaltlichen Qualität, versteht sich. So starten wir beispielsweise mit einem spannenden Interview ins Ressort „Politik & Verwaltung“: Martina Nolte, Teamleitung E-Government bei der Stadt Mönchengladbach, berichtet darüber, wie sie das Thema Digitalisierung angeht, welche Initiativen und Projekte ihre Mannschaft aktuell beschäftigen und wie kommunenübergreifende Zusammenarbeit
Stephan Augsten Redaktionsleitung eGovernment in der Praxis aussehen kann. Die Gunst der Stunde hat derweil Bernd Lehmann, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg ergriffen Im Zuge der Sanierung des städtischen Rathauses ab 2019 erging dort die Entscheidung, das papierlose Büro möglichst konsequent umzusetzen, um den mit der Covid-19-Pandemie aufgekommenen Digitalisierungsschub weiter zu befeuern; im Ergebnis stehen nicht nur ein Digitalisierungsgrad von über 75 Prozent, sondern auch finanzielle Einsparungen dank gar nicht erst angeschaffter Aktenschränke.
Der Blick in beide Kommunen macht deutlich: Innovative Ideen und Technologien müssen nicht immer mit Schmerz verbunden sein, sie können sogar für echtes Glück sorgen – ein Aspekt, mit dem sich auch Professor Björn Niehaves in seiner Kolumne zum Thema KI beschäftigt Entgegen vieler Unkenrufe glaubt er nämlich nicht daran, dass künstliche Intelligenz den Menschen ersetzt,

sondern dass sie vielmehr dessen Arbeitsweise verändert, Kompetenzen ergänzt und so wieder mehr Zeit für das Wesentliche schafft: mehr Menschlichkeit im Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern. Allerorten stehen die Zeichen auf Veränderung, das gilt auch und insbesondere mit Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung Eine besonders wichtige Aufgabe besteht aktuell darin, allen Betroffenen klarzumachen, dass nicht jede Veränderung per se schmerzhaft sein muss, es aber durchaus sein kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie unsere kleine LayoutÄnderung verwinden können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Lektüre
eGovernment jederzeit & überall: Hintergründe und News rund um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung online lesen.
Bereits freitags vor der Print-Ausgabe online verfügbar: eGovernment.de/digitale_ausgaben

eGovernment Vogel IT-Medien GmbH
Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150 redaktion.egov@vogel.de
Handelsregister Augsburg HRB 11943
Redaktionsleitung
Susanne Ehneß / su (CvD, -180, ViSdP für redaktionelle Inhalte)
Stephan Augsten / aus (-145)
Redaktion
Nicola Hauptmann / nh (-260)
Johannes Kapfer / jk (-181)
Serina Sonsalla / se (-184)
Co-Publisher Harald Czelnai (verantwortlich für den Anzeigenteil, -212), harald.czelnai@vogel.de Fax 0821/2177-152
Mediaberatung
Sandra Schüller (-182), Heike Kubitza (-213)
Anzeigendisposition
Mihaela Mikolic (-204)
Grafik & Layout: Vogel Medienservice Kampagnenmanagement
Ursula Gebauer (-217) EBV: Carin Böhm
Anzeigen-Layout: Alexander Preböck
Leserservice: eGovernment.de/hilfe oder eMail an: vertrieb@vogel.de mit Betreff eGovernment“ Gerne mit Angabe Ihrer Kundennummer vom Adressetikett
*CS-1234567*
Geschäftsführer Tobias Teske Günter Schürger
Erscheinungsweise: 12 Ausgaben jährlich
Abonnement Preis des Jahresabonnements: 108,- inkl MwSt und Versand
Druck
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstr 5, 97204 Höchberg Gedruckt auf Steinbeis silk Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel. Mehr Infos unter: www.stp.de Fragen zur Produktsicherheit produktsicherheit@vogel.de Haftung
Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen unzutreffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur beim Nachweis grober Fahrlässigkeit. Für Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind ist der jeweilige Autor verantwortlich Redaktionelle Beiträge, die zur Veröffentlichung in eGovernment bestimmt sind, können auch auf allen Websites der Vogel Communications Group verwendet werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Sie können nur zurückgesandt werden, wenn Rückporto beiliegt.
Copyright Vogel IT-Medien GmbH Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion Fotokopieren veröffentlichter Beiträge ist gestattet zu innerbetrieblichen Zwecken, wenn auf jedes Blatt eine Wertmarke der Verwertungsgesellschaft Wort, Abt Wissenschaft, in 80336 München, Goethestraße 49 nach dem jeweils geltenden Tarif aufgeklebt wird. Nachdruck und elektronische Nutzung Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über: www.mycontentfactory.de Tel. 0931/418-2786. Die Artikel dieser Publikation sind in elektronischer Form über das Datenbankangebot der GBI zu beziehen: www.gbi.de eGovernment ist die Zeitung für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche
Sicherheit Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den Öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector Das Onlineportal www.eGovernment.de stellt maßgeschneiderte Services für IT-Entscheider der Öffentlichen Hand dar und bietet ein umfangreiches, exklusives Webangebot mit hohem Nutzwert. Das Stammhaus Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group. Der führende deutsche Fachinformationsanbieter mit rund 100 Fachzeitschriften und 60 Webseiten sowie zahlreichen internationalen Aktivitäten hat seinen Hauptsitz in Würzburg.
Mitgliedschaft eGovernment ist IVW-zertifiziert. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Healthcare Digital, BigData-Insider, CloudComputingInsider, DataCenter-Insider, IP-Insider, Security-Insider, Storage-Insider.
Taskforce, Teilhabe und Transparenz

Die Stadt Siegburg verzichtet im neuen Rathaus auf Papier und Aktenschränke.

Martina Nolte, Teamleitung E-Government in Mönchengladbach, erklärt, was bei der Digitalisierung wirklich zählt, worüber in der Politik bislang zu wenig gesprochen wird und weshalb sich ein Blick über den Tellerrand lohnt.
Frau Nolte, wenn heute über Digitalisierung gesprochen wird, geht es oft um Technik, Tools und Prozesse. Sie aber sagen: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Was heißt das konkret – und warum reicht Technik allein nicht aus?
Nolte: Ich beschäftige mich tagtäglich mit Online-Services, mit der Einführung von Chatbots, von Fachverfahrensanbindungen und so weiter und so fort. Dabei stelle ich aber immer wieder den Menschen in den Mittelpunkt Das ist mir besonders wichtig. Wir können der Maschine ja tatsächlich nur das sagen, was wir selbst wissen oder was wir wissen wollen – und dafür müssen wir zuerst wissen, was wir wollen. Damit wir genau das auch so weitergeben können.
Was denken Sie, über welches Thema in der Welt der Digitalisierung wird noch zu wenig gesprochen und weshalb?
Nolte: Für mich ist das ganz klar das Thema der digitalen Teilhabe und Datenethik Wir reden viel über Technik, über Plattformen und Prozesse – und viel zu selten darüber, ob wir wirklich alle mitkommen.
Menschen ohne Internetzugang, mit Sprachbarrieren oder Einschränkungen erleben digitale Verwaltung oft als Ausschluss. Auch beim Thema Daten ist oft unklar, wie wir sie fair, sinnvoll und transparent nutzen können, ohne Vertrauen zu verspielen. Das ist ein riesiges Feld und meiner Meinung nach auch ein sehr unterschätztes. Ebenso wenig reden wir über Wirkungsorientierung. Was bewirkt eigentlich die Digitalisierung, die wir jeden Tag machen, bei den Menschen? Was können Indikatoren für Mitarbeitende und für die Gesellschaft sein? Und reicht es überhaupt, eine digitale Lösung bereitzustellen oder müssen wir diese nicht auch mal messen und schauen, ob sie angenommen wird, ob Barrieren abgebaut werden, wie es mit den Lebensrealitäten ist, um diese zum Beispiel zu verbessern? Also „Wirkungscontrolling“ ist für mich ein ganz essentieller Punkt, der in der Digitalisierung bisher immer gefehlt hat.
Was müsste sich denn ändern, damit Digitalisierungsprozesse in Kommunen beschleunigt werden?
Nolte: Meiner Meinung nach braucht es drei Dinge – und zwar erstens klare Zuständigkeiten. Digitalisierung darf nicht nur in der IT oder bei Projektteams hängen,sondernmusseinegemeinsame Aufgabe sein, interdisziplinär und auch interkommunal. Sie betrifft ja den gesamten Staat – das gepaart mit klaren Zuständigkeiten wäre wirklich der richtige Weg. Zweitens kompetente Ressourcen. Wir brauchen kluge Köpfe, aber auch Zeit und Geld – das zur richtigen Zeit für das Richtige. Statt mit dem Gießkannenprinzip, sollten wir punktuell schauen, wo wir mit gewissen Ressourcen einen großen Output erreichen und diesen auch skalierbar machen. Und drittens weniger Bürokratie. Bürokratie an sich ist zwar wichtig, insbesondere in einem Rechtsstaat, aber wichtig wäre weniger bei der Umsetzung und Beschaffung, sonst verlieren wir einfach zu viel Schwung mit den Formalitäten.
Wie treiben Sie die Digitalisierung in der Stadt Mönchengladbach voran?
Nolte: Wir setzen ganz besonders auf praxisnahe Digitalisierung mit strategischem Blick. Das heißt, wir schauen, was Bürgerinnen, Bürger und Nutzende wirklich brauchen und was Mitarbeitende im Alltag entlastet. Wichtig ist dieser Zweiklang der Dinge, statt nur auf eine Seite zu schauen Denn das macht auch die Akzeptanz innerhalb der Stadtverwaltung und außerhalb viel größer. Was wir brauchen, sind zum Beispiel Taskforces, also Menschen, die sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammentun. Wir haben gerade die Taskforce „Registermodernisierung“ gestartet. Dort unterstützen wir die Umsetzung der RegistermodernisierungmitKnowhow aus Datenmanagement, ITSicherheit, Datenschutz und unserem E-Government-Team. Zunächst analysieren wir, welche Daten und Register vorhanden, wie sie aktuell strukturiert sind und wie sie gestaltet sein müssen –damit wir zukunftsfähig sind und
„Nicht alles funktioniert eins zu eins, aber das Prinzip ‚machbar‘ statt ‚perfekt‘ ist überall hilfreich.“
Martina Nolte
den Menschen auch in Zukunft das Once-Only-Prinzip ermöglichen können.
Des Weiteren entwickeln wir gerade KI-gestützte und nutzerzentrierte Services bei der Stadt Mönchengladbach und befähigen unsere Mitarbeiter, u. a gängige Sprachmodelle zu nutzen Wir haben dazu eine Leitlinie entwickelt, um ganz klar die Rahmenbedingungen zu schaffen, denn ein Verbot macht keinen Sinn. Alle nutzen es und möchten es schließlich nutzen Also stellt sich die Frage: Wie können wir den Einsatz sicher und verantwortungsvoll gestalten? Außerdem optimieren wir immer weiter unsere Services für das digitale Rathaus Das Serviceportal ist auch ein großer Teilbereich meines Teams. Das macht ganz besonderenSpaß,weilmandaunheimlich viel mit Menschen zu tun hat und sehen kann, wenn etwas bürgernah nach Wünschen umgesetzt wurde und auch gut genutzt wird. Gleichzeitig fördern wir aber auch eine Kultur des „Einfach mal Machens“, aber mit Leitplanken – nicht chaotisch,sonderneherexperimentierfreudig und verantwortungsvoll.
Welche spannenden Initiativen und Projekte laufen denn noch gerade an, und was beschäftigt Sie aktuell?
Nolte: Neben der Umsetzung von KI-gestützten Anwendungsfällen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir Digitalisierung demokratischer gestalten können. Wie binden wir Bürgerinnen, Bürger und Nutzende frühzeitig ein? Wie holen wir Fachbereiche, Fachkompetenzen und die Politik mit ins Boot? Oder welche Stakeholder auch immer da abgeholt werden müssen. Außerdem schauen wir im Bereich Datenmanagement und Statistik der Stadt Mönchengladbach, wie wir mit Daten echte Mehrwerte schaffen können. Etwa durch bessere Steuerung, frühere Problem-


erkennung oder gezielte Leistungen. Und gerade im Bereich EGovernment-Daten – das beinhaltet zum Beispiel auch die Registermodernisierung, das Onlinezugangsgesetz oder das EGovernment-Gesetz – haben wir unheimlich viele Projekte, die versuchen, Gesetze nutzerzentriert umzusetzen und als niedrigschwelliges Angebot erlebbar zu machen.
Ihre Blaupausen könnten auch für andere wichtig sein. Wo sehen Sie Potenzial für andere und inwiefern lassen sich diese denn auf andere Bereiche und Kommunen übertragen?
Nolte: Unsere Erfahrungen mit kleinen interdisziplinären Teams, mit gezielter Kompetenzplanung und vor allem mit offenem Austausch lassen sich gut übertragen. Das haben wir bereits öfter festgestellt Wir arbeiten beispielsweise sehr eng mit der Landeshauptstadt Wiesbaden zusammen und tauschen uns immer wieder interdisziplinär und interkommunal aus. Nicht alles funktioniert eins zu eins, aber das Prinzip „machbar“ statt „perfekt“ ist überall hilfreich. Das bedeutet, wir prüfen zunächst, was mit den vorhandenen Ressourcen machbar ist und wie viel Output es erzielt. Wir wollen weg von diesen 100 Prozent Es ist immer das MVP, das Minimalprodukt, das wir dann immer weiterentwickeln Das ist ein lebender Prozess, und manchmal sind es einfach die kleinen Lösungen, die schnell Wirkung entfalten Da arbeiten wir u. a eben sehr eng mit Wiesbaden zusammen. Wir haben auch mehrere Kooperationen und Nachnutzungsmöglichkeiten. Darunter hat Wiesbaden jetzt auch unseren Passierschein A38, den wir digital umgesetzt haben, als GamificationAnsatz nachgenutzt Wir nennen das den humorvollsten EfA-Dienst Deutschlands, weil es kein echter Online-Service ist Bei diesem Dienst geht es darum, dass die Menschen mit Witz und ein wenig Lockerheit an die Bund-ID herangebracht werden. Wir erklären lediglich, wie sie sich selbstständig für eine Bund-ID eintragen, wie sie den elektronischen Personalausweis oder einen Online-Dienst
Künstliche Intelligenz ersetzt nicht, sie verändert und ergänzt.
mit der eID-Funktion nutzen können – und das ist genau der Ansatz, den wir fahren wollen. Wir bringen die Menschen dorthin, wo wir sie haben wollen. Denn was bringen uns die ganzen OnlineServices, wenn keiner sie nutzen kann? Zum Beispiel, weil die eIDFunktionen nicht freigeschaltet wurden Des Weiteren haben wir mit dem Ko-Pionier-Preis für Stadtlabor2go, der Stadt Mönchengladbach, Wiesbaden sowie dem Citizen Lab Auszeichnungen, und nun das „Bewährt vor Ort“-Siegel, erhalten Das kam vom Städte- und Gemeindebund und ProjectTogether Hier wurden wir für die Nachnutzung unseres OZG-Bootcamps ausgezeichnet, das die Landeshauptstadt Mainz nachgenutzt hat, und wie bereits erwähnt, für den Passierschein A38. Das sind beides Methoden, die auch skalierbar und relativ einfach umzusetzen sind – wir sind da auch sehr stolz. Ich finde es sehr wichtig, dass man voneinander lernt und wir uns als einen Staat betrachten – statt immer wieder das Rad neu zu erfinden. Das größte Ziel sollte sein, dass wir es gemeinsam machen.
„Gemeinsames machen“ – das ist ein wichtiges Stichwort. Was können wir eigentlich von anderen Kommunen lernen und wie? Wie kommen Entscheiderinnen und Entscheider am besten in den Austausch? Nolte: Ja, das geht natürlich unheimlich gut über Beziehungen, so wie wir das auch mit anderen Städten pflegen. Also ich bin beispielsweise mit der Stadt Nürnberg oder eben mit Wiesbaden, Mainz, Düsseldorf oder sonstigen in Kontakt Da haben wir wirklich viele Städte, mit denen wir im engen Austausch sind Wir teilen immer mit, was wir aktuell vorhaben und fragen direkt nach, ob sie mitmachen wollen – oder umgekehrt: Wir haben das bei euch gesehen, können wir uns das mal anschauen? Ich finde aber tatsächlich, dass wir auch mehr nach Europa schauen sollten, denn wir sind auch ein Europa – und die Niederlande: Dort wird wirklich sehr radikal nutzerzentriert gedacht und sie sind uns schon sehr weit voraus. Warum nicht mal hinfahren und sich angucken, wie macht ihr das eigentlich?
Es lohnt sich, den Blick über den Tellerrand zu werfen und vor Ort zuerfahren,wieandereKommunen digitale Lösungen gestalten. In gewissen Gemeinden kann man schließlich viele, viele Dinge adaptieren Ansonsten gibt es auch in anderen Städten tolle Beispiele von smarten Beteiligungsplattformen, Ende-zu-Ende-Digitalisierung bis hin zu Open-Data-Projekten. Das machen wir bereits mit Entwicklungsallianzen, gerade im Smart-City-Bereich Der Schlüssel ist einfach: Austausch auf Augenhöhe – nicht abwarten, sondern nachfragen und gerne auch mal nachmachen Das ist ja das, was ich auch immer sage, also Nachnutzung ist wirklich das A und O. Das Interview führte Serina Sonsalla
Verwaltungsdigitalisierung konsequent gedacht
Wenn die Siegburger Verwaltung zum ersten September das neu sanierte Rathaus bezieht, wird einiges anders laufen als im Rest von Deutschland. Im Gespräch verrät Bernd Lehman, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt, was es damit auf sich hat.
Lassen Sie uns ein Assoziationsspiel spielen. Currywurst. Fabergé Rathaus. Wenn Sie zur Pommes-, Ei- und Papierakte-Fraktion gehören, dann seien Sie beruhigt Sie sind nicht allein. Schließlich befindet sich – trotz fortschreitendem Digitalisierungsgrad – in ausnahmslos allen Rathäusern noch der eine oder andere Regalkilometer an Akten jeglicher Couleur In allen Rathäusern? Nun ja, nicht ganz Seit 2019 wird das Rathaus in Siegburg von Grund auf saniert. In wenigen Wochen werden die Verwaltungsfachangestellten dort ihre Arbeit nach fünfjährigem Interimsstandort-Exil wiederaufnehmen. Das Besondere dabei: Bei der Neubeschaffung der Büromöbel hat die Stadtverwaltung auf Aktenschränke verzichtet. Und das aus gutem Grund Denn Siegburg wird das erste deutsche Rathaus sein, welches (beinahe) komplett auf Papier verzichtet
Projekt „Ohne Papier ins sanierte Rathaus“
Bernd Lehmann, Dezernent sowie Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Siegburg, berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sich die Stadt diesem MammutProjekt genähert hat und welche Fallstricke ihr dabei untergekommen sind Den aktuellen Stand der Digitalisierung in Siegburg schätzt Lehmann auf etwa 75 bis 80 Prozent ein Wobei es durchaus Unterschiede in einzelnen Bereichen gebe, wie er erklärt „Wir haben Bereiche, zum Beispiel das Finanzwesen der Stadt, die arbeiten komplett digital, komplett papierlos, komplett prozessorientiert.“
Gleichzeitig gebe es aber auch Be-
reiche, in denen Papier noch stärker vertreten sei, oft aufgrund rechtlicher Hemmungen. Einen besonders bezeichnenden Fall benennt Lehmann als Paradebeispiel für die Probleme der Digitalisierung in Deutschland: „Wir stellen Förderanträge bei der Bezirksregierung online, schicken diese online weg und signieren digital. Zur Bestätigung des Ganzen sind wir aber verpflichtet, einen Ausdruck via Faxgerät zur Bezirksregierung schicken.“ Dies führe unter anderem dazu, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert seien, ob sie rein digital arbeiten dürften.
Die Covid-19-Pandemie als Digitalisierungs-Turbo
Im Gegensatz zu den meisten anderen Institutionen und Verwaltungsbehörden kam Corona sowie die damit verbundenen Lockdowns der Siegburger Stadtverwaltung nicht ganz ungelegen Vielmehr hatte sich die Pandemie als regelrechter Digitalisierungs-Turbo erwiesen, berichtet Lehmann. War das Thema Homeoffice beziehungsweise Remote-Arbeit beispielsweise vor Corona vielerorts ein Tabuthema, hat es sich mittlerweile zum Standard in vielen Branchen gemausert
„Wir haben uns diesem Thema komplett geöffnet“, erklärt Lehmann. Heute habe jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Siegburger Stadtverwaltung – sofern es das jeweilige Arbeitsgebiet zulässt – die Möglichkeit, mobil zu arbeiten Die Hälfte der Arbeitszeit dürfe mobil verbracht werden. Interessanterweise hätte die Verwaltung ihren Verwaltungsfachan-
gestellten sogar noch mehr individuelle Arbeitszeit und -ortgestaltung eingeräumt, wurde aber vom Personalrat dahingehend eingeschränkt.
KI-Einsatz mit Siggi
Ein weiterer Faktor, der in Siegburg zu Entlastung von Bürgerschaft und Verwaltung führt, ist der Chatbot Siggi Seit anderthalb Jahren wird er von der Stadt eingesetzt und kürzlich – im Rahmen des deutschen Digitaltags – um eine Sprachausgabe erweitert „Siggi hat sprechen gelernt“, freut sich Lehmann. Der „fleißigste Mitarbeiter der Stadtverwaltung“, mittlerweile zum Voicebot befördert, werde als Ergänzung zur Telefonzentrale – während der Geschäftszeiten sei dafür das Callcenter der Stadt Köln verantwortlich – eingesetzt und könne in 96 verschiedenen Sprachen mit den Anruferinnen und Anrufern kommunizieren.
Besonders wichtig sei dies für Menschen, die Schwierigkeiten im Umgang mit Geschriebenem hätten. „Man darf nie außer Acht lassen, egal ob muttersprachig oder fremdsprachig, wie viele Analphabeten es tatsächlich in Deutschland gibt, die natürlich mit einem klassischen Chatbot wie Siggi und diesen Werkzeugen im Allgemeinen überhaupt nicht zu Rande kommen.“ Aus reiner Inklusionssicht ist dies natürlich ein sehr großer Schritt auf dem Weg zu einer barrierearmen öffentlichen Verwaltung Doch Lehmann warnt – bei allem Potential, welches in KI und deren Einsatz schlummere – vor einer Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wichtig sei


Bernd Lehmann verantwortet und koordiniert in Siegburg die Digitalisierungsvorhaben der
es, die Ängste und Ressentiments, welche gegenüber künstlicher Intelligenz vorherrschen – abzubauen und zu zeigen, dass nicht die Arbeit der Einzelnen überflüssig, sondern sinnvoll ergänzt und erleichtert werde, so Lehmann. Ein besonders wichtiges und lohnenswertes Anwendungsfeld sieht er im KI-basierten Wissensmanagement „Wir stehen vor einem großen – vielleicht dem größten –demografischen Wandel in den Verwaltungen Viele erfahrene Menschen werden in den nächsten Jahren die Verwaltungen verlassen.“ Und mit diesen langjährigen und spezialisierten Mitarbeitern würde auch deren Wissen verrentet werden. Nun gelte es dieses Wissen „in irgendeiner Form“ zu behalten. Genau an dieser Stelle könne ein Ratsinformationssystem, welches mit einem KI-Assistenten ausgestattet ist, für nachhaltige Abhilfe sorgen Aus diesem Grund wird eben solch ein System – das übrigens aus der gleichen geistigen Feder wie Siggi stammt – demnächst in Siegburg als Ergänzung zu den bisher datenbankorientierten Lösungen eingeführt
Auch KI-Agenten sind für die Verwaltung ein Thema
Lehmann denkt das Thema KI in der Verwaltung konsequent weiter und gibt ein Beispiel. „Vor vielen, vielen Jahren, als man mit der Digitalisierung von einzelnen Fachverfahren begonnen hat, war es ja meistens so, dass auf dem Weg zur Sachbearbeiterin, zum Sachbearbeiter hin dann ein Medienbruch fester Bestandteil des Prozesses war. Im nächsten Schritt war dann der Medienbruch abgeschafft und von der Antragsstellung bis hin zur Bearbeitung und der Bescheidung lief alles digital.“ Nun sei man an dem Punkt angekommen, an welchem gewisse Prozesse – Lehmann zieht an dieser Stelle den Anwohnerparkausweis heran –, für die es lediglich binäre Entscheidungsmöglichkeiten gebe – entweder ist man zur Beantragung berechtigt oder eben nicht –, von einer KI und ohne weiteres Zutun einer Verwaltungsfachkraft bearbeitet werden. Eine Stufe weitergedacht wäre es ebenfalls möglich, dass künstliche Intelligenz eine Art Sparringspartner für die Angestellten in der öffentlichen Verwaltung darstellt
So sei es beispielsweise denkbar, dass die KI verschiedene Lösungsvorschläge präsentiert, auf die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen oder diese – nach eigenem Ermessen – auch in Gänze ignorieren könnten, sagt Lehmann. Seiner Meinung nach berge der Einsatz von KI im behördlichen und verwaltungstechnischen Kontext durchaus interessante Synergiepotentiale, und zukünftig werde das Thema künstliche Intelligenz mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.
Herausforderungen und Ausblick
Trotz der zahlreichen Fortschritte der vergangenen Jahre blieben etliche Herausforderungen bestehen, davon ist Lehmann überzeugt. Das föderale System führe zu unterschiedlichen Verfahren und erschwere einheitliche Lösungen. Für die Zukunft wünscht sich Lehmann unter anderem deswegen mehr Verbindlichkeit von oben. „Es wäre manchmal besser, wenn von oben nach unten bestimmte Dinge verpflichtend wären.“ Als Beispiel nennt der Digitalisierungsbeauftragte die konsequente Nutzung digitaler Ausweisfunktionen oder ein zentrales Melderegister nach dänischem Vorbild Mit dem Einzug ins sanierte Rathaus Anfang September sieht Lehmann darüber hinaus die nächste Phase der Digitalisierung in Siegburg erreicht: „Die Saat ist gesät mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, mit dem neuen modernen Rathaus, mit neuen und papierlosen Arbeitswelten in diesem Rathaus. Und dieses zarte Pflänzchen muss jetzt kräftig gegossen werden, damit es wächst und gedeiht und wir Schritt für Schritt auch auf 100 Prozent digitalisieren.“ jk

Weitere Infos zu Siegburg Wenn Sie sich über die Digitalisierung in Siegburg informieren möchten oder einfach einen Plausch mit Siggi halten möchten, können Sie dies über die offizielle Webseite der Stadt tun. [ siegburg.de ]
Smart City Index? Spielt für Ingolstadt keine Rolle – die Stadt ist trotzdem ganz vorne mit dabei. Bernd Kuch, Referent für Personal, Organisation und IT-Management erklärt, wie die Stadt es an die Spitze geschafft hat und weshalb auch die digitale Verwaltung mehr braucht als nur Technik

In den vergangenen Jahren erreichten Sie immer wieder vordere Plätze im Smart City Index des Digitalverbands Bitkom – zuletzt 2024 den ersten Platz in der Kategorie „Energie und Umwelt“. Auch in der digitalen Verwaltung gehört Ingolstadt seit Langem zu den Vorreitern. Wie haben Sie diese Erfolge erzielt? Sicher spielte die Digitalstrategie auch eine Rolle?
Kuch: Auf jeden Fall. Es gab ja 2018 den Beschluss zur Digitalisierungsstrategie. Damit wurden klare strategische Ziele festgelegt und andere Dinge sehr weit operativ weiterentwickelt Das war eine gute Basis, auf der wir 2023 die Digitalisierungsstrategie fortgeschrieben haben. Mit der Firma KPMG haben wir uns zudem einen externen Berater an Bord geholt –weniger wegen der fachlichen Zielsetzungen oder der notwendigen Anpassungen, sondern mehr aus dem Grund, auch die internen Strukturen im Blick zu haben Oft hat man selbst einen blinden Fleck und denkt, dass alles gut passt und das Ziel klar ist. Daher war es uns wichtig, jemanden von außen zu holen, der das objektiv beobachtet und hinterfragt. In Zusammenarbeit mit KPMG sind Themen wie eine zentrale Portfolio-Planung und ein zentrales Projektmanagement aufgekommen. Es gab zu wenig Abstimmung darüber, wo es parallele Ansätze gibt, die man bündeln könnte. Wo kann man aus verschiedenen Projekten Synergien schaffen und
eine strategische Bewertung der Digitalisierungsprojekte vornehmen? Was ist aus strategischer Sicht wichtiger als anderes? Mit der Stabsstelle, die wir seit August 2024 haben – eine Initiative, die aus der Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie entstanden ist – haben wir nun gute Strukturen geschaffen, um diese Fragen zu adressieren.
Im Verwaltungsbereich haben wir damals beim Smart City Index gepunktet, weil wir sehr viele OnlineDienste angeboten haben – auch bayernweit waren wir wirklich sehr
weit vorne Vor fünf Jahren hatten wir 30 Online-Dienste. Doch im Vergleich dazu, bieten wir heute schon knapp 250 an.
In Ingolstadt haben wir die Aufgabenbereiche in der Digitalisierung weiter aufgeteilt und spezialisiert: Mein Fokus liegt intern auf der Stadtverwaltung und auf den Dienstleistungsangeboten der Stadtverwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.
Zum Thema Smart City hatten wir im vergangenen Jahr ein Förderprogramm für Photovoltaik aufgelegt, das sehr erfolgreich war, beispielsweise für Minisolaranlagen, kleine Balkonkraftwerke, und auch grüne Wärme war ein großes Thema – also das Fernwärmenetz der Stadtwerke Ingolstadt oder das Low-Ex-Netz am IN-Campus Gelände, bei dem mittels reversibler Wärmepumpen Gebäude mit der Abwärme anderer Gebäude beheizt werden Bei der städtischen Verkehrsgesellschaft wurden emissionsarme Busse eingesetzt: Wir haben zwölf Elektrobusse (BEVBusse, Batterie Electric Vehicle) und ein Wasserstoff-Müllauto beschafft Und wir haben 2019 bei der Straßen- und Gehwegbeleuchtung auf den LED-Standard umgestellt Mit 50 Prozent Dimmung leuchten sie nun in der Zeit von 23 bis 5 Uhr morgens.
Im Sommer sollte die Umsetzung der Maßnahmen aus der digitalen Agenda erfolgen. Wie sieht der aktuelle Stand aus?
Kuch: Neben dem reinen Verwaltungsteam, wollten wir auch den Aspekt Smart City stärker vorantreiben. Auch die Wirtschaftsförderung spielt eine Rolle Im Wirtschaftsreferat behandeln sie u a. das Thema „Urban Air Mobilität“ An dieser Initiative ist eine Allianz von 90 nationalen und internationalen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden beteiligt.
Mittlerweile sind zahlreiche Forschungsobjekte umgesetzt worden – vom Fluggerät über Luftraumerprobung bis hin zur Bodeninfrastruktur für die Geräte. Praxisbeispiele sind u. a die Unterstützung bei Sicherheitsaufgaben im medizinischen und rettungsdienstlichen Bereich sowie der Lage-Erkundung durch Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bergwacht.
2024 wurde Ingolstadt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr als Vorreiter für die internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz) gelobt. Damit können viele Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsbehörden online durchgeführt werden.
Kuch: Ja, stimmt I-Kfz ist ein überregionales Angebot und war hier besonders beliebt Mit 21 Prozent der Anmeldevorgänge, die bereits digital abgewickelt werden, liegt Ingolstadt bundesweit vorne – wobei das an einem großen Automobilhersteller liegen soll, der hier viele Autos zulässt Wären wir nicht „Audi-Stadt“, wären es vielleicht nicht ganz so viele. Unser früherer Amtsleiter in der Zulassungsstelle hatte auch sehr gute Kontakte zur Audi.
Nichtsdestotrotz: Unter den Großstädten wie München, Stuttgart und Wolfsburg sind wir führend Für das i-KFZ waren wir zudem Pilotanwender. Gemeinsam mit der Audi sind wir bereits seit 2013 im Rahmen eines Pilotprojekts an der Entstehung der Online-Dienstleistung beteiligt.
Apropos Pilotanwender: 2014 war Ingolstadt bereits beim Bürgerservice-Portal Pilotstadt. Das bundesweit einheitliche
Unternehmenskonto wurde von der AKDB (Anstalt für kommunale

Datenverarbeitung in Bayern) entwickelt und ist nun bayern- bzw. deutschlandweit in verschiedenen Kommunen im Einsatz Daran sieht man auch, dass in Ingolstadt schon sehr früh die Erkenntnis und die Bereitschaft da waren, in digitale Themen zu investieren. Während meiner vorherigen Tätigkeit im Landratsamt Fürth habe ich das bereits angestoßen; tatsächlich eingeführt wurde es jedoch erst später. Das Bürgerservice-Portal war allerdings auch ein Thema, das wir gegenüber dem Freistaat und bei den Spitzenverbänden immer wieder angesprochen hatten. Das Bürgerservice-Portal ist ein klarer Mehrwert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die digitale Angebote nicht nutzen können oder wollen. Es gibt immer noch viele Bürgerinnen und Bürger, die gerne persönlich ins Rathaus kommen – und das ist keine Altersfrage Für die wenigen Angelegenheiten, die im Jahr anfallen, geht man doch gerne ins Rathaus, weil man dort persönlich mit anderen Menschen spricht Deshalb werden auch weiterhin persönliche Termine in der Verwaltung angeboten. Digitalisierung soll ergänzen, nicht ersetzen. Für Unternehmen ist es jedoch ein entscheidender Standortfaktor, ob sie für jeden Antrag oder jede Bescheinigung jemanden persönlich ins Rathaus schicken oder ob sie dies bequem von überall aus erledigen können. Deshalb hatten wir im vergangenen Jahr das deutschlandweite Unternehmenskonto bei uns implementiert und binden es nun auch an unsere Fachanwendungen an.
Eine Firma, die beispielsweise ihren Hauptsitz in Flensburg hat und bei uns lediglich eine Zweigstelle betreibt, kann bestimmte Aufgaben von Flensburg aus anstoßen und erledigen – zum Beispiel mit einem einheitlichen Konto und den gleichen Zugangsdaten. Egal, ob sie etwas für den Hauptsitz in Flensburg oder für die Zweigstelle bei uns erledigt, es bleibt immer dasselbe Portal und dasselbe Unternehmenskonto.
Das große Potenzial besteht darin, dass die Stadt insbesondere für Unternehmen attraktiv wird Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt auch in der Region wirtschaftlich erleben, ist das hoffentlich ein Standortfaktor. Unser neuer Oberbürgermeister hat angekündigt, große Weltunternehmen ansiedeln zu wollen – da würde sich das anbieten.
Sehen Sie in Ingolstadt besonders großes Potenzial für die Digitalisierung?
Und wie schätzen Sie die konkreten Chancen dafür am Standort ein?
Kuch: Ich würde das nicht speziell auf Ingolstadt beziehen, sondern eher sagen, dass es deutschlandweit in allen Städten noch großes Potenzial für die Digitalisierung gibt Ich würde mir wünschen, dass von staatlicher Seite noch mehr standardisierte Angebote bereitgestellt werden.
Change in der Führung
Gute Führungskräfte im öffentlichen Dienst und der Wirtschaft übernehmen längst mehr als klassische Leitungsaufgaben, schlechte nicht. Wer heute wirksam führen will, muss Communitys gestalten – intern, extern und übergreifend.
Die gute Nachricht: Du musst kein CommunityManager sein Die schlechte: Du bist es längst – also fang an, es gut zu machen. Führungskräfte tun gut daran, diese Realität anzuerkennen. Denn moderne Führung bedeutet nicht mehr nur entscheiden, steuern und kontrollieren Wer heute Verantwortung trägt, wird automatisch auch zum CommunityManager: als Brückenbauer, als Kulturstifter, als Möglichmacher. Warum? Weil wir längst nicht mehr in klar abgegrenzten Hierarchien arbeiten, sondern in dynamischen Netzwerken, Projektstrukturen und offenen Systemen. Schauen wir uns das auf drei Ebenen an.
1. Intern – das eigene Team, die Organisation, die Verwaltung Führung beginnt im Inneren: bei der eigenen Organisation, beim eigenen Team. Wer intern keine Community aufbaut, wird auch nach außen keine Wirkung entfalten. Führungskräfte sind heute mehr denn je gefordert, verbindende Strukturen zu schaffen – nicht durch Kontrolle, sondern durch Ermöglichung Das beginnt bei
offenen Austauschformaten wie „Open Fridays“ oder bereichsübergreifenden Impulsrunden, in denen Mitarbeitende freiwillig ihre Ideen einbringen. Solche Forma
geben. Führung heißt in diesem Kontext nicht, alles selbst zu wissen – sondern Wissen zu kuratieren. Und schließlich braucht es Führungskräfte, die Veränderun

sollten interne und externe Netzwerke unterstützen.
te fördern Vertrauen, Dialog und Vernetzung – und stärken ganz nebenbei die Innovationskraft Hinzu kommt der Aufbau von PeerLearningStrukturen: MentoringProgramme, WissensTandems oder kleine Lerngruppen aktivieren internes Knowhow und helfen, Erfahrungswissen weiterzu
gen nicht nur verordnen, sondern moderieren Wer als Führungskraft zuhört, Orientierung bietet und aktiv einbindet, schafft Akzeptanz – und bringt sein Team sicher durch den Wandel Die Rolle verändert sich: vom Vorgesetzten zum Möglichmacher, vom Entscheider zum Kulturträger.
2. Extern – Bürger, Partner, Stakeholder Moderne Führung endet nicht am Ausgang des Rathauses oder am Tor des Unternehmens Sie wirkt nach außen – zu Bürgern, Partnern und Stakeholdern Gerade im öffentlichen Dienst wird deutlich, wie wichtig diese Außenbeziehungen sind Beteiligung ist kein Selbstzweck, sondern Führungsaufgabe. Digitale Ideenplattformen, Bürgerdialoge oder hybride Veranstaltungsformate eröffnen neue Räume für Mitgestaltung –und fördern das Vertrauen in Verwaltung und Institutionen. Gleichzeitig verlangt der Umgang mit externen Partnern – von politischen Gremien bis hin zur Zivilgesellschaft – eine hohe Kommunikationsfähigkeit Wer moderieren kann, statt zu dominieren, verbindet Interessen und schafft tragfähige Lösungen. Das gilt auch für denöffentlichenAuftritt:Führungskräfte, die sichtbar und ansprechbar sind – über Linkedin, lokale Medien oder eigene Formate –, bauen Nähe auf. Und sie setzen Signale: Hier wird geführt – offen, verbindlich, authentisch Wer diesen Raum nicht aktiv gestaltet, überlässt ihn anderen CommunityManagement nach außen bedeutet, die eigene Organisation in den Dialog zu bringen – und Führung als Brücke zu verstehen.
3. Netzwerke – interkommunal, strategisch, übergreifend Die dritte Ebene ist oft die unsichtbarste – und doch eine der wirksamsten: strategische Netzwerke. In einer zunehmend komplexen Welt entscheidet nicht die Größe einer Organisation über ihren Erfolg, sondern ihre Fähigkeit, sich zu vernetzen Führungskräfte, die
interkommunale oder organisationsübergreifende Netzwerke aktiv gestalten, schaffen Plattformen für kollektive Intelligenz Wer sich hier einbringt, setzt nicht nur Impulse, sondern wirkt systemisch Denn über Netzwerke verbreiten sich Ideen, Innovationen und Lösungen schneller und nachhaltiger Führungskräfte werden dabei zu Moderatoren, die den Rahmen halten, Verbindungen schaffen und den Austausch am Laufen halten Kurz: Wer Netzwerke pflegt, gestaltet Zukunft. Und auch im Falle des Berufswechsels gilt: Der Arbeitsplatz bleibt zurück, das Netzwerk geht mit
Führen heißt: verbinden
Führung ist nicht mehr nur das, was in Organigrammen steht Sondern das, was zwischen Menschen entsteht Wer sich selbst als CommunityManager versteht, führt wirksamer – ob im kleinen Team oder auf der großen Bühne Es braucht mehr davon. Wer keine Community führt, überlässt das Feld denen, die es tun –ob intern oder extern Das war noch nie eine gute Idee. Wer das nicht will, kann natürlich weiter „führen wie früher“. Nur darf er sich nicht wundern, wenn ihm irgendwann niemand mehr folgt Also, wozu entscheiden Sie sich?
„Die
Seit fünf Jahren sind Sie nun in der Stadtverwaltung in Ingolstadt tätig. Wie sehen Sie Ihre Rolle im Stadtrat und was ist Ihr Hauptanspruch?
Kuch: Im Bereich der Organisationsentwicklung und IT gab es schon vor unserem ehemaligen Oberbürgermeister Dr Christian Scharpf einen Grundsatzbeschluss zur Digitalisierung. Das war eigentlich schon eine gute Basis in Bezug auf die Zielsetzungen. In vielerlei Hinsicht waren aber noch die Strukturen und die Umsetzung ausbaufähig.
Ganz entscheidend für Digitalisierung sind die Prozesse Ich muss wissen, wie die aktuellen Prozesse umzusetzen sind und wie diese zukünftig aussehen sollen. Dafür braucht es aber erst mal eine Prozessaufnahme, also das Bewusstmachen und Kennenlernen von Prozessen. Dann braucht es ein Prozessmanagement – das war ein Thema, mit dessen Aufbau ich unmittelbar nach meinem Start im Stadtrat 2020 begonnen habe. Wir arbeiten weiterhin am Ausbau des OnlineAngebots.
liegt auf dem Platz“
Ein Bereich, in dem wir allerdings noch an Tempo und inhaltlicher Tiefe zulegen müssen, betrifft die Umsetzung von EndtoEndProzessen – von der digitalen Antragstellung über die Bearbeitung, die Anbindung an Fachverfahren bis hin zum Rückkanal zum Bürger Dabei geht es auch um die Schaffung von Strukturen und das Fördern des Bewusstseins. Dies war auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit in den ersten fünf Jahren
Skalierbarkeit, Interoperabilität oder durchgängige Systemarchitektur spielten damals keine Rolle – heute sind sie Grundvoraussetzung Wir sind jetzt auch fast fertig, die Organisationsstruktur so aufzubauen, dass wir uns mit Themen wie KIEinsatz und Datenmanagement befassen können. Die technische Ausrichtung ist mittlerweile so aufgestellt, dass sich diese Ziele mit vertretbarem personellem Aufwand realisieren lassen.
„Die technische Ausrichtung ist mittlerweile so aufgestellt, dass sich diese Ziele mit vertretbarem personellen Aufwand realisieren lassen. Aber es geht um mehr als neue Technik – es geht um neue Verwaltungslogik.“
Bernd Kuch, Referent für Personal, Organisation und IT-Management
Außerdem muss die IT angepasst werden; aktuell sind wir kurz vor der Fertigstellung Die Technik in vielen Firmen sowie im öffentlichen Bereich stammen im Kern noch aus den Anfängen der 1980erJahre, als die ersten Computer und Fachverfahren eingeführt wurden.
Aber es geht um mehr als neue Technik – es geht um neue Verwaltungslogik. Es braucht nun einheitliche Standards für KI und für Datenmanagement Wenn ich für jede Fachanwendung in einem Amt – im Tiefbauamt, im Bürgeramt, etc. –
immer wieder andere Standards hätte, dann würde sich unser technischer Bereich so verzetteln, dass wir es nicht umsetzen könnten. Auch im ITBereich gibt es selbstverständlich den Fachkräftemangel. Das vorhandene Personal muss also alles Wichtige abdecken können. Das geht nur über Standardisierung und Skalierbarkeit
Das waren meine Hauptthemen in den ersten Jahren – mal abgesehen von der notwendigen Stellenplankonsolidierung, wobei auch das sehr eng zusammenhängt: In dem Augenblick, wo ich Stellen aus wirtschaftlichen Gründen abbauen und gleichzeitig den Bürgerservice aufrechterhalten oder weiter ausbauen muss, geht das nur noch, indem ich verstärkt digitalisiere.
Die Digitalisierung bestimmter Aufgaben vereinfacht entweder die Arbeit der handelnden Personen oder übernimmt diese vollständig, zum Beispiel durch die Automatisierung mit künstlicher Intelligenz Deshalb sind Personal, Organisation und IT stark miteinander verbunden.

Der Autor Felix Appel ist Überzeugungstäter im öffentlichen Dienst. Nach über 17 Jahren in Verwaltung, Führung und Aufbauarbeit gründete er 2024 franconia one, um Verwaltung neu zu denken – menschlicher, vernetzter, digitaler. Sein Schwerpunkt liegt auf Community Building und Community Management als strategischen Hebeln für eine zukunftsfähige Verwaltung.
Digitalisierung ist schließlich keine kurzfristige Initiative, sondern eine strukturelle Daueraufgabe – oder wie sehen Sie das?
Kuch: Genau, da bin ich einfach überzeugt. Beim Fußball kannst du auch die tollste Strategie haben, planen und super Spieler auf das Feld schicken. Aber dort gibt es den Spruch: „die Wahrheit liegt auf dem Platz“ – und das gilt auch für uns Digitalisierung bedeutet ein Umdenken in der Verwaltungslogik. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Zusammenspiel von IT, Organisation und Personal – sowie in einem realistischen und kontinuierlichen Umsetzungswillen.
Außerdem bringt das für die Kommunen nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch insgesamteinefinanzielleEntlastung mit sich, oder?
Kuch: Natürlich Wenn ich auf der einen Seite sehe, dass die Aufgaben zunehmen und wir auf der anderen Seite weiterhin einen guten Bürgerservice bieten wollen – und das mit weniger Personal –, dann führt an der Digitalisierung kein Weg vorbei Ich kann entweder die Prozesse digitalisieren oder die Qualität nimmt ab. Das Interview führte Serina Sonsalla
Kolumne
Manche befürchten, dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze in der Verwaltung ersetzen wird Doch was wäre, wenn sie genau das Gegenteil bewirkt und Verwaltung menschlicher macht? Professor Niehaves zeigt, dass ein Beruf mehr ist als die Summe seiner Aufgaben. Und dass KI (potenziell) Freiräume schafft – eben für das, was Menschen ausmacht.
Der Mediziner Eric Topol wirft in seinem Buch „Deep Medicine: Wie KI das Gesundheitswesen menschlicher macht“ eine spannende These zur künstlichen Intelligenz auf, die im Gegensatz zu den sonst üblichen Erzählungen steht. Statt Ärztinnen und Ärzte zu ersetzen, entlaste KI sie von administrativen Tätigkeiten wie Dokumentation oder Dateneingabe und schaffe so wieder Raum für echte Zuwendung, Empathie und Beziehung „Deep Medicine“ ist für Topol eine Medizin, die durch KI tiefer wird – nicht technisch, sondern menschlich. Menschlicher wegen und durch KI! Er spricht von „Deep Empathy“ und zeigt, dass Technologie helfen kann, zur eigentlichen Berufung zurückzukehren: zum Gespräch, zur Aufklärung, zur Verantwortung gegenüber dem Menschen Soweit das Buch, das in meinem Regal steht … aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Nehmen wir das absolute KIVorreiter-Feld, die Radiologie, in den Blick. „Radiologen wird es in fünf Jahren nicht mehr geben.“ Das war2016 diePrognosevonGeoffrey Hinton, einem der wichtigsten KIForscher unserer Zeit und inzwischen Nobelpreisträger Warum? Weil KI in der Lage ist, Karzinome auf medizinischen Bildern besser zu erkennen als Menschen Also besser in der Kernaufgabe. Doch wie die New York Times im Mai 2025 berichtete („Your A.I. Radiologist Will Not Be With You Soon“),
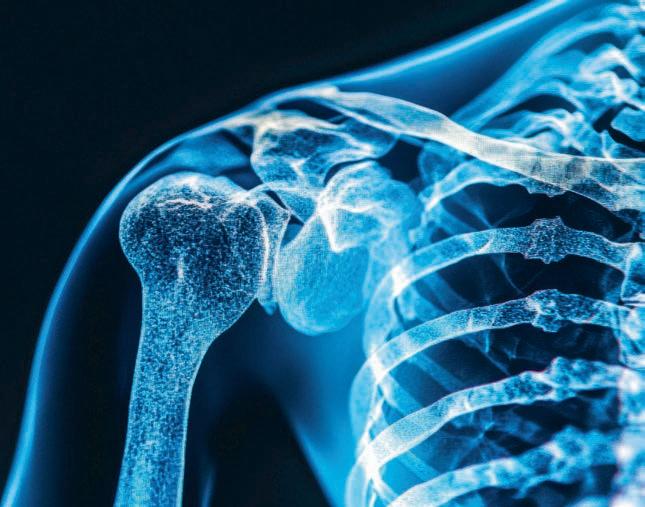
Die Radiologie ist das absolute KI-Vorreiter-Feld, zeigt aber: Auf Radiologen kann nicht verzichtet werden.
ist das Gegenteil eingetreten: Die Mayo Clinic, eine der renommiertesten Gesundheitseinrichtungen der USA, hat heute 55 Prozent mehr Radiologinnen und Radiologinnen als vor wenigen Jahren Obwohl dort über 250 (!) KI-Systeme im Einsatz sind. Die KI kam – und mit ihr mehr Radiologen. Wie lässt sich das erklären?
Die ergänzende KI
KI ersetzt nicht, sie verändert und ergänzt. Die praktische Erklärung ist einfach und aufschlussreich zugleich: KI übernimmt Routinetätigkeiten, etwa das Sichten gro-
Basisdienste, Standards, Infrastruktur
ßer Bildmengen oder das Erkennen einfacher Muster Sie unterstützt in der Diagnosevorbereitung, sortiert, vergleicht, berechnet Wahrscheinlichkeiten Doch das eigentliche ärztliche Handeln bleibt beim Menschen: das Einordnen von Kontexten, das Abwägen von Unsicherheiten, das Kommunizieren mit anderen Fachbereichen, das Gespräch mit den Patienten Gerade weil KI repetitive Aufgaben automatisiert, wird der Mensch in den nicht-automatisierbaren Aufgaben sichtbarer, notwendiger, wertvoller.
Radiologinnen haben heute in der Praxis mehr Zeit für das, was vor-
In seiner Studie „Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks“ geht Thilak Mahendran auf die Voraussetzungen für eine plattformfähige Verwaltung ein und nennt konkrete Handlungsvorschläge.
Was ist der „Deutschland-Stack“ eigentlich genau? Diese Frage ist der Ausgangspunkt einer Studie der Agora Digitale Transformation Thilak Mahendran, Innovation Lead – Digitales Regierungshandeln, befasst sich im Papier mit dem Titel „Government-as-a-Platform als Leitbild des DeutschlandStacks“ mit der Begrifflichkeit, aber auch mit den strukturellen Voraussetzungen für eine plattformfähi-
ge Verwaltung sowie mit konkreten Handlungsvorschlägen Laut Studie basiert eine erfolgreiche digitale Verwaltung auf klar definierten Stacks mit drei funktionalen Säulen im Zentrum: W Vertrauensdienste wie digitale Identitäten und Signaturlösungen, W Interaktionsdienste wie ePayment- oder Benachrichtigungssysteme sowie
her oft zu kurz kam: für Qualität statt Quantität. Topols zu Beginn genannte Vision der „Deep Medicine“, einer empathischeren Medizin, wird in der Radiologie ganz praktisch und real sichtbar: KI erledigt Hintergrundprozesse, der Mensch tritt wieder in den Vordergrund. Radiologen müssen weniger Befunde tippen und mehr kommunizieren Sie haben mehr Zeit für schwierige Fälle, für Zweitmeinungen, für kollegiale Abstimmungen Sie werden zu interdisziplinären Partnern und nicht nur zu Technikern vor dem Bildschirm Genau das beschreibt Topol: Wenn KI die Routine abnimmt, entsteht Raum für Tiefe, Empathie und Berufung. Die Radiologie zeigt: KI bringt nicht Entfremdung, sondern Rückbindung. Nicht Ersatz, sondern Ergänzung Nicht Maschinenmedizin, sondern menschlichere Medizin.
Und in der Verwaltung?
Okay, vier Absätze lang habe ich Sie auf eine kleine Reise in die Medizin mitgenommen, aber Sie wollen natürlich wissen, was lässt sich daraus über KI in unserem Bereich, der öffentlichen Verwaltung lernen? Auch die Verwaltung kennt Routine. Formularprüfung, Aktenbearbeitung, Bescheiderstellung
Und genau hier liegt das Missverständnis, wenn über KI in der Verwaltung gesprochen wird. Denn häufig heißt es dann: „Wenn die KI den Antrag prüfen kann – wozu noch Menschen?“ Die richtige Frage lautet aber: Was bleibt übrig, wenn die Maschine die Regel kennt? Und was beginnt dann neu? Die Antwort liegt in der gleichen Richtung wie in der Radiologie: Wenn der formale Prozess durch KI unterstützt wird, gewinnt der Mensch Raum – für die Ausnahmen, die Widersprüche, die komplexen Lebenslagen.
Der Mensch wird zur unverzichtbaren Instanz im Ausnahmefall. Denn Verwaltung endet nicht bei der Regel – sie beginnt oft genau dort, wo die Regel nicht mehr greift: Härtefälle, Widersprüche, begründete Abweichungen. Wer mit einem
Antrag nicht durch ein Standardverfahren passt, braucht keinen Algorithmus, sondern Verständnis, Abwägung, Kommunikation Genau hier kommt das zurück, was Topol für die Medizin beschreibt: Empathie, Kontextkompetenz, Verantwortung. KI macht aus Verwaltungsmitarbeitenden keine Ersetzten, sondern entscheidende Instanzen im Umgang mit dem Besonderen.
Der Charakter öffentlicher Aufgaben
Weg von der Bescheidfabrik, hin zur Beziehungsarbeit Verwaltungen sind keine Bescheidfabriken. Verwaltung erklärt, begleitet, vermittelt Sie ist in vielen Fällen erste Kontaktstelle für Menschen in komplexen Lebenslagen: Migration, Pflege, Bildung, Arbeitslosigkeit Wer glaubt, dass das maschinell abbildbar ist, verkennt den Charakter öffentlicher Aufgaben Verwaltung ist auch soziale Infrastruktur KI kann helfen, sie davon zu entlasten, was automatisierbar ist – damit wieder mehr Raum für das Menschliche entsteht. Es geht nicht um Rationalisierung, es geht um Rehumanisierung Der Fehler vieler Digitalisierungsdebatten ist, dass sie Effizienzsteigerung mit Personalabbau verwechseln Doch wie in der Radiologie zeigt sich: Gerade wenn KI kommt, wird der Mensch wichtiger, weil seine Rolle sich verändert. Von der Prozessabwicklung hin zur Sinnstiftung, zur Kommunikation, zur Entscheidungsverantwortung. Zurück zur Berufung. Und auch in der Verwaltung gilt: Wer sich weniger im Aktenstapel vergraben muss, kann wieder für Bürgerinnen und Bürger da sein Das ist kein KIRückschritt, das ist KI-Fortschritt.
Der Autor

Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves ist Informatikprofessor und Politikwissenschaftler, leitet die Arbeitsgruppe„Digitale Transformation öffentlicher Dienste“ an der Universität Bremen und berichtet in der wissenschaftlichen Kolumne über aktuelle Forschungsergebnisse zur digitalen Verwaltung. [ linkedin.com/in/niehaves ]
W Datendienste, die einen sicheren und strukturierten Austausch ermöglichen. Viele dieser Komponenten seien laut Mahendran in Deutschland bereits vorhanden – doch ihre Qualität, Anschlussfähigkeit und strategische Steuerung variierten erheblich. „Deutschland verfügt über viele digitale Bausteine – von der BundID bis zu ePayBL“, schreibt der Autor. Doch es fehle ein ge-
meinsamer Ordnungsrahmen, der Wiederverwendung ermögliche, Zuständigkeiten kläre und den Betrieb über föderale Ebenen hinweg sichere. „Genau das leistet ein plattformbasierter Ansatz“, schreibt Mahendran Government as a Platform verstehe Digitalisierung nicht als Ansammlung technischer Projekte, sondern als staatliche Infrastrukturaufgabe. „Zentraler Baustein dieses Ansatzes ist der Deutschland-Stack – also ein strategisch gefasster Plattformkern aus Basisdiensten für Authentifizierung, Datenübertragung und Transaktionen“, fasst Mahendran in der Studie zusammen. Er warnt aber zugleich davor, den Stack isoliert voranzutreiben oder politisch zu überdehnen. Dies könne zu einer technikgetriebenen Fragmentierung führen. Es brauche „eine gemeinsame Kraftan-
strengung“ – und ein Verständnis dafür, „dass Plattformfähigkeit eine Governance voraussetzt, um eine allein technische Denkweise zu verhindern“. Mahendran: „Der Deutschland-Stack darf keine Wunschliste sein, sondern muss als gemeinsame Infrastruktur strategisch eingebettet werden.“ su
Zur Studie
Die Studie„Government-as-a-Platform als Leitbild des Deutschland-Stacks. Technik allein reicht nicht: ein Governance-Rahmen für plattformbasierte Verwaltungsmodernisierung“ ist als PDF verfügbar.

[ agoradigital.de/projekte/ government-as-a-platform ]




Gesetze digitaltauglich zu gestalten, genügt nicht: Die Initiative Law as Code will einen Paradigmenwechsel – von der Digitalisierung von Rechtsvorschriften durch die Anwender hin zur digitalen Bereitstellung des Rechts.
An erster Stelle der jetzt veröffentlichten Reformempfehlungen der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ steht der Bereich Gesetzgebung Aus gutem Grund, wie die Initiatoren in ihrem Abschlussbericht darlegen:„Gesetze sind im freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat Grundlage allen staatlichen Handelns“, ihre Verständlichkeit und Vollzugsfreundlichkeit seien entscheidend sowohl für eine effektive und schnelle Verwaltung als auch dafür, dass die Gesetze befolgt würden. Es hakt bekanntlich an beiden Punkten, der Verständlichkeit, aber vor allem der Umsetzbarkeit. Die Initiatoren schlagen unter anderem eine Visualisierung der Organisationsstrukturen und Prozessabläufen für alle Gesetzentwürfe vor. Sie mahnen mehr Sorgfalt an, verweisen aber gleichzeitig darauf, „dass die Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren mittlerweile eine Komplexität erreicht haben, die von der Ministerialbürokratie kaum noch bewältigt werden kann" Die Liste der im Bericht aufgeführten Leitfäden, Arbeitshilfen undsonstigenToolsistentmutigend lang, und es ist nur eine Auswahl. Daher der Vorschlag, den gesamten Rechtsetzungsprozess neu zu durchdenken und zu vereinfachen. Neben der frühzeitigen Einbeziehung aller Fachressorts und Beteiligten sei die zentrale Bereitstellung spezifischer Gesetzgebungsexpertise hilfreich, etwa für Berechnung des Erfüllungsaufwands, Digitalchecks, Wirkungsanalysen, Kosten-
Nutzen-Abschätzungen, Visualisierung und Modellierung der Rechtssprache.
Paradigmenwechsel: Law as Code
In diesem Kontext ist eine noch junge Initiative der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND interessant: „Law as Code“. Worum geht es dabei? Darum, dass Gesetze digital anwendbar sein müssen und letztlich um nicht weniger als einen Paradigmenwechsel. Derzeit müssen die Ministerien auf Bundesebene bereits die digitale Umsetzbarkeit ihrer neuen Gesetze beachten, dazu wurde 2023 der von der bundeseigenen DigitalService GmbH entwickelte Digitalcheck eingeführt Damit sollen, wie es heißt, „Digitalisierungshürden wie das persönliche Erscheinen auf demAmtoderNachweiseinPapierform“ vermieden werden Die Tools und Hilfestellungen zum Digitalcheck, bei denen Visualisierungstechniken eine große Rolle spielen, werden gemeinsam mit dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) weiterentwickelt, basierend auf dem Feedback der Nutzenden Der DigitalService bietet zudem Unterstützung. Seit 2025 wird diese Infrastruktur des Digitalchecks auch gleichzeitig für die Interoperabilitätsbewertungen für die Europäische Union genutzt. Dennoch müssten derzeit Rechtsnormen von jedem einzelnen Anwender individuell in digitale Strukturen übersetzt werden, be-
schreibt die Low-as-Code-Initiative die aktuelle Situation Diese parallele Digitalisierung identischer Normen bei tausenden Akteuren führe zu „massive(n) gesellschaftlichen Ineffizienzen“. Zudem arbeiteten die Anwender mit unterschiedlichen digitalen Sprachen, Formaten und Strukturen, damit werde „den Zielen von Standardisierung und Interoperabilität systembedingt entgegengewirkt“. Mit dem neuen Ansatz „Law as Code“ dagegen sollen Rechtsnormen parallel zum juristischen Text auch als Rechtscode, also in maschinenlesbarer und ausführbarer Form, bereitgestellt werden. Die Digitalisierungsaufgabe liegt damit nicht mehr bei den Anwendern, sondern beim Gesetzgeber „Das bisherige Zielbild der verantwortlichen Akteure ist, Gesetze digitaltauglich zu machen, damit sie von den Anwendern besser digitalisiert werden können. Law as Code geht darüber hinaus: Gesetze werden von Anfang an digital bereitgestellt.“ Nur so könne das System wirklich medienbruchfrei funktionieren, erklärt Dr. Hakke Hansen, der Leiter der Initiative Law as Code Es gehe um einen Paradigmenwechsel: „Wir wollen die Digitalisierung von Rechtsvorschriften durch die Anwender ersetzen – durch die digitale Bereitstellung des Rechts“. Dies sei ein grundlegend anderer Ansatz. „Deshalb ist es unser zentrales Anliegen, alle relevanten Akteure zusammenzubringen und das Vorhaben gemeinschaftlich zu realisieren", erläutert

Maschinenraum statt
Elfenbeinturm: Aktives Zuhören ist eine Frage der Haltung.

Über SPRIND
Die Abstimmung für den
des eGovernment Wettbewerbs läuft.
Die Abkürzung SPRIND steht für „Sprunginnovationen in Deutschland“. Darunter werden Innovationen verstanden, die einen existierenden Markt grundlegend verändern, einen komplett neuen Markt erschaffen oder ein bedeutendes technologisches, soziales oder ökologisches Problem lösen. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRIND, wurde im Dezember 2019 in Leipzig gegründet – als schnelles, flexibles staatliches Instrument zur Förderung zukunftsweisender Erfindungen und Entwicklungen. Mit dem seit 30. Dezember 2023 geltenden SPRIND-Freiheitsgesetz wurde diese Flexibilität nochmals erhöht, u. a. kann die SPRIND neben bisherigen Finanzierungsinstrumenten auch privatrechtliche finanzielle Mittel zur Förderung von Innovationen nutzen und sich selbst an Unternehmen sowie Unternehmensgründungen beteiligen. Die Förderung der Rulemapping Group zusammen mit einem privaten Investor ist ein Beispiel dafür. Darüber hinaus fördert die SPRIND visionäre Ansätze wie Law as Code, die wegweisende Durchbrüche ermöglichen sollen.
Hansen Im Ergebnis sollen Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft den Rechtscode ohne eigene Übersetzungs- oder Programmierleistungen unmittelbar in ihre Systeme integrieren können. Die erforderlichen Schnittstellen, AustauschformateundDatenstrukturen sind offen und nachvollziehbar zu definieren Dabei wird auch eine Qualitätsverbesserung erwartet, da bei der Übersetzung in Programmcode auch logische Brüche und Unklarheiten sichtbar würden
Die digitale Rechtsinfrastruktur ermögliche zudem neue Formen der Evaluation und Simulation. Noch mag das nach Zukunftsmusik klingen, die Initiative hat aber bereits die nötigen Grundelemente definiert:
W die Festlegung einer einheitlichen Rechtscode-Struktur für maschinenlesbare und ausführbare Rechtsnormen als zentrale Grundlage für Law as Code, mit verbindlich definierten Schnittstellen, Austauschformaten und Datenstrukturen;
W die Werkzeuge: Open SourceEditoren, die allen Akteuren offen und kostenfrei zur Verfügung zu stellen sind; W spezialisierte KI-Werkzeuge zur Codierung bestehenden Rechts, die Skalierbarkeit ermöglichen; W eine zentrale Bibliothek, die den Rechtscode strukturiert und offen bereitstellt sowie
W ein Fortbildungsprogramm zur Vermittlung der nötigen Kompetenzen Auch die nächsten Schritte sind klar: Zum einen die Entwicklung von Editoren – der zentralen Tools. „Ein wichtiger Teil der Realisierung der Law-as-Code-Initiative ist die Entwicklung von OpenSource-Editoren und der Aufbau einer Community darum Unser Fokus liegt darauf, diese Prozesse gezielt zu unterstützen“, erklärt Jörg Resch, Innovationsmanager mit Schwerpunkt Zukunft Staat bei der SPRIND Dabei sollen bestehende Lösungen oder in der Entwicklung befindliche Lösungen genutzt werden, wie etwa die der Rulemapping Group, die von der SPRINDgefördertwird „Technisch wollen wir sicherstellen, dass Unternehmen und Verwaltungen Standards der Law-as-Code-Initi-
ative nutzen können, um Verwaltung zu automatisieren – ohne durch Vendor-Lock-in an bestimmte Tools gebunden zu sein“, verdeutlicht Resch. So werde sich die Initiative durch die Community weiterentwickeln und den Standard mitdefinieren.
Gesamtgesellschaftliches Vorhaben
Das große Anliegen der Initiative ist es, Mitstreiter zu gewinnen und die Akteure zu vernetzen „Wir sind dabei, das Thema Law as Code zu platzieren und bei den politisch Verantwortlichen zu verankern." Dafür brauche es Information –und auch Überzeugung, so Hakke Hansen Die Initiative sieht Law as Code als ein gesamtgesellschaftliches Vorhaben. Für die Umsetzung brauche es „das Wissen, die Erfahrung und die Perspektiven vieler“ Alle relevanten Akteure – Fachanwender, Rechtsentwickler, Standardisierer, Technologieanbieter, zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Entscheidungsträger seien eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.„Insbesondere bitten wir Verbände, Kommunen, Landesvertretungen und weitere Institutionen, sich einzubringen: mit Fragen, Ideen, kritischen Rückmeldungen und konzeptionellen Impulsen“, heißt es auf der Website der Initiative. Der Anspruch ist groß, der Reformbedarf aber eben auch. Denn wie eingangs beschrieben, geht es um die Umsetzbarkeit von Gesetzen, aber auch darum, die vielen Vorgaben zur Gesetzgebung selbst wieder handhabbar zu machen. nh

Weitere Informationen Mitwirkungsmöglichkeiten reichen von offenen Fachdialogen über prototypische Entwicklungsprojekte bis hin zur Mitgestaltung der technischen und semantischen Standards. Mehr zur Initiative„ Law as Code" finden Sie auf der Website: [ voge.ly/law-as-code ]
Live aus dem CDO-Zirkel
Seit kurzem ist es wissenschaftlich bewiesen: Die meisten Menschen haben ungefähr doppelt so viele Ohren wie Münder Eigentlich (ja: eigentlich) sollten wir daher ziemlich gut zuhören können.
Doch an manchen Stellen scheint das noch längst nicht oft genug der Fall zu sein.

Ein ganz realer Fall: Bei mir zuhause in Berlin wird die Nachbarschaft mit Parkraumbewirtschaftung beglückt. Man findet Hinweise im Netz, dass diese neue Parkzone bereits im Herbst 2023 existent sein sollte, anderswo steht „Sommer 2024“ – beide Termine sind schon eine Weile überholt Als dann tatsächlich die ersten Automaten aufgestellt werden, bemühe auch ich mich um einen entsprechenden Parkausweis – online, per E-Mail Als fünf Wochen später nichts per Post eingetroffen ist, folgt eine zweite Mail, noch freundlich und höflich, jedoch ein wenig eindringlich Und zwecks möglicher Beschleunigung auch in Kopie an die zuständige Bezirksstadträtin Was passiert? Weniger als zwanzig Minuten später klingelt mein Telefon! Ein freundlicher und kompetenter Mensch klärt mich über den Zustand und die Zukunft dieser Parkzone auf. („Wird noch eine Weile dauern.“) Ich bedanke mich für dieses Update und die schnelle Reaktion. Wir kommen ins Gespräch, ich oute mich als NEGZ-Mensch, spreche von den Versuchen der Verwaltungsmodernisierung – und wir geraten immer mehr ins Eingemachte.
„Wenn die da oben doch mal häufiger bei uns hier unten nachfragen würden!“ Das kann man jetzt schnell als typisch deutsches Meckern und Jammern über „die da oben“ abtun. Oder einfach mal zuhören
(genau: mit den beiden vorhandenen Ohren) Habe ich getan Hat sich gelohnt Auch wenn – eigentlich – sämtliche Erkenntnisse aus diesem Telefonat schon längst bekannt sind oder sein sollten: W Wir reden in unseren Elfenbeinturm-Bubbles über KI und Cloud, über Quantencomputer und andere Dinge Doch teilweise sind es der Toner fürs Faxgerät (leicht übertrieben, ich weiß) oder ein PC, auf dem noch eine Windowsversion von 1847 (oder war's 1848?) installiert ist, die das Heute bestimmen, die mit künstlicher Intelligenz so viel zu tun haben, wie ich ein Astronaut bin Kopf in den Wolken, um heute schon bereit für die Zukunft von übermorgen zu sein?
Ja, unbedingt! Und gleichzeitig bitte ebenfalls die Füße auf dem Boden der trivial erscheinenden Tatsachen behalten, wie man sie in vielen ganz realen Amtsstuben noch immer antrifft. Es ist kein Entweder-oder, man muss nicht das Eine tun und das Andere lassen. Beides, bitte Beides geht gemeinsam.
W Bitte zuhören: Das zuerst knapp halbstündige Telefonat wurde zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Dort drehte es sich darum, dass noch viel zu selten diejenigen ausreichend Gehör bekommen, die sich tagtäglich mit Fachverfahren (die man manchmal nur mit sehr viel Galgenhumor ertragen kann)
ten und zuvor berechneten Ergebnisse zustande Das hat diese Menschen damals echt gewurmt. Nochmal alles neu kalkuliert und konzipiert, doch wieder kam nur Schrott heraus – und zwar wortwörtlich Da dachte sich einer dieser Menschen: „Das schaue ich mir mal ganz genau an!“ und schlug sein Lager an dieser Maschinenstraße auf. Anscheinend so gut versteckt, dass er nun eine real existierende Verschwörung (keine Theorie) mitbekam: Die Mitarbeiter hatten sich heimlich abgestimmt, um nachts fiesen Metallschrott in die Zahnräder der Maschine zu werfen, um diese Apparatur zu boykottieren Nicht im übertragenen, sondern im echten Sinne Und nicht, weil die neue Maschine schlecht oder falsch gewesen wäre – im Gegenteil! Sondern weil niemand sie, die wahren Expertinnen und Experten dieser Abläufe, jemals gefragt hatte (Das darf kurz sacken Vielleicht kommt jemandem so etwas bekannt vor.)
Peter Senge, der „Godfather“ des Prinzips der Lernenden Organisation, hat dazu schon vor Jahren dieses Zitat hinterlassen: „Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung Sie wehren sich dagegen, verändert zu werden.“
Nun kann man über „die da oben“ meckern, fiese Vorurteile gegenüber höheren Diensten und gehobenen Gehaltsklassen formulieren, womöglich gegenüber Juristinnen & Juristen oder anderweitigen Rollen & Positionen, die nur selten „im Maschinenraum“ anzutreffen sind.
herumschlagen Um wirklich sinnvolle Vorschläge einzubringen, wie so manches darin mit recht wenig Aufwand besser, einfacher, funktionaler, für alle Beteiligten nutzerfreundlicher und damit wirkungsvoller werden kann.
Abgehoben und weltfremd?
Ein anderes Beispiel, schon wesentlich älter, mir nur via Hörensagen bekannt, doch umso deutlicher auf den Punkt gebracht: In einem Projekt noch vor den Zeiten der Digitalisierung sollte eine „Prozessstraße“ mit physischen Maschinen optimiert werden Viele kluge Beraterinnen und Ingenieure waren involviert, hatten alles zigmal durchdacht, perfekt geplant und super-sauber umgesetzt – und trotzdem kamen nicht die erhoff-
Den allermeisten Chief Digital Officers, die ich bislang hierzulande kennenlernen durfte, würde ich eine „abgehobene“ oder „weltfremde“ Attitüde nicht attestieren. Auch keine Sorge, sich womöglich die Hände schmutzig zu machen, im Gegenteil. Doch möglicherweise sollte der eingangs genannte Hinweis aus der Wissenschaft zur Anzahl der Ohren an manchen Stellen erst noch vorgestellt und ins breitere Bewusstsein gebracht werden. (Achtung: das da oben war Humor. Die Erkenntnis hinsichtlich der zwei qua Geburt bereitgestellten humanoiden Hörgeräte existiert schon länger.)
Zuhören im Maschinenraum
Wir können – wie zuletzt in dieser Kolumne, als der Blick in die bayerische Landeshauptstadt gerichtet wurde – ganz wunderbar über „New Work“ und artverwandte Dinge plaudern Wir sollten auch weiterhin den Blick in die Zukunft

richten, um aufs Morgen vorbereitet zu sein. Doch es braucht, damit die digitalen Dinge wirklich Nutzen stiften und Wirkung zeigen, wohl noch sehr viel mehr echtes Zuhören als Grundlage von gelebter Partizipation und kluger Optimierung. Nicht in hübschen Hochglanzbroschüren, nicht nur in tollen Strategiepapieren. Sondern in den Maschinenräumen der Amtsstuben Genau dort, wo Beamte und Beamtinnen auf Bürgerinnen und Bürger treffen.
„Das machen wir doch! Schon längst!“ Wenn diese Reaktion beim Lesen resultiert: Super! Dann reden Sie bitte noch mehr mit anderen darüber, dass dies bei Ihnen der Fall ist – und vor allem: warum Was genau die Grundlagen dafür sind, dass eine Abwehrhaltung „vom Fußvolk“, wie sie Peter Senge beschrieb, keine Rolle spielt, weil die Menschen wirklich beteiligt werden, weil ihnen tatsächlich zugehört wird.
Ja, das sollte – eigentlich – eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht, nicht überall. Das oben beschriebene Beispiel aus Berlin ist kein Einzelfall. Ein wenig neugieriges Recherchieren auf weiter unten in Organigrammen angesiedelten Positionen von Behörden hat mir gezeigt, dass fachliches Nachfragen und aktives Zuhören durch Führungskräfte auch an vielen anderen Orten jenseits der „Arm-aber-sexy-Hauptstadt“ noch deutlich ausbaufähige Prozesse sind Zuhören? Denen, die direkt beteiligt sind? Das hat nichts mit Budgets oder IT zu tun, es ist eine Frage der Haltung und des Handelns. Und möglicherweise lohnt sich hierfür auch der Austausch von CDO zu CDO Wenn dabei mindestens ebenso viel zugehört wie gesprochen wird. Um voneinander zu lernen. Um dadurch eben auch zu erkennen und in die breitere Anwendung zu bringen, was es braucht, um denen mehr „akustische“ Aufmerksamkeit zu schenken, das Gehör denen zu widmen, die nicht nur Meckern oder Jammern, sondern ganz oft auch clevere Lösungsansätze parat haben. Hören Sie einander noch mehr zu. Über Hierarchieebenen, ministeriale, Landes- und Stadtgrenzen hinweg Um den Maschinenraum tiefer und besser zu verstehen, muss manchmal einfach nur tiefer und besser zugehört werden Und zum besseren Zuhören gehört auch noch mehr nachfragen.
Power to the Amtsstube. Power for the People. Let's go, CDO.

Autor Andreas Steffen ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des NEGZ, dort auch Co-Sprecher des CDO-Zirkels und beschäftigt sich seit 1996 mit Digitalisierung, Transformation und Innovation. Er ist Gründer und Managing Director von 5STEP und arbeitet als Strategieberater, Executive Coach und Moderator für Organisationen aus der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft. CDO-Zirkel
Kontakt zum CDO-Zirkel des NEGZ: [ negz.org/arbeitskreis/cdo-zirkel ]
Gleich 15 Projekte haben es beim 24. eGovernment-Wettbewerb in die Endrunde geschafft Während die Fachjury ihre abschließende Wertung bereits im Rahmen der Finalistentage abgegeben hat, läuft nun das öffentliche Voting für den Publikumspreis
Noch bis zum 17. August 2025 besteht die Möglichkeit, Einfluss auf den Ausgang des eGovernmentWettbewerbs zu nehmen – und zwar beim sogenannten Publikumspreis, der losgelöst von der Jury-Wertung vergeben wird Zur Abstimmung stehen dabei alle 15 Projekte, die es in die Finalistenrunde des von BearingPoint und Cisco ausgerichteten Wettstreits geschafft haben; wobei das Wort „Streit“ der Sache nicht gerecht wird, geht es vordergründig doch um die Vernetzung und den Austausch aller Nominierten, nicht um den Konkurrenzkampf.
Die Projekte im Überblick
Das soll aber nicht heißen, dass sich die Projektverantwortlichen bei ihren Pitches auf den Finalistentagen am 30. Juni und 1. Juli nicht ins Zeug gelegt hätten. Ob Zukunftsprojekte wie MaKI, der Marktplatz der KI-Möglichkeiten des BMDS, greifbare Lösungen wie die Jobcenter-App der Agentur für Arbeit oder Strategien wie die Initiative „Nachhaltige Softwareentwicklung“ des ITZBund:

Nur noch Gewinner: Ein Award ist den Finalistenprojekten des eGovernment-Wettbewerbs bereits sicher. Aber wer schafft es ganz nach oben aufs Treppchen?
Sie alle rangen mit vollem Einsatz um die Gunst der Jurymitglieder und stellten sich anschließend den fachlichen Fragen. Die Projekte verteilen sich auf vier Kategorien Im Bereich „KI und moderne Infrastruktur“ findet sich
neben MaKI die „ID Austria App“ des Bundeskanzleramts Österreich. Die Freie und Hansestadt Hamburg präsentierte das Projekt „Connected Urban Twins“ und war zusammen mit Schleswig-Holstein noch einmal mit dem UX-Standard
© BearingPoint
24. eGovernment-Wettbewerb
Weiterer Ablauf
2. Juli bis 17. August 2025: Publikumsvoting
Preisverleihung: September 2025 auf dem Ministerialkongress in der ehemaligen Münzprägeanstalt „Alte Münze“ Berlin
17. September, 17.30 Uhr: Verleihung des Publikumspreises 18. September, 13.00 Uhr: Verleihung der Jurypreise
KERN vertreten, welcher die vierte Säule der Digitalen Dachmarke bildet Die Jobcenter-App ist in der zweiten Kategorie „Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende neu gedacht“ nominiert Mitbewerber sind die FITKO mit „FIT-Connect“ und das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mit „digital. VM.SERVICES“, während das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung Thurgau das Projekt „DVS4U“ präsentierte.
Um kulturelle Aspekte geht es in der Kategorie „Organisations- und Veränderungsmanagement“, hier sind die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit der Strategie „ZEIT für Führung“, Hamburg und seine „Next Level Verwaltung“, das „Co-Creation Lab Verwaltungsdigitalisierung Dresden" sowie „Gemeinsam Digital für SachsenAnhalt“ vertreten. In der vierten Kategorie „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT“ hatte das Hessische Ministerium für Wirtschaft die beiden Fernerkundungsprojekte zur „Überwachung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen“ und für seine „Planungshilfen für Klimaschutz und Klimaanpassung“ gemeinsam eingereicht. Das ITZBund präsentierte seine bereits aktiv gelebte Initiative für „Nachhaltige Soft-
Ursprünglich für Bundesbehörden erdacht, soll der „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ künftig auch Ländern und Kommunen offen stehen. Dies könnte dem KI-Register zusätzlichen Schub geben.
Mit MaKI, dem „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“, ist seit Januar 2025 ein Bundesregister online, das eine Übersicht über die in der Bundesverwaltung realisierten KISysteme geben soll. Ursprünglich unter der Federführung des Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) vorangetrieben, fällt die Weiterentwicklung der Plattform mittlerweile in den Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernierung (BMDS).
Für mehr Nachnutzung und Zusammenarbeit
MaKI fungiert als zentrale Anlaufstelle für Behörden, die KI-Anwendungen suchen oder ihre eigenen Lösungen anderen Ressorts und
Verwaltungseinheiten zur Verfügung stellen möchten. Ebenso ist es registrierten Behörden möglich, beim Eintragen selbst betriebener KI-Systeme neben dem Nachnutzungspotenzial auch Kooperationswünsche mit anzugeben. „Diese Angaben erleichtern die gezielte Suche nach Partnern mit ähnlichen Zielen oder komplementären Ressourcen und Kompetenzen“, heißt es dazu auf der Informationsseite des Bundes. Ziel des Marktplatzes ist also zum einen die bessere Vernetzung zwischen den Behörden und darüber hinaus die Nachnutzung bereits entwickelter KI-Anwendungen, um sowohl technische als auch personelle Ressourcen einsparen zu können. Positiver Nebeneffekt: Die zugehörige Transparenzdatenbank
hilft der Bundesverwaltung schon jetzt dabei, eine der Transparenzpflichten aus der KI-Verordnung umzusetzen.
Öffnung für Bundesländer und Kommunen
Ein weiteres Merkmal von MaKI ist das Web-Dashboard, welches Kennzahlen zur Verbreitung und Verwendung der KI-Lösungen visualisiert. Demnach umfasst die MaKI-Datenbank Stand Juli insgesamt 186 Projekte, 182 davon noch aktiv betrieben und gepflegt, von denen 51 als reine Idee oder in Form einer konkreten Bedarfsmeldung vorliegen. 41 KI-Systeme sind noch in der Planung oder der Proof-of-Concept-Phase, 42 befinden sich in der Entwicklung und
wareentwicklung“, das Umweltbundesamt das „Anwendungslabor für Künstliche Intelligenz und Big Data“.
Die Award-Trophäen warten schon
Im Rahmen der Finalistentage präsentierten die Initiatoren der ausgewählten Projekte ihre Arbeit insgesamt zehn Minuten lang der unabhängigen Jury, die sich aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien zusammensetzt Welche Projekte dabei auf dem ersten Platz landeten, erfahren die Finalisten und Finalistinnen erst bei der Preisverleihung am 18. September zum 30-jährigen Jubiläum des Ministerialkongresses. Der Publikumspreis wird heuer schon am Vortag überreicht aus

Weitere Informationen Jetzt mitmachen beim Publikumsvoting für den eGovernment-Wettbewerb 2025. [ voge.ly/egovwett-voting25 ]

Aktueller Stand der im „Marktplatz der KI-Möglichkeiten“ erfassten KI-Systeme in der Bundesverwaltung.
48 wurden bereits umgesetzt. Sehr umtriebig war dabei das Umweltbundesamt, das allein 48 Projekte eingetragen hat. Mit Abstand folgen die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie das Bundesamt für Naturschutz mit 15, 14 respektive einem Dutzend Projekten.
Was sich erst einmal nach nicht besonders viel Input anhören mag, relativiert sich schnell angesichts der nachgelagerten Evaluierungsprozesse Für zusätzlichen Schub dürfte die schrittweise Einbindung der Bundesländer und Kommunen sorgen, die im Januar 2025 vom IT-Planungsrat beschlossen wurde und inzwischen in der Pilotierungs-
phase steckt Landesseitig sind die Freie und Hansestadt Hamburg als Projektpatin sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingebunden, aber auch Städtetag, Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag partizipieren aus
Weitere Informationen

Zum Dashboard und Informationsportal von MaKI, dem Marktplatz der KI-Möglichkeiten: [ maki.beki.bund.de ]
Feedback erwünscht
Die Industrie hat geliefert: Die Termine und weitere Informationen zu den ePa-Modulen hat der Bundesverband Gesundheits-IT in einer Übersicht zusammengefasst. Praxen sollten die verbleibende Zeit für Feedback nutzen, empfiehlt die KBV
An der Auslieferung der Module für die Praxisverwaltungssysteme (PVS) sollte der Start der „ePA für alle“ nicht scheitern: Zumindest die im Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e V. organisierten Unternehmen haben ihre ePA-Module bereits ausgeliefert bzw. die Auslieferung zu Beginn des dritten Quartals zugesagt. Eine ent-
sprechende Liste hat der Verband jetzt veröffentlicht. Darin sind neben Auslieferungsterminen auch weitere Informationen der Hersteller enthalten. Demnach stehen die Anbieter den Anwendern auch bei der Implementierung und bei Fragen zur Seite Rückmeldungen zur ePA-Nutzung in der Praxis würden „in einem kontinuierlichen

Der bvitg sieht die Weiterentwicklung der ePA als „ein gemeinschaftliches Projekt, an dem die gematik als spezifizierende und prüfende Stelle, die umsetzende Industrie und die Praxen gemeinsam arbeiten“.
Telematikinfrastruktur
ePA: Es bleibt beim Opt-Out
Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags hält an der Widerspruchslösung zur elektronischen Patientenakte fest Eine Petition hatte gefordert, die Akte nur mit ausdrücklichem Einverständnis anzulegen.
In der Begründung der Petition heißt es, der Zugang zu intimen, medizinischen Daten dürfe Forschern und anderen Nutzern nicht gewährt werden, zudem werde damit die ärztliche Schweigepflicht abgeschafft. Auch aufgrund der Gefahr von Hackerangriffen dürfe es keine zentrale Speicherung von Krankheitsdaten – ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen – geben.
Verbesserungsprozess“ durch die Anbieter bewertet und in die Systeme integriert. Somit seien die technischen Voraussetzungen und die begleitenden Informationsund Schulungsangebote für die ePA flächendeckend vorhanden. Mit der elektronischen Medikationsliste sei auch bereits ein konkreter Mehrwert spürbar In den Ausbaustufen sollen dann Funktionserweiterungen folgen Den Ausbau der „bestehenden Weiterbildungsangebote zu rechtlichen, wirtschaftlichen und behandlungsbezogenen Aspekten der ePA“ und die Beantwortung von Fragen der Ärztinnen und Ärzte sieht der Verband wiederum „in der primären Verantwortung der ärztlichen Selbstverwaltung und Standesvertretung“.
KBV: Testen und Feedback geben
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) informierte, dass die Bereitstellung der bvitg-Daten zum ePA-Rollout auf ihre Initiative hin erfolgt sei. Die KBV wolle für die Praxen weitere Informationen be-
Das Ende der Einbox-Konnektoren ist eingeläutet: Die Gesellschafter der gematik haben beschlossen, dass die Nutzung der Geräte bis maximal Ende 2030 möglich ist. Mit dem TI-Gateway steht der Nachfolger bereits parat.
Einrichtungen des Gesundheitswesen kennen sie: die Einbox-Konnektoren Und den damit verbundenen Ärger. Gerade in der Anfangszeit kam es rund um die Vor-Ort-Hardware zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) häufig zu technischen Problemen: Die Installation war aufwendig, die Praxissoftware manchmal nicht kompatibel, Ausfälle waren keine Seltenheit.
Virtuelle Anbindung an die TI
Diese Einbox-Konnektoren, wie sie einst in jeder Arztpraxis standen, sind bald Geschichte, denn sie können bis maximal Ende 2030 genutzt werden Der Grund für diese Entscheidung der gematik-Gesellschafter ist die Weiterentwicklung der Verschlüsselungstechnik

Wer (Entscheidungs-)Unterstützung für den Wechsel auf das TI-Gateway braucht, wird bei der gematik fündig.
für Gesundheitsdaten sowie eine entsprechende Begrenzung der aktuell verwendeten Zertifikate „Einrichtungen können die Konnekto-
ren noch bis zu deren Laufzeitende nutzen. Danach stehen ihnen andere Möglichkeiten zur Anbindung an die TI zur Verfügung“,
Der Ausschuss erkennt hingegen große Potenziele darin, die ePA flächendeckend verfügbar zu machen. Die Opt-out-Lösung sei in anderen europäischen Ländern wie Österreich oder Frankreich bereits Realität. Mit der erhöhten Verfügbarkeit wichtiger Gesundheitsdaten könnten medizinische Therapieentscheidungen auf einer besseren Datengrundlage erfolgen, heißt es weiter. Die ePA solle somit stärker als bisher Versorgungsprozesse unterstützen und auf konkrete mehrwertstiftende Anwendungen fokussiert werden. Die im Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz – DigiG) enthaltenen Regelungen berührten die Vorschriften des geltenden Rechts zur ärztlichen Schweigepflicht nicht. „Das gilt auch und gerade mit Blick auf gesetzlich normierte Verpflichtungen für Ärzte, die ePA mit bestimmten gesetzlich festgelegten Daten zu befüllen“, schreiben die Mitglieder des Petitionsausschusses, die zudem darauf hinweisen, dass es für das Forschungsdatenzentrum Gesundheit keinesfalls eine Datenfreigabe gebe. Vielmehr erhielten Forscher in sicheren virtuellen Verarbeitungsräumen kontrollierten Zugang zu anonymisierten oder pseudonymisierten Daten.
reitstellen und dazu selbst die Nicht-Mitgliedsunternehmen um Auskunft bitten. KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner empfiehlt Ärzten und Psychotherapeuten, die ePA zu testen und ihren PVS-Herstellern Feedback zu geben, um noch vor der verpflichtenden Nutzung ab Oktober weitere Verbesserungen an der Software zu erreichen. nh
heißt es von der gematik Als Nachfolger steht das so genannte TIGateway parat. Dabei läuft die Anbindung an die Telematikinfrastruktur virtuell, sodass keine physischen Boxen in den Praxen mehr nötig sind. Statt lokalem Konnektor gibt es einen TI-Client ohne Wartungsaufwand. Wie die gematik mitteilt, sind aktuell über das TI-Gateway mehr als 8.000 virtuelle Konnektoren in Praxen, Apotheken, Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren und Pflegeeinrichtungen im Einsatz „Die technische Vertrauenswürdigkeitsprüfung, die mit der Einführung der Konnektoren 2017 etabliert wurde, bleibt auch weiterhin bestehen, um den Schutz sensibler Gesundheitsdaten zu gewährleisten“, versichert die gematik.
Um die Akteure des Gesundheitswesens beim Wechsel auf das TIGateway zu unterstützen, hat die gematik einen Leitfaden veröffentlicht. Darin gibt es eine Gegenüberstellung von TI-Gateway und Einbox-Konnektoren, eine Erklärung zu technischen Voraussetzungen sowie Hilfen zu Beauftragung, Vertragsabschluss und Implementierung. Außerdem gibt es auf der Website der gematik allgemeine Checklisten mit Infos, wie sich medizinische Einrichtungen an die
Weitere Informationen
Die Übersicht des bvitg finden Sie online hier:

[ voge.ly/bvitg-ePA ]
Telematikinfrastruktur anschließen können.
„Wesentlicher Baustein“
„Die TI 2.0 ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einer digitaleren Infrastruktur, die sich noch besser an die Wünsche und Anforderungen der praktischen Versorgung anpasst“, heißt es von der gematik. Dafür werde neben dem TIGateway die Sicherheitsarchitektur der TI mit dem Zero-Trust-Ansatz grundlegend weiterentwickelt
„Der Ansatz setzt auf moderne Mechanismen, die sich bereits in anderen Bereichen, wie dem Finanzwesen und insbesondere in CloudInfrastrukturen, etabliert haben“, so die gematik Die Nutzung der TI werde dadurch flexibler. su
Weitere Informationen

Leitfaden zum TI-Gateway: [ voge.ly/Leitfaden-Gateway ]
Checklisten zum TI-Zugang:
[ voge.ly/gematik-Checklisten ]
22. bis 23. Oktober 2025
Die Veranstaltung stellt digitale Verwaltungen und nachhaltige Stadtentwicklung in den Mittelpunkt. Außerdem wird die Kommunale im Messezentrum Nürnberg erstmals auf drei Messehallen erweitert.
An dem Leitgedanken „Veränderungen beobachten und hinhören“ orientiert sich die Veranstaltung der Nürnberger Messe: die Kommunale Beschaffungsentscheider sollten nicht nur die Präsentation passender Lösungen und Produkte im Blick behalten, sondern auch „die Zukunft von Morgen“ Dieses Jahr wird das Event vom 22. bis zum 23. Oktober im Messezentrum auf drei Hallen erweitert:
W Halle 8 fokussiert sich auf den öffentlichen Raum, die Mobilität und Nutzfahrzeuge.
W Halle 9 befasst sich mit Digitalisierung, IT und Kommunikation
Überblick
Kommunale 2025 22. und 23. Oktober
Messezentrum 1 90471 Nürnberg
Öffnungszeiten:
9 bis 18 Uhr (1. Tag) bzw bis 17 Uhr (2. Tag)

Veranstalter/Kontakt: NürnbergMesse GmbH kommunale@nuernbergmesse.de Tel. 0911/8606 8775
Eintrittspreise: Tageskarte 25 Euro, Dauerkarte 35 Euro [ kommunale.de ]
15. September 2025

W Halle 10 steht für Klima, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Diese Themenschwerpunkte sollen die digitale Verwaltung und die nachhaltige Stadtentwicklung ins Zentrum rücken Ein Highlight könnte der DigitalTalk sein, der weitere Zukunftsthemen der digitalen Kommune beleuchtet. Neben den Ausstellerforen wird der DigitalKongress einen Großteil der Veranstaltung abdecken –und zwar mit sieben weiteren KongressRäumen. In diesen werden an beiden Tagen Workshops, Seminare und Diskussionen stattfinden. Parallel findet auch der Kongress des Bayerischen Gemeindetags statt, erstmals mit dem
Gemeindetag BadenWürttemberg (BW) Steffen Jäger, Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags BW, erklärte: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit entlang der Südschiene – zwischen den badenwürttembergischen Kommunen und den bayerischen Städten, Gemeinden und Märkten – ist ein starkes Zeichen für ein gutes kommunales Miteinander über Landesgrenzen hinweg.“ Zusammen wollten sie den Austausch fördern und Verbesserungen anstoßen. Am ersten Messetag wird der DigitalAward für innovative Kommunalprojekteandeutschlandweite Gemeinden, Städte, Landkreise und Behörden verliehen se
Workshops statt Vorträge: In Berlin werden Methoden ausprobiert und neue Lösungsansätze entwickelt Dafür bietet das Event Fachthemen, Austausch und einen geselligen Ausklang.
Die NEGZHerbsttagung ist eine jährliche Veranstaltung für die öffentliche Verwaltungsdigitalisierung und vereint nicht nur Menschen aus der Verwaltung, sondern auch Experten aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Auch auf diesem Event bleiben die aktuellen Herausforderungen und Lösungen zentrale Aspekte und bieten genügend Zündstoff für Diskussionen Dafür bietet die Plattform in Berlin am 15. September, neben interaktiven Sessions und 28 Workshops, ebenso Raum für praxisnahe, fachliche und offene Dialoge. Es wird hier also vielmehr Wert auf das Teilen von Erfahrungen, das Ausprobieren von Methoden und die Entwicklung gemeinsamer Lösungen gelegt – und weniger auf das Verfolgen klassischer Vorträge. Eingeladen sind jedoch nicht nur besagte Experten, sondern auch Neulinge im Gebiet, die gerne mitdiskutieren oder Impulse mitnehmen möchten Und am Ende aller Sessions – als finaler Abschluss – wartet schließlich ein

| 16. SEPTEMBER 2025 | 10.00

DigitaleModernisierungfürIhreVerwaltung
geselliger Abend, um sich zu vernetzen, weitere Ideen auszutauschen und den Tag gemeinsam entspannt ausklingen zu lassen. Dieses Jahr wird allerdings zum ersten Mal eine Teilnahmegebühr erhoben. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite se
Überblick
NEGZ-Herbsttagung 2025 15. September
silent green Kulturquartier 13347 Berlin
Öffnungszeiten: 9 bis 22 Uhr

Veranstalter/Kontakt: NEGZ – Kompetenznetzwerk Digitale Verwaltung Tel. 030/7543 89 55
Eintrittspreise:
NEGZ-Mitglieder und Mitgliedsorganisationen: 60 Euro; Nicht-Mitglieder: 80 Euro [ voge.ly/negz.org/herbsttagung ]

ThomasKirschke
SalesDeutschlandPublic LANCOMSystems

LutzLinzenmeier SalesEngineeringManager International LANCOMSystems

UnsereLANCOMExpertenLutzLinzenmeierundThomas Kirschke führen Sie praxisorientiert durch die Welt der modernenStandortvernetzung.
VieleöffentlicheEinrichtungenstehenvorderHerausforderung, ihre Standorte sicher, performant und DSGVOkonform zu vernetzen. In unserem kompakten Deep Dive zeigen Ihnen unsere Experten Lutz Linzenmeier und Thomas Kirschke, wie Sie moderne Standortvernetzung ganzheitlich denken – mit Best Practices, Technologien „Engineered in Germany“ und Beispielen direkt aus der kommunalenPraxis
ImFokusstehendabei:
• SichereStandortvernetzung–StabilitätundDatenschutz ohneKompromisse.
• Zentrales Management mit der LANCOM Management Cloud–maximaleTransparenzundEffizienz.
• IT-Sicherheit auf höchstem Niveau – Backdoor-frei, DSGVO-konform&„EngineeredinGermany“.
• PraxisnaheBeispieleausderVerwaltung–sosetzenSie moderneInfrastrukturimAlltagerfolgreichum.

Jetztanmeldenunter https://voge.ly/webinar16092025/

Nicola Hauptmann Redakteurin eGovernment

STACKIT bietet souveräne Lösungen für hochregulierte Bereiche mit besonderem
Anspruch an Datenschutz & Sicherheit und ist bezugsfähig über die Mitglieder der govdigital. Das Portfolio umfasst neben klassischen Cloud- & Colocation-Lösungen auch umfassende Beratung & Migrationsunterstützung.
STACKIT GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Gabriel Becker Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm Tel. +49713230484539 gabriel.becker@ stackit.cloud www.stackit.de
DIGITAL SECURITY

genua GmbH
Ansprechpartner: Katrin Pfeil Domagkstraße 7 85551 Kirchheim bei München Tel. +4989991950-902 vertrieb@genua.de www.genua.de
genua schützt IT-Infrastrukturen von Behörden zuverlässig vor Cyber-Risiken – mit IT-Sicherheit „Made in Germany“. Als Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe und enger Kooperationspartner des BSI unterstützen wir von der Konzeption über die Auswahl und Implementierung geeigneter Lösungen – wie PAP-Strukturen und mobile Zugangslösungen für VS-NfD-Kommunikation – bis hin zur Unterstützung bei beschleunigten Zulassungsverfahren.
DMS, WORKFLOW
PDV GmbH
Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt die PDV GmbH zu den renommiertesten
Haarbergstraße 73 99097 Erfurt Tel. +493614407100 Fax. +493614407 299 info@pdv.de
E-Akte-Anbietern in Deutschland. Die mit dem E-Akte-Award bereits 7-mal ausgezeichnete Produktfamilie hält Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung bereit und ist in Bundesbehörden, Landesund Kommunalverwaltungen sowie im kirchlichen Umfeld, in der Polizei und in der Justiz erfolgreich im Einsatz. Das standardbasierte System erlaubt eine schnelle und allen voran wirtschaftliche Umsetzung der E-Verwaltung.

xSuite Group GmbH
Ansprechpartner: Daniel Petersen Hamburger Str. 12 22926 Ahrensburg Tel. 0173/7208949 info@xsuite.com www.xsuite.com
Als Softwarehersteller der SAP-zertifizierten xSuite® bieten wir für öffentliche Auftraggeber eine standardisierte, SAP-integrierte Lösung zur Rechnungsverarbeitung. Angesprochen werden die SAP-Module FI, MM, PSM und PSCD sowie der Kommunalmaster Finanzen. Es können alle Rechnungsformate wie Papier, PDF XRechnung, ZUGFeRD etc. verarbeitet werden.


OPTIMAL SYSTEMS Hannover ist seit 1997 die treibende Kraft für ein optimales Enterprise Content Management System in Öffentlichen Verwaltungen. In dem ECM enaio® werden Dokumente digital erfasst ausgewertet, verwaltungsweit für alle berechtigten Mitarbeiter*innen bereitgestellt und rechtssicher archiviert. Dank der ausgeprägten Schnittstellenvielfalt zu kommunalen Fachverfahren ist ein reibungsloser Datentransfer möglich.
OPTIMAL SYSTEMSVertriebsgesellschaft mbH Hannover
Ansprechpartner: Björn Wittneben Wöhlerstraße 42 30163 Hannover Tel: +49511123315-0 hannover@optimalsystems.de www.optimalsystems.de/hannover
Fabasoft
Fabasoft ist als Produktanbieter und bei der erfolgreichen Umsetzung der Partner für die öffentliche Verwaltung. Nahezu drei Jahrzehnte Erfahrung in Sachen
Deutschland GmbH THE SQUAIRE 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt/Main Tel: +49696435515-0 Fax: +49696435515-99 egov@fabasoft.com www.fabasoft.com
E-Government-Lösungen machen die Fabasoft eGov-Suite zu einem führenden Produkt im deutschsprachigen Raum. Flexible Nutzungsformen und die Integration in den Standardarbeitsplatz sorgen für hohe Anwenderzufriedenheit. Die Fabasoft eGov-Suite unterstützt alle Module des Konzepts E-Verwaltungsarbeit.

procilon – Technologie für Informationssicherheit und Datenschutz

procilon GmbH
Ansprechpartner: Falk Gärtner
Leipziger Straße 110 04425 Taucha Tel. +4934298487831 Fax +4934298487811 anfrage@procilon.de www.procilon.de
Der Name procilon steht seit mehr als 20 Jahren für sichere Softwaretechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Heute nutzen mehr als 850 Kommunen, Landes- und Bundesbehörden procilon-Software und strategische Beratungsleistungen für sicheres E-Government



AKDB
Hansastraße 12-16, 80686 München Tel. 089/5903-1533 Fax 089/5903-1845 presse@akdb.de www.akdb.de
Der Marktführer für kommunale Software: Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Bereiche der Kommunalverwaltung. Zur Angebotspalette gehören im BSI-zertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-, Verkehrs- Sozialund Grundstückswesen. Das Bürgerservice-Portal ist die bundesweit modernste und reichweitenstärkste E-Government-Plattform für Online-Verwaltungsdienste.


Governikus KG
Ansprechpartner: Stefan Rauner
Hochschulring 4 28359 Bremen Tel. 0421/20495-0 Fax 0421/20495-11 kontakt@governikus.de www.governikus.de
Die Governikus KG ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den gesamten Zyklus elektronischer Kommunikation von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis hin zur Beweissicherung elektronischer Daten. Gesetzeskonformität, Sicherheit und Innovation stehen für das in Deutschland und EU agierende Unternehmen im Vordergrund.

PROSOZ Herten GmbH Ewaldstraße 261 45699 Herten Tel. 02366/188-0 info@prosoz.de www.prosoz.de
Mit innovativen Lösungen, praxisorientierter Qualifizierung und hoher Beratungskompetenz hat sich Prosoz in den zurückliegenden 35 Jahren vom Softwarehersteller für Kommunen zum Komplettlösungsanbieter in den Bereichen Soziales, Jugend sowie Bauen und Umwelt entwickelt. Als Vordenker für die Digitalisierung in den Kommunen stehen wir Ihnen als strategischer Partner zur Seite.


saascom GmbH
Ansprechpartner: Martina Diederich Heidelberger Straße 6 64283 Damstadt Tel. 06151/3600808 vertrieb@saascom.de www.saascom.de www.civento.de
IT-Experte für öffentliche Verwaltungen! saascom versteht die Bedürfnisse der Verwaltungen und unterstützt durch innovative Lösungen bei der digitalen Transformation. Mit civento© bieten wir eine zukunftssichere Low-Code-Digitalisierungsplattform, die vereinfachte und voll digitalisierte Sachbearbeitungsprozesse mit Endezu-Ende-Automatisierung ermöglicht.

SysEleven GmbH
Ansprechpartnerin: Christin Rehbein
Boxhagener Str. 80 10245 Berlin Tel.: +49302332012105 marketing@syseleven.de www.syseleven.de
SysEleven GmbH, eine Tochter der secunet, betreut 500+ Kunden im DACHMarkt und bietet Cloud- und Kubernetes Managed Services, darunter die OpenStack Cloud und „MetaKube“. Als CNCF-Mitglied und zertifizierter Kubernetes Provider legt SysEleven Wert auf Datenschutz und hostet in nachhaltigen Rechenzentren.

KI-Agenten
Chatbots
Digitaler Zwilling
Projektmanagement
Digitale Identität
Smart Government
Datenschutz & -analyse
Low Code & No Code
Dokumentenmanagement
Prozessoptimierung
Sprachmodell trifft auf Persona
Sortieren, analysieren, zuweisen Repetitive Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung werden immer häufiger von KI-Agenten erledigt. Doch wie funktionieren diese eigentlich?

In nicht all zu ferner Zukunft werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung von KI-basierten, agentischen Kollegen unterstützt.
Spätestens seit der allgemeinen Verfügbarkeit von OpenAIs
ChatGPT Ende 2022 ist das Thema künstliche Intelligenz im kollektiven Bewusstsein angekommen. Stand jetzt gibt es wohl wenige Personen, die noch nie mit einer KI oder einem Produkt derselben in Berührung gekommen ist. Einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge haben mehr als 70 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mindestens einmal mit einer KI im beruflichen Kontext aktiv interagiert Dementsprechend sollte mittlerweile ein relativ großer Konsens darüber herrschen, welche Möglichkeiten und Risiken sich bei der Verwendung von KI-Modellen ergeben. Die Mehrzahl aller Interaktionen mit bestehenden Lösungen lief mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit folgendermaßen ab: Der Nutzer oder die Nutzerin hat einen Prompt – neudeutsch für maschinenverwertbarer Befehl – eingetippt und – je nach Lizenzmodell – ein mehr oder minder passendes Ergebnis erhalten. Dieses wird per erneutem
Prompt beliebig oft angepasst Im Anschluss hat man ein Ergebnis vorliegen und der eigene Spieltrieb ist befriedigt
Im professionellen Alltag sind derartige Trial-and-Error-Verfahren nicht sonderlich zielführend, wenngleich sich dadurch einerseits gewisse Gewöhnungseffekte einstellen und andererseits niederschwellig Ressentiments abgebaut werden.
Personenkreise, die künstliche Intelligenz aktiv in ihren Arbeitsalltag integriert haben, gehen mehr und mehr dazu über, nicht ein einzelnes Produkt sondern vielmehr eine Verkettung verschiedener KIModelle zu verwenden. Zahlreiche Organisationen und Behörden haben aus diesem Grund eine Vielzahl verschiedener KI-Modelle lizenziert und diese an die individuellen Bedürfnisse des Hauses angepasst. Aber ob man nun ein kostenfreies oder ein bezahlpflichtiges Modell verwendet, eines haben sie alle gemein: Ohne die Eingabe der Nutzerinnen und Nutzer, ohne getätigte Prompts, geschieht nichts

Erprobung hinter verschlossener Tür
Nächste Iteration: Autonomie
Im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Modellen künstlicher Intelligenz versteht man unter einem KI-Agenten eine autonome Softwareeinheit, welche ihre Umgebung wahrnehmen, in Eigenregie Entscheidungen treffen und vorgegebene Ziele verfolgen kann. Dabei verfügen sie über vier grundlegende Charakteristika.
W Autonomie: Eigenständige Aufgabenbearbeitung ohne kontinuierliche menschliche Anleitung.
W Planungsfähigkeit: Zerlegung komplexer Aufgaben in handhabbare und für menschliche Supervisoren jederzeit nachvollziehbare Teilschritte.
W Gedächtnis: Speicherung und Nutzung vergangener Erfahrungen für aktuelle wie zukünftige Entscheidungen.
W Entscheidungsfindung: Bewertung und Priorisierung verschiedener Handlungsoptionen zur optimalen Zielerreichung.
Aktuell testet die Bundesagentur für Arbeit (BA) den Einsatz von KIAgenten auf Basis großer Sprachmodelle innerhalb ihrer Verwaltungsorganisation. Die Erprobung zielt darauf ab, die gleichermaßen zeitintensive wie fehleranfällige manuelle Übertragung von Änderungsanforderungen (RfC-Dokumente) sowie Nutzeranforderungen (User Stories) in Jira-Tickets zu automatisieren. Das IT-Verfahren ALLEGRO bildet zentrale Förderprozesse nach dem SGB II ab und wird von über 40.000 Anwenderinnen und Anwendern im gesamten bundesdeutschen Gebiet genutzt Innerhalb dieses Systems haben SoftwareArchitekten der BA gemeinsam mit KI-Expertinnen und Experten des Beratungsunternehmens Capgemini zahlreiche Use Cases für KIAgenten entwickelt und diese in den operativen Betrieb befördert. Während der Pilotierungsphase kommen mehrere hochspezialisierte KI-Agenten zum Einsatz. Zunächst werden relevante Inhalte aus RFCs oder User Stories von einem Reader-Agenten extrahiert. Daraufhin zerlegt ein PlanningAgent die Aufgabe in konkrete kleinteilige Arbeitsschritte Ein Creator-Agent erstellt daraufhin automatisch ein Jira-Ticket. Dieses wird mit einem entsprechenden Titel sowie einer Beschreibung versehen Gleichzeitig weist dieser KI-Agent dem Ticket eine (vorläufige) Priorität und eine Kategorie zu Im Nachgang überprüft ein Review-Agent die Ergebnisse der anderen KI-Agenten auf Konsistenz und Plausabilität und sortiert eventuell aufgetretene Dubletten aus.
Technische Umsetzung innerhalb der BA
Um eine möglichst sichere Testumgebung zu kreieren, haben die IT-Verantwortlichen der Bundesagentur für Arbeit entschieden, dass die Implementierung der KIAgenten ausschließlich mit lokal betriebenen Modellen zu erfolgen hat. Zum Einsatz kommen dabei Modelle von Herstellern wie Aleph Alpha, Meta, Mistral oder auch Alibaba Die zentrale Steuerung der KI-Agenten erfolgt über CrewAI Dabei handelt es sich um eine Open-Source-Plattform für MultiAgenten-Systeme. Um weitere Sicherheitsbedenken auszuräumen, wurde die Pilotumgebung vollständig in die lokale Jira-Instanz der Bundesagentur für Arbeit integriert Den Anlern- und Trainingsprozess sowie die testweise Verwendung der KI-Agenten finden in der geschlossenen On-Premise-
IT-Infrastruktur des Systemhauses der BA statt. Laut den Verantwortlichen verbleiben dabei sämtliche Daten innerhalb der hauseigenen Infrastruktur. Eine externe Datenübertragung ist ausgeschlossen.
Erste Ergebnisse stimmen positiv
Nach eingehenden Tests haben die Verantwortlichen der BA ein zwischenzeitliches Fazit gezogen und festgestellt, dass die automatisierte Erstellung von Tickets in den meisten Fällen reibungslos funktioniert Lediglich sehr umfangreichen RfC-Dokumente würden noch gelegentliche Ausnahmen darstellen. Der wiederkehrende Aufwand für die manuelle Ticket-Erstellung entfalle durch den Einsatz der Agenten. Die vom System erstellten Tickets würden zumeist über die geforderten Eigenschaften verfügen. Die Integration in eine hochsichere On-Premise-Architektur erfordere umfangreiche Abstimmungen zwischen verschiedenen Einheiten. Unklare oder widersprüchliche Anforderungen können zu Fehlern führen. Die Modelle müssten dazu regelmäßig aktualisiert werden, was in einer lokalen Umgebung mehr Aufwand bedeutet Darüber hinaus seien Mitarbeiterschulungen notwendig, um die KI-Systeme effektiv zu nutzen. Eine weitere potentielle Fehlerquelle sind große RfC-Dokumente. Bei deren Verarbeitung können Token-Limits überschritten werden, was eine Anpassung der Eingabedaten und dementsprechend menschliches Eingreifen erfordert. Das Pilotprojekt der BA zeigt das Potenzial für eine breitere Anwendung von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung auf. KI-Agenten könnten künftig auch bei Fachverfahren, im Dokumentenmanagement oder für Bürgerkommunikation eingesetzt werden Entscheidend wird jedoch sein, dass die Technologie eben dort eingesetzt wird, wo sie einen praktischen Mehrwert schafft und Mitarbeitern monotone Arbeitsschritte abnehmen kann. jk
Weitere Informationen

Die BA ist eine der Bundesbehörden, die schon relativ früh die Vorzüge technischer Innovationen erkannt hat und diese an verschiedenen Stellen produktiv einsetzt. Auch die Integration von Angeboten in leichter Sprache war seinerzeit wegweisend. [ arbeitsagentur.de ]
Die nächste Ausgabe der eGovernment erscheint am Montag, den 25. August 2025. Das SPEZIAL dieser Ausgabe widmet sich dem Thema Smart City / Smart Country Anzeigenschluss ist der 11. August 2025.
Anzeigenhotline: 0821/2177-212
Was die Arbeit im Weltraum mit dem modernen Büro zu tun hat
Das vermehrte Einbinden Künstlicher Intelligenz (KI) verändert sowohl Prozesse als auch das zwischenmenschliche Miteinander –auch in der öffentlichen Verwaltung
Erfahrungen aus der Raumfahrt –etwa im Umgang mit Isolation, Komplexität und psychischer Belastung – bieten wertvolle Impulse für die Gestaltung heutiger und künftiger Arbeitswelten. Als besonders hilfreich erweisen sich KILösungen, die zentrale menschliche Bedürfnisse wie Bindung, Autonomie,KompetenzundSicherheit stärken. Akzeptanz entsteht vor allem dann, wenn Technologien verständlich kommuniziert, partizipativ eingeführt und als konkrete Entlastung im Alltag erfahrbar werden – nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung.
Die öffentliche Verwaltung der Zukunft ist nicht nur digital, sondern vor allem flexibel und menschennah. In einer komplexen Arbeitswelt braucht es mehr als Effizienz – gefragt sind Umgebungen, die Mitarbeiter:innen entlasten und individuell unterstützen Dazu gehören digitale Technologien wie Augmented Reality (AR) ebenso
wie empathische KI-Assistenten und Systeme, die unterschiedliche Arbeitsstile respektieren Immer im Fokus: der Mensch.
Praxisnah lernen mit VR
Ein Beispiel für diese menschenzentrierte Herangehensweise ist
eine Virtual-Reality-Anwendung, die Rechtsreferendar:innen realitätsnahe Gerichtsverhandlungen, Zeugenvernehmungen und sogar den Gang zur mündlichen Prüfung simulieren lässt In einem virtuellen Gerichtssaal begegnen sie einem KI-gesteuerten Zeugen, stellen Fragen, erhalten Antworten –

Richtig eingesetzt kann KI für mehr Sicherheit und Unterstützung im Behördenalltag sorgen.

mal ausweichend, mal kooperativ Ein geschützter Raum zum Üben, der Sicherheit schafft und Handlungskompetenz stärkt.
AR für bessere Orientierung
Gerade in großen Verwaltungen mit Shared-Desk-Modellen, mehreren Liegenschaften oder häufig wechselndenRaumbelegungenbietet AR eine innovative Lösung für mehr Orientierung. Eine App ermöglicht es den Mitarbeiter:innen, per Smartphone-Kamera durch das Gebäude zu navigieren – inklusive digital eingeblendeter Wegweiser und Raumkennzeichnungen. Besonders neue Kolleg:innen oder Besucher:innen profitieren davon, schnell und sicher ans Ziel zu finden
Neuroadaptive Räume: Arbeiten mit Gefühl
AR erleichtert schon heute die Orientierung im Büroalltag Doch der Blick in die nahe Zukunft zeigt, dass sich auch physische Arbeitsumgebungen grundlegend wandeln werden In neuroadaptiven Räumen ermöglichen es Sensorik und KI, Licht, Temperatur und Geräuschkulisse automatisch an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen anzupassen – für mehr Konzentration, weniger Stress und ein besseres Arbeitsklima. Noch einen Schritt weiter gehen sogenannte „Morphing Spaces“: Räume, die sich physisch
transformieren lassen – je nach Nutzungsszenario vom ruhigen Einzelarbeitsplatz bis zum kollaborativen Kreativraum. Gerade vor dem Hintergrund von Desk-Sharing und hybriden Arbeitsmodellen eröffnen solche Lösungen neue Spielräume für eine moderne, adaptive Arbeitsumgebung in der öffentlichen Verwaltung.
Verwaltung neu denken: flexibel, empathisch, digital
Technologie ist kein Selbstzweck – sie soll dazu dienen, zentrale menschliche Bedürfnisse wie Bindung, Kompetenz, Sicherheit und Selbstbestimmung zu stärken. Computacenter begleitet Behörden seit vielen Jahren partnerschaftlich bei der digitalen Transformation – auf allen Verwaltungsebenen
Dabei gilt: Digitalisierung darf das Menschliche nicht verdrängen, sondern muss es bewusst fördern Richtig eingesetzt, macht sie öffentliche Verwaltung nahbarer, zugänglicher und wirksamer Genau darin liegt die große Chance: Technologie als Katalysator für echten gesellschaftlichen Mehrwert im öffentlichen Dienst.
Die Autoren Nina Kohl-Haefke, Solution Manager Future of Work bei Computacenter, und Falk Alexander Schmidt, CDO Public / Director Digital Government bei Computacenter. [ computacenter.com/de-de ]
Realisieren Sie Online-Services mit digitalem Mehrwert fürIhreVerwaltung.
• Schlüsselfertige Online-Formulare fürzahlreicheAntragsanlässe
• Umfassendes Formularmanagement bis zu individuellerFormularerstellung und -hosting
• Datenübernahme aus Online-Anträgen in die Prosoz-Fachverfahren inkl. begleitenderDokumente
prosoz.de/ ende-zu-ende-digitalisierung
Die neue Verantwortungslücke im Gesundheitswesen
Künstliche Intelligenz unterstützt im medizinischen Kontext bei Verwaltungstätigkeiten, aber auch bei der Diagnose Doch wer trägt die Verantwortung, wenn eine Empfehlung des digitalen Assistenten falsch ist?
Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht länger ein Versprechen – sie ist die neue Realität im Klinikalltag. Heute helfen KI-Systeme bei der Diagnose, priorisieren Patientendaten oder formulieren Arztbriefe – mitunter auf Basis generativer Sprachmodelle Während diese Entwicklungen Zeit und Ressourcen sparen, rückt eine unbequeme Frage in den Vordergrund: Wer übernimmt die Verantwortung, wenn eine automatisierte Empfehlung in die Irre führt?
Die Europäische Union hat darauf eine eindeutige Antwort gefunden und neue Regeln aufgestellt Mit dem EU AI Act hat sie ein umfassendes Gesetz zur Regulierung von KI-Systemen verabschiedet. Was bislang technologisch möglich war, muss nun auch regulatorisch belastbar sein Vor allem Systeme mit hohem Risikopotenzial, wie etwa medizinische Entscheidungsunterstützung, werden künftig stärker kontrolliert. Der gesetzliche Rahmen ist dabei ebenso ambitioniert wie konkret: Sicherheit, Nachvollziehbarkeit, menschliche Kontrolle und robuste Datenqualität sind nicht länger wünschenswert, sondern sie sind verpflichtend.
Zwischen Regulatorik und Realität: Herausforderung für Kliniken und Hersteller
Die Herausforderung für Kliniken, Softwareentwickler und Medizintechnikunternehmen besteht darin, diese Vorgaben in die Praxis zu überführen. Denn so klar die Ziele formuliert sind, so komplex ist auch ihre Umsetzung: KI-Systeme müssen technisch sicher sein und zugleich ethisch vertretbar, auditierbar und erklärbar. Dabei geht es nicht nur um technische Details, sondern auch um grundlegende Governance-Fragen:
W Wer darf KI-Systeme einsetzen?
W Wer prüft ihre Qualität?
W Und wie bleibt die Kontrolle beim Menschen?
Parallel zur EU passen auch Drittstaaten ihre Regeln an Die USamerikanische FDA hat ihre Leitlinien für KI-gestützte Medizinprodukte überarbeitet und fordert darin u. a nachvollziehbare Dokumentation, kontinuierliches Monitoring und Konzepte zur Risikominimierung. Auch die Schweiz und Österreich orientieren sich zunehmend an europäischen Vorgaben. Inmitten dieser regulatorischen Dynamik fehlt es jedoch bislang an einem praktischen Werkzeug, mit dem sich all diese Anforderungen integriert umsetzen lassen, ohne Innovation zu blockieren.
Ordnungsrahmen, der auch in unterschiedlichen regulatorischen Systemen tragfähig bleibt.
Regulatorische Schnittmengen systematisch adressieren
Besonders relevant wird ISO 42001 dort, wo mehrere Vorschriften gleichzeitig greifen – etwa wenn ein KI-System als aktives Medizinprodukt gilt und sowohl dem EU AI Act als auch der europäischen MDR unterliegt Die MDR verpflichtet Hersteller, Datenher-

Wer behandelt, trägt Verantwortung.
ISO 42001: Governance, die sich operationalisieren lässt
Mit ISO/IEC 42001 liegt erstmals eine internationale Norm vor, die speziell auf Managementsysteme für künstliche Intelligenz ausgerichtet ist. Anders als viele gesetzliche Vorgaben, die mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeiten, konkretisiert ISO 42001 die Anforderungen an eine verantwortungsvolle KI-Governance Organisationen müssen den Einsatzkontext jeder Anwendung systematisch analysieren: Zweck, Zielgruppe, Betriebsumgebung Darauf aufbauend fordert die Norm eine strukturierte Bewertung potenzieller Risiken wie systematische Verzerrungen, Datenlücken oder unerwünschte Automatisierungseffekte. Maßnahmen zur Risikominimierung müssen dokumentiert und über den gesamten Lebenszyklus wirksam verankert werden.
Zentral ist dabei die Transparenz: ISO 42001 verlangt nachvollziehbare Dokumentationen für Trainingsdaten, Modellversionen, Entscheidungslogiken und Änderungen im laufenden Betrieb Un-
ternehmen schaffen damit prüfbare Grundlagen für interne Reviews, externe Audits und regulatorische Nachweise – etwa im Rahmen einer CE-Kennzeichnung oder FDAZulassung.
Verankerung von Verantwortlichkeit
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der klaren Rollenverteilung innerhalb der Organisation. Für jede KIAnwendung sind Verantwortlichkeiten festzulegen: von Entwicklung und Betrieb über Monitoring und Dokumentation bis hin zu Eskalationsmechanismen Die Norm fordert außerdem kontinuierliche Überprüfung, Feedbackmechanismen sowie verpflichtende Schulungen für alle beteiligten Rollen – gerade in sicherheitskritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen ein entscheidender Faktor. Diese Governance-Struktur ist international anschlussfähig: ISO 42001 orientiert sich an etablierten Rahmenwerken wie dem NIST AI RMF (USA), dem AI und Data Act (Kanada) und den ethischen PrinzipienderOECDundUNESCO Für international tätige Unternehmen entsteht so ein kohärenter
Kontrollmechanismen könnte sich das System in eine Richtung entwickeln, die zwar mathematisch konsistent, aber medizinisch nicht mehr vertretbar ist, z B. durch Übergewichtung seltener, aber auffälliger Korrelationen.
Globale Perspektive: FDA, Schweiz, internationale Harmonisierung
Auch außerhalb Europas steigen die regulatorischen Anforderungen. Die FDA erwartet von Herstellern vollständige Modellbeschreibungen, Bias-Tests, lebenszyklusbegleitende Überwachung und Änderungsmanagement über sogenannte Predetermined Change Control Plans. Diese Pläne – auch als Predetermined Change Protocols bezeichnet – definieren vorab, welche Änderungen am KI-Modell (z B. an den Trainingsdaten oder der Modellarchitektur) im Betrieb zulässig sind, unter welchen Bedingungen sie erfolgen dürfen und wie sie überwacht werden, ohne dass für jede Anpassung ein neues Zulassungsverfahren erforderlich ist. Sie schaffen damit regulatorisch abgesicherte Entwicklungsspielräume für lernende Systeme nach der Markteinführung ISO 42001 unterstützt diese Anforderungen, indem sie kontinuierliche Performanceüberwachung, Änderungsprotokollierung und die Erfassung demografischer Merkmale als Standardbestandteile eines KI-Managementsystems definiert.
kunft, Modellveränderungen und klinische Leistung über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachzuweisen Der EU AI Act ergänzt diese Anforderungen um strenge Vorgaben zu Risikomanagement, Transparenz und menschlicher Aufsicht – insbesondere bei Hochrisiko-Anwendungen wie der medizinischen Entscheidungsunterstützung.
Während MDR und AI Act das „Was“ definieren, beantwortet ISO 42001 das „Wie“:
W Wie lassen sich Anforderungen konkret in Abläufe, Dokumentationen und Verantwortlichkeiten überführen?
W Wie wird Nachvollziehbarkeit hergestellt – nicht nur im Training, sondern auch im Realbetrieb?
W Wie wird verhindert, dass KIbasierte Systeme sich unkontrolliert weiterentwickeln oder durch Daten-Drift an Wirksamkeit verlieren?
Ein theoretisches Beispiel: Ein klinisches Entscheidungsunterstützungssystem verändert auf Basis neuer Patientendaten seine Gewichtung zugunsten bestimmter Risikofaktoren Ohne wirksames Monitoring und definierte
Die Schweiz übernimmt den AI Act bereits in Form von nationalem Recht, Österreich prüft ein entsprechendes Modell. Gleichzeitig stehen viele außereuropäische Anbieter vor der Herausforderung, ihre Systeme grenzüberschreitend zu zertifizieren. In diesem Umfeld fungiert ISO 42001 als verbindendes Framework: Die Norm bündelt regulatorische Erwartungen in einen gemeinsamen organisatorischen Ordnungsrahmen, ohne regionale Anforderungen außer Acht zu lassen.
Zukunftssicherheit durch Struktur
Die regulatorischen Anforderungen rund um KI in der Medizin werden sich weiter differenzieren – etwa durch neue Vorgaben für Explainable AI, domänenspezifische Richtlinien in der Onkologie oder separate Prüfverfahren für LLM-basierte Anwendungen. Organisationen, die bereits heute mit ISO 42001 arbeiten, schaffen ein strukturelles Fundament, das aktuellen Normen genügt und auch zukünftigen Entwicklungen gewachsen ist. Gerade Unternehmen im Gesundheitswesen vereinen künftig regulatorische Sicherheit, interne Prozessstabilität und technologische Resilienz auf Basis eines Standards, der nicht auf Reaktion, sondern auf verantwortungsvolle Gestaltung ausgelegt ist.
Der Autor
Ingo Unger, Manager of International Business Development bei der DQS GmbH

Künstliche Intelligenz: Vertrauen und Erwartungen
Matthias Wodniok, Mitglied des Vorstandes der Fabasoft Gruppe spricht über die Kraft von KI als Motor der Digitalisierung und über die Chancen für eine effizientere und modernere Verwaltung
Herr Wodniok, warum braucht es Ihrer Meinung nach eine Modernisierung und Einsatz von KI in der Verwaltung?
Die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung steigen Bürger:innen erwarten digitale Services, die jederzeit verfügbar sind – schnell, barrierefrei und zuverlässig. Künstliche Intelligenz bietet die Möglichkeit, genau hier anzusetzen. Sie kann Daten schneller und präziser auswerten als jede manuelle Prüfung, unterstützt fundierte Entscheidungen und hilft, Trends frühzeitig zu erkennen.
Gleichzeitig entlastet sie Mitarbeitende bei Routineaufgaben – etwa bei der Bearbeitung von Anträgen, der Klassifizierung von Dokumenten oder der Beantwortung häufiger Fragen.
Auch im Kontakt mit Bürger:innen bringt KI Vorteile: Chatbots oder sprachgesteuerte Assistenten stehen rund um die Uhr zur Verfügung und verkürzen Wartezeiten deutlich Dazu kommt mehr Sicherheit – etwa durch automatisierte Erkennung von Cyberangriffen oder Datenanomalien. KI ist kein Selbstzweck. Richtig eingesetzt, verbessert sie die Qualität, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit von Verwaltungsarbeit Und sie bereitet den Boden für den nächsten Schritt: die durchdachte, wirksame Automatisierung von Prozessen, die heute noch Zeit und Personal binden.
Welche Prozesse lassen sich besonders gut automatisieren?
Wir verfolgen den Ansatz, durch Automatisierung schnell und einfach einen signifikanten Nutzen für die öffentliche Verwaltung zu schaffen. Typische Tätigkeiten betreffen dah lle di Erfa
und in weiterer Folge entsprechend zu klassifizieren und einer Adressatin oder einem Adressaten zuzuweisen Automatisierungen eignen sich insbesondere für sich wiederholende und zeitaufwendige Tätigkeiten. Auch komplexere, klar definierte Abläufe wie Antragsoder Freigabeprozesse lassen sich durchgängig automatisieren – inklusive der notwendigen Prüf-, Entscheidungs- und Kommunikationsschritte.
Viele Menschen haben die Befürchtung, dass sie von der KI ersetzt werden. Was ist Ihre Meinung dazu, sind diese Ängste begründet?
Die KI ersetzt den Menschen nicht – sie unterstützt. Die künstliche Intelligenz bietet einzigartige Chancen und genau das müssen wir auch den Mitarbeitenden vermitteln Transparente Einblicke in die Funktionsweise der Systeme schaffen Akzeptanz und bauen Skepsis ab Wichtig ist hier der „Human in the Loop“-Ansatz Dabei ist es erforderlich, dass der Mensch immer aktiv in Automatisierungsprozesse eingebunden ist, um sicherzustellen, dass Vorgangsweisen ethisch korrekt sind. Besonderes wenn es um heikle Entscheidungen geht: Die künstliche Intelligenz erkennt Muster, versteht aber keine Zusammenhänge und kennt keine Empathie. Hier braucht es eine menschliche Handhabe KI führt also nicht zu Arbeitslosigkeit, sondern macht Verwaltung effizienter.
Was erwarten Bürger:innen von der digitalen Verwaltung?
Grundsätzlich ist die Erwartungshaltung, dass Leistungen der Verwaltung leicht und intuitiv nutzbar sind De eG t
Menschen ist „digital first“ mittlerweile selbstverständlich. Die Abläufe sollen automatisiert und unkompliziert sein und am besten proaktiv an die Bürger:innen herangetragen werden. Hier sprechen wir von „No-Stop-Shop“-Ansätzen. Und genau das ermöglichen intelligente Software-Solutions Eine Anwendung wäre zum Beispiel die automatische Ausstellung der Geburtsurkunde und die anschließende Beantragung von Kindergeld, ohne dass die Eltern dafür aktiv einen Antrag stellen müssen.
Wie geht es mit der Verwaltungsdigitalisierung weiter und was braucht es dafür?
Das Ziel der Deutschen Bundesregierung ist es, alle Verwaltungsleistungen bis 2030 digital zu erledigen Nur 9 Prozent der Deutschen wollen weiterhin ausschließlich analoge Angebote nutzen Diese Gruppe gilt es noch zu überzeugen. Ich bin mir aber sicher, dass es möglich ist, mit den richtigen Schritten auch diese Personen ins Boot zu holen. Auch ältere Menschen lehnen Online-Angebote nicht grundsätzlich ab Viele trauen sich nicht, diese Hürde zu nehmen und brauchen zu Beginn noch Unterstützung. Diese Hilfsangebote muss es von den Behörden niederschwellig geben. Für mich ist es entscheidend, dass wir die digitale Verwaltung auch inklusiv denken – mit einem barrierefreien Zugang, der unterschiedliche Lebensrealitäten berücksichtigt und allen die einfache Nutzung öffentlicher Services ermöglicht.
Entbürokratisierung und Bürgernähe stehen im Fokus – wie vereint die Fabasoft eGov-Suite beides konkret in der Praxis? Entbürokratisierung gelingt nur mit digitalen Werkzeugen, direktem Zugang für Bürger:innen und einer Verwaltung, die selbstbestimmt handeln kann. Die Erwartungen sind klar: weniger Papier, kürzere Wartezeiten, einfache digitale Angebote. Die Fabasoft eGov-Suite setzt diese Anforderungen um Formulare lassen sich online ausfüllen, ein-

reichen und weiterverarbeiten –ohne Medienbrüche. Verwaltungsmitarbeitende passen Abläufe dank Low-Code-/No-Code-Technologie selbst an und benötigen dazu keine speziellen IT-Kenntnisse So bleibt die Verwaltung flexibel und reagiert schnell auf neue Anforderungen. Ein echtes Plus ist die intelligente Akte Sie durchsucht Dokumente in Sekundenschnelle, erkennt Zusammenhänge und liefert Antworten in natürlicher Sprache Kein langes Suchen mehr – die relevanten Infos sind sofort da. Beschäftigte erhalten kompakte Übersichten, auch bei komplexen Vorgängen. Die KI fasst Inhalte zusammen, kann nächste Schritte vorschlagen und hilft somit beim Treffen fundierter Entscheidungen. Das spart Zeit, entlastet Teams und verbessert den Bürgerservice spürbar.
Wie ist der Status quo in der Verwaltung in Deutschland? In Deutschland gibt es erstmals ein Digitalisierungsministerium. Das ist ein deutliches Signal, dass durch Digitalisierung und Staatsmodernisierung zielführende Maßnahmen durch die neue Bundesregierung umgesetzt werden. Beispielsweise ist laut BMDS ein „App-Store für die Verwaltung“ nach österreichischem Vorbild geplant. Erst im Juni löste die „ID Austria“ mit einer userfreundlicheren Oberfläche die bisherige App „Digitales Amt“ ab Digitale Behördenwege sollen künftig noch einfacher sein. Nutzer:innen haben nun Zugang zu über 500 digitalen Funktionen aus Verwaltung und Wirtschaft – und das rund um die Uhr.
Ich halte es für wichtig, dass insbesondere Deutschland und Österreich im E-Government-Bereich eng kooperieren und voneinander lernen – fachlich wie technisch. Gerade im Hinblick auf die digitale Souveränität in Europa zählt jeder gemeinsame Schritt.
Bedeutet die Einführung von KI und Automatisierung nicht einen enormen Aufwand für Behörden?
Am Anfang ist der Aufwand nicht zu leugnen: bestehende Prozesse prüfen, Strukturen anpassen und Mitarbeitende einbinden. Aber dieser Einsatz rechnet sich schnell. Automatisierung wird oft als kompliziert wahrgenommen, doch das Gegenteil ist der Fall. Intelligente Automatisierung ist heute schnell und einfach umsetzbar, gerade auch mit den Fabasoft Solutions. Unsere Systeme können auf riesige Datenmengen zugreifen, lernen kontinuierlich dazu und bieten rasch messbaren Nutzen. Es geht darum, einen niederschwelligen Zugang zu bieten, der mit geringem personellem und zeitlichem Aufwand umsetzbar ist und
somit Verwaltungsangestellte entlastet
Wie lässt sich das auf die kommunale Ebene übertragen? Dort fehlen oft Personal und Mittel. Gerade Kommunen profitieren, wenn Standards und Technologien auf ihre Realität zugeschnitten sind Es geht nicht darum, jeden Trend mitzugehen, sondern pragmatisch anzupassen. Viele Verwaltungsprozesse ähneln sich – hier hilft es, übergreifend zu denken und gemeinsam einsetzbare Anwendungen zu entwickeln. Gleichzeitig bleibt genug Raum für individuelle Anforderungen Wichtig ist: Alle Körperschaften brauchen Werkzeuge, die sofort einen Nutzen bringen und keine großen IT-Abteilungen voraussetzen.
Durch diese gravierenden Änderungen stellt sich die Frage des Vertrauens: Wie würden Sie Bedenken Ihrer Kunden entkräften?
Vertrauen entsteht durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit Wenn ein System Vorschläge macht, muss eindeutig erkennbar sein, wie es zu diesen Ergebnissen kommt – und der Mensch bleibt in der Verantwortung Unsere Anwendungen unterstützen genau das: Mitarbeitende prüfen, korrigieren oder bestätigen, sie werden nicht ersetzt, sondern unterstützt Schulungen und eine klare Kommunikation sind dabei unerlässlich.
Sie haben vorhin bereits die digitale Souveränität erwähnt. Warum ist sie so wichtig – gerade für Deutschland und Europa?
Digitale Souveränität bedeutet, selbst zu entscheiden, wie und wo Daten verarbeitet werden Darauf setzt die Fabasoft eGov-Suite. In Zeiten globaler Spannungen ist das keine abstrakte Debatte mehr, sondern ein konkretes Sicherheitsinteresse Fabasoft entwickelt und betreibt seine Produkte vollständig in Europa, unterliegt europäischem Recht und bietet volle Transparenz bei Architektur und Betrieb Wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach die digitale Verwaltung?
Wir stehen am Anfang einer spannenden Reise Niemand kann genau sagen, wie die Verwaltung der Zukunft aussehen wird Doch eines steht fest: KI und Automatisierung werden Arbeits- und Entscheidungsprozesse grundlegend verändern. Neue Berufsbilder entstehen, während Systeme zunehmend Routinetätigkeiten übernehmen. Die künstliche Intelligenz bietet große Chancen für alle Beteiligten, besonders wenn wir auf digitale Souveränität setzen und in Europa aktiv eigene Innovationen fördern und etablieren
Kommunalpolitik trifft KI
Von automatisierten Sitzungsprotokollen bis hin zu intelligenten Recherche-Tools – KI-basierte Assistenten für Ratsinformationssysteme machen Politik transparenter, effizienter und bürgernäher Doch die Technik bringt auch neue Herausforderungen mit sich.
Was haben die Städte Bonn, Siegburg und Freiburg im Breisgau gemeinsam? Abgesehen von malerischen Altstädten und jeweils sehr guten ansässigen Brauereien vereint die drei Städte, dass sie alle in naher Zukunft KI-basierte Assistenten für das jeweilige Ratsinformationssystem einsetzen werden.
Transparenz durch Open Data und KI-Services
Die Bundesstadt Bonn geht einem systematischen Ansatz zur Digitalisierung ihrer Ratsinformationssysteme nach Seit Oktober 2019 nutzt die Stadt das System ALLRIS (zuvor BoRIS 2.0), um die digitale Verwaltung weiterzuentwickeln und die Smart City-Strategie umzusetzen Das System unterstützt die digitale Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen verschiedener Gremien und ermöglicht eine weitgehend papierlose Ratsarbeit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Transparenz und einer

Open-Data-Strategie. Bonn stellt kommunale Daten aus dem Ratsinformationssystem über die OParl-Open-Data-API öffentlich und maschinenlesbar zur Verfügung Dadurch können strukturierte Informationen wie Tagesordnungspunkte, Vorlagen und Beschlüsse anonym, offen und ohne technische Hürden abgerufen werden. Durch die, im JSON-Format bereitgestellten, Daten können komplexe Analysen durchgeführt
RLP erweitert sein „Ökosystem KI“
und neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt werden.
Nachhaltigkeit durch intelligente Technologie
Unterdessen verfolgt die Stadtverwaltung von Freiburg im Breisgau einen ganzheitlichen Ansatz, welcher KI-Technologie mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft Die Stadt setzt überwiegend auf elektronische Akten und hat mit ihrem
LLMoin, der KI-Assistent aus dem Norden, unterstützt jetzt auch bei der Verwaltungsdigitalisierung in Rheinland-Pfalz.

ECM-System eine nahtlose Integration relevanter Fachverfahren erreicht Sie verwendet bereits seit längerer Zeit ein umfassendes Rats- und Bürgerinformationssystem. Dieses fungiert als zentraler Baustein der städtischen eGovernment-Strategie Über dieses System können die Bürgerinnen und Bürger aktuelle Informationen zu Gremien sowie öffentliche Sitzungsunterlagen und Protokolle digital einsehen Doch die Freiburger Strategie geht einen Schritt weiter. Mit dem Projekt „I4C – Intelligence for Cities“ werden lokal präzise Klimamodelle und Planungstools entwickelt, die es ermöglichen, mittels künstlicher Intelligenz verschiedene Auswirkungen von Planungsszenarien wie etwa Hitzeentwicklung in kürzester Zeit zu simulieren
Kommunikation als Schlüssel
Siegburg hingegen setzt voll und ganz auf die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Im Mittelpunkt steht dabei der Chatbot Siggi,welcher in knapp 100 Sprachen Rede und Antwort stehen kann. Mittlerweile ist er sogar via Telefon erreichbar und ermöglicht dadurch einen niederschwelligen Kontaktweg mit der öffentlichen Verwaltung Weitere Informationen zur Digitalisierungsstrategie Siegburgs finden Sie auf der vierten Seite dieser Ausgabe Dort berichtet der Siegburger Digitalisierungsbeauftragte Bernd Lehmann unter anderem über die Bestrebungen der Stadtverwaltung, komplett digital zu werden.
Nach Niedersachsen und Bremen nutzt jetzt auch Rheinland-Pfalz das KI-Assistenzsystem LLMoin aus Hamburg. „Mit LLMoin setzen wir auf eine bewährte Lösung, die bereits in Hamburg und anderen Bundesländern erfolgreich im Einsatz ist", erklärte die Digitalisierungsministerin des Landes, Dörte Schall. Die Nachnutzung spare Zeit und Kosten und ermögliche eine schnelle Implementierung, Betreiber der Lösung in RLP ist der zentrale Dienstleister, der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) „Wir bauen die KI-Systemarchitektur auf, passen sie an die Bedürfnisse von RheinlandPfalz an und unterstützen verschiedene KI-Projekte in den Behörden“, erläutert LDI-Geschäftsführer Matthias Bongarth. Zu den Grundangeboten gehörten technischer Support, Pflege der Benutzerkonten und Online-Schulungen durch das Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz (CC-KI). Auch das Wissensmanagement im Land werde aufgebaut.
Die Einführung des KI-Assistenten ist in Rheinland-Pfalz Teil der Umsetzung des „Ökosystems KI". Damit schaffe man „die Grundlage für eine moderne, effiziente und bürgernahe Verwaltung, so Ministerin Schall: „Wir nutzen KI gezielt, um Prozesse zu beschleunigen, Ressourcen besser einzusetzen und die Arbeit unserer Beschäftigten zu erleichtern.“
Die nächste Generation der Kommunalpolitik?
Die Beispiele aus Siegburg, Bonn und Freiburg zeigen drei verschiedene, aber doch komplementäre Ansätze für die Zukunft der Kommunalpolitik Während Siegburg auf direkte KI-Integration setzt, nutzt Bonn standardisierte Schnittstellen für maximale Offenheit, und Freiburg kombiniert verschiedene Technologien für spezifische Anwendungsfälle.
Künftig werden vermutlich Aspekte aller drei Ansätze kombiniert werden Benutzerfreundliche KIInterfaces, offene APIs für Drittanwendungen und spezialisierte KI-Tools für komplexe politische Prozesse werden den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern von morgen weitreichende Möglichkeiten für deren politisches Wirken bieten. Aber auch für die aktuelle Generation der Kommunalpolitik gibt es tiefgreifende Lösungen Wie eingangs erwähnt, werden die genannten Städte in absehbarer Zukunft allesamt einen KI-basierten Assistenten für ihre Ratsinformationssysteme einsetzen Dabei vertrauen Sie auf eine Lösung des KI-Startups neuraflow aus Bremerhaven Diese ermöglicht einerseits eine intelligente Suchfunktion innerhalb des RIS und geht andererseits aktiv gegen den Wissensverlust innerhalb der ÖV vor Die Verwaltungsdigitalisierer der drei Städte möchten damit den Mitgliedern der kommunalen Gremien Last von den Schultern nehmen und das Vertrauen der Bürgerschaft in die Kommunalpolitik stärken jk
„Wir freuen uns, dass RheinlandPfalz nun Teil des wachsenden Netzwerks von Verwaltungen ist, die von LLMoin profitieren“, so Torsten Koß, Vorstand Digitalisierung bei Dataport. Er betonte die gute und kooperative Zusammenarbeit zwischen Land, dem LDI, govdigital und Dataport. Möglich wurde die Nutzung durch die Anbindung von LLMoin über das öffentliche Netz. Damit könnten erstmals auch Verwaltungen außerhalb des Trägerkreises von Dataport das Tool einsetzen Nicht nur Bundesländer, sondern auch kleinere Verwaltungen wie Kommunen, für die es ein spezielles, nutzerbezogenes Abrechnungsmodell gebe, wie Dataport informiert. Landes- und Kommunalverwaltungen könnten LLMoin über die Genossenschaft govdigital beauftragen, erklärte Torsten Koß nh
Weitere Informationen

LLMoin basiert auf dem Large Language Model GPT-4o und wurde von der Freien und Hansestadt Hamburg gemeinsam mit Dataport speziell für die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung konzipiert. Es hält höchste Datenschutzstandards ein; die eingegebenen Daten werden nicht zu Trainingszwecken genutzt. [ voge.ly/LLMoin-Hamburg ]
Mehr als Prompting
Wer GenKI in der Verwaltung einsetzen will, braucht mehr als Technik: Entscheidend ist der richtige Kompetenzmix – abgestimmt auf Rolle, Einsatzzweck und Freiheitsgrad der Nutzung. Ein neues Kompetenzframework gibt Orientierung
Generative KI (GenKI) wird in der öffentlichen Verwaltung bereits vielfältig erprobt – bei der Texterstellung, Informationserschließung oder im Bürgerdialog Doch welche Kompetenzen braucht es, damit solche Systeme effektiv und sicher eingeführt und genutzt werden können? Entscheidend ist der richtige Mix – abhängig von Rolle, Risiko des Einsatzzwecks und Freiheitsgrad der Nutzung.
Drei Rollen, drei Kompetenzprofile
Zunächst braucht es rollenübergreifende Kompetenzen, etwa Basiskompetenzen in digitaler Bedienfähigkeit und im Umgang mit Daten, Wissen über die grundlegenden Chancen, Risiken und Funktionsweisen generativer KI sowie eine Haltung, die u.a. kritisches Denken, Resilienz und kontinuierliche Lernbereitschaft um-
FINO – mehr als ein Chatbot
fasst Diese Grundlagen sollten in der Breite vermittelt werden.
Darauf aufbauend braucht es – je nach Rolle in Bezug auf eine GenKI-Lösung – rollenspezifische Kompetenzen: Entscheider:innen legen Ziele, Einsatzbereiche und Rahmenbedingungen generativer KI in ihrer Organisation fest. Sie benötigen Kompetenzen u. a in strategischer Steuerung, Governance, Projektund Risikomanagement sowie in der Förderung einer organisationsweiten Lern- und Kommunikationskultur.
Techniker:innen verantworten Entwicklung, Integration, Betrieb undWeiterentwicklungvonGenKILösungen Gefragt sind Kompetenzen u.a. in Datenbereitstellung, Wissensrepräsentation, Modellarchitektur, Schnittstellenintegration, Betriebssicherheit sowie erklärbarer KI und agiler Entwicklung.
Nutzer:innen setzen GenKI in ihrer täglichen Arbeit ein – etwa für Texterstellung, Recherchen oder Ideenskizzen. Sie benötigen u.a. Kompetenzen zur Einschätzung von Einsatzmöglichkeiten und -grenzen der jeweiligen GenKILösung, zur Promptgestaltung sowie zur kritischen Bewertung der Ergebnisse (z. B Relevanz, Korrektheit, Verzerrungen).
Den Abschluss bilden systemspezifische Kompetenzen in Ethik, RechtundStandards(insbesondere Datenschutz) sowie Fachkompetenzen Diese sind je nach Systemgestaltung und Einsatzzweck unterschiedlich auf die drei Rollen verteilt.
Nicht jede:r muss in jedem Kontext gleich viel können
Je höher das Risiko des Einsatzzwecks sowie der Freiheitsgrad der Nutzung einer GenKI-
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung schreitet gezielt voran Ein innovatives Beispiel liefert die bol Behörden Online Systemhaus GmbH mit dem KI-Formular-Assistenten FINO
Als smarter Form-Bot schafft FINO eine angenehme Interaktion zwischen Bürger:innen und Verwaltung – verständlich, einfach und nutzerfreundlich.
FINO geht über einen klassischen Chatbot hinaus: Er begleitet Antragsteller durch komplexe Formulare, erklärt Inhalte verständlich, reagiert auf Rückfragen und nutzt auf Wunsch einfache Sprache –
auch in vielen anderen Sprachen. Quellenangaben mit Links schaffen Transparenz. Das verbessert die Datenqualität und das Nutzererlebnis Die KI prüft beispielsweise, ob Formulare vollständig und korrekt ausgefüllt sind. Ein zentrales Feature ist die automatische Dokumentenprüfung. Hochgeladene Unterlagen erkennt FINO und prüft sie direkt vor dem
Senden – effizient und zuverlässig. Im integrierten Chat erlaubt FINO Rückfragen und hilft bei der Navigation durch Formularabschnitte So entsteht ein Dialog ähnlich wie mit einem Sachbearbeiter – rund um die Uhr verfügbar. Den ersten Praxiseinsatz soll FINO in Braunschweig haben. Das Ziel der Erprobung ist, Bürgerinnen und Bürger zunächst bei der An-
Die Fachzeitschrift zur Digitalisierung der Verwaltung als E-Paper. Alle eGovernment-Ausgaben schon am Freitag vor Erscheinen bequem online lesen:
eGovernment.de/digitale_ausgaben
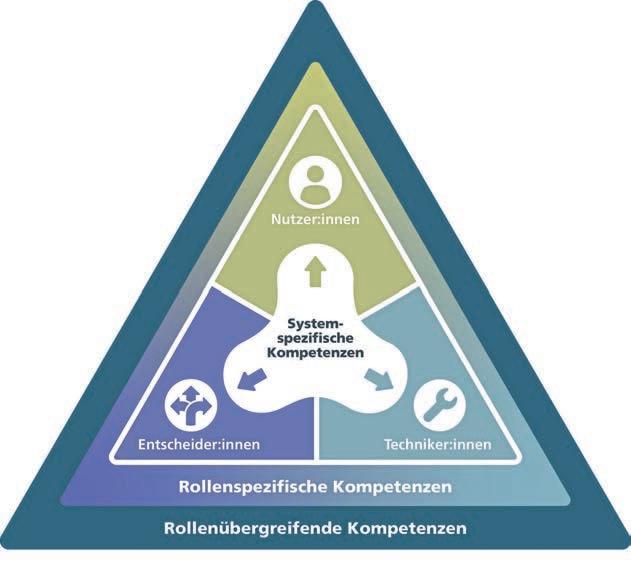
Lösung, desto höher sind die Kompetenzanforderungen – insbesondere bei Nutzer:innen sowie in den Bereichen Ethik, Recht, Standards und Fachkompetenz. Bei stärker geführten Systemen –etwa bei vollautomatisierter Formularprüfung – verlagert sich der Kompetenzbedarf dagegen auf die Entscheider:innen und Techniker:innen, welche die Systeme entsprechend gestalten und einführen.
Kompetenzen sind essenzielle Voraussetzung für den erfolgreichen GenKI-Einsatz in der Verwaltung Systemgestaltung und Kompetenzaufbau müssen von Beginn an zusammengedacht werden.
Autor:innen:
Dorian Wachsmann, Gabriele Goldacker und Maximilian Kupi sind wissenschaftliche Mitarbeitende des Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS.
Weitere Informationen

Mehr dazu im ÖFIT GenKI-Kompetenzframework [ voge.ly/ÖFIT-Kompetenzen ]
FINO, der blaue, sympathische Form-Bot, unterstützt die Stadt Braunschweig bei der Hundesteuer-Anmeldung.
meldung von Hunden zu unterstützen. Fotos von Hunden werden analysiert – Rasse und Fellfarbe automatisch erkannt Die Daten fließen direkt ins Formular und steuern bei bestimmten Rassen Folgeprozesse wie die Prüfung der Maulkorbpflicht.
Dr Neven Josipovic, Chief Innovation Officer der Stadt Braunschweig, erklärt: „KI kann das Aus-

füllen von Anträgen deutlich vereinfachen. Ich freue mich daher, dass wir FINO in Braunschweig erproben und dadurch Erfahrungen zur Akzeptanz neuer innovativer KI-Services sammeln können.“
Weitere Informationen
Sie möchten FINO auch kennen lernen? Dann schreiben Sie an info@bol-systemhaus.de.


Fachkräftemangel und Fortbildungen
Künstliche Intelligenz kann im privaten und beruflichen Umfeld eine Hilfe sein und Arbeit abnehmen In einer Umfrage des Bitkom wurde klar, dass sogar noch mehr geht: Jeder Dritte meint, eine KI könne seinen Chef ersetzen.
Wofür kann künstliche Intelligenz (KI) genutzt werden? Und inwieweit werden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für den Umgang mit KI-Tools geschult? Das wollte der Branchenverband Bitkom genau-

Um KI-Tools sinnvoll einsetzen zu können, braucht es Know-how.
er wissen und hat rund 1.000 Personen in Deutschland telefonisch befragt. Die Ergebnisse zeichnen ein heterogenes Bild 20 Prozent der Berufstätigen haben demnach bereits Fortbildungen zum KI-Einsatz erhalten, 6 Prozent bekämen Fortbildungen, haben sie aber noch nicht wahrgenommen, und ganze 70 Prozent kamen bislang noch gar nicht in diesen Genuss. „KI macht viele Tätigkeiten im Beruf einfacher und effizienter – und die Nutzung kann zudem noch Spaß machen Wichtig ist, dass man die Tools richtig bedienen kann und auch über die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie sowie über Datenschutz und Datensicherheit Bescheid weiß“, betont Bitkom-Präsident Dr Ralf Wintergerst. Nicht nur das: Laut europäischer KI-Verordnung müssten Unternehmen, die KI einsetzen, sicherstellen, dass die beteiligten Personen über ein „ausreichendes Maß an KI-Kompetenz“ verfügen Dazu ge-

Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt langfristig verändern, so viel steht fest.
hörten neben den eigenen Beschäftigten unter anderem auch Freelancer, Zeitarbeiter oder Dienstleister. Diese Vorgabe gilt seit Februar 2025 „Auch Unternehmen, die aktuell noch keine KI einsetzen, sollten überlegen, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Fortbildungen anzubieten, denn viele nutzen zum Beispiel private KI-Apps auch für berufliche Zwecke“, ergänzt Wintergerst Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt in den kommenden Jahren weiter verändern, hier herrscht Konsens unter den Erwerbstätigen. Doch nicht nur das: 14 Prozent glauben, dass eine KI sie in ihrem Job komplett ersetzen könnte Und immerhin 33 Prozent gehen sogar davon aus, dass ihre Vorgesetzte oder ihr Vorgesetzter durch eine KI ersetzbar sei. „Angesichts der demographischen Entwicklung und des bereits bestehenden Fachkräftemangels bietet KI gerade für die deutsche Volkswirtschaft eine Chance, den sich verschärfenden
Mangel an Arbeitskräften zu mildern“, sagt Wintergerst Der Branchenverband schlägt bedarfsgerechte Schulungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz vor. Dabei sollten technische Grundlagen zur Funktionsweise von KI-Tools ebenso zur Sprache kommen wie rechtliche und ethische Aspekte „Vollständige Weiterbildungskonzepte sollten unter anderem einen Lernraum zum Ausprobieren, Peer-Learning und Community-Netzwerke für informelles Lernen beinhalten“, empfiehlt der Bitkom su

und die Nutzung von Daten gibt es beispielsweise auf der Website des Bitkom. [ bitkom.org/Themen/KI-Daten ]
Bauwirtschaft
„Die meisten Bauämter sind in den 1980ern stehen geblieben“, sagt
Klaus-Peter Stöppler Der Bau- und Immobilienexperte spricht sich für mehr Digitalisierung aus und erläutert, wie die gesamte Baubranche von künstlicher Intelligenz profitieren kann.
Das Thema „Building Information Modeling (BIM)“ ist in der Baubranche angekommen. Hierbei werden Bauvorhaben digital geplant und kontrolliert, indem ein digitales Modell erstellt wird. Die BIM-Methode wird durch die Bundesregierung vorangetrieben. „Das Ziel der Bundesregierung ist es, die BIM-Methode flächendeckend und nach bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen bei der Planung, der Genehmigung, dem Bau und Instandhaltung von Bundesverkehrswegen und Infrastruktur anzuwenden“, heißt es dazu Mit der Bundesinitiative „BIM Deutschland“ wurde sogar ein nationales Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens ins Leben gerufen.
Klaus-Peter Stöppler, Bau- und Immobilienexperte sowie Executive Interim Manager, ist über-
zeugt, dass die Bauwirtschaft vor einer Zeitenwende steht – geprägt durch künstliche Intelligenz „Die Baubranche ist prädestiniert für den Siegeszug der Real-world AI, also der Nutzung künstlicher Intelligenz in der realen Welt“, ist Stöppler überzeugt Real-world AI stehe dabei als Gegenentwurf zur Gen AI, der generativen KI Während Gen AI wie etwa ChatGPT lediglich Texte, Bilder, Grafiken oder Videos generieren könne, umfasse Real-world AI beispielsweise KI-Roboter oder Baumaschinen mit KI-Steuerung „Die Baubranche wird beides kombinieren“, glaubt Stöppler
Beim Thema BIM erwartet Stöppler die Verknüpfung mit KI-Algorithmen. Dadurch ließen sich Planungsfehler nicht nur frühzeitig erkennen, sondern auch automa-
tisch korrigieren. „Der Einsatz künstlicher Intelligenz verändert die Prozesse, Planungslogiken und Geschäftsmodelle der Branche
grundlegend. Dabei geht es perspektivisch nicht nur um digitale Baupläne oder automatisierte Ausschreibungen Vielmehr werden intelligente Systeme künftig Einzug in nahezu alle Phasen eines Bauprojekts halten: von der Bedarfsplanung über die Bauausführung bis zum Gebäudebetrieb“, erläutert Stöppler Er verweist auf eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aus dem vergangenen Jahr, wonach allein durch frühzeitige Fehlervermeidung und optimierte Materiallogistik bis zu 20 Prozent der Projektkosten eingespart werden könnten „Studien zufolge setzen heute schon knapp drei Viertel der deutschen Bauunternehmen KI in

Planung und Entwurf ein, aber bei der Umsetzung auf der Baustelle fällt der Anteil deutlich niedriger aus“, erklärt Stöppler Das werde sich in den nächsten Jahren allmählich ändern: „Sensorik, Drohnen und autonome Baumaschinen liefern Daten in Echtzeit, die mithilfe von KI analysiert werden So entstehen prädiktive Modelle, die etwa den Verschleiß von Maschinen vorhersagen oder Arbeitsabläufe dynamisch anpassen, um Verzögerungen zu vermeiden.“ Auch selbstfahrende Bagger, Radlader und Muldenkipper sowie KI-gesteuerte Kräne und Betonmischer seien im Kommen.
Verbesserungsbedarf sieht Stöppler bei der Verzahnung mit Bauämtern und anderen staatlichen Stellen mit geringem Digitalisierungsgrad. „Die meisten Bauämter sind in den 1980ern stehen geblieben, mit einem Unterschied: Dank Home Office erreicht man heutzutage im Gegensatz zu damals selbst telefonisch kaum noch jemanden im Amt“, moniert Stöppler. Er bezeichnet die mangelnde Digitalisierung in den Bauämtern als „Flaschenhals für die gesamte Bauwirtschaft“ su
Weitere Informationen
Zum„Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens“ gelangen Sie hier: [ bimdeutschland.de ]
Game Changer KI
KI ist der zentrale Trend zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Nun zeigen sich echte Anwendungsszenarien
Ein klassisches Beispiel ist die Beleglesung – über Jahre hinweg die Achillesferse in der automatisierten Rechnungsverarbeitung. Hier sorgt KI für deutlich mehr Präzision und Effizienz beim Umgang mit unstrukturierten oder inkonsistenten Daten
Doch mit Blick auf die Zukunft stellt sich eine berechtigte Frage: Wird mit der verpflichtenden Einführung der E-Rechnung KI in der Rechnungsverarbeitung überhaupt noch gebraucht? Ab dem 1 Januar 2027 werden in Deutschland
maschinenlesbare E-Rechnungen grundsätzlich zur Pflicht Auf den ersten Blick scheint die automatisierte Verarbeitung damit zum Selbstläufer zu werden – und KI somit überflüssig. Doch das greift zu kurz: E-Rechnungen decken längst nicht alle Fälle ab. Gerade in Ausnahmefällen bleibt eine PDFoder gescannte Rechnung relevant und damit auch die KI-gestützte Belegerfassung. Selbst vollständig strukturierte Rechnungen liefern oft nicht alle für die Verarbeitung nötigen In-
formationen. Kontextwissen ist entscheidend: Welche Kostenstelle ist betroffen? Welchem Projekt ist der Vorgang zuzuordnen? Wie ist der buchhalterische Rahmen? Genau hier entfalten KI-Modelle wie LLMs ihr Potenzial – mit automatisierten, lernfähigen und unternehmensspezifischen Zuordnungen.
Weitere Aspekte sind vorgelagerte und begleitende Beschaffungsprozesse Neben Rechnungen fallen Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Zahlungsavise oder
Materna, ITZBund und NVIDIA starten Pilotprojekt für Software-Entwicklung
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf: Das ITZBund erprobt gemeinsam mit Materna den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung in der Software-Entwicklung
Grundlage ist dabei KIPITZ, das KI-Portal des ITZBund, kombiniert mit leistungsstarken KI-Technologien von NVIDIA. Ziel des Pilotprojekts namens AIDA: Effizienzsteigerung, Fachkräftesicherung und mehr Tempo bei Digitalisierungsprojekten des Bundes. Das ITZBund verantwortet als zentraler IT-Dienstleister des Bundes die Umsetzung zahlreicher Softwareprojekte für die Bundesverwaltung Diese Aufgaben erfordern spezialisierte Fachkräfte – eine Ressource, die angesichts des
Effizient und bürgernah

demografischen Wandels zunehmend knapp wird. Um dem entgegenzuwirken, erprobt das ITZBund nun im Rahmen von AIDA gemein-
Thomas Feld, Vice President Data Economics und AI bei Materna.
sam mit Materna die Integration von generativer KI in bestehende Entwicklungsumgebungen. Im Mittelpunkt steht die Verknüp-
Künstliche Intelligenz und Automatisierung bieten der Verwaltung enormes Potenzial

ffentliche Verwaltung in and wird viel und oft , erfolgreiche Digitaliojekte sind allerdings Thema Der digitale edarf ist erheblich – ins-

Gutschriften an – Dokumente, die meist nicht standardisiert sind und nicht unter die E-Rechnungspflicht fallen. Hier bleibt das „intelligente Erfassen und Verstehen“ der Inhalte essenziell. KI-Systeme, die sich flexibel an unterschiedliche Dokumenttypen anpassen und kontinuierlich dazulernen, bringen hier deutliche Effizienzgewinne. Die E-Rechnung schafft eine wert-
fung der sicheren Software-Entwicklungsinfrastruktur des Bundes mit KIPITZ, dem KI-Portal des ITZBund, das speziell für die Nutzung generativer KI-Anwendungen in behördlichen Kontexten aufgebaut wurde Anders als kommerzielle KIDienste operiert KIPITZ vollständig innerhalb souveräner IT-Umgebungen des Bundes und erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Die technologische Grundlage bilden dabei Hochleistungsprozessoren von NVIDIA, die in den Rechenzentren des Bundes betrieben werden. Materna bringt in das Projekt umfassende Expertise in der Entwicklung und Implementierung von KIgestützten Fachverfahren für die öffentliche Verwaltung ein. In einem ersten Schritt wurde die nahtlose Integration von KI in den Entwicklungsprozess sowie die Anbindung an KIPITZ bereits erfolgreich als Proof Of Concept demonstriert – nun folgt die Pilotierung unter
volle Datenbasis – KI macht daraus echten Mehrwert. Beide Technologien sorgen gemeinsam für eine durchgängige, smarte Automatisierung von Finanzprozessen.
Weitere Informationen zur Rechnungsverarbeitung mit KI finden sich im E-Book von xSuite: [ bit.ly/xSuite-E-Book-KI ]
Realbedingungen im ITZBund. Jens Gehres, Abteilungsleiter im ITZBund, sieht darin eine große Chance für die Verwaltung und erklärt: „Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten die umfassenden Möglichkeiten der KIunterstützten Softwareentwicklung „powered by KIPITZ“ im ITZBund auszuloten und umzusetzen.“ Konkret bedeutet das: KI-Modelle unterstützen die Entwicklerinnen und Entwickler direkt bei alltäglichen Aufgaben wie Codegenerierung, Testfall-Erstellung, Fehleranalyse und Dokumentation. Zeitaufwändige Recherchen und manuelle Routinetätigkeiten werden reduziert – das steigert die Produktivität und schafft Freiräume für die kreative und fachlich anspruchsvolle Entwicklung neuer Anwendungen.
besondere bei komplexen, zeitintensiven und teuren Verwaltungsprozessen. Wo heute noch Stempel und Vor-Ort-Termine dominieren, könnte schon bald eine digitale Service-Infrastruktur für echte Entlastung sorgen. Die nötigen Technologien stehen bereit: Künstliche Intelligenz und Automatisierung bieten der Verwaltung enormes Potenzial. Besonders der Einsatz agentenbasierter KI hebt die Möglichkeiten großer Sprachmodelle (LLMs) auf ein neues Niveau Solche Sys-
teme können nicht nur Prozesse automatisieren, sondern auch auf Basis von Kontext und Daten eigenständig Entscheidungen vorbereiten In der Praxis könnten sie etwa Wohngeldanträge prüfen, Unterlagen anfordern oder Rückfragen stellen – schnell, zuverlässig und rund um die Uhr. Das entlastet Sachbearbeitende und verbessert den Bürgerservice Erste Kommunen zeigen bereits, wie auf diese Weise Effizienz und Zufriedenheit steigen können. Auch im Bereich Cybersecurity leisten KIAgenten wertvolle Dienste, indem sie Angriffe frühzeitig erkennen und automatisch Gegenmaßnahmen einleiten. Wenig überraschend kommen die zahlreichen Vorteile nicht ganz ohne Herausforderungen aus. Vor allem ethische und rechtliche Fragen sind im Voraus zu klären Wie können wir zum Beispiel sicherstellen, dass agentenbasierte Systeme mit unseren Werten übereinstimmen? Wer ist verantwortlich,
wenn eine agentenbasierte KI einen Fehler macht? Nichtsdestotrotz: Die Zukunft der öffentlichen Verwaltung ist digital und zu einem hohen Grad automatisiert Auf dem Weg zu diesem Ziel sind einige wichtige Stolpersteine zu umgehen, etwa zu starke Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern und die damit verbundene eingeschränkte Flexibilität Wer wirklich digitale Souveränität erreichen will, kommt an offenen Standards und Open Source nicht vorbei –nur so bleiben Kontrolle, Anpassungsfähigkeit und Transparenz gewahrt. Technologien wie Red Hat OpenShift bieten hier eine robuste, skalierbare und zugleich souveräne Plattform, um moderne, KI-gestützte Verwaltungslösungen sicher und zukunftsfähig umzusetzen.

Neben Printausgabe, E-Paper und Online-Auftritt ist eGovernment auch auf vielen sozialen Plattformen aktiv. Bei Facebook, Twitter und LinkedIn teilen wir ausgewählte News und Insights.


https://www.facebook.com/ egovernmentde

https://twitter.com/ egovernmentde

https://de.linkedin.com/ showcase/egovernmentde/
Geben Sie uns ein „Like“ und folgen Sie uns!
MARKTÜBERSICHT
ZUKUNFTSSICHER
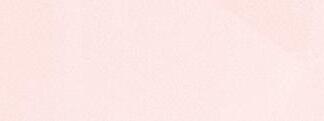










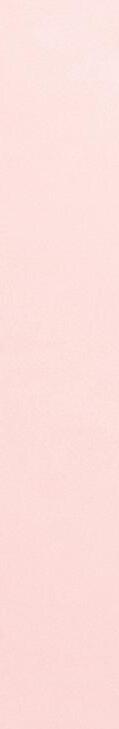
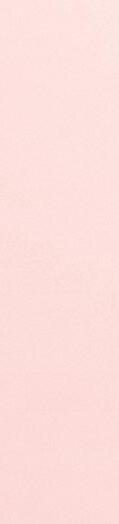
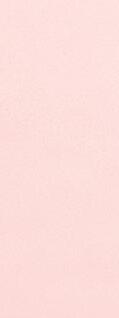








Neue digitale Lösu swelten entdecken!



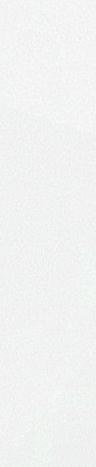




MitelementsuiteundIoT:
Entdecken Sie element suite, die neue IoT-Komplettlösung von ZENNER! Sie verbindet die Fieldservice-Lösung element go zur Digitalisierung von Montageprozessen, die IoT-Plattform element iot – mit der Sie das Geräte-undAsset-Management,denLoRaWAN-Netzbetrieb, die Datenverarbeitung, die Prozessautomation, die Alarmerstellung und vieles mehr realisieren – sowie die neue Anwendung element apps, die Ihnen
www.zenner-iot.com










passende Applikationen bietet und die Möglichkeit, neue Applikationen selbst zu erstellen. Nutzen Sie mit element apps innovative, fertige Out-of-the-box-Applikationen wie ZENNER BuildingLink oder GridLink. Durch die Vernetzung aller Elemente bietet Ihnen element suite einen vollständig digitalen Ende-zu-Ende-Datenfluss von der Inbetriebnahme einzelnerSensorenbiszurfertigenApplikation.






























































































AIACCELERATEDQUADDISPLAY4×2.5GBIT3×M.2SSDUP TO 96GBREMOTEPOWER ON
Die ShuttleXPCslimDN11-SeriekombiniertneueIntelCoreUltra Prozessoren mitintegrierterKI-Beschleunigungund hervorragender Konnektivität –idealfüranspruchsvolleAnwendungeninIndustrie, BusinessundContent-Produktion. Vier2,5-Gbit/s-LAN-Ports, Unterstützungfürbiszuvier UHD-Displays,biszu 96GB DDR5-RAMundeine vielseitige M.2-Speicherarchitekturmachendie1,3-Liter-Plattformzurersten Wahl,wenn maximale Leistung aufminimalem Raumgefragtist.
ObalsKI-Edge-Device,Netzwerk-Gateway,Firewalloder fürdatenintensiveVisualisierung –die Mini-PCsder DN11Serie passensich flexibel an IhreAnforderungen an.
Mehr erfahrenundModellevergleichen: WWW.SHUTTLE.EU
TIPP: IhrDN11‒so individuellwie IhrProjekt! NutzenSie unseren Produktkonfiguratorund passen Sie IhrBareboneperfektanIhre
Anforderungenan: go.shuttle.eu/YTv0X
*EmpfohlenerHEKbei offiziellenShuttle Distributoren, zzgl. USt.Änderungen vorbehalten.


Intel Core Ultra5125H Prozessor Biszu34TOPSKI-Leistung (CPU, GPU,NPU kombiniert)
Quad 2,5-Gbit/s-LANfürFirewalls, Gatewaysoder VM-Setups
4× UHD-Display-Ausgänge (2× HDMI2.1,2× DisplayPort1.4a)
Biszu96GBDDR5-RAMund
3×M.2 SSD-Steckplätze (RAID-fähig)
2× USB 3.2 Gen 2×2 TypeC (20 Gbit/s +PD) und sechs weitereUSB-Ports
Optional mitWLANund 4G/5G-Modul erweiterbar
RobustesMetallgehäuse, VESA-Mount-fähig,24/7-tauglich
Wie DN11H5,jedochmit...
Intel Core Ultra7155HProzessor
Wie DN11H5,jedochmit...
Intel Core Ultra9185H Prozessor
AB €622,–*


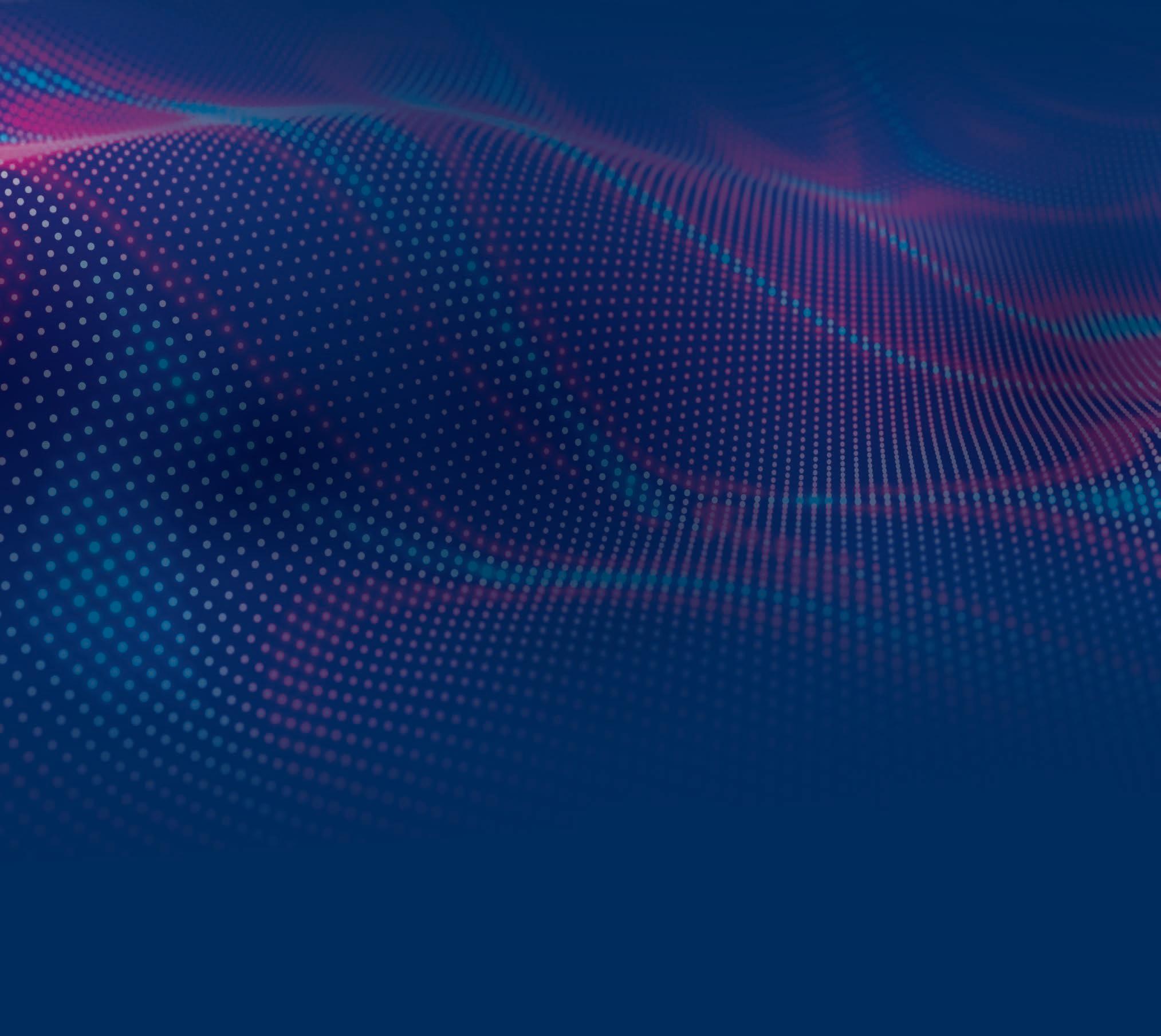
Stimmen Sie ab und küren Sie in 10 Kategorien jeweils Ihren bevorzugten Lösungsanbieter für den diesjährigen eGovernment Readers‘ Choice Award
