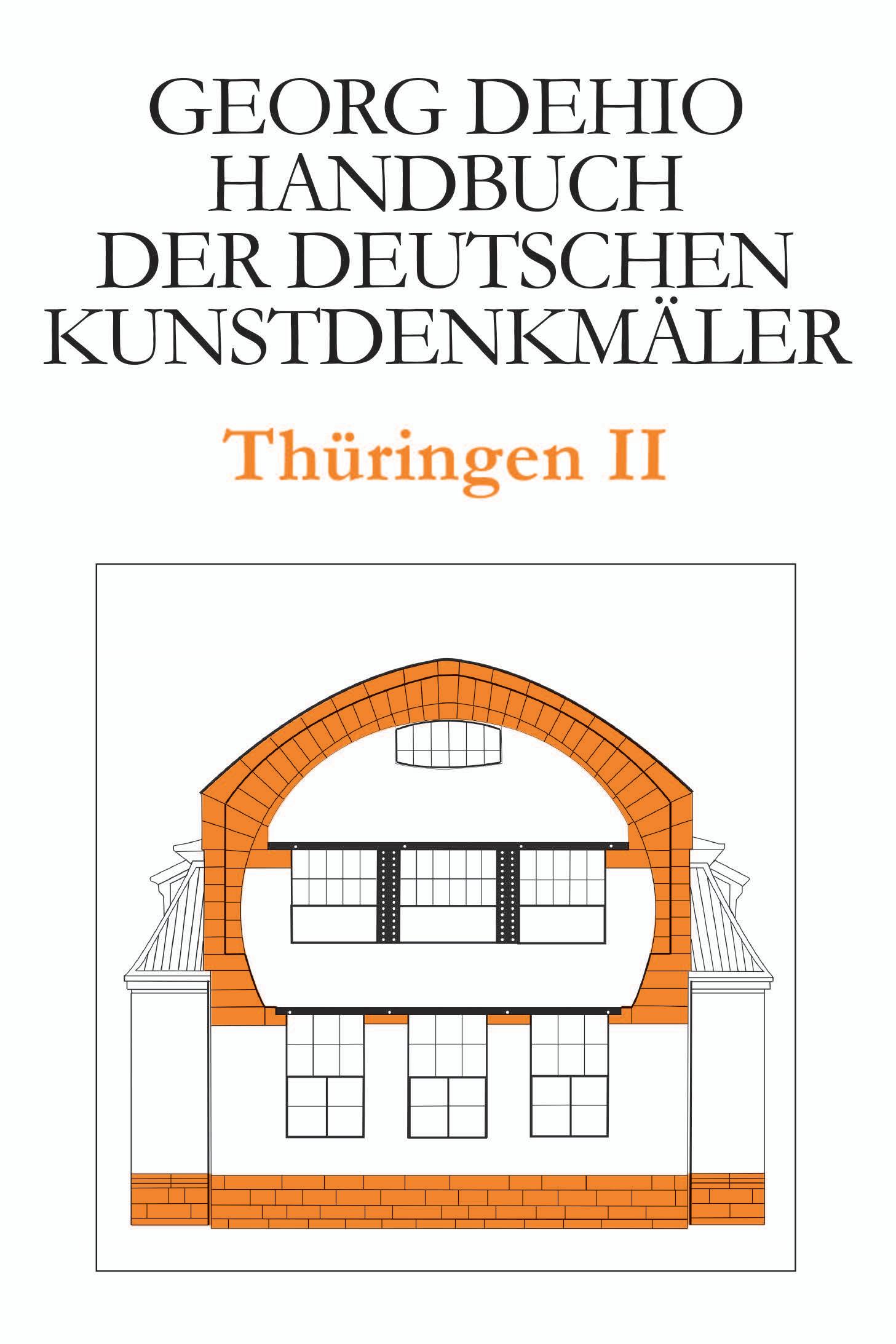
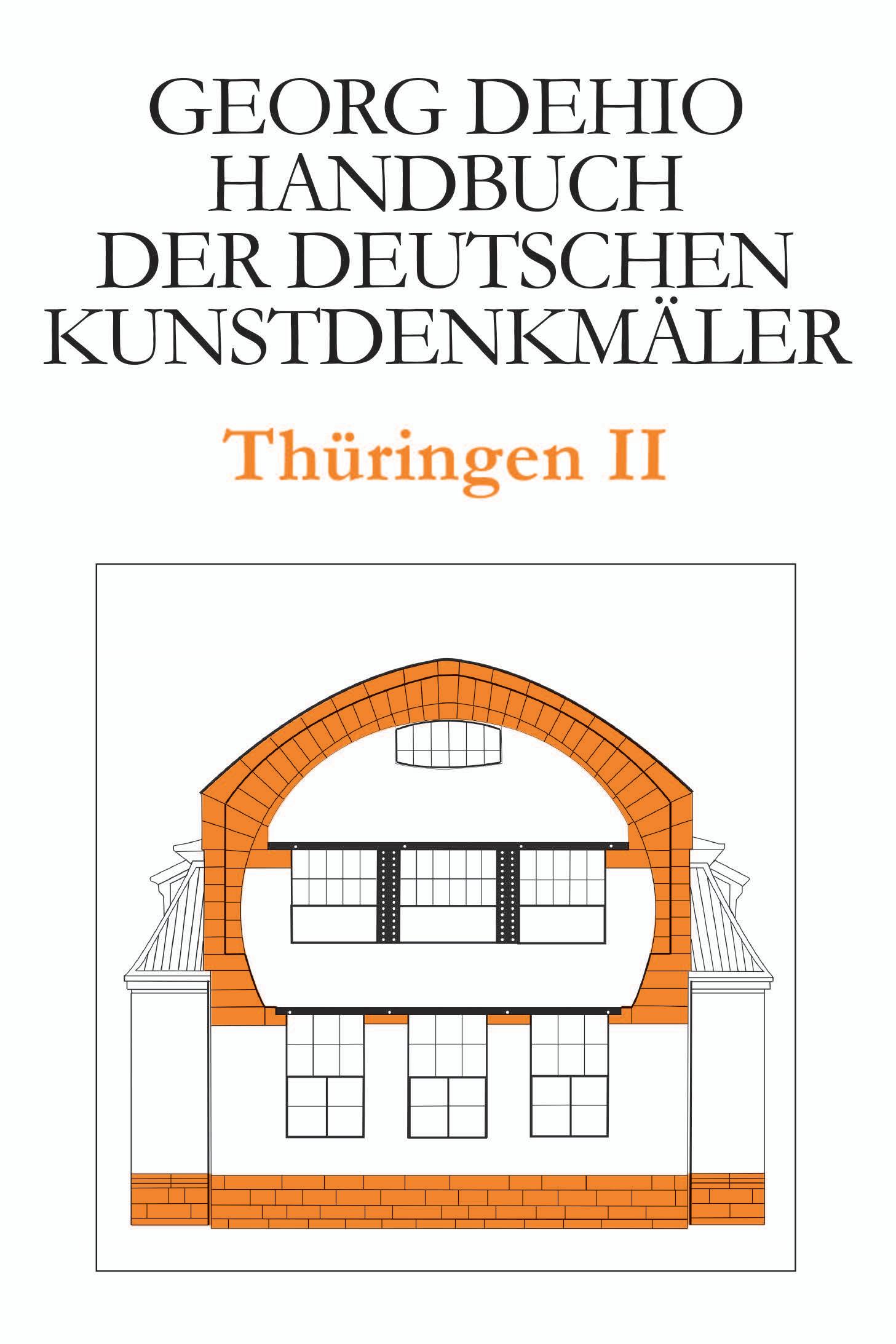
Thüringen II
Kreis Altenburger Land, Stadt Erfurt, Stadt Gera, Kreis Greiz, Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Kreis Sömmerda, Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land
Bearbeitet von Stephanie Eißing, Franz Jäger und anderen
Überarbeitet und erweitert von Kerstin Vogel und anderen
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und der Bauhaus-Universität Weimar
Georg Dehio
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Begründet vom Tag für Denkmalpflege 1900 Fortgeführt von Ernst Gall
Bearbeitung besorgt durch die Dehio-Vereinigung (Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopographischen Werkes von Georg Dehio e.V.)
Redaktion: Hans-Christian Feldmann, Hans-Rudolf Meier, Holger Reinhardt
Gefördert aus Mitteln des Freistaats Thüringen, der Bauhaus-Universität Weimar, der Kulturstiftung der Länder und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.
Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Herausgebern.
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 Deutscher Kunstverlag Ein Verlag der Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston
www.deutscherkunstverlag.de www.degruyter.com
ISBN 978-3-422-80272-8 e-ISBN (PDF) 978-3-422-80273-5 Library of Congress Control Number: 2025931915
Orte von A bis Z ...................................
Verzeichnis von Örtlichkeiten, die unter anderen Ortsbezeichnungen aufgeführt sind
Übersichtskarte von Thüringen mit Markierung der Bearbeitungsregionen auf den Vorsatzblättern.
Altenburg, Stadtgeschichte
3 werk. – Großes Stuckepitaph für Anton Ludwig von Schwarzenfels, gest. 1725, mit Porträtmedaillon, Inschrift- und Wappenkartusche sowie zwei weiblichen Allegorien. – Unter dem Chor kreuzgratgewölbte bauzeitliche Gruft. – Glocke von 1447, eine weitere 15. Jh.
Herrenhaus (Dorfstr. 47). Ein Vorgänger vielleicht schon M. 15. Jh. in Nachfolge der zerstörten Burg entstanden. Der heutige stattliche, zweigeschossige Rechteckbau M. 17. Jh. wohl unter Verwendung älterer Teile errichtet; Walmdach und vermutlich auch das Obergeschoss 1663 (d). Später mehrfach verändert. – Im Hauptgeschoss Kamin, daran zwei Paare jeweils identischer gusseiserner Reliefplatten von einem Ofen ehem. in der Kirche, mit Darstellung der Venus bzw. des Gleichnisses von Pharisäer und Zöllner sowie Bildnismedaillons, inschr. 1551 von Philipp Soldan.
ALTENBEUTHEN Kr. Saalfeld-Rudolstadt (Bergner XXII). Karte 11
Ev. Kirche. Chorturmkirche, in der Anlage und in Teilen des Aufgehenden wohl um/nach 1200. Um 1500 an der Nordseite des Turms kreuzgratgewölbte Sakristei angefügt. 1715–22 durchgreifender Umbau. – In der Ostwand des Chors romanisches Rundbogenfenster mit Trichtergewände. – Innen barock geprägt. An der Flachdecke Gemälde des Auferstandenen, 1775 bez. Ausstattung um 1715: dreiseitige Empore, an der Südseite mit Loge, reich dekorierter Kanzelaltar und Orgel (diese 1716 von Johann Georg Fincke). Taufstein, 13. Jh. (?). Im Chor spätgotische Sakramentsnische, unter Kielbogen Madonnenfigur und Engel; zur Sakristei Stabwerkportal.
ALTENBURG Kr. Altenburger Land (Lehfeldt XXI). Karte 8 Kreisstadt im ehem. Pleißenland. – Bodenfunde im Norden und Nordwesten des gegenwärtigen Stadtgebiets belegen eine bis in das 4. Jahrtausend v. Chr. zurückreichende Besiedlung. Das Zentrum der frühmittelalterlichen Siedlung und des späteren Reichslandes Pleißenland war die Königsburg auf dem Schlossberg, die erstmals 976/77 zusammen mit dem benachbarten slawischen Dorf „ Podegrodici“ (Pauritz) erwähnt wird. Daneben entstand eine deutsche Marktsiedlung am Brühl mit der Pfarrkirche St. Bartholomäi und eine zweite Siedlung bei der südwestl. gelegenen Pfarrkirche St. Nikolai (in beiden Bereichen Besiedelung für die 1. H. 12. Jh. belegt). M. 12. Jh. Einrichtung einer Burggrafschaft; im 12. und 13. Jh. Hoftage und häufige Aufenthalte der staufischen Könige und Kaiser. Friedrich Barbarossa, der mindestens siebenmal in Altenburg weilte, förderte den Ausbau der Reichsstadt. Er stiftete angeblich (lt. gefälschter Urkunde) um 1172 das Augustinerchorherrenstift St. Marien und gründete 1181 das Hospital St. Johannis, das Friedrich II. 1214 dem Deutschen Ritterorden übereignete. Der heute verschwundene Deutschordenshof war eine der ältesten Niederlassungen des Ordens in Mitteldeutschland. Im 13. Jh.
Altenburg, Stadtgeschichte
entstanden außerdem ein Franziskaner- und ein Magdalenerinnenkloster. Zwischen Bartholomäi- und Nikolaisiedlung im sp. 12. Jh. die regelmäßige Stadtanlage um den 1192 erwähnten neuen Markt gegr. Die ab A. 13. Jh. errichtete Stadtmauer bezog die älteren Siedlungen (außer Pauritz) großenteils ein. 1256 Bestätigung des auf älteren Privilegien beruhenden Stadtrechts.
Im 14. Jh. gelang den Wettinern, die seit 1243 das Pleißenland zunächst im Pfand-, dann im Vollbesitz hatten, die Eingliederung der ehem. Reichsstadt in ihre Territorialherrschaft. Sie bestimmten fortan maßgeblich die Entwicklung der Stadt, die von 1603 bis 1672 und nochmals von 1826 bis 1918 Residenz eines eigenständigen Herzogtums war. Während der Zugehörigkeit zum Herzogtum Sachsen-Gotha im 18. Jh. erhielt Altenburg durch höfische und anspruchsvolle bürgerliche Bauten seinen typischen Residenzstadtcharakter. Unter Herzog Friedrich II. (1691–1732) das Schloss grundlegend umgebaut und erweitert und bedeutende Barockbauten in der Stadt errichtet. – Zwischen 1825 und 1836 Entfestigung mit Niederlegung der fünf Stadttore. Der frühe Anschluss an das Eisenbahnnetz 1842 und die Erschließung der Braunkohlelagerstätten nördl. von Altenburg begünstigten den wirtschaftliche Aufschwung im 19 . Jh., dabei von besonderer Bedeutung für die Stadt die 1832 gegr. Spielkartenfabrik (heute ASS Altenburger), die bereits 1603 von Torgau hierher verlegte Druckerei und die ab 1871 gegr. Nähmaschinenfabriken. Im 3. Dr. 19. Jh. Verdopplung der Einwohnerzahl auf über 37 000 um 1900. Durch Auflösung des Herzogtums 1918 Bedeutungsverlust; seit 1920 Kreisstadt. Nach 1990 mit Zusammenbruch der Industrie die Einwohnerzahl um fast die Hälfte reduziert.
Stadtgestalt . Das Areal der mittelalterlichen Stadt liegt in einer Hangmulde am linken Ufer eines von Süden nach Norden verlaufenden Bachlaufs, der Blauen Flut. Am rechten Ufer im Nordosten auf einem stadtseitig steil ansteigenden Bergrücken das Residenzschloss und im Osten auf einer weiteren Höhe das ehem. Augustinerchorherrenstift St. Marien, sog. Bergerkloster. Von der Blauen Flut drei innerstädtische Teiche gespeist ( Großer Teich). – Kernstadt mit historisch vielgestaltigem, von Stadtbränden und Kriegszerstörungen weitgehend verschontem Stadtbild auf mittelalterlich geprägtem Grundriss ; darin drei Siedlungskerne. Im Nordosten der Bereich um Bartholomäikirche und Brühl, den alten Markt an der Richtung Leipzig führenden Handelsstraße. Im Südwesten ein zweiter älterer Siedlungskern um die ehem. Nikolaikirche ( Nikolaiturm). Dazwischen die großzügige staufische Stadtanlage in regelmäßiger Straßenrasterform. Dominierend die in West-Ost-Richtung verlaufenden Platz- und Straßenanlagen: nahezu mittig der langgestreckte, sich trichterförmig nach Osten weitende neue Markt, nördl. davon die Johannisstraße als innerstädtischer Teil eines alten Handelswegs Richtung Zeitz, südl. die Straßenmärkte Topf- und Kornmarkt, parallel dazu Teichstraße mit Roßplan und Schmöllnsche Straße. Am
1 sog. Lehnshaus
2 Hohes Haus
3 Neues Schloss
Beichlingen, Schloss
4 Schlosskapelle
5 Kaltes Tor
mutlich am Rand des urspr. Burgareals errichtet, sodass die Aborterker an Nord- und Westseite auf den Burggraben hinausführten (Konsolen erhalten). Die gerundeten Ecken des Gebäudes innen durch konvex hervortretende Mauerzüge verstärkt, vielleicht Indiz für urspr. zugehörige turmartige Aufbauten (vgl. Burgruine „Hoher Schwarm“ in Saalfeld). Fenster- und Türöffnungen im Laufe des 16. Jh. verändert, dabei auch große Wandpartien ersetzt. Wohl in den 1530er Jahren die südöstl. Ecke anstelle der Rundung mit Eckquaderung neu aufgeführt und der Dachstuhl erneuert (1535 d), zudem vermutlich auch der rechteckige Treppenturm an der Ostseite angebaut. Das repräsentative Portal mit der wohl auf den Innenausbau bezogenen Bez. „1592“ um 1935 an das Neue Schloss versetzt; hier jetzt Rundbogenpforte und Nachbildung einer Inschrifttafel zum Gedächtnis an Wolfgang von Werthern. – Innen in allen Geschossen durch steinerne Querwände in drei annähernd gleichgroße Teile gegliedert. Das Erdgeschoss mit kreuzgratgewölbten Räumen urspr. nur über die Wendeltreppe vom ersten Obergeschoss aus zu erreichen. In den Obergeschossen das mittlere Drittel ein saalartiger Raum, südl. und nördl. davon ehem. je ein zweiräumiges Appartement mit Wohnstube und Schlafkammer. Diese Raumstruktur auf den Umbau um 1500 zurückgehend, die repräsentative Spätrenaissance-Ausstattung hingegen überwiegend um 1590. Hervorzuheben die Gestaltung der im südl. Bereich jeweils erhaltenen Wohnstuben: an Decken und Wänden kunstvolle farbige oder grisailleartige Fassungen mit Arabesken sowie Roll- und Beschlagwerk; die
Türrahmungen zum Mittelraum mit Säulen, Gebälk und Aufsatz, darin Relief: Verkündigung bzw. Opferung Isaaks; in den Bohlenwänden zur Kammer pilastergerahmte Türen, in den Aufsätzen gemalte Wappen. Im Mittelraum des zweiten Obergeschosses zwei Hermenportale mit Reliefaufsätzen und Deckenfries mit ionischem Kyma. Die gleichen Ornamentformen auch an anderen Teilen der Ausstattung. In einigen Räumen Kamine, der größte im Mittelraum des ersten Obergeschosses bez. 1597. Im seit 1937 ungeteilten Nordraum des zweiten Obergeschosses Wanddekoration aus Modelstuck dat. 1577, teilweise jedoch erst 1937 nach Modellen von 1577 ausgeführt: mit Bildnismedaillons, biblischen und Jagdszenen sowie Friesen mit Rankenwerk. – Die Grundrissstruktur des Hohen Hauses ein Beispiel für einen in seiner Zeit höchst modernen, auf herrschaftliche Wohnansprüche ausgerichteten Umbau an der Schwelle zur Neuzeit; die Ausstattung ein herausragendes Denkmal der Spätrenaissance.
Das gegenüberliegende zweiflüglige Neue Schloss in mehreren Bauphasen seit dem 16. Jh. entstanden. Ältester Teil wohl der Südflügel mit einem kurzen Stück des Ostflügels. Veränderungen durch Restaurierungen 1854 (bez.) und 1901–04. Der westl. Teil des Südflügels von 1905 wohl unter Wahrung des Fassadenbildes und unter Einbeziehung der alten Schlossküche. Hervorzuheben das Portal von Hans Friedemann d. Ä., bez. 1592, urspr. am Treppenturm des Hohen Hauses. Über kannelierten Säulen Gebälk mit Inschrift, in den Zwickeln allegorische Frauenfiguren, Aufsatz mit Wappen des Bauherrn Hans von Werthern und seiner Gemahlin Anna von Ponickau. – Innen mehrfach verändert. – Der Ostflügel in Höhe des ersten Obergeschosses durch Fachwerkgang mit der Kapelle verbunden; südl. davon sog. Kirchgarten.
Die Schlosskapelle ein wohl A. 16. Jh. entstandener Saalbau, um 1590 durch einen zweigeschossigen westl. Fachwerkanbau mit Herrschaftsloge und vermutlich im 18 . Jh. durch ein Nordseitenschiff erweitert. Ein Ostturm aus Fachwerk M. 19. Jh. beseitigt; die 1596 von Melchior Moering gegossene Glocke jetzt im Dachreiter des Hohen Hauses. – Innen durch drei Rundbögen in Haupt- und Seitenschiff geteilt. Im Hauptschiff zweiteilige stuckierte Kassettendecke von 1592. Aus derselben Zeit ein Zyklus großformatiger Stuckreliefs mit Bibelszenen: fünf an der Ost- und zwei an der Südwand; weitere Bildfelder möglicherweise bei Umbau und Neuausstattung im 18. Jh. beseitigt. Über dem Zyklus ein bis zur Westwand fortgeführter Wappenfries. – Altaraufsatz von 1688. Die übrige schlichte Ausstattung mit dreiseitiger Empore und Ständen 18. Jh.; Orgel mit 1928 erneuertem Werk. – Zahlreiche Grabstätten für Familienangehörige der von Werthern, 17. und 18. Jh. Beisetzungsstätte der Urne des Schriftstellers und Historikers Ferdinand Gregorovius (1821–1891), der mit Georg von Werthern (1816–1895), einem bedeutenden preußischen Diplomaten, befreundet war. – Großer Waldpark. Eine Lindenallee führt auf
Erfurt, Sakralbauten
Weitere Sakralbauten
Ev.-meth. Ägidienkirche (Wenigemarkt 4). Torkirche über der Ostauffahrt der Krämerbrücke. Einzige erhaltene Brückenkopfkirche Erfurts. Schon 1110 als Kapelle gen., in mehreren Phasen umgebaut und erweitert; der Turmbau zog sich vom fr. 14. bis zum fr. 15. Jh. hin (Turmhelm 1415 d); die Ostfassade wohl um 1400 neu errichtet. 1525 reformiert und mit der Kaufmannsgemeinde vereinigt, deshalb keine Gottesdienste mehr, 1582 Einsturz von Westgiebel und Dach, 1609 Wiederherstellung mit niedrigerer Dachlinie. Zwischen 1827 und 1927 profaniert. Nach umfassender Restaurierung seit 1960 Kirche
5 m
Erfurt, Ägidienkirche mit Durchfahrt zur Krämerbrücke
Erfurt, Sakralbauten
der Ev. Gemeinschaft (heute Ev.-meth. Gemeinde). – Die architektonische Gestaltung der an drei Seiten verbauten Kirche auf den zum Wenigemarkt gerichteten Ostgiebel mit drei großen Maßwerkfenstern beschränkt. Etwas außermittig auf einer weit hervortretenden, gestaffelten Konsole ein großer Altarerker aus Quaderwerk mit ungleichen Maßwerkfenstern. An der Nordseite der hohe Glockenturm, Turmhelm von 1415 (d). Im Erdgeschoss tunnelartige Durchfahrt zur Brückengasse sowie ehem. Kaufgewölbe und Aufgang zur Kirche. – Der Saal im Obergeschoss durch einen kräftig profilierten Spitzbogen mit dem gewölbten Altarerker verbunden. Daneben eine spätgotische Sakramentsnische mit reicher architektonischer Rahmung. Sonstige Raumgestaltung und Ausstattung aus den 1950er Jahren.
Kath. Allerheiligenkirche (Allerheiligenstr. 21). Kleine Hallenkirche in der Gabelung von Markt- und Allerheiligenstraße mit unregelmäßigem, trapezförmigem Grundriss und markantem Westturm am Schnittpunkt der Straßen. Nordöstl. der Kirchhof. – 1217 erstmals erwähnt, ein in der Literatur angenommener Zusammenhang mit dem Allerheiligenhospital ( Reglerkirche) irrtümlich. – Kleiner romanischer Apsissaal als Vorgänger nachgewiesen. Die heutige, stilistisch einheitliche Kirche im 14. Jh. errichtet; das Dachwerk von 1372 (d). 1896–98 unter Leitung von Arnold Güldenpfennig durch Albert Kortüm und Karl Frühling umgebaut. Nach Instandsetzung 2005– 07 als Kolumbarium eingerichtet. – Äußeres . Die sich nach Westen zum Turm hin stark verengende, zweischiffige Halle an beiden Langseiten ehem. durch mittige Portale erschlossen (das nördl. jetzt zugemauert). Am Südportal reliefiertes Tympanon mit Kreuzigungsgruppe, um 1360/70 wohl vom Meister des Severi-Sarkophags. Das kleine Chorpolygon und die Sakristei östl. des Nordschiffs E. 19. Jh. angebaut. – Auf dem quadratischen Westturm ein achteckiger Aufsatz mit hohem spitzem Helm, beide 1870 erneuert. In der breiten, ebenerdigen Nische der Turmsüdseite Kopie eines steinernen Vesperbilds, um 1380/90 (Original in der Maria-Magdalenen-Kapelle). – Das Innere durch drei spitzbogige Arkaden in zwei Schiffe geteilt. Darüber ein Dachwerk mit der Tragkonstruktion zweier ehem. Holztonnen, im 19. Jh. durch eine Flachdecke verschlossen. Im Ostpolygon Glasmalerei 1897 von Hertel & Lersch: Anbetung der Hirten und Kreuzigungsgruppe. – Ausstattung . Der ehem. im Nordschiff stehende Hauptaltar beim Umbau im 19. Jh. an die Ostwand des Südschiffs versetzt. Geschlossener, plastisch durchgebildeter Architekturprospekt mit Pilastern und Säulen. Hauptbild mit Christus und Heiligen, flankiert von den Schnitzfiguren der Apostel Petrus und Paulus. Am geschnitzten Auszug Darstellung der Trinität und Engel. Chronogramm mit Dat. 1782. Ein bei zeitweiligem Abbau des Altars 2007 sichtbares, um 1370/80 entstandenes gemaltes Volto Santo-Bild mit Stifterfigur wieder abgedeckt. – Achtseitiger Taufstein des 16. Jh. (?). – Im Ostpolygon Schnitzfigur der Maria mit Kind, um 1410/20, im Nordschiff lebensgroßes Kruzifix, 4. V. 15. Jh. – Hölzernes Tischpult der 2. H. 14. Jh., ausgelagert; auf der geritzten Platte
Erfurt, profanierte Sakralbauten
sierten Backsteins in der mittelalterlichen Baukunst Thüringens. – Im Nordseitenschiff urspr. der südl., zweigeschossige Kreuzgang eingebaut, an den sich im Westen das innere Schiff der zweischiffigen Annenkapelle anschloss. Beide Bauteile 1842–52 beseitigt; die paarweise eingesetzten Kreuzgangsfenster erhalten. Die durch den Vorgängerbau bedingte Einziehung des Kreuzgangs in das Kirchenschiff wohl vorbildhaft für die Augustiner- und die Reglerkirche. – Das Innere von Chor und Von-der-Sachsen-Kapelle größtenteils kreuzrippengewölbt. Zwischen den vom Boden aufsteigenden Gewölbediensten im Chorpolygon flache Wandnischen, gegliedert durch paarweise eingesetzte, genaste Spitzbögen; im Gewölbe Schlusssteine mit Blattwerkornamentik. Im Ostteil der Kapelle ein Sterngewölbe mit Wappensteinen an den Schnittstellen der Rippen, die übrigen Schlusssteine im westl. Teil mit christlichen Symbolen und weiteren Wappen.
Zum wertvollsten Besitz der Kirche gehören die aus dem 13. Jh. stammenden Glasfenster . Es sind Teile von Bildzyklen, die das Leben des 1228 heiliggesprochenen Ordensgründers Franziskus von Assisi zu Leben und Passion Christi in Beziehung setzen. Obwohl die stilkritische Datierung auf 1230/40 wie auch der naheliegende Zusammenhang mit italienischer Glasmalerei (Oberkirche von Assisi) umstritten ist, nimmt der Franziskuszyklus als ältester, auf dem Gebiet des deutschrömischen Reiches erhaltener in der Franziskus-Ikonographie einen besonderen Platz ein. Bei der Chorverglasung im 14. Jh. wurden die Scheiben in einen neuen programmatischen Zusammenhang gebracht. Ihre gegenwärtige Anordnung in den drei östl. Chorfenstern erfolgte nach einer Rest. 1967 z. T. unter Beibehaltung des spätmittelalterlichen Bleiverbunds. – Der Umfang der Zyklen und die Fenstergröße sind unbekannt, doch gehen alle Rekonstruktionsversuche von einer gestaffelten Dreifenstergruppe aus, deren Zentrum das sog. Wurzel-Jesse-Fenster bildete. Daneben befanden sich das sog. Christus-Fenster und das Franziskus-Fenster. Die unterschiedlichen Formen der Bildmedaillons erlauben eine genaue Zuordnung der erhaltenen Scheiben. Zum Wurzel-Jesse-Fenster gehören drei große und sechs kleine Medaillons mit dem Stammvater Jesse (1), Verkündigung und Geburt Jesu (2), Anbetung der Könige (3), Darbringung im Tempel und Taufe im Jordan (4), Höllenfahrt, Auferstehung (6) und Himmelfahrt (7). Im vorletzten Hauptregister befand sich wohl eine Kreuzigung (5), von der jedoch nichts erhalten ist. – Aus dem Christus-Fenster sind vier große Medaillons mit der Verklärung Christi (8), Gastmahl des Simon (9), Einzug in Jerusalem (10), Auferweckung des Lazarus (11), außerdem Teile von vier Medaillonumschriften sowie Zwickelfüllungen mit Sitzfiguren und Spruchbändern erhalten. – Im Franziskus-Fenster waren u. a. die Bestätigung der Franziskanerregel durch Papst Honorius III. (12) und die Stigmatisation des hl. Franziskus (13) angebracht. Fragmente einer Szene mit dem Tod des Heiligen (14) im Angermuseum aufbewahrt. Die im Einzelnen ungewöhnliche Ikonographie des Franziskusfensters entstand vielleicht auf mittelbare Anregung des Schöpfers der ersten
Erfurt, profanierte Sakralbauten
Erfurt, Chor der Barfüßerkirche, Glasfenster des 13. Jh. (Rekonstruktion nach Drachenberg/Maercker/Schmidt 1976)
Die Nummerierung bezieht sich auf die im Text genannten Scheiben.
Franziskus-Vita Thomas von Celano, dem der Erfurter Guardian Jordanus von Giano 1230 in Italien begegnet war. – Von den im 1. V. 14. und im 15. Jh. eingesetzten Chorfenstern sind Ornamentscheiben und drei szenische Darstellungen erhalten.
Ausstattung. Großes Altarretabel mit zwei schwenkbaren Flügelpaaren, ehem. Hauptaltar der aufgegebenen Bartholomäuskirche ( Türme abgebrochener Kirchen). 1445/46 von den Bildschnitzern Hans von Schmalkalden und Jakob von Leipzig gefertigt und von Michael Wiespach sowie einem zweiten, anonymen Maler aus Göttingen und anderen gefasst bzw. bemalt. Auf den Außenseiten der beidseitig bemalten äußeren Flügel vier stark fragmentierte Szenen. Nach der ersten Wandlung zwölf Heilige in Baldachinarchitektur mit Prophetenbüsten und Engelschören. Auf den Innenseiten des zweiten Fügelpaars urspr. je acht geschnitzte Heiligenfiguren in zwei Registern. Im Mittelschrein Marienkrönung, seitlich Reliefs mit Geburt, Darbringung im
Meuselwitz, Orangerie
Mittelpavillon durch zwei hohe, von Pilasterpaaren flankierte Bögen nach Norden und Süden geöffnet; darüber reiche Bekrönung (Wappenkartuschen und Ziervasen) sowie geschwungene, vom Quadrat ins Achteck übergehende Haube mit Laterne. An den ehem. für die Winterung der Pflanzen genutzten Flügeln südseitig hohe rundbogige Öffnungen, die Nordseite geschlossen. Die Eckpavillons durch Pilasterpaare, Portale und Dreiecksgiebel sowie Mansarddächer betont. Das Gebäude von Metopen-Triglyphen-Fries umzogen. Hervorgehobene Bauteile in Naturstein, Wandflächen und Pilaster hell verputzt. – Kosmologisches Skulpturenprogramm. Am Mittelpavillon symbolisieren Büsten die vier Himmelsrichtungen mit den zugehörigen Erdteilen; innen überkuppelte Rotunde mit in Nischen eingestellten Allegorien der vier Jahreszeiten. An den Flügeln die zwölf Sternbilder des Tierkreises. – Am Parkeingang zwei Torhäuser des 18. Jh.
MIELESDORF Stadt Tanna, Saale-Orla-Kreis (Lehfeldt XII). Karte 12 Ev. Kirche. Chorturmkirche; in der Anlage wohl von einer Gründung des Deutschen Ordens in der 2. H. 13. Jh. Nach Brand 1719 durchgreifender Um- oder Neubau. Innen aus dieser Zeit eingeschossige Empore, Loge und Kanzelaltar. Altarkreuz und Dornenkrone auf dem Kanzeldeckel von Elly-Viola Nahmmacher. –Orgel 1916 von Ernst Poppe & Sohn. – Glocke 1856 von Johann Gotthelf Große.
MILBITZ Stadt Königsee, Kr. Saalfeld-Rudolstadt (Lehfeldt XX). Karte 6
Ev. Kirche St.Nikolaus. Saalkirche mit dreiseitigem Chorschluss und eingezogenem Westturm, weitgehender Neubau von 1767–81 anstelle eines Vorgängers. – Innen bauzeitlich. Dreiseitige zweigeschossige Empore, über dem Mittelraum Spiegelgewölbe. Qualitätvoller, dem Verlauf des Chorpolygons folgender Emporenkanzelaltar mit Sakristeigehäuse, 1779. Taufständer mit Lesepultdeckel. Stattliche Orgel mit üppig verziertem Prospekt, im Kern 1740 von Elias Schulze, 1774 durch Andreas Schulze umgebaut; weitgehend umbauzeitlich erhalten. – Glocke 1910/14 von Franz Schilling Söhne.
MILBITZ Stadt Rudolstadt, Kr. Saalfeld-Rudolstadt (Lehfeldt XIX).
Karte 6
Ev. Kirche. Rechtecksaal mit eingezogenem Westturm. – Der westl. Teil des Saals von einem romanischen Bau. Im sp. 13./1. H. 14. Jh. der bündig anschließende Chor angesetzt. 1696 durchgreifender Umbau. Der Turm 1751 errichtet. – Auf der Südseite des Saals ein Grabstein von 1371 vermauert. – Im Saal Brettertonne, Doppelempore und schlichte Kanzelwand. Orgel um 1860 von Friedrich Wilhelm Dornheim. – Glocke 1922 von Franz Schilling Söhne.
MILDA Saale-Holzland-Kreis (Lehfeldt VII).
Karte 6
Ev. Kirche St. Jakob. Chorturmkirche; der Saal im Kern romanisch mit kleinem Rundbogenfenster an der Südseite. Im 13./14. Jh. Turm angebaut. Um 1500 kreuzgratgewölbte Sakristei urspr. mit Gruft im Untergeschoss angefügt, vermutlich 1572 zu einem Raum vereinheitlicht. Wohl von einem Umbau 1688 die Spitzbogenfenster im Erdgeschoss des Turms. Der Saal nach Brand 1793 bis 1799 wieder aufgebaut. 1830 und 1902 Renovierungen. – Innen Flachdecke, umlaufende, an den Langseiten zweigeschossige Empore mit Kanzel sowie Stände beidseits des Altars, sämtlich von der Neuausstattung E. 18. Jh. Der mit steinerner Tonne überwölbte ehem. Chor durch Einbau aus Holz abgetrennt. – Orgel 1891 von Adam Eifert. – Glocke 1796 von Gebr. Ulrich. – Großräumig befestigter Kirchhof mit rechteckiger, bis 3 m hoher Ummauerung; an der Südostecke runde Streichwehr mit drei Schlitzscharten und ebenerdigem Zugang, der durch eine partiell erhaltene Mauer mit dem östl. Tor der einstigen Ortsbefestigung verbunden war. In der Kirchhofmauer nach allen Himmelsrichtungen insgesamt acht Schlitz- und drei Hosenscharten.
Ehem. Pfarrhaus (Dorfstr. 1). Urspr. fachwerksichtiger Oberstock von 1673 (d) über z. T. älterem massivem Erdgeschoss bez. 1555, Anbau mit Küche 1701 (d).
NEUSITZ Gem. Uhlstädt-Kirchhasel, Kr. Saalfeld-Rudolstadt (Lehfeldt III).
Karte 6
Ev. Kirche. Rechteckbau mit Mansarddach und eingezogenem Westturm, 1732 . Innen Emporensaal mit trapezförmiger Bretterdecke und bauzeitlicher Ausstattung. Kanzelaltar mit Sakristeigehäuse und Ostempore; der Aufbau von Kruzifix, um 1500 , bekrönt. An der Westempore Altarretabel , 1515 dat., von einer Saalfelder Werkstatt (Hans Gottwald von Lohr?): im überhöhten Mittelteil des Schreins Strahlenkranzmadonna, zu ihren Seiten hll. Markus und Wenzeslaus sowie Blasius und Erasmus. An den Innenseiten der Flügel hll. Katharina, Anna Selbdritt und Barbara sowie Laurentius, Sebastian und Cyriacus. Über sämtlichen Schnitzfiguren aus Astwerk gebildete Baldachine. Die Aufsatzbretter der Flügel mit je einem musizierenden Engel bemalt. Auf den Außenseiten Verkündigungsszene und Geburt Christi, mit Gottvater und jubilierenden Engel auf den Aufsatzbrettern. Predellengemälde Christus zwischen den zwölf Aposteln. Eine vielleicht urspr. zugehörige Kreuzigungsgruppe jetzt auf dem Altar. – Orgel 1792 von Christian August Gerhard.
NEUSTADT AN DER ORLA Saale-Orla-Kreis (Lehfeldt XXIV). Karte 7 Kleinstadt in der Orlasenke. Knapp 1 km nördl. der Burg Arnshaugk gründete die dort seit M. 13. Jh. ansässige Linie der Herren von Lobdeburg eine kleine, planmäßige Stadtanlage. Nach Aussterben des Familienzweigs 1289 wettinisch, ab 1571 albertinisch, 1657–1718 Sekundogenitur Sachsen-Zeitz; 1815 an Sachsen-Weimar-Eisenach. 1294 Gründung eines Augustinereremitenklosters, 1449 des Hospitals St. Laurentius ( Hospitalkirche). Die abseits vom Markt gelegene Stadtkirche St. Johannis war bis 1528 Filial der Großpfarrei Neunhofen. Frühe Einführung der Reformation; der Klosterkonvent als einer der ersten in Thüringen aufgelöst. Wirtschaftliche Blüte im Spätmittelalter, vor allem durch das bis in die Neuzeit dominierende Tuch- und Ledergewerbe. Seit wettinischer Zeit mit der Burg Arnshaugk Verwaltungsmittelpunkt zunächst eines Amtes, später des Neustädtischen Kreises, 1850–1922 des Bezirks Neustadt. Im 19./20. Jh. Industrialisierung, vor allem Leder-, Textil- und Metallwaren; 1871 Bahnanschluss.
Stadtgestalt . Kernstadt mit mittelalterlich geprägtem, regelmäßigem Grundriss und einer durch Markt und Rathaus gekennzeichneten Mitte. Annähernd rechteckiger Umriss; von der Stadtbefestigung mit drei Toren nur Reste erhalten (u. a. südöstl. des Schlosses). Die Hauptdurchgangsstraße, jetzige Ernst-Thälmann-Straße, markiert den Verlauf einer historischen Handelsroute von Gera nach Saalfeld; ihr innerstädtischer Abschnitt verband das westl. und das östl. Stadttor miteinander. An der Hauptstraße jeweils nördl. das Rathaus mit Marktplatz und die Pfarrkirche mit Kirchplatz; der zwischen die-
Neustadt an der Orla
Neustadt an der Orla
1 Kirche St. Johannis d. T.
2 Hospitalkirche St. Laurentius
3 ehem. Kirche des Augustinerklosters
4 Schloss
5 Rathaus
6 Fleischbänke
7 sog. Lutherhaus
sen Plätzen gelegene Baublock von einer schmalen Passage mit den Fleischbänken durchstoßen. Der Marktplatz L-förmig mit kleinem südöstl. Baublock, sog. „Marktstock“ (die jetzige Bebauung von 1997). Im Südosten der Kernstadt in Randlage die ehem. Kirche des Augustinereremitenklosters und das auf dem einstigen Klosterareal errichtete Amtshaus, nachmalige Schloss. – Spätmittelalterliche Vorstadtbildungen. Nördl. nahe der Orla das ehem. Gerberviertel, westl. die Hospitalkirche mit Friedhof. – Aus der Blütezeit der Stadt im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit ein umfangreicher Baubestand erhalten. Die spätgotische Pfarrkirche prägt mit hohem Satteldach und Turm die Stadtsilhouette; die Schmuckgiebel des gleichfalls spätgotischen Rathauses sind Blickfang im Straßenraum der Hauptachse. Bemerkenswert auch die aus dem 16. Jh. überlieferten Fleischbänke und eine beachtliche Anzahl an frühneuzeitlichen Wohnbauten, in stattlicher Ausprägung vor allem am Markt (mit sog. Luther-
Orla
KÜNSTLERVERZEICHNIS
Die Jahreszahlen in Klammern direkt hinter dem Namen sind Lebensdaten. Bei Künstlern, deren Lebensdaten im Rahmen der Überarbeitung nicht ermittelt werden konnten, beziehen sich die Jahreszahlen in Klammern hinter der Berufsbezeichnung auf das bzw. die in diesem Band erwähnten Werke oder auf den in einschlägigen Quellen mitgeteilten Wirkungszeitraum. Die klammerlosen Jahreszahlen hinter den Namen von Werkstätten, Firmen und Büros geben deren Gründungsjahr oder Dauer des Bestehens an. Die Ortsangaben bezeichnen Aufenthaltsorte der Künstler, vorrangig im Hinblick auf ihr Wirken in bzw. ihren Einfluss auf Thüringen.
Abentbrot, Bertold, Glockengießer, (zw. 1441 u. 1461), Erfurt 170
Abentbrot, Hans, Glockengießer, (zw. 1497 u. 1533), Erfurt 188, 338, 342, 487, 852
Adam, Anton, Architekt, (1727/28), Dresden 324
Ahammer, Andreas, Maler, (1585) 618
Ahrens, Walter, Architekt, (1939), Erfurt 227
Albiker, Karl (1878–1961), Bildhauer, Dresden 337
Albini, Adam Rudolph (1719–97), Stuckateur, Würzburg 331
Albrecht, Hans, Stuckateur, (1686) 204
Albrecht, Johann (gest. 1719), Orgelbauer, Römhild, Schleusingen, Coburg 183
Albrecht, Johann Friedrich (1781–1849), Glockengießer; ab 1832 Albrecht & Sohn (Johann), Coburg 589
Altenbourg, Gerhard (1926–89), Maler, Grafiker, Altenburg 25, 31
Altenburg, Moyses von Moyses von A.
Apel, Hofgärtner, (1701–04), Altenburg 29
Appelt, Karl-Heinz (1940–2013), Bildhauer, Jena, Kahla 309, 417
Arens, Johann August (1757–1806), Architekt, Hamburg 784, 786, 787, 815
Arndt, Alfred (1898–1976), Architekt, Weimar, Probstzella, Darmstadt 410, 589, 590
Arnim, Bettina von (1785–1859), Schriftstellerin, Berlin, Wiepersdorf 799
Arnold, Walter (1909–79), Bildhauer, Dresden 819
Auerbach, Maximilian (1861–?); Münchener Glasmalerei M. Auerbach & Co, (1893/94), Berlin 36
Aumüller, Johann Christoph, Orgelbauer, (zw. 1777 u. 1812), Hirschberg 460
Bach, Anita (1927–2021), Architektin, Weimar 797
Bach, Anton, Stuckateur, (1782/83), wohl aus Böhmen 331
Bachert, Gebr., Glockengießerei, unter dieser Bez. 1904–68 in Karlsruhe 274, 575
