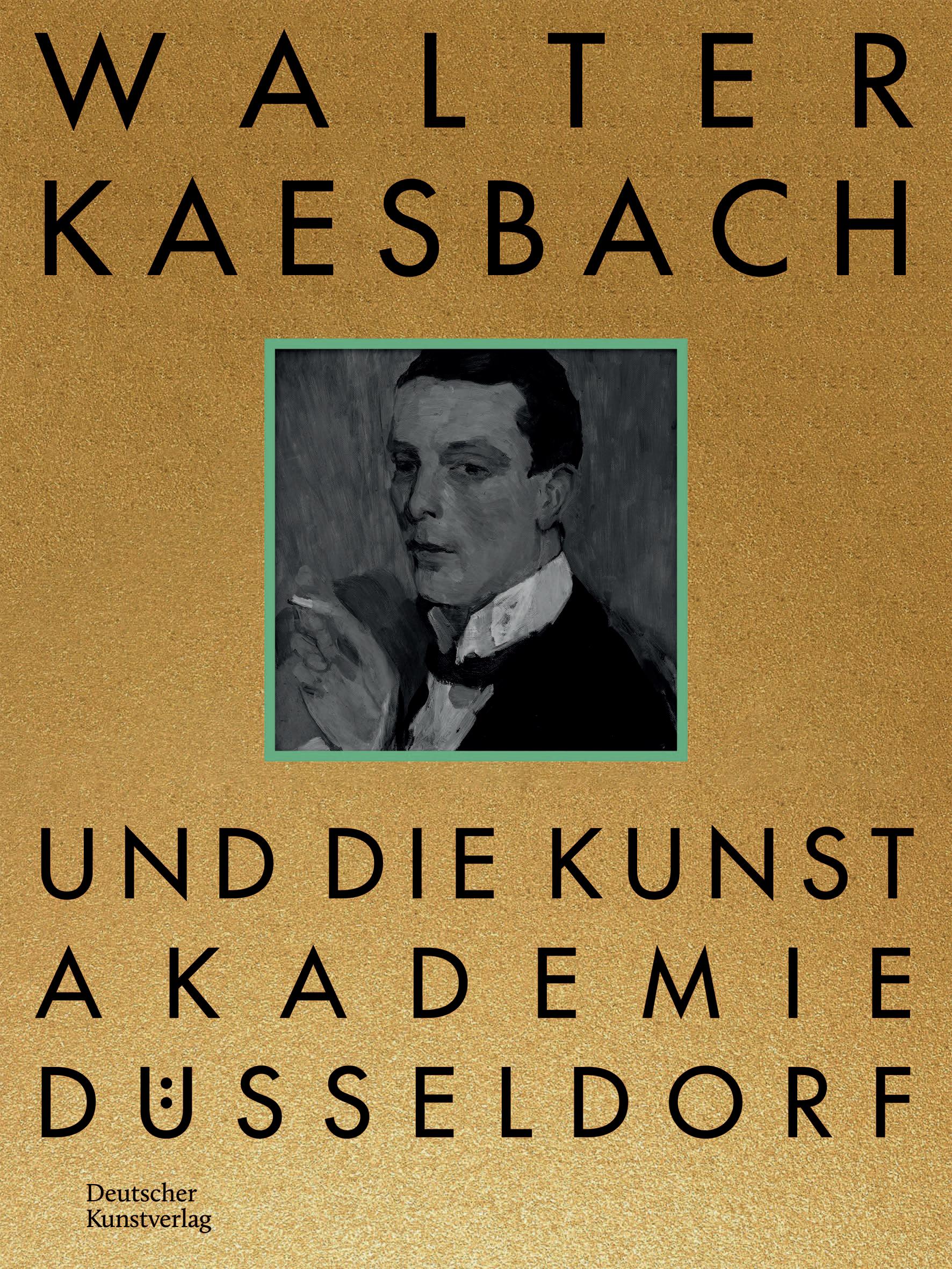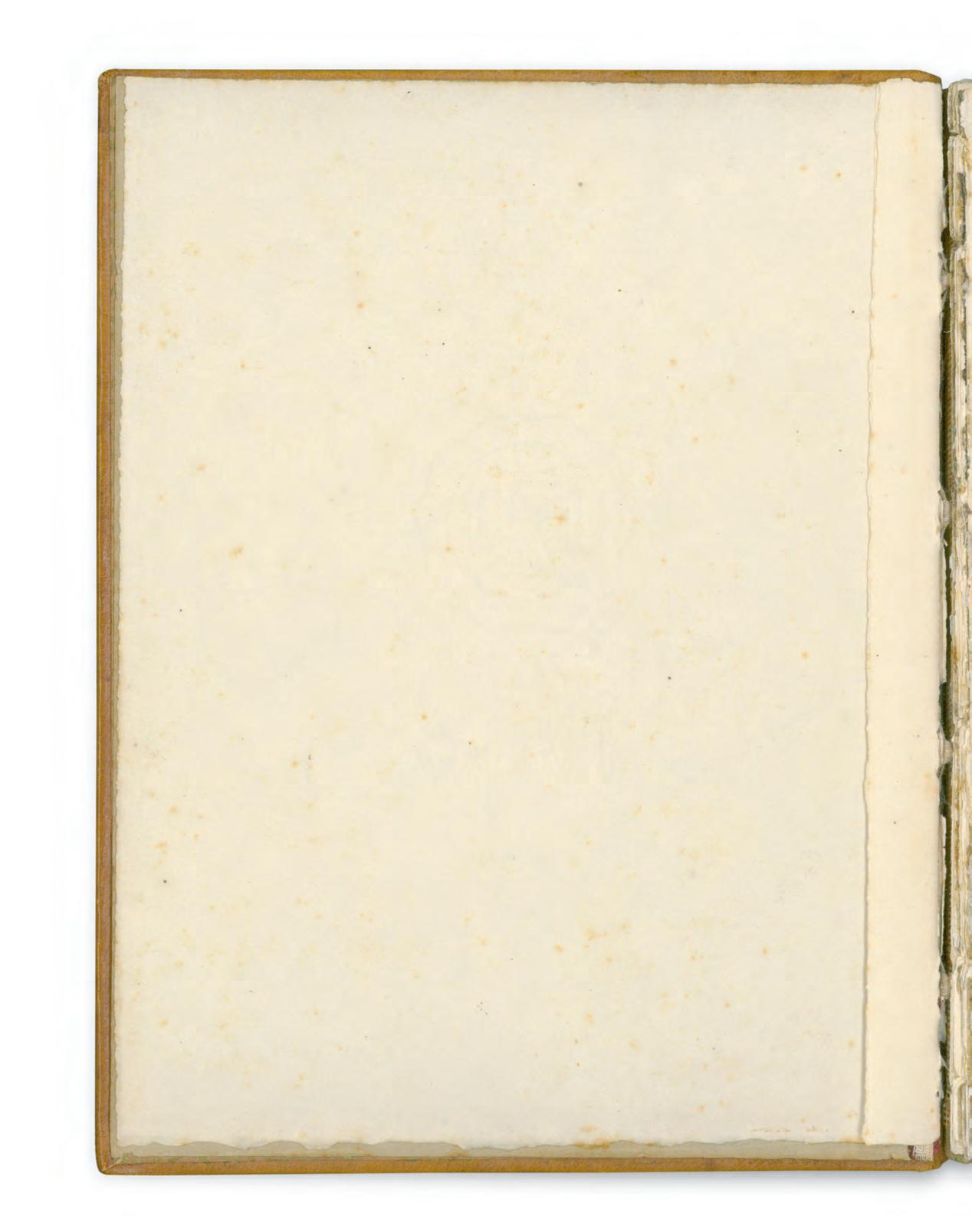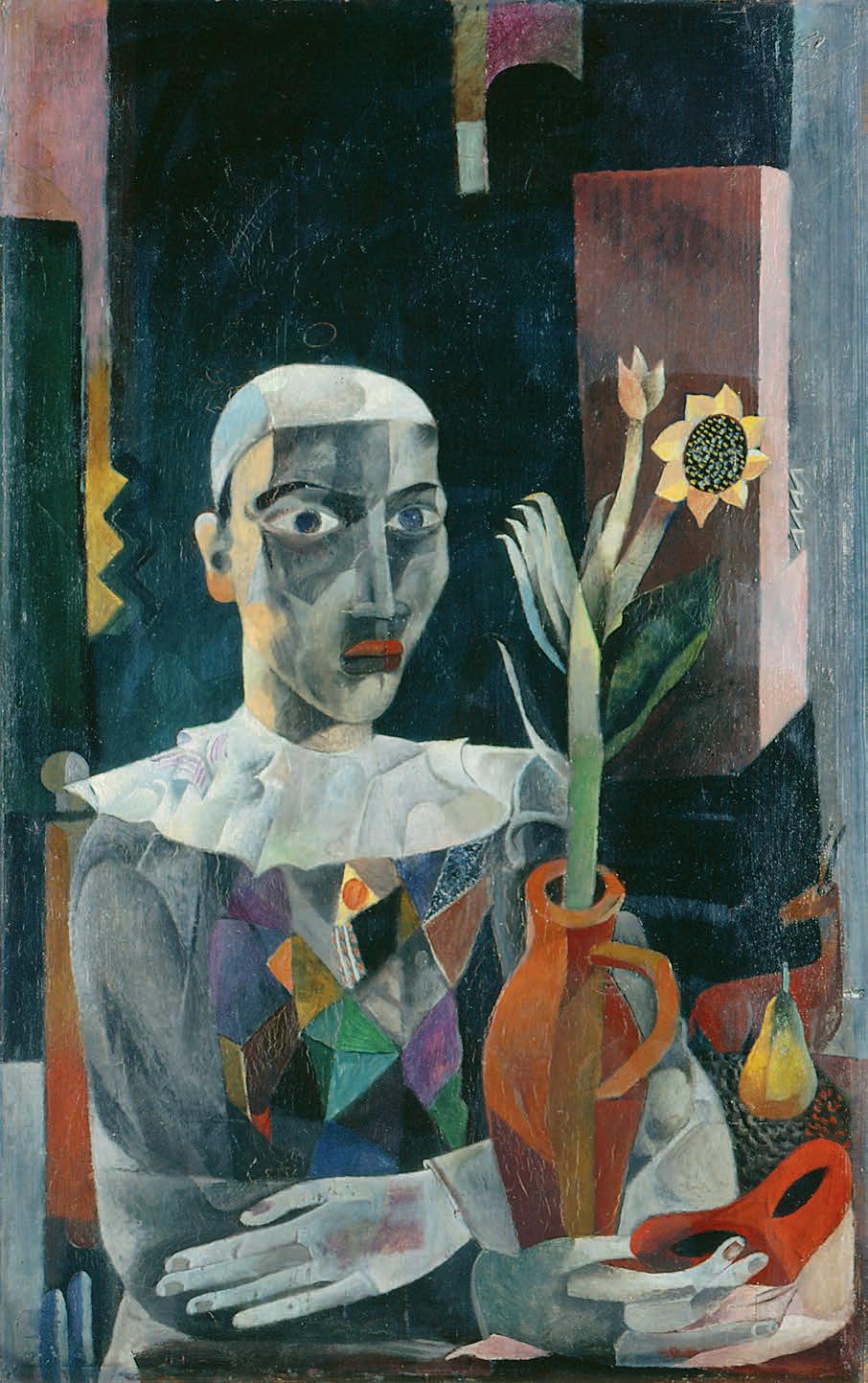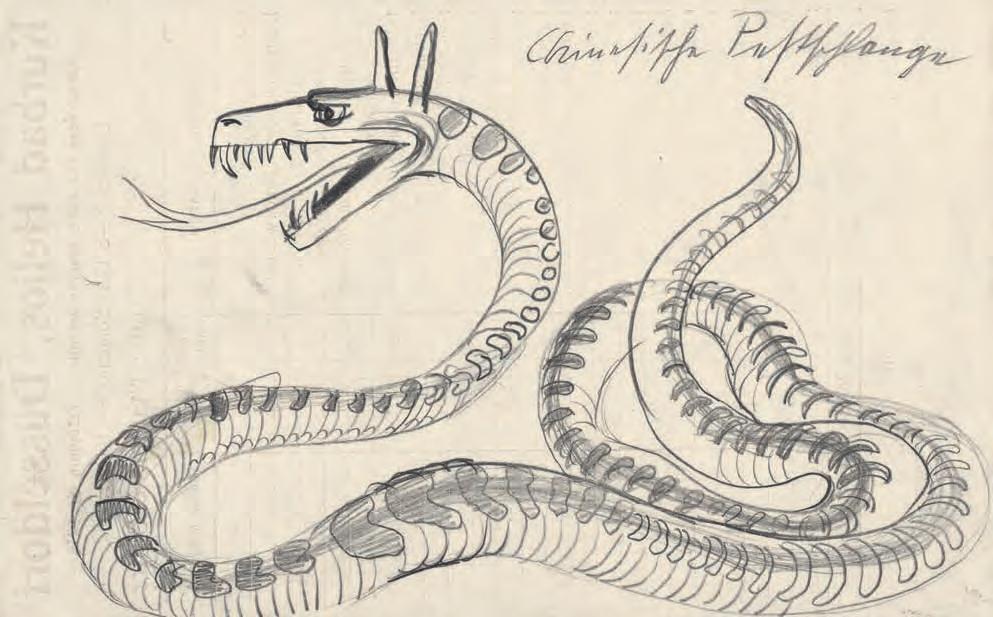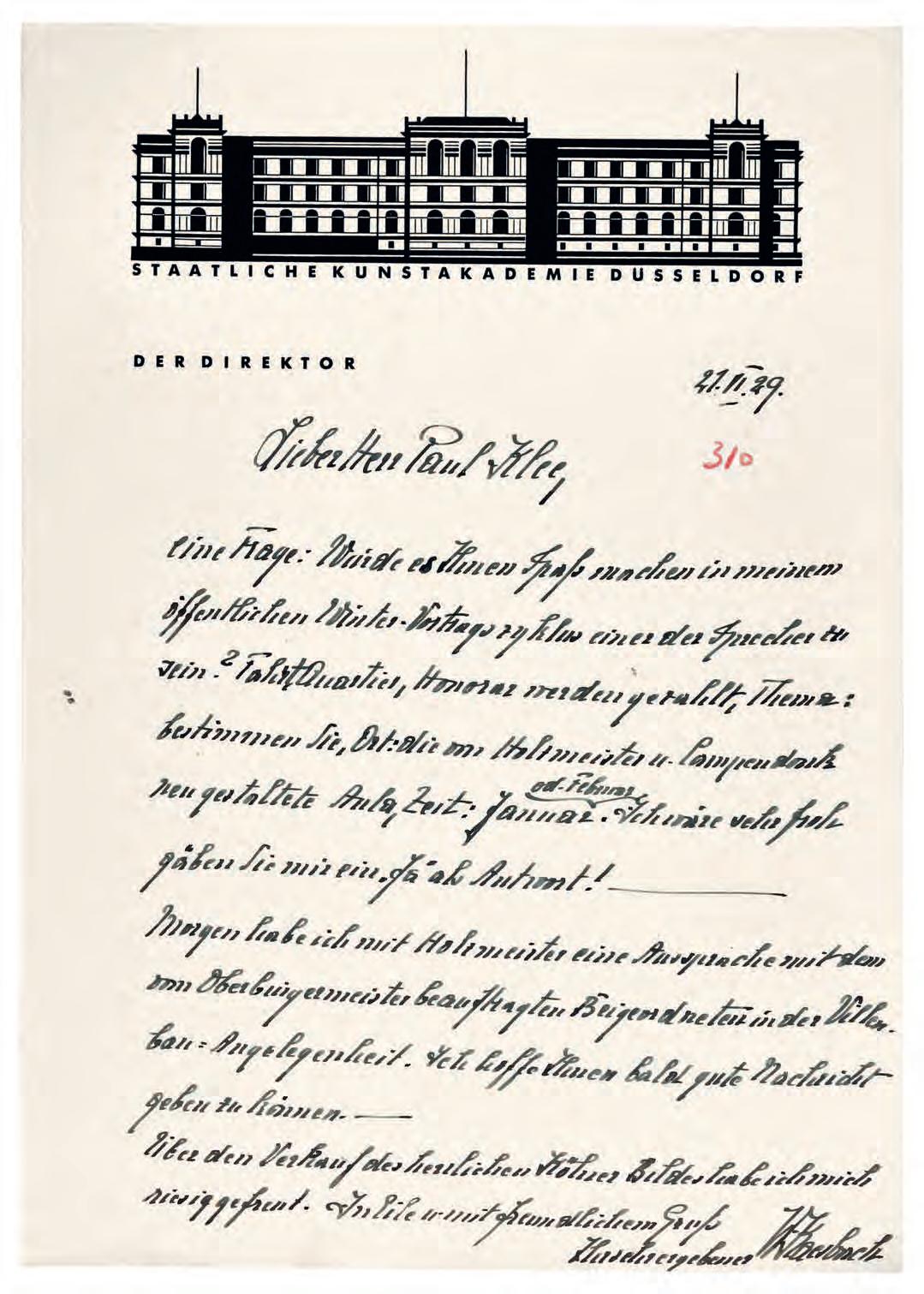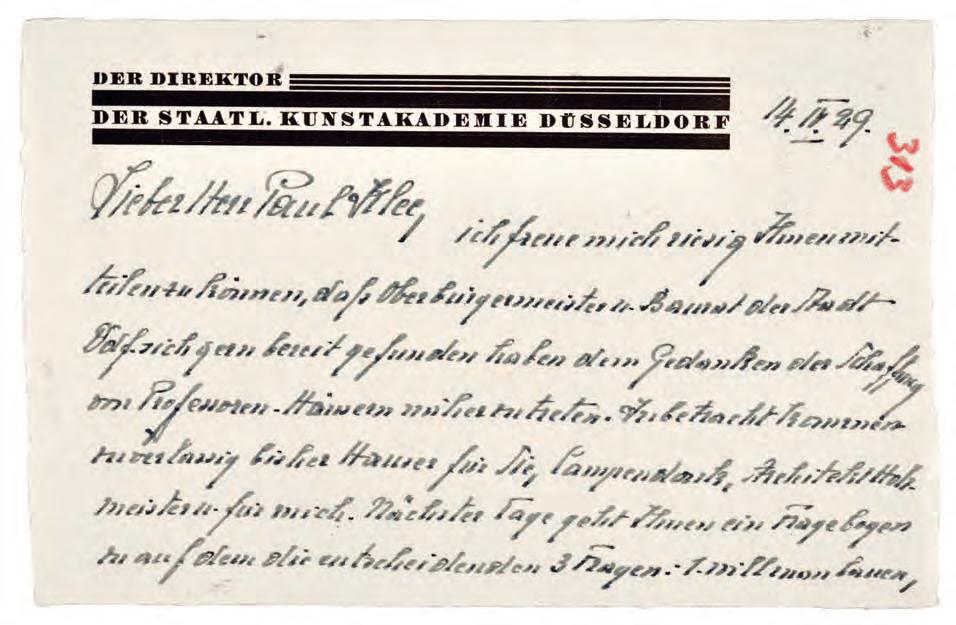ANNA SIMONS
266

267
Dante Alighieri, La Divinia Commedia, Bremer Presse, München 1921


268
Dante Alighieri, La Divinia Commedia, Bremer Presse, München 1921

269
Dante Alighieri, Werke. Deutsch von Rudolf Borchardt, Bremer Presse, München 1923–1930
Jankel Adler
Selbstbildnis
1924
Mischtechnik auf Leinwand und Holz
68,5 × 56,5 cm
Van der Heydt-Museum
Wuppertal
© Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler
Stillleben mit Fisch
Um 1926–30
Mischtechnik auf festem Papier
63,7 × 49 cm
Privatsammlung
Foto mit freundlicher
Genehmigung Villa Grisebach, Jankel Adler
Ohne Titel
Um 1927
Mischtechnik auf leichtem Karton
45,3 × 31,5cm
Privatsammlung
Foto © Mit freundlicher
Genehmgung Van Ham Köln; Jankel Adler
Stillleben mit Fisch, Flasche und Zeitung
1928
Tempera, Sand und Gips mit Abklatsch einer Zeitungsseite auf grauem Velin
48 × 64 cm
Peter Karbstein
Stehendes Mädchen
Um 1929
Mischtechnik mit Sand auf Papier
63,5 × 48,5 cm
Van der Heydt-Museum
Wuppertal © Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler
Durch die Hand Schauender
Um 1935
Aquarell
35,9 × 24,2 cm
Van der Heydt-Museum
Wuppertal
© Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum, Wuppertal, Jankel Adler
Heinrich Campendonk
Otto Dix
Mann und Maske (L’ Homme en rouge) 1922
Öl auf Leinwand
115 × 132 cm
Kunstmuseum Bonn
Foto: Reni Hansen –ARTOTHEK
© VG Bild-Kunst Bonn 2024
Pierrot mit Sonnenblume 1925
Öl auf Leinwand
95 × 59 cm
Kunstmuseen Krefeld
Foto: Volker Döhne –ARTOTHEK
© VG Bild-Kunst Bonn 2024
Pierrot mit Schlange
1923
Hinterglasmalerei
44 × 38,5 cm
Kunstmuseen Krefeld
Foto: Volker Döhne –ARTOTHEK
© VG Bild-Kunst Bonn 2024
Roter Hirte mit Tieren
1928
85,5 × 100,3 cm
Erworben 1965 als Dauerleihgabe des Landes NRW (ursprünglich 1928
Geschenk Campendonks an die Kaesbach-Stiftung; 1937 beschlagnahmt)
Inv. Nr. 7948
Museum Abteiberg Mönchengladbach, Foto: Achim Kukulies © VG Bild-Kunst Bonn 2024
Selbstporträt im Profil
1922
Lithographie
211 × 150 mm, im Stein signiert und datiert
Privatsammlung, Fischbachau
Der Selbstmörder (Erhängter)
1922
Radierung
351 × 282 mm, signiert, datiert, bezeichnet »No.I«, numeriert »15/50«, in der Platte signiert Privatsammlung, Düsseldorf
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Alte Kokotte
1922
Aquarell über Tusche
493 × 398 mm signiert, datiert, rückseitig betitelt
Privatsammlung, Fischbachau
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Alte Frau
1922
Aquarell und Deckfarben über Tusche 490 × 369 mm, signiert und datiert unten links
»DIX 1922«, darunter gelöschte »191..« oder »121..«, rückseitig betitelt und gewidmet »Für Hans & Tamolly«, ebenfalls rückseitig von »Dr. Koch« signiert und Stempel »Dr. med. Hans Koch Facharzt für Nierenu. Blasenleiden Düsseldorf Bismarckstr. 48 Fernspr.« Privatsammlung, Düsseldorf
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
305
Katalog
Werner Heuser
Paul Klee
Maskenfisch um 1922
Bleistift
217 × 135 mm, betitelt unten Privatsammlung, Fischbachau Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars
»Kurbad Helios, Düsseldorf«.
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Schmetterling um 1922
Bleistift
135 × 217 mm, betitelt rechts Privatsammlung, Fischbachau Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars
»Kurbad Helios, Düsseldorf«.
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Daktylosaurus um 1922
Bleistift
135 × 217 mm, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf
Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars
»Kurbad Helios, Düsseldorf«. Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Chinesische Pestschlange um 1922
Bleistift
135 × 217 mm, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf Tierzeichnung für die Kinder von Martha und Hans Koch auf der Rückseite eines Verschreibungsformulars »Kurbad Helios, Düsseldorf«. Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Kinderspiele
1923
Bleistift
292 × 193 mm, signiert unten rechts, betitelt oben rechts Privatsammlung, Düsseldorf
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Krähender Hahn
1923
Bleistift
291 × 193 mm, signiert unten rechts
Privatsammlung, Fischbachau
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Schloß Randegg
1925
Radierung 145 × 195 mm, signiert, datiert, betitelt, numeriert »1/36«
Privatsammlung, Fischbachau
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf;
VG Bild-Kunst Bonn 2024
Schloß Randegg
1925
Original-Zinkplatte
Privatsammlung, Fischbachau
Foto © ehem. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf; VG Bild-Kunst Bonn 2024
Silberpfennig
1929
Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Nachlass Werner Heuser
Foto © Tim Riecke
Brot tragende Zigeunerin
1932
Öl auf Leinwand
100 × 75 cm
Nachlass Werner Heuser
Foto © Tim Riecke
dein Ahn ? 1933
Kleisterfarbe auf Papier, vom Künstler auf Karton aufgelegt 48,4 × 35,3 cm
Privatbesitz
Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin
Hörender 1934
Kleisterfarben (Messerarbeit) und Bleistift auf Kanzleipapier
32,7 × 21 cm
Privatbesitz
Foto: Mit freundlicher
Genehmigung der Villa Grisebach
auswandern, 1933, 181 Kreide auf Papier auf Karton 32,9 × 21 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
der Künftige, 1933, 265
Kleisterfarbe und Kohle auf Papier auf Karton
61,8 × 46 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Kopf eines Märtyrers, 1933, 280 Aquarell auf Grundierung auf Gaze auf Karton; originaler Rahmen
26 × 20,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Leibesübung, 1933, 87 Kreide auf Papier auf Karton 15,3 × 32,3 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Anklage auf der Strasse, 1933, 85 Kreide auf Papier auf Karton 16,9 × 25 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Menschenjagd, 1933, 115 Bleistift auf Papier auf Karton 23/23,2 × 32,3 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
306
Geheim Richter, 1933, 463
Kleisterfarbe auf Papier auf Karton
41,3 × 28,9 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Lumpen gespenst, 1933, 465 Kleisterfarbe auf Aquarell auf Papier auf Karton
48 × 33,1 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
auch »ER« Dictator!, 1933, 339 Bleistift auf Papier auf Karton
29,5 × 21,8 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
von der Liste gestrichen, 1933, 424 Ölfarbe auf Papier auf Karton
31,5 × 24 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
die Ratlosen, 1933, 186
Bleistift auf Papier auf Karton
32,9 × 20,9 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Brief Walter Kaesbach an Paul Klee, [11.1924]
Seite: 1/1
27,9 × 22 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 37
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Grußkarte der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee
14.4.1929
Seite: 1/«
11,4 × 17,6 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 07
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Brief der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee
30.3.1929
Seite: 1/2
27,1 × 21,8 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 05
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Postkarte Walter Kaesbach an Paul Klee
16.05.1933
Seite: 1/2
10,4 × 14 cm
Signatur: SFK Ko P Kae 1
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Brief der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee
21.06.1929
Seite: 1/1
29,6 × 21 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 09
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Postkarte der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach) an Paul Klee
15.3.1929
Seite: 1/2
10,5 × 14,8 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 04
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum
Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Brief (Entwurf) Paul Klee an die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (Walter Kaesbach)
03.1929
Seite: 1/3
33 × 17,1 cm
Signatur: SFK Ko I Düs 27
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv
Ewald Mataré
Frau mit Rindern 1930/31
Bronzerelief
124 × 183 cm, Gesamthöhe: 177cm Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie. 1950 erworben durch das Land Berlin
Foto © Dominik Berg, MontMedia, Luxenburg, © Ewald Mataré, VG Bild-Kunst 2024
Stehende Kuh
»Grosse Terrakotta-Kuh« 1939
Terrakotta, hellgrauer, schamottierter Scherben. Aufgebaut und geschnitten. Mit heller Engobe geschlämmt und braunen Eisenoxyden bemalt
22 × 40 cm
Akademie-Galerie –Die Neue Sammlung
Foto: Kunstakademie Düsseldorf
© Ewald Mataré, VG Bild-Kunst Bonn 2024
Brief Walter Kaesbach an Ewald Mataré, Düsseldorf, 4.4.1932
Inv. Nr. 2020-X-17 (0001)
Museum Kurhaus Kleve –Ewald Mataré-Sammlung, Dauerleihgabe des Freundeskreises Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e. V., Vermächtnis Sonja Mataré, Meerbusch-Büderich https://sammlung.mkk.art/ werke/73364
Foto: Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung Digitalisierung durch Museumsmitarbeiter*innen)
© Ewald Mataré, VG Bild-Kunst Bonn 2024
Oskar Moll
Sonnenblumen
(mit Fensterladen)
Um 1934
Öl auf Leinwand
80,5 × 69,7 cm
Privatbesitz Bonn
Foto © Mit freundlicher Genehmigung Kunsthaus Lempertz Köln
Schwarze Vase mit Mohn
Um 1920
Öl auf Leinwand
64 × 57cm
Privatsammlung
Foto © Mit freundlicher
Genehmigung Villa Grisebach
Stillleben mit weißem Krug und Kachelmuster
Um 1946
Öl auf Pappe
49 × 67,3 cm
Kunstpalast Düsseldorf
Grunewaldlandschaft im Winter 1915
Öl auf Leinwand
80 × 69,3 cm
Privatsammlung
Foto © Mit freundlicher Genehmigung Villa Grisebach
Palme am Fenster
1924
Öl auf Leinwand
80 × 70 cm
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg
Leihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München
Pinakothek der Moderne
Foto: Jochen Remmer – ARTOTHEK
307
Alexander Zschokke
Selbstbildnis mit Hut
Um 1909
Öl auf Leinwand
70 × 60 cm
Kunstmuseen Krefeld
Volker Döhne –ARTOTHEK
Astern im Westerwälder Krug
1909
Öl auf Leinwand
100 × 80 cm
Kunstpalast Düsseldorf
Kunstpalast © Foto ARTOTHEK
Jugendbildnis Dr. Walter
Kaesbach
Um 1909
Öl auf Karton
30 × 30 cm
Museum Abteiberg
Mönchengladbach, Foto: Achim Kuklies
Besuch
1913
Tempera, auf textilem Bildträger
210 × 260 cm
Kunstmuseen Krefeld –Volker Döhne –ARTOTHEK
Früchtestillleben in Blau
um 1913
Öl auf Leinwand
67,5 × 50,2 cm
Inv. Nr. 5962
Museum Abteiberg Mönchengladbach
Foto: Achim Kukulies
Bildnis Karl Kaesbach
1914
Kohle
45 × 30 cm
Privatsammlung
Sonnenblumen
um 1914
Öl auf Leinwand
36 × 66 cm
Inv. Nr. 5933
Museum Abteiberg
Mönchengladbach, Foto: Achim Kukulies
Dr. Walter Kaesbach
1918
Darstellungsmaß:
44,5 × 33,5 cm
Blattmaß: 60,3 × 45 cm
Kunstpalast Düsseldorf
© Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK
Studie zu der liegenden
Badenden II
1919
Aquarell
21,8 × 20,1 cm
Kunstmuseum Bonn
Foto: David Ertel
Studie zu der sitzenden
Badenden
1919
Schwarze Kreide, Pastell und Tusche
48 × 28,5 cm
Kunstmuseum Bonn, Foto: David Ertel
Porträt Alfred Flechtheim
1919
Lithographie
51,5 × 41,5 cm
Kunstpalast Düsseldorf
Kunstpalast © Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK
Landschaft mit Bäumen
1920er-Jahre
Gouache und Tempera auf Velin
68,2 × 49,7 cm
Privatbesitz
Foto: Mit freundlicher
Genehmigung Villa Grisebach
Blumenstillleben mit heller Vase
Um 1920
Öl auf Leinwand, alt doubliert
100 × 70,5 cm
Privatbesitz Frankfurt am Main
Foto: Mit freundlicher
Genehmigung Kunsthaus Lempertz Köln
Kapuzinerkresse in einer Glasvase
Um 1925
Öl auf Leinwand
80 × 50 cm
Kunstpalast Düsseldorf
© Foto: Stefan Arendt – ARTOTHEK
Sonnenblumen im Westerwälder
Krug vor blauem Grund
Um 1927
Öl und Tempera auf Leinwand
100 × 71 cm
Kunstpalast Düsseldorf
© Foto Horst Kolberg – ARTOTHEK
Selbstbildnis
Um 1927
Schwarze Kreide
61,1 × 45,2 cm
Kunstmuseum Bonn
Foto: David Ertel
Bildnis Walter Kaesbach vor rötlichem Grund
Um 1932
Öl auf Leinwand
60 × 48 cm
Kunstmuseum Bonn
© Foto: David Ertl – ARTOTHEK
Briefe Heinrich Nauen an Walter Kaesbach
Brief Walter Kaesbach an August Hoff
Briefe von Heinrich Nauen an Walter Kaesbach und andere Personen, aus den Jahren 1910–1925 und 1940 Archivmaterialien aus dem Bestand des Kunstmuseums Bonn, © Foto: David Ertel
Brief Heinrich Nauen an Erna Sieben
Museum August Macke Haus, Archiv
© Foto: David Ertel
Bildnisbüste Paul Klee
1931
Gips, bemalt
46 × 26 × 18 cm
Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf
Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf © Nachlass Zschokke
Bildnisbüste Heinrich Campendonk
1931
Bronze, gegossen
31 × 21 × 25,5 cm (ohne Sockel), Sockel: 7 × 13 × 14 cm
sign. (am Hinterkopf, Ligatur): AZ Stiftung Museum Schloss Moyland, MSM 20594
Foto: Kai Werner Schmidt © Nachlass Zschokke
308 Heinrich Nauen
Vorwort Donatella Fioretti: Abb. Georg W. Büxenstein & Comp (Fotografisches Atelier); W. Neumann & Co (Lichtdruck) Wohnhaus in Berlin, Brückenallee 4, Berlin, 1901. Papier; Hochformat; Lichtdruck, 25,6 × 20,7 cm. Inv.Nr. IV 643470 © Sammlung Stiftung Stadtmuseum Berlin. Vorwort Vanessa Sondermann: Walter Kaesbach in seinem Garten 1958, Foto: © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Fritz Eschen. Beitrag Vanessa Sondermann: Abb. 1 Walter Kaesbach und seine Kollegen an der Kunstakademie Düsseldorf, ohne Jahr (Bildnachweis: Kunstakademie Düsseldorf, Archiv); Abb. 2 Ernst Ludwig Kirchner, Kopf Redslob, 1924, Brücke-Museum, Dauerleihgabe der Pressestiftung TAGESSPIEGEL Gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin (Bildnachweis: Brücke-Museum, Gemeinfreies Werk); Abb. 3 Heinrich Nauen, Jugendbildnis Dr. Walter Kaesbach, um 1909, Museum Abteiberg Mönchengladbach (Foto: Achim Kuklies); Abb. 4 Programmauszug des Arbeitsrates für Kunst, Titelblatt nach einem Holzschnitt von Unbekannt, 1919, Berlin (Bildnachweis: Archiv der Akademie der Künste, Berlin); Abb. 5 Erich Heckel, Madonna von Ostende, 1916, Folkwang Museum Essen (Bildnachweis: Archiv Erich Heckl, Hemmenhofen); Abb. 6 Wohnhaus Walter Kaesbach in Erfurt, Architekt: Karl Meinhardt, Zustand 2023 (Foto: Marcel Krummrich); Abb. 7 Wohnhaus Walter Kaesbach in Düsseldorf-Lohausen, Architekt: Karl Meinhardt, Zustand 2023 (Foto: Kai Werner Schmidt); Abb. 8 Ernst Aufseeser, Signet Haus Kaesbach, ca. 1930, Düsseldorf (Bildnachweis: MARCHIVUM Mannheim); Abb. 9 Alexander Zschokke, Bildnisbüste Paul Klee, 1931, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf; Abb. 10 Alexander Zschokke, Bildnisbüste Heinrich Campendonk, 1931, Stiftung Museum Schloss Moyland MSM 20594 (Foto: Kai Werner Schmidt); Abb. 11 Heinrich Campedonk, Probefenster Kunstakadeimie Düsseldorf (Foto: Stiftung Museum Moyland) © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 12 August Sander, Porträt Jankel Adler, 1924/1978 (Bildnachweis: Von der Heydt-Museum Wuppertal, © Foto: Antje ZeisLoi, Medienzentrum, Wuppertal), August Sander © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 13 Ernst Aufseeser, Wandgestaltung Düsseldorf, 1928 (Foto: Kunstakademie Düsseldorf); Abb. 14 Haus von Alfred und Thekla Hess, Erfurt. Zustand 2023 (Foto: Marcel Krummrich). Beitrag Cornelia Nowak: Abb. 1 Heinrich Nauen, Bildnis Dr. Walter Kaesbach, um 1918, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 9428 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 2 Eduard Bissinger, Das städtische Museum Erfurt (heute Kunstmuseen Erfurt, Angermuseum), frühe 1920erJahre (Reproduktion: Constantin Beyer/ Dirk Urban, Erfurt); Abb. 3 Promotionsschrift von Walter Kaesbach zum Werk der Maler Victor und Heinrich Duenwege und des Meisters von Kappenberg, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 4 »Vereinigung der Erfurter Museums-
freunde«, Mitgliedsausweis von Dr. Walter Kaesbach, Holzschnitte von Alfred Hanf, 1920, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 5 Hans Baldung Grien, Die Erschaffung der Menschen und Tiere, 1532, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 9318 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 6 Crucifixus aus Suhl-Heinrichs, Mitte 14. Jahrhundert, mit Überarbeitungen des 15. und 16. Jahrhunderts, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. I 201 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 7a Curt Herrmann, Blumenrhythmus, um 1920, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 6841 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 7b Curt Herrmann, Goldregen, um 1920, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. 6842 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 8 Gerhard Marcks, Stehende Frau, um 1922, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. IV 936 (Foto: Dirk Urban, Erfurt), © VG Bild-Kunst Bonn 2024 © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 9 Lyonel Feininger, Barfüßerkirche II, 1923, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. VI 582 (Foto: Dirk Urban, Erfurt), © VG Bild-Kunst Bonn 2024; Abb. 10 Erich Heckel, Wandmalereien im Angermuseum Erfurt (sog. HeckelRaum), 1922/24, Bildszene: Welt des Mannes (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 11 Christian Rohlfs, Dom und Severikirchein Erfurt, 1924, Angermuseum Erfurt, Inv. Nr. III 750 (Foto: Dirk Urban, Erfurt); Abb. 12 Dankschreiben des Erfurter Oberbürgermeisters Bruno Mann an Walter Kaesbach vom 1. Dezember 1924, Angermuseum Erfurt, Nachlass Kaesbach (Foto: Dirk Urban, Erfurt). Beitrag Susanne Deicher: Abb. 1 Paul Klee, Bildarchitektur rot, gelb, blau (Architektur gestufter Kuben), 1923, Paul-Klee-Stiftung im Kunstmuseum Bern; Abb. 2 Piet Mondrian, Compositie, donkerekleuren, 1919, Den Haag, Haags Gemeentemuseum; Abb. 3 Paul Klee, Abend in Ägypten, 1929, Privatsammlung (Foto: Courtesy Galerie Kornfeld, Bern); Abb. 4 Pablo Picasso, Groupe de nus féminins (Drei weibliche Akte am Meer) 4.5.1921, C 1959/914, Staatsgalerie Stuttgart (Foto: © Staatsgalerie Stuttgart; Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2024); Abb. 5 Paul Klee, Pop und Lok im Kampf, 1930, Kunstmuseum Bern; Abb. 6 Paul Klee, Polyphonie, 1932, Kunstmuseum Basel; Abb. 7 Paul Klee, Kleine Felsenstadt, 1932, Kunstmuseum Bern; Abb. 8 Paul Klee, dein Ahn ?, 1933, Privatsammlung (Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin); Abb. 9 Albrecht Dürer, Selbstbildnis leidend, mit Marterwerkzeugen, 1522, Kunsthalle Bremen, Kupferstichkabinett, Kriegsverlust Lichtbildreproduktion (Foto: Kunsthalle Bremen © Karen Blindow – ARTOTHEK); Abb. 10 Albrecht Dürer, Kopf des toten Christus, 1503, British Museum London (Foto: The Trustees of the British Museum); Abb. 11 Pablo Picasso, Ohne Titel (Porträt eines Mannes), 1912, heutiger Standort unbekannt (Photographie von Alexis Brandt, publiziert in der Zeitschrift Camera Work, August 1912, S. 33); Abb. 12 Pablo Picasso, Das Absinth-Glas, 1914, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Berggruen (Foto: bpk/ Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen/Andres Kilger;
Pablo Picasso © Succession Picasso / VG BildKunst Bonn 2024); Abb. 13 Paul Klee, dein Ahn?, Detail, 1933 (Foto: Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch, Berlin); Abb. 14 Albrecht Dürer, Christi Auferstehung (Kleine Passion), um 1510, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin (Foto: bpk/Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz). Beitrag Kunibert Bering: Abb. 1 Gertrud von Kunowski, Porträt Lothar von Kunowski, 1921 (Mit freundlicher Genehmigung der Nachlassverwaltung von Gertrud von Kunowski); Abb. 2 Fotografie Lothar von Kunowski (Foto: Archiv der Kunstakademie Düsseldorf); Abb. 3 Lothar von Kunowski, Orpheus, 1925 (Foto: Archiv der Kunstakademie Düsselorf); Abb. 4 Lothar von Kunowski, Die Kunsthochschule, 1925; Ausstattung: Ernst Aufseeser, Kunstakademie Düsseldorf (Bildnachweis: Kai Werner Schmidt). Zeitschriftendokumentation: Aus dem Portal zeit. punkt NRW und dem Archiv der Kunstakademie Düsseldorf, S. 289 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Anzeiger Nr. 29 vom 6.6.1926; GeneralAnzeiger vom 25.6.1927; Düsseldorfer StadtAnzeiger Nr. 41 vom 18.6.1926; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 213 vom 18.12.1926; Düsseldorfer Anzeiger Nr. 328 vom 27.11.1927; S. 290 und 291 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Rheinisches Volksblatt Nr. 270 vom 16.11.1928; Düsseldorfer StadtAnzeiger Nr. 295 vom 23.10.1928; DüsseldorferStadt-Anzeiger Nr. 1 vom 1.1.1929; Düsseldorf Anzeiger Nr. 82 vom 22.3.1928; Kölnische Zeitung Nr. 596/597 vom 29.10.1928; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 87 vom 27.3.1928; Bielefelder General-Anzeiger Nr. 60 vom 12.3.1929; S. 292 und 293 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 192 vom 13.7.1929; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 155 vom 6.6.1929; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 13 vom 13.1.1929; Der Querschnitt durch Alfred Flechtheim, 1. April 1928, Deckblatt; Der Querschnitt, Bd. 9, Heft 6, Dez. 1924, S. 34; Der Querschnitt durch Alfred Flechtheim, 1. April 1928, S. 5 und 6; S. 294 und 295 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorf StadtAnzeiger Nr. 192 vom 14.7.1929; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 190 vom 11.7.1930; Düsseldorfer Anzeiger Nr. 9 vom 9.1.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 24 vom 24.1.1931; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 96 vom 6.4.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 84 vom 24.3.1930; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 95 vom 9.4.1930; Düsseldorf Stadt-Anzeiger Nr. 24 vom 24.1.1930, S. 296 und 297 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 41 vom 10.2.1931; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 18 vom 18.1.1932; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 12 vom 12.1.1932, S. 298 und 299 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 10 vom 10.1.1932; Düsseldorfer Stadt-Anzeiger Nr. 12 vom 12.1.1932; Kölnische Zeitung Nr. 692 vom 24.12.1933, S. 300 und 301 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Wochenschau Nr. 19, wahrscheinlich 1932 Rückseite; S. 302 (v.l.n.r. und v.o.n.u.); Wochenschau Nr. 19, wahrscheinlich 1932 Vorderseite; Volksparole 1933, o. Datumsangabe. Letzte Seite: Walter Kaesbachs Haus in Hemmenhofen am Bodensee, Blick von der Gartenseite, Foto: Slg. Hans Koch, Heinrich-Heine-Institut, Düsseldorf
309 Fotonachweis und Copyright