Sonderkonzert
Werke von Toshio Hosokawa und Gustav Mahler
Philharmonie Berlin, 16. September 2025
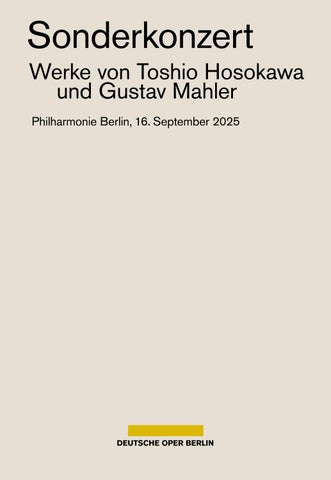
Philharmonie Berlin, 16. September 2025
„Blossoming II“ für Kammerorchester
„Das Lied von der Erde“ für Singstimme und Orchester
1. Das Trinklied vom Jammer der Erde
2. Der Einsame im Herbst
3. Von der Jugend
4. Von der Schönheit
5. Der Trunkene im Frühling
6. Der Abschied
Musikalische Leitung Antonello Manacorda
Mezzosopran Okka von der Damerau
Tenor David Butt Philip
Orchester der Deutschen Oper Berlin

Ulrike Heckenmüller
Der 1955 in Hiroshima geborene Toshio Hosokawa hat sich heute als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Japans etabliert. Von Kammermusik bis zu Solokonzert, von Sinfonik bis zu Oper und Oratorium widmet sich sein Œuvre sämtlichen klassischen Formen. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. 1982 mit dem Ersten Preis des Kompositionswettbewerbs anlässlich des 100. Geburtstags der Berliner Philharmoniker, dem Kyoto Musikpreis 1988 und dem Rheingau Musikpreis 1998. Hosokawas Werke werden an zahlreichen internationalen Institutionen und bei Festivals aufgeführt, bilden mal eine Hommage an Größen der westlichen Musikgeschichte, wie Mozart, Schumann oder auch Messiaen, mal greifen Sie traditionelle japanische Kultur wie deren Instrumente oder das Nō-Theater auf und verbinden diese mit der europäischen. Auch einschneidende historische und politische Ereignisse thematisiert seine Musik, wie der Abwurf der Atombombe auf Hosokawas Geburtsstadt oder die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. Seine Klangwelt beinhaltet große gewaltvolle Ausbrüche, die das Katastrophale erfahrbar machen, konzentriert sich im Wesentlichen aber auf meditative Momente und einen sehr bewussten Umgang mit Stille und der Durchbrechung dieser.
Für Hosokawa ist der Kompositionsprozess eng mit den Vorstellungen des Zen-Buddhismus und dessen symbolhafter Deutung der Natur verbunden. „Die tiefe Verwurzelung der Blumen in der japanischen Ästhetik und Spiritualität haben mich dazu gebracht, sie zum Gegenstand dieses Werkes zu machen“, erklärt der in Tokio und Berlin bei Isang Yun und in Freiburg bei Klaus Huber ausgebildete Komponist, der die Musik als ein pflanzenartiges Wachsen wahrnimmt. „Die Blume, an die ich in diesem Werk gedacht habe, ist der Lotus, Symbol des Buddhismus.“ Denn, so der Japaner: „Wenn ich Musik schaffe, möchte ich dies auf der Basis meiner eigenen musikalischen und kulturellen Wurzeln tun und sie von dort aus innerlich erblühen lassen.“
Und sie erblüht ganz wunderbar, diese Komposition für Kammerorchester, die auf einem Streichquartett aus dem Jahr 2007 basiert. Kaum wahrnehmbar, im vierfachen Piano, erklingt ein lang ausgehaltener Ton im mittleren Register, dessen Erwachen der Hörer nur allzu leicht verpassen kann. Allmählich schälen sich aus diesem Urgrund Glissandi und Tremoli heraus, winden sich Töne in engen Intervallen kaum merklich auf- und abwärts, mischen sich Windeffekte der Bläser in dieses sensibel austarierte, äußerst störanfällige Klanggeflecht. Nach einer ganzen Weile erblühen aus diesem „Schoß der Harmonie“ vorsichtig kurze melodische Floskeln, wachsen dem Licht entgegen, zunächst in einzelnen Stimmen, hernach jeweils um ein Achtel versetzt in verschiedenen Stimmen gleichzeitig. Erst spät kommt mehr (Gegen-)Bewegung ins pflanzliche Ranken, verläuft das Wachsen bisweilen auch sprunghaft, bis sich der lebendige Mikrokosmos peu à peu wieder in den wuselnden Urgrund zurückzieht.
Der Lotus gräbt seine Wurzeln tief in den Schlamm unter der Teichoberfläche; der Stamm streckt sich durch das Wasser der Oberfläche und dem Himmel entgegen; die Knospe erblüht in Richtung des morgendlichen Sonnenscheins.
„Das Lied von der Erde“ von Gustav Mahler
Kerstin Schüssler-Bach
Im Spiegel fernöstlicher Kultur erhofften sich europäische Künstlerinnen und Künstler um 1900 eine belebende Perspektive, die weit über die „chinesische“ Dekorationsmode des Rokoko hinausging. Asiatische Holzschnitte und Musikinstrumente hinterließen ihre Spuren etwa bei Vincent van Gogh, Aubrey Beardsley, Franz Marc, Giacomo Puccini, Claude Debussy – und Gustav Mahler. 1907 erschien im Insel-Verlag das Bändchen „Die chinesische Flöte“, herausgegeben von Hans Bethge. Es versammelt freie Nachdichtungen von chinesischer Lyrik aus dem 8. Jahrhundert, vor allem von Li-Tai-Po (Li Bai), über den Bethge ganz aus dem Blickwinkel des Jugendstils schreibt: „Er dichtete die verschwebende, verwehende, unaussprechliche Schönheit der Welt, den ewigen Schmerz und die ewige Trauer und das Rätselhafte alles Seienden. In seiner Brust wurzelt die ganze dumpfe Melancholie der Welt. ‚Vergänglichkeit‘ heißt das immer mahnende Siegel seines Fühlens“. Es war wohl dieser Tonfall, von dem Gustav Mahler sofort angezogen wurde. Bald, nachdem ihm ein Freund das Büchlein schenkte, machte er sich noch im Sommer 1907 an die Vertonung – ein Wendejahr in Mahlers Leben, eine Zeit, die ihn näher an den Tod heranrückte. Drei Katastrophen ereigneten sich: die Demission vom Amt des Wiener Hofoperndirektors nach einem Pressefeldzug, die Diagnose seiner schweren Herzerkrankung und der Tod seiner älteren Tochter Maria Anna. An den befreundeten Dirigenten Bruno Walter schrieb Mahler, „dass ich einfach mit einem Schlage alles an Klarheit und Beruhigung verloren habe, was ich mir je errungen, und nun am Ende eines Lebens als Anfänger wieder gehen und stehen lernen muss.“
In dieser seelischen Verfassung schlugen die Weisheiten der Gedichte aus der „Chinesischen Flöte“ eine verwandte Saite in Mahler an: In aller Melancholie verweigern sie sich einer hypochondrischen Todesfurcht, sondern schweben in einer „blumenhaften Grazie der Empfindung“ (Bethge). Und genau diese Mischung aus todwunder, klangsatter Schwermut und leichter, teils kammermusikalischer Eleganz macht den besonderen Charakter des „Lieds von der Erde“ aus, das Mahler „wohl das Persönlichte, was ich bis jetzt gemacht habe“ nannte.
Den größten Teil komponierte Mahler im Sommer 1908 in seinem „Komponierhäuschen“ in Toblach. Mit noch nicht 50 Jahren formulierte er seinen eigenen Abschied, auch wenn es nicht sein letztes Werk bleiben sollte. Die Drucklegung und Uraufführung erlebte er nicht mehr. Im November 1911, ein halbes Jahr nach Mahlers Tod, erklang „Das Lied von der Erde“ erstmals unter Bruno Walter in
München im Rahmen einer Gedächtnisfeier. „Es ist so wie das Vorbeiziehen des Lebens, besser des Gelebten in der Seele des Sterbenden“, sagte der Augenzeuge Anton Webern.
In den sechs Sätzen – drei für Tenor, drei für Alt oder Bariton – geht Mahler mit der Textvorlage recht frei um. Zur musikalischen Ausgestaltung greifen nur die Mittelsätze 3 und 4 einen „milieutreuen“ Exotismus auf. Das „Trinklied vom Jammer der Erde“ setzt mit einem wildbewegten Fanfarenruf des Horns gleich ein Ausrufezeichen. Leben und Tod sind verschwistert. Auf der Seite des Lebens stehen Gesang, Trinken, Lautenspiel. Grelle Bilder erscheinen im Rausch. Sie kontrastieren mit dem ruhigen Refrain: „Dunkel ist das Leben, ist der Tod“. „Der Einsame im Herbst“ findet im Welken und Absterben der Natur ein Gleichnis für den Seelenzustand: „Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange“. Der Tod erscheint als ersehnte Stätte von Frieden und Heimat. Anders als im massiv instrumentierten ersten Lied herrscht hier kammermusikalische Durchsichtigkeit. Nur einen leidenschaftlichen Ausbruch erlaubt Mahler in dieser zurückhaltenden Todesmeditation – der aber greift ans Herz: „Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen“. „Von der Jugend“ erscheint als „Chinoiserie-Miniatur“: hier nähert sich Mahler am ehesten einer fernöstlichen Aura. Die pendelartige auf- und niedersteigende Linie ist pentatonisch, also nach dem fünftönigen System gebildet, das vielen außereuropäischen Musikkulturen zugrundeliegt. Kaum werden die Bassinstrumente eingesetzt – die Schwerelosigkeit der wellenförmigen Bewegung unterstüzt das textliche Bild des Pavillons, der auf dem Kopf steht. Auch „Von der Schönheit“ atmet die „blumenhafte Grazie“, die Hans Bethge so an den chinesischen Gedichten bewunderte. Das zarte Genrebild der anmutigen Mädchen wird nur durch einen atemlosen, marschartigen Mittelteil aufgestört.
Li-Tai-Po war, wie Hans Bethge schreibt, „ein Abenteurer und Trinker“. In „Der Trunkene im Frühling“ hallte für Mahlers Zeitgenossen auch Friedrich Nietzsche nach: Welterkenntnis durch Rauschzustand und Einflüsterungen der Natur (hier im Zwiegespräch mit dem Vogel). Der Scherzocharakter wird durch die burleske Instrumentation mit Trillern, Pizzicati und „lustigen“ Vorschlägen unterstrichen. „Der Abschied“ ist das weitaus längste Lied – ein überwältigender Abgesang, ein zeit- und raumloser Abschied von der Liebe und dem Leben. „Ist das überhaupt zum Aushalten? Werden sich die Menschen nicht danach umbringen?“, fragte sich Mahler. Alle vorhergehenden Distanzierungen durch Burleske, Ironie oder Exotismus werden aufgehoben. Es ist eine musikalische Erzählung vom Sterben, die viel Zeit nimmt. Immer wieder gerät sie ins Stocken, unterbrochen von dem TamTam-Schlägen des Todes: „Die Welt schläft ein“. Mahler fügte Zeilen aus einem eigenen Jugendgedicht ein: „Die müden Menschen gehn heimwärts, um im Schlaf vergessnes Glück und Jugend neu zu lernen“. Die kaum zu ertragende Sehnsucht nach dem Gefährten mündet in einen schwer lastenden Trauermarsch. Danach ändert sich der Ausdruck: Der Freund antwortet „sehr weich und ausdrucksvoll“. Die erstarrte Trauer weicht einem warm strömenden Gesang, der die Gewissheit des Todes ruhig akzeptiert. Filigrane Farben von Mandoline und Celesta kommen hinzu, für Mahler Klangsymbole der Weltentrücktheit. Das mehrfach wiederholte Wort „ewig“ steht am Schluss, immer weiter gedehnt, sich ins Unhörbare auflösend. „Gänzlich ersterbend“ schreibt Mahler über die Schlusstakte, die harmonisch gesehen keine auflösende Wirkung haben, sondern in einer milden Dissonanz stehenbleiben. Die Grenze zwischen Klang und Stille verwischt, Leben geht in Tod auf. Wie es in einem anderen Gedicht aus „Die chinesische Flöte“ über den Menschen heißt: „Sein Dasein ist ein Lufthauch, der zerfließt“.
Antonello Manacorda
Wir beginnen den Konzertabend mit „Blossoming“ von Toshio Hosokawa. Das Stück ist kleiner besetzt, die Musik ist verklärender, positiver, sie leitet perfekt zu dem gewichtigen Mahler über, wie eine Ouvertüre. Hosokawa ist ein zeitgenössischer japanischer Komponist, sein Klang beschreibt eine ähnliche Naturromantik. „Wie ein Blütenblatt, das sich öffnet“, steht in der Partitur, gemeint ist die Lotusblüte, auch dies ist eine Verbindung zum „Lied von der Erde“, wo der Lotus eine Rolle spielt.
Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ gibt vielen Menschen Rätsel auf. Ist es eine Sinfonie, ein Liederzyklus, ein Experiment? Für mich sind die sechs Orchesterlieder vor allem ein zutiefst berührendes Stück Musik, ein fantastisches Erlebnis, bei dem es um Leben und Tod geht, um Jenseits und Spiritualität. Die Musik ist mal melancholisch schwebend, dann wieder ausschweifend und schwelgerisch. Inhaltlich sind wir in Fernost. Mahler benutzte Texte von Hans Bethge, der chinesische Gedichte aus einer französischen Übersetzung bearbeitet und die mehr als tausend Jahre alte Naturlyrik ins Existenzielle, Philosophische gehoben hat. Entstanden ist das „Lied von der Erde“ 1908, Mahler bezeichnete es als „das Persönlichste“, was er bis dahin geschaffen habe. Die Uraufführung 1911 hat er nicht mehr erlebt. Schon die Arbeit daran fiel in eine schwere Zeit, im Jahr zuvor war eine seiner Töchter gestorben, im Alter von vier Jahren. Den Posten als Direktor der Wiener Hofoper hatte er nach einer antijüdischen Hetzkampagne räumen müssen, seine Frau Alma suchte Trost in Affären, die Mahler natürlich mitbekam. Ende des Jahres wurde seine Herzkrankheit diagnostiziert, an der er drei Jahre später sterben sollte.
Musikalisch hat Mahler im „Lied von der Erde“ die Singstimmen wie Instrumente in die Sinfonie verwoben: Tenor, Alt, Flöte und Oboe reden miteinander wie gleichwertige Stimmen. Mahlers Musik entstand an der Schwelle vom Impressionismus zum Expressionismus. So wie die Künstler seiner Ära, Kandinsky, Kokoschka, Schiele, Trakl, richtete er den Blick nach innen, schaute in die Seele des Menschen. Auch wir gehen bei diesem Konzert nach Innen. In die größte Freude, aber auch in das intensivste Leid.




Arthur Paunzen: „Sechs Radierungen zum Lied von der Erde von Gustav Mahler“, 1920. 1_ Das Trinklied vom Jammer der Erde // 2_ Der Einsame im Herbst // 3_ Von der Jugend // 4_ Von der Schönheit // 5_ Der Trunkene im Frühling // 6_ Der Abschied.


Autograph der Partitur von Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“. Beginn des fünften Teils „Der Trunkene im Frühling“. 5 6

1. Das Trinklied vom Jammer der Erde
Schon winkt der Wein im gold’nen Pokale, doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer soll auflachend in die Seele euch klingen.
Wenn der Kummer naht, liegen wüst die Gärten der Seele, welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang. Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins! Hier, diese Laute nenn’ ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren, das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
Das Firmament blaut ewig und die Erde wird lange fest stehen und aufblühn im Lenz.
Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen an all dem morschen Tande dieser Erde!
Seht dort hinab! Im Mondschein auf den Gräbern hockt eine wildgespenstische Gestalt.
Ein Aff ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!
Jetzt nehm den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen! Leert eure gold’nen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!
2. Der Einsame im Herbst
Herbstnebel wallen bläulich über’m See, vom Reif bezogen stehen alle Gräser, Man meint’, ein Künstler habe Staub von Jade über die feinen Blüten ausgestreut.
Der süße Duft der Blumen ist verflogen, ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.
Bald werden die verwelkten, gold’nen Blätter der Lotosblüten auf dem Wasser zieh’n.
Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe erlosch mit Knistern, es gemahnt mich an den Schlaf.
Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange. Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen, um meine bitter’n Tränen mild aufzutrocknen?

Mitten in dem kleinen Teiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber. In dem Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ihre seidnen Ärmel gleiten rückwärts, ihre seidnen Mützen hocken lustig tief im Nacken. Auf des kleinen Teiches stiller Wasserfläche zeigt sich alles wunderlich im Spiegelbilde. Alles auf dem Kopfe stehend in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan; Wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt der Bogen. Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern.
Junge Mädchen pflücken Blumen, pflücken Lotosblumen an dem Uferrande.
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie, sammeln Blüten in den Schoß und rufen sich einander Neckereien zu.
Gold’ne Sonne webt um die Gestalten, spiegelt sie im blanken Wasser wider. Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder, Ihre süßen Augen wider, und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen das Gewebe ihrer Ärmel auf, führt den Zauber ihrer Wohlgerüche durch die Luft.
O sieh’, was tummeln sich für schöne Knaben dort an dem Uferrand auf mut’gen Rossen, weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen; schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden trabt das jungfrische Volk einher!
Das Roß des einen wiehert fröhlich auf und scheut und saust dahin; über Blumen, Gräser, wanken hin die Hufe, sie zerstampfen jäh im Sturm die hingesunk’nen Blüten. Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen, dampfen heiß die Nüstern!
Gold’ne Sonne webt um die Gestalten, spiegelt sie im blanken Wasser wider. Und die schönste von den Jungfrau’n sendet
lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung.
In dem Funkeln ihrer großen Augen, in dem Dunkel ihres heißen Blicks
schwingt klagend noch die Erregung ihres Herzens nach.
Wenn nur ein Traum das Leben ist, warum denn Müh und Plag?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann, den ganzen, lieben Tag!
Und wenn ich nicht mehr trinken kann, weil Kehl’ und Seele voll, so tauml’ ich bis zu meiner Tür und schlafe wundervoll!
Was hör ich beim Erwachen?
Horch! ein Vogel singt im Baum. Ich frag ihn, ob schon Frühling sei, mir ist als wie im Traum.
Der Vogel zwitschert: ›Ja! Der Lenz, der Lenz ist da, sei kommen über Nacht!‹
Aus tiefstem Schauen lauscht’ ich auf, der Vogel singt und lacht!
Ich fülle mir den Becher neu und leer ihn bis zum Grund und singe, bis der Mond erglänzt

am schwarzen Himmelsrund!
Und wenn ich nicht mehr singen kann, so schlaf ich wieder ein, was geht mich denn der Frühling an!
Laßt mich betrunken sein!
6. Der Abschied
Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge. In allen Tälern steigt der Abend nieder mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.
O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt der Mond am blauen Himmelssee herauf. Ich spüre eines feinen Windes Weh’n hinter den dunklen Fichten!
Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel. Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf, alle Sehnsucht will nun träumen.
Die müden Menschen geh’n heimwärts, um im Schlaf vergeß’nes Glück und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen. Die Welt schläft ein!
Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten. Ich stehe hier und harre meines Freundes; ich harre sein zum letzten Lebewohl.
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite die Schönheit dieses Abends zu genießen. Wo bleibst du …? Du läßt mich lang allein! Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute auf Wegen, die vom weichen Grase schwellen.
O Schönheit! O ewigen Liebens – Lebenstrunk’ne Welt!
Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin er führe und auch warum es müßte sein.
Er sprach, seine Stimme war umflort: Du, mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold!
Wohin ich geh? Ich geh, ich wand’re in die Berge. Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte. Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt aufs neu!
Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig … ewig …
nach Hans Bethges „Die chinesische Flöte“ nach Gedichten von Li Bai, Qian Qi, Meng Haoran, Wang Wei [618–917, Tang-Zeit]
Antonello Manacorda hat sich in den letzten Jahren als international gefragter Dirigent für Oper und Konzert etabliert. Von 2010 bis 2012 brachte er Mozarts Da-Ponte-Zyklus in einer Neuinszenierung des Regisseurs Damiano Michieletto am Tearro La Fenice in Venedig heraus. Es folgten Debüts am Teatro del Maggio Musicale in Florenz, am MusikTheater an der Wien, am La Monnaie in Brüssel, beim Glyndebourne Festival, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, an der Komischen Oper Berlin, der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Wiener Staatsoper, der Semperoper Dresden und der New Yorker MET. Opernproduktionen der jüngsten Vergangenheit führten ihn an die Staatsoper Stuttgart mit IL TROVATORE , an das Royal Opera House Covent Garden mit LES CONTES D’HOFFMANN , an die Züricher Oper mit LE NOZZE DI FIGARO und an die Opéra national de Paris mit PELLÉAS ET MÉLISANDE
Als Konzertdirigent gastierte Antonello Manacorda in der letzten Saison u. a. beim Mahler Chamber Orchestra, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Finnish Radio Symphony Orchestra und dem Royal Philharmonic Orchestra. In den vergangenen Spielzeiten arbeitete er u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orchestra dell’Accademia Nazionale die Santa Cecilia, den Berliner Philharmonikern, dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem SWR Symphonieorchester erfolgreich zusammen.
Von 2010 bis zum Ende der letzten Spielzeit war Antonello Manacorda Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam mit der er für Sony Classical sowohl einen Mendelssohn-Zyklus einspielte als auch einen Schubert-Zyklus, für den sie beim ECHO Klassik 2015 den Preis in der Kategorie „Orchester des Jahres“ erhielten. Im Oktober 2022 folgte der OPUS KLASSIK in derselben Kategorie für die Einspielung der letzten Sinfonien Mozarts. Im Mai kam zudem eine Gesamteinspielung der Sinfonien von Ludwig van Beethoven dazu, die erneut von Sony Classical veröffentlicht wurde. Zuletzt brachte er mit der Kammerakademie Potsdam Webers FREISCHÜTZ konzertant in Potsdam, im Pariser Théâtre des Champs Elysées, im Festspielhaus Baden-Baden und in der Berliner Philharmonie zur Aufführung.
Okka von der Damerau ist eine der führenden Mezzosopranistinnen ihrer Generation. In der letzten Saison sang sie in den Neuproduktionen von RHEINGOLD und WALKÜRE die Fricka unter der Leitung von Christian Thielemann an der Mailänder Scala sowie Ježibaba in RUSALKA am Liceu in Barcelona und bei den Münchner Opernfestspielen. Unter der Leitung von Riccardo Chailly übernahm sie jüngst an der Scala die Partie der Waldtaube in Arnold Schönbergs „Gurreliedern“, sang in Mahlers 2. Sinfonie unter der Leitung von Aziz Shokhakimov in Turin sowie Mahlers 8. Sinfonie im Rahmen des Mahler Festivals in Amsterdam mit dem Concertgebouw-Orchester unter der musikalischen Leitung von Klaus Mäkelä.
Als langjähriges Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper war sie in München u. a. zu erleben als Waltraute in GÖTTERDÄMMERUNG , Erda in RHEINGOLD und SIEGFRIED sowie Charlotte in DIE SOLDATEN unter Kirill Petrenko, aber auch als Azucena in IL TROVATORE . Von München aus nahm ihre internationale Karriere Fahrt auf und führte sie u. a. an die Opéra national de Paris, die Wiener Staatsoper, das Teatro di San Carlo Neapel, das Teatro Real in Madrid, die Semperoper Dresden und zu den Bayreuther Festspielen. Viel Beachtung erfuhren ihre Rollendebüts als Brünnhilde in der WALKÜRE an der Staatsoper Stuttgart unter der musikalischen Leitung von Cornelius Meister, in der Titelpartie von ARIADNE AUF NAXOS und als Venus in TANNHÄUSER an der der Bayerischen Staatsoper. Als Konzertsängerin arbeitet sie u. a. mit dem Chicago Symphony Orchestra, den Wiener Philharmonikern, den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Münchner Philharmonikern, der Berliner Staatskapelle, dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia und dem KBS Symphony Orchestra Seoul. Bei den Salzburger Festspielen sang sie Mahlers „Kindertotenliedern“ unter dem Dirigat von Daniel Barenboim. Hochgelobt wurde auch ihre 2017 erschienene Einspielung von Frank Martins Liedzyklus „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ mit der Philharmonia Zürich unter Fabio Luisi.
David Butt Philip studierte am Royal Northern College of Music, der Royal Academy of Music und am National Opera Studio. Von 2012 bis 2014 war David Butt Philip Mitglied des Jette Parker Young Artists Programme am Royal Opera House Covent Garden. Im Herbst 2014 debütierte er als Rodolfo in LA BOHÈME an der English National Opera und war in dieser Partie 2015 am Zorlu Centre in Istanbul und mit der English Touring Opera an mehreren Orten in Großbritannien zu erleben.
Konzertauftritte umfassten Verdis „Requiem” mit dem Orchestre de Picardie und dem Orchestre Symphonique de Bretagne, Mahlers „Das Klagende Lied” mit Vladimir Jurowski und dem London Philharmonic Orchestra, Rossinis „Petite Messe solennelle“ am Barbican Centre, Brittens „Folk Songs” mit dem Royal Philharmonic Orchestra sowie in der Wigmore Hall mit Simon Lane und dem Solstice Quartet. Auszeichnungen umfassen den John Cameron Prize for Lieder, den Richard Lewis / Jean Shanks Award, den Edwin Samuel Dove Prize und den Bruce Millar / Gulliver Prize. Zu seinen jüngsten Engagements zählen u. a. sein Debüt an der Wiener Staatsoper mit einem Dreifachauftritt als Laca in JENŮFA , Stolzing in DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG und schließlich Don José in CARMEN . Es folgte an der San Francisco Opera sein Debüt als Kaiser in DIE FRAU OHNE SCHATTEN , den er auch an der Deutschen Oper Berlin verkörperte. An das Royal Opera House Covent Garden kehrte er als Prinz in RUSALKA zurück. Darüber hinaus sang er an der New Yorker MET Grigorij in BORIS GODUNOW sowie in Brett Deans HAMLET die Partie des Laertes, an der Washington National Opera, bei den Salzburger Festspielen und in Glyndebourne Boris in KÁŤA KABANOVÁ , debütierte als LOHENGRIN an der Deutschen Oper Berlin und als Bacchus in ARIADNE AUF NAXOS an der Bayerischen Staatsoper. Weitere Engagements sind die Titelpartie in Zemlinskys DER ZWERG an der Deutschen Oper Berlin, Froh in DAS RHEINGOLD und Essex in GLORIANA am Teatro Real sowie Erik in DER FLIEGENDE HOLLÄNDER an der Opéra de Lille und Florestan in FIDELIO in Prag und London.
Im Jahr 2012 feierte die Deutsche Oper Berlin und mit ihr das Orchester des Hauses den 100. Geburtstag. Die wechselvolle Geschichte des Orchesters ist eng mit der der Stadt Berlin verknüpft. Es war fast eine kleine Kulturrevolution, die Berlins Bürger wagten, als sie vor mehr als hundert Jahren ein eigenes Opernhaus gründeten, das mit seinem Verzicht auf Logen das Ideal eines „demokratischen“ Opernhauses verkörperte und von allen Plätzen die volle Sicht auf die Bühne bot. In den 1920er Jahren arbeiteten berühmte Gastdirigenten wie Wilhelm Furtwängler und Bruno Walter regelmäßig an der Deutschen Oper, und es entstanden damals schon die ersten Schallplatteneinspielungen. Nach der Zerstörung des Hauses im Zweiten Weltkrieg musste sich die Deutsche Oper lange mit Ausweichquartieren arrangieren. 1961 wurde schließlich das Opernhaus in der Bismarckstraße eröffnet, in dem sie bis heute residiert. Seitdem ist die Deutsche Oper Berlin mit ihren 1860 Plätzen nicht nur das größte Opernhaus Berlins mit hervorragenden Sicht- und Akustikverhältnissen, sondern auch eine erste Adresse in der internationalen Opernwelt. Die Reihe der Dirigenten, die als Gast oder als Chefdirigent am Pult des Orchesters der Deutschen Oper Berlin standen, ist beeindruckend und reicht von Lorin Maazel und Herbert von Karajan bis zu Giuseppe Sinopoli und Christian Thielemann, der von 1997 bis 2004 als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper amtierte. Seit 2009 hat das Orchester der Deutschen Oper Berlin mit Sir Donald Runnicles einen international renommierten Dirigenten als Generalmusikdirektor.
Ein künstlerischer Schwerpunkt der Deutschen Oper Berlin liegt in der Pflege der Werke von Richard Wagner und Richard Strauss. Die besondere Wagnertradition des Orchesters schlägt sich auch darin nieder, dass viele seiner Mitglieder im Orchester der Bayreuther Festspiele musizieren. Ein weiteres wichtiges Element im künstlerischen Profil des Orchesters der Deutschen Oper Berlin ist die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Musik der Gegenwart. Zahlreiche Komponisten arbeiteten eng und produktiv mit dem Orchester zusammen, so kam es 2017 mit der Premiere der Oper L’INVISIBLE zu einer neuerlichen Zusammenarbeit mit Aribert Reimann, den bereits eine längere Uraufführungsgeschichte mit dem Orchester des Hauses verbindet. Detlev Glanerts 2019 entstandene Oper OCEANE wurde mit einem International Opera Award für die „Beste Uraufführung des Jahres“ ausgezeichnet, kurz darauf erlebte Chaya Czernowins HEART CHAMBER die erste Aufführung. Neben den Opernvorstellungen gibt das Orchester der Deutschen Oper Berlin regelmäßig Sinfoniekonzerte mit führenden Solist*innen und ist dabei sowohl im Haus in der Bismarckstraße wie in der Berliner Philharmonie zu erleben. Zudem bereichern zahlreiche von Mitgliedern des Orchesters gebildete Ensembles – vom Streichquartett bis zur Bigband – mit ihren Konzerten den Spielplan der Deutschen Oper. Die Diskografie des Orchesters umfasst mehr als 200 Titel, zu denen zahlreiche herausragende Einspielungen gehören. Die Aufnahme mit Jonas Kaufmanns Wagner-Recital wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt der Sänger für diese Aufnahme den „Echo Klassik“. Die DVD von Leoš Janáceks JENŮFA mit dem Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin unter Sir Donald Runnicles erhielt 2015 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Opera Recording“. Der Aufnahme von Aribert Reimanns L’INVISIBLE folgte Erich Wolfgang Korngolds DAS WUNDER DER HELIANE und Alexander von Zemlinskys DER ZWERG , 2020 ebenso für einen Grammy nominiert.
1. Violine
Roberta Verna, Anna Matz, Dietmar Häring, Claudia Schönemann, Martina Klar, Franziska Genetzke, Keiko Kido, Céline Corbach, Yukari Aotani-Riehl, André Robles Field, Francesca Temporin, Marit Vliegenthart, Rebecca Thies, Mailis Bonnefous, Hildegard Niebuhr, Anastasia Tsvetkova
2. Violine
Ikki Opitz, Daniel Draganov, Magdalena Makowska, Kaja Beringer, Iris Menzel, Ivonne Hermann, Chié Peters, Kurara Tsujimoto, Esther Feustel, Onyou Kim, Aaron Biebuyck, Peter Fritz, Jae-Shin Song, Wei-Hsuan Tsai
Viola
Emiko Yuasa, Yi-Te Yang, Axel Goerke, Liviu Condriuc, Juan-Lucas Aisemberg, Alexander Mey, Sebastian Sokol, Manon Gerhardt, Seo Hyeun Lee, Yoonseok Kang, Christoph Starke, Hoyoon Kim
Violoncello
Stefan Heinemeyer, Johannes Mirow, Maria Pstrokonska-Mödig, Johannes Petersen, Birke Mey, Georg Roither, Ulrike Seifert, Claudio Corbach, Margarethe Niebuhr, Stephan Buchmiller
Kontrabass
Hermann Wömmel-Stützer, Florian Heidenreich, Bernd Terver, Sebastian Molsen, Martin Schaal, Theo J. W. Lee, Johannes Ragg, Astrid Travagli
Flöte
Eric Kirchhoff, Akiko Asai, Ruth Pereira Medina, Annika Rast
Oboe
Juan Pechuan Ramirez, Yijea Han, Chloé Payot
Klarinette
Markus Krusche, Leandra Brehm, Sophie Pardatscher, Felix Welz
Fagott
Paul-Gregor Straka, Isabella Homann, Vedat Okulmus
Horn
Norbert Pförtsch-Eckels, Margherita Lulli, Luis Diz, Angelika Goldammer
Trompete
Rudolf Matajsz, Thomas Schleicher, Yael Fiuza Souto
Posaune
Guntram Halder, Rafael Mota, Thomas Richter
Tuba
Elias Samuel Rodehorst
Pauke / Schlagzeug
Benedikt Leithner, Björn Matthiessen, Rüdiger Ruppert, Lukas Zeuner
Harfe
Virginie Gout-Zschäbitz, Marion Ravot
Mandoline
Maria Bogdanova
Celesta
Jisu Park
20 Jahre BigBand der Deutschen Oper Berlin
20. September 2025, 19 Uhr Philharmonie Berlin

Manfred Honetschläger
Musikalische Leitung
Mathilde Vendramin
Vocals und Violoncello
Thomas Pigor Vocals
Biréli Lagrène
Solo-Gitarre
Philharmonie Berlin
Herbert-von-Karajan-Straße 1 10785 Berlin
Infos und Karten
www.deutscheoperberlin.de 030 343 84 343
Impressum
Copyright Stiftung Oper in Berlin Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
Intendant Christoph Seuferle; Geschaftsführender Direktor Thomas Fehrle; Spielzeit 2025/2026 Redaktion Konstantin Parnian; Gestaltung Sandra Kastl / Uwe Langner Druck Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin
Textnachweise
Der Text von Ulrike Heckenmüller entstand 2012 für die Kölner Philharmonie und wurde für dieses Heft von der Redaktion überarbeitet. Der Text von Kerstin Schüssler-Bach entstand 2017 für die Neue Philharmonie Westfalen und wurde für dieses Programmheft von der Autorin überarbeitet.
Der Text von Antonello Manacorda basiert auf einem Protokoll von Thomas Lindemann.
Bildnachweise
S. 2: „Album of Poetry and Painting“, Hu Jiusi 1824 [Heritage Images / akg-images / Heritage Art].
S. 8/9: „Sechs Radierungen zum Lied von der Erde von Gustav Mahler“, Wien (Richard Lanyi) 1920, Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte [akg-images].
S. 9, unten: Notenhandschrift „Der Trunkene im Frühling“ 1907, Wien, Wiener Stadt- u. Landesbibliothek [akg-images].
S. 12: Foto, Gustav Mahlers Komponierhäuschen in Toblach, wo er in den Sommermonaten der Jahre 1908–1910 am „Lied von der Erde“, an der 9. und der unvollendeten 10. Symphonie arbeitete [akg-images].
S. 16: Foto, Gustav Mahler während seiner letzten Reise nach Amerika an der Reeling des Dampfers, November 1910 [akg-images].