
HEAT OF THE MOMENT
Was es braucht, um jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren.
Harter Start ins Leben: Als Folge des Klimawandels nehmen Frühgeburten zu.
Getränk der Gesetzlosen: Alkoholfreier Wein kann wieder bio sein.


Was es braucht, um jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren.
Harter Start ins Leben: Als Folge des Klimawandels nehmen Frühgeburten zu.
Getränk der Gesetzlosen: Alkoholfreier Wein kann wieder bio sein.
DER ERSTE BIO KOMBUCHA ZU 100% AUS ÖSTERREICH.

NEU im Kühlregal nur bei:
ZU 100% AUS ÖSTERREICH AUF BASIS VON BRENNNESSELTEE

Einen Sommer wie damals, als wir uns die 1,5 °C Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zum Ziel gesetzt haben, wird es wahrscheinlich länger nicht geben. Er war geprägt von extremer Hitze und Trockenheit, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der zweitwärmste in Österreich und der drittwärmste in Deutschland. Im auf ihn folgenden Dezember kam der Durchbruch bei der Pariser Klimakonferenz – die Staatengemeinschaft konnte sich darauf einigen, dass eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf »jedenfalls unter 2 Grad« verfolgt wird – wenn möglich 1,5 Grad verfolgt wird, weil bei allem darüber mit dem In-GangSetzen irreversibler Prozesse zu rechnen ist. Was jetzt? Könntet ihr nun einwenden. Das Dumme mit dem Klimawandel ist, dass der einzige Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad womöglich nur ein bisschen Rumtrödeln ist. Diesen Frühling wurde berechnet: Mindestens vorübergehend werden wir noch vor 2030 die 1,5-Grad-Marke überschreiten.
Aus dem Jahr 2015 wird manchen vielleicht anderes als das Klima für hitzige Diskussionen und von der Spitze der politischen Agenda in Erinnerung geblieben sein. Welche Aufmerksamkeit internationale Konflikte, Sicherheits- und Migrationsfragen damals verlangt haben, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Wetten wir, ob wir uns an ihn bald wegen des milden Wetters erinnern werden? Oder als Wendepunkt, an dem der schon spürbare Klimawandel dafür gesorgt hat, dass die Kehrtwende eingeläutet wird! Wir haben uns umgesehen und -gehört, welche Ideen es dazu gibt, etwas gegen diese verdammte Hitze zu tun.
Gute Lektüre und milden Sommer!
IMPRESSUM
HERAUSGEBER Thomas Weber CHEFREDAKTEURIN Irina Zelewitz AUTORiNNEN Silke Jäger, Martin Mühl, Ursel Nendzig, Hanna Stummer, Thomas Weber, Irina Zelewitz GESTALTUNG Ulrike Dorner, Stefan Staller ANZEIGENVERKAUF Herwig Bauer, Michael Mazelle, Thomas Weber DRUCK Walstead Leykam Druck GmbH, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten PRODUKTION & MEDIENINHABERIN Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien GESCHÄFTSFÜHRUNG Martin Mühl KONTAKT Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien; www.biorama.eu, redaktion@biorama.eu BANKVERBINDUNG Biorama GmbH, Bank Austria, IBAN AT44 12000 10005177968, BIC BKAUATWW ABONNEMENT biorama.eu/abo ERSCHEINUNGSWEISE BIORAMA 6 Ausgaben pro Jahr ERSCHEINUNGSORT Wien.
BLATTLINIE BIORAMA ist ein unabhängiges, kritisches Magazin, das sich einem nachhaltigen Lebensstil verschreibt. Die Reportagen, Interviews, Essays und Kolumnen sind in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt angesiedelt. Sie zeigen Möglichkeiten für ein Leben mit Qualität für den Menschen und den Planeten Erde. Ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. BIORAMA erscheint sechs Mal im Jahr. Zusätzlich erscheinen wechselnde BIORAMA-Line-Extentions.

Irina Zelewitz, Chefredakteurin zelewitz@biorama.eu
PEFC-zertifiziert Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen www.pefc.at
PEFC/06-39-08

03 Editorial
06 Bild der Ausgabe
08 LeserInnen
10 Street Talk
14 Global Village
18 Hitze in der Schwangerschaft Durch den Klimawandel werden auch Frühgeburten zunehmen.
24 Ist es heiß?
Neben der Temperatur kündigt der Wetterbericht auch eine »gefühlte Temperatur« an. Dieses Gefühl hat konkrete physische Auswirkungen.
26 Mythbusting: Lüften
Beim Lüften halten sich hartnäckige Mythen.
27 Digitaler Zwilling
Die Stadt München testet Maßnahmen, um die Altstadt klimaresilienter zu gestalten.
30 Entalkoholisierter Biowein
Rund zwei Jahre konnte er in der EU nicht mit Biolabel verkauft werden.
32 Salbei: Botanischer Bodyguard
Sage dem schweiß en Kampf an.
36 »Ich würde gern zum FC Bayern Essen gehen.«
Der Küchenchef des Fussbalclubs im Interview.
38 Gemeinschaftsküche
Das »Haus der Kost« in München berät, um mehr Bio in die AußerHaus-Verpflegung zu bringen.
42 Bruderhahn – Zweinutzung
Hennen, die viele Eier legen, haben Brüder, die langsam wachsen.
50 Gesucht: Die perfekte
Biozwiebel
Können alte Bio-Landsorten mit hochgezüchteten Hybridsorten mithalten?
56 Kochbuchempfehlungen
60 Rezensionen
Warnungen, Empfehlungen.
48 Bruderhahn-Produkte
54 Marktplatz Kosmetik
Das Haus der Kost in München hat den Auftrag, mehr Bio in die Gemeinschaftsverpflegung zu bringen. 38
KOLUMNEN
64 Aus dem Verlag
66 Elternalltag

Die Mast der »Bruderhähne« bleibt ein Nischenprogramm und nur bedingt wirtschaftlich. Ein Problem, vier Lösungsansätze.

HITZE IN DER SCHWANGERSCHAFT
Hitze stresst den Körper von Schwangeren.

BIOZWIEBEL
Alte Bio-Landsorten vs. hochgezüchtete Hybridsorten.



sondern eine Welt, in der Olivenöl nicht nur für eine gesündere Ernährung, sondern auch für einen gesünderen Planeten sorgt.

DIEZ OFFICE / OMC°C
Vert steht aktuell auf dem Vorplatz der Bundeskunsthalle in Bonn – Anlass ist die Ausstellung »Wetransform«, die sich dem umweltverträglichen Bauen der Zukunft widmet. Entwickelt und erstmals aufgestellt wurde Vert vom Designbüro Diez gemeinsam mit »OMC°C« für das London Design Festival 2024. Am Ende des Festivals wurde die modulare und mobile Holzkonstruktion zur Begrünung und Beschattung von städtischen Räumen nach vier Wochen dort abgebaut und nun in Bonn wieder aufgebaut. Für das Gerüst wurden in einem eigens entwickelten Verfahren dünne Schichten amerikanischen Eichenholzes zu massiven Trägern verleimt – die Konstruktion ist fast zehn Meter hoch, ebenso breit und

14 Meter lang. Noch nicht sichtbar sind die Pflanzen, diese sollen an Netzen emporwachsen und schattenspendende Segel bilden, auch die Sitzgelegenheiten sind Hängemattennetze, die dazu einladen, zu pausieren. Ziel ist es, das stabile Gerüst mit seinen imposanten Dreiecken auch in Zukunft an weiteren Orten aufzubauen und dafür auch neuen Gegebenheiten anzupassen – als Beitrag zur Klimawandelresilienz dieser Orte.
MARTIN MÜHL
bundeskunsthalle.de/wetransform
LeserInnen an und über uns – Mails, Tweets und hoffentlich Liebesbriefe an die Redaktion – und unsere Antworten.


in biorama 92 (August/September 2024)
»Nun möchte ich mir doch einmal die Zeit nehmen und ein Lob an die AutorInnen und GrafikerInnen Ihrer Zeitschrift schicken. Die Artikel sind modern, beleuchten Themen gut recherchiert aus verschiedenen Blickwinkeln, sehr ansprechend gestaltet. Manchmal lege ich das Heft zur Seite, um zu applaudieren für die gelungenen Wortspiele. Aktuelles Beispiel: Kulinarische Hanfplan-Tage. Ich flippe aus. :-) Herzliche Grüße aus Bayern.«
– CLAUDIA SCHERZER, per Mail
Liebe Frau Scherzer! Wir freuen uns riesig, dass Ihnen unsere Arbeit so gefällt. Eine solche Reaktion auf die Lektüre unserer Artikel ist bisher viel zu selten überliefert. Womöglich haben mehr Menschen einfach noch nicht zum Humor gefunden, das ist traurig, wir möchten Ihr Schreiben zum Anlass nehmen, dazu zu inspirieren, möglichst alles möglichst locker zu nehmen – so weit es die Faktenlage eben zulässt. Falls Sie uns vom nächsten Applaus und dem Anlass dazu in unserem Magazin ein Bild und zwei Zeilen schicken – dürfen Sie sich von uns eine Recherche (mehr Fakten) zu einem Thema Ihrer Wahl wünschen, wenn machbar, wird dann auch ein Artikel dazu veröffentlicht. (Nach Möglichkeit inklusive Wortspiel). Falls es unter unseren LeserInnen weitere gibt, die durch das BIORAMA-Lesen zu physischen Reaktionen bewegt werden, möchten wir auch diese zur Dokumentation (Nachstellen wäre auch akzeptabel) und Einsendung motivieren!



in biorama BIORAMA BIOKÜCHE 2025
»Glückwunsch zu dem sehr lesenswerten Beitrag zum Biohof Voglauer, in dem der Autor vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels einen sehr weitsichtigen Blick in die Zukunft unserer Agrarwirtschaft wagt!
Mir gefällt vor allem die Forderung nach einer Transformationsbegleitung. Ich würde diese jedoch weniger als ›Begleitung zum Aufhören‹ verstehen wollen. Vielmehr könnte sie als Brückenhilfe in eine Agrar-Umwelt-Kulturwirtschaft dienen, in der LandwirtInnen auch Umweltdienstleistungen von Kühen und anderen Weidetieren abgegolten werden –sei es, weil wir die tierfreundliche Weidehaltung als kulturell und touristisch wertvoll erachten, Weidetiere als naturnahe und moderne Form der Biodiversitätsförderung verstehen oder dem Konsum von tierischem Protein doch noch einen höheren Stellenwert geben.
Obwohl ich nicht abstreite, dass wir für eine erfolgreiche Transformation unnachhaltige Praktiken einstellen müssen, plädiere ich im Fall der Familie Voglauer eher für die Zeichnung eines wünschenswerten Diversifizierungs-Szenarios, in dem sich Gourmet-Carnivoren ebenso wie VertreterInnen einer postletalen Landwirtschaft wiederfinden können.«
– ALEXANDRA FRANGENHEIM, per Mail
Liebe Frau Frangenheim!
Vielen Dank für das differenzierte Feedback! Der Ausstieg der Familie Voglauer aus der Milchwirtschaft mag zwar kein untypischer sein, in unserer Reportage war es aber vor allem das Ziel, die Beweggründe im konkreten Fall darzustellen und die wirtschaftlichen Bedingungen aus der Perspektive dieses Betriebs zu erzählen. Freilich gibt es auch andere Möglichkeiten, Landwirtschaft, auch eine auf Milch- und Fleischproduktion ausgerichtete, zu betreiben – wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Wir werden auch darüber weiterhin in kleinen und großen Geschichten berichten – freuen uns auch immer über Anregungen und zweckdienliche Hinweise.
Bitte mehr davon an redaktion@biorama.eu!

INFO UND BERATUNG
+43 2822 54109
info@waldviertel.at waldviertel.at

Es erwarten Sie: außergewöhnliche Orte, außergewöhnliche Menschen und außergewöhnliche Produkte
Unter dem Motto »brutal lokal & fest verwurzelt« haben sich Kulinarik- und Kulturschaffende aus der Region zusammengetan und die neue Erlebnisreihe »Waldviertler TischKultur« entwickelt. Wie der Name schon verrät, wird hier alles an einem Tisch vereint: Tradition & Innovation, Haubenküche & Waldviertler Klassik, Kunst & Kultur. Es geht darum, Gästen die Besonderheiten dieser Region in all ihren Facetten näherzubringen.
Bei diesen Veranstaltungen interpretieren Spitzenköch:innen heimische Klassiker wie Waldviertler Karpfen, Mohn oder Erdäpfel neu und auf Haubenniveau – zwar nicht biozertifiziert, aber natürlich mit vorwiegend regionalen Zutaten und natürlich auch regionalen Bioprodukten. Dazu gesellt sich traditionelles Handwerk: von geschliffenen Kristallkaraffen über mundgeblasene Weingläser bis hin zu gewobenen Leinenservietten. Als Rahmen dienen atemberaubende Naturschauplätze – unter freiem Himmel oder am Waldesrand, aber auch speziell gestaltete Indoor-Locations.
Für noch mehr Abwechslung und Atmosphäre sorgen Künstler:innen.
Zusätzlich kann man die Waldviertler Produzent:innen vor Ort treffen und sich mit den Köch:innen austauschen.
15. Juli – HORA Restaurant & Weinbar am See*
Stefan Ho begrüßt seine Gäste am Steg des direkt am idyllischen Allentsteiger Stadtsee gelegenen Restaurant HORA* gemeinsam mit Petra Zlabinger aus der Kaminstube Zlabinger*
11. September – Schloss Haindorf
Zum Abschluss des Kultursommers in Langenlois, lädt Christian Ensbacher den Sternekoch Roland Huber vom Esslokal* und 2-Hauben-Koch Philipp Wimmer-Joannidis vom Kaiser’s Hof* ins Schloss Haindorf* ein.

Buchen Sie gleich ihre exklusiven Tickets und erfahren Sie warum »brutal lokal & fest verwurzelt« mehr als ein Versprechen ist! waldviertel.at/tischkultur
20. November – Kolm*
3-Hauben-Koch Michael Kolm öffnet zur kühlen Jahreszeit gemeinsam mit Sternekoch Roland Huber vom Esslokal seine Pforten im urigen Ambiente und lädt zu »kulinarischen Eskapaden« ein.
* Nicht biozertifiziert.


54, Fotografin
Das kommt darauf an, wer. Ich glaube, Menschen am eher linken Spektrum tun das nicht, die am rechten schon eher. Ich finde es wichtig, dagegen etwas zu tun –wie aus der Ölwirtschaft auszusteigen. Als Einzelperson glaube ich, dass das Wichtigste ist, sich darüber zu informieren, welche Konsequenzen unser Handeln auf den Planeten hat.

30, Freizeitpädagoge a, da sind wir sehr nachlässig. Auch wenn wir rumspekulieren, dass die Hitze bei uns erst in weiter Zukunft ein richtiges Problem darstellen wird, existiert dieses ja schon in vielen Ländern. Ein Beispiel ist Kalifornien, wo es große Wasserversorgungsprobleme gibt, und da sprechen wir von den reichen USA. Also, es ist ein Jetzt-Problem, das unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Ich finde es ignorant und egoistisch, das nicht zu berücksichtigen. Jede einzelne Person sollte sich damit befassen, aber vor allem der Staat und alle Staaten als Gesamtheit sind verantwortlich, etwas zu tun. Es bringt nichts, wenn wir uns als KleinkonsumentInnen abmühen, aber dann von oben keine Sachen in Gang gesetzt werden.

30, Tanzlehrerin
Als Gesellschaft ja, absolut. Ich merke jetzt mit 30 schon, dass ich die Hitze viel schlechter vertrage als noch vor fünf oder zehn Jahren. Dementsprechend ist es für ältere Leute bestimmt noch schlimmer. Ich glaube, auch Kindern geht es nicht so gut damit, obwohl sie das nicht so einordnen können. Das merke ich bei meinen jüngeren Geschwistern, die in der Schule sitzen, die für diese heißen Tage überhaupt nicht ausgestattet ist.

35, IT-Support
Ich sehe das Ganze entspannter und nicht so schlimm, wie es in den Medien kolportiert wird. Ich finde, es wird nicht so heiß, wie es dargestellt wird, dazu braucht man nur die Statistik anschauen.

79, ehemaliger Mediziner
Ich persönlich nicht und ich glaube, auch in der Gesellschaft passiert ein Umdenken. Man sieht in der Stadt, dass mehr Bäume gepflanzt und Kühlmöglichkeiten wie Wasserzerstäuber installiert werden. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu wenig, aber es passiert etwas. Aber ich muss schon sagen, es kommt auch auf die Umgebung an. Ich komme vom Land und bin erst vor sechs Jahren nach Wien gezogen, und wenn es 27 Grad in der Wohnung hat, ist das nicht mehr ganz fein, da fehlt der schattige Garten schon.

37, Lebens- und Sozialberaterin, Yogalehrerin und Doula Ja, wir nehmen sie auf die leichte Schulter. Sie betrifft in unserem Umfeld besonders alte Menschen, aber auch sehr junge. Als
Mutter von zwei kleinen Kindern ist es mir zum Beispiel bewusst, dass im Sommer die Schlafräume nicht heißer als 18 Grad sein sollten – unser Schlafzimmer hat in der Jahreszeit aber nie unter 25 Grad. Aber nicht nur Menschen leiden unter Hitze, sondern auch der Planet.
Ich glaube, es müssen sowohl Einzelpersonen als auch der Staat etwas tun. An alle Menschen, die in Wien wohnen: Auto abschaffen, Rad und Öffis nutzen! Aber eigentlich sind es große Unternehmen, die maßgeblichen Einfluss auf die Erderwärmung haben, und da braucht es Maßnahmen der Regierung.

23, Architekturstudentin
Ja, viel zu sehr. In den Städten wird es immer heißer und dafür müssen wir Lösungen finden. In meinem Studium befassen wir uns zum Beispiel mit kühlenden Materialien und Stadtgestaltung generell. Ich befürchte auch, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie schlimm es mit der Klimaerwärmung ist, und sie denken sich: ›Ein halbes oder ein Grad wärmer klingt nicht so tragisch‹ – ist es aber.

29, IT-Security-Spezialist
Ich habe von Studienkollegen Erfahrungen aus Indien gehört, wo regelmäßig ein Prozentsatz an alten Menschen durch Hitzewellen stirbt. In Österreich wird das Thema, finde ich, ein bisschen ignoriert und durch bequeme Lösungen wie Klimaanlagen im Wohnraum zu umgehen versucht. Besser wäre etwas Nachhaltigeres, wie Grünflächen und Bäume, die Schatten spenden. Ich merke das sehr stark, dass Straßen mit Baumalleen, wo früher nur Asphalt war, jetzt viel kühler sind.

28, Studentin
Ich würde sagen, die Wirtschaft und die Politik nehmen sie auf jeden Fall zu sehr auf die leichte Schulter. Ich glaube aber nicht, dass die ganze Gesellschaft das tut. Ich wohne mitten in der Stadt und da hat es abends manchmal noch 32 Grad, was Schlafen sehr schwierig macht. Es ergibt sich dann das Problem, dass man einen Ventilator nimmt und damit eigentlich wieder extra Hitze erzeugt. Ich finde es
schade, dass nicht mehr in den Städten passiert, um das Thema anzugehen, zum Beispiel mit Begrünung. Auch wichtig wäre die Erneuerung von altem Baubestand, um das mit der Möglichkeit besserer Kühlung und Heizung im Winter zu verbinden.

24, arbeitet bei Ikea
Ja. Ich glaube, viele Leute hier sind die Hitze und diese häufig vorkommenden schnellen Wetterumbrüche gar nicht gewohnt. Vorige Woche hatten wir knapp zehn Grad und dann auf einmal 30. In meinem Bekanntenkreis ist das eher etwas, was nur als unangenehm empfunden wird, aber ich sehe oft in den Nachrichten, dass RentnerInnen Probleme bekommen und Hitzetode zunehmen. Ich glaube, eigentlich ist die Hitze bewältigbar, aber uns fehlt die Infrastruktur. Wenn man in Regionen schaut, wo es generell heißer ist, gibt es überall Klimatisierung, bei uns eben überhaupt nicht. In den Öffis ist das besonders schlimm, es wäre gut, wenn sich das ändern würde.

47, Frühpensionistin nach einem Schlaganfall Auf jeden Fall. Rein gesundheitstechnisch glaube ich, dass ältere Menschen, Leute mit Beeinträchtigungen und Kinder besonders betroffen sind und unter der Hitze leiden, genauso wie unsere Tiere. Ich finde es sehr schade, dass wir zu wenig Begrünung haben – obwohl ich sagen muss, dass die Stadt Wien schon sehr viel macht. Es gehören trotzdem mehr Bäume in die Stadt und mein Vorschlag wäre zum Beispiel, die Gleise der Straßenbahnen zu begrünen, das gibt es in anderen Städten auch. Ich wäre auch dafür, dass jegliche neu gebaute Halle eine Grünfläche am Dach haben muss. Das würde ich machen, wenn ich in der Politik sitzen würde.

Daniel ist stolz auf seinen Job, in dem er an der Zukunft unserer Gesellschaft arbeitet. Er trägt dazu bei, dass unsere Kinder von Beginn an gefördert werden. Diese wichtige Aufgabe motiviert ihn täglich aufs Neue.
Die Stadt Wien bietet ihm ein faszinierendes, vielfältiges und innovatives
Arbeitsumfeld und das in einem krisensicheren Job mit Verantwortung und einer guten Work-Life-Balance.
Arbeite auch du an Wien und bewirb dich unter: jobs.wien.gv.at #arbeitenanwien


»Jeden der 23 Wiener Bezirke möchten sie besuchen, und zwar zu Fuß!«
— Petra Jens, Beauftragte für Fußverkehr der Stadt Wien
Gerda und Leonie haben diesen Sommer etwas vor. Großmutter und Enkelin machen gemeinsam Städteurlaub in Wien. Genau genommen wohnen sie da auch, aber schließlich kann man überall noch etwas Neues entdecken. Jeden der 23 Wiener Bezirke möchten sie besuchen, und zwar zu Fuß! Dafür haben sie sich spezielle Reiseführer von der Mobilitätsagentur Wien besorgt. In den »Grätzlrallyes« finden sie Reisetipps und lustige Rätsel zu Straßen, Parks und Gebäuden. Leonie findet heraus, dass es auch anderswo richtig coole Spielplätze gibt, und Gerda entdeckt so manches charmante Kaffeehaus. Es ist ein entspannter Städteurlaub, den sich die beiden dieses Jahr gönnen. Zu Fuß und mit Öffis lernen sie ganz Wien kennen. Jede Tour endet in einem schönen Park, wo sie den Nachmittag ausklingen lassen – am liebsten mit einem Eis! mobilitaetsagentur.at/bildung
Das Volksbegehren »Mountainbiken Freies Wegerecht« fordert eine gesetzliche Neuregelung, die den Sport im Wald generell erlaubt.
In Österreich ist das Mountainbiken in Wäldern für die etwa 800.000 heimischen RadfahrerInnen grundsätzlich verboten – es sei denn, der oder die GrundeigentümerIn erteilt explizit eine Genehmigung. Das Volksbegehren »Mountainbiken Freies Wegerecht« kritisiert das – und argumentiert mit wirtschaftlichen Nachteilen dieser Regelung, insbesondere im Tourismus. In anderen Ländern Europas sei das Mountainbiken auf Forstwegen erlaubt und das Angebot dadurch deutlich besser. Außerdem komme es immer wieder zu Konfliktsituationen zwischen FahrradfahrerInnen, GrundeigentümerInnen und der JägerInnenschaft. Die InitiatorInnen des Volksbegehrens fordern aus den genannten Gründen eine gesetzliche Neuregelung, die das Radfahren auf geeigneten Wegen im Wald generell erlaubt – als Pendant zum Wandern. Sie schlagen vor, bestehende, ausreichend breite Wege, die der forstlichen Nutzung oder Erholungszwecken dienen, ohne Zustimmung der EigentümerInnen befahren werden dürfen. Die Nutzung durch RadfahrerInnen soll gegenüber FußgängerInnen nachrangig sein.
Das Volksbegehren befindet sich derzeit in der Unterstützungsphase. Ist diese erfolgreich, wird das Eintragungsverfahren gestartet. Bei Erreichen von 100.000 Unterschriften muss das Anliegen im Nationalrat behandelt werden.
bmi.gv.at
HANNA STUMMER


ÖSTERREICH: PROBLEMSAMMELSTELLE
Verbesserungen beginnen oft mit dem Finden konkreter Probleme. Das AWS sucht jene in den Lebensmittelsystemen.
Dir macht die Hitze nichts aus? Dann werde Hitzebuddy für eine Person, der es anders geht.
Das Zitat von den Herausforderungen, in denen sich bei richtiger Sichtweise Chancen erkennen lassen, haben wir zu oft gehört. Aber die Identifikation ungelöster Probleme ist im besten Fall der nötige Impuls für Veränderung. Das ist auch in den komplexen Lebensmittelsystemen nicht anders. In drei Fördercalls der »AWS Sustainable Food Systems Initiative« hat das Austria Wirtschaftsservice bereits Lösungen für die Transformation in Richtung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme gefördert – nun geht es als Community einen Schritt zurück, an mögliche Anfänge. Alle AkteurInnen der Lebensmittelsysteme, aber auch private KonsumentInnen sind aufgefordert, bis Ende August 2025 ihre Erfahrungen auf der Onlineplattform »Gemeinsam gestalten« zu teilen und »ungelöste Probleme im nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln« zu melden. Dabei kann es um Produktion, Verarbeitung, Transport, Lagerung, Vermarktung oder (Wieder-)Verwertung gehen und alles andere, das auf- und einfällt. Die Einreichungen werden anonym ausgewertet und in Innovationsfelder kategorisiert. Im Rahmen eines großen Community-Events im Oktober werden diese präsentiert und als mögliche Transformationshebel jenen mitgegeben, die sich ihrer als Unternehmen oder in anderen Organisationsformen annehmen wollen.
gemeinsamgestalten.at
MARTIN MÜHL
Mit den durch die Klimaerwärmung zunehmenden Hitzewellen wird auch die Belastung für besonders gefährdete Gruppen wie ältere Menschen, Kranke und Säuglinge größer. Bei diesen Menschen funktionieren die körpereigenen Abkühlmechanismen häufig nicht ideal, womit die Hitze für sie schnell zu einem Gesundheitsproblem werden kann. Das Projekt »Hitzebuddys« soll Unterstützung für diese vulnerablen Zielgruppen bieten. Organisiert wird es vom Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leukental, zusammen mit dem Land Tirol und der Klimawandelanpassungsregion »Klar Regio 3«, einem Förderprogramm des Klima- und Energiefonds, das Gemeinden und Regionen bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt. Die »Hitzebuddys« werden unter anderem darin geschult, betroffenen Personen in Hitzesituationen zu helfen oder sie darin zu beraten, ihre Aktivitäten anzupassen. Außerdem lernen sie hilfreiche Tipps, wie Menschen leichter mit der Hitze umgehen können. Mit dem Projekt soll ein Netzwerk ehrenamtlicher Betreuender aufgebaut werden, die während starker Hitzeperioden auch für Besuche, Telefonate oder andere Kontaktformen zur Verfügung stehen. Besonders ältere Menschen leiden in Hitzezeiten an verringerten Sozialkontakten, wodurch zusätzlich zu den körperlichen Problemen auch die mentale Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Freiwillige, bitte melden! HANNA STUMMER
regio-tech.at

Entdeckertouren in Niederösterreich.
Der kühle Fahrtwind im Haar. Die Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft. Nur das eigene Schnaufen stört die grenzenlose Idylle. Klingt verführerisch? Dann ab in den Sattel und auf nach Niederösterreich, wo sechs fein kuratierte Rad-Entdeckertouren auf Sie warten. Ob gemütlich oder sportlich ambitioniert, auf historischen Spuren oder inmitten kultureller Highlights – entlang der Wege bieten kleine, feine Hotels, traditionelle Wirtshäuser und versteckte Plätze immer wieder Gelegenheit zum Verweilen. Bereit, neue Lieblingsorte zu entdecken?
Wer die Energie unberührter Flusslandschaften spüren möchte, ist am Ybbstal- und Erlauftalradweg im Mostviertel genau richtig. Entlang ehemaliger
Bahntrassen durchqueren Sie Naturjuwele wie die eindrucksvolle Schlucht »Ofenloch» oder fahren direkt in Richtung Ötscher, stets umgeben vom leisen Rauschen kühler Flüsse. Mit dem Lunzer See, Niederösterreichs einzigem Natursee, wartet schließlich eine verdiente Erfrischung nach der Radtour – authentisches Naturerlebnis inklusive.

Wer den besonderen Kick im Urlaub sucht, fährt direkt auf die Wexl Trails. Wo früher ausschließlich Wandernde und Kletterbegeisterte unterwegs waren, lautet heute das Motto: Freiheit spüren, Flow genießen! Die sicheren Trails unterschiedlicher Levels begeistern sowohl Anfänger:innen als auch Mountainbike-Profis. Vom sanften Trail durch schattige Wäl-
der bis hin zu aussichtsreichen Panoramen auf Almhöhen –die Wexl Trails wurden bewusst naturschonend konzipiert, was eine Balance aus Action und Nachhaltigkeit ermöglicht. Wer noch mehr Abenteuer spüren möchte, macht zusätzlich einen Abstecher zum nahen Bikepark Semmering: Adrenalinkick inklusive!
GRENZERFAHRUNGEN SAMMELN
Der Iron Curtain Trail erzählt nicht nur von vergangenen Zeiten – er lässt Geschichte regelrecht lebendig werden. Alte Panzerstraßen, ehemalige Grenzanlagen und stille Bunker erinnern an eine Zeit vor einem vereinten Europa. Wer hier unterwegs ist, radelt mitten durch eines der waldreichsten Gebiete Österreichs, in dem sich Spuren der Vergangenheit heute harmonisch mit artenreicher Natur verwoben haben.
Auch im Wienerwald treffen Natur und Kultur auf außergewöhnliche Art und Weise aufeinander. Auf der Klöster Kaiser Künstler Tour finden sich Kunst und Natur, Kultur und Landschaft auf engstem Raum vereint. Von prachtvollen Schlössern und geheimnisvollen Klöstern über idyllische Wege durch stille Täler – hier eröffnen sich neue Perspektiven vor den Toren Wiens. Was bereits weltberühmte Künstler:innen einst als Rückzugsorte nutzten, bietet auch heute viel Raum, den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Im Weinviertel eröffnet sich Radfans ein schier endloses Radwegenetz. Eines der Herzstücke sind die Sternfahrten rund um Retz, wo man besonders spürt, dass der Wein hier zu Hause ist. Ein Hauch von Nostalgie liegt über den »Dörfern ohne Rauchfang« und alten Kopfsteinpflasterwegen, wo heute gesellige Weinfeste und kulinarische Veranstaltungen aller Art stattfinden. Wenig verwunderlich, dass die traditionellen Kellergassen beliebte Treffpunkte für Radfahrer:innen sind, um zu rasten, einzukehren und zu verweilen.
KOPF AN KOPF MIT DEM STROM
Der Donauradweg verbindet auf seiner rund 210 Kilometer langen Etappe zwischen Ybbs und Bratislava Naturgenuss mit zahlreichen Energieplätzen direkt am Wasser. Entlang der sanften Weinberge und historischen Ortschaften entfaltet sich die Donau in voller Kraft. Zwischen beeindruckenden Ruinen, Badestränden und Sonnenterrassen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ganz bewusst innezuhalten und neue Energie zu schöpfen. Marillen- und Weingärten, Kletterfelsen oder charmante Heurigenlokale – selten findet man Ruhe und Vielfalt so angenehm kombiniert wie beim Radfahren entlang der Donau.
Nicht alles oder jedes, sondern das wirklich Besondere verraten Ihnen unsere fein kuratierten Reisetipps, die von Locals persönlich stammen oder gute Freunde und Freundinnen

Auf den Wexl Trails warten Freiheitsgefühle und Adrenalinkicks.
vor Ort empfehlen. Nähere Informationen zu den Rad-Entdeckertouren finden Sie unter www.niederoesterreich.at/entdeckertouren-rad.
INSPIRIEREN LASSEN! NIEDERÖSTERREICHS RADKARTE MIT DEN SCHÖNSTEN TOUREN UND REISETIPPS KOSTENLOS BESTELLEN ODER DOWNLOADEN:

Planen Sie Ihren Urlaub in Niederösterreich? Wir helfen gerne weiter: Tel +43 (0)2742/9000-9000 info@noe.co.at, www.niederoesterreich.at visitniederoesterreich visitniederoesterreich
Silke Jäger Hitze stresst den Körper von Schwangeren. Durch den Klimawandel werden Frühgeburten zunehmen.
TEXT
In den meisten Ländern der Welt sorgt der Klimawandel für mehr als doppelt so viele Hitzetage, die für Schwangere gefährlich sind.
22 Tage pro Jahr waren das in Deutschland während der vergangenen fünf Jahre, 27 in Österreich: So oft war die Hitze so groß, dass sie ein Risiko für die Gesundheit von Schwangeren darstellte. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Bericht von Climate Central.
Derzeit endet circa eine von zehn Schwangerschaften mit einer Frühgeburt. Doch angesichts der Klimaprognosen rechnen WissenschaftlerInnen damit, dass Frühgeburten häufiger werden. Im Jahr 2033 könnten circa 15 Prozent der Geburten Frühgeburten sein. Oder anders gesagt: Fast jedes sechste Kind könnte zu früh auf die Welt kommen. Das zeigt eine im Juli 2023 veröffentlichte Studie des Universitätsklinikums Hamburg, die
Einlingsschwangerschaften einer Hamburger Spezialklinik der Jahre 1999 bis 2021 untersucht und unter anderem Zusammenhänge zu den Wetterdaten für diesen Zeitraum geprüft hat
Hauptursache für das gestiegene Frühgeburtsrisiko ist Hitzestress für werdende Mütter. Was bedeutet eine Frühgeburt für ein Kind, wieso macht Hitze Frühgeburten wahrscheinlicher, und wie lässt sich die Gesundheit von Müttern und Kindern im Klimawandel besser schützen?
FOLGEN EINER FRÜHGEBURT FÜR DAS KIND
Eine Frühgeburt birgt verschiedene Gesundheitsgefahren sowohl für die erste Lebensphase als auch für das weitere Leben. Das Gesundheitsrisiko für Frühgeborene lässt sich anhand verschiedener Faktoren abschätzen.
Normalerweise dauert eine Schwangerschaft ungefähr 40 Wochen. Kommt ein Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt, gilt es als Frühgeburt. Frühgeborene können nach der Dauer der Schwangerschaft und nach ihrem Geburtsgewicht in Kategorien eingeteilt werden.
Ein wesentlicher Faktor für die Abschätzung von Komplikationen ist der Reifegrad der Organe zum Zeitpunkt der Geburt. Dabei gilt grob: Je jünger und leichter ein Kind ist, desto höher ist sein Risiko für Komplikationen, zum Beispiel für einen Stopp der Lungenreifung. Dann kann die Lungenfunktion ein Leben lang eingeschränkt sein; das kann das Herz-Kreislauf-System dauerhaft belasten. Generell haben zu früh Geborene ein höheres Risiko für Infektionen, Allergien und Asthma. Frühgeburten können die Entwicklung des Kindes aber auch insgesamt verzögern und mit Konzentrationsstörungen und schlechteren Schulleistungen zusammenhängen. Das betrifft auch Kinder, die als modera-
Frühgeburten nach Schwangerschaftsdauer:
1. Extrem frühe Frühgeburt: Die Geburt findet vor der vollendeten 28. Schwangerschaftswoche statt
2. Frühe Frühgeburt: Die Geburt findet zwischen vollendeter 28. und 32. Schwangerschaftswoche statt
3. Mäßig frühe Frühgeburt (auch späte oder moderate Frühgeburt genannt): Die Geburt findet zwischen vollendeter 32. und vollendeter 37. Schwangerschaftswoche statt
Frühgeburten nach Geburtsgewicht:
1. Extrem niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 1000 Gramm
2. Sehr niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 1500 Gramm
3. Niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 2500 Gramm.
te Frühgeburten zur Welt kamen, wie die ABCD-Studie, eine aktuelle Studie an fast 12.000 Kindern in den USA, nahelegt. Hitzestress erhöht das Risiko für eine Frühgeburt. Der Zusammenhang zwischen Frühgeburten und gefährlichen Hitzetagen im letzten Schwangerschaftsdrittel zeigt sich in vielen Ländern, zum Beispiel in China, Nepal, Südafrika, Burundi, Nigeria, Haiti und den USA. Aber auch in Europa nehmen Gesundheitsprobleme in der Schwangerschaft an Hitzetagen zu.
Eine Gradzahl, ab der Hitze zur Gesundheitsgefahr wird, kann man leider nicht nennen. Ausschlaggebend ist die gefühlte Temperatur. Sie hängt auch von der Luftfeuchtigkeit und von den Windverhältnissen ab – und natürlich von der Konstitution einer Person.
HITZESTRESS BELASTET MUTTER UND KIND. In einer Langzeitstudie untersuchen For-
Climate Central ist eine Non-Profit-Organisation aus WissenschaftlerInnen und KommunikationsspezialistInnen. Sie sammelt Fakten über den Klimawandel und erklärt, wie er das Leben der Menschen verändert.
Die Abkürzung ABCD steht für Adolescent Brain and Cognitive Development, übersetzt: Heranwachsendes Gehirn und kognitive Entwicklung. Die ForscherInnen wollten herausfinden, wodurch bestimmte Schwierigkeiten entstehen, die den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Das betrifft zum Beispiel den Wortschatz, die Lesefähigkeit, die Mustererkennung, das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit. Dafür testeten sie neun- bis zehnjährige Kinder in diesen Bereichen.
Dabei stellten sie fest, dass Kinder, die in der 32. oder 33. Woche als moderate Frühgeburt zur Welt gekommen waren, häufiger Schwächen im Wortschatz sowie mit dem autobiografischen und dem kurz- und langfristigen Erinnerungsvermögen hatten. Auf die Testergebnisse hatten sozioökonomische Faktoren, wie zum Beispiel das Einkommen und Vermögen der Eltern, keinen Einfluss. Auch Verzerrungen durch genetische Faktoren rechneten die WissenschaftlerInnen aus den Ergebnissen heraus.
Allerdings stach den ForscherInnen etwas anderes ins Auge: Kinder, die zwischen der 28. und der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden, hatten weniger kognitive Defizite als zwischen der 32. und der 37. Woche geborene Kinder. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die frühen Frühgeborenen intensiver gefördert wurden.
scherInnen des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) seit 2011, wie sich der Lebensstil einer werdenden Mutter auf die spätere Gesundheit des Kindes auswirkt. Das Ziel der Studie ist, molekulare Mechanismen zu entschlüsseln, die bereits vor der Geburt die Grundlagen für spätere Gesundheitsprobleme legen.
Unter den zahlreichen Einflussfaktoren, die die ForscherInnen dabei fanden, befindet sich auch Hitzestress. Dieser Stress entsteht, wenn der Körper der Schwangeren seine ganze Kraft darauf verwendet, sich selbst und den Körper des Säuglings zu kühlen und das Baby gleichzeitig zu versorgen.
Dabei steigt das Risiko für eine späte Frühgeburt in den ersten sieben Tagen nach einem Hitzetag. Das stellten ForscherInnen des UKE beim Vergleich von Geburtsdaten mit Wetterdaten fest. Blieb es länger als zwei Tage heiß, kam es vermehrt zu vorzeitigen Wehen – vor allem, wenn eine erhöhte Luftfeuchtigkeit das gefühlte Wärmeempfinden steigerte. Vorzeitige Wehen können eine Frühgeburt ankündigen.
Besonders gefährdet für eine Frühgeburt sind nach den Daten der Forschenden weibliche Babys. Warum das so ist und welche molekularen Mechanismen zu einem höheren Frühgeburtenrisiko führen, verstehen die WissenschaftlerInnen aber noch nicht ausreichend.
Was genau führt nun zu einem Anstieg des hitzebedingten Frühgeburtsrisikos? Über die genauen Mechanismen rätseln Forschende noch. Die Ursachenforschung ist schwierig, weil es aus ethischen Gründen nicht erlaubt ist, Schwangere absichtlich Hitzestress auszusetzen. Aus Stammzellforschung und Untersuchungen an Tieren leiten ForscherInnen vor allem drei Theorien ab.
THEORIE 1:
VERÄNDERTER BLUTFLUSS UNTER HITZEBEDINGUNGEN
Bei Stress steigt die Herzfrequenz, dadurch wird die Plazenta weniger gut durchblutet. Dann gelangen weniger Sauerstoff und Nährstoffe zum Kind. Bei Hitze weiten sich die Gefäße, um mehr Wärme an die Umgebung abgeben zu können. Dazu kommt: Im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn Frauen bereits zugenommen haben und das Gewicht des Kindes auf die Hauptvene drückt, gelangt weniger Blut zum Herzen. Beides kann dazu führen, dass die Gebärmutter schlechter durchblutet und die Versorgung des Kindes beeinträchtigt wird, vermuten die Hamburger ForscherInnen.
THEORIE 2:
GESTÖRTER SCHLAFRHYTHMUS DURCH TROPISCHE NÄCHTE
Fehlender Schlaf durch tropische Nächte verstärkt den Effekt weiter. Der Körper schüttet in dieser Situation weniger Schwangerschaftsund mehr Stresshormone, wie zum Beispiel Cortisol, aus. Diese Stresshormone können über die Plazenta zum Baby gelangen. Übersteigt die Konzentration der Stresshormone eine gewisse Schwelle, kommt es zu vermehrter Zellteilung im kindlichen Organismus. Dabei können Zellen sterben oder geschädigt werden, die wichtig für die Reifung von Organen und des Immunsystems sind. Das könnte die
Schwüle Hitze ist für den Körper belastender, da bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Wind und starker Sonneneinstrahlung die gefühlte Temperatur die gemessene Lufttemperatur übertrifft. Das erschwert die körpereigene Kühlung.
Das AutorInnenteam von Climate Central zählte für seinen Bericht in 247 Ländern die Tage, an denen lokal die maximale Temperatur höher lag als an 95 Prozent der Tage. Dazu verglichen sie die Werte mit einem Zeitraum zwischen 1991 und 2020. Nach Ansicht der ForscherInnen ergibt sich daraus ein Schwellenwert, ab dem das Risiko für eine Frühgeburt steigt. Für Deutschland heißt das: Der Klimawandel sorgte für zwölf gefährliche Hitzetage mehr pro Jahr, jeweils insgesamt 22 Tage in den Jahren zwischen 2020 und 2024 im Durchschnitt. Und in Österreich kamen gefährliche 17 Hitzetage dazu, eine Steigerung von über 60 Prozent auf insgesamt 27 Tage pro Jahr mit erhöhtem Risiko für Schwangere.
Vor allem, wenn die Temperaturen an mehreren Tagen hintereinander die errechnete Marke überschreiten, steigt die Gefahr für Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel. Dabei gilt: Je länger eine Hitzewelle dauert, desto höher ist das Gesundheitsrisiko für sie –übrigens auch für Bluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes, Krankenhauseinweisungen und Tod.
erhöhte Allergieneigung von Frühgeborenen erklären.
ENTZÜNDUNGSKASKADE AUF ZELLULÄRER EBENE.
Hitzestress könnte ebenso einen Entzündungsvorgang in Gang setzen, wodurch vermehrt Prostaglandin ausgeschüttet wird. Dieses Hormon macht den Gebärmuttermund weicher. In Tierversuchen zeigte sich bei Hitze auch eine erhöhte Konzentration von Oxytocin, eines Hormons, das Wehen auslösen kann. Wahrscheinlich wirken diese drei Faktoren zusammen und verstärken sich teilweise gegenseitig.
Auch die Gesundheit der Mütter leidet unter einer Frühgeburt. Eine 2018 veröffentlichte Studie, die Daten von über 1000 Müttern aus den USA untersuchte, die an einer Langzeitbeobachtung teilgenommen hatten, belegte ein höheres Risiko für Bluthochdruck und koronare Herzkrankheiten (also Verengungen der Herzgefäße) für Mütter nach einer Frühgeburt. Ihr
Mehr als 800 Schwangere haben an der sogenannten Prince-Studie teilgenommen. Prince steht für Prenatal Identification of Children’s Health, übersetzt: Vorgeburtliche Identifikation der kindlichen Gesundheit.
»Guter Hoffnung« zu sein –ein altmodischer Ausdruck für Schwangerschaft – fällt unter diesen Umständen nicht gerade leicht.
Oft fühlen sich Mütter von Frühgeborenen noch monatelang nach der Geburt gestresster, müder und aggressiver als Mütter, deren Kinder zum errechneten Termin geboren wurden.
Risiko für Depressionen bleibt noch lange nach der Geburt erhöht.
Wie kann man Schwangere vor den Folgen des Klimawandels besser schützen?
Erstens ist wichtig, dass die Gesundheitsversorgung möglichst gut auf den Bedarf von Schwangeren an Hitzetagen vorbereitet ist. Deshalb plädieren verschiedene Berufsverbände der Gynäkologie und Geburtshilfe dafür, die Prävention von Schwangerschaftsproblemen durch Hitzestress voranzutreiben. Das heißt: Der Treibhausgasausstoß muss sinken – je schneller und stärker, desto besser für die Gesundheit.
Viertens muss das Gesundheitssystem klimaresilienter und nachhaltiger werden. Dazu gehört auch, Hebammen und GynäkologInnen stärker bei der Entwicklung von Hitzeaktionsplänen einzubeziehen und Frauen und Schwangere als Risikogruppe mitzudenken. Derzeit müssen Schwangere noch viel zu oft mit überhitzten Kreißsälen zurechtkommen. Außerdem sorgt chronischer Personalmangel für zusätzlichen Stress: Es bleibt kaum Zeit für die Bewältigung der normalen Aufgaben. Wenn Schwangere bei Hitze mehr Fürsorge brauchen, zum Beispiel zur Abkühlung des Körpers und zur Stabilisierung des Kreislaufs, fehlt dafür häufig die Zeit.
Fünftens muss notwendiges Wissen über Hitzestress in der Schwangerschaft ein fester Teil von Ausbildung und Studium der Gesundheitsberufe werden.
Klimaresiliente Gesundheitssysteme sind sowohl auf Extremwetterereignisse vorbereitet als auch in der Lage, mehr chronisch Kranke zu versorgen. So steigt zum Beispiel durch den Klimawandel die Zahl der AllergikerInnen.
Zweitens müssen kommunale und überregionale Regierungen die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben. Dazu gehört insbesondere die Begrünung von Städten. Mehr Schatten und niedrigere Temperaturen in Grünanlagen reduzieren den Hitzestress an heißen Tagen. Parks sind aus vielen Gründen gut für die Gesundheit, auch weil sie soziale Kontakte fördern und Zellen verjüngen. Sie sind regelrechte Jungbrunnen. Zudem sollen Hitzeaktionspläne besonders gefährdeten Gruppen helfen, rechtzeitig klimatisierte öffentliche Räume aufsuchen zu können.
Drittens müssen die Auswirkungen des Klimawandels auf Schwangerschaft und Geburt besser erforscht werden. Das fordern MedizinerInnen, zum Beispiel: Wie wirken sich hohe Feinstaub- und Ozonkonzentrationen auf die Gesundheit von Mutter und Kind aus? Beeinflusst Hitze die Organentwicklung im Mutterleib? Wie hängen Schwangerschaftskomplikationen mit den höheren Temperaturen zusammen?
Fachleute bescheinigen dem deutschen Gesundheitswesen, derzeit nicht ausreichend auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereitet zu sein. Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der dafür notwendigen Transformation. Dazu entstand das Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen (Klimeg). Es bietet Materialien, Workshops und Beratung an. Auch in Österreich gibt es noch Luft nach oben. Ein Klimaresilienzplan, wie ihn etwa Kanada oder Schweden haben, soll erarbeitet werden. Grundlage dafür ist ein Bericht, den das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2024 in Auftrag gab. Ein Zielkatalog zeigt den Weg dorthin auf.
Düstere Klimaprognosen erhöhen das Stressniveau für Schwangere noch aus anderen Gründen: Wenn (kriegerische) Konflikte und wirtschaftliche Probleme zunehmen, steigt auch die Zukunftsangst. So steht bereits für Kinder, die noch gar nicht geboren sind, die Gesundheit auf dem Spiel und es werden schon früh die Weichen in Richtung Krankheiten gestellt – und das, obwohl diese Entwicklung mit einem ambitionierteren Klimaschutz vermeidbar wäre. »Guter Hoffnung« zu sein – ein altmodischer Ausdruck für Schwangerschaft – fällt unter diesen Umständen nicht gerade leicht.

In deinem Tempo durch deine Stadt. Top-Kondition
zu Top-Konditionen. Du kannst alles erreichen!
Immer in Bewegung: Ein Abo von WienMobil Rad bringt dich jeden Tag fit und flexibel ans Ziel.
Die gefühlte Temperatur hat sehr objektive Auswirkungen. Wenn auch nicht für alle die gleichen.

TEXT
Irina Zelewitz

Dr. Peter Hoffmann ist Klimaforscher am Climate Service Center Germany (Gerics), einer Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Hereon.
Sie ist fixe Nebendarstellerin im Wetterbericht und auch die meisten Smartphone-Apps bieten sie ergänzend zur Anzeige der tatsächlichen Temperatur an: die gefühlte Temperatur. Anders als ihr Name vielleicht vermuten lässt, ist sie ein durchaus hilfreicher Indikator dafür, welche Belastung die Wetterbedingungen für unseren Körper darstellen. Denn sie drückt aus, an welche Temperatur dieser sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen anpassen muss. Und der Einsatz dieser Werkzeuge verlangt ihm so einiges ab.
»Unser Körper muss seine Kerntemperatur halten, dazu hat er Mechanismen, wir nennen das Thermoregulation«, erklärt Peter Hoffmann, Klimaforscher am Climate Service Center Germany (Gerics) – und diese Anstrengungen hängen eben nicht nur von der Temperatur, sondern auch von Wind, Luftfeuchtigkeit, Sonnenstrahlung wie auch der Abstrahlung von Ge-
bäuden und Boden ab. »Die Summe dieser Effekte wird als gefühlte Temperatur zusammengefasst«, sagt Hoffmann, »und die Anpassung an diese, ein Beispiel hierfür ist das Schwitzen, nicht ausreicht oder gestört ist, kann das auch negative Auswirkungen haben, etwa Hitzestress. Der ist vor allem ein Problem bei Kindern oder geschwächten Personen«. Wenn nämlich die Thermoregulation eines Körpers nicht so gut funktioniert, droht schon früher Hyperthermie (Überhitzung) bis zum Hitzekollaps. Allerdings kann sie, auch wenn sie funktioniert, selbst zur Belastung werden: zum Beispiel, indem der Körper durch Weitung der Blutgefäße mehr Wärme abgibt, dadurch der Blutdruck abfällt und das Herz-Kreislauf-System belastet.
Die gefühlte Temperatur fließt aus diesen Gründen auch in die Hitzewarnungen mit ein
– sie bietet Orientierung nicht nur für Vulnerable und deren soziale Umgebung. »Wenn ich mich zum Beispiel frage, ob ich mein Kind noch zum Fußballspielen rausschicken soll oder ob es dazu zu heiß ist, ist ein Blick auf die gefühlte Temperatur sinnvoll«, aber man solle sich nicht die Illusion machen, dass das nur bestimmte Gruppen betreffe, betont Hoffmann, »es ist wichtig, dass Bewusstsein entsteht, dass Hitze den Körper stresst – auch den von jungen, fitten Menschen«. Wer weiß, dass gefühlte Hitze zum Beispiel auch Aktivität berücksichtigt, denkt vielleicht auch daran, das eigene Aktivitätslevel an diesen Tagen runterzuschrauben und plant schon im Vorhinein entsprechend. Über mehr Aspekte des erwarteten Wetters als Temperatur, Bewölkung und vielleicht noch Windaufkommen informieren sich ja die wenigsten Menschen im Vorhinein. »Die gefühlte Temperatur enthält die wichtigsten Einflussfaktoren – die man selber eben unter Umständen ja nicht kennt«.
GEFÜHLE AUSTESTEN
Wo ein Gefühl, da muss auch ein Lebewesen sein – wie also wird festgestellt, wie Umgebungsbedingungen sich für uns anfühlen? Um nun für einen bestimmten Tag die gefühlte Temperatur zu ermitteln, werden alte Untersuchungsergebnisse mit neuen Wetterdaten kombiniert: »Zugrunde liegen größere Studien und Befragungen, unter anderem aus den 1970ern, bei denen Menschen in Kammern mit unterschiedlichen Temperaturen gesetzt und gefragt wurden, ob ihnen zu warm oder zu kalt ist«, erklärt Hoffmann und schickt nach: »Man muss dazu sagen, dass sich bei jeder Temperatur mindestens 5 % nicht wohlfühlen.« Die echte Komfortzone ist also begrenzt intersubjektiv gültig feststellbar. Modellierungen versuchen, Standardmenschen zu definieren.
In Deutschland ist das Modell, das üblicherweise herangezogen wird, der Klima-Michel. Er soll den Standardmenschen mimen, an dem wir uns orientieren – wenn der Wetterbericht Auskunft über die gefühlte Temperatur gibt, dann meint er damit die für ihn. Und er ist ein »flott gehender« Waldspaziergänger, der bei 1,75 Größe 75 Kilogramm wiegt. In puncto Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen
entspricht er vermutlich eher einem Idealtypus – klar ist, wenn wir uns von diesen Bedingungen entfernen, verspüren wir auch extremere gefühlte Temperaturen. Es gibt durchaus auch Modellierungen, die etwa gezielt ältere Menschen in den Mittelpunkt stellen – aber die von einer Klima-Michaela im Seniorinnenalter gefühlte Temperatur ist noch nicht dem täglichen Wetterbericht zu entnehmen.
Jenseits der individuellen Möglichkeiten, die gefühlte Temperatur zu berücksichtigen, weist Hoffmann wie viele ExpertInnen eindringlich darauf hin, dass viele Kommunen noch keine Hitzeaktionspläne haben. Die brauche es, »auch in Städten, wo es gar nicht so heiß ist, etwa Hamburg, das inzwischen über einen Hitzeaktionsplan verfügt, bedeutet eine Zunahme von Hitzetagen einerseits Aufklärungsbedarf, andererseits aber auch, dass eine Stadt mit ihnen kalkulieren muss, etwa auch damit rechnen, dass mehr Leute in die Notaufnahme kommen«. Hoffmann ist als Leiter einer vom deutschen Forschungsministerium geförderten Nachwuchsgruppe außerdem besonders die langfristige Perspektive und daher ein Arbeiten entlang der folgenden Frage wichtig: »Wie bauen wir unsere Städte so, dass die Hitzehotspots identifiziert werden – und mit welchen Maßnahmen kann dort die gefühlte Temperatur gesenkt werden?«
In der Ursachenbekämpfung schließlich führe an der Reduktion von Treibhausgasemissionen nichts vorbei. Hoffmann beforscht derzeit auch das Zusammenspiel unterschiedlicher klima- und gesundheitsrelevanter Faktoren in Städten: etwa die Effekte von emissionsreduzierenden Mobilitätsverhalten und Energieproduktion durch Photovoltaikanlagen in Städten auf die Gesundheit der Stadtbevölkerung. Manche dieser Faktoren hätten eben auch wieder direkte Auswirkungen auf das subjektive Hitzempfinden: »Es ist wichtig, dass, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, sie dabei auch vor Hitze geschützt sind. Wenn wir das in Modellierungen berücksichtigen, können wir für Win-win-Situationen sorgen.« Eine Antwort laute daher oft: mehr Bäume. Aber es ist dabei eben auch nicht egal, wo und welche gepflanzt werden.
BMFTRNachwuchsgruppen
Globaler Wandel
Peter Hoffmann leitet eine der vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Nachwuchsgruppen. »CoSynHealth«
Im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe wird am Climate Service Center Germany im Projekt zu Konflikten und Synergien unterschiedlicher Szenarien für eine CO2-neutrale, gleichzeitig gesunde Stadt gearbeitet..
Eine Uhrzeit, ab wann es zu spät zum Lüften zur Raumabkühlung ist, gibt es nicht. Das hängt vom Wetter oder der Sonneneinstrahlung in einen bestimmten Raum ab. Um Diskussionen abzukürzen, kann man sich an dem Grundsatz orientieren, dass Lüften so lange (oder so bald wieder) Sinn macht, wie die Außentemperatur die Innentemperatur nicht übersteigt. Auch Pflanzen und Beschattung im Außenbereich können sich auf die Innentemperatur auswirken.
Auch wenn sie dauerhaft gekippt bleiben, geht bei gekippten Fenstern nur wenig Luftaustausch vonstatten. Dazu kommt, dass durch sogenannte Wärmebrücken, wenn an einer Stelle am Gebäude die Wärme schneller als an umliegenden austritt, wieder Kondensation und Schimmelbildung eintreten können.
Im Umgang mit Hitze halten sich einige hartnäckige Mythen.
TEXT Hanna Stummer
Lüften – das Konzept wurde im Sommer 2024 auf dem amerikanischen Blog Apartment Theory »Deutsches Herbstritual« genannt und als »Wellness-Trend« betitelt, den man unbedingt ausprobieren sollte. Das in den USA offensichtlich weniger verbreitete Lüften ist in Österreich und Deutschland nach wie vor eine naheliegende Grundmaßnahme für ein gesundes Raumklima – und trotzdem kursieren darüber viele Irrtümer. Besonders im Sommer ist falsches Lüften schlicht ineffektiv bis kontraproduktiv.
Der Gedanke, dass regelmäßige oder konstante Luftzirkulation durch lange geöffnete Fenster Feuchtigkeit aus den Räumen ziehen lässt, mag naheliegen – doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Warme Außenluft enthält viel Feuchtigkeit und kann in kühleren Räumen (insbesondere in Kellerabteilen) zu Kondensation führen, die wiederum ein ideales Verbreitungsmilieu für Schimmelpilz bietet. Tatsächlich ist die beste Methode gegen Schimmel zeitlich begrenztes Stoßlüften, am besten frühmorgens oder spätabends, da zu diesen Zeiten die Temperaturen am niedrigsten sind. Am kältesten ist es im Laufe des Tages kurz vor oder sogar kurz nach Sonnenaufgang.
Richtiges Stoßlüften reduziert nicht nur Feuchtigkeit, sondern kann, wenn richtig angewendet, die Temperatur in Räumen deutlich senken.
4. VENTILATOREN MACHEN NUR HEISSEN WIND
Ventilatoren kühlen die Luft nicht wirklich, sondern bewegen sie nur. In Kombination mit feuchten Tüchern oder Bettlaken können sie aber durch Verdunstungskälte die Raumtemperatur leicht senken und bieten so eine stromsparende Alternative zur Klimaanlage. Besonders für Räume, in denen Querlüftung nicht möglich ist, kann es hilfreich sein, den Ventilator beim Stoßlüften vor das Fenster zu stellen und so die Luftzirkulation zu beschleunigen.
5. NUR KLIMAANLAGEN KÜHLEN RÄUME EFFEKTIV Klimaanlagen regulieren die Temperatur schnell und effektiv. Doch die Systeme sind teuer und brauchen viel Energie – und auch regelmäßige Wartung, damit sich das Klimagerät nicht zur Keim- und Bakterienschleuder entwickelt. Es gibt durchaus andere Methoden, Räume nachhaltig abzukühlen: Besonders außen an den Fenstern angebrachte Rollläden oder Jalousien etwa verringern die Wärme, die durch Sonneneinstrahlung im Raum entsteht. Auch in Büroräumen ein Klassiker: Viele Elektrogeräte stellen eine relevante Wärmequelle dar und sollten, sofern sie nicht benutzt werden, vollkommen abgeschaltet werden und nicht im Standby-Modus laufen.

Mit einem digitalen Zwilling testet die Stadt München unter anderem Maßnahmen, um die Altstadt klimaresilienter zu gestalten.
Die Stadt München hat einen digitalen Zwilling. Darunter versteht man eine Simulation, die es ermöglicht, weitreichende Tests durchzuführen und Maßnahmen, Design- und Materialentscheidungen auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen oder auch in 3D-Simulationen erlebbar zu machen, bevor sie umgesetzt werden. Zum Einsatz kommen digitale Zwillinge in vielen Bereichen: im Werkzeugbau und in der Produktentwicklung oder eben auch in der Stadtplanung und im Klimaschutz.
Der digitale Zwilling Münchens ist Teil des Projekts Connected Urban Twins (Cut) und wurde in einer Partnerschaft von München ge-
meinsam mit Hamburg und Leipzig entwickelt, als Teil der Smart-City-Strategien der Städte. In einer Laufzeit von fünf Jahren arbeiten 70 Fachleute bis Ende 2025 gemeinsam mit vielen weiteren Partnern an dem Projekt und haben 73 Modellprojekte umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um Simulationen, sondern auch um BürgerInnenbeteiligung – viele Einsichten werden möglichst rasch als Open Data zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel für die Modellprojekte ist das Digitale Städtebauliche Monitoring für die Hamburger Verwaltung, das helfen soll, Verdrängungs- und Aufwertungsprozesse in durchmischten (Altbau-)Quartieren zu erkennen – dabei werden auch Daten zur Bevölkerung, der Sozialstruktur und der Mietentwicklung bereitgestellt. Ein anderes ist die
TEXT
Martin Mühl
Künftig soll es möglich sein, von jedem Standort innerhalb von 150 Metern kühle Aufenthaltsorte in der Altstadt zu erreichen.
BürgerInnen beteiligung
Die BürgerInnen Münchens haben regelmäßig die Möglichkeit, vor Ort, im »PlanTreff«, die digitalen Medien einzusehen und mitzudiskutieren. Online können sie das auf der Beteiligungsplattform Dipas
»Kitanetzplanung« in Leipzig, mit dem Ziel, mehr Transparenz für die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen und Wechselwirkungen im Bereich der Stadtplanung zu bringen. Viele weitere Projekte haben mit Themen wie der Energiewende und auch Klima- und Umweltschutz zu tun.
Und in einem der Projekte geht es um die klimaresiliente Altstadt in München. Der digitale Zwilling von München ermöglicht es, Hitzeinseln zu identifizieren und unterstützt die Planung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Künftig soll es möglich sein, von jedem Standort innerhalb von 150 Metern kühle Aufenthaltsorte in der Altstadt zu erreichen. Besonders herausfordernd ist dabei, dass die Attraktivität und der Charakter einer Altstadt mit ihren zahlreichen historischen und denkmalge-
schützten Gebäuden, Plätzen und Straßen erhalten bleiben soll. Zu den Fragen, die mit dem digitalen Zwilling beantwortet werden, gehören unter anderem jene, wie, wo es besonders heiß ist, wo der Handlungsdruck besonders hoch ist, welche Maßnahmen zur Abkühlung die gewünschte Wirkung erzielen oder wie sich diese in die denkmalgeschützten Strukturen des Altstadtensembles einpassen. Das Projekt wurde vom Geodatenservice im Kommunalreferat und dem IT-Referat, dem Referat für Klimaund Umweltschutz und dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Zu den geplanten und getesteten Maßnahmen gehören Begrünung oder Entsiegelung. Das Simulationsmodell ermittelt vielfältige Daten und Kennwerte für Tages- und Nachtzeiten, Informationen zu Windströmen, Lufttemperaturen und den Pet-Index, der die gefühlte Temperatur abbildet. Die zentralen Ergebnisse wurden in unterschiedlichen Karten visualisiert und in den dreidimensionalen digitalen Zwilling überführt.

Ergebnis des Projekts ist das Gutachten »Integration von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt«. Durch die Simulation im digitalen Zwilling konnte gezeigt werden, dass die Maßnahmen die Aufenthaltsqualität durch eine deutlich niedrigere Tageshöchsttemperatur erhöhen und auch die Nachttemperaturen spürbar gesenkt werden könnten. Deutlich wird auch, dass passgenaue Maßnahmen individuell für jeden Ort vorgeschlagen werden müssen, um eine möglichst hohe kühlende Wirkung zu erzielen. Noch ist es nicht möglich, alle 150 Meter einen geschützten und kühlen Ort in der Altstadt zu erreichen und sich dort auszuruhen. Und weil sich viele Umgestaltungsideen nicht von heute auf morgen umsetzen lassen, schlägt das Gutachten auch temporäre Maßnahmen und Experimente vor. Dazu gehören Markisen oder Sonnensegel, Pflanzentröge, Wanderbäume oder mobile Nebelduschen. Diese sollen Spielräume zeigen und helfen, weitere Lösungsansätze zu entwickeln.

VIER PFOTEN hat über 300.000 Streunertiere kastriert, geimpft und medizinisch versorgt.
In vielen, vor allem ärmeren Ländern gehören sie zum Straßenbild: abgemagerte und verwahrloste streunende Hunde und Katzen, auf der verzweifelten Suche nach Nahrung, nach Schutz vor Witterung und den überall lauernden Gefahren. Ein großer Teil der Tiere hungert, leidet unter Parasiten, ist krank oder verletzt. Und sie vermehren sich schnell und unkontrolliert: Wird nicht gezielt gegengesteuert, steigt die Population von Streunern exponentiell an.
Seit 1999 hilft VIER PFOTEN in zahlreichen Ländern streunenden Tieren. Ziel ist es, ihre Zahl auf humane Weise nachhaltig zu reduzieren. Die Tierschutzorganisation wendet dabei die so genannte »Catch-Neuter-Vaccinate-Release«-Methode an: Die Tiere werden gefangen, kastriert, geimpft und danach in ihrem angestammten
Revier wieder freigelassen. Wo es nötig ist, helfen die VIER PFOTEN-TierärztInnen mit oft lebensrettender medizinischer Betreuung. Mittlerweile konnte VIER PFOTEN über 300.000 streunende Hunde und Katzen kastrieren, impfen und versorgen.

Jede Spende hilft! Lassen wir die Tiere auf der Straße keinen Tag länger leiden.
»Für streunende Hunde und Katzen ist jeder Tag auf der Straße ein Kampf ums Überleben. Als Tierschutzorganisation ist es daher unsere Pflicht, uns um sie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht weiter vermehren. Aber letztlich ist Tierschutz auch Hilfe für den Menschen: Krankheiten können von Streunertieren auf den Menschen übertragen werden. Eine nachhaltige Streunerhilfe ist daher im Interesse von uns allen«, sagt VIER PFOTENDirektorin Eva Rosenberg. vier-pfoten.at/streuner
Mühl
Rund zwei Jahre konnte in der EU entalkoholisierter Biowein nicht mit Biolabel verkauft werden.
EEcovin

Der größte deutsche, 1985 gegründete Verband ökologisch arbeitender Weingüter in Deutschland.
Entalkoholisierung
Neben der Vakuumdestillation gibt es weitere, selten angewandte Methoden: die teure Umkehrosmose, bei der Wein durch Membranen gefiltert wird, oder auch die in der EU noch nicht zugelassene Spinning-Methode.
Alkoholfrei
Ein Produkt darf so genannt werden, wenn der Restalkoholgehalt unter 0,5 Vol.-% oder 4 Gramm/Liter liegt.
s war schlicht ein Fehler, ein Versehen, dass entalkoholisierter Wein von 1. Jänner 2023 bis 18. März 2025 nicht mit dem EU-Biolabel versehen werden konnte. Dazu geführt hatte, dass mit Dezember 2021 und mit der EU-Verordnung 2021/2117 entalkoholisierter Wein nicht mehr dem Lebensmittelrecht unterlag, sondern dem Weinrecht. Die EU-Öko-Verordnung 2018/848, in der auch der Biowein geregelt ist, wurde aber nicht rechtzeitig angepasst und enthielt keine Regelung für entalkoholisierten Wein, und deswegen konnte dieser auch nicht nach den Biovorschriften auf den Markt gebracht werden.
Einzelne Staaten versuchten, Übergangslösungen zu finden, diese scheiterten aber unter anderem an Streitigkeiten zwischen diesen Staaten – und so kam es, dass für mehr als zwei Jahre auch entalkoholisierter Wein, der geprüfterweise nach den Regeln des biologischen Weinbaus produziert wurde, nur ohne Hinweise auf seine Herkunft im Ökoweinbau auf den Markt gebracht werden konnte. Erst im Februar 2025 wurde die Delegierte Verordnung 2025/405 veröffentlicht – eine Abänderung der EU-Bioverordnung, die die entsprechenden Regelungen enthält. Seit März 2025 ist es wieder möglich, entalkoholisierten Biowein zu verkaufen.
SAUBERE ARBEIT
Nun können WeinfreundInnen darüber diskutieren, ob das Fehlen von entalkoholisier-
tem Biowein für sie ein Verlust war. Im Gegensatz zu anderen alkoholfreien Getränken wie Bier oder auch Schaumwein-Alternativen, etwa aus fermentiertem Tee, ist es bisher kaum gelungen, eine geschmacklich würdige Alternative für stillen Wein herzustellen. Auch wenn es das explizite Ziel verschiedener Entalkoholisierungsmethoden ist, den typischen Weingeschmack zu erhalten.
Bei der nun erlaubten Methode der Entalkoholisierung handelt es sich um Vakuumdestillation. Diese nutzt den Umstand, dass Flüssigkeiten unter niedrigem Druck schon bei niedrigeren Temperaturen verdampfen. Der Siedepunkt des Alkohols sinkt in der Anlage von 78 °Celsius auf 28–32 °C und so kann der Alkohol schonend vom Wein getrennt werden. Dies ist die am weitesten verbreitete Methode, Getränken den Alkohol zu entziehen. Nachdem Biowein im Gegensatz zu konventionellem Wein keine Konservierungsstoffe bei der Entalkoholisierung hinzugefügt werden dürfen, muss hier besonders sauber gearbeitet werden. Die meisten Anbieter lagern die Entalkoholisierung auch deswegen an Spezialisten aus. Es gibt jedenfalls keinen Grund, wieso Biowein von diesen Entwicklungen ausgeschlossen bleiben soll. Denn unabhängig von Geschmacksfragen, die immer auch von der Ziel-

»Für uns widerspricht die Entalkoholisierung von Wein nicht der Idee ökologischen Weinbaus.«
Vincent Hürter, Ecovin


gruppe abhängen, ist klar: Der Markt für Getränke mit wenig oder keinem Alkohol wächst. Laut einer vom Deutschen Weininstitut in Auftrag gegebenen Studie ist der Gesamtmarktanteil von alkoholfreiem Wein in Deutschland mit 1,5 % 2024 zwar noch gering, im Gegensatz zum Vorjahr wurden aber nach einer Steigerung von 56 % auf 2023, 2024 um 86 % mehr alkoholfreie Weine gekauft. In erster Linie zusätzlich zu Wein mit Alkohol.
Alkoholfreier Biowein bleibt trotz der Nachfrage umstritten – auch bei den BioproduzentInnen. Für so manche Biowinze rInnen, vor allem auch jene, die biodynamisch arbeiten, wi derspricht die Entalkoholisierung ihrem Verständnis eines »natürlichen« Produktes. So haben verschiedene Verbände, etwa der Biodynamie-Verband Demeter, eigene Regeln, die in vielen Ländern den Mitgliedsbetrieben die Entalkoholi sierung untersagen. Beziehungsweise es unmöglich machen, diese mit dem Verbandslogo versehen zu verkaufen. Auch der Energieaufwand der Entalkoholisierung widerspricht für manche dem ökologischen Gedanken der Biolandwirt schaft, während andere Wege der Energie- und Ressourcen schonung wie der Verzicht auf die Glasflasche noch recht selten diskutiert werden. Vincent Hürter, Fachreferent für ökologischen Weinbau und Kellerwirtschaft bei Ecovin, hofft auf eine allgemeine Entspannung: »Wir sehen ein gro ßes Interesse der VerbraucherInnen an alkoholfreiem Wein und für uns widerspricht die Entalkoholisierung von Wein nicht der Idee ökologischen Weinbaus.« Biowein darf im Gegensatz zu konventionellem Wein übrigens nur vollständig entalkoholisiert werden – und nicht nur teilweise: »Die Einschränkung, dass der Alkohol nicht teilweise entzogen werden kann, finden wir richtig«, sagt Hürter und verweist auf die vielen Möglichkeiten der Arbeit im Weingarten, mit dem Erntezeitpunkt oder auch im Weinkeller, die WinzerInnen generell Einfluss auf den Alkoholgehalt geben. Die EU-Bio-Verordnung schränkt die Entwicklung von entalkoholisiertem Biowein nun jedenfalls nicht mehr ein.


bis Z










Dieses Jahr werden sortenreine Kräuter und Gewürze ganz genau unter die Lupe genommen. Das gesammelte Kräuterwissen und hilfreiche Tipps stecken im digitalen Kräuter- und Gewürz-ABC von SONNENTOR. Komm mit auf die Mission Kräuterwissen!
www.sonnentor.com

TEXT
Irina Zelewitz
Antihidrotisch, adstringierend, antibakteriell? Das Triple A gegen Schwitzen und Schweißgeruch soll ausgerechnet der altbekannte heimische Salbei (Salvia officinalis) bieten. Ob und wie eingenommen Salbeiblatt zuverlässig eine relevante antihidrotische, also direkt hemmende Wirkung auf die Schweißdrüsen, verspricht, ist noch nicht eindeutig geklärt. Seine adstringierende und antibakterielle Wirkung allerdings ist klar belegt. Drei Beispielsituationen, in denen die Kraft des Küchenkrauts Vorteile bieten kann, sollen inspirieren, diesen Sommer auch auf die Kraft der Pflanzen zu setzen – ohne Wunderwirkung zu erwarten.
LANGER TAG
Auch die Wirkung äußerlich angewendeter Deos, mit oder ohne Aluminiumsalze oder Natron, hat ihre Grenzen. Bei innerlicher Anwendung – also zum Beispiel durch Teetrinken –wirkt Salbeiblatt adstringierend (porenverengend). Bei regelmäßiger Einnahme dauerhafter als ein Deo. Verantwortlich dafür werden die enthaltenen Gerbstoffe (Tannine) wie etwa Rosmarinsäure gemacht, besonders bei einer Einnahme in Tablettenform ist aber durchaus Vorsicht und ärztliche Rücksprache angeraten – um Überdosierungen vor allem durch Einnahme über eine zu lange Dauer vorzubeugen.
MEET
An Handflächen, Fußsohlen und Stirn sind viele ekkrine Schweißdrüsen konzentriert, also jene, die besonders zur Thermoregulation im Einsatz sind. Also Bereiche, die sich nicht unbedingt zum Auftrag größerer Schichten Deo anbieten. Salbei wirkt allerdings auch äußerlich angewendet adstringierend – etwa durch ein Spray oder eine Tinktur. Beides lässt sich aus wenigen Zutaten (Wasser, Salbei, Alkohol) auch selbst herstellen und ist im Kühlschrank nicht nur länger haltbar, sondern gekühlt auch in der Anwendung ein erfrischendes Wellnesserlebnis.
SPORTFRISCH
Schwitzen ist das eine – der Geruch, der durch die freigesetzten Bakterien auf Haut und Kleidung entsteht, allerdings oft störender. Äußerlich angewendet hilft Salbei auch dank seiner anti-













































Mit der Deutschen Umwelthilfe haben wir Klimaschutz als Grundrecht durchgesetzt.
Jetzt bringen wir gemeinsam die Bundesregierung dazu, es auch umzusetzen.








Mehr über (Heil-)Kräuter BIORAMA.EU/ HEILKRAUTER







bakteriellen Inhaltsstoffe, Schweißgeruch in Grenzen zu halten, ohne den Vorgang des Schwitzens einzuschränken, den man besonders beim Sport oder anderen Formen körperlicher Belastung ja vielleicht auch zulassen möchte. Der klassische Einsatzfall für ein desodorierendes Pflanzendeo!

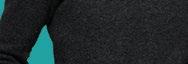






für 365 Tage im Jahr
Wer ernten will muss auch säen und das zum richtigen Zeitpunkt, sonst hilft die beste Absicht nicht und der Ertrag bleibt aus. Mit diesem Aussaatkalender wird die Beetplanung zum Kinderspiel, das gepflanzte Gemüse ein wahrer Genuss und das Blütenmeer zum echten Hingucker! Die Übersicht zeigt dir auf einen Blick, welches Saatgut früh in die Erde will und was du auch noch im Herbst aussäen kannst – für 365 Tage voller Wachstum.
Die Blüten von Schnittlauch, Schnittknoblauch, Borretsch, Kapuzinerkresse und vielen mehr sind nicht nur hübsch anzusehen und ein wahres Blüten-Buffett für Bienen und andere Nützlinge, sondern auch für uns Menschen essbar. Als Verzierung auf Salat und Co. dürfen sie einfach mitgegessen werden und verleihen jedem Gericht das gewisse Extra.
Blauer Waldmeister
Cosmea (Schmuckkörbchen)
Färberdistel
Goldmohn
Jungfer im Grünen
Kapuzinerkresse
Klatschmohn
Kornblume
Lampionblume
Lupine
Mädchenauge
Malve Zebrina
Mauretanische Malve
Prachtwinde
Ringelblume
Roter Sonnenhut
Schleierkraut
Sommeraster
Sonnenblume
Stockrose (Bauernrose)
Tagetes
Zinnien Kalifornische Riesen
BIO WILDBLUMEN
Acker-Glockenblume, Arznei-Baldrian, Berglauch, Blut-Weiderich, Dichtblütiger Ziest, Dunkel-Königskerze, Echte Kamille, Echtes Labkraut, Echtes Seifenkraut, Echtes Tausendgüldenkraut, Eigentlicher Kiel-Lauch, Färber-Hundskamille, FelsenNelke, Frühlings-Fingerkraut, Gelbe Skabiose, Gemeine Akelei, Gemeine Schafgarbe, Glanz-Skabiose, Großblütige Königskerze, Heide-Nelke, Kartäuser Nelke, Kleine Margerite, KnäuelGlockenblume, Ochsenauge, Pfirsichblättrige Glockenblume, Pracht-Nelke, Quirl-Salbei, Rosen-Malve, Rote Lichtnelke, SandGrasnelke, Sand-Nelke, Sauerampfer, Steppen-Salbei, Skabiose, Teufelsabbiss, Wiesen-Witwenblume, Wiesensalbei, Wilde Malve
Johanniskraut
Kuhschelle
Natternkopf
Wiesen-Schlüsselblume
Man spürt sofort, welch Anziehungskraft Wildblumen versprühen. Ein wahrer Anziehungsmagnet für Wildbienen und andere Insekten und ein Augenschmaus für uns alle. Wildblumen fördern die Artenvielfalt, sind winterhart und halten längere Trockenperioden gut aus. Win-win-win-Situation für Flora, Fauna und uns Menschen. Viel Freude beim Entdecken der Leidenschaft für Wildblumen!
Hol dir jeden Tag des Jahres frische Vitamine von der Fensterbank. Mit Sprossen & Micorgreens kannst du ganzjährig guten Geschmack ernten. Egal ob altbekannte Kresse, bunte Radieschensprossen oder kleinen Sonnenblumen-Triebe, diese kleinen Kraftpakete verwandeln deine Gerichte in wahre Geschmackserlebnisse. Jeden Tag, einfach immer gut!
Alfalfa
Brokkoli
Kresse
Radieschen
Rettich
Rote Rüben
Rucola
Sonnenblume
Weizengras
Der Einsatz von Gründüngung liefert einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Bodens und sorgt so für eine reiche Ernte. Obendrein sind sie schön anzusehen und fördern die Biodiversität.
BIO
Buchweizen
Gelbsenf
Leindotter
Phacelia
Rotklee / Weißklee
Wicklinse
Sommeraussaat / Winterernte
Wer auch im Herbst & Winter frische Zutaten aus dem eigenen Beet ernten möchte, sollte im Sommer & Herbst das richtige Saatgut aussäen oder ganzjährig im Haus einige Kräuter ansetzen. Neben Spinat und Barbarakraut, können auch Asiasalate, Winter-Endivien, Zichoriensalate und Pastinaken im Winter geerntet werden. Auch Karotten bleiben in der Erde frisch und knackig und werden geschmacklich immer süßer.
Paprika
Pfefferoni Milder Spiral
div. Tomaten / Wildtomaten
Buschbohnen
Edamame Sojabohne
Markerbsen
Prunkbohnen / Käferbohnen
Stangenbohnen
Zuckererbsen
Blumenkohl (Karfiol)
Brokkoli
Chinakohl
Grünkohl
Kohl (Wirsing)
Kohlrabi
Rosenkohl
Rot-/Blaukraut
Stängelkohl
Weißkraut Oststeirerkraut
Weißkraut Ruhm von Enkhuizen 2 Weißkraut Spitz- Filderkraut spät
Karotten Berlikumer 2
Karotten Blanche de Küttingen
Karotten Gniff
Karotten Jaune du Doubs
Karotten Nantaise 2
Karotten Rote Riesen 2
Radies & Radieschen
Rettich Daikon
Rettich Hilds Blauer Herbst u. Winter
Rettich Ostergruß rosa 2
Rettich Zürcher Markt
Winter-Rettich Runder schwarzer
Einlegegurken
Gurken
Melothria (Mexikanische Minigurke)
Asia-Salate
Asia-Salat Senfkohl (Pak Choi) Eissalat
Feldsalat
Hirschhornsalat
Kopfsalat Ovation
Kopfsalat Wintermarie Pflücksalat
Romanasalat
Winter-Endivien
Zichoriensalat
Salat Grüner aus Maria Lankowitz
Blumen- & Kräutermischung / Wildblumenmischung
Rasen-/ Wiesenmischung
Andenbeere
Artischocke
Aubergine / Melanzani
Belugalinsen
Cardy
Echter Erdbeerspinat
Erdkirsche
Flaschenkürbis
Gemüsemalve
Große Brennnessel
Knollenfenchel
Knollensellerie
Kürbis
Litschi-Tomate
Mairüben
Mangold
Neuseelandspinat
Porree
Rote Rüben
Schwarzwurzeln
Speisekürbis
Spinat
Surinam-Spinat
Tomatillo
Wassermelone
Weiße Rüben
Zucchini
Zuckermais
Zwiebeln Ailsa Craig
Zwiebeln Gelbe / Rote Laaer
Zuckermelone
Zuckerwurzel
BIO KRÄUTER
Barbarakraut (Winterkresse)
Basilikum
Bohnenkraut
Borretsch
Dill
Drachenkopf (Türkische Melisse)
Gartenkresse
Koriander
Kümmel
Liebstock (Maggikraut)
Majoran
Oregano-Dost
Pastinaken
Petersilie
Rucola
Salbei
Schnitt-Knoblauch
Schnittlauch
Thymian mehrjährig
Wurzel-Petersilie Halblange
Ysop
Zitronenmelisse
Team & Belegschaft des FC Bayern München werden weitgehend bio bekocht, der Küchenchef des »Casinos« erklärt, wie er einkauft.
TEXT
Thomas Weber


Mittwoch ist Pastatag. Zweimal in der Woche gibt es Fleisch, freitags Fisch. Das sind werktags die Konstanten, auf die sich die 450 MitarbeiterInnen des FC Bayern München verlassen können. »Die Leute sind sehr zufrieden mit dem, was wir kochen«, sagt Markus Zierer, »wir werden mit Lob überschüttet«. Der Küchenchef des »Casinos«, wie die Kantine in der Säbener Straße gleich bei dem Trainingsgelände der Münchner Fußballprofis genannt wird, ist überzeugt, dass das auch damit zu tun hat, dass er beim Einkauf der von ihm verarbeiteten Lebensmittel
»Das Essen ist für unsere
MitarbeiterInnen komplett
gratis.
Kostenvorgabe
gibt es keine. Wir schauen halt, dass wir bei den Kosten die Kirche im Dorf lassen und achten auf gute Qualität.«
Markus Zierer, Küchenchef des Casinos des FC Bayern München
vielfach zu Bioqualität greift. In einigen Warengruppen sogar zu 100 Prozent. Bei den Nudeln und beim Mehl beispielsweise, beim Fleisch, beim Öl und beim Kaffee. 20 Kilo Pasta kauft er Woche für Woche bei Il Golosone aus Regensburg. Die Pastamanufaktur verarbeitet Einkorn, Emmer und Urgetreide zu Nudeln. Die Mehle stammen durchwegs von der Drax Mühle (aus Rechtmehring). Das Fleisch – 140 Kilo pro Woche – von der Tiroler Metzgerei Juffinger. Das Raps- und Sonnenblumenöl beziehen die Bayern bei der Ölmühle Hofbauer. »Die macht unser ehemaliger Greenkeeper«, sagt Zierer. Statt, wie früher, um den Fußballrasen kümmert sich der nunmehrige Ex-Kollege seit ein paar Jahren um seine Biolandwirtschaft. Der Kaffee kommt von Merchant & Friends, einer Rösterei mit Sitz in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten. Mindestens so wichtig wie bio ist dem Küchenchef, dass er um die genaue Herkunft seiner Zutaten Bescheid weiß. Das heißt: Im besten Fall wird bioregional eingekauft. »Kartoffeln aus Ägypten wird man in meiner Küche keine finden«, sagt er. Eine Biozertifizierung hat die Kantine nicht. Zumindest eine hundertprozentige Bioverpflegung wäre allein schon aufgrund von Sponsorenverträgen (z. B. mit Coca-Cola) nicht möglich. Für eine – theoretisch mögliche – Teilzertifizierung sieht Markus Zierer keinen praktischen Bedarf: »Es hat noch nie jemand danach gefragt, ob wir biozertifiziert sind. Also sehe ich keine Notwendigkeit, uns ein Korsett anzuziehen.« Dass annähernd einhundert Prozent Öko möglich wären,
daran hat er keinen Zweifel. Bei manchen Lebensmitteln verzichtet er aber auch bewusst auf Bio. »Beim Gemüse glaube ich nicht an die spanischen Biotomaten«, sagt er, »die sind für mich wenig greifbar. Und den letzten Tropfen Grundwasser aus den trockensten Regionen Spaniens zu holen, das passt für mich nicht zu Bio.« Beim Gemüse sticht im Casino deshalb mitunter die deutsche, bevorzugt: die bayerische Herkunft das anonyme Importprodukt mit Biozertifikat.
»LEBENSMITTEL,
Grundsätzlich ist der 50-Jährige, der sich bereits sein ganzes Leben mit dem bewussten Essen beschäftigt, aber sehr von den Vorzügen von Bio überzeugt: »Bio schafft Wissen und gibt Gewissheit, dass das Tier glücklicher war, schön aufwachsen konnte und nicht aus der Quälanstalt kommt«, sagt Zierer, »und Kaffee oder auch das Getreide fürs Mehl wurden bei Bio nicht unnötig gespritzt.« Seine Überzeugung: »Essen ist Lebensmittel, kein Füllstoff. Wir kochen deshalb auch das, worauf wir selbst gerne Lust haben und alles frisch.« Auch der Fisch werde freitags Blech für Blech frisch zubereitet, Nudeln werden die ganze Mittagszeit über immer wieder frisch gekocht, »die kommen immer al dente raus, wir praktizieren kein Cook&Chill, bei dem alles vorbereitet wird«. Wert lege man auch auf Vielfalt und Saisonalität. Bei der Planung wird darauf geachtet, dass sich die Speisen nicht alle paar Wochen wiederholen. »Die Leute freuen sich dann auch sehr, wenn es alle vier, fünf Monate mal wieder Currywurst gibt«, sagt er. Im Vorhinein wird nicht bekannt gegeben, was es zu essen gibt. »Sonst kommen alle aus dem Homeoffice ins Büro, wenn sie wissen, dass es Schnitzel gibt«, sagt er. Bei der Essensausgabe wird aber genau angeführt, was es zu essen gibt. Am Tag des Gesprächs zum Beispiel: »Allerlei vom Bio-Iberico-Schwein«. Zwei ganze Schweine hat Zierer dafür gekauft und nose to tail verarbeitet. Auch Rinder kauft das Casino im Ganzen.
Gegessen wird im Casino ab 11 Uhr. Die Mittagszeit endet für die Küchenbelegschaft mit einem gemeinsamen Ritual. Jeden Tag setzen

sich alle 13 MitarbeiterInnen um 13 Uhr 30 gemeinsam zu Tisch. »Das Soziale gehört zum Essen einfach dazu«, sagt Zierer. Auch, weil es – wie der Fußballsport – Identität und Gemeinsamkeit stiftet.
Das Handwerk gelernt und seine Überzeugungen gewonnen hat Markus Zierer einst bei Feinkost Käfer. Nach Stationen in der Sternegastronomie und einem Abstecher in der Küche des Audi-Forums in Ingolstadt landete er vor 18 Jahren bei Bayern München. Drei Kantinenbetriebe baute er für die Bayern auf: das Casino, die Kantine der Profis – also fürs Fußballteam – und jene des Nachwuchs-Leistungszentrums. Mittlerweile haben die Profis und der Nachwuchs einen eigenen Küchenchef. Grundsätzlich, sagt er, mache es keinen allzu großen Unterschied, ob man für Spitzensportler oder die Bürobelegschaft koche. »Im Sportgeschäft kochst du halt weniger Schweinefleisch und man bereitet die Desserts mit weniger Zucker zu«, sagt er. Der einzige relevante Unterschied: »Man richtet sich beim Kochen halt nach dem Rhythmus des Teams. Vor dem Spiel gibt es helles Fleisch und du sorgst dafür, dass der Kohlehydratespeicher aufgefüllt wird.« Und irgendwie ist nach dem Spiel natürlich immer auch vor dem Spiel.


Das Haus der Kost in München hat den Auftrag, mehr Bio in die Gemeinschaftsverpflegung zu bringen.
INTERVIEW
Martin Mühl
Das Münchner Haus der Kost ist ein Beratungs- und Coachingzentrum, angesiedelt im Munich Urban Colab, wo es unter anderem einen Seminarraum mit drei Kochinseln eingerichtet hat. Geleitet wird es von den beiden Ökotrophologinnen Silke Brugger und Karoline Stojanov. Die Hauptaufgabe ist es, Gemeinschaftsküchen – etwa in Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen oder öffentlichen Kantinen – dabei zu unterstützen, mehr regionale und biologische Lebensmittel zu verwenden. Der Fokus liegt auf individueller Prozessbegleitung der Küchenteams, um sowohl die Küchenorganisation als auch die Lieferbeziehungen nachhaltig zu gestalten. Um nach-
haltige Ernährung im großen Maßstab umzusetzen, ist vor allem die Gemeinschaftsverpflegung wichtig: Sie erreicht jeden Tag Millionen Menschen und kann so für viele Stellen im Lebensmittelsystem der entscheidende stabile Absatzmarkt sein.
BIORAMA: Wer ist Ihre Zielgruppe, und wo spüren Sie das größte Interesse?
SILKE BRUGGER: Unsere Zielgruppe ist sehr vielfältig: von Kantinen, Mensen bis hin zu Kitas, Schulen und Seniorenheimen. Besonders groß ist das Interesse dort, wo mit begrenztem Budget gearbeitet wird – hier sind kreative Lösungen gefragt, um Bio nachhaltig und langfristig
in die Speisepläne zu integrieren. Die Nachfrage am Coachingprogramm wächst – insbesondere im Care-Bereich.
Wie läuft eine Beratung bei Ihnen ab?
Die Beratung findet in der Regel im direkten 1:1-Coaching mit den Küchenverantwortlichen statt. Dabei geht es um ganz praktische Themen – von der Rezeptplanung über die Kalkulation bis hin zur Lieferantenauswahl. Unser Ziel ist, individuelle Lösungen zu den jeweiligen Anforderungen der unterschiedlichen Küchen zu finden, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich tragfähig sind. Wie wir in Bayern sagen: »A bissl was geht immer!« Auch kleine Schritte können viel bewirken.
Welche Arbeitsschwerpunkte verfolgen Sie aktuell?
Das grundlegende Konzept für das Haus der Kost wurde mit der Unterstützung der Kantine Zukunft in Berlin erarbeitet. Außerdem treten wir damit in die Fußstapfen des House of Food in Kopenhagen. Derzeit haben wir drei Arbeitspakete extern vergeben: Erstens coachen und begleiten unsere AuftragnehmerInnen Küchenverantwortliche der Gemeinschaftsverpflegung bei der Umstellung auf mehr bio-regionale Zutaten. Beraten werden Kantinen im städtischen Geschäftsbereich und auch private Betriebsrestaurants. Zweitens stärken wir regionale Wertschöpfungsketten, indem wir regionale Erzeuger*innen mit Küchen in der Stadt zusammenbringen. Ein Beispiel ist unser erfolgreiches Format »Küche trifft Region«, bei dem Küchenteams auf ErzeugerInnen treffen. Und schließlich wollen wir unsere eigene Marke bekannter machen. Etwa durch Öffentlichkeitsarbeit und auch Veranstaltungen wie unseren Kongress »Essen, das wir morgen lieben – wie wir Trends setzen und Zukunft gestalten« am 9. Juli 2025.
Was ist in Ihrer Arbeit das stärkste Argument für Bioprodukte?
Bio sichert Biodiversität, sauberes Trinkwasser, gesunde Böden – wir haben als Kommune eine Verantwortung für unsere BürgerInnen. Der Bezug aus der Region bedeutet außerdem Wertschöpfung vor Ort und das stärkt nicht nur
»Besonders groß ist das Interesse dort, wo mit begrenztem Budget gearbeitet wird – hier sind kreative Lösungen gefragt.«
Silke Brugger, Haus der Kost
die landwirtschaftliche Produktion, sondern auch das lokale Lebensmittelhandwerk.
Wie definieren Sie regional? Es gibt für diesen Begriff keine eindeutige, allgemeingültige Definition. Er ist gemeinsam mit dem Marketingbegriff »Heimat« emotional besetzt. Für uns bedeutet regional: so nah wie möglich, so fern wie nötig. Wir wollen lokale ErzeugerInnenbetriebe und regionale Strukturen fördern, die kurze Lieferketten ermöglichen. »Regional« hat den Vorteil, dass man eine direkte, transparente Beziehung zu den ProduzentInnen aus dem Umland aufbauen kann – mit fairen Preisen und saisonaler Ware. Saisonal bedeutet allerdings auch, dass es nicht immer alles gibt und dass man auf Eingemachtes oder Fermentiertes zurückgreifen muss. Wie es früher bei meinen Großeltern noch war.
Wo stoßen Sie auf wiederkehrende Hindernisse oder Skepsis?
Der Faktor Zeit ist eine große Herausforderung – gerade in Großküchen, wo es häufig an Fachpersonal mangelt. Wenn jemand ins Coaching kommt, fehlt er oder sie einen Tag in der Küche. Und natürlich gibt es die klassischen Argumente gegen Bio …
Welche sind die häufigsten?
Da ist beispielsweise die schwankende Verfügbarkeit der Biolebensmittel oder der Glaube, Bio sei zu teuer. Aber wenn man regional und saisonal einkauft und frisch kocht, ist das der Schlüssel, um einzusparen. Manche Küchen haben Sorgen, den KundInnen etwa die beliebte Currywurst zu nehmen – unser Ansatz ist es, ge-
Biostädte
Seit 2010 arbeiten Städte zusammen, die den Ökolandbau und Biolebensmittel fördern. Im Vordergrund stehen Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte, die Akquise von Fördermitteln und öffentlichkeitswirksame Aktionen. Das gemeinsame Auftreten verleiht größeres politisches Gewicht.
Ökotrophologie
Interdisziplinäre Verbindung von Ernährungswissenschaft und Haushaltswissenschaft – in Deutschland ein eigenständiges Studienfach. Gemeinschaftsverpflegung
Das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geht davon aus, dass deutschlandweit täglich circa 16.000.000 Menschen in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung essen, davon rund 6.000.000 Kinder und Jugendliche.
»Die Wiesn ist ein Leuchtturmprojekt mit großer Strahlkraft – wenn sich hier etwas verändert, zieht das Kreise.«
Kantine Zukunft
Die Kantine Zukunft gestaltet im Rahmen der Berliner Ernährungsstrategie seit 2019 gemeinsam mit Einrichtungen der öffentlichen Hand die Transformation der Gemeinschaftsgastronomie.
nussvolle Alternativen zu bieten. Eine Bowl mit frischem Gemüse ist mindestens so schmackhaft, wenn man sie selbst einmal probiert hat. Unser Ziel ist, künftig mit homogeneren Zielgruppen in den Kursen zu arbeiten – etwa nur mit Kindergärten, da diese ähnlichere Fragestellungen, Bedürfnisse und Voraussetzungen haben.
Wie wichtig sind gesetzliche Vorgaben für die Ernährungswende?
Sehr wichtig. Die öffentliche Hand hat große Verantwortung – und eine Vorbildfunkti-
on. Gute Vorgaben können Planungssicherheit schaffen und faire Wettbewerbsbedingungen ermöglichen, gute Preise für die EinkäuferInnen und Sicherheit für die ProduzentInnen. Ausschreibungen müssen möglichst einfach zu handeln sein für diejenigen, die in der Verwaltung Lebensmittel ausschreiben, und für die BieterInnen.
Und eine konkrete Bioquote?
In München lautet das Ziel 60 Prozent Bio in der Gemeinschaftsverpflegung. Wir erheben gerade aussagekräftige Zahlen, wo wir in diesem Prozess stehen. Ein spannendes Beispiel ist die Wiesn – also das Oktoberfest. Seit letztem Jahr gibt es dort eine eigene Bio-Wertschöpfungsketten-Managerin, angesiedelt bei Bioland: Johanna Zierl. Sie begleitet das Großevent, ausgerichtet von der Stadt München, mit dem Ziel, nachhaltige Lebensmittelversorgung auch in diesem Kontext umzusetzen. Das ist beeindruckend, denn die Herausforderungen sind enorm – es geht um riesige Mengen und kurzfristige Logistik. Gerade hier kann viel Sichtbarkeit entstehen. Die Wiesn ist für uns ein Leuchtturmprojekt mit großer Strahlkraft – wenn sich hier etwas ver-


Das Haus der Kost bietet unter anderem einen Seminarraum mit drei professionellen Kochstellen, an denen sich das Wissen in der Praxis erproben lässt.
ändert, zieht das Kreise. Wir hoffen, dass sich dieses Engagement weiter verstetigt – und zu einer ganzjährigen Auslastung regionaler Bioproduzenten beiträgt.
Weshalb haben Sie sich das Munich Urban Colab als Standort für das Haus der Kost ausgesucht?
Das Munich Urban Colab ist ein Innovationszentrum, in dem Start-ups und Nachhaltigkeitsprojekte angesiedelt sind. Es passt perfekt zu uns, weil wir hier an Lösungen für die städtische Ernährung der Zukunft arbeiten. Wir bringen Menschen zusammen. Ernährung hat mehr Einfluss auf Klima und Gesundheit, als viele wissen.
Gibt es vergleichbare Initiativen anderswo und Austausch?
Ja, das erwähnte House of Food in Kopenhagen oder die Kantine Zukunft in Berlin. In Deutschland gibt es außerdem das Netzwerk der Biostädte, mit denen wir im Austausch stehen. Jede Stadt geht ihren eigenen Weg. In Bremen, im Forum Küche etwa, arbeitet man mit der Volkshochschule zusammen. Hier in München gibt es eine aktive Community aus NGOs und Initiativen, mit denen wir den Austausch suchen. Das Haus der Kost soll die Drehscheibe der Ernährungswende sein. Es ist uns wichtig, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, und so stehen unsere Erfahrungen auch anderen Kommunen zur Verfügung, die sich auf den Weg machen wollen.








































TEXT
Thomas Weber
Die schwachbrüstigen Bruderhähne der Biolegehennen werden nicht mehr gleich als Küken getötet. Gelöst ist das Problem nicht.
Aus Kinderbüchern über Tiere auf dem Bauernhof sind sie nicht wegzudenken: das lautmalerische Kikeriki, der stolze Hahn und die Küken, die von einer fürsorglichen Glucke bewacht werden. Die Realität sieht längst anders aus. Fast überall werden Küken aus kommerziellen Brütereien gekauft, statt der einst bunten Vielfalt am Geflügelhof dominieren hochgezüchtete Hybridtiere, die zu Tausenden gehalten werden, schnellstmöglich zur Schlachtreife heranwachsen oder bis zu 300 Eier pro Jahr legen – je nachdem, ob Fleisch oder Eier produziert werden. Selbst wenn am Straßenrand aus mobilen Hühnerställen oder Eierautomaten – bioregional oder nur regional – Eier zum Verkauf angeboten und gruppenweise nur ein paar Hundert Tiere gehalten werden: Die Spezialisierung hat die Zuchtlinien von Masthühnern und Legehennen bereits seit Jahrzehnten getrennt. Nur in der Hobbyhühnerhaltung oder zur Selbstversorgung der bäuerlichen Familien kommen noch alte – oft bedrohte – Hühnerrassen zum Einsatz, die deutlich weniger Eier legen und langsamer und zudem weniger Fleisch ansetzen. Im kommerziellen Bereich sind Rassen wie der flugfähige Bergische Kräher, das einst auch von Gourmets geschätzte Sulmtaler oder das Altsteirer Huhn mit ihren 130, 160 oder 180 Eiern im stärksten ersten Legejahr nicht mehr wettbewerbsfähig. Diese Spezialisierung hat ihren Preis: Moderne Masthühner können als wandelnde Brustmuskelmasse kaum noch gehen. Hochgezüchtete Legehybride produzieren dermaßen viele Eier, dass das
»In Österreich werden im Biobereich alle Brüder der Legehennen aufgezogen.«
Robert Sperrer, Prokurist Eiermacher
dafür benötigte Kalzium trotz zugefüttertem Muschelgrit das Knochenwachstum der Tiere beeinträchtigt.
Und während es die Fleischgenetik ermöglicht, Henne und Hähnchen gleichermaßen zu mästen (weil beide Geschlechter ordentlich Muskelmasse ansetzen), sind die schwachbrüstigen Bruderhähne der Legehennen nicht wirklich zu gebrauchen.

»ES WAR EINMAL DAS HUHN« von Astrid
Drapela, Goldegg Verlag, 2025.
Amüsant und lehrreich führt diese famose »Forschungsreise durch die bewegte Geschichte von Mensch und Huhn« auch an jene folgenschwere Weggabelung zurück, an der die Genetik von Mastund Legehuhn züchterisch auseinandergeführt wurde. Ein künftiges Standardwerk.
Hennen, die viele Eier legen, haben Brüder, die langsam wachsen. Lange wurden deshalb alle männlichen Küken gleich nach dem Schlüpfen getötet; auch jene der Biolegehennen. Der Biobereich hat diese Praxis weitestgehend beendet, wenn auch erst seit ein paar Jahren und gewissermaßen als freiwillige Branchenlösung für mehr Tierwohl.
LÖSUNGSANSATZ 1:
DER QUERFINANZIERTE MASTGOCKEL
Die Mast der langsam wachsenden männlichen Tiere wird durch höhere Eierpreise querfinanziert. So bleibt das »Gockel«-Fleisch bezahlbar und wird tiefgekühlt, in Konserven oder als Geflügelwurst – durchaus erfolgreich – unter klingenden Namen wie »Bruderhahn«, »Bruderwohl« oder »Hähnlein« vermarktet. »In Österreich werden im Biobereich alle Brüder der Legehennen aufgezogen«, sagt Robert Sperrer, Prokurist vom oberösterreichischen Geflügelbetrieb Eiermacher. Das entspricht etwa 600.000 Tieren im Jahr. »In Deutschland verpflichten die meisten Handelsketten die Lieferanten von Bioeiern, die Bruderhähne der Biolegehennen aufzuziehen«, sagt Sperrer. Bioverbände wie Bio Austria, Naturland oder Bioland verlangen von ihren Mitgliedsbetrieben außerdem, dass die Hähne in Österreich oder Deutschland auf Biohöfen aufgezogen werden (meist passiert das auf spezialisierten Betrie-
ben) – und nicht irgendwo im Ausland auf konventionellen Mastanlagen verschwinden. »In der Praxis sieht das so aus, dass Naturland-LegehennenhalterInnen beim Kauf der Junghenne einen Aufschlag für den Bruderhahn bezahlen«, erklärt Markus Fadl, Sprecher des Naturland-Verbands, »diesen Aufschlag bekommt der Mastbetrieb, der die Bruderhähne aufzieht. Koordiniert wird das über die Brütereien«.
Die Mitgliedschaft in einem Bioverband ist allerdings freiwillig. Jeder Biobetrieb kann sich auch entscheiden, einfach nach den etwas niedrigeren gesetzlichen Vorgaben der EU-Bioverordnung kontrollieren zu lassen. »Zirka die Hälfte der deutschen Bioeierproduktion wird als EU-Bio-Eier vermarktet«, sagt Robert Sperrer. Das bedeutet: Jedes zweite deutsche Bioei stammt von einem Geflügelhof, der »nur« die EU-Biovorgaben erfüllt. »Deren Bruderküken werden vorwiegend im Ausland, vor allem in Polen, aufgezogen«, sagt Branchenkenner Robert Sperrer. Wie und wo ihr Fleisch vermarktet wird, ist unklar.
Wobei mittlerweile alle Biolabels in Österreich und Deutschland garantieren, dass keine männlichen Küken gleich nach dem Schlüpfen geschreddert oder irgendwie anders getötet werden. Auch dürfen nicht einfach junge konventionelle Legehennen aus dem Ausland importiert werden.
In Österreich setzen mittlerweile sogar einzelne konventionelle Vermarktungsschienen, die nicht biozertifiziert sind, aber Mehrwert durch Tierwohl vermitteln, auf die Aufzucht der Hähne und kommunizieren dies auch beim Verkauf der Eier aus konventioneller Freiland-Legehennenhaltung; beispielsweise die Eigenmarken der Handelskonzerne Rewe (»Toni’s«), Hofer/ Aldi (»Fairhof«) oder Lidl (»Tierwohl«). Während das Fleisch der Biobruderhähne gefragt ist und seinen Markt gefunden hat, bleibe die Vermarktung der derzeit jährlich 150.000 konventionellen Bruderhähne laut Robert Sperrer »aber nach wie vor schwierig im österreichischen Handel«. In Deutschland, wo seit 2022 sogar bundesweit kein Küken mehr wegen seines Geschlechts getötet werden darf, wird die-









www.gaissmayer.de





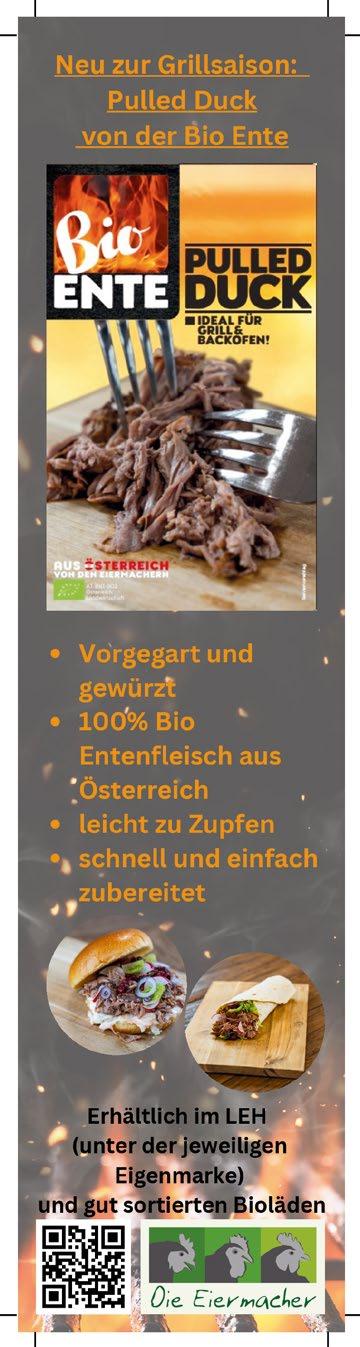

Zuchtziel des Zweinutzungshuhns: Eine Genetik, die nicht nur eine gute Legeleistung garantiert, sondern auch Fleisch liefert. Dann ist der Hahn auch kein »Abfall« mehr. Im Bild: Hahn und Hennen der Rasse ÖTZ Cream.
ses Gesetz mitunter einfach umgangen. Es gilt nur für deutsche Brütereien. Teilweise kaufen konventionelle Legebetriebe einfach Tiere, die im Ausland geschlüpft sind.
Wobei die Geflügelbranche ohnehin nie wirklich erwartete, von der ursprünglich im Biobereich entwickelten Bruderhahn-Idee beflügelt zu werden. Im großen Stil soll das Problem der unbrauchbaren männlichen Küken technisch
gelöst werden – mittels In-ovo-Früherkennung des Geschlechts, dem sogenannten »Sexing« der Eier. Hier wurden zuletzt einige Methoden zur Marktreife gebracht. Etwa die Hormonanalyse des »Seleggt«-Verfahrens (dessen Entwicklung vom deutschen Bundeslandwirtschaftsministerium mit fünf Millionen Euro unterstützt wurde): Mit annähernd hundertprozentiger Genauigkeit lässt sich durch einen winzigen Nadelstich durch die Eierschale über wenige Tropfen embryonalen Harns klären, ob darin ein weibliches Tier heranwächst. Wenn nicht, wird der männliche Embryo nicht weiter ausgebrütet. In der konventionellen Eierproduktion wird der überwiegende Teil der Legeküken bereits am elften oder zwölften von insgesamt 21 Bruttagen »gesext«. In Ländern wie Belgien und Holland dürfen die abgestorbenen männlichen Embryonen auch zu Tierfutter verarbeitet werden.
Die Biobewegung wollte sich mit dieser industriellen Lösung nie anfreunden. »Eine Technik, die mit dem Ziel eingesetzt wird, eines der beiden Geschlechter – und damit die Hälfte der Tiere – erst gar nicht entstehen zu lassen, ist ethisch abzulehnen«, urteilte die einflussreiche Veterinärmedizinerin Anita Idel bereits 2016 in einem Gastbeitrag für die Schweisfurth-Stiftung. Alle namhaften Bioverbände in

In der konventionellen Legehennenproduktion – auch für Freilandeier – werden bebrütete Eier, deren Embryonen sich als männlich erweisen, immer öfter aussortiert. Im Bild: die Cheggy-Maschine zur In-ovo-Geschlechtserkennung der deutschen Agri Advanced Technologies GmbH.
Deutschland und Österreich untersagen ihren Bäuerinnen und Bauern, gesexte Legehennen zu halten. Laut EU-Bioverordnung wäre das allerdings möglich.
LÖSUNGSANSATZ 3:
DAS ZWEINUTZUNGSHUHN
Während der allergrößte Teil der Bioeier in Deutschland und Österreich von Hybridhennen stammt, deren Legeleistung die Bruderhähne querfinanziert – und die männlichen Tiere derart »durchgefüttert« werden müssen –, sucht ein kleiner Teil der Branche züchterisch nach einer prinzipiellen Lösung, die besser zu Bio passt. Seit zehn Jahren – und damit seit acht Zuchtgenerationen – engagiert sich die gemeinnützige Ökologische Tierzucht (ÖTZ), die von den Verbänden Bioland und Demeter als Gesellschafter getragen wird, für ein »Zweinutzungshuhn«. Ziel ist es, aus mehreren weniger spezialisierten Hühnerrassen ein Huhn herauszuzüchten, das gleichermaßen Fleisch wie Eier liefert (»Zweinutzung«), von dem also Hahn wie Henne wirtschaftlich gehalten werden können, und das besonders zu den Anforderungen an biologische Kreislaufwirtschaft passt. Überraschenderweise drängt diesbezüglich der Schweizer Bioverband Bio Suisse, der seinen Betrieben erst ab 2026 vorschreibt, dass alle männlichen Küken am Leben bleiben müssen, plötzlich nach vorne –und positioniert sich in Sachen Zweinutzungshuhn als besonders fortschrittlich. Auf seiner neuen Positivliste der für Mitgliedsbetriebe zugelassenen Hühner tauchen neben Hybridhühnern, die sich auch in der Bruderhahnaufzucht bewährt haben, erstmals zwei Zweinutzungshühner der Ökologischen Tierzucht auf: die Zweinutzungskreuzungen »Coffee« und »Cream«. Bislang werden in der Schweiz 6000 Coffee- und Cream-Legehennen gehalten, verteilt auf rund 60 Demeter- und Biobetriebe; also auf eher kleinen Betrieben. Erstmals wird nun auch mit einer Herde von 2000 Hennen experimentiert. Nicht nur die ÖkotierzüchterInnen, auch Tierschutzorganisationen hoffen, dass sich das Zweinutzungshuhn bewährt. »Die Aufzucht der Bruderhähne war ein wichtiger erster Schritt, damit der Biobereich vom Kükentöten wegkommt. Das ist gelungen«, sagt Eva Rosenberg von Vier Pfoten
Österreich. Die Aufzucht dürfe aber nur ein Zwischenschritt sein, und weiter: »Der einzig weiterverfolgenswerte Ansatz, den fordern wir auch vehement, ist der Umstieg auf Zweinutzungsrassen, die Eier und Fleisch liefern. Hier ist das Potenzial da, das Kükentöten wirklich zu beenden und Tierbestände zu reduzieren. Die Schweizer Biobewegung ist da ganz vorne dabei. Bei uns will man das als Lösung nicht so recht gelten lassen, auch aus Angst vor nötigen Investitionen.«
Eindeutige Position dazu gibt es in der Biobranche derzeit noch keine. Wobei viele darauf hoffen, dass es bald Zweinutzungshühner gibt, die sich als wirklich wettbewerbsfähig bewähren und die derzeitige Praxis eine Zwischenlösung bleibt. Denn die Mast der Bruderküken offenbart ein Dilemma, einen Zielkonflikt zwischen Tierwohl und Klimaschutz: Die Bruderhähne der Legehennen müssen in den wenigen Wochen ihres Lebens intensiv mit Kraftfutter gemästet werden, um überhaupt nennenswert Fleisch anzusetzen. Ein effizienter Einsatz von Ressourcen ist das nicht.
Im Kleinen lässt sich das Problem manchmal am leichtesten lösen: Wer selbst im Garten oder hinter dem Haus Hühner hält, muss selten auf besondere Wirtschaftlichkeit der Tierhaltung achten. Und wer sich junge Tiere alter Hühnerrassen beiderlei Geschlechts besorgt, selbst aber nur Eier essen und nicht selbst beim Schlachten Hand anlegen möchte, findet im persönlichen Umfeld sicher jemanden, der oder die sich früher oder später gerne der herangewachsenen Hähne annehmen möchte.

Muskelmasse und Gockelgehabe: Das Ergebnis der gemeinnützigen Ökologischen Tierzucht – hier: ein prächtiger Gockel der Rasse ÖTZ Coffee – kann sich sehen lassen.
TEXT
Thomas Weber
Produkte rund um den Bruderhahn

Spar Österreich sorgt seit einigen Jahren dafür, dass alle Bruderhähne, die in der Bioeierproduktion für Spar anfallen, auch biologisch in Österreich aufgezogen und geschlachtet werden. »Das Fleisch wird in diversen Produkten verarbeitet«, sagt Sprecherin Magdalena Gottschall, »allerdings nicht in Spar-Eigenmarken. Wir testen hier einiges und haben auch schon vieles probiert, allerdings noch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.«.
Das Bruderhahnfleisch ist auf der Babynahrung von Hipp nicht eigens ausgewiesen, »findet sich aber in vielen Beikost-Gläschen, in denen Hühnchen deklariert ist«, sagt Pressesprecher Clemens Preysing. Das Agrarmanagement des Familienbetriebs kümmert sich nicht nur um den Eiereinkauf, sondern besucht und kontrolliert auch die Bruderhahnaufzucht auf den liefernden Biobetrieben. »Wir decken unseren gesamten Ei-Bedarf über die Schwestern, deren Brüder wir zusätzlich abnehmen«, sagt Preysing. Das fettarme Fleisch eigne sich besonders gut für Babynahrung.


Zwar führt die Eigenmarke von Rewe Österreich auch eigene Gockelwürstel und Mischwürstel für Kinder (bestehend aus Freilandschwein, Weiderind und vom Bruderhahn). Mit den einmal pro Woche frisch an einzelne Filialen ausgelieferten Mini-Gockeln hat man sich aber eine besondere Zielgruppe erschlossen. »Einerseits sind das flexitarische Fast-schon-VegetarierInnen, die eigentlich kaum noch Fleisch essen, sich aber eingestehen, dass es, wenn man Ei isst, einfach dazugehört, hin und wieder auch einen Gockel zu essen«, sagt Andreas Steidl, Geschäftsführer von Ja! Natürlich. »Pro Person einen davon in der Pfanne zubereiten und diesen dann, wie eine Wachtel, schön garnieren«, lautet Steidls Tipp. Mit 600 Gramm ist an so einem Mini-Gockel zwar nicht viel dran, dafür bringt er die Vielfalt verschiedener Fleischteile auf den Teller.

ZURÜCK
Auch der Diskonter Hofer (Aldi Süd) ist mit seiner Biomarke »Zurück zum Ursprung« und dem Projekt »Hahn im Glück« einer der Pioniere der Bruderhahnaufzucht. Seit 2016 gibt es das Fleisch der Brüder der Biolegehennen in Form von Biowürsteln (Hühnerwürstel, Käsekrainer, Frankfurter) und als Landhendl-Filetstreifen zu kaufen. »Die Produkte werden von unseren KundInnen sehr gut angenommen«, sagt Isabell Riedl, Nachhaltigkeitssprecherin von Zurück zum Ursprung, »wir durften uns im vergangenen Jahr über eine äußerst gute Entwicklung freuen, speziell auch im Bereich Geflügel, mit Zuwachsraten im zweistelligen Bereich.«

Ein relevanter Teil der Bruderhähne, die auf Biohöfen des Naturland-Verbands gehalten werden, landet in der Wurst von Rewe Bio. Die Hähnchen Lyoner, das Hähnchenbrustfilet und die Hähnchen Lyoner mit Paprika sind deutschlandweit in den Rewe-Filialen erhältlich.


Feldversuche zeigen, dass einige alte Zwiebel-Landsorten am Bioacker durchaus mit hochgezüchteten Hybridsorten mithalten können.
TEXT
Thomas Weber

Die Zwiebel ist gemeinhin kein Gemüse, das wir mit besonderer Vielfalt verbinden. Während bei Tomaten – der wichtigsten Gemüsepflanze überhaupt – zumindest saisonal eine gewisse Auswahl an unterschiedlichen Sorten verfügbar ist und sogar Supermärkte immer wieder ausgewählte Sortenspezialitäten im Angebot haben, stehen bei Zwiebeln oft nur Rot oder Weiß bzw. Gelb zur Wahl. Dabei ist Zwiebel nicht gleich Zwiebel. Und auch bei der zweitwichtigsten Gemüsepflanze steigt die Nachfrage nach regionaler Bioqualität. Das konventionelle Angebot dominieren Hybridzwiebeln. Dieser Massenmarkt war für Züchtung und Saatgutvermehrung über Jahrzehnte am attraktivsten. Wirtschaftlich war es nicht besonders interessant, Sorten für die lange Jahre eher überschaubare Nische der Biolandwirtschaft zu züchten.
Zwar dürfen auch auf Biofeldern Hybridzwiebeln angebaut werden. Doch die hochgezüchteten Hybride eignen sich nicht optimal für die Beschränkungen, denen sich Bio freiwillig unterwirft. »Hybridsorten entfalten ihr volles Ertragspotenzial unter konventionellen Anbaubedingungen – also auf Flächen, auf denen chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel verwendet werden«, sagt Maria Romo-Perez, Pflanzenbauforscherin an der Universität Hohenheim. »Diese intensiven Systeme schaffen gezielt die Bedingungen, auf die Hybridsorten hin gezüchtet wurden.« Ökoanbauverbände wie Bioland oder Demeter sehen Hybridsorten außerdem kritisch, weil diese von ihren Bäuerinnen und Bauern nicht selbständig vermehrt werden können. Hybridzüchtungen sind nicht samenfest. Gemeinsam mit

Im direkten Vergleich: die gelblichen »Birnenförmigen« (alle drei links), eine auch im Bioanbau weitverbreitete Hybridsorte (4. v. l.) und »Rijnsburger 4« (ganz außen).
dem staatlichen deutschen Max-Rubner-Institut unternahm die Forscherin deshalb einen mehrjährigen Feldversuch, um herauszufinden, ob es alte, vereinzelt noch regional vorkommende Landsorten gibt, die unter Bioanbaubedingungen besonders überzeugen. Zuallererst befragte das Projekt »ZwiebÖL« (für Zwiebel und Ökologischen Landbau) konventionell wie biologisch wirtschaftende LandwirtInnen, welche Sorten sie überhaupt anbauen. Genannt wurden 60 Zwiebelsorten, darunter 44 Hybridsorten, die von vielen verschiedenen Betrieben genannt wurden, aber nur noch 16 samenfeste beziehungsweise alte Sorten waren. »Davon wurden alle höchstens zweimal genannt«, sagt Romo-Perez, »was darauf hinweist, dass diese Sorten nur lokal bei einzelnen LandwirtInnen bekannt und nicht weit verbreitet sind«. Mitunter gibt es Vorbehalte, dass Landsorten nicht mehr zeitgemäß und wirtschaftlich angebaut werden können. »Gelegentlich wird behauptet, dass samenfeste und alte Sorten grundsätzlich nicht mit Hybridsorten konkurrieren können«, sagt die Forscherin. »Diese Annahmen, die sich bei anderen Gemüsekulturen teilweise bestätigen, haben wir für Zwiebelsorten überprüft.«
An zwei Anbaustandorten – in Kleinhohenheim bei Stuttgart und am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Rheinpfalz (in Schifferstadt) – wurden über drei Anbaujahre vier bis sechs Land- und Hybridsorten unter den Bedingungen des Ökolandbaus erprobt. Denn diese unterscheiden sich stark vom konventionell Üblichen. »Im konventionellen Zwiebelanbau kommen sowohl präventive als auch kurative Maßnahmen zum Einsatz – etwa im Kampf gegen


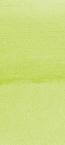












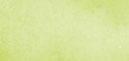


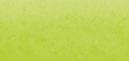
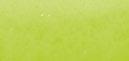







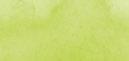
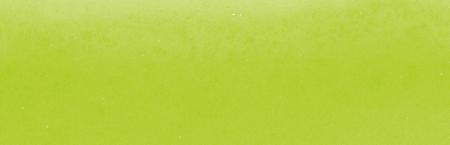

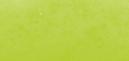
»Bezüglich Ertrag waren unter ökologischen Bedingungen weder die Hybrid- noch die Landsorten klar im Vorteil.«
Zwiebelland Deutschland?
Der Selbstversorgungsgrad bei Zwiebeln betrug in der Saison 2023/2024 70 Prozent.
2023 bauten deutschlandweit 1756 Betriebe Speisezwiebeln an. Auf 15.000 Hektar brachte ein durchschnittlicher Ertrag von 44 Tonnen je Hektar gesamt 666.300 Tonnen Zwiebeln. 51.855 Tonnen davon (1542 Hektar) waren Biozwiebeln.
die gefürchtete Pilzerkrankung, den Falschen Mehltau«, sagt Christoph Weinert, Laborleiter am Karlsruher Max-Rubner-Institut. Der herkömmlichen Landwirtschaft steht eine breite Palette chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. Bio ist hier stark eingeschränkt – und kann diese Krankheiten ebenso wenig einfach »wegspritzen« wie die zahlreichen Unkräuter, die den Zwiebelanbau prinzipiell erschweren. Denn die Zwiebel ist als Pflanze nicht besonders konkurrenzstark und wird leicht überwuchert. »Während im konventionellen Anbau Herbizide eingesetzt werden können, muss im Ökolandbau auf die aufwendigere und nicht immer effektive mechanische Unkrautentfernung zurückgegriffen werden«, sagt Weinert. Für den Anbau von Biozwiebeln spielt deshalb die Fruchtfolge auf den Feldern, etwa durch zwischendurch angebaute Gründüngung, eine zentrale Rolle. Sie bereitet den Boden auf und beugt Krankheiten vor.
Die Ergebnisse der Zwieböl-Feldversuche un-


terscheiden sich von Sorte zu Sorte. »Bezüglich Ertrag waren unter ökologischen Bedingungen weder die Hybrid- noch die Landsorten klar im Vorteil«, sagt Weinert. Als besonders lagerfähig erwies sich die gelbliche Landsorte »Birnenförmige« mit ihrem ausgeprägt scharfen Aroma, die optisch an Schalotten erinnert. Die milde, bronzefarbene Landsorte »Rijnsburger 4« bringt auf derselben Fläche dafür etwas mehr Ernteertrag. All das lässt durchaus hoffen, dass die Vielfalt an in Bioqualität erhältlichen Zwiebelsorten mittelfristig zunimmt. Denn die Zwieböl-Ergebnisse machen die alten Landsorten nicht nur für Anbaubetriebe interessant, sondern auch für die Züchtung und Vermehrung.

POST LOOP-FRISCHEPAKET
Mit eingebauter Nachhaltigkeit.
post.at/frischepaket

Gekühlte und frische Lebensmittel verschicken Sie einfach in unserer handlichen Isolierbox. Ihre Waren kommen schon am nächsten Tag sicher an. Empfänger*innen retournieren die Box im passenden Überkarton direkt nach der Zustellung und Sie können sofort die nächste Bestellung auf den Weg schicken. Egal, ob Sie an Privatkund*innen versenden oder an die Gastronomie: Mit unserem Post Loop-Frischepaket bleiben gekühlte Köstlichkeiten immer fresh.

DIE TOMATE AUS DEM SPANISCHEN FOLIENTUNNEL HAT EINE
GERINGERE CO2-BILANZ ALS DIE REGIONAL PRODUZIERTE IM HIESIGEN SUPERMARKT. Mehr auf biorama.eu/regionalitaet
KLIMAFAKTEN IN PERSPEKTIVE GESETZT. – MAGAZIN FÜR NACHHALTIGEN LEBENSSTIL.
Im Abo erhältlich auf biorama.eu/abo – auch zum Verschenken.
6AUSGABEN À25EURO

TEXT
Irina Zelewitz
BILD
Biorama
So schnörkellos wie die alte Schreibweise des Wortes Creme soll sie sein: die Tagespflege, die idealerweise das ganze Jahr passt, alleine reicht, aber auch von Sonnenschutz bis Make-up mit allem kombinierbar ist. Ein Basic, das, wenn immer nötig, mit dem Wichtigsten versorgt: Feuchtigkeit. 5 Vorschläge.
i+m Rosy Glow Cream
Gesichtscreme
Vorsicht! Die samtige, leichte Textur könnte dazu verführen, mehr aufzutragen, als nötig. Die rosige Farbe zaubert frische Backerl – und auch im Restgesicht einen gesünderen Teint.
Mit kaltgepresstem Wildrosenöl, vegan, nicht nur Natrue-Organic, sondern auch Gemeinwohlökonomie-zertifiziert. Hergestellt in Deutschland. iplusm.berlin
Seewald Bio. Rose
Anti-Aging Gesichtscreme
Mhmm. Eine Rosencreme, wie sie sein soll. In der Special Edition mit Frauenmantel, Holunder, Gänseblümchen, Mädesüß – die beliebte Retinol-Alternative Bakuchiol und zweifach-Hyaluronsäure inklusive. Biozertifiziert nach Austria-Bio-Garantie. seewald-ortho.com
Tagespflege
Puristisch, ohne Duft, mikrobiomfreundlich – ideal für alle mit sensibler Haut oder geschundener Hautbarriere. Ergiebig, alkoholfrei, hergestellt in Deutschland und nach Natrue-Standard zertifiziert. lavera.com

Bioemsam kao:tsuki/ Feuchtigkeitscreme
Schon ein Klassiker, weil ein vollgepackter Allrounder – dabei aber einer der wenigen, die so fein duften und für normale, aber auch für fettige Haut geeignet sind. Biozertifiziert nach Bio-Austria-Garantie. Made in Austria. multikraft.com
Tägliche Pflege für reife Haut
Eine Pflegebombe mit Marulaöl und Sheabutter, aber auch Hyaluronsäure und Rotalgenextrakt – wirklich reichhaltig, für trockene und reife Haut. Zieht aber schnell ein. Nach Icada-Standard zertifizierte Naturkosmetik aus Deutschland. jolu.eu

TEXT
Irina Zelewitz
Der aus Ecuador stammende und in Salzburg kochende Vergara fackelt nicht lang herum, das Ziel gesunde Ernährung erreiche man am einfachsten durch unkomplizierte Gerichte, vegan oder vegetarisch – das kommt auch Tier- und Umweltschutzzielen entgegen. Seine Küche ist geprägt von der seines Herkunftslandes und der an seinem jetzigen Lebensmittelpunkt – und allem Möglichen dazwischen, es da allzu genau zu nehmen, ist auch
nicht nötig – einige Grundkniffe würden sich ohnehin international ähneln, meint Vergara. Und so folgen dann nach einer Mini-Anleitung zum Veganisieren von vegetarisch konzipierten Gerichten auch gleich 160 Seiten knappe Rezeptanleitungen, die nicht nur unkompliziert sind, sondern auch auf eine Art in Szene gesetzt, die den Hobbykoch nicht entmutigt. Mit ein bisschen Geschick kriegt man das hin!
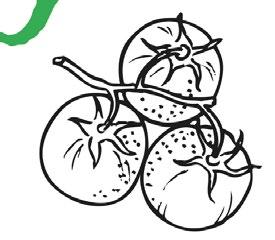

ZUTATEN
Teig
• 250 g Weizenmehl (Type 550)
• 50 g Hartweizengrieß
• 200 ml Wasser
• 6 g Salz
• 7 TL Pflanzenöl
• Öl zum Bearbeiten, für das Backblech und die Arbeitsfläche
• 80 g gesalzene Butter
• Grieß zum Bestreuen
Balsamico-Feigen
• 12 Feigen (nicht zu weich)
• 2 EL Butter
• 2 EL Aceto Balsamico Bianco
• 200 g Hirtenkäse, gewürfelt,
• zum Garnieren
ZUBEREITUNG
In einer Schüssel Mehl und Grieß vermengen, das Wasser hinzugeben und für mindestens 2 Minuten verrühren, anschließend Salz und 1 TL Pflanzenöl beimengen und für ca. 6 Minuten kneten, bis sich der Teig von der Schüssel löst und er eine elastische Konsistenz hat. Den Teig in ca. sechs gleich große Stücke teilen, jedes rund formen und im restlichen Pflanzenöl auf der Arbeitsfläche oder in einer flachen Schüssel wenden. Ein Backblech mit Öl einfetten und die Teiglinge auf dem Blech verteilen. Mit Frischhaltefolie abdecken und den Teig mindestens 30 Minuten ruhen lassen.
Die Butter schmelzen, Öl dazumischen und in eine kleine Schüssel geben. Den Grieß ebenfalls in eine kleine Schüssel füllen. Die Arbeitsfläche erneut einölen und jeden Teigling mit dem Nudelholz zu einem Kreis mit etwa 25 cm Durchmesser ausrollen, bis er sehr dünn wird und man fast durchsehen kann (ähnlich wie Strudelteig).
1 EL der Butter-Öl-Mischung mit den Fingern auf dem Teig verteilen und mit etwa 1 TL Grieß bestreuen. Das obere Drittel des Kreises nach unten schlagen, ebenfalls mit Butter-Öl bestreichen und mit etwas Grieß bestreuen, dann den unteren Teil nach oben darüberklappen, wieder bestreichen und bestreuen. Dann von der linken Seite ein Drittel des Rechtecks nach innen klappen, erneut bestreichen und danach von der rechten Seite ein Drittel darüberklappen. Es entsteht ein Quadrat mit etwa 8 cm Seitenlänge. Diese Arbeitsschritte bei allen Teiglingen wiederholen. Die gefalteten Teiglinge mit der Oberseite nach unten auf das geölte Backblech legen und 15 Minuten ruhen lassen.
Währenddessen sechs Backpapierstücke von ca. 18 × 20 cm zuschneiden. Nach der Ruhezeit die Teiglinge auf das vorbereitete Papier legen und vorsichtig mit den Händen auf die doppelte Größe auseinanderziehen. Falls sich der Teig nicht gut ziehen lässt, noch etwas länger ruhen lassen.
Eine große Pfanne bei mittlerer Temperatur ohne Öl erhitzen. Jeweils einen Teigfladen mit der Backpapier-Seite nach oben in die Pfanne legen. Sobald das Brot beginnt, fest zu werden, lässt sich das Papier leicht abziehen. Nach ca. 3 Minuten wenden und die andere Seite ebenfalls 3 Minuten backen, bis sie erst durchscheinend und dann an einigen Stellen braun wird. Aus der Pfanne nehmen und zum Auskühlen auf einen Rost legen.
Die Feigen längs vierteln. In einer Pfanne Butter schmelzen lassen, mit Aceto Balsamico ablöschen und kurz kochen lassen. Die Feigen beimengen und darin schwenken. Die Msemen auf flachen Tellern anrichten, die Balsamico-Feigen darauf verteilen und mit dem gewürfelten Hirtenkäse garnieren.
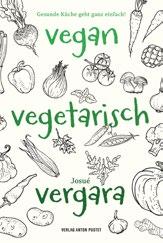
Josué Vergara, »Vegan · Vegetarisch · Vergara«, 2024, Anton Pustet.

ZUTATEN

• 2 große rote Zwiebeln
• 300 g bunte
Kirschtomaten
• 4 Limetten (ausgepresst)
• 4 EL geschnittener
Koriander
ZUBEREITUNG
• Salz, Pfeffer
• 500 g Maniok, gekocht und in 1/2 cm große Würfel geschnitten
• 6 EL Olivenöl
Die roten Zwiebeln schälen, in feine Streifen schneiden,
in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben und für etwa 5 Minuten ruhen lassen. Die Tomaten vierteln und mit dem Limettensaft, Koriander, Salz und Pfeffer in einer anderen Schüssel vermengen.
Die Zwiebeln aus dem Wasser herausnehmen und dazugeben, den gewürfelten Maniok ebenso hinzufügen, mit dem Olivenöl vermengen und vorsichtig rühren.
Nach Bedarf mit Salz und Pfeffer nachwürzen.
Variante mit Edamame: Man verzichtet auf Maniok und greift dafür auf 500 g geschälte Edamame zurück.

• ca. 1 kg Rote Bete
• frischer Thymian
• 250 ml Schlagsahne
• 200 g Quark
• 3 Eier, verquirlt
1/2 Knoblauchzehe, fein gehackt
• Salz, Pfeffer
• 200 g Montello, gerieben
Den Ofen auf ca. 200 Grad vorheizen. Rote Bete schälen, waschen, in feine Scheiben (ca. 2 mm dick) schneiden.In einer entsprechend großen Auflaufform schichten. Thymian, Sahne, Quark, Knoblauch und die verquirlten Eier miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die Mischung über die Rote Bete gleichmäßig verteilen, mit dem geriebenen Montello bestreuen, danach mit Alufolie abdecken. Das Gratin im heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca. 50 Minuten garen.
Anschließend die Folie entfernen und weitere 6 Minuten backen, bis das Gratin eine goldbraune Farbe angenommen hat.
Dazu passt sehr gut eine Paprikasauce. Dazu 4 rote Paprika waschen, halbieren und entkernen. Mit einer Mischung aus etwas Knoblauch, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer bedecken. Im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten backen. Danach in einen Mixer geben und mit ca. 50 ml Gemüsefond glatt mixen. Durch ein Sieb passieren und die Sauce nach Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit einem Schuss Sahne wird sie noch cremiger.


Empfehlungen, Warnungen, warnende Empfehlungen. Von Neuentdeckungen und alten Perlen. Auf dass uns Weghören und -sehen vergeht.
DAG O. HESSEN / »DIE SPUR DES VIELFRASSES« / Kommode, 2025.
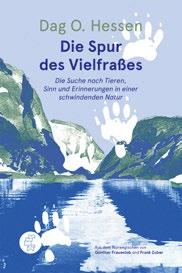
Vorgelesen für alle, die sich mit auf die Spur eines real existierenden Fabelwesens ins norwegische Niemandsland begeben wollen.
Es ist natürlich eine Reise zu sich selbst, auf die sich Dag O. Hessen aufmacht, wenn er 50 Jahre, nachdem er bei einer Skitour mit seinem Vater die Spur eines Vielfraßes entdeckt und eine Zeit lang verfolgt hat, an denselben Ort zurückkehrt, um die Fährte wiederaufzunehmen. Er reflektiert – sich, seine Umwelt und seinen eigenen Umgang mit der Natur. Das erste Mal seit seiner Jugend begibt er sich wieder in die Natur /hinein/, nicht /hinaus/ in die Natur, hinein in ein weißes, menschenleeres Niemandsland über der Baumgrenze. Ob er das Fabelwesen, dessen Fährte ihm seit 1972 nicht mehr aus dem Kopf ging, wirklich findet, wird dabei zusehends unerheblich (und soll hier auch gar nicht verraten werden). »Der Vielfraß verkörperte für mich alle Wildheit«, schreibt Hessen, »Ich erlebte den Vielfraß als Urkraft, als Wildnis in Tiergestalt. Er stand für alles, was in der gezähmten Restnatur mehr und mehr verloren ging.« Dag Olav Hessen, Professor für Biologie an der Universität Oslo und Mitglied der Norwegischen Akademie der Wissenschaften, ist in seiner Heimat ein angesehener Sachbuchautor und vielfach ausgezeichnet (u. a. mit dem Humanistprisen). Seine Meditationen über den Vielfraß (aus
dem Norwegischen übersetzt von Günther Frauenlob und Frank Zuber) sind ein gelungenes Stück appellatives Nature Writing, das trotz feurigem Herzen vermittelt, wozu es sich auszahlt, kühlen Kopf zu bewahren – und den Klimawandel zu bekämpfen.
LINH NGUYEN, DANIEL ESSWEIN / »LIKE A VIRGIN« / Callwey, 2025.
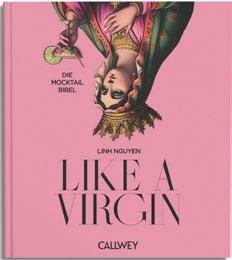
Vorgelesen für alle mit einem zumindest optisch klassischen Zugang zu Drinks.
Linh Nguyen hat weltweit so manch Preis als Barkeeperin für ihre Drinks und Kreationen bekommen und bezeichnet sich selbst als »Queen of Cocktails«. Ihre »Mocktail-Bibel« bietet einen recht umfassenden Einblick und startet mit viel angenehm knapp gehaltenem Basiswissen zur Mixologie, Zutaten, Werkzeugen und auch Techniken. Die Rezepte sind vielfältig – wenig überraschend mit einem Hang zu fruchtigen Drinks. Dabei werden teilweise in klassischen Rezepten Destillate mit alkoholfreien Produkten ersetzt, es gibt aber ebenso Vorschläge, die darüber hinausgehen und schon im Grundansatz alternative Wege einschlagen. »Like a Virgin« ist wertig gestaltet und produziert, der Gesamteindruck – vor allem was die Bilder und den Fonteinsatz betrifft, weist aber geradezu klassisch in eine opulente,
leicht süßlich gestimmte Vergangenheit. Und so knapp der erste Teil des Buchs Wissenswertes sammelt, so redundant und unkreativ sind viele Infos bei den Rezepten. Wer sich an der Aufmachung nicht stört oder von dieser sogar angesprochen wird, findet hier ganz sicher so manch Idee, die zur Nachahmung oder Weiterentwicklung inspiriert. Für Kenner bietet das Buch – auch wenn die Drinks hier eben ohne Alkohol auskommen – vielleicht doch etwas zu wenig Überraschungen. Eine Bibel eben.
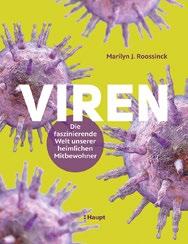
MARTIN MÜHL
Vorgelesen für alle, die mehr über die Welt der Viren, die von ihnen ausgehenden Gefahren und ihren Nutzen wissen wollen.
»Viren« ist die deutsche Übersetzung des 2023 erschienenen »Viruses – A natural history« und bietet eine umfassende und bunte Sammlung von Wissen über Viren, ihre Varianten und ihren Einfluss auf das Leben. Gemeint sind hier nicht nur Menschen, sondern die gesamte Biologie. Das Buch ist um Zugänglichkeit bemüht – die Inhalte sind aber nicht wirklich einfach – als LeserIn ohne tiefgehende naturwissenschaftliche Kenntnisse läuft man immer wieder Gefahr, auszusteigen, weil sowohl Fachtermini als auch das Nachvollziehen mancher der beschriebenen Prozesse LaiInnen mindestens fordert. Und das gerade am Anfang des Buchs, in dem es um die Grundlagen für die späteren Kapitel, etwa den grundsätzlichen Aufbau von Zellen, die Unterscheidung von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen, RNA oder auch DNA geht. Eine Gemeinsamkeit aller Viren ist: Sie brauchen Wirte und werden für diese oft auch gefährlich. Nicht ausgespart wird hier etwa die Erklärung, warum

So schmeckt der Sommer: Knackiges Gemüse, süßes Obst, frische Kräuter, ein fruchtiger Saft und würziges Kräutersalz.
Im ADAMAH Sommer Kistl ist das alles schon drin und kommt um € 35,- bequem zu dir nach Hause. www.adamah.at
MARTIN MÜHL
diese Gefährlichkeit der Viren beispielsweise für Populationsregulation (evolutions)biologisch betrachtet auch notwendig ist. Kapitel widmen sich beispielsweise dem »Kampf zwischen Viren und ihren Wirten«, der »Funktion von Viren in Ökosystemen« oder auch den »guten Viren« und ihrem Nutzen. Etwa durch Symbiose mit den Wirten oder wenn diese Feinde von Wirten bekämpfen. Die Virenarten werden nicht nur über das gesamte Buch verteilt beschrieben, sondern jede bekommt auch ein knackiges wie aufschlussreiches Kurzporträt auf einer Doppelseite. »Viren« gibt einen umfassenden Einblick für alle, die vor der Komplexität und Detaildichte nicht zurückschrecken.
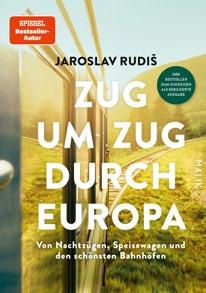
Nachgelesen für alle, die nach neuen Wegen zu Klimaneutralität und Savoir-vivre suchen.
»Wie ein Eisenbahnmensch lebt«, vermittelt Jaroslav Rudiš in diesem Buch, sagt sein Verlag und würdigt das mit einer mit 150 Bildern versehenen Neuauflage als Geschenkausgabe der 2021 erschienenen Hommage an Europa, seine Zugstrecken und Originale entlang dieser zum Titel »Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen« (BIORAMA hat berichtet). Wegen ihres ästhetischen Werts allein braucht man die
Neuauflage nicht kaufen, aber im Zusammenspiel mit dem vollständigen Text der Originalausgabe eine noch rundere Sache. Kann man verschenken, muss man haben.
IRINA ZELEWITZ

Nachgelesen für Kinder jeden Alters, die mehr vom Meer wissen wollen.
Dieser schwere, große Band mit über 3000 Bildern bietet nicht nur einen Ausflug in die maritime Welt, wie ihn das Cover verspricht, sondern eigentlich mehrere hundert solcher Ausflüge. Ein Bilderbuch im besten Sinn, bei dem jede Doppelseite kontrastierenden Zugängen gewidmet ist und als Einstiegsort ins Buch gewählt werden kann und trotzdem noch Platz ist, die einzelnen Geschichten in einen Kontext zu setzen. Von Marcus Pfisters »Der Regenbogenfisch« (der Klassiker aus dem Nordsüd Verlag) über Paul Klees »Fischbild« bis zu einem Geldschein der Republik Malediven: Ob man das nun in erster Linie willkürlich oder großartig findet, liegt vermutlich an der Ausprägung des eigenen Meeresinteresses. »Ozeane – Die Welt der Meere« hat alles, was mittelgroße bis große Kinder wollen.
HELGE SCHNEIDER · KETTCAR LEVIN LIAM · MELVINS MIGHTY OAKS · ZAZ MILKY CHANCE · NOGA EREZ RIAN · WOLFMOTHER TOCOTRONIC
Die fünfzehnte BIORAMANiederösterreichRegionalausgabe

Niederösterreich umgibt die österreichische Bundeshauptstadt Wien, da liegt es uns besonders nahe, schwerpunktmäßig darüber zu berichten, was dort nachhaltig bewegt. In der jüngst erschienenen dreht sich alles um Energie und darum, wie vorteilhaft es ist, ihre Produktion und Verteilung selbst in die Hand zu nehmen. Kann auch von Nicht-NiederösterreicherInnen gelesen werden – zum Beispiel über eine Nachbestellung im Aboshop oder online unter
biorama.eu/abo biorama.eu/noe15
Jedes Jahr im Spätherbst küren BIORAMA und die Messe Wieselburg die »Bio-Produkte des Jahres«. Bis 19. September können interessante Produkte eingereicht werden. Bewertet wird nach den Kriterien Innovation, Nachhaltigkeit, Packaging/Design und Geschmack/Nutzen in den Kategorien »Farm & Craft« (Handwerkliches, Bäuerliches), »Retail & Big Brand« (starke Marke), »Beverages« (Getränke & Drinks), außerdem in den Sonderkategorien »Bio Austria« und »Garten« (Alles für den Biogarten). Erstmals wird auch das Demeter-Produkt des Jahres ausgezeichnet. Die Jury besteht aus Kulinarikjournalistin und Kochbuchautorin Katharina Seiser, Reinhard Gessl (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), Bio-Austria-Obfrau Barbara Riegler, Barbara Köcher-Schulz (Bio-Marketing der Agrarmarkt Austria), Rainer Will (Österreichischer Handelsverband), Jürgen Undeutsch (Messe Wieselburg), Stefan Strobelberger (Bewegung »Natur im Garten« des Landes Niederösterreich und der Stadt Tulln) und BIORAMA-Herausgeber Thomas Weber.
Shortlists und GewinnerInnen sind wie jedes Jahr in der BIORAMAOnlineausgabe mitverfolgbar, die Urkunden und Trophäen werden am 13. November am »Forum Bio« in Wieselburg verliehen.
bio-auszeichnung.at biorama.eu/bioprodukt-des-jahres
NETZWERK
Mit dieser Ausgabe startet die Kooperation zwischen BIORAMA und der Genossenschaft Riffreporter – einem Zusammenschluss freier AutorInnen. Auf Basis des gemeinsamen Ziels, mit solider Information zu guten gesellschaftlichen Entscheidungen beizutragen, findet ihr ab jetzt auch Beiträge des Kollektivs in eurem LieblingsNachhaltigkeitsmagazin. Juhu!
riffreporter.de

Jährlich sechs Ausgaben direkt in deinen Briefkasten!

BIORAMA WIEN–BERLIN #5


Ist da was im Wasser? In der nächsten Ausgabe von BIORAMA Wien–Berlin werden wir uns wieder ansehen, welche unterschiedlichen oder auch ähnlichen Antworten die beiden Städte auf die Bedürfnisse ihrer BewohnerInnen finden – wir werden Unvergleichbares vergleichen. Denn: Wir lieben unsere Hauptstädte, wollen sie aber noch liebenswerter gestaltet wissen und dazu immer wieder neue Vorbilder finden. Unsere bisherigen Hauptstadtausgaben sind – wie alle BIORAMA-Printmagazine – online nachlesbar auf biorama.eu/ausgaben
Auch wenn biorama ein Gratismagazin ist, kannst du es abonnieren und bekommst jede Ausgabe nach Hause geschickt – bei einem Wohnsitz in Österreich auch unsere LineExtension biorama Niederösterreich. Für 25 EUR im Jahr bist du dabei und unterstützt unsere unabhängige redaktionelle Arbeit. biorama.eu/abo
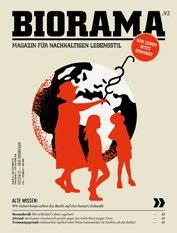

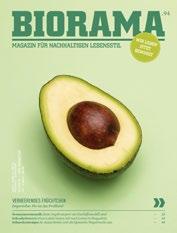


TEXT
Ursel Nendzig
Als sich ein vermeintlich pädagogisch wertvolles Märchen in Wohlgefallen auflöste wie Salz in heißem Wasser.
N»Und

Autorin Ursel Nendzig, Mutter zweier Söhne, berichtet live aus der Achterbahn.
eben Dosenananas (ich berichtete) liebt der große Sohn alles, was ordentlich salzig schmeckt. Er salzt wie ein Verrückter und ich habe die leise Vermutung, dass ich daran schuld bin: Nachdem ich es geschafft hatte, ihn sein gesamtes erstes Lebensjahr von Zucker fernzuhalten, versagte ich bei Salz. Ich erinnere mich genau daran, wie er sich ein Stück Surschnitzel (für alle, die es nicht kennen: gepökeltes, paniertes – also sehr salziges – Fleisch) von einem Teller geschnappt hat, da war er vielleicht ein knappes Jahr alt. Alle Versuche, ihm die Beute abzunehmen, scheiterten. Wie ein Jagdhund, der den Fasan nicht mehr hergeben möchte, verteidigte er es, hielt es fest in seinen kleinen Händchen und entwand sich geschickt jedem Versuch, es ihm abzunehmen. Es fehlte gerade, dass er knurrte. Mit nur zwei Schneidezähnchen brachte er es zuwege, dieses Stück Fleisch zu zermalmen und ratzeputz aufzuessen. Danach war er das erste Mal in seinem Leben glücklich verliebt. In Salz. Meine Vorträge darüber, dass zu viel Salz ungesund sei, interessierten ihn selbstverständlich nicht. So versuchte ich es, meinem pädagogischen Instinkt folgend, mit einer der, wie ich jedenfalls fand, besten (einzigen?) Geschichten zum Thema Salz, die ich kannte: dem Märchen von der Prinzessin Binsenkappe. Das zerlesene Heft, aus dem ich sie kannte, war längst verschollen, also erzählte ich sie aus dem Kopf: Ein König hat drei Töchter und fragt sie der Reihe nach, wie sehr sie ihn liebten. Eine sagt »wie Edelsteine«, die nächste »wie Gold« – und die dritte: »wie die Speisen das Salz«. Der König natürlich erzürnt, jagt die dritte Tochter vom Hof,
die sich daraufhin mit Gewand und Hut, die sie selbst aus Binsen geflochten hat, unkenntlich macht und heimlich in der Küche des Hofes arbeitet. Als dann die älteste Tochter heiratet, werden nur Speisen ohne Salz serviert und der König erkennt, wie scheiße das schmeckt und wie unrecht er der Tochter getan hat.
An diesem Punkt fiel es mir dann auch auf: Die Geschichte ist kompletter Bullshit. Und davon einmal abgesehen absolut pro Salz! Sie macht null Sinn als pädagogisch wertvolles Anti-Salz-Manifest!
Der Sohn schaute mich mit großen Augen an, fasziniert und ergriffen von dieser Geschichte, die ihm schließlich aus tiefster Seele sprach. Ich erkannte meinen Irrweg und versuchte, diesem seltsamen Märchen, das ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht hinterfragt, sondern als Schatz aus meiner Kindheit
so aßen sie die ungesalzenen Speisen und erkannten, wie köstlich sie waren, und die Tochter kehrte an den Hof zurück und sie lebten glücklich und blieben ihr Leben lang gesund.«
im Herzen getragen hatte, ein neues, meiner Mission dienlicheres Ende zu verpassen. »Und so aßen sie die ungesalzenen Speisen und erkannten, wie köstlich sie waren, und die Tochter kehrte an den Hof zurück und sie lebten glücklich und blieben ihr Leben lang gesund, weil sie weder an Bluthochdruck noch an Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Folge von zu hohem Salzkonsum starben.« Selbst einem kleinen, salzabhängigen Buben war klar: Dieser klägliche Versuch ging voll in die Binsen.




Sonnenschneckerl Photovoltaik-Fan

Warum die Sonne so gerne auf Wiens Dächer scheint? Weil wir sie seit rund 25 Jahren in Öko-Kraftwerke verwandeln. Ob Wohnhaus, U-Bahnstation oder Sehenswürdigkeit – wir treiben den Ausbau auf allen möglichen Häusern voran: wienenergie.at