Nr. V / 40. Jg / 19. Woche
Bonn und Berlin / Mai 2025


Nr. V / 40. Jg / 19. Woche
Bonn und Berlin / Mai 2025

Die Kommunen sind gleichsam Nukleus und Nährboden unseres Staatswesens und unserer Demokratie. Ob Migration, Digitalisierung, Sicherheit oder Bürokra tie – wie unter einem Brennglas zeigen sich Probleme und Herausforderungen in Städten und Gemeinden. Dabei kämpft die kleinste Einheit der deutschen Verwal tung selbst mit knappen Budgets, Personalmangel und zunehmend komplexen Vorgaben.
Europa sucht den Anschluss im Low‑Earth‑Orbit
(BS/Jonas Brandstetter) Der Weltraum ist kriegsentscheidend in allen Dimensionen. Besondere Bedeutung kommt dabei Konstellationen – Satellitennetzwerken in den erdnahen Umlaufbahnen (LEO) – zu. Die meisten Fähigkeiten im All hat US‑Unternehmer Elon Musk. Seit 2022 arbeitet die EU mit IRIS2 an einer eigenen Lösung. Doch seit April ist klar: Deutschland könnte einen Sonderweg gehen.
Mitte April bröckelte die deutsche Weltraumsolidarität mit der EU: Das Verteidigungsministerium (BMVg) räumte ein, dass die Mitarbeitenden zurzeit verschiedene Optionen für den möglichen Aufbau einer eigenen Konstellation ausloten. Sie soll den steigenden Bedarf an raumgestützter Aufklärung auf nationaler Ebene decken. Die Frage, wie sich die geplante Konstellation technisch gestalten könnte und welche Kosten damit einhergingen, ließ das BMVg unbeantwortet. Eine Idee davon, welche Summen ein derartiges Vorhaben verschlingen könnte, vermittelt aber ein Blick auf das
europäische Konstellationsprojekt
IRIS²: 10,6 Milliarden Euro soll es kosten, um 292 Satelliten der Konstellation ans Netz zu bekommen. Der Koalitionsvertrag verspricht Investitionen in die Infrastruktur im All, bleibt aber vage. Konkrete Summen werden nicht genannt.„Wir werden die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Weltraum entschlossen und zügig ausbauen“, heißt es lediglich.
Die Bundeswehr braucht mehr Kapazitäten im All
Auch die Bundeswehr will ihre Weltraumfähigkeiten ausbauen.
Der stellvertretende Inspekteur des Kommandos Cyber und Informationsraum, Generalmajor Jürgen Setzer, hatte noch im Februar erklärt, dass die Kapazitäten der Bundeswehr für die Aufgaben im Internationalen Krisenmanagement (IKM) bislang noch auskömmlich gewesen seien, unter den Bedingungen der Landes und Bündnisverteidigung (LV/ BV) seien aber mehr Fähigkeiten vonnöten.
Einen autarken Kern, der mit anderen Systemen ergänzt wird,
formulierte Setzer damals als Ziel. Zwei Monate später scheint dieser autarke Kern bedeutend an Umfang gewonnen zu haben. Zurzeit tauscht sich die Bundesregierung mit Unternehmen der deutschen Weltraumindustrie über Umsetzungsmöglichkeiten einer eigenen Konstellation aus. Kritik an IRIS² gab es jedoch bereits zuvor. Im Mai vergangenen Jahres brachte die Fraktion der CDU/CSU im Rahmen einer Kleinen Anfrage ihre Bedenken zum Ausdruck. Wegen mangelnder Beteiligung der deutschen Industrie befürchteten die Christdemokraten, dass die Bundesrepublik sicherheits und industriepolitisch den Anschluss im All verlieren könnte. Ein Jahr später stellt die CDU den nächsten Kanzler und hat im Koalitionsvertrag niedergelegt, wie sie gemeinsam mit der SPD die deutsche Weltraumpolitik gestalten will. Eine eigene Konstellation für die Bundeswehr käme diesem Ziel und dem Wunsch nach weltraumindustrieller Autonomie entgegen. Einer von vielen Ausreißern
Die Idee, neben IRIS² eine eigene Konstellation aufzubauen oder andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, kann die Bundesrepublik nicht für sich allein beanspruchen. Anfang Januar sorgte die italienische Regierung für Aufsehen, als Premierministerin Giorgia Melo-
ni Verhandlungen mit SpaceX zum Einsatz der Konstellation Starlink aufnahm. Mittlerweile liegen die Bemühungen aber auf Eis. „Derzeit gibt es keine Verhandlungen über eine mögliche Vereinbarung zur Nutzung des Starlink Satellitensystems“, erklärte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto Anlass dafür hätte Kritik an der Person Musk gegeben. Mitte April monierte Crosetto hingegen, dass die Debatte, ob Italien SpaceX oder europäische Konkurrenz als Dienstleister für sichere Kommunikation beauftragen sollte, zu politisch sei: „Ich glaube, wir müssen zwischen politischen und technischen Aspekten unterscheiden.“
Während Deutschland und Italien nach Alternativen zur europäischen Satellitenlösung suchen, hält Frankreich IRIS² die Treue. Anfang April forderte der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu die Kommission auf, die Geschwindigkeit bei der Entwicklung der europäischen Konstellation mit mehr Geld zu erhöhen.
„Dieser Schritt ergibt Sinn, weil wir keinen Plan B haben – entweder das oder Starlink.“ Teil der Wahrheit ist aber auch, dass der französische Rüstungsprimus Thales seit April damit beauftragt ist, Einheiten für den Anschluss französischer Armee Fahrzeuge an kommerzielle Netze zu entwickeln.

Ein wunderbarer Kreislauf
Das Beispiel Rottenburg am Neckar zeigt, wie Integration gelingen kann: Wer nur von Problemen spricht, be feuert diese.
Seite 15

Kompatibel mit Europa
Seit Jahresbeginn verpflichtend: Die sogenannte Interoperabilitätsbewer tung fließt in den Digitalcheck ein. Seite 26

Gewalt im Algorithmus
Zwischen Peer Pressure und Mobbing: Wie die Sozialen Medien die Polizeili che Kriminalstatistik beeinflussen. Seite 35
Schwerpunktthema der Ausgabe

SCHWERPUNKT
Die Förderung ins Land bringen NRW.Bank zieht Jahresbilanz
Zugang verweigert
Wie barrierefrei ist die Kommunalverwaltung?
Kommunen als Stützen der Demokratie
Die soziale Daseinsvorsorge in Zeiten des Umbruchs
11
Eine für alle, alles in einer Kommunale Apps als digitaler Bürgerservice S. 22

Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Fundament Kommune“ handelt.
Alt und Neu bleibt sich treu

Impressum
Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH.
Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Moschinski Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon
Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch
Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser
Digitaler Staat Christian Brecht, Paul Schubert, Anna Ströbele Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky
Sonderkorrespondenten BOS Dr. Barbara Held, Gerd Lehmann
Online-Redaktion Tanja Klement
Parlamentsredaktion Berlin
Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10
Zentraler Kontakt
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57
Tel. 0228/970 97-0
Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41
Tel. 030/55 74 12-0
www.behoerdenspiegel.de
Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch
Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch Layout Fabienne Besold, Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, Maximilian Spuling Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn
Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau
Herausgeber- und Programmbeirat Uwe Proll (Vorsitz)
Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent
Für Bezugsänderungen:
Kommentare
Wie
(BS) Für Bürgerinnen und Bürger sind 500 Milliarden Euro eine nicht auszugebende Summe. Aber wenn es um die kränkelnde Infrastruktur Deutschlands geht, ist das nichts, was den heißen Asphalt dauerhaft abkühlen lässt, aber ein großer Schritt in die richtige Richtung. Zumindest wenn das Geld tatsächlich da ankommt, wo es gebraucht wird. Denn wer – oder welche Baustelle – letzten Endes wie viel erhält, ist nach wie vor nicht geklärt, auch der Koalitionsvertrag gibt hier nur grobe Orientierungspunkte. Gerade die Kommunen hoffen, dass das Geld in großen Teilen bei ihnen landen wird, nicht zuletzt auch, weil sie im letzten Jahr ein Rekorddefizit zu verzeichnen hatten. Wenn das Sondervermögen nur an die über 10.000 Kommunen fließen würde, wären das immerhin noch mehr als 40 Millionen Euro pro Kommune. Damit könnten schon einige Projekte – von der Sanierung der maroden Infrastruktur und kommunaler Krankenhäuser über nachhaltige Umgestaltung oder soziale Projekte –erfüllt und angestoßen werden. Aber so wird das Geld laut Koalitionsvertrag nicht verteilt werden. Dort steht, dass den Ländern und Kommunen direkt nur 100 Milliarden Euro zugeteilt werden. Damit würden ohne Berücksichtigung der Länder schon weniger als zehn Millionen Euro an jede Kommune gehen, und das ist nicht viel Geld für eine Sanierung und Modernisierung. Zwar sollen auch weitere Anteile des Sondervermögens Ländern und Kommunen zugänglich gemacht werden, z. B. über den
Klima- und Transformationsfonds in den weitere 100 Milliarden Euro schrittweise einfließen sollen. Aber auch damit werden logischerweise nicht alle Baustellen abgearbeitet werden können. Es bleibt also zu hoffen, dass die dringensten Vorhaben als erste angegangen werden.
Immerhin sieht der Koalitionsvertrag auch Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren bei Projekten vor, die besonders wichtig sind, auch wenn nicht festgelegt ist, wie diese Beschleunigung aussieht oder was besonders wichtige Projekte sind. Es ist also noch nicht abzusehen, wie viel Geld letzten Endes wo eingesetzt wird. Verteilen wir das Geld langsam und mühselig über möglichst viele Baustellen oder werfen wir jetzt so viel Geld wie nötig auf ein gezieltes Problem? Nehmen wir einmal unsere maroden Brücken. Wenn wir nun einfach aus den 500 Milliarden das nehmen, was wir brauchen, um die Brücken zu sanieren, kommt es unweigerlich zu einem Stau, denn neben den voraussichtlich langwierigen Vergabeverfahren, wird es auch einen Mangel an umsetzenden Firmen geben. Ganz zu schweigen von den Folgen für unser Infrastrukturnetz, wenn wir alle Brücken gleichzeitig sanieren. Das Sondervermögen muss also schnell und sinnvoll fließen, um unsere marode Infrastruktur wieder nach vorne zu bringen. Es kommt also nicht nur auf die Größe des Sondervermögens an, sondern darauf, wie man es einsetzt.
(BS) Boris Pistorius wollte das Land kriegstüchtig machen, die NATO wird mehr Einsatzkräfte für den Ernstfall von Deutschland fordern –dafür bräuchte es eine Umkehr bei der Gewinnung von Rekruten. Derzeit gibt es 181.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Bundeswehrintern wird mit einer Notwendigkeit von 460.000 gerechnet. Mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag wird dies aber erst mal nichts. Das schwedische Modell auf Basis eines Fragebogens und von Freiwilligkeit getragen ist der extrovertierteste Schritt, den sich die neue Bundesregierung traut.
von Dr. Eva-Charlotte Proll
Aber die Sicherheit des Landes braucht mehr! Das belegt das Sondervermögen, von dem ein beachtlicher Teil in andere Sicherheitsarchitekturen als die militärischen fließen soll: Innere Sicherheit, Nachrichtendienste, Katastrophen- und Zivilschutz, Cyber-Sicherheit. Wie das Geld genau investiert werden soll, ist noch offen, aber um es abrufen zu können, braucht es Personal: ziviles wie militärisches. Demzufolge muss das Ziel der Kriegstüchtigkeit in ein Paradigma der Sicherheitstüchtigkeit umgewandelt werden, denn nirgendwo sonst hat Deutschland die vergangenen Jahre so drastisch Kompetenzen abgebaut und Regulierungen hochgezogen. In der Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht geht vollkommen unter, was vor Jahren mit den vom Wehrdienst Ausgemusterten passiert ist. Sie leisteten Zivildienst ab, der später zum Bundesfreiwilligendienst wurde. Feuerwehren, Rettungsstellen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen –sie alle brauchen Personal und der Dienst im Staate motiviert mehr junge Menschen, als es der Begriff der Kriegstüchtigkeit je könnte. Dies alles gehört zum neuen Verständnis von Infrastruktur.
Neben höheren Gehalts- und Sonderzahlungen ging es auch um Entlastungen und mehr Souveränität für die Beschäftigten
Mit der von den Schlichtern vorgeschlagenen Einigung konnten sich letzten Endes jedoch alle arrangieren. Laut der noch amtierenden Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist die Einigung dabei ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes.
Die harten Fakten
Im Kern gibt es für die Beschäftigten ab April drei Prozent mehr Gehalt mit einer weiteren Erhöhung um 2,8 Prozent ab Mai 2026. Die erste Erhöhung liegt hier bei mindestens 110 Euro, was gerade für die Entgeltgruppen eins bis fünf zu einer spürbaren Steigerung des Gehalts führt. Zusätzlich werden die Sonderzahlungen ab 2026 von den Kommunalen Arbeitgebern einheitlich auf 85 Prozent gesetzt und es wird die Möglichkeit geschaffen, Teile dieser Sonderzahlungen auch in freie Tage umzuwandeln. Die Ausbildungs- und Studienentgelte werden ebenfalls jeweils zum April 2025 und Mai 2026 um 75 Euro angehoben.
Die Arbeitszeiten für Tarifbeschäftigte von Bund und Kommunen werden ebenfalls flexibler. So können mit Einverständnis beider Seiten die wöchentlichen Arbeitsstunden ab 2026 auf bis zu 42 Stunden angehoben werden – für einen maximalen Zeitraum von 18 Monaten. In dieser Zeit erhalten die Beschäftigten ein angepasstes Entgelt und einen Er-
D ass Unternehmen angesichts von Herausforderungen wie dem demografischen Wandel oder Klimaveränderungen nachhaltiger werden müssen – sei es, um beispielsweise durch eine gute Unternehmensführung Fachkräfte finden und binden zu können oder einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten –, steht außer Frage. In den letzten Jahren haben deshalb für Unternehmen die Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit beständig zugenommen. Der Hintergrund hierfür ist, dass, vergleichbar mit der finanziellen Berichterstattung, Unternehmen auch zu ihrer Nachhaltigkeit auf den Feldern Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Governance (ESG) handeln und darüber berichten sollen.
Positive Effekte
Gisela Splett, Staatssekretärin im baden-württembergischen Finanzministerium, sprach den zahlreich Betroffenen Mut für das Ziel der Nachhaltigkeit zu, indem sie ausführte: „Wir müssen in Bezug auf Nachhaltigkeit handeln – und es ist noch nicht zu spät!“ Sie wies darauf hin, dass für das Land Baden-Württemberg als Anteilseigner von Unternehmen etwa die Felder der ökologischen Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit untrennbar miteinander verbunden seien. Für das Land als Anteilseigner sind für die erfolgreiche Beteiligungsführung Fragen wie „Wie viel Energie benötigt das Unternehmen?“ oder „Wie groß sind unternehmensimmanente Gehaltsunterschiede?“ elementar wichtig. Und genau dies liefern die mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (die CSRD bzw. CSR-Richtlinie) erweiterten Berichtspflichten, die hierzu konkrete Zahlen enthalten.
Der Größe nach Zur aktuellen Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichtpflicht führte Prof. Dr. Dörte
Es
Finanzielle Probleme durch die Tarifeinigung
(BS/sr) Mit dem Tarifabschluss ist zwar die Situation für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen wieder für zwei Jahre geklärt, jedoch kommt die hart erstrittene Einigung mit einem großen Preisschild. Besonders für die ohnehin schon stark finanziell belasteten Kommunen wird die Erfüllung des Vertrages nicht einfach werden.
höhungszuschlag in Abhängigkeit ihrer Entgeltgruppe. Auf betrieblicher Ebene soll ein Langzeitkonto beschlossen und eingerichtet werden können. Die darin erfassten Werte sollen z. B. zur Reduzierung der Arbeitszeit eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang werden dann auch die Regelungen für Teilzeit zukünftig enger gefasst, um Überstunden auf das Langzeitkonto zu übertragen. Künftig sollen auch Überstunden angeordnet werden können, um die Kappung zu vermeiden.
Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin des Verband kommunale Arbeitgeber (VKA), zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden und betont, dass die Handlungsfähigkeit der kommunalen Arbeitgeber mit diesem Ergebnis erhalten bleibe. Sie lobt auch die flexibleren Arbeitszeitmodelle, die zusätzliche Attraktivität für die Arbeit im Öffentlichen Dienst schaft. Etwas, dass in Zeiten des Fachkräftemangels ungemein viel wert ist. Auch DBB-Verhandlungsführer Volker Geyer zeigte sich grundsätzlich mit zufrieden: „Es ist zentral, dass die von uns geforderten Kom-
ponenten lineare Erhöhung, soziale Komponente, Arbeitszeitsouveränität und Entlastung alle Teile des Abschlusses sind. In dieser Einigung kann sich jede und jeder wiederfinden.“ Er sieht die Fortschritte bei der Gewinnung von Fachkräften allerdings als nicht ausreichend und erinnert daran, dass schon aktuell 570.000 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst fehlen. Ein Umstand, der sich auch in den nächsten Jahren weiter verschlimmert wird. Abschließend forderte Geyer die zeit- und inhaltsgleiche sowie systemgerechte Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich: „Wir werden dazu unverzüglich das Gespräch mit dem Bundestag und der neuen Bundesregierung aufnehmen.“
Sind die Kosten tragbar? Die Einigung wird für die öffentliche Hand jedoch teuer werden. Faeser erklärte: „[…] Zugleich hatten wir die angespannte Haushaltslage zu jedem Zeitpunkt im Blick. Wir sind an die Grenze dessen gegangen, was wir bei schwieriger Haushaltslage verantworten können.“ Besonders hart treffen die zusätzlichen Kosten jedoch die Kommunen. So rechnet
zum Beispiel die Freie Hansestadt Bremen allein 2025 mit sechs Millionen Euro Mehrkosten für die 4.440 Beschäftigten. 2026 werden Kosten von 14 Millionen und 2027 von 17 Millionen Euro aufgrund des Tarifabschlusses entstehen. Bremens Finanzsenator Björn Fecker erklärte, dass sich die große finanzielle Belastung des Haushaltes auch auf die Bürger auswirken wird: „Die steigenden Personalkosten werden sich voraussichtlich auch auf die Gebühren beziehungsweise Eintrittspreise zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger auswirken. Dieser Tarifabschluss schränkt die Spielräume in den kommenden Haushalten weiter ein, sodass alle Ressorts umso mehr zur Haushaltsdisziplin gezwungen sind.“ Generell hätten aber vor allem die finanzschwachen Städte bei der Umsetzung ein großes Gewicht zu stemmen, erklärt Thomas Kufen, Vorsitzender des Städtetags NRW und Oberbürgermeister der Stadt Essen. Er schätzt die Kosten für die kommunalen Arbeitgeber in NRW auf etwa 2,8 Mrd. Euro. Dennoch sei es positiv, dass es nun Planungssicherheit für dieses und das nächste Jahr gebe, ergänzte er. Insgesamt sei das Tarifpaket aber ein guter
Spannende Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichterstattung
(BS/Prof. Dr. Michèle Morner/Johannes Hassemer*) Überraschend wechselhafte Entwicklungen kennzeichneten im vergangenen Jahr die Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (vgl. Behörden Spiegel/März 2025). Wie der öffentliche Sektor mit diesen Herausforderungen sinnvoll umgehen kann, stand im Blickpunkt der 12. Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance.

Diemert, Stadtkämmerin und Dezernentin für Finanzen und Recht der Stadt Köln, aus, dass Kommunen eine wichtige Rolle bei der Transformation spielten – und ihrer Vorbildfunktion gerecht werden müssten. Die Stadt Köln hat die Gesellschaftsverträge ihrer Unternehmen so angepasst, dass sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Größe der Unternehmen richtet. Denn bislang mussten viele öffentliche Unternehmen unabhängig von ihrer Größe in der Regel wie große Kapitalgesellschaften berichten. Damit aber würden
sie, voraussichtlich ab diesem Jahr, unter die Bestimmungen der CSRD fallen und müssten damit über 1.000 Datenpunkte zur Nachhaltigkeit jährlich erheben und veröffentlichen.
Viele Wege führen zum Ziel
Lars Scheider, Abteilungsleiter Beteiligungssteuerung Frankfurt am Main, hob in diesem Zusammenhang hervor, dass auch öffentliche Unternehmen mit kleiner Personalausstattung Großes im Bereich der Nachhaltigkeit erreichen könnten. Dafür könnten sie den „Voluntary
Kompromiss, erklärte Welge „Angesichts der finanziellen Herausforderungen der Kommunen haben wir ein Gesamtpaket geschnürt, das die Handlungsfähigkeit der kommunalen Arbeitgeber sichert und gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen für unsere Beschäftigten schafft.“
Hauptlast bei Kommunen Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags, sieht die Kommunen bei der Tarifeinigung deutlich im Nachteil: „Für Sachsens Kommunen stellt sich einmal mehr die Frage, ob die Verhandlungsgemeinschaft mit dem Bund Sinn macht. Während die Kommunen die Mehrkosten des Tarifabschlusses weitgehend selbst tragen müssen, kann der Bund seine Mehrausgaben durch seinen Anteil von 42,5 Prozent am zusätzlichen Einkommenssteueraufkommen kompensieren. Das erklärt das aus unserer Sicht erneut große Entgegenkommen der Bundesinnenministerin.“

SCHWERPUNKT
teils sehr kurzen Umsetzungsfristen der Vorgaben wichtig.
Und nun?
Die CSR-Richtlinie stellt mit ihren mehr als 1.000 Datenpunkten die umfangreichsten Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit und verspricht damit den besten detaillierten Einblick in betreffende Anstrengungen. Darunter fallen wegen ihrer Vorbildfunktion auch kleine öffentliche Unternehmen, sofern sie davon nicht davon ausgenommen werden. Eine reizvolle Alternative kann der VSME liefern, bei dem Unternehmen in Hinblick auf ihre Zielgruppe selbst deutlich stärker entscheiden können, worüber sie wie stark berichten wollen.
Die Speyerer Tagung für Public Corporate Governance
Die Veranstaltung hat sich zu einem der taktgebenden Foren der Public Corporate Governance in Deutschland entwickelt. Neben den hochklassigen Vorträgen und der inhaltlich fundierten Diskussion der Themen waren wieder der persönliche Austausch und die Vernetzung der Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft ein herausragendes Merkmal. Die Tagung findet auch im kommenden Frühjahr wieder statt, dann am 13./14. April. 2026.
SME-Standard“ (VSME) nutzen. Dieser schlägt den Unternehmen neben den verpflichtenden Kennzahlen im Basisteil weitere Berichtsmöglichkeiten vor, die freiwillig sind. Generell sei es jedoch wichtig, dass es eine grundlegende Vorbereitung auf die nichtfinanziellen Berichtspflichten gebe, betonte Saskia Six, Referentin für Nachhaltigkeit bei der Stadtreinigung Hamburg. So sollten die Unternehmen genügend Zeit für einen Testlauf der Erhebung einplanen. Dies sei gerade vor dem Hintergrund der
*Prof. Dr. Michèle Morner ist Inhaberin des Lehrstuhls für Personal, Führung und Entscheidung im öffentlichen Sektor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und leitet das Wissenschaftliche Institut für Unternehmensführung und Corporate Governance.
Johannes Hassemer, M.A., ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Personal, Führung und Entscheidung im öffentlichen Sektor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.
Behörden Spiegel: Im Gutachten „Bürokratieabbau und ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln“ werden großzügige Pauschalisierungen und bedingungslose De-MinimisRegeln vorgeschlagen. Was erhoffen Sie sich davon?
Prof. Dr. Klaus Schmidt: Ein großes Problem ist, dass sehr viele Regelungen auf Einzelfallgerechtigkeit abzielen. Sie versuchen, alle möglichen Einzelfälle gesetzlich oder durch Verordnungen zu regeln. Das macht die Gesetze unglaublich kompliziert und führt zu enormem zusätzlichem Aufwand. Wenn wir großzügige Pauschalierung oder großzügige De-MinimisRegeln (EU-Ausnahmeregelungen zur unbürokratischen Vergabe geringfügiger Beihilfen, Anm. d. Red.) einführen, können wir auf diese Einzelfallprüfung verzichten. Dann wird der Anspruch auf Einzelfallgerechtigkeit aufgegeben, die sich sowieso nicht erreichen lässt. Stattdessen wird ein bestimmter Bereich von Fällen durch die Pauschale abgedeckt. Es lohnt sich, solche Pauschalisierungen in der Praxis auszuprobieren. Das erfordert allerdings die Bereitschaft, in Kauf zu nehmen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal Ungerechtigkeiten gibt. An dieser Stelle sind die Gerichte in der Pflicht, sich stärker zurückzuhalten. Bislang fordern sie im Falle einer Einzelfallklage häufig Prüfungen und den Erlass passender Regelungen ein. Stattdessen müssten sie es dann akzeptieren, wenn der Staat beschließt, eine Reihe von Einzelfällen durch eine Pauschale zu regeln.
Behörden Spiegel: Ein weiterer Ansatz ist, die Erfüllung von Normen künftig nicht mehr so konsequent zu kontrollieren wie bisher. Was ist die Alternative?
Schmidt: In Deutschland sind derzeit umfangreiche Ex-ante-Kontrollen der Standard. Bevor ein Vorhaben umgesetzt werden kann, überprüft der Staat detailliert, ob sämtliche Bedingungen, die er stellt, auch tatsächlich erfüllt sind.
Stattdessen könnte der Staat zunächst darauf vertrauen, dass diese rechtlichen Regelungen eingehalten werden und ex post, also im Nachgang, überprüfen, ob das auch tat-
(BS) Die Belastung durch Bürokratie steigt – allen Entlastungsbemühungen zum Trotz –massiv an. In seinem Gutachten ermutigt der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dazu, bei der Normsetzung und -implementierung neue Wege einzuschlagen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Der federführende Autor Prof. Dr. Klaus Schmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, verrät, welche Maßnahmen hierbei wirklich helfen. Die Fragen stellte Ann Kathrin Herweg.

Prof. Dr. Klaus Schmidt plädiert für eine engere Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die Gesetze schreiben, und denen, die sie ausführen müssen. Foto: BS/privat
sächlich der Fall war. Das bedeutet, es werden nur noch stichprobenhafte Kontrollen durchgeführt. Und das bedeutet auch, dass es keine langen Wartezeiten gibt, bis ein Vorhaben genehmigt wird. Es kann direkt mit der Umsetzung begonnen werden – sofern alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Allerdings kann eine Kontrolle nach der Umsetzung erfolgen. Wenn dabei eine systematische Abweichung von den Vorschriften entdeckt wird, dann muss natürlich eine entsprechende Sanktionierung erfolgen, die es unattraktiv macht, von den Regelungen abzuweichen.
Behörden Spiegel: Der Beirat empfiehlt: mehr Markt statt Regulierung. Was steckt hinter diesem Gedanken?
Schmidt: In Deutschland wird den Menschen genau vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen haben. Eine andere Möglichkeit wäre es, ihnen die richtigen Anreize zu geben, das Richtige zu tun und dann darauf zu vertrauen, dass sie im Großen und Ganzen auch das Richtige tun wer-
„Die One-in-one-out-
Regel gaukelt uns nur vor, dass im gleichen Maße Bürokratie abgeschafft wird, wie neue Bürokratie eingeführt wird.“
den. Lassen Sie mich das am Beispiel des Klimaschutzes erläutern: Statt sehr detaillierter Vorschriften beim Heizungsgesetz könnte der Fokus stärker auf den Markt gelegt werden. Das gelingt durch einen CO2-Preis, der den Menschen einen Ansporn gibt, von selber auf klimafreundliche Heizungen wie solche mit Wärmepumpe umzusteigen und ihr Haus zu dämmen. So käme der Anreiz zu mehr Klimafreundlichkeit über den Markt und der Staat müsste gar nicht mehr kontrollieren. Wenn jemand sein Haus nicht dämmt, sondern stattdessen die hohen CO2-Preise bezahlt, dann ist das eben so und muss akzeptiert werden. Aber im Großen und Ganzen werden die Menschen diesen Anreizen folgen und werden sich klimafreundlicher verhalten.
Behörden Spiegel: Wie schätzen Sie den Erfolg der One-in-one-out-Regel oder gar einer One-in-two-out-Regel ein?
Schmidt: Der Beirat sieht diese Regeln kritisch. Auf der einen Seite ist es gut, dem Staat einen Anreiz zu geben, bestimmte Gesetze wieder abzuschaffen. Das wird durch die One-in-one-out-Regel beabsichtigt.
Aktuelles aus dem Arbeitsrecht
Eine Kolumne von Ralph Heiermann
Auf der anderen Seite wird aber die Illusion geweckt, dass durch die Einhaltung dieser Regel tatsächlich die Bürokratiekosten stabil gehalten werden, bzw dass diese in den letzten Jahren sogar gesenkt worden seien. Das ist nicht der Fall, denn die Art, wie diese Bürokratiekosten gemessen werden, führt dazu, dass sie systematisch unterschätzt werden. Der Vergleich von entstehenden Kosten durch neue Gesetze mit den Einsparungen durch geplante Entlastungen zeigt deutlich: Die Onein-one-out-Regel gaukelt uns nur vor, dass im gleichen Maße Bürokratie abgeschafft wird, wie neue Bürokratie eingeführt wird.
Behörden Spiegel: Wie kommt die Verwaltung weg von Verfahrensorientierung hin zu Ergebnisorientierung?
Schmidt: Aktuell werden Behördenleitungen sehr stark von Juristen dominiert. Für diese ist vor allem entscheidend, dass ein Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird. Es geht nicht so sehr um das Ergebnis des Verwaltungshandelns.
Ein Beispiel: Bei meiner Arbeit an der Universität muss ich jeden Euro, den ich ausgebe, gegenüber der Verwaltung begründen. Welches Ergebnis bei meiner Forschung oder Lehre am Ende herauskommt, also was ich tatsächlich mit dem Geld erreicht habe, danach fragt niemand. Das m uss sich ändern. Bei der Ausbildung von Verwaltungspersonal muss daher weniger Gewicht auf rein juristische Inhalte und mehr Gewicht auf öffentliches Management gelegt werden. Mitarbeitende müssen sich auf das Ziel und die Zielerreichung fokussieren. Dafür müssen bestimmte Managementmethoden erlernt und ausgebildet werden. Neben einer veränderten Ausbildung ist es an dieser Stelle auch hilfreich, mehr Quereinsteiger
aus der Wirtschaft, die über solche Kenntnisse verfügen und eine andere Perspektive mitbringen, in den Öffentlichen Dienst zu holen. Und schließlich sollten sich auch die Anreize für die Verwaltung ändern, in dem die Zielerreichung gemessen und verglichen wird. Es sollte einen gewissen Wettbewerb zwischen den Behörden geben – z. B. welches Landratsamt braucht wie lange, um eine bestimmte Genehmigung zu erteilen? Solch ein Vergleich kann erheblich zur Motivation der Verwaltungsmitarbeitenden beitragen.
Behörden Spiegel: Wie kann eine Messung der Erfolge aussehen?
Schmidt: Zunächst muss darauf geachtet werden, dass mit der Ermittlung von Kennzahlen keine zusätzliche Bürokratie geschaffen wird. Es geht auch nicht darum, im Detail jede Leistung eines jeden Verwaltungsmitarbeitenden zu messen. Viel mehr geht es darum, den Output in den wichtigsten Dimensionen zu erfassen. Das könnte beispielsweise die Verfahrensdauer bis zum Erhalt einer Baugenehmigung, einer Gewerbeanmeldung oder einer Aufenthaltsgenehmigung für einen ausländischen Beschäftigten sein. Solche Kennzahlen wären nicht schwer zu erheben und sie wären wichtig, um die Leistung der Behörde zu messen. Auch Kundenzufriedenheit kann durch Umfragen ermittelt werden. Natürlich ergibt sich daraus eine subjektive Bewertung, aber auch die gibt wichtige Informationen darüber, wie nutzerorientiert eine Behörde arbeitet. Allein die Tatsache, dass Kennzahlen erhoben und Zufriedenheit gemessen wird, signalisiert den Verwaltungsmitarbeitenden, dass diese Ergebnisse das Ziel ihres Handelns sein sollten. Im Moment ist das nicht der Fall, es scheint für Mitarbeitende nicht relevant, wie lange ein Vorgang dauert. Hier konkrete Erfolgswerte zu erheben, ist an erster Stelle ein Signal. Noch wichtiger ist es aber, dass so der schon erwähnte Wettbewerb zwischen Behörden ermöglicht wird. Die Ergebnisse könnten dann auch an die Entlohnung oder an leistungsbezogene Bonuszahlungen für die Mitarbeitenden gekoppelt werden, um so Leistungsanreize zu schaffen.
Büroarbeit birgt Gefahren. Nicht nur für Handwerker, Polizeiund Feuerwehrbeamte – Arbeitsunfälle sind für Beschäftigte in Verwaltungen ebenso ein präsentes Thema. Auch dort kann man stürzen, sich stoßen, schneiden oder auf andere Art verletzen. Zum Glück erfasst der Dienstoder Arbeitsunfallschutz die typischen Risiken, die mit der übertragenen Tätigkeit verbunden sind. Entscheidend ist, dass der Unfall in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Erfasst werden zudem Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeitsstätte. Gleiches gilt für bestimmte Erkrankungen wie etwa die Borreliose eines Forstbeamten nach einem Zeckenbiss.




Unfälle im Dienst können rechtlich eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen. Selbst wenn sie bei Ausübung dienstlicher Aufgaben geschehen, muss Dienstunfallschutz nicht zwingend die Folge sein. Der dienstlich angeordnete Sport, der einen Achillessehnenabriss zur Folge hat, kann eine bloße Gelegenheitsursache darstellen. Die vorgeschädigte Achillessehne wäre auch bei nächster privater Gelegenheit gerissen.
Im Einzelfall
Die Abgrenzung ist nicht immer trennscharf möglich. So ist Dienstunfallschutz ausgeschlossen, wenn es um die Erledigung privater Angelegenheiten geht, aber es



Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung.

Foto: BS/privat
soll Dienstunfallschutz bestehen, wenn Beschäftigte während der Mittagspause in der dienstlichen Kantine eine Lebensmittelvergiftung durch verdorbenes Essen erleiden. Mit einem kuriosen Fall musste sich jüngst das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 13. März 2025 – 2 C 8.24 ) befassen. Ein Beamter stellte bei Dienstbeginn fest, dass die sonst über der Tür des Dienstzimmers hängende Uhr auf der Fensterbank lag und die Batterie der Uhr nicht korrekt im Batteriefach steckte. Er versuchte mit seinem Klappmesser die dadurch verbogene Klemmfeder wieder zu richten und schnitt sich dabei tief in einen Finger, weil das Messer plötzlich zuklappte.
Sein Dienstherr lehnte den Antrag auf Anerkennung des Unfalls als Dienstunfall ab und auch seine Klage dagegen blieb letztlich erfolglos. In letzter Instanz entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass kein Dienstunfallschutz bestand. Es bestätigte zwar, dass sich der
Unfall in den Diensträumen und während der Dienstzeit ereignet hatte. Damit kam grundsätzlich eine Anerkennung als Dienstunfall in Betracht. Schon die Vorinstanz hatte entschieden, dass es nicht darauf ankomme, dass das Reparieren der Uhr nicht zu den eigentlichen Aufgaben des Beamten gehörte, weil sich ohnehin bei der Dienstausübung dienstliche und private Aspekte nicht streng voneinander trennen ließen. Ungeeignetes Werkzeug Dienstunfallschutz scheidet aber aus, wenn entweder die Tätigkeit vom Dienstherrn verboten ist oder aber seinen begründeten – wohlverstandenen – Interessen zuwiderläuft. Eine Haftung für Unfälle während des Dienstes soll nur für die mit der dienstlichen Tätigkeit verbundenen spezifischen Gefahren begründet werden.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt deshalb für seine Entscheidung darauf ab, dass der Beamte mit der Benutzung eines Klapp-
messers für die Reparatur der Uhr gegen das wohlverstandene Interesse des Dienstherrn handelte. Das Messer als ein gefährlicher Gegenstand war weder für die Reparatur der Uhr geeignet noch bestimmt.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die die Vorinstanz bestätigt, stellt sich als interessengerecht dar und beachtet das System der Risikoverteilung im Dienstunfallrecht. Dem Beamten war es nicht etwa untersagt, die Uhr zu reparieren. Auch wenn dies nicht zu seinen dienstlichen Aufgaben gehörte, bestand hierfür grundsätzlich Dienstunfallschutz. Bei lebensnaher Betrachtung bestand nämlich bei dieser kleinen Reparatur, für die keine besonderen Kenntnisse erforderlich waren, der notwendige Zusammenhang mit der Dienstausübung. Der Dienstherr muss jedoch nicht das Risiko tragen, wenn hierfür ein ungeeignetes Werkzeug genutzt wird, dessen Gefährlichkeit sich verwirklicht.
Bis 2029 sollen mindestens acht Prozent der Stellen in der Bundesverwaltung abgebaut werden, darauf haben sich CDU, CSU und SPD in ihrem Regierungsprogramm geeinigt. Das bedeutet einen Stellenabbau von zwei Prozent pro Jahr in der Ministerial- und Bundestagsverwaltung sowie in bestimmten nachgeordneten Behörden. Eine Ausnahme stellen hierbei die Sicherheitsbehörden da.
Auch die Anzahl der Beauftragten des Bundes soll halbiert werden –eine Entscheidung, die DBB-Chef Ulrich Silberbach begrüßt. „Da kann einiges weg. Zuallererst einmal der Bundespolizeibeauftragte. Eine Fehlkonstruktion von Anfang an, die vor allem Misstrauen gegenüber den eigenen Beschäftigten ausdrückt.“
Missionsorientierte Arbeit Mit einer gesteuerten Aufgabenund Ausgabenkritik sowie verbesserter politischer Prioritätensetzung möchten die Koalitionäre die Arbeit der Bundesverwaltung effizienter organisieren. Dazu sind unter anderem die Zusammenlegung von Bundesbehörden und der Abbau von Redundanzen geplant – weg vom Silodenken, hin zum Whole of Government-Ansatz, also zu verstärkter Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungseinheiten. Die Maßnahmen dazu: die Stärkung interministerieller Projektteams, die Bündelung von Fachwissen und interdisziplinäres Arbeiten. So soll es auch leidigen Doppelstrukturen an den Kragen gehen. Die Koalitionäre setzen auf leistungsfähige, gebündelte Service-Einheiten, in denen künftig standardisierbare Aufgaben zentralisiert werden sollen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung – kontrovers diskutiert und mit dem Koalitionsvertrag nun beschlossene Sache – wird einer dieser Orte sein, an dem künftig Kompetenzen gebündelt und ausgebaut werden. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst blickt dieser Ministeriumsgründung hoffnungsvoll ent-
B
ehörden Spiegel: Frau Windgätter, welche Aufgaben im Tagesgeschäft gehen mit ihrer Funktion als Dienstvorgesetzte der Beamtinnen und Beamten einher und welche Themen beschäftigen Sie zurzeit?
Sandra Windgätter: Als Dienstvorgesetzte für die Beamtinnen und Beamten in der Deutschen Telekom verantworte ich sowohl das Beamtenrecht als auch alle Personal-Services für die Beamten. Ich bin außerdem Inklusionsbeauftrage für alle Beschäftigten der Deutschen Telekom und kümmere mich darum, dass wir das Potenzial unserer Beschäftigten optimal nutzen können und Barrieren weitestgehend aus dem Weg räumen. Diese Rollenvielfalt empfinde ich als sehr spannend und beide Rollen bereichern sich auch gegenseitig.
Behörden Spiegel: So einen Themenmix kennen viele unserer Leserinnen und Leser, die Dezernaten und Abteilungen vorstehen, die oft viele Themen vereinen. Viele denken vermutlich in Zusammenhang mit der Deutschen Telekom AG zunächst an Breitbandausbau, Mobilfunk und MagentaTV. Dass die Telekom noch Beamte hat, ist für die meisten vermutlich nicht mehr präsent.
Windgätter: Das glaube ich. Wir haben aktuell noch rund 13.000 Beamte, die bei uns in allen Bereichen eingesetzt sind. Die Anzahl
Was der Koalitionsvertrag für die Verwaltungsmodernisierung vorsieht
(BS/Ann Kathrin Herweg) „Deutschland braucht eine echte Staatsreform“ – das betonen Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag. In den kommenden vier Jahren sollen daher Behörden umstrukturiert, Gesetzgebung reformiert und das Vertrauen in den Staat gestärkt werden. Insbesondere Beschäftigte auf Bundesebene werden sich an vielen Stellen neu aufstellen müssen, aber auch in den Behörden auf Landes- und Kommunalebene stehen Veränderungen ins Haus.
gegen: „Richtig ausgestaltet, kann es die digitalpolitischen Themen im Bund in einer Hand zusammenführen und so zu einem echten Treiber für die Digitalisierung werden.“
Ganz anders sieht das DBB Frauen-Chefin Milanie Kreutz. Sie steht der Gründung des Digitalministeriums kritisch gegenüber: „Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, neue Ministerien zu schaffen. Stattdessen sollte die Politik Beschäftigte in den Verwaltungen fragen, wie es besser gehen kann.“ Silberbach hinterfragt zu Recht, über welche Kompetenzen und welches Budget das Ressort verfügen wird. Dazu äußert sich der Koalitionsvertrag nicht – genauso wenig wie zu Struktur und Verantwortlichkeiten des CDU-geführten Ministeriums.
Digitalmentalität und Kulturwandel
Beim Durchblättern des 146 Seiten langen Koalitionsvertags wird schnell deutlich, dass ein Digitalisierungsschub für Verwaltungsleistungen eines der Kernziele für die kommenden vier Jahre ist. Zunehmend antragslose Verfahren, Digital Only, eine zentrale Plattform für Verwaltungsleistungen (One-StopShop), ein verpflichtendes Bürgerkonto und eine digitale Identität für jede Bürgerin und jeden Bürger – das sind einige der Vorhaben, die den Behördenkontakt für Privatpersonen und Unternehmen drastisch vereinfachen sollen.
Doch nicht nur bei Behördenstrukturen und Digitalisierung müssen Staatsdienerinnen und Staatsdiener sich auf Neuerungen einstellen. CDU, CSU und SPD versprechen auch einen Kulturwandel in der Verwaltung. „Wir werden eine moderne und wertschätzende Füh-

Wirklich revolutionär muten die meisten Vorhaben der Koalitionäre nicht an. Damit die angekündigte Verwaltungsreform Früchte trägt, müssen den ehrgeizigen Zielen nun Taten folgen. Foto: BS/atipong, stock.adobe.com
rungskultur etablieren und fördern zuständigkeitsübergreifendes Denken, Entscheidungsfreudigkeit und ein Ausschöpfen von Handlungsspielräumen“, heißt es. In diesem Sinne sollen Freiräume geschaffen, Führungskräfteentwicklung eingeführt und Hospitationen zur Stärkung der Praxisorientierung gefördert werden.
Die Beschäftigten im Fokus Durch grundlegende Modernisierungen im öffentlichen Dienstrecht will Schwarz-Rot die bisher für Verwaltungslaufbahnen geltenden starren Einstiegs- und Qualifika-
tionsvoraussetzungen für Quereinsteiger öffnen. Laufbahnwechsel sollen vereinfacht werden. Zudem ist ein Rotationsverfahren für Personal von Bund, Ländern, Kommunen und der EU geplant. Ein erklärtes Ziel der Koalitionäre ist außerdem, den Öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Eine Fachkräfteoffensive soll mehr Frauen in Führungspositionen bringen, es soll flexiblere Arbeitszeitmodelle und bessere Möglichkeiten für Führen in Teilzeit geben. Abgesehen davon soll die öffentliche Verwaltung die Vielfalt in der Gesellschaft besser widerspiegeln. Kreutz freut
Ein Gespräch über digitale Beamtenprozesse der Telekom
(BS) In einer Welt, in der Digitalisierung und Effizienzsteigerung auf der Tagesordnung stehen, spielt die Deutsche Telekom eine Schlüsselrolle weit über die Bereiche Mobilfunk und Glasfaser hinaus. Sandra Windgätter gibt Einblicke in die fortschrittlichen Personalprozesse des Unternehmens und erläutert, wie Innovationen, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Fachkolleginnen und Fachkollegen aktiv unterstützen.
sinkt Demografie-bedingt kontinuierlich. Seit 1994 ernennen wir keine neuen Beamten, aber für den übrigen „Lifecycle“ eines Beamten von Zuweisung und Versetzung über die dienstliche Beurteilung und Beförderung bis hin zu Verfahren zur Dienstunfähigkeit und Zurruhesetzung bilden wir alle Prozesse bei uns ab – und das zentralisiert und digital.
Behörden Spiegel: Kann man denn alle Prozesse digitalisieren? Es gibt ja auch Hindernisse, wenn beispielweise eine Unterschrift notwendig ist.
Windgätter: Wir nutzen die Digitalisierung tagtäglich als konsequente Unterstützung für unsere Fachkolleginnen und Fachkollegen. Das bedeutet, dass wir all unsere Prozesse (und das sind sehr viele) vollständig digital abgebildet haben. Unser Beurlaubungsprozess läuft – wie wir es nennen – „Zero-Touch“. Das bedeutet, dass die Beamtin oder der Beamte den Antrag digital stellt und die Führungskraft dies im Workflow genehmigt. Der Rest, also die gebundene Entscheidung, die Erstellung des Bescheids, der Versand und die Ablage in der elektronischen Personalakte, erfolgt vollautomatisiert.

Sandra Windgätter ist die Dienstvorgesetzte für die Beamtinnen und Beamten in der Deutschen Telekom. Foto: BS/DeutscheTelekom AG
Zudem nutzen wir die qualifizierte elektronische Signatur, die wir bereits vor vielen Jahren eingeführt haben, z. B. im Beurteilungsprozess. Dies stellt für uns eine große Erleichterung und Entlastung dar und spart Ressourcen. Das zahlt damit auch auf die Nachhaltigkeit ein. Neuerdings setzen wir auch auf unterstützende KI in einem Prozess. Wichtig ist hier dabei, dass am Ende immer der Mensch die Entscheidung trifft. Das haben wir sichergestellt.
sich, dass mit dieser Offensive einige langjährige Forderungen der DBB Frauen Einzug in den Koalitionsvertrag gehalten haben. Auch Gewaltschutz finde Beachtung, lobt sie. „Aber aus Frauensicht fehlt auch einiges: Wir vermissen beispielsweise richtige Antworten auf die Herausforderungen in der Pflege und im Steuerrecht“, so Kreutz Regeln unter die Lupe nehmen Detaillierte Ausführungen zu den Themen gute Gesetzgebung und Bürokratieabbau machen deutlich, dass es sich hierbei um einen weiteren wichtigen Arbeitsschwerpunkt für die kommende Legislaturperiode handeln muss. Veraltete Gesetze will die neue Regierung streichen. Regelungen, die nicht gemacht werden müssen, gar nicht erst machen. Praxischecks und die Einbeziehung der Beschäftigten, die Gesetzte schlussendlich auf bundes-, landes- oder kommunaler Ebene umsetzten müssen, sollen bereits frühzeitig dabei helfen, die Gesetzgebung zu optimieren. Darüber hinaus soll Recht verständlich und digitaltauglich sein und sein Wirkungsgrad mit Erfolgsindikatoren überprüfbar gemacht werden. Betroffene wie auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Behörden können sich u. a. auf den Wegfall von überbordenden Berichtspflichten freuen. Die künftige Regierung hat sich auf die Agenda gesetzt, Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 25 Prozent (ca. 16 Milliarden Euro) zu senken. Der Erfüllungsaufwand für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung soll um mindestens zehn Milliarden Euro reduziert werden. Die One-inone-out-Regel wird zur One-in-twoout-Regel weiterentwickelt. Auch bei EU-Bürokratievorgaben soll der Rotstift angesetzt werden. Zudem sollen Bund, Länder und Kommunen mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Gleich nach der Regierungsübernahme soll ein Ideenwettbewerb gestartet werden, um ein Bundesexperimentiergesetz vorzubereiten.
Behörden Spiegel: Als Unternehmen haben Sie da möglicherweise mehr Freiheiten als Behörden. Kann die öffentliche Hand trotzdem etwas von Ihnen lernen?
Windgätter: Ich glaube nicht, dass wir mehr Freiheiten haben. Für uns gelten ja dieselben Vorschriften wie für Bundesbehörden, auch wir haben eine Rechtsaufsicht. Wir haben allerdings als DAX-notiertes Unternehmen jahrelang einen anderen Effizienzdruck gehabt. Durch den Fachkräftemangel kommt dieser nun stärker auch in den Verwaltungen an.
Von uns lernen kann man vielleicht, dass es sich lohnt, im Rahmen der Aufgabenkritik auch immer wieder eine Vollzugskritik zu machen. Sich also z. B. die Frage zu stellen, ob wirklich alle Datenfelder zur Durchführung notwendig sind oder ob die Daten nur „der guten Ordnung halber“ erfasst werden. Ist eine Unterschrift notwendig oder kann darauf verzichtet werden, weil es andere „Kontrollelemente“ gibt? Digitalisierung bedeutet eben nicht, dass man das Papierformular in die IT transferiert, sondern dass Daten- und Bearbeitungsstränge intelligent ineinandergreifen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie sandra.windgaetter@ telekom.de oder besuchen Sie dtse.telekom.com/de → Services → Public Solutions.
Die gute Nachricht ist: Deutschland verfügt über einen großen und wertvollen Datenbestand. Die schlechte Nachricht: Das Potenzial dieser Daten wird bislang nur unzureichend ausgeschöpft. Der hohe Datenschutzstandard in Deutschland ist Ausdruck eines berechtigten Schutzinteresses – gleichzeitig erschwert er in seiner derzeitigen Ausgestaltung vielfach die sinnvolle Nutzung vorhandener Daten. Um das volle Potenzial der verfügbaren Informationen auszuschöpfen, braucht es dringend gesetzliche Reformen. Nur mit einer modernen Gesetzgebung können wir sicherstellen, dass Daten verantwortungsvoll, aber zugleich effektiv für die politische Entscheidungsfindung eingesetzt werden können.
Ungenutztes Potenzial
Als erste Anlaufstelle für amtliche und qualitativ hochwertige Daten zu Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Staat spielt das Statistische Bundesamt eine zentrale Rolle bei der Erhebung, dem Zugang und der Analyse von Daten. In seinen Empfehlungen zur Fortentwicklung der amtlichen Statistik in der 21. Legislaturperiode hat der Statistische Beirat treffsicher festgestellt, dass die amtliche Statistik ein unverzichtbares Fundament für faktenbasierte Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist.
Allerdings bleiben die vollen Potenziale der amtlichen Statistik in Deutschland aufgrund des veralteten Bundesstatistikgesetzes ungenutzt. Auch die Kommission Zukunft Statistik argumentiert in ihren Analysen, dass die längst überfällige, grundlegende Reform des Bundesstatistikgesetzes zügig
Gesetzliche Reformen für eine datengestützte Politik
(BS/Dr. Daniel Vorgrimler) Um Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu analysieren und auf dieser Basis evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, benötigt die Politik hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten. Gerade in Krisensituationen zeigt sich, wie wichtig eine fundierte Datengrundlage ist – und dass diese in Deutschland ausbaufähig ist. Immer wieder werden Entscheidungen ohne ausreichende empirische Evidenz getroffen.

Das Fundament für gute Entscheidungen sind die richtigen Informationen. Doch einer optimalen Nutzung von bereits erhobenen Daten stehen u. a. veraltete Gesetze im Wege. Foto: BS/ImageKing, stock.adobe.com
in Angriff genommen werden muss, um das Potenzial der von Unternehmen und von Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellten Daten voll zu nutzen.
Sichere Vernetzung
Seit über 20 Jahren akkreditiert der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) Forschungsdatenzentren als Datentreuhänder, um den Zugang zu sensiblen Daten für die Wissenschaft zu ermöglichen. Diese Zentren stärken den Standort Deutschland für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung. Allerdings fehlt bislang die Möglichkeit, Datenbestände verschiedener
Anbieter zu verknüpfen und so das volle Potenzial der Daten auszuschöpfen. Hier setzt die Forderung nach einem Deutschen Zentrum für Mikrodaten (DZM) an. Ein DZM würde es ermöglichen, Daten aus verschiedenen Forschungsdatenzentren zu verknüpfen und datenschutzkonform zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung eines DZM über ein Forschungsdatengesetz würde eine wichtige Lücke schließen und den Wissenschaftsstandort Deutschland weiter stärken, ohne Doppelstrukturen zu schaffen. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag zum Ziel
Recruiting worldwide leicht gemacht
(BS/sr) Es sind zwei der großen Herausforderungen der letzten Jahre: Irreguläremigration und Fachkräftemangel. Während das eine die Verwaltung zu überlasten droht, verschärft das andere die Lage zusätzlich. Dabei kann mithilfe von Migration das Problem des Fachkräftemangels angegangen und den Öffentliche Dienst so auch vielfältiger und zukunftssicher gestaltet werden.
Das Potenzial von ausländischen Fachkräften für den Öffentlichen Dienst lässt sich aber nicht passiv ausschöpfen, sondern erfordert Engagement vonseiten der Verwaltung. Die niedersächsische Landesregierung hat in diesem Zusammenhang bereits mehrere Initiativen auf den Weg gebracht, welche die Chance der Migration in Deutschland nutzen sollen.
Ein klares Zeichen
So wurde erst Anfang des Jahres eine neue Kampagne zur Gewinnung von Fachkräften mit Migrationsgeschichte veröffentlicht, die vom niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung gefördert und vom niedersächsischen Innenministerium koordiniert wird.
Die Kampagne ist im Kontext der Maßnahmen zur Bewältigung des Fachkräftemangels entstanden und präsentiert das Land Niedersachsen als offenen und modernen Arbeitgeber, der qualifiziertes Personal unabhängig von der Migrationsgeschichte gewinnen möchte. Dazu werden Hilfsangebote wie eine Homepage zur Beantwortung möglicher Fragen und mit nützlichen Links für Interessierte bereitgestellt.
Ziel ist es, ein klares Zeichen zu setzen, dass Migration als Chance und wichtiger Bestandteil einer zukunftsfähigen Gesellschaft verstanden wird. Auch sollen verstärkt
Menschen mit Migrationshintergrund zu einer Bewerbung beim Arbeitgeber Niedersachsen ermutigt werden, indem man ihnen den
Bewerbungsprozess erleichtert.Eine weitere Maßnahme in diesem Zusammenhang sind die sogenannten Welcome Center, die auf Grundlage des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes etabliert wurden. Diese fokussieren sich jedoch auf die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und sind nicht für die Gewinnung von Fachkräften für die Landesverwaltung vorgesehen. Anders in Bochum: mit dem neuen Welcome Office: Hier wurde eine Anlaufstelle für internationale Fachund Arbeitskräfte geschaffen, um diesen ein schnelles Ankommen in der Stadt zu erleichtern. Neben der Stadt sind auch hier Partner aus der Wirtschaft beteiligt.
Gebündelte Kompetenz Um die bürokratische Belastung weiter zu senken, wurde in Niedersachsen eine Zentralstelle für das beschleunigte Fachkräfteverfahren geschaffen. Diese entstand unter anderem auf Wunsch der Partner der niedersächsischen Fachkräfteinitiative und ist nun landesweit für die Bearbeitung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens zuständig. Zuvor wurde diese Aufgabe von den insgesamt 52 niedersächsischen kommunalen Ausländerbehörden wahrgenommen. Diese nehmen, bis zum Ende des Jahres, weiter die Anträge entgegen, leiten diese aber an die Zentralstelle weiter. Die Bearbeitung durch eine einzelne Fachstelle soll sowohl die Verfahrensweise einheitlich gestalten als auch das Fach- und Erfahrungswissen bündeln und so eine Beschleunigung
der Verfahren und einen Bürokratieabbau gewährleisten.
Auch in anderen Bundesländern wird zunehmend auf eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen für ein beschleunigtes Verfahren zur Anwerbung von Fachkräften gesetzt. So ist im April in BadenWürttemberg die neue Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften an den Start gegangen. Zwar konzentrieren sich diese Angebote auf Unternehmen und sind nicht für die Anwerbung im Öffentlichen Dienst bestimmt, jedoch ist es durchaus plausibel, dass einmal in Deutschland Beschäftigte im Laufe ihrer Karriere auch in den öffentlichen Sektor wechseln können.
Sparmaßnahmen bei Fachkräfteinitiativen
Trotz der vielen Bundes-, Landes- und Kommunalinitiativen ist eine Lösung des Fachkräftemangels nicht garantiert, wenn in den kommenden Jahren viele weitere Beschäftigte aus dem Öffentlichen Dienst ausscheiden. Denn es würden weitere Sparmaßnahmen im Bereich des Personals eingeleitet, die auch durch fortschreitende Digitalisierung nicht vollständig kompensiert werden könnten, wie der Beamtenbund und Tarifunion Thüringen (TBB) anmahnt. Auch in Sachsen sind für den Haushalt 2025 weitere Stellenkürzungen angedacht und frei werdende Stellen sollen nur aus triftigen Gründen nachbesetzt werden. So ein Abbauplan wird den Fachkräftemangel jedoch nur weiter verstärken.
der Erleichterung von Datennutzung bekannt haben und ein Forschungsdatengesetz noch in diesem Jahr vorlegen wollen.
Die Bevölkerung in Zahlen Um die Befragten weiter zu entlasten, soll beispielsweise der Zensus künftig schrittweise in ein registerbasiertes Verfahren überführt werden. Dabei ist vorgesehen, verstärkt auf bereits vorhandene Verwaltungs- und Statistikdaten zurückzugreifen. Ziel ist es, Politik und Gesellschaft auch weiterhin mit verlässlichen Basisdaten zu versorgen – etwa zur Bevölkerungsstruktur, zur Erwerbstätigkeit, zu Bildungsniveaus, zur Wohnsituation oder zur Heizungsart in Gebäuden. Hierfür ist eine Zensusgesetzgebung notwendig, die regelt, wie die Ergebnisse des Zensus ermittelt werden können und wie die Datenqualität sichergestellt wird, um verlässliche Daten für politische Entscheidungen, Planungen und die Verteilung öffentlicher Mittel bereitzustellen. Eine stärker registerbasierte Datenerhebung ist mit Blick auf die Vorgaben der Europäischen Union notwendig, damit diese Informationen künftig schneller, regelmäßiger und mit höherem regionalen Detailgrad zur Verfügung stehen. Ein weiteres Beispiel für vorhandene, aber un-
zureichend genutzte Daten ist der Bereich Bildung. In Wissenschaft und Forschung besteht seit Langem die Forderung nach registerbasierten Bildungsverlaufsdaten. Auch für den RatSWD ist dies ein wichtiges Anliegen. Derzeit können zentrale Fragen zum Bildungsgeschehen in Deutschland, v. a. zu Übergängen zwischen den Bildungsphasen, aber auch zu Erfolg und Abbruch, nur unzureichend beantwortet werden. Mit dem Aufbau eines Bildungsverlaufsregisters kann eine bildungsbereichsübergreifende statistische Datenbasis geschaffen werden, die Bildungsverlaufsdaten für Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bereitstellen kann. Ein solches Bildungsverlaufsregister ist ein erster zentraler Schritt, um die bestehenden Informationslücken zu schließen und so eine qualitativ hochwertige empirische Grundlage für Bildungsforschung und Bildungspolitik bereitzustellen. Reformen statt Blockaden Eine zügige Schaffung von gesetzlichen Grundlagen wird dringend notwendige Modernisierungen und Entlastungen bringen. Die genannten Rechtsetzungsverfahren müssen von der neuen Bundesregierung mit Nachdruck vorangetrieben werden.

Dr. Daniel Vorgrimler ist Abteilungsleiter Strategie und Planung, Internationale Beziehungen, Forschung und Kommunikation im Statistischen Bundesamt. Foto: BS/Destatis
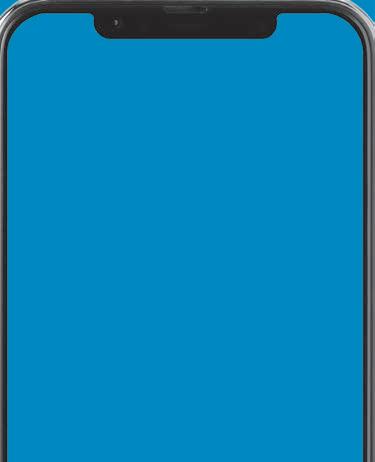
–Tägliche News rund um den Public Sector – Vernetzen Sie sich zu aktuellen Themen und erstellen Sie Ihren individuellen Newsfeed
– Direkter Zugriff auf Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts und vieles mehr







Ein fataler Fehler, gnadenlose Selbstüberschätzung – aber auch eine Chance für die EU: Mit diesen Worten beschreibt Marcel Fratzscher den handelspolitischen Zickzackkurs des US-Präsidenten. „Trump überschätzt sich selbst und die globale Macht der USWirtschaft“, erklärte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in einem Pressestatement.
Handelspolitischer Schlingerkurs mit Folgen
Nach der Ankündigung von USPräsident Donald Trump, auf Einfuhren aus der EU Zölle in Höhe von 20 Prozent zu erheben, folgte ein handelspolitischer Schlingerkurs: Kurz darauf schwenkte der US-Präsident um und entschied überraschend, vielen Staaten – darunter auch die Staaten der Europäischen Union – 90 Tage lang eine Pause von besagten Zöllen zu gewähren. Für diesen Zeitraum solle lediglich der reguläre Zollsatz von zehn Prozent gelten.
„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die EU, gegen den Marktmissbrauch einiger mächtiger US-Digitalkonzerne vorzugehen.“
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung
Konsequenzen aus dem Handelsstreit
(BS/Anne Mareile Moschinski) Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sorgen für Chaos an den Börsen, stellen die globale Wirtschaftsordnung infrage und verunsichern Handelspartner ebenso wie Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Folgen für Deutschland schätzen Ökonomen sehr unterschiedlich ein.

Trumps handelspolitischer Schlingerkurs hält derzeit die Welt in Atem. Experten rechnen für Deutschland nicht mit einer eklatant steigenden Inflation, für die EU sei das sogar eine Chance. Foto: BS/Rokas, stock.adobe.com
seien als im Falle pauschaler USZölle von 20 Prozent. „Wenn die EU mit den USA vollständig reziproke Zölle aushandelt, und Trump bereit wäre, Zölle auch entsprechend zu senken, würde die deutsche Wertschöpfung steigen“, prognostiziert Flach. Das unterstreiche die wichtige Rolle von Verhandlungen, um nachteilige Auswirkungen eines Handelskrieges abzuwenden. Mäßiger Einfluss auf die Inflation Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), beschreibt die Zollankündigung als „Atombombe auf die Weltwirtschaftsordnung.“ Allerdings unterstreicht er auch: In Deutschland werde die Inflation dadurch kaum steigen. Denn die Importe aus den USA seien überschaubar, chinesische Exporte würden nach Europa umgelenkt und das dämpfe den Preisanstieg. Den EU-Staaten empfiehlt er, mit Gegenzöllen auf die US-Zölle zu reagieren. So könne die Europäische Union „sehr spezifische Zölle erheben und auch sehr spezifische Zölle senken“, sagte er in einem Interview mit „Capital“.
Kurze Zeit später gab es allerdings auch hier eine unerwartete Kehrtwende und US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte, die eben noch ausgenommenen Produktgruppen würden nun doch mit Zusatzzöllen belegt. Von Ökonomen wird das handelspolitische Chaos und dessen Folgen für Deutschland unterschiedlich bewertet.
DIW-Chef Marcel Fratzscher rechnet vor allem für die US-Wirtschaft mit negativen Folgen. Solange Europa, China, Mexiko und Kanada koordiniert agierten, könnten die USA einen Handelskonflikt gegen die gesamte Welt nicht gewinnen.
Auch bestimmte Produktgruppen, wie Smartphones, Laptops und andere Elektronikwaren wurden von den Sonderzöllen zunächst befreit.
NRW.Bank zieht Jahresbilanz
(BS/Anne Mareile Moschinski) Trotz einer allgemein investiven Zurückhaltung blickt die NRW.Bank positiv auf das vergangene Jahr: Im Bereich der WohnraumFörderung erreichte sie 2024 erneut eine Bestmarke.
Die mittelständischen Betriebe in Nordrhein-Westfalen trafen im vergangenen Jahr nur zögerlich Investitionsentscheidungen. „Darüber sind wir unglücklich“, zog Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank, auf der JahresPressekonferenz des Kreditinstituts Bilanz. Mit Bezug auf die von der US-Regierung angekündigten Zölle erklärte er: Auch Zölle machten die Unternehmen unsicher und dadurch würden ebenfalls Investitionen aufgeschoben. Dennoch sei der Investitionsbedarf für Wirtschaft, Kommunen und Infrastruktur weiterhin hoch. „Wir können es fördern“, machte der Bank-Chef Mut. Auch in Zukunft würden Förderleistungen ins Land und zu den Kommunen gebracht.
Wohnraum-Förderung als Erfolgsgeschichte
In Zahlen und mit Blick auf das vergangene Jahr bedeutet dies: Insgesamt 11,4 Milliarden Euro Fördermittel hat die NRW.Bank 2024 vergeben – ein Betrag, der sich in etwa auf dem Vorjahres-Niveau mit 11,8 Milliarden Euro befindet. Das Thema Wohnraum-Förderung sei dabei in NRW nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. 2024 erreichte hier die Nachfrage mit einem Neuzusage-Volumen von 4,5 Milliarden Euro einen Rekordwert – dies stellt im Vergleich zu 2023 einen Zuwachs um 20 Prozent dar. Grund für die Entwicklung seien „beson-
ders günstige Konditionen“ gewesen, durch die sich die Förderung im gestiegenen Marktzinsumfeld noch attraktiver dargestellt habe, so Forst Einen leichten Rückgang gab es hingegen bei den kostenlosen Finanz- und Förderberatungen. So wurden 2024 insgesamt 49.330 Beratungsgespräche geführt, im Vorjahr waren es noch 49.700 gewesen. Ein besonderes Augenmerk will die Förderbank 2025 auf das Programm „Invest Zukunft“ legen, das Anfang des Jahres mit NordrheinWestfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur vorgestellt wurde. Das Programm beinhaltet einen bis zu zwei Prozent niedrigeren Zins im Vergleich zum Marktzins und bietet kleinen und mittleren Unternehmen einen Tilgungsnachlass von bis zu 20 Prozent. Damit will das Kreditinstitut die Investitionsbereitschaft wieder ankurbeln.

Europäische Unternehmen seien bei einer solch „erratischen Politik“ klug beraten, ihre Produktion nicht in die USA zu verlagern, erklärte Fratzscher weiter. Als geeignete Antwort sieht er die Einführung gleichhoher Zölle. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die EU, endlich gegen den Marktmissbrauch einiger mächtiger US-Digitalkonzerne vorzugehen“, so der DIW-Präsident. Für die EU sei es besser, jetzt diesen Schritt zu gehen, als weitere Zeit zu vergeuden. Noch drastischer schätzt Clemens Fuest, der Präsident des Münchner ifo-Instituts, die Lage ein. Aus seiner Sicht sei eine Weltwirtschaftskrise nicht auszuschließen. „Die Zinsen in den USA steigen, der Dollar fällt“, erklärte er. Das sei ein Alarmsignal. Zwei Drittel der weltweiten Börsenkapitalisierung befänden sich auf dem amerikanischen Aktienmarkt, der Dollar sei weltweite Ankerwährung. „Wenn das alles kippt, hätte das unkalkulierbare Folgen“, so Fuest Mögliche Steigerung der deutschen Wertschöpfung
„Die Zinsen in den USA steigen, der Dollar fällt.“
Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo-Instituts
Die ifo-Handelsexpertin Lisandra Flach verweist in einer Presseerklärung darauf, dass im Falle wechselseitiger Zölle die Auswirkungen auf Deutschland wesentlich geringer
Zuletzt hatte Trump seinen Kurs gegenüber Peking enorm verschärft: Abgaben von bis zu 145 Prozent werden auf Einfuhren aus China verhängt. Die Volksrepublik reagierte darauf mit Gegenzöllen von 125 Prozent.
Entlastung geplant – Zukunft vertagt
(BS/Hans-Jürgen Leersch) Trotz großer Herausforderungen setzen Union und SPD im Koalitionsvertrag auf zahlreiche Entlastungen – doch wichtige Zukunftsfragen bleiben unbeantwortet.
Den großen Wurf haben Union und SPD mit ihrem Koalitionsvertrag nicht geschafft. Aber wenn die vielen kleinen Entlastungen und Vergünstigungen zusammengerechnet werden, ergibt sich bis zum Ende der Legislaturperiode eine Gesamtentlastung von rund 200 Milliarden Euro. Es bleiben allerdings Risiken: Die amerikanische Zollpolitik und die heimische Wirtschaftsschwäche machen Planungen schwierig.
Entlastungen mit Unsicherheiten
Doch trotz der vom Atlantik herüberziehenden dunklen Wolken sendet der Koalitionsvertrag für Wirtschaft und Verbraucher erfreuliche Signale aus. Das Institut der deutschen Wirtschaft addierte die vereinbarten Entlastungen auf rund 50 Milliarden Euro pro Jahr. Besonders durch eine SuperAbschreibung für Unternehmen kommen zwischen 2026 und 2028 insgesamt sieben Milliarden Euro pro Jahr zusammen. Damit könnte auch das Wirtschaftswachstum wieder in Gang gebracht werden, das Noch-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt noch auf Null zurücksetzen musste Die Senkung der Körperschaftssteuer, die ab 2028 in fünf Schritten erfolgen soll, wird die Unternehmen um etwa vier Milliarden Euro entlasten. Wettbewerbsfähig wird Deutschland im internationalen Vergleich damit aber frühestens ab 2032.
Weitere Maßnahmen sind etwa die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer. Das Internetportal „Finanztip“ rechnete vor: Wer mehr als 20 Kilometer Fahrtweg zur Arbeit habe, zahle je nach Einkommen 60 bis 140 Euro weniger Steuern im Jahr. Eine große Reform der Einkommensteuer steht nicht auf dem Programm. Viel mehr als Anpassungen des Grundfreibetrages und der übliche Ausgleich der kalten Progression sind wohl nicht drin.
Vorsorge statt Reformen Weit in die Zukunft geblickt haben die Koalitionsparteien beim Projekt Frühstart-Rente. Das bedeutet, das jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren schon ab 2026 jeden Monat zehn Euro vom Staat für die Altersvorsorge bekommen kann. Das Geld soll in ein „individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot“ eingezahlt und zum Beispiel in den beliebten Exchange Traded Fund (ETF) angelegt werden können; Kapitalerträge daraus sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Projekt wird die Rentenlücke nicht schließen, aber es ist ein Anreiz, mit privater Vorsorge anzufangen. Damit werden eine Reihe wichtiger Maßnahmen durchgeführt, aber auch Partikularinteressen bedient.
Die Lösung großer Probleme im Bereich der Sozialversicherungen wird nicht angegangen oder muss im Laufe der Legislaturperiode er-
folgen. Denn die Zusatzbeiträge der Krankenkassen steigen immer schneller, aber vereinbart haben Union und SPD bisher nur die Einsetzung einer Kommission, die im Laufe des Jahres 2027 eine Lösung vorlegen soll, wie die Kostensteigerungen werden können. Wirtschaftsexperten wie Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft sehen einen massiven „blinden Fleck“ im Koalitionsvertrag: die demografische Alterung. Union und SPD hätten dieses Problem ignoriert. Im Koalitionsvertrag seien nur das Renteneintrittsalter von 67 Jahren festgeschrieben und das Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 garantiert worden. Hüther warnt: „Uns brechen in den nächsten Jahren Millionen von Arbeitskräften weg, die das Rentenalter erreichen – und die zukünftige Koalition reagiert hier mit nichts weiter als Homöopathie.“ Damit meint der Experte unter anderem die sogenannte Aktivrente: Danach bleiben für Rentner, die nach dem Renteneintrittsalter weiterarbeiten, die ersten 2.000 Euro des monatlichen Gehalts steuerfrei. „Das ist extrem teuer und bringt kaum etwas“, kritisiert Hüther Offenbar wegen des „blinden Flecks“ machte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, bereits deutlich, dass in den Bereichen Gesundheit, Rente und Pflege „auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen“.
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin
Klosterstraße 59, 10179 Berlin
Telefon:
030/9020-0
Fax
030/9020-7704
E-Mail: poststelle@senfin.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/finanzen
Stabsstelle Antikorruption und Innenrevision
Alexander Lamprecht -5505
Behördliche Datenschutzbeauftragte
Rebekka Binder -5511
Staatssekretär Geschäftsbereich A Wolfgang Schyrocki -8025

Bürgermeisterbüro
Julius Schulz -8014
Alexander Eichner -8019
Leitung des Leitungsstabes
Johannes Wohlstein -8027
Senatorenbüro
Christian Tebling -8016
Milena Schrader -8010
Finanzreferent, Europaangelegenheiten Jan Köhler -8007
Gremienangelegenheiten Samantha Dombrowsky -8030
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Silke Brandt -8017
Staatssekretärin Geschäftsbereich B Tanja Mildenberger -8022
Abteilung ZS Zentraler Service
Thorsten Steinmann -5004
Ressort-Digitalisierungsbeauftragter
Thorsten Steinmann -5004
Referat ZS A Erbschaften, Selbstversicherung und Regress, Innerer Dienstbetrieb, Landesausgleichsamt (LAA)
Matthias Voigt; -5200
Referat ZS B Digitalisierung
Ralf Meyer 0151-72 78 06 40
Referat ZS C
Personaldienstleistungen:
Personalleitstelle, Personalhaushalt und Personalwirtschaft
Thomas Biedermann -5300
Referat ZS D
Organisations- und Personalentwicklung, Sachhaushalt, Ressort-Controlling
Françoise Lancelle 0151-16 25 08 43
Justiziariat Juristische Dienstleistungen
Marion Holtz (komm.) -5500
ZS A EZI Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Remo Zuter (komm.) 0151-72 78 36 11
Geschäftsstelle des Hauptpersonalrats (HPR)
Geschäftsstelle der Hauptschwerbehindertenvertretung (HSBV)
Geschäftsstelle der Haupt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (HJAV)
Referentin des Staatssekretärs Antje Winkler -8021
Abteilung I Vermögen und Beteiligungen
Anja Naujokat -1004
Referat I A Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungspolitik; EnergieKonzessionsangelegenheiten, Grundsatzangelegenheiten der Besteuerung der Körperschaft Land Berlin
Jana Widlak -1801
Referat I B Beteiligungsmanagement I
Renate Hachtmann -1200
Referat I C Beteiligungsmanagement II; Koordinierung Flughafenpolitik
Ralf Karasch -1301
Referat I D Liegenschaftspolitik und Immobilienmanagement
Harald Fuchs 0151-16 25 44 06
Referat I E
Standortförderung, Finanzierungshilfen und Bürgschaften, Beteiligung Berlins an den Anstalten des Öffentlichen Rechts
Steffen Hontscha -1500
Referat I F Kreditmanagement
Elke Badack-Hebig -1612
Referat I G Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften; Wiedervereinigungsrecht
Stefan Frauenstein -1700
Abteilung IV Landespersonal
Ellen Çavdarci -4007
Leitstelle Diversity (LSt Diversity)
Sophie Finkenauer -4600
Serviceorientiertes PersonalManagement ( SPM)
Anette Schiller -4700
Referat IV A
Grundsatzangelegenheiten Personal, Personalpolitik
Michael Weidenhammer -4100
Referat IV B
Tarifrecht und Recht der Arbeitnehmer, Zusatzversorgung und Lohnsteuer und Sozialversicherungsrecht
Simone Mayr -4200
Referat IV C Demografiemanagement und Personalentwicklung
N.N. -4300
Referat IV D Öffentliches Dienstrecht
Sandra Winter -4400
Referat IV E
Landesweites Personalmarketing und -recruiting
Sylvia Gers 0151-18 85 30 29
Referat IV F Besoldung und Versorgung
Birgit Gründel (komm.) -4402
PStat
Statistikstelle Personal
Marcus Zager -4800
Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) Dr. William Brunton (030) 18 91 00-613
Abteilung II Finanzpolitik und Haushalt
Katrin Dube -2006
Leitstelle Investitionsplanung (LIP)
Ansgar Ostermann -2800
Leitstelle Geschlechtergerechte
Haushaltssteuerung (LGH)
Dr. Mara Kuhl 0151-18 85 29 92
Referat II A Grundsatzangelegenheiten der Finanzpolitik, Finanzstrategien und Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Dr. Bernhard Speyer -2100
Referat II B Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Grundsatzangelegenheiten des Öffentlichen Rechnungswesens des Landes Berlin, Haushalts-, Gebührenund Beitragsrecht, Aufsicht über den Landesfinanzservice sowie Angelegenheiten des Einzelplans 29
Oliver Rohbeck 0151-16 25 10 45
Referat II C Angelegenheiten des Einzelplans 10 sowie der entsprechenden Bezirkshaushaltspläne
René Lange-Nitschke 0151-18 85 29 95
Referat II D Angelegenheiten des Einzelplans 11 sowie der entsprechenden Bezirkshaushaltspläne und Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen
Melanie Rubach 0151-29 27 64 06
Referat II E
Angelegenheiten der Einzelpläne 01, 02, 03, 05, 06, 20, 21, 25 und 29 sowie der entsprechenden Bezirkshaushaltspläne
Iris Brockmann 0151-29 27 53 58
Referent der Staatssekretärin Tim Andres -8024
Abteilung III Angelegenheiten der Steuerverwaltung
Susanne Klose -3001
Stabsstelle Behördlicher Datenschutz für die Berliner Steuerverwaltung ( DSB)
Dr. Sebastian Pliquett (komm.) -3093
Referat III A Grundsatzfragen, Steuerpolitik, internationales Steuerrecht Holger Borkamm -3100
Referat III B Einkommensteuer, Umwandlungssteuerrecht, Lohnsteuer, Arbeitnehmerbesteuerungsverfahren, Wohnungsbauprämie, Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Zinsinformationsverordnung, Investmentsteuergesetz, Forschungszulagengesetz
Angela Herbst -3200
Referat III C Umsatzsteuer, Zölle und Verbrauchsteuern
Gerd-Volker Olbrich -3300
Referat III D Grundsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertung, Gemeindesteuern, Spielbankabgabe, besondere Verkehrsteuern
Bettina Werth -3400
Referat III E Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Erhebung, Vollstreckung, Kirchensteuer
Susanne Ott -3500
Referat III F Außenprüfungsdienste, Steuerfahndung, Steuerstrafrecht, Steuerberatungsrecht
Katharina Wehrhahn -3600
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses/Einigungsstelle für Personalvertretungssachen (LPA/EPV)
Referat II F Angelegenheiten der Einzelpläne 07, 12 und 13 sowie der entsprechenden Bezirkshaushaltspläne
Jan Schubert -2600
Referat II G Angelegenheiten des Einzelpläne 08, 09 und 15 sowie der entsprechenden Bezirkshaushaltspläne
Karola Scherler 0151-29 27 53 79
Referat II H
Angelegenheiten der Bezirke
Berthold Minthe 0151-18 85 29 93
II LFU
Projekt „Landesweites Forderungsmanagement zum Unterhaltsvorschussgesetz“
Karola Scherler 0151-29 27 53 79
Referat III G Controlling in der Berliner Steuerverwaltung, Stellenwirtschaft für die Berliner Finanzämter
Bettina Arlt -3700
Referat III H Organisation und Automation in der Berliner Steuerverwaltung Lutz Treuter -3800
Referat III K Laufbahnordnungsbehörde für die Steuerverwaltung; Personalmanagement Frank Gerasch -3900
Referat III M Unternehmensbesteuerung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Gemeinnützigkeit
André Brakrock -3120
Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Finanzen unterstehen:
Sonderbehörden: Finanzämter
Landesfinanzservice (einschl. Landeshauptkasse)
Landesverwaltungsamt
Anstalten des Öffentlichen Rechts: Verwaltungsakademie Berlin
Landesbetriebe: Staatliche Münze
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung
Körperschaften des Öffentlichen Rechts: Steuerberaterkammer Berlin
Referat III R Interne Revision und Beschwerdemanagement
Dr. Sebastian Pliquett (komm.) -3093
Referat III FS Finanzschule der Berliner Finanzämter
Jana Simroß (komm.) 9024-13322
► MATERIALVORGABEN
Funktionale Beschreibung
Im Interesse des Wettbewerbes
Im Vorabentscheidungsverfahren eines belgischen Gerichts hatte der EuGH die Frage zu entscheiden, ob eine Festlegung auf das Material einer Betonbauweise für Abwasserrohre vorgegeben werden darf oder ob es im Interesse des Wettbewerbes erforderlich ist, auch Kunststoffrohre zuzulassen. Thematisiert hatte dies ein Anbieter von Kunststoffrohren. Er erhielt Recht, und zwar mit der Begründung, dass die Vergabekoordinierungsrichtlinie (VKRL 2014/24/EU) in ihrem Artikel 42 den Begriff der „Technischen Spezifikationen“ in der Weise regelt, dass darunter ausdrücklich auch Materialien zu verstehen sind und nicht lediglich „Technische Spezifikationen“ im engeren Sinne von Normen und Gütezeichen, welche mittlerweile zu einem erheblichen Anteil europäisiert sind. Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass die Vorgaben von Materialien nur dann gerechtfertigt sind, wenn entweder technische Zwänge zur Verwendung bestimmter Materialien bestehen oder z. B. das Bauordnungsrecht, bis hin zu Gesichtspunkten der Optik, regelt, dass nur bestimmte Materialien erlaubt sind. Diese Rechtsprechung ist nicht gänzlich neu, weil der EuGH bereits im Oktober 2018 (Rechtssache C-413/17) genau dies ausgesagt hatte, dass nämlich der Begriff der „Technischen Spezifikationen“ sich keineswegs ausschließlich auf Normen im engeren Sinne bezieht, sondern auf jede Materialwahl auszudehnen ist. Diese Entscheidung wird einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, weil Materialvorgaben in Vergabevermerken und ggf. zusätzlich mit einer kurzen Begründung im Leistungsverzeichnis zu rechtfertigen sind. Anderenfalls wären sie angreifbar.
EuGH, Urt. v. 16.01.2025 (C 424/23)
► UNMITTELBARE VERGABE
Europas Markt entscheidend
Markterkundung unvollständig
Im Nachprüfungsverfahren ging es um die Frage, ob eine Klinik im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, also unmittelbar, eine Vergabe an einen Anbieter bzw. Hersteller tätigen durfte, von dem sie der Auffassung war, dass er für ihre Bedürfnisse der einzige infrage kommende Wettbewerber sei. Die Vergabekammer des Freistaates Thüringen verneint dies unter folgende Gesichtspunkten:
Die bei wettbewerblichen Vergabeverfahren weitgehend nicht prüfbare Freiheit eines öffentlichen Auftraggebers, seinen Beschaffungsbedarf zu bestimmen, gilt im Falle des Paragrafen 14 IV Nr. 2 VgV nicht so ohne Weiteres. Hohe Anforderungen gelten für Art und Umfang der vor der Beschaffung durchzuführenden Markterforschungen.
Die im Vergabevermerk niedergelegte Begründung, dass „aus technischen Gründen kein Wettbewerb“ vorhanden sei, wird den strengen Anforderungen nicht gerecht. Eine Markterkundung der AG lediglich auf dem nationalen Labormarkt ist im Lichte der Rechtsprechung des (EuGH, Urt. v. 15.10.2009, C-275/08) unzureichend. Gegenstand der Markterforschung muss der relevante Angebotsmarkt für die nachgefragte Leistung sein. Der öffentliche Auftraggeber muss ungeachtet nationaler oder regionaler Grenzen prüfen, welche Unternehmen zur Leistungserbringung in Betracht kommen. Insbesondere muss er sich eine europaweite Marktübersicht verschaffen. Solche Nachforschungen sind aus den Akten nicht erkennbar. Es wurde zunächst lediglich der regionale Markt erkundet. Erst im Anschluss hieran wurde dies auf den deutschen Markt erweitert. Das ist in jedem Falle unzureichend. VK Thüringen, Beschl. v. 11.07.2024 (5090-250-4003/430)
► FREIHÄNDIGE VERGABE Nicht an Region gebunden Fördermittel nicht in Gefahr Im Rahmen einer Rückforderung von Fördermitteln stand die Streitfrage im Raum, ob und inwieweit bei einer zulässigen freihändigen Vergabe die Nichtbeteiligung von regionsfernen Unternehmen einen Grund dafür liefert, dass infolge einer unterstellten Wettbewerbsbeschränkung ein Vergabefehler und damit ein Verstoß gegen die Nebenbestimmungen zum Fördermittelbescheid liegt. In der Sache ging es um die Reparatur des Schieferdaches einer Grundschule. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und die Arbeiten waren zwischen Mai und September 2009 auszuführen. Unbeanstandet blieb die Wahl der freihändigen Vergabe. Jedoch was die fördermittelgebende Stelle der Auffassung gewesen, dass ein Auftragswert von 70.000 Euro dazu hätte veranlassen müssen, regionsferne Dachdeckerunternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. Das Verwaltungsgericht in Arnsberg sieht dies anders. Die ausschreibende Stelle habe eine durchaus sorgfältige Auswahl von Unternehmen mit dem entsprechenden Know-how für die Eindeckung mit Schiefer im denkmalgeschützten Bereich getroffen. Außerdem sei nicht dargelegt worden, und dies ist im Kern der Hauptvorwurf, weswegen die Nicht-Aufforderung von weit entfernten Unternehmen vorliegend zu einer Beschränkung des Wettbewerbs und damit zu einem unterstelltermaßen überteuerten Einkauf geführt habe. Das Gericht stellt fest: Die betreffende Stadt hatte richtigerweise nicht nur örtliche, sondern auch regionale Unternehmen aufgefordert, wobei sie berücksichtigte, dass sie an der Grenze zwischen Rheinland und Westfalen liegt. Auch insofern hatte sie bereits regionsübergreifend Unternehmen aufgefordert.
VG Arnsberg, Urt. v. 15.11.2023 (1 K 3771/18)
► RESTABBRUCHARBEITEN Änderung des Vertrages
Neuausschreibung
Die öffentliche Auftraggeberin hatte ihrem in einer EU-weiten Ausschreibung ermittelten Vertragspartner gekündigt. Sie war dann der Auffassung, dass sie die restlichen Arbeiten ohne (neue) Ausschreibung an eine andere Firma im Zuge einer Ersatzvornahme vergeben dürfe, weil die (Rest-)Arbeiten nun abgeschlossen werden müssten. Die Antragstellerin ist gemäß dem Entscheid (sog. „Fortsetzungsfeststellung“) der Vergabekammer in ihren Rechten aus Paragraf 97 VI GWB auf Einhaltung des Vergaberechts verletzt. Sie könne sich nicht darauf berufen, dass keine (wesentliche) Änderung des Vertrages stattgefunden habe. Die öffentliche Auftraggeberin habe unter Verstoß gegen Paragraf 132 I 3 Nr. 4 GWB einen neuen Auftragnehmer an die Stelle des bisherigen Auftragnehmers gesetzt. Solche wesentlichen Änderungen eines Auftrags während der Vertragslaufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren (vgl. BayObLG, Beschl. v. 21.02.2024, Verg 5/12). Ebenso stelle die Beauftragung des Drittunternehmens im Wege von Nachträgen mit Nachunternehmereinsatz eine Änderung des Gesamtcharakters des Auftrags dar (vgl. VK Südbayern, Beschl. v. 28.02.2023, 3194.Z3-3_01-22-41). Paragraf 3a III Nr. 4 VOB/A-EU kommt nicht in Betracht. Ungeachtet dessen, dass diese Bestimmung lediglich die Wahl der Verfahrensart betrifft, liegen deren Voraussetzungen nicht vor. Eine äußerste Dringlichkeit der Leistung infolge von Ereignissen, welche die Vergabestelle nicht verursacht habe und nicht voraussehen konnte, liege nicht vor. Die Restabbrucharbeiten hätten daher auch nach der Kündigung des ursprünglichen Auftragnehmers erneut öffentlich ausgeschrieben werden müssen.
OLG Nürnberg, Beschl. v. 14.01.2025 (2 W 2077/24)
► UNMITTELBARE VERGABE Markterkundung
Nur mit offiziellem Charakter?
Die öffentliche Auftraggeberin schaltete eine unionsweite „Ex-anteTransparenzbekanntmachung“ für die Beschaffung einer Plattform für dermatologische Telekonsultationen im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb (Paragraf 14 IV Nr. 2 lit. b) VgV). Auf der Grundlage einer Internetrecherche ist sie der Auffassung gewesen, dass kein anderes Unternehmen in der Lage ist, entsprechende Leistungen zu erbringen.
Die Vergabekammer widerspricht dieser Vorgehensweise. Die durchgeführte Markterkundung im Internet könne keinen Beleg dafür liefern, dass nur ein Unternehmen die Leistung erbringen könne. Die Prognose sei entgegen den ausdrücklichen Vorgaben des Paragrafen 28 I VgV ohne Marktkonsultation durchgeführt worden. Die Bestimmung schreibe vor, dass die vor Beginn des Vergabeverfahrens durchzuführende Markterkundung nicht nur der Vorbereitung des Auftraggebers diene, sondern auch "zur Unterrichtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen" zu erfolgen habe. Dies solle dem Markt ermöglichen, sich auf eine Ausschreibung vorbereiten zu können (so auch: OLG Hamburg, Beschl. v. 06.04.2024, 1 Verg 1/23). Nur mit offizieller Ansprache des Marktes könne der Wettbewerb einem Test im Sinne eines wirkllichen „Nachweises“ unterzogen werden. Schließlich müsse der Auftragnehmer die zur Leistungserbringung erforderlichen Mittel erst zum Zeitpunkt des effektiven Vertragsbeginns vorweisen (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.06.2019, VII-Verg 52/18). Dieser Grundsatz sei auch hier zu beachten. Der Beschluss wird noch im Wege der sofortigen Beschwerde durch das OLG Düsseldorf (Verg 4/25) überprüft. VK Bund, Beschl. v. 28.01.2025 (VK 2-109/24)
Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Kanzlei Dr. Noch)
Der Koalitionsvertrag zum Beschaffungswesen
(BS/sr) Die Vereinfachung des Vergaberechts und eine Beschleunigung von öffentlichen Beschaffungen: Diese Ziele hat sich die kommende Koalition im gemeinsamen Koalitionsvertrag gesetzt. Dazu möchte sie unter anderem auch sektorale Befreiungen von Beschaffungsverfahren nutzen und Wertgrenzen anheben.
Beschaffungs- und Vergabeverfahren sind komplex und verlangsamen Prozesse zunehmend. Ein Umstand, der gerade jetzt, wo schnelles Handeln bei Infrastruktur und Sicherheitspolitik gefragt sind, hinderlich ist. Aber auch bei zivilen und vergleichsweise alltäglichen Kooperationen belastet die Komplexität die Verwaltung. Dr. Martin Schellenberg, Rechtsanwalt für Vergaberecht bei der Kanzlei HEUKING, hat daher klare Forderungen an die zukünftige Bundesregierung: „Die neue Bundesregierung muss die vergaberechtlichen Hürden für die innerstaatliche Zusammenarbeit beseitigen. Es kann nicht sein, dass bei jeder staatlichen Kooperation zunächst eine Kanzlei die vergaberechtliche Zulässigkeit prüfen muss.“ Tatsächlich sieht der Koalitionsvertrag auch einen Kahlschlag im Bürokratiedschungel vor. Ob die angestrebten Maßnahmen ausreichen werden, wird sich zeigen. So soll die Wertgrenze bei Direktaufträgen für Liefer- und Dienstleistungen angehoben werden. Sie wird
auf Bundesebene auf 50.000 Euro erhöht. Bei Start-ups, die innovative Lösungen vorantreiben, wird die Wertgrenze sogar auf 100.000 Euro angehoben. Was eine innovative Leistung ist, wird allerdings nicht näher definiert.
Strategischer IT-Einkauf
Auch wird die Absicht deutlich gemacht, das öffentliche Beschaffungswesen systematisch zu optimieren und ein strategisches Beschaffungsmanagement zu implementieren. So sollen Rahmenverträge unter Behörden und öffentlichen Dienststellen auf einer zentralen Einkaufsplattform gegenseitig zur Verfügung gestellt werden können. Die Vergabeplattformen für Bund, Länder und Kommunen sollen zentral im Kaufhaus des Bundes konsolidiert werden. Der IT-Einkauf des Bundes soll dann strategisch gesteuert werden, Abhängigkeiten von monopolistischen Anbietern seien zu reduzieren und der Digitalstandort Deutschland zu stärken. Für Bieterinnen und Bieter soll zudem
auch der Eignungsnachweis vereinfacht und bürokratiearm gestaltet werden, heißt es weiter im Koalitionsvertrag. Auch die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen der Vergabekammern zu den Oberlandesgerichten soll zukünftig entfallen.
Befreiung vom Vergaberechts Bei kritischen Beschaffungsvorgaben der nationalen Sicherheit oder bei Leitmärkten für emissionsarme Produkte in der Grundstoffindustrie soll die Möglichkeit einer Befreiung vom Vergaberecht geschaffen werden. Im Kapitel Verteidigungspolitik ist für militärische Bauvorhaben eine Vereinfachung der Bedarfsdefinition und Genehmigung sowie die Verabschiedung eines Bundeswehrinfrastrukturbeschleunigungsgesetzes mit Ausnahmeregelungen im Bau-, Umwelt- und Vergaberecht vorgesehen. Noch im ersten halben Jahr der Regierungsarbeit soll ein Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr zu beschlossen werden.
Ausschreibungen · Submissionen a24salescloud.de Die wie-für-mich-gemacht Ausschreibung

Früher. Passender. Einfacher. So geht Ausschreibung heute. www.a24salescloud.de


Jetzt Ihre Vorteile entdecken











Berliner Gespräch mit der schwedischen Botschafterin
Veronika Wand-Danielsson








(BS/ps) Schreiben wir diesmal über ein Königreich, wo die Sonne sogar nächtens scheint, die Männer, groß und blond, einst als Wikinger viel zur See fuhren und die Frauen Brigitta (die Erhabene), Lillemor (kleine Mutter) und Wilma (entschlossene Beschützerin) heißen, ihren Namen alle Ehre machen – und des Königs Gemahlin aus Deutschland kommt. In seiner Hauptstadt Stockholm lebt seit 1955 Herr Karlsson, ein „gerade richtig dicker Mann in den besten Jahren“, auf einem Dach und fliegt einfach so durch die Lüfte. Die Kinder heißen dort schon mal Pippi oder Michel, wohnen in der Villa Kunterbunt, in Lönneberga oder Bullerbü. Die weltberühmte Mutter dieser anarchisch-sympathischen Lauser, Astrid Lindgren, wäre heute 118 Jahre alt geworden. Das allbekannte Möbelregal aus diesem Land heißt seit 46 Jahren Billy und zeitlose Popgrößen ABBA. Wir schreiben über Schweden, das erneut nach Finnland, Dänemark und Island die UN-Liste der glücklichsten Nationen, den „Happyness Report“ anführt, und seine Botschafterin in Berlin, Veronika Wand-Danielsson.
Als deutsche Diplomatentochter mit schwedischer Mutter geht sie zunächst in Bonn zur Schule, verbringt große Teile ihrer Jugend in Afrika, studiert in den 80-er Jahren in Uppsala und Paris Politik, kommt 1990 ins schwedische Außenministerium, 1993 zur EU nach Brüssel, 2007 ins dortige NATO-Hauptquartier und ist als erste Frau von 2014 bis 2020 Botschafterin ihres Landes in Frankreich. Nach einer Stage im Außenamt in Stockholm wird sie zweite Frau seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1951 als Hausherrin der Königlichen Botschaft in der Berliner Rauchstraße. „Von großer Wichtigkeit für uns Schweden“, so Botschafterin Wand-Danielsson, „ist derzeit die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression.“ Russlands Krieg und die veränderten transatlantischen Beziehungen zeigten mit großer Dringlichkeit, dass Europa wesentlich mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen müsse. Denn der Angriff auf die Ukraine sei ein Angriff auf Europa, auf die internationale Ordnung sowie auf unsere europäischen Werte und die gemeinsame Sicherheit. All dies prägt auch ihre Arbeit als Botschafterin. Deutschland ist für Schweden ein sehr wichtiger strategischer Partner – sowohl bei der Organisation einer effektiven Unterstützung der Ukraine als auch bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Europas – mit einem besonderen Fokus auf den Sicherheitsinteressen des Ostseeraums. In diesem Kontext und angesichts der Tatsache, dass Schweden seit genau einem Jahr Mitglied der NATO ist, rücken die Länder in der Verteidigungszusammenarbeit noch enger zusammen. Kommenden November wird Schweden beispielsweise Partnerland der Berlin Security Conference sein.
„Ich
liebe die vielen politischen Talkshows am Abend und schätze die deutsche Streitkultur.“
Der Ukraine-Krieg hat überdies erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft des skandinavischen
Landes. Das Wachstum für 2022 und 2023 liegt um etwa 4,2 Prozent unter dem Wert vor Kriegsbeginn. Ferner belasten es die gestiegenen Energiepreise, die gedämpfte globale Nachfrage und die hohe Inflation.
„Auch die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands – unseres wichtigsten Handelspartners – wirkt sich negativ auf den schwedischen Export aus. Dennoch ist es der Regierung gelungen, die Inflation erfolgreich zu bekämpfen und wir erwarten, dass das Wirtschaftswachstum ab diesem Jahr wieder an Fahrt gewinnt.“
Stichwort Klimaneutralität
„Es gibt bereits große Fortschritte. So ist unser Strommix vollständig CO2-frei und diesen Kurs werden wir konsequent fortsetzen. Als exportorientiertes Land mit kleinem heimischem Markt hat für uns zudem die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit allerhöchste Priorität“.
Gleichsam wichtig ist seit 2017 Deutschlands sehr erfolgreiche Innovationspartnerschaft mit den Schweden in den Bereichen EHealth, Mobilität, Energie, Testbeds für Industrie 4.0 und der Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen. „Auf welch großes Interesse unser Know-how hierzulande trifft, das konnten wir im Februar auf der E-World in Essen erleben.“ Das „Volksheim Schweden“ (Folkhemmet), einst von den schwedischen Sozialdemokraten in den 1930-er und 1940-er Jahren als Wohlfahrtsstaat erbaut, ist heute keinesfalls baufällig, sondern kräftig renoviert und modernisiert und ist dort immer noch ein relevantes Gesellschaftsmodell. „Dennoch ist das Schweden von vor 100 Jahren, als der Begriff geprägt wurde, kaum mit dem heutigen vergleichbar. Wir sind Teil der EU und einer globalisierten Welt. Zu einem gewissen Grad ist der Begriff des Folkhemmet daher eine nostalgisch aufgeladene Projektionsfläche für eine vermeintlich gute alte Zeit.“ Gleichzeitig bleibe es ein zentraler Begriff der schwedischen Selbstwahrnehmung, fest verankert als Teil des kulturellen Gedächtnisses, und ein starker Wohlfahrtsstaat, der Sicherheit und Chancengleichheit ermögliche, sei nach wie vor Kernziel der schwedischen Politik, so Wand-Danielsson Untrennbar ist damit im heutigen Schweden die seit 1970 geltende gesetzliche Gleichstellung von Frauen und Männern verbunden. Ur-

















und interessiert sich seit ihrem Engagement bei der NATO insbesondere für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
sprünglich waren es wirtschaftliche Notwendigkeiten, Frauen stärker in den Arbeitsmarkt einzubinden. Man schaffte deshalb das Ehegattensplitting ab, um den Frauen auch die finanzielle Selbstständigkeit zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden konsequent der Ausbau der Kinderbetreuun sowie eine großzügige Elternzeitregelung mit explizit vorgesehenem Vaterschaftsurlaub gefördert. „Frauen und Männer müssen sich in Schweden heute nicht mehr zwischen Beruf und Familie entscheiden. Frauen sind finanziell unabhängig von ihren Partnern und somit weniger von Altersarmut bedroht.“ Im Alltag zeige sich das konkret daran, dass in vielen Familien beide Partner Vollzeit berufstätig seien, während die Kinder problemlos einen Platz in der Kita oder der Nachmittagsbetreuung erhielten. Gleichzeitig herrsche am Arbeitsplatz ein ausgeprägtes Verständnis für familiäre Verpflichtungen – für Mütter wie Väter.
Transparenz und Datenschutz Das Öffentlichkeitsprinzip ist ein weiterer zentraler Grundsatz des schwedischen Staatswesens und Teil der Verfassung. Alle Bürger haben danach das Recht, öffentliche Dokumente einzusehen und Informationen über die Arbeit von Behörden zu erhalten, ohne sich dafür ausweisen und Gründe angeben zu müssen. Ziel ist es, Transparenz, demokratische Kontrolle und eine offene Verwaltung zu fördern „Gleichzeitig wird in Schweden durch das Öffentlichkeits- und Geheimhaltungsgesetz sichergestellt, dass persönliche Daten und sensible Informationen geschützt sind und vor der Herausgabe eine Geheimhaltungsprüfung durchgeführt. Außerdem sind Behörden verpflichtet, nur solche Daten zu erheben, die für den jeweiligen Zweck unbedingt erforderlich sind.“ Wohl mit ein Grund, warum man im Königsreich glücklich und VeronikaWand-Danielsson die Hälfte ihres Lebens im diplomatischen Dienst aktiv ist: „Tatsächlich bin ich sogar mit ihm aufgewachsen. Als Tochter eines deutschen Diplomaten und einer schwedischen Tänzerin habe ich einen großen Teil meiner Kindheit in Afrika verbracht. Ich liebe den Job, meinen Auftrag, der auch meiner Persönlichkeit als offener und neugieriger Mensch entspricht.“ Das Schöne daran sei, dass die Abwechslung in den Berufsalltag eingepreist sei. Jede Postierung und jedes Land er-
öffne neue Themen, neue Netzwerke und setze andere Schwerpunkte. „Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist seit meinen Jahren als Botschafterin bei der NATO meine große Passion. Wer wie ich die Vielfalt liebt, ist im diplomatischen Dienst genau an der richtigen Stelle.“
Positive deutsche Streitkultur Sie hat die ersten Schuljahre in Bonn verbracht. Daher ist ihr die deutsche Kultur im Grunde sehr vertraut: „Was mir dennoch – auch als Botschafterin hier – immer wieder bewusst wird, ist die Vielfalt des Landes mit seinen 16 sehr unterschiedlichen Bundesländern.“ Immer wieder sei sie auch fasziniert von der deutschen Diskussionskultur und der Tiefe und Breite, mit der politische Diskussionen hier in die Öffentlichkeit getragen würden. Deutschland habe fantastische Journalisten: „Ich liebe die vielen politischen Talkshows am Abend und schätze die deutsche Streitkultur, im besten Sinne des Wortes, sehr.“ Was sie überrascht habe, besonders wenn sie die östlichen Bundesländer besuche, sei die Erkenntnis, wie groß die Unterschiede auch 35 Jahre nach der
Rezept der Botschafterin
Kanelbullar
Zutaten (ca. 20 Stück):
Für den Teig
Wiedervereinigung noch seien, so die Botschafterin. Ebenso lange ist Botschafterin Wand-Danielsson mit unterschiedlichen Aufgaben für ihr Land tätig und möchte, wenn überhaupt, z. B. mit David Attenborough, dem berühmten britischen Tierfilmer, während einer Foto-Expedition in Kenia, tauschen. „Oder auch mit Jane Goodall, der englischen Schimpansen-Forscherin, als sie noch aktiv war und sich in Tansania für den Schutz bedrohter Tiere einsetzte. Ein Tag mit ihr im afrikanischen Urwald wäre ein fantastisches Erlebnis gewesen.“ Letzte Frage: „Die schwedischen Kriminalromane sind bei uns sehr populär, welchen empfehlen Sie uns?“ „Eine Empfehlung, die kein klassischer Krimi ist, aber ein wichtiges Buch über die sozialen Verhältnisse, die im heutigen Schweden zu Kinder- und Bandenkriminalität führen, ist Malin Persson Giolitos Roman 'Mit zitternden Händen'. Der Roman erzählt die tragische Geschichte zweier Freunde aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen, die in das kriminelle Bandenmilieu eines Stockholmer Vororts gezogen werden“, resümiert sie.
25 g frische Hefe (oder 1 Päckchen Trockenhefe), 250 ml Milch (lauwarm), 75 g Butter (geschmolzen), 50 g Zucker, 1 TL Kardamom (gemahlen), 1 Prise Salz, 400 – 450 g Weizenmehl
Für die Füllung
75 g Butter (weich), 50 g Zucker, 1 EL Zimt Zum Bestreichen und Dekorieren 1 Ei (verquirlt), Hagelzucker
Zubereitung: Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. Butter, Zucker, Kardamom und Salz hinzufügen. Das Mehl nach und nach einarbeiten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Etwa 5 Minuten kneten. Den Teig abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Füllung herstellen: Die weiche Butter mit Zucker und Zimt zu einer Creme verrühren. Zimtschnecken formen: Den Teig auf einer bemehlten Fläche zu einem Rechteck (ca. 40 x 50 cm) ausrollen. Die Zimtfüllung gleichmäßig darauf verstreichen. Den Teig von der langen Seite her aufrollen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Backen: Die Scheiben auf ein Backblech mit Backpapier legen, abdecken und weitere 30 Minuten gehen lassen. Die Schnecken mit verquirltem Ei bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 220 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 8 – 10 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Mai 2025





www.behoerdenspiegel.de





(BS/Anne Mareile Moschinski) Per EU-Gesetz sind alle öffentlichen Stellen zu digitaler Barrierefreiheit verpflichtet, auch kommunale Bauvorhaben müssen in den meisten Bundesländern barrierefrei gestaltet sein. Trotzdem scheitert es in vielen Städten und Gemeinden an der Umsetzung.



Fehlende Rollstuhlrampen, Kommunikationshürden beim Behördengang und Webseiten, die nicht zu dechiffrieren sind: Der Umgang mit Ämtern und Behörden gehört für Menschen mit Behinderung zu den größten Herausforderungen im Alltag. Das ist das Ergebnis einer Studie der Aktion Mensch. Darin gaben mehr als 58 Prozent der befragten Personen mit Einschränkungen an, dass es an Aufklärung und Informationen zu den eigenen Ansprüchen und Rechten mangele. Vor allem die auszufüllenden Anträge und der bürokratische Aufwand sorgten für Probleme – doch abgesehen von den Schwierigkeiten beim Behördengang hakt es auch vielerorts bei den kommunalen Bauvorhaben, die längst nicht überall an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst sind.
„Inklusion ist nicht nur ein wünschenswertes Ideal, sondern ein grundlegendes Menschenrecht.“
Svenja Schulze, amtierende Bundesentwicklungsministerin
Anfang April tagte in Berlin der Weltgipfel für Menschen mit Behinderung, mehr als 3.000 Menschen aus rund 100 Ländern reisten hierfür in die Hauptstadt. Ein zentrales Ergebnis der Konferenz: In einer gemeinsamen Erklärung verpflichteten sich mehr als 80 Staaten und Organisationen, mindestens 15 Pro-




zent ihrer entwicklungspolitischen Projekte in Zukunft auf die Förderung von Inklusion auszurichten.
Zudem wurden rund 800 Selbstverpflichtungen für mehr Barrierefreiheit und Inklusion eingereicht. Die bei Redaktionsschluss noch amtierende Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze erklärte auf dem Gipfel: „Inklusion ist nicht nur ein wünschenswertes Ideal, sondern ein grundlegendes Menschenrecht.“
Nachholbedarf innerhalb der Bauvorschriften
Ende 2023 lebten nach einer aktuellen Erhebung des Statistischen Bundesamtes rund 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung in Deutschland. Ihre mangelhafte Inklusion hat dabei auch wirtschaftliche Folgen. So schätzt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), dass dadurch bis zu sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts eines Landes verloren gehen. Dabei findet eine unzureichende Inklusion nicht nur am Arbeitsplatz statt, auch im Umgang mit der Verwaltung sind die Hürden für Menschen mit Behinderungen mitunter groß.
„Innerhalb der Bauvorschriften gibt es noch großen Nachholbedarf“, sagt der Architekt und Bauingenieur Martin Philippi von der Agentur Barrierefrei NRW, die Interessenverbände und Vertreter aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu Themen der Barrierefreiheit berät. So würden bei kommunalen Baumaßnahmen zwar häufig die Belange von Rollstuhlfahrenden berücksichtigen, die Bedürfnisse von blinden und gehörlosen Menschen hingegen blieben wegen der ungenauen Definitionen in den Baunormen meistens außen vor.
Ob Barrierefreiheit im analogen




wie digitalen Bereich ausreichend von den Kommunen berücksichtigt werde, hänge in erster Linie von den Strukturen vor Ort ab, sagt Philippi So sei es ausschlaggebend, wie die Behindertenbeiräte einer Gemeinde agieren und wie Verfahrensabläufe bei Baumaßnahmen und digitalen Projekten ausgestaltet seien. Als Beispiel führt Philippi die Webseitengestaltung an. Einige Kommunen würden in ihre Online-Präsenz im Nachhinein sogenannte Overlay-Tools integrieren – eine barrierefreie Gestaltung sei das allerdings nicht. Die Tools würden lediglich suggerieren, dass die Webseite für Menschen mit Behinderung nutzbar sei, tatsächlich sei sie das aber nicht. Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit und Informationstechnik (BFIT) untermauert die Beobachtung. Sie warnt vor dem Einsatz der Overlay-Tools: Die nachträglich integrierte Software genüge nicht den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften. Eine barrierefreie Darstellung müsse bereits während der Konzeption des Webauftritts berücksichtigt werden, so das BFIT.
Zu wenig Meldungen in den Beschwerdestellen
Wie gut oder schlecht eine Kommune Inklusion mitdenke, habe allerdings nichts mit dem finanziellen Status einer Gemeinde zu tun, so Philippi. „Das Problem sind die fehlenden Sanktionen“, sagt er. Zwar seien Kommunen per Gesetz zur Einhaltung von barrierefreien Standards verpflichtet – doch die Konsequenzen bei Nichteinhaltung fehlten. „Wo kein Kläger, da kein Richter“, bringt es der Architekt der Agentur Barrierefrei NRW auf den Punkt. In den Beschwerdestellen gingen viel zu wenig Meldungen




über Versäumnisse ein, in der Folge versandeten die Missstände. Ein Positivbeispiel für eine barrierefreie Kommune ist der bayerische Landkreis Bad Kissingen. 2023 wurde er vom Freistaat Bayern zur Modellkommune für das landesweite Projekt „Bayern barrierefrei“ ernannt. Ziel des Projekts war es, Bayern bis 2023 im gesamten öffentlichen Raum barrierefrei zu gestalten, ein von der Landesregierung herausgegebener Leitfaden gab die Rahmenbedingungen vor. Bad Kissingen setzte im Zuge dessen etliche Maßnahmen auf baulicher Ebene um.
500.000 Euro für barrierefreies Bauen
Thomas Hack, Pressesprecher der Stadt Bad Kissingen, erklärt: „Die Vorgaben aus dem Handlungsleitfaden wurden bei jeder Neubaumaßnahme mit einer jährlichen Aufwendung von 150.000 bis 250.000 Euro berücksichtigt.“ Zu den Vorgaben gehörten abgesenkte Bordsteine, das Vermeiden von Stolperkanten sowie direkte und kurze Wegeführung. Für seheingeschränkte Menschen integrierte die Stadt taktile Leitelemente und vermied Hindernisse in Verkehrsflächen, darunter Beschilderungen oder Mülleimer. Auch die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden geht mit gutem Beispiel voran. 2016 wurde sie mit dem Access City Award der Europäischen Kommission ausgezeichnet, da sie seit 2013 in insgesamt 226 öffentliche Gebäude barrierefreie Elemente integrierte. Die entsprechenden Einrichtungen sind seitdem mit einem Aufkleber am Eingangsbereich als barrierefrei gekennzeichnet. 500.000 Euro pro Jahr investierte die Stadt in die Anpassungsmaßnahmen. Auch die




230 Busse des Wiesbadener ÖPNV sind barrierefrei, verfügen über Niederflurböden, taktile und farblich kontrastierende Haltegriffe sowie akustische und optische Informationen.
Digitale Inklusion ist ebenfalls ein Thema: Neben der barrierefreien Webseite der Kommunalverwaltung gibt es in Wiesbaden eine App, über die Nutzende per GPS zu barrierefreien Parkplätzen geleitet werden. „Wiesbaden ist davon überzeugt, dass gute Kommunikation entscheidend für die Stärkung der Teilhabe behinderter Menschen am städtischen Leben ist“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Broschüre anlässlich der Auszeichnung mit dem Access City Award. „Dienstleistungen und Informationen des Staates sind für alle Menschen gleich wichtig. Darum müssen alle unabhängig von ihren Fähigkeiten Zugang zu ihnen haben“, heißt es auf der Webseite des Informationstechnikzentrums des Bundes (ITZBund). Die Anforderungen an die Barrierefreiheit seien gesetzlich reguliert. Um diesen Anspruch umzusetzen, zeichnen Kommunen wie Bad Kissingen und Wiesbaden einen praktikablen Weg vor.

Die Frage ist: Was hält unsere Gesellschaft in Zeiten des Umbruchs noch zusammen?
Die Antwort ist einfach – ihre Umsetzung jedoch alles andere als leicht: Was es braucht, ist eine starke soziale Infrastruktur vor Ort Unsere 40.000-Einwohner-Kommune Schorndorf und alle Kommunen in Deutschland sind mehr als bloße Verwaltungseinheiten. Sie sind der Ort, an dem Demokratie erfahrbar wird. Doch genau hier entstehen die größten Spannungen: Steigende Anforderungen treffen auf knappe Ressourcen. Wie können wir als Städte und Gemeinden unsere soziale Verantwortung weiter wahrnehmen, ohne uns finanziell und personell zu überfordern?
Kommunale Sozialpolitik als Demokratiepolitik
Es gibt die weit verbreitete Vorstellung, dass Demokratie vor allem auf Bundes- oder Landesebene gestaltet wird. Doch das eigentliche Fundament demokratischer Teilhabe ist die kommunale Ebene. Hier wird Politik nicht abstrakt verhandelt, sondern konkret erlebt – in der sozialen Infrastruktur, in der Kinderbetreuung, in der Pflege, den Schulen, in der Wohnungs- und Quartierspolitik und in vielem mehr. Doch genau diese Infrastruktur ist bedroht. Die finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden ist desaströs. Nur noch 9,2 Prozent der Kommunen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes schuldenfrei. Und das, während die Lasten der Sozialpolitik ungleich verteilt sind: Während die Verantwortung für soziale Daseinsvorsorge wächst, bleibt die Gegenfinanzierung durch Bund und Länder oft unzureichend. Gleichzeitig stehen wir vor einer paradoxen

SCHWERPUNKT
Die soziale Daseinsvorsorge in Zeiten des Umbruchs
(BS/Bernd Hornikel/Christian Bergmann) Die letzten Jahre haben eine Krise nach der anderen hervorgebracht: Flüchtlingsbewegungen, die Finanzkrise, die Pandemie, den Krieg in Europa – sie alle haben den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe gestellt. Parallel dazu beobachten wir eine zunehmende Polarisierung, sinkendes Vertrauen in Institutionen und das Erstarken populistischer Bewegungen.

Den tragenden Säulen der föderalen und demokratischen Ordnung gebührt mehr Aufmerksamkeit. Foto: BS/respiro888, stock.adobe.com
Herausforderung: Mit weniger Mitteln müssen wir mehr erreichen –mehr Teilhabe ermöglichen, mehr Integration fördern, mehr sozialen Zusammenhalt sichern.
Allianzen neu denken –Zukunftsfähigkeit sichern Staat und Wohlfahrt stehen vor einem Scheideweg. Lange Zeit wurde die Daseinsvorsorge durch die enge Kooperation zwischen kommunaler Verwaltung und freien Trägern gesichert. Doch diese Balance gerät ins Wanken. Die Herausforderungen wachsen, während die Ressourcen stagnieren oder sogar schrumpfen. Die Wohlfahrtsverbände sind ebenfalls am Limit: Fachkräftemangel, wirtschaftlicher Druck und eine fehlende langfristige Finanzierung führen dazu, dass Angebote reduziert oder ganz eingestellt werden müssen. Einrichtungen der Altenhilfe, Kinderbetreuung oder Sozialberatung können nicht mehr die Bedarfe decken, die an sie herangetragen werden. Verhandlungen mit den
Kostenträgern gestalten sich zäh, da sie durch starre bürokratische Strukturen und unzureichende Refinanzierungen ausgebremst werden. Angesichts dieser Entwicklungen können Kommunen und Wohlfahrtsverbände nicht mehr nur auf altbewährte Strukturen setzen. Wir müssen neue Wege gehen. Statt isolierter Maßnahmen brauchen wir eine langfristige Strategie, die nachhaltige Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand, Sozialwirtschaft und Zivilgesellschaft fördert. Das bedeutet, wir brauchen:
• einen stärkeren Fokus auf Prävention statt reiner Reparaturmaßnahmen,
• neue Finanzierungsmodelle, die nicht auf kurzfristige Einzelprogramme setzen, sondern verlässliche Strukturen schaffen, sowie
• Bürokratieabbau, um Kooperationen zwischen Staat und Wohlfahrt schneller und flexibler zu gestalten zu können.
Die kommunale Ebene ist das tragende Fundament unseres sozialen
Zusammenhalts. Doch um diese Verantwortung wahrzunehmen, braucht es strukturelle Veränderungen in der Finanzierung.
Sondervermögen ohne Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt? Kommunen stemmen mehr als 25 Prozent des öffentlichen Gesamthaushalts, erhalten aber nur 14 Prozent des Steueraufkommens –eine unhaltbare Schieflage. Die Innenministerkonferenz hat auf Initiative Baden-Württembergs einstimmig beschlossen, dass der Bund für eine angemessene Finanzierung der kommunalen Aufgaben sorgen muss. Eine Kernforderung ist die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, um die soziale Daseinsvorsorge nachhaltig zu sichern. Ohne diese strukturelle Anpassung wird die soziale Infrastruktur zunehmend von kurzfristigen Förderlogiken und politischem Opportunismus abhängig werden. Auch das historische 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen des
Bundes für Infrastruktur wird vermutlich kein Gamechanger für Städte wie Schorndorf. Zwar stehen Baden-Württemberg über zwölf Jahre jährlich rund 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung – doch bei einer rein proportionalen Verteilung würden auf Schorndorf mit seinen 40.000 Einwohnern nur etwa vier Millionen Euro entfallen (0,36 Prozent der Landesbevölkerung). Diese Summe würde unser aktuelles Haushaltsdefizit pro Jahr nicht einmal decken. Zudem ist unklar, ob das Land Baden-Württemberg diese Mittel überhaupt eins zu eins an die Kommunen weiterreicht. Vielmehr ist mit einer Halbierung zu rechnen, da das Land erfahrungsgemäß bis zu 50 Prozent einbehält. Das wäre ein fatales Signal – gerade jetzt, wo die kommunale Infrastruktur am Limit steht.
Zeit für eine soziale Wende Wir stehen an einem Scheideweg: Entweder gelingt es uns, die kommunale Sozialpolitik mutig weiterzuentwickeln – oder wir riskieren, dass soziale Ungleichheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter untergräbt. Die gute Nachricht ist: Die Kommunen sind bereits dabei, neue Wege zu gehen. Was wir nun brauchen, sind entschlossene politische Entscheidungen, stabile Partnerschaften und die Bereitschaft, das alte Denken zu verlassen. Wenn wir nicht jetzt handeln, wird das Fundament unserer Demokratie porös – und niemand wird sagen können, wir hätten es nicht kommen sehen.


Bernd Hornikel (parteilos) ist seit 2022 Oberbürgermeister von Schorndorf (Baden-Württemberg).
Foto: BS/Danijel Grbic
Christian Bergmann ist seit 2017 Fachbereichsleiter für Familie und Soziales in der Stadtverwaltung von Schorndorf. Foto: BS/Danijel Grbic
… war ich mal wieder in der Gemeinde, wo ich 16 Jahre lang Bürgermeister war. Erfreut stellte ich fest, dass die neue Turnhalle für die Grundschule mittlerweile fertiggestellt wurde. Den Bau hatte ich noch angestoßen. Es war einfach eine herausfordernde Zeit als Bürgermeister, vor allem weil man für die Menschen vor Ort der staatliche Repräsentant für alle Auswirkungen ist, die Bund und Länder produzieren.
Theorie und Praxis: Wo die Bundespolitik zur Realität wird Wenn Deutschland mit der Migration überfordert ist, wird das eben nicht im Bundestag sichtbar, sondern ganz unten, in der Kommune. Diejenigen, die in Berlin die Gesetze beschließen, müssen sie




nicht vollziehen. Vollzogen werden sie in der Sporthalle der Gemeinde, in der der örtliche Sportverein nicht mehr trainieren kann. Vollzogen werden sie in den Schulen mit Kindern, die nicht schulfähig sind, weil sie kein Wort Deutsch sprechen.
Kommunale Selbstverwaltung: Anspruch und Realität Kommunen sind das Fundament unseres Zusammenlebens. Hier werden Kitas gebaut, Straßen saniert und Schwimmbäder betrieben. Bund und Länder sollten also Städte und Gemeinden bestmöglich unterstützen, damit das Leben vor Ort funktioniert. Doch dieser Support ist sehr überschaubar. Deutschlands Kommunen werden nicht nur im Stich gelassen, sondern auch überfordert. Der Staat überträgt den Städten und Gemeinden immer neue Aufgaben: Integration, Klimaschutz, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Mittel dafür?
Fehlanzeige! Eigentlich sollte aber bei einer neuen Aufgabenübertragung das
Konnexitätsprinzip greifen: Wer bestellt, der bezahlt. Das sieht die nordrhein-westfälische Verfassung immerhin so vor, das Grundgesetz verweigert den Kommunen diesen Anspruch.
Wenn gute Ideen an schlechter Finanzierung scheitern Hinter jeder neuen Aufgabe, die von oben nach unten oktroyiert wird, sollte ein Preisschild stehen. Denn die neuen Zuständigkeiten wollen auch auskömmlich finanziert sein. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Nehmen wir das Beispiel Inklusion. Diese Aufgabe (im Übrigen europäisches Menschenrecht) verursacht einen enormen finanziellen Mehraufwand für die Kommunen. Da aber (nicht nur) der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen sich gescheut hat, Verantwortung zu übernehmen und dem Schulträger eben nicht vorgeschrieben hat, wie groß z. B. eine Schule mit zusätzlichem Inklusionsangebot sein muss, wie viele Differenzierungsräume beispielsweise bereitgestellt werden müssen, bleibt es nur bei
unverbindlichen Empfehlungen. Da das Land eben nur empfiehlt und nicht bestellt, greift hier nicht der Konnexitätsgrundsatz. Das lässt sich dann sogar auch politisch gut verkaufen. Großzügig erklärt man, dass man den Kommunen keine Vorgaben machen möchte, die wüssten ja selbst am besten, was sie brauchen. In Wahrheit ducken sich Bund und Länder von einer auskömmlichen Finanzierung weg. Deutschlands Gemeinden werden im Regen stehen gelassen. Sie waren 2024 mit 24 Milliarden Euro verschuldet, ein vorläufiger Höchststand seit der Wiedervereinigung. Die Schulden haben sich gegenüber 2023 vervierfacht. Kommunen zwischen Hoffnung und Enttäuschung
Nun hat die künftige Bundesregierung Sondervermögen und Milliardenpakete geschnürt. Von diesem Kuchen sollen auch die Städte und Gemeinden etwas abbekommen. Dass auch in Zukunft die Kluft zwischen Sonntagsreden und Montagmorgen-Realität immer
größer wird, dafür muss ich kein Prophet sein.
Am Ende trifft es die Menschen vor Ort – mit höheren Gebühren, Einrichtungen, wie Schwimmbädern und Jugendräumen, die geschlossen werden. Die Kenntnis des Ortes ist die Seele des Dienstes, stellte Freiherr vom Stein richtigerweise fest. Es wird Zeit, dass die Politik die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort kennenlernt. Ich erahne schon, dass von der Unterstützung der viel beschworenen kommunalen Familie nur noch eine leere Hülse übrig bleiben wird. Hoffentlich habe ich dieses Mal unrecht.

SCHWERPUNKT
Insgesamt 144 Seiten umfassen die geplanten Regierungsvorhaben von Union und SPD, das letzte Drittel des Papiers widmet sich der kommunalen Ebene. Dort heißt es: „Der funktionierende Staat fängt auf kommunaler Ebene an.“ Auch in Zukunft müssten Kommunen „lebenswert und leistungsfähig“ sein. Mit einem Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen wollen die Regierungsparteien in spe die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken. Zudem soll es unter anderem Verbesserungen bei der Migrationspolitik und der Förderprogrammstruktur geben. Die Weltlage ändere sich gerade dramatisch. Alle drei Parteien müssten daher dem Koalitionsvertrag jetzt zustimmen, sagte Markus Lewe, der Präsident des Deutschen Städtetags. Ein Knackpunkt ist aus seiner Sicht das Ansinnen der Parteien, die Städte in den kommenden vier Jahren „wieder finanziell handlungsfähig zu machen“. Die rund 25 Milliarden Euro kommunales Defizit im Jahr 2024 hätten den Kommunen fast jeden Handlungsspielraum geraubt. „Deshalb muss klar sein: Jedes Gesetz zur Steuerentlastung, das den Bundestag passiert, muss Steuerausfälle bei den Kommunen vollständig ausgleichen“, so Lewe Förderprogramme auf dem Prüfstand
Die Kommunalfinanzen wollen die künftigen Regierungsparteien zwar systematisch verbessern – aus Sicht des Städtetags werde ein zentrales Instrument hierfür aber nicht genannt: einen höheren Steueranteil für die Kommunen einzuführen. Sinnvoll sei es zudem, nicht nur Förderprogramme auf ihre Wirksamkeit zu testen, sondern auch zu prüfen, welche Programme sich durch erhöhte Steueranteile für Städte und Gemeinden ersetzen lassen.
Um die Finanzierung der Kommunen auskömmlicher zu gestalten, verständigten sich die Koalitionäre
Papier ist geduldig – Hamburger auch. Die Koalitionsverhandlungen in der Hansestadt liefen deutlich geruhsamer ab, als jene im Bund. „Wir sind fertig, wenn wir fertig sind“, hatte der Erste Bürgermeister Peter Tschenscher (SPD) zusammen mit seiner Stellvertreterin Katharina Fegebank (Grüne) erklärt. Gestört hatte das niemand, zumal der rot-grüne Senat im März sein 14-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Tschenscher hatte Olaf Scholz (SPD) 2018 als Bürgermeister abgelöst. In zwei Jahren wird er das Amt länger als alle seine Vorgänger bekleiden. Im Norden nichts Neues. Doch der jüngst präsentierte Koalitionsvertrag setzt neben Bewährtem auch auf neue Ideen.
Hamburg, smarte Perle „Bürokratieabbau ist das beste Konjunkturprogramm“, heißt es im Vertrag, „die beste Entbürokratisierung ist die Digitalisierung“, konkretisiert Tschenscher. Gemäß dieser Kredos solle Hamburg Deutschlands smarteste Stadt bleiben. Besondere Aufmerksamkeit widmet das Papier dafür den Bezirksverwaltungen, denn die letzte Verwaltungsreform liegt bereits 20 Jahre zurück. Zuständigkeiten der Bezirksämter und Fachbehörden sollen neu aufgeteilt und stellenweise zentralisiert werden, um den Zugang zu städtischen Leistungen „schneller, digitaler und einfacher“ zu gestalten. Dadurch müsste beispielsweise der Hamburger KitaGutschein künftig nur noch einmal pro Kind, statt jährlich beantragt
Kommunale Implikationen des Regierungsprogramms
(BS/Anne Mareile Moschinski) Union und SPD haben die Eckpunkte ihrer Regierungsvorhaben zu Papier gebracht und sich auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Die kommunalen Spitzenverbände attestieren der Vereinbarung im Großen und Ganzen „gute Impulse“.

Ob der von Union und SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag tatsächlich einen Neustart für die Kommunen bedeutet, wird sich noch zeigen müssen. Die kommunalen Spitzenverbände äußern in vielen Punkten Skepsis. Foto: BS/Yingyaipumi, stock.adobe.com
in ihrem Papier auf die Umsetzung des Konnexitätsprinzips. Dabei gilt: Führen Bundesgesetze oder andere Maßnahmen des Bundes zu Mehroder Minderausgaben bei Ländern und Kommunen, muss der Bund für die Finanzierung aufkommen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Mittel bei der ausführenden Ebene ankommen. Der Deutsche Städteund Gemeindebund (DStGB) hält den Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ für ein wichtiges Signal an die lokale Ebene. Allerdings brauche es auch verlässliche und verbindliche Zusagen, fügt er an. Der Präsident des Deutschen Landkreistags (DLT), Dr. Achim Brötel, schreibt in einem Presse-
statement zum Koalitionsvertrag hingegen: „Das, was wir im Vertrag lesen, ist deutlich zu wenig.“ Er habe beispielsweise erwartet, „dass die Politik begreift, in welch dramatischer Situation die kommunalen Finanzen bundesweit sind.“ Das zentrale Problem der dramatischen Unterfinanzierung werde mit dem Vertrag aber nicht gelöst. „Aufbruch und Wende sehen anders aus“, so Brötel
In Bezug auf den von allen Seiten geforderten Bürokratieabbau haben die Koalitionsparteien konkrete Zielvorgaben formuliert: Die Bürokratiekosten für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sollen in der kommenden Legislatur um
mindestens zehn Milliarden Euro gesenkt werden. Den Deutschen Städtetag stimmt hier die geplante Entbürokratisierung des Aufenthaltsrechts hoffnungsfroh, damit würden die Ausländerbehörden „deutlich entlastet“.
Zustimmend reagierten die kommunalen Spitzenverbände auf die avisierte Migrationswende. Eine klare Begrenzung der illegalen Zuwanderung, mögliche Zurückweisung an den Grenzen in Abstimmung mit den europäischen Partnern und die Bündelung der Zuständigkeiten für Rückführungen seien die richtigen Schritte, fasst der DStGB zusammen. Der Deutsche Landkreistag signalisierte
Rot-Grün präsentiert Koalitionsvertrag
(BS/Julian Faber) In Hamburg haben SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Der Senat bleibt rot-grün – und plant neue Impulse vor allem in Sachen Entbürokratisierung und Verwaltungsmodernisierung.
werden. Wartezeiten wolle man verkürzen, Antragsstellung und Terminvergabe sollen vorrangig digital erfolgen. Eine sogenannte Support Unit soll flexible Unterstützung bei Bearbeitungsrückständen liefern und Ressourcen je nach Belastung vor Ort flexibler verteilt werden. Zudem sollen die städischen Kundenzentren künftig auch Samstags geöffnet sein. Um das dafür notwendige Personal zu akquirieren, macht die Koalition die unverbindlich formulierte Ankündigung, das Entgeldniveau der städtischen Beschäftigten auf „weitere Verbesserungen zu überprüfen“, um die Konkurrenzfähigkeit der Verwaltung auch in Zeiten des Fachkräftemangels zu sichern. Zur Stärkung des Vertrauens in das Staatswesen sind außerdem Förderungen innovativer Bürgerbeteiligungsformate geplant. Unter anderem sieht der Koalitionsvertrag die Einrichtung von Jugendparlamenten und -beiräten in allen Bezirken vor.
Baustandard leicht gemacht Wohnungsnot und hohe Mieten sind auch in Hamburg ein wachsendes Problem. Deshalb haben sich die Koalitionäre unter anderem auf eine Absenkung der Öko-Standards bei Bau und Sanierung verständigt.
Das entspricht den Wahlversprechen der SPD: Noch im Wahlkampf hatte Hamburgs Bausenatorin Karen Pein (SPD) den so genannten Hamburg-Standard vorgestellt. Durch den Wegfall nicht zwingender Bauvorschriften sollten die Kosten für Neubauten um ein Drittel reduziert werden. Der Gebäudetyp EH40, der im Vergleich zu unsanierten Bestandsgebäuden lediglich 40 Prozent der Energie verbraucht, soll entfallen. Der Typ EH55 reiche aus, zumal, wenn diese mit klimafreundlichen Heizungen wie Fernwärme ausgestattet würden. Der HamburgStandard vereinfacht außerdem einen ganzen Katalog an Einzelnormen, beispielsweise zur Deckendicke, Schallschutz und Größe des Treppenhauses. „Wir wollen guten Klimaschutz. Wir brauchen aber auch Ressourcen,“ so Tschenscher „Das macht Baukosten niedriger. Das ist enorm bedeutsam für günstiges bezahlbares Wohnen, denn darauf liegt auch in Zukunft unser Schwerpunkt. Auch für Sanierungen wolle man den Expertenmeinungen folgen, demnach Kosten und Einsparungen in keinem gesunden Verhältnis stünden. Man wolle „den energetischen Standard so anpassen, wie dies im Hinblick auf die CO2-Einsparung am wirkungsvollsten ist,“
ebenfalls Zustimmung. „Dieser Teil des Koalitionsvertrags vermittelt den Eindruck, dass die Migrationspolitik des Bundes konsequenter werden soll. Dass Zurückweisungen bereits an den Grenzen erfolgen und eine Rückführungsoffensive gestartet werden soll, begrüßen wir ausdrücklich“, so Präsident Achim Brötel
Koalitionsvertrag mit Leben füllen Weitere Vorhaben, die der Koalitionsvertrag für die Kommunen ankündigt: Nachweispflichten für kommunale Förderprogramme sollen reduziert und ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn besser ermöglicht werden. Um den Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zu stärken, soll auf Grundlage des „Operationsplans Deutschland ” zusammen mit den Ländern für die notwendigen Investitionen sowie eine dauerhafte Finanzierung gesorgt werden. Schnellere Investitionen wollen Union und SPD mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz ermöglichen. Der Deutsche Städtetag bezeichnet dieses als „echten Gamechanger“, da so Gesetze rechtlich priorisiert werden könnten.
„Was
wir im Vertrag lesen, ist deutlich zu wenig.“
Dr. Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistags
Grundsätzlich appellieren die kommunalen Spitzenverbände an die Koalitionsparteien, ihre ausgehandelten Ansätze „rasch mit Leben zu füllen“. Denn nur wenn Bürgerinnen und Bürger schnell Verbesserungen in ihrem Alltag erleben, lasse sich verlorengegangenes Vertrauen in den Staat zurückgewinnen.
Einen pauschalen Rückbau von Fahrspuren oder Parkplätzen lehnt der Vertrag aber ab. Ziel der Hamburger Verkehrspolitik sei ein „Mobilitätsmix“, der alle Verkehrsmittel berücksichtigt - auch das Auto, gerade mit Blick auf Wirtschafts- und Pendlerverkehre. Mit Pilotprojekten für autonomes Fahren am Stadtrand sowie einer Ausweitung des Hamburgtakts im Bus- und Bahnverkehr strebt rot-grün aber eine besondere Förderung alternativer Verkehrskonzepte an.
Kurs halten
Der Landesparteitag der SPD hat den Koalitionsvertrag bereits einstimmig angenommen. Auch die Zustimmung der Grünen gilt als sicher. Rot-Grün fährt in Hamburg in ruhigen Gewässern. Fegebank, neben dem Posten als Zweite Bürgermeisterin bisher Forschungssenatorin, soll zur Umweltbehörde wechseln. Ihre Nachfolgerin wird Maryam Blumenthal. Alle übrigen Sanatsposten sollen unverändert bleiben. Die Wiederwahl Tschenschers in der Hamburger Bürgerschaft ist für den 7. Mai angesetzt.
sagt Tschenscher. Gemäß Koalitionsvertrag halte man außerdem am Ziel fest, 10.000 neue Wohneinheiten pro Jahr zu genehmigen, wobei 3.000 Sozialwohnungen sein sollen. Auch wolle man den Pakt zur Beschleunigung von Planungsund Genehmigungsverfahren auf Bundesebene unterstützen. Auch Maßnahmen gegen Leerstand und Zweckentfremdung sind geplant. Streitpunkt Verkehr Während die Verhandlungen weitgehend harmonisch abliefen, kündigten sich im Bereich der Vekerspolitik früh einige Zielkonflikte zwischen SPD und Grünen an. Während die SPD für die Fertigstellung der A26 plädierte, wollten die Grünen den Autoverkehr weiter zurückdrängen. Das Verhandlungsergebnis dürfte für einige Grüne eine Enttäuschung sein, wenngleich sie einige Zugeständnisse erwirken konnten: Die Bezirke sollen künftig stärker in die Entwicklung von Rad- und Fußverkehrskonzepten eingebunden werden. Bis 2040 will die Stadt insgesamt 40.000 neue Fahrradstellplätze schaffen. Darüberhinaus sollen neue „Stadtteilkonzepte für den Fußverkehr“ entstehen, etwa durch breitere Gehwege und attraktivere Straßenräume. Aus der Stadt verbannt wird der Individualverkehr aber nicht: Die Koalitionäre kündigen einen „Masterplan Parken“ an. Parkraummanagement soll künftig bezirksgenauer und digitaler gesteuert werden, mit mehr Park-and-Ride-Angeboten am Stadtrand zur Entlastung des Zentrums. Für Elektroautos wird der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur weiter forciert.
B

Foto: BS/Philipp Marthaler







ehörden Spiegel: Die musikalische Protestform der Aktion in Berlin war ein kreativer Ansatz, um auf die prekäre Finanzlage vieler Kommunen aufmerksam zu machen. Wie hat sich Ihre Teilnahme ergeben, wie haben Sie die Aktion erlebt und planen Sie weitere solcher unkonventionellen Aktionen?
Jürgen Kleine-Frauns: Die Stadt Lünen engagiert sich schon seit Jahren im Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“. Deren Forderungen nach einem kommunalen Altschuldenschnitt und einer auskömmlichen Finanzausstattung sind für mich ohne Alternative. Die Kommunen müssen wieder für die Zukunft ihrer Bürgerinnen und Bürger investieren können. Deswegen bin ich gemeinsam mit unserem Kämmerer nach Berlin gefahren, um unseren Forderungen gerade mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin Nachdruck zu verleihen. Und ich finde, das ist uns auf das Beste gelungen. Das lässt sich nicht nur daran festmachen, dass unsere Aktion von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde, sondern vor allem daran, dass die Altschuldenhilfe nunmehr Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Was die konkrete Umsetzung anbetrifft, werden wir im Aktionsbündnis sicherlich nicht nachlassen.
Behörden Spiegel: Sie haben in Berlin betont, dass der aktuelle Sparkurs eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Können Sie erläutern, wie finanzielle Engpässe das Vertrauen der Menschen in den Staat beeinflussen?
Interview mit Jürgen Kleine-Frauns, Oberbürgermeister der Stadt Lünen
Ein lauter Weckruf für Berlin
(BS) Musik vor den Parteizentralen von Union und SPD in Berlin: Mit einer unüberhörbaren Aktion hat das Bündnis „Für die Würde unserer Städte“ kürzlich eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen gefordert. Getreu dem Motto: Wer (die Musik) bestellt, bezahlt. Wir sprachen dazu mit dem Oberbürgermeister von Lünen. Die Fragen stellte Julian Faber.

Vor dem Konrad-Adenauer-Haus und der SPD-Zentrale wurde es laut. Foto: BS/Electric Egg Ltd, stock.adobe.com
Kleine-Frauns: Denken Sie bitte allein an den Zuwachs an gesetzlich verordneten Aufgaben und bürokratischen Anforderungen in den letzten Jahren ohne vollständige Kostenausgleiche, immer nach dem Motto: „Ihr macht das schon.“ Und es stimmt ja auch: Wir in der Verwaltung machen das –immer! Mit unseren Mitarbeitenden geben wir alles für unsere Bürgerinnen und Bürger. Um ihre Ansprüche zu erfüllen, ihre Rechte zu gewähren und um ihren Erwartungen gerecht zu werden. Aber stellen Sie sich bitte den Aufschrei vor, wenn wir das nicht mehr stemmen könnten, wenn wir
also nicht mehr Mitarbeitende beim Wohngeld einsetzen, unser Angebot im OGS-Bereich nicht stetig ausweiten, unseren Ordnungsdienst nicht permanent erweitern und personell aufstocken, die digitale Infrastruktur an Schulen nicht mit Hardware und Personal ausbauen, nicht in den Klimaschutz, in Brandschutzvorsorge oder den Rettungsdienst investieren und vieles mehr nicht tun würden. Wenn wir diesen Aufgaben irgendwann nicht mehr nachkommen können, führt die Unterfinanzierung der Kommunen zur Handlungsunfähigkeit und die Bürgerinnen und
Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern (BS/Julian Faber) Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 11. Mai finden in Mecklenburg-Vorpommern vier Landkreiswahlen und eine Oberbürgermeisterwahl statt. Wir werfen einen Blick auf die Kandidaten und die wichtigsten Themen vor Ort.
Landratswahlen werden oft als unwichtig geschmäht. Dabei handelt es sich um das höchste direkt wählbare politische Amt in Deutschland. In Ludwigslust-Parchim, der Mecklenburgischen Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen werden die Posten der obersten Kommunalbeamten bestimmt. Hier dominieren ganz andere Themen als im Bund.
Gesundheitsversorgung im Fokus In Ludwigslust-Parchim fordert Simone Borchardt (CDU) Amtsinhaber Stefan Sternberg (SPD) heraus. Die 57-jährige Gesundheitsmanagerin war im Februar erneut in den Bundestag gewählt worden und müsste ihr Mandat bei einem Wahlsieg abgeben. Der krisenerprobte Sternberg saß von 2021 bis zu dessen Auflösung im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Auch AfD und Grüne haben jeweils einen Kandidaten aufgestellt. Im Kreis der Mecklenburgischen Seenplatte dominiert das Thema der Gesundheitsversorgung. Landrat Heiko Kärger (CDU) hat nach 15 Jahren entscheiden, nicht erneut zu kandidieren. Nun will ihn sein zweiter Stellvertreter Thomas Müller beerben. Ins Rennen gehen außerdem Bundestagsmitglied Johannes Arlt (SPD), Enrico Schult für die AfD, Björn Eckardt (Die Basis) und Torsten Koplin (Die Linke). Koplin plädiert für den Ausbau der sozialen Infrastruktur, insbesondere bei Bildung, Kultur und ÖPNV. In-
tegration gelinge durch Begegnung, dafür brauche es entsprechende soziale Räume. Koplin sitzt seit 27 Jahren im Schweriner Landtag und ist einer der bekanntesten Politiker des Bundeslandes, gilt aber aufgrund seiner Vergangenheit als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit als vorbelastet.
Ein abtrünniger Landrat Im Kreis Vorpommern-Rügen kündigt sich eine besondere Auseinandersetzung an: Die SPD hatte Mitte Februar den parlamentarischen Staatssekretär Vorpommerns, Heiko Miraß für die Wahl nominiert. Sein Konkurrent, Amtsinhaber Stefan Kerth war ehemals Sozialdemokrat und verließ im November 2023 die Partei. Als parteiloser Kandidat wird er nun von der CDU unterstützt. Kehrt warf der SPD vor, „gesinnungsethische Ziele über Realpolitik“ zu stellen. Der Wahlkampf zwischen den ehemaligen Genossen verspricht also, eine persönliche Note zu bekommen. Weitere Kandidaten sind
Carlos Rodrigues (AfD), Sebastian Lange (Die Linke) sowie zwei parteilose Einzelbewerber. In einem durch den NDR veranstalteten Bürgergespräch waren vor allem die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung strittig.
Kein Bundestagsmandat erhielt Erik von Malottki. Jetzt geht er für das Spitzenamt im Kreis Vorpommern-Greifswald gegen Amtsinhaber Michael Sack (CDU) ins Rennen und wird dabei von SPD, Grünen und
Linken unterstützt. Sack beschäftigt vor allem die Verwaltungsdigitalisierung und Entbürokratisierung. Für die AfD bewirbt sich die gebürtige Hamburgerin Inken Arndt Showdown in Neubrandenburg Ebenfalls gewählt wird ein neuer Oberbürgermeister Neubrandenburgs. Der scheidende Amtsinhaber Silvio Witt (parteilos) hatte im Oktober seinen Rückzug angekündigt. Er erklärte, es sei in den „vergangenen Jahren eine Stimmung kreiert und von allen Parteien zugelassen worden, die mit einer konstruktiven Zusammenarbeit nichts zu tun“ habe. Das einen Tag vor seiner Erklärung mit Stimmen von AfD, BSW und zwei rechtspopulistischen Bürgerbewegungen im Stadtrat beschlossene Regenbogen-Beflaggungsverbot habe am „Ende einer langen Kette von Ereignissen“ zu seinem Rückzug beigetragen. Insgesamt gibt es neun Bewerber – darunter keine einzige Frau. Die größten Erfolgschancen haben wohl der Geschäftsführer der Neubrandenburgischen Wohnungsgesellschaft Frank Benischke (CDU), der Sozialversicherungsangestellte Jens Kreutzer (BSW) und der von SPD und Grünen unterstützte Nico Klose
Diese Wahlen sind mehr als nur regionale Entscheidungen. Sie spiegeln politische Spannungen, Brüche und neue Bündnisse wider – und könnten damit zum Seismografen für die kommenden landespolitischen Entwicklungen werden.
Bürger werden das Vertrauen in unseren Staat endgültig verlieren. Die jüngsten Wahlergebnisse haben schließlich gezeigt, wie akut die Bedrohung ist. Wir können es uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, die Menschen vor Ort in unseren Städten zu enttäuschen. Im Umkehrschluss heißt das, dass man das Vertrauen in den Staat nur herstellen oder zurückgewinnen kann, wenn man die Kommunen finanziell stärkt – wir brauchen dringend frisches Geld!
Behörden Spiegel: Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um die Finanzsituation der Kommunen zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die von Ihnen geforderte Altschuldenlösung und die Entlastung der Eingliederungshilfe?
Kleine-Frauns: Sie haben zwei wichtige Entlastungsmaßnahmen genannt. Es ist zu begrüßen, dass sowohl die nordrhein-westfälische Landesregierung als auch die nächste Bundesregierung einen Teil der kommunalen Altschulden übernehmen möchten, auch wenn diese Beteiligungen bei Weitem noch keine abschließende Lösung bilden. Über die Lösung des Altschuldenproblems hinaus braucht es endlich eine stabile Grundfinanzierung der laufenden Aufgaben und notwendigen Investitionen, damit wir nicht sofort wieder in die Verschuldung abrutschen. Ein deutlich höherer Anteil des Bundes an den staatlich
veranlassten Sozialleistungen würde helfen. Die Finanzierung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein. Auf dieses Problem haben wir im vergangenen Jahr im Rahmen unserer „Lüner Gespräche“ unter Einbindung der Bundes- und Landespolitik in aller Deutlichkeit aufmerksam gemacht. Was die Investitionen in unsere Infrastruktur betrifft, können die für die Länder und ihre Kommunen vorgesehenen Investitionsmittel aus dem Sondervermögen des Bundes hilfreich sein, wenngleich hiermit noch eine Reihe an offenen Fragen verbunden ist.
Behörden Spiegel: Das Aktionsbündnis fordert neben finanziellen Entlastungen auch einen konsequenten Bürokratieabbau und die Vereinfachung von Förderprogrammen. Welche konkreten bürokratischen Hürden sehen Sie derzeit als besonders hinderlich für die Kommunen an?
Kleine-Frauns: Den großen Infrastrukturfonds des Bundes habe ich gerade angesprochen. Diese Mittel müssen nicht nur schnell und unbürokratisch bei uns ankommen. Vielmehr braucht es auch eine deutliche Beschleunigung der Planungs- und Ausschreibungsverfahren, um dieses Geld dann auch „auf die Straße zu bekommen“. Und was die notwendige Reform der Förderpolitik betrifft, ist eine vereinfachte und gerechtere Förderpraxis längst überfällig – neben der Freiheit, selbst zu entscheiden, wofür die Mittel eingesetzt werden. Schließlich wissen wir vor Ort am besten, wo es am dringendsten Geld braucht, um die Probleme der Stadtgesellschaft zu lösen. Das wäre im Übrigen auch ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in die Akteure in Verwaltung und Räten.










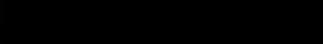


Die sogenannte Selffulfilling Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung, ist eine Annahme über die Zukunft, die das Verhalten so ändern kann, dass die Annahme tatsächlich real wird. Das wohl berühmteste Beispiel ist der Placebo-Effekt, bei dem eine Tablette ohne jeglichen Wirkstoff Schmerzen lindert, alleine weil jemand daran glaubt. Und Prüfungsangst aus der Annahme heraus, man könnte scheitern, setzt so unter Stress, dass die Leistung tatsächlich schwächer wird. Selbst Marktdynamiken kennen selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn die Sorge darüber, Toilettenpapier könne knapp werden, Menschen horten lässt, sodass tatsächlich ein Engpass entsteht. Und Selffulfilling Prophecy macht auch nicht vor politischen Prozessen Halt. Das hat die AfD schon frühzeitig erkannt und für sich genutzt: Alleine die Debatte über Migrationsthemen, immer wieder angeheizt durch in den Vordergrund gerückte Probleme, Sorgen und Ängste im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten, hat ihr schon vor der Bundestagswahl ein gigantisches Hoch beschert.
Wie Narrative Realitäten schaffen Je häufiger Probleme thematisiert werden, desto stärker rücken sie in den Vordergrund. Und je intensiver die Prognose geäußert wird, dass Deutschland die Flüchtlingssituation nicht in den Griff bekommt, umso mehr wird sie zur Realität. Das gilt auch auf kommunaler Ebene. Kommunen tragen Sorge für die Integration vor Ort, mit grundlegenden Aufgaben wie Unterbringung, Vorhalten von Kita- und Schulplätzen, Unterstützung bei Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Arbeitsmarktintegration. Zugegeben: Angesichts der vielerorts knappen Kassen, hoher Bevölkerungsdichte und anderen kommunalen Herausforderungen ist das natürlich keine leichte Aufgabe. Aber glaubt man dem Mechanismus der selbsterfüllenden Prophezeiung, führt das Wehklagen vieler Bürgermeisterin-
Die Frage, wie es mit der Unterbringung von Geflüchteten tatsächlich aussieht, wurde über 600 Kommunen bereits gestellt – einmal 2023 und dann im Folgejahr 2024 noch einmal – mit einem interessanten Ergebnis. Die Online-Befragung der Universität Hildesheim zeigte 2023, dass ca. 58 Prozent der Kommunen die Lage als „herausfordernd, aber (noch) machbar“ einschätzten, wohingegen ca. 40 Prozent der Befragten die „Lage der Unterbringung von Geflüchteten in ihrer Kommune“ als überlastet und „im Notfallmodus“ beschrieben. Nur bei 1,5 Prozent der Befragten war die Lage entspannt. Nur ein Jahr später zeigte die Befragung bei fast 800 teilnehmenden Kommunen ein deutlich positiveres Bild: Die Zahl der überlasteten Kommunen ist von 40 auf knapp 23 Prozent gesunken, während circa 71 Prozent die Lage als herausfordernd, aber machbar einschätzten. Auch die Zahl der Kommunen ohne größere Schwierigkeiten ist auf fast sechs Prozent gestiegen.
Bessere Verteilung dank Algorithmus
Wie Integration gelingen kann
(BS/Stephan Neher) Sprechen wir heute über Migration und Integration, sprechen wir hauptsächlich über Herausforderungen. Wie wir über Herausforderungen sprechen, prägt unseren Umgang mit ihnen. Wer vor allem Probleme betont, befeuert sie oft ungewollt. Wer dagegen auf Lösungen setzt, kann erstaunlich viel bewegen – auch bei der kommunalen Integration von Geflüchteten.

Was im idyllischen Rottenburg am Neckar funktioniert, kann überall gelingen.
nen und Bürgermeister, ihre Verwaltung sei mit der Betreuung und Integration von Migrantinnen und Migranten überfordert, keine Lösung herbei. Im Gegenteil, die Annahme, man stehe vor unlösbaren Problemen, wird immer mehr zur Realität und öffnet rechten Gesinnungen immer mehr Tür und Tor.
Die Stadt, in der es klappt Rottenburg am Neckar ist eine mittelgroße Stadt im Kreis Tübingen in Baden-Württemberg mit rund 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Etwa die Hälfte lebt in der eher städtisch geprägten sogenannten Kernstadt, die andere Hälfte verteilt sich auf 17 eher dörflich geprägte Ortschaften. Aktuell leben rund 1.800 Menschen mit humanitärem Aufenthaltstitel in
der Gesamtstadt. Städtisch untergebracht sind rund 700 Menschen vor allem aus Herkunftsländern wie der Ukraine, Syrien, Nigeria oder Afghanistan. Die vorgegebene Quote zur Aufnahme Geflüchteter wird seit Jahren übererfüllt. Und Rottenburg am Neckar bricht nicht unter der Last zusammen. Im Gegenteil, in überregionalen Medien liest man zuweilen, Rottenburg sei die Stadt, in der es klappt. Was also läuft hier anders?
Sicherlich ist im Zusammenhang mit Integrationsfragen eine Flächenstadt mit 17 Ortschaften ein Vorteil, den Rottenburg vor allem zur dezentralen Unterbringung, verteilt auf die Gesamtstadt, nutzt. Das gilt auch für Kitas und Grundschulen. Rottenburg setzt aber auch auf Signale sowohl an
Foto: BS/EKH-Pictures, stock.adobe.com
die eigene Bevölkerung als auch weit über die Stadtgrenzen hinaus: Etwa, dass Migration kein Problem, sondern eine Chance ist. 2019 hat sich Rottenburg als Sicherer Hafen und somit solidarisch mit den Zielen der zivilgesellschaftlich organisierten Initiative Seebrücke erklärt und gehört zu den Gründungsmitgliedern im bundesweit aufgestellten Städtebündnis Sicherer Häfen. Als Bischofsstadt ist sowohl in der Verwaltung als auch in der Bevölkerung eine besondere Verantwortung spürbar, christliche Grundwerte auch zu leben. So ist es vermutlich kein Zufall, dass eine überwältigende Anzahl Rottenburger Bürgerinnen und Bürger bereit waren und immer noch sind, privaten Wohnraum vor allem für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu
Wie Kommunen die Hürden der Flüchtlingswellen besser meistern können
(BS/Scarlett Lüsser) Vielerorts ist zu hören: „Die Flüchtlingswellen sind das große Problem, die Wurzel allen Übels, Kommunen sind deswegen überlastet und und und…“ Aber entspricht das tatsächlich der Realität? Wie sehen das die Kommunen selbst? Und wo liegen die tatsächlichen Probleme, die auf kommunaler Ebene angepackt werden müssen –und können?

Mit einer stabilen Finanzierung und ausreichendem Personal können und möchten viele Kommunen von sich aus Integrationsangebote schaffen. Foto: BS/Fotofreundin, stock.adobe.com
Wie Prof. Dr. Petra Bendel, Forscherin für Migration, Flucht und Integration an der Friedrich-Alexander -Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in einer NeueStadt.org-Diskussionsrunde erklärt, sei das größte Problem bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten, dass die Asylsuchenden nach dem Gießkannenprinzip einfach irgendwie verteilt würden. Das führe zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten, denn „die Kommunen sagen oft, wir bekommen Leute, von denen wir gar nicht wissen, was bringen sie für Bedarfe mit, für Kenntnisse und Fähigkeiten“, während die Bedürfnisse der Geflüchteten wenig Beachtung fänden und sie es auch später bei der Arbeitssuche sehr schwer hätten, so Prof. Bendel. Um dieses Problem zu entschärfen, habe die FAU über dreieinhalb Jahre ein Pilotprojekt mit vier Bundesländern und über 20 Kommunen durchgeführt, bei dem ein Algorithmus bei der Verteilung helfen sollte. So werden in den Erstaufnahmeeinrichtungen Befragungen
stellen – abgesehen von einem nach wie vor unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement in zahlreichen Initiativen und Projekten für die Menschen, die in Rottenburg am Neckar Zuflucht suchen.
Handeln, wo andere zögern Vermeintliche Hürden geht die Rottenburger Verwaltung pragmatisch an: Wenn ein plötzlicher Zustrom Geflüchteter die Verwaltung vor große Herausforderungen stellt, wird kurzerhand ein gut zugängliches Trauzimmer zum Bürgerbüro Ukraine umfunktioniert, mit Fusion aus Aufnahme-, Unterbringungsund Ausländerbehörde in einem Team und ausgestattet mit ehrenamtlichen Dolmetschenden. Wenn eine große Menge Kinder auf der Flucht vor Krieg besonderer Aufnahme und Fürsorge bedarf, bevor sie in Kitas und Schulen integriert werden, nutzt Rottenburg ein freistehendes Gebäude als UkraineSchule und bietet ehrenamtlich betreutes Ankommen im Sinne der Kinder an. Und wo in vielen anderen Städten schon gleich zu Beginn eines solchen Projektes die problematische Frage der Finanzierung im Vordergrund stehen würde und womöglich alles zunichtemacht, wird in Rottenburg erst mal gehandelt. Denn Rottenburg setzt auf Lösungen und fokussiert nicht die Probleme. Und wie gut, dass dabei auch die selbsterfüllende Prophezeiung hilft! Denn Erwartungen und Glaubenssätze beeinflussen auch im positiven Sinne das eigene Verhalten; und nicht nur das, auch das Verhalten anderer Menschen wird beeinflusst. Deren Erwartungen und Verhaltensweisen stärken wiederum die eigenen Glaubenssätze. Was für ein wunderbarer Kreislauf!

mit den Schutzsuchenden durchgeführt, um „integrationsrelevante Eigenschaften und Bedürfnisse mit den Bedingungen in den Kommunen“ mithilfe von „Match’In“ zu vergleichen und passend zusammenzuführen. Dabei spielen z. B. Bildungsstand, Arbeitserfahrung, aber auch Barrierefreiheit und gesundheitliche Bedarfe eine Rolle. Das Verfahren biete eine transparente und klare Entscheidungshilfe für eine passgenauere Verteilung, ist Prof. Bendel überzeugt. Im Ergebnis sei das Algorithmusverfahren auch von allen Beteiligten gut aufgenommen worden, sodass Prof. Bendel eine flächendeckende Einführung empfiehlt.
Probleme und Lösungsansätze
Bei der tatsächlichen Integration wird häufig die Sprachbarriere zum Problem, besonders wenn es um die Integrierung von Kindern und Jugendlichen ins deutsche Schulsystem geht. Zwar würden die meisten Schulen bereits sogenannte Willkommensklassen anbieten, wie Marc Elxnat, Beigeordneter des Deutschen Städte und Gemeindebunds, meint, jedoch seien die
daraus gewonnenen Sprachkenntnisse oft nicht ausreichend und zudem sei die zusätzliche Belastung des ohnehin schon vielerorts zu dünn besetzten Lehrerschlüssels so hoch, dass eben doch keine oder zu wenige Willkommensklassen angeboten werden könnten. Elxnat sieht hier besonders die Länder in der Pflicht, solche Integrationsklassen zu ermöglichen, doch die Organisation selbst müsse vor Ort stattfinden.
Darauf aufbauend wird oft die Diskussion angestoßen, ob Integration zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werden sollte. Für Prof. Bendel ist das aber eindeutig nicht der richtige Weg. Für sie liegen die Hauptprobleme zum einen – wie bei vielen anderen Problemen in deutschen Kommunen auch – in der Finanzierung und zum anderen im Flickenteppich der sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidenden Maßnahmen. Sinnvoller wäre in ihren Augen eine einheitliche Zielvorgabe, die „aber kommunale Spielräume bei der konkreten Ausgestaltung ermlöglicht – also die Freiheit gibt, bestimmte Teilaufgaben an freie Träger, wie Wohlfahrtsverbände, auszulagern.“ Dazu seien gesetzlich verankerte Fördermaßnahmen durch die Länder sinnvoll. Als Beispiel nennt Prof. Bendel das Landesintegrationsgesetz von NRW, in dem festgelegt ist, dass kommunale Integrationszentren eingerichtet werden müssen. Gleichzeitig stehen hierfür Fördersummen zur Verfügung.

Sie möchten in verantwortlicher Position städtische Grundstücke für den Wohnungsbau oder Gewerbeansiedlungen entwickeln und durch eine strategische Bodenbevorratung auf die Entwicklung der Stadt Einfluss nehmen?

Dann sind Sie bei uns richtig.
Der Fachbereich Immobilienmanagement übernimmt mit seinen zur Zeit 34 Mitarbeitenden innerhalb der Stadtverwaltung die Funktion der Eigentümerin städtischer Grundstücke. Wir verantworten die bauliche Entwicklung sowie die Vermietung und Verpachtung unserer Grundstücke, ebenso wie die Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Wohnungsbestandes. Wir kaufen strategisch wichtige Grundstücke zur Umsetzung städtebaulicher Planungen und zur Bodenbevorratung. Wir suchen eine kommunikative und kreative Person als
Abteilungsleitung „Strategisches Immobilienmanagement und Grunderwerb“ und stv. Fachbereichsleitung (w/m/d)
Die Stelle ist nach A 14 LBesO A NRW bzw. EG 14 TVöD bewertet. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Sanny Groß, Gianna Forcella und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Zukunft bauen in Krefeld:
Ihre Chance als Betriebsleitung des ZGM!

Machen Sie Krefeld mit uns l(i)ebenswert! Die Stadtverwaltung Krefeld ist vor Ort eine der größten Arbeitgeberinnen. Im Zusammenwirken mit der Bürgerschaft organisieren und gestalten rund 4.000 Mitarbeitende den Alltag und das tägliche Miteinander in unserer Stadt. Das Zentrale Gebäudemanagement Krefeld (ZGM) übernimmt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Krefeld die ganzheitliche Betreuung von rund 732 Objekten in 232 städtischen Liegenschaften. Die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Realisierung von Neubauprojekten, die Instandhaltung und Pflege der Bestandsimmobilien bis hin zur technischen Entwicklung. Dabei ist das ZGM für die unterschiedlichsten Gebäudenutzungsarten wie Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen, Feuerwachen, Verwaltungs- und Sozialgebäude sowie Sport- und Kulturstätten zuständig. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine engagierte Führungspersönlichkeit als
Betriebsleitung (w/m/d) Zentrales Gebäudemanagement
Die attraktive Position wird für Beamtinnen und Beamte nach B 2 LBesG bzw. für Tarifbeschäftigte entsprechend außertariflich vergütet. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Alexander Wodara oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Talentboard-AC_2024.indd 1
Digital. Innovativ. Zukunftssicher. – Dein IT-Impact für unsere Kitas im Erzbistum!
25.01.24 16:30
Das Erzbistum Köln hat eine Trägergesellschaft (Katholino Kindertagesstätten im Erzbistum Köln gGmbH) gegründet, die die Einrichtung und den Betrieb der rund 530 katholischen Kindertagesstätten des Erzbistums Köln verantworten und deren strategische Weiterentwicklung fördern soll. Gemeinsam mit der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH, Deutschlands größtem freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen, hat das Erzbistum Köln zudem eine Servicegesellschaft für die Verwaltung der Kitas des Erzbistums Köln gegründet. Durch die Bündelung der Kompetenzen beider Organisationen etablieren wir in der neu gegründeten Servicegesellschaft eine moderne Verwaltung, die die besten Rahmenbedingungen für die Förderung von Kindern und die Entlastung von Familien ermöglicht. Für den Kita-Träger suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine innovative Abteilungsleitung (w/m/d) IT Katholino
Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit für den Standort Köln zu besetzen. Wir bieten eine attraktive Vergütung nach KAVO (TVöD vergleichbar) mit zusätzlichen Sozialleistungen und betrieblicher Altersvorsorge sowie Jahressonderzahlungen und einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Alexander Wodara oder Sarah Jankowski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Die Lebensadern der Stadt
Schorndorf unter Ihrer Leitung!

Schorndorf liegt idyllisch im Remstal, eingebettet zwischen Weinbergen, Wäldern und dem Naherholungsgebiet Schwäbischer Wald und nur rund 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Die Daimlerstadt verbindet Historie mit Innovationsgeist und bietet hohe Lebensqualität mit urbanem Flair und ländlicher Nähe.
Die Lebensadern unserer Stadt - Straßen, Wege, Brücken und Grünflächen - stehen im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Nach den jüngsten Hochwasserereignissen gilt es, die beschädigte Infrastruktur nachhaltig wieder aufzubauen, Bestehendes weiterzuentwickeln und neue Wege im Sinne einer zukunftsorientierten „Infrastruktur 4.0“ zu gehen. Der Fachbereich gliedert sich in die Abteilungen Wege und Brücken sowie Grünplanung mit angegliedertem Friedhofswesen. Der städtische Baubetriebshof und die Stadtentwässerung sind als Eigenbetriebe ausgegliedert und auch der Wasserverband Unteres Remstal hat seinen Sitz in Schorndorf.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine engagierte und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit als
Fachbereichsleitung
Infrastruktur (w/m/d)
Die Besoldung / Vergütung dieser attraktiven Position erfolgt je nach Voraussetzung bis zur Besoldungsgruppe A 15 bzw. EG 15.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Alexander Wodara, Yanna Schneider oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_FBL-Infrastruktur_Schorndorf_05-2025.indd 1
Zukunft erfinden: Kreative Ideen für Vaihingens historische Vielfalt!

Vaihingen an der Enz – eine Stadt mit ca. 30.000 Einwohner*innen und neun vielfältigen Stadtteilen –bietet charmantes Kleinstadtleben mit der Nähe zu den Großstädten Stuttgart und Karlsruhe. Umgeben von Weinbergen und Naturparks lädt die Region Wanderlustige und Naturverliebte ein.
Um die bestehende Idylle und Tradition mit der geforderten Moderne zu vereinen, fördert das Stadtplanungsamt in Vaihingen eine nachhaltige Stadtentwicklung. Uns ist es wichtig, das historisch mittelalterlich geprägte Erbe zu erhalten und zugleich kreative Konzepte zu entwickeln, um Raum für Neues zu schaffen. Ein besonderes Highlight wird die Gartenschau 2029 sein, die innovative Stadtentwicklung und Naturerlebnis verbindet und der Region weitere neue Impulse verleihen soll.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine zielorientierte Führungspersönlichkeit als
Diese attraktive Position wird nach A 14 LBesGBW bzw. EG 14 TVöD vergütet. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen und dynamischen Umfeld. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Alexander Wodara oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_AL-Stadtplanung_Vaihingen_12-2024.indd

Verwaltung neu denken. Gemeinsam gestalten. Trossingen bewegen.
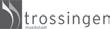
Die Stadt Trossingen ist mit über 18.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Landkreis Tuttlingen und liegt zentral in der Region zwischen Alb und Schwarzwald in Baden-Württemberg. Eingebettet in eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands bietet Trossingen eine gelungene Verbindung von ländlicher Idylle und städtischer Infrastruktur. Umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft bietet Trossingen eine hohe Lebensqualität für Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste mit einem breiten Spektrum an Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an entscheidender Schnittstelle der Verwaltung eine persönlich und fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit als
Dezernatsleitung (w/m/d) für die Hauptverwaltung und Bürgerdienste
Vergütet wird die Stelle bis zur Besoldungsgruppe A15 LBesGBW bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen oder eine vergleichbare Vergütung nach TVÖD. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe ist eine ausgeprägte Sozialkompetenz von wesentlicher Bedeutung. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Gianna Forcella oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung

Anz_Dez-Hauptverwaltung_Trossingen_05-2025.indd 1 23.04.25 11:26
Gestalten Sie zusammen mit der Stadt Aachen die Zukunft im engen Dialog mit der Stadtgesellschaft sowie den Nachbar*innen in der Städteregion, den Niederlanden und Belgien.

Der Fachbereich Stadtentwicklung und -planung besteht aus den Abteilungen Verwaltung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung sowie Denkmalpflege. Ein engagiertes Team von etwa 60 Fachleuten aus den Gebieten Stadt- und Raumplanung, Geographie, Architektur, Baugeschichte, Archäologie, Verwaltung und Finanzen arbeitet täglich daran, attraktive Rahmenbedingungen für das Leben in Aachen zu schaffen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit als Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Stadtplanung (w/m/d)
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Die Funktion der Fachbereichsleitung ist nach Besoldungsgruppe A 16 LBesO A NRW bewertet. Für Tarifbeschäftigte erfolgt eine vergleichbare Eingruppierung nach TVöD. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Raza Hoxhaj und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Leistungsuebersicht.indd 1
Als Interimsmanager*in schaffen Sie in kurzer Zeit einen Mehrwert.
22.03.24 12:43
Vieles ist aktuell in Bewegung. Der demographische Wandel fordert von öffentlichen Verwaltungen und kommunalen Unternehmen neue Herangehensweisen und Lösungsansätze für anstehende Aufgaben.
Für Kundenprojekte in allen Funktionsbereichen des öffentlichen Sektors suchen wir erfahrene und ambitionierte Persönlichkeiten als Interimsmanagerin / Interimsmanager (w/m/d)
Als Interimsmanager*in übernehmen Sie bei unseren Kunden kurzfristig Verantwortung, um dringende Aufgaben und Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen.
Was Sie mitbringen sollten:
Erfahrung: Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in verantwortungsvoller Position, idealerweise im öffentlichen Sektor oder in projektnahen Aufgabenstellungen.
Flexibilität: Bereitschaft, sich schnell in neue Themenfelder und Organisationen einzuarbeiten.
Kompetenz: Fundiertes Wissen in den Bereichen Verwaltung, Prozessoptimierung, Digitalisierung oder strategisches Management.
Persönlichkeit: Ausgeprägte Kommunikations- und Führungskompetenz sowie eine hohe soziale und interkulturelle Sensibilität.
Verfügbarkeit: Offenheit für zeitlich befristete Einsätze mit wechselnden Aufgabenstellungen.
Interessiert?
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 0178 8894251 zfm-Geschäftsführer Edmund Mastiaux zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Die Stadt Bochum mit ca. 375.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist mit einer Vielzahl anspruchsvoller Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturstätten sowie vielen Einrichtungen für Freizeit, Sport und Erholung eines der wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Ruhrgebiets.
Wir suchen eine*n

Beigeordnete*n (w/m/d) für Jugend, Soziales, Arbeit und Gesundheit (Stadträtin / Stadtrat)
Diese attraktive Position wird nach Besoldungsgruppe B 5 LBesG vergütet. Als Mitglied des Verwaltungsvorstandes sind Sie maßgeblich an der gesamtstädtischen Entwicklung und der Umsetzung der Bochum Strategie beteiligt. Sie verantworten die Bereiche Jugend, Soziales, Arbeit und Gesundheit und führen nach gegenwärtigem Zuschnitt neben dem Jugendamt auch das Amt für Soziales sowie das Gesundheitsamt. Sie sind Vorsitzende*r der Trägerversammlung für das Jobcenter Bochum. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit Bochum und der Stadt Bochum.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Elisa Heinen und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_BG-Jugend_Bochum_05-2025.indd 1 23.04.25 11:06
Sie sind fachlich versiert, umsetzungsorientiert, führen überzeugend und werteorientiert? Dann erwartet Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung geführt. Die Betriebsleitung des Gebäudemanagements besteht aus einer Technischen und einer Kaufmännischen Betriebsleitung. Diese sind gemeinschaftlich für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betriebsführung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Gebäudemanagements verantwortlich.
Die Technische Betriebsleitung ist für die Geschäftsbereiche „Technisches Gebäudemanagement“ und „Hochbautechnisches Gebäudemanagement“ zuständig. Ihr zugeordnet ist die „Stabsstelle Nachhaltiges Bauen“ Wir suchen zum nächstmöglichen eine überzeugende Persönlichkeit als
Diese attraktive Position wird für Beamt*innen nach Besoldungsgruppe A 16 LBesO NRW bzw. für Tarifbeschäftigte entsprechend außertariflich vergütet. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Sanny Groß, Gianna Forcella und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Techn-BL_Aachen_05-2025.indd
Die Haushalte der Kommunen in Deutschland geraten immer mehr in Schieflage. Allein in Hessen haben die kommunalen Kernhaushalte im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von rund 2,6 Milliarden Euro verzeichnet. Um überhaupt noch Investitionen in die vielerorts marode kommunale Infrastruktur tätigen zu können, wird immer wieder gerne auf die vielen Förderprogramme hingewiesen. Der Förderlandschaft ist allerdings problematisch. Allein der Zugang zu Fördermitteln wird für Kommunen von einem erheblichen
bürokratischen Aufwand begleitet. Hat man diese erste Hürde genommen und ein passendes Förderprogramm gefunden, geht es weiter in langwierigen Antrags-, Genehmigungs- und Verwendungsnachweisverfahren. Die Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) war gleich zwei Mal dabei. Zunächst erhielt sie aus dem Programm „Ländliche Regionalentwicklung“ für die geplante Errichtung eines Aufenthaltsgebäudes auf einem Jugendzeltplatz eine Förderung in Höhe von 84.000 Euro. Gefördert wurde dabei aber nicht nur die Maßnahme an sich

Protest gegen sächsischen Haushaltsentwurf (BS/sr) Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) fordert einen höheren Kommunalanteil am Haushalt des Landes statt der geplanten Kürzung. Andernfalls könnten die erdrückenden Kosten nicht mehr gedeckt werden.
Dass die Kommunen sich einer wachsenden Mehrbelastung gegenübersehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Steigende Sozialausgaben sowie Personal- und Sachkosten drohen die Kommunen zu erdrücken. Auch die kommunale Daseinsvorsorge gerät zunehmend unter Druck. Bibliotheken, Schwimmbäder und Jugendzentren sind vielerorts von Schließung bedroht, da notwendige Investitionen und Betriebskosten nicht mehr gedeckt werden können. Gleichzeitig steigt der Erwartungsdruck der Bürgerinnen und Bürger, etwa hinsichtlich Digitalisierung, Mobilität oder Klimaschutz. Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Radebeul und Präsident des SSG, Bert Wendsche, stellte vor diesem Hintergrund anlässlich der jüngsten Haushaltsanhörung im Sächsischen Landtag klar: „Der Anteil der Kommunalzuweisungen am sächsischen Staatshaushalt muss in den kommenden beiden Jahren deutlich gestärkt werden. Immer weniger Kommunen können ihre Haushalte noch ausgleichen.“ Eine Kürzung des Kommunalanteils sei für ihn deshalb undenkbar – doch genau das sieht der aktuelle Haushaltsentwurf vor. „Die kreisfreien Städte und Landkreise werden von der Entwicklung der Sozialausgaben erdrückt und die finanziellen Nöte der kreisangehörigen Gemeinden werden durch steigende Personal- und Sachkosten sowie Kreisumlagenerhöhungen immer größer“, so Wendsche.
Es fehlen 500 Millionen Euro Laut dem aktuellen Haushaltsentwurf beträgt der Kommunalanteil lediglich 33 Prozent, während er von 2020 bis 2024 konstant 35 Prozent umfasste. Bei einem jährlichen Gesamthaushalt des Freistaates von rund 25 Milliarden Euro
(also das Aufenthaltsgebäude für die Jugendlichen), sondern auch die Umzäunung des Aufenthaltsgebäudes – das jedoch nicht konsequent.
So gab es nur für die Errichtung des Zauns Fördermittel. Die notwendige Schließanlage, um die Umzäunung abschließen zu können und so dem Zaun seinen eigentlichen Sinn zu geben, wurde gerade nicht gefördert. Denn das war Aufgabe der Kommune. Daneben erhielt Poppenhausen aus dem Programm „Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur“ eine weitere Förderung von rund 200.000 Euro. Bei der Schlussrechnung kam es jedoch zu einer im Ergebnis für alle folgenschweren Rundungsdifferenz von fünf Cent.
Der Fördermittelgeber akzeptierte die eingereichte Schlussrechnung aufgrund der Rundungsdifferenz von fünf Cent nicht. Poppenhausen musste nach langen Verhandlungen mit dem Fördermittelgeber die Rechnung korrigieren und erneut einreichen.
Das ist kleinlich und hat mit dem ursprünglichen Wortsinn der „Förderung“ nicht mehr viel zu tun. Vielmehr zeigt es, dass die eine Hand der Verwaltung der ande-
fehlen den Kommunen damit rund 500 Millionen Euro jährlich für die laufende Verwaltung und weitere Investitionen, zum Beispiel in die klimaneutrale Gestaltung des Verkehrswesens. Besonders prekär: Die meisten Einsparungen des Landes finden sich in den Investitionsprogrammen. Sachsen finanziert laut Wendsche hauptsächlich Fördermittel, die bereits in den Vorjahren zugesagt wurden. Neue Vorhaben würden hingegen kaum noch gefördert. Nach Aussage des SSG hält sich der Freistaat bei der Brandschutzförderung so nicht mehr an seine eigenen gesetzlichen Vorgaben. Diese schreiben eine Förderhöhe vor, die mindestens das Niveau der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer haben muss.
2026 werden zudem erstmals acht Millionen Euro zur Erfüllung der Vorgaben des Blaulichtgesetzes fehlen. „Das kann so auf keinen Fall bleiben“, machte Wendsche deutlich. „Wir erwarten, dass der Freistaat seine eigenen Gesetze respektiert und die investive Brandschutzförderung wieder deutlich aufstockt.“
Sondervermögen reicht nicht
Die ausbleibenden Investitionen seitens des Landes gefährden allerdings auch den dringend notwendigen Schul- und Kitaausbau sowie den kommunalen Straßenbau. Daran kann auch ein Sondervermögen des Bundes nichts ändern – zumal hier bislang noch nicht geklärt ist, wie viel den Kommunen zufließen wird.
Daher sei eine Überarbeitung des Haushaltsentwurfs wichtig, so Wendsche. Aktuell befindet sich der Entwurf in der parlamentarischen Beratung. Dementsprechend könnte der Appell des SSG Berücksichtigung finden.
Dr. Ulrich Keilmann
leitet die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof in Darmstadt. Foto: BS/privat
ren in komplexen Förderverfahren nicht für fünf Cent traut.
Beide Beispiele in einer einzigen Kommune zeigen zwei zentrale Kritikpunkte an unserem Förderwesen.
1. Unser Förderwesen ist kurios und bürokratielastig. Der kommunale Verwaltungsaufwand steht häufig nicht mehr in einem sinnvollen Verhältnis zu den eingeworbenen Fördermitteln. Entsprechend müssen die Verfahren deutlich vereinfacht werden. Der Abbau bürokratischer Hürden ist ein entscheidender Schritt, um den Wirkungsgrad der Förderungen wieder deutlich zu erhöhen.
2. Zudem hat sich zumindest mir in beiden Beispielen der eigentliche Förderzweck bisher nicht erschlossen.
Warum wird ein Zaun gefördert, aber nicht die notwendige Schließ-

anlage dafür? Warum wird eine Scheingenauigkeit betrieben, um einen Betrag von fünf Cent bei 200.000 Euro dokumentiert aufzuklären? Müsste es nicht vielmehr Ziel einer Förderung sein, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen?
Bereits in der Pressekonferenz des hessischen Rechnungshofs am 21.11.2023 wurde festgestellt: „Gut gemeinte politische Ziele dürfen nicht in aufwendig umsetzbaren Gesetzen und Normen und damit in zusätzlicher vermeidbarer Bürokratie münden.“
Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Kommunalbericht 2024, Hessischer Landtag, Drucksache 21/1148 vom 11. Oktober 2024, S. 132 f. Der vollständige Bericht ist kostenfrei unter rechnungshof. hessen.de abrufbar.
Bayerischer Oberster Rechnungshof (ORH) legt Jahresbericht vor (BS/Anne Mareile Moschinski) Die Mängelliste der Prüfer ist lang und reicht von fehlerhafter Besteuerung kommunaler Mandatsträger über unverhältnismäßig teuren Straßenbau bis hin zu Millionen von fehlerhaft ausgestellten Steuerbescheiden mit unzutreffenden Kirchensteuer-Sonderausgaben.

Insgesamt drei große Bauvorhaben an Staatsstraßen nahmen die Prüfer des bayerischen Rechnungshofs im Jahresbericht 2025 unter die Lupe. Hier stiegen die Baukosten von ursprünglich 34 auf 90 Millionen Euro. Damit wurden die Vorhaben 2,2- bis 4,5-fach so teuer wie ursprünglich geplant. Grund für die enormen Kostensteigerungen seien Defizite in Planung und Kostenermittlung sowie fehlende Kostendisziplin gewesen, so der ORH.
Grenzen bei der bayerischen Grenzpolizei Einsatzunterstützungen angefordert. Eine Kostenerstattung erfolgte nicht, allerdings hätte die Landespolizei die Kosten an den Bund weitergeben müssen, monierten die Prüfer in ihrem Bericht. An den Flughäfen Nürnberg und Memmingen nahm die bayerische Grenzpolizei ebenfalls Aufgaben des Bundes wahr. Hier beliefen sich die Personalkosten von 2020 bis 2023 auf insgesamt 42,5 Millionen Euro.
„Es kommt jetzt entscheidend darauf an, mit dem Schuldenpaket verantwortungsbewusst und generationengerecht umzugehen.“
Heidrun Piwernetz, Präsidentin des ORH
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kosten für den Schutz des Bundesgebietes. So habe der Bund 2020, 2021 und 2023 zur Sicherung der
In Anbetracht dessen fordert der Bayerische Rechnungshof: „Das Innenministerium sollte zur Wahrung der Haushaltsinteressen des
Freistaates Verhandlungen mit dem Bund über eine Kostenbeteiligung führen.“
Generationengerechter Umgang mit Schuldenpaket
Zum jüngst beschlossenen Schuldenpaket des Bundes stellte ORHPräsidentin Heidrun Piwernetz klar: „Es kommt jetzt entscheidend darauf an, damit verantwortungsbewusst und generationengerecht umzugehen.“ Die Schuldenbremse des Grundgesetzes sei nicht aufgehoben, sondern nur verändert worden. Eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur sei grundsätzlich aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren. Schulden kämen nur für nachgewiesene, zusätzliche Maßnahmen in Betracht, die über den Status quo hinausgingen und nachfolgenden Generationen zugutekämen. „Nur so kann überhaupt gerechtfertigt werden, dass diese die erheblichen Zinslasten aus einer möglichen enormen Neuverschuldung und die damit einhergehenden finanziellen Einschränkungen tragen müssen“, so Piwernetz
Aus diesem Grund haben sich CDU und SPD im Koalitionsvertrag auf ein Sondervermögen für die Infrastruktur geeinigt. Auch die Grünen waren an diesem Vorhaben noch beteiligt, denn um das gesamte geplante Finanzpaket und die damit verbundene Lockerung der Schuldenbremse umsetzen zu können, ist eine Grundgesetzänderung und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Auf Grund der Eilbedürftigkeit des Vorhabens nutzten Union und SPD daher die Mehrheitsverhältnisse des bis dato noch amtierenden Bundestags. Damit konnte ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität geschaffen werden, dass über zwölf Jahre laufen soll. Für Länder und Kommunen ist ein Anteil von 100 Milliarden Euro vorgesehen, weitere 100 Milliarden Euro sollen auf Druck der Grünen „schrittweise dem Klima- und Transformationsfonds zugeführt“ werden, lässt sich dem Koalitionsvertrag entnehmen. Der Bundesanteil beläuft sich während der Legislaturperiode bis 2029 auf insgesamt rund 150 Milliarden Euro. Neben dem Ausbau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur soll auch in den Zivil- und Bevölkerungsschutz, in die Krankenhausstrukturen, Bildungs-, Betreuungsund Wissenschaftsinfrastrukturen, in das Schienennetz sowie in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung investiert werden.
Positiv, aber…
Verbände wie der Deutsche Städteund Gemeindebund (DStGB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) sind sich einig: Zwar setzte das Sondervermögen Infrastruktur ein wichtiges und notwendiges Signal zum Aufbruch, allerdings sei damit auch eine schlagkräftige Reform von Nöten. „Der
Maßnahmen des Bundes gegen marode Infrastruktur
(BS/Scarlett Lüsser) „Eine funktionierende Infrastruktur ist die Basis für Wohlstand, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, heißt es im neuen Koalitionsvertrag. Schaut man sich aber die eingestürzte Carolabrücke in Dresden, die nun abgerissene Ringbahnbrücke in Berlin oder das marode Schienennetz in ganz Deutschland an, wird schnell klar, dass besonders die Infrastruktur unseres Landes zu lange vernachlässigt wurde.

Mit dem Sondervermögen werden wir unser Land in den kommenden Jahren systematisch modernisieren. Wir sind sicher: Deutschland kann seine Probleme aus eigener Kraft lösen“, erklären SPD und Union im Koalitionsvertrag. Foto: BS/Pungu x, stock.adobe.com
Dreiklang ‚Entlastung, Digitalisierung, Entbürokratisierung‘ muss insbesondere auch für Planung, Genehmigung und Vergabe gelten“, heißt es in einem gemeinsamen Pressestatement von DStGB und HDB. Dr. André Berghegger, der Hauptgeschäftsführer des DStGB, ist dabei der Ansicht, dass der überwiegende Teil der vorgesehenen 100 Milliarden Euro direkt den Kommunen zur Verfügung gestellt werden sollte, denn vor Ort finde sich die Expertise: „In den Städten und Gemeinde kennt man die Bedarfe und deren Dringlichkeit. Hier braucht es
Im Koalitionsvertrag der grünschwarzen Regierung von 2021 wird das Gesetz erstmals erwähnt. Eigentlich hätte Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/ Die Grünen) es gerne schon 2023 auf den Weg gebracht. Doch durch Gegenwind aus den Reihen der CDU konnte das LMG erst Ende März 2025 verabschiedet werden. Im Zuge dessen wurden im vorherigen Jahr durch 21 Modell- und drei Vorreiterkommunen die wesentlichen Grundlagen für das Gesetz getestet. Mit den Instrumenten, die das neue Gesetz mit sich bringt, nimmt Baden-Württemberg in einigen Punkten eine bundesweite Vorreiterrolle ein. Einer dieser Punkte, und zugleich das zentrale Element des LMGs, ist der Mobilitätspass, mit dem Kommunen eine Abgabe für den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur erzielen können. Die Einführung einer solchen Abgabe ist für die Kommunen freiwillig. Allerdings ist sie an Mindestanforderungen für den ÖPNV geknüpft. Sie darf nur angeordnet werden, „wenn in dem von ihr vorgesehenen Abgabengebiet zu den gängigen Verkehrszeiten ein ausreichendes und nutzbares Angebot des ÖPNV zur Verfügung steht“, erklärt das baden-württembergische Verkehrsministerium. Zu wählen ist dann aus zwei Modellen, dem Einwohnerbeitrag und dem Kfz-Halterbeitrag. Diejenigen, die zur Kasse gebeten werden, bekommen im Gegenzug ein Mobilitätsguthaben, welches sie mit dem Kauf von ÖPNV-Tickets, wie dem Deutschlandticket, verrechnen können. Damit soll zum einen ein Anreiz zum Nutzen der öffentlichen Verkehrsstrukturen geschaffen werden und zum anderen können Kommunen das übrige Geld für die Erneuerung und den Ausbau ebenjener Strukturen einsetzen. Des Weiteren ist eine freiwillige und durch das Gesetz finanzierte Einsetzung von Radkoordinatorinnen und -koordinatoren vorgesehen, die Kommunen und Landkreise beim Ausbau von Radwegen unterstützen sollen. Auch der Einsatz von Scan-Fahrzeugen für eine effizientere Kontrolle von Falschparkenden wird durch das LMG ermöglicht. Zu guter Letzt werden mit dem Gesetz Vorgaben der EU und des Bundes umgesetzt, sodass zukünftig mehr saubere Fahrzeuge
keine Vorgabe von Bund oder Ländern, sondern mehr Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung“, so Dr. Berghegger. Für die Baubranche sei das Sondervermögen zuallererst ein „lang herbeigesehnte Absichtserklärung“, die Planungssicherheit bringen könnte, erklärt eine Sprecherin der HDB. Nun müssten die Mittel geordnet und schnell eingesetzt werden können – aber auch sie ist sich sicher, dass dies mit den bisherigen, langwierigen Planungsprozessen nicht möglich sei. Politik und Verwaltung müssten daher einen
Weg finden, bei der Planungszeit, gerade im Bereich des Ersatzneubaus von Brücken, ein Jahr nicht zu überschreiten. Dafür müssten Fristen und Verfahren verkürzt und Planungsschritte gestrichen werden. Dass die Politik dazu in der Lage sei, haben sie schon mit dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz gezeigt. Auch Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages (DST) ist ähnlicher Ansicht: „Je einfacher das Verfahren ist, desto schneller haben wir das Geld auf der Straße und die Menschen merken, dass etwas passiert.“ Neben dem Sondervermögen brauche es aber auch eine weitreichende Reform der Finanzordnung von Bund, Ländern und Kommunen. Denn das Rekorddefizit, in dem die Städte steckten, sei so hoch, dass die Kommunen es niemals aus eigener Kraft auffangen könnten. So könnte das Sondervermögen zwar einen Einbruch der kommunalen Investitionen verhindern, die strukturelle Schieflage der kommunalen Haushalte aber nicht beseitigen. Für Dedy ist klar: „Die Städte brauchen deshalb als ersten Schritt einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.“
Großer Bedarf in Kommunen Auf kommunaler Ebene, wo das Geld besonders dringend gebraucht wird, ist man sich ebenfalls einig. Ein schneller, unkomplizierter Weg
Was das neue LMG für Baden-Württembergs Kommunen bringt
(BS/Scarlett Lüsser) Vier Jahre hat das baden-württembergische Landesmobilitätsgesetz (LMG) gebraucht. Damit soll den Kommunen ein Werkzeugkasten an die Hand gegeben werden, um die ÖPNV-Infrastruktur zu verbessern und den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu unterstützen. Verkehrsminister Winfried Hermann zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden, aber wie stehen Verbände und Kommunen dazu?

Der Plan: Weniger Individualverkehr und mehr Geld zum Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur. Foto: BS/cmfotoworks, stock.adobe.com
für den ÖPNV angeschafft werden und mit MobiData BW stellt das Land ein IT-System für gesammelte Mobilitätsdaten offen zur Verfügung. Insgesamt soll das LMG vor allem Möglichkeiten eröffnen und keine Zwänge einführen, jedoch fragen sich besonders die Modellkommunen und Verbände, warum man dann nicht mehr Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat.
Stimmen der Kritik Ursprünglich getestet wurden nämlich zwei weitere Abgabemodelle, die viele der sich kritisch äußernden Stimmen bevorzugt hätten. Denn die ersten Gesetzes-
der Auszahlung muss her und der Großteil, der den Ländern versprochen wurde, sollte den Kommunen zugeführt werden. „Wie so viele Kommunen ist Kaiserslautern hoch verschuldet und schiebt daher einen Investitionsstau vor sich her“, erklärt ein Sprecher der Stadt. Um die Mittel schnellstmöglich nutzen zu können, schlägt er zweckgebundene Zuweisungen anstelle von aufwändigen Förderprogrammen vor. Vor Ort sollten den Kommunen dann freie Hand gelassen werden, um „Maßnahmen in der Reihenfolge anzugehen, wie sie baulich und personell für uns sinnvoll sind“.
Auch der Kieler Oberbürgermeister, Ulf Kämpfer, ist der Meinung, dass das Sondervermögen zwar enorm hilfreich sei, aber nicht ausreiche. Daher sei u. a. die Anpassung der Schuldenbremse ein Schritt in die richtige Richtung. Und für das Geld gäbe es in Kiel viele Einsatzmöglichkeiten, z. B. für den Neubau von Schulen und Kitas, aber auch die Hinterlandanbindung des Kieler Hafens, auch unter verteidigungspolitischen Aspekten. Auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und insbesondere der Bau der Kieler Stadtbahn würde damit in Angriff genommen werden, so Kämpfer

SCHWERPUNKT
entwürfe sahen neben den bereits genannten Modellen noch eine Arbeitgeberabgabe und eine CityMaut vor. Diese wurden jedoch auf Drängen der CDU aus dem endgültigen Gesetzesentwurf gestrichen. Dr. Frank Mentrup (SPD), Karlsruher Oberbürgermeister und Vorsitzende des baden-württembergischen Städtetags, zeigt sich darüber enttäuscht: „Mit der Streichung dieser Varianten können die beiden in ganz Europa erfolgreichsten Nahverkehrsabgabekonzepte nicht zur Anwendung kommen. Die Stadt Karlsruhe hat sich als Modellstadt mit viel Personalaufwand bei der Variante „Arbeitgeberabgabe“ engagiert und bedauert, dass diese Option nicht Teil des LMG geworden ist.“ Insgesamt bewertet er das in Kraft getretene Gesetz als nicht förderlich für die Verkehrswende im baden-württembergischen ÖPNV-Bereich. Bund und Länder würden zwar jährlich das Deutschlandticket finanzieren, weigerten sich aber, den ÖPNV-Betrieb selbst mitzufinanzieren. Dies habe zur Folge, dass dessen Qualität von Jahr zu Jahr abnehme. „Das LMG könnte mit dem Mobilitätspass eine kleine Teillösung bieten, bleibt aber durch die übrig gebliebenen Varianten leider zahnlos“, so Dr. Mentrup. Auch die Opposition ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, wie Landtagsabgeordneter Jan-Peter Röderer (SPD) erklärt. Laut ihm
habe das LMG zwei große Schwachstellen: Zum einen sei es immer noch gespickt mit bürokratischem Aufwand und Berichtspflichten, beispielsweise für die Busunternehmen, die saubere Fahrzeuge anschaffen wollen, aber auch in Form der Radkoordinatoren. Zum anderen sieht auch Röderer die Streichung der zusätzlichen Optionen für den Mobilitätspass als problematisch an. Kommunen „brauchen die Wahlfreiheit, um in ihrem Kontext den größten Nutzen für den ÖPNV und die größte verkehrslenkende Wirkung zu haben. So wird das LMG deshalb weder eine Lenkungswirkung im Ballungsraum noch im ländlichen Raum entfalten.“
Doch sollte mit dem LMG nicht nur die Mobilitätswende vorangebracht, sondern auch der Klimaschutz mitgedacht werden. Ist wenigstens das geglückt? Der Landesgeschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg, Martin Bachhofer, begrüßt das Gesetz zwar grundsätzlich, jedoch sei der Klimaschutz viel zu wenig mitgedacht worden. Zwar seien manche Maßnahmen wie Parkraumkontrolle und Radkoordinatoren ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch bleibe das LMG besonders bei seinen Zielen vage und unverbindlich. „Dass weder die fünf Klimaziele im Verkehr noch der in Aussicht gestellte Mindestbedienstandard im ÖPNV (Mobilitätsgarantie) den Weg ins LMG gefunden haben, zeigt die Ambitionslosigkeit dieses Gesetzes.“ Auch für Bachhofer hätten die weggefallenen Optionen das „größte Potential zur Verlagerung von Fahrten auf klimafreundlichere Verkehrsmittel“ gehabt.
Anfang April eröffnete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) in der Eifelgemeinde Simmerath die diesjährige Motorradsaison. Dabei verwies er noch einmal auf die kurz zuvor veröffentlichte Verkehrsunfallbilanz des Landes für das Jahr 2024. Aus dieser geht hervor, dass sich die Zahl der Motorradunfälle im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht hat (plus 11,8 Prozent) und die Zahl der tödlich Verunglückten von 58 auf 86 Personen gestiegen ist (plus 48 Prozent).
Unfälle meist durch Kradfahrer verursacht
Wider die Unvernunft auf deutschen Straßen
(BS/Lars Mahnke) Mit dem Wetterwechsel geht auch ein Wechsel bei den Herausforderungen in der Verkehrssicherheit einher. Holen die Kradfahrer bei den ersten warmen Sonnenstrahlen ihre Motorräder hervor, stellt die Poser- und Tuningszene sich und ihre aufgemotzten Autos traditionell am „Carfreitag“ zur Schau – illegale Straßenrennen inklusive.

erfasst, zahlreiche Fahrzeuge stillgelegt und mehrere Verstöße wegen erloschener Betriebserlaubnis festgestellt.
„Das letzte Jahr war kein gutes für die Motorradcommunity. Das sind leider unsere Sorgenkinder im Straßenverkehr geworden“, bilanzierte der Innenminister und wandte sich mit mahnenden Worten an die Anwesenden. Denn die Mehrheit der getöteten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer hatte den Unfall selbst verschuldet. Die Devise müsse daher lauten: „Drosseln statt rasen.“ Vor allem nach der langen Winterpause seien viele Fahrerinnen und Fahrer wieder ungeübt und die Maschinen sollten in jedem Fall einem Frühjahrscheck unterzogen werden. Neben dem Appell zur Eigenverantwortung kündigte Reul eine verstärkte Polizeipräsenz auf beliebten Motorradstrecken an. Auch der ADAC warnt: Wer seine Maschine und Ausrüstung nicht richtig vorbereite, riskiere unnötige Gefahren. Einen wichtigen Appell richtet der Automobilclub auch an Autofahrerinnen und Autofahrer: Sie müssten sich zum Saisonbeginn wieder an das erhöhte Motorradaufkommen gewöhnen. Gerade beim Überholen, Abbiegen oder Spurwechsel ist besondere Aufmerksamkeit gefragt, um Motorräder nicht zu übersehen. Die Geschwindigkeit von Zweirädern wird oft unterschätzt – ein gefährlicher Fehler. Gegenseitige Rücksichtnahme bleibt daher entscheidend, um schwere Unfälle zu verhindern.
Die Tuner-Szene geht mit ihren Umbauten gerne an die Grenze des Erlaubten, weshalb die Polizei bei Kontrollen ein genaues Auge auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge hat.
stock.adobe.com
baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Vorfeld der Maßnahmen. In Nordrhein-Westfalen wurden fast 3.000 Ordnungswidrigkeiten angezeigt und über 4.000 Verwarngelder ausgesprochen. In Dortmund kontrollierten Polizei und Stadt dutzende Fahrzeuge und Personen – zwei Autos wurden sichergestellt, 769 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Ein Fahrer war sogar doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Großflächige Einsätze in Bundesländern
Im Harz, ebenfalls ein beliebter Szenetreff, überprüfte die Polizei 400 Fahrzeuge – mit 123 Beanstandungen, darunter Alkohol- und Drogenfahrten sowie Fahrten ohne Fahrerlaubnis. Die Behörden betonen: Nicht das Tuning an sich sei das Problem, sondern unsachgemäße Umbauten und gefährliches Verhalten. In Mecklenburg-Vorpommern blieb der „Carfreitag“ aus Sicht der Polizei überwiegend ruhig. Zwar wurden bei einem Treffen in Stralsund rund 250 Fahrzeuge gezählt, doch nur vereinzelte Verstöße registriert. In Pasewalk entkam ein Fahrer einer Kontrolle – gegen ihn wird nun wegen eines illegalen Rennens ermittelt.
Alle angefragten Städte nehmen bei der Einordnung abgestellter Gegenstände und Kisten grundsätzlich Einzelfallfallbewertungen vor. So verweist z. B. Münster darauf, dass das Ordnungsamt prüft, ob eine Kiste ein Problem oder sogar eine Gefahr darstellt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen veranlasst. Zwar seien keine Problemmeldungen oder Beschwerden bekannt, jedoch fordere die Stadt Münster in einem solchen Fall den Aufsteller auf, die Kiste zu beseitigen. In Duisburg betrachtet man die Kisten nicht als Problem, „solange diese den öffentlich Raum nicht behindern und eine Verunreinigung der Straßen und Anlagen ausge schlossen ist“. Doch ist dort durch aus das Problem bekannt, dass fremde Gegenstände dazugestellt werden und auf diese Weise Müllab lagerungen entstehen. Diese wür den wie eine „wilde Kippe“ gewertet und gegen den Verursacher – sofern ausfindig zu machen – ein Bußgeld verfahren eingeleitet. Grundsätzlich könnten Verwarnungsgelder bis 55 Euro sowie Bußgelder ab 100 Euro erhoben werden.
Drohende Bußgelder
Während die Kradfahrer mit mahnenden Worten und dem Appell an die Vernunft in die neue Saison starteten, fällt die Tuner- und Raser-Szene traditionell am „Carfreitag“ eher mit Unvernunft und Imponiergehabe auf. Doch die Polizei behält den nicht ganz so ruhigen Feiertag der Raser- und Poserszene im Auge: Auch in diesem Jahr
Foto: BS/Q
fanden am Karfreitag gezielte bundesweite Polizeikontrollen statt, um gegen illegale Umbauten, gefährliches Imponiergehabe auf öffentlichen Straßen und illegale Autorennen vorzugehen.
Rund um das Osterwochenende kommt es traditionell zu unerlaubten Fahrzeugrennen und auffälligen Fahrmanövern. Bereits zum vierten Mal beteiligte sich etwa die Polizei Baden-Württemberg an der groß angelegten Kontrollaktion. „Posing und illegales Tuning ist nicht nur ohrenbetäubend, es gefährdet auch den Straßenverkehr und verunsichert viele Menschen“, erklärte der
Baden-Württemberg meldete mit über 15.000 kontrollierten Fahrzeugen landesweit einen der größten Einsätze. Über 6.600 Verstöße wurden registriert, mehr als 1.200 Fahrzeuge mussten aus dem Verkehr gezogen werden. In Städten wie Mannheim und Heilbronn wurden illegale Rennen aufgedeckt, Führerscheine entzogen und Fahrzeuge beschlagnahmt. Auch Bayern verzeichnete mit über 100 festgestellten Verstößen einen aktiven Kontrolltag. Neun Fahrverbote wurden ausgesprochen, mehrere Autos wegen technischer Mängel stillgelegt. Registriert wurden zudem 115 Fälle von überhöhter Geschwindigkeit. In Rheinland-Pfalz konzentrierten sich die Kontrollen besonders auf den Nürburgring, einen traditionellen Treffpunkt der Szene. Es wurden mehr als 1.100 Temposünder
Von der schönen Idee zum lästigen Ärgernis
(BS/Lars Mahnke) „Zu-verschenken“-Boxen wandeln sich immer öfter von einem gut gemeinten Angebot zu einer Müllentsorgungsalternative. Gerade jetzt, zur Zeit des Frühjahrsputzes, landen die Kisten mit überflüssigen und aussortierten Gegenständen häufig auf dem Gehweg. Der Behörden Spiegel hat exemplarisch bei fünf Kommunalverwaltungen nachgefragt, wie sie mit dem Phänomen umgehen.




In Freiburg sieht die Verwaltung die „Zu-verschenken“-Boxen nicht gerne im öffentlichen Raum, „da diese erfahrungsgemäß nicht dauerhaft betreut und häufig weitere Gegenstände dazugestellt werden“. Daher fordert die Stadt dazu auf, die Kisten nur an trockenen Tagen und auf privatem Gelände aufzustellen. Zudem sollten sie am Abend wieder hereingeholt werden. Denn sollten sich daraus wilde Müllablagerungen entwickeln, drohen den Verursachern saftige Bußgelder: Während für Objekte, die als solche eingestuft werden, bis zu 500 Euro fällig werden, liegt die Spanne bei Gegen-
„Karfreitag ist Kontrolltag“ Polizei und Politik betonen die Differenzierung innerhalb der Szene: Während Tuner oft großen Wert auf technisch aufwendige, aber legale Umbauten legten, zielten Poser auf auffälliges Verhalten im Straßenverkehr. Raser dagegen gefährdeten durch illegale Rennen oder hohe Geschwindigkeiten direkt die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Diese Differenzierung soll künftig noch stärker in die Kontrollstrategien einfließen.
Herbert Reul stellte klar: „Karfreitag ist Kontrolltag – Sicherheit hat Vorfahrt.“ Thomas Strobl betonte, dass gefährliches Posing und illegales Tuning nicht nur störend seien, sondern auch eine reale Gefahr für die Allgemeinheit darstellten. Auch Staatssekretär Klaus Zimmermann (Sachsen-Anhalt) forderte ein konsequentes Vorgehen bei unsachgemäßen Umbauten.
Bußgeldkatalog Umweltschutz, den das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 2017 herausgegeben hat.


Was als nachhaltige Idee zur Müllvermeidung begann, fördert mancherorts eher die Vermüllung des öffentlichen Raums. Inzwischen machen sich die Verschenker nicht einmal mehr die Mühe, ihre „Geschenke“ mit einem Schild zu kennzeichnen. Foto: BS/Mahnke
ständen wie Elektro- und Elektroaltgeräten bei 50 bis 2.500 Euro. Auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kennt das Problem. Kartons mit „Zu-verschenken“-Aufschrift würden dort häufig abgestellt. Das Amt macht darauf aufmerksam, dass es sich dabei jedoch um einen Verstoß gegen das Straßenreinigungsgesetz handele. In solchen Fällen werde versucht, die Verursacherinnen und Verursacher zu ermitteln. Zwar gelinge dies nicht immer, aber würden Bürgerinnen und Bürger bei der Meldung von unschönen Ansammlungen gelegentlich Hinweise liefern, die zu dem ursprünglichen Eigentümer führten. Der Bezirk ahnde derartige Vergehen konsequent mit Buß-
geldern. Bei der Höhe richte man sich nach den Umständen, wie der Inanspruchnahme von Flächen und gegebenenfalls einer sich bildenden Vermüllung der Örtlichkeit. In der Regel beliefen sich diese auf mehrere hundert Euro.
Auch in Leipzig betrachtet man die Entwicklung mit Skepsis, denn: „Mitunter gewinnt man dabei den Eindruck, dass durch eine solche Handlungsweise eine einfache Entsorgung von Sperrmüll erfolgen sollte.“ Man stelle durchaus einen Trend fest, dass zunehmend unbrauchbare Altwaren als vermeintliche Geschenke entsorgt würden. Zwar stehe man der Grundidee, gebrauchte Gegenstände weiterzugeben, positiv gegenüber. Doch
blieben die abgelegten Gegenstände häufig liegen und die Geschenkekisten verwahrlosten mit der Zeit aufgrund von Wettereinflüssen und Vandalismus. Die Stadt verweist auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz und den Paragrafen 3, 28 Abs. 1 Satz 1 in Verbund mit dem Paragrafen 69 Abs. 1 Nr. 2. Die Praxis erfülle den Tatbestand der unzulässigen Lagerung beziehungsweise Ablagerung von Abfällen. Demnach können Geldbußen von fünf bis 100.000 Euro verhängt werden. Die Stadt stuft den „Entledigungswillen“ des „Verschenkers“ grundsätzlich als vorrangig ein, was den Vorgang zu einem abfallrechtlichen Sachverhalt macht. Sie beruft sich dabei auf den
Sondernutzung erfordert Erlaubnis Die Stadtverwaltung Leipzig betont, „dass im Falle des Herausstellens der Verschenkekisten in den Bereich der öffentlichen Straße auch dann eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn der Sachverhalt nicht abfallrechtlich betrachtet werden würde“. Da durch die Nutzung eines Teils der Straße ohne dass eine Genehmigung der Behörde vorliegt, der öffentliche Raum dem Gemeingebrauch entzogen würde, liege eine unerlaubte Sondernutzung vor. Um eine solche Kiste mehrere Tage am Straßenrand stehen lassen zu dürfen, müssten Bürgerinnen und Bürger beim Ordnungsamt einen Sondernutzungsantrag stellen. Für das Aufstellen einer Kiste können dann gegebenenfalls Gebühren erhoben werden. Um Probleme und Kosten zu vermeiden, empfiehlt Leipzig daher, legale Alternativen wie Tausch- und Verschenkemärkte zu nutzen. So betreibe der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig mit „Täglich rausgeputzt – unser Laden fürs Beraten“ einen Beratungs- und Serviceladen, bei dem auch nicht mehr benötigte Dinge abgegeben und getauscht werden könnten.
Auch Freiburg verweist auf die Möglichkeit, unliebsam gewordene Gegenstände an soziale Einrichtungen abzugeben. Dafür gebe es in Freiburg „viele tolle Initiativen“ wie „die gut gepflegten öffentlichen Bücherschränke oder den Verschenkmarkt der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg“. Diese planten noch in diesem Jahr die Eröffnung eines Gebrauchtwarenkaufhauses.
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Mai 2025


www.behoerdenspiegel.de
(BS/Anna Ströbele) Im Kontext der Verwaltungsdigitalisierung wird der Datenschutz allzu oft als Bremse verstanden. Dann heißt es, die gleiche IT-Lösung werde von den 17 Datenschutzbehörden einzeln geprüft – im schlimmsten Fall mit 17 unterschiedlichen Ergebnissen. Die neue Koalition hat nun eine Reform der Aufsicht versprochen. Wird so das Ziel eines einheitlichen und einfacheren Datenschutzes erreicht? Und welche anderen Wege gibt es?
„DieRisiken für die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger sind bei allen Projekten der Verwaltungsdigitalisierung frühzeitig in den Blick zu nehmen“, betont die Berliner Datenschutzbeauftragte und diesjährige Vorsitzende der Datenschutzkonferenz (DSK), Meike Kamp. Auch für Regina Mühlich und Thomas Spaeing, Vorstandsmitglied bzw. Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V., ist klar: Der Datenschutz muss in der Verwaltungsdigitalisierung von Anfang an mitgedacht und als Qualitätsmerkmal verstanden werden. Denn er sei kein Hemmschuh, sondern „Garant für Vertrauen, Transparenz und Rechtssicherheit“. Um dies zu gewährleisten, brauche es klare Zuständigkeiten und einheitliche Standards. Doch wie können diese erreicht werden?
Der BvD befürwortet zum Beispiel die einheitliche datenschutzrechtliche Bewertung zentraler Komponenten von EfA-Lösungen, also solcher Verwaltungsleistungen, die über das „Einer für alle“-Prinzip (EfA) von einer Behörde entwickelt und anderen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. Die DSK hat dieses Potenzial ebenso erkannt: „Wir setzen uns innerhalb der Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder dafür ein, einheitliche Prüfstandards für länderübergreifende Online-Dienste nach dem Onlinezugangsgesetz zu entwickeln“, erklärt Kamp. Als Reaktion auf die Koalitionsverhandlungen empfahl die DSK in einem Statement zudem die Ausweitung des EfA-Prinzips auf die Datenschutzbehörden, um sich die Arbeit effizient aufzuteilen. Das Ergebnis der Prüfung von länderübergreifend
„Wir setzen uns dafür ein, einheitliche Prüfstandards für länderübgreifende Online-Dienste nach dem OZG zu entwickeln.“
Meike Kamp, 2025 Vorsitzende de Datenschutzkonferenz
eingesetzten Verfahren durch eine Landesbehörde soll die anderen Behörden demnach binden.
Die Experten sind sich also einig: Datenschützer müssen früh eingebunden und Standards etabliert werden. Das große Ziel ist mehr Einheit und Effizienz im Datenschutz. Die Reformpläne der neuen Regierung gehen jedoch vielen zu weit. Was die Koalition ändern will CDU, CSU und SPD wollen laut Koalitionsvertrag die Aufsicht über die Privatwirtschaft bei der Bundesdatenschutzbehörde (BfDI) bündeln. Bislang sind die Landesbehörden für die Aufsicht über Unternehmen in ihrer Region zuständig. Die BfDI beaufsichtigt einige bundesweit tätige Wirtschaftsunternehmen mit datengetriebenen Geschäftsmodellen und unterschiedlichen Standorten, beispielsweise Telekommunikations- und Postdienste. Während die aktuelle BfDI, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, grundsätzlich zur Übernahme der neuen Verantwortung bereit ist, gibt es in den Ländern Widerstände: Bettina Gayk, die Datenschutzbeauftragte
von NRW, verweist auf die guten Kontakte, welche die Landesbehörden über die Jahre aufgebaut hätten und die zu „schnellen und praxisnahen Lösungen“ führten. Mit einer zentralen Aufsicht beim Bund würden Bürger und Unternehmen die „leicht zugängliche Beratung“ verlieren. Auch der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz, Prof. Dr. Tobias Keber, hält die Bündelung für den „falschen Weg“ und erklärt, dass dezentrale Aufsichtsstrukturen die Resilienz sicherten.
Die DSK befürwortet zwar eine zentrale Datenschutzbehörde als Ansprechpartnerin – jedoch nur für „länderübergreifende Sachverhalte“, etwa bei Forschungsprojekten oder bei Konzernen mit mehreren Standorten. Eine bessere Lösung sehen Keber und seine Kollegen darin, die Datenschutzkonferenz zu stärken, um ein kohärenteres Vorgehen zu ermöglichen. Immerhin: Dieser Vorschlag hat es ebenso in den Koalitionsvertrag geschafft.
Die Rolle der DSK „Die Datenschutzkonferenz verankern wir im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), um gemeinsame Standards zu erarbeiten“, heißt es im Dokument der drei Parteien. Doch welche Vorteile würde dieser Schritt tatsächlich bringen? BvDVorstandsmitglied Regina Mühlich ist überzeugt: „Eine gesetzlich verankerte Datenschutzkonferenz könnte wesentlich zur Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht in Deutschland beitragen.“ Die DSK könnte eine abgestimmte Auslegung der Vorgaben fördern und damit für mehr Rechtsklarheit sorgen. Außerdem könnte die Position der deutschen Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene gestärkt werden. Die aktuelle
Vorsitzende der DSK, Kamp, glaubt, die Institutionalisierung trage der Bedeutung des Gremiums Rechnung und könne seine Reichweite ausbauen. Es gibt aber ein weiteres Anliegen: die Einrichtung einer Geschäftsstelle in der DSK. Bisher rotiert der Vorsitz jährlich, was insbesondere kleinere Aufsichtsbehörden vor Herausforderungen stelle.
Der Berliner Weg Aus Berlin kommt derweil ein anderer Ansatz für mehr Einheitlichkeit im Datenschutz. Unter Leitung von Dr. Claudia Federrath wurde ein Standardprozess entwickelt, welcher der Verwaltung helfe, „Datenschutzrisiken bei der Digitalisierung selbst frühzeitig erkennen und minimieren zu können“. Die Datenschutzprüfung werde in den ohnehin verpflichtend zu durchlaufenden Prozess eingebettet – Schritt für Schritt und mit konkreten Anforderungen. „So kann verhindert werden, dass nachträgliche Anpassungen notwendig werden, die zu Verzögerungen bei
„Mit dem Standardprozess können Verwaltungen Datenschutzrisiken bei der Digitalisierung selbst frühzeitig erkennen und minimieren.“
Dr. Claudia Federrath, Abteilungsleiterin bei der Berliner Datenschutzbeauftragten







der Umsetzung führen“, erläutert die Abteilungsleiterin der Berliner Datenschutzbehörde. Der Standardprozess wurde im Herbst 2024 veröffentlicht und wird gerade in der Praxis erprobt. Die Berliner gehen davon aus, dass er auch von anderen Ländern genutzt werden könnte. Die dort betrachteten Datenschutzanforderungen würden schließlich in allen Ländern gleichermaßen gelten. „Wichtig erscheint uns, dass die Prozesse der Verwaltungsdigitalisierung möglichst standardisiert erfolgen, damit sich auch die Datenschutzprüfungen daran anlehnen können“, bekräftigt Federrath Schwer vereinbare Regelungen Ein weiteres Spannungsfeld liegt in der Vereinbarkeit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit neuen EU-Digitalverordnungen wie dem Data Act oder dem AI Act. Kamp kritisiert, dass die DSGVO in manchen Punkten mit den neuen Rechtsakten „schwer vereinbar“ sei. Beispielsweise kollidiere das Recht von Betroffenen auf Löschung von Daten mit der technischen Realität von KI-Mode-llen. Die Berliner Datenschutzbeauftragte spricht sich für die Schaffung von Synergien aus, etwa durch die Zusammenfassung von Meldepflichten, z. B. der NIS2-Richtlinie und der DSGVO. Mühlich und Spaeing zufolge braucht es eine klare Abgrenzung der Anwendungsbereiche, konsistente Begriffsdefinitionen sowie einen strukturierten Austausch zwischen Datenschutzbehörden, Gesetzgebern und der Fachöffentlichkeit. Die Debatte ist angestoßen – ob die DSK künftig an Bedeutung gewinnt, die Koalition ihre Bündelungspläne umsetzt oder andere Länder das Berliner Modell übernehmen, wird sich zeigen.
Das kleine Symbol im App-Store entspricht schon mal dem designtechnischen Zeitgeist: Eine minimalistische blaue Linie zeigt einen Dom. Es ist der Dom St. Peter und das Wahrzeichen der Stadt, um die es geht: Worms. Die kreisfreie Stadt im Südosten von Rheinland-Pfalz, bekannt für die Nibelungen-Sage, konkurriert mit Trier, Augsburg und Kempten um den Titel „älteste Stadt Deutschlands“. Wichtiger für Worms und andere deutsche Kommunen scheint jedoch der Blick in die Zukunft zu sein, der in digitalen Zeiten davon geprägt ist, nicht den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu verlieren. Wie sich dieser Kontakt verbessern lässt, ist theoretisch auch klar: per App. Immer mehr kommunale Apps setzen diese Theorie in die Praxis um und machen über ihre Stadt- und Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam – etwa die Heimat-InfoApp oder die App DorfFunk, welche gleich für eine ganze Reihe von Gemeinden funktionieren.
Kaninchenbau mit Notausgang Kommunen wie Worms legen nun mit einer individualisierteren Variante nach. Die City-App Worms ist in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar. Eine Registrierung ist nicht notwendig, wobei das anschließende Anlegen eines individuellen Profils eine Option ist und für Userinnen und User, die die App regelmäßig zu nutzen gedenken, Sinn macht. Die Startseite zeigt ein idyllisches Foto mit dem Titel „Unser Worms“ – ein bisschen Stadtgeschichte und Kultur als Intro. Gleich darunter repräsentieren unterschiedliche Symbole die urbanen Kategorien. Das erste Symbol zeigt ein Krankenhaus, die Kategorie heißt „Städtische …“ – das Wort ist zu lang,
RIWA begleitet Städte und Gemeinden auf diesem Weg. Der digitale Zwilling ist mehr als nur ein digitales Abbild – er ist ein funktionales Werkzeug, das Daten aus unterschiedlichsten Quellen bündelt. Geodaten, Fachinformationen, Live-Sensordaten oder Planungsstände fließen in ein virtuelles 3D-Modell ein, das Planungs-, Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse wirksam unterstützt.
Diese Modelle lassen sich gezielt auf verschiedene Zielgruppen anpassen: In der Verwaltung dient der digitale Zwilling als Arbeitsgrundlage für Fachbereiche wie Stadtplanung, Bauverwaltung oder Umweltwesen. Damit lassen sich Infrastrukturen analysieren, Maßnahmen simulieren oder Verkehrsflüsse nachvollziehen – mit realitätsnaher Visualisierung und datenbasiertem Zugriff. Kommunalpolitische Gremien erhalten eine für sie aufbereitete Sicht und können geplante Vorhaben anschaulich nachvollziehen. Das erleichtert die Abstimmung mit der Verwaltung und verbessert die Grundlage für Entscheidungen. Darüber hinaus wird der digitale Zwilling in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Bürgerinnen und Bürger erhalten auf einer intuitiv bedienbaren Plattform Einblick in laufende Planungen, können sich informieren oder aktiv beteiligen. Das schafft Vertrauen, fördert Transparenz und stärkt die Beteiligung – ein Aspekt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein digitaler Zwilling rechnet sich nicht nur für Großstädte. Dank modularer Konzepte und skalier-
Kommunale Apps als digitaler Bürgerservice
(BS/cb) Viele der beliebtesten Apps sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie für einen spezifischen Lebensbereich perfektioniert sind: Kommunikation, Mobilität, Kultur – um nur drei zu nennen. Kommunen stehen da vor ganz anderen Herausforderungen. Kommunale Apps müssen nicht nur digitalisierte Verwaltungsleistungen nutzerfreundlich ins Smartphone-Format packen, sondern das ganze Spektrum ihres Ortes abbilden. Eine der ältesten Städte Deutschlands zeigt, dass dies machbar ist.

Historische Hintergründe, moderne Dienstleistungen und hohe IT-Sicherheit – kommunale Apps wie die City-App Worms müssen viele unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Screenshot: BS/Brecht
um ganz sichtbar zu sein. Ein Klick auf „Alles ansehen“ bringt die Erklärung: „Städtische Dienstleistungen“, der direkte Draht zur Verwaltung. Hier warten acht Unterkategorien an kommunalen Dienstleistungen. Neben „News“, einem „Mängelmelder“ oder dem Punkt „Bürgerbeteiligung“ steht eine Kategorie ganz oben: „Bürgerservice“. Hier wiederum können die gewünschten Verwaltungsservices in eine Suchleiste eingegeben,
Termine online gebucht und sich um die Kfz-Zulassung gekümmert werden.
Unter „Online-Dienste der Stadt Worms“ finden sich dann alle digitalen Verwaltungsleistungen in der Übersicht – von „Abfallkalender“ bis „Wohnsitz anmelden“. Ein Klick auf die einzelnen Leistungen bringt einen tiefer in die Verzweigungen des Kaninchenbaus der Kommunalverwaltung. Die Bestellung der Geburtsurkunde etwa erfordert eine Datenschutzeinwilligung, gefolgt von der Art der Authentifizierung, wobei die BundID und Mein Unternehmenskonto zur Auswahl stehen. Ebenso können die nachfolgenden personenbezogenen Daten ohne Anmeldung eingegeben werden. Für einen anderen Service, die Online-Beantragung des Bürgergelds, landen User auf einer Unterseite der Bundesagentur für Arbeit. Nicht immer gelangt man schrittweise zurück zu jedem Untermenü, doch das kleine X oben rechts dient als permanenter Notausgang: Ein Klick darauf und es erscheinen wieder die acht städtischen Dienstleistungen. Perfekt ist die Menüführung (noch) nicht, angesichts der verwaltungsimmanenten Menge an Services aber bemerkenswert intuitiv.
Alle Stakeholder an Bord Finanziert wird die City-App Worms mit Mitteln des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige
Innenstädte und Zentren“, welches das Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) umsetzt.
Der Ausgangspunkt für die App sei ein Arbeitskreis der Stadt Worms im Jahr 2021 gewesen, erklärt die städtische Projektleiterin Heike Landwehr. Dieser Arbeitskreis habe sich schlicht mit der Frage beschäftigt, wie die Stadt attraktiver werden könne. Eine Bedarfsanalyse sei dann 2023 gestartet – mit nahezu „allen Public Stakeholdern der Stadt: IHK, Hochschule, Energieversorger, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing e.V., IT, Datenschutz und IT-Sicherheit“ und mehr, so Landwehr Zusätzlich hätten in dieser Phase Workshops mit dem Einzelhandel stattgefunden.
Verwaltung allein kein Erfolg
Die technische Umsetzung der App übernimmt das SoftwareUnternehmen KOBIL GmbH, das seinen Sitz ebenfalls in Worms hat. Zusätzlich zur lokalen Nähe kann KOBIL internationale Erfahrungswerte vorweisen. Seit drei Jahren ist die App in der türkischen Metropole Istanbul im Einsatz und verzeichnet dort rund fünf Millionen Userinnen und User. KOBILGründer und CEO Ismet Koyun hat genaue Vorstellungen, worauf es ankommt. Eine App nur für Ver-
Digitaler Zwilling für Kommunen jeglicher Größenordnung
(BS) Die digitale Transformation stellt Kommunen vor zahlreiche Herausforderungen: vom demografischen Wandel über begrenzte personelle Ressourcen bis hin zu komplexer werdenden Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig bieten neue Technologien wie der digitale Zwilling konkrete Chancen, Verwaltungsarbeit effizienter, transparenter und bürgernäher zu gestalten.

Ein digitaler Zwilling rechnet sich nicht nur für Großstädte, wie etwa das Beispiel aus Schwandorf im Regierungsbezirk Oberpfalz (Bayern) zeigt. Foto: BS/RIWA
barer Lizenzmodelle ist er auch für kleinere Kommunen wirtschaftlich realisierbar. Die Investition orientiert sich an der Einwohnerzahl und am gewünschten Funktionsumfang – aber vor allem an den individuellen Anforderungen. Während im ländlichen Raum beispielsweise die Optimierung von Durchfahrtsregelungen oder der Schutz vor Hochwasser im Vordergrund steht, beschäftigen sich urbane Regionen eher mit Ver-
kehrslenkung oder Hitzevorsorge.
Datengetriebene Entscheidungsfindung
In der Stadt Schwandorf etwa war bereits eine Vielzahl von Sensoren im Einsatz – gesucht wurde jedoch eine Lösung, um die Daten strukturiert zu bündeln, zu analysieren und anschaulich zu visualisieren. Der digitale Zwilling schafft hier den entscheidenden Mehrwert, indem er eine zentrale Plattform
für die datengetriebene Entscheidungsfindung bietet. In Forchheim wiederum liegt der Schwerpunkt auf der Visualisierung städtebaulicher Entwicklungen und einer aktiven Bürgerbeteiligung. Mithilfe von 3DModellen – zum Beispiel bei der Planung eines neuen Kindergartens – können Gemeinderäte und Bürger frühzeitig ein realistisches Bild vom künftigen Stadtbild gewinnen und aktiv mitwirken.
waltungsdienstleistungen werde niemals erfolgreich sein, ist sich Unternehmengründer Koyun sicher. Was es brauche, sei eine App für alles – eine Super-App. Leiser Go-Live, Launch im Mai Die erste Version der City-App Worms steht seit Januar 2025 zum Download bereit. Aktuell ist dies als „Silent Go-Live“ der Fall, also noch nicht öffentlich gemacht. Parallel zur weiteren Entwicklung finden Tests statt. Ein „Herausstellungsmerkmal“ der Applikation solle „in Zeiten einer Bedrohung unserer Cyber-Sicherheit“ nämlich deren Sicherheit sein, bekräftigt Landwehr – zusätzlich dazu, dass die App „interessante Angebote und Mehrwerte“ zu Themen wie Energie, Umwelt, Freizeit, Mobilität oder Bildung in sich vereinen soll. Der öffentliche Launch ist für Mai 2025 geplant. Auch vor dem offiziellen Start lägen die Downloads derzeit bei „über 500“, so Landwehr, was die Projektleiterin als ersten Erfolg verbucht. Wie sehr die Wormserinnen und Wormser die Angebote der Stadt und insbesondere deren Verwaltungsleistungen nutzen werden und ob dies das Verhältnis zwischen Kommune und Bürgern signifikant verbessert, bleibt mit Spannung abzuwarten.

SCHWERPUNKT
ADVERTORIAL
Gleichzeitig dient der digitale Zwilling als Plattform zur Vermarktung innerstädtischer Leerstände. Integration Künstlicher Intelligenz Ein weiteres Zukunftsthema, das konsequent mitgedacht wird, ist die Integration Künstlicher Intelligenz. Durch KI eröffnen sich neue Möglichkeiten im Umgang mit kommunalen Daten – etwa bei der Analyse großer Datenmengen, der Mustererkennung oder durch sprach- und textbasierte Abfragen. So wird ein digitaler Zwilling künftig beispielsweise alle südlich ausgerichteten Dächer in einem Stadtviertel erkennen, denkmalgeschützte Gebäude automatisch ausklammern und das Solarpotenzial berechnen – innerhalb weniger Sekunden.
Mit all diesen Möglichkeiten wird der digitale Zwilling zu einem zentralen Baustein moderner Kommunalentwicklung. Er verbindet Fachwissen, Technologie und Beteiligung zu einem Gesamtsystem, das nicht nur die Verwaltung, sondern auch Politik und Bürgerschaft stärker vernetzt. Es ist entscheidend, dass Kommunen –unabhängig von Größe oder Standort – beim Eintritt in diese digitale Realität unterstützt werden: mit erprobten Lösungen, praxistauglichen Modellen und echtem Verständnis für die Herausforderungen vor Ort.
wurde die Initiative von Frederik Just. Er ist Abteilungsleiter Zentrale Services bei der ZITiS. „Ende 2023, Anfang 2024 ist die Idee gereift, diese Art Netzwerk zu bilden“, erzählt er. Angetrieben habe ihn die über verschiedene berufliche Stationen auf Landesund Bundesebene gereifte Erkenntnis, dass es bei vielen Behörden „Leuchttürme“ gebe. Gemeint sind Verwaltungsinnovationen, die es verdienen, nachgeahmt zu werden. Gleichzeitig gebe es eine große Bereitschaft öffentlicher Stellen, sich gegenseitig zu unterstützen. Nach Konzeptplanungen innerhalb der ZITiS wurde für Mitte Januar 2025 zum ersten Treffen eingeladen. Dabei habe man sich insbesondere an Führungskräfte sowie Mitarbeitende im gehobenen und höheren Dienst gewandt, die mögliche Erkenntnisse anschließend in ihre Behörden und Abteilungen tragen können.
BMI & Friends
Das erste Präsenztreffen zum Start des Netzwerks fand in München statt. Mit von der Partie waren unter anderem Angehörige des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) und Beschäftigte aus Behörden in dessen Geschäftsbereich, z. B. aus dem Bundeskriminalamt (BKA), der Bundespolizei (BPOL) und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie von der Deutschen Bahn und der Landeshauptstadt München.Just zeigte sich zufrieden, dass viele Behörden Vertreterinnen und Vertreter zu diesem Event entsandt hätten. Schließlich bestehen hohe Erwartungen der Teilnehmenden selbst und ihrer Führungskräfte, dass bei den Treffen konkrete
MoVe-Netzwerk möchte die Verwaltung von morgen gestalten
(BS/Paul Schubert) Wie kann die Verwaltung in Zukunft aussehen? Im neu gegründeten MoVe-Netzwerk, initiiert von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS), tauschen sich Mitarbeitende aus verschiedenen Behörden und Organisationen über Best Practices aus. Das Anfang dieses Jahres gestartete Verknüpfungsformat soll helfen, Behördenmitarbeitende auf Bundes- und Landesebene sowie der kommunalen Ebene und in Staatsbetrieben besser zu vernetzen. Die ersten Projektideen sind bereits in Arbeit.

Höhepunkt des ersten Präsenztreffens des neuen ZITiS-Netzwerks in München: die „Transformers Night“ Foto: BS/ZITiS
Ergebnisse erarbeitet würden: „Es zeugt vom Vertrauen und der Chancenorientierung der Führungskräfte, den eigenen Teammitgliedern die aktive Teilnahme am Netzwerk zu ermöglichen“, so der Abteilungsleiter.
Talentpool und Kleinanzeigen Mit dabei war auch Nicole Müller vom BSI. Die Strategiereferentin der Abteilung Z (Zentrale Aufgaben) nahm gemeinsam mit einer Kollegin aus der Personalentwicklung am Event teil. Ihr Ziel war es, Impulse aus der Praxis mitzunehmen – sie fand es positiv, über Behördengrenzen hinweg arbeiten zu können. Auch intern gab es eine Vorbereitung: In einem Miniworkshop wurde geklärt, welche Themen für das Netzwerktreffen besonders relevant sein könnten.
Das eigentliche Netzwerktreffen
Über kurz oder Lang
wurde – neben der Bestandsaufnahme und lockerem Austausch –mit einer „Transformers Night“ abgeschlossen. Zuvor wurden spezifische Ideen in Workshopformaten entwickelt, berichtet Just von der ZITiS. Spannende Ideen waren zum Beispiel ein behördenübergreifender Talentpool und eine „Kleinanzeigenbörse für Verwaltungsaufgaben und -innovationen“. Der behördenübergreifende Talentpool überzeugte Strategiereferentin Müller am meisten: „Eine übergreifende Plattform zu entwickeln, um identifizierte Talente gezielt in die Verwaltung zu bringen, ist auch für das BSI strategisch enorm wertvoll: Wir könnten so selbst schneller auf Fachkräfte zugreifen und gleichzeitig Talente mit spezifischen Anforderungen, für die wir aktuell keine Verwendung anbieten können, gezielt dort hinbringen, wo eben ge-
Wie werden wir digital souverän?
In kaum einer Sache sind wir uns im politischen Europa momentan so einig wie in dieser: Wir müssen souveräner werden. Also irgendwie unabhängiger vom militärischen Schutz der USA, nicht mehr angewiesen auf Öl aus Russland oder Technologie aus China. Nun bin ich weder Verteidigungs-, noch Wirtschaftsexpertin. Mein Steckenpferd ist der digitale Raum. Aber auch in diesemsind wir weder als EU geschweige denn als Bundesrepublik annähernd souverän. Und das, obwohl die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass es dringend Zeit ist, etwas zu ändern. Hier sind deshalb einige Vorschläge, die uns als Staat und Verwaltung nicht nur kurzfristig souveräner, sondern auch langfristig selbstbewusster machen: Klären wir zunächst, was „digitale Souveränität“ eigentlich ist: Sie bezeichnet die Fähigkeit, selbstbestimmt, sicher und unabhängig digitale Systeme zu nutzen, Daten zu verarbeiten und Technologien einsetzen zu können. Für Staaten bedeutet das ganz konkret: Ihre Verwaltung muss stets hand-

Eine Kolumne von Christina Lang
lungsfähig sein und flexibel auf Lösungen und Ressourcen zurückgreifen können – technisch und rechtlich wie personell.
Handlungsfähig durch Kompetenz „Personell“ kann ich dabei nicht genug betonen, denn digitale Souveränität ist kein reines Tech-Thema. Um Server-Standorte, CloudAnbieter und Software-Lizenzen wählen zu können, geht es vielmehr – und vielleicht vor allem – um die Menschen, die Entscheidungen über das Digitale treffen sollen. Mitarbeitende, die verstehen, wie digitale Prozesse funktionieren. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die souverän sind in ihrem Tun, weil sie wissen, wovon sie sprechen. Es geht also auch um Souveränität im Sinne von Resilienz und um Handlungsfähigkeit durch Kompetenz. Vereinfacht gesagt: Deutschland wird digital nie souverän werden, wenn die Verwaltung in zentralen IT-Fragen von wenigen Großanbietern abhängig ist und zugleich intern zu wenig Digitalkompetenz hat, Abhängigkeiten zu hinterfragen oder Alternativen zu finden.
Christina Lang ist Chief Executive Officer (CEO) des DigitalService. Foto: BS/DigitalService
Ende der klassischen Beamtenstruktur Aber wie kommen wir dahin? Indem wir Mitarbeitende zur aktiven Nutzung der digitalen Möglichkeiten fortbilden und schulen. Kurzum: befähigen. Durch praxisnahe und verpflichtende Weiterbildungsmaß-
nahmen können wir ein besseres Grundverständnis für digitale Anwendungen und Entwicklungsmethoden aufbauen. Wir sensibilisieren für Gefahrenpunkte und zeigen, was Qualitätsmerkmale guter digitaler Anwendungen und Prozesse sind. Aber es braucht auch neue Profile in der Verwaltung, um interdisziplinär Digitalisierung besser umsetzen zu können. Darum muss die Verwaltung Wege und Methoden finden, neue digitale Talente anzuziehen. Voraussetzungen sind attraktive Arbeitsbedingungen, eine moderne Personalkultur und Karrierewege, die nicht auf klassischen Beamtenstrukturen basieren.
Digitale Realitäten Im Bereich der digitalen Infrastruktur und Beschaffung sehen wir schon positive Entwicklungen: Das Zentrum für digitale Souveränität Deutschland (ZenDiS) leistet seit Ende 2022 seinen Beitrag, die Deutsche Verwaltungscloud ist in der Entstehung und auch auf europäischer Ebene gibt es eine engagierte Zusammenarbeit für digitale Lösungen. Der generelle politische Wille zur (digitalen) Souveränität ist da. Ich appelliere an aktuelle und zukünftige Entscheidungsträgerinnen und -träger allerdings stark, ebenso das Personal auf diese Realität vorzubereiten: Indem wir aktuelle Mitarbeitende fördern – aber auch, indem wir ihnen Expertinnen und Experten zur Seite stellen, die sich im Digitalen schon sehr gut auskennen. Dann können wir bald selbstbewusst vom digitalen Staat reden.
nau diese Skills gesucht werden. Wenn wir einen fähigen Bewerber leider intern ablehnen müssen, wir ihn aber weiterempfehlen können, ist das eine Win-win-Situation.“ Allerdings befinden sich beide Projekte laut Just noch in der Entwurfsphase.
Zentrale Plattform angestrebt
Nun werden die Projekte in die jeweiligen Behörden gespiegelt und es wird über eine mögliche Realisierung gesprochen. Der Bau einer App – zum Beispiel für die Kleinanzeigenbörse – sei dabei nur der erste Schritt: „Die spannende Frage ist: Wie kommt so etwas aufs Diensthandy? Auf welchen Anbieter können wir dabei zugehen?“, skizziert Just die bevorstehenden Herausforderungen. Das MoVe-Netzwerk soll jedoch nicht auf dieses eine Netzwerktreffen beschränkt bleiben. Geplant ist, sich künftig zweimal jährlich in Präsenz zu treffen sowie quartalsweise eine digitale Abstimmung durchzuführen, um die Ideen weiterzuentwickeln. Müller zieht eine positive Bilanz: „Das MoVe-Netzwerk hat mit seinem Auftakt gezeigt, dass Zusammenarbeit, Innovationskraft und Praxisorientierung Hand in Hand gehen können. Die ersten Projekte sind angestoßen, erste Ergebnisse
sichtbar. Nun gilt es, dranzubleiben und die Projekte in die Umsetzung zu bringen.“ Hierfür beteiligen sich die Fachkolleginnen und -kollegen der Verwaltungsabteilung des BSI an einzelnen vom Netzwerk gestarteten Projekten. Müller resümiert, dass sich das MoVe-Netzwerk zu einer zentralen Plattform für Verwaltungstransformation entwickeln könne – mit Wirkung über Einzelbehörden hinaus. „Das BSI wird diese Entwicklung aktiv mittragen, denn für uns ist es eine wertvolle Möglichkeit, effizient die Verwaltung von morgen mitzugestalten.“
Behördenübergreifender Talentpool
Eine der Ideen aus der Transformers Night war ein behördenübergreifender Talentpool. Zukünftig sollen fähige Bewerberinnen und Bewerber nicht abgewiesen, sondern in einen gemeinsamen Pool aufgenommen werden. Dort können sich andere Behörden über die Profile informieren und geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gezielt ansprechen.
Kleinanzeigen für Verwaltungsprojekte
Eine weitere Idee drehte sich um eine Art Kleinanzeigenbörse für Verwaltungsprojekte. Mithilfe einer App könnte es künftig möglich sein, Projektideen oder Dienstleistungen zwischen Behörden zu teilen, um bei der Projektentwicklung nachhaltiger und effizienter zu agieren. Im Idealfall ließen sich so Verwaltungsaufwände bündeln und reduzieren. Interesse, Teil von MoVe zu werden? E-Mail an zs@zitis.bund.de!
Elektronische Patientenakte in ganz Deutschland (BS/cb) Die elektronische Patientenakte (ePA) kommt bundesweit zum Einsatz. Damit konnte Karl Lauterbach (SPD) das ihm zufolge „größte Digitalprojekt Deutschlands“ noch vor dem Ende seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister auf die Zielgerade bringen. Sicherheitsbedenken bleiben.
In einem Brief des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an die gematik, der mehreren Medien vorliegt, schrieb Lauterbach, „dass die Technik (der elektronischen Patientenakte, Anm. d. R.) einsatzbereit ist und sich auch die Erfahrungen bezüglich der Nutzung positiv entwickeln“. Die Pilotierung in den Modellregionen – Franken, Hamburg und Umgebung sowie Teile Nordrhein-Westfalens – habe wertvolle Erkenntnisse gebracht, aus denen sich drei Prinzipien für den bundesweiten Rollout ableiten ließen. Erstens seien mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden, die einen deutschlandweiten Einsatz ermöglichten. Zweitens hänge die Nutzbarkeit der ePA „stark von den jeweilig eingesetzten Systemen ab“ und die Einführung der elektronischen Patientenakte solle über einen Zeitraum gedacht werden, in dem die Nutzung kontinuierlich steige. Drittens seien positive Nutzererfahrungen „der Treiber der ePA in der Versorgung“ und Leistungserbringende sollten in der Einführungsphase nicht für Umstände unter Druck geraten, die sie nicht zu verantworten hätten.
Elektronischer Medikationsplan kommt später Nicht alle Beteiligten im Gesundheitswesen sind von der sogenannten „Hochlaufphase“, die Ende April startete, überzeugt. Dr. Jan-Niklas Francke, Vorstand der Deutschen
Apothekerverbände (DAV), merkt auf der Website der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) an, dass sich der Gesundheitsminister „weder mit den Apothekerinnen und Apothekern, noch mit anderen gematik-Gesellschaftern im Vorfeld abgestimmt“ habe. Nun komme es insbesondere darauf an, dass „die notwendigen Softwaresysteme in den Apotheken installiert und in Betrieb gesetzt werden“, so Francke. Selbst dann könnten Apotheken jedoch nur auf die elektronische Medikationsliste (eML) zugreifen. Der elektronische Medikationsplan (eMP) wiederum könne erst in späteren Ausrollphasen aktiv befüllt werden.
Die IT-Sicherheitsexpertin Bianca Kastl bezweifelte gegnüber dem Portal netzpolitik.org, dass die Sicherheitslücken der ePA komplett beseitigt seien. Die angekündigten Updates seien „grundsätzlich ungeeignet, um die aufgedeckten Mängel in der Sicherheitsarchitektur auszugleichen“. Kastl selbst hatte diese Mängel im Rahmen des Kongresses 38C3 im Dezember 2024 aufgedeckt: Mit ihrem Kollegen Martin Tschirsich hatte sie einen Hackerangriff auf die elektronische Patientenakte gefahren und dabei ihrer Aussage nach auf Gesundheitsdaten zugreifen können. BMI, gematik und BSI hatten daraufhin reagiert und die IT-Schwachstellen der ePA zu beseitigen versucht. Ob dies vollumfänglich gelungen ist, werden die kommenden Monate zeigen.
KOMPETENZZENTRUM ÖFFENTLICHE IT (ÖFIT)
Wikipedia gehört zu den populärsten Websites weltweit. Millionen Nutzerinnen und Nutzer engagieren sich bei der OnlineEnzyklopädie. Was liegt näher, als diese wunderbare, offene Datenquelle mit einem eigens entwickelten Open-Source-Tool für die Trendanalyse zu nutzen?
W ikipedia bietet sich hier aus verschiedenen Gründen an: die Daten sind per API ohne Einschränkungen oder Bezahlschranken abrufbar, eine große Community hält Informationen aktuell und die sehr große Datenmenge ermöglicht quantitative Analysen. Umso verwunderlicher, dass existierende Webangebote zur Analyse dieser Daten bisher nur an der Oberfläche kratzen, wenn sie für Trendidentifikation und -monitoring genutzt werden sollen. Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT hat deshalb ein Open-Source-Werkzeug entwickelt, das den Wikipedia-Datenschatz zielgerichtet erschließt. Eine zentrale Herausforderung besteht im Umgang mit der thematischen Spannweite Wikipedias. Die meisten Anwenderinnen und Anwender haben ein spezifisches Interessensgebiet, etwa Informationstechnologie oder Politik. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Inhalte Wikipedias gar nicht relevant sind und in der Datenverarbeitung nur zusätzlichen Aufwand bedeuten. Bei Wikipedia sind Artikel zumeist mehreren Kategorien zugeordnet. Die passende Auswahl einer kleinen Menge von Kategorien kann genutzt werden, um relevante Artikel zu identifizieren. Das wiki4trends-Dashboard basiert auf etwa 800 Kategorien, die mehr als 30.000 Artikel umfassen. Zusätzlich wurde noch ein MachineLearning-Klassifizierer genutzt, um relevante Artikel herauszufiltern. Eine weitere Herausforderung besteht in der Festlegung von Kriterien, anhand derer ein Trend identifiziert werden soll. Üblicherweise wird unter einem Trend ein Thema verstanden, das rasch an Bedeutung gewinnt. Dies kann zum Beispiel eine Technologie sein, deren Verwendung stark ansteigt. Das vielleicht offensichtlichste Kriterium zur Identifikation ist ein Anstieg an Aufrufzahlen eines Artikels zu einem Thema. Es sind aber auch andere Kriterien denk- und umsetzbar, etwa ein Anstieg in der
Der Governikus MultiMessenger (GMM) ist eine mandantenfähige, intelligente Kommunikationsplattform zur Umsetzung von Multikanalstrategien. Ganz gleich ob eine Nachricht über FIT-Connect, die EGVP-Infrastruktur, ein Antragsportal oder ganz klassisch als E-Mail übermittelt wird: Als virtuelle Poststelle werden die Nachrichten vom GMM in den unterschiedlichen Formaten empfangen, technisch-juristisch geprüft und an ein gewünschtes Zielsystem zugestellt, also, entweder an die vorhandenen E-Mail-Programme oder direkt an das Fachverfahren oder E-Akte-System.
Der GMM ist ein modulares System, das je nach Anforderungen um weitere Bausteine ergänzt werden kann:
• GMM ERV-Xtension zur Erstellung des XML-Strukturdatensatzes und zur Beantwortung des elektronischen Empfangsbekenntnisses im ERV,
• GMM Verzeichnisdienst-Connector (VDC) zur Anbindung an den Verzeichnisdienst der Justiz (SAFE) sowie den DE-Mail-Verzeichnisdienst und
• GMM SAFE-ID Manager zum zentralen oder dezentralen Anlegen und Verwalten von SAFE-Identitäten und -Zertifikaten.
• GMM Content-Routing (GCR) zur automatisierten, regel- und inhaltsbasierten Weiterleitung von Nachrichten aus einem GMM-Postfach über verschiedene Weiterleitungskanäle an andere Postfächer. Praxisbeispiel: der Empfang elektronischer Rechnungen
Gemäß der EU-Richtlinie 2014/55/EU und der entsprechenden nationalen Umsetzung sind al-
Mai 2025
Anzahl der Artikelbearbeitungen oder ein relativ frisches Erstellungsdatum eines Artikels. Das wiki4tren ds-Dash board vereint verschiedene Kriterien und bietet Nutzerinnen und Nutzern die Gelegenheit, selbst zu entscheiden, welche Kriterien wie viel Gewicht haben sollen. Verwandt damit ist auch die Frage, wie populär ein Thema aktuell ist. Auch hier sind verschiedene Kriterien anlegbar, etwa die Anzahl der Beobachterinnen und Beobachter eines Artikels im Vergleich zu anderen Artikeln. Bei Beobachterinnen und Beobachtern handelt es sich um Wikipedia-Autorinnen und -Autoren, die einen Artikel zu ihrer eigenen Beobachtungsliste hinzugefügt haben, um Änderungen und Entwicklungen leichter verfolgen zu können. In Ergänzung zur Mehrheit der Nutzenden, die Wikipedia lediglich als Informationsquelle verwenden, können Beobachterinnen und Beobachter als Mitwirkende mit einem starken Interesse an einem Thema aufgefasst werden. Das wiki4trendsDashboard bietet Nutzerinnen und Nutzern auch hinsichtlich der Quantifizierung von Popularität die Möglichkeit, selbst verschiedene Kriterien zu gewichten. Das Dashboard mag zwar der sichtbarste Aspekt sein, wiki4trends ist jedoch mehr als das. Es handelt sich im Wesentlichen um ein aus drei Teilen bestehendes Programmpaket. Zuerst kommt die Datensammlung. Hierbei können Anwenderinnen und Anwender

und Funktionsweise von wiki4trends
festlegen, zu welchen Kategorien sie Daten sammeln möchten. Das Programm nutzt dann APIs, um Daten herunterzuladen und so zu strukturieren, dass die weitere Verarbeitung möglichst leichtfällt. Die Datenanalyse stellt den zweiten Teil von wiki4trends dar. Hierbei werden die Daten entsprechend der oben beschriebenen und weiteren Kriterien ausgewertet und angereichert. Das wiki4trends-Dashboard bildet den Abschluss und ermöglicht eine interaktive Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Datenanalyse.
Sichere Behördenkommunikation mit dem Governikus MultiMessenger (BS/Carolin Hinz*) Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, die Verpflichtung zur Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) sowie zur Führung elektronischer Akten treiben den Wandel in der öffentlichen Verwaltung (ÖV) voran. Behörden stehen vor der Herausforderung, vielfältige Kommunikationswege zu bedienen. Eine virtuelle Poststelle verschafft Hilfe: Sie sorgt für eine effiziente und zukunftssichere Kommunikation innerhalb der Verwaltung. Angebunden an bestehende Fachverfahren oder E-Akte-Systeme verhilft diese Poststelle zu reibungslosen Abläufen. Mit der optionalen Weiterleitung an ein System zur Langzeitaufbewahrung wird das Bild der digitalen Verwaltung komplett.
All das leistet ein Multitalent: Governikus MultiMessenger.

Der Governikus MultiMessenger als Multikanal-Plattform.
le öffentlichen Stellen verpflichtet, elektronische Rechnungen anzunehmen. Dies wird in Deutschland durch den Standard XRechnung umgesetzt. Wenn ein Bauunternehmen mit der Errichtung einer neuen Schule beauftragt wurde, dürfen Rechnungen bei der beauftragenden Kommune nur elektronisch eingehen. Die Übermittlung erfolgt über verschiedene Eingangskanäle, die in Rechnungseingangsplattformen
Foto: BS/Governikus
zusammenlaufen. Die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes und weitere Lösungen setzen dafür serverseitig auf die bewährten Governikus-Lösungen COM Despina Peppol/AS4 Edition und den GMM. Die Übertragung in Fachverfahren erfolgt mit dem GMM als Schnittstelle. Der GMM kann alle in der ÖV relevanten Nachrichtenkanäle verarbeiten. Über eine Webservice-Schnittstelle kann der GMM außerdem direkt an vorhandene EAkte-Systeme bzw. Fachverfahren angeschlossen werden. Mitarbeitende arbeiten dann wie gewohnt in der bekannten Oberfläche der etablierten Programme. Die einzelnen Prozessschritte hinsichtlich der sicheren und rechtsverbindlichen Kommunikation zwischen Behörden oder Dienststellen führt der GMM im Hintergrund aus. Jede vom GMM entgegengenommene elektronische Nachricht
Während das wiki4trends-Dashboard unter wiki4trends.oeffentliche-it.de auf das Interessensgebiet ÖFIT zugeschnitten ist, lässt sich wiki4trends auch auf andere Felder anpassen. Der Code sowie die Dokumentation sind Open-Source unter gitlab.fokus.fraunhofer.de/ oefit-werkstatt/wiki4trends/ verfügbar. Die Nachnutzung ist ausdrücklich erwünscht und das Kompetenzzentrum Öffentliche IT freut sich über Rückmeldungen zu Einsatzzwecken, möglichen Weiterentwicklungen und auch allgemeineren Fragen zur Trendforschung.
ADVERTORIAL
bleibt im Originalformat erhalten und kann für die Beweiswerterhaltung direkt in einen Langzeitspeicher übergeben werden. Ein sog. TR-ESOR-System (Technische Richtlinie BSI TR-03125) ermöglicht eine nahezu automatisierte Langzeit-Beweiswerterhaltung der Daten. Im Kontext der sicheren Kommunikation zwischen Behörden kommen Signaturen und Siegel zum Einsatz, die in der Folge über lange Zeiträume prüfbar zu halten sind. Die Software-Lösung Governikus DATA Aeonia gewährleistet die langfristige und sichere Aufbewahrung elektronischer Dokumente.
GMM – ein Produkt des ITPlanungsrats Der wesentliche Vorteil des GMM gegenüber anderen Systemen ist die Multikanalstrategie: Der GMM ist in der Lage, alle gängigen Transportkanäle der ÖV und Justiz zu bedienen. Durch das BaukastenPrinzip kann der GMM beliebig um Teilanwendungen ergänzt werden. Seit 2017 ist der Governikus MultiMessenger ein Produkt des IT-Planungsrates. Der Bund sowie elf Bundesländer sind der „Anwendung Governikus MultiMessenger“ beigetreten, die damit auch deren Kommunen zur Nutzung zur Verfügung steht.
Die kontinuierliche und nachhaltige Pflege sowie Weiterentwicklung erfolgen in Abstimmung mit dem Bund und den Ländern, die dem Vertrag beigetreten sind. Der Abruf sowie Support der Anwendung erfolgen direkt über Governikus.
*Carolin Hinz ist Marketing Managerin Secure Communication bei Governikus.
Die Deutsche Verwaltungscloud hat Produktstatus erreicht. Über das integrierte Cloud-Service-Portal sind zum Start bereits mehr als 40 Cloud-Lösungen von elf öffentlichen IT-Dienstleistern erhältlich. Die angebotenen Services umfassen eine breite Palette sogenannter As-a-Service-Produkte: Sie haben gemeinsam, dass sie nicht auf den Servern bzw. Rechnern der Nutzer installiert, sondern über das Internet oder über interne Netze auf Bundes- und Landesebene bereitgestellt und aktualisiert werden. Die Anwender der Services müssen sich nach erfolgter Integration in ihre Umgebung nicht um Wartung und Updates kümmern. Beispiele sind Messenger-Dienste oder Kollaborationstools (Software-as-a-Service), die Bereitstellung vorkonfigurierter Server (Infrastructure-as-a-Service) oder spezialisierte Lösungen wie Kubernetes-Cluster im Bereich Platform-as-a-Service.
Angebotsvielfalt
Die Deutsche Verwaltungscloud bringt im Cloud-Service-Portal Anbieter und Kunden zusammen. Für einen ersten Überblick können die in der Deutschen Verwaltungscloud angebotenen Produkte nach Schlagwörtern durchsucht sowie nach Themen oder Anbietern gefiltert werden. Nach erfolgreicher Registrierung im Cloud-Service-Portal erhalten Interessierte Zugang zu allen vorliegenden Produktinformationen. Eigene Cloud-Produkte entwickelt die Deutsche Verwaltungscloud nicht.
Digitaler Marktplatz für Cloud-Lösungen
(BS/FITKO) Bund, Länder und Kommunen können Cloud-Services jetzt deutlich einfacher beziehen: Mit der Deutschen Verwaltungscloud (DVC) des IT-Planungsrats steht Behörden hierfür seit Anfang April ein souveräner digitaler Marktplatz zur Verfügung.
„Der digitale Marktplatz der DVC trägt dazu bei, dass Kunden in der öffentlichen Verwaltung mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Entscheidend für den Erfolg der Deutschen Verwaltungscloud ist ein stetig wachsendes Angebot an Cloud-Services“, erklärt Dr. André Göbel, Präsident der FITKO, die das Produkt im Auftrag des ITPlanungsrats steuert. Zukünftig sollen daher neben öffentlichen IT-Dienstleistern auch verwaltungsexterne Anbieter ihre CloudServices über die DVC anbieten können.
Garantierte Mindeststandards
Mit einheitlichen Nutzungs- und Bezugsbedingungen, standardisierten Produktbeschreibungen und transparenten Preismodellen vereinfacht die Deutsche Verwaltungscloud den Beschaffungsprozess für Behörden. Die Kunden erhalten über das Cloud-ServicePortal der Deutschen Verwaltungscloud eine schnelle Übersicht und können die angebotenen Services unkompliziert miteinander vergleichen. Alle Services werden nach einem Reifegradmodell bewertet und erfüllen relevante Mindestkriterien, unter anderem in den
ADVERTORIAL
Materna richtet Bereich Defence strategisch neu aus (BS) Materna richtet ihr Cyber- und IT-Engagement für den Verteidigungsbereich strategisch neu aus und stärkt damit ihre Position als verlässlicher Partner der Bundeswehr. Im Fokus stehen dabei der Ausbau verlegefähiger, hochverfügbarer IT-Systeme, die Digitalisierung militärischer Führungsund Unterstützungsprozesse sowie die Entwicklung sicherer Plattformlösungen für den Einsatz im In- und Ausland.

Geschäftsleitung bei der CONET Solutions GmbH.
„Die digitale Souveränität der Bundeswehr ist ein zentrales Zukunftsthema – sowohl für unsere nationale Sicherheit als auch im Kontext internationaler Bündnisse“, sagt CEO Michael Hagedorn „Mit der Neuausrichtung im Bereich Defence schaffen wir die Basis, um unsere technologische Kompetenz und Beratungsstärke gezielt weiterzuentwickeln.“
Die Anforderungen an die Streitkräfte verändern sich kontinuierlich – unter anderem durch CyberBedrohungen, hybride Konflikte und internationale Einsätze. Um diesen Herausforderungen mit resilienten, skalierbaren IT-Lösungen zu begegnen, schafft Materna klare Strukturen und verstärkt den Bereich Defence innerhalb des Ressorts Public Sector. Ein zentraler Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Bündelung aller Defence-Aktivitäten unter einer eigenen Führungsstruktur. Mit Wirkung zum 1. April 2025 hat Ulrich Bötzel die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Defence als Senior Vice President übernommen. Ulrich Bötzel bringt umfassende Erfahrung aus IT-Architekturprojekten für die Bundeswehr mit und war zuletzt Mitglied der
Technologie für digitale Souveränität
Materna unterstützt die Bundeswehr seit vielen Jahren mit spezialisierten IT-Lösungen – von der Lageanalyse und Gefahrenprävention über sichere Kommunikationssysteme bis hin zum Meldewesen und zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Mit der neuen Struktur treibt Materna die Entwicklung innovativer, einsatzfähiger IT-Systeme weiter voran – und leistet einen aktiven Beitrag zur Sicherheit Deutschlands und seiner Partner.
Auf der diesjährigen AFCEA am 27./28. Mai in Bonn stellt Materna gemeinsam mit dem Partner SThree unter dem Motto „Digitalisierung als Basis einer handlungsfähigen Bundeswehr“ aus.
Bereichen Sicherheit und Datenschutz.
Zwei Bezugsmodelle
Der Einkauf von Produkten in der DVC aktuell über zwei Vertragsmodelle möglich: Zum einen können Behörden einen Direktvertrag mit dem Anbieter eines Services in der DVC abschließen. Voraussetzung ist, dass das Vertragsvolumen unterhalb der jeweils gültigen vergaberechtlichen Bagatellgrenze liegt oder bereits eine InhouseBeziehung zum Anbieter besteht. Zum anderen ist der Einkauf von Cloud-Services möglich, wenn eine direkte oder indirekte Vertragsbeziehung zu govdigital vorliegt. Als Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister entwickelte govdigital die DVC und ist für den technischen Betrieb des Cloud-
Service-Portals der DVC zuständig. Die Realisierung der DVC erfolgte in den letzten 15 Monaten auf Grundlage eines Beschlusses des IT-Planungsrats und wurde unter der Gesamtprojektleitung der FITKO gemeinsam mit govdigital umgesetzt: Neun öffentliche ITDienstleister trugen in der Projektphase zur Entwicklung und Umsetzung bei. „Für die öffentlichen IT-Dienstleister stellt die Deutsche Verwaltungscloud eine gemeinsame Plattform dar, auf der die Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen weiter ausgebaut und die digitale Souveränität gemeinsam organisiert werden kann. Die Cloud-Transformation der deutschen Verwaltung wird sich auf diese Infrastruktur stützen können“, sagt Martin Schallbruch, CEO der govdigital.
Der Start der DVC ist damit auch Ausdruck erfolgreicher föderaler Zusammenarbeit, die vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie einem zunehmenden Fachkräftemangel immer wichtiger wird: Über die DVC können Behörden über attraktive Mietmodelle die benötigten Services beziehen. Der Aufbau komplizierter und teurer IT-Infrastruktur ist nicht notwendig. Bund, Länder und Kommunen können so flexibel auf sich verändernde Anforderungen im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung reagieren. Im nächsten Schritt soll das Cloud-Service-Portal der DVC mit den weiteren Marktplatz-Angeboten FIT-Store und EfA-Marktplatz des IT-Planungsrats zusammenführt und damit die öffentliche Beschaffung von Software- und IT-Dienstleistungen weiter vereinfacht und beschleunigt werden.

Weitere Informationen unter: www. deutsche-verwaltungscloud.de

Die heise academy bietet praxisrelevante Weiterbildung, die Sie voranbringt. Lernen Sie von führenden Experten, erweitern Sie gezielt Ihre IT-Skills und wenden Sie Ihr Wissen direkt an. Bauen Sie heute das IT-Know-how auf, das morgen den Unterschied macht.
• Individuelle Lösungen für Einzelpersonen und Teams & Organisationen
• Flexibles Lernen mit On-Demand-Kursen und Live-Events
• Aktuelle IT-Themen in bewährter heise-Qualität
• Direkter Austausch mit erfahrenen IT-Experten
Jetzt IT-Wissen vertiefen unter heise-academy.de
Behörden Spiegel: Wozu dienen die Interoperabilitätsverordnung und die Interoperabilitätsbewertung?
Tabea Grünewald: Die Interoperabilitätsverordnung hat ein klares Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen digitale Verwaltungsdienste in der EU einfacher und grenzüberschreitend nutzen können. Gleichzeitig stärkt die Verordnung die Zusammenarbeit der Verwaltungen in den Mitgliedstaaten – insbesondere beim Datenaustausch.
Ein zentrales Instrument ist dabei die Interoperabilitätsbewertung. Sie macht sichtbar, wo Potenziale, aber auch Hindernisse für die europäische Zusammenarbeit liegen. Die Bewertung soll dabei auch ein Umdenken bei Entscheiderinnen und Entscheidern in der öffentlichen Verwaltung anstoßen: Interoperabilität ist kein technisches Detail, sondern ein zentraler Baustein für leistungsfähige öffentliche Dienstleistungen.
Benedikt Liebig: Ein Beispiel: Ich möchte in meinem Urlaub in Slowenien einen Angelschein beantragen, um im Fluss zu fischen. Hier sollte meine deutsche digitale Identifikation ausreichen. Damit das möglich ist, braucht es im Hintergrund eine funktionierende Infrastruktur. Verwaltungsleistungen müssen so gestaltet sein, dass sie technisch, organisatorisch, semantisch und rechtlich zusammenpassen – über Ländergrenzen hinweg. Genau darum geht es bei der Interoperabilitätsverordnung. Sie schafft die Grundlagen dafür, dass digitale Verwaltungsangebote in Europa zusammenarbeiten – und wir als Bürgerinnen und Bürger am Ende gar nicht mehr merken, ob wir gerade einen Verwaltungsservice in
Verwaltungsservices sollen besser zusammenpassen
(BS) Seit Januar 2025 ist die sogenannte Interoperabilitätsbewertung verpflichtend. In Deutschland wird die EU-Anforderung in den bereits bestehenden Digitalcheck integriert. Wie die beiden Werkzeuge zusammenpassen und welche Chancen sie für die Erarbeitung von Regelungen bieten, erklären Tabea Grünewald, Referentin im Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI), und Benedikt Liebig, Produktmanager beim DigitalService, im Gespräch mit Anna Ströbele.

Ein Kernelement der neuen Arbeitsweise ist die Visualisierung von Regelungen.
Deutschland oder in einem anderen EU-Land nutzen.
Behörden Spiegel: Die Interoperabilitätsbewertung wird in den Digitalcheck eingebracht. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Grünewald: Eine neue Verordnung muss nicht immer einen neuen Prozess oder zusätzlich unnötige Anforderungen bedeuten. Die EUKommission, die die Verordnung selbst auch erfüllen muss, hat im Rahmen der neuen Verordnung einen Digitalcheck aufgebaut. Wir haben
den Digitalcheck bereits. So haben wir beschlossen, den Digitalcheck entsprechend zu erweitern. Aus zwei Prozessen wird einer.
Liebig: Digitaltauglichkeit und Interoperabilität haben dabei inhaltliche Parallelen. Beim Digitalcheck haben wir beispielsweise zu Beginn fünf Prinzipien für digitaltaugliches Recht entwickelt. Dazu gehören die Wiederverwendung von Daten und Standards in neuen Regelungen oder der Datenschutz und die Informationssicherheit. Beim Interoperable Europe Act gibt es vier Ebenen, die
ADVERTORIAL
Aber was brauchen Behörden wirklich für den Wandel?
(BS/Clara Maria Pölzl) Ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung – damit will Deutschland einen wichtigen Schritt in die Zukunft machen und sich als modernes Land etablieren. Ein entscheidendes Signal, das den Puls der Zeit – für manche etwas spät, aber doch – trifft. So hat etwa auch eine Studie des Softwareentwicklers Meister bestätigt, dass sich Städte und Gemeinden in Deutschland bereits von der vorherigen Regierung aus SPD, Grünen und FDP bessere Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten gewünscht hätten.
Die Studie basiert auf einer Umfrage mit mehr als 1.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Bundesrepublik. Ziel war es, den Digitalisierungsstand deutscher Kommunen zu erfassen und besser zu verstehen, welche internen und externen Hürden die öffentliche Verwaltung von der Digitalisierung abhalten. Die Ergebnisse zeichnen ein ambivalentes Bild: Der Wille zur digitalen Transformation ist vielerorts spürbar. Doch zwischen Absicht und Umsetzung klafft eine Lücke – nicht aus Mangel an Einsicht, sondern häufig an Ressourcen, Koordination und Mut zur Veränderung.
Als größte Hindernisse für die Digitalisierung nennen deutsche Rathäuser regulatorische Vorgaben, fehlende Fachkräfte und fehlendes Budget. Dabei ist letzteres in den vergangenen drei Jahren für gut die Hälfte aller Befragten sogar gestiegen.
Die Lösung sehen 80 Prozent in digitalen Tools, wie etwa MeisterTask. Eine Produktivitätssoftware kann Mitarbeitende entlasten und Prozesse nicht nur optimieren, sondern auch automatisieren. So können Verwaltungsprozesse einfacher, transparenter und effizienter gestaltet werden.
Besonders wichtig ist für die öffentliche Verwaltung dabei natürlich die Datensicherheit. Deshalb
speichern auch annähernd die Hälfte der Städte und Gemeinden ihre Daten ausschließlich in Deutschland, ein kleinerer Anteil sogar auf eigenen Servern. MeisterTask ist eines von wenigen digitalen Tools, die auf Servern in Frankfurt gehostet werden. Und aufgrund seiner Unternehmenswurzeln in Deutschland auch mit allen gängigen Datenschutz- und Sicherheitsstandards, wie etwa der DSGVO, konform ist. Eine heimische Alternative zu den zahlreichen US-Produkten.
Unterm Strich lässt sich erkennen: Deutschlands Städte wollen digitaler werden. Der Wille ist da, die Notwendigkeit erkannt und möglicherweise liefert das angekündigte Digitalministerium auch die nötigen Rahmenbedingungen für Kommunen, die bereit sind in ihre digitale Zukunft aufzubrechen.
Wichtige Begleiter auf einer solchen Digitalisierungsreise sind Expertinnen und Experten und Fachleute, die einerseits mit der Thematik vertraut sind und andererseits auch verstehen, mit welchen Herausforderungen sich Behörden und Ämter konfrontiert sehen.
Da IT-Fachkräfte aktuell rar sind, bieten sich hier externe Digitalisierungspartner an. Diese können die nötige Starthilfe geben und mit Erfahrung und Fach-
kenntnissen beratend zur Seite stehen. Das kann bereits bei der Auswahl der richtigen Softwarelösung entscheidend sein.
MeisterTask bietet all das aus einer Hand: vom digitalen Werkzeug, über die persönliche Beratung und Strategieentwicklung, bis hin zur fortlaufenden Begleitung der Verwaltungsmodernisierung. Denn Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein fortlaufender Prozess, der sich durch interne und externe Anforderungen und Einflüsse stetig weiterentwickelt.
„Digitale Transformation ist mehr als ein IT-Projekt, es ist ein Kulturwandel. Das bedeutet: kürzere Reaktionszeiten, effizientere Prozesse und eine Verwaltung, die nicht nur für die Zukunft bereit ist, sondern sie aktiv gestaltet.“, so Clemens Weidenbach , Geschäftsführer von Meister.
Erfolg hat, wer bereit ist, Ressourcen zu bündeln, neue Wege mutig zu gehen und individuelle Lösungen zu finden. Denn am Ende geht es um mehr als Technik. Es geht um eine Verwaltung, die näher am Menschen ist – und um Städte, die ihre digitale Zukunft aktiv gestalten.
Kontakt
Clara Maria Pölzl ist Director of Sales bei Meisterlabs.
+43(0)699 18187814
clara.poelzl@meisterlabs.com
Behörden Spiegel: Stichwort Unterstützung – Welche Angebote stellt der Bund bereit? Und was sind die Ziele des DigitalService und des BMI?
Liebig: Wir bauen aktuell eine nationale Kontaktstelle auf, um Bund, Länder und Kommunen bei der Durchführung von Interoperabilitätsbewertungen gezielt zu unterstützen. In der Bundesverwaltung begleiten wir zudem Regelungsvorhaben direkt: Dabei unterstützen Digital-Expertinnen und -Experten – etwa Designer, Entwicklerinnen oder Produktmanager – Mitarbeitende der Verwaltung in der frühen Erarbeitungsphase von Regelungen. Und in diesem Jahr werden wir auch wieder Informations- und Schulungsangebote anbieten – zu Themen wie Digitaltauglichkeit, Interoperabilität oder zum Einsatz von Visualisierungen im Regelungsprozess. Alle aktuellen Unterstützungsangebote gibt es auf unserer Webseite.
Foto: BS/DigitalService des Bundes
den Prinzipien des Digitalchecks sehr ähneln. Auch da geht es um Daten, Sprache, Struktur und die Kohärenz von Recht. Beides passt inhaltlich gut zusammen.
Behörden Spiegel: Es geht also eher um eine grundsätzlich andere Arbeitsweise. Was gehört dazu?
Liebig: Genau, es geht darum, dass Regelungen anders erarbeitet werden. Bereits frühzeitig vor der Formulierung von Regelungen können unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. Beispielsweise der Einbezug von umsetzenden Behörden oder das Erstellen von Visualisierungen, um Beziehungen und Prozesse besser erfassbar zu machen. Außerdem zeigt unsere Erfahrung, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wirkungsvoll ist. So entstehen Regelungen, die eine praxisnahe Umsetzung ermöglichen, Prozesse verschlanken und Kosten senken. Und: Diese andere Art des Arbeitens bedeutet keineswegs Mehraufwand. Im Gegenteil – sie vereinfacht Abstimmungen und erleichtert die Dokumentation.
„Es geht darum, dass Regelungen anders erarbeitet werden.“
Benedikt Liebig, DigitalService
Behörden Spiegel: Die Interoperabilitätsbewertung ist ohnehin seit diesem Jahr verpflichtend. In welchen Fällen muss sie durchgeführt werden?
Grünewald: Grundsätzlich gilt die Verpflichtung für alle öffentlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die Interoperabilität muss erarbeitet und bewertet werden, sobald über eine verbindliche Anforderung bei einem digitalen Verwaltungsdienst entschieden wird – und dieser eine grenzüberschreitende Komponente hat oder von einer profitieren würde. Das betrifft vor allem Gesetze, kann aber auch Verordnungen oder Richtlinien betreffen, die sich mit der Leistungserbringung befassen. Das heißt, wir haben einen sehr breiten Anwendungsbereich.
„Wir
begreifen es als große Chance, auf europäischer Ebene mehr zusammenzuarbeiten.“
Tabea Grünwald, BMI
Grünewald: Zudem wollen wir die Möglichkeiten, die der Interoperable Europe Act eröffnet, stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Anders als etwa die KI-Verordnung ist die Interoperabilitätsverordnung bislang noch wenig bekannt. Wir begreifen es als große Chance, auf europäischer Ebene mehr zusammenzuarbeiten – an der Interoperabilität, aber auch grundsätzlich an den Themen der Verwaltungsdigitalisierung. Das Gremium des Interoperable Europe Boards, welches im Rahmen der Interoperabilitätsverordnung geschaffen wurde, institutionalisiert diese Zusammenarbeit zum ersten Mal. Hier treffen sich die CIOs der EU-Staaten, für Deutschland nimmt Staatssekretär Markus Richter an den Treffen teil. Nach seiner konstituierenden Sitzung im Dezember trifft sich das Board das nächste Mal am 20. Mai 2025.

Benedikt Liebig ist Produktmanager beim DigitalService des Bundes. Foto: BS/DigitalService des Bundes

Tabea Grünewald ist Referentin für internationale und EU-Angelegenheiten im Bundesinnenministerium (BMI). Foto: BS/privat
Zahlen zu Angebot, Nutzung und Verbreitung aus dem Jahresbericht 2024/25 (BS/gg) Der IT-Planungsrat und die FITKO haben vor wenigen Wochen ihren gemeinsamen Jahresbericht 2024/2025 vorgelegt. Hier finden sich u. a. interessante Zahlen zum Produktportfolio des IT-Planungsrats, welches von der FITKO gemanagt wird. Dieses wächst: So ist das ehemalige Projekt Deutsche Verwaltungscloud (DVC) seit dem 1. April 2025 ein weiteres – mittlerweile das 15. – Produkt des IT-Planungsrates. In der Übersicht des aktuellen Jahresberichts ist es folglich noch nicht enthalten. Weitere Informationen zur DVC können jedoch dem Beitrag aus unserer FITKO-Serie auf Seite 25 entnommen werden.


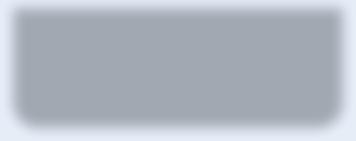
Einheitliche Behördennummer für Bürger/-innen und Unternehmen
54 Servicecenter
ca. 5,8 Millionen Anrufe
ca. 37,5 Prozent der Bevölkerung voll versorgt


Ein Nutzerkonto für alle Online-Verwaltungsleistungen
Nutzung durch sieben Länderkonten und BundID (DeutschlandID) deutschlandweite Nutzung



Schnelle Entwicklung digitaler Anwendungen
25 föderale IT-Standards
35 Entwicklungsressourcen


Zentraler Zugang zu offenen Verwaltungsdaten
>130.000 Datensätze
Top 3 in der EU
16+1 Abdeckung aller Länder & des Bundes


Medienbruchfreier Workflow für personenbezogene Sicherheitsüberprüfungen
ca. 1,9 Millionen Sicherheitsüberprüfungen
davon 173.495 im Rahmen der Fußball-EM 1.007 angeschlossene Fachbehörden



Das Diensteverzeichnis der öffentlichen Verwaltung
ca. 39.560 registrierte Organisationen
ca. 500 Millionen Anfragen
27 neue Dienste


Ei nfache Kommunikation bei Antragsprozessen
ca. 14.000 Anträge/Monat
>150 Hersteller angebunden
Produktübersicht unter:



Online-Lernmodule für die Verwaltungsdigitalisierung
ca. 18.000 Einschreibungen
20 Online-Kurse
ca. 3.500 Absolventinnen/Absolventen



Nachnutzen statt neu entwickeln
129 bestellbare Leistungen
761 registrierte Organisationen
360 Nachnutzungsverträge

www.it-planungsrat.de/produkte-standards/produkte



Sicherer Datenaustausch für die öffentliche Verwaltung
>1 Milliarde OSCI-Transaktionen
>50 Millionen eID-Transaktionen


Einfacher Online-Zugang zu allen Verwaltungsleistungen
27 Millionen Abrufe/Monat
ca. 23.200 Leistungsbeschreibungen


Standardisierte Informationen zu Leistungen
14.000 Einträge im Verzeichnis > 2.000 Einträge im Datenfelderkatalog > 1.000 Datenschemata



Zukunftssichere Multikanalkommunikation für die Verwaltung
11+1: Länder & Bund
7.000 Städte & Gemeinden
40 Betriebsstätten


Digitale Identität für Unternehmen in Deutschland
> 2,5 Millionen ELSTER-Organisationszertifikate > 600.000 Unternehmen
839 Anbindungspartner im Live-Betrieb
Eine Zeitreise bis ins digitale Zeitalter (BS/mk) Brandenburg will seiner Verwaltung ein digitales Gewand verleihen. Seit 1. Februar sind die Digitalisierungsfragen im erweiterten Ministerium der Justiz und für Digitalisierung gebündelt. Nun zieht dessen Staatssekretär der Justiz und für Digitalisierung, Ernst Bürger, ein erstes Fazit.
„In Raketengeschwindigkeit haben wir das Digitalministerium aufgebaut“, berichtete Ernst Bürger bei einer Veranstaltung des Behörden Spiegel zum Thema „Quo vadis Digitalisierung der Verwaltung in den ostdeutschen Bundesländern?“. Die Veranstaltung knüpfte an eine gemeinsame Studie des Behörden Spiegel und der LANCOM Systems GmbH an, die sich mit regionalen Faktoren beschäftigt, die in den ostdeutschen Bundesländern den Digitalisierungsfortschritt hemmen.
Bürger, der sein Amt zum 12. Dezember 2024 antrat, habe zu Beginn eine gewisse digitale Ernüchterung verspürt: „Am ersten Abend hatte ich nahezu keine E-Mail im Postfach.“ Auch die elektronische Aktenführung erwies sich als kaum genutzt: „Die gibt es, aber die nutzt quasi niemand“, habe man ihm auf Nachfrage geantwortet. Stattdessen verließ er das Ministerium am ersten Abend mit zwei Pilotenkoffern voller Papier – eine Situation, die ihn an seine Zeit im Bundesinnenministerium vor 15 Jahren erinnerte.
Inzwischen sei die Situation eine andere. Binnen vier Wochen seien 50 Prozent der Daten in der E-Akte hinterlegt worden. „Vor ein paar Tagen ging die Hausmeldung raus: ab dem 15. April nur noch in der E-Akte.“
Digitalbudget unter Spardruck Als zweiten Meilenstein nannte Bürger die Schaffung eines zentralen Digitalbudgets – trotz laufender
Haushaltsplanung für 2025/2026 und angekündigter Einsparungen von 20 Prozent. Die Herausforderung: Mittel aus verschiedenen Ressorts zu bündeln und zentrale Zuständigkeiten zu schaffen. „Das war anstrengend“, so Bürger. Besonders, da die Digitalbudgets der Ressorts angetastet werden mussten – nicht immer zur Begeisterung der Beteiligten. Dennoch sei es gelungen, gemeinsam einen Kabinettsbeschluss auf den Weg zu bringen. Im Zuge dessen wurden die Digitalmittel in drei Kategorien eingeteilt. Die sogenannten A-Mittel sind zentral im Digitalministerium verortet, das auch die Projektverantwortung übernimmt. Die B-Mittel werden ebenfalls durch das Digitalministerium vergeben, ihre Umsetzung liegt jedoch bei anderen Landesbehörden oder Ressorts. Die Vergabe dieser Mittel ist an Vorgaben wie ITArchitektur, Qualität oder Projektstandards gebunden – ein Bereich, in dem Bürger weiteren Entwicklungsbedarf sieht. C-Mittel verbleiben zunächst dezentral, fließen jedoch ebenfalls in das Digitalbudget ein. Zur besseren Koordination soll ein zentraler Staatssekretärsausschuss eingerichtet werden. „Ich bin persönlich davon überzeugt: Gute Digitalprojekte leben von iterativen Prozessen – Fachseite und Digitalseite arbeiten dabei gemeinsam und entwickeln die Prozesse iterativ weiter“, erklärte Bürger mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit innerhalb der Landesverwaltung.
Wie TrustCam die mobile Einsatzfähigkeit revolutioniert
(BS) Ob im Gefechtsstand, auf der Werft, im Sanitätszelt oder bei der Dokumentation einer Fahrzeugübergabe in der Kaserne – Fotos sind sowohl im Einsatzgeschehen als auch im behördlichen Alltag unverzichtbar. Doch wie lassen sich Verschlusssachen (VS-NfD) mobil aufnehmen und teilen – ohne Sicherheitsrisiken? Mit TrustCam präsentiert Materna Virtual Solution die erste Kamera-App für die native Plattformfreigabe indigo. Entwickelt in Deutschland für deutsche Behörden, Einsatz- und Streitkräfte.
Die moderne Einsatzrealität verlangt nach digitaler, ultramobiler Ausrüstung – auch in der Informationsverarbeitung. Smartphones und Tablets gehören längst zur Standardausrüstung in sicherheitskritischen Bereichen. Doch gerade bei Kameraanwendungen stießen etablierte Lösungen an ihre Grenzen: Als einzige Alternative kamen bisher herkömmliche Digitalkameras zum Einsatz – verbunden mit SD-Karten, manuellen Übertragungen und einer Vielzahl an Arbeitsschritten. Neben dem hohen Aufwand war vor allem die Datensicherheit kaum nachvollziehbar. Für Organisationen, die auf VS-NfD-Niveau arbeiten, war das keine tragbare Lösung. TrustCam schließt diese Lücke: sicher, integriert, souverän.
TrustCam: Die Kamera-App für Verschlusssachen
TrustCam ist die erste Kamera-App, die speziell für das indigo-Ökosystem konzipiert wurde – eine Initiative des BSI, bei der die nativen Sicherheitsfunktionen der Apple-Plattformen iPhone und iPad umfassend geprüft und für die VS-NfD-Kommunikation zugelassen wurden.
Die App ist Teil der Trust-Familie von Materna Virtual Solution und erweitert das Spektrum sicherer
Kommunikation um den visuellen
Bereich: Fotografieren, speichern, teilen – alles im geschützten Bereich, alles VS-NfD-konform.
Praxisbeispiele: Wo TrustCam sensible Bilddaten schützt
Ob Bundeswehr, Polizei oder Infrastrukturbetreiber – TrustCam verändert den Umgang mit sensiblen Bildern:
• Lagebilder bei Auslandseinsätzen oder Naturkatastrophen
• Fortschrittsdokumentation bei Infrastrukturprojekten
• Dokumentation sicherheitskritischer Bauteile
• Sanitätsdienstliche Anwendungen
• Bildübertragung in medienarmen Lagen via Satellit
TrustCam ersetzt herkömmliche Kameras und ermöglicht die direkte Verarbeitung von VS-NfDklassifizierten Inhalten – auf einem einzigen ultramobilen Gerät wie Smartphone oder Tablet.
Sicherheit und digitale Souveränität im Fokus Dabei erfüllt die App höchste Sicherheitsanforderungen nach dem BSI-indigo-Standard: Alle Aufnahmen verbleiben ausschließlich in der geschützten App, eine Weitergabe ist nur an
ebenfalls geprüfte indigo-Anwendungen möglich. Künftig wird eine automatisierte Übertragung an interne Archive – etwa im Dienststellen-Intranet – möglich sein. indigo erlaubt erstmals die sichere Nutzung nativer Apple-Apps für vertrauliche Kommunikation – und mit TrustCam wird dieses Konzept um eine Kamera-App ergänzt, die speziell für den Schutz visueller Inhalte konzipiert wurde. Entwickelt von Materna Virtual Solution in München, optimiert für iOS und Android, lässt sich TrustCam dank geprüfter Sicherheitsfunktionen schnell in Behördenumgebungen integrieren. Vertrauliche Daten bleiben dabei jederzeit unter Kontrolle: Es gibt keine Cloud-Anbindung und keinen ungewollten Datenabfluss. Speicherung und Nutzung erfolgen vollständig innerhalb etablierter IT-Sicherheitsstrukturen. Entwicklung und Wartung finden ausschließlich in Deutschland statt – für maximale Resilienz, Effizienz und digitale Souveränität im täglichen Einsatz. Aufklärungskräften, Sanitätern, Technikern oder Verwaltungsbediensteten steht mit TrustCam eine Kamera-App für VS-NfD-Niveau zur Verfügung, die sichere, medienbruchfreie und unmittelbar nutzbare Bildverarbeitung ermöglicht.


Deshalb sorgen wir für passgenaue Sicherheit –in kritischen Infrastrukturen, Industrie, Verwaltung und Sicherheitsbehörden.
secunet macht souveräne Digitalisierung möglich.
Der Digital Services Act (DSA) ist eine Rechtsordnung der Europäischen Union. Er regelt die Pflichten von Online-Plattformen und soll die Sicherheit der Nutzenden im Internet erhöhen. Dazu gehört auch, dass alle Plattformen gegen illegale Inhalte vorgehen und Verstöße zügig beseitigen müssen. In Deutschland übernimmt die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Rolle des „Digital Services Coordinators“ (DSC). Die Koordinierungsstelle steht im engen Austausch mit nationalen Behörden, anderen Vermittlungsdiensten, Akteuren der Zivilgesellschaft, Nutzerinnen und Nutzern sowie mit der Europäischen Kommission.
Darüber hinaus hätten auch andere deutsche Behörden spezielle Zuständigkeiten bei der Umsetzung des DSA – darunter die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die Landesmedienanstalten und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Das erklärte Dr. Deniz Erdem, Referatsleiter für Grundsatzfragen und Zertifizierungsaufgaben bei der BNetzA, bei einer Diskussionsrunde auf Digitaler Staat Online zum Thema Desinformation und Fake News. Der DSC solle sicherstellen, dass Menschen sich sicher und frei im Netz bewegen könnten: „Dazu kontrollieren wir, ob die Diensteanbieter die neuen DSA-Regeln einhalten“, so Erdem.
Kein Instagram, Facebook oder TikTok
Eine zentrale Aufgabe des DSC ist auch die Einrichtung einer Beschwerdestelle für Online-Nutzende bei möglichen Verstößen gegen den DSA. Allerdings ist diese Stelle nicht für alle Plattformen zuständig: „Große Online-Plattformen und -Suchmaschinen liegen in der Zuständigkeit der Europäischen Kommission“, erläutert Erdem Plattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzenden – wie Facebook, Instagram oder TikTok –werden direkt von der Europäischen Kommission geprüft. Dass der deutsche DSC für diese Plattformen nicht zuständig sei, müsse man klar öffentlich kommunizie-
Zwischen Anspruch und Realität
(BS/Paul Schubert) Seit über einem Jahr ist der Digital Services Act (DSA) in Kraft – ein Gesetz, das digitale Plattformen stärker regulieren und Nutzende besser schützen soll. Grund genug für uns, bei der nationalen Koordinierungsstelle, der Bundesnetzagentur, nachzufragen. Dort wird gleich zu Beginn mit einem weit verbreiteten Mythos aufgeräumt.

Wie weit reichen die Befugnisse des Digital Services Coordinators – und wie lässt sich Medienkompetenz stärken? Dies wurde in einer Diskussionsrunde auf
ren, sagt auch Alexander Rabe, Geschäftsführer des Internetwirtschaftsverbands eco. Die sogenannten „Very Large Online Platforms“ dominierten zwar den öffentlichen Diskurs, doch Deutschland konzentriere sich auf
des DSC. Dieser Beirat soll die Erfahrungen und Perspektiven von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in die Aufsicht über die DSA-Umsetzung einbringen. Insgesamt, so Rabe, solle der Beirat zu einer praxisnahen Herange-
„Wir müssen Inhalte und Äußerungen, die wir als unangemessen empfinden, die aber rechtlich zulässig sind, wahrscheinlich einfach aushalten.“
Alexander Rabe, Geschäftsführer des Internetwirtschaftsverbands eco
kleinere Plattformen und Internetpräsenzen wie etwa Kochbuch.de, die keine kritischen Schwellenwerte überschritten. Rabe selbst ist aktiv in die Ausgestaltung des DSA eingebunden. Der Verband eco ist Mitglied im Beirat

CYBER-SICHERHEIT ALS SCHLÜSSEL ZU NATIONALER

hensweise und zu mehr Transparenz bei der Umsetzung beitragen. Dennoch warnt er: Der DSA stecke „noch in den Kinderschuhen“. DSA wird Diskussionskultur nicht verändern
Generell, so die Einschätzung mehrerer Experten, dürfe man den DSA nicht als „Chef-Regulierer“ des Internets missverstehen. Dr. Michael Littger, Strategiedirektor des cyberintelligence.institute (CII), warnt davor, die Möglichkeiten dieser Rechtsordnung zu überschätzen. Der DSA sei nicht dafür geschaffen worden, einen ausgewogenen Diskurs im digitalen Raum
tralen Herausforderungen des DSA: Ab wann sind Manipulationen im Netz so irreführend, dass sie entfernt werden müssen?
Befugnisse des DSC klar begrenzt Denn auch wenn in der öffentlichen Debatte gelegentlich der Begriff „Zensurbehörde“ in Verbindung mit der BNetzA fällt, so ist der DSC in seinen Befugnissen klar begrenzt, betont Erdem. Über den Wahrheitsgehalt oder die Rechtswidrigkeit von Inhalten entscheidet nicht die Bundesnetzagentur, sondern die Justiz. „Die Kompetenz, über Inhalte zu urteilen, haben wir nicht – das ergibt sich aus dem nationalen Recht“, so Erdem. Letztlich entscheiden Richterinnen und Richter, ob eine Äußerung von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Rabe ergänzt: „Wir müssen Inhalte und Äußerungen, die wir als unangemessen empfinden, die aber rechtlich zulässig sind, wahrscheinlich einfach aushalten.“
Gemeldete Äußerungen stammen dabei nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft, sondern auch von sogenannten Trusted Flaggern. Diese definiert die BNetzA als Organisationen, die über besondere Expertise und Erfahrung bei der Identifizierung und Meldung rechtswidriger Inhalte verfügen. Ein Trusted Flagger ist z. B. die Meldestelle REspect! der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg.
„Eine Beschwerde kann ein wichtiger Hinweis auf strukturelle Probleme auf einer Plattform sein.“
Dr. Deniz Erdem, Referatsleiter für Grundsatzfragen und Zertifizierungsaufgaben bei der BNetzA
analysieren, ob systemische Risiken bestünden und ob daraus Konsequenzen zu ziehen seien: „Desinformation und Fake News sind per se nicht illegal, aber sie können in ihrer Masse und in ihrer Reichweite ein Risiko für das System werden.“ In solchen Fällen – etwa vor wichtigen Wahlen – ist gegebenenfalls auch der DSC gefordert, bei großen Plattformen aktiv zu werden. Der DSC ist verpflichtet, relevante Vorfälle und Entwicklungen auf diesen Plattformen an die Europäische Kommission zu melden. Die Kommission entscheidet daraufhin eigenständig, wie sie das Risiko bewertet und welche Maßnahmen sie gegebenenfalls ergreift.
Klar ist aber auch: Der DSA wird die Diskussionskultur im Netz nicht grundlegend verändern. Doch selbst wenn man diese Rechtsordnung ausklammert, gibt es in Deutschland zahlreiche Initiativen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die das Internet zu einem faireren und sichereren Raum machen wollen. Ein Beispiel dafür ist die Bayern Allianz gegen Desinformation.
Kleinere Initiativen gegen Desinformation
Das Projekt will unter anderem die Medienkompetenz von Internetnutzenden stärken. Initiiert wurde es vom bayerischen Digitalministerium. Digitalminister Dr. Fabian Mehring und sein Team – unter anderem Vera Cornette – haben sich des Themas angenommen. Ziel ist es, Desinformation konsequent zu adressieren. „Dazu haben wir Tech-Konzerne, die in München ansässig sind, eingeladen, um mit ihnen über den Kampf gegen Desinformation zu sprechen“, berichtet Cornette. Zur Allianz gehören sieben internationale Plattformbetreiber und globale Tech-Unternehmen wie Meta, Microsoft und Google, die ihre Technologie bereitstellen, um die Bevölkerung aufzuklären und digitale Kommunikationsplattformen zu schützen. Langfristig wolle man auch die Zivilgesellschaft einbinden, so Cornette Letztlich geht es bei all diesen Bemühungen um ein zentrales Ziel: die Steigerung der Medienkompetenz in allen Bevölkerungsschichten. Hier ist laut Cornette noch viel zu tun. So habe etwa Schweden bereits 2022 eine Behörde für psychologische Verteidigung gegründet. Dort habe man früh die Gefahren von Desinformation erkannt und auf Früherkennung gesetzt, erklärt Cornette
Vielleicht wäre das auch eine Aufgabe, die im neu gegründeten Bundesdigitalministerium angesiedelt werden könnte.

sicherzustellen: „Er soll vor allem den schlimmsten Manipulationen Einhalt gebieten.“ Der DSA sei ein ambitioniertes Vorhaben, das wichtige Maßnahmen ermögliche – etwa zur Durchsetzung von Transparenzpflichten, zur Sicherung von Datenzugängen oder zur Nachverfolgung von Plattformentwicklungen. Dennoch werde der DSA Desinformation nicht verhindern und die Risiken im Netz nicht grundlegend beseitigen können. Weiter bemerkte Littger: „Lügen ist zwar nicht verboten, aber ab einem bestimmten Grad eben doch.“ Diese Aussage unterstreicht eine der zen-
Plattformen seien gesetzlich verpflichtet, Meldungen von Trusted Flaggern prioritär zu behandeln und unverzüglich Maßnahmen wie beispielsweise die Löschung der Inhalte zu ergreifen.
Desinformation und Fake News sind nicht per se illegal
Einen Hebel hat der DSC bei den großen Online-Anbietern dennoch: „Eine Beschwerde kann ein wichtiger Hinweis auf strukturelle Probleme auf einer Plattform sein“, erklärt Erdem. Die Aufgabe der Koordinierungsstelle sei es dann, Beschwerden auszuwerten und zu
Im Webinar ging es neben dem DSC und der Bayern Allianz gegen Desinformation auch um Trusted Flagger sowie um Altersfreigaben auf SocialMedia-Plattformen. Über den QR-Code gelangen Sie direkt zum Video. Auch im Frühsommer versorgen wir Sie wieder mit spannenden Themen auf Digitaler Staat Online. Ein Programmtipp: der Thementag „Digital Souverän – Jetzt erst recht“ am 26. Juni. Weitere Programmpunkte finden Sie auf digitalerstaat.online.
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Mai 2025
www.behoerdenspiegel.de

(BS/mk/jb/bk) Da ist er nun. Eigentlich sollte er schneller kommen und dünner sein, aber zumindest ist er da: der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU. Auf 146 Seiten legen die Parteien dar, was sie sich die nächsten vier Jahre vornehmen wollen. Wie viel Zeitenwende steckt in dem Vertrag? Und was ist von den Versprechen zu halten?


Nach dem Neustart im Bevölkerungsschutz, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Jahr 2022 ausgerufen hatte, soll ein „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ das Schutzniveau erhöhen. Konkret (bzw. eher unkonkret): „Wir stärken das BBK als zentrale Stelle und das THW als operative Einsatzorganisation.“ Mit dem angesprochenen Pakt will man für nachhaltige Investitionen in Fähigkeiten sorgen sowie das Bewusstsein für den Selbstschutz erhöhen. Den Zivilschutz und den ergänzenden Katastrophenschutz des Bundes will man stärken und „die neuen Finanzierungsinstrumente für die Gesamtverteidigung von Bund und Ländern“ nutzen. Was auch immer „gut“ ist Auch die Zivile Verteidigung wurde mit einigen Sätzen bedacht. Durch die Änderung der Rechtslage möchten die Koalitionäre die Handlungsfähigkeit in der Zivilen Verteidigung bereits vor dem Spannungs- und Verteidigungsfall ermöglichen. Die Umsetzung des "OPLAN Deutschland" soll auf allen Ebenen gesteuert werden. Dies umfasst sowohl die zivilen als auch die militärischen Aufgaben. Schlussendlich möchte die kommende Bundesregierung zeitnah ein „gutes“ KRITIS-Dachgesetz beschließen. Was zeitnah bedeutet, wird nicht ausgeführt – geschweige denn, was ein gutes oder ein schlechtes Gesetz wäre.
Dirk Aschenbrenner , Präsident der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb): „Wir begrüßen sehr den im Koalitionsvertrag genannten ‚Pakt für Bevölkerungsschutz‘ und sehen damit unsere langjährigen Forderungen erfüllt. Wichtig ist es jetzt,
dass der Absichtserklärung auch schnellstmöglich Taten folgen.“
Die Hilfsorganisationen sehen Licht und Schatten. So erklärte Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der JohanniterUnfall-Hilfe (JUH): „Angesichts der weltpolitischen Lage ist es ein wichtiges Signal, dass der Koalitionsvertrag den Bevölkerungsschutz in den Fokus rückt. Die Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz und die Vorbereitung unseres Gesundheitssystems auf Krisenfälle sind zentrale Aufgaben.“ Entscheidend seien dabei zielgerichtete Investitionen in den Bevölkerungsschutz und die Schaffung einer klaren Rechtslage in der Zivilen Verteidigung. Dabei kritisierte Mähnert, dass eine bundesweite Helfergleichstellung nicht im Vertrag vorkomme.
Viele Baustellen – wenig Konkretes
„Unsere Sicherheit ist heute so stark bedroht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr.“ Gerade einmal vier Zeilen benötigen Union und SPD, um im Koalitionsvertrag zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Diese Bedrohung gehe von Russland aus und mache es erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges notwendig, dass Deutschland und Europa ihre Sicherheit selbst gewährleisteten, fahren die Autorinnen und Autoren fort. Die Brisanz ist also erkannt – doch wie plant das Kabinett Merz in den kommenden vier Jahren, die sicherheitspolitischen Weichen neu zu stellen? Zunächst einmal an der Seite der EU, der NATO sowie der USA. Außerdem versprechen die Koalitionspartner, mehr in die Verteidigung zu investieren. Darüber, in welchem Umfang und mit welchen Mitteln das erfolgen soll, schweigt
sich der Koalitionsvertrag allerdings aus. Konkretes zur Finanzierung und Beschaffung gibt es hingegen an anderer Stelle: „Wir streben […] die Einführung eines mehrjährigen Investitionsplans für die Verteidigungsfähigkeit an“, lassen Christund Sozialdemokraten im Koalitionsvertrag verlauten. Außerdem sollen die Gelder schneller in den Markt fließen. Ein entsprechendes Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz soll noch in den ersten sechs Amtsmonaten unter Merz in Kraft treten. Neu ist diese Idee nicht. Das Ministerium des alten und neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) erarbeitete bereits ein gleichnamiges Gesetz in der letzten Legislaturperiode und rief einen Tagesbefehl zur Beschaffungsbeschleunigung aus. Die gewünschte Wirkung wurde aber nie ganz erzielt. Darüber hinaus findet sich ein weiteres Thema, das sich der Verteidigungsminister bereits in der vergangenen Legislaturperiode auf die Fahnen schrieb, wieder: der Wehrdienst. An der Präferenz für das sogenannte „schwedische Modell“, hat sich nichts geändert. Neu ist aber der Zeitplan, dem sich die Koalitionspartner verpflichten: Die Voraussetzungen für den neuen Wehrdienst sollen noch in diesem Jahr geschaffen werden. Abgesehen davon gibt es für den Aufwuchs der Truppe nur alten Wein in neuen Schläuchen. Flexible Dienstzeit- und Laufbahnmodelle, mehr soziale Fürsorge und ein offeneres Klima für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund sollen zum Dienst motivieren. Wer Aufrüstung fordert, muss auch die industriellen Partner ins Boot holen – das wissen auch Christ- und Sozialdemokraten. Da-
für sollen die verworrenen Beschaffungsprozesse begradigt werden, z. B. durch das Vereinfachen von Genehmigungs- und Vergaberecht. Darüber hinaus streben die Koalitionspartner eine Reform des Planungs- und Beschaffungswesens an. Einzelne Großprojekte und Zukunftstechnologien mit hohem Innovationsdruck sollen von neuen Realisierungswegen profitieren –darüber, wie diese sich gestalten werden, schweigt sich das Papier aus. Im Bereich Munition möchte die Bundesregierung verstärkt mit Vorhalteverträgen und Abnahmegarantien arbeiten. Darüber hinaus sind sich beide Parteien einig, die Höhe des Schwellenwertes für Beschaffungsvorlagen zu erhöhen.
Befugnisse, Befugnisse, Befugnisse
Der Koalitionsvertrag widmet der Inneren Sicherheit rund zwei Seiten. Bereits im ersten Satz wird die seit Langem von verschiedenen Politikern angekündigte „Zeitenwende“ erneut ins Spiel gebracht: „Wir begegnen den multiplen Bedrohungen von außen und im Innern mit einer Zeitenwende in der Inneren Sicherheit“, heißt es darin. Konkret bedeutet das unter anderem erweiterte Befugnisse für die Polizei. So sollen Telekommunikationsanbieter künftig verpflichtet werden, IP-Adressen für mögliche Ermittlungen drei Monate lang zu speichern. Außerdem planen SPD und Union, der Bundespolizei zur Bekämpfung schwerer Straftaten den Einsatz der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) zu ermöglichen – allerdings ohne Zugriff auf bereits gespeicherte Daten. Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und automatisierten
Datenrecherche sollen die Sicherheitsbehörden mehr Handlungsspielraum erhalten. Für bestimmte, im Vertrag jedoch nicht näher beschriebene Zwecke, sollen künftig „die automatisierte Datenrecherche und -analyse sowie der nachträgliche biometrische Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten, auch mittels Künstlicher Intelligenz“ möglich sein. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die von Sicherheitsbehörden schon lange gefordert und immer wieder diskutiert wurden. Entsprechend positiv äußern sich die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu den geplanten Neuerungen. „Einige Vorschläge, die die DPolG im Vorfeld der Verhandlungen eingebracht hatte, werden im Vertrag umgesetzt“, heißt es in einem offiziellen Statement der Gewerkschaft. Ganz ohne Kritik kommen die Gewerkschaften jedoch auch nicht aus. So bemängelt Jochen Kopelke, der Vorsitzende der GdP, vor allem die unklare Finanzierung, fehlende Aussagen zur verfassungswidrigen Besoldung von Bundesbeamten sowie die bislang nicht erfolgte Übertragung des aktuellen Tarifabschlusses auf Polizeibeamte und Versorgungsempfänger. Auch die im Koalitionsvertrag enthaltenen Migrationspläne sieht Kopelke kritisch: Diese wiesen rechtliche Unsicherheiten auf, konkrete Ressourcenstärkungen seien nicht vorgesehen. Bereits in der Vergangenheit hatte die GdP auf den Personalmangel bei der Bundespolizei hingewiesen – insbesondere im Hinblick auf die anhaltenden Grenzkontrollen. Trotz vier Seiten zum Thema Migration bleibt diese Problematik im Koalitionsvertrag weiterhin unbehandelt.
Verfassungsschutz und MAD sollen so gestärkt werden, gerade auch im Hinblick auf ihre Befugnisse und Kooperationsmöglichkeiten, bei der Wahrung der Inneren Sicherheit und Abwehr von Spionage, Sabotage und Desinformation. Als einziger Nachrichtendienst des Bundes findet der BND dagegen keine Erwähnung, auch nicht im Zusammenhang mit Außen- und Sicherheitspolitik. Da hilft offenbar kein Bundesverfassungsgericht, das die entscheidende Bedeutung der nachrichtendienstlichen Auslandsaufklärung für die außen- und sicherheitspolitische Orientierung und Handlungsfähigkeit der Bundesregierung mehr als deutlich konstatiert hat. Auch das Grundsatzpapier der Bundesakademie für Sicherheitspolitik zu den Nachrichtendiensten als „erster Verteidigungslinie“ findet offenbar keine Resonanz. Politisch gelebte und gedachte „Intelligence Culture“ sieht anders aus
Der BND hätte auch im Kapitel „Befugnisse der Sicherheitsdienste“ in seiner Unterstützungsfunktion für die Wahrung der Inneren Sicherheit erwähnt werden müssen. Dass Innere und Äußere Sicherheit nicht mehr voneinander zu trennen sind, sollte inzwischen ja als Binse gelten. Die Aufzählung von BKA, BfV und Bundespolizei hätte hier einfach nur erweitert werden müssen: „Wir stärken das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst
gehören an mehreren deutschen Grenzen bereits zum Alltag. An der deutschösterreichischen Grenze bestehen sie bereits seit 2015. Sie sind Teil des politischen Instrumentariums – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. So heißt es im Koalitionsvertrag: „Die Grenzkontrollen zu allen deutschen Grenzen sind fortzusetzen bis zu einem funktionierenden Außengrenzschutz und der Erfüllung der bestehenden Dublin- und GEAS-Regelungen durch die Europäische Gemeinschaft.“
Der saarländische CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani bezeichnet diese Formulierung als klares Bekenntnis zu temporären Binnengrenzkontrollen, solange es an einem effektiven EU-Außengrenzschutz fehle. Langfristiges Ziel
Trotz guter Ansätze fehlen klare Worte zu den Nachrichtendiensten
(BS/Gerhard Conrad*) Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD bietet Ansätze für eine sicherheitspolitische Umorientierung hin zu staatlicher wie gesellschaftlicher Resilienz, Verteidigungsfähigkeit und mit dem Nationalen Sicherheitsrat und Krisenlagezentrum im Bundeskanzleramt auch zu überfälligen ressortübergreifenden Lage- und Entscheidungsstrukturen.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat eine neue Werbekampagne gestartet: „Wir suchen Terroristen (m/w/d)“ ist aktuell auf großen Plakaten an Bahnhöfen und Bushaltestellen – oder auch vor dem BND-Gebäude – zu lesen. Foto: BS/Klinger
im Rahmen der jeweiligen Kompetenzen, insbesondere in der Bekämpfung von Cyber-Kriminalität, Spionage und Sabotage.“
Höchste Priorität notwendig
Die Handlungsfelder bei der Stärkung der Dienste gehen dabei über die zu Recht in Aussicht gestellte Novellierung der ND-Gesetzgebung hinaus. Fraglich ist auch, ob der skizzierte Maßnahmenkatalog (drei-
monatige Vorratsdatenspeicherung, strikt limitierte Quellen-TKÜ für die Bundespolizei bei schweren Delikten, automatisierte Datenrecherche und -analyse, biometrische Abgleiche, automatisierte Kennzeichenlesesysteme, erweiterter Datenaustausch unter den Sicherheitsbehörden) den existenziellen Herausforderungen gerecht werden kann. Außergewöhnliche, auch finanzielle Anstrengungen werden für
alle Dienste jedoch zusätzlich bei der Rekrutierung und Entwicklung fachlich qualifizierten Personals ebenso zu meistern sein wie massive Investitionen in technische/digitale Infrastruktur sowie in zukunftsfähige und bedrohungsadäquate technische wie fachliche Befähigungen. Angesichts der schweren Irritationen im transatlantischen Verhältnis muss all dies mit höchster Priorität geleistet werden. Die Dringlichkeit und das Volumen dieser Aufgabe kommen im Koalitionsvertrag nicht ausreichend klar zum Ausdruck, obwohl dies gerade auch als politisches Statement mehr als am Platz gewesen wäre.
Es bleibt zu hoffen, dass Abhilfe hier über den künftigen Sicherheitsrat geschaffen werden kann, der nun nach mehr als 17 Jahren der partei- und ressortübergreifenden Prokrastination im Bundeskanzleramt geschaffen werden soll.
Der Druck steigt
Auch hier steht die eigentliche aufbau- und ablauforganisatorische Gestaltungsaufgabe in den Wochen
Die hitzige Debatte um die deutsche Asylpolitik
(BS/mk) Die große Frage nach einer Asylwende dominiert auch nach dem Wahlkampf den innenpolitischen Diskurs – gerade mit Blick auf den Koalitionsvertrag und seinen vier Seiten Migrationswegweiser. SPD und Union haben sich darin auf eine Reihe migrationspolitischer Maßnahmen verständigt, die auf Begrenzung und Steuerung setzen. Ein zentrales Element dabei: die Fortsetzung stationärer Grenzkontrollen, insbesondere zur Bekämpfung irregulärer Migration.
bleibe jedoch ein offener SchengenRaum – unter der Voraussetzung gemeinsamer europäischer Lösungen.
Rechtliche Fragen kommen auf Doch die Praxis ist rechtlich nicht unumstritten. Mitte März urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München, dass die Kontrolle eines österreichischen Staatsbürgers durch die Bundespolizei im Sommer 2022 rechts-


LEITUNG
Rainer Wendt
Bundesvorsitzender der DPolG
IMPULSVORTRAG
„Entwicklungen in Krisenregionen und Migrationsbewegungen“
Jörg Dehnert

widrig war. Der Kläger, ein Jurist aus Wien, war im ICE kurz hinter Passau überprüft worden – ohne dass es laut Gericht eine neue, ernsthafte Bedrohungslage gegeben hätte, die solche Maßnahmen rechtfertige. Der Fall zeigt: Zwischen politischem Willen und rechtlichen Vorgaben der EU besteht mitunter ein Spannungsverhältnis. Wie dieses aufzulösen ist und wie eine gemeinsame europäische Linie in der Asylpolitik künftig aus-
sehen kann, darüber wird nicht nur in Regierungskreisen debatiert –sondern auch beim diesjährigen Europäischen Polizeikongress. Im Fachforum „Asylpolitik und Innere Sicherheit“ wird die Bandbreite migrationspolitischer Herausforderungen im europäischen und nationalen Kontext diskutiert – von der Rolle der Sicherheitsbehörden bis hin zu rechtlichen Grundlagen. Ein Impulsvortrag über Migrationsbewegungen aus Krisenregionen sorgt
und Monaten nach der Regierungsbildung an, auch dies unter erheblichem Zeit- und Ergebnisdruck. Hier wird es gelten, keine zusätzliche bürokratischen Monster zu schaffen, sondern bestehende Strukturen zu nutzen, neu zu beauftragen, informationstechnisch zu vernetzen und Personal für Lage- und Analysearbeit zu qualifizieren.
Wichtig ist hier, dass das öffentliche Dienstrecht mit dem Ziel einer deutlich erhöhten Attraktivität für Fachkräfte modernisiert werden soll – ein Vorhaben, das entscheidend zur Bewältigung der auch den Nachrichtendiensten bevorstehenden „Mega-Herausforderung Personalgewinnung“ beitragen kann und muss.
Gleiches gilt für die angestrebte Initiative zur Förderung der strategischen Sicherheitsforschung, zu der auch die in Deutschland im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Raum kaum existenten Intelligence Studies gehören. Hier kann der Bund bereits über die von ihm betreuten Institutionen wie BAKS, SWP oder DGAP wichtige Impulse setzen.

dabei für den internationalen Blick auf Ursachen und Entwicklungen. Am selben Tag steht außerdem das Fachforum „Bekämpfung von Schleuserkriminalität und illegaler Migration“ auf dem Programm, das sicherheitsbehördliche Strategien und internationale Zusammenarbeit in den Fokus rückt. Am Folgetag folgt das Forum „Sicherheitskonzepte in Flüchtlingseinrichtungen“, das die Herausforderungen innerhalb Deutschlands aufgreift –etwa in Bezug auf Unterbringung, Schutzkonzepte und interkulturelle Konfliktprävention.
Die Debatte um Asylpolitik, Migration und innere Sicherheit bleibt damit nicht nur ein Thema für politische Gremien – sondern auch für die Fachwelt, die Praxis und die europäische Öffentlichkeit.



UNTER EUROPAEISCHERPOLIZEIKONGRESS.DE
Regional Direktor – MENA, Friedrich-Naumann-Stiftung


„Asylpolitik und Innere Sicherheit“
Hans Leijtens

Exekutiv Direktor, Frontex
Lena Düpont
MdEP, CDU/Fraktion der Europäischen Volkspartei
Michał Rosół Polizeirat, Hauptkommandantur der polnischen Polizei (KGP)
Engelhard Mazanke


Direktor Landesamt für Einwanderung Berlin aus unserem Programm

Optimisten kommentieren diese Versprechen von CDU/CSU und SPD mit: „Na endlich!“ Skeptiker halten dagegen und raten: „Erst mal abwarten!“ Und beide Positionen haben ihre Berechtigung.
Schuldenbremse gelockert
Nach der Lockerung der Schuldenbremse steht der neuen Regierung in den nächsten zehn Jahren ein eine Billion Euro schweres Paket für Investitionen zur Verfügung. Und dies zusätzlich zum normalen Bundeshaushalt. Die Hoffnung, dass das Versprechen, mehr Geld für den Digitalfunk der BOS bereitzustellen, eingehalten wird, ist also berechtigt. Da aber der tatsächlich bestehende Investitionsbedarf deutlich höher ist als das geschnürte Investitionspaket, stehen alle Versprechungen – auch die auf mehr Geld für den BOS-Digitalfunk – zunächst einmal unter dem Vorhalt ihrer Finanzierbarkeit.
Im Übrigen ist nicht anzunehmen, dass der Bund die Errichtung eines breitbandigen Mobilfunknetzes für die BOS und für eine richtungsweisende MCX-Kommunikationslösung übernehmen will. Dafür ist die Mitwirkung der Bundesländer und die Entwicklung eines gemeinsamen Finanzierungskonzeptes wie bereits beim BOS-Digitalfunk 1.0 erforderlich. Angesichts der Haushaltslage der Länder ein nicht ganz einfaches Vorhaben, was voraussehbar zumindest viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Insoweit ist „Abwarten“ kein schlechter Vorschlag.
Internationale Mitsprache Für die mobile Breitbandkommunikation der BOS wird ein Frequenzspektrum von 60 MHz als notwendig erachtet. Das von den BOS aufgrund der günstigen Ausbreitungscharakteristiken (unter anderem

INNOSYSTEC.DE

Die Hoffnung auf Einlösung des Versprechens beim BOS-Digitalfunk
(BS/Gerd Lehmann) Das von der „AG 1 Innen, Recht, Migration und Integration“ im Rahmen der Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD formulierte Versprechen, „der Digitalfunk BOS erhält mehr Geld und einen eigenen UHF-Frequenzbereich“, findet sich nunmehr im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wieder. Gemeint ist damit das seit zehn Jahren heiß diskutierte Projekt BOS-Digitalfunk 2.0, der Einstieg in die mobile Breitbandkommunikation der BOS.

Die Bundesnetzagentur erstellte bereits 2021 eine Studie, die infrage stellte, ob eine rein deutsche Lösung für einen eigenständigen BOS-Netzbetrieb realistisch ist.
Deep-Indoor-Versorgung) und der erzielbaren Datenraten für die mobilen Breitbanddienste adressierte Frequenzspektrum im UHF-Bereich (470 bis 694 MHz) ist aktuell bis Ende 2030 primär für die terrestrische digitale Übertragung linearer Fernsehprogramme (DVB-T2) sowie als Sekundärnutzung für den Betrieb lokaler Funkstrecken im Rahmen der professionellen Veranstaltungstechnik zugeteilt. Ob die Weltrundfunkkonferenz 2031 (WRC-31) angesichts des rückläufigen Frequenzbedarfs für den Rundfunk, insbesondere aufgrund des sich wandelnden Mediennutzungsverhaltens, neuer Methoden zur intelligenten Ausnutzung


des Frequenzbandes und neuer Übertragungstechniken (z. B. 5G Broadcast) zu einer anderen Entscheidung als die WRC-21 kommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin wurde aber schon im Rahmen der WRC-23 für einzelne europäische Staaten eine zusätzliche sekundäre, also nachrangige, Zuweisung an den Mobilfunk in diesem Frequenzbereich beschlossen. Der Status eines Sekundärnutzers bedeutet, dass dieser die Nutzung der Frequenzen durch den Primärnutzer (terrestrischer Rundfunk) nicht stören darf. Die Entscheidungskompetenz für die Zuteilung eines eigenen UHFFrequenzbereiches für die BOS obliegt nicht allein der Bundesre-

gierung. Die Zuweisung von Funkfrequenzen erfolgt über internationale Organisationen, insbesondere über die alle vier Jahre stattfindenden Weltfunkkonferenzen der Internationalen Fernmelde-Union und in Europa über die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT). Zudem sieht das Telekommunikationsgesetz (TKG) eine Beteiligung der Länder an einer Frequenzzuteilung vor. Und die haben bislang stets für den Vorrang von Rundfunk und Kulturschaffenden plädiert.
Sinkendes Interesse an UHF-Band Auch im Koalitionsvertrag von 2021 der von der SPD angeführten Ampelregierung hieß es noch: „Wir wollen das UHF-Band dauerhaft für Kultur und Rundfunk sichern.“ Insoweit lässt die Aussage in den Zeilen 3.923 bis 3.925 des Koalitionsvertrages der schwarz-roten Koalitionäre auf eine Änderung der bisherigen Positionen hoffen. Dort heißt es: „Das UHF-Band steht auch Medien und Kultur zur Verfügung, die Abwägung mit Sicherheitsbedarfen wird derzeit evaluiert.“
Wer will, kann diese Aussage als Einschränkung des Versprechens der Zuteilung eines eigenen UHFFrequenzbereiches für die BOS verstehen. Aufschluss über das tatsächlich zu erwartende Handeln der neuen Regierung findet sich in den Zeilen 2.222 und 2.223 des Koali-
tionsvertrages. Dort heißt es: „Bei der Vergabe der UHF-Frequenzen setzen wir uns auf europäischer Ebene für die Berücksichtigung der berechtigten Interessen ein.“ Im Übrigen sei der Hinweis erlaubt, dass die Nutzung eines Spektrums im Bereich des UHF-Bandes durch die BOS eine europaweit harmonisierte Frequenznutzung voraussetzt. Derzeit unterscheiden sich die Frequenzbelegungen für Dienste der BOS in Europa teilweise deutlich. Im europäischen Ausland findet der Digitalfunk der BOS u. a. auch im 430-MHz- und im 450-MHzBand statt. Frequenzbereiche, die in Deutschland für andere Anwendungen zugeteilt sind. Allgemeine Interessensbekundungen der BOS in Europa für eine Nutzung des UHF-Bandes zeigen eine deutlich abnehmende Tendenz.
Eigenes BOS-Netz noch zeitgemäß? International entscheiden sich immer mehr Staaten gegen einen eigenen BOS-Netzbetrieb auf dezidierten Frequenzen. Sie setzen stattdessen auf einen externen Betrieb des Funknetzes durch kommerzielle Mobilfunkanbieter. Nach der im Auftrag der Bundesnetzagentur 2021 erstellten Studie erscheint es daher fraglich, ob eine Nachfrage aus einem Markt wie Deutschland mit rund 900.000 BOS-Teilnehmern allein groß genug ist, um Ausrüster/ Hersteller zu einem kommerziellen Markteintritt in den Endgerätemarkt zu bewegen. Für die praktische Nutzung des Spektrums ist daher neben einer europaweiten Standardisierung der Bänder auch eine europäisch koordinierte Nachfrage entscheidend, um einen unter Wettbewerbsbedingungen kommerziell tragfähigen Endgerätemarkt mit verschiedenen Endgeräteherstellern zu schaffen.



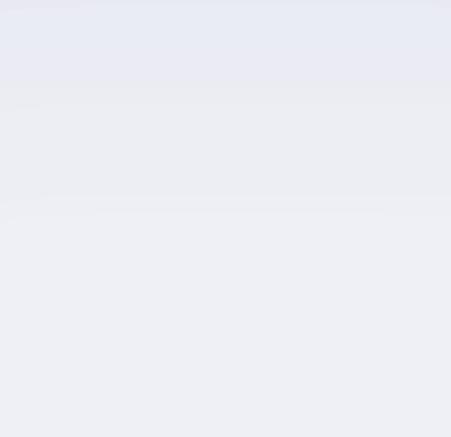


Setzen Sie auf 25 Jahre Expertise im Bereich Massendatenanalyse.


SCOPE ist der hoch performante Analyse- und Knowledge Hub Made in Germany. Mit SCOPE kumulieren Sie Ihre Daten und Informationen in einem System und schaffen damit die Grundlage für Wissen, das durch effiziente Auswertung gezielt zur Einleitung konkreter Maßnahmen genutzt werden kann.




All-source Massendatenanalyse mit SCOPE: das sind 25 Jahre Domänenerfahrung für datenbasierte Entscheidungsfindung Made in Germany.
EPK | 20.-21.05. | Stand 144






















ERPROBT. EFFIZIENT. PERFORMANT.




Eigentlich sollte das psychiatrische Gutachten von Taleb A. – dem Beschuldigten beim Anschlag in Magdeburg – dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Anschlag bereits vor Ostern vorliegen. Die Innenministerin Sachsen-Anhalts, Tamara Zieschang (CDU), teilte jedoch in ihrer Rede auf dem Polizeitag Magdeburg mit, dass dies noch nicht geschehen sei. Nicht nur zur Frage der Schuldfähigkeit könnte dieses Gutachten für mehr Klarheit sorgen. Psychische Erkrankungen bei Straftäterinnen und Straftätern rücken zunehmend in den Fokus der polizeilichen Arbeit. „Das ist etwas, das viele Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer täglichen Arbeit merken. Die Landespolizeien sind zunehmend mit psychisch-auffälligen Menschen konfrontiert“, erklärte Zieschang. Die Gewalttaten von Aschaffenburg und Mannheim Anfang dieses Jahres verdeutlichten, dass einige dieser psychisch auffälligen Menschen potenziell gefährlich werden könnten.
In Aschaffenburg war im Januar ein Mann mit einem Messer auf eine Kitagruppe losgegangen. Die Ermittler fanden nach der Tat schnell Hinweise auf eine psychische Erkrankung – unter anderem entsprechende Medikamente in seinen Wohnräumen. Auch der Tatverdächtige, der im März in Mannheim durch eine Fußgängerzone gerast sein und dabei zwei Menschen getötet haben soll, befand sich nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim in der Vergangenheit regelmäßig in ärztlicher beziehungsweise psychiatrischer Behandlung – zuletzt im vergangenen Jahr auch stationär.
Erneute Einschätzung der Gefahr
„Auch wegen der Gefahr von Nachahmungstaten nach Aschaffenburg und Mannheim war es uns wichtig, dass die Landespolizei in den letzten Wochen Menschen, die nach polizeilichem Kenntnisstand psychische Auffälligkeiten aufweisen, einer aktuellen Gefährdungsein-
Wie Ermittelnde den Fokus auf die Täter legen
(BS/Mirjam Klinger) Die Frage nach dem „Wer“ rückte wenige Minuten nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Während sich die mediale Debatte auf den Täter konzentrierte, arbeiten die Sicherheitsbehörden längst im Hintergrund an der Einschätzung sogenannter „Personen mit Risikopotenzial“.

Laut dem innenpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalts, Rüdiger Erben (Mitte), müssen aus der Amokfahrt in Magdeburg Konsequenzen gezogen werden. „Die Bürgerinnen und Bürger – nicht nur in unserem Land – fragen berechtigterweise: Was tut ihr nun, damit so etwas nicht noch einmal passiert?“ Foto: BS/Klinger
schätzung unterzieht“, erläuterte die Innenministerin. Ihr Ministerium beauftragte Anfang Februar 2025 die Polizeiinspektionen Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg und Stendal sowie das Landeskriminalamt (LKA) damit, umgehend Prüfgruppen einzusetzen, um mögliche Gefahren im Rahmen von Personen mit psychischen Auffälligkeiten zu erkennen. Die betroffenen Personen sind nach Angaben des Innenministeriums Sachsen-Anhalt in einem bundesländerübergreifenden Informationssystem der Polizei mit dem personengebundenen Hinweis „Psychische und Verhaltensstörung“ gespeichert. In Sachsen-Anhalt betraf dies zum Zeitpunkt der Prüfung insgesamt 180 Menschen. Die aktuelle Gefährdungseinschätzung wurde laut Zieschang inzwischen in allen Flächeninspektionen vorgenommen. „Auch wenn wir wissen, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein unmittelbares Einschreiten der Polizei notwendig ist, werden wir
trotzdem als Landespolizei den einen oder anderen noch mal genauer betrachten.“ Gerade beim Umgang mit psychisch auffälligen Menschen sei die Polizei zwingend auf die Mitwirkung anderer Akteure angewiesen. Deshalb sei eine Modernisierung der Informationsarchitektur der Polizei dringend notwendig.
Bevor es zur Straftat kommt Ein Beispiel für interdisziplinären Austausch und den präventiven Umgang mit psychisch auffälligen Menschen liefert das Präventionsprogramm PeRiskoP. Das Konzept zur Früherkennung von und zum Umgang mit Personen mit Risikopotenzial – kurz PeRiskoP – setzt auf verstärkte Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern, Schulen, Landeskrankenhäusern und Justizvollzugsanstalten, um mögliche Täter frühzeitig zu identifizieren.
Nach einer Pilotphase im Mai 2022 wurde PeRiskoP landesweit in den nordrhein-westfälischen
Polizeibehörden eingeführt. „Die Auswertungen zu möglichen anstehenden Amoktaten in NordrheinWestfalen (NRW) haben gezeigt, dass oftmals bei den Tätern oder Täterinnen nicht unbedingt eine politische oder religiöse Motivation vorlag, sondern andere Risikofaktoren“, führte Christian Belz von der Zentralstelle PeRiskoP am LKA NRW auf dem Polizeitag Magdeburg aus. Diese Faktoren – Anzeichen für Wahn oder eine Psychose, aber auch Missbrauch von Alkohol oder Drogen sowie eine Affinität zu Waffen – habe man laut Belz durchaus im Vorfeld erkennen können. Bei der Einschätzung des Gefahrenpotenzials orientiert sich die Polizei NRW an einem festgelegten Kriterienkatalog. Zeigt eine Person Anzeichen der definierten Risikofaktoren, kann das Instrument PeRiskoP zum Einsatz kommen. In sogenannten Fallkonferenzen tauschen sich Polizei und weitere beteiligte Stellen wie Schulen,
Gesundheitsämter oder psychiatrische Einrichtungen aus. Ziel ist es, das Risiko gemeinsam einzuschätzen und geeignete Maßnahmen möglichst rasch umzusetzen. Neben der Polizei in NRW soll das Präventionsprogramm zukünftig auch in anderen Bundesländern wie Hessen Anwendung finden. Lob für das Projekt gab es zudem auch aus Sachsen-Anhalt. Christiane Bergmann, die Abteilungsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Innenministeriums, erklärte, dass sie zu Beginn des Projektes zwar äuserst kritisch war – nun jedoch müsse man die dortige Polizei beglückwünschen. „Herzlichen Dank an NordrheinWestfalen, dass wir alle dort nun weiter ansetzen können.“
Neue Regelung im Gespräch In Sachsen-Anhalt, ließ Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalts anklingen, werde sich der Landtag im Rahmen der Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) mit dem Umgang mit psychisch auffälligen Menschen befassen. Zwar sei die Thematik im aktuellen Entwurf der Gesetzesnovelle noch nicht inkludiert, jedoch „haben Gesetzesvorhaben ja die Besonderheit, dass das gesetzt wird, was am Ende der Landtag beschließt. Wir sind in die Beratung gerade erst eingestiegen“, so Erben. Zuvor hatte auch die Innenministerin Zieschang eine solche Einbindung eines neuen Rahmens für den Umgang mit psychisch auffälligen Menschen in Ausblick gestellt. Konkret erklärte sie: "Wir prüfen im Augenblick, ob wir mit Blick auf die Thematik 'psychisch Auffällige', vielleicht den Austausch mit den psychologischen Einrichtungen verbessern können." Am Ende gehe es um den Schutz und die Sicherheit für die Menschen im Land. „Deswegen überprüfen wir dort im Augenblick sehr sorgfältig, ob wir da vielleicht noch im laufenden parlamentarischen Verfahren Vorschläge und Ideen haben.“
16.06.2025 Digitaler Polizeitag ` Kinderpornographie – sechs Jahre nach Lügde

27.08.2025 Polizeitag Mainz ` Krisenresilienz der Sicherheitsbehörden
01.10.2025 Polizeitag Potsdam ` Innovationen in der Polizeiarbeit: Einsatz fortschrittlicher Technologie zur Bekämpfung von Kriminalität und Erhöhung der Sicherheit
27.11.2025 Polizeitag München ` Digitale Einsatzunterstützung

www.polizeitage.de
Wem gehört unsere digitale Zukunft?
(BS/Fritz Rudolf Körper) Stellen Sie sich vor, Sie flüstern jemandem etwas Vertrauliches ins Ohr – und am anderen Ende der Welt hört jemand mit. Kein Science-Fiction-Szenario, sondern digitale Realität. Wollen wir wirklich riskieren, dass politische Kräfte außerhalb Europas bei unseren Anfragen mitlesen, die Logik von Such-Algorithmen definieren – und im Zweifel das Ergebnis beeinflussen?
Digitale Souveränität bedeutet, dass ein Staat selbst entscheidet, wie digitale Technologien genutzt und geschützt werden – unabhängig, sicher und auf Basis eigener Interessen. Insbesondere im Bereich der Cyber-Sicherheit ist das zentral: Kontrolle über Server, Cloud-Dienste und Netzwerke, Schutz sensibler Daten vor fremdem Zugriff und die Fähigkeit, auf digitale Bedrohungen eigenständig zu reagieren. Doch Europa ist in hohem Maße abhängig – von US-amerikanischen und chinesischen Technologiekonzernen. Diese Abhängigkeit mag im Alltag unsichtbar bleiben, wird aber in geopolitischen Spannungen wie dem Krieg in der Ukraine oder im Konflikt mit China zur strategischen Schwachstelle.
Richtung digitale Unabhängigkeit Auch auf Bundesebene findet das Thema zunehmend Beachtung: Im neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union werden die Nutzung automatisierter Datenverarbeitung, Recherche und Datenanalyse sowie der nachträgliche biometrische Abgleich mit öffentlich zugänglichen

Nach einer Phase der Konzeptionierung tritt das Programm P20 nun in die Umsetzungsphase ein. Foto: BS/emil, stock.adobe.com
Internetdaten – auch unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz – ausdrücklich im Zusammenhang mit digitaler Souveränität thematisiert. Ein Schritt in die richtige Richtung ist der Entschließungsantrag im Bundesrat, eingebracht unter anderem von Sachsen-Anhalt und Bayern: Das darin formulierte Ziel –bereits im Programm P20 festgelegt – ist der Aufbau eines gemeinsamen Datenhauses für die Polizei des Bundes und der Länder. Es soll die Grundlage für eine einheitlich betriebene, automatisierte Plattform
zur Datenverarbeitung und -analyse schaffen: eine längst überfällige Maßnahme. Doch der Antrag sieht auch die mögliche interimsmäßige Bereitstellung einer solchen Plattform vor – eine Übergangslösung, die uns in genau den Abhängigkeiten halten würde, von denen wir uns eigentlich befreien wollen. Digitale Souveränität darf kein Etappenziel bleiben. Sie muss politisch priorisiert, dauerhaft finanziert und strategisch gedacht werden. Alles andere bedeutet Stillstand – und bleibt hinter den sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit zurück.
Ein souveränes digitales Europa beginnt nicht morgen – sondern mit den Entscheidungen, die wir heute treffen.

Mehrfach brennt es in den vergangenen Monaten in den Toiletten einer Berufsschule in Hechingen. Der Verdacht: Die Täter folgen einem TikTok-Trend. Die sogenannte „Devious Licks“-Challenge ist zwar nicht neu, kursiert aber weiterhin in den sozialen Netzwerken. Schon 2022 kam es deutschlandweit vermehrt zu Fällen von Vandalismus und Brandstiftung an Schulen. Dabei zündeten Schülerinnen und Schüler bewusst Toilettenpapier oder Handtücher in Schultoiletten an. In mehreren Fällen entwickelten sich daraus so schwere Brände, dass die Feuerwehr eingreifen musste. Die Täterinnen und Täter brachten sich dabei mitunter selbst sowie andere in ernsthafte Gefahr. Immer wieder verbreiten sich TikTok-Challenges unter Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es darum, teilweise scherzhafte, aber auch –im schlimmsten Fall – lebensgefährliche Aufgaben zu erfüllen. Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen untersuchte die Verbreitung und Wahrnehmung von TikTok-Challenges. Dabei zeigte sich: Rund ein Drittel der analysierten Videos enthielt potenziell schädliche Inhalte – etwa ein Prozent sogar potenziell tödliche. Doch nicht nur Challenges, sondern auch gewaltverherrlichende Videos sind Teil der Plattformen. Sie werden Jugendlichen oft ungefragt angezeigt. Laut der Studie stoßen über 60 Prozent der minderjährigen TikTok-User regelmäßig auf verstörende Inhalte. Fast die Hälfte zeigt absichtliche Verletzungen, 40 Prozent extremistisches Gedankengut. Die Frage, wie weit der Einfluss reicht, kommt gerade mit dem Blick auf die gestiegenen Zahlen der Gewaltverbrechen von Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr wieder auf. Die kürzlich vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 (PKS) verzeichnete in diesem Deliktsfeld 13.755 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren – ein An-
Wie die Sozialen Medien die Polizeiliche Kriminalstatistik beeinflussen
(BS/Mirjam Klinger) Radikalisierung, Peer Pressure und Mobbing: Soziale Medien bieten längst nicht mehr nur Raum für Tanzvideos oder neue Foodtrends. Immer wieder werden Gewalttaten und gefährliche Challenges auf Plattformen wie TikTok verbreitet. Gewalttaten, die sich auch auf die Zahlen der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik niederschlagen. Die Verbindung zwischen Sozialen Medien und Jugendkriminalität ist nicht zu leugnen – aber komplex.

Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom steigt die tägliche Smartphone-Zeit mit dem Alter deutlich an – von durchschnittlich 37 Minuten bei
stärkere Orientierung an gewaltgeprägten Männlichkeitsnormen. „Es sind daher solch kulturelle Veränderungen, die sich kurz mit ‚Gewalt ist wieder cooler geworden‘ zusammenfassen lassen.“
Einfluss auf die Psyche Wie Soziale Medien die Psyche von Jugendlichen und Kindern beeinflussen, untersucht die Cyber-Psychologin Catarina Katzer: „Digitale Räume sind zu einem neuen Koordinatensystem für emotionale und kognitive Prozesse sowie konkretes Verhalten geworden“, erklärt Katzer gegenüber dem Behörden Spiegel. Vor allem Life-Video-StreamingPlattformen wie TikTok würden
„[D]urch den digitalen Raum ist eine vollkommen neue Tätersituation entstanden [...].“
Catarina Katzer, Cyber-Psychologin
stieg um ganze 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren gab es einen Zuwachs – die Zahl der Tatverdächtigen stieg um 3,8 Prozent auf 31.383. Ähnlich viele tatverdächtige Jugendliche im Bereich der Gewaltkriminalität gab es im Jahr 2011. Nach einem Rückgang in den Folgejahren kam es ab 2021 wieder zu einem steilen Anstieg. Damals wurde das auch mit psychischen Belastungen durch die Corona-Maßnahmen begründet. „Wir haben nach dem Ende der Covid-19-Pandemie tatsächlich einen Anstieg der Jugendkriminalität gesehen. Hierfür war aus meiner Sicht in erster Linie die Normalisierung des Jugendalltags verantwortlich“, teilt Prof. Dr. Dirk Baier, Dozent für Kriminologie an der Universität Zürich, dem Behörden Spiegel mit. Die Zunahme von Gewalt führt er jedoch auf problematische Verhaltensvorbilder zurück, die über soziale Medien verbreitet werden. Laut Baier gibt es „leider noch kaum wissenschaftliche Studien, die die Rolle der Sozialen Medien als Einflussfaktor von Jugendgewalt und Jugendextremismus untersucht haben.“ Zudem beobachtet Baier eine
hierbei eine immer größere Bedeutung bei minderjährigen Nutzern einnehmen. Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs) von 2022 nutzt jedes zweite Kind zwischen sechs und zehn Jahren inzwischen die Plattform. Durch die häufige Nutzung entstehe eine emotionale Bindung sowohl zur Plattform selbst als auch zu den Erstellerinnen und Erstellern der Videos. So werden laut Katzer Meinungen schneller und unreflektierter in das eigene Verhalten übernommen. „Aus psychologischer Sicht ist durch den digitalen Raum eine vollkommen neue Tätersituation entstanden, die deutliche Auswirkungen auf emotionale und kognitive Prozesse hat.“ Das Handeln per Bildschirm oder Touchscreen, ohne direkte körperliche Teilnahme, verändere die Wahrnehmung.
„Durch die Trennung der Handlung, die im virtuellen Raum stattfindet, und der physischen Präsenz, die vor dem Bildschirm sitzen bleibt, entsteht eine emotionale Distanz zu sich selbst. Die Täter entfernen sich psychologisch gesehen immer mehr von ihren Taten, da sie diese analog nicht miterleben“, erläutert Katzer
Auch die Distanz zu den Opfern spiele eine Rolle – ohne sichtbare Reaktion fehle das Mitgefühl. Der Reiz, bei etwas Verbotenem zuzusehen, sei gerade für Jugendliche groß – und im digitalen Raum besonders leicht zugänglich. Zudem verwischten die Grenzen zwischen realer und virtueller Gewalt: „Dies wird deutlich, wenn reales Verprügeln, das auf dem Schulhof stattfindet, oder Jugendliche in peinlichen, intimen Situationen gefilmt und im Internet gezeigt werden.“
Der Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei Brandenburg, Prof. Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger, sieht noch eine dritte Problematik in der Nutzung von Sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche. Der Wunsch nach Views, Likes und Follower-Zahlen führe zu einem Druck, hierfür aufmerksamkeitsstarke und somit teilbare Inhalte liefern zu müssen. „Dies könnte aus meiner Sicht einerseits erklären, warum sich gerade solche Inhalte schnell verbreiten, andererseits aber auch, warum teilweise strafbare Handlungen begangen werden, um Content zu generieren.“
Lösungen müssen früh ansetzen
Sowohl Katzer als auch Rüdiger sehen im Umgang mit Sozialen Medien deutlichen Handlungsbedarf –durch die Politik und von den Plattformen selbst. „Letztlich brauchen wir eine digitale Sicherheitsarchitektur, die auch wirklich den Willen hat, Minderjährige vor Straftaten im digitalen Raum zu schützen“, betont der Cybercrime-Experte. Rüdiger sieht hier eine Analogie zur Sicherheitsarchitektur im Straßenverkehr. Wie im digitalen Raum seien auch dort verschiedene Akteure und Maßnahmen notwendig, um eine risikominimierte Teilnahme am Straßenverkehr für Minderjährige zu ermöglichen. „Das fängt bei den Eltern an, die die Risiken dieses Raumes kennen und ihre Kinder darauf vorbereiten, das geht weiter über die Schulen und die Lehrer. Gleichzeitig haben wir eine Vielzahl von Gesetzen, Regeln und auch technischen Maßnahmen geschaffen, vom Gehweg über die Ampel bis zur Fahrerlaubnis. Am Ende kontrollieren auch noch verschiedenste Institutionen diesen Raum – vom
Foto: BS/Seventyfour, stock.adobe.com
Ordnungsamt bis zur Polizeistreife“, so Rüdiger. Diese Struktur müsse auf das Internet übertragen werden – auf Grundlage einer echten Initiative, um allen Erwachsenen digitale Bildung zu vermitteln, damit sie das Wissen an Kinder weitergeben könnten. Da dies allein jedoch nicht ausreiche, plädiert der Leiter des Instituts für Cyberkriminologie für eine verpflichtende digitale Bildung ab der 1. Klasse an jeder Schule in Deutschland. Darüber hinaus fordert Rüdiger konkrete Maßnahmen aufseiten der Plattformbetreiber: „Dann brauchen wir das Äquivalent zu Gehwegen und Ampeln, d. h. die Betreiber von Social Media, Messengern, OnlineSpielen und Co. müssen ernsthafte Vorschläge zum Jugendschutz vorlegen – das kann von Altersverifikation über verbindliche Standards für Content-Moderatoren – z. B. eine staatliche Prüfung – bis hin zu einer gesellschaftlichen Diskussion über Social-Media-Verbote reichen.“ Gleichzeitig müssten sich auch die
Von und mit allen Seiten
Die Bundeszentrale für Kinderund Jugendmedienschutz (BzKJ) schließt sich vielen dieser Forderungen an. „Die BzKJ verfolgt einen ganzeinheitlichen Ansatz bei der Ausgestaltung eines modernen Kinder- und Jugendmedienschutzes, der die Kinderrechte auf Schutz, Befähigung und Teilhabe umfasst“, erläutert eine Sprecherin der Zentrale auf Anfrage des Behörden Spiegel. Kinder und Jugendliche sollen dadurch nicht nur vor möglichen Risiken geschützt werden. Ihnen soll auch eine altersgerechte Nutzung ermöglicht werden. Die bei der BzKJ angesiedelte Stelle „KidD“ überwacht, ob Plattformen wie TikTok oder Instagram ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen – etwa durch Meldefunktionen, Altersverifikation oder sichere Voreinstellungen. Zudem organisiert die BzKJ das Dialogformat „Zukunftswerkstatt“, bei dem Behörden, Plattformen, Wissenschaft und Jugendhilfe gemeinsam Strategien für besseren Schutz und mehr Teilhabe junger Nutzer entwickeln. Auch Kinder und Jugendliche selbst werden beteiligt. Geförderte Projekte der
„Letztlich brauchen wir eine digitale Sicherheitsarchitektur, die auch den Willen hat, Minderjährige im digitalen Raum zu schützen.“
Prof. Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei Brandenburg
BzKJ stärken digitale Teilhabe und Selbstschutz – durch kindgerechte Informationen zu Themen wie Cyber-Mobbing oder Hatespeech. Ziel ist es, Kindern nicht nur passiven Schutz, sondern aktive Medienkompetenz zu vermitteln. Trotz aller besorgniserregenden Entwicklungen gibt es auch Grund zur Hoffnung: Laut dem Kriminologen Dirk Baier zeigt die aktuelle Kriminalstatistik, dass sich die Dynamik des Anstiegs bereits abschwächt. Er geht davon aus, dass bald eine Stagnation oder sogar ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten sein wird. Entscheidend wird nun sein, dass Prävention, Medienbildung und Schutzmaßnahmen weiter gestärkt werden.
Sicherheitsbehörden stärker auf das Netz als Kriminalitäts- und Interventionsraum einstellen. Auch für Katzer steht fest: Prävention gegen Kinder- und Jugendgewalt muss früh ansetzen – flächendeckend und bereits bei den Jüngsten. „Internationale Wissenschaftler forderten bereits 2016 neue Strukturen der Gewaltprävention – Ausbildungs-, Beratungsund Hilfesysteme – sowie altersund geschlechtsgerechte Konzepte und Lerninhalte, die individuelle, soziale und kulturelle Faktoren berücksichtigen und mit Medienerziehung verbinden.“ Neben der Präventionsarbeit nennt sie drei weitere zentrale Punkte: Erstens müssten gesetzliche Bestimmungen angepasst werden. „Opfer von digitaler Gewalt, insbesondere von CyberMobbing, fühlen sich hilflos, auch weil die Täterinnen und Täter meist ungeschoren davonkommen. Ein Cyber-Mobbing-Gesetz sowie verbesserte Aufklärungsmöglichkeiten wären sinnvoll.“ Zweitens brauche es mehr Hilfeangebote. „Da die Zahl der jugendlichen Betroffenen mit Suizidgedanken gerade bei CyberMobbing seit Jahren ansteigt, ist eine schnelle Reaktion und Hilfe besonders wichtig: Ein SOS-Button auf allen Sozialen Netzwerken, der sofortige Kontaktaufnahme garantiert, wäre sinnvoll.“ In Frankreich gibt es seit 2023 einen solchen „Sicherheitsknopf“ – Betroffene werden direkt an eine Hotline mit psychologischer und juristischer Beratung weitergeleitet. Drittens plädiert Katzer für den Einsatz technologischer Hilfen: „Innovative Tools mit psychologischer Wirkung wie z. B. Pop-ups, Chatbots etc., die durch KI beschreiben, was man als User gerade tut, fungieren wie eine Art digitaler Spiegel, der das eigene Handeln vorführt, zum Nachdenken anregt und aufzeigt, inwiefern man sich u. U. gerade strafbar macht und was dieses Verhalten bei den Betroffenen auslösen kann.“
Für das bunten Treiben der Feierwütigen auf den Mainzer Straßen am Rosenmontag hatten einige rheinland-pfälzische Polizeikräfte kaum einen Blick übrig. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Geschehen über den Köpfen der Fastnachterinnen und Fastnachtern. Denn wie Matthias Bockius, Pressesprecher beim Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz erklärte, sind rheinland-pfälzische Polizeikräfte seit Anfang 2024 im gesamten Bundesgebiet bei Einsatzlagen im Rahmen der Drohnendetektion und Drohnenabwehr aktiv. Einer dieser Einsätze fand am besagten Rosenmontagszug in Mainz statt –aber auch bei den Drohnenüberflüge im Luftraum der BASF, den Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe oder der Ramstein Air Base überwachten Polizistinnen und Polizisten des Bundeslandes den Luftraum.
Es mangelt an eindeutigen Zuständigkeiten
Anlässe für Polizeieinsätze zur Drohnenabwehr gibt es viele, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sie ermöglichen, sind allerdings undurchsichtig. 2023 legte das Bundesministerium des Inneren (BMI) eine Novellierung des Bundespolizeigesetzes vor. Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass die Bundespolizei künftig technologische Mittel gegen unbemannte Fahrzeugsysteme einsetzen darf, falls von den Systemen Gefahr ausgeht. Die technischen Mittel „reichen von Netzwerfern über elektromagnetische Impulse und die Störung von
Jährlich steigen die Temperaturen in Deutschland. Mediterrane Verhältnisse sind bald kein Szenario mehr, sondern teilweise schon Realität. Was für den Einen oder Anderen einen schönen Sommer verspricht, stellt für die Vegetation und die Böden in Deutschland einen Stresstest dar. Schon Anfang April dieses Jahres warnten Meteorologinnen und Meteorologen vor zu trockenen Böden. Dies unterstützt die Entstehung von Waldund Vegetationsbränden. Ein Blick in die Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) zeigt einen Anstieg der Anzahl der Brände und der betroffenen Fläche über die vergangenen Jahre. Im Jahr 2022, dem schlimmsten Jahr in der näheren Vergangenheit, gab es nach Angaben des BMEL knapp 2.400 Waldbrände in Deutschland, die eine Fläche von über 3.000 Hektar in Mitleidenschaft gezogen haben.
Zwei fliegen, einer kommt Mit viel Stolz verkündete das Land Niedersachsen 2023 die Stationierung von zwei Löschflugzeugen des Typs AT 802, welche vom spanischen Unternehmen „Titan Firefighting Company SL“ betrieben werden, auf einem Flughafen bei Braunschweig. Diese waren Teil der deutschen Ressource im europäischen Katastrophenschutz. „Eine aus EU-, Bundes- und Landesmitteln finanzierte niedersächsische Einheit von Löschflugzeugen ist ein wichtiger Schritt hin zu einer schnelleren und effektiveren Kontrolle dieser zerstörerischen Brände“, erklärte damals die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Doch damit ist nach zwei Jahren Schluss.
Ein Sprecher des Innenministeriums teilte auf Behörden Spiegel-Anfrage mit, dass die Vorhaltung von Anfang an auf einen zweijährigen Zeitraum für die Jahre 2023 und 2024 begrenzt gewesen sei. Als Erklärung gab er an: „Für die Vorhal-
Die Zuständigkeiten bei der Drohnenbekämpfung bleiben unklar
(BS/mk/jb) Die Drohnensichtungen über Bundeswehrliegenschaften und Kritischer Infrastruktur nehmen zu. Bisher fehlen aber klare Regelungen und Zuständigkeiten, um stringent dagegen vorzugehen. Die Koalitionspartner versprechen Abhilfe. Die Bundeswehr macht unterdessen Pläne für den Ernstfall.

Drohnenflüge über Kritische Infrastruktur sind keine Seltenheit. Die Bekämpfung gestaltet sich schwierig. Foto: BS/Sebaonflames, pixabay.com
Funkverbindungen bis hin zur physischen Einwirkung auf Drohnen“, so das BMI. Der Gesetzentwurf befindet sich jedoch aktuell noch im parlamentarischen Verfahren. Eine klare Regelung durch den Bund bleibt also weiter aus. Zudem fehlt es auf Landesebene an Einheitlichkeit. Fliegt ein unbemanntes System über eine Bundesländergrenze, wechseln die Zuständigkeiten und eine Verfolgung
bzw. eine Abwehr wird erheblich erschwert. Kritik an dem Gesetzesgewirr kommt unter anderem von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG): „Auch an dieser Stelle wird die Überschneidung von Innerer und äußerer Sicherheit deutlich. Umso wichtiger ist die klare Zuweisung von Zuständigkeiten und Befugnissen“, betonte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der DPolG gegenüber dem Behörden Spiegel. Die
Länder müssten ihre Aufgaben bei der Gefahrenabwehr wahrnehmen und sich entsprechend ausstatten. Außerdem müsse der Bund ein entsprechendes Gesetz hervorbringen: „Nancy Faeser hat ein Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen nicht zuwege gebracht, das muss die neue Bundesregierung jetzt rasch nachholen“, so Wendt. Mit dem Operationsplan Deutschland (OP PLAN) regelt die Bundeswehr den militärischen Anteil der zivilen Verteidigung. Neben der Sicherstellung des Aufmarsches alliierter Kräfte, zähle dazu auch, zu gewährleisten, dass die Leistungsfähigkeit Kritischer Infrastruktur im Krisen- und Verteidigungsfall weiter besteht, erläuterte Generalleutnant Andre Bodemann, Stellvertreter des Befehlshabers des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr und Kommandeur für territoriale Aufgaben. Das schließt auch mögliche Angriffe mit unbemannten Systemen ein. Denn „Drohnen sind ein Gamechange und deshalb ist Drohnenabwehr, gerade, wenn man zu wenig Personal hat, ein Riesenthema“, so Bodemann Abseits des Spannungs- und Verteidigungsfalles und der eigenen Liegenschaften verfügt die Bundeswehr aber über keine Befugnisse, um im Inland mit Waffengewalt gegen Drohnen zu agieren. Doch daran könnte sie etwas ändern. Zum Jahresbeginn wagte die damalige Bundesregierung einen Vorstoß, um die Bundeswehr stärker in die Drohnenabwehr einzubinden. Ein Kabinettsvorschlag sah eine Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes vor. Dieser soll es der Polizei ermöglichen, bei Drohnenüberflügen Kritischer Infrastruktur die Bundeswehr zur Hilfe zu rufen. Das ist aber an Bedingungen geknüpft. Die deutschen Streitkräfte sollen nur dann im Inland gegen Drohnen wirken dürfen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht oder Kritische Infrastruktur bedroht ist. Außerdem muss die grundsätzlich zuständige Polizei mit den eigenen technischen Mitteln dem Problem nicht Herr werden können. „[...] wir sehen dass immer häufiger Drohnen zum Einsatz kommen, die für die Polizei und ihre aktuelle Technik eine zunehmende Herausforderung darstellen. Deshalb ist es notwendig, dass wir im Luftsicherheitsgesetz die Befugnis schaffen, dass auch die Bundeswehr bei schwerwiegenden Gefahren eingreifen darf“, so Faeser. Eine parlamentarische Abstimmung über den Kabinettsbeschluss steht bis heute aus. Der von der SPD erdachte Vorschlag passt durchaus in das Profil der neuen CDU/CSU-geführten Koalition. „Der Bund schafft die rechtlichen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für eine wirksame Drohnendetektion und -abwehr“, heißt es dort.
Löschflugzeuge in Zeiten des Klimawandels (BS/bk) Der Sommer ist nicht nur Reise- und Badezeit, sondern auch der Höhepunkt der Waldbrandsaison. Doch Waldbrände beschränken sich nicht nur auf die Sommermonate. Dieses Jahr wurden die ersten Waldbrände Anfang März in Hessen gemeldet. Während es vor Jahren hieß, dass keine Löschflugzeuge gebraucht würden, sieht es mittlerweile anders aus. Doch während die einen sich die Vorhaltung leisten, bestellen andere diese schon wieder ab.

Nach Angaben der EU-Kommission zählte das Jahr 2023 zu den fünf schlimmsten Waldbrandjahren. Bei der Bekämpfung könnten Löschflugzeuge helfen. Foto: BS/JAH, stock.adobe.com
tung der Löschflugzeuge als deutsche Ressource im europäischen Katastrophenschutz war immer die Mitfinanzierung des Bundes notwendig. Dieser hat die Mitfinanzierung ab 2025 jedoch mit dem Hinweis auf fehlende Haushaltsmittel zurückgezogen.“
Zudem erachte er den alleinigen Betrieb von Löschflugzeugen für und durch das Land Niedersachsen neben den finanziellen Aspekten vor allem aus fachlicher Sicht als nicht sinnvoll. Die Flugzeuge seien in diesem Zeitraum auch nur einmal bei einem Brand im Harz (auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt) und sonst ausschließlich im europäischen Ausland zum Einsatz gekommen. „Für die spezifisch niedersächsischen Erfordernisse hat sich vor diesem Hintergrund herausgestellt, dass Hubschrauber besser für die auftretenden Einsatzszena-
rien geeignet sind“, heißt es aus dem Innenministerium in Hannover. Die Hubschrauber hätten den Vorteil, dass die Anforderungen an die Aufnahmeplätze für Landeplätze und die Aufnahme von Löschwasser flexibler seien. Innenministerin Behrens ließ sich nun mit den Worten zitieren: „Das Land Niedersachsen ist aufgrund der Investitionen in unsere Einsatzmittel zur Vegetationsbrandbekämpfung auch ohne Löschflugzeuge sehr gut aufgestellt. Die Vorhaltung der Flugzeuge in den vergangenen zwei Jahren hat uns dennoch wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen gebracht.“ Sollte sich der Bund zukünftig entschließen, wieder Löschflugzeuge über den europäischen Katastrophenschutzmechanismus in Deutschland zu stationieren, stünden man in Niedersachsen bereit, sich mit den
bereits gesammelten Erfahrungen erneut einzubringen.
Vorhaltungskosten vs. Einnahmeausfälle
Einige Kilometer von Braunschweig, im sachsen-anhaltinischen Landkreis Harz, machen die Verantwortlichen dort weiter, wo die Niedersachsen aufgehört haben. Dort unterzeichnete man einen Mehrjahresvertrag für die Stationierung eines Löschflugzeugs des Typs Dromader PZL M18 B mit dem polnischen Unternehmen Mieleckie Zakłady Lotnicze.
„Infolge des Klimawandels kommt es zu längeren Trockenperioden, höheren Temperaturen und häufigeren Extremwetterlagen. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Vegetations- und Waldbränden erheblich“, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Harz.
So gab es im Landkreis 2022 aufgrund verschiedener Einflussfaktoren im Bereich des Brockens einen Brand im unwegsamen Gelände, der durch Bodenkräfte nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Dies führte schlussendlich zum Ausrufen des Katastrophenfalls und zum Einsatz verschiedenster luftgestützter Einsatzmittel. Auch wenn die Anschaffung und Wartung eines Löschflugzeugs kostspielig sei, stünden diesen Ausgaben potenziell hohe Folgekosten durch unkontrollierte Großbrände gegenüber – etwa durch zerstörte Wälder, Gebäude, Tourismusausfälle, usw. Für die jährliche Vorhaltung investiert der Landkreis rund 267.000 Euro. Die Einsatzstunden zur Brandbekämpfung werden durch die anfordernden Gemeinden beglichen.
Nur im Rahmen von rescEU „Der Einsatzwert von Löschflugzeugen, die passend zur Einsatzlage eingesetzt werden, ist relativ hoch –dies zeigt sich auch gerade wieder im Harz mit dem dort durch den Landkreis stationierten ‚Dromader‘“, sagt Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV). Eine Stationierung von weiteren kleineren Flugzeugen könnte im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens „rescEU“ sinnvoll sein. Größere Löschflugzeuge, wie die Canadair, die 6.000 Liter pro Flugzeug abwerfen können, sollten nur in Deutschland realisiert werden, wenn sie über das EU-Katastrophenschutzverfahren geplant und grenzübergreifend eingesetzt würden, zeigt sich Banse überzeugt. „Generell halte ich Hubschrauber für effektiver in den meisten Einsatzlagen und durch die Synergieeffekte weiterhin für multifunktionaler“, mahnt der DFV-Präsident jedoch abschließend an. Der Ausbau der Flotte sollte vorrangig betrieben werden. Immer sei jedoch zu beachten, wie sich die weitere Einsatzlage mit den Auswirkungen des Klimawandels verändert.
Dass die Medium-Altitude-Long-Endurance(MALE-) Drohne German Heron TP seit vergangenem Monat in 12.500 Metern Höhe die baltischen Seewege überwacht, war wahrlich kein Selbstläufer. Die Beschaffung des Systems des israelischen Rüstungsunternehmens IAI wurde von Anfang an von Kontroversen und Kritik begleitet.
Am 13. Juni 2018 billigte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Beschaffung. Bis die ersten Systeme bei der Luftwaffe zuliefen, mussten jedoch noch weitere sechs Jahre verstreichen. Im Sommer 2024 leaste die Bundeswehr sechs Aufklärungsdrohnen vom israelischen Hersteller. Von einer möglichen Bewaffnung der Drohne – deren Bedienung Angehörige der Bundeswehr in Israel erlernen – sahen die Verantwortlichen aber zunächst ab. Gerade die Option der Doppelnutzung als Aufklärungs- und Kampfdrohne war jedoch Kern der Kritik an der Heron-TP-Beschaffung. Vor allem vonseiten der SPD formierte sich Widerstand gegen den Einsatz einer Kampfdrohne durch die Bundeswehr. Seitdem ist die Drohne auf dem Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein stationiert. In den kommenden Jahren sollen bis zu sechs Systeme von Deutschland aus betrieben werden. Die Bundeswhr hat aber einige ihrer Heron TP den israelischen Streitkräften (IDF) für den Kampf gegen die Hamas bereitgestellt.
Unbemanntes Großgerät wird zum Nebenstrang
Die Heron TP ist ein Kind der 2000er-Jahre. Der israelische Rüstungskonzern entwickelte die MALE-Drohne als Weiterentwicklung der bereits etablierten, aber
Heron TP geht bei „Baltic Sentry“ in den Einsatz
(BS/jb) Im April setzte die Bundeswehr die Großdrohne German Heron TP erstmals in einem regulären Einsatz außerhalb einer Übung ein. Im Rahmen einer NATO-Mission überwacht sie die Ostsee. Der Aufklärungsmission gingen zehn Jahre Debatte voraus. Mittlerweile dreht sich der Diskurs jedoch um ganz andere Systeme.

Die German Heron TP soll die NATO über der Ostsee durch Aufklärung stärken.
leistungsschwächeren und unbewaffneten Heron. 2010 ging das erste Flugzeugmuster bei den israelischen Luftstreitkräften in Dienst. Seither hat sich die Drohnenkriegsführung in Quantität und Qualität radikal gewandelt. Katalysator und prominentestes Beispiel dieser Entwicklung ist der Krieg in der Ukraine. Bewaffnete Kleinstdrohnen kommen dort in größtmöglichem Umfang zu Aufklärungszwecken oder als Wirkmittel zum Einsatz. Das ist auch dem Verteidigungsmi-
Foto: BS/Ann-Kathrin Steinbring, Bundeswehr
nisterium (BMVg) nicht entgangen. Im April erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass die Bundeswehr in die Beschaffung fliegender teilautonomer Systeme einsteige. Gemeint ist die sogenannte Loitering-Munition – mit Sprengstoff beladene, unbemannte Luftfahrzeuge, die über dem Einsatzgebiet kreisen, um dann auf mögliche Ziele herabzustürzen.
Ein solches Beschaffungsvorhaben ist Neuland in der Bundesrepublik. Dementsprechend beschreitet
das Verteidigungsministerium auch bei der Erprobung neue Wege. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit Loitering-Munition in der Truppe schießen“, stellte der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, Anfang April in Berlin klar. Die Bundeswehr setze auf maximale Beschleunigung, „weil wir das aufgrund der Bedrohungslage müssen“, führte der ranghöchste deutsche Soldat weiter aus. Deshalb erhalten die Soldatinnen und Soldaten zunächst Loitering-Munition mehrerer Hersteller in nennenswerter Anzahl. Deren Einsatz wird anschließend streng evaluiert, um zu entscheiden, ob die Bundeswehr sie in großer Menge beschafft oder weitere Hersteller und alternative Systeme in Betracht zieht. Zwar gibt es seitens des BMVg bislang keine Aussagen, aus welchen Quellen die Systeme bezogen werden sollen, doch die Gerüchteküche brodelt besonders um zwei Lösungen aus deutscher Fertigung von Helsing und Stark. Der 2021 in München gegründete Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI) im Verteidigungssektor, Helsing, hat mit der HX2 eine KI-befähigte Kleinstdrohne für die Massenproduktion im Portfolio. Sie kann gegen militärische Ziele auf Distanzen von bis zu 100 Kilometern wirken. Darüber hinaus bietet Helsing eine Software-Lösung für den Einsatz des Systems in einem Drohnenschwarm an. Die Bundesregierung vergab be-
reits in der Vergangenheit Aufträge an die Münchner; die damals bestellten Systeme waren jedoch für den Einsatz bei den ukrainischen, nicht bei den deutschen Streitkräften bestimmt. Neben Helsing soll auch ein weiteres Münchner Start-up Loitering-Munition für die Bundeswehr produzieren. Stark bietet mit dem System OWE-V ebenfalls eine KI-fähige Drohnenlösung an. Das System ist zwar etwas größer als das des Stadtrivalen, dafür kann es als Senkrechtstarter ohne zusätzliches Equipment abheben. Ähnlich wie die Lösung der Konkurrenz stellte die OWE-V ihre Leistungsfähigkeit bereits im Ukraine-Krieg unter Beweis.
Was andere Nationen Deutschland voraus haben
Dass die Bundesrepublik bei der Beschaffung autonomer bewaffneter Systeme zu den zögerlichsten Nationen zählt, ist bekannt. Bei Loitering-Munition setzt sich diese Tradition fort. Mit der Switchblade reichen die US-Bemühungen um Entwicklung und Einsatz von Loitering-Drohnen bis in die 2000er-Jahre zurück. 2011 wurden die ersten Systeme offiziell in Dienst gestellt. Vorreiter auf diesem Gebiet sind jedoch die israelischen Streitkräfte: Mit der Harop brachte die israelische Industrie das erste System dieses Typs überhaupt hervor. Auch im europäischen Vergleich gehört Deutschland zu den Nachzüglern: Großbritannien, Spanien, Frankreich, Polen – sie alle haben Loitering-Munition unterschiedlichster Typen im Einsatz. Ob, wann und mit welchem System sich Deutschland in diese Liste einreiht, wird sich – nach den Plänen des Generalinspekteurs – noch in diesem Jahr zeigen.

IM EINSATZ FÜR EINE SICHERE WELT
Eurofighter Tranche 5 „Credible and Capable“
Sichert Kernkompetenzen und mehr als 25.000 Hochtechnologie-Arbeitsplätze in Deutschland Schlüsseltechnologie „Made in Germany“
Unterstützt Weiterentwicklung von Technologien und Fähigkeitsaufwuchs hinsichtlich des Future Combat Air Systems (FCAS)




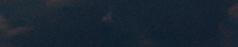


Behörden Spiegel: Wie viel AhrKatastrophe ist in Ihrem Amt drin?
René Schubert: Die Katastrophe war zweifellos der Punkt, an dem die Aktivitäten zur Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in RheinlandPfalz erheblich intensiviert wurden. Es gibt jedoch Erkenntnisse, die aus der Pandemiephase stammen und bereits in den Prozess eingeflossen sind. Zudem gab es schon zuvor Vorarbeiten seitens der Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und der LFKA, bei denen festgestellt wurde, dass wir uns in bestimmten Bereichen als Land besser aufstellen müssen. Die Katastrophe war der entscheidende Moment, der den Prozess sicherlich auch maßgeblich beschleunigt hat. Besonders wertvoll war hier die Enquete-Kommission. Sie hat zahlreiche Empfehlungen abgegeben, die nun in der Umsetzung – soweit es möglich ist – berücksichtigt werden.
Behörden Spiegel: Wie viel war für das Amt durch die verschiedenen Gutachten vorgezeichnet? Welche Vorstellungen konnten Sie selbst einbringen?
Schubert: Es gab natürlich bereits vorbereitende Arbeiten seitens der Kolleginnen und Kollegen, die über langjährige Expertise im Brand- und Katastrophenschutz in RheinlandPfalz verfügen. Mit diesen Kenntnissen wurden damals die Gutachter und das Projektteam beauftragt. In dieses flossen insbesondere die Ergebnisse der Enquete-Kommission ein, die nach der Ahr-Katastrophe eingerichtet wurde. Gutachten und Projektergebnisse sind im Wesentlichen die Leitfäden für die Landesverwaltung geworden. Die weiteren Aktivitäten der Landesverwaltung – sei es in Bezug auf gesetzliche Neuausrichtungen oder die Errichtung des Landesamtes – orientieren sich stark an diesen. Natürlich gibt es im Verlauf des Prozesses auch neue Erkenntnisse. An bestimmten Stellen wird festgestellt, dass sich der Wissensstand weiterentwickelt hat, was dazu führt, dass bestimmte Maßnahmen angepasst oder verändert werden. Zum Beispiel wurde die Struktur des Lagezentrums in den letzten Monaten des vergangenen Jahres nochmals neu bewertet. Insbesondere die Schichtmodelle und die An-
Die Antwort liefert unter anderem der bei Redaktionsschluss noch amtierende Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing (parteilos): „Erstmals bündeln wir an zentraler Stelle sämtliche Frühwarnungen sowie Lage- und Vorsorgeinformationen zu wetterbedingten Naturgefahren, über die wir in Deutschland verfügen.” Denn die Auswirkungen der Ahrtal-Katastrophe hätten gezeigt, dass Warnungen zwar frühzeitig vorgelegen, die sich daraus ergebenden Reaktionen aber gefehlt hätten. Gerade in der Bevölkerung habe man nicht gewusst, was nun zu tun sei. „Und dann muss man auch eine Antwort auf die Fragen bekommen, also: Wie kann ich mich davor schützen? Und dann ist klar, dass Handlungsbedarf abzuwarten keine Option ist. Zu denken, es wird schon nicht so schlimm kommen, ist Selbstbetrug, denn die Prognosen des DWD sind so präzise, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten“, ist Dr. Wissing überzeugt.
Die Präsidentin des DWD, Prof. Dr. Sarah Jones, ergänzt, man wisse aus Erfahrungen und Forschungen, dass Menschen erst handelten, wenn sie sich die Auswirkungen konkret vorstellen könnten und
Aufbau, Anforderungen und Aufgaben des neuen LfBK
(BS) Es gibt nicht viele ihrer Art: Landesämter, die rein für den Katastrophenschutz zuständig sind. Während in den meisten Bundesländern die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in den jeweiligen Innenministerien organisiert wird, geht die rheinland-pfälzische Landesregierung einen anderen Weg. René Schubert, der erste Präsident des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK), erklärt im Gespräch, was das Amt leisten soll. Das Interview führte Bennet Biskup-Klawon.

Herzstück dar, sagt LfBK-Präsident René Schubert.
wesenheit von Kolleginnen und Kollegen wurden überdacht und noch leistungsfähiger gestaltet. Ich hatte die Gelegenheit, als stellvertretender Projektleiter in der damaligen Projektstruktur zum Aufbau des Amtes tätig zu werden. Das war eine wertvolle Chance für mich, die Neuausrichtung kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Meine Erfahrung, die ich sowohl aus meiner langen Dienstzeit in NRW als auch aus meiner Arbeit in verschiedenen Gremien (DFV/AGBF/FNFW) mitbringen konnte, war sicherlich ein zusätzlicher Gewinn für diesen Prozess.
Behörden Spiegel: Wie ist Ihr Amt aufgebaut?
Schubert: Das Landesamt wurde zum 1. Januar gegründet, nachdem das Errichtungsgesetz am 11. Juli des vergangenen Jahres im Landtag von Rheinland-Pfalz einstimmig beschlossen worden war. Das ist ein sehr wichtiges Signal und unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung. Im Vergleich zur alten Struktur, bei der die Feuerwehr- und Kata-
strophenschutzakademie (LFKA) und das Referat 22 der ADD nebeneinander agierten, wurden die Bereiche nun zusammengefasst. Zum Beispiel ist die ehemalige Akademie nun eine eigenständige Abteilung. Technik-Themen wurden in der Abteilung Technik zusammengeführt, während viele der Aufgaben des ehemaligen Referats 22 sowohl im Planungsreferat als auch im Krisenmanagementreferat zu finden sind. Diese Strukturen sind derzeit im Aufbau und bilden die Grundlage für die kommenden Jahre. Die einzelnen Aufgabenbereiche sind bereits strukturiert. Dazu gehören unter anderem Stabsstellen wie der Leitungsstab, in den auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit integriert ist. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Zivile Verteidigung. Hier müssen wir als Behörde nicht nur die Zivilschutzaspekte des Bevölkerungsschutzes behandeln, sondern auch sicherstellen, dass wir im Krisenfall selbst handlungsfähig bleiben. Die Abteilung P ist mit den Themen Risikomanagement und Vorplanung betraut. Hier werden Verfahren zur Risikoanalyse entwickelt
und gleichzeitig die kommunale Gemeinschaft unterstützt sowie die Aufsicht über die Bedarfs- und Entwicklungspläne übernommen. In Zukunft werden Feuerwehrbedarfspläne und Katastrophenschutzbedarfspläne in den Gemeinden und Kreisen erstellt, die fachlich abgestimmt werden müssen. Dazu gehören auch die Zivilschutzplanung, die Beratung zu Kritischer Infrastruktur und die Sensibilisierung der Bevölkerung. Darüber hinaus entwickeln wir auch die Fähigkeit, Ereignisse auszuwerten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen – und das nicht nur für Ereignisse in Rheinland-Pfalz, sondern auch überregional. Hinter diesem neuen Aufbau steht ein umfassendes gutachterliches und als Projekt erarbeitetes Gesamtkonzept, das die Leitlinie für die Landesverwaltung darstellt. Es geht davon aus, dass der Personalaufbau bis 2030 auf etwa 300 Vollzeitäquivalente ansteigt – also mehr als eine Verdopplung der alten Personalstruktur. Derzeit sind wir sehr intensiv mit Personalentwicklungsmaßnahmen beschäftigt, um diese Zielsetzung zu erreichen. Auf unserem Gelände besteht jedoch aktuell ein erheblicher Liegenschaftsmangel. Wir entwickeln daher zügig neue Funktionen in bestehenden Gebäuden und neue Gebäude, um die wachsenden Funktionalitäten unterbringen zu können, was parallel zur Ausbildungsoffensive verläuft.
Behörden Spiegel: Sie haben den operativen Dienst schon zum Jahreswechsel mit dem Lagezentrum begonnen. Was ist das Besondere daran?
Schubert: Das Lagezentrum ist ein zentrales Element der Neuausrichtung. Eine Besonderheit hierbei ist, dass wir vor dem 1. Januar bereits mit dem Betrieb des Lagezentrums
Konkret wissen, was bei Extremwetterlagen zu tun ist (BS/Scarlett Lüsser) Neben den bereits vorhandenen Katastrophenwarn-Apps wie NINA und Katwarn gibt es seit April ein neues Internetportal, betrieben vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dieses zeigt unter anderem ebenfalls eine Karte mit aktuellen Katastrophenwarnungen. Daher stellt sich die Frage, warum es zusätzlich zu den bereits bestehenden WarnApps noch das neue Naturgefahrenportal (NGP) braucht?

begonnen haben. Es wurde baulich bereits abgeschlossen und ist seit Herbst letzten Jahres im Dienstbetrieb. Der Betrieb wird nun ab Sommer 2025 in einen 24/7-Betrieb überführt. Das Lagezentrum ist auf Landesebene eine absolute Neuerung. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die solche Aufgaben meist in die Lagezentren ihrer Innenbehörden integrieren, die überwiegend polizeiliche Aufgaben abbilden, haben wir in Rheinland-Pfalz ein eigenes Zentrum für den Bevölkerungsschutz.
Behörden Spiegel: Kann das LfBK in die Einsatzleitung eingreifen?
Schubert: Sie blicken bereits auf die Neufassung des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG). Das derzeitige LBKG ermöglicht es uns als Land, die Einsatzleitung zu übernehmen, jedoch nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Zukünftig wird es so sein, dass ein Kreis, der feststellt, dass er mit der Lage überfordert ist, die Unterstützung des Landes anfordern kann, sodass das Landesamt die Einsatzleitung übernimmt. Ebenso wird die Übernahme der Einsatzleitung insbesondere dann relevant, wenn eine flächendeckende Lage vorliegt, bei der mehrere Kreise betroffen sind. In solchen Fällen müssen die verfügbaren Ressourcen auf Landesebene gezielt gesteuert werden – nicht nach dem Prinzip „wer zuerst ruft, bekommt alles“, sondern im Sinne einer übergeordneten, bedarfsgerechten Koordination. Ein weiterer Fall tritt ein, wenn wir feststellen, dass eine örtliche Struktur überfordert ist. In diesem Fall können wir ebenfalls die Einsatzleitung übernehmen. Der vierte Fall, der sehr spezifisch ist, betrifft komplexe Strahlenschutzunfälle, die auch heute bereits unter diese Regelung fallen.
wenn auch Handlungsoptionen bekannt, möglich und geübt seien. Darum stelle das Portal eine zentrale Plattform dar, die aktuelle
Warnungen, wissenschaftlich fundierte Analysen und Prognosen zu Wetter und Naturgefahren sowie Handlungs- und Vorsorgeempfehlungen bündele und leicht zugänglich und verständlich aufbereite.
Denn „nur wenn wir über Naturgefahren früh kommunizieren, können wir wirklich Schäden minimieren und Menschenleben schützen“, erklärt Prof. Jones.
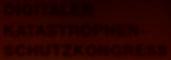
www.katastrophenschutzkongress.de 9.–10. SEPTEMBER 2025

DIGITALER KATASTROPHENSCHUTZKONGRESS

DWD-Daten durch Länder ergänzt Zusätzlich zu den gesammelten meteorologischen Daten des DWD werden die Informationen und Funktionen des NGP durch länderspezifisch gesammelte Daten und Karten ergänzt. Für einen tieferen Einblick werden auch die Länderportale noch einmal deutlich sichtbar verlinkt, sodass die Bevölkerung sich spezifischer über bestimmte Lagen informieren kann. Petra Berg, die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes, erklärt, dass eine Wetterlage nicht gleich eine Naturgefahr sei. Um hier bestmöglich und schnellstmöglich reagieren zu können, brauche es verschiedene Daten, die zusammengeführt und ausgewertet werden müssten. Dr. Wissing ergänzt: „Angesichts der föderalen Hürden in unserem Land zeigt das NGP beispielhaft, wie Bundes- und Landesbehörden zusammenarbeiten können und sollten, um bürgerfreundliche Angebote zu schaffen.“ Neben aktuellen Warnungen zu Lagen und anderen wichtigen Informationen wie Gefahrenstoffwarnungen, die durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ergänzt werden, können Nutzerinnen und Nutzer sich außerdem eine Prognose anzeigen lassen, wie wahrscheinlich ein Gebiet bspw. von einer Hochwasserlage betroffen sein wird. Um dann auch zu wissen, wie man richtig handeln sollte, kann man sich zu den aktuell vier verfügbaren Lagen Hochwasser, Sturmflut, Regen und Frost übersichtlich anzeigen lassen, wie man sich auf die jeweilige Situation vorbereiten kann und was während und nach einer solchen Lage zu tun ist. Geplant ist auch, „das Portal in Zukunft schrittweise um das gesamte Spektrum der Naturgefahren wie Ozonbelastung, Waldbrände, Dürren, Lawinen oder Erdbeben zu erweitern“, erklärt ein Sprecher des DWD.
Behörden Spiegel: Was ist die Aufgabe der BAKS und was zeichnet sie aus?
Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl: Die BAKS ist die einzige ressortübergreifende Weiterbildungsstätte der Bundesregierung im Bereich Sicherheitspolitik. Unsere Hauptzielgruppe sind Angehörige der Ministerien und Behörden. Doch Sicherheitspolitik kann heute nicht mehr nur staatlich gedacht werden – sie muss gesamtgesellschaftlich vermittelt werden. Deshalb binden wir neben staatlichen Akteuren auch Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und die Zivilgesellschaft ein. Unsere Arbeit lässt sich in drei Kernbereiche gliedern: Weiterbildung: Wir vermitteln öffentlich Bediensteten das notwendige Mindset und Handwerkszeug. Vernetzung: Wir bringen Expertinnen und Experten zu sicherheitspolitischen Themen zusammen, um den Austausch auf neutralem Boden zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür waren unsere Workshops zur Nationalen Sicherheitsstrategie.
Kommunikation: Wir fördern das Verständnis für die Leitlinien der deutschen Sicherheitspolitik, insbesondere die integrierte Sicherheitspolitik, wie sie in der Nationalen Sicherheitsstrategie verankert ist.
Behörden Spiegel: Wie reagiert die BAKS auf aktuelle sicherheitspolitische Ereignisse?
Integrierte Sicherheit verständlich vermitteln
(BS) Im Interview macht Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), deutlich, wie die Akademie als Weiterbildungseinrichtung, Netzwerk und Kommunikator Grundlagen der Sicherheitspolitik erläutert, ohne dabei den aktuellen Bezug zu verlieren. Die Fragen stelle Dr. Eva-Charlotte Proll.

Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), moniert, dass viele Bildungseinrichtungen das Thema Sicherheitspolitik kaum abbildeten.
Stahl: Generell vermittelt die Akademie – ähnlich wie eine Schule – vor allem sicherheitspolitische Grundlagen und verfolgt einen langfristigen Ansatz. Wir betreiben keine tagesaktuelle Sicherheitspolitik, sondern schaffen die konzeptionellen Grundlagen dafür. Dennoch passen wir uns aktuellen Entwicklungen an. So bieten wir beispielsweise Seminare zu neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen an – jüngst eines zum Thema Desinformation. Aktuell entsteht ein Seminar zum Klimawandel, das grundlegende Zusammenhänge aufzeigt und die Frage klärt, welche Akteure in der Gesellschaft welchen Beitrag zur Bewältigung leisten können.
Bisweilen klingt die Experimentalserie Land nach Science-Fiction: 2024 erprobten die Soldatinnen und Soldaten des Stabs „Test und Versuch“ mit Unterstützung der Bedarfsträger aus der Truppe den Lasereffektor MILOS-D. Doch wer bei dieser Erzählung an Star Wars und Raumschiff Enterprise denkt, irrt. Ziel der Experimentalserie Land ist es nämlich gerade nicht, langwierig Zukunftstechnologien unter Laborbedingungen für den Tag X zu erproben. Vielmehr strebt das Heer mit der Experimentalserie an, marktverfügbare Produkte für ihren Einsatz im vernetzten System Heer im Sinne der Digitalisierung landbasierter Operationen (D-LBO) zu testen. „Wenn Konzeptionen im Elfenbeinturm entstehen und die Realität auslassen, wird sich ein System auf lange Sicht nicht durchsetzen“, erläuterte Major Christopher Weiss, Dezernent Experimentalserie Land, auf dem Defence Day des Behörden Spiegel. Dementsprechend gestaltete sich auch der sogenannte Einzeltest von MILOS-D. Gemeinsam mit der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91, dem Hersteller MBDA und dem Amt für Heeresentwicklung wurde ein scharfer Schuss auf einem regulären Truppenübungsplatz abgegeben. Der Laserstrahl wirkt gegen Drahtsperren, Minen, Türschlösser und Improvised Explosive Devices (IED). Neben der Erkenntnis, dass MILOS-D unter feldnahen Bedingungen funktionieren kann, nutzt der Stab „Test und Versuch“ Erprobungen dieser Art, um Fragen des praktischen Einsatzes zu klären: Wie schwer ist das Waffensystem? Was bedeutet es für den Infanteristen oder die Infanteristin, es bei sich zu tragen? Welchen militärischen Mehrwert hat es? Über all dem schwebt jedoch die Kernfrage: „Ist das System im Gesamtverbund Heer einsatzfähig?“ Eine Herange-
wir im Austausch mit der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung sowie mit der Akademie Auswärtiger Dienst und ihren Attaché-Lehrgängen. Auch im nachrichtendienstlichen Bereich sind wir vernetzt. Unser Ziel ist es, Verbindungen zu schaffen und gemeinsame Schnittstellen zu identifizieren. Die BAKS bietet dabei den übergeordneten Rahmen, an den sich andere Institutionen mit ihrer Tiefenexpertise anschließen können.
Behörden Spiegel: Bestehen auch internationale Kontakte?
Foto: BS/BAKS
Behörden Spiegel: Wie stehen Sie im Austausch mit Fort- und Weiterbildungseinrichtungen auf Bundesund Landesebene?
Stahl: Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wie Sicherheitspolitik in anderen Bildungseinrichtungen vermittelt wird und wo Anknüpfungspunkte bestehen. Allerdings haben einige Institutionen das Thema noch nicht so verinnerlicht, wie ich es mir wünschen würde. Konkret stehen
Stahl: Ja, insbesondere im Rahmen des European Security and Defence College in Brüssel. Dieses Netzwerk verbindet mehrere europäische Akademien. Wir bringen uns aktiv ein, unter anderem durch die Durchführung eines Moduls in Berlin – beispielsweise im Senior Strategic Course. Dabei vermitteln wir sicherheitspolitische Themen aus deutscher Praxissicht mit Schwerpunkt auf dwe europäischen Verteidigung.
Behörden Spiegel: Sie haben die Nationale Sicherheitsstrategie angesprochen – dabei fällt oft der Begriff der integrierten Sicherheit. Welchen
In der Experimentalserie Land muss sich Innovation beweisen (BS/jb) Im Sinne der Verteidigungspolitischen Richtlinien 2023 leistet das Heer mit der Experimentalserie Land einen Beitrag zur zyklischen Fähigkeitsanpassung. Die Soldatinnen und Soldaten des Stabs „Test und Versuch“ in Munster prüfen die Einsatzfähigkeit innovativer, marktverfügbarer Produkte im Gesamtsystem Heer. Dabei gilt: Ganz gleich, wie potent ein System isoliert sein mag – am Ende zählt der Mehrwert im taktischen Gefechtsverbund.
hensweise, die sich im Heer erst in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. „Wir haben unterschiedliche Rüstungsprojekte lange als Einzelprojekt betrachtet“, erinnerte sich Weiss. Dass das neue Material im Systemzusammenhang Leistung bringen müsse, habe man hintangestellt. Mit der Neuorientierung im Rahmen der D-LBO habe sich dies radikal gewandelt. Im Fokus stehe nun die Verknüpfung aller Sensoren und Wirkmittel über das gesamte Heer hinweg. Den Mittelpunkt dieses Kommunikationsnetzwerkes bildet das Battle-Management-System Sitaware. An dieser Stelle laufen alle Knotenpunkte zusammen. Der Einsatz und sichere Umgang mit diesem Führungsinformationssystem sei Voraussetzung für die Einsatzfähigkeit des Heeres – ebenso für die Anschlussfähigkeit zu den Leistungsbringern aus anderen Dimensionen oder zur Interoperabilität mit Partnernationen, stellte Weiss klar. Mit der Experimentalserie Land stellt das Heer sicher, dass neu angeschafftes Material innerhalb des orchestrierten Gesamtsystems einen Platz findet und einen Mehrwert bietet.
Fähigkeitserprobung in drei Schritten
Zu diesem Zweck setzt sich die Experimentalserie aus zwei vernetzten Säulen zusammen. Zu nennen ist hier zunächst der bereits angeklungene Einzeltest. Ziel dieses Vorgehens sei es, die technische Leistungsfähigkeit und Handhabbarkeit zu bewerten, erläuterte

Im Rahmen der Experimentalserie Land gelang der scharfe Schuss mit dem Lasereffektor MILOS-D auf einem regulären Truppenübungsplatz. Foto: BS/MBDA
Weiss. Taktische Aspekte fänden dabei nur zweitrangig Beachtung. Diese Form der Erprobung kann ganzjährig und wiederholt erfolgen. Darauf aufbauend erfolgt die erste Vernetzung von zwei Systemen. Dieser Schritt ist rein technischer Natur – taktische Aspekte spielen keine Rolle. „Das Ziel ist die technische Machbarkeit“, machte der Dezernent Experimentalserie Land deutlich. Es gelte zu überprüfen, ob das System aus sich heraustreten könne. Mit dem vernetzten System aus zwei Einheiten wurde eine Blackbox geschaffen, um genau das zu erproben. Diesen beiden Erprobungsverfahren steht auf der zweiten Säule die Integration im simulierten Gesamtsystem gegenüber. Die taktische Lage ist bei diesem Schritt entscheidend. Denn das System muss in der Lage sein, im Heeresverbund zu wirken. „Dafür rüsten wir Güter – für den Einsatz im Gefecht“, so Weiss. Die Integrationstestung kann – anders als die übrigen Verfahren – ob ihrer Größe und ihres Umfangs nicht mehrmals im Jahr durchgeführt werden. 2024 beteiligten sich neben dem Stab „Test und Versuch“, bestehend aus einem Panzer- und zwei Jägerzügen, 600 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeitende aus dem Feldheer. Die Truppengattungen mit dem jeweiligen Bedarf begleiten die Integrationstestung und erstellen einen Auswertungsbericht. Im letz-
Einfluss hat das neue Sondervermögen auf den Fortbildungsbereich und das Konzept der integrierten Sicherheit?
Stahl: Integrierte Sicherheit ist ein Leitmotiv. Die Bundesregierung versteht darunter den Schutz von Leben, Freiheit und Lebensgrundlagen. Von integrierter Sicherheit sprechen wir, weil Sicherheit gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich im multilateralen Kontext gewährleistet werden muss. Das ist der Kern der Strategie. Daraus ergibt sich eine Politik der integrierten Sicherheit, die auf drei Handlungsfelder setzt: Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit.
Um das umzusetzen, braucht es Ressourcen – die mit der jüngsten Verfassungsänderung gesichert wurden. Ich erwarte deshalb auch, dass der Bedarf an Fortbildung in diesem Bereich weiter wächst.
Behörden Spiegel: Was bedeutet der Begriff der Wehrhaftigkeit für das Curriculum der BAKS?
Stahl: Die erste Assoziation mit Wehrhaftigkeit ist bei vielen die Bundeswehr. Tatsächlich geht es aber um Verteidigungsfähigkeit im umfassenden Sinne – also auch um Zivile Verteidigung. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, etwa im Umgang mit hybriden Bedrohungen. Nachhaltigkeit schließt den Klimaschutz mit ein.
Diese drei Konzepte lassen sich vereinfacht zusammenfassen, wenn man ans Boxen denkt: Man muss zuschlagen können, Schläge einstecken können und über mehrere Runden durchhalten.
ten Jahr erfolgte das bei 46 Systemen. Erfolge konnten die Soldatinnen und Soldaten, die teilweise zwischen sechs Uhr morgens und 21 Uhr abends auf den Beinen waren, nicht in jedem Fall verzeichnen. Ein Umstand, den Weiss auf den Faktor Zeit und die Vielfalt der eingesetzten Kommunikationssysteme zurückführt. „Es war wie eine Operation am offenen Herzen“, fasste er zusammen.
Die Experimentalserie leistet, was die WTD nicht können
Die Experimentalserie bietet Erkenntnismöglichkeiten, welche unter den laborartigen Bedingungen der WTDs nicht realisierbar sind. Weiss machte das anhand eines Beispiels deutlich: Im Jahr 2023 erprobte der Stab unbemannte Flugsysteme (UAV). Darunter war ein Modell, das durch seine guten Flugeigenschaften und die eingebaute Sensorik zu überzeugen wusste. Während der Serie offenbarte sich aber: Das Luftfahrzeug ist bei zu hoher Luftfeuchtigkeit nicht flugfähig. Gegen Wind und Wetter war die Drohne schlicht nicht gehärtet. Unter den klimatischen Bedingungen einer Fabrikhalle war dies bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht deutlich geworden. „Auch dafür machen wir Einzel- und Integrationstests“, so Weiss. Wesentliches Anliegen der Experimentalserie ist daher auch, eine Schnittstelle zwischen Soldatinnen und Soldaten, den Ingenieursteams hinter der Technik und den Beschaffungsjuristen zu schaffen. Dementsprechend ist Kommunikation ein wesentliches Element aller Testungen. Wie bedeutend diese Zusammenarbeit ist, zeigt der Kommentar eines Industrievertreters zum Integrationstest des Jahres 2023: „So schön die Innovationsromantik auch sein mag –am Ende zählt, was in der Truppe Leistung bringt.“
Null Toleranz gegenüber Gewalt gegen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes
(BS/Lars Mahnke) „Gewalt eskaliert im Bürgerservice – Mitarbeiter haben Angst“, „Bierflasche trifft Busfahrer“, „Polizisten werden attackiert – Passanten jubeln“, „Maskierter geht auf Lehrer los“, „Anstieg der Gewalt gegen Politiker“: Das sind Schlagzeilen, die aus der aktuellen Berichterstattung nicht mehr wegzudenken sind. Sie machen eine alarmierende gesellschaftliche Entwicklung sichtbar, auf die auch aktuelle Statistiken und Studien hinweisen. Diesem Trend entgegenzutreten haben sich Ralf Hövelmann und das Team von #sicherimDienst verschrieben. Der Polizeihauptkommissar ist einer von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stabstelle des NRW-Präventionsnetzwerks #sicherimDienst und zuständig für das Kampagnen- und Veranstaltungsmanagement.

Eine Stadtverwaltung möchte ein Alarmierungssystem für die Mitarbeitenden bei Notfällen einrichten. Aber wie geht das? Ralf Hövelmann vom Netzwerk #sicherimDienst findet eine Antwort unter den vielen Netzwerkpartnern. Das Netzwerk ist Ansprechpartner, stellt Informationen zur Verfügung oder vermittelt an Organisationen, die sich bereits erfolgreich mit dem Problem beschäftigt haben. Auch Veranstaltungen wie Kongresse, Fachtagungen, Messen und Präventionstage besucht Hövelmann, um auf das Thema Gewaltschutz aufmerksam zu machen. Außerdem begleitet er Workshops, in denen Praxistipps vermittelt werden, um den Arbeitsalltag der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sicherer zu machen. Fit genug, um selbst mitzumischen, ist der sportbegeisterte Familienmensch – „Meine Familie ist mein Hobby“ – allemal. Im Internet richtet das Netzwerk unter dem Namen „SICHERE STUNDE“ eine themenorientierte Diskussionsrunde mit Fachleuten als Studiogästen aus. Der Livestream wendet sich an Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, Führungskräfte, Personal- und Berufsvertretungen, Beauftragte für Arbeits- und Gesundheitsmanagement, Trainingsund Lehrpersonal, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und alle Interessierten. In dem neuen monatlichen, offen gehaltenen Online-Format „Frag doch mal das Netzwerk“ können Netzwerkmitglieder, begleitet von Experten, mit anderen Partnern in Austausch treten und Praxisbeispiele miteinander teilen. Elfmal jährlich geht es für Hövelmann und das Netzwerkteam zudem in den Landtag, um den Mandatsträgerinnen und -trägern eine sichere Sprechstunde vor Ort anzubieten. Im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft im vergangenen Jahr hat er mit Kooperationspartnern Bedienstete des ÖPNV nach dem Prinzip „Train the Trainer“ auf mögliche Gefahrensituationen vorbereitet.
Netzwerk mitgebracht
Nach der Ausbildung in Münster und Selm begann der begeisterte Hobbygärtner seinen Polizeidienst in den achtziger Jahren. Die Anfangszeit, die er als Fußstreife auf den Wachen im Kölner Eigelsteinviertel und der Bismarckstraße verbrachte, war noch geprägt vom Terror seitens RAF/RZ und IRA. Anfang der neunziger Jahre wechselte er zum Wachdienst nach Münster und bald darauf ins Personenschutzkommando beim damaligen NRW-Justizminister Rolf Krumsiek Dessen Nachfolger war der spätere Innenminister Fritz Behrens, dem Hövelmann ins Innenministerium
folgte. Während seiner 21 Jahre im Ministerium war er als Redakteur der „Streife“, Mitarbeiterzeitung für die Beschäftigten der Polizei NRW, tätig und absolvierte unter anderem eine Fortbildung im Veranstaltungsmanagement an der Akademie Mont-Cenis in Herne.
In jungen Jahren entwickelte er für die Polizei die ersten InternetAuftritte und eine Corporate Identity, um die Außendarstellung der NRW-Polizei und ihrer Polizeibehörden zu vereinheitlichen. Zudem begleitete er viele Arbeitsgruppen auf
helfen kann“. Teamarbeit ist ihm in der Tat wichtig, wie er sagt: „Ich helfe gerne mit meinem Wissen und meiner Erfahrung.“
Zahlreiche Partner
Hövelmann kann viele Aspekte seiner polizeilichen Expertise in den Dienstalltag einbringen: „Polizeikräfte sind Betroffene von Gewalt, sie sind aber auch gleichzeitig Ermittler.“ Zudem sei die Polizei im Bereich von Prävention und Opferschutz federführend. „Polizei ist für die Menschen die Marke für Sicher-

Im Vorfeld der Fußballeuropameisterschaft führte das Netzwerk #sicherimDienst mit seinen Kooperationspartnern ein Selbstschutztraining für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖPNV durch.
Landes- und Bundesebene. Neben der Standardisierung einzelner Bereiche der Polizei NRW war er verantwortlich für die Organisation vieler Veranstaltungen, z. B. des Landespreises für Innere Sicherheit und des Landespreises für Zivilcourage, sowie von großen öffentlichen Polizeipräsentationen wie dem „Tag der Polizei NRW“. Dabei kam er mit vielen Führungspersönlichkeiten in Kontakt und baute sich über die Jahre ein breitgefächertes Netzwerk auf. Dieses kam ihm zugute, als er im Jahr 2021 gebeten wurde, beim Aufbau des Präventionsnetzwerks zu unterstützen.
In der Projektphase von #sicherimDienst war er durch seine Kenntnisse und seine Kommunikationsstärke ein wichtiger Faktor bei der Etablierung von Kontakten und Verbindungen. Mit seinen Vorkenntnissen und der Hilfe engagierter Projektmitglieder aus Forschung und Praxis fiel auch die Erstellung des Präventionsleitfadens, des Internetauftritts und der markenrechtlich geschützten Wort- und Bildmarke #sicherimDienst relativ leicht. Im Webauftritt finden sich alle wichtigen Präventionsmaterialien und Broschüren, die das Netzwerk entwickelt hat. Im Team ist Hövelmann als „Macher“ bekannt, der „immer eine zündende Idee hat oder jemanden kennt, der weiter-
Foto: BS/Polizei NRW
heit schlechthin“, so der Vater von drei Kindern. Die Polizei sei aber nicht tonangebend unter den Partnern. Sinn des Netzwerkes sei es vor allem, sich untereinander zu helfen. Daher sollten sich die Mitglieder bei der Umsetzung in ihrer kommunalen Selbstverwaltung wiederfinden. Das Netzwerk steht den Organisationen dabei mit theoretischem und praxisorientiertem Know-how zum Gewaltschutz zur Seite. Eine enge Zusammenarbeit pflegt die Stabsstelle von #sicherimDienst mit großen Kommunen wie Köln, Düsseldorf und Dortmund, die als

In seiner Freizeit treibt Hövelmann leidenschaft gerne Sport wie hier im Boot Camp auf Mallorca. Dies erledigt er am liebsten schon vor dem Dienst – bei Wind und Wetter im Park. Foto: BS/Polizei NRW
Vorbilder für kleinere Kommunen dienen können. Auch die Unfallkasse NRW und generell die gesetzlichen Versicherungsträger seien wichtige Partner, da diese ein immanentes Interesse am Gewaltschutz für Beschäftigte hätten. „Wir machen in unserer Arbeit auf Kampagnen und Initiativen aufmerksam, wie zum Beispiel die Kampagne #GewaltAngehen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)“, so Hövelmann Zudem steht die Stabsstelle mit den NRW-Bezirksregierungen im Austausch, unter anderem um das Thema Gewaltschutz in die Lehrer-Ausbildung zu integrieren, und unterstützt Schulen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern bei der Ausrichtung von Präventionsveranstaltungen.
Sensibilisierung ist wichtig Auch im Gesundheitswesen wird das Thema Gewaltschutz immer präsenter. Gemeinsam mit Netzwerkpartnern wird an zentralen Themen gearbeitet, z. B. der Meldung und Dokumentation von Gewaltvorfällen, der Verankerung von Gewaltschutz in Organisationen sowie an der Frage, wie gemeinsame Energien und Ressourcen genutzt werden können. Denn bislang liegen keine verlässlichen Daten dazu vor, wie viele Fälle von Gewalt tatsächlich im Klinikalltag oder auch generell im Öffentlichen Dienst auftreten. Viel hänge vom subjektiven Sicherheitsgefühl und von der Haltung ab. Denn: „Selbst Übergriffe werden häufig genug nicht gemeldet. Eine unserer wesentlichen Aufgaben ist es daher, zu sensibilisieren“, so Hövelmann. Gegenüber Gewalt dürfe keinerlei Toleranz geübt werden. Wichtig sei daher eine möglichst niederschwellige und konsequente Meldung von Gewaltfällen. Nur auf dieser Basis könnten Arbeitgeber präventive Maßnahmen ableiten und ein aussagekräftiges Bild darüber bekommen, wie sich die Situation in der eigenen Organisation darstellt. Allerdings könne eine verstärkte Sensibilisierung auch dazu führen, das Bild der Lage zu verzerren. Eine Zunahme der gemeldeten Vorfälle könne durchaus auf die Aufklärungsarbeit und die dadurch gewachsene Sensibilisierung zurückzuführen sein. Ob es sich dabei um einen tatsächlichen Anstieg an Übergriffen handele, könne nicht genau gesagt werden. Hövelmann konstatiert jedoch, dass bei den Beschäftigten durchaus eine negative Tendenz bzgl. der Häufigkeit und Qualität von Gewaltvorfällen wahrgenommen werde. Nach alledem, was aus den bekannten Zahlen, Daten, Fakten und den Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit bekannt
ist: Fälle und Qualität haben in den letzten Jahren bereichsübergreifend zugenommen. Diese Entwicklungen können möglicherweise auf eine veränderte Einstellung gegenüber staatlichen Institutionen zurückzuführen sein. Zudem machten es die digitalen Medien einfach, Drohbriefe und Hassmails an die Verwaltungen zu verschicken. Der Polizeihauptkommissar zitiert seinen Chef Herbert Reul (CDU), um auf die Dimension des Problems aufmerksam zu machen: „Jeder Angriff auf Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ist ein Angriff auf die Demokratie.“ Wenn er im Rahmen seiner Tätigkeit unterwegs sei, mache er daher immer „das Thema zum Thema“, um zu sensibilisieren. Es müsse eine „Null-Toleranz“-Einstellung gegenüber Gewalt entstehen und Vorfälle konsequent gemeldet werden. Zudem sollten die Handlungssicherheit gesteigert und das Thema Gewaltschutz etabliert werden. Er versuche, insbesondere Führungskräften zu vermitteln, „dass sie eine spezielle Rolle als Ansprechpartner und Fürsorger gegenüber den Beschäftigten haben“. Wie lange sein Engagement dem Präventionsnetzwerk weiter erhalten bleibt, ist noch nicht klar: Zum Ende des Jahres soll es mit 62 Jahren eigentlich in Pension gehen. Dann hätten er und seine Frau genug Zeit, sich intensiv um den eigenen Schrebergarten zu kümmern, den sie vor 25 Jahren übernommen haben. Doch könne er sich durchaus vorstellen, noch mindestens ein Jahr dranzuhängen: „Ich habe große Lust, noch weiterzumachen und mein Wissen weiterzugeben.“
#sicherimDienst
Die Präventionskampagne #sicherimDienst des Landes Nordrhein-Westfalen bietet eine Plattform und Möglichkeiten zu einem umfassenden Austausch rund um das Thema „Gewaltschutz am Arbeitsplatz“. Geeignete und wirksame Lösungsansätze und Praxisbeispiele werden im Netzwerk bekannt gemacht und übergreifend zwischen Behörden, Kliniken, Schulen, ÖPNV oder der Justiz ausgetauscht.
Das Präventionsnetzwerk #sicherimDienst umfasst als Netzwerkpartner mehr als 2.400 Beschäftigte aus über 850 Behörden, Institutionen, Verbänden oder Organisationen und befindet sich in ständigem Wachstum. Die NRW-Initiative wurde durch die Landesregierung angestoßen, aber die Weitergabe des Know-hows ist auch bundesweit willkommen. Interessentinnen und Interessenten können sich auf der Internet-Präsenz www.sicherimdienst.nrw informieren. Zudem ist das Netzwerk in den Sozialen Medien aktiv (@SicherimDienst).