

in Südtirol Jagd Wild
Wie steht es um die Jagd in Südtirol?

Zum Auftakt unserer Beilage haben wir dem zuständigen Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher 3 Fragen gestellt – über die Rolle der Jagd, den Stand der Jäger und welchen Stellenwert Wildbret im Hause Walcher hat.
Herr Walcher, Sie sind seit Kurzem als Landesrat für die Jagd zuständig. Welche Erfahrungen haben Sie bisher in diesem Bereich gewinnen können?
Ich habe vor allem erkannt, welche zentrale Rolle die Jagd für Südtirol spielt. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit Land- und Forstwirtschaft und wirkt sich indirekt auch positiv auf den Tourismus aus. Indem wir unsere Wildbestände im Gleichgewicht halten, schützen und erhalten wir unsere Kulturlandschaft– und genau diese gepflegte Landschaft macht Südtirol so besonders und lebenswert.
Braucht es heute überhaupt noch Jäger?
Ja, Jäger werden auch heute gebraucht – und zwar weit über die eigentliche Jagd hinaus. Wie wichtig ihre Aufgabe ist, zeigt ein Blick in andere Regionen Italiens, wo die Zahl der Jäger zurückgeht und zu-
nehmend Probleme bei der Regulierung der Wildbestände entstehen. Unsere Jäger tragen Verantwortung für ein gesundes Gleichgewicht in der Natur und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Wälder und für das Wohl der Tiere. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das erst kürzlich vorgestellte Netzwerk Kitzrettung, bei dem Jäger unentgeltlich und in ihrer Freizeit Rehkitze vor dem Mähtod retten.
In dieser Sonderbeilage geht es auch um die Zubereitung von Wildgerichten. Essen Sie gerne Wild?
Ja, sehr gerne. Wildfleisch gehört für mich zu unserer heimischen Küche dazu: Es kommt direkt aus der Region, ist nachhaltig, ohne Zusatzstoffe– und es hat einfach einen ganz besonderen, unvergleichlich guten Geschmack. Besonders im Herbst kommt bei mir regelmäßig Wildfleisch auf den Tisch.
„Dolomiten“-Sonderheft : „WILD&JAGD“, Oktober 2025, Herausgeber, Verlag und Druck: Athesia Druck GmbH, Bozen Redaktion und Druckerei: Weinbergweg 7, 39100 Bozen, Tel. 0471/928888, Chefredakteur: Elmar Pichler Rolle Redaktion: Ulrike Raffl und Nadia Kollmann, Südtiroler Jagdverband, Fotos: Franziska Raffl Steiner, Südtiroler Jagdverband, Layout: Athesia Druck GmbH, Tel. 0471/925358, Koordination: Lidia Galvan, „Dolomiten“- Anzeigenabteilung, Tel. 0471/925312, dolomiten.spezial@athesia.it
Privacy
Athesia Druck GmbH hat gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) ernannt. Die Kontaktaufnahme für jedes Thema in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist über dpo@athesia. it möglich. Druckreif übermittelte Unterlagen können seitens der Anzeigenabteilung nicht korrigiert werden. Für die Richtigkeit, sei es in grammatikalischer, stilistischer, inhaltlicher oder grafischer Form, haftet ausschließlich der Auftraggeber bzw. die beauftragte Agentur.

produziert nach den Richlinien des Österreichischen Umweltzeichens UW 1492
© Simon Fischler
Über Balsam, Bärte und Braten
Zwischen Südtirols schroffem Hochgebirge, dichten Wäldern und stillen Almen lebt nicht nur das Wild – hier lebt auch ein Handwerk, das tief in der Natur verwurzelt ist. In dieser Sonderbeilage widmen wir uns den Menschen, die dieses Wissen bewahren und weiterentwickeln. Es geht ums Bartbinden, Wildkochen, Salbenrühren, um Tierpräparation und Jagdmalerei. Ein Gespräch mit Landesjägermeister Günther Rabensteiner und SJV-Geschäftsführer Benedikt Terzer.
In dieser Sonderbeilage dreht sich alles um das jagdliche Handwerk und das ganzheitliche Verwerten von Wild. Wieso dieses Thema?
Günther Rabensteiner: Weil wir zeigen wollen, dass die Jagd mehr ist als das bloße Erlegen von Wild. Sie ist in unserer Kultur tief verwurzelt, und viele traditionelle Handwerksberufe sind aus der Jagd heraus entstanden. Wir wollen zeigen, wie viel Wissen, Leidenschaft und Können darin stecken.
Benedikt Terzer: Es gehört einfach zum Selbstverständnis des Jägers dazu, dass die Beute geachtet und sorgfältig verwertet wird. Der Gamsbart auf dem Festtagshut, die Trophäe vom Rehbock in der Jägerstube, ein gut zubereitetes Wildgericht oder eine heilsame Salbe aus Murmeltierfett – das sind alles Produkte, die aus Respekt gegenüber dem Tier und der Natur entstehen
Wie wichtig sind denn Berufe wie Tierpräparator, Bartbinder, Jagdmaler für die Erhaltung der jagdlichen Tradition?
Günther Rabensteiner: Ohne diese Handwerke würde ein bedeutender Teil unserer jagdlichen Identität verloren gehen. Es geht nicht nur um

Produkte, sondern um Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit.
Viele dieser Tätigkeiten sind heute selten geworden. Wie steht der Jagdverband zur Bewahrung solchen Wissens?
Benedikt Terzer: Wir bemühen uns, diese Berufe sichtbar zu machen, und wir haben das große Glück, dass auch in einigen Bildungseinrichtungen des Landes, in der Forstschule Latemar, im Bildungs-
Tradition wird bei den Jägerinnen und Jägern großgeschrieben. Vor wenigen Monaten hat der Südtiroler Jagdverband ein neues Buch über den Jägerbrauch in Südtirol herausgegeben. Geschäftsführer Benedikt Terzer und Landesjägermeister Günther Rabensteiner freuen sich über das große Interesse für dieses Thema.
haus Schloss Goldrain und in der Weiterbildungsgenossenschaft des Bauernbundes das Wissen um diese Berufe weitergetragen wird. Das Wichtigste ist aber die Wertschätzung, denn nur, was gelebt, gesehen und verstanden wird, hat eine Zukunft.

Haar für Haar
Zu besonderen Anlässen tragen viele Jäger einen Gamsbart auf dem Hut –Ehrensache, dass er von selbst erlegten Gamsen stammt. Das Gamsbartbinden erfordert viel Geduld und Geschick. Hubert Bacher aus Rein in Taufers ist einer der wenigen in Südtirol, die dieses Handwerk noch ausüben.
Hubert, wie bist du zur Bartbinderei gekommen?
Hubert Bacher: Ich wollte gerne von meinen ersten erlegten Gamsböcken einen Bart haben. Also fragte ich bei einem Bartbinder aus Kematen, ob ich zuschauen darf, wenn
er meinen Bart bindet. Danach habe ich selbst probiert und probiert, bis ich 3 Jahre später nebenher mit dem Bartbinden anfing.
Aus welchen Haaren macht man denn einen Gamsbart?
bart reicht ein einziger Hirsch und beim Dachs gehen sogar 3 Bärte aus einem einzigen Dachs heraus.
Das Gamsbartbinden ist eine unglaubliche Geduldsarbeit. Wie viel Arbeit steckt in so einem Bart?

Für einen Gamsbart nimmt man die Haare vom Rücken der Gams. Im Winter sind sie besonders lang. Aber nicht nur vom Gamswildhaar können schöne Bärte gebunden werden. Beim Hirsch werden die Haare der Brunftmähne vorne am Träger– so heißt der Hals in der Jägersprache – zum Bart gebunden. Viele kennen auch den Dachsbart, der früher, als der Dachs noch jagdbar war, als hochwertiger Rasierpinsel genommen wurde oder auch als wunderschöner Hutschmuck.
Bartbinden ist eine Geduldsarbeit. Bis alle Haare der Länge nach sortiert sind, hat Hubert jedes Haar mehrmals zwischen den Fingern.
Wie viele Stücke braucht es für einen Bart?
Für einen Gamsbart wären 7 oder 8 Gamsen ideal, für einen Hirsch-
In einem Gamsbart stecken mindestens 30–40 Stunden Arbeit. Die gerupften Haare werden gewaschen und getrocknet. Die Wolle wird ausgekämmt und die Haare werden so gerichtet, dass sie alle in die gleiche Richtung schauen. Dann werden sie nach ihrer Länge sortiert und zu Büscheln gebündelt. In jedem Büschel stecken ungefähr 250 gleich lange Haare. Danach werden die Haarbüschel um einen Holzstab herumgewickelt. 200–220 Büschel braucht es für einen Bart, dass er richtig voll wird. Zum Schluss wird der Bart noch sauber mit einem schönen Garn abgebunden und ein letztes Mal gründlich ausgekämmt.

1: Die Haare werden ausgekämmt, vorsortiert und mit den Spitzen nach oben in ein schmales Glas gesteckt.
2: Das Glas wird so lange auf die Arbeitsplatte geklopft bis alle Haare unten bündig sind. Danach werden immer die längsten herausgezogen und zu Büscheln mit gleichlangen Haaren gebunden.
3: Die Spitzen der Rückenhaare beim Gams haben keine Pigmente eingelagert und sind deshalb hell. Das bezeichnet man als Reif. Wenn die Haare keinen Reif haben, dann nennt man sie „blind“ und der Bart gilt als weniger wertvoll.
4: Die Haare werden der Länge nach sortiert.
5: Hubert wickelt die Haarbüschel mit Zwirn um selbst gedrechselte Holzspindeln herum. Angefangen wird mit den kürzesten Büscheln.
6: Hubert fertigt mit kürzeren Haaren auch schöne Gams- und Hirschradl an und hat dafür mit seinem Sohn eine eigene Maschine konstruiert. Gamsradl kamen Ende des 18. Jahrhunderts auf, als es dem Adel vorbehalten war, einen Gamsbart zu tragen. Um dieses Gamsbart-Verbot zu umgehen, fertigten sich viele Burschen aus den kurzen Nackenhaaren solche Gamsradl an, sie werden auch „Jagertratzer“ genannt.
Wenn man bedenkt, wie viel
Arbeit in einem Bart steckt, dann verwundert es nicht, dass man von Gamsbärten hört, die viele Tausend Euro kosten. Was macht einen schönen Bart aus?
Bei den Gamsen ist es wie bei den Leuten. Der eine hat gutes Haar, der andere nicht. Wenn das Haar nicht fest ist, kriegt man auch keinen gescheiten Bart zusammen. Für mich ist der ideale Bart ungefähr 18 Zentimeter lang. Ganz wichtig ist außerdem, dass die Haare einen schönen Reif haben.





Die Geschichte des Gamsbartes
Du gibst dein Wissen übers Bartbinden auch bei Kursen in der Forstschule Latemar weiter. Gibt es in Südtirol viele Gamsbartbinder?
Leider nicht. Aber ich wünsche mir fest, dass dieses Handwerk in Südtirol nicht ausstirbt und von jemandem weitergeführt wird. Mich freut es sehr, wenn ich sehe, wie motiviert die Kursteilnehmer sind. Vielleicht sind ja ein oder 2 dabei, die mit dem Bartbinden weitermachen.


Angeblich trug schon Kaiser Maximilian I. von Österreich im 15. Jahrhundert einen Gamsbart. Das Gamsbartbinden wurde erstmals 1802 dokumentiert. Richtig populär wurde der Gamsbart erst im 19. Jahrhundert durch Erzherzog Johann, der ein großer Liebhaber der alpenländischen Lebensart und Tracht war und diese salonfähig machte. Auch der bayerische Prinzregent Luitpold war leidenschaftlicher Gamsbartträger und machte diesen Kopfschmuck modern.

Das zweite Leben
Walter Gufler ist Tierpräparator oder „Ausstopfer“, wie man hierzulande auch sagt. Das Wort beschreibt, wie Tierpräparate früher angefertigt wurden: Der haltbar gemachte Tierkörper wurde mit Holzwolle oder Watte ausgestopft. Wir haben Walter in seiner Werkstatt in St. Leonhard in Passeier besucht und ihm zugeschaut, wie er bleibende Jagderinnerungen erschafft. Seine Kunden sind aber nicht nur Jäger.
Walter, dein Beruf ist eher ungewöhnlich. Wie bist du denn zum Präparieren gekommen?
Walter Gufler: Ich wollte das Präparieren eigentlich immer schon lernen. Es ist aber sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Der Beruf des Präparators kann an der Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe in Wien erlernt werden, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Um dort aufgenommen zu werden, benötigt man aber eine Lehrstelle, die ich leider nicht hatte, denn die Lehrstellen sind rar. Also bin ich nach Saarbrücken und habe dort eine 4-monatige Ausbildung bei einem Präparator absolviert.
Welche Fähigkeiten sollte man als Präparator oder Präparatorin mitbringen?
Die Arbeit ist sehr vielfältig. Es braucht handwerkliches Geschick, ein gutes Auge für Details und eine kreative Ader. Wir Präparatoren sind Gerber, Kürschner, Kosmetiker, Frisöre, Handwerker, Künstler, Chemiker und, und, und. Das sieht man auch am Handwerkszeug, das wir uns zwischen Baumarkt, Handarbeitsgeschäft, Apotheke und Frisörbedarf

zusammensuchen. Weil es keine spezielle Ausrüstung gibt, die eigens für unser Handwerk gemacht wurde, muss man einfallsreich sein. Es ist alles erlaubt, solange es funktioniert und das Ergebnis am Ende passt.
Du arbeitest gerade an einem Schulterpräparat eines Rehbockes. Erklärst du uns die einzelnen Arbeitsschritte?
Um das Tier naturgetreu zu präparieren, muss man zuerst die Maße des Tieres nehmen und eine passende Form vorbereiten. Für die meisten Tiere gibt es schon vorgefertigte Korpusse zu kaufen. Für meine Schulterpräparate stelle ich diese selbst her. Dann wird die Decke – so heißt das Fell in der Jägersprache –abgezogen, gegerbt, gewaschen und eingeölt, damit sie weich bleibt. Parallel dazu wird der Schädel mit dem Geweih ausgekocht und das Geweih auf den Korpus geschraubt. Die vorbereitete Form wird nun mit Leim bestrichen und die gegerbte Decke darübergezogen, zurechtgerückt und mit Nadeln fixiert. 4, 5 Tage lang wird dann täglich kontrolliert, ob beim Trocknen alles an Ort und Stelle bleibt, und eventuell nachge-
bessert. Zuletzt wird noch gebürstet, die Augen werden mit Klarlack zum Glänzen gebracht, Nase und Augen geschminkt, und das Präparat wird auf ein Brett montiert.
Das klingt nach sehr viel Arbeit. Wie viele Arbeitsstunden stecken in so einem Präparat?
Insgesamt braucht es gut 5 Wochen, bis ein Schulterpräparat vom Rehbock fertig ist. Die reine Arbeitszeit liegt bei 20 Stunden.
Im Nachlass vieler Menschen finden sich immer wieder ausgestopfte Tiere und es kommt oft vor, dass man ein solches Tier vererbt bekommt. Wie soll so ein Präparat gepflegt werden, damit es lange schön bleibt?
Am besten staubt man ein Präparat alle paar Monate ab, und zwar mit einem trockenen Lappen in Wuchsrichtung der Haare. Niemals mit feuchten Tüchern abwischen! Eventuell kann es auch vorsichtig kalt geföhnt werden. Bei Vögeln kann man zur Pflege auch einen Pinsel oder eine große Feder nehmen.


1: Zuerst wird die Decke gegerbt.


2: Das Geweih wird auf den vormodellierten Korpus geschraubt.
3: Dann wird das Fell über den Korpus gespannt …
4: … und vernäht.
5: Zuletzt wird das Tierpräparat akribisch in Form gebracht.
Welche Tierarten werden von den Kunden am häufigsten nachgefragt? Hast du auch schon kuriose Anfragen bekommen?
Am häufigsten präpariere ich Murmeltiere. Mittlerweile dürften es bestimmt rund 100 Stück sein. Kuriose Anfragen kommen immer wieder, z. B. wenn die Leute tote Igel, oder Fledermäuse finden, wenn das Haustier, die Schildkröte, die Katze stirbt. Diese Aufträge lehne ich meistens ab, denn eine Hauskatze werde ich nie so präparieren kön-
nen, wie sie der Besitzer in Erinnerung hat. Aber ich bekomme hier im Passeiertal auch immer wieder Ziegen und sogar Rinder zum Präparieren. Die Bauern und Züchter hängen sehr an ihren Tieren, auch mit einem gewissen Stolz. Und wenn ein besonders schönes Exemplar verunglückt oder geschlachtet werden muss, dann wollen die Besitzer ein Präparat als Erinnerung anfertigen lassen. Es freut mich, wenn ich diesen Wunsch erfüllen und den Tieren so ein zweites Leben schenken kann.


Nicht nur Wildtiere werden präpariert. Diese Sprinzenkuh war der ganze Stolz ihres Besitzers. Nun ziert sie den Hofladen.
Taxidermie
Taxidermie – so heißt die Kunst der Haltbarmachung von Tierkörpern zu Studien-, Lehr- oder Dekorationszwecken. Früher wurden für die Taxidermie gefährliche Giftstoffe verwendet, um die Präparate vor Insektenbefall zu schützen und sie zu konservieren. Ältere Stücke können immer noch mit diesen gefährlichen Stoffen belastet sein. Heute werden diese giftigen Chemikalien nicht mehr eingesetzt, die Behandlung erfolgt giftfrei.


Wilde Küche
Der junge Glurnser Spitzenkoch Thomas Ortler verwendet in seiner Küche am liebsten Produkte aus der Gegend. „Wild“, sagt er, „ist eines der hochwertigsten Produkte, die unser Land zu bieten hat, und wir haben in Südtirol das große Glück, dass wir gutes Wildbret und Jäger haben, die sehr gewissenhaft sind.“ Er selbst ist nicht Jäger. Sein Bezug zur Jagd ist eine Mischung aus Respekt und Bewunderung. „Die Jagd ist für mich eines der größten Geheimnisse überhaupt. Sie ist Urinstinkt und verlangt Wissen und Mühe im selben Maße. Man muss viel können, um gut zu jagen.“ Wir haben Thomas Ortler beim Kochkurs in der Kochschule „Roter Hahn“ auf dem Föhrnerhof oberhalb von Bozen entlockt, worauf es bei der Zubereitung von Wild ankommt.
Wenn man eine gute Soße zubereiten will, braucht es viel Gemüse, viel Fleisch und viel Wein. „Viel guat, viel guat“, weiß Spitzenkoch Thomas Ortler.

Thomas, was ist bei der Zubereitung von Wild zu beachten?
Thomas Ortler: Wildfleisch ist relativ mager und die Kunst beim Kochen ist, dass es saftig bleibt. Deshalb halte ich mich gern an die Weisheit meiner Oma: „’s Grasl am Stoan und ’s Fleischl am Boan isch es beschte“. Und ich bereite gerne Fleischstücke zu, die noch am Knochen hängen. Einen Hirschschlegel lasse ich mir immer in 3 Teile schneiden und schmore ihn, bis das Fleisch butterzart vom Knochen gezupft werden kann.
Auch in deinem Kochkurs „Auf der Pirsch“ an der Kochschule „Roter Hahn“ auf dem Föhrnerhof bereitest du mit den Teilnehmern ein Schmorgericht zu. Nennst du uns das Geheimnis einer guten Soße? Das Geheimnis sind die Röstaromen. Damit ich die bekomme, brauche ich einen guten Topf mit dickem Boden, der die Hitze gut speichert und richtig heiß wird. Bei einem Schmorgericht brate ich zuerst das gewürzte Fleisch und dann die gewürfelten

Zwiebeln, Karotten und Sellerie sowie Tomatenmark an. Wenn sich am Topfboden dann ein schöner brauner Bratensatz bildet, wird mit ein wenig Rotwein abgelöscht. Das Ganze lasse ich einreduzieren und lösche wieder mit etwas Wein ab. Indem man diesen Vorgang mehrmals wiederholt und immer wieder schrittweise ablöscht und einreduziert, bekommt man mehr Röstaromen und eine schöne dunkelbraune Farbe in die Soße. Zum Ablöschen kann man auch Bier oder Wasser nehmen, aber ich nehme für Wild am liebsten Lagrein. In meiner Restaurantküche verwende ich auch die Knochen, um eine Grundsoße, den so genannten „Jus“ herzustellen. Knochen, Knorpel und Sehnen enthalten viel Kollagen, das gut für Gelenke, Darm und Haut ist.
Du kochst gerne mit Wild. Reizt es dich gar nicht, selbst auf die Jagd zu gehen?
Doch, tut es mich! Ein guter Freund von mir ist auch Jäger. Er beliefert uns oft mit Wildbret. Nach vielen Gesprächen über die Jagd hat er mich einmal zum Wildbeobachten mit in den
Der Profi zeigt, wie auch aus einer Schulter noch ein Kurzbratstück werden kann. Er schneidet 2 Steaks aus der Schulter, indem er die Mittelsehne entfernt. Das sogenannte „Flat Iron Steak“ macht sogar dem Filet Konkurrenz und eignet sich durch seine Beschaffenheit perfekt zum Kurzbraten oder für Tartar.
Wald genommen. Es war sehr früh, sehr still und auch sehr magisch. Wer weiß, vielleicht versuche ich wirklich eines Tages, die Jagdprüfung zu absolvieren. Meinem Bäuchlein und meinem Geist würde es glaube ich nicht schaden!
Tipp für das Schneiden von Tatar: das Fleisch vorher kurz in die Gefriertruhe legen

Thomas Ortler verwertet alles, was ein Tier hergibt, gerne auch die Innereien. Die Leber wird gewaschen und anschließend pariert, das heißt, Haut, Adern und Gefäße werden entfernt, weil diese beim Braten zäh werden und die Konsistenz stören. Danach 2, 3 Minuten pro Seite braten, bis die Leber leicht gebräunt ist, und mit Salz und Pfeffer würzen.


Was passiert beim Braten?
Man unterscheidet 2 Fleischarten: kurzfaserige Muskelstücke und Stücke mit langfaserigen Muskeln und viel Bindegewebe.
* Kurzfaserige Muskelstücke sitzen an jenen Körperteilen, wo wenig Muskelkraft benötigt wird, z. B. im Rücken, der immer in derselben Position verweilt. Die dort sitzenden Muskeln müssen kaum Arbeit leisten, das Fleisch (Filet, Roastbeef, Entrecote) ist zart und man könnte es auch roh essen. Wenn man diese Stücke brät, ziehen sich die Fasern, die in Kontakt mit der Hitze kommen, sofort zusammen und das im Muskel enthaltene Wasser tritt aus. Wenn man ein Filet zu stark erhitzt, wird es grau und trocken und ist kulinarisch nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb sollte es nur kurz und scharf angebraten werden, damit es nur
außen in Kontakt mit hoher Hitze kommt. So bleibt es zart und saftig.
* Langfaserige Muskeln braucht es dort, wo beim Laufen und Springen hohe Belastungen ausgehalten werden müssen. Dieses Fleisch (Schulter, Hals, Schlegel) ist zäh, wenn es roh ist. Es ist von Bindegewebe und Sehnen durchzogen. Das Kollagen in den Sehnen verwandelt sich aber beim stundenlangen Garen mit niedriger Temperatur um 65 Grad Celsius in Gelatine. Diese ist kulinarisch deshalb so wichtig, weil sie den Saft bindet, der beim Kochen aus den Muskelfasern tritt. Sie sorgt also dafür, dass ein Schmorstück nicht austrocknet, sondern beim langen sanften Garen immer saftiger wird. Also beim Schmoren im Topf sorgsam darauf achten, dass die Flüssigkeit kaum köchelt, oder bei 65Grad Celsius unter Vakuum garen (Sous Vide).
Wildtiere fressen nur die besten Kräuter und leben in unserer weitgehend unberührten Natur. Deshalb ist nicht nur ihr Fleisch, also das Wildbret, sondern auch ihr Fett so wertvoll. Leider wird Fett jedoch aus Unwissenheit oft mit den Innereien entsorgt. Die Innsbrucker Jägerin
Barbara Hoflacher weiß alles über den Wert von Wildtierfetten. Sie stellt daraus Cremen und Seifen her und gibt ihr Wissen in Kursen und in ihren Büchern weiter.
Barbara, du arbeitest in der Universitätsklinik in Innsbruck, führst eine OutdoorSchule und wurdest als Reaktion auf Massentierhaltung und Tiertransporte Vegetarierin. Wie bist du zur Jagd gekommen?
Barbara Hoflacher: Ich hatte eigentlich gar keinen Bezug zur Jagd. Aber irgendwann wollte ich mein Wissen über die Wildtiere vertiefen, damit ich auch einmal eine gefundene Feder oder Losung bestimmen kann, wenn ich Heilpflanzenwanderungen führe. Also habe ich die Jagdprüfung gemacht, aber ohne selbst jagern zu wollen. Über Freunde bin ich dann aber doch irgendwie zur Jagd gekommen. Bei meinem ersten Abschuss hat meine Jagdbegleitung einen Satz gesagt, der mich sehr beeindruckt hat: „Weidmannsheil, jetzt kannst du deine Familie ernähren.“ Das hat etwas mit mir gemacht und ich werde nie vergessen, wie dankbar

Gamsfett statt Labello
ich das Fleisch dieses Rehbocks gegessen habe. Ich hatte das unbeschreibliche Gefühl, das Wesen dieses Tieres in mich aufzunehmen. Seitdem esse ich ausschließlich das Fleisch von Tieren, die ich selbst erlegt habe oder die Freunde von mir erlegt haben.
Welchen Stellenwert hat die Jagd in deinem Leben?
Die Jagd ist ein solides Handwerk, kein Hobby, sondern ein Lebensstil. Für mich ist es der art- und wesensgerechteste Weg, ein Lebensmittel zu gewinnen. Beim Jagern liegt die Verantwortung einzig und allein in meinen Händen. Die sibirischen Schamanen sagen, es ist egal, ob man ein Tier oder eine Pflanze tötet. Es geht nur darum, mit welcher Einstellung man es tut. Ich bin keine Trophäenjägerin, denn von einem Geweih kann ich nicht abbeißen. Alles, was ich nicht essen oder anziehen kann, erlege ich nicht, es sei denn, das Tier ist schwer krank. Das Allerwichtigste ist
für mich die nachhaltige Nutzung und vor allem die restlose Verwertung eines erlegten Stückes.
Mit dem Gedanken der restlosen Verwertung bist du auch dazu gekommen, dich mit dem Wert der Wildfette zu befassen. Wie werden diese verwendet?
Das Murmeltieröl hat in der Volksmedizin eine lange Tradition. Seine Heilwirkung liegt im Zusammenspiel von einem geringen Anteil an cortisonähnlichen Inhaltsstoffen und einem hohen Anteil an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Es wirkt gegen Schmerz und Entzündungen. Äußerlich kann es bei Hautproblemen, Hämatomen und Wunden eingesetzt werden, als Balsam bei Erkrankungen der Lunge und der Atemwege sowie bei Beschwerden des Bewegungsapparates. Innerlich eingenommen wirkt Murmeltieröl bei Erkältungen und Magen-DarmBeschwerden.
Damit das Fett gut verarbeitet werden kann, sollte es idealerweise noch etwas angefroren sein. Es wird in Stücke geschnitten und im Mixer püriert.
Auch aus dem Fett von Rotwild können Hirschtalgsalben hergestellt werden. Sie sind sehr gut bei rauer, rissiger und trockener Haut und als Lippenpflege geeignet, als Windund Wetterschutz für das Gesicht, sogar bei Säuglingen und Kindern, sowie als Pfotenschutz für den Hund im Winter.
Gamsfett wirkt stark wärmend und durchblutungsfördernd. Daraus kann eine tolle Lippenpflege hergestellt werden, oder ein Wind- und Kälteschutzbalsam für Hände, Gesicht und Füße. Es bewährt sich auch bei rheumatischen Beschwerden und bei Erkältung. Das Fett der Gams ist recht hart und stockt bei Zimmertemperatur, sodass daraus sogar Kerzen und Seifen gemacht werden können.
Was antwortest du Leuten, die die Naturheilkunde und die Verwendung von Wildfetten als Hokuspokus abtun?
Viele der Rezepte und Anwendungsbereiche sind von früher überliefert, aber heute haben wir ja zum Glück die technischen Möglichkeiten, die Zusammensetzung der Fette objektiv zu prüfen. Die Analysen, die wir gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität von Wien gemacht haben, belegen, dass es sich hier um wissenschaftliche Fakten handelt und keinesfalls um Hokuspokus. Da ich selbst beruflich seit vielen Jahren im medizinischen Bereich tätig bin, ist es mir schon wichtig, dass die Dinge Hand und Fuß haben. Ich hoffe, auch andere von den Vorzügen der Wildtierfette begeistern zu können. Denn warum etwas Wertvolles wie Murmeltieröl, Hirschtalg und Gamsfett wegwerfen, wenn wir daraus etwas so Heilsames zubereiten können?

Natürliche Zusätze wie Lärchenharz, Thymian, Beinwell, Lorbeer, andere ätherische Öle helfen, die positive Wirkung der Wildfette zu verstärken und die Haltbarkeit zu verlängern.

Murmeltierfett wird schonend über dem Wasserbad ausgelassen und abgeseiht.

Reines Murmeltierfett ist flüssig. Der Zusatz von biologischem Bienenwachs bringt die gewünschte Konsistenz zur Herstellung einer Salbe.

Das

Barbara Hoflacher bezeichnet sich selbst als Lehrling der Natur. Sie hat eine mehrjährige Ausbildung in verschiedenen naturheilkundlichen Themengebieten absolviert und ist zertifizierte Wanderleiterin und Ernährungstrainerin.
„Original Tiroler Murmeltiersalbe” aus Kasachstan
Das Murmeltieröl, das in handelsüblichen Produkten enthalten ist, stammt zu 95 Prozent vom Steppenmurmeltier aus Kasachstan. Dort wird das Murmeltier, das viel größer ist als das Alpenmurmeltier und damit auch mehr Fett liefert, mit Fallen gefangen. Eine nicht tierschutzgerechte Methode, die bei uns als nicht weidgerecht gilt und verboten ist. Auch der Hirschtalg in handelsüblichen Produkten stammt weitgehend aus Neuseeland.





Hervorragende Leistung, sensationeller Preis.



ZEISS Secacam 3



Nur €139,99
ZEISS Secacam 3 Wildkamera bietet exzellente Bildqualität bei Tag und bei Nacht, schnellste LTE-Übertragung und verlässliche App-Konnektivität – alles zu einem hervorragenden Preis. Dank der Live-Ansicht auf dem 1,9-Zoll-Display und dem praktischen TEST-Knopf ist die ZEISS Wildkamera blitzschnell einsatzbereit!
ZEISS Secacam 3: Mit nur einem Klick im Revier.
bignami.it - info@bignami.it

Kunstvolle Zielscheibe
Wendelin Gamper malt seit über 40 Jahren Jagdmotive. Landauf, landab kennt und schätzt man in Jägerkreisen seine Bilder und vor allem seine Schießscheiben. Mittlerweile ist er in den Ruhestand getreten. Wir haben ihn in seiner Künstlerwerkstatt in St. Nikolaus/Ulten besucht.
Wendl, wann hast du mit dem Malen begonnen?
Das hat sich so ergeben. Dazu beigetragen hat sicher auch, dass ich als Kind zweimal einen Beinbruch hatte. Ich bin auf einem Berghöfl auf 1600 Metern aufgewachsen, wo keine Straße hinaufführte. Mit einem Gips ist man da oben gefangen. Ich hab in der Zeit halt gemalt. Auch als ich einmal lange mit einem Oberschenkelbruch im Krankenhaus liegen musste, habe ich mit dem Kugelschreiber sämtliche Illustrierten, die dort herumlagen, bis auf den letzten Zentimeter zugekratzelt. Bei so viel Übung war Zeichnen natürlich mein Lieblingsfach in der Schule. Am liebsten zeichnete ich Tiere. Mein Großvater war ein begeisterter Jäger und er nahm mich oft bei seinen Reviergängen mit. Das war etwas ganz Besonderes. Mich zog aber nicht so sehr die Jagd in den Wald, sondern die Schönheit der Natur, die Stille, die Urigkeit und vor allem die Wildtiere.
Und wann hast du gemerkt, dass das Malen mehr ist als nur eine Liebhaberei?
Das hat schon einige Zeit gedauert. In den 1970er-Jahren, als ich ein Bub war, wäre einem ja nie in den Sinn gekommen, das Malen zum Beruf zu machen. Ich machte eine Tischlerlehre und zog „aufs Land hinaus“ nach Meran. Nur mein Großvater ermunterte mich, das Zeichnen und Malen nicht aufzugeben. Wenn ich dann und wann die Ruhe des Ultentales suchte, entstanden immer wieder Bilder, die auch Abnehmer fanden. Ich bekam Aufträge, Häuser, Landschaften oder Tiere zu malen. 1985 hat dann jemand zu mir gesagt: „Probier einmal, eine Schießscheibe zu malen.“ Ich wusste zuerst nicht einmal, was das sein soll– ich war ja kein Jäger – aber sie hat gefallen. Die nächsten Scheiben gab dann ein Waffengeschäft in Meran in Auftrag. Diese hingen dort und plötzlich kam ein Auftrag nach dem anderen, bis die Malerei irgendwann
Wendelin Gamper stammt von einem Bergbauernhof hoch über St. Nikolaus. Seit 2002 ist er Jäger im Revier Ulten. Über seinen Beruf als Jagdmaler sagt er:„Ich sehe mich selbst eigentlich nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Ich gehe jeden Tag mit Freude an die Arbeit und teile mir diese so ein, dass ich immer zum vereinbarten Termin liefern kann.“

nicht mehr mit meinem Beruf vereinbar war. Ich gab die Arbeit in der Tischlerei auf und von da an war das Scheibenmalen mein Beruf. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Scheiben ich in meinem ganzen Leben schon gemalt habe.
Die Leute kamen also zu dir und gaben Schießscheiben, Bilder oder Urkunden in Auftrag. Welches Motiv wurde am meisten gefragt? Die meisten wollen ihren Hausberg, einen Hof oder einen bestimmten Hochsitz auf den Bildern. Die Leute haben einfach mehr Freude mit einem Motiv, zu dem sie einen Bezug haben, etwas Vertrautes. Dann hat das Werk einen ganz anderen Wert für sie. Die Ehrenscheiben werden zu einem bestimmten Anlass wie ein Jubiläum, einer Hochzeit bestellt. Die Leute schicken mir ein Foto mit der Landschaft, die auf
der Scheibe abgebildet sein soll, und was sie sonst noch draufhaben möchten, ein Wildtier, eine Person, einen Jagdhund.
Deine Schießscheiben sind kleine Kunstwerke. Tut es dir nicht leid, dass darauf scharf geschossen wird?
Zum Teil wird tatsächlich auf diese Scheiben geschossen, allerdings lediglich mit einem kleinen Kaliber, sodass nur kleine Einschusslöcher zu sehen sind. Aber wenn der Zielkreis weit am Rand der Scheibe liegt oder wenn sehr viele Schützen die Scheibe direkt beschießen, wird diese schon in Mitleidenschaft gezogen und muss dann repariert werden. Viele schießen auch auf einen Zielkreis aus Papier oder auf eine Fotokopie der Scheibe und lassen das Schussbild dann von mir auf die Scheibe übertragen. Das ist sicher die schonendere Variante.
Wendl Gamper malt in Öl, Acryl und Aquarell: Schießscheiben, Holztafeln und Bilder auf Leinwand. Auch Urkunden werden bei ihm in Auftrag gegeben und letzthin Glockenriemen für Kühe, die er auf Bestellung kunstvoll mit den gewünschten Motiven verziert.

Die Tradition der Schießscheiben
Seit Mitte des 17. Jahrhunderts besteht die Tradition, bei Schießwettbewerben auf bemalte Holzscheiben zu schießen. Nach und nach wurde die Schießscheibe zu einem Gegenstand der Volkskunst, der zu feierlichen Anlässen besonders kunstvoll gestaltet wird. Der beste Schütze erhält die Scheibe als Trophäe für seine Schussfertigkeit. Sogenannte Ehrenscheiben werden, wie der Name schon sagt, zu Ehren einer bestimmten Person angefertigt und dann ausgeschossen. Anlässe hierfür können ein Geburtstag, eine Hochzeit oder ein anderes Jubiläum sein. Die Scheiben dienen als Andenken an den Ehrentag. Vor allem im alpenländischen Raum haben Schützenscheiben eine große Tradition.
Wo Jagd Tradition ist und Brauchtum lebendig bleibt
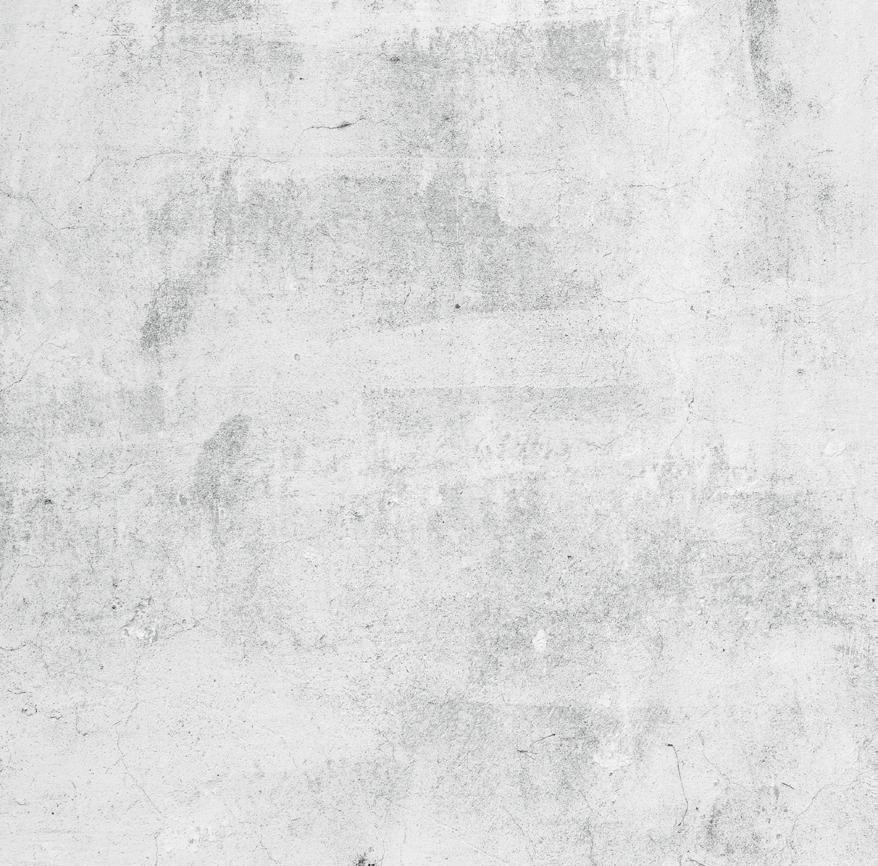
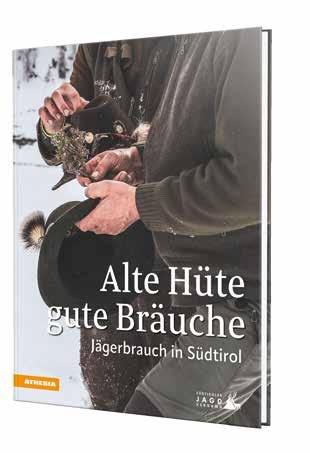
Rund um die Jagd ranken sich viele Bräuche, die gelebt und gepflegt werden wollen. Das jagdliche Brauchtum begleitet die Jägerinnen und Jäger auf der Jagd, bei Zusammenkünften, wenn sie feiern und auch auf ihrem letzten Weg. Die Jägersprache, die stumme Verständigung mittels Bruchzeichen, das Jagdhornblasen, das jagdliche Gewand und der Jägerschmuck gehören genauso dazu wie die gute Gesinnung gegenüber dem Wild und das freundschaftliche Miteinander der Jägerschaft. „Alte Hüte, gute Bräuche - Jägerbrauch in Südtirol“ sammelt und kommentiert die jagdlichen Gepflogenheiten in Südtirol. Der Band ist reich bebildert, die wunderschönen Fotos sind im Laufe eines Jagdjahres entstanden. Ein eigenes Kapitel widmet sich den Südtiroler Dialektnamen einiger Tiere und Pflanzen, damit auch diese nicht in Vergessenheit geraten.
Südtiroler Jagdverband (Hrsg.), Heinrich Aukenthaler, Ulrike Raffl, Nicol Santer, Simone Santer, 128 Seiten Athesia-Tappeiner Verlag, ISBN 978-88-6839-844-6
28,00 €
