
4 minute read
Transformation der Kommunalverwaltung

from eGovernment 4/2023
by vit
Langsam keimt bei vielen eGovernment-Machern die Hoffnung, Smart-City-Projekte könnten der Modernisierung und Digitalisierung der Kommunalverwaltungen auf die Sprünge helfen. Erste Ansätze dazu sind bereits erkennbar. Noch aber gibt es zahlreiche Fallstricke.
Finanz- und Klimakrise, Migrations- und Coronawellen – und nun auch noch Energieknappheit setzen die Kommunen unter erheblichen Druck. Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Kapazitäten und Kompetenzen fehlen, um den steigenden Anforderungen in der Verwaltung gerecht zu werden. Neue Formen der Organisation und des Einsatzes des Personals (Arbeit 4.0) ist notwendig. Kurzum: Ohne umfassende Transformation der Kommunalverwaltung – sowohl in organisatorischer wie technischer Hinsicht – werden wir die Herausforderungen nicht bewältigen können. Damit stellt sich die Frage, welchen Beitrag Smart City dazu leisten kann?
den in der allgemeinen Verwaltung unterschiedlich wahrgenommen.
Für die einen sind sie Speerspitze der Veränderung, für die anderen eine Art „Traumfabrik“, die die hergebrachten Grundsätze des Beamtentums in Frage stellen.
CDOs von Smart-City Städten beklagen, dass ihre Anliegen schwer in den Fachabteilungen der Verwaltung zu vermitteln sind. Verwaltungskräfte in den Fachabteilungen bremsen nicht selten die Smart-City Projekt Teams aus und verweisen auf ihre fachliche Zuständigkeit. Kommunikationsstörungen sind die Folge. Neuerungen werden als zusätzliche Arbeit wahrgenommen, die angesichts generell erhöhter Arbeitsaufwände
Smart City für Kommunen
Infos zum Buch
Sicher ist, das kommunale Handeln muss flexibler werden. Agilität und Resilienz müssen das kommunale Geschehen bestimmen. Die Erfahrung jedoch zeigt, dass Strukturen und die Erledigung von Aufgaben nicht über Nacht verändert werden können. Verwaltung ist eine zähe Angelegenheit.
Aber es gibt auch Lichtblicke. Oft sind es einzelne Projekte, die ein neues Vorgehen ermöglichen. Ihnen wohnt die Kraft inne, auf die gesamte Verwaltung auszustrahlen, wenn alles richtig gemacht wird. Ein solches Veränderungsprojekt ist zweifelsohne die SmartCity-Entwicklung in Deutschland.
73 Kommunen werden vom Bund mit 780 Millionen Euro gefördert. Das ist bisher einmalig und eine große Chance für Deutschlands Kommunen, sich neu aufzustellen. Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten in Teams, um die Stadt oder die Region smart zu machen. Das läuft nicht immer problemlos. Sie wer- nicht auch noch übernommen werden kann. Mit subtilen Mitteln versucht man, „neue Arbeit“ von sich weg zu halten, beziehungsweise Veränderungsvorschlägen reserviert gegenüberzustehen.
Bremser versus Macher
Warum ist das so? Dieser Frage ist erstmals Ilona Benz in ihrer Dissertation „Zukunft smarte Kommune – Modellentwurf, Vorgehen und Handlungsempfehlungen für kleine Städte und Gemeinden“ nachgegangen. Die Promotionsarbeit zeigt anhand einer Analyse von neun kleineren Kommunen auf, dass oftmals ein starkes Beharrungsvermögen vorherrscht und dadurch Veränderungen in Organisation, Personal- und Technikeinsatz erschwert werden. Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass risikoscheues Verhalten den Weg zur smarten Kommune erschwert.
„Risikoscheues Verhalten […] führt zu einer weitgehenden Bewahrung des Status quo. In einem volatilen Umfeld verstärken risikoscheues Verhalten sowie ein nicht erfüllter Unterstützungsbedarf die Überforderung der Kommunalverwaltung“ (Benz 2023, S. 288). Aus ihrer Analyse leitet sie die Phänomene einer Bewahrungsspirale und einem Zirkel der Verfestigung innovationsfeindlicher Strukturen bei der Bürgerbeteiligung ab. Eine erfolgreiche Transformation der Verwaltung ist nur dann möglich, wenn alle Verwaltungskräfte mitgenommen werden. Die existierende Beharrungsspirale muss durchbrochen werden. Ohne ein umfassenden Mindset wird es nicht gehen. Dabei gilt es Vertrauen aufzubauen und Angst vor Verände- rung zu reduzieren. Ein interessantes Experiment findet derzeit in der hessischen Stadt Eltville statt. Dort wird im Rathaus ein Lernlabor als Ort des informellen Treffens aufgebaut. Hier können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem kommunikativen Ambiente sich austauschen, Ideen einbringen und diskutieren und zu gemeinsamen Projekten finden. Eingebunden in das Lernlabor sind Studierende der Hochschule Darmstadt aus dem Fachbereich Public Management. Künftig aber auch Experten aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Das Konzept der Smart City wird in wissenschaftlicher, politischer, medialer und projektpraktischer Hinsicht überwiegend in großen Städten bearbeitet. Demgegenüber empfinden kleine, ländlich geprägte Gemeinden den SmartCity-Diskurs überwiegend als fremd. Es mangelt an inhaltlichen Modellentwürfen, Vorgehensmodellen und an kommunale Entscheidungsträger gerichtete Handlungsempfehlungen, die sich am Aufgabenportfolio, den speziellen Rahmenbedingungen und Herausforderungen kreisangehöriger Gemeinden in einer Größenklasse bis 20.000 Einwohner orientieren. Dieses Buch widmet sich diesen Aufgabenstellungen und entwirft das Modell einer smarten Kommune als Spiegelbild zur smarten Stadt.
Um die Transformation erfolgreich auf den Weg zu bringen ist es notwendig, die Digitalkompetenz der Verwaltungskräfte erheblich zu verbessern. Dies passiert derzeit im Land Sachsen. Dort startete im vergangenen Jahr eine vom Land unterstützte Offensive zur Ausbildung von Digitalnavigatoren und Digitallosten in den sächsischen Kommunen. Beim Sächsischen
Städte-und Gemeindetag wurde unter Leitung von Matthias Martin ein Schulungsteam gebildet. Mehrere Hundert Verwaltungskräfte wurden bisher qualifiziert. Der Digital-Navigator kommt aus der Mitte einer Kommunalverwaltung, kennt die Herausforderungen vor Ort genau und fungiert als Bindeglied zwischen der Mitarbeiterschaft und der Verwaltungsführung in Sachen Digitalisierung. Die Digitallosten sind die Ansprechpartner und Unterstützer der Navigatoren. Jeden dritten Freitag im Monat gibt es ein digitales Frühstück, um sich untereinander auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Ursprungsidee geht auf das erfolgreiche Digitallotsenprogramm in Baden-Württemberg zurück. Auch das Land Bayern hat ein solches Programm aufgelegt. Das Land Sachsen-Anhalt überlegt ebenfalls, für ihre Kommunen eine Weiterbildung aufzulegen. Mit diesen Programmen wird die Grundlage für mehr Awareness im Bereich Digitalisierung und Transformation in der Mitarbeiterschaft der Kommunen gelegt. Von diesem Vorgehen werden auch die Smart-City Projekte profitieren. Kritisch sieht Ilona Benz in ihrer Dissertation auch die bisherigen Förderprogramme im Bereich Digitalisierung, die die besonderen Bedarfe kleinerer Kommunen und von interkommunalen Zusammenschlüssen oft nicht ausreichend berücksichtigen. Sie fordert eine Neuausrichtung der Förderpolitik und plädiert für eine Ausweitung des förderpolitischen Innovationsbegriffs kombiniert mit einer Aufwertung von Kollektivförderungen. Die künftige Förderpolitik müsse in grundsätzlicher Weise und viel stärker als bisher auf die Schaffung gerechter Rahmenbedingungen für alle Städte und Gemeinden und damit auf interkommunalen Ausgleich zielen. Eine Fokussierung auf kapitalintensive Einzelförderungen, vorrangig orientiert am technischen Innovationsgrad von Maßnahmen, läuft diesem Ziel zuwider.
Die Dissertation zählt zu den ersten wissenschaftlichen Darstellungen in Deutschland, die sich mit dem Thema smarte Kommunen im ländlichen Raum befassen. Die Autorin zeigt anschaulich die digitale Lage in kleinen Städten und Gemeinden auf und was konkret getan werden muss, um sie zu smarten Kommunen zu entwickeln. Bislang mangelt es für kleinere Kommunen an inhaltlichen Modellentwürfen, Vorgehensmodellen und Handlungsempfehlungen. Untersucht und ausgewertet wurden in der Arbeit die Erfahrungen von neun baden-württembergischer Pilotkommunen.
Fazit
In der Dissertation wird ein Modellentwurf der smarten Kommune in den 12 Handlungsfeldern Innere Verwaltung, Sicherheit, Ordnung und eGovernment, Schule, Kinder und Jugend, Kultur, Soziales, Gesundheit und Freizeit, räumliche Entwicklung, Infrastruktur, Mobilität, Umwelt und Wirtschaft entwickelt. Ausgehend von aktuellen kommunalpolitischen Herausforderungen, den langfristigen Auswirkungen des demografischen Wandels, den Anforderungen der Bundesbürger an die Lebensqualität in Deutschland sowie dem tatsächlichen rechtlichen Handlungsspielraum kleiner Gemeinden, werden diese Handlungsfelder weiter in mehreren untergeordneten Zielbildern ausdifferenziert. Dazu zählt etwa eine vorhersagende, kleinräumliche Bedarfsplanung in der Kinderbetreuung. Gemeint ist damit eine (teil) automatisierte Auswertung relevanter Daten aus eigenen kommunalen Fachverfahren sowie öffentlicher Datenquellen wie Kinderund Jugendstatistiken oder Arbeitsmarktdaten.
Der Autor
Franz-Reinhard Habbel, Publizist und Berater Weitere Informationen
Die Dissertation„Zukunft smarte Kommune“ von Ilona Benz ist Ende Januar im Verlag Springer VS erschienen und im Buchhandel erhältlich. Dr. Benz ist Geschäftsführerin der städtischen Digitalisierungsagentur KL.digital GmbH und Chief Digital Officer der Stadt Kaiserslautern.
[ t1p.de/SmarteKommune ]
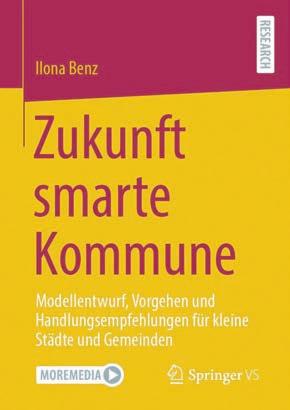
Dirk Schrödter zur OZG-Novelle








