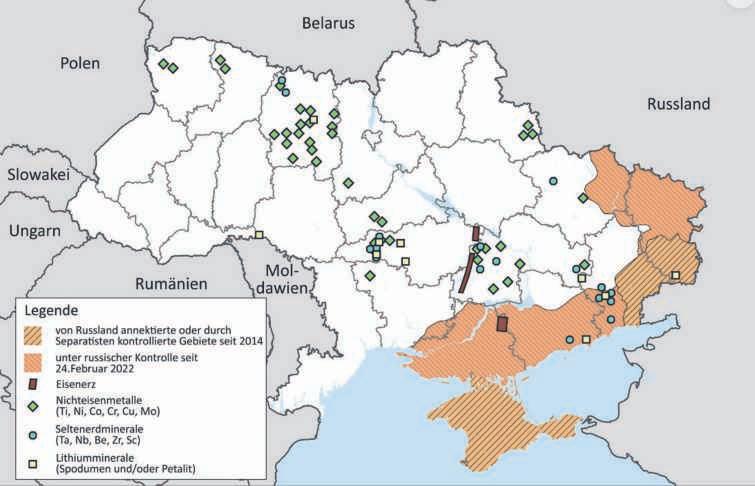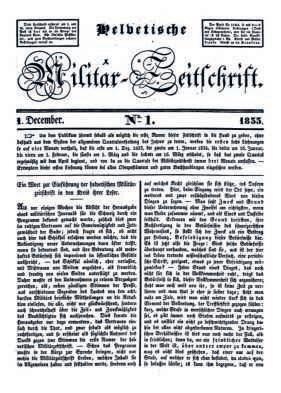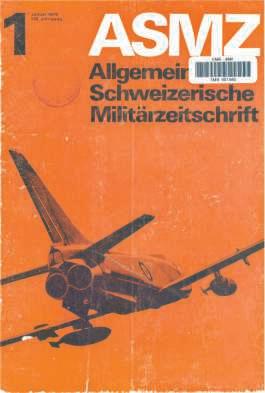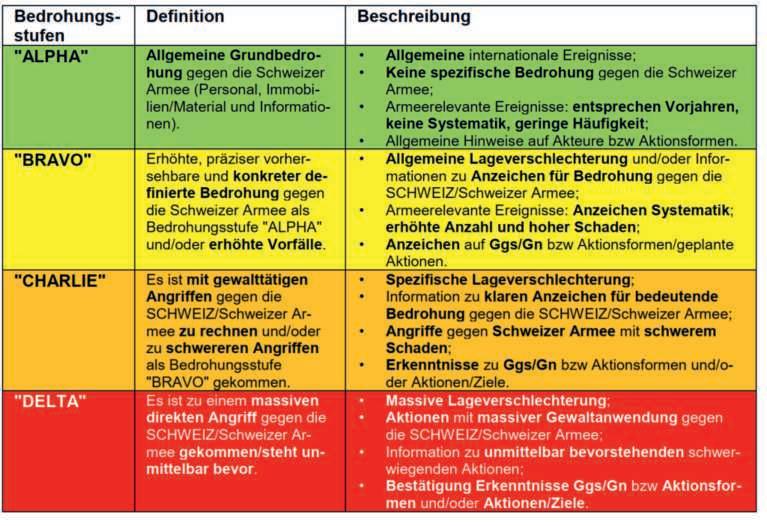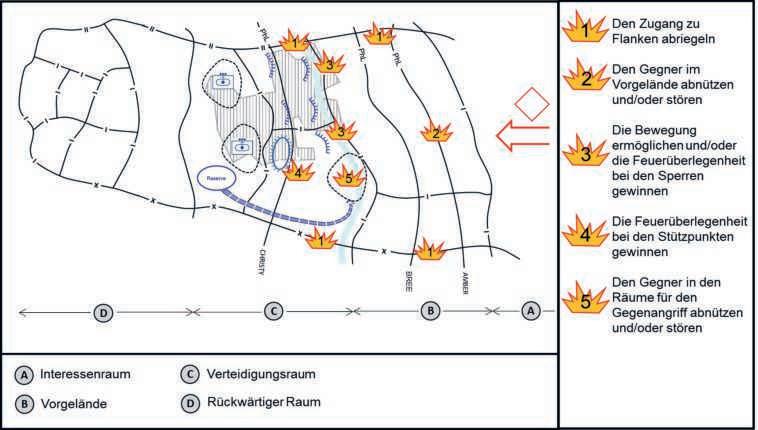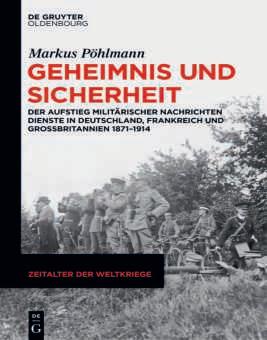ALLGEMEINE
Herausgeber:
Schweizerische Offiziersgesellschaft
190. Ja H rgang Nr. 6 – Juni 2024

ATOMWAFFEN
Die USA wollen die nukleare Triade modernisieren
Seite 12
DOKTRIN
Hier gehts lang: Die Verteidigung steht im Zentrum
Seite 5
MÖRSER 16
Nach 15-jährigem Unterbruch erhalten die Gelben wieder Werfer
Seite 32
SCHWEIZERISCHE
MILITÄRZEITSCHRIFT
ODM GmbH
Aufklärung aus der Luft
Von der Überwachung verdächtiger Bewegungen bis zur Abdeckung grosser Gebiete –TANO Drohnen ermöglichen eine sichere Aufklärung und ein umfassendes Lagebild für die Einsatzkräfte.
Aufklärungsdrohnen sind bei militärischen Operationen unverzichtbar, da sie Informationen in Echtzeit liefern. TANO Drohnen ermöglichen durch ihre modulare Bauweise die Anpassung an unterschiedliche Missionsanforderungen, gewährleisten taktische Überlegenheit und erhöhen die Sicherheit.
Aufklärung und Lagebestimmung
Die hochauflösenden Kameras der TANO Drohnen und die Wärmebildtechnik bieten einen wertvollen Lageüberblick aus der Vogelperspektive. So lassen sich potenzielle Bedrohungen erkennen und präzise Manöver exakt planen. Die Integration von HochzoomKameras ermöglicht eine detaillierte Überwachung grosser Gebiete und verschafft Einblicke in feindliche Aktivitäten und Geländebedingungen.
Wärmebildkamera
Im militärischen Bereich werden Wärmebildkameras zum Beobachten und Aufklären bei Dunkelheit oder schlechter Sicht genutzt. Sie haben gegenüber Nachtsichtgeräten den Vorteil, dass weder Restlicht vorhanden sein noch ein Infrarotscheinwerfer eingesetzt werden muss, der seinerseits sehr einfach entdeckt werden kann.
CBRN Gefahrenmessung
Die Aufnahme oder Integration von Messgeräten zur Erkennung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen erhöht die Sicherheit der Militärangehörigen, indem sie frühzeitig vor gefährlichen Substanzen oder Kontaminationen warnen können.
Transport, Abwurf bzw. Aufnahme TANO Drohnen sind vielseitig einsetzbar und können Transportaufgaben übernehmen. Beispielsweise können sie mit einem Abwurfmechanismus für die Luftversorgung und einer Aufnahmefunktion mittels einer Seilwinde ausgestattet werden.
Funknetz für mobile Kommunikation
Das TANO Drohnen EcoSystem bietet nicht nur die Kommunikation unter den Drohnenpiloten, sondern es ermöglicht auch den Aufbau eines mobilen Funknetzes aus der Luft. Die HCDrohne beinhaltet in dem Fall die IntercomBasisstation und begleitet z. B. eine abgesessene Einheit während des Einsatzes aus der Luft.
Kontaktdaten:
ODM GmbH
Hettenleidelheimer Straße 2A DE 67319 Wattenheim
Telefon +49 6359 937020 produkte@odmgmbh.com www.tanodrones.com

Modulare Drohnen für jedes Einsatzszenario
Konfigurationsmöglichkeiten
Aufklärung & Lagebestimmung Wärmebildkamera
CBRN Gefahrenmessung
Transport, Abwurf bzw. Aufnahme
Funknetz für mobile Kommunikation
Spot- und Signallampe
Lautsprecher und Mikrofon
Seilwinde
Top Features
Modulare Bauweise
Flexibles Payload-Konzept
Robustes Design
Smart Battery
Störsicherer Datenlink
ITAR-frei & NDAA konform
Lade- und Transportkoffer
Doppelbedienermodus

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: tano-drones.com MADE IN GERMANY +49 6359 937020 produkte@odm-gmbh.com www.odm-gmbh.com
Publireportage
Von der Vorbereitung, der Führung und der Beendigung von Kriegen
Liebe Leserin, lieber Leser
Wer etwas erreichen will, sollte einen Plan haben. Um die Chancen zu erhöhen, dass er sein Ziel auch wirklich schafft, muss er Eventualitäten berücksichtigen. Gut gestellt ist, wer für jede Situation eine passende Antwort hat: eine Strategie.
Schon Perikles, ein führender Staatsmann im antiken Athen, hatte erkannt: «Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.» Das Denken in Szenarien ist dabei zentral. Und stets gilt es auch das Undenkbare zu denken und das Unerwartete zu erwarten.

Christian Brändli, Chefredaktor
christian.braendli@asmz.ch
Seite Mitte des vergangenen Jahres hat die Schweigespielt. Und die USA sind daran, ihre Trägersysteme zu modernisieren. Die ASMZ wirft in mehreren Beiträgen einen Blick auf diese Waffen, die mit dem Ende des Kalten Krieges in den Hintergrund getreten sind, deren Einsatz aber heute wie damals keine Gewinner kennen würde.
Auch wenn die neue Doktrinpyramide in der Schweizer Armee erst in Erarbeitung ist, wird an der Basis doch schon auf die Rückerlangung der Verteidigungsfähigkeit hingearbeitet. Nachdem die Kampfverbände letztes

ASMZ 3 06/2024 EDITORIAL
EDITORIAL
3
Christian Brändli
SICHERHEITSPOLITIK
Christian Brändli
5 Im Interview erklärt Divisionär Alexander Kohli die grössten Knackpunkte bei der Entwicklung der Armee
Mauro Mantovani
9 Was bringen strategische Studien in der Praxis?
Thomas Bachmann
12 Angesichts der weltweiten Sicherheitslage nimmt die USA nukleare Handlungsoptionen wieder in den Fokus
Christian Brändli
16 Die Schweiz tritt dem Kernwaffenverbotsvertrag nicht bei
Kumiko Ahr
17 China und Nordkorea bauen ihre Nukleararsenale aus
Matthias Kuster
19 Carl von Clausewitz und seine Beschreibung des militärischen Genies
Peter Müller
22 Grösste Herausforderung bei den Top-Projekten des VBS sind zunehmende zeitliche Verzögerungen
Dominik Knill
24 Ein Konflikt muss reifen, ehe er gelöst werden kann
SOG
Dominik Knill
26 Die Armeefinanzen im Fokus
Thomas Hauser
27 Die ASMZ wird auch ohne Pflichtabo im bisherigen Rahmen weitergeführt

EINSATZ UND AUSBILDUNG
Ernesto Kägi
28 Das Logistikbataillon 52 lernt, wie Versorgung im Kriegsfall funktioniert
Yves Gächter, Yoann Poffet
32 Die Kampfbataillone erhalten ihre eigene indirekte Feuerunterstützung zurück
AKTUELL
Hans Peter Gubler
34 Die im Kriegseinsatz stehenden russischen Streitkräfte erhalten leistungsfähige Luftverteidigungswaffen

Jonathan Stumpf
36 Wie die Ukrainer in Tschassiw Jar die russischen Angriffe abwehren
FORSCHUNG UND LEHRE
Etienne Heitz, Hubert Annen
38 Eine Studie klärt, ob während der RS eine Persönlichkeitsentwicklung stattfindet

28 Logistiker erlernen das gefechtsmässige Aufmunitionieren 34 Russische Radarstation für die Luftverteidigung auf der Krim 38 «I dä RS wirsch än richtige Maa.» Wirklich?
RUBRIKEN
Thomas Süssli
8 Verteidigungsfähigkeit erklärt
Marc Ruef
39 Cyber Observer
Fritz Kälin
40 Aus dem Bundeshaus
Pascal Kohler
41 Internationale Nachrichten
Erdal Öztas
45 Veranstaltungen
Christian Brändli
46 Vermischtes
Christian Brändli
48 Echo aus der Leserschaft
Bruno Russi
50 Bücher
INHALT
Titelbild: Logistiker und Aufklärer sprechen sich für die kriegsmässige Aufmunitionierung im Feld ab. Bild: Aufkl Bat 11
«Mit der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit können wir uns Respekt verschaffen»
Im Zielbild und in der Strategie für den Aufwuchs der Armee finden sich neue Grundsätze der Kampfführung. Divisionär
Alexander Kohli, Chef Armeestab, erklärt, was es noch alles dazu braucht, bis diese auch umgesetzt werden können.
Die Armee befindet sich zurzeit in einem gewaltigen Transformationsprozess. Welches sind die grössten Knackpunkte?
Alexander Kohli: Die Armee hat mit dem «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs –die Verteidigungsfähigkeit stärken» eine sehr konzise Richtschnur. Die grösste Herausforderung ist, das, was dort doktrinär und entwicklungsthematisch beschrieben ist, in Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten zu bringen. In der schweizerischen Staatsverwaltung und somit auch für die Armee gelten einerseits das Legalitätsprinzip und andererseits die Budgetsteuerung. Offensichtliche Notwendigkeiten sind immer vor diesem Hintergrund zu betrachten, darüber hinausgehende Forderungen sind Wunschträume.
Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten mehrfach geändert: Wie wird da bei den laufenden Ausgaben und den Investitionen priorisiert?
Das ist ein ganz normaler Prozess. Im ersten Quartal legt der Bundesrat die finanzpolitischen Rahmenbedingungen fürs folgende Budgetjahr fest – und gibt der Armee damit auch den Budgetrahmen vor. Darauf basierend werden unter Berücksichtigung der laufenden Betriebskosten die Investitionen justiert. Die Verpflichtungskredite führen zu verschiedensten Zahlungsplänen, je einer pro Projekt beziehungsweise Teilprojekt. Diese bereiten wir so vor, dass wir eine hohe Flexibilität erhalten für verschiedene Zahlungstranchen. Das ist wie ein finanzielles Tetris: Es gibt eine Reihe von Verpflichtungskrediten; die einzelnen Bauteile, sprich Finanzierungstranchen, müssen wir dann ins Korsett einpassen, das uns Bundesrat und Parlament vorgeben. Somit
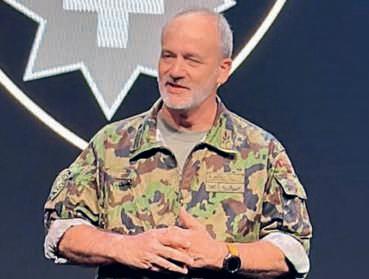
ist der sogenannte Planungsüberhang auch notwendig.
Die Armee finanziert natürlich nur Projekte, in denen im betreffenden Jahr auch Tätigkeiten umgesetzt werden. Wenn sich ein Projekt verzögert, treten wir auch bei den Zahlungen auf die Bremse. Bezahlt wird nur das, was man auch erhält. Dieser Finanzierungsüberhang hat zu den medienwirksamen, aber eigentlich nicht notwendigen Diskussionen im ersten Quartal dieses Jahres geführt. Nochmals: Ein solcher Planungsüberhang ist völlig normal. Angesichts des strukturellen Defizits im Bundesbudget hat das Parlament nun nochmals den Gürtel enger geschnallt. Entsprechend musste die Armee erneut justieren mit dem Resultat, dass es zu Verzögerungen in einzelnen Projekten kommen wird. Wir können nur das Geld einsetzen, das bei uns durch den Beschluss des Parlaments im Portemonnaie landet.
Schliesslich ist es wichtig zu verstehen, dass die Armee auf Basis der vom Parlament bewilligten Armeebotschaft beziehungsweise der darin enthaltenen Verpflichtungskredite die Erlaubnis hat, Verträge für ein Vielfaches dessen abzuschliessen, was pro Jahr effektiv bewilligt wird.
«Das System Armee ist kein Schnellboot, sondern vielmehr ein Supertanker.»
Divisionär Alexander Kohli
Diese erstrecken sich ja über Jahre. Eine normale Rüstungsbeschaffung dauert etwas gar lange, nämlich zwischen sechs und neun Jahren. Darüber bin ich nicht glücklich. Um uns den Bedürfnissen der heutigen Zeit anzupassen, gilt es mehr Teilprojekte zu schaffen, die rascher abgeschlossen werden können. Dadurch werden die Beschaffungen auch für die Politik sowie die Bevölkerung besser greifbar und verbindlicher. Das ist ebenso wichtig. Bei Projektlaufzeiten von neun Jahren, also über zwei Legislaturen hinaus, fehlt eine gewisse Verbindlichkeit für das Projekt.
Gleichzeitig gilt aber auch festzuhalten, dass das System Armee kein Schnellboot ist, sondern vielmehr ein Supertanker. Der ist nur langsam zu steuern. Unser System mit einem kleinen Berufskern und einem grossen Milizanteil kann nicht ruckzuck und
VOM INGENIEUR ZUM CHEF ARMEESTAB
Divisionär Alexander Kohli führt seit Anfang 2023 als Chef des Armeestabes der Schweizer Armee im Departementsbereich Verteidigung die wichtigsten unternehmerischen Belange. Als Mitglied der Armeeführung ist er dem Chef der Armee direkt unterstellt. Er verantwortet die operationelle Umsetzung der politischen und militärstrategischen Vorgaben und Handlungsanweisungen. An der Nahtstelle der politisch-strategischen und operativ-taktischen Stufe ist er für die Entwicklung, Planung, Ressourcenallokation und Steuerung der Armee zuständig.
Der 57-jährige Kohli hat 1995 an der ETH Zürich sein Studium als Kulturingenieur abgeschlossen. Von 1995 bis 1998 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH und promovierte zum Dr. sc. techn. Danach wirkte er in einem Ingenieur- und Planungsbüro. 2016 wurde er Kommandant der Infanteriebrigade 5, 2018 dann der neu gebildeten Mechanisierten Brigade 4.
ASMZ 5 06/2024 SICHERHEITSPOLITIK
Interview Christian Brändli
Als Chef des Armeestabes ist Divisionär Alexander Kohli für die Planung der Armee verantwortlich. Bild: Armeestab
hüpfend unterwegs sein. Die Leute brauchen eine klare, kontinuierliche Ausrichtung.
Sie sagen es: Punkto Umsetzung von Neuerungen ist eine Milizarmee ein recht schwerfälliges Gebilde. Lassen sich solche Neuerungen eigentlich im nötigen Tempo umsetzen?
Ich drücke es anders aus: Die Armeeführung und der CdA vorneweg wollen schneller umsetzen, um Empathie zu schaffen. Das sind wir der Miliz schuldig. Ich benütze hier ein Schlagwort: Die Armee muss agiler werden. Auch die Arbeitstechnik in der Militärverwaltung – ebenso ein schlechtes Wort, das man nicht gerne hört – sieht nicht mehr nur konventionelles Projektmanagement vor. Wir mischen hier vermehrt auch agile Komponenten hinzu.
Im Beschaffungswesen wurde vor zwei Jahren noch das Konzept Agilo vorgestellt, das ein schrittweises Vorgehen vorsah. Agilo war nur eine erste Konzeption. Bezüglich Entwicklung der Armee gehen wir in mehreren Schritten – adaptiv – vor. Das ist agiler. Wie bei der Stabsarbeit gilt es kleine Teams anzusetzen. Ein solches Vorgehen steckt den Milizkadern in den Genen. Wir müssen das nur bewusst leben, auch in der Verwaltung.
Gibt es eine Vorstellung davon, in welcher Kadenz unsere Armee Änderungen in der Strategie verdauen kann?
Die Armee hat keine Klarheit darüber, was wie schnell machbar ist. Aber wir spüren rückblickend, was verkraftbar ist. In den letzten 20 Jahren haben wir vier Armeereformen gehabt. Dadurch haben wir teilweise auch Rückhalt bei den eigenen Milizangehörigen verspielt. Das ist mit ein Grund, warum wir nicht mehr die grossen Würfe machen wollen, sondern die Armee künftig schrittweise, kontinuierlich weiterentwickeln. Das heisst nicht eine kontinuierliche Verunsicherung, sondern lieber kleine Schritte und kleine Veränderungen, die kein solches Gefühl aufkommen lassen.
Und wie schnell kann sich die Truppe auf neue Einsatzverfahren und Systeme umstellen?
In der Mechanisierten Brigade 4, die ich befehligte, brauchte es drei, vier, fünf Jahre, um eine Änderung wirklich durchgehend umzusetzen. Sie haben nie alle Soldaten und Kader in einem WK. Um die Durch-
dringung zu erreichen, braucht es einfach seine Zeit. Ich spreche hier von Neuerungen in der Doktrin über Einsatzverfahren bis hin zu den Gefechtsgrundsätzen. Für den Soldaten ändert sich ja häufig gar nicht viel. Aber beim Kader verhält es sich ganz anders. Auf der Karriereleiter verbleibt einer dort vielleicht vier Jahre auf einer Stufe, ehe es weitergeht. Diese Funktionswechsel machen eine Durchdringung ganz schwierig.
Auf der politischen Ebene steht die Diskussion darüber noch aus, wie weit die Kooperation mit der NATO oder befreundeten Staaten gehen darf. Wie weit muss sie aus militärischer Sicht gehen? Die Armee hat klar festgehalten, dass eine langfristige und umfassende Verteidigung alleine nicht möglich ist. Uns fehlt räumlich die operative Tiefe. Aber auch von den Ressourcen her haben wir Probleme. Die Bevorratung ist schnell erschöpft. Daher steht im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs», dass die Armee nach einer Anfangsphase –deren Länge ist nicht definiert – und einer ersten Abwehr eines Angriffs auch rechtlich die Möglichkeit hat, sich zusammen mit Partnern weiter zu verteidigen. Somit müssen wir stark und umfassend selbst wirken können, danach aber auch fähig sein, zusammenzuarbeiten.
«Selbst dort, wo wir stark sind, beispielsweise im Cyberbereich, agieren wir nie alleine.»
Divisionär Alexander Kohli
Wieweit ist die Schweizer Armee heute noch in der Lage, sich autonom verteidigen zu können?
Selbst dort, wo wir stark sind, beispielsweise im Cyberbereich, agieren wir nie alleine. Die Vernetzung ist gross, vor allem im nachrichtendienstlichen Bereich. In der Cyberverteidigung dagegen sind wir wirklich stark. Wenn Sie die einzelnen Sphären anschauen, spüren Sie rasch, wo wir stärker sind und wo weniger. Das hängt auch mit dem technischen Stand der Waffensysteme zusammen. Im Bereich Luft werden wir mit der Umsetzung des geplanten Aufwuchses sehr bald ein gutes Leistungsprofil erreichen können. Am Boden dagegen geht es deutlich länger, dort hinken wir hintennach.
Wir erleben in der Ukraine, aber auch im Nahen Osten, wie sich das Gefechtsfeld rasant verändert. Kann die Armeeplanung darauf in nützlicher Zeit reagieren?
Wir beobachten diese Gefechtsfelder sehr genau. Dabei gewinnen wir wichtige Erkenntnisse, die uns aber nicht in jedem Fall überraschen. So wussten wir, dass es eine lange Phase gibt, in welcher weitreichendes Feuer gefragt ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir in einem ersten Schritt unsere Luftverteidigung hochfahren müssen mit dem neuen Kampfflugzeug und der bodengestützten Luftverteidigung grosser Reichweite. So bald wie möglich müssen wir auch mit der bodengestützten Luftverteidigung mittlerer und kurzer Reichweite nachziehen.
Daneben gibt es sehr viele «kleine» Erfahrungen, die wichtig sind und eingeschlagene Wege verdeutlichen. Ich spreche hier von der Bedeutung der Drohnen oder der Bedeutung der digitalen Transformation der Gesellschaft. Vor zehn Jahren, und das trifft auf alle zu, hatten wir noch nicht die gleichen Erkenntnisse wie heute. Wichtig festzuhalten ist aber: Im Augenblick, in dem jemand in einen Konflikt hineingerät, kämpft er mit dem, was er hat. Und alles wird genutzt, was irgendwie dienlich ist. So werden eben schnell auch handelsübliche zivile Geräte zu Waffensystemen umfunktioniert.
Stimmt bei den Beschaffungen angesichts der rasanten Veränderungen auf dem modernen Gefechtsfeld unsere Prioritätensetzung, die dem Verfalldatum der bestehenden Hauptwaffensysteme folgt?
Dieses Ablaufdatum ist bei Weitem nicht der wichtigste, geschweige denn der einzige Faktor. Die fähigkeitsorientiere Streitkräfteentwicklung beginnt mit der Lage. Ausgehend von dieser fragen wir uns: Passt das, was wir haben, mit dem überein, was wir haben müssten? Dann wird überlegt, wie wir darauf reagieren. Es folgen Diskussion und Versuche. Dabei wird geprüft, ob unsere erarbeiteten Konzepte wirklich passen. Das alles mündet in einen Masterplan, der in Übereinstimmung mit der Rüstungspolitik und den konkreten Beschaffungen gebracht wird.
Dass wir nicht einfach zum schon Vorhandenen ein Nachfolgemodell suchen, zeigt sich ja nur schon daran, dass wir initial ein Schwergewicht auf die weitreichende Abwehr legen, um dann entlang der Eck-
6
SICHERHEITSPOLITIK

werte für die Ausrichtung der Armee in zwölf Jahren ein ausgeglichenes Fähigkeitsprofil zu erreichen. Danach folgt die Beschaffung der weitreichenden operativen Mittel. Mit der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit können wir uns Respekt verschaffen. Diese weitreichenden Mittel gehen weit über das hinaus, was unsere Artillerie heute mit den Panzerhaubitzen kann. Wir sprechen jetzt von Raketenartillerie und Loitering Munition, damit wir bei der geänderten Situation punkto Tiefe des Raumes einen anderen Hebel haben.
Dieses Zerschlagen angreifender gegnerischer Kräfte bereits ausserhalb der Landesgrenzen ist eine neue strategische Komponente. Findet dieser neue Grundsatz der Kampfführung in der Politik Akzeptanz und werden alle dafür notwendigen Mittel auch zur Beschaffung freigegeben?
Das ist tatsächlich einer der brandheissen und wesentlichen Grundsätze, den die Armee im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» postuliert hat. Dieser Ansatz erfährt heute erhöhte Akzeptanz.
Erstaunlicherweise?
Ja. Selbst jene, die die Neutralitätspolitik als unverrückbare und nicht interpretierbare Grundlage sehen, sprechen nicht über diesen Punkt. Alle scheinen erkannt zu haben, dass es nicht die Lösung sein kann, dass wir bei einer Bedrohung erst den Schaden bei uns stattfinden lassen, ehe wir reagieren. Mit der Beantwortung des ständerätlichen Postulates 23.3000 ist «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs – die Verteidigungsfähigkeit stärken» vom Bundesrat homologiert worden. Damit ist die Sicht der
Armee, die wir am 17. August 2023 in Kloten präsentiert haben, zur Haltung der Landesregierung geworden. Das ist für uns zentral.
Im schwarzen Buch «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» werden auch gewisse bisher bestehende Denkverbote aufgehoben. Noch bis vor Kurzem sperrte sich die Armee gegen die Einführung von bewaffneten Drohnen oder sogar Loitering Munition. Mittlerweile werden solche Waffen in den aktuellen Konflikten auf unterster Stufe eingesetzt. Wann werden solche vergleichsweise sehr günstigen Systeme hierzulande bei der Truppe sein? Die Schweizer Armee kann sich technologischen Fortschritten gegenüber nicht verschliessen. Als Beispiel spreche ich von Waffenautomaten im Objektschutz. Dieses Thema begleiten wir aktiv, zumal solche Systeme angesichts beschränkter personeller Ressourcen immer wichtiger werden. Auch die Drohnenabwehr ist sehr wichtig. Wann die Schweizer Armee bewaffnete und KI-unterstützte Drohnen haben wird, kann ich aber nicht sagen. Einerseits fehlen uns aufgrund der Priorisierung anderer Rüstungsbeschaffungen momentan die notwendigen Finanzen dafür. Andererseits schauen wir gerade in diesem Bereich, dass die Frage geklärt ist, wo hier der Mensch Teil des Prozesses bleibt und die Kontrolle behält. Die Sicherheit muss stets gewährleistet werden. Ein solches System wäre ja auch im Nicht-Kriegszustand im Einsatz.
Ins gleiche Kapitel gehört der Einsatz von Panzerminen. Diese wurden vor Jahren alle aus unserem Waffenarsenal ausgestaubt. Dabei wäre das doch die Panzerabwehr des «armen Mannes» und
damit ein wichtiges Mittel für unsere in Finanznöten steckende Armee. Die Armee prüft, wie sie sich in diesem Bereich wieder aufstellen kann. Wir können es uns nicht erlauben, das einfach beiseitezuschieben. Auch wenn dies Systeme des «armen Mannes» sind, werden sie präziser. Fehlabgänge sind immer weniger möglich. Wie werden auf Stufe Armee die Lehren aus den aktuellen Kriegen gezogen?
Die ganze Armee macht dabei mit. In unseren Operational Domains wird grundsätzlich überlegt, welche Entwicklungen aktuell sind. Daraus abgeleitet wird das Ambitionsniveau festgelegt. Dann wird geprüft, welche Systeme für die Erreichung dieses Ambitionsniveaus benötigt werden. Danach verlässt der Prozess die Ebene der Streitkräfteentwicklung und es wird das System selbst unter die Lupe genommen. Mit verschiedenen Versuchen wird über die ganze Armee hinweg mitgedacht, was essenziell wichtig ist. Es darf nicht heissen, dass das irgendwo in Bern im Büro erdacht worden sei. Aber gesteuert werden muss der ganze Prozess zentral, im Sinne der Streitkräfteentwicklung.
«Die Doktrinpyramide ist in Erarbeitung.»
Divisionär
Alexander Kohli
Im schwarzen Buch «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» werden die Grundzüge der Doktrin der Armee vorgestellt. Wird es eine ausgefeilte Doktrin 202x geben?
Im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs – die Verteidigungsfähigkeit stärken» ist die Armeedoktrin zu finden. Diese ist die Basis der neuen Doktrinpyramide. Das Zusammenspiel der Teilstreitkräfte in den verschiedenen Operationssphären wird über die Joint-Doktrin geklärt, die beim Kommando Operationen liegt. Dann geht es hinunter zu den Einsatzverfahren und den Gefechtsgrundsätzen. Die Doktrinpyramide ist in Erarbeitung. Es gilt zu bedenken, dass nicht nur bei der Armee die Strategie in Überarbeitung ist. Parallel dazu gibt es auch die Gesamtstrategie für den Bereich Verteidigung. Darin eingeschlossen ist das Unternehmen. Hinzu kommt eine Dachstrategie für die digitale Transformation. Alles zusammen wird jetzt auf einer Roadmap synchronisiert. Der Prozess der durch-
7 06/2024 ASMZ Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift
Mit der Beschaffung der F-35 verfügt die Schweizer Armee über Mittel zur weitreichenden Abwehr. Bild: Christian Lucek
gehenden Entwicklung, der auch einhergeht mit der Neudefinition der Kopfreglemente, läuft nun an.
Was bedeutet das Denken in Szenarien für die Strategie?
Wir denken nur noch in Szenarien, das ist unser Rückgrat. Der ganze Streitkräfteentwicklungsprozess basiert auf acht Grundszenarien. Diese hängen ab vom Sicherheitspolitischen Bericht respektive von den neusten Erkenntnissen des MND. Diese Szenarien haben wir für die Armeebotschaft 24 auf noch vier benannte Szenarien kondensiert, wobei das Szenario «innere Sicherheit» nicht dargestellt wird. Die übrigen drei Szenarien sind in der Armeebotschaft 24 dargestellt und die Variante 2 wird als Designgrundlage verwendet. Diese geht davon aus, dass Formen der hybriden Konfliktführung, der militärischen Bedrohung aus der Distanz und eines militärischen Angriffs gleichzeitig oder in rascher Abfolge eintreten können. Dies bedingt ein ausgeglichenes Fähigkeitsprofil, auch weil uns ein Gegner immer da angreifen würde, wo wir am schwächsten sind oder Lücken haben.
Mit dem Hinausschieben des Finanzierungsziels von 1 Prozent des BIP auf 2035 droht die Armee ihr Heer zu verlieren. Angenommen es bleibt bei dieser Zeitmarke: Wie weit ist damit das Zielbild und die Strategie für den Aufwuchs mit der Umsetzung — oder eben mangels Geld Nichtumsetzung — des ersten Schritts Makulatur?
Makulatur ist es nicht. Es ist wie ein Gummiband: Es verzieht sich. Schlimm wäre, wenn die Zielmarke noch weiter hinausgeschoben würde. Das heisst der Gummi so weit verzogen würde, dass er nicht mehr brauchbar wäre oder gar reissen würde. Das endet dann in massiven Fähigkeitslücken. Wir müssen uns bewusst sein, dass das System Schweizer Armee mit den vorhandenen Mitteln wegen der Betriebskosten stark limitiert ist. Wenn die Betriebskosten immer noch weiter ansteigen, weil wir antiquierte Systeme einsetzen – diese mögen vielleicht noch schön aussehen, haben aber keinen militärischen Wert mehr –, dann sind diese für die Armee schlicht zu teuer. Daher haben wir schon länger versucht, Systeme, die für die Verteidigung nicht mehr sinnvoll sind, stillzulegen, was vom Parlament nicht immer genehmigt wurde. Der erste Schritt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit wird so oder so umgesetzt. Steht früher
mehr Geld zur Verfügung rascher, steht das Geld erst später zur Verfügung konsequenterweise weniger rasch.
Wo hat die Fokussierung auf den Kernauftrag Verteidigung Auswirkungen auf das Stationierungskonzept der Armee? Die ganze Kampf- und Führungsinfrastruktur wird punkto Weiterverwendung überprüft. Dabei kann es auch zu Umnutzungen kommen. Beispielsweise werden die Festungsminenwerfer nun nicht mehr als solche in Betrieb gehalten, sondern sollen die dazugehörigen Anlagen als Kompaniestützpunkte genutzt werden. So ist eine sinnvolle Weiterverwendung einer teuren Investition möglich.
Verschiedenste Konzepte, insbesondere im Unterstützungsbereich, werden nun erarbeitet. Die Einsatz- und Kampflogistik beschäftigt uns sehr stark, weil wir dort grossen Nachholbedarf haben. Stellen Sie sich vor: In den letzten 25 Jahren wurde die Logistik völlig neu ausgelegt auf eine effizienzbasierte, zivile Logistik mit noch fünf oberirdischen Zentren mit Hochregallagern. Diese Art von Logistik ist aber nicht kriegstauglich. Zum Glück haben wir noch viele Kavernen, die reaktiviert werden können. Die Kosten für deren Betrieb können wir aber heute schlicht nicht stemmen. Im Moment können wir diese Infrastrukturanlagen nur blockieren, damit sie nicht weiter abgebaut werden. Später werden sie dann in die Konzeption eingebaut. Sobald wir in der Kurve des Anstiegs der finanziellen Entwicklung sind, haben wir auch die Möglichkeit, schwergewichtig in die Infrastruktur zu investieren. Wir sprechen hier von 2028/29.
Es ist geplant, zwei schwere Divisionen zu bilden. Sind die Vorbereitungsarbeiten dafür auf Kurs?
Die Vorbereitungsarbeiten wurden von der Armee im Sinne der adaptiven Weiterentwicklung an die Hand genommen. Diese umfassen neben den Strukturen auch die Logistik und die Führungsunterstützung. Aktuell können aber noch keine konkreten Inhalte kommuniziert werden.
 Major
Major
a D
Christian Brändli Chefredaktor ASMZ christian.braendli@asmz.ch
8607 Seegräben

VERTEIDIGUNGSFÄHIGKEIT ERKLÄRT
Thomas Süssli, CdA
Mit der Armeebotschaft 2024 wurden dem Parlament die Eckwerte zur strategischen Ausrichtung der Armee bis 2035 vorgelegt. Dies ist die politische Ausarbeitung der Ziele, die im «schwarzen Buch», dem Zielbild und der Strategie für den Aufwuchs, im letzten Sommer definiert wurden. Damit hat die Armee ein klares Ziel, eine Strategie sowie eine Doktrin.
Im Zentrum der neuen Armeedoktrin steht die Verteidigung. Mit Blick auf die Komplexität hybrider Bedrohungen muss die Verteidigung breiter aufgefasst werden. Ein Aggressor wird nur einen umfassenden bewaffneten Angriff führen, wenn er seine Ziele nicht anders erreicht. Wahrscheinlicher ist, dass er das Land durch eine hybride Konfliktführung sukzessive destabilisieren und die Behörden in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken will. Ob die Schweiz in einen Krieg verwickelt wird, wird auch von ihrer glaubwürdig demonstrierten Bereitschaft abhängen, ihr Territorium zu verteidigen. Einem potenziellen Angreifer muss unmissverständlich aufgezeigt werden, dass die Armee einem bewaffneten Angriff entschlossen und wirksam entgegentreten würde. Dies in allen Wirkungsräumen. Gelingt es nicht, den Gegner von der Eskalation abzuhalten, könnte er sich zu einem umfassenden bewaffneten Angriff entschliessen. Dann greift die Doktrin für die territoriale Verteidigung, welche die Armee seit 2016 entwickelt hat: die sogenannte «zonengebundene Verteidigung». Auf der territorialen Grundplatte, mit den Territorialdivisionen, werden Schwergewichtszonen gebildet. In jeder Schwergewichtszone wird die Verteidigung jeweils von einer schweren Division selbständig geführt. Dieser wird dafür Raumverantwortung übertragen, was das Konzept von den heutigen mechanisierten Verbänden unterscheidet. Die schweren Divisionen verfügen dabei über alle Mittel, um selbständig den Kampf zu führen und somit eine zeitliche und räumliche Überlegenheit zu erlangen.
8
SICHERHEITSPOLITIK
Strategische Studien: vom akademischen zum praktischen Nutzen
Angesichts der aktuellen geopolitischen Verwerfungen haben die strategischen Studien Konjunktur. Sie bringen ein breites Spektrum von Untersuchungen hervor, wobei jene herausragen, welche die verdeckten Ziele und die bloss angedrohten Mittel von Strategie erhellen und in die Zukunft projizieren.
Vor knapp 20 Jahren beklagte der renommierte britische Militärhistoriker Hew Strachan «the lost meaning of strategy». Längst aus seiner angestammten militärischen Sphäre herausgetreten, habe der Begriff eine Beliebigkeit erlangt, die ihm seine praktische Verwendbarkeit entzogen habe. Dessen ungeachtet blüht die Landschaft der strategischen Studien mehr denn je. Weltweit produzieren Dutzende von Institutionen, die «strategic» im Namen führen, einen kontinuierlichen Strom von Analysen aller Art und in unterschiedlichsten Publikationsformaten. Sie finden offenbar eine Kundschaft, vielleicht gerade wegen ihrer diffusen Selbstbezeichnung, die wohl von der positiven Konnotation des Wortes im allgemeinen Sprachgebrauch profitiert: Strategisch wird mit der höchsten Hierarchiestufe assoziiert, mit Aktualitätsbezug und Zukunftsorientierung, mit breitem Denken in grossen Räumen und Zeiträumen und mit den existenziellen Fragen von Krieg und Frieden.
In der Tat geht es bei Strategie im Kern um die Verfolgung der eigenen Ziele unter Rückgriff auf die zur Verfügung stehenden Machtmittel – und dies gegen Akteure mit konträren Zielen –, also um Grundfragen der Conditio humana. Seit den 1980er-Jahren hat sich in der amerikanischen Militärdoktrin hierfür die Kurzformel «Ends –Ways – Means» eingebürgert, ein elastisches Dreieck, nicht nur weil sich die drei Komponenten gegenseitig beeinflussen, sondern auch permanent verändern, und dies umso mehr, je länger ein Konflikt dauert.
Die Beschreibung, wie genau und mit welcher Kausalität diese Veränderungen stattfinden beziehungsweise in ihrer Bedeutung für eine Gesamtstrategie variieren, ist schon eine grosse Herausforderung in den strategischen Studien. Damit aber nicht genug. Die höhere Kunst liegt darin, zwei wichtige Merkmale von Strategie zu begreifen: Zum einen zeigt sich bei jeder Umsetzung von strategischen Konzepten die
Unterscheidung zwischen offen erklärten und verdeckt verfolgten Zielen. Denn Klandestinität ist geradezu die Voraussetzung für jeden strategischen Erfolg. Zum anderen pflegen die Akteure von ihren Machtmitteln entweder direkt oder indirekt Gebrauch zu machen. Das heisst, man setzt sie in ihrer (destruktiven) Primärfunktion ein (vgl. Abb. 3) oder man droht nur mit ihrem Einsatz und erhofft sich die gewünschte Verhaltensänderung beim Gegner auf diese Weise (vgl. Abb. 4). Diese Kerngedanken seien nachfolgend am Beispiel der Strategie Russlands im Ukraine-Krieg illustriert.
Erklärte und verdeckte Ziele
Der Nebel des Krieges, von Carl von Clausewitz mit Blick auf die Nachrichtenlage ersonnen, erstreckt sich auch und wesentlich auf die Ziele der Konfliktparteien. Diesen Nebel zu lichten, ist eine vordringliche Aufgabe der strategischen Studien. Wenn Russland die «Verhinderung eines Genozids im
Donbass», die «Demilitarisierung» und «Entnazifizierung» der Ukraine als politische Ziele seines Einmarsches in der Ukraine erklärte, waren dies offensichtlich Propagandalügen oder fadenscheinige Vorwände (vgl. Abb. 1). Als solche aber dienen sie durchaus verdeckten innenpolitischen Zielen, die bei jeder Strategie unausgesprochen vorhanden, ja zentral sind: dem Machterhalt nämlich und der Unterstützung für die gewählte Strategie, hier die fortgesetzte Kriegführung, seitens der relevanten Machtbasis. Was in Demokratien das Wahlvolk ist, stellen in Russland die Profiteure des Regimes Putin dar. Diese Ziele haben alle Herrscher zu allen Zeiten als vital erkannt und sorgfältig verfolgt, nicht nur mit der Peitsche, sondern auch mit Zuckerbrot. Wie weit die deklarierten Ziele aber «greifen» und die Machtbasis trägt, muss somit auch ein Primärinteresse der strategischen Studien sein.
Soweit die Ziele militärischer Natur sind, werden sie natürlich noch viel weniger of-

06/2024 9 SICHERHEITSPOLITIK
Mauro Mantovani
Abb. 1: Erklärtes Ziel: «Entnazifizierung», hier Kämpfer des Asow-Regiments. Bild: Wikimedia Commons ASMZ
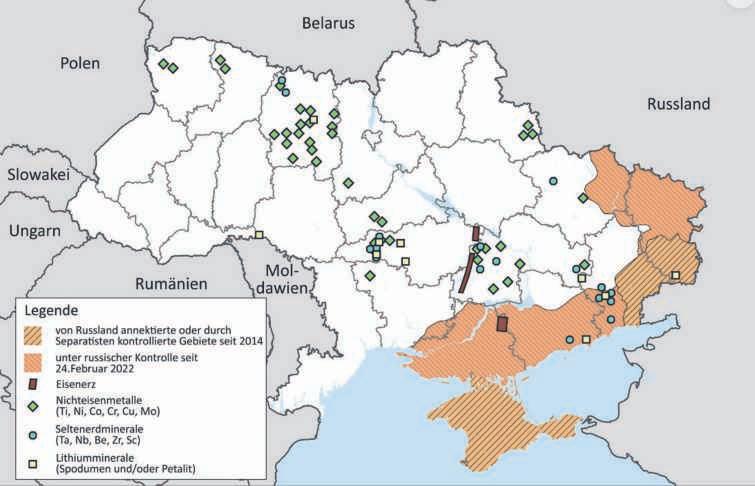
fengelegt: Man pflegt sich auf den generellen Hinweis zu beschränken, dass die Streitkräfte die Voraussetzungen für die Erreichung der (erklärten) politischen Ziele schaffen und das Einlenken des Gegners bewirken sollen: Mit dem militärischen soll der politische «Endzustand» vorbereitet werden, im doktrinellen Fachjargon. Aber offensichtlich verfolgt die russische Armee in der Ukraine auch konkretere Ziele, etwa den Landkorridor zur Krim abzusichern, die annektierten Provinzen zu befrieden und möglichst weite Teile des Landes zu erobern – und dies alles durch die Schwächung der militärischen
Mittel der Ukraine und ihrer sozio-ökonomischen Grundlagen. An welchen Frontabschnitten und mit welchen Mitteln mutmasslich ein nächstes Schwergewicht gebildet und ein Durchbruch gesucht wird, ist aktuell eine zentrale Frage der strategischen Studien in militärischer Hinsicht.
Die Erhellung der verdeckten politischen und militärischen Ziele erfolgt durch die Analyse des Agierens. Das russische Handeln in der Ukraine verfolgt offenkundig eine Reihe von nicht erklärten politischen Zielen: die Einsetzung einer prorussischen Regierung; die Abkoppelung der

Ukraine von EU und NATO und die Eingliederung des Landes in die russische Einflusszone, mithin die Wiederherstellung von «Grossrussland»; eine kulturelle Assimilierung des ukrainischen Volkes; den Zugriff auf die Wirtschaftsleistung des Landes, seine Bodenschätze (vgl. Abb. 2) und sein Humanpotenzial; die Spaltung des Westens durch Drohungen, Subversion und die Verursachung von Flüchtlingsströmen, mithin dessen Destabilisierung; den Aufbau eines ideologischen Gegenmodells zum «dekadenten» Westen. Viele Handlungen Moskaus deuten auf diese verdeckten Ziele hin und sind Forschungsgegenstand der strategischen Studien. Politisch relevant werden Analysen dann, wenn sie zeigen können, wie wichtig dem Kreml diese Ziele tatsächlich sind beziehungsweise wie weit er bereit ist, dafür einen Preis in Form von Rückschlägen zu bezahlen und seine Kriegsanstrengungen zu eskalieren.
Eingesetzte und bloss angedrohte
Mittel
Damit ist ein zweiter «springender Punkt» der strategischen Studien angesprochen: Das Erkennen, über welche Machtmittel ein Akteur aktuell und in Zukunft verfügt. Denn niemand wird alle seine Mittel einsetzen, bevor ihn eine existenzielle Notlage dazu zwingt. Vielmehr wird er seine Mittel zurückhalten und versuchen, eine Wirkung beim Gegner zu erzielen, indem er ihren Einsatz bloss ankündigt, mithin androht. Dies ist der offenkundige Zweck der oft wiederholten nuklearen Drohungen Russlands. Über das Vorhandensein dieses Potenzials bestehen keine Zweifel – wohl aber über das tatsächliche Kalkül um ihren Einsatz hinter den Kreml-Mauern. Anders liegen die Dinge bei den angekündigten Wunderwaffen Putins, vom Kampfpanzer T-14 Armata bis zum Marschflugkörper Burewestnik («Sturmvogel»): Sie stellen aufgrund technischer Mängel aktuell noch keine realen Optionen in der Hand des Kremls dar.
Wie weit aber sind diese Waffen von der Einsatzfähigkeit, sei es in der Ukraine oder gar gegen den Westen, entfernt? Es geht damit letztlich um die Innovationskraft der russischen Rüstungsindustrie – und der mit Russland befreundeten Staaten, und nicht nur um ihre Kapazität, um Verluste an der Front zu substituieren. Und damit wiederum sind Fragen der personellen Ressourcen verknüpft, des Ausbildungs- und Mobilma-
10 SICHERHEITSPOLITIK
Abb. 2: Verdecktes Ziel: Fossile Energieressourcen.
Nr. 296
Bild: Ulrich Blum et al., Die Rohstoffe der Ukraine und ihre strategische Bedeutung, Ukraine-Analysen
Abb. 3: Eingesetztes Mittel: Raketensystem 9K720 («Iskander»). Bild: Wikimedia Commons

chungssystems und letztlich der Leidensfähigkeit der russischen Gesellschaft und Wirtschaft. Strategische Studien zu diesen Fragen erlangen damit eine hohe Relevanz – gleichzeitig aber auch eine kaum mehr zu bewältigende Komplexität. Dieser wird eine simple Berechnung von vergangenen «Abnützungsraten» bei Einzelsystemen oder des Munitionsverbrauchs und ihre Extrapolation in die Zukunft bis hin zur Prognose eines Zeitpunkts, wann dieser Krieg für Russland «strategisch» gewonnen oder verloren sei, nicht gerecht.
Ein Akteur wird auch seine nichtmilitärischen Mittel nur im äussersten Fall ausschöpfen. So könnte wohl auch Russland seine innenpolitische Repression weiter steigern; aussenpolitisch seine Annäherung an China, Iran und Nordkorea noch vertiefen und auf diese Weise weitere militärische Unterstützung erlangen; es könnte seine Exporte fossiler Energieträger an «unfreundliche» Staaten weiter drosseln und diese mit noch mehr Desinformation und Sabotage überziehen. Wird es dies aber tun und bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen? Auch dies sind lohnende Ansatzpunkte für strategischen Studien.
Der praktische Nutzen Strategieanalyse ist ein hochanspruchsvolles, interdisziplinäres Forschungs- und Lehrgebiet, das mit einer riesigen Datengrundlage arbeitet, deren Lückenhaftigkeit
zu vielen Annahmen und zu beständiger Überprüfung der Einschätzungen zwingt, um mit einer fortschreitenden Lageveränderung Schritt zu halten.
In der skizzierten Weise betrieben, entfalten die strategischen Studien einen Nutzen, der über die Schulung des langfristigen Denkens über Sicherheitsfragen hinausgeht, insbesondere dann, wenn sie die politischen Entscheidungsträger erreichen und ihnen einen Informationsvorsprung für ihr Handeln geben wollen. Sie nähern sich damit dem Wesen und der Funktion von Nachrichtendiensten an, ohne auf deren exklusive Quellen zurückgreifen zu können.
Ob dieser Nutzen auch in messbare Wirkung umgesetzt wird, entzieht sich jedoch den Möglichkeiten der strategischen Studien. Die Politik handelt nach ihren eigenen Gesetzen und akademische Empfehlungen sind nur eine von vielen Entscheidungsgrundlagen, die nach Opportunität herangezogen werden, wie gerade die aktuelle schweizerische Innenpolitik zeigt: Auch nach über zwei Jahren Krieg in der Ukraine gehen die Meinungen, ob die russische Strategie ein sicherheitspolitisches und militärisches Umdenken der Schweiz mit einschneidenden Verschiebungen von Ressourcen erfordere, weit auseinander.

Dr. Mauro Mantovani
Dozent Strategische Studien MILAK an der ETHZ 8903 Birmensdorf
Pensionierung. Träume. Finanziert.
«Wozu eine Pensionsplanung?»
Eine gut durchdachte Pensionsplanung lohnt sich mehrfach: Wer lückenlos in die AHV einbezahlt hat und stets über den Arbeitgebenden bei einer Pensionskasse versichert war, kann mit etwa 60% des letzten Einkommens rechnen. Bei höheren Löhnen, längeren Erwerbsunterbrüchen oder Beitragslücken könnte es jedoch schnell mal weniger sein. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, sich frühzeitig mit einer Reihe von wichtigen Fragen zu beschäftigen.
«Planungssicherheit erhalten.»
Zunächst sollte das Einkommen nach der Pensionierung berechnet werden – bei regulärer sowie bei frühzeitiger Pensionierung, falls Sie dies in Betracht ziehen. Eine relevante Rolle spielt darüber hinaus die Steuerbelastung. Weitere Überlegungen betreffen die eigene Hypothek: Sollte sie amortisiert werden? Ist es möglich, das Wohneigentum im Alter weiter zu finanzieren? Und zu guter Letzt ist die Frage zu klären, ob das Altersguthaben der Pensionskasse als Rente oder als Kapital bezogen werden sollte. In einer individuellen Pensionsplanung werden solche Fragen analysiert und Lösungen aufgezeigt.

Patrick Zwygart Generalagent Generalagentur Thun
Weitere Informationen helvetia.ch/pensionsplanung
Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024 ASMZ 11
Abb. 4: Angedrohtes Mittel: Nuklearwaffen, hier RS-24 («Jars»/«Satan 2»). Bild: Wikimedia Commons
Der Versicherungstipp

Die Modernisierung der nuklearen Triade der USA geniesst oberste Priorität
Seit den frühen 1960er-Jahren bildet die nukleare Triade das Rückgrat der nuklearen Abschreckungsfähigkeiten der Vereinigten Staaten. Angesichts der weltweiten Sicherheitslage rücken nukleare Handlungsoptionen und die Modernisierung der Trägersysteme wieder stärker in den Fokus des Pentagons.
Thomas Bachmann
Wladimir Putin bekräftige am 13. März 2024 in einem im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview den Willen Russlands, im Falle einer Bedrohung der Existenz des russischen Staates jegliche Waffen einzusetzen, insbesondere auch Atomwaffen. Dabei hob er die einzigartigen nuklearen Fähigkeiten Russlands hervor, die er als «viel fortgeschrittener und moderner» als alle anderen bezeichnete. Diese Äusserungen reihten sich nahtlos in die vorhergegangene Rhetorik ein, denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scheinen zumindest in Russland atomare Drohgebärden wieder salonfähig geworden zu sein. Geradezu leichtfertig und verantwortungslos äusserten sich der Kremlchef respektive sein Sprachrohr und «Mann fürs Grobe», Dmitri Medwedew, dahingehend.
Solche Verlautbarungen stellen einen eigentlichen Bruch in der bisherigen Haltung dar, denn bis anhin wurde in Moskau wie auch in Washington – über 90 Prozent der weltweit vorhandenen Atomsprengköpfe befinden sich in deren Besitz – stets betont, dass ein Krieg zwischen Atommächten um jeden Preis vermieden werden müsse. Nun mischten sich aber in dieses Bekenntnis andere Töne, der Einsatz von Atomwaffen sei gerechtfertigt, sollte sein Land in der Ukraine in Bedrängnis geraten, so die unverhohlene Drohung Putins. Erstmals setzte Russland den Einsatz von Atomwaffen in Zusammenhang mit einem Angriffskrieg und senkte damit die einst so hohe Einsatzschwelle, indem der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine als Akt der Selbstverteidigung verklärt wurde.
Diese rhetorische Drohkulisse, unterfüttert durch gutgetimte Tests von Interkonti-
nentalraketen und Bereitschaftsübungen der strategischen wie taktischen Raketentruppen, verfehlte mindestens in Berlin ihre Wirkung nicht und schürte längst verloren geglaubte Ängste aus den Zeiten des Kalten Krieges; die «Atomsau» wurde sprichwörtlich durchs Dorf getrieben. Manch einer wähnte sich angesichts des nuklearen Säbelrasselns im falschen Film und unverhofft kursierten unlängst wieder Begriffe wie «Gleichgewicht des Schreckens», «Erstund Zweitschlagfähigkeit» oder «nukleares Armageddon». Mit der im Februar 2023 in Moskau erfolgten Ankündigung, den noch 2021 erneuerten New-Start-Vertrag auszusetzen, ein Abkommen, das den Vertragspartnern vorschreibt, die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe auf maximal 1550 und die Zahl der nuklearen Trägersysteme auf 800 zu reduzieren, wurde den eingangs zitierten Äusserungen Putins der Boden bereitet.
Eine teure Herausforderung
Im Herbst 2022 wurde in der Neuauflage der nationalen Verteidigungsstrategie prominent auch die Einzigartigkeit und Alternativlosigkeit der nuklearen Komponente
12 SICHERHEITSPOLITIK
Unverwüstlich und möglicherweise bis zu 100 Jahre im Einsatz stehend: B-52H-Bomber, der modernisiert in der Variante B-52J bis in die 2050erJahre fliegen soll. Bild: US Air Force
innerhalb der Verteidigungs- und Abschreckungsdoktrin der Vereinigten Staaten hervorgehoben. Die Nuclear Posture Review 2022 konstatierte dies wie folgt: «As long as nuclear weapons exist, the fundamental role of U.S. nuclear weapons is to deter nuclear attack on the United States, our allies, and partners. The U.S. would only consider the use of nuclear weapons in extreme circumstances to defend the vital interests of the United States or its allies and partners.» Um dieser fundamentalen Rolle, die den Atomwaffen zukommen, gerecht zu werden, müsse der Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals höchste Priorität eingeräumt werden, so das Grundsatzpapier weiter.
Das entsprechend teure, Hunderte von Milliarden verschlingende Modernisierungsprogramm wurde im August 2023 kommuniziert und umfasst beinahe zeitgleich sämtliche Pfeiler der nuklearen Triade: die Erneuerung der in die Jahre gekommenen «Minuteman III»-Interkontinentalraketen, der Ersatz der zwölf U-Boote der Ohio-Klasse, die Einführung des neuen Stealth-Langstreckenbombers B-21 sowie die Modernisierung des B-52-Bombers. Die rund 400 ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM: Intercontinental Ballisitic Missile) des Typs Minuteman III stammen aus den 1970er-Jahren und wurden – obwohl für die Nutzungsdauer von nur einem Jahrzehnt konzipiert – in den darauffolgenden Jahrzehnten kontinuierlich modernisiert.
Nun sind weitere Updates dieses silobasierten Waffensystems, das den reaktionsschnellsten Teil der nuklearen Abschreckungsfähigkeiten bildet, aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Die neuen Interkontinentalraketen LGM-35A «Sentinel» des Herstellers Northrop Grumman sollen ab 2029 in den ebenfalls 450 modernisierten und rundum erneuerten Startsilos, die sich auf dem Gebiet der Bundesstaaten North Dakota, Wyoming, Montana, Colorado und Nebraska befinden, die Nachfolge antreten. Das gesamte Rüstungsprogramm, das somit nicht nur die eigentlichen Trägersysteme betrifft, sondern die ganze dazugehörende Infrastruktur inklusive verbunkerter Kommandoanlagen,
unterirdischer Zufahrtswege und Verbindungsstrassen, ist aufgrund dieser Dimensionen eines der grössten Infrastrukturprogramme der Vereinigten Staaten seit den 1950er-Jahren. Daher überraschen die immensen Kosten nicht.
Verzögerungen gefährden die Abschreckungsfähigkeiten
Mittlerweile mehren sich im Kongress aber die kritischen Stimmen, denn der Ersatz der Minuteman III schlägt mit über 139 Milliarden US-Dollar zu Buche und hat das Poten-
zial, zum teuersten Waffenprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden. Deshalb wurde im Kongress auch schon laut über einen Abbruch der Übung nachgedacht, zumal die Standorte der Raketenabschussanlagen einem potenziellen Gegner bekannt und diese damit durch einen Erstschlag gefährdet seien. Verlangt wurde stattdessen der Ausbau der seegestützten Abschreckungskapazitäten, da diese nur schwer zu orten seien und so den unsichtbaren Teil der Triade stellen würden. Letztere werden momentan durch 14 U-Boote (SSBN: Ship Submersible Ballistic Nuclear)

Renaissance der atomaren Abschreckungslogik des Kalten Krieges: Start einer Minuteman-III-Rakete im Jahre 1971 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Bild: thehill.com

«ICBMs are responsive»: Darstellung einer der neuen Interkontinentalraketen LGM-35A «Sentinel», die ab den 2030er-Jahren das Rückgrat landgestützter Atomwaffen bilden sollen. Bild: nationalinterest.com
ASMZ 13 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
der atombetriebenen Ohio-Klasse sichergestellt, die gleichsam die überlebensfähigste Komponente der Triade darstellen. Die mit bis zu 24 Trident-II-D5-Raketen ausgestatteten U-Boote sollen in den frühen 2030er-Jahren im Verhältnis 1:1 durch UBoote der neuen Columbia-Klasse abgelöst werden, ein mit budgetierten 136 Milliarden US-Dollar ebenfalls höchst kostspieliges Unterfangen, das zudem durch Verzögerungen und Lieferkettenprobleme gekennzeichnet ist. So wird das erste U-Boot, die zukünftige USS District of Columbia, frühestens 2028 ausgeliefert werden können. Dabei handelt es sich gemäss der US-Navy um das wichtigste Rüstungsprogramm der Marine innerhalb einer ganzen Reihe von laufenden Programmen, wie Fregatten, Flugzeugträgern und Jagd-U-Booten. Dass dabei die Schiffsbaukapazitäten der verschiedenen Hersteller und Zulieferfirmen überfordert werden, liegt im Bereich des Möglichen. Diese Verzögerungen werden dazu führen, dass einige U-Boote der OhioKlasse länger in Dienst bleiben müssen als ursprünglich vorgesehen. Dies erfordert jedoch pro U-Boot eine 18-monatige Überholung, was die Einsatzfähigkeit der nuklearen Triade beeinträchtigen würde, da die USNuklear-Doktrin vorsieht, dass jederzeit zehn U-Boote auf Patrouillen- respektive Schleichfahrt sein müssen.
Eher auf Kurs zu sein scheint die Beschaffung des Nachfolgers des B-2A-StealthBombers «Spirit», der seit den späten 1990er-Jahren in der kleinen Stückzahl von 20 Exemplaren neben den unverwüstlichen B-52H-Bombern das dritte Standbein der nuklearen Triade stellt. Rund 100 neue strategische Bomber des Typs B-21 «Raider» sollen beschafft werden, ein Flugzeug der sechsten Generation, das letzten November seinen Erstflug unternahm. Rund 66 nuklearfähige Bomber stellen momentan den dritten Pfeiler der Triade und bieten den Kommandeuren im Pentagon die flexibelsten Handlungsoptionen. Diese sind somit der sichtbarste Teil der nuklearen Abschreckungskomponente. Deren Verlegung sendet jeweils klare Signale aus. Zusätzlich zur Einführung der B-21 werden die noch vorhandenen 75 B-52H «Stratofortress», die seit den 1960er-Jahren in Dienst stehen, für weitere drei bis vier Jahrzehnte flottgemacht respektive einer umfassenden Verjüngungskur unterzogen, die neben neuen Triebwerken auch ein neues Cockpit und Radarsysteme umfasst. Während die B-21

«SSBNs are survivable»: 14 U-Boote der Ohio-Klasse bilden die seegestützte Komponente der nuklearen Triade. Der Ersatz durch U-Boote der Columbia-Klasse ist angelaufen. Bild: twz
aufgrund ihrer Stealth-Merkmale dafür geschaffen ist, gegnerische Flugabwehrdispositive zu penetrieren, wird die «neue» B-52J zukünftig aus der Distanz wirken, bestückt mit Hyperschallwaffen und Marschflugkörpern, die sich auch nuklear bestücken lassen.
Von der nuklearen Bi- zur Tripolarität
Allen Unkenrufen zum Trotz halten die Planer im Pentagon an der bestehenden Triade fest, da sich deren Pfeiler gegenseitig ergänzen und nur so die erwünschte Abschreckungswirkung und damit verbundene Glaubwürdigkeit erzielt werden könne. Zudem bilden die weit verstreuten und gut geschützten ICBM-Silos schwer auszuschaltende Ziele. Hinzu kommt, dass Analysten mittlerweile davon ausgehen, dass bis Ende des Jahrzehnts China im Bereich der Anzahl ICBM mit den Vereinigten Staaten gleich- und bis Mitte der 2030erJahre womöglich zahlenmässig davonziehen werde. Daher überraschen Forderungen der Falken innerhalb des Pentagons und Kongresses wenig, den New-Start-Vertrag ebenfalls frühzeitig aufzukündigen und das eigene Atomwaffenarsenal auf die Zielgrösse von 3500 Sprengköpfen deutlich anzuheben.
Diese Mahner warnen gar vor einem «Missile Gap» ähnlich der 1950er-Jahre und fordern einen konsequenten Ausbau der nuklearen Arsenale. Dies sei nötig, da künftig sowohl den chinesischen wie auch russischen Fähigkeiten Paroli geboten werden müsse, erst recht, falls die beiden Staaten koordiniert gegen das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten vorgehen würden, so das Extremszenario, das hier nordkoreanische oder iranische Kapazitäten nicht mal
mitberücksichtigt. Diese Forderungen lassen aber ausser Acht, dass dadurch ein kostspieliges atomares Wettrüsten in Gang gesetzt werden würde, das per se nicht zur Steigerung der eigenen Sicherheit beitragen würde.
Die Anstrengungen Chinas intensivierten sich in den letzten Jahren deutlich und es werden dort grosse Summen in die Modernisierung der Triade gesteckt. Prioritär sind dies neue ICBM-Raketensilos, mobile Abschussvorrichtungen, strategische Raketen-U-Boote des Typs 094 sowie ein neuer Langstreckenbomber mit Stealth-Eigenschaften. Dass diese chinesische Aufrüstung bisher durch keinerlei Rüstungskontrollverträge beschränkt wurde und China auch keine Anstalten machte, solche zu unterzeichnen, macht die Position gewisser USExponenten verständlicher.
Russland forciert die Modernisierung des eigenen strategischen und taktischen Atomarsenals. Darunter fallen verschiedene Typen von silobasierten und mobilen Interkontinentalraketen, rund 60 strategische Bomber der Typen Tu-95M und Tu-160M und neue ballistische Raketen-U-Boote der BorejKlasse. Verstärkt wird die Einführung und Entwicklung nuklearfähiger taktischer Kurzund Mittelstreckenraketen wie auch Marschflugkörper und Hyperschallwaffen vorangetrieben. So hat beispielsweise der Iskander-Komplex, sowohl konventionell wie nuklear bestückbar, seine Zielgenauigkeit im Angriffskrieg gegen die Ukraine unter Beweis stellt – gegen militärische wie zivile Ziele. Mit dem Ausbau dieser Kapazitäten seit 2014 wurden etablierte Rüstungskontrollvereinbarungen unterlaufen und verletzt, namentlich der INF-Vertrag, eine eigentliche Erfolgsstory in der Geschichte der Abrüstungsverhandlungen des Kalten Krieges. In
14 SICHERHEITSPOLITIK

«Bombers are visible»: Bis zu 100 B-21 «Raider» werden neben den modernisierten B-52 den flexibelsten Teil der nuklearen Abschreckungskomponente bilden. Bild: twz

Das ballistische Kurzstreckensystem Iskander-M kann mit nuklearen wie konventionellen Sprengköpfen ausgerüstet werden. Drills mit diesen Waffensystemen wurden von Wladimir Putin im Mai angekündigt. Bild: twz
den 1980er-Jahren ausgehandelt, besiegelte dieser Abrüstungsvertrag die Abschaffung einer ganzen Kategorie nuklearer Raketen und sorgte in Europa noch vor dem Fall der Mauer für eine merkliche Entspannung. Die eingangs erläuterte Anspielung Wladimir Putins, wonach Russland über einzigartige Fähigkeiten verfüge, bezieht sich auf das angebliche Vorhandensein von weltraumgestützten Atomwaffen sowie Hyperschallwaffen. Noch können diese Behauptungen mit Vorsicht genossen werden, die Entwicklungssprünge der entsprechenden Waffentechnologie scheinen aber in diese Richtung hinzudeuten, sowohl in Russland wie auch in China.
Die nukleare Logik auf dem Prüfstand
Diese nukleare Tripolarität stellt die Vereinigten Staaten vor neue und zusätzliche Herausforderungen, die womöglich nach einer neuen nuklearen Doktrin verlangen, denn die nukleare Logik des Kalten Krieges muss angesichts der neuen Situation überdacht werden. Zu der veränderten Sicher-
heitslandschaft gesellen sich zudem moderne konventionelle und weitreichende Waffensysteme, militärische Operationen im Cyberraum und neue nukleare Akteure. Momentan zielt das US-Atomarsenal gemäss der eigenen Doktrin ausschliesslich auf die vermuteten gegnerischen Abschussbasen, Häfen und Flugplätze («counterforce-only doctrine»), dies vor dem Hintergedanken eines dadurch möglicherweise limitierten nuklearen Schlagabtauschs. Um die Abschreckungswirkung und strategische Ambiguität zu erhöhen, wird von den Hardlinern auch hier ein Umdenken gefordert: Zivile Ballungszentren sollten wieder ins Visier genommen werden («countervalue doctrine»). Eine solche Rhetorik erinnert stark an den Kalten Krieg der späten 1950er- und 1960er-Jahre. Für Stimmen, die eine Wiederaufnahme der Rüstungskontrollbegrenzungen fordern, auch unter Einschluss von China, fehlt in der aktuell angespannten Lage das Gehör.
NUKLEARE TRIADE
Aus der Sicht der Vereinigten Staaten bildet das Atomwaffenarsenal die Grundlage und das Fundament ihrer eigenen Verteidigung und Sicherheit, auch derjenigen ihrer Verbündeten. Es ist dieser Nuklearschirm − so die feste Überzeugung −, der seit sechs Jahrzehnten daneben auch Europa und somit die Schweiz schützt und gemäss vieler Militärs und Politiker in Washington nichts an seiner abschreckenden Wirkung einbüssen darf, gerade in angespannten Zeiten des nuklearen Säbelrasselns des Kremls. Die dort öffentlichkeitswirksam zelebrierte Zurschaustellung des Atomarsenals anlässlich der Militärparade am 9. Mai, gepaart mit Bereitschaftsübungen der taktischen Raketentruppen, zielte dabei psychologisch geschickt auf die Ängste der Menschen in Westeuropa ab. Es ist eben jene Wahrnehmung der Gegenseite, die durch die Aufrechterhaltung von glaubwürdigen eigenen Abschreckungsfähigkeiten beeinflusst wird. Der damalige stellvertretende Vorsitzende des Vereinigten US-Generalstabs, General Paul Selva, drückte dies 2018 treffend aus: «We believe the triad is foundational to deterrence. It is not about how we see the triad, it is how our potential adverseries view the triad.» Diese Aussage ist folglich ein Beleg dafür, dass Nuklearwaffen primär politische Waffen sind und militärisch nur einen beschränkten Wert haben.

Oberleutnant a D Thomas Bachmann M.Sc., M.A. thomas.bachmann@asmz.ch 8132 Hinteregg
Die nukleare Triade bezieht sich auf die drei primären Bestandteile der nuklearen Abschreckung eines Landes: stationäre oder mobile interkontinentale ballistische Raketen (ICBMs: Intercontinental Ballistic Missiles), U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBMs: Sea Launched Ballistic Missiles) und strategische Langstreckenbomber, die mit Marschflugkörpern oder Freifallbomben bestückt sind. Diese drei Elemente sollen sicherstellen, dass ein Land in der Lage ist, einen nuklearen Gegenschlag durchzuführen, falls es angegriffen wird, und damit potenzielle Angreifer abschrecken.
Die Idee hinter der Triade ist, dass sie unterschiedliche Startplattformen und Einsatzmöglichkeiten bietet, was die Überlebensfähigkeit und Wirksamkeit der nuklearen Abschreckung erhöht. Selbst wenn eine dieser nuklearen Komponenten ausfällt oder neutralisiert würde, könnten die beiden anderen Pfeiler die Glaubwürdigkeit der Abschreckung mittels eines Zweitschlages aufrechterhalten. Momentan verfügen einzig die USA, Russland und China über Trägersysteme, die den Anspruch der nuklearen Triade erfüllen können. Frankreich verfügt sowohl über luftals auch U-Boot-gestützte Nuklearwaffen, während sich Grossbritannien ganz auf die vier Unterseeboote der Vanguard-Klasse verlässt, die jeweils mit 16 Trident-Raketen aus US-amerikanischer Produktion bewaffnet sind.
ASMZ 15 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Bundesrat setzt weiter auf den Atomwaffensperrvertrag
2021 trat der im Rahmen der UNO verhandelte Kernwaffenverbotsvertrag in Kraft. Der Bundesrat will diesem weiterhin nicht beitreten. Er erachtet den Schweizer Einsatz für eine Welt ohne Kernwaffen im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags als zielführender.
Christian Brändli
1958 machte der Bundesrat eine Schweizer Atombombe zum Thema. Und die Schweizer Bevölkerung sprach sich darauf gegen ein Atomwaffenverbot aus. Dieses Zeiten sind längst vorbei, auch wenn erst 1988 mit der Auflösung des Arbeitsausschusses das Kernwaffenprogramm der Schweiz beendet wurde. 1995 stimmte die Schweiz der unbefristeten Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags (NPT) zu, dem sie 1977 beigetreten war. Dieser sieht ein vollständiges Verbot von Atomtests und ein effizientes Überprüfungssystem vor. 1996 erfolgte auch die Zusage zum umfassenden Atomteststoppabkommen.
Ende März nun beschloss der Bundesrat, auch in Zukunft alleine auf den Atomwaffensperrvertrag zu setzen. Zur Diskussion stand eine Neupositionierung zum 2021 in Kraft getretenen Kernwaffenverbotsvertrag (TPNW). Wie schon 2018 und 2019 kam die Landesregierung aber zum Schluss, dem TPNW nicht beizutreten.
Für eine atomwaffenfreie Welt
In seiner aktuellen aussenpolitischen Strategie spricht sich der Bundesrat unmissverständlich für eine nuklearwaffenfreie Welt aus. Der Einsatz von Kernwaffen wäre mit dem humanitären Völkerrecht «kaum vereinbar», findet er. Entsprechend äusserte sich die Schweiz auch im UNO-Sicherheitsrat und erklärte, dass ein Atomkrieg keine Gewinner kennen würde und darum auch niemals geführt werden dürfe. Wie der Bundesrat festhält, werde die Frage, wie das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt realisiert werden könne, auch hierzulande kontrovers diskutiert. Deshalb liess er seine früheren Entscheidungsgrundlagen zum TPNW durch eine interdepartementale Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem EDA, VBS, UVEK und dem WBF umfassend aktualisieren und nahm darauf basierend eine erneute Beurteilung vor.

In den Bericht flossen neu die sicherheitspolitischen Entwicklungen seit 2018, die Erkenntnisse aus der NPT-Überprüfungskonferenz sowie die Einschätzungen externer Experten mit ein. Mit dem Postulat Dittli (22.3800) forderte das Parlament auch einen spezifischen Bericht zu den aussenund sicherheitspolitischen Auswirkungen eines allfälligen TPNW-Beitritts, namentlich vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und dessen Folgen für die Sicherheitsarchitektur Europas.
Verschlechterte Sicherheitslage
In seiner Sitzung vom 27. März nahm der Bundesrat den Bericht der Arbeitsgruppe zur Kenntnis und verabschiedete den Bericht in Erfüllung des Postulats 22.3800. Auf der Grundlage dieser zwei Berichte kam die Landesregierung zum Schluss, «dass es derzeit keinen Bedarf für einen Richtungswechsel gibt». Der Bundesrat ist überzeugt, dass ein TPNW-Beitritt im gegenwärtigen internationalen Umfeld, in welchem mit einem neuen Krieg in Europa sicherheitspolitische Aspekte wieder in den Vordergrund gerückt sind, nicht im Interesse der Schweiz liegt.
In den Augen des Bundesrats ist die Wirkung des TPNW weiterhin «als gering» einzustufen, weil er von den Atomwaffenbesitzern, aber auch von fast allen westlichen und europäischen Ländern, nicht anerkannt werde. «Eine Welt ohne Kernwaffen kann aber nur mit und nicht gegen die Besitzerstaaten erreicht werden», betont der Bundesrat. Auch wenn die nukleare Abrüstung derzeit stocke und gar gegenläufige Tendenzen aufweise, werde die Schweiz weiterhin einfordern, dass die betroffenen Staaten ihren Abrüstungsverpflichtungen nachkommen.
Viele Länder bei Atomwaffensperrvertrag dabei
Im Rahmen der «Strategie Rüstungskontrolle und Abrüstung 2022–2025» setzt sich der Bundesrat für die Eindämmung der nuklearen Risiken und die Entwicklung von verifizierbaren künftigen Abrüstungsverträgen ein. «Der NPT ist der Eckpfeiler der nuklearen Rüstungskontrolle und der globalen Sicherheitsarchitektur. Die Schweiz setzt sich aktiv für die Stärkung dieser Architektur ein», unterstreicht der Bundesrat. So ist der Atomwaffensperrvertrag (NPT) von 191 Mitgliedsstaaten unterzeichnet worden, darunter auch die Kernwaffenstaaten USA, Russland, China, Frankreich und das Vereinigte Königreich.
Demgegenüber ist der 2021 in Kraft getretene Kernwaffenverbotsvertrag (TPNW) bis heute erst von 70 Staaten ratifiziert worden. Unter anderem sind ihm die Kernwaffenbesitzer und die mit ihnen verbündeten Staaten bisher nicht beigetreten. Der TPNW wurde 2017 in der UNO verhandelt. Er enthält ein umfassendes und ausdrückliches Verbot für Kernwaffen, verbietet also den Einsatz, die Androhung des Einsatzes, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb, den Besitz, die Stationierung, die Weitergabe sowie Tests von Kernwaffen und die Unterstützung dieser verbotenen Tätigkeiten.

Major a D Christian Brändli Chefredaktor ASMZ christian.braendli@asmz.ch 8607 Seegräben
16 SICHERHEITSPOLITIK
Als Waffenträger für die Schweizer Atombomben wurde 1960 die Mirage III Dassault auserkoren. Die letzten Exemplare dieses Jets wurden 2003 ausgemustert. Bild: Peter Lewis, VBS
Länder ohne Atomwaffen könnten Kriegsschauplätze werden
Zwei mächtige Gruppen konkurrieren in Ostasien: hier die USA mit ihren Alliierten, dort Russland, China und Nordkorea. Die USA stationieren eine Spezialeinheit auf Taiwan und verstärken ihr Bündnis mit Japan. China und Nordkorea bauen ihre Nukleararsenale aus.
Seit Ende des letzten Jahres kursiert das Gerücht, dass Japans Premierminister Kishida im Frühling 2024 Nordkorea besuchen werde (Stand Anfang April). Nordkorea hat in den letzten Jahren viele Personen entführt. Bestätigt sind zwölf, die Dunkelziffer könnte aber bei über 800 liegen. Nun sollen möglicherweise gerade einmal zwei Personen freigegeben werden und zudem würde Nordkorea mit Japan diplomatische Beziehungen aufnehmen. Als Gegenleistung erhielte Nordkorea von Japan rund 50 Milliarden US-Dollar als Wirtschaftshilfe. Gemäss dem Gerücht sei eine Person ein ehemals in Japan wohnender Nordkoreaner und die andere ein ehemaliges Waisenkind. Nordkorea legte das Angebot schon vor längerer Zeit vor, aber die vorherigen Regierungen Japans lehnten es ab, weil sie sämtliche entführten Japaner zurückwollten und erst nach der Lösung dieses Kernpunktes gewillt waren, diplomatische Beziehungen zu knüpfen. Kishidas unvernünftige Entscheidung, falls sie realisiert wird, erfolgt wahrscheinlich auf Druck der Biden-Regierung, die vor der Präsidentschaftswahl im November einen aussenpolitischen Erfolg vorzeigen will. Kishida seinerseits erwartet damit wohl auch eine Verbesserung seiner Popularität. Die Zustimmungsrate lag Anfang April unter 20 Prozent.
Nordkorea und China rüsten nuklear auf
Nordkorea feuerte im Jahr 2022 70 Kurzstreckenraketen ab, was die höchste je erreichte Zahl darstellt. Machthaber Kim Jong-un äusserte Ende 2022, dass sein Land 2023 auf eine massive Produktionszunahme der taktischen Nuklearwaffen abziele. Er nahm die Strukturveränderung in der Weltpolitik wahr und bekräftigte die Wichtigkeit der Stärkung des Militärs, um gegen die Allianz der USA, Südkoreas und Japans zu bestehen.
Auch China beschleunigte seine nukleare Aufrüstung und produzierte 2022 vermutlich 60 Atomsprengköpfe. Damit würde es nun insgesamt über rund 410 Atomsprengköpfe verfügen. Es wird erwartet, dass der Ausbau weitergeht und die Zahl bis 2030 auf schätzungsweise über 1000 ansteigt. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges nützt China die Situation aus, um die flaue Wirtschaft mittels einträglicher Beziehungen zu Russland anzukurbeln. Es besteht eine Koexistenz zwischen Russland und China. Nordkorea profitiert auch von der situationsbedingten geopolitischen Lage. Der dritthöchste Politiker Chinas besuchte Anfang April Nordkorea. Er und sein nordkoreanischer Kollege kündigten die Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern an.
Realität oder Illusion der nuklearen Abschreckung
Der renommierte russische Wissenschaftler Sergej Karaganov befand, dass westliche Politiker dank des relativen Friedens während der vergangenen 75 Jahre die Schrecken des Krieges vergessen und sogar die Angst vor Atomwaffen verloren hätten. Angesichts der Gefahr eines dritten Weltkrieges liessen die westlichen Politiker die Lage unverantwortlich eskalieren.
Die Verlässlichkeit des US-Atomschildes wird ausserdem bestritten. Die Gefahr einer nuklearen Eskalation müsse deswegen wieder wahrgenommen werden. In seinem im Juni 2023 veröffentlichten Bericht erläuterte Karaganov die Wichtigkeit eines Atomwaffeneinsatzes als Notwendigkeit trotz schwieriger Entscheidungsfindung, um die weitere Eskalation der Lage (nämlich den dritten Weltkrieg) zu vermeiden. Es ist möglich, dass sein Bericht reine Propaganda darstellt. Es gibt aber trotzdem definitiv keinen Grund zur Zurückweisung seiner These.
Strategiewechsel Chinas?
In Taiwan ist eine Spezialeinheit der US-Armee stationiert, um das taiwanesische Militär zu trainieren. Der Personalbestand der Einheit stieg gemäss einem Bericht von rund 30 im Jahr 2022 auf 100 Mann im Jahr 2023.
Der chinesische Präsident Xi Jinping beendet seine aktuelle Amtszeit 2027. Um sich eine weitere Amtszeit zu sichern, wolle er, gerüchteweise, vor dem Beginn der neuen Amtszeit (März 2028) Taiwan erobern. Ob China bis 2027 bereit ist, gegen die USA zu kämpfen, hängt auch davon ab, wie die USA die Macht ihrer Streitkräfte einsetzen und ihre wirtschaftlichen Einflüsse auf die Welt ausüben. China als Nuklearmacht ist noch
Neun Länder haben nukleare Sprengköpfe in ihrem Waffenarsenal.
ASMZ 17 06/2024 SICHERHEITSPOLITIK
Kumiko Ahr
Land Operative Nuklearsprengköpfe Total (Januar 2023) Total (Januar 2022) USA 3708 5244 5428 Russland 4489 5889 5977 UK 225 225 225 Frankreich 290 290 290 China 410 410 350 Indien 164 164 160 Pakistan 170 170 165 Israel 90 90 90 Nordkorea 30 30 20
Bild:
Hiroshima for Global Peace, bearbeitet von der Autorin

weit entfernt von den USA und Russland und baut deswegen sein Atomwaffenarsenal aus. Im Unterschied zu den USA und Russland deklariert China den «Verzicht auf den Ersteinsatz» von Atomwaffen und ruft andere Nuklearmächte zur Übernahme dieser Politik auf. Sobald das Land Russland und die USA einholt, könnte es diese Politik revidieren. China baute diskret die Zahl der Nuklearraketen mit kürzerer und mittlerer Reichweite aus, während die USA und Russland wegen des INF-Vertrags (Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag, 2019 aufgelöst) ihre entsprechenden Arsenale (boden-/landgestützt) vernichteten.
China steht folglich gegenwärtig mit dieser Raketenklasse vor den USA und macht auch seine Intention sichtbar, eine Nuklearmacht analog den USA und Russland zu werden. Der Versuch Chinas zur Eroberung von Taiwan mit militärischer Gewalt vor der Erreichung dieser Kompetenzfähigkeit ist anscheinend ohne äusserst ungewöhnlichen Grund unvernünftig.
Der Kalte Krieg in Ostasien
Südkoreas Verteidigungsbudget nimmt im Jahr 2024 zu und dürfte 4,2 Prozent höher als im letzten Jahr liegen. Es will so der Bedrohung Nordkoreas effizienter begegnen. Die regierende Partei Südkoreas verlor bei der Parlamentswahl im April massiv, trotzdem bleibe die Aussen- und Sicherheitspolitik angeblich unverändert. Südkorea, aber auch Japan verstärken ihre Bündnisse mit den USA, während China und Russland
mit Nordkorea strategische Beziehungen pflegen. Die Lage ist ein Spiegelbild des Kalten Krieges.
Beim Treffen des russischen und chinesischen Aussenministers in Peking warnten Russland und China die NATO vor einer Expansion in die Asien-Pazifik-Region. Da die NATO im letzten Sommer Japan, Australien, Südkorea und Neuseeland zum NATO-Gipfel eingeladen hatte, sind sie auch dieses Jahr wieder eingeladen.
Nach dem Beginn des Krieges in Gaza greifen Jemens Huthis seit Mitte November 2023 die das Rote Meer passierenden Schiffe an, um Israels Angriffen in Gaza Einhalt zu gebieten. Die Huthi-Rebellen verkündeten aber, dass sie nicht auf chinesische und russische Schiffe zielen würden. Der Schiffsverkehr wird anstatt durch den Suez-Kanal nun um das Kap der Guten Hoffnung an Afrikas Südspitze zum Umweg gezwungen, was die Frachtkosten um ungefähr das Dreifache ansteigen liess im Vergleich zu vor dem Krieg. Als Folge davon leiden die Lieferketten und die Wirtschaft in Europa und Asien. Der nördliche Seeweg entlang Russlands Küste wäre vor allem zwischen Europa und Ostasien optimal.
In einer gemeinsamen Erklärung beim Gipfeltreffen von Biden und Kishida im April 2024 wurde die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den in Japan stationierten US-Streitkräften und den Streitkräften Japans erwähnt. Die militärischen Einrichtungen Japans werden dem Bericht zufolge den US-Streitkräften in Japan ohne bürokratische Prozesse zur Verfügung ge-
An der Militärparade zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China wurde auch die Dongfeng-41Nuklearrakete gezeigt.
Bild: China Military
stellt, und die Streitkräfte Japans könnten im Ernstfall unter Umständen dem US Indo-Pacific Command unterstellt werden. Japan setzt seine Souveränität ohne Wissen des Volkes aufs Spiel.
Im Gegensatz zu China und Nordkorea leiden Taiwan, Südkorea und Japan unter teuer gewordener Energie, was als Industrie- und Exportländer direkt den Wohlstand des Landes beeinflusst. Selbst wenn die Containment-Politik (Eindämmung) der USA und ihrer Alliierten gegen China und Nordkorea Erfolg hätte, werden die Energieprobleme in der Region kaum gelöst.
Die USA vermeiden einen direkten Krieg gegen China oder Russland. Somit rücken Länder ohne Atomwaffen als potenzielle Kriegsschauplätze in den Vordergrund. Solange Nordkorea die USA atomar nicht beträchtlich bedrohen kann, kann auch Nordkorea nicht als Kriegsschauplatz ausgeschlossen werden. Taiwan und Nordkorea werden öfters als Hotspots in Ostasien erwähnt. Aber es besteht auch ein Konfliktpotenzial zwischen China und Japan. Premierminister Kishida bekundete wiederholt, dass die heutige Ukraine das morgige Ostasien sein könnte. Je nachdem wie man seinen Satz versteht, könnte er damit Japan meinen.

Kumiko Ahr-Okutomo Dr. phil. Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Strategische Studien 8041 Zürich
18
SICHERHEITSPOLITIK
Das militärische Genie
Krieg ist das Gebiet des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten. Und dennoch gibt es entscheidende Erfolgsfaktoren. Carl von Clausewitz hat fünf herausragende Eigenschaften herausgefiltert, welche das militärische Genie ausmachen.
Matthias Kuster
Krieg ist die wohl komplexeste menschliche Tätigkeit überhaupt, da der Erfolg im Krieg von einer Vielzahl von sich stets verändernden Faktoren abhängt, die sich gegenseitig in unberechenbarer Weise beeinflussen. Krieg ist also das Gebiet des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten.1 Der berühmt-berüchtigte Nebel des Krieges hat sich bis heute trotz KI, Cyber, Aufklärungsmittel und sozialen Medien nicht gelichtet, wie der aktuelle Ukraine-Krieg deutlich belegt. Das heutige Umfeld, in dem Kriege stattfinden, wird als VUCA-Welt bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein englisches Akronym, bestehend aus den Begriffen volatility (Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Diese Merkmale verhindern eine mathematische Berechnung der Dauer und des Ausgangs eines Krieges (auch wenn es immer wieder versucht wird!). Zu dieser Ungewissheit gesellen sich die Friktion im Krieg, verstanden als erschwerende Umstände, sowie die vielfältigen Gefahren für Leib und Leben der Soldaten.
Wegen der hierarchisch geprägten Führungskultur in den Armeen spielen die Fähigkeiten des militärischen Chefs für den Erfolg oder Misserfolg eine entscheidende Rolle. Die Kernaufgabe eines jeden militärischen Chefs besteht darin, den Einsatz der ihm unterstellten Mittel und Verbände im Kampf derart geschickt zu koordinieren, dass er damit ein Maximum an Wirkung auf den Gegner erzielt. Vereinfacht ausgedrückt muss er befähigt sein, die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum Einsatz zu bringen.
Die Kriegstheorie wie die Kriegsgeschichte setzten sich denn auch immer wieder mit den Anforderungen an den militärischen Chef auseinander. Carl von Clausewitz (1780–1831), der herausragende Militärtheoretiker aus Preussen, analysierte diese Anforderungen in seinem epochalen Werk

«Vom Kriege» umfassend. Napoleon Bonaparte (1769–1821), eines der wenigen militärischen Genies der Kriegsgeschichte, diente Carl von Clausewitz als hervorragendes Studienobjekt (Clausewitz bezeichnete ihn gar als Kriegsgott).
Basierend auf seinen Ausführungen in «Vom Kriege» lassen sich fünf herausragende Eigenschaften herausfiltern, welche das militärische Genie ausmachen. Diese fünf Eigenschaften seien kurz dargestellt und erläutert. Jedem Kapitel werden dabei Zitate aus «Vom Kriege» vorangestellt.
Kühnheit
So glauben wir denn, dass ohne Kühnheit kein ausgezeichneter Feldherr zu denken ist, d. h. dass ein solcher nie aus einem Menschen werden kann, dem diese Kraft des Gemütes nicht angeboren ist, die wir also als die erste Bedingung einer solchen Laufbahn ansehen. […]2 Sooft die Kühnheit auf die Zaghaftigkeit trifft, hat sie notwendig die Wahrscheinlich-
keit des Erfolges für sich, weil Zaghaftigkeit schon ein verlorenes Gleichgewicht ist.3 Um im Krieg bestehen und die darin vorherrschenden Gefahren bewältigen zu können, ist die Kühnheit die wichtigste Eigenschaft; Clausewitz nennt sie die «erste Bedingung» des militärischen Führers. Kühnheit setzt sich zusammen aus dem Mut, verstanden als Kraft des Gemüts, und dem Verstand, verstanden als Kraft des Geistes. Massgebend ist dabei die richtige Mischung. Überwiegt der Mut, nimmt Leichtsinn überhand, überwiegt dagegen der Verstand, sind Zaghaftigkeit und Passivität die Folge. Clausewitz widmet dieser Eigenschaft ein ganzes Kapitel in seinem Werk «Vom Kriege».
In langen Friedensperioden verkümmert die Kühnheit der militärischen Chefs, da mutiges Handeln weder von der Politik noch von der Gesellschaft gefragt ist. Dies gilt heute mit Blick auf den Einfluss der Medien in besonderem Masse. Kriegertypen sind schlicht nicht gefragt, was insbesondere auch für die Verhältnisse in der Schweiz gilt; Kühnheit ist jedenfalls keine typisch schweizerische Eigenschaft. Entsprechend wird sie in der Armee weder gefördert noch geschult.
Clausewitz weist als profunder Kenner der militärischen Seele auf einen Umstand hin, der bis heute unverändert gültig ist: Je höher wir in den Führerstellen hinaufsteigen, um so mehr wird Geist, Verstand und Einsicht in der Tätigkeit vorherrschend, um so mehr wird also die Kühnheit, welche eine Eigenschaft des Gemütes ist, zurückgedrängt, und darum finden wir sie in den höchsten Stellen so selten, aber um so bewunderungswürdiger ist sie auch dann. Eine durch vorherrschenden Geist geleitete Kühnheit ist der Stempel des Helden, diese Kühnheit besteht nicht im Wagen gegen die Natur der Dinge, in einer plumpen Verletzung des Wahrscheinlichkeitsgesetzes, sondern in der kräftigen Unterstützung jenes höheren Kalküls, den das Genie, der Takt des Urteils in Blitzesschnelle und nur halb bewusst durchlaufen hat, wenn er seine Wahl trifft.4
Weiter schreibt Clausewitz: Fast alle Generale, die uns die Geschichte als mittelmäßige oder gar unentschlossene Feldherren kennenlernt, hatten sich in geringeren Graden durch Kühnheit und Entschlossenheit ausgezeichnet 5
ASMZ 19 06/2024
SICHERHEITSPOLITIK
Carl von Clausewitz nach einem Gemälde von Karl Wilhelm Wach (um 1818). Bild: Wikimedia
Intelligenz
Es hat nie einen ausgezeichneten Feldherrn beschränkten Geistes gegeben, und sehr zahlreich sind die Fälle, wo Männer, die in geringeren Stellen mit der höchsten Auszeichnung gedient hatten, in der höchsten unter dem Mittelmäßigen blieben, weil die Fähigkeiten ihres Geistes nicht zureichten.6
Dass das Abwägen dieser mannigfachen und mannigfach durcheinandergreifenden Gegenstände eine große Aufgabe, dass es ein wahrer Lichtblick des Genies ist, hierin schnell das Rechte herauszufinden, während es ganz unmöglich sein würde, durch eine bloße schulgerechte Überlegung der Mannigfaltigkeit Herr zu werden, ist leicht zu begreifen.7
Menschliche Intelligenz besteht vereinfacht ausgedrückt in der geistigen Leistungsfähigkeit, Informationen rasch erfassen, verarbeiten und die entsprechenden Schlüsse zur Problemlösung ziehen zu können. Sie besteht somit im Wesentlichen in der hohen Analysefähigkeit. Richtigerweise weist Clausewitz darauf hin, dass es keinen ausgezeichneten Feldherrn von beschränktem Geist, spricht mit geringer Intelligenz, gegeben hat. Somit ist bei der Auswahl der Kader stets auch die geistige Leistungsfähigkeit, etwa mittels Intelligenztests, zu prüfen und zu berücksichtigen.
Da Intelligenz angeboren ist und praktisch nicht gefördert werden kann, ist sie Wesensmerkmal des Feldherrentalents. An der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin, welche Carl von Clausewitz besuchte, wurde zur Schulung der geistigen Leistungsfähigkeit Logik, verstanden als die Lehre des folgerichtigen Denkens, unterrichtet. Im Zentrum steht dabei der Syllogismus, verstanden als Lehre der logischen Schlussfolgerung, wie ihn der antike Philosoph Aristoteles (384–322 v. Chr.) entwickelt hat. Der Syllogismus besteht aus den drei Elementen Obersatz, Untersatz und Schlussfolgerung. Dies sei an einem Beispiel veranschaulicht: Alle Menschen sind sterblich (Obersatz oder Grundsatz), Petrus ist ein Mensch (Untersatz), also ist Petrus sterblich (Schlussfolgerung).
Die Schweizer Armee kennt mit dem Schema A-E-K (Aussage, Erkenntnis, Konsequenz) ein Analyseschema, welches die rationale Entscheidfindung insbesondere bei der Analyse der Faktoren der Lagebeurteilung (Auftrag, Umwelt, gegnerische Mittel, eigene Mittel, Zeitverhältnisse) sowie der Faktoren Raum, Kraft, Zeit und Information
erleichtern soll. Dieser Prozess dürfte mit Hilfe der künstlichen Intelligenz in Zukunft stark verbessert und beschleunigt werden.
Initiative und Entschlossenheit
Soll er nun diesen beständigen Streit mit dem Unerwarteten glücklich bestehen, so sind ihm zwei Eigenschaften unentbehrlich: einmal ein Verstand, der auch in dieser gesteigerten Dunkelheit nicht ohne einige Spuren des inneren Lichts ist, die ihn zur Wahrheit führen, und dann Mut, diesem schwachen Lichte zu folgen. Der erstere ist bildlich mit dem französischen Ausdruck coup d’oeil bezeichnet worden, der andere ist die Entschlossenheit.8
Wir müssen nämlich nicht vergessen, daß der überlegende Verstand nicht die einzige intellektuelle Kraft des Feldherrn ist. Mut, Kraft, Entschlossenheit, Besonnenheit usw. sind die Eigenschaften, die wieder da mehr gelten werden, wo es auf eine einzige große Entscheidung ankommt […].9
Was die persönliche Eigentümlichkeit der Generale betrifft, so geht hier alles in das Individuelle über, aber die eine allgemeine Bemerkung dürfen wir nicht übergehen, daß man nicht, wie wohl zu geschehen pflegt, die vorsichtigsten und behutsamsten an die Spitze der untergeordneten Armeen stellen soll, sondern die unternehmendsten, denn wir kommen darauf zurück: es ist bei der getrennten strategischen Wirksamkeit nichts so wichtig, als daß jeder Teil tüchtig arbeite, die volle Wirksamkeit seiner Kräfte äußere, wobei denn die Fehler, welche auf einem Punkte begangen sein können, durch die Geschicklichkeit auf anderen ausgeglichen werden. Nun ist man aber dieser vollen Tätigkeit aller Teile nur gewiß, wenn die Führer rasche, unternehmende Leute sind, die der innere Trieb, das eigene Herz vorwärtstreibt, weil eine bloße objektive, kalte Überlegung von der Notwendigkeit des Handelns selten ausreicht.10
Ohne Kühnheit und Unternehmungsgeist des Feldherrn wird der glänzendste Sieg keinen großen Erfolg geben, und noch viel schneller erschöpft sich diese Kraft an den Verhältnissen, wenn diese sich ihr groß und stark entgegenstellen.11
Ein Blick in die Kriegsgeschichte zeigt, dass heraussagende militärische Führer ein Übermass an Tatkraft und Entschlossenheit aufwiesen. Erinnert sei an den Zug von Hannibal über die Alpen, an den Feldzug Alexanders des Grossen bis nach Indien, an die Niederwerfung Galliens durch Caesar, an
die überragenden Erfolge von Gustav Adolf im Dreissigjährigen Krieg, an die glänzenden Siege Napoleons in Oberitalien oder etwa an den Vorstoss von Rommel in Afrika.
Kreativität
[…] wir finden es unbeschreiblich lächerlich, das Umgehen einer Stellung der Erfindung wegen wie einen Zug großer Genialität zu betrachten, wie so oft vorgekommen ist, aber nichtsdestoweniger ist dieser Akt schöpferischer Selbsttätigkeit notwendig, und der Wert kritischer Betrachtung wird durch ihn wesentlich mitbestimmt.12
Hinweise auf die Kreativität, von Clausewitz als schöpferische Selbsttätigkeit bezeichnet, sind in «Vom Kriege» nur sehr spärlich zu finden. Clausewitz weist darauf hin, dass aus der Mannigfaltigkeit der geistigen Individualität auch die Mannigfaltigkeit der Wege, die zum Ziel führen, entspringen.13 Gemäss Reglement Operative Führung 17 (OF 17) der Schweizer Armee zielt operatives Denken darauf ab, die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen Kraft, Raum, Zeit und Informationen sowohl systematisch als auch kreativ und intuitiv zu erfassen.14 Die OF 17 weist damit explizit auf den Wert der Kreativität hin.
Kreativität bedeutet insbesondere, Grenzen des Denkens zu sprengen, das heisst, sich über bestehende Regeln und Prozesse hinwegzusetzen und Neues zu versuchen. Clausewitz schreibt dazu: Wehe dem Krieger, der zwischen diesem Betteltum von Regeln herumkriechen sollte, die für das Genie zu schlecht sind, über die es sich vornehm hinwegsetzen, über die es sich auch allenfalls lustig machen kann! Was das Genie tut, muss gerade die schönste Regel sein, und die Theorie kann nichts Besseres tun, als zu zeigen, wie und warum es so ist.15
Nach Albert Einstein (1879–1955) ist Fantasie wichtiger als Wissen, denn Wissen sei begrenzt. Die Kriegsgeschichte belegt die herausragende Bedeutung der Kreativität für den Erfolg im Krieg. So trug die Entwicklung der Software GIS Arta, welche ukrainische Softwarespezialisten entwickelt haben und seit 2014 einsetzen, massgeblich zum Abwehrerfolg der Ukrainer gegen die Russen bei, da damit die Zeit zwischen der Zielerfassung und Zielbekämpfung durch die eigene Artillerie massiv verkürzt werden konnte. Ein äusserst bemerkenswertes Beispiel für Kreativität lieferte Sultan Mehmed II. (1432–1481) während der Belagerung von
20
SICHERHEITSPOLITIK

«Mehmed II. besichtigt den Transport der Schiffe über Land in das Goldene Horn» von Fausto Zonaro, gemalt im Jahr 1908. Bild: Wikimedia
Konstantinopel im Jahr 1453 durch die Osmanen. Dieser griff zu einem genialen und äusserst unkonventionellen Schachzug: Über eine Landzunge liess er seine Schiffe ins Goldene Horn schleppen, eine natürliche Bucht, die Konstantinopel vor Angriffen schützte. Damit gelang es ihm, die Seeblockade und die Flotte der Verteidiger zu umgehen, welche die Bucht vor Eindringlingen schützten. Dieses kühne Vorgehen ermöglichte es den Osmanen, die Kontrolle über das Goldene Horn zu erlangen und die Flotte der Verteidiger zu neutralisieren.
Kenntnis der Kriegsgeschichte und der Kriegstheorie
Die Kriegsgeschichte ist mit allen ihren Erscheinungen für die Kritik selbst eine Quelle der Belehrung, und es ist ja natürlich, daß sie die Dinge mit eben dem Lichte beleuchte, was ihr aus der Betrachtung des Ganzen geworden ist.16
Historische Beispiele machen alles klar und haben nebenher in Erfahrungswissenschaften die beste Beweiskraft. Mehr als irgendwo ist dies in der Kriegskunst der Fall.17 Kriegsführung ist eine Erfahrungswissenschaft, keine Mathematik. Sie ist den menschlichen Schwächen, Emotionen, der Fehleinschätzung, beschränktem Geist, Unvermögen und Ignoranz unterworfen. Erfolgreiche Kriegsführung basiert wesentlich auf Erfahrung. Fehlt diese, kann sie zumindest teilweise durch das Studium der Kriegsgeschichte kompensiert werden. Wesenszug der meisten herausragenden Feldherren ist
denn auch deren intensive Auseinandersetzung mit der Kriegsgeschichte. So empfahl Napoleon Bonaparte kurz vor seinem Tod im Mai 1821 seinem Sohn in einer schriftlichen Aufzeichnung Folgendes: Que mon fils lise et médite souvent l’histoire; c’est la seule véritable philosophie. Qu’il lise et médite les guerres des grands capitaines; c’est le seul moyen d’apprendre la guerre.18
General Georg S. Patton (1885–1945) empfahl seinem Sohn George, damals Kadett in West Point, in einem Schreiben vom 6. Juni 1944 mit folgenden Worten exakt das Gleiche wie Napoleon: To be a successful soldier you must know history. Read it objectively – dates and even the minute details of tactics are useless, what you must know is how man reacts. Weapons change but man who uses them changes not at all. To win battles you do not beat weapons – you beat the soul of man of the enemy man. To do that you have to destroy his weapons, but that is only incidental. You must read biography and especially autobiography.19
Kriege ändern ihre Natur immer wieder, bedingt vor allem durch die technologische Entwicklung. Daher sollte das Schwergewicht des Studiums auf die aktuelle Kriegsgeschichte gelegt werden. Nach wie vor lesenswert sind die Biografien herausragender Feldherren. Zu nennen sind (nicht abschliessend): Alexander der Grosse (356–323 v. Chr.), Hannibal Barca (247–183 v. Chr.), Publius Cornelius Scipio Africanus (235–183 v. Chr.), Gaius Iulius Caesar (100–44 v. Chr.). Gustav II. Adolf (1594–1632), Friedrich II. der Grosse (1712–1786), Napoleon Bonaparte
(1769–1821) sowie Erich von Manstein (1887–1973).
Nebst dem Studium der Kriegsgeschichte ist auch das Studium der herausragenden Klassiker der Kriegskunst wie Sun Tzu (544–496 v. Chr.), Carl von Clausewitz (1780–1831) sowie Antoine-Henri Jomini (1779–1869) von zentraler Bedeutung. Diese Klassiker haben die zeitlos gültigen Prinzipien der Kriegskunst in einzigartiger Weise aus der Kriegsgeschichte herausgefiltert.
Schlussbemerkung
Genie allein garantiert den militärischen Erfolg zwar nicht, ohne Genie ist er aber ungleich schwieriger zu erlangen. Abschliessend sei allerdings an die Warnung von Jonathan Swift (1667–1745), anglo-irischer Erzähler, Moralkritiker und Theologe, erinnert, der schreibt: Taucht ein Genie auf, verbrüdern sich die Dummköpfe.
1 Vom Kriege, I/1, Ziff. 28.
2 Vom Kriege, III/6.
3 Vom Kriege, III/6.
4 Vom Kriege, III/6.
5 Vom Kriege, III/6.
6 Vom Kriege, II/2.
7 Vom Kriege, VIII/3B.
8 Vom Kriege, I/3.
9 Vom Kriege, VI/30.
10 Vom Kriege, VIII/8.
11 Vom Kriege, IV/10.
12 Vom Kriege, II/5.
13 Vom Kriege, II/2.
14 Ziff. 87.
15 Vom Kriege, II/2.
16 Vom Kriege, II/5.
17 Vom Kriege, II/6.
18 Übersetzung des Autors: Mein Sohn soll die Geschichte studieren und darüber nachdenken; das ist die einzige wahre Philosophie. Er soll die Kriege der grossen Feldherren studieren und darüber nachdenken; das ist der einzige Weg, um den Krieg zu erlernen. Quelle: Correspondance de Napoleon Ier, Henri Plon, J. Dumaine, 1870, S. 379 in Correspondance de Napoléon Ier. Tome 32 / publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III.
19 Übersetzung des Autors: Um ein erfolgreicher Soldat zu sein, musst du die Geschichte kennen. Lies sie objektiv – Daten und sogar die winzigen Details der Taktik sind nutzlos, was du wissen musst, ist, wie der Mensch reagiert. Waffen ändern sich, aber der Mensch, der sie benutzt, ändert sich überhaupt nicht. Um Schlachten zu gewinnen, besiegt man nicht die Waffen – man besiegt die Seele des feindlichen Menschen. Um dies zu tun, muss man seine Waffen zerstören, aber das ist nur nebensächlich. Lies Biografien und vor allem Autobiografien. Quelle: Selected quotations: U.S. Military Leaders, Office of the Chief of Military History Department of the Army, Washington, D.D. 20315, 1964, S. 67.
lic. iur./LL. M. Matthias Kuster
Selbständiger Rechtsanwalt in Zürich, Oberst i Gst, Stab Op S
Mitglied IISS sowie der Clausewitz-Gesellschaft
Sektion Schweiz
ASMZ 21 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Projektbericht VBS 2023: Probleme akzentuieren sich
Ende März publizierte das VBS seinen neuen Bericht über den aktuellen Stand der wichtigsten Top-Projekte. Grösste Herausforderung sind die zunehmenden zeitlichen Verzögerungen. Zahlreiche Beschaffungsvorhaben befinden sich auf Kurs; aber die Beurteilung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr.
Müller
Seit 2017 veröffentlicht das VBS jährlich einen sogenannten Projektbericht. Er beinhaltet eine enge Auswahl aus den mehrere hundert gleichzeitig geführten Projekten. Diese sind für die Politik, die Departementsleitung und die Öffentlichkeit von unterschiedlicher Relevanz. Am 25. März erschien der neuste Bericht mit insgesamt 23 TopProjekten (eines weniger als im Vorjahr). Er ist zum zweiten Mal im Webformat gehalten und gibt Auskunft über den Stand der Arbeiten per Ende 2023 sowie die aktuellen Herausforderungen.
Fehlende Gesamtsicht
Anfänglich erschien der Projektbericht VBS in gedruckter Form. Und er enthielt eine gesamthafte Würdigung der ausgewählten Top-Projekte. Auf beides wurde mit der Umstellung auf das Webformat verzichtet. Im Fokus stehen nur noch die einzelnen Projekte. Es kommt denn auch nicht von ungefähr, dass für das Jahr 2023 kaum mehr von «Projektbericht» gesprochen wird, sondern durchs Band von «Top-Projekten» des VBS. So muss man sich, soll ein aussagekräftiges Gesamtbild entstehen, mittels unzähliger Klicks durch die einzelnen Projekte durcharbeiten und selbst ein Fazit zu ziehen versuchen.
Diese fehlende Gesamtsicht ist auch deshalb bedauerlich, weil heute viele Projekte voneinander abhängig sind. Man denke beispielsweise an die Programme Air2030 und FITANIA. Die Links zwischen den einzelnen Projekten dieser Programme sind zwar im Bericht 2023 durchaus zu finden. Aber auch so fehlen Gesamtwertungen. Immerhin scheint die Lücke erkannt zu sein: Gemäss eigenen Aussagen plant das VBS, ab 2025 «dem Aspekt der Abhängigkeiten unter den Projekten stärker Rechnung zu tragen und das Qualitäts- und Risikomanagement zu stärken».
Hauptproblem ist der Faktor Zeit
Verschiedene Top-Projekte kämpften schon in der Vergangenheit mit Terminproblemen. So musste deren ursprünglich geplante Projektdauer schrittweise hinausgeschoben werden. Man könnte jetzt wieder wie bei den Armeefinanzen eine Synonym-Diskussion starten, um das Problem zu beschönigen oder kleinzureden. Tatsache ist: Immer mehr Top-Projekte haben Verspätung: Sechs oder sieben Jahre sind keine Einzelfälle mehr; es können aber auch neun oder zehn Jahre sein.
Von den aktuell 23 präsentierten TopProjekten haben 14 teilweise erhebliche Verspätung; rund 60 Prozent sind folglich verzögert. Gegenüber dem Vorjahr ist das zwar vordergründig ein Projekt weniger. Aber: Im Projektbericht 2023 sind fünf Top-Projekte aus dem Vorjahr nicht mehr enthalten, weil sie zwischenzeitlich als abgeschlossen gelten. Sie sind grösstenteils durch neue Vorhaben ersetzt worden. Von diesen fünf Projekten waren nicht weniger als vier verspätet. Die Gesamtbilanz fällt folglich deutlich negativ aus: Der Faktor Zeit wird zunehmend zum Problemkind.
Verzögerungen und deren Begründung
Es gibt durchaus achtenswerte Gründe, weshalb sich ein Projekt verspätet. Im Projektbericht 2023 wird namentlich auf «die globalen Engpässe in den Lieferketten», die
unsichere Lage im Nahen Osten oder die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hingewiesen. Aufgeführt werden auch Begründungen wie «Mehrfachbelastungen von internen Schlüsselpersonen», der Konkurs eines Lieferanten, Projektverzögerungen im Parlament, nicht planbare WTO-Verfahren oder gewissermassen höhere Gewalt wegen der Räumung des Munitionslagers Mitholz.
Bereits bei der Mehrfachbelastung von internen Schlüsselpersonen stellen sich jedoch Fragen. Wenn man weiter liest, dass «die IKT-Services vom Rechenzentrum VBS nicht innerhalb der zeitlichen und finanziellen Vorgaben erbracht werden», der Schnittstellen-Abgleich mit Untersystemen mehr Zeit erforderte, die Bearbeitung technischer Probleme zeitintensiver sei als angenommen, material- und fertigungstechnische Probleme bestünden, «der ursprüngliche Projektauftrag bloss auf einer groben Kostenschätzung basierte» oder noch kein Prototyp vorhanden war, dann wird rasch klar: Etliche Probleme sind hausgemacht.
Die Beurteilung verschlechtert sich
Die Top-Projekte werden nach vier Kriterien beurteilt: Ziele, Finanzen, Personal und Zeit. Zur Verfügung stehen je vier Beurteilungsmöglichkeiten: offen, plangemäss, knapp und ungenügend. Hineingeschlichen hat sich jüngst noch «verzögert», ohne dies allerdings klar einzuordnen. Offen und ungenügend wurden Ende 2023 nie verteilt. Alles war entweder plangemäss (deutliche Mehrheit) oder knapp und ausnahmsweise verzögert. Zur Erinnerung: Es sind Selbstbeurteilungen der Projektverantwortlichen; die genauen Beurteilungsmassstäbe werden nicht offengelegt.
Wenn überwiegend plangemäss steht, könnte man rasch beruhigt zur Tagesordnung übergehen. Man muss jedoch tiefer kratzen: Für die 23 Top-Projekt stehen ins-
TOP-PROJEKTE VBS: RICHTWERTE ZUR AUSWAHL
• DTI-Schlüsselprojekt Bund
• Finanziell bedeutend (Investition ≥ 100 Mio. CHF)
• Interner Personalaufwand ≥ 10 Personenjahre
• Mehrjähriges Projekt
• Hohe politische und/oder strategische Relevanz
• Hohes öffentliches Interesse
• Komplexes Projekt und hohes Risikopotenzial
Quelle: Projektbericht VBS 2023
22
Peter
SICHERHEITSPOLITIK

Unvollständige Nutzungsdauerverlängerung am F/A-18. Bild: VBS

Mittlerweile sechs Jahre verspätet: ADS 15. Bild: VBS
gesamt 92 Beurteilungen zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr sind vier Verbesserungen zu verzeichnen, 74 Beurteilungen sind unverändert und 14-mal ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung zu verzeichnen (am meisten bei den Zielen und der Zeit). Die Tendenz ist klar: Es ist 2023 auch hier ein Abwärtstrend der Gesamtsituation eingetreten.
Werden Lehren gezogen?
Dieser Befund irritiert: Gemäss Projektbericht werden «die Stufen Departement und Amt regelmässig über den Stand und die Entwicklung der Top-Projekte orientiert». Falls angezeigt, erlassen sie Handlungsrichtlinien für die weitere Bearbeitung. Die Eidgenössische Finanzkontrolle prüft «systematisch die Schlüsselprojekte im Bereich der digitalen Transformation sowie der Informations- und Kommunikations-
technologie». Zusätzlich informiert das VBS bei Bedarf regelmässig die parlamentarischen Kommissionen. Primär aber bestehen zahlreiche interne Kontroll- und Rapportgremien.
Wird wegen der vielen Kontrollen die Steuerung vernachlässigt oder dringt diese nicht durch?
Laut Projektbericht ist das VBS daran, gestützt auf eine Empfehlung aus einer früheren externen Untersuchung, ein Projektportfoliomanagement aufzubauen. Dieses solle der Priorisierung der Vorhaben und «letztlich der Ressourcensteuerung dienen». Die Finanzdelegation hat neu eine Subdelegation eingesetzt, «die sich künftig gezielt mit den Top-Projekten auseinandersetzt». Diese punktuellen Massnahmen in Ehren; aber eine Gesamtsicht mit projektübergreifender Ursachenforschung und Steuerungsmassnahmen ist noch kaum erkennbar.
Wie Probleme verschwinden
Vereinzelt wird auch zu «kreativen» Massnahmen gegriffen, um ein Projekt gegen aussen auf Kurs zu halten. So ist die 2018 gestartete Entflechtung der IKT-Basisleistungen im VBS (von der FUB zum BIT) noch nicht abgeschlossen. Das Projekt wurde trotzdem Ende Februar 2023 aufgelöst. Die noch ausstehende Entflechtung der Gruppe Verteidigung wurde in deren Verantwortung übertragen und dort neu als DTI-Schlüsselprojekt Bund (digitale Entflechtung) mit eigenem Budget von 48 Mio. Franken geführt. Flankierend startet ein zweites neues Projekt, um die militärisch einsatzkritischen und nicht einsatzkritischen IKT-Leistungen zu entflechten. Die beachtlichen Kostensteigerungen und Verzögerungen sind damit erfolgreich vernebelt.
Beim Projekt Nutzungsverlängerung der F/A-18 (gestartet 2018) konnten zwar zahlreiche Arbeiten abgeschlossen werden. Bei der Überprüfung und Sanierung der Flugzeugstruktur ergaben sich jedoch erhebliche Probleme. Die Ruag begründet dies mit aufwendigeren und technisch anspruchsvolleren Arbeiten als ursprünglich angenommen und mit Lieferverzögerungen des Ersatzmaterials. Trotz einer Projektverlängerung um zwei Jahre bis 2027 wird nun darauf verzichtet, bei 15 von 30 Kampfjets die Flugzeugstruktur zu sanieren. Dafür soll diese Hälfte der Flotte bei periodischen Wartungen «zusätzliche Inspektionen durchlaufen». Damit ist die Kostenüberschreitung obsolet.
Welcher Mehrwert?
Wie schon früher mehrfach moniert, ist die Entstehung des Inhalts des Projektberichts VBS intransparent: Neben der Auswahl der Projekte fehlen – zumindest gegen aussen – nachvollziehbare Kriterien für die genaue Projektbeurteilung. Wenn von vier möglichen Qualifikationen stets nur die mittleren zwei verwendet werden, müsste das System hinterfragt werden.
Es bleiben drei zentrale Fragen im Raum: Welchen Mehrwert bietet der Projektbericht VBS? An welches Zielpublikum ist er adressiert? Und weshalb harzen die Verbesserungen in der Projektführung?

Maj a D Peter Müller Dr. rer. pol. Redaktor ASMZ peter.mueller@asmz.ch 3672 Oberdiessbach
ASMZ 23 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Wie Leidensdruck und Konfliktreife Kriege beenden
Während die meisten Studien zur friedlichen Beilegung von bewaffneten Konflikten und Kriegen die Substanz der Lösungsvorschläge als den wesentlichen Erfolgsfaktor ansehen, zeigt sich, dass ein zweiter, ebenso notwendiger Erfolgsfaktor im Timing der Lösungsbemühungen liegt.
Dominik Knill
«Der richtige Zeitpunkt ist eine der absoluten Essenzen der Diplomatie», schrieb John Campbell (1976: 73). «Man muss das Richtige zur rechten Zeit tun», ohne konkrete Gründe zu nennen. Henry Kissinger (1974) machte es besser, als er feststellte, dass «ein Patt die beste Voraussetzung für eine Einigung ist». Umgekehrt ist von Praktikern oft zu hören, dass bestimmte Mediationsinitiativen nicht ratsam seien, weil der Konflikt einfach noch nicht reif sei.
Das Konzept des «reifen Moments»
Das Konzept des «reifen Moments» konzentriert sich auf die Wahrnehmung einer für beide Seiten gleichsam schmerzhaften Pattsituation, der Mutually Hurting Stalemate (MHS), durch die Parteien, die idealerweise mit einer drohenden, vergangenen oder kürzlich abgewendeten Tragödie oder Krise verbunden ist (Zartman und Berman 1982: 66–78; Touval und Zartman 1985: 258–260). Das Konzept geht davon aus, dass die Parteien, wenn sie sich in einem Konflikt oder Krieg befinden, aus dem sie nicht siegreich hervorgehen können, und wenn diese Pattsituation für beide Seiten schmerzhaft ist (wenn auch nicht in gleichem Ausmass oder aus gleichen Gründen), nach einer alternativen Politik oder einem Ausweg suchen. Die Notlage bietet eine Frist oder eine Lektion, die darauf hinweist, dass der Leidensdruck stark zunehmen kann, wenn nicht sofort gehandelt wird. Wenn die Parteien keine «eindeutigen Beweise» dafür erkennen, dass sie sich in einer Sackgasse befinden, ist eine für beide Seiten schmerzhafte Pattsituation (noch) nicht eingetreten. Ein anderes Element, das für einen reifen Moment notwendig ist, ist weniger komplex und ebenfalls wahrnehmbar: ein Ausweg. Die Parteien müssen nicht in der Lage sein, eine bestimmte Lösung zu finden, sie müssen nur das Gefühl haben, dass eine
Verhandlungslösung möglich ist und dass die andere Partei dieses Gefühl und die Bereitschaft, ebenfalls zu suchen, teilt. Ohne das Gefühl, dass es einen Ausweg gibt, würde der mit dem MHS verbundene Druck die Parteien ins Leere laufen lassen.
Subjektive Äusserungen des Leidens, der Hoffnungslosigkeit und der Unfähigkeit, die Kosten einer weiteren Eskalation zu tragen, können zusammen mit objektiven Beweisen für eine Pattsituation, Informationen über die Anzahl und Art der Opfer und die materiellen Kosten und/oder anderen derartigen Indikatoren für MHS regelmässig in einem Konflikt untersucht werden, um festzustellen, ob eine Konfliktreife vorliegt.
Die Theorie der Konfliktreife
Die Theorie wirft einige interessante Aspekte auf. Eine Komplikation mit der Vorstellung einer schmerzhaften Pattsituation entsteht, wenn erhöhter Leidensdruck den Widerstand verstärkt, anstatt ihn zu verringern (Reife ist zwar eine notwendige Voraussetzung für Verhandlungen, aber nicht jeder Reifezustand führt zu einer Verhandlung).
Obwohl dies als schlechtes, irrationales oder sogar pubertäres Verhalten angesehen werden kann, ist es eine häufige Reaktion und eine, die Erfolg haben kann. Die Theorie besagt, dass ein Ausweg aus der Sackgasse nicht durch Eskalation geschieht, was Bemühungen um einen Ausweg vor dem Nachgeben impliziert. Druck auf eine Konfliktpartei führt oft zur psychologischen Reaktion, das Image des Gegners zu schädigen oder zu ruinieren, eine natürliche Tendenz, die oft als Verringerung der Chancen auf Versöhnung angeprangert wird, aber den funktionalen Vorteil hat, Widerstand zu rechtfertigen. Bestimmte Kategorien von Gegnern, wie zum Beispiel «wahre Gläubige», «Krieger» oder «Hardliner», lassen sich durch grösseren Leidensdruck kaum zu Kompromissen bewegen; stattdessen rechtfertigt der Schmerz wahrscheinlich einen
erneuten Kampf (Snyder und Diesing 1977). Gerechtfertigte Kämpfe erfordern grössere Opfer, die den erhöhten Schmerz absorbieren und die Entschlossenheit stärken. Der Kreislauf ist zweckmässig und selbstschützend.
Häufig lange Konflikdauer
So unausweichlich es auch sein mag, die unglücklichsten Implikationen des Konzepts der gegenseitigen schmerzhaften Pattsituation liegen in seiner Abhängigkeit vom Konflikt. An sich erklärt das Konzept die Schwierigkeit, eine präventive Konfliktlösung und eine vorausschauende Diplomatie zu erreichen, auch wenn nichts in der Definition des MHS verlangt, dass sie auf dem Höhepunkt des Konflikts oder auf einem hohen Gewaltniveau stattfinden muss. Die internen (und nicht vermittelten) Verhandlungen in Südafrika zwischen 1990 und 1994 sind ein bemerkenswertes Beispiel für Verhandlungen, die auf der Grundlage eines MHS eingeleitet (und fortgeführt) wurden, das von beiden Seiten als drohende Katastrophe wahrgenommen wurde (Ohlson und Stedman 1994; Zartman 1995b). Je grösser die objektiven Beweise sind, desto grösser ist die subjektive Wahrnehmung der schmerzhaften Pattsituation. Die Beweise kommen wahrscheinlich spät, wenn alle anderen Handlungsmöglichkeiten und Eskalationsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. In bemerkenswert vielen Fällen ist eine lange Konfliktdauer erforderlich, bevor das MHS sich durchsetzt.
In Anbetracht der grossen Anzahl potenzieller Konflikte, die noch nicht den «Höhepunkt» erreicht haben, deutet alles darauf hin, dass die Wahrnehmung eines MHS entweder (und im Optimalfall) auf einem niedrigen Konfliktniveau erfolgt, auf dem es in den meisten Fällen relativ einfach ist, mit der Problemlösung zu beginnen, oder, in auffälligen Fällen, auf einem ziemlich hohen Konfliktniveau. So scheinen Konflikte, die nicht «früh» behandelt werden, ein hohes Mass an Intensität zu benötigen, damit eine MHS-Wahrnehmung einsetzt und Verhandlungen über eine Lösung beginnen können. Um zumindest die Konflikte, die nicht frühzeitig behandelt wurden, für eine Lösung reifen zu lassen, muss man das Konfliktniveau erhöhen, bis eine Pattsituation erreicht ist, und dann weiter, bis es anfängt, weh zu tun, und dann noch mehr, um die Wahrnehmung von Leidensdruck sicherzustellen, und dann noch mehr, um die Wahr-
24 SICHERHEITSPOLITIK

nehmung einer bevorstehenden Katastrophe zu erzeugen.
Herausforderungen und Kritikpunkte
Die Friedensforschung und mit ihr die MHS sind aus dem Kalten Krieg hervorgegangen mit der Annahme, dass eine Konfrontation zwischen den beiden Supermächten einer gegenseitigen Selbstzerstörung gleichkäme. Obwohl die MHS-Theorie eine wichtige Rolle bei der Konzeptualisierung von Konfliktlösungsstrategien spielen kann, ist sie nicht frei von Kritik.
1. Subjektivität der Wahrnehmung: Eine der Hauptkritiken an der MHS-Theorie ist, dass die Wahrnehmung eines Stillstands schmerzhaft und unveränderlich stark subjektiv ist. Andere Faktoren wie politische, religiöse oder ideologische Verpflichtungen werden vernachlässigt. Was für eine Partei als schmerzhafter Stillstand erscheint, muss nicht zwangsläufig von der anderen Partei ebenso wahrgenommen werden. Dies kann dazu führen, dass eine Partei bereit ist zu verhandeln, während die andere Partei vielleicht noch Möglichkeiten zum Sieg sieht oder den Status quo als tolerierbar empfindet. Ein Verhandlungsfrieden ist daher meist ein Diktat- oder Verzichtfrieden, wenn von einem Sieg ausgegangen wird.
2. Asymmetrie in Konflikten: Zartmans Theorie setzt oft voraus, dass alle Parteien
ähnlich vom Stillstand betroffen sind. In vielen realen Konflikten gibt es jedoch eine Asymmetrie, bei der eine Partei vielleicht mehr Ressourcen oder eine höhere Schmerztoleranz hat als die andere. Dies kann dazu führen, dass die weniger betroffene Partei keinen Grund sieht, in Verhandlungen einzutreten, selbst wenn die andere Partei dringend eine Lösung sucht.
3. Überbetonung rationaler Entscheidungsfindung: Die Theorie geht davon aus, dass Parteien rational handeln und Entscheidungen basierend auf einer KostenNutzen-Analyse treffen. In der Realität können jedoch emotionale, kulturelle, ideologische oder historische Faktoren eine ebenso starke Rolle spielen und die Entscheidungen der Parteien beeinflussen, was von der Theorie nicht vollständig erfasst wird.
4. Rolle externer Akteure: Zartmans Theorie konzentriert sich stark auf die internen Dynamiken der Konfliktparteien und berücksichtigt weniger die möglichen Einflüsse externer Akteure. Externe Kräfte können jedoch durch politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Druck die Wahrnehmung eines MHS beeinflussen oder eine Pattsituation künstlich herbeiführen oder auflösen. Ein Beispiel hierfür ist der Krieg in der Ukraine mit ihren Proxy-Staaten.
5. Timing und Dynamik des Konflikts: Die Theorie setzt voraus, dass der richtige Mo-
Wann ist die Zeit reif für Verhandlungen? Schweizer Militärbeobachter auf Patrouillenfahrt.
Bild: Swissint
ment für Verhandlungen identifiziert werden kann. Das Erkennen dieses «reifen» Moments kann jedoch schwierig sein und die Dynamik eines Konflikts kann sich schnell ändern, was die Anwendung der Theorie in der Praxis kompliziert macht.
Aktuelle Kriege noch nicht reif für Verhandlungen
William Zartmans Mutually Hurting Stalemate ist ein bewährtes Konzept in der Konfliktbeilegungsforschung, das wertvolle Einblicke in das strategische Kalkül bietet, das Parteien dazu veranlasst, Verhandlungen aufzunehmen. Trotz ihrer Grenzen und ihrer unterschiedlichen Anwendbarkeit auf verschiedene Konflikte bleibt die MHS eine grundlegende Theorie, die Mediatoren und Verhandlungsführern hilft, die optimalen Bedingungen für die Initiierung erfolgreicher Friedensprozesse und Waffenstillstandsvereinbarungen zu verstehen und zu identifizieren. Da sich die globalen Konflikte weiterentwickeln, werden die Lehren aus Zartmans Arbeit zweifellos sowohl Theorie als auch Praxis beeinflussen. Der Krieg in der Ukraine und die Kriege im Nahen Osten zeigen, dass aktuell weder die Konflikte (über)reif noch der gegenseitige Leidensdruck gross genug sind, um sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Die Kampfhandlungen vorzeitig abzubrechen, hiesse für die eine oder andere Partei, einen inakzeptablen Gesichtsverlust zu erleiden.
Literatur
Campbell, J., 1976, Successful Negotiation
Zartman, I. W. and Berman, M., 1982, The Practical Negotiator
Touval, S. and Zartman, I. W., eds., 1985, International Mediation in Theory and Practice
Snyder, G. and Diesing, P., 1977, Conflict among Nations

Oberst Dominik Knill
MAS ETH MPP (Mediation in Peace Processes), MAS ETH SPCM (Security Policy Crisis Management) UN-Militärbeobachter (Georgien), Vermittler Aceh-Konflikt (Indonesien), Lehrbeauftragter Verhandlungsführung, Präsident SOG
8500 Frauenfeld
ASMZ 25 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Sparen, Steuern und Schulden –
Armeefinanzen im Fokus
Finanzierungsvorschläge aus Parlament und Bundesrat führen die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) gelegentlich in ein Dilemma. Aus dem von der SiK-S verabschiedeten Sonderfonds über 15 Milliarden Franken wird der Armee ein grosser und sehr verlockender Knochen von 10 Milliarden Franken vor die Füsse geworfen. Ist es moralisch (oder sicherheitspolitisch) vertretbar, ein so grosszügiges Geschenk auszuschlagen, und stimmt es vielleicht doch, dass es keinen «free lunch» gibt?

Oberst Dominik Knill Präsident SOG
Die SOG begrüsst grundsätzlich jedes Vorgehen, das zu einer Erhöhung des Armeebudgets führt. Sie setzt sich für eine kohärente und nachhaltige Armee- und Sicherheitspolitik ein und ist der Ansicht, dass die damit verbundenen finanzpolitischen Überlegungen im Gesamtzusammenhang zu sehen sind. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs scheint sich zumindest bei bürgerlichen Parteien und linken Kreisen der Eindruck verfestigt zu haben, dass sich die Schweizer Armee in einem ziemlich desolaten Zustand befindet. Am offensichtlichsten ist, dass es der Armee an genügend moderner Ausrüstung und Munition mangelt, um auch nur wenige Wochen durchzuhalten.
Eine Auslegeordnung
• Der Reigen der zelebrierten Entschlossenheit, der Kehrtwenden, der Selbstinszenierungen verschiedener Protagonisten und der pathetischen Schuldzuweisungen in Sachen Armeefinanzen zeigt allerdings: Wir sind in der Substanz so weit wie im Frühjahr 2022.
• So könnte man den gegenwärtigen Stand der Debatte auf den Punkt bringen: Die bürgerlichen Parlamentarier werfen dem Bundesrat de facto vor, ihren Forderungen nicht nachzukommen, obwohl dies realis-
tischerweise nur unter Verletzung der Schuldenbremse möglich wäre. Zudem soll dem Bundesrat die unangenehme Aufgabe überlassen bleiben, vorzuschlagen, welche Klientelen mit Subventionskürzungen brüskiert werden sollen. Bei den Mitgliedern beider Räte ist wenig Lust zu spüren, sich an dieser Frage die Finger zu verbrennen. Der Bundesrat plant im Rahmen der Verfassung und der geltenden Gesetze, was ihn faktisch daran hindert, bürgerliche Wünsche zu erfüllen. Er ist insofern in einer komfortablen Lage, als er dem Parlament mit dem Voranschlag lediglich Vorschläge unterbreitet und es dem Parlament als Hüter der Budgethoheit obliegt, über die effektive Zuteilung der finanziellen Mittel zu entscheiden.
• Die bürgerliche Mehrheit gibt sich entschlossen: Ab Anfang 2030 soll die Armee 1 Prozent des BIP erhalten. SVP und FDP verteidigen die Schuldenbremse aber entschiedener als den Mittelbedarf der Armee. Sparen soll es richten. Aufgezählt werden Bereiche, die in den letzten Jahren überproportional gewachsen sind, wie die internationale Zusammenarbeit und die Sozialausgaben. Dass letztere grösstenteils gebundene Ausgaben sind, also gesetzliche Grundlagen haben, die alle angepasst werden müssten – wohl jedes Mal mit einem Referendum – wird heruntergespielt und als Kleingeistigkeit abgetan, wenn man nach den realen Chancen dieses Vorgehens fragt. Dabei müssten FDP und SVP glaubhaft darlegen, wie sie das Volk, das sich gegen den Willen der bürgerlichen Parteien grosszügig eine 13. AHV-Rente gönnt, von einem Abbau der Sozialleistungen überzeugen wollen. Auch über den Zeitbedarf für diesen Gesetzgebungsreigen mag man nicht sprechen.
• Im bürgerlichen Begehren spielt die SVP in einer eigenen Kategorie. Sie legt im Februar 2024 ein Papier zur Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit vor, dessen materielle Umsetzung mindestens zwei Prozent des BIP erfordern würde, wobei die geforderte zweite Tranche von F-35-Kampfflugzeugen nicht eingerechnet ist. Gleichzeitig hat sie erklärt, dass die Landwirtschaft von den Sparrunden zugunsten der Armee ausgenommen werden soll.
• Die Schuldenbremse ist ein Verfassungsinstrument, das wesentlich zur guten Wirtschafts- und Finanzlage der Schweiz beigetragen hat und weiterhin soll. FDP und SVP müssen sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nur so viel Sicherheitsbedrohung zulassen, wie es die Schuldenbremse zulässt.
• Die Mitte, oder zumindest Teile von ihr, wären angesichts der düsteren Sicherheitsperspektiven für Europa bereit, eher für die Armee als für die Schuldenbremse einzutreten, auch auf die Gefahr hin, zum Steigbügelhalter der SP für grenzenlose Staatsausgaben zu werden.
• Allen Akteuren dieses politischen Schattenboxens scheint gemeinsam zu sein, dass sie die realen Zielkonflikte zwischen parteipolitischen Partikularinteressen und Armeefinanzen herunterspielen oder so tun, als gäbe es sie nicht. Solange dies die Richtschnur des eigenen Handelns ist, wird die Armee ausser Lippenbekenntnissen nichts erreichen. Und die Uhr tickt.
• Wie könnte eine Lösung aussehen? Erstens müssen sich alle Beteiligten mit der Vorstellung anfreunden, dass 1 Prozent des BIP bis 2030 zwar sehr erstrebenswert, aber zunehmend unrealistisch ist. Zweitens müssen in allen Bereichen, in denen Kürzungen ohne Gesetzesänderungen möglich sind, substanzielle Kürzungen vorgenommen werden, auch in der Landwirtschaft und vor allem in der internationalen Zusammenarbeit. Mehr Geld für die Armee von Gesetzesänderungen abhängig zu machen, ist bestenfalls Selbsttäuschung. Im Zuge der Einigung darüber, wie viel gekürzt werden kann, muss festgelegt werden, wie viele zusätzliche Mittel für die Armee ab 2030 tatsächlich freigespielt werden können. Diese Absenkung des Anspruchsniveaus ist kein vaterlandsloser Defätismus. Die Armee braucht nicht nur grossartige Entschlossenheit. Sie braucht dringend mehr Geld.
Fazit: Zuerst sparen, Subventionen kürzen, Armeefinanzen über das reguläre Budget erhöhen. Und wenn das nicht reicht, vorübergehend Steuern erhöhen. Lockerung der Schuldenbremse nur nach strengen Kriterien – ohne Präjudiz.
26
SOG
Die Zukunft der ASMZ wird gesichert
Neue Kollektivabos, ein Subskriptionsangebot für Einzelabonnenten sowie die Lancierung einer Gönnerinitiative: Mit einer Palette von Massnahmen wird das Weiterbestehen der ASMZ gewährleistet.
Die Kommission ASMZ der SOG und unsere Redaktion bedanken sich ganz herzlich für die zahlreichen E-Mails, Telefonate und Leserbriefe aufgrund des Artikels in der April-Ausgabe. Wir konnten nur einen Teil der Leserbriefe in der Ausgabe 5/24 veröffentlichen, weitere finden sich in dieser Nummer.
Wir können unserer treuen Leserschaft bestätigen, dass die ASMZ auch im 2025 weitergeführt wird, und zwar weiterhin auf dem jetzigen, hochstehenden Qualitätslevel. Unsere Miliz und die SOG brauchen ein starkes Sprachrohr!
Die Zeitschrift wird von der SOG und gegebenenfalls mit einer erweiterten Trägerschaft, zusammen mit unserem Verlag Brunner Medien AG, marktwirtschaftlich angeboten werden. Die SOG erwirtschaftet hierbei keinen Gewinn. Ein mögliches Defizit wird durch das statutarisch für die ASMZ zweckgebundene Vermögen der SOG und eine Gönnergemeinschaft getragen.
Durch den Wegfall des statuarischen Pflichtabos für die deutschsprachigen Einzelmitglieder einer SOG-Sektion reduziert sich die Auflage. Dies muss mit einer entsprechenden Erhöhung des Abopreises aufgefangen werden. Wir bedanken uns aber ausdrücklich für die zahlreichen Meldungen, dass viele Sektionen das Pflichtabo für ihre Mitglieder beibehalten wollen.
Kollektivabos und Subskriptionsangebot
Anstelle des Pflichtabos wurde den Sektionen nach Pfingsten schriftlich ein Kollektivabo angeboten. Dieses wird deutlich günstiger sein als ein Abo von Einzelpersonen (derzeit Fr. 92.– für 11 Ausgaben) und kann sowohl als Kombi-Abo (Print und Digital) wie auch als reines Digital-Abo abgeschlossen werden. Die Meldefrist für die Sektionen zu diesem attraktiven Angebot läuft noch bis Mitte Juli 2024. Anlässlich der SOG-Präsidentenkonferenz am 15. Juni 2024 wird nochmals ausdrücklich über dieses Angebot informiert.
Für Einzelabonnenten besteht die Möglichkeit, über ein Subskriptionsangebot in den Genuss einer Vergünstigung zum NormalAbo von Fr. 92.–/Jahr zu kommen. Je länger die Laufdauer des Abonnements mit Vorauszahlung geht (ein, zwei oder drei Jahre), desto grösser fällt der Einschlag aus (von 10 bis 20 Prozent). Diese Subskription wird in der ASMZ-Ausgabe vom August lanciert.
Gönnervereinigung in Vorbereitung
In Vorbereitung für die Publikation in der August-Ausgabe ist auch die Gründung einer Gönnervereinigung «Freunde der ASMZ» (Stiftung). Deren Mitglieder helfen mit einem einmaligen oder wiederkehrenden Solidaritätsbeitrag mit, die finanzielle Basis für unsere Publikation zu vergrössern. Das wiederum trägt dazu bei, den hochstehenden Qualitätslevel fortzuführen. Damit sollte es auch möglich werden, das nach über 14 Jahren im Jahr 2022 aus
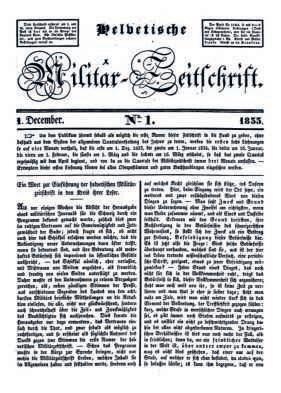
Kostengründen eingestellte Gratis-Abo für neu brevetierte Leutnants wieder einzuführen. Zudem sollen auch künftige Sonderausgaben über diese neuen Finanzmittel der Gönnerschaft finanziert werden.
Die Preise für das Jahr 2025 hat die ASMZKommission nun festgelegt. Erst im Laufe des Jahres 2025 werden wir sehen, ob unsere Einschätzungen bezüglich der Anzahl Abonnenten realistisch waren und ob ein mögliches Defizit über die vorhandenen Geldmittel gedeckt oder die weitere ASMZ-Herausgabe zwingend über ein überarbeitetes Preismodell ab 2026 sichergestellt werden muss.
Wir freuen uns, dass wir damit die Fortführung der ASMZ ab 2025, also im 191. Jahrgang, sichern können. Dabei zählen wir auf unsere treue Leserschaft, insbesondere in der schwierigen Übergangsphase.
Alle Leserinnen und Leser sind aufgerufen, der ASMZ die Treue zu halten, sodass die Herausgabe auch nachhaltig und langfristig gesichert ist. Weitere Informationen zur Gönnerschaft und die Einladung zum Subskriptions-Abo finden Sie in der kommenden Ausgabe vom August 2024.
Kameradschaftliche Grüsse
Oberst i Gst Thomas K. Hauser Präsident der ASMZ-Kommission der Schweizerischen Offiziersgesellschaft thauser@sog.ch
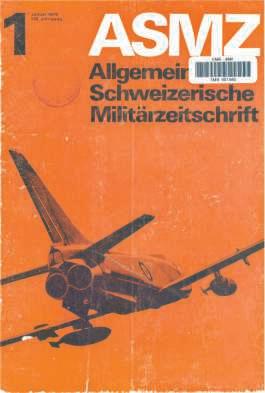
Die ASMZ ist dieses Jahr in ihrem 190. Jahrgang – und sie wird trotz Abschaffung des Pflichtabos auch im kommenden Jahr erscheinen. Drei Titelseiten, links die erste Nummer überhaupt im Dezember 1833, in der Mitte eine Ausgabe von 1970 und rechts ein Exemplar aus dem Jahr 2000. Bilder: ASMZ

ASMZ 27 06/2024 SOG

Logistikbataillon 52 auf dem Weg zurück zur Kriegslogistik
Schritt für Schritt wird auch die Logistik in der Schweizer Armee auf Kriegstauglichkeit ausgerichtet. Das Logistikbataillon 52 lernt sich und Anlagen zu schützen. Auch die kriegsmässige Aufmunitionierung der Truppe gehört zur Ausbildung.
Ernesto Kägi
Auf dem Weg ins Armeelogistikcenter (ALC) Othmarsingen kam mir als ehemaliger Nachrichtenoffizier in den Sinn, was ich während des Kalten Krieges gelernt hatte: bezüglich des Gegners «das Undenkbare denken». Was wäre, wenn die Gegenseite gezielte Raketen über weite Distanz auf unsere fünf ALC in Hinwil, Othmarsingen, Thun, Grolley und Monteceneri abfeuern und diese zerstören würde? Dort, wo praktisch sämtliche Fahrzeuge in Hallen und sämtliches Material in hohen Schmalregallagern computergesteuert oberirdisch gelagert wird.
Ohne Logistik keine Operationen
Divisionär Rolf Siegenthaler, Chef der Logistikbasis der Armee, forciert seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Rückkehr zu einer kriegsgenügenden Logistik (ASMZ 8/2023). In der militärwissenschaft-
lichen Zeitschrift Stratos 2/2023 hat er eine Auslegeordnung vorgenommen. «Eine kriegsgenügende Logistik muss sich auf Bedrohungen wie verbotenen Nachrichtendienst, Sabotage, Anschläge, Blockaden sowie Mangellagen ausrichten. Bereits in der friedlichen Alltagslage müssen die Systeme witterungs- und sichtgeschützt gelagert und gewartet werden können. Oberstes logistisches Ziel ist es, Versorgungsgüter und Einrichtungen verfügbar zu machen; nur so können Instandhaltung, Nachschub, Verkehr und Transport, Sanität sowie Infrastruktur über alle Lagen gewährleistet werden. Fakt ist: Ohne Logistik gelingt keine militärische Operation. Eine grosse Herausforderung bleibt dabei die Umsetzung der durchhaltefähigen Bevorratung.»
Für die dringend notwendige Munitionsaufstockung und die übrige Bevorratung rechnet die Armeeführung alleine mit Aufwendungen von zehn Milliarden Franken.
Logistik ist ein Primärziel
Wie sich im Ukraine-Krieg zeigt, ist die gegnerische Logistik ein Primärziel, egal ob es sich um wichtige Brücken, Eisenbahnknotenpunkte, Rüstungsproduktionsstandorte, Treibstoffdepots, Kraftwerke, Getreidelager, Häfen oder Spitäler handelt. Entsprechend muss sich auch die Schweizer Armee darauf ausrichten, dass die eigene Logistikinfrastruktur aufgeklärt und mit Präzisionsmunition auf grosse Distanz zerschlagen würde. Bereits in der normalen Lage gilt es daher Zutritte zu kontrollieren, Einbrüche zu verhindern und Transporte zu begleiten. Es müssen Vorkehrungen gegen Feuer und Stromausfall getroffen werden, die Alarmierung ist rund um die Uhr zu gewährleisten. Für die Kriegslogistik ist gemäss Siegenthaler aber das Wichtigste, sich der gegnerischen Aufklärung durch Tarnung und Täuschung zu entziehen und sich gegen weitreichendes Feuer zu schützen. Logistische Depots müssen dezentralisiert und durch eine Evakuation unter Boden dem gegnerischen Feuer entzogen werden.
Wie Siegenthaler betont, stellten sich für die Schweiz verschiedene besondere Probleme: «Erstens besitzt unser Land keine eigenen Rohstoffvorkommen, zweitens eine
EINSATZ UND AUSBILDUNG
schwindende Rüstungsindustrie und drittens kaum räumliche Tiefe.» Hinzu kommt, dass die Logistik seit dem Ende des Kalten Krieges zunächst langsam, seit 20 Jahren aber gemäss dem Kosteneffizienz-Paradigma radikal umgebaut wurde. Konsequenzen daraus waren die Zentralisierung, eine weitgehende Abkehr von geschützter Infrastruktur, der Abbau staatlicher Rüstungsbetriebe und ein massiver Personalabbau. Mit der Abwendung von geschützter Infrastruktur wurden auch die Festungstruppen und das Festungswachtkorps als Berufsformation aufgehoben.
Fehlende Rohstoffe sowie die kaum vorhandene Möglichkeit der Produktion von Rüstungsmaterial im Inland erfordern laut Siegenthaler den rechtzeitigen Import und die Bevorratung aller zur Kriegsführung notwendigen Güter: «Hier ist die richtige Menge der entscheidende Punkt, und diese ist eine Funktion von erwartetem Verbrauch und angestrebter Durchhaltefähigkeit. Die minimale Durchhaltefähigkeit wird bestimmt von der Frage, wie lange es dauert, bis Nachschub über die Grenze nachgeführt werden kann.» Der Chef der Logistikbasis der Armee gibt zu bedenken, dass eine Lieferung von Nachschubgütern über die Grenze während eines Krieges nur stattfindet, wenn dies im Interesse der Lieferländer liegt und wenn die Schweiz die gleichen Güter braucht, die diese Länder herstellen.
Mit Versuchen Konzeption verfeinern
Bis zu einer funktionierenden Kriegslogistik in der Schweizer Armee ist es noch ein weiter Weg. Es gilt die Konzeption zu verfassen, gleichzeitig aber konkrete Massnahmen umzusetzen, die für die Bedrohungsstufe ALPHA (siehe Grafik) gelten. Dazu gehören etwa ein verbesserter Schutz sowie die Anpassung der Schwergewichte in der Ausbildung der Truppe. Siegenthaler hat angeordnet, sich auf die Bedrohungsstufe BRAVO auszurichten sowie CHARLIE und DELTA zu planen.
Ausgewähltes Schlüsselpersonal der Logistikbasis, welches insbesondere im Bereich der Infrastruktur und mit Munition arbeitet, soll zum Selbstschutz bewaffnet werden. Diese Massnahme ist schon bald umgesetzt. Die Areale mit logistischer Infrastruktur sollen besser gesichert werden. Neben klassischen Mitteln wie der stationären Überwachung mit Kameras und Sensoren werden auch innovative Lösungen wie Robotik und Fesselballone mit Überwachungskameras und Drohnen verfolgt. Die zentrale Alarmierung ist bereits heute technisch wie taktisch sichergestellt.
Die Gesamtkonzeption Armeelogistik liegt bereits in einem ersten Entwurf vor. Schlussendlich soll für die Zukunft der Armeelogistik ebenfalls ein Dokument veröffentlicht werden, analog Luftverteidigung, Bodentruppen und Cyber.
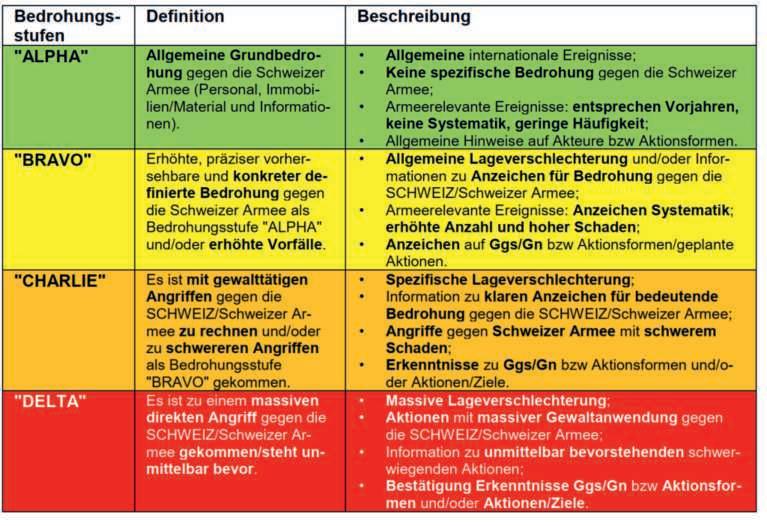
Brigadier Meinrad Keller, Kommandant der Logistikbrigade 1, hat das Schwergewicht der Ausbildung der Logistikbataillone bereits 2023 auf den Eigenschutz ausgerichtet. Im laufenden Jahr finden nun erste Einsatzlogistik-Versuche mit dem Heer und den Territorialdivisionen statt. Dabei wird der Nachschub von Versorgungsgütern über Logistikpunkte durchgeführt. Ziel ist es, die konzeptionellen Überlegungen in Übungen, zuerst im kleinen Rahmen, zu überprüfen, um dann die Konzeption zu verfeinern. Ebenfalls versuchsweise werden die Logistikbataillone die eingelagerten Güter neu kommissionieren – also eine Neuzusammenstellung der Güter für die «Kunden» –und dezentralisieren. Es geht hier darum, erste Erfahrungen bei der Dezentralisierung zu sammeln bezüglich Personal-, Mittelund Zeitaufwand.
Mittel nicht mehr vorhanden
Eine Stärkung der Einsatzlogistik ist unabdingbar, sollen dereinst schwere Divisionen mit ihren mechanisierten Mitteln erfolgreich verteidigen können. Dazu müssen die Truppenmechaniker wieder in die Lage versetzt werden, die nötigsten Reparaturen möglichst nahe am Einsatzort, also unter Gefechtsbedingungen, vollziehen zu können. Diese Konzepte sind aus der Zeit des Kalten Krieges noch vorhanden, müssen aber angepasst werden. Nicht mehr vorhanden sind teilweise die dazu notwendigen Mittel wie Werkstattcontainer, Hebezeug oder Transportmittel.
Solche Anpassungen erfordern zudem eine Veränderung in der Fachgrundausbildung in den Rekruten- und Kaderschulen. Daher müssen die Ausbildungskonzepte überarbeitet werden ebenso wie die technischen Weisungen für die Instandhaltung je System.
Jede Anlage wird dokumentiert
Zu den Sofortmassnahmen gehört auch der Stopp der Ausserdienststellung von Infrastruktur. Jedes Objekt wird daraufhin überprüft, ob es weiter von Nutzen sein könnte. Die Führungsanlagen werden derzeit nachdokumentiert. Eine solche Dokumentation der technischen Anlagen ist die Grundlage für den Einsatz der Miliz. Heute kann es vorkommen, dass die Angehörigen des Infrastrukturbataillons, die den Betrieb von unterirdischen Anlagen verantworten, nur
ASMZ 29 06/2024
Die Bedrohungsstufen der Armee. Grafik: VBS Für den Schutz des ALC-Tanklagers in Rothrist setzt die Log Kp 52/3 Unmengen von Material zur Härtung ein. Bild: Log Bat 52
untergeordnete Tätigkeiten ausführen dürfen, weil sie aufgrund der fehlenden Dokumentation auf die direkten Anweisungen des Personals der Logistikbasis angewiesen sind. Ebenso müssen sodann alle übrigen, heute noch genutzten Anlagen aufgenommen werden, aber auch diejenigen, die aus dem Immobilien-Dispositionsbestand in den Immobilien-Kernbestand zurückgenommen wurden.
Die Sanität ist ihrerseits damit beschäftigt, das Konzept des militärischen Gesundheitswesens wieder auf den Kriegsfall auszulegen. Der zu erwartende Patientenanfall und die Verletzungsmuster stellen völlig neue Herausforderungen an die sanitätsdienstliche Versorgung.
Eine taktische Munitionsübergabe
Der 23. April war ein wichtiger Tag für das Log Bat 52, eines von insgesamt fünf Logistikbataillonen der Log Br 1. Diese arbeiten jeweils partnerschaftlich mit je einem der fünf ALC zusammen. Mit der gesamten Regierung des Göttikantons BaselLandschaft und dem deutschen LogistikBrigadegeneral Holger Draber zusammen mit zwei seiner direkt unterstellten Oberstleutnants waren gleich zwei hochrangige Delegationen zu Besuch.

Bisher gehörten zu den Logistiktruppen die drei Prozesse Instandhaltung, Verkehr/ Transport sowie Nachschub/Rückschub. Auf dem Weg zur Kriegslogistik legt der Kommandant der Log Br 1, Brigadier Meinrad Keller, grossen Wert darauf, dass die Logistiker auch in der Gefechtstechnik der Infanterie ausgebildet werden und somit Bewachungs- und Überwachungsaufträge inklusive Härtung der entsprechenden Objekte beherrschen. So hatte je eine Kompanie des Log Bat 52 das ALC Othmarsingen sowie eine örtlich abgesetzte Tankanlage zu
BUNDESWEHR-DELEGATION ZEIGT SICH BEEINDRUCKT

Hptm Jennifer Rasch, Kdt Log Kp 52/4, erläutert dem deutschen Logistik-Brigadegeneral Holger Draber das Sicherungsdispositiv im ALC Othmarsingen. Bild: Ernesto Kägi
Im Rahmen eines Gegenbesuches bei der Logistikbrigade 1 hat Brigadegeneral Holger Draber, Kommandant der Bundeswehr-Logistikschule in Osterholz (nahe Bremen), zusammen mit zwei direkt unterstellten Logistik-Kommandanten während eines Tages auch das Log Bat 52 bei der Arbeit im ALC Othmarsingen beobachtet. Brigadier Draber und seine Kommandanten zeigten sich vor Ort von den Schweizer Milizkadern und Soldaten stark überzeugt. Nach seiner Rückkehr in den Norden Deutschlands schrieb er dem Autor noch: «Ich bin tief beeindruckt von der Professionalität und der hohen Motivation des hier eingesetzten Personals. Dem Lagevortrag zur Unterrichtung des Bataillonskommandanten Oberstleutnant Samuel Forster konnte ich entnehmen, welche Herausforderungen die Aufgabenwahrnehmung als Vorgesetzter eines Milizbataillons mit erhöhtem Bereitschaftsgrad darstellt. Man erkennt an der Herangehensweise bei zu erteilenden Aufträgen, dass es bei der Ausbildung der Offiziere deutliche Parallelen zwischen dem deutschen und dem schweizerischen System gibt. Die Einweisung durch die Kompaniekommandantin Jennifer Rasch hat diesen Eindruck bestätigt: Der gewählte Kräfteansatz zur Sicherung des ALC Othmarsingen mit ihrer Logistikkompanie wurde logisch hergeleitet und erfolgversprechend umgesetzt!
Ein Zug einer Logistikkompanie versorgt das Aufkl Bat 11 kriegsmässig mit Munition. Hier ist der Konvoi auf der gedeckten Annäherung zu sehen.
Bild: Aufkl Bat 11
Insgesamt wurde unserer Delegation eindrucksvoll dargestellt, dass der ‹Mindset› und das Verständnis für die militärisch-logistischen Aufgaben einer Landesverteidigung hohe Übereinstimmung beinhalten, obwohl die Aufgaben der jeweiligen Streitkräfte sich teilweise wesentlich unterscheiden.»
«Mit der Logistik gewinnt man keine Kriege, aber ohne Logistik verliert man jeden Krieg!», pflegt Generalmajor Gerald Funke, der Kommandant des Logistikkommandos der Bundeswehr und Vorgesetzter von Brigadier Holger Draber, immer wieder zu betonen.
bewachen. Ein weiteres Schwergewicht bildet im Zusammenhang mit Transporten auch ein bewaffneter Konvoischutz. Die im Vorjahr begonnene Ausbildung wurde in diesem WK verfeinert.
So führte das Log Bat 52 zusammen mit der Aufkl Log Kp 11 eine taktische Munitionsübergabe durch. Dies geschah mittels einer sogenannten Link Up Procedure. Damit wird ein koordiniertes Zusammentreffen eigener oder benachbarter Truppen beschrieben, um «friendly fire» zu verhindern
und das Zusammentreffen der beiden Truppen zu koordinieren. Mit einer gegenseitigen Identifikation wird sichergestellt, dass es sich dabei um eigene Truppen handelt. Im Fall der kriegsmässigen Munitionsübergabe wurden die Fahrzeuge des Logistikbataillons in den Konvoi der Aufkl Log Kp 11 integriert und zum Munitionsmagazin eskortiert. Die erhaltene Munitionsdotation wurde anschliessend unter dem Schutz beider Truppen im Munitionsdepot des Aufkl Bat 11 eingelagert.
30 EINSATZ UND AUSBILDUNG



Mechaniker der Log Kp 52/4 reparieren im ALC Othmarsingen Pneufahrzeuge und helfen mit, Spitzenbelastungen im ALC abzubauen. Bild:
Hochregallager soll geräumt werden
«Logistikbrigade 1: Ohne uns kein Einsatz» lautet das Motto von Kellers Brigade. Mit Blick auf eine glaubwürdige Kriegslogistik sollen im Fortbildungsdienst 2025 erstmals auch versuchsweise Neukommissionierungen ab den Schmalganglagern der ALC erfolgen sowie das Material in dezentrale, geschützte Anlagen eingelagert werden. Gemäss dem Bataillonskommandanten benötigt eine gesamte Evakuation des Schmalganglagers ALC Othmarsingen mit dem ganzen Bataillon fünf Tage im 24-Stunden-Betrieb.
Die Logistikbataillone können aus dem Stand, das heisst innerhalb von 24 bis 96 Stunden nach der Mobilisierung, zusammen mit dem ALC-Fachpersonal Ausrüstung für Truppen zusammenstellen und Unterstützung im Betrieb der Schmalganglager leisten. Zudem können sie gemeinsam mit dem Fachpersonal Instandhaltungsleistungen erbringen, Nachschub zugunsten der ALC sicherstellen und eine (improvisierte) Werkstatt ausserhalb der ALC übernehmen, einrichten und betreiben. Sie gewährleisten geschützte Transporte, schützen die Infrastrukturen eines ALC und unterstützen die Einsatzlogistik materiell und personell in Einsätzen und bei deren Kompetenzerhalt.
Stabstraining wie bei Kombattanten
Oberstleutnant Samuel Forster, Kommandant des Log Bat 52, ist Schlagzeuglehrer, Leiter zweier Musikschulen, Fachdidaktikdozent an der Hochschule für Künste in Bern und ein überzeugender Milizkommandant. Dies wurde bereits an der Fahnenübernahme in der Reithalle Schachen Aarau klar, spätestens aber beim zweitägigen Stabstraining im Bataillonkom-
mandoposten Ringierhaus in Zofingen. Dieses leitete er mit viel methodisch-didaktischem Geschick.
Zwar gibt es weder beim Bataillonsstab noch bei den Kompaniekommandanten Vakanzen, doch gab es im WK mehrere Ausfälle im Stab. So wurde etwa der ABC-Offizier im Stabstraining plötzlich S3/Chef Einsatz, weil nicht nur dieser Funktionsträger, sondern auch sein Stellvertreter, der Instandhaltungsoffizier, ausgefallen waren. Oberstleutnant Forster meisterte auch solche Klippen elegant, indem er immer wieder Übungsunterbrüche einbaute und mit Ausbildungs- und Erklärsequenzen fehlendes Know-how ausglich.
Verschiedenste logistische Anfragen, Befehle und Einsätze wurden in den zwei Stabstrainingstagen bearbeitet. Die Stabsmechanik mit den periodischen Lage-, Entschlussfassungs- und Befehlsrapporten war dabei gleich gegliedert wie bei Kampfbataillonen, aber inhaltlich mit viel mehr Detailorganisationstiefe. Denn diese benötigen solche Instandhaltungs-, Nachschub- und Rückschubaufträge.

EIN QUEREINSTEIGER ALS BRIGADEKOMMANDANT
Brigadier Meinrad Keller ist als Quereinsteiger seit 2022 Kommandant der Log Br 1. Ursprünglich wollte er in den diplomatischen Dienst einsteigen. So absolvierte der studierte lic. phil. nach dem Studienabschluss ein Hochschul-Traineeprogramm bei der UBS. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten blieb er dann dem Banking treu und arbeitete nach Weiterbildungen in den Bereichen Leadership, Banking und Finance im In- und Ausland knapp 25 Jahre bei der UBS. Dort bekleidete er unterschiedliche Führungspositionen und war während mehr als zehn Jahren im Range eines Managing Director tätig, unter anderem als Head Global Reporting oder Leiter Sourcing Group Finance. Zudem verbrachte er längere Phasen im Ausland, etwa drei Jahre als Group Finance Delivery Lead der Bank in Chennai (Indien). Keller kommandierte eine Füsilierkompanie und ein Füsilierbataillon, war Unterstabschef (G5) sowie Kommandant Stellvertreter der Territorialregion 2. Vor seinem Übertritt ins Berufskader der Schweizer Armee war er Gründungsmitglied und Managing Partner der Onoc Advisory GmbH.

ASMZ 31 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Oberst Ernesto Kägi Ehem. DC Kdo FAK 4 Pz Br 11 und Inf Br 7 8965 Berikon
Br Meinrad Keller (links) erklärt Br Holger Draber die Abläufe. Bild: Ernesto Kägi
Oberstlt Samuel Forster, Kommandant des Log Bat 52. Bild: Ernesto Kägi
Die Logistiker üben sich in Personen- und Fahrzeugkontrollen im ALC Othmarsingen. Bild: Log Bat 52
Log Bat 52
Der Mörser 16 stopft eine Fähigkeitslücke
Die Kampfbataillone erhalten ihre eigene indirekte Feuerunterstützung und damit ein Schlüsselelement der Kampfführung zurück.
Das Heer erhält sechs Kompanien, die mit Mörser 16 ausgerüstet sind.
Yves Gächter, Yoann Poffet
Die Minenwerferpanzer 64/91 wurden im Jahr 2009 ausser Dienst gestellt. Seither verfügen die Kampfbataillone über keine eigene indirekte Feuerunterstützung mehr. Insbesondere ging damit die Fähigkeit für Steilfeuer in der oberen Winkelgruppe verloren. Der Krieg in der Ukraine führt uns jedoch vor Augen, wie wichtig diese Art der Kampfunterstützung insbesondere im überbauten Gelände ist.
Die Fähigkeitslücke wird mit dem neuen 12-cm-Mörsersystem geschlossen. Dieses besteht hauptsächlich aus den folgenden drei Teilsystemen:
neue Piranha IV-Fahrzeuge mit einem 12-cm-Mörser-Cobra-Geschütz;
Kommandofahrzeuge Piranha II 8x8 (ehemals Piranha FUOf) für den Einheitskommandanten, dessen Stellvertreter sowie die Zugführer der Mörserzüge; – geschützte Fahrzeuge für den Munitionstransport (Iveco 8x8 mit Multilift) und Mörser Mun FLAT.
Darüber hinaus, auch wenn es nicht direkt zum aktuellen Beschaffungsprojekt «Mörser 16» gehört, wird der Zugführerstellvertreter über ein geschütztes Fahrzeug für die Erkundung und Führung der Logistik in den Stellungsräumen verfügen (ehemals das mechanisierte Schiesskommandantenfahrzeug).
Mit Ausnahme der Munitionstransporte sind alle Fahrzeuge mit den Funkgeräten der neuen Generation SE-495 EmK (Ersa mob Komm) ausgestattet. Die Steuerung der Feuerprozesse sowie der logistischen Prozesse erfolgt über das integrierte Artillerie-Führungs- und Feuerleitsystem (INTAFF 15).
Eingliederung der Mörser
Die 12-cm-Mörser werden als zusätzliche Kompanie den Panzer- und Mechanisierten Bataillonen unterstellt, was insgesamt sechs Mörserpanzerkompanien (Mö Pz Kp) ergibt. Jede dieser Kompanien besteht aus zwei Feuereinheiten (Zug +). Jede Feuereinheit
verfügt über vier Mörsergeschütze, die entweder als einzeln oder im Verband (Zug oder eventuell Halbzug) schiessen können.
Die 12 cm Mö Pz Kp besteht aus drei Zügen: einem Kommandozug und zwei Mörserzügen mit je einer Kommandogruppe (Zugführer und dessen Stellvertreter), vier Geschützen und einer Nachschubgruppe. Damit die Logistik zugunsten der Mö Pz Kp auf Stufe Bataillon gewährleistet ist, wird die Logistikkompanie der Panzerrespektive Mechanisierten Bataillone mit einer Mörser-Nachschubgruppe und einer Mörser-Diagnosegruppe verstärkt.
Die wichtigsten Einsatzgrundsätze
Die kleinste taktische Einheit ist die Feuereinheit. Sie besteht aus drei Elementen: einem Führungselement inklusive Fahrzeug auf Stufe Bataillon (Kompaniekommandant oder dessen Stellvertreter), einem Feuerelement (Zugführer und Geschütze aus dem Mörserzug), einem Logistikelement (Zugführer-Stellvertreter und Transportfahrzeug aus dem Mörserzug sowie einigen Elementen aus der Logistikkompanie).

Die gesamte Mörserpanzerkompanie kann einem einzigen Truppenkörper (dies entspricht der Grundgliederung in den Panzer- und Mechanisierten Bataillonen) oder in zwei Elementen respektive zwei Feuereinheiten unterteilt zwei verschiedenen Truppenkörpern einsatzunterstellt werden. Der Marsch der Feuerelemente (Mörserzug) zwischen den Stellungsräumen erfolgt so, dass jederzeit eine indirekte Feuerunterstützung gewährleistet ist. Er wird vom unterstützten Truppenkörper auf die Aktionen der Manövereinheiten abgestimmt.
In der Regel wenden die Feuerelemente die Grundsätze «Schiessen und Verschwinden» an. Je nach Absicht des Bataillonskommandanten kann er situativ «Wirkung vor Deckung» befehlen. Ein Feuerelement kann jederzeit und innerhalb weniger Minuten vom Marsch in die Feuerunterstützung übergehen. Die Grafik zeigt die Möglichkeiten des Feuereinsatzes von Mörsern in der Gefechtsform Verteidigung auf.
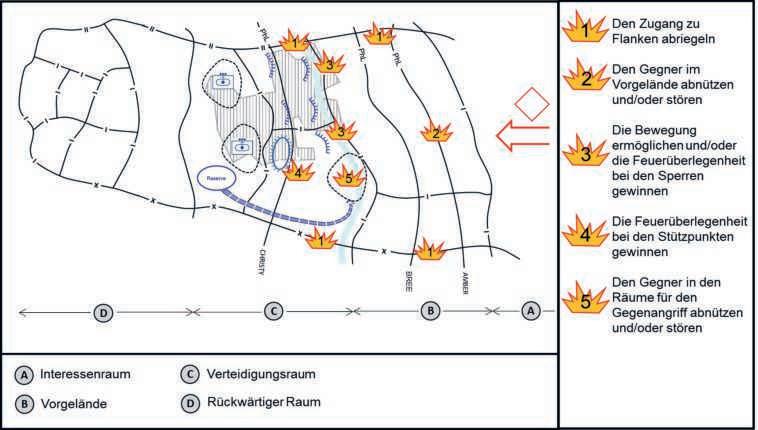
32 EINSATZ UND AUSBILDUNG
–
–
Bild: LVb
Pz/Art


In Ausnahmefällen und für eine bestimmte Einsatzphase können ein oder zwei Mörsergeschütze (ohne Kommandofahrzeug) einem Verband (beispielsweise einer Infanteriekompanie) als Mittel der Gewalteskalationsdominanz zugewiesen werden. Jedes Geschütz verfügt über einen eigenen Feuerleitrechner und kann im StandaloneModus eingesetzt werden. Diese Einsatzvariante ist technisch möglich, hält aber den Grundsatz der kleinsten taktischen Einheit (die Feuereinheit) nicht ein und bringt deshalb Nachteile mit sich, die berücksichtigt werden müssen (manuelle Eingabe von Feuerbefehlen direkt in das Geschütz, kein zugeteiltes Nachschubelement, kein Mörserkommandoelement auf Stufe Zug/Kompanie/Bataillon für die Führung und Synchronisation des Einsatzes).
Die Elemente des Bewegungsraums
Der Bewegungsraum der Mörser-Feuereinheit ist ein bestimmter Raum, welcher der Feuereinheit die notwendige Bewegungsfreiheit für den Einsatz und das Überleben gewährt. Dieser Raum besteht aus mehreren Stellungsräumen und reservierten Strassen, welche die Verschiebung der Elemente der Mörserfeuereinheit ermöglichen. Der Stellungsraum einer Mörserfeuereinheit umfasst idealerweise zwischen einem und vier Quadratkilometer. Dieser muss folgende Elemente enthalten: mindestens zwei Feuerstellungen (jeweils mit einem Radius von 50 bis 500 m) und eine mögliche Zugslauerstellung. Letztere muss im Bereitschaftsraum oder im Fall eines lang andauernden Einsatzes in das Dispositiv einer anderen Einheit integriert werden. Für den Bezug von Feuerstellungen und die Bewegung von einem Raum zum anderen ist ein ausreichend dichtes Strassennetz zu
bevorzugen, auch wenn der Mörser geländetauglich ist.
Element des Sensor-NachrichtenFührung-Wirkungsverbundes
Das taktische Aufklärungssystem (TASYS), das gleichzeitig mit den 12-cm-Mörsern eingeführt wird, ermöglicht den Aufklärern nicht nur, den Nachrichtenprozess digital zu bearbeiten, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, über INTAFF indirektes Feuer anzufordern. Die Kampfbataillone werden durch das eigene Bogenfeuer im Gefecht eine grössere Autonomie, mehr Dynamik, ein höheres Tempo und eine bessere Effizienz erlangen.
Die unmittelbare Feuerunterstützung (UF) erzielt folgende taktische Wirkungen: den Gegner abnützen, einen Geländeteil abriegeln, die Bewegung der eigenen Truppen ermöglichen, in einem bestimmten Raum
Der 12-cm-Mörser 16 im Gelände.
Bild: VBS
Ein geschützter Lastwagen Iveco 8×8 mit FLAT.
Bild: LVb Pz/Art
die Feuerüberlegenheit gewinnen oder den Gegner stören. Zur Wirkungserbringung hat der Beobachter die Wahl zwischen folgenden Feuerzwecken: Zerstören, Zerschlagen, Stören, Niederhalten und Beleuchten. Das Blenden wird in Betracht gezogen, ist aber derzeit nicht anwendbar, da die Schweizer Armee über keine spezifische 12-cm-Munition für diesen Feuerzweck verfügt.
Das 12-cm-Mörsersystem, das als Wirkmittel in diesen Verbund integriert ist, wird somit zu einem Schlüsselelement der Kampfführung auf Stufe Bataillon.
Br Yves Gächter

Kdt LVb Pz/Art 3609 Thun

Maj Yoann Poffet
Kdt Stv Kdo Vsu/VBA2 und BO Mörser 3609 Thun

Dieser QR-Code führt zu einem Clip, der einen Einblick auf den 12-cmMörser 16 gibt. Video: VBS
TECHNISCHE DATEN ZUM 12-CM-MÖRSERGESCHÜTZ
Besatzung: 1 Geschützführer, 1 Fahrer, 2 Kanoniere
Feuerführungsmittel: INTAFF 15
Rechner für Schiesselemente: Ballistic Onboard Computer (Boc) Zulässiges Gesamtgewicht: 30 t
Trägerfahrzeug: Piranha IV (GDELS Mowag)
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Motor: Scania DC-13, 6-Zylinder Turbodiesel 431 kW (586 PS)
Primärwaffe: 12-cm-Glattrohr-Mörser mit hydraulischer Rückstossdämpfung (Ruag)
Schusskadenz/weite: bis 10 Schuss pro Minute, ≤ 9000 m (je nach Munitionstyp: Wurfgranate, Beleuchtungsgeschoss, explosive Übungsgranate)
Sekundärwaffen: Waffenstation mit 12,7 mm Maschinengewehr 07 und 7,6 cm Nebelwurfanlage (8 Becher)
ASMZ 33 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Russland verstärkt
seine bodengestützte Luftverteidigung
Den im Kriegseinsatz stehenden russischen Streitkräften werden neue leistungsfähige Luftverteidigungswaffen zugeführt. Die vom Verteidigungsministerium Russlands angekündigten Massnahmen sind eine Reaktion auf die ukrainische Aufrüstung mit weitreichenden Waffen.
Hans Peter Gubler
Anfang dieses Jahres kündigte der damalige russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu an, dass die Streitkräfte in den nächsten Monaten neue militärische Mittel erhalten werden. Ein Schwergewicht soll dabei gemäss seinen Aussagen bei der Luftverteidigung liegen. Gemäss Russlands Verteidigungsministerium soll die Verbesserung der Luftverteidigungsfähigkeiten im Bereich des Zentralen Militärbezirks entscheidend für den Schutz russischer militärischer und strategischer Einrichtungen sein. So soll der Schutz von Kommando- und Überwachungssystemen, Flugplätzen, Versorgungseinrichtungen sowie auch von Anlagen der Ölindustrie und der strategischen Nuklearstreitkräfte verbessert werden.
Mit Priorität produziert und möglichst rasch an die Truppen ausgeliefert werden die strategischen Luftverteidigungssysteme S-400 und S-300V4 sowie die taktisch-operativen Abwehrwaffen Buk-M3, Tor-M2U sowie Pantsir-S1. Zusätzlich sollen Überwachungs- und Radarstationen einer neuen Generation an die Truppen ausgeliefert werden.
Reaktion auf westliche Waffenlieferungen
Die Ukraine ist heute in der Lage, mit ihren wachsenden Langstreckenkampffähigkeiten tiefgreifende Operationen gegen Russland durchzuführen. Die Entscheidung Washingtons, der Ukraine die Langstreckenversion des Army Tactical Missile System (ATACMS) mit einer Reichweite von 300 km zu liefern, zwingt Russland zu entsprechenden Gegenmassnahmen. Die nun erfolgte Lieferung unterstreicht aber das Engagement der westlichen Verbündeten, die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine
gegen die russische Aggression weiter zu unterstützen.
Unterdessen wurden mit den amerikanischen ATACMS-Raketen sowie mit den von Grossbritannien gelieferten Cruise Missiles Storm Shadow diverse russische Kommando- und Radarstationen auf der Krim erfolgreich bekämpft. In diesem Sommer soll die Ukraine insgesamt 45 Kampfflugzeuge F-16 von NATO-Staaten, unter anderem von Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Belgien, erhalten. Diese Lieferung ist ein weiterer Teil umfassender Bemühungen, die operativen Fähigkeiten der Ukraine zu stärken. Die Besatzungen dieser Flugzeuge, die jeweils aus rund einem Dutzend Mitarbeitern bestehen, sollen bis spätestens Ende dieses Jahres einsatzbereit sein. Im Weiteren bemüht sich die ukrainische Führung seit Kurzem auch um eine Beschaffung von amerikanischen Kampfdrohnen MQ-9 Reaper.
Mittel der strategischen russischen Luftverteidigung
Das seit 2007 bei der Truppe eingeführte und heute im zentralen russischen Militärbezirk und auf der Krim stationierten Abwehrsystem S-400 Triumf ist in der Lage, Flugzeuge, unbemannte Flugkörper, ballistische Raketen und Marschflugkörper zu bekämpfen. Russland hatte solche Luftverteidigungswaffen in den letzten Jahren auch an China, Indien und die Türkei verkauft. Je nach Art der Ziele können die S400-Systeme unterschiedliche Typen von Lenkwaffen einsetzen. Die maximale Reichweite soll gemäss Herstellerangaben bei 380 km liegen, die maximale Einsatzhöhe liegt bei 30 bis 35 km. Zu den Radarsystemen des S-400 gehört unter anderem das mobile Erfassungs- und Gefechtsführungsradar 91N6, das die Erkennung und Steuerung
mehrerer Ziele ermöglicht. Diese Radarstationen sind für die ukrainischen Truppen Ziele hoher Priorität.
Die erstmals bei aktiven russischen Truppen erkannten Systeme S-300V4 sind eine Weiterentwicklung der bekannten russischen S-300-Serie. Die gegenüber früheren Versionen auf einem Raupenfahrgestell basierende Waffe verfügt über verbesserte Fähigkeiten gegen die heute aktuellen Bedrohungen aus der Luft. Als Nachfolger der S-300 zeichnet sich die S-300V4 durch erhebliche Verbesserungen in Reichweite, Präzision und Mobilität aus. Das System hat eine erhöhte Abfangreichweite von bis zu 400 km und ist in der Lage, mehrere Ziele gleichzeitig mit erhöhter Genauigkeit anzugreifen. Bemerkenswert ist, dass die S-300V4-Systeme über verbesserte Radarund Erkennungsfähigkeiten verfügen, die gegnerische elektronische Störmanöver ausschalten. Das System ist so konzipiert, dass es das Rückgrat eines aus mehreren Waffentypen bestehenden, mehrschichtigen Luftverteidigungsnetzwerks bildet.
Taktisch-operative Abwehrwaffen
Mit dem mobilen Luftverteidigungssystem Buk-M3 können Flugzeuge, Helikopter, Marschflugkörper und unbemannte Luftfahrzeuge sowie vor allem auch taktische ballistische und aeroballistische Ziele bekämpft werden. Anfang Mai 2024 meldete das russische Verteidigungsministerium die erfolgreiche Bekämpfung von Gefechtsfeldraketen ATACMS, die kürzlich von den USA an die Ukraine geliefert worden sind. Russische Luftverteidigungskräfte sollen demnach mit Abwehrsystemen Buk-M3 etwa ein Dutzend ATACMS-Raketen über der Halbinsel Krim abgefangen haben. Die Buk-M3 ist für ihre Fähigkeit bekannt, gegnerische Luftziele auch unter schwierigen Bedingungen der elektronischen Kriegsführung erfolgreich zu bekämpfen.
Eher auf der taktischen Stufe eingesetzt wird das System Tor-M2U. Das hochmobile Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem dient zum Schutz vor präzisionsgelenkten Waffen wie intelligenten Bomben, taktischen Raketen und Drohnen. Auch Tor-M2U verfügt über eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen elektronische Gegenmassnahmen und verbesserte Feuerleitkomponenten. Gemäss russischen Berichten wurden damit in den letzten Monaten erfolgreich Raketen der ukrainischen Waffensysteme Himars und Vilkha abgeschossen.
34 AKTUELL


Verteidigung der Kertsch-Brücke
Ende April hatte die ukrainische Militärführung eine Dislozierung zusätzlicher russischer Luftverteidigungswaffen auf der Krim und insbesondere im Bereich der Kertsch-Brücke publik gemacht. Erkannt wurden Waffen der Typen Pantsir-S1 und S-300 vermutlich von S-300V4. Die KertschBrücke verbindet das russische Festland mit der im Jahre 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die Brücke, die offiziell als Krim-Brücke bekannt ist, wird von Russland sowohl aus logistischen, strategischen als auch aus psychologischen Gründen als entscheidend in der Region angesehen. Mit einer Länge von etwa 19 km gilt sie als die längste Brücke Europas und umfasst separate Abschnitte für den Fahrzeug- und Schienenverkehr. Die Brücke wurde nach
der Eingliederung der Krim in die Russische Föderation im Jahr 2014 begonnen und in Etappen fertiggestellt, wobei der Fahrzeugteil 2018 und der Eisenbahnabschnitt 2019 eröffnet wurden. Russland dürfte mit allen verfügbaren Mitteln versuchen, eine Zerstörung dieser Brücke zu verhindern.
Serienproduktion des strategischen Systems S-500

Kommt im Ukraine-Krieg erstmals zum Einsatz: das strategische Luftverteidigungssystem S-300V4.
Verteidigungsministerium

Das mobile Luftverteidigungssystem Buk-M3. Bild: russisches Verteidigungsministerium

Russland hat mit der Serienproduktion des strategischen Luftverteidigungssystems S-500 begonnen. Bild: russisches Verteidigungsministerium
Anfang Mai meldete das russische Verteidigungsministerium, dass Mitte Mai 2024 die Serienproduktion des neuen strategischen Luftverteidigungssystems S-500 aufgenommen worden. Das vom Rüstungskonzern Almaz-Antey entwickelte System der neuesten Generation wurde entwickelt, um eine Vielzahl strategischer Luftbedrohungen zu bekämpfen und zu neutralisieren; darunter fallen Interkontinentalraketen (ICBMs), HyperschallMarschflugkörper und Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen in Höhen von bis zu 200 km.
Die S-500 soll sich nahtlos in die S400-Systeme integrieren lassen und so ein mehrschichtiges Verteidigungsnetzwerk schaffen, das die Luft- und Raketenabwehr erheblich verbessern soll. In der russischen Militärpresse wird in letzter Zeit auch über die strategische Bedeutung der neuen Luftverteidigungssysteme berichtet, wobei vermehrt auch deren angebliche Abschreckungsfunktion hervorgehoben wird.

Oberstleutnant a D Hans Peter Gubler 3045 Meikirch
ASMZ 35 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Eine Stellung von Luftverteidigungswaffen S-400 auf der Krim. Bild: Russian Military Photos
Das taktische Flugabwehrkanonen- und Lenkwaffensystem Pantsir-S1. Bild: Sputnik
Bild: russisches
Der Kampf um Tschassiw Jar
In den Gefechten um Tschassiw Jar setzen die Russen auch Reizgas ein, um die Ukrainer aus ihren Stellungen zu vertreiben. Dafür scheinen die russischen Jets durch die Fliegerfäuste vertrieben worden zu sein, die die Ukrainer aus den USA erhalten haben.
Jonathan Stumpf
Es ruckelt kurz, dann steht der Zug. Ich werfe einen Blick auf die vielen Uniformierten, die hier zusteigen. Darunter ist auch eine rothaarige Schönheit Anfang zwanzig. Sie hat schwer an ihrem Militärrucksack zu tragen, den ein Patch mit einer «Wyschywanka», einer traditionellen ukrainischen Stickerei, ziert. Natürlich sind da ausserdem die obligatorischen Dickwänste Mitte vierzig, die selbst nach Monaten im Feld kein Gramm Gewicht zu verlieren scheinen. Mein Blick wandert zur Bahnhofshalle, über der in grossen hellblauen Lettern der Name der Stadt prangt: Slowiansk. Abgefahren ist der Zug kurz zuvor in Kramatorsk. Ich habe diese Stadt im vergangenen Monat sehr liebgewonnen. Der Frühling im Donbass hat seinen ganz besonderen Reiz. Obwohl es verglichen mit Deutschland oder den Niederlanden selten regnet, ist die Landschaft üppig grün. Am reizvollsten ist aber die Abwesenheit von Touristen. Souvenirläden gibt es in Kramatorsk nicht, dafür eine Markthalle, zahlreiche Parks, Alleen und Grünanlagen. Dank der vielen Mülleimer, die offenbar häufig geleert werden, ist die Stadt zudem sauber. In diesem Idyll erholt sich meine Gruppe von den Fronteinsätzen in der umkämpften Stadt Tschassiw Jar.
Wenige Hundert Zivilisten
harren aus Heute ist der 9. Mai. Eigentlich wollten die Russen Tschassiw Jar bis zu diesem historischen Datum, an dem in Moskau der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert wird, erobert haben. Das sagten zumindest Militärblogger und Analysten. Von einer Einnahme der Stadt in der Oblast Donezk sind Putins Truppen indes noch weit entfernt. Die durch einen Kanal in West und Ost geteilte Stadt wird auch von der Internationalen Legion des ukrainischen Militärgeheimdienstes verteidigt.
Vor der russischen Invasion lebten in Tschassiw Jar etwa 13 500 Menschen, von
denen trotz der extrem bleihaltigen Luft noch ein paar Hundert in ihren Häusern oder dem, was davon übrig ist, ausharren. Jedes Mal, wenn ich einen alten Mann sehe, der sich auf seinem klapprigen Fahrrad in aller Seelenruhe seinen Weg durch die Geisterstadt bahnt, während die Russen sie mit Mörsern, Artillerie und Panzern unter Dauerbeschuss nehmen, muss ich unwillkürlich den Kopf schütteln. Diese alten Knacker sind Stoiker, wenn es je welche gab, denke ich dann.
Ein rumänischer
Minenwerfer
Unsere Mörserstellung befindet sich auf der westlichen Seite der Stadt unweit des Kanals. Wir haben es uns im Keller eines Hauses mit grossem Garten bequem gemacht. Unseren rumänischen Minenwerfer M96A haben wir mit Gerümpel und Asbest-Wellplatten getarnt. Die Mörsergranaten mit 82 Millimetern Umfang lagern im Nebengebäude. Zum Glück ist es nicht dieses, sondern das andere Nebengebäude, das gegen Ende unseres ersten Einsatzes einen Volltreffer erhält. Da das Feuer auf unser Gebäude überspringt, das ebenfalls bis auf die Grundmauern niederbrennt, müssen wir umziehen.
Aber um ein neues Haus und ein neues Kellerloch zu finden, brauchen wir nicht lange zu suchen. Das heisst, wir müssen gar nicht suchen, denn unser Notfallplan sieht das Verlegen in eine zuvor ausgekundschaftete alternative Stellung bereits vor.
Warnung vor einer Schamanin
Es ist auch nicht so, als habe man uns nicht davor gewarnt, in der ersten Stellung zu bleiben. Das war folgendermassen: Gerade erst habe ich mit einem blutjungen, schlaksigen Weissrussen mit blondem Flaum am Kinn, der «Matros» gerufen wird, im Laufschritt eine Ecoflow-Powerstation aus der etwa einen Kilometer entfernt gelegenen
SPG-9-Stellung – ein rückstossfreies Ge-


Autor Jonathan Stumpf wurde nach Tschassiw Jar verlegt. Bild: PD
schütz – herangeschleift, um ihn mit unserem Benzingenerator zu laden. Zu seinem Spitznamen kam «Matros», weil er in Polen zwei Jahre auf der Schifffahrtsschule verbracht hat, bevor ihn das Abenteuer lockte und er sich zum ukrainischen Militär meldete. Plötzlich tauchen ein Grieche und ein alter Schwede aus meiner Gruppe zusammen mit einem ukrainischen Sanitäter auf. Sie sollen potenzielle Verbandsplätze auskundschaften.
Diese Versammlung im Vorgarten unseres Domizils veranlasst eine ältere Frau
AKTUELL

dazu, ihren Morgenspaziergang zu unterbrechen und uns unter Tränen zu beschwören, woanders Stellung zu beziehen. Das Haus sei nämlich von einer Schamanin bewohnt gewesen, einer sehr bösen Frau. Es bringe Unheil, sich dort aufzuhalten. Wir nicken verständnisvoll und rühren uns dennoch nicht vom Fleck.
Diese «böse Frau» muss sich, wie ich am Inhalt der Schränke ablesen kann, wie meine Grossmutter gekleidet haben. Ihr Sohn hat offenbar 1982 seine Ausbildung zum Klempner abgeschlossen und zwei Jahre später den Führerschein gemacht. Ob er ihn nicht mehr benötigt? Jedenfalls liegt er mit anderen Habseligkeiten am Boden. An den zahlreichen Familienfotos, die in einem anderen Zimmer den Fussboden pflastern, lässt sich unschwer erkennen, dass offenbar auch Hexen geliebte Grossmütter sein können. Neben den Myriaden von Einmachgläsern finden sich in dem Haus ausserdem eine Menge Heiligenbilder. Besonders häufig: der heilige Nikolaus. Sankt Florian, der Schutzpatron gegen die Gefahr des Feuers, wäre vielleicht eine bessere Wahl gewesen.
Ein Himmel voller Drohnen
Bis wir endlich kapieren, dass die meisten Drohnen, die über uns kreisen, unsere eigenen Drohnen sind, vergehen ein paar Tage. Und Nächte. In einer dieser dunklen Nächte,

Ein Gebäude in Tschassiw Jar ist durch einen Volltreffer in Brand geraten. Bild: Jonathan Stumpf
Der Minenwerfer M96A des Mörsertrupps der Internationalen Legion in Aktion. Bild: PD
ein junger Schwede und ich richten den Minenwerfer gerade auf ein neues Ziel aus, kommt eine Drohne besonders nah heran, sodass wir Reissaus nehmen.
Ich laufe in das nächstbeste Haus, biege in einen unbekannten Gang und falle über einen umgeworfenen Stuhl. Die Landung erfolgt mehr oder weniger sanft zwischen Eimern, Kesseln, Töpfen, Teppichen und Einmachgläsern, die ich zum Glück knapp verfehle. Mehr als eine Beule am Schienbein und eine Prellung am Oberschenkel ziehe ich mir nicht zu. Ein paar Minuten später sind wir wieder am Mörser. Leider können wir wegen Munitionsmangels nicht so häufig schiessen, wie wir gerne möchten.
Russische Jets verschwunden
Die meiste Zeit verbringen wir in einem der modrigen Keller und hören den russischen Panzern bei ihrer Arbeit zu. Es knallt ganz unvermittelt, also ohne das dem Einschlag vorausgehende charakteristische Pfeifen von Mörser- und Artilleriegranaten. Etwa zwei Sekunden später hört man die Schrapnelle in der Umgebung gegen Hauswände und andere Hindernisse prasseln. Während unser weissrussischer Vorgesetzter die Flugbahnen

Die Granaten werden beschriftet. «Volya» bedeutet Freiheit. «Ria» ist das Restaurant in Kramatorsk, das im vorigen Sommer von russischen Raketen zerstört wurde. Dabei kamen zahlreiche Zivilisten ums Leben. Der Autor hatte dort wenige Tage zuvor zu Mittag gegessen. Bild: Jonathan Stumpf
verschiedener Granaten berechnet, scrollt sich der junge Schwede, in seinen Schlafsack eingewickelt, durch Marvel-Comics.
Die Abwürfe von Gleitbomben, die wir in den ersten Tagen noch hören konnten, haben aufgehört. Auch sieht man keine russischen Jets mehr über der Stadt kreisen. Vielleicht eine Vorsichtsmassnahme wegen der von den Vereinigten Staaten nun doch nach langem Hin und Her gelieferten Waffen, unter denen sich auch Fliegerfäuste befinden.
Einsatz von Reizgas
Dafür setzen Putins Truppen mittlerweile wie schon zuvor andernorts Gas ein. Gerade dort, wo der Wald um Tschassiw Jar sehr dicht ist, und um die Ukrainer zum Verlassen ihrer Gräben zu zwingen. Abgefeuert wird das Reizgas offenbar mit dem Mehrfachraketenwerfer BM-21, auch genannt Grad, was «Hagel» bedeutet. Als mein Kumpel Niente und andere Jungs aus meiner Gruppe einen verwundeten Japaner und einen gefallenen Australier bergen sollen, geht ein solcher Hagel um sie herum nieder. Niente ist eine Weile blind wie ein Maulwurf und die Operation Samurai muss auf den Folgetag verschoben werden. Der Japaner wird gerettet.
Jonathan Stumpf, 1988 in Richmond, Virginia, geboren und am Bodensee aufgewachsen, schloss in Pforzheim eine Gärtnerlehre ab, ehe er als Maschinenkadett für eine Hamburger Reederei zur See fuhr. Während eines längeren Landurlaubs verpflichtete er sich bei der US-Armee als Infanterist, wurde aber nach der Grundausbildung in Bayern stationiert. Anschliessend studierte er in Heidelberg und Cluj-Napoca (Rumänien) Geschichte und Klassische Archäologie und in Mannheim und Leiden (Niederlande) Geschichte und Religionswissenschaft. Nach seinem Master heuerte er auf einem Binnenschiff an. In der Ukraine arbeitete er zunächst als Kriegsberichterstatter, ehe er sich selbst der Internationalen Legion anschloss. Diesen Sommer kehrt er vorübergehend nach Deutschland zurück.
ASMZ 37
AUTOR
Wie entwickelt sich die Persönlichkeit in der RS?
«I dä RS wirsch än richtige Maa.» Findet eine solche Persönlichkeitsentwicklung statt? Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das hat mit der Schwierigkeit zu tun, eine Veränderung zweifelsfrei auf die RS zurückzuführen. Aktuell läuft eine Studie, die diese Forschungslücke schliessen will.
Etienne Heitz, Hubert Annen
Wie die Rekrutenschule die Persönlichkeit von jungen Erwachsenen beeinflusst, hat schon zahlreiche Psychologinnen und Psychologen in verschiedenen Ländern beschäftigt. Dabei beschreiben Forschende die Persönlichkeit meist mit fünf Faktoren, den sogenannten «Big Five»: Extraversion, Offenheit, emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Die Big Five bilden das in der Wissenschaft weitverbreitetste Modell der Persönlichkeit (siehe Kasten).1 Es hängt mit einer Vielzahl bedeutsamer Themen im Leben eines Menschen zusammen. So begünstigen beispielsweise starke Ausprägungen von emotionaler Stabilität und Gewissenhaftigkeit die Gesundheit beziehungsweise den beruflichen Erfolg.2, 3
Die Theorie dahinter und bisherige Resultate
Gemäss verschiedener wissenschaftlicher Theorien lässt sich eine Entwicklung der Persönlichkeit darauf zurückführen, dass junge Erwachsene eine neue soziale Rolle in der Gesellschaft übernehmen.4, 5 So müssen sie beispielsweise ein guter Vater werden, im Verein Projekte leiten oder als Angestellte Verantwortung übernehmen. Verbunden damit sind Veränderungen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln, die sich in der Entwicklung der Persönlichkeit widerspiegeln. Da der Eintritt in die RS die Übernahme einer neuen sozialen Rolle bedingt, ist also auch zu erwarten, dass damit eine Persönlichkeitsveränderung einhergeht. In der wahrscheinlich frühesten Studie zum Thema untersuchten Vickers et al. (1996) Rekruten der US Navy am Start und am Ende ihrer Grundausbildung.6 Die Autoren fanden heraus, dass die emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit der Befragten in dieser Zeit zunahmen. Dar und Kimhi (2001) interviewten ehemalige Angehörige der israelischen
Streitkräfte.7 Diese berichteten, dass sich durch den Militärdienst ihr Selbstbewusstsein verstärkte und ebenso Merkmale, die mit Verträglichkeit verwandt sind. Jackson et al. (2012) verglichen deutsche Männer, die in der Bundeswehr waren mit solchen, die keinen Militärdienst leisteten.8 Hier zeigte sich, dass Angehörige der Bundeswehr nach ihrem Militärdienst eine geringere Verträglichkeit aufwiesen als Zivilisten, und zwar auch noch mehrere Jahre später.
Bech et al. (2021) betrachteten die Veränderung der Persönlichkeit nach einem Training für Spezialkräfte in Dänemark.9 Als Kontrollgruppe nutzten sie Studenten. Verglichen mit dieser zivilen Gruppe zeigte sich bei den Militärs nach ihrem Training ein stärkerer Zuwachs von Extraversion und emotionaler Stabilität. Niederhauser und Annen (2020) untersuchten die Entwicklung von Rekruten in der Schweizer Armee.10 Die Rekruten gaben an, dass sie selbstbewusster und sicherer im Sozialkontakt, lösungsorientierter und mental stärker wurden. Diese Entwicklung deutet auf eine Zunahme
von Verträglichkeit und emotionaler Stabilität hin. Dies gilt allerdings nur für Personen, die von Anfang an eine hohe Resilienz aufwiesen und den Stress der RS gut bewältigen konnten. Die Autoren berücksichtigten zudem keine zivile Vergleichsgruppe.
Herausforderungen bei der Messung
Bisherige Studien zeigen also wiederholt, dass Rekruten nach ihrer militärischen Ausbildung emotional stabiler und selbstbewusster sind. Insbesondere beim Faktor Verträglichkeit kommt man aber auch zu widersprüchlichen Resultaten. Das liegt einerseits daran, dass die Studien unterschiedliche Länder und Streitkräfte betrachteten. Vickers et al. (1996) untersuchten eine professionelle Armee in den USA, Jackson et al. (2012) hingegen eine Milizarmee in Deutschland. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Personen beziehungsweise ihre Entwicklung hundertprozentig vergleichbar sind. Ein anderer Grund für die Unterschiede ist wahrscheinlich auch, dass die Frage nach der Entwicklung nicht optimal überprüft wurde. Um sie zuverlässig zu beantworten, müssen vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, was bisher noch auf keine solche Studie zutraf. Es handelt sich dabei um folgende Punkte: 1. Kontrollgruppe. Um Effekte zweifelsfrei auf die RS zurückführen zu können, muss neben den Angehörigen der Armee gleichzeitig eine zivile Kontrollgruppe untersucht werden. Idealerweise ist sie identisch mit der militärischen Gruppe (gleiches Alter,
DIE BIG FIVE, EIN MODELL DER PERSÖNLICHKEIT
MIT FÜNF FAKTOREN 11
Jeder der eingangs erwähnten fünf Faktoren stellt jeweils ein Spektrum mit zwei Gegenpolen dar, auf dem sich ein Mensch einordnen lässt. Ein Pol ist jeweils namensgebend für den ganzen Faktor. Extraversion reicht zum Beispiel von «Extraversion» bis hin zu «Introversion». Im Folgenden wird genauer beschrieben, was jeder Faktor beinhaltet: Extraversion: Personen mit starker Extraversion sind gesellig, durchsetzungsfähig und voller Energie. Menschen mit geringer Extraversion verbringen Zeit lieber alleine und überlassen anderen die Führung, wenn sie in einer Gruppe sind.
Offenheit: Personen mit grosser Offenheit sind neugierig, kreativ, fantasievoll und schätzen Dinge wie Ästhetik und Kunst. Personen mit geringer Offenheit bevorzugen eher das Althergebrachte und sind weniger verträumt.
Emotionale Stabilität: Personen mit starker emotionaler Stabilität sind fröhlich, ausgeglichen und sorgenfrei. Personen mit schwacher emotionaler Stabilität sind eher ängstlich, empfindlich und machen sich häufig Sorgen. Dieser Faktor wird auch als Neurotizismus bezeichnet, was den Gegenpol zu emotionaler Stabilität darstellt. Gewissenhaftigkeit: Personen mit stark ausgeprägter Gewissenhaftigkeit sind fleissig, ordentlich und zuverlässig. Sie verfügen über Selbstdisziplin und verfolgen langfristige Ziele. Personen mit wenig Gewissenhaftigkeit hingegen planen nicht weit voraus und leben eher im Moment. Sie halten sich auch seltener an Regeln und Vorschriften. Verträglichkeit: Personen mit grosser Verträglichkeit sind höflich, mitfühlend und schenken anderen leicht Vertrauen. Sie bevorzugen es, wenn Harmonie zwischen Menschen herrscht. Personen mit wenig Verträglichkeit hingegen sind eher misstrauisch und nehmen weniger Rücksicht auf andere.
38 FORSCHUNG UND LEHRE
Bildungsniveau etc.), ausser dass sie eben keine RS absolviert. Somit kann ausgeschlossen werden, dass eine allenfalls beobachtete Entwicklung in der betreffenden Phase auch ohne RS stattgefunden hätte.
2. Followups. Um festzustellen, ob ein Effekt auch nach der RS im Zivilleben anhält, müssen mehrere Monate nach Abschluss der RS noch weitere Messungen bei denselben Personen vorgenommen werden.
3. Fremdauskunft. Üblicherweise geben Befragte selbst Auskunft über ihre Persönlichkeitsmerkmale. Aber jede und jeder kennt es: Man beantwortet Fragen über sich selbst nicht immer ganz ehrlich. Wer beispielsweise nach Selbstdisziplin (Faktor Gewissenhaftigkeit) oder dem Umgang mit anderen (Faktor Verträglichkeit) gefragt wird, neigt zu sozial erwünschtem Antworten. Hier gibt man Gegensteuer, indem man nicht nur die Rekrutinnen und Rekruten, sondern zusätzlich auch ihre Angehörigen befragt. Dabei kann es sich zum Beispiel um einen Elternteil oder die Partnerin handeln. Ihnen werden dieselben Fragen über ihren Sprössling respektive Freund gestellt, was den Forschenden objektivere Daten liefert.
4. Moderatorvariablen. Damit gemeint sind Variablen, die einen Effekt verstärken oder abschwächen. Es kann beispielsweise sein, dass die RS zu positiven Entwicklungen führt, aber nur wenn Rekrutinnen und Rekruten von Anfang an stressresistent sind. Wenn nicht, könnte die RS den psychischen Zustand vielleicht zwischenzeitlich verschlechtern. In diesem Falle wäre Resilienz eine Moderatorvariable.
Die aktuelle Studie in der Schweizer Armee
Eine wissenschaftliche Studie, die alle vier oben genannten Bedingungen erfüllt, läuft gegenwärtig in der Schweizer Armee. Sie erforscht den Einfluss der RS auf die Big Five und das Selbstwertgefühl der Rekrutinnen und Rekruten. Die Studie wird im Rahmen einer Dissertation an der Dozentur für Militärpsychologie und -pädagogik mit Unterstützung der Professur «Differenzielle Psychologie und Diagnostik» an der Universität Zürich durchgeführt. Bis im Frühjahr 2025 dauert die Datenerhebung noch an, danach beginnt die Auswertung. Jedes Jahr starten um die 20 000 junge Erwachsene die RS. Es ist wichtig zu wissen, wie das Wesen einer so grossen Anzahl junger Schweizerinnen und Schweizer durch
den Militärdienst beeinflusst wird. Sollte sich die Annahme einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit wissenschaftlich zweifelsfrei nachweisen lassen, wäre dies ein starkes Argument zugunsten der militärischen Ausbildung. Vielleicht wird es junge Schweizerinnen und Schweizer, die momentan noch nicht viel vom Militärdienst halten, dazu bewegen, diese Herausforderung nicht nur mit Überzeugung anzutreten, sondern auch durchzustehen. Des Weiteren kann mit dieser Studie überprüft werden, ob die Big Five frühzeitige Abbrüche des Militärdienstes vorhersagen können. Mit diesem Wissen liesse sich die Rekrutierung von Stellungspflichtigen optimieren.
11 John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative big-five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Hrsg.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 114–158). Guilford Press.
12 Strickhouser, J. E., Zell, E., & Krizan, Z. (2017). Does personality predict health and well-being? A metasynthesis. Health Psychology, 36(8), 797–810.
13 Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2(4), 313–345.
14 Roberts, B. W., & Davis, J. P. (2016). Young adulthood is the crucible of personality development. Emerging Adulthood, 4(5), 1–9.
15 Caspi, A., & Moffitt, T. E. (1993). When do individual differences matter? A paradoxical theory of personality coherence. Psychological Inquiry, 4(4), 247–271.
16 Vickers, R. R., Hervig, L. K., Paxton, E., Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (1996). Personality change during military basic training. Naval Health Research Center.
17 Dar, Y., & Kimhi, S. (2001). Military service and self-perceived maturation among Israeli youth. Journal of Youth and Adolescence, 30(4), 427–448.
18 Jackson, J. J., Thoemmes, F., Jonkmann, K., Lüdtke, O., & Trautwein, U. (2012). Military training and personality trait development: Does the military make the man, or does the man make the military? Psychological Science, 23(3), 270–277.
19 Bech, S. C., Dammeyer, J., & Liu, J. (2021). Changes in personality traits among candidates for special operations forces. Military Psychology, 33(3), 197–204.
10 Niederhauser, M., & Annen, H. (2020). Die Rekrutenschule als Lebensschule – Mythos oder Realität? Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, 186(9), 42–43.
11 McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of personality, 60(2), 175–215.


Etienne Heitz
M. Sc.
Forschungsprojektmitarbeiter Dozentur Militärpsychologie, -pädagogik MILAK an der ETH Zürich
Oberst Hubert Annen
Dr. phil.
Dozent Militärpsychologie und Militärpädagogik, MILAK/ETHZ 6300 Zug

CYBER OBSERVER
Marc Ruef Head of Research scip AG
Die letzten Wochen wurde über «Lavender» berichtet. Eine durch die israelischen Streitkräfte eingesetzte künstliche Intelligenz, um Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihads in Palästina zu identifizieren. Punktuelle Angriffe können mit einer erhöhten Effizienz und Genauigkeit umgesetzt werden. Ein hinderlicher Flaschenhals konnte damit beseitigt werden. Software, Automatisierung und KI werden umfangreichen Einfluss auf unser aller Leben, auch abseits etwaiger Schlachtfelder, haben. Entscheidungen, die durch Maschinen getroffen werden, können «ruhigen Gewissens» mitgetragen werden. Man sieht sich nicht mehr in der eigenen Verantwortung. Es ist ein «räsonabler Befehl von oben».
Damit verliert man aber früher oder später den Skeptizismus und das Verständnis für die eingesetzten Mechanismen. Denn wer lange genug einer Software glaubt, wird irgendwann unmündig, selbst die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Oder nicht mehr in der Lage sein, falsche Entscheidungen als solche zu erkennen. Wir sehen es an den GPS-Systemen, die uns helfen, effizient mit dem Auto an unseren Zielen anzukommen. Die Kunst des Lesens von Strassenkarten wird über kurz oder lang verloren gehen. Denn wieso soll man sich mit sperrigem Papier auseinandersetzen, wenn das Mobiltelefon doch handlich und unhinterfragt «vorausdenken» kann.
Ich bin keineswegs ein Gegner von Computern. Aber sie sollen in erster Linie unterstützend helfen. Und uns nicht zu einem hörigen Stück Fleisch degradieren, das nur noch für das Herantragen von Daten und Strom gebraucht wird. Es ist wichtig, dass wir die Funktionsweise von Computern verstehen, um sie kritisieren und optimieren zu können. Fällt das weg, verlieren die Entscheidungen ihre Menschlichkeit. Dann haben wir uns abgeschafft.
ASMZ 39 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Die Schuldenbremse zwecks Nachrüstung umgehen?

AUS DEM BUNDESHAUS
Dr. Fritz Kälin Bundeshausredaktor ASMZ fritz.kaelin@asmz.ch
Bei der diesjährigen Armeebotschaft (24.025s) beantragte die ständerätliche SiK einstimmig, den vom Bundesrat beantragten Ausgabenplafond für die Jahre 2025–2028 auf 29,8 Mrd. CHF anzuheben. Mediale Schlagzeilen machte aber nicht dieses starke Bekenntnis aller ständerätlichen Sicherheitspolitiker, die Verteidigungsausgaben eben doch bis 2030 und nicht erst 2035 auf 1 Prozent des BIP anzuheben. Zur Finanzierung dieses Ausgabenaufwuchses reichte nämlich eine Mitte-LinksMehrheit von 8 gegen 5 Stimmen eine Motion ein (24.3467s). Diese würde einen spezialgesetzlich geregelten befristeten Fonds schaffen, der von 2025 bis 2030 zusätzliche 10,1 Mrd. Franken für die Armeenachrüstung deckt, sowie 5 Mrd. für den Wiederaufbau und die Infrastrukturinstandsetzung der Ukraine. Die Ukraine-Hilfe würde damit zusätzlich statt zu Lasten
der bisherigen Entwicklungshilfeausgaben finanziert.
Sowohl die mit dem Fonds verbundene Umgehung der Schuldenbremse als auch die Verknüpfung von Landesverteidigung und (Ukraine-)Entwicklungshilfe stiessen bei SVP, FDP und sogar Exponenten der Mitte auf entschiedene Ablehnung. Die Mitte-Partei bleibt in der Armeefinanzierungsfrage gespalten. Von den Milizverbänden sprach sich die SOG gegen eine schuldenbasierte Armeefinanzierung aus. Der VMG hingegen hält dies angesichts der sicherheitspolitischen Lageverschlechterung für gerechtfertigt. Ob so ein Fonds den finanziellen Aufwuchs wirklich beschleunigen würde, ist jedoch nicht sicher, da dagegen ein Referendum ergriffen werden könnte. Die Fonds-Motion dürfte in der Sommersession schon im ständerätlichen Erstrat abgelehnt werden.
Ein solcher Mitte-LinksHandel hätte grössere Erfolgsaussichten, wenn er erst kurz vor der jährlichen Budgetdebatte im Dezember mit dem Plazet der Führungsspitzen aller involvierten Parteien gemacht würde. Jetzt kostet diese Fonds-Idee die SP lediglich ein Lippenbekenntnis zur Armeefinanzierung. Dafür wird der bürgerliche Konsens über eine raschestmögliche Nachrüstung der Armee durch
diese Grundsatzdebatte über die Schuldenbremse belastet. Eine weitere neutralitätspolitische Grundsatzdebatte steht in der Sommersession im Nationalrat bevor, wenn er die SiK-N-Motion behandelt, welche der Armee jede Teilnahme an NATOBündnisfall-Übungen verbieten würde (24.3012n).
Ausgesuchte Geschäfte, kurze Erläuterungen Entschluss
SiK-S am 25. April
BR-Geschäft 24.025s «Armeebotschaft 2024»
Mo. 24.3467s «Schaffung eines Bundesgesetzes über einen ausserordentlichen Beitrag für die Sicherheit der Schweiz und den Frieden in Europa angesichts des Krieges gegen die Ukraine»
Po. 23.000s «Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz»
Po. 23.3131s «NATO-Kooperation im Verteidigungsbereich verstärken, ohne dem Bündnis beizutreten!»
Mo. 23.4311n «Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Bundesregelung des nationalen polizeilichen Datenaustausches»
Einstimmige Zustimmung zu den Bundesbeschlüssen Ausrichtung bis 2035 + Armeematerial + Immobilienprogramm sowie zum Zahlungsrahmen 2025–2028. Mit 12 zu 1 Enthaltung für das Rüstungsprogramm, mit 7 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen für zusätzlichen Verpflichtungskredit von 660 Mio. CHF für BODLUV. Mit 7 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen für Erhöhung des Ausgabenplafonds auf 29,8 Mrd. CHF (zwecks 1% BIP bis 2030)
Eingereicht von SiK-S mit 8 gegen 5 Stimmen, um die bei 24.025s beantragten Mehrausgaben zu finanzieren → SR
Kenntnisnahme des Postulatsberichts → SR
Kenntnisnahme des Postulatsberichts → SR
Einstimmige Annahme zur Umsetzung der Mo. 18.3592n «Nationaler polizeilicher Datenaustausch»
Abkürzungen: BR = Bundesrat; NR = Nationalrat; SR = Ständerat; SiK = Sicherheitspolitische Kommission; Mo.= Motion; Pa.Iv.= Parlamentarische Initiative
40 BUNDESHAUS
Nächste Instanz
→
DIE DIGITALE ASMZ App Verfügbar im Apple Store und Google Play Website Online lesen auf www.asmz.ch Digital-ArchivDigital Archiv www.asmz.chDigital-Archiv ASMZ-Sammlung Die Abo-Nummer ist ersichtlich auf der Verpackungsfolie und auf der Rechnung oder verlangen Sie diese unter abo@asmz.ch
NIGER
Russische Militärberater und Luftabwehrsysteme im Land
In einer bedeutenden Entwicklung der russisch-nigrischen Beziehungen sind am 10. April 2024 mehrere Dutzend russische Militärberater in der Hauptstadt Niamey eingetroffen. Begleitet wurden sie von Luftabwehrsystemen, darunter das hochmoderne S-400, sowie einer nicht näher bezifferten Anzahl von Bodentruppen zum Schutz der Ausrüstung und des Personals. Insgesamt etwa 100 Personen. Die Ankunft der russischen Kräfte folgt auf ein im Februar unterzeichnetes Militärabkommen zwischen Moskau und Niamey, das eine verstärkte Sicherheitskooperation vorsieht. Niger, ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in der Sahelzone, hatte sich zuletzt zunehmend Russland zugewandt, nachdem die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, auch auf Anraten der Junta in Niamey, ihre Militärpräsenz in der Region reduziert hatte. Laut Angaben des nigrischen Verteidigungsminis-

teriums werden die russischen Militärberater die Streitkräfte des Landes in der Bedienung und Wartung der gelieferten Waffensysteme schulen. Zudem sollen sie bei der Planung und Durchführung von Anti-Terror-Operationen unterstützen. Beobachter sehen in der Entsendung der Russen einen weiteren Schritt Moskaus, seinen Einfluss in Afrika auszubauen und die Vormachtstellung westlicher Staaten zu untergraben. Niger ist ein wichtiger Uranlieferant für die EU, vor allem für Frankreich. Bis 2023 stammten etwa ein Viertel der EU-Uranimporte aus dem Land. Moskau versuchte deshalb schon länger, in Afrika Fuss zu fassen, um damit auch die eigene Vormachtstellung im Uransektor zu festigen. Das Beispiel Niger kann man deshalb als herben Schlag für Frankreichs Atomkraftver-
sorgung bezeichnen, die stark von nigrischem Uran abhängt. Die Reaktionen auf die russische Präsenz fallen insgesamt gemischt aus. Während die nigrische Regierung die Zusammenarbeit als Stärkung der eigenen Sicherheit und Souveränität begrüsst, zeigen sich westliche Diplomaten besorgt. Sie befürchten, dass Russland die Instabilität in der Sahelzone für eigene geopolitische Zwecke ausnutzen könnte. Auch warnen sie vor möglichen Menschenrechtsverletzungen durch russische Kräfte, wie sie in anderen afrikanischen Ländern bereits dokumentiert wurden. Moskau weist diese Vorwürfe zurück und betont den rein defensiven Charakter seines Engagements. Man respektiere die Souveränität Nigers und unterstütze das Land lediglich beim Schutz seiner Bürger und seiner ter-
ritorialen Integrität. Zugleich wirft Russland dem Westen vor, durch seine Interventionen zur Destabilisierung der Region beigetragen zu haben und nun die wachsenden russisch-afrikanischen Beziehungen zu torpedieren. Ungeachtet der Kontroverse dürfte die russische Militärpräsenz in Niger vorerst Bestand haben. Der Putschistenführer von 2023, General Abdourahamane Tianihat, hat deutlich gemacht, dass er die Partnerschaft mit Moskau als Ergänzung, nicht als Ersatz für die Zusammenarbeit mit westlichen Staaten sieht. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass russische Truppen unterdessen auf einem Militärstützpunkt in Niger eingetroffen sind, auf dem auch amerikanische Soldaten stationiert sind. Die USA, die seit 2013 Soldaten in Niger stationiert hat, beginnen nun, ihre Truppen abzuziehen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die verschiedenen Interessen auszubalancieren und die Sicherheitslage in der Sahelzone nachhaltig zu verbessern. Andernfalls droht die Region weiter im Strudel von Terrorismus, organisierter Kriminalität und geopolitischer Rivalität zu versinken. pk
Lagebericht des Befehlshabenden
Laut dem US-Kommandeur in Europa (SACEUR), General Christopher Cavoli, ist Russland nach wie vor eine «chronische Bedrohung» für die Welt. Trotz der massiven Verluste, die Russland bisher im Ukraine-Krieg erlitten hat, ist seine Armee sogar um 15 Prozent grösser, als sie es zum Zeitpunkt des Angriffs war. Dies
liegt vor allem daran, dass Russland seine Mobilisierungsbemühungen verstärkt und neue Rekruten ausbildet. Die Ukraine hat zwar beachtliche Fortschritte gemacht und konnte grosse Gebiete zurückerobern, doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Eine der grössten Herausforderungen ist die Ausbildung ukrainischer Piloten auf modernen Kampfjets wie den F-16. Hier gibt es Schwierigkeiten, da die Piloten zunächst die englische Sprache erlernen müssen, bevor sie mit dem Training beginnen können. Trotz dieser
Hürden zeigt sich die Ukraine entschlossen, den Kampf fortzusetzen. Präsident Wolodimir Selenski hat kürzlich erklärt, dass sein Land bereit sei, den Krieg bis zum Ende durchzustehen, um die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Auch die USA haben ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt und weitere Militärhilfe in Aussicht gestellt. Insgesamt zeigt sich, dass der Krieg in der Ukraine nach wie vor eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten darstellt. «Sowohl die Ukraine als auch ihre Verbündeten
müssen weiterhin entschlossen und ausdauernd sein, um diesen Konflikt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen» schloss der SACEUR. pk

ASMZ 41 06/2024
NATO
«Hier um zu helfen», meint ein russischer Soldat in fliessendem Französisch. Bild: Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger
INTERNATIONALE NACHRICHTEN
Spricht Klartext: Saceur General Christopher Cavoli. Bild: Office of the Secretary of Defense Public Affairs
GEORGIEN
Pulverfass am Kaukasus
Seit Mitte April kommt es in Georgien zu anhaltenden Protesten gegen ein umstrittenes Gesetz über «ausländische Einflussnahme». Das von der Regierungspartei «Georgischer Traum» eingebrachte Gesetz sieht vor, dass Medien und Nichtregierungsorganisationen sich als «ausländische Agenten» registrieren lassen müssen, wenn sie mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten. Kritiker sehen darin eine Anlehnung an ein russisches Gesetz aus dem Jahr 2012, das zur Unterdrückung regierungskritischer Gruppen und Medien genutzt wird. Die Proteste, die vor allem von proeuropäischen Jugendlichen angeführt werden, erreichten am
1. Mai einen neuen Höhepunkt, als das Parlament in zweiter Lesung mit 83 zu 23 Stimmen für das Gesetz stimmte. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis und schwenkten georgische und EU-Flaggen. Es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei, die Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten einsetzte. 63 Demonstranten wurden festgenommen, viele weitere verletzt. Im Parlament selbst spielten sich tumultartige
Szenen ab. Präsidentin Salome Surabischwili legte unterdessen ihr Veto gegen das Gesetz ein. Die Regierungspartei verfügt im Parlament jedoch über die nötige Mehrheit, um dies zu überstimmen. Beobachter befürchten, dass das Gesetz die Bemühungen Georgiens um eine EU-Mitgliedschaft gefährden könnte. Die EU hat die Entwicklungen in Georgien mit Sorge zur Kenntnis genommen. «Das georgische Volk sehnt sich nach einer europäischen Zu-

ISRAEL
Patriot-System wird ausser Dienst gestellt
Nach über 30 Jahren im Dienst der israelischen Luftverteidigung werden die PatriotRaketenabwehrsysteme in den kommenden Monaten ausser Dienst gestellt. Die israelischen Streitkräfte (IDF) gaben Ende April bekannt, dass die alternden amerikanischen Systeme durch fortschrittlichere einheimische Luftverteidigungssysteme wie Iron Dome, Arrow und David’s Sling ersetzt werden. Die PatriotSysteme, die in der israelischen Luftwaffe als «Yahalom» (Hebräisch für «Diamant») bekannt sind, wurden erstmals während des Golfkriegs 1991 eingesetzt, um der Bedrohung durch irakische Scud-Raketen zu begegnen. Obwohl die Patriot-Batterien of-
fiziell im selben Jahr in den israelischen Dienst aufgenommen wurden, gelang ihnen erst 2014 der erste erfolgreiche Abschuss einer Drohne aus dem Gazastreifen. In den letzten Jahren hat Israel erhebliche Fortschritte beim Ausbau seiner Luftverteidigungssysteme und Offensivfähigkeiten gemacht. Das mehrstufige integrierte Luftverteidigungssystem umfasst Iron Dome für Bedrohungen kurzer Reichweite, David’s Sling für Bedrohungen mittlerer Reichweite und Arrow für Bedrohungen ausserhalb der Atmosphäre. Darüber hinaus soll im Jahr 2025 ein Laser-Luftverteidigungssystem eingesetzt werden. Die Entscheidung, die Patriot-Systeme ausser Dienst zu stellen, fällt nur wenige Tage, nachdem die israelischen Systeme und Flugzeuge mit Unterstützung des amerikanischen, französischen, britischen und jordanischen Militärs eine iranische Breitseite von Drohnen und
kunft für sein Land», so die offizielle Wortmeldung. «Georgien steht an einem Scheideweg. Es sollte auf dem Weg nach Europa standhaft bleiben.» Auch die USA äusserten sich besorgt. Das Gesetz ähnele «beunruhigend» dem russischen Vorbild und sei nicht vereinbar mit dem erklärten Ziel Georgiens, der EU beizutreten, hiess es aus dem Aussenministerium. Die Regierung unter «Georgischer Traum», die seit 2012 an der Macht ist, beharrt darauf, mit dem Gesetz lediglich für mehr Transparenz bei der Finanzierung aus dem Ausland sorgen zu wollen. Kritiker halten dies jedoch für vorgeschoben. Sie sehen in dem Gesetz den Versuch, die ehemals sowjetische Republik Georgien wieder stärker an Moskau zu binden. Die Proteste halten unterdessen an. Die Opposition hat zudem eine Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. pk
Raketen abwehren konnten. Dies unterstreicht die Fähigkeiten der einheimischen israelischen Luftverteidigung. Während Israel die Patriot-Systeme ausrangiert, ist die Nachfrage nach ihnen in anderen Teilen der Welt nach wie vor hoch. Insbesondere die Ukraine hat grosses Interesse an der Beschaffung von Patriot bekundet, um sich gegen die anhaltende russische Aggression zu verteidigen. Experten argumentieren deshalb, dass Israel gut daran täte, seine ausgemusterten Patriot-Batterien an die
Ukraine zu übergeben, anstatt sie einzumotten. Mit der Ausserdienststellung geht eine Ära der israelischen Luftverteidigung zu Ende. Gleichzeitig markiert dieser Schritt den Beginn eines neuen Kapitels, in dem hochmoderne einheimische Systeme die Hauptlast der Verteidigung des israelischen Luftraums tragen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Systeme in zukünftigen Konflikten bewähren werden, aber die jüngsten Erfolge bei der Abwehr iranischer Angriffe stimmen zuversichtlich. pk

42 INTERNATIONALE NACHRICHTEN
Ein israelischer Patriot-Werfer. Bild: IDF
Volksaufstand in Tiflis. Bild: X/Twitter
DEUTSCHLAND
Bundeswehr erhält zentrales Führungskommando
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am 4. April 2024 eine umfassende Strukturreform der Bundeswehr vorgestellt, die auf den Vorschlägen der Projektgruppe «Bundeswehr» unter Aufsicht des Generalinspekteurs basiert. Die Reform zielt darauf ab, die Streitkräfte an die veränderte Bedrohungslage durch Russlands Angriff auf die Ukraine anzupassen und die Kriegstüchtigkeit sowie Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu verbessern. Ein zentraler Punkt der Reform ist die Neuaufstellung des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr, das durch die Zusammenlegung des Territorialen Führungskommandos in Berlin und des Einsatzführungskommandos in Potsdam entsteht. Das neue Kommando soll als einzige Operationszentrale für alle Bundeswehraktivitäten dienen und ein gemeinsames Lagebild zur Führung und Entscheidungsfindung bereitstellen. Es wird auch die zentrale Ansprechstelle für operative Belange für Verbündete, multinationale Organisationen und deutsche Behörden sein. Die Fusion der beiden bisherigen Kommandos soll bis Herbst 2024 abgeschlossen sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gründung eines Unterstützungsbereichs, der knappe Schlüsselfähigkeiten bündelt und flexibel einsetzt. Unter der Leitung eines neuen Unterstützungskommandos werden die bisher eigenständigen Organisationsbereiche Streitkräftebasis und Zentraler Sanitätsdienst zusammengeführt. Hier werden unter anderem die Gesundheitsversorgung, Logistik, Feldjägerwesen und zivil-mili-

tärische Kooperation verortet. Durch die Bündelung dieser operationsentscheidenden Fähigkeiten sollen die Streitkräfte entlastet und auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentriert werden. Die Reform sieht auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Streitkräften und Wehrverwaltung vor, insbesondere in den Bereichen Personal, Material und Infrastruktur. Die gesamte Bundeswehr muss sich auf den Bündnis- und Verteidigungsfall ausrichten, was bedeutet, dass auch die Wehrverwaltung Vorsorge für die Gesamtverteidigung treffen muss. Die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien legen die Rollen und Aufgaben der Akteure in der Operationsführung fest, reduzieren Schnittstellen und beschleunigen Entscheidungswege. Ein Abbau von Kopf- und Kommandolastigkeit soll die unteren taktischen Ebenen stärken. Das Leitprinzip der Kriegstüchtigkeit steht im Mittelpunkt der Feinplanung. Generalinspekteur Carsten Breuer betont die Notwendigkeit, stark eingeschränkte Ressourcen wie Feldjäger, ABC-Abwehrtruppe, Logistik und Sanität in allen Teilstreitkräften verfügbar zu machen, um die Kampfkraft zu gewährleisten. Die Verantwortung dafür soll beim Generalinspekteur liegen und nicht bei einer einzelnen Teilstreitkraft. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Erlass zur
vollständigen Strukturreform Ende April im Osnabrücker Rathaus unterzeichnet. Dieser «Osnabrücker Erlass», der als Kernstück der geplanten Bundeswehr-Reform gilt, trat am
1. Mai in Kraft und löste den vorherigen «Dresdner Erlass» aus dem Jahr 2012 ab. Die Umsetzung der Reform wird in den kommenden Monaten und Jahren erfolgen. pk

ASMZ 43 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Verteidigungsminister Boris Pistorius reformiert die Bundeswehr. Quelle: Bundesministerium der Verteidigung
ANZEIGE
TAIWAN
Spannungen mit China nehmen weiter zu
Die Beziehungen zwischen China und Taiwan bleiben äusserst angespannt. Seit der Wahl des China-kritischen Präsidenten Lai Ching-te in Taiwan im Januar 2024 hat Peking den militärischen und politischen Druck auf die Inselrepublik nochmals erhöht. Bereits im April, kurz nach einem Besuch einer hochrangigen US-Delegation in Taiwan, entsandte China Dutzende Kampfjets in die Taiwanstrasse. Taiwans Ver-
teidigungsministerium meldete 22 chinesische Militärflugzeuge, von denen 12 die Mittellinie in der Meerenge überquerten. Taipeh verurteilte die Manöver als Provokation. Anfang Mai, unmittelbar nach Lais Amtseinführung, startete China erneut grossangelegte Militärübungen rund um Taiwan. Laut Chinas Militärbehörde sollten diese eine «ernste Warnung an Taiwans Separatisten» senden. Taiwan versetzte seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Derweil sicherten die USA Taiwan weiterhin Unterstützung zu. Eine parteiübergreifende Delegation des US-Kongresses besuchte Ende April die Insel und bekräftigte das Bekennt-
nis Washingtons, Taiwans Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Der Kongress bewilligte zudem 300 Millionen Dollar an Militärhilfen für Taiwan. Neben den Militärmanövern setzt China auch auf Desinformationskampagnen, um die öffentliche Meinung in Taiwan und den USA zu beeinflussen. Dabei nutzt Peking vermehrt KI-gestützte Methoden, unter anderem auch «Deep Fake»-Videos, um die Meinungen in der westlichen Welt, vor allem aber in den USA, zu beeinflussen. Taiwan versucht, dem mit eigenen KI-Tools zur Aufdeckung von Falschinformationen entgegenzuwirken. Selbst eine humanitäre Krise konnte die Spannungen
nicht überbrücken: Nach einem schweren Erdbeben in Taiwan im April bot China Hilfe an, knüpfte diese aber an politische Bedingungen. Die Regierung in Taipeh lehnte dies als «unangemessen» ab und betonte, ausreichend eigene Ressourcen zu haben. So kann man leicht erahnen, dass sich der Taiwan-Konflikt zu einer der gefährlichsten Krisen weltweit entwickelt. Zwar beteuern sowohl Peking als auch Washington, an einer friedlichen Lösung interessiert zu sein. Doch die zunehmenden Provokationen auf beiden Seiten bergen die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation. pk
SÜDCHINESISCHES MEER
Spannungen wegen gestrandetem Landungsschiff
Das südchinesische Meer, eine Region reich an maritimen Ressourcen und potenziellen Energiereserven, ist seit Langem ein Brennpunkt für Spannungen zwischen Ländern wie China, den Philippinen, Malaysia, Vietnam und Brunei. Inmitten der verschiedenen Streitigkeiten hat sich die Pattsituation um die BRP Sierra Madre, ein alterndes Schiff aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als bedeutender Konfliktherd herauskristallisiert. Die «Sierra Madre», ein 30 Meter langes Schiff, das in den USA gebaut und dort als Landungsschiff in Dienst gestellt worden ist, ist seit 1999 auf der Second Thomas Shoal, einem versunkenen Riff im südchinesischen Meer, gestrandet. Die Philippinen – denen das Panzerlandungsschiff zuletzt gehörte – platzierten es absichtlich dort, um ihre territorialen Ansprüche auf die grössten-
teils unbewohnten Spratly-Inseln zu untermauern. In den letzten Jahren hat China seine maritimen Aktivitäten in dieser Region verstärkt und Küstenwache- und Marineschiffe eingesetzt, um seine Souveränität zu behaupten. Dieser Schlagabtausch unterstreicht nicht nur die strategische Bedeutung des Gebiets, sondern auch die geopolitischen Ambitionen der beteiligten Parteien. Jüngste Berichte, die sich auf Schiffsverfolgungsdaten und Videos stützen, zeigen, dass chinesische Schiffe wiederholt mit philippinischen Versorgungsschiffen zusammengestossen sind und Wasserwerfer und militärische Laser gegen sie eingesetzt haben. Obwohl China die «Sierra Madre» nicht blockiert und die Versorgung des dort stationierten Personals mit Lebensmitteln und Wasser zuliess, ging China proaktiv vor, um die Versorgung des philippinischen Schiffes mit Baumaterial zu unterbinden. Die Bedeutung der «Sierra Madre» geht über die territorialen Ansprüche der Philippinen hinaus. Das südchinesische Meer ist eine umstrittene Region, in der Länder seit Langem konkur-

rierende Ansprüche auf Inseln und ihre umliegenden Gewässer erheben. Eine ausschliessliche Wirtschaftszone erstreckt sich 200 Seemeilen (370 km) über das Hoheitsgebiet einer Nation hinaus und gewährt einem Küstenstaat die Gerichtsbarkeit über lebende und nicht lebende Ressourcen innerhalb dieses Gebiets. Die USA, die die Philippinen als wichtigen strategischen Verbündeten betrachten, haben ihre Unterstützung für das Land zum Ausdruck gebracht und sich auf neue Richtlinien für einen Verteidigungsvertrag von 1951 geeinigt. Diese Richtlinien besagen nun, dass ein bewaffneter Angriff auf öffentliche Schiffe, Flugzeuge oder Streitkräfte einer der beiden Parteien, einschliesslich ihrer Küstenwa-
chen, im Pazifik, einschliesslich des südchinesischen Meeres, die gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen gemäss Artikel IV und V des Vertrags über gegenseitige Verteidigung zwischen den USA und den Philippinen von 1951 auslösen würde. Die anhaltenden Spannungen an der Second Thomas Shoal unterstreichen die Notwendigkeit eines facettenreichen Ansatzes zur Konfliktlösung. Dazu gehört die Anerkennung der legitimen Ansprüche und Interessen aller beteiligten Parteien, die Förderung von Dialog und Vertrauensbildung sowie die Entwicklung eines Rahmens für die gemeinsame Bewirtschaftung und Nutzung der Ressourcen. Eine nachhaltige Lösung scheint derzeit aber in weiter Ferne. pk
INTERNATIONALE NACHRICHTEN 44
Das Pièce de résistance, die BRP Sierra Madre. Bild: US Naval Institute
Der Veranstaltungskalender der Schweizer Offiziersgesellschaften
Beiträge für die AugustNummer bis Do, 11. Juli 2024, bei Oblt Erdal Öztas, Gönhardweg 4, 5000 Aarau. EMail: sog.und.sektionen@asmz.ch www.asmz.ch/sogsektionen
AARGAU
Sa, 15. Juni. Mil Hist Anlass: Sonderführung Festung Magletsch. OG Aarau. Fr, 21. Juni, 18 bis 22.30 Uhr, Schiessanlage Lenzhard (SAL). 17. Obligatorisches 25 m der OGL, anschliessend Apéro. OG Lenzburg.
Sa, 22. Juni, Bärenhöhle Suhr. 10 000Rittertag. Reitsektion Arizona. Sa, 22. Juni, 13 bis 18 Uhr, Schützenhaus Neuenhof. Pistolenwettschiessen. OG Baden.
Do, 4. Juli, 19 bis 23 Uhr, Baden. GrillStamm. OG Baden.
Fr bis Sa, 5. bis 6. Juli, StOÜbPl Bruchsal, Baden-Württemberg (D). Internationaler Schiesswettbewerb ISW –50. (Jubiläums)Ausgabe.
Fricktalische OG.
Mi, 10. Juli, 18.30 Uhr, Restaurant Feldschlösschen, Feldschlösschenstrasse 32, 4310 Rheinfelden. SommerRapport. Fricktalische OG.
BERN
Sa, 1. Juni, 17 Uhr, Restaurant Schützen, Steffisburg. OGStamm. OG Thun. Ve à sa, 7 à 8 juin. Courses de Bienne. OG Biel/Bienne-Seeland.
Fr bis Sa, 7. bis 8. Juni. Bieler Lauftage. OG Biel/Bienne-Seeland.
Do, 20. Juni, 18 bis 19 Uhr, Pistolenstand Huttwil 25-m-Anlage. OG Huttwil «PistolenCup» mit Damen & UOV: «Bundesstich» Obligatorisches Programm. OG Huttwil und Umgebung. Do bis So, 20. bis 23. Juni, Schiessenlage Guntelsey, Thun. 10. Internationales OG Thun Wettschiessen. OG Thun. Sa, 22. Juni. Frühlingsanlass mit OG Langenthal: «Bushcraft mit KSK». OG Huttwil und Umgebung.
Mo, 24. Juni. Referat von Oberstlt Lukas Rechsteiner: «Einsätze der Luftwaffe: Schweizer Helikopter im Ausland». OG der Stadt Bern.
Fr bis Sa, 5. bis 6. Juli, Bruchsal, Karlsruhe (D). Internationaler Schiesswettbewerb bei der Bundeswehr (ISW). OG der Stadt Bern.
FREIBURG
So, 23. Juni. Murtenschiessen; traditionelle Munitionsausgabe durch unsere Sektion, Umzug aufs «Bodenmünzi», Feldgottesdienst, anschliessend Frühschoppen. OG Seebezirk.
GRAUBÜNDEN
Do, 13. Juni, 17.30 Uhr, Schiessanlage Rossboden, Chur. BOG@KULTUR: Traditionelles Pistolenschiessen mit anschliessender Grillade. Bündner OG. Sa, 22. Juni, 14 Uhr. BOG@KULTUR: «190 Jahre BOG», Sonderanlass für alle Generationen. Bündner OG.
NIDWALDEN
Fr, 14. Juni. Überraschungsanlass. OG Nidwalden.
Do, 27. Juni. OG Fischessen. OG Nidwalden.
SOLOTHURN
Mo, 24. Juni, Rm Ter Div 2. Besuch takt Mob U. OG Grenchen und Umgebung.
ST. GALLEN
Mi, 5. Juni, 18 bis 19.30 Uhr, Bettenauer Weiher, Oberuzwil. Pist Training Juni. OG Fürstenland.
Sa, 8. Juni, ab 15.30 Uhr, Rm Toggenburg. OGT Triathlon. OG Toggenburg.
Sa, 8. Juni, Herisau. OG Motorradtour «Innerschweiz». OG Rorschach.
Mi, 12. Juni, 17 Uhr, Schiessanlage Witen, Goldach. Endschiessen 25 m, anschliessend Absenden im tbd (alle Mitglieder willkommen). OG Rorschach.
Sa, 29. Juni, Guschaturm St. Luzisteig. Familienanlass «U GUSCHATURM», Wanderung und Bogenschiessen Grillevent. OG Werdenberg.
Mi, 3. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, Bettenauer Weiher, Oberuzwil. Pist Training Juli. OG Fürstenland.
THURGAU
Sa bis So, 29. bis 30. Juni, 16 bis 9 Uhr, Rm Tägerwilen. FamilienBiwak mit InfanteriebunkerBesichtigung. OG Bodensee.
ZÜRICH
Sa, 1. Juni, ganztags, Rm Waldegg/Zürich. Exkursion mit Br Daniel Lätsch zum Thema: «2. Weltkrieg im Gelände – die Stellungen der F Div 6 im Rm Waldegg/ Zürich». OG Zürcher Oberland. Do, 13. Juni, 18 Uhr, Tegital, Waffenplatz Kloten. Pistolenschiessen (Präz+Gefm S). OG Zürcher Unterland. Do, 20. Juni, 18.30 Uhr, Militärflugplatz, 6032 Emmen. Referat von Oberst i Gst Dubs: «Drohnen Kommando 84». OG Zürcher Unterland.
Di, 25. Juni. AOG Stamm. AOG Zürich und Umgebung.
Mi, 3. Juli, 13.30 bis 16 Uhr, Langnau am Albis. Sommeranlass: Besuch Entlastungsstollen SihlZürichsee (Tpt 1. Stock des Bacher Garten-Centers, Spinnereistrasse 3, Anmeldung erforderlich). OG Zürichsee linkes Ufer.
Sa, 6. Juli. AOG Pistolenschiessen (mit Partnern/Innen). AOG Zürich und Umgebung.
FACHSEKTIONEN
Do, 6. Juni, 17.30 Uhr, Pistolenstand Teufmoos, Hergiswil NW. Pistolenschiessen und Grillabend. SOLOG Sektion Zentralschweiz.
Do, 6. Juni, ab 18 Uhr, Clouds, Prime Tower Zürich. Kadertisch Zürich. OG Panzer.
Do, 6. Juni, ab 19 Uhr, Oliver Twist Pub, Zürich. AVIA Beer Call. AVIA Sektion Zürich.
Fr bis So, 7. bis 9. Juni, Berlin. Reise an die ILA. AVIA Flieger-Sektion Luzern.
Sa, 8. Juni, 8.30 bis 18 Uhr, KD-Anlage Tegital b. Kloten. Traditionelles Tegitalschiessen, Präzision & dynamisch, inkl. anschliessendem Grill’n’Chill. AVIA Sektion Zürich.
Sa, 8. Juni, Zürich. Besuch beim Schweizer Radio und Fernsehen. SOLOG Sektion Ostschweiz.
Mi, 12. Juni, 18 Uhr, Spl Gehren, Erlinsbach. Schiessanlass. AVIA Sektion Aargau.
Do, 13. Juni, Lausanne. Netzwerkanlass 2024. Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie.
Do, 20. Juni, Zürich. Netzwerkanlass 2024. Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie.
Fr, 21. Juni, Walenstadt. Combat Training. Kadervereinigung Spezialkräfte.
Sa, 22. Juni, ganztags, Schiessplatz Altmatt, Rothenthurm. Schiesstraining und gemeinsames Grillieren. AVIA Flab-Sektion Zentralschweiz.
Sa, 22. Juni, 9.30 Uhr, Lausanne. Generalversammlung Zentral AVIA mit Referat und anschliessendem Apéro riche. AVIA Sektion Zürich.
Sa, 22. Juni, Raum Westschweiz. Generalversammlung AVIA Luftwaffe. AVIA Flieger-Sektion Luzern. Sa, 22. Juni, AQUATIS Hotel, Lausanne. Generalversammlung. AVIA Luftwaffe. Mo, 24. Juni. Referat von Oberstlt Lukas Rechsteiner: «Einsätze der Luftwaffe: Schweizer Helikopter im Ausland». AVIA Sektion Bern.
Mi, 26. Juni, ab 11.30 Uhr, Restaurant Holding, Fliegermuseum Dübendorf. AVIA Stamm. (Anmeldung via pstcky@ spiderweb.ch) AVIA Sektion Zürich.
Mi und Sa, 26. und 29. Juni, Spl Mussi, Sempach. 102. Historisches Sempacherschiessen. SOLOG Sektion Zentralschweiz.
Sa, 29. Juni, 12 Uhr. Schlacht bei Sempach: Standartenweihe der SOLOG Zentralschweiz gemäss Einladung. SOLOG Sektion Zentralschweiz.
Do, 4. Juli, Bern. Netzwerkanlass 2024. Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie.
Fr bis Sa, 5. bis 6. Juli, Bruchsal, Karlsruhe (D). Internationaler Schiesswettbewerb bei der Bundeswehr (ISW). AVIA Sektion Bern.
Fr, 19. Juli, Lugano. Netzwerkanlass 2024. Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie.
Der Veranstaltungskalender erscheint in der gedruckten Ausgabe zweimonatlich. Aktuelles und Daten der Stämme finden Sie unter: www.asmz.ch, Rubrik «Agenda». Die Adressen der kantonalen OGs sowie aller Sektionen sind unter www.asmz.ch, Rubrik «SOG & Sektionen» zu finden.
SOG UND SEKTIONEN ASMZ 45
Aktuelles auf www.asmz.ch Auf der Website der ASMZ finden Sie laufend aktuell aufbereitete Nachrichten –die ideale Ergänzung zur monatlichen Printausgabe der ASMZ.
Offertanfrage für BODLUV-Systeme mittlerer Reichweite
Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat die Offertanfrage für neue Systeme der bodengestützten Luftverteidigung mittlerer Reichweite (BODLUV MR) an drei Herstellerfirmen übergeben. Die Erneuerung soll eine bestehende Sicherheitsund Fähigkeitslücke schliessen. Aktuell im Einsatz stehende Systeme erreichen bald ihr Nutzungsende. Zudem haben die bestehenden Systeme des Typs Stinger und Mittlere Fliegerab-
wehr (M Flab) nur sehr kurze Reichweiten – moderne Kampfflugzeuge setzen ihre Waffen aus grösseren Höhen und Distanzen ein. Angefragt worden sind Diehl Defence (Deutschland), Kongsberg (Norwegen) / Raytheon (USA) sowie MBDA (Frankreich). Diese Hersteller werden gebeten, ein passendes System anzubieten. Dabei muss es sich um Systeme handeln, welche bereits erfolgreich im Einsatz stehen. Die Auswahl der
Herstellerfirmen beruht einerseits auf einer aktuellen Marktbeobachtung. Andererseits wurden für die Auswahl auch übergeordnete Kriterien in Abhängigkeit des Herstellerlandes berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere das Kooperationspotenzial in verschiedenen Bereichen wie der Ausbildung, des Trainings und der Instandhaltung. Dem Einbezug der Schweizer Industrie kommt ein besonderer Stellenwert zu.
Armasuisse erwartet den Eingang der Offerten der Herstellerfirmen bis Mitte Juli 2024. Der Typenentscheid ist im dritten Quartal 2024 geplant. Die Planung ist auf eine Aufnahme der Beschaffung in die Armeebotschaft 2025 ausgerichtet. Die Teilnahme an der European Sky Shield Initiative nimmt den Typenentscheid nicht vorweg, zumal sie nationale Zuständigkeiten in der Beschaffung nicht tangiert. Armasuisse
Schaffhauser Offiziere fordern intakte Verteidigungsfähigkeit
Der Austragungsort der diesjährigen Generalversammlung der Kantonalen Offiziersgesellschaft Schaffhausen im Kantonsratssaal war nicht nur aufgrund der architektonischen Ästhetik passend, sondern auch inhaltlich angemessen. Die statutarischen Geschäfte wurden durch den Präsidenten, Major i Gst Philipp Zumbühl, speditiv abgehandelt. Als neues Vorstandsmitglied wurde Major i Gst Nicola Jacky gewählt. Im Vordergrund des Anlasses stand die aktuelle Sicherheitslage. Dies verdeutlichte schon der erste Redner, welcher aus Ankara zugeschaltet wurde. Verteidigungsattaché Oberst i Gst Dieter Wicki ist akkreditiert für die Türkei, Georgien und Aser-
baidschan. Er verdeutlichte die Wichtigkeit seiner Funktion für den Austausch und den Dialog mit seinen Pendants anderer Länder. Die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit unterstrich anschliessend Brigadier Thomas A. Frey, Kommandant des Lehrverbandes Führungsunterstützung. Er präsentierte unter anderem die drei übergeordneten Ziele des Chefs der Armee. Nebst der adaptiven Weiterentwicklung der Fähigkeiten soll die Schweizer Armee ebenso die Chancen der Technologien nutzen. Zudem soll die internationale Zusammenarbeit intensiviert werden. Während sich hierzulande die Budgetdiskussionen um 1 Prozent des BIP drehten, investiere

Der Präsident der KOG Schaffhausen, Major i Gst Philipp Zumbühl, kündigt Gastredner Brigadier Thomas A. Frey, Kommandant des Lehrverbandes Führungsunterstützung, an. Bild: KOG SH
Russland 30 Prozent in die Rüstung, führte Frey aus. Experten rechneten mit sechs bis acht Jahren, bis Russland materiell bereit sei, noch tiefer in Europa einzudringen. Aktuell könne in der Schweiz knapp eine Brigade vollständig ausgerüstet werden. «Eigentlich müssen wir nicht die Verteidigungsfähigkeit stärken, sondern erreichen», betonte Frey. Christoph Merki
Divisionär Brülisauer sprach vor den Glarner Offizieren
In seinem Jahresrückblick legte Major Hans Jörg Riem, Präsident der Glarner Offiziersgesellschaft (GOG), das Schwergewicht auf die Bedürfnisse der Armee, damit sie ihren Auftrag, die Schweiz und deren Bewohner zu schützen, minimal erfüllen kann. Nach 22 Jahren im GOG-Vorstand ist Oberst Jürg Feldmann zurückgetreten. Als neues Mitglied wurde Leutnant Valentin Lütschg gewählt. Die aktuelle Weltlage ist für Gastredner Divisionär Willy Brülisauer, Kommandant Territorialdivision 4, eine globale Multikrise, deren Treiber unter anderem das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel, die Alterspyramide und auch die künstliche Intelligenz sind.
In westlichen Ländern werde in den nächsten Jahren mit einem Angriff der russischen Armee gerechnet und entsprechend die eigene Armee grosszügig ausgebaut. Im Ukraine- wie im Gaza-Krieg kämen autonome Waffensysteme wie zum Beispiel Drohnen mit künstlicher Intelligenz als «Sensor-Nachrichtendienst-Führungs-Wirkungsverbund» zum Einsatz. Dieser Verbund erlaube es, einen Wissens- und Entscheidungsvorsprung für schnellere nächste Handlungen zu erlangen. Bezogen auf die Schweizer Armee gilt es laut Brülisauer, technologische Fortschritte zu nutzen.
Jürg Feldmann
VERMISCHTES 46
Zivildienstler sollen Zivilschützer helfen müssen
Der Zivilschutz ist mit Unterbeständen konfrontiert. Während die nationale Zielgrösse vor rund zehn Jahren auf 72 000 Zivilschutzangehörige festgelegt wurde, lag der tatsächliche IstBestand Anfang 2024 bei 60 000 (davon 2600 im Personalpool eingeteilt). Bei rund 4000 neurekrutierten Zivilschutzangehörigen pro Jahr ist davon auszugehen, dass der Ist-Bestand bis 2030 noch bei rund 50 000 Zivilschutzangehörigen liegen wird. Werden keine Massnahmen zur Verbesserung der Bestände im Zivilschutz ergriffen, führt dies zu einem Leistungsabbau beim Zivilschutz. Mit der Botschaft zur Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes, die der Bundesrat an seiner Sitzung vom 8. Mai 2024 zuhanden des Parlaments verabschiedet
hat, werden Erkenntnisse aus dem ersten Teil des Berichtes zur Alimentierung von Armee und Zivilschutz umgesetzt. Die Botschaft sieht nun eine Ausweitung der Schutzdienstpflicht vor: Militärdienstpflichtige, die bis zum 25. Altersjahr keine Rekrutenschule absolviert haben und aus der Armee entlassen werden, sollen neu schutzdienstpflichtig werden. Auch ehemalige Armeeangehörige, die ihre Rekrutenschule vollständig absolviert haben und militärdienstuntauglich werden, sollen künftig schutzdienstpflichtig werden, sofern sie noch mindestens 80 Diensttage zu leisten hätten. Weiter wird das Wohnsitzprinzip im Zivilschutz aufgehoben. So können Schutzdienstpflichtige aus Kantonen mit einem Über-
bestand in Kantonen mit einem Unterbestand eingeteilt werden. Schutzdienstpflichtige müssen zudem neu innert zwei Jahren ab Rekrutierung die Grundausbildung beginnen. Zivilschutzorganisationen in Kantonen mit einem Unterbestand im Zivilschutz sollen neu als Einsatzbetriebe des Zivildienstes anerkannt werden. Sind sämtliche Mittel des Zivilschutzes zur Behebung des Unterbestands ausgeschöpft, können zivildienstpflichtige Personen verpflichtet werden, in einer solchen Zivilschutzorganisation vorrangig maximal 80 Tage ihrer Zivildienstpflicht zu leisten. Die zivildienstpflichtigen Personen werden dabei nicht der Schutzdienstpflicht unterstellt. Sie unterstehen weiterhin der Zivildienstgesetzgebung. Sie absolvieren die reguläre Grundausbildung des Zivilschutzes und können auch an Zusatz- und Kaderausbildungen teilnehmen. Im Weiteren absolvieren sie Wiederholungskurse und können für Einsätze im Ereignisfall aufgeboten werden. Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass die Bestimmungen betreffend die Verpflichtung von zivildienstpflichtigen Personen im Zivilschutz auf politischen Widerstand stossen könnten. Die Gesetzesrevision wird daher auf eine Vorlage zu zivildienstpflichtigen Personen und eine Vorlage für die übrigen Neuerungen aufgeteilt, damit im Falle eines Referendums die nicht umstrittenen Teile der Revision nicht verzögert oder abgelehnt werden. BABS
Bodenseekongress widmete sich dem Ukraine-Krieg
Am 13. April fand unter dem Titel «Der Ukraine-Krieg und seine Folgen für Europa – militärisch, politisch und ökonomisch» der 10. Bodenseekongress in Friedrichshafen statt, welcher von sicherheitspolitischen und militärischen Organisationen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgeführt wurde. Generalleutnant Bruno Hofbauer, Stellvertretender Chef des österreichischen Generalstabes, stellte nach der Präsentation der Lage in der Ukraine fest, dass mechanisierte Kräfte, bodengestützte Luftverteidigung, Panzerabwehr, Artillerie und Genie eine Renaissance erlebten. Drohnen seien unverzichtbares Element für Aufklärung, Führung und Kampfeinsätze. Digitalisierung, rasche, korrekte Erstellung und Verbreitung eines zutreffenden
Lagebildes sei zentral. Nukleare Bedrohung sei anhaltend aktuell. Laut Hofbauer ergeben sich folgende Konsequenzen: Die Taktiken der russischen Streitkräfte hätten sich nicht substantiell verändert; Drohnen seien entscheidend; der Bereich Cyber sei zentral und das «gläserne Gefechtsfeld» Realität geworden. Zu den wichtigen strategischen Folgen zählte Hofbauer die Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, wie die längere direkte Grenze der NATO mit Russland. Traditionelle militärische Bedrohungen seien nicht verschwunden, sie würden im Gegenteil durch neue Mittel verstärkt.
Dr. habil. Markus Kern, Stiftung Wissenschaft und Politik, betonte den Bedeutungsgewinn
der NATO, die Prioritätensetzung auf Rückversicherung und Abschreckung und die Ausweitung auf Schweden und Finnland. Die USA führten prioritär den systemischen Konflikt mit China, der Krieg in der Ukraine habe zu einer temporären Rückkehr der USA nach Europa geführt. Europa sei in einer geopolitisierten Welt aufgewacht, diese verlange grössere Handlungsfähigkeit im Bereich der Aussen- und Sicherheitspolitik. Europa müsse innerhalb der NATO eine eigenständige Rolle in Absprache mit den USA übernehmen. In den Köpfen habe eine Zeitenwende stattgefunden; Russland werde als Bedrohung wahrgenommen. Diese Wahrnehmung habe 2022 ihren Höhepunkt erreicht und nehme wieder ab; es bestünde das Risiko, dass die Sehnsucht nach dem «status quo ante» wieder stärker werde.
Prof. Dr. Andreas Müller, Universität Basel, diskutierte Fragen von Wirtschaftssanktionen, Energieabhängigkeit aus Russland, Störungen der Lieferketten, Zunahme ukrainischer Flüchtlinge, bilaterale Hilfe an die Ukraine und die Ausgaben für Streitkräfte. Wirtschaftlich stehen nach Müller folgende Risiken und Herausforderungen im Vordergrund: Ausweitung des Krieges auf die NATO, Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA; mögliche zusätzliche Schocks; Koordination bezüglich Verteidigungs- und Rüstungsausgaben auf europäischer Ebene und mit NATO-Staaten und bessere Abwägung von Vorteilen der militärischen Spezialisierung auf europäischer Ebene und den nationalen Interessen. RSB
ASMZ 47 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
Wechsel an der Spitze der Höheren Kaderausbildung



Divisionär Germaine J. F. Seewer, seit Anfang 2020 Kommandantin Höhere Kaderausbildung der Armee/Stellvertreterin Chef Kommando Ausbildung, wird per 1. August 2024 Chefin Internationale Beziehungen Verteidigung. Die 60-Jährige leistete 2000/2001 einen Einsatz als Stabsoffizierin bei der Swisscoy im Kosovo und 2004 als UN-Militärbeobachterin Äthiopien und Eritrea. Ab 2004 wurde sie Chefin Operationen und Stellvertreterin Chef Missionen im Kompetenzzentrum für Friedensförderung Swissint. 2007 erfolgte der Übertritt ins Instruktionskorps der Schweizer Luftwaffe, wo sie ab 2008 als Kommandantin der Führungsunterstützungsschulen der Luftwaffe und ab 2010 als Chefin Ausbildung Luftwaffe und Stellvertreterin des Chefs Luftwaffenstab tätig war. Per 1. Juli 2018 übernahm sie das Kommando der Führungsunterstützungsbrigade 41/SKS. Seewers Nachfolge tritt Divisionär René Wellinger, seit Anfang 2018 Kommandant Heer, an. Der 57-Jährige trat 1992 in das Instruktionskorps der Artillerie ein. Ab 2004 war er Stabschef des Kommandanten der Höheren Kaderausbildung der Armee und ab 2008 Stabschef des Stellvertreters des Chefs der Armee. Am 1. Juli 2012 wurde er Kommandant der Panzerbrigade 11 und ab 2014 Kommandant des Lehrverbandes Panzer/ Artillerie. Die Nachfolge für die Funktion Kommandant Heer wird dem Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt beantragt. Brigadier Hans-Jakob Reichen, zurzeit Stabschef Kommando Operationen, wird per 1. Au-

Von links: Div Germaine J. F. Seewer, Div René Wellinger, Br Hans-Jakob Reichen, Oberst i Gst Christian Arioli. Bilder: VBS
gust 2024 Zugeteilter Höherer Stabsoffizier Chef der Armee. Der 50-Jährige trat 1997 in das Instruktionskorps der Artillerie ein. Per 1. September 2016 wurde Reichen zum Kommandanten der Artillerieschulen 31 ernannt, bevor er ab 1. Januar 2020 die Funktion als Kommandant Waffenplatz Bière/Artillerie Ausbildungszentrum übernahm. Ab 1. September 2021 war er in der operativen Schulung als Stellvertreter / Chef Militärstrategische Schulung tätig. Per 1. April 2022 wurde er zum Stabschef Kommando Operationen ernannt. Oberst i Gst Christian Arioli, seit 2023 Kommandant Kompetenzzentrum ABC-Kamir, wird per 1. August 2024 Stabschef Kommando Operationen, unter gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier. Der 50-Jährige trat 2006 in das Instruktionskorps ein. Per Ende 2009 übernahm er die Funktion als Chef Einsatz des Kompetenzzentrums ABC beziehungsweise ab 2013 zusätzlich die Lehrgangsleitung ABC-Abwehrtruppen. Im Übergang ab dem 1. Januar 2021 war Arioli kurzzeitig als Stabschef und Stellvertreter Kommandant Kompetenzzentrum ABC-Kamir tätig, bevor er per 1. Mai 2021 zum Kommandanten Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere ernannt wurde. Weiter hat der Bundesrat der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses von Divisionär Rolf A. Siegenthaler als Chef Logistikbasis der Armee bis zum 31. Oktober 2027 zugestimmt. Zudem hat der Bundesrat der vorzeitigen Pensionierung von Divisionär Claude Meier per 31. August 2024 zugestimmt. VBS
ECHO AUS DER LESERSCHAFT
Quo vadis, Helvetia?
Zum Bericht «Pflichtabonnement für ASMZ wird abgeschafft» in der ASMZ 4/2024
Die ASMZ-Redaktion liefert hervorragende Qualität und aktuelle Informationen. Ich habe überhaupt kein Verständnis für den Entscheid der SOG-Delegierten, das Pflichtabonnement für die ASMZ abzuschaffen. Bedenklich und abstrus! Als sehr engagierter Staatsbürger und ehemaliger Offizier bin ich zutiefst enttäuscht über die Entwicklungen während der letzten Jahre. Ich war stolz, in einer Armee zu dienen, die glaubwürdig war – auch wenn sie viel Verzicht erforderte. Tempi passati! Unsere Armee von heute ist zur Lachnummer mutiert und bewirbt sich mit der deutschen Bundeswehr und dem österreichischen Bundesheer um die letzten Plätze. Völlig unfähig, unser Land zu verteidigen! So weit haben wie es gebracht! Völlig verunglückte Armeereformen und der naive Friedensglaube der Politik und der Armeeführung haben uns ins Abseits befördert. Es brauchte keine GSoA – die Armee hat sich selbst abgeschafft.
Nun stehen wir – angesichts echter Bedrohungen – in den Unterhosen da: kein gutes Gefühl. Und die «Spitzen der Armee» liefern sich in diesem Umfeld einen Kampf um das SOG-Präsidium – unglaublich – und sie wissen keine bessere Antwort auf die Bedrohungen als die Abschaffung des Pflichtabonnements der ASMZ. Quo vadis, Helvetia? Dazu erinnern Generalstabsoffiziere (ASMZ 4/24) an die «reine Lehre der Armee» – obwohl die missglückten Reformen der Armee gerade von Generalstabsoffizieren zu verantworten sind (einige von ihnen – wohl die intelligentesten – haben sich in der Zwischenzeit davon distanziert). Statt vereint für eine bessere Armee zu kämpfen, macht sich Selbstprofilierung breit! Quo vadis, Helvetia?
Die Armeeführung (CdA und Mitarbeiter) versuchen mutig, Gegensteuer zu geben. Bravo und Danke! Aber unsere Politiker, Parlament und Bundesrat, die die Verfassung (Schutz der Sicherheit und Verteidigung unseres Landes) grobfahrlässig verletzen und die deswegen eigentlich angeklagt gehörten, wenden sich lieber KitaPlätzen, Krankenkassen-Prämienverbilligungen, der 13. AHV-Rente und anderen Hobbys zu. Quo vadis, Helvetia?
Ruedi E. Wäger
Dr. sc. nat. ETH Oberstlt aD Geb Inf 1253 Vandoeuvres
Die Schweiz ist wehrunwillig
Zum Bericht «Nachrüsten der Armee:
Sechs selbstgemachte Probleme …» in der ASMZ 4/2024
Die ASMZ bringt es auf den Punkt. Die Analyse von Michael Arnold ist schnörkellos klar und beängstigend. Die Schweiz ist wehrunwillig, die noch Wehrwilligen unter sich zerstritten. Symptomatisch ist die Abschaffung des ASMZ-Pflichtabos. Die Offiziere berauben sich selbst ihres wichtigsten Kommunikationsmittels. Die Angst, dass 30 oder 45 Franken zu viel für junge Mitglieder gewesen wäre, lässt keine Zweifel am Wertewandel. Ich danke der Redaktion für ihre ausgezeichnete Arbeit. Und ich drücke die Daumen für eine weitere Zukunft der ASMZ.
HansPeter Steffen Maj a D 6417 Sattel
48 VERMISCHTES
Ein Wachruf
Die ASMZ 4/2024 gibt interessante geopolitische und vaterländische Denkanstösse. Bringen wir vorerst etwas Ordnung ins Getriebe. Geopolitisch haben wir drei Staatsformen: Demokratie, Autokratie und die Willkürsysteme des Totalitarismus (China, Russland, Iran). Die Widerstandsfähigkeit von Staat und Gesellschaft basiert auf der eigenen Kultur, Religion und Geschichte. Als Schweizerbürger sind wir stolz auf unsere gelebte direkte Demokratie, die einen Konsens auf den drei Ebenen Gemeinden, Kanton und Bund erfordert. So weit, so gut! Das funktionierte über eine lange Zeit. Alle Departemente, ausser dem VBS, konnten ihre hohen materiellen Ansprüche durchsetzen. Es entwickelte sich dabei ein Silodenken der Departemente und seit dem Mauerfall 1989 vernachlässigte der Bundesrat seine sicherheitspolitische Gesamtverantwortung. Bis er vom russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 jäh aufgeschreckt wurde. Seither ringen wir mit den Konsequenzen der Vernachlässigung unserer Sicherheitspolitik. Aber der Schock des russischen Überfalls sitzt offensichtlich nicht tief, denn die hehre Absicht der Legislative, bis im Jahre 2030 die jährlichen Armeeausgaben von aktuell 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) auf 1 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen, wurde vom Parlament mit 98 zu 97 Stimmen auf 2035 zurückgestellt. Den wirklichen Ausschlag dafür gaben die 10 Stimmen der Mitte zusammen mit ihrem Präsidenten, der seither keine Gelegenheit auslässt, sich vaterländisch zu profilieren! Übrigens – auch Viola Amherd hat im Bundesrat für 2035 votiert. So viel zu unserer famosen Mitte! Aber auch die FDP steht nicht klar hin. Der gute Grund ist, man will seiner eigenen Bundesrätin nicht in den Rücken fallen. Zurzeit ist das Gejammer wegen den Krankenkassenprämien viel lauter. Wie können wir nur der Armee Geld geben, wenn es uns nicht einmal für die Krankenkasse reicht – oder wir auf Ferien auf den Malediven verzichten müssten? Es kommt aber noch ein Punkt dazu, der bisher kaum angesprochen wurde: Die Politiker tun das, was ihnen die Wiederwahl mutmasslich sichert. Wir sind als Volk immer noch nicht erwacht.
Daniel Urech 8753 Mollis
Danke, Kamerad Arnold, für deine klare Position Zu den Berichten «Nachrüsten der Armee: Sechs selbstgemachte Probleme …» und «Gedanken als Generalstabsoffizier zu den verteidigungspolitischen Versäumnissen» in der ASMZ 4/2024 In der ASMZ vom April befasst sich Oberst i Gst a D Michael Arnold mit dem Zustand unserer Armee in zwei Beiträgen. Kamerad Arnold schöpft das Privileg des «Veteranen» voll aus, die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch zu legen: Unserer Nation fehlt der Wehrwille, es fehlt der Gestaltungswille, es fehlt der Wille, den Tatsachen in die Augen zu blicken. Seit zehn Jahren herrscht Krieg in Europa. Das Volk nimmt es nicht wahr – ist weit weg. Die Militärs nehmen es nicht wahr – ist unpopulär. Die Politik nimmt es nicht wahr –die strategischen Fragen sind Gratistampons im Kindergarten und Menstruationsprämien in den Lehrkörpern. Nicht alle fordern das, aber alle machen mit. Eine Zeitenwende tut Not.
Max R. Homberger
Oberst i Gst a D
Bisheriges System mit automatischem Abonnement war zweckmässig
Zum Bericht «Pflichtabonnement für ASMZ wird abgeschafft» in der ASMZ 4/2024
Seit meiner OS anno 1966 bin ich eifriger Leser der ASMZ. Für mich ist diese Publikation – mit Präferenz Printform – eine wichtige, fundierte und kompetente Informationsquelle über militärische Belange aus allen Bereichen. Persönlich war ich damals in der Flugwaffe eingeteilt, als Pilot im Bereich Erdkampf, später als Geschwaderführer, stellvertretender Regimentskommandant und schliesslich C EK in der Einsatzzentrale. Militärisch wurde ich 2004 «pensioniert». Seitdem verfolge ich die militärischen Geschehnisse und Beiträge in der ASMZ mit leider wachsender Besorgnis. Das bisherige System der Mitgliedschaft mit automatischem Abonnement auf die ASMZ fand ich aus meiner Sicht zweckmässig. Was nun zu diesem Thema zu lesen ist, spottet wirklich jeder Beschreibung. Es ist schlicht unfassbar, dass ein kleiner Betrag von 15 Franken den Fortbestand dieser guten und fachkompetenten Zeitschrift gefährden soll. Im Übrigen bin ich mir nicht so sicher, ob die beschriebenen Querelen um das Präsidium überall goutiert werden. Es würde mich nicht erstaunen, wenn das zu noch mehr Austritten führen würde; motivierend wirkt das leider nicht. Aus meiner Sicht ist der Erhalt der ASMZ in adäquater Form prioritär, die Mitgliedschaft ist da sekundär. Es geht mir da nicht ums Stänkern, sondern um eine Stimme aus dem «Fussvolk», die vielleicht mithelfen kann, den Rank wieder zu finden. Die Sache ist zu wichtig – und wird immer wichtiger –, als dass wir uns in der Öffentlichkeit streiten dürften. «Zusammenstehen» muss die Devise sein.
Hans Baer
Oberstlt
a D
Unverständlicher Entscheid der Delegierten
Zum Bericht «Die Zukunft der ASMZ ohne Pflichtabo» in der ASMZ 4/2024
Dieser Entscheid zur Abschaffung des Pflichtabos ist für mich unverständlich, er erfolgt zudem völlig zur Unzeit – ungeschickter geht’s ja wohl nicht! Wie konnte man insbesondere im heutigen sicherheitspolitischen Umfeld nur einen solchen Antrag stellen! Und dass man als Argument eine behauptete Gleichgültigkeit junger Offiziere zur beiläufigen Rechtfertigung beizieht, ist denn doch sehr billig. Selbstverständlich werde ich das Abo weiterhin aufrechterhalten. Als längst pensionierter Major mit Kommando- und Stabsfunktionen in der FF-Truppe, als ehemaliger Chef eines zivilen Bezirksführungsstabes wie auch als gewöhnlicher Staatsbürger brauche und schätze ich die ASMZ zur regelmässigen Lektüre. Ich hoffe, dass sich eine befriedigende Lösung finden lässt.
Hans Möhr lic. iur.
8800 Thalwil
ASMZ 49 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024
alt Kantonsrat Grüne Zürich 8620 Wetzikon
Hans Peter Michel
Die Führungspyramide
Leadership – Erkenntnisse, Erfahrungen, Herausforderungen
Einen etwas anderen Weg als viele andere Werke über Führung beschreitet der Landwirt und Politiker Hans Peter Michel. Im ersten Teil des Buches werden wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Führung analysiert und in Bezug zur Führungspraxis gesetzt, der zweite Teil besteht aus Interviews mit Experten und der dritte Teil bespricht Herausforderungen, die

Somedia Buchverlag, Ennenda/Chur, 2023
ISBN 978-3-7253-1086-9
Markus Pöhlmann
auf Führungskräfte zukommen. Auf witzige Weise führt er in drei zentrale Erkenntnisse ein: dass die Führungsperson von den zu Führenden anerkannt sein muss, dass Führen heisst, Unterstellte so zu beeinflussen, dass gemeinsame Ziele erreicht werden können, und schliesslich dass sich Führungsperson, Geführte und die Situation gegenseitig beeinflussen. In der grundsätzlichen Frage, ob Führung überhaupt notwendig sei, kommt Michel zum Schluss, dass gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter im «Courant normal» kaum Führung (Auftragserteilung) benötigten, wohl aber beim Eintreten von unerwarteten Ereignissen/Krisen.
In komplexen, unberechenbaren Situationen sei aber nicht nur Vernunft und Logik gefordert, sondern auch Erkennen und Zulassen von eigenen und fremden Gefühlen sowie ausreichend Zeit. Basis von Führung sei Fachwissen, auf dem ein von Vernunft geleitetes lern- und kalkulierbares Handwerk auf-
Geheimnis und Sicherheit
Der Aufstieg militärischer
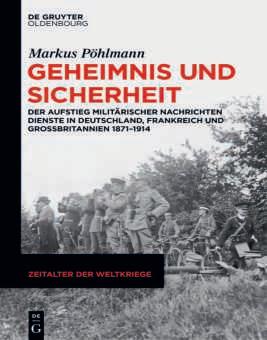
Der Historiker Markus Pöhlmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er nimmt den Leser mit in eine Zeit gewaltiger technologischer Fortschritte, die sich im Militärwesen wie in einem Brennglas bündelten: Beginnend mit dem Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich nahezu alles in den tonangebenden europäischen Heeren und Marinen und kurze Zeit später auch in den neu aufgestellten
baut. Das Erkennen von Risiken und die Bewältigung von Krisen unter Zeitdruck gehören zu den besonderen Herausforderungen der Führung. Neben Vertrauen gehört auch die Übernahme von Verantwortung für Risiken sowohl der Mitarbeitenden als auch bei der Gefährdung der Organisationsziele zu den zentralen Themen der Führung. Michel analysiert weiter Parameter von Veränderungen der zukünftigen Führung wie IT-Revolution, Globalisierung (interkulturelle Kompetenz), demografischer Wandel etc. Wichtige Veränderungen ergeben sich auch aus den unterschiedlichen Wahrnehmungen, Kompetenzen («digital natives») und Ansprüchen jüngerer Generationen, die es nicht nur zu verstehen, sondern auch zu nutzen gelte. Neben Intuition und Flexibilität sei hier zunehmend auch Charisma gefordert. Im zweiten Teil gibt Michel Experten aus Wirtschaft, Politik und Militär das Wort. Zu den Experten gehören unter ande-
rem Benedikt Weibel (CEO SBB 1993−2006), Ulrich Zwygart (Wirtschaftsberater, Divisionär) und Eveline Widmer-Schlumpf (Bundesrätin 2008−2015).
Im Kapitel «Führungspyramide» nimmt Michel die vier den Experten gestellten Fragen wieder auf: die Wechselwirkungen zwischen Führungspersonen und Geführten, die Frage, ob Fachkompetenz die Basis guter Führung sei, ob Führung Handwerk und/oder Kunst sei und schliesslich die Frage, ob Leadership vom Zufall beeinflusst werde. Schliesslich diskutiert Michel die Frage, wie sich Führung in Zukunft verändert. Als wichtige Einflussfaktoren nennt er IT-Revolution, Globalisierung und die notwendige Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen, den demografischen Wandel und die Rahmenbedingungen der Gesellschaft beziehungsweise neuer Generationen.
Ein gut lesbares, erfrischendes Buch auf solider wissenschaftlicher Basis. RSB
Luftstreitkräften. Eine der grossen Herausforderungen war es, in diesen Zeiten den Überblick über das Geschehen zu erlangen. Man antwortete darauf mit dem Aufbau von Nachrichtendiensten. Pöhlmann geht sein Thema von zwei Seiten an: Einerseits beschreibt er die Organisationsebene (Kriegsministerien, Generalstäbe, Dienste), andererseits stellt er acht Einzelfälle heraus, um so am konkreten Beispiel das Handeln der Nachrichtendienste zu erfassen. Er führt spektaku-
läre Einzelbeispiele wie das des «Spionagebetrügers Hendrik Reeser» auf, eines wichtigtuerischen «Selbstanbieters», der Informationen über deutsche Mobilisierungsvorbereitungen (1882) und über die Festung Ingolstadt beschaffen wollte, dies aber so dilettantisch tat, dass er umgehend angezeigt und vor Gericht gestellt wurde und in der Folge unter verschiedenen weiteren Tarnidentitäten erfolglos versuchte, sich sowohl bei den französischen als auch den bayrischen Behörden an-
50 BÜCHER
Nachrichtendienste in Deutschland, Frankreich und Großbritannien 1871−1914
ISBN 978-3-11-138046-9
Walter de Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2024. 256 Seiten
zudienen und schliesslich von beiden Staaten verfolgt wurde. Pöhlmann skizziert aber auch die Aufklärung des deutschen Eisenbahnaufmarsches durch die Franzosen. Ein Ziel des Deutschen Reiches war es spätestens seit den 1880er-Jahren, möglichst rasch möglichst viel Material und Soldaten von Ost nach West zu befördern. Nur so lässt sich der Ausbau von vier zweigleisigen Querverbindungen entlang der deutschen Westgrenze erklären. Besonders deutlich wurde dies bei der Trasse, die zweigleisig durch die nahezu menschenleere Eifel führte. Diese Schienenstränge konnten nicht übersehen werden, umso mehr gab man sich in
Berlin Mühe, deren Leistungsfähigkeit und Innovationspläne zu verschleiern. Und die Gegenseite bemühte sich, die Effizienz des deutschen Schienennetzes umfassend zu erkunden. Am Beispiel des britischen Militärattachés in Berlin (1900−1903) veranschaulicht Pöhlmann deren damalige Instruktionen, Aufgaben (Repräsentation bei Hofe, militärische Liaison und militärische Aufklärung), Möglichkeiten und Grenzen. Zwar werde diesen nur das gezeigt, «was dem Gastgeber opportun erschien». Gleichwohl bildete das Kerngeschäft des Attachés «Informationen zu sammeln über Stärke, Verteilung, Operationsplanung, Doktrin, Technik,
Ausbildung, Spitzenpersonal und Moral des deutschen Heeres».
Kann man aus der Geschichte lernen? In der Gegenwart eröffnen Cyber-Attacken und künstliche Intelligenz auch im Militärischen völlig neue Horizonte. Wie vor dem Ersten Weltkrieg wird es auch jetzt unverzichtbar sein, in der aufziehenden neuen Welt der Nachrichtendienste die richtigen Antworten zu geben. Dazu werden grosse Investitionen in personeller und auch in materieller Hinsicht notwendig sein. Fraglich ist, ob die politischen Entscheidungsebenen gerade in den westlichen Staaten zu diesen Investitionen bereit sein werden. Dr. Reinhard Scholzen
IMPRESSUM
Nr. 6 – Juni 2024 190. Jahrgang
Präsident Kommission ASMZ
Oberst i Gst Thomas K. Hauser
Chefredaktor
Major a D Christian Brändli (cb) Redaktionssekretariat
ASMZ c/o Brunner Medien AG
Brunner Verlag
Arsenalstrasse 24, CH-6010 Kriens
Telefon +41 41 318 34 34
E-Mail: redaktion@asmz.ch abo@bag.ch
Stellvertretender Chefredaktor Fachof Fritz Kälin, Dr. phil. I (fk)
Redaktion
Oberst i Gst Michael Arnold, lic. phil. II (AM) Oblt Thomas Bachmann (tb) Oberst Dieter Kläy, Dr. phil. I (dk)
Oberstlt Pascal Kohler (pk)
Major i Gst Christoph Meier (cm)
Major a D Peter Müller, Dr. rer. pol. (pm) Oblt Erdal Öztas (E. Ö.)
Hptm Daniel Ritschard, lic. oec. HSG (DR) Oberst a D Bruno Russi (RSB) Oberstlt Hans Tschirren (HT)
Redaktionelle Mitarbeiter Marc Ruef (mr)
Marco Jorio
Die Schweiz und ihre Neutralität
Eine 400-jährige Geschichte
Wie vor ihm Paul Schweizer 1895 und Edgar Bonjour 1946 ff. widmet sich neu Marco Jorio 2023 der Geschichte der schweizerischen Neutralität. Wie vom ehemaligen Chefredaktor des Historischen Lexikons der Schweiz zu erwarten war, hat Jorio ein lesenswertes Buch geschrieben. Wie ebenfalls zu erwarten war, ersetzt Jorio die Klassiker Schweizer und Bonjour nicht. Was Jorios «Neutralität» im Jahre 2024 besonders interessant macht, ist die angestrebte eigene Rolle dieses Werkes im «Ringen» von «Bundesrat und Parlament» «mit dem Volk» (S. 432). Dabei fällt eine eher selektive Würdigung des Materials zur jüngsten Neutralitätsgeschichte des Landes auf. Einiges kommt zu kurz: Das Beitrittsgesuch der Schweiz zur EU von 1991 wurde 2016 zurückgezogen. Wie ernst war das Gesuch gemeint, wie ernst der Rückzug? Hat dieses Manöver das nachhaltig erschüttert, was die Bundesverfassung von 1999 jedermann im Lande auf-
erlegt: «Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben» (Artikel 5, Ziffer 3)?
Die Bundesverfassung spricht sogar zweimal von den Parlament und Bundesrat anvertrauten «Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz» (Art. 173 und Art. 185). Doch um das geltende Verfassungsrecht geht es Marco Jorio im letzten Teil seines Buches weniger. Umso mehr geht es ihm um die Bekämpfung der Initiative eines Komitees von 27 Schweizerinnen und Schweizern, als deren erster Name Thomas Aeschi erscheint. In seiner Ablehnung dieser auf Stärkung der Neutralität abzielenden Initiative geht Jorio die Sprache durch: «Die Volksinitiative ist daher eigentlich nichts anderes als eine moralisch höchst fragwürdige ‹Pro-Putin-Initiative›» (S. 464). In seinem Ausblick erhebt der Autor weltpolitische Forderungen: «Die heute geradezu sklavische Abhängigkeit vom häufig dysfunktionalen
UN-Sicherheitsrat muss beendet werden» (S. 470). Wie? «Wie bereits im Bericht zur Neutralität von 1993 zu lesen ist, kann jeder Staat, der angegriffen wird, unterstützt werden» (S. 471). Es ist nicht verboten, zu träumen. Aber bevor wir von der Unterstützung jedes angegriffenen Staates auf der Welt sprechen, sollten wir unsere eigenen Kräfte als Land richtig einschätzen und mit in der Verfassung verankerten Werten behutsam umgehen, mit Werten wie Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität. Jürg Stüssi-Lauterburg

Zürich: Hier und Jetzt, 2023 ISBN 978-3-03919-389-9
Herausgeber
Schweizerische Offiziersgesellschaft Verlag
Brunner Medien AG, Brunner Verlag
Arsenalstrasse 24, CH-6010 Kriens
Verlagsleiter
Jürg Strebel
Telefon +41 41 318 34 60
E-Mail: j.strebel@bag.ch
Abonnemente
Telefon +41 41 318 34 34
E-Mail: abo@bag.ch
Layout
Brunner Medien AG
Inserateverkauf
Brunner Medien AG, Brunner Verlag Martin Plazzer Telefon +41 41 318 34 74
E-Mail: m.plazzer@bag.ch
Abo-Preis
inkl. 2,6 % MwSt Kollektivabonnement SOG ermässigt Jahresabo Inland Fr. 92.–/Ausland Fr. 120.–App-Jahresabo Fr. 81.–
Druck
Brunner Medien AG
CH-6010 Kriens
Erscheinungsweise 11-mal pro Jahr © Copyright Nachdruck nur mit Bewilligung der Redaktion und Quellenangabe www.asmz.ch
Member of the European Military Press Association (EMPA) ISSN 0002-5925
ASMZ 51 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024



Mit Sicherheit erfolgreich.
Fachausweis
Cyber Security Specialist
Lassen Sie Ihr Cyber Security Knowhow zerti zieren und stellen Sie die Weichen für eine erfolgreiche Zukun
Absolventinnen und Absolventen des Cyber-Lehrgangs der Armee mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung sind zur eidgenössischen Berufsprüfung «Cyber Security Specialist» zugelassen.


.
Haben Sie Fragen? Melden Sie sich bei uns! ICT-Berufsbildung Schweiz Telefon +41 58 360 55 50 info@ict-berufsbildung.ch www.ict-berufsbildung.ch Jetzt informieren www.ict-weiterbildung.ch



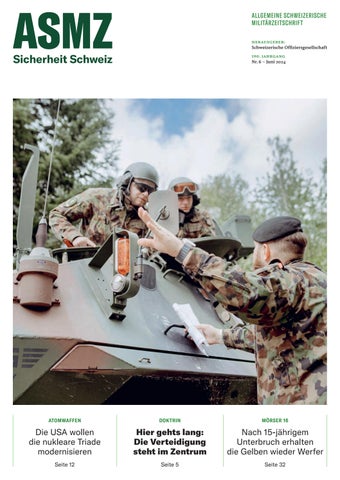





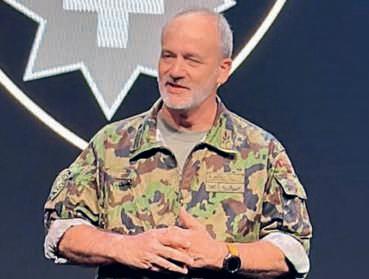

 Major
Major