






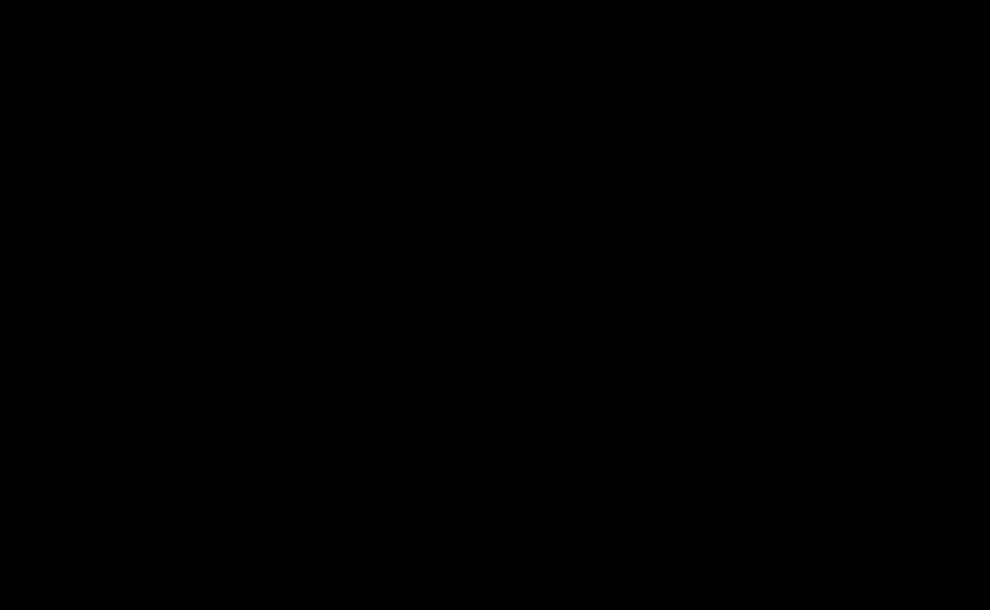
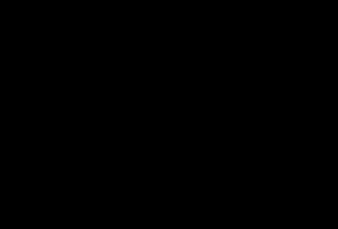
Diese Fibel ist für all jene gedacht, die sich im Dschungel der unzähligen Outdoor-Artikel, des Marketings und der Marken zurechtfinden möchten – insbesondere als Neuling fühlt man sich hier oft überfordert. Ob zu großer Rucksack, viel zu schwere Kochausrüstung oder unnötiges
Zubehör: Es ist leicht, den Überblick zu verlieren und am Ende Ausrüstung zu kaufen, die nicht optimal zu den eigenen Bedürfnissen passt.
Genau hier möchte diese Fibel helfen. Sie soll eine Art Wegweiser sein –wie die Schilder in den Bergen, die dich sicher auf den richtigen Pfad führen. Sie bietet dir praktische Tipps und Einblicke in die Ausrüstungsgegenstände, die sich über die „Jahre“ bei mir bewährt haben. Dabei stelle ich nicht nur die Vor- und Nachteile der einzelnen Ausrüstungsstücke vor, sondern zeige dir auch mögliche Alternativen, sodass du die für dich beste Wahl treffen kannst.
Wichtig ist mir zu betonen: Diese Fibel ist keine streng wissenschaftliche Anleitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen, Tipps & Tricks die ich mit der Zeit gesammelt habe und ist ein Hilfsmittel, um dir Orientierung in der Vielfalt der Angebote zu geben. Natürlich übernehme ich keine Haftung – am Ende liegt es bei dir, zu entscheiden, was für dich am besten geeignet ist.
Das Schreiben dieser Fibel hat mir neben Zeit, auch viel Freude bereitet, und ich hoffe, du hast ebenso viel Spaß beim Lesen. Nimm es nicht zu ernst – schließlich ist der Weg das Ziel, und auch beim Bergsteigen darf der Humor nie fehlen!
Wenn dir diese Fibel weiterhilft, freue ich mich über Rückmeldungen, Tipps und Erfahrungsberichte – Deine Meinung ist herzlich willkommen und kann vielleicht in zukünftigen Versionen dieser Fibel berücksichtigt werden.
In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, großartige Erlebnisse und natürlich stets sichere Touren. Möge dir die Fibel ein treuer Begleiter auf deinen Wegen sein!
Viel Spaß beim Lesen und immer eine Handbreit Fels unter den Füßen
Die Wahl der richtigen Bekleidung ist für jede Bergtour von entscheidender Bedeutung. In den Bergen können die Wetterbedingungen schnell und unvorhersehbar umschlagen – von sengender Sonne bis hin zu eisigem Wind und plötzlichen Regenschauern. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein.
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Kleidungsstücken, die dir Schutz und Komfort bieten: von den richtigen Socken über das passende Schuhwerk bis hin zu Kopfbedeckungen und Handschuhen. Ich werde das Zwiebelprinzip erklären, bei dem mehrere Schichten übereinander getragen werden, um sich flexibel an wechselnde Bedingungen anzupassen. Auch Details wie die Wahl einer geeigneten Sonnenbrille, Gamaschen oder das Einpacken eines Ersatzpaares Socken werden hier beleuchtet – denn jedes dieser Teile kann den Unterschied ausmachen.
Hinweis: Dieses Kapitel bietet dir viel Theorie und detaillierte Informationen. Dennoch kann nichts die persönliche Fachberatung durch Profis im Fachgeschäft ersetzen! Dort können erfahrene Berater direkt „schauen, wo der Schuh drückt“ und dir wertvolle Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung bieten. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen: Der Versuch, im Internet ein paar Euros zu sparen, hat mich am Ende oft sehr viel mehr gekostet. Vor allem bei Ausrüstung, die lange halten und perfekt sitzen soll, lohnt sich der Besuch im Geschäft.
Und nicht zuletzt reden wir in der heutigen Zeit immer häufiger von Nachhaltigkeit und davon, unseren Nachkommen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Indem wir Fachgeschäfte unterstützen, ermöglichen wir es auch den zukünftigen Generationen, auf wertvolle Beratung und hochwertige Ausrüstung zurückzugreifen – auch eine (weitere) Art der Nachhaltigkeit.
Beim Bergsteigen sind die Socken von entscheidender Bedeutung. Sie können den Unterschied zwischen einer komfortablen Tour und schmerzhaften Blasen oder kalten Füßen ausmachen.
Was macht ein perfektes Paar Socken aus?
• Blasenvermeidung: Die richtige Socke kann helfen, Reibung zu minimieren und dadurch Blasen zu vermeiden.
• Feuchtigkeitsmanagement: Socken aus Materialien wie Merinowolle oder synthetischen Fasern sind darauf ausgelegt, Feuchtigkeit von der Haut weg zuleiten. Trockene Füße bedeuten weniger Reibung und geringeres Infektionsrisiko.
• Polsterung und Unterstützung: Spezielle Wandersocken bieten zusätzliche Polsterung an Fersen, Zehen und Fußballen. Tipp: Achte bei der Auswahl auf die Polsterzonen – sie sollten zu deinem Schuhmodell passen.
• Wärmeisolation: Zusätzliche Isolationsschicht, die hilft, die Füße warm zu halten. Merinowolle ist hier besonders beliebt, da sie selbst in feuchtem Zustand gut isoliert. Der sog. "Loft" von Merinowolle speichert Luft – diese isoliert gegen Kälte.
• Passform und Stabilität: Hochwertige Wandersocken haben oft eine spezielle Passform, die den Fuß gut umschließt und zusätzlichen Halt bietet. Verstärkte Bündchen verhindern ein rutschen der Socke.
• Antimikrobielle Eigenschaften: Socken aus Merinowolle und einige synthetische Materialien haben natürliche antimikrobielle Eigenschaften. Diese helfen, Gerüche zu reduzieren und die Füße hygienisch zu halten, was besonders bei längeren Touren ohne regelmäßige Waschmöglichkeiten wichtig ist.
• Druckverteilung: Die Polsterung und die Verstärkung in bestimmten Bereichen der Socke helfen, den Druck gleichmäßig zu verteilen. Dies kann Schmerzen und Müdigkeit vorbeugen, die durch ungleichmäßige Belastung entstehen können.
Bei schwerem Gepäck ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
„Wie wähle ich nun das richtige Paar Socken für mich aus?“
Art der Tour und Jahreszeit
• Leichte Wanderungen in warmen Bedingungen: Dünne, atmungsaktive Socken aus synthetischen Materialien oder Merinowolle. Die Füße bleiben trocken und Hitze wird effektiv abgeführt.
• Anspruchsvolle Berg- oder Mehrtagestouren: Dickere, gut gepolsterte Socken – Merinowolle oder Mischgewebe mit Kunstfasern sorgen für Dämpfung und Komfort über lange Strecken. Hier zahlt sich "Zonenkonstruktion" aus – also gezielte Polsterung in belasteten Bereichen.
• Wintertouren oder sehr kalte Bedingungen: Dicke Thermosocken mit hoher Isolationsleistung.
Wichtig: Auch in Kombination mit wasserdichten Schuhen muss die Feuchtigkeit abgeleitet werden können.
Materialien und Eigenschaften
• Merinowolle: Komfort, Feuchtigkeitsmanagement und Temperaturregulierung.
Feine Fasern mit welliger Struktur speichern Luft, sind weich auf der Haut und geruchsneutral.
• Synthetische Materialien: Robuster und trocknen schneller. Ein guter Mix aus Nylon, Polyester oder Elastan bietet Haltbarkeit, Flexibilität und schnelles Feuchtigkeitsmanagement.
• Kombinationen: Moderne Wandersocken kombinieren Merinowolle mit Kunstfasern, um Komfort und Haltbarkeit zu verbinden. Achte auf den prozentualen Anteil der Materialien – z. B. 60 % Wolle, 30 % Polyamid, 10 % Elastan.
Schuhwerk beachten
• Schwere Bergschuhe: Dickere, gepolsterte Socken, die Stöße und Druckstellen abmildern.
• Leichte Wander- / Trekkingschuhe: Leichte, eng anliegende Socken, atmungsaktiv.
Zu dick = Reibung. Zu dünn = zu wenig Schutz.
Passform und Größe
• Keine Falten oder Verrutschen! Socken sollten gut sitzen - zu große
Socken können Reibung verursachen und Blasen hervorrufen, zu kleine Socken drücken und behindern die Durchblutung.
• Spezifische Passform für links und rechts: Einige Wandersocken sind anatomisch geformt.
Bessere Passform = weniger Reibung, besserer Sitz.
Zwiebelprinzip anwenden
In kälteren, wechselhaften Bedingungen kannst du das Zwiebelprinzip auch auf die Füße anwenden:
• Innensocke: Dünn, synthetisch – transportiert Feuchtigkeit weg.
• Außensocke: Dickere Isolations- und Polstersocke.
Diese Schichttechnik verringert Reibung, hält warm und trocken – und ist besonders bei langen Touren Gold wert.
Blasenschutz und Komfort
• Merinowolle oder Mischgewebe: Transportieren Feuchtigkeit ab und verhindern Blasen.
• Keine Falten, nicht zu eng, nicht zu weit – sonst reibt’s!
• Doppellagige Socken:
Das innere Gewebe bewegt sich mit dem Fuß, das äußere mit dem Schuh – Reibung wird zwischen den Lagen absorbiert.
Pflegeleicht und langlebig
Auch die Pflege deiner Socken sollte eine Rolle spielen. Wenn du häufig auf Tour gehst, brauchst du langlebige und pflegeleichte Materialien.
Merinowolle: Schonwäsche, lufttrocknen, kein Weichspüler.
Synthetik: Maschinenfest, oft robuster.
Tipp: Auch Socken sollte man einlaufen. Frisch gewaschene Socken können fusseln & weniger geschmeidig sein. Leicht getragene Socken schmiegen sich besser an.
Warum man ein Ersatzpaar Socken dabei haben sollte:
• Feuchtigkeitsmanagement: Auch bei atmungsaktiven Socken können die Füße durch Schweiß, Regen oder nasses Gelände feucht werden.
Trockene Ersatzsocken = gesunde Haut.
• Blasenprävention: Nasse oder verschmutzte Socken = mehr Reibung. Ein frisches Paar reduziert die Reibung – das senkt das Blasenrisiko.
• Komfort und Hygiene: Frische Socken erhöhen den Komfort erheblich, besonders nach einem langen Tag. Psychologisch eine Wohltat – es fühlt sich fast wie frisch geduscht an.
• Wärmeisolation: Nasse Socken entziehen den Füßen Wärme. Ein trockenes Paar kann sogar Erfrierungen vorbeugen.
• Schnelle Trocknung: Die nassen Socken können während Pausen oder über Nacht trocknen – Ersatzsocken anziehen, trockene nachlegen.
• Psychologischer Effekt: Ein frisches Paar kann die Moral heben und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Tipp: Nutze das frische Paar abends auf der Hütte – trockene Füße, entspannter Schlaf. Die getragenen Socken können in der Zeit lüften oder trocknen
Die richtigen Schuhe sind beim Bergsteigen aus verschiedenen Gründen entscheidend:
• Sicherheit: Gute Bergschuhe bieten Stabilität und Halt, was das Risiko von Umknicken, Ausrutschen und Stürzen deutlich verringert. Die Sohlen sind speziell entwickelt, um auf verschiedenstem Untergrund optimalen Grip zu bieten – ob nasser Fels, Matsch oder Schotter.
• Schutz: Bergschuhe schützen die Füße vor scharfen Steinen, Wurzeln, Dornen und Geröll. Sie bieten außerdem Schutz vor Kälte und Nässe –besonders relevant in höheren Lagen oder bei wechselhaftem Wetter.
• Komfort: Passende Bergschuhe sorgen dafür, dass die Füße auch bei langen Märschen oder technischen Passagen bequem bleiben. Sie bieten Dämpfung, Unterstützung und vermeiden Ermüdung oder Überlastung.
• Anpassung an Gelände und Bedingungen: Nicht jeder Schuh passt zu jeder Tour. Leichte Wanderschuhe für gemütliche Pfade, steigeisenfeste Modelle für hochalpines Gelände – die Wahl muss zum Terrain passen.
• Verletzungsprävention: Eine gute Passform und abgestimmte Dämpfung entlasten Gelenke, Sehnen und Bänder. Das verringert das Risiko von Überlastung (z. B. Plantarfasziitis, Achillessehnenreizung, Schienbeinsyndrom).
• Effizienz: Gut sitzende Schuhe verbessern den Bewegungsablauf, fördern ein natürliches Abrollen und sparen Energie.
• Langlebigkeit: Qualitativ hochwertige Schuhe halten viele Jahre – bei guter Pflege sogar Jahrzehnte. Pflege und richtige Lagerung verlängert das Leben des Leders – und auch die Verklebung der Sohle.
Wanderschuhe / Approach-Schuhe
Einsatz: Zustiege, einfache Wanderwege, Tagestouren
Merkmale: Komfortabel, leicht, Flexibilität und Halt
Sohle: Gut gedämpft, mit rutschfestem Profil
Leichtwanderschuhe (Kategorie A)
Einsatz: Mittelgebirge, einfache Alpentouren, trockene Pfade
Merkmale: Leicht, angenehm zu tragen, flexibler Schaft
Sohle: Griffig, aber weicher als bei alpinen Modellen
Bergwanderschuhe (Kategorie B)
Einsatz: Anspruchsvolle Wanderungen, Geröll, alpine Wege
Merkmale: Stabile Sohle, robuster Aufbau, oft bedingt wasserdicht
Sohle: Fester, abriebresistenter Gummi mit starkem Profil
Steigeisenschuhe (Kategorie C)
Einsatz: Hochtouren, Gletscher, Klettersteige
Merkmale: Steife Bauart, bedingt oder voll steigeisenfest, hoher Schaft
Sohle: Hart, trittfest, oft mit Steigeisenaufnahme hinten (halbautomatisch)
Achtung: Für normales Wandern schnell zu steif und unbequem.
Expeditions- & Hochgebirgsschuhe (Kategorie D)
Einsatz: Extremtouren, Winterbesteigungen, Höhenlagen
Merkmale: Maximal steif, stark isoliert, mit Gamasche oder Doppelaufbau
Sohle: Sehr steif, extrem griffig, geeignet für automatische Steigeisen
Mehrschichtige Sohlenkonstruktion für Isolierung, Stabilität und Haftung – kompromisslos.
Wichtiger Hinweis zur Kategorisierung:
Diese Klassifizierung (A–D) ist eine Orientierungshilfe, aber nicht genormt. Hersteller interpretieren sie unterschiedlich, also immer anprobieren, vergleichen, und im Fachgeschäft beraten lassen.
1. Profilsohle (Außensohle)
• Material: Gummi mit speziellen Mischungen (z. B. Vibram®, Continental®, Michelin®)
• Härtegrad: Härtere Mischungen halten länger, weichere bieten besseren Grip – besonders bei Nässe
• Profil:
◦ Tief & aggressiv = gut für Matsch, Schnee, Geröll
◦ Flach & dicht = ideal für Felskontakt (z. B. Kletterpassagen)
• Selbstreinigung: Rillen- und Stollenanordnung sorgt dafür, dass Schlamm beim Gehen ausgeworfen wird
Tipp: Für Kletterpassagen oder Klettersteige achte auf eine „Climbing Zone“ – eine flache, reibungsstarke Kletterfläche im Zehenbereich.
2. Zwischensohle (Midsole)
• Material: EVA-Schaum oder PU (Polyurethan)
◦ EVA: Weicher, leichter, aber weniger langlebig
◦ PU: Robuster, fester, formstabil – ideal für schwere Touren
• Aufgabe: Stoßdämpfung, Energierückführung, Druckverteilung
• Manche Modelle haben zusätzlich:
◦ Nylonplatten (Shanks) zur Torsionsstabilität
◦ Steigeiseneinlagen aus Carbon oder Aluminium bei C/D-Schuhen
3. Brandsohle (Innensohle, Trägerplatte)
• Steuert die Steifigkeit und Torsionsfestigkeit
• Oft aus faserverstärktem Kunststoff oder Nylon
• Einfluss auf die „Steigeisenfestigkeit“
Tipps zur Auswahl: Passform:
◦ Kein Drücken, kein Rutschen
◦ Ferse muss fest sitzen, Zehen haben vorne „Spielraum“
◦ Tipp: Bergab laufen beim Testen – rutschen die Zehen? → zu klein!
Material:
◦ Leder = langlebig, passt sich an, braucht Pflege
◦ Synthetik = leichter, trocknet schneller, oft günstiger
◦ Kombinationen aus beidem sind heute Standard
Schnürung:
◦ Gleichmäßig fest, aber nicht einschnürend
◦ Während der Tour nachjustieren
◦ Viele Schuhe bieten „Zweizonenschnürung“ – z. B. Vorderfuß locker, Schaft fest
Mythencheck
• „Ein fester Schuh ist immer besser“ – Falsch! Für einfache Wege sind steife Schuhe überdimensioniert und unbequem.
• „Wasserdicht = perfekt“ – Nicht immer! Gore-Tex®-Schuhe sind bei Hitze schlecht belüftet. In heißen Regionen kann das zur Fuß-Sauna werden.
Hinweis: Schuhe im Sale
"Ein stark reduzierter Schuh kann teuer werden – im schlimmsten Fall mit der Tour!"
Warum?
Die Sohle altert – auch unbenutzt! Besonders Zwischensohlen aus PU können spröde werden und sich plötzlich ablösen (Hydrolyse-Effekt).
Tipp:
• Herstellungsdatum prüfen (oft im Schuhcode versteckt: YYMM)
• Bei Unsicherheit: Finger weg!!!
• Ersatz-Schnürsenkel oder Paracord zur Reparatur dabei haben
Eine gute Wanderhose ist beim Bergsteigen und Wandern nicht bloß ein Kleidungsstück – sie ist ein funktionales Ausrüstungsteil, das Komfort, Schutz und Beweglichkeit bietet. Besonders in wechselhaftem Gelände oder bei langen Touren macht sich die richtige Hose bezahlt.
Warum eine Wanderhose wichtig ist:
1. Bewegungsfreiheit:
Wanderhosen sind so geschnitten, dass sie deine Bewegungen beim Gehen, Klettern oder Kraxeln nicht einschränken.
• Elasthan-Anteil oder 4-Wege-Stretch sorgt für Flexibilität
• Vorgeformte Kniepartien/ Zwickeleinsätze geben mehr Freiheit
Tipp: Auf die Dehnbarkeit im Schrittbereich achten – dort scheuern viele Modelle zuerst durch!
2. Wetterbeständigkeit:
Viele Hosen bestehen aus wasserabweisenden oder sogar laminierten (wasserdichten) Materialien.
• Winddichte Außenlagen helfen, bei Zugluft nicht auszukühlen
• Manche Hosen verfügen über PFC-freie Imprägnierung
• Modelle mit abperlender Oberfläche (DWR) sind ideal bei Nieselregen
Achtung: „Wasserabweisend“ heißt nicht „regenfest“ – für Starkregen brauchst du eine Überhose!
3. Atmungsaktivität:
Die besten Hosen leiten Schweiß nach außen, während sie Regen draußen halten.
• Technische Stoffe wie Softshell, Nylon-Mix oder Polyester mit MeshInnenfutter regulieren das Klima
• Seitliche Belüftungszipper (oft an den Oberschenkeln) sind Gold wert bei steilen Anstiegen
4. Robustheit und Langlebigkeit: Wanderhosen müssen viel aushalten: Reibung, Felskontakt, Äste, …
• Verstärkungen an Gesäß, Knien und Beinabschlüssen (z. B. mit Cordura®) schützen besonders beanspruchte Zonen
• Doppel- oder Dreifachnähte erhöhen die Lebensdauer
Tipp: Wenn du viel mit Steigeisen oder Grödeln gehst: auf Hosen mit „Anti-Cut-Material“ am Saum achten!
5. Schutz vor Umwelteinflüssen:
• UV-Schutz (UPF 30+ bis 50+) ist bei Höhenwanderungen wichtig
• Längere Hosen schützen vor Insekten, Brennnesseln, Dornen,…
• Auch Kälte (z. B. frühmorgens im Schatten) wird abgehalten
6. Praktische Funktionen:
• Taschen: Ob Karten, Riegel oder Handy – funktionale Taschen (idealerweise mit RV) sind unverzichtbar
• Beinabschlüsse: Verstellbar mit Klett oder Kordel → passt über Wanderschuh oder in die Gamasche
• Abzippbare Hosenbeine verwandeln lange Hosen schnell in Shorts
Hinweis: Reißverschlüsse der Zip-Offs sollten leichtgängig, stabil und innen abgedeckt sein, sonst reiben sie an den Beinen.
7. Komfort:
• Elastische Bündchen, verstellbare Taillenbänder, manchmal auch ein integrierter Gürtel erhöhen den Tragekomfort
• Flache, scheuerfreie Nähte verhindern Hautirritationen
• Innen weich gebürstete Modelle eignen sich für kältere Tage
Tipp: Probiere deine Hose in der Bewegung – z. B. Knie hochziehen oder in die Hocke gehen.
8. Leichtigkeit & Packmaß
• Viele Hosen wiegen unter 300 g und lassen sich klein komprimieren –perfekt für Mehrtagestouren
• Schnelltrocknende Materialien sind vorteilhaft bei Regen oder beim Waschen unterwegs
Materialien & Features
• Softshellhosen: Leicht elastisch, atmungsaktiv, windabweisend – ideal bei Trockenwetter
• Hardshellhosen: Voll wasserdicht, aber weniger atmungsaktiv – eher als Notfallhose oder bei Dauerregen
• Hybridmodelle: Kombinieren Stretchzonen und Verstärkungen → maximaler Mix aus Beweglichkeit und Robustheit
• Mesh-Belüftung / Laser-Cut-Airpanels: Für technische Modelle mit besonders hohem Tragekomfort
Tipps
• Anprobieren! Nicht jede Hose passt jeder Figur gleich gut. Beweg dich beim Testen – setzt du dich oder machst du einen Ausfallschritt?
• Waschpflege beachten: Viele technische Stoffe verlieren bei Weichspülern ihre Atmungsaktivität.
• Funktion schlägt Style: Farbe und Schnitt sind zweitrangig, wenn die Hose reibt oder nicht schützt.
• Ersatz dabei? Eine zweite, leichte Hose kann in kalten Nächten oder bei Nässe Gold wert sein.
Das Zwiebelprinzip (Layering System) ist eine bewährte Methode, sich beim Bergsteigen, Wandern oder auf Expeditionen optimal an wechselnde Wetterbedingungen und körperliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Statt einer dicken Kleidungsschicht setzt man auf mehrere funktionale Lagen, die einzeln regulierbar, kombinierbar und leicht anoder auszuziehen sind.
Ziel: Den Körper bei allen Bedingungen angenehm warm, trocken und geschützt zu halten – ohne zu überhitzen oder auszukühlen.
Funktion: Feuchtigkeitsmanagement – hält dich trocken
Typische Materialien Eigenschaften
Merinowolle
Natürlich, geruchsneutral, reguliert Temperatur auch in feuchtem Zustand
Synthetik (Polyester, Polyamid) Sehr leicht, trocknet extrem schnell, günstiger
Beispiele: Funktionsunterwäsche, Longsleeves, lange Unterhosen
Diese Schicht liegt direkt auf der Haut und ist dafür verantwortlich, Schweiß schnell nach außen zu transportieren.
Ist diese Schicht ungeeignet (z. B. Baumwolle), saugt sie Feuchtigkeit auf – das führt zu Kältegefühl, Scheuerstellen oder sogar Unterkühlung.
Technischer Hinweis:
Achte auf die Materialstärke in g/m²:
• 150–180 g/m²: Sommeraktivitäten
• 200–250 g/m²: 3-Jahreszeiten
• 250+ g/m²: Wintertouren / Expeditionen
Tipp: Base Layer sollte eng anliegen, aber nicht einengen.
Mesh-Baselayer sind im kommen - sehr witzige Optik fantastische Leistung (z.B. von Brynje) oder das Material Alpha (z.B. von Polartec)
Funktion: Wärmeerhalt – hält die Körperwärme zurück
Material
Fleece
Daune
Synthetik-Isolierung
(z. B. Primaloft®)
Eigenschaften
Atmungsaktiv, pflegeleicht, gut bei Bewegung
Extrem leicht, hohe Isolationskraft, bei Nässe aber kritisch
Trocknet schneller als Daune, weniger komprimierbar
Beispiele: Fleecejacken, isolierte Westen, Daunenjacken
Diese Schicht speichert die Körperwärme und schützt dich vor dem Auskühlen – je nach Aktivitätslevel kann man sie leicht anpassen oder wegpacken.
Tipp: Für bewegungsintensive Touren lieber atmungsaktiven Fleece, bei Pausen oder Kälte komprimierbare Isolationsjacke mitnehmen.
Technik: Der Isolationswert wird oft als „CLO-Wert“ angegeben – je höher, desto wärmer.
Funktion: Schutz vor Wind, Regen & Schnee
Typ Eigenschaften
Hardshell (z. B. Gore-Tex®) Vollständig wind- & wasserdicht, abriebfest
Softshell
Regenponcho / ultraleichte
Varianten
Wasserabweisend, sehr atmungsaktiv, elastisch
Minimalistisch, ideal für Sommertouren
Beispiele: Regenjacke, Hardshellhose, Windbreaker
Die äußere Schicht ist deine Barriere gegen das Wetter. Sie sollte möglichst atmungsaktiv (MVTR-Wert beachten)und gleichzeitig dauerhaft wasser- und winddicht sein.
Gute Shells haben verklebte Nähte, Unterarmbelüftung („Pit Zips“) und robuste Reißverschlüsse.
• Hardshells brauchen Pflege: regelmäßig imprägnieren
• Softshells sind top für trockene, windige Tage mit viel Bewegung
„Be bold, start cold.“ = „Sei mutig, starte kühl.“
Ein häufiger Fehler: Zu warm losgehen – und dann direkt durchschwitzen.
Warum diese Regel Sinn macht:
• Du vermeidest Überhitzung und starkes Schwitzen
• Die Base Layer bleibt trocken – du bleibst warm
• Du musst nicht ständig anhalten und umziehen
• Du sparst Energie, weil der Körper nicht ständig nachreguliert
Das Prinzip hilft auch gegen:
• Blasenbildung durch Schweißstau
• Scheuerstellen an Rücken & Rucksackgurt
• unnötige Unterkühlung nach kurzen Anstrengungspausen
Flexibilität & Layer-Feinabstimmung
Erweiterte Schichtideen:
• T-Shirt + Longsleeve-Kombi als variable Base Layer
• Weste als ultraleichte Zwischenlage
• Windjacke statt schwerer Hardshell bei gutem Wetter
• Ultraleichte Daune (z. B. unter 300 g) für Gipfelpausen
Tipp: Trage mehrere dünne Schichten als eine dicke – das erhöht deine thermische Flexibilität.
Gerade Menschen, die schnell frieren oder längere Pausen in kalter Umgebung machen, sollten sich nicht auf eine Standard-Isolationsschicht verlassen.
Beispiele für zusätzliche Midlayer:
• Dünne Daunenwesten unter die Hardshell
• Merino-Hoody unter der Fleecejacke
• Stretchfleece für mehr Bewegungsfreiheit
Tipp: Eine dünne, ultraleichte Isolationsjacke (z. B. Primaloft® oder Daune) passt in jeden Rucksack und wirkt Wunder bei plötzlich einsetzendem Wind oder Temperaturen unter Null.
Der Kopf ist ein echter Wärmeabfluss – aber auch ein Angriffspunkt für Sonne, Wind und Insekten. Die richtige Kopfbedeckung ist Pflicht – das ganze Jahr über.
Warum sie wichtig ist:
• Sonnenschutz: UV-Schutz für Kopf, Gesicht, Ohren, Nacken
• Wärmespeicherung: Weniger Wärmeverlust bei Kälte
• Windschutz: Kein kalter Zug an den Ohren
• Schweißmanagement: Hält den Kopf trocken, Haare aus dem Gesicht
• Schutz vor Staub & Insekten: Besonders auf offenen Pfaden
Kopfbedeckung nach Saison:
Jahreszeit Empfehlung Eigenschaften
Sommer Hut mit Krempe / Cap / Buff UV-Schutz, Belüftung, leicht
Übergang Stirnband / dünne Mütze Wärme + Luftaustausch
Winter Merinomütze / Fleece Isolierend, evtl. doppellagig
Tipp:
Ein Buff + eine Mütze oder ein leichter Hut decken nahezu alle Bedingungen ab – minimalistisch & maximal funktional.
Unterschätzt, bis du das erste Mal keine Finger mehr spürst…
Funktion:
• Wärme & Windschutz: Besonders bei Schnee, Höhenlage, kaltem Wind
• Feingefühl & Schutz: Für Klettersteige, Trekkingstöcke, Kamera
• Wetterschutz: Nässe = Kälterisiko → wasserabweisend = Pflicht!
Das 3-Schicht-Handschuhsystem:
Typ Zweck
Material / Eigenschaft
Liner Leicht, für Feinarbeiten Merino, Softshell, Stretch
Isoliert Wärme bei Kälte Daune, Primaloft®, Fleece
Überhandschuh Wetterschutz, Wind & Regen Hardshell, wasserdicht, robust
Spezialfall: Klettersteighandschuhe Sie schützen vor scharfen Stahlseilen & Splittern. Finger frei oder mit Verstärkung in der Handfläche – unbedingt empfehlenswert bei Via Ferrata. (Siehe Kapitel 4)
Tipp:
Ganzjährig ein Paar im Rucksack! Und bei nassem Wetter oder Winter: ein zweites Paar als Ersatz – nasse Handschuhe ruinieren nicht nur Komfort, sondern Funktion & Sicherheit.
Der Hals ist eine oft übersehene Schwachstelle bei Wind, Kälte, Staub oder Sonne. Ein Buff gehört in jeden Rucksack – egal ob Tagestour oder Expedition.
Eigenschaften:
• Vielseitigkeit: Stirnband, Mütze, Maske, Haarband, Nackenschutz
• Materialien:
◦ Mikrofaser: Leicht, schnelltrocknend
◦ Merinowolle: Wärmer, geruchsneutral, ideal im Winter
◦ Fleece-Variante: Für richtig kalte Bedingungen
• UV-Schutz: Viele Modelle bieten UPF 30–50+
• Feuchtigkeitsmanagement: Schweiß wird abtransportiert
• Wind- & Staubschutz: Besonders bei Hochtouren oder auf Geröllfeldern
Einsatzmöglichkeiten:
Funktion Anwendung
Nackenwärmer Wind-/Kälteschutz am Hals
Gesichtsmaske
Schutz gegen Sonne, Kälte, Staub Stirnband Schweißmanagement, Haare bändigen
Kühlhilfe In Wasser tauchen → Nackenkühler
Ersatzhandtuch Bei Hitze oder Notfall
Tipp:
Im Sommer nass machen, um dich zu kühlen. Im Winter doppelt legen für zusätzliche Isolation. Auch als leichte Notmaske nutzbar (z. B. bei Windsturm oder Schmutz).
Gamaschen sind ein oft übersehenes, aber extrem nützliches Ausrüstungsstück für Bergsteiger:innen, Wanderer und Trekker. Sie schützen die empfindliche Übergangszone zwischen Schuh und Hose –und halten Feuchtigkeit, Schmutz, Geröll und Schnee zuverlässig draußen.
Was leisten Gamaschen konkret?
• Trocken bleiben: Sie halten Regen, Matsch, Schneematsch und Tau davon ab, in die Schuhe oder Hosenbeine zu laufen.
• Schutz vor Dornen & Geröll: Verhindern Kratzer, Schnitte und zerkratzte Hosenbeine durch Gestrüpp, Äste, Steine.
• Verhindern von Blasen: Kein Sand, keine Steinchen im Schuh = weniger Reibung, weniger Blasen.
• Wärmeverlust reduzieren: Bei winterlichen Touren helfen sie zusätzlich, den unteren Beinbereich zu isolieren.
• Halt für Hosenbeine: Vor allem bei Softshell- oder Regenhosen, die leicht hochrutschen, bieten Gamaschen zusätzliche Fixierung.
Tipp: Wer schon mal Schnee in den Schuhen hatte oder im Sommer mit Steinchen im Socken gelaufen ist, weiß: Gamaschen sparen Nerven und Haut.
Welche Gamaschen gibt es?
Typ Merkmale & Einsatz Höhe
Trekking Gamaschen Kurz, aus Stretch oder dünnem Nylon, elastisch Knöchelhoch
SoftshellGamaschen (mittelhoch)
Alpin-/WinterGamaschen
Atmungsaktiv, wasserabweisend, ideal für nasses Gras & leichten Schnee Wadenhoch
Wasserdicht (oft Gore-Tex®), robust (Ripstop, Cordura)l für Tiefschnee & Eis Kniehoch
Tipp: Unterfußriemen sollte aus Kunstoff o.ä. sein für längere Haltbarkeit
In den Bergen ist eine hochwertige Sonnenbrille unverzichtbar. Sie schützt deine Augen vor UV-Strahlung, Blendung, Wind, Partikeln – und vor ernsten Schäden wie Schneeblindheit. Dabei ist nicht jede Brille fürs Gebirge geeignet.
Warum ist eine Sonnenbrille in den Bergen so wichtig?
• UV-Schutz: In höheren Lagen nimmt die UV-Strahlung pro 1.000 m Höhe um ca. 10–15 % zu. Die Atmosphäre filtert weniger – die Augen sind besonders gefährdet.
• Schneeblindheit vermeiden: Reflektierter UV-Strahl auf Schnee kann die Hornhaut regelrecht „verbrennen“.
→ Schmerzhaft, gefährlich – vermeidbar mit richtiger Brille!
• Blendung reduzieren: Gletscher, Eis, Felsen oder nasser Fels reflektieren extrem. Gute Gläser filtern das effektiv.
• Physischer Schutz: Wind, Staub, Insekten oder ausschlagende Äste –die Brille schützt wie ein Visier.
• Leistungsfähigkeit: Ohne geblendet zu werden siehst du mehr, schneller und sicherer – auch auf technischem Gelände.
Technische Eigenschaften – worauf du achten solltest
UV-Schutz:
• 100 % UV-A & UV-B Schutz ist Pflicht.
• Der UV-Schutz hat nichts mit der Tönung zu tun – auch klare Gläser können UV-sicher sein (z. B. bei Gletscherbrillen mit Wechselglas).
Wichtig: Billiggläser mit „Tönung, aber ohne echten UV-Schutz“ können sogar schädlicher sein als gar keine Brille!
Die Pupille weitet sich → mehr UV gelangt ins Auge → erhöhtes Risiko für dauerhafte Schäden.
Lichtdurchlässigkeit (VLT – Visible Light Transmission)
Kategorie Lichtdurchlässigkeit Einsatzbereich
Kat. 3 8–18 %
Kat. 4 3–8 %
Normale alpine Bedingungen, Sonne, Sommer
Hochalpin, Gletscher, Schnee, Expeditionen (Achtung: nicht zum Autofahren erlaubt!)
Hinweis: Kategorie 4 ist im Hochgebirge Pflicht – z. B. bei Gletscherüberschreitungen oder Schnee bei voller Sonne.
Polarisierte Gläser
• Reduzieren Spiegelungen (z. B. auf Wasser oder Schnee)
• Verbessern Kontraste und Tiefenwahrnehmung
• Besonders angenehm bei grellem Licht
Ideal für Touren über Gletscher, Schneefelder oder Flüsse. Nicht immer
ideal für Klettern – da können Reflexionen bewusst hilfreich sein (z. B. zur Felsstruktur).
Fotochrome Gläser (selbsttönend)
• Passen sich automatisch an Lichtverhältnisse an
• Wechseln von klar → dunkel in Sekunden
• Praktisch bei Touren mit viel Schatten-Sonne-Wechsel (z. B. Wälder)
Hinweis: Die Tönungsintensität kann sich bei Kälte verlangsamen – auf Gletschern ggf. nicht dunkel genug für Kat. 4!
Tipp:
• Brillenband verwenden! Damit geht nichts verloren – besonders bei Klettersteigen, beim Abnehmen oder auf Gletschern.
• Gelb-/Bernstein-Tönung kann bei bewölktem Licht helfen, die Sicht freundlicher und kontrastreicher zu gestalten.
• Seitenschutz: Besonders bei Gletscherbrillen wichtig! verhindert seitlichen Lichteinfall & Reflexionen – häufig unterschätzt
• Brillen mit abnehmbarem Nasenschutz, z. B. Expeditionsmodelle –schützen vor Sonnenbrand an der empfindlichen Nase.
Zusammengefasst: Was deine Sonnenbrille mitbringen sollte
Feature Warum es wichtig ist
100 % UV-A/B Schutz
Kategorie 3 oder 4
Seitenschutz
Bruchsichere Gläser
Guter Sitz
Verhindert dauerhafte Augenschäden
Für Gebirgstouren notwendig
Gegen Reflexionen und Streulicht
Sicherheit bei Stürzen oder Steinschlag
Kein Verrutschen, kein Druck bei Bewegung
Optional: Polarisiert oder fotochrom Mehr Komfort bei variabler Sonne
Wer auf einer Berghütte übernachtet, kommt an ihnen nicht vorbei: Hüttenschuhe sind Pflicht – aus praktischen und hygienischen Gründen. Sie gehören zur Grundausstattung bei Mehrtagestouren oder Hüttentreks und sollten nicht unterschätzt werden.
Vorteile von Hüttenschuhen:
1. Erholung & Komfort
Nach einem langen Wandertag wollen deine Füße nur eins: aus den schweren Bergschuhen raus!
Ein weicher, bequemer Hüttenschuh hilft beim Abschalten, lockert Muskeln und bringt echten Erholungseffekt.
2. Sauberkeit & Hygiene
Bergschuhe sind oft nass, schlammig oder verschwitzt.
→ In fast allen Hütten gilt: Schuhe aus – Hüttenschuhe an. So bleibt der Hüttenboden sauber – besonders wichtig in Schlaf- & Aufenthaltsräumen.
3. Wärme & Schutz
Hütten liegen oft hoch & kühl. Kalte Stein- oder Holzböden entziehen Wärme – vor allem abends oder morgens.
Ein isolierender Hüttenschuh hält deine Füße warm & trocken, auch bei feuchtem Klima.
4. Verletzungsprävention
Barfuß auf Treppen, Fliesen oder im Waschraum? Rutschgefahr!
Hüttenschuhe mit griffiger Sohle und fester Passform verhindern Stolpern, Ausrutschen und kleine, unnötige Verletzungen.
5. Schonung deiner Bergschuhe
Jedes unnötige Tragen in Innenräumen bedeutet mehr Feuchtigkeit, Abrieb & Verschleiß.
6. Gemeinschaftsgefühl & Rücksichtnahme
In Hütten ist Rücksicht auf andere besonders wichtig.
Wer in stinkenden Bergschuhen herumläuft, macht sich keine Freunde.
7. Praktikabilität
Moderne Hüttenschuhe sind leicht, weich, faltbar und nehmen kaum Platz im Rucksack ein.
→ Kein unnötiger Ballast – dafür viel Nutzen!
Merkmale eines guten Hüttenschuhs:
Merkmal
Leicht & kompakt
Rutschfeste Sohle
Isolierend
Atmungsaktiv
Einfach an- und auszuziehen
Material-Tipps:
Warum es wichtig ist
Muss in den Rucksack passen
Sicherheit auf glatten Böden (Holz, Stein)
Hält warm – besonders abends oder morgens
Kein Hitzestau oder Feuchtigkeit im Schuh
Bequem – auch für nächtliche Klogänge
• Wollfilz: Warm, natürlich, langlebig
• Fleece & Kunstfaser: Leicht, schnelltrocknend
• Mit Gummisohle: Für mehr Grip und Wasserfestigkeit
Tipp:
Ultraleicht: Hüttensocken mit Gumminoppen – spart Gewicht, bietet aber trotzdem Isolation & Hygiene.
Komfortliebhaber: Daunenhüttenschuhe - für kalte Nächte
Sonne & Hitze
Körperbereich Empfehlung
Kopf Leichter Hut oder Kappe mit Nackenschutz
Augen
Sonnenbrille Kat. 3 (UV 100 %)
Oberkörper Atmungsaktives Shirt (Merino / Kunstfaser)
Beine Leichte, lange Hose (Sonnenschutz, Belüftung)
Füße Dünne, atmungsaktive Socken
Extras Buff (nass machen = Kühlung)
Wind & Übergangswetter
Körperbereich Empfehlung
Kopf Mütze oder Stirnband
Oberkörper Winddichte Softshelljacke
Hände Leichte Handschuhe
Hals Buff oder Halstuch als Windblock
Beine Hose mit windabweisendem Material
Kälte & Schnee (Winter / Hochtour)
Körperbereich Empfehlung
Unterwäsche Merino oder Synthetik (Base Layer)
Midlayer Fleece / Isolationsjacke (z. B. Daune, Primaloft)
Außenschicht Hardshell-Jacke & -Hose (wasserdicht)
Kopf Warme Mütze
Hände Liner + wasserdichte Fäustlinge
Füße Dicke Merinosocken + Gamaschen
Augen
Sonnen- oder Skibrille Kat. 4
Regen & Nässe (Sommergewitter, Schlechtwettertag)
Körperbereich Empfehlung
Oberkörper Hardshell-Jacke mit Kapuze
Beine Regenhose oder Regenrock
Füße Gamaschen + schnell trocknende Socken
Hände Wasserdichte Handschuhe
Darunter Fleece oder Merino → wärmt trotz Nässe
Extras Poncho für leichte Schauer, gut belüftet
Mehr Infos zu wettertechnischer Kleidung in Kapitel 3
Wer seine Ausrüstung versteht, trifft bessere Entscheidungen beim Kauf und in der Nutzung. Hier ein Überblick über die wichtigsten Materialien und Begriffe in der Outdoor-Bekleidung:
Die gängigsten Materialien im Überblick:
Auf der nächsten Seite ->
„Es gibt kein perfektes Material – nur das richtige für den jeweiligen Einsatzzweck.
Eine clevere Kombination verschiedener Stoffe ergibt ein starkes, funktionierendes System.“
Lasst euch nicht von den Marken und deren Versprechen blenden!
Trivex / Polycarbonat
Brillenglasmaterial, bruchfest, leicht
Kunstdaune (z. B. Primaloft®)
Synthetische Isolierung aus Mikrofasern
Daune
UV-Schutz, stabil, klarSonnenbrillen
Trivex / Polycarbonat
Brillenglasmaterial, bruchfest, leicht
Hardshell (mit Membran)
Naturisolator, Gänse-/Entendaune
Softshell
Fleece
Wärmt auch nass, pflegeleicht
Extrem leicht & warm (hoher CUIN-Wert)
Mehrlagiges Laminat mit Membran (z. B. Gore-Tex) Wasserdicht, winddicht, dauerhaft wetterfest
Schwerer als Daune, weniger komprimierbar Isolationsjacken, Handschuhe Kunstdaune (z. B. Primaloft®)
Synthetische Isolierung aus Mikrofasern
Polyamid (Nylon)
Polyester
Funktionsverlust bei Nässe, teurer Winterjacken, Schlafsäcke Daune
Knisternd, weniger elastisch, teuer Jacken, Hosen (Outer Layer) Hardshell (mit Membran)
Naturisolator, Gänse-/Entendaune
Mischung aus dehnbarem Außenmaterial & Fleece
Windabweisend, atmungsaktiv, flexibel
Nicht völlig wasserdicht Jacken, Hosen, Handschuhe
Softshell
Aufgerauter Kunstfaserstoff
Guter
Wärmespeicher, leicht, weich
Kunstfaser, sehr reißfest, glatt
Merinowolle
Material
Kunstfaser, leicht, schnelltrocknend
Naturfaser, temperaturregulierend, geruchshemmend
Abriebfest, langlebig, leicht
Günstig, robust, pflegeleicht
Eigenschaften
Bewegung dick auf Mid Layer Fleece
Winddurchlässig, trägt bei viel
Weniger atmungsaktiv als Polyester Hosen, Shells, Rucksäcke Polyamid (Nylon)
Nimmt schneller Geruch an Base Layer, Mid Layer, Shirts Polyester
Angenehm auf der Haut, warm trotz Nässe, geruchsarm Trocknet langsamer, empfindlicher bei Reibung Base Layer, Mütze, Buff Merinowolle
Mehrlagiges Laminat mit Membran (z. B. Gore-Tex)
Mischung aus dehnbarem Außenmaterial & Fleece
Aufgerauter Kunstfaserstoff
Kunstfaser, sehr reißfest, glatt
Kunstfaser, leicht, schnelltrocknend
Naturfaser, temperaturregulierend, geruchshemmend
Vorteile
Nachteile
Typische Verwendung
Material
Eigenschaften
Begriff
Bedeutung
MVTR (g/m²/ 24h) „Moisture Vapor Transmission Rate“ → je höher, desto atmungsaktiver. 10.000+ für gute Shells.
RET
Misst den Widerstand gegen Feuchtetransport (je niedriger, desto besser). (Resistance to Evaporative Heat Transfer) < 6 = top atmungsaktiv.
CLO-Wert Wärmewiderstand (1 CLO = Wärme eines Anzugs bei 21°C)
g/m² Gramm pro Quadratmeter → Stoffgewicht (wichtig bei Merino, Fleece etc.)
DWR „Durable Water Repellent“ – wasserabweisende Oberflächenbehandlung
Ripstop Verstärktes Gewebe (z. B. Nylon) mit hoher Reißfestigkeit
Cuin
Volumen in cubic inches per ounce. Je höher, desto wärmer bei gleichem Gewicht.
Fillweight Tatsächliche Menge Daune im Produkt (z. B. 150 g) – entscheidet mit über die Wärmeleistung.
Wassersäule (mm)
Denier (D)
Misst den Wasserdruck, den ein Material aushält, bevor es durchlässt. 10.000 mm = gut, 20.000 mm+ = sehr stark
Faserdicke – je höher, desto robuster, aber auch schwerer. 20D = leicht, 70D = robust (z. B. Hardshellhosen)
Lagenaufbau z. B. 2L, 2.5L, 3L: Anzahl Schichten bei Shells
Gut gepflegte Kleidung hält länger – und funktioniert besser.
Waschen:
Material Pflegehinweis
Merino 30 °C, Wollwaschmittel, kein Weichspüler
Kunstfaser 30–40 °C, Feinwaschmittel, kein Weichspüler
Hardshell Spezialwaschmittel (z. B. Nikwax), extra Spülgang
Daune Schonwaschgang, Tennisbälle beim Trocknen verwenden, Trockner ja!
Tipp: Funktionskleidung nie zu heiß waschen, kein Weichspüler, immer auf Pflegeetikett achten!
Imprägnieren:
• Hardshells nach 3–5 Wäschen nachimprägnieren (z. B. mit Spray oder Waschimprägnierung)
• DWR lässt Wasser abperlen → Sichttest: bildet sich kein Tropfenfilm mehr → nachbehandeln!
Wenn du in die Berge gehst, gehört mehr dazu als nur die richtige Bekleidung. Eine gut gewählte Grundausstattung sorgt dafür, dass du für alle Eventualitäten gewappnet bist – von der richtigen Trinkversorgung über Orientierung in unübersichtlichem Terrain bis hin zu Sicherheit bei Verletzungen. Diese Ausrüstung macht den Unterschied zwischen einer unbeschwerten, genussvollen Wanderung und einer herausfordernden Tour, bei der es an wichtigen Dingen fehlt.
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen, die auf jeder Bergtour mit dabei sein sollten: Dein Rucksack, der alles sicher verstaut und doch leicht genug bleibt; deine Trinkversorgung, die dich auch bei langen, heißen Anstiegen immer mit der nötigen Energie versorgt; Erste-Hilfe-Ausrüstung, die im Notfall schnelle Hilfe bietet; Wanderstöcke, die deine Gelenke entlasten; und viele weitere Dinge, die du vielleicht nicht auf den ersten Blick für notwendig hältst, aber bei deiner Tour den entscheidenden Unterschied machen.
Wir schauen uns außerdem an, wie du deine Navigation sicherstellen kannst – sei es mit Karte und Kompass oder moderneren Tools – und was du für die richtige Ernährung auf dem Weg mitnehmen solltest, um fit und energiegeladen zu bleiben. Ein Hüttenschlafsack, der dich in Notfällen auch in Schlafplätzen schützt, wird ebenso thematisiert.
Eine durchdachte Grundausstattung ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern vor allem der Sicherheit. Diese Ausrüstung begleitet dich in jeder Situation und sorgt dafür, dass du dich ganz auf das Erleben der Berge konzentrieren kannst, ohne ständig an das „Was, wenn…?“ denken zu müssen.
„Was ist eigentlich der ideale Rucksack?“
Diese Frage stellen sich fast alle, die anfangen zu wandern, zu trekken oder in die Berge zu gehen. Die Antwort ist nicht pauschal – aber mit der Zeit und Erfahrung wirst du lernen, was du wirklich brauchst – und was nur mitgeschleppt wird.
Weniger ist oft mehr
• Kleinerer Rucksack = weniger unnötiger Ballast
• Leichter Rucksack = mehr Komfort, mehr Energie, weniger Blasen
Es gibt heute Rucksäcke mit 40+ Litern Volumen unter 500 g, während manche voll ausgestattete Modelle mit Rahmen, Hüftflossen und Belüftung über 2.500 g wiegen.
Welche Rucksackgröße brauche ich?
Tourtyp Literzahl Beispielinhalt
Tageswanderung 20–30 Liter Wasser, Snacks, Regenjacke, Erste Hilfe, Extra-Layer Wochenendtour 30–50 Liter + Schlafsack, Matte, Kocher, Hygiene, Wechselkleidung
Mehrtägige Tour 50–70 Liter + Proviant, Zeltplane, Zusatzausrüstung, Kamera etc. Langtrekking 60–80 Liter Je nach Versorgung, Klima, Wasserbedarf
Faktoren bei der Wahl des Rucksacks
• Tourart & Jahreszeit: Mehr Kleidung und Ausrüstung im Winter oder Hochgebirge.
• Körperbau & Rückenlänge: Rucksäcke gibt’s oft in verschiedenen Rückenlängen oder sind verstellbar.
• Persönlicher Stil: Minimalist:in oder Komfortwanderer:in?
• Aktivität: Klettersteig, Trekking, Schneeschuhgehen – oft braucht’s spezielle Features.
Worauf solltest du beim Rucksack achten?
Kriterium Warum es wichtig ist
Größe & Volumen Passend zur Tour & Ausrüstung, nicht zu groß!
Tragekomfort Verstellbare Schulter-, Hüft- & Brustgurte, weiche Polsterungen
Gewicht Je länger die Tour, desto wichtiger – Lightpacks werden beliebter
Material Reißfest, wetterfest, leicht – z. B. Robic-Nylon, Cordura
Organisation Außenfächer, Deckelfach, Netztaschen, Innenzugang etc.
Wetterschutz Integriertes Regencover oder Rucksackliner (Drybag)
Belüftungssysteme Netzrücken, Luftkanäle → beugt Hitzestau & Schweiß am Rücken vor
Richtig Packen: Technik & Tipps
Vor dem Packen:
• Packliste erstellen: Dauer, Gelände, Wetter, Notfälle bedenken
• Rucksack passend zur Tour wählen
Beim Packen:
Bereich Was rein?
Bodenfach / unten Schlafsack, leichte Kleidung, Dinge, die du tagsüber nicht brauchst Rückennah & mittig Schwere Gegenstände: Wasser, Proviant, Kocher, Zeltgestänge
Oben Regenjacke, warme Schicht, Snacks, Karte, Stirnlampe, Buff
Seitentaschen Trinkflasche, Müllbeutel, leichte Snacks
Deckelfach Erste Hilfe, Sonnencreme, Multitool, Feuerzeug, Handy Außen befestigt Wanderstöcke, Isomatte, Gamaschen (gesichert!)
Packhilfen
• Packsäcke oder Zipbeutel: Organisation & Nässeschutz
• Rucksackliner (Müllsack oder Drybag): Schutz gegen Regen, besonders an der Rückenpartie
• Ultraleicht-Tipp: Müllsack aus stabilem Material statt Regenhülle spart Gewicht & Platz
Rucksackgewicht – wie viel ist „ok“?
Tourtyp
Durchschnittsgewicht gepackt
Tageswanderung 5–7 kg
Wochenendtour (2–3 Tage) 8–12 kg
Trekking (3–7 Tage) 12–18 kg
Langtour (>7 Tage) 15–20 kg (mit leichter Ausrüstung)
Faustregel: Rucksackgewicht max. 20–25 % deines Körpergewichts –sonst leidet der Rücken.
Tragekomfort: Gurte richtig einstellen
Allgemein:
• Hüftgurt: Trägt 60–70 % des Gewichts, sitzt auf dem Beckenknochen
• Brustgurt: Stabilisiert, sollte nicht die Atmung einschränken
• Schultergurte: So einstellen, dass der Rucksack rückennah sitzt
Beim Aufstieg:
• Hüftgurt leicht lockern
• Schultergurte straffer ziehen
• Brustgurt leicht anziehen
Beim Abstieg:
• Hüftgurt fester schnallen
• Schultergurte etwas lockern
• Brustgurt nach Bedarf justieren
Mythos: Je größer der Rucksack, desto besser?
Nein! Große Rucksäcke verleiten zum Überpacken. Mehr Volumen = mehr Gewicht = mehr Belastung.
→ Lieber klein & durchdacht packen, als groß & chaotisch.
Tipp: Vorab testen!
• Vor der Tour mit realistischem Gewicht einlaufen (z. B. Wasserflaschen)
• Gurte nachjustieren → Druckstellen & Blasen vermeiden
• Unterschiedliche Packvarianten ausprobieren (Balance!)
Bonus: Bücher im Rucksack als Gewichte = unterwegs was zu lesen.
Zusatz-Tipp: Rücken nass trotz Regenhülle? Rucksackcover schützen nur von außen – die Rückenpartie bleibt oft ungeschützt → Wasser läuft vom Rücken rein.
→ Liner oder Müllsack im Inneren = besserer Nässeschutz bei Dauerregen.
Der Rucksack ist das Zentrum deiner Ausrüstung:
• Er trägt nicht nur dein Equipment, sondern beeinflusst deinen Komfort, deine Energie & Sicherheit.
• Es gibt nicht den einen perfekten Rucksack, aber mit der Zeit wirst du mehrere Modelle für verschiedene Touren besitzen – und genau wissen, wann welcher passt.
Tipp: Dein größter Gegner? Die Kofferwaage. Was wiegt dein Rucksack eigentlich, wenn alles drin ist? Die Antwort kann ganz schön ernüchternd sein. Deshalb: Hinterfrag jedes Teil.
Muss wirklich jeder Gegenstand eine eigene Hülle haben? Braucht dein Schlafsack einen extra Packsack im Packsack? Und wie viele kleine Taschen brauchst du wirklich? Diese „Kleinigkeiten“ summieren sich – schnell sind 500 Gramm oder mehr nur für Verpackung und Ordnungssysteme draufgegangen.
Schmeiß konsequent alles raus, was nicht nötig ist.
Viele Packsäcke, die bei Ausrüstungsteilen dabei sind, sind super –aber eher für die Lagerung daheim. Unterwegs zählt jedes Gramm. Wenn du Ordnung brauchst, kannst du auch leichtere Alternativen verwenden, oder Dinge direkt im Rucksack organisieren.
Beispiel Isomatte: Die braucht keine zusätzliche Hülle. Ein einfaches Gummiband tut’s vollkommen – spart Platz und Gewicht
Tolle Lösung sind Zip-Beutel aus dem Supermarkt z.B. als Kulturbeutel, um Kabel und Technik aufzubewahren,…
„Ein Kasten Sprudel auf dem Rücken?“
Nein danke. Wer draußen unterwegs ist – egal ob für einen Tag oder eine Woche – braucht eine durchdachte und zuverlässige Trinkstrategie. Hier ein Überblick über die besten Systeme und Lösungen für Bergsport, Trekking und Abenteuer.
Softflasks
Sind flexible, zusammenfaltbare Trinkflaschen – meist aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) oder Silikon. Besonders beliebt bei Trailrunnern, aber auch beim Bergwandern extrem praktisch.
Vorteil
Beschreibung
Ultraleicht Spart Gewicht – 0,5 L Flask wiegt oft unter 50 g leer
Platzsparend Lässt sich leer klein zusammenrollen
Einfache Handhabung Mit Beißventil oder Schraubverschluss, einhändig bedienbar
Ideal für Fronttaschen Perfekt für elastische Taschen am Schulterträger oder Hüftgurt
Tipp: Einige Modelle lassen sich mit Wasserfiltern kombinieren – z. B. der Sawyer Mini wird direkt auf die Flasche geschraubt!
Trinkblasen
Sind flexible Wasserspeicher mit Schlauchsystem. Sie werden im Rucksack verstaut und ermöglichen kontinuierliches Trinken unterwegs.
Vorteil Warum praktisch?
Bequemer Zugriff Du trinkst, ohne Rucksack abzunehmen
Gewichtsverteilung Wird am Rücken platziert → ausgewogene Lastverteilung
Volumenvielfalt Typisch 1,5 L – 3 L, oft mit Skala zur Kontrolle
Kompatibel
Integrierbare Schlauchdurchführung bei vielen Rucksack-Modellen
Vorsicht: Es gibt auch bedeutende Nachteile!
• Schwitzwasser bei kaltem Wasser → Ausrüstung im Rucksack wird nass
• Mundstück kann einfrieren (Winter!) – auch mit Isolierung
• Umständliches Nachfüllen, wenn sie tief im Rucksack steckt
• Plastikgeschmack bei manchen Modellen
• Keine Kontrolle des Füllstands → Überraschung, wenn leer
• Platzbedarf vs. Schutz → vor spitzen Gegenständen schützen
• Aufwendige Reinigung (alles muss zerlegt werden)
Tipp: Wenn du nicht auf die Vorzüge des Trinkschlauchs verzichten möchtest: Nutze den Convertube von Source oder ähnlichesdamit machst du jede PET-Flasche zu einem Trinksystem – ideal als Hybridlösung!
Wasserfilter
Sind gerade bei Mehrtagestouren, in warmem Klima oder abgelegenen Regionen unverzichtbar. Sie machen Wasser aus Bächen, Quellen oder Pfützen sicher(er) trinkbar.
Arten von Wasserfiltern:
Typ Funktion / Vorteil Nachteil
Pumpfilter
Mechanisch betrieben, hoher Durchsatz Größer, schwerer
SqueezeFilter Leicht, mobil (z. B. Sawyer Mini)
Schwerkraft filter
Chemische Methoden
Weniger geeignet bei trübem Wasser
Ideal für Gruppen, kein Pumpen nötig Benötigt Aufhängemöglichkeit
Tabletten oder Tropfen, leicht & simpel Wartezeit nötig, ggf. Geschmack
UV-C (z. B. Steripen) – tötet Viren & Bakterien Batterieabhängig, keine Filterleistung bei Partikeln
WICHTIG: Immer Filtern bei Wildwasser – auch klare Quellen können
Keime enthalten!
Elektrolyte & Zusätze – Flüssigkeit ≠ Hydratation
Wasser allein reicht nicht immer – gerade bei Hitze, Höhenluft oder starker Belastung brauchst du Elektrolyte, um Mineralienverluste durch Schweiß auszugleichen.
Warum sinnvoll? Wirkung
Ausgleich von Elektrolytverlusten
Schnellere
Wasseraufnahme
Vermeidung von Hyponatriämie
Natrium, Magnesium, Kalium → gegen Krämpfe, Müdigkeit
Salze helfen dem Körper, Wasser besser zu speichern
(Zu viel Wasser, zu wenig Salz = gefährlich!)
Energieversorgung Viele Elektrolytprodukte enthalten auch Zucker
Regeneration & Leistungserhalt
Hilft, länger fit zu bleiben – besonders bei Mehrtagestouren
Wann besonders wichtig?
• Längere Touren (3h+)
• Intensive Etappen / starke Höhenmeter
• Heißes Wetter oder Wüstenklima
• Starke Schweißverluste / Höhenluft
Tipp: Tabletten, Pulversticks oder Kapseln – so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Nicht überdosieren!
Zusammengefasst: Systeme & Strategien im Überblick
System / Helfer Ideal für…
Softflask
Trinkblase
Leichte Tagestouren, Trailrunning
Dauerhafte Hydratation bei Bewegung
Besonderheit / Beachten!
Kompakt, ideal für Fronttaschen
Komfortabel, aber nicht perfekt wintertauglich
Convertube Mischform für Minimalisten Spart Gewicht & bleibt vielseitig
Wasserfilter
Mehrtagestouren, Wildnis, heiße Klimazonen
Elektrolyte Hitze, Höhe, lange Strecken
Thermosflasche Winter, Tagestouren mit heißen Getränken
Macht unabhängig von Versorgungsstellen
Stützt Leistungsfähigkeit & Wasseraufnahme
Auch für Suppe oder Brühe top!
Die Trinkversorgung ist nicht nur logistisch wichtig – sie ist gesundheitsrelevant. Wer unterwegs dehydriert, wird langsamer, unsicherer und anfälliger für Fehler. Ein durchdachtes Trinksystem spart Zeit, Gewicht, Platz und Energie – und kann im Ernstfall über Wohl & Wehe einer Tour entscheiden.
„Was du mitträgst, musst du auch bedienen können.“
Die beste Ausrüstung hilft nichts, wenn man sie im Ernstfall nicht nutzen kann. Deshalb gilt: Erste Hilfe ist Pflicht – und regelmäßige Auffrischung ebenso.
Ein gut gepacktes und durchdachtes Erste-Hilfe-Set sollte auf deine Tour, deine Gruppe und deine Kenntnisse angepasst sein.
Grundausstattung für die Erste Hilfe am Berg
Verbandsmaterialien:
Inhalt Funktion
Sterile Wundauflagen & Pflaster Schutz & Abdeckung kleinerer Wunden
Mullbinden Fixierung, leichte Druckverbände
Kompressen & Verbandtücher Reinigung, Abdeckung größerer Wunden
Selbsthaftende Fixierbinden (Cohesive) Kein Knoten nötig, stabil & elastisch
Dreieckstuch Armschlinge, Druckverband, Schiene
Desinfektion & Schutz:
• Desinfektionstücher oder -spray
• Einmalhandschuhe (mind. 2 Paar) – für Eigenschutz & Hygiene
• Müllbeutel / Zipbeutel für kontaminierte Materialien
Werkzeuge & Helferlein:
Werkzeug
Rettungsdecke
Erste-Hilfe-Schere
Warum dabei?
Gegen Unterkühlung / Hitzeschutz, extrem leicht
Zum Schneiden von Verbänden & Kleidung
Pinzette / Zeckenzange Für Splitter, Stacheln, Zecken etc.
Klebeband / Leukoplast Fixieren, improvisieren, Hautblasen versorgen
Signalpfeife Für akustische Notsignale ohne viel Kraftaufwand
Medikamente (Basisausstattung):
Typ Anwendung
Schmerzmittel
Antihistaminikum
Paracetamol, Ibuprofen – gegen Schmerzen & Fieber
Z. B. Cetirizin – bei allergischen Reaktionen
Individuelle Medikation Asthmaspray, Insulin, EpiPen etc.
Sonstiges & oft Vergessenes:
• Notfallkarte: Mit medizinischen Infos + Notfallkontakt
• Kompakte Stirnlampe / Taschenlampe (+ Ersatzbatterien)
• Erste-Hilfe-Kurzanleitung – Outdoor-tauglich laminiert oder wasserfest
• Bleistift & Papier – zur Notfalldokumentation oder für Notsignale
Erste Hilfe ist kein Hexenwerk – aber muss geübt sein!
Hinweis:
• Kenn deine Ausrüstung! – Übe den Umgang mit Verbänden & Co.
• Besuche regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse, am besten mit Bergbezug
• Mach dich mit S.O.S.-Zeichen & Signalen vertraut
Zusatzwissen: Notsignale & Helikopterrettung
Signalart
Bedeutung
Akustisch: 6 Töne / Rufe pro Minute – 1 Min. Pause → wiederholen Ich benötige Hilfe!
Optisch: 6 Lichtsignale / Blinkzeichen – 1 Min. Pause → wiederholen Ich benötige Hilfe!
Antwort: 3x pro Minute Hilfe unterwegs!
Handzeichen für Helikopterrettung
Geste
Bedeutung
Y – Arme nach oben „Ja – Landen!“
N – ein Arm oben, einer unten „Nein – nicht landen!“
Merken:
• 6 = „Ich brauche Hilfe“
• 3 = „Ich habe dich gehört / Hilfe kommt“
Diese Signale gelten international – egal ob per Hubschrauber, Bergwacht oder Wildnisrettung.
Pack-Tipps für dein Erste-Hilfe-Set
• Wasserdicht verpacken – z. B. in Zipbeutel oder Drybag
• In separater Tasche oder Fach → schnell erreichbar
• Alle Packungen beschriften → schneller Zugriff im Stress
• Regelmäßig checken: Haltbarkeit, Vollständigkeit, Sauberkeit
• Set nicht überladen – sondern an die Gruppengröße anpassen
Fazit:
Dein Erste-Hilfe-Set muss nicht riesig, aber funktional, durchdacht & griffbereit sein.
Vor allem aber: Du musst wissen, wie du damit umgehst.
Regelmäßiges Üben, Schulung & Auffrischung sind essenziell – denn wenn’s drauf ankommt, zählt jede Sekunde.
Tipp:
Pack dein Erste-Hilfe-Set mit System. Kein loses Chaos im Beutel –sondern klare Ordnung.
➤ z. B. Blasenversorgung extra, Wunden extra, Medikamente separat.
Neben der Standard-Erste-Hilfe-Ausrüstung gibt es eine ganze Reihe von potenziell sehr hilfreichen Ergänzungen, die je nach Tour, Umfeld, Vorerkrankungen oder persönlicher Vorliebe viel Sinn machen können.
Diese Liste soll als Inspiration dienen – sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will dich anregen, dein Set bewusst und persönlich anzupassen.
Zusätzliche Medikamente & Pflegeprodukte:
Ergänzung
Blasenpflaster
Wofür hilfreich?
Klassiker – bei neuen Schuhen oder empfindlichen Füßen
Wundsalbe / -gel Für kleine Schnitte, Schürfwunden oder Reizungen
Kohletabletten Bei akutem Durchfall (z. B. durch verunreinigtes Wasser)
Antiemetika Gegen Übelkeit / Erbrechen (z. B. Vomex)
Kopfschmerztabletten Z. B. bei Höhenanpassung oder als Begleitsymptom
Jodsalbe / Antiseptikum Zur Wunddesinfektion
Magnesium + Calcium Bei Muskelkrämpfen oder als Regenerationshilfe
Lippenbalsam mit LSF UV-Schutz nicht vergessen – gerade in Höhenlagen wichtig
Hirschtalg (z. B. Stick) Für Fußpflege, Hautschutz, Vorbeugung gegen Blasen
Tipp: Tabletten in kleine Druckverschlussbeutel verpacken, beschriften & Haltbarkeitsdatum notieren!
Erweiterte Wund- und Verbandversorgung
Produkt
Warum es Sinn macht
Zusätzliche Kompressen Für größere Verletzungen oder längere Touren
Selbstklebender Verband Schnell anzulegen, gut zur Fixierung kleinerer Wunden
Klammerpflaster Kleine, klaffende Schnitte zusammendrücken
Reißverschluss-Pflaster „Kabelbinder“-System für tiefe Wunden – schließt & schützt
SAM-Splint Schiene Formbare, leichte Universalschiene – Verdacht auf Fraktur
Israelische Wundauflage Druckverband + Wundabdeckung in einem
Hinweis: Besonders bei Gruppen- oder Hochgebirgstouren sinnvoll –aber auch auf Solo-Touren kein Fehler!
Insekten & Sonne – Schutz & Versorgung
Ergänzung
Anwendung / Warum wichtig
Mückenspray / Zeckenschutz Je nach Region & Jahreszeit sinnvoller Standard
Stichgel (z. B. Fenistil) Nach Insektenstichen zur Linderung
Giftpumpe / Saugstempel
Zum Absaugen von Insektengift
Aftersun-Creme Zur Linderung von Sonnenbrand
Sonnencreme (LSF 30+) Pflicht ab 1500 m – auch im Frühling/Winter
Klein, aber hilfreich – oft unterschätzt
• Tiger Balm / Arnika-Salbe / Wärmepflaster:
→ Hilfe bei Verspannungen vom Rucksack oder muskulären Überlastungen
• Taschenwärmer (Handwärmer / Einweg-Gel-Kissen):
→ Bei Kälte, z. B. für Finger, Zehen oder auf den Nacken
• Tampons:
→ Nicht nur für Menstruation, sondern als Not-Verband / Zunder
Tipp: Tuben & Flüssigkeiten in kleinen Druckverschlussbeuteln verpacken → verhindert Auslaufen im Rucksack!
Zeckenspray gibt es auch für die Kleidung zeigt großartige Wirkung!
Wichtiger Hinweis zu Aspirin / ASS
Aspirin (ASS) wird häufig als Schmerzmittel mitgenommen – beim Bergsport ist es jedoch kritisch!
ASS wirkt blutverdünnend, was bei Verletzungen (v. a. Kopfverletzungen nach Stürzen) zu gefährlicher innerer Blutung führen kann.
Lieber Ibuprofen oder Paracetamol mitnehmen – sicherer & ebenso wirksam gegen Schmerzen.
Fazit: Anpassen, aber nicht überladen
• Diese Ergänzungen sind kein Muss, aber echte Helfer je nach Tour, Klima, Vorerkrankung oder Gruppengröße.
• Denk daran: Du musst wissen, wie du sie einsetzt!
• Alles regelmäßig überprüfen, pflegen und austauschen – nichts ist ärgerlicher als abgelaufene oder unbrauchbare Mittel im Ernstfall.
Ein Notfall-Biwaksack (auch Rettungsbiwak oder Survival Bivy) gehört zu den am meisten unterschätzten, aber wichtigsten Teilen deiner Sicherheitsausrüstung – auch auf kurzen Touren.
Er schützt dich bei plötzlichem Wetterumschwung, Verletzung, Orientierungslosigkeit oder ungeplanter Übernachtung im Freien – und kann im Ernstfall Leben retten.
Warum ein Biwaksack unverzichtbar ist:
Vorteil Bedeutung
Schutz vor Witterung Hält Regen, Wind, Schnee ab – schützt vor Auskühlung
Wärmeerhalt
Sichtbarkeit
Reflektiert Körperwärme – beugt Unterkühlung vor
Leuchtende Farben + Reflektoren helfen bei Luftrettung
Kompakt & leicht Wiegt oft < 300 g, passt in jede Seitentasche
Notfallreserve Für Verletzte, orientierungslose Personen oder Nachtbiwaks
Vielseitigkeit
Pflicht!
Als Schlafsack-Upgrade, Zeltliner, improvisierte Trage etc.
Bei Notfällen in den Bergen zählt oft jede Minute – aber keine Netzabdeckung ist keine Seltenheit.
Deshalb: Nie auf ein einziges Gerät verlassen, sondern bewusst redundant planen.
Smartphone – dein erstes Notfallmittel:
• Notrufnummer einspeichern: z. B. 112 (Europa) / 144 (CH)
• Offline-fähige Karten & GPS-App installieren
• Notfall-Apps für deine Region: z. B. SOS EU ALP oder Echo112
Hinweis: Einige moderne Smartphones (z. B. iPhones ab 14) unterstützen SOS per Satellit – auch ohne Netzempfang!
Satelliten-Kommunikatoren – wenn wirklich nichts mehr geht:
Gerät (Beispiele) Funktion / Vorteil
Garmin inReach Mini
GPS-Tracker + Zwei-Wege-Kommunikation + NotfallSOS per Satellit
Personal Locator Beacon Reines Notsignalgerät – sendet SOS + Position auf Notfrequenz
Vorteil: Funktionieren weltweit ohne Mobilfunknetz – ideal für abgelegene Gebiete oder Solo-Touren
Nachteil: Der Service ist extrem teuer! Bei Garmin z.B.: Gerät + Aktivierungsgebühr + Abonnement
Stromversorgung: Powerbanks nicht vergessen!
• Mindestens 1 Powerbank mitführen (z. B. 10.000–20.000 mAh)
• In der kalten Jahreszeit geschützt aufbewahren – z. B. in einer Socke im Rucksack oder am Körper
• Handy im Flugmodus → erhöht Akkulaufzeit drastisch
• Hinweis: „Mein Handy hält schon durch“ → Leider nicht bei -5 °C. Kälte entlädt Akkus bis zu 5x schneller.
Entsprechend benötigte Kabel nicht vergessen!
Weiteres Nützliches:
Hilfsmittel
Signalpfeife
Nutzen
Auch bei Erschöpfung hörbar – kein Schreien nötig
Spiegel / Reflektor Für visuelle Signale bei Sonne – sehr weit sichtbar Stirnlampe mit Blinkfunktion Hilfreich bei Nacht oder in der Dämmerung
RECCO – Extra-Sicherheit für den Notfall
Kleine, wartungsfreie Chips, die in Kleidung, Helmen oder Ausrüstung verbaut sind oder aber nachträglich hinzugefügt werden können. Sie ermöglichen es Rettungskräften, vermisste Personen mithilfe spezieller Suchgeräte zu orten. Besonders beim alpinen Bergsteigen, wo Hubschrauber mit Recco-Detektoren zum Einsatz kommen können, ist das System eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Notfallausrüstung. Recco ersetzt keine aktive Ortung wie GPS oder Funk, erhöht aber die Chance, im Ernstfall schneller gefunden zu werden.
Tourenplanung + Info an Dritte:
Kein Gadget, aber ein Muss: Immer jemandem mitteilen, wohin du gehst und wann du zurück sein willst – das erleichtert jede Suche enorm.
Biometrische Notfallarmbänder / Smartwatches:
Manche Modelle senden bei Unfällen automatisch Notrufe und/oder tracken Vitaldaten.
Fazit: Vorbereitung statt Panik
Ein Biwaksack schützt – ein Notrufgerät rettet. Ob du alleine unterwegs bist oder in der Gruppe: Mit der richtigen Ausrüstung gewinnst du Zeit, Sicherheit & Handlungsspielraum, wenn’s brenzlig wird.
Wer plant, braucht keine Panik. Wer nur hofft, braucht oft Glück.
Nicht alle halten sie für essenziell – aber wer sie nutzt, weiß: Trekkingstöcke bieten Komfort, Sicherheit und Entlastung.
Warum Wanderstöcke sinnvoll sind:
Vorteil Wirkung
Stabilität
Bessere Balance auf unebenem und steilem Gelände
Entlastung der Gelenke Bergab – reduziert Druck auf Knie, Hüfte & Sprunggelenke
Effizientere Bewegung Arme arbeiten mit → Kraftverteilung, weniger Ermüdung
Mehr Sicherheit Halt auf rutschigem Untergrund oder Schnee
Muskelunterstützung Beine werden entlastet, Armmuskulatur unterstützt aktiv
Materialien im Überblick:
Material Vorteile
Aluminium
Günstig, robust, biegsam (knickt, bricht nicht sofort)
Carbon Leicht, vibrationsdämpfend, steif
Stock-Typen: Aufbau & Funktion:
Typ Vorteile
Teleskopstock Länge individuell verstellbar, außen tragbar
Faltstock Ultrakompakt, leicht
Nachteile
Etwas schwerer, kann bei Kälte unangenehm sein
Teurer, kann bei Überlastung plötzlich brechen
Nachteile
Etwas schwerer, mehr Mechanik = mehr Fehlerquellen
Längenverstellung begrenzt, oft im Rucksack verstaut
Einsegment-Stock Leicht, stabil, keine Gelenke Nicht verstellbar, unhandlich im Transport
Griffe:
Material Vorteile
Nachteile
Kork Passt sich an, rutschfest, isoliert gut Etwas teurer
Schaumstoff (EVA) Weich, leicht, angenehm
Nutzt sich schneller ab Gummi Robust, gut bei Nässe Kann kleben, schwitzig
Tipp: Ein verlängertes Griffstück am Schaft hilft bergauf – du musst den Stock nicht ständig verstellen.
Weitere Merkmale:
• Stoßdämpfungssysteme: Federung bei Aufprall – entlastet bergab
• Verschlusssysteme:
◦ Drehverschluss: klassisch, aber anfällig für Verdrehen
◦ Klemmverschluss: stabil & einfach
◦ Klicksystem: z. B. Faltstöcken = schnell auf- & zusammenklappbar
• Spitzen & Aufsätze:
◦ Hartmetallspitze: für Fels & unbefestigte Wege
◦ Gummipuffer: für Asphalt / Stein
◦ Schneeteller: gegen Einsinken im Tiefschnee
Empfehlungen nach Tourtyp:
Einsatzbereich Ideal geeignet sind…
Tageswanderung Alu- oder Carbonstöcke, Schaumstoffgriff, Teleskopsystem
Mehrtages-/Alpentouren Robuste Alustöcke mit Korkgriff, Stoßdämpfer, verstellbar
Wintertour / Schneeschuh Alustock, Schneeteller, Gummigriff oder isolierter Kork
Ultraleicht-Trekking Carbon-Faltstöcke, fix oder minimal verstellbar
Für Klettersteiggeher sind Faltstöcke empfohlen, da diese im Rucksack verschwinden und dadurch ein Verlust oder hängen bleiben an Hindernissen vermieden werden kann.
Hinweis: Carbonbruch =oft irreparabel. Aluminium ist robuster im Alltag.
Stock richtig einstellen:
Faustregel:
Körpergröße x 0,68 = optimale Stocklänge für flaches Gelände
Beispiel: 1,75 m → 1,75 x 0,68 ≈ 119 cm
Gelände Einstellung
Flach 90°-Ellenbogenwinkel → Grundstellung
Bergauf Kürzer stellen → besserer Druck nach vorne
Bergab Länger stellen → mehr Dämpfung für Knie
Hangquerung Hangseitiger Stock kürzer, Talseitiger länger
Handschlaufen? Unbedingt!
• Entlasten die Hände
• Stabilisieren die Führung
• Verhindern Verlieren bei Loslassen
Richtig nutzen: Von unten nach oben in die Schlaufe greifen = mehr Kontrolle.
Fazit:
Ob Carbon oder Aluminium, faltbar oder teleskopisch: Der beste Stock ist der, den du auch benutzt. Teste verschiedene Modelle – es lohnt sich!
Wer einmal mit Stöcken unterwegs war, möchte oft nicht mehr ohne.
Tipps:
• Wer sich unsicher ist: Ausleihen & ausprobieren!
• Spitzen immer schützend abdecken wenn die Stöcke im Rucksack verstaut werden, sonst gibts Löcher.
• Spitzen außen am Rucksack immer nach unten - zur Sicherheit!
Hinweis:
Die eigene Erfahrung zeigt, das Faltstöcke im Rucksack seltener benutzt werden, weil man sich im „Flow“ befindet und dann keine Lust hat den Rucksack abzuziehen.
Klein, leicht – und kann im Ernstfall den Unterschied machen: Die Stirnlampe gehört in jeden Rucksack, egal ob Tageswanderung oder Mehrtagestour. Denn: Es wird schneller dunkel, als du denkst.
Warum eine Stirnlampe unverzichtbar ist:
Vorteil
Hände frei
Sicherheit
Warum es zählt
Beim Navigieren, Kartenlesen, Biwakieren oder bei Notfällen
Gesehen werden = weniger Risiko, besserer Überblick
Pfadbeleuchtung Auf Wegen, bei Auf- & Abstieg oder Bachquerungen
Camp-Tauglichkeit Zelt aufbauen, Kochen, Waschen – alles mit Licht
Notfallbeleuchtung Orientierung bei Nacht, Verletztenversorgung, Signale geben
Tipp: Auch bei Tagestouren einpacken – eine Stirnlampe ist wie ein Sicherheitsgurt: Lieber haben als brauchen.
Hybridmodelle: Akku + Batterie = doppelte Sicherheit:
Vorteil
Flexibilität
Warum es sinnvoll ist
Akku im Alltag → Batterien als Backup in der Wildnis
Nachhaltigkeit Weniger Einwegmüll durch USB-Ladung
Längere Laufzeit
Akkus = stabilere Leistung über Zeit
Tipp: Modelle mit USB-C-Ladung sparen Kabel-Chaos im Rucksack. Einige Lampen laden sogar direkt per Powerbank unterwegs.
Rotlichtfunktion – klein, aber mächtig
Vorteil
Erhalt der Nachtsicht
Wann nützlich?
Ideal beim Kartenlesen, Kochen, leise Umgebung
Kein Blenden Auf Hütten, im Biwak, bei Gruppenaktivitäten
Tierbeobachtung / Diskretion Für Wildbeobachtung oder nächtliche Kloausflüge
Hightech auf dem Trail
Beispiel: PETZL Swift RL (900 lm)
- REACTIVE LIGHTING automatische Lichtanpassung (ähnlich FernlichtAutomatik im Auto). Die Lampe erkennt Reflektionen (z. B. Schilder, Personen) und dimmt selbstständig = Effizienz & Akkuschonung.
Lumen – wie hell muss es sein?
Lumen-Bereich Eignung
100–200 Lumen Zeltleben, Kochen, Lesen – reicht für Nahbereich
200–400 Lumen Normale Wanderungen, Biwakieren, Lager
400–600 Lumen Technisches Gelände, Bergtouren, Nachtwanderungen
600+ Lumen Extrem hell, lange Reichweite – für schwierige Bedingungen
Hinweis: Viele Stirnlampen werben mit Maximalwerten, die nur für kurze Boost-Phasen gelten. Danach dimmt die Lampe automatisch herunter → Akkuschutz & Hitzeregulierung.
Diese Info steht oft versteckt im Datenblatt – genau hinschauen!
Wasserfestigkeit – was heißt eigentlich IPX?
IPX-Wert Bedeutung
IPX4 Spritzwassergeschützt → reicht für Regen
IPX6+ Strahlwasser / starker Regen / Schnee
IPX7+ Kurzzeitig untertauchbar (nicht bei allen nötig, aber top im Winter)
Tipp: In Hardshell-Innentasche oder Zipbeutel aufbewahren – schützt vor Feuchtigkeit im Rucksack.
Weitere Einsatzmöglichkeiten in der Praxis:
• Signal geben: Blinkfunktion verwenden – bei Nacht weit sichtbar
• Pupillen prüfen: Bei Kopfverletzungen wichtig für Erste Hilfe
• Notbiwak: Lichtquelle, Sicherheit & psychologische Beruhigung
• Reparaturen durchführen: Unterwegs oder im Camp
Fazit:
Die Stirnlampe – kleines Gewicht, große Wirkung Sie ist leicht, effektiv und vielseitig – und im Notfall unbezahlbar. Ob beim Sonnenaufgangs-Start, im Biwak oder bei ungeplanten Verzögerungen: Ohne Licht wird alles schwerer.
Tipp:
Lieber eine zuverlässige Stirnlampe + Ersatz-Akku + einfache Backuplampe (z. B. Mini-LED oder Schlüsselanhängerlampe) im Rucksack. Denn: Ohne Licht? → Keine sichere Tour.
Klar, moderne Technik ist verlockend. Aber im Gelände gilt: Was keinen Akku braucht, bringt dich im Zweifelsfall zurück.
Navigation ist nicht nur für Profis – sie beginnt vor der Tour.
Grundausstattung zur Orientierung:
Hilfsmittel
Funktion / Wichtigkeit
Topografische Karte Zeigt Geländeformen, Wege, Wasserquellen & Höhenschichtlinien
Kompass / Planzeiger Richtungsbestimmung & Orientierung an Kartenmerkmalen Höhenmesser Bestimmung der Höhe zur besseren Standort-Eingrenzung
Smartphone mit App Navigation per GPS, z. B. mit Komoot, Locus, Organic Maps
GPS-Gerät Robust, unabhängig vom Mobilfunknetz, lange Laufzeit
Tipp: Analog + Digital kombinieren! Eine Karte kann nicht abstürzen –dein Akku schon
Vor der Tour – Vorbereitung ist alles:
• Route planen: Wege, Abkürzungen, Notunterkünfte kennen
• Offline-Karten speichern: Apps wie Locus Map, Komoot,…
• Wetter prüfen: Nebel, Schneefall oder Starkregen = Sichtverlust
• Tour mental durchgehen: „Was erwartet mich wo?“
• Geländeanalyse: Höhenlinien lesen – wie steil ist es wirklich?
Während der Tour – aufmerksam bleiben
Handlung
Warum sinnvoll
Regelmäßig Standort checken Nicht erst, wenn du dich unsicher fühlst Höhenmesser abgleichen Lage besser eingrenzen, v. a. im Nebel
Wegmarkierungen beachten Farbcode (z. B. rot-weiß = Wanderweg, blau = alpin) „Zurück zum letzten Punkt“ Wenn unklar: besser umdrehen als verirren
Tipp: Viele Outdoor-Apps zeigen aktuelle Position, Höhe & geplanten Track – aber: GPS braucht Sicht zum Himmel.
Im Notfall: Was tun?
• Ruhe bewahren, kein blinder Aktionismus
• Standort ermitteln: per GPS, Karte + Höhenmeter kombinieren
• Notruf absetzen:
◦ 112 in ganz Europa
◦ 140 in Österreich (Alpinnotruf)
• Position durchgeben: Koordinaten, Höhe, markante Umgebung
• Warten, nicht umherirren! → bessere Chance gefunden zu werden
Lern aus Fehlern – meine eigene Geschichte
Ich hatte alles dabei – dachte ich:
• Neues Handy ✔

• Powerbank ✔

• Offline-Karten ✔

Navigiert, dabei ein Hörbuch gehört, Fotos gemacht – und zack: Akku leer. Kein Problem, dachte ich – Powerbank raus… falsches Kabel dabei. Ohne Karte. Ohne Reserve.
Rettung? Eine Hütte, auf der ich mein Handy laden durfte.
Verloren: 2 Stunden, Energie, Nerven.
Merke: Technik ist gut – Redundanz ist besser.
Fazit: Navigation = Wissen, wo du bist – nicht nur, wo du hinwillst.
Papierkarte & Kompass bleiben Basics.
Auch wenn du ein GPS nutzt – ohne Backup keine Sicherheit. Regelmäßiges Üben mit Karte & Kompass lohnt sich – und gibt dir Selbstvertrauen, wenn die Technik versagt.
Tipp:
Karte & Kompass nicht nur haben, sondern auch nutzen können –notfalls nochmal Grundlagen auffrischen.
Beim Wandern & Bergsteigen braucht dein Körper viel Energie – nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch Kälte, Höhe und lange Belastung.Mit der richtigen Ernährung bleibst du leistungsfähig, wach und motiviert.
Die Brotzeit lebt – klassisch & sinnvoll
Egal ob belegtes Vollkornbrot oder Reiswaffel mit Nussmus:
Die klassische Brotzeit ist nachhaltig, nahrhaft und individuell anpassbar. Am besten verpackt in Bienenwachstüchern, wiederverwendbaren Boxen oder Zip-Beuteln.
Schnelle Energie – für den schnellen Boost!
Snack Warum er hilft
Trockenfrüchte (z. B. Datteln, Aprikosen) Natürlicher Zucker, Mineralstoffe
Nüsse & Kerne
Fett + Eiweiß = Energiebombe mit Biss (Müsli-/Energie-)Riegel
Fruchtschnitten
Traubenzucker / Energy-Gels
Kompakt, haltbar, viele Varianten
Fruchtzucker + Ballaststoffe
Notfall-Booster – schnell, aber kurz
Langfristige Energie – für Ausdauer & Sättigung
Snack / Mahlzeit
Vollkornbrot mit Käse / Nussmus
Vorteile
Langanhaltend, gut zu transportieren
Haferflocken-Mix (z. B. mit Nüssen, Früchten) Perfekt als Frühstück oder als Kaltmahlzeit
Hartkäse & Trockenwurst (z. B. Landjäger)
Couscous-/Reissalat
Gefriergetrocknete Outdoornahrung
Weitere gute Energiequellen:
Haltbar, nahrhaft, proteinreich
Gut vorzubereiten, sättigt lange
Leicht, heißes Wasser genügt, viele Varianten
• Kokosprodukte (Wasser, Chips) – Elektrolyte & Energie
• Getrocknetes Fleisch (Jerky) – Protein pur
• Dunkle Schokolade – Kakao, Fett & Seelennahrung
• Bananen – Kalium, Kohlenhydrate, leicht verdaulich
• Vollkorn-Cracker oder Cerealien – ballaststoffreich und kompakt
Tipps zur Ernährung unterwegs
• Alle 1–2 Stunden kleine Snacks essen → vor dem Hunger!
• Energiequellen mischen → schneller + langanhaltender Effekt
• Leicht & nahrhaft statt schwer & fettig
• Immer eine Notration dabeihaben
• Müll vermeiden – alles wieder mitnehmen
Tipp: Teste dein Essen vorher auf kurzen Touren → so weißt du, was du gut verträgst! UND was dir schmeckt!!!
Geheimwaffe: Warme Brühe in der Thermosflasche
• Gibt Wärme, Flüssigkeit & Salz
• Schont den Magen
• Stärkt Körper & Geist bei Kälte oder Erschöpfung
Hinweise:
• „Alkohol wärmt“ → Falsch! Er kühlt durch Gefäßerweiterung
• „Schnee einfach schmelzen“ → Schadet! Ohne Aufbereitung fehlen
Elektrolyte → Dehydration möglich
Ob Alpenvereinshütte, Trekkinghütte in Norwegen oder Gästehaus in Nepal – ein Hüttenschlafsack gehört immer mit ins Gepäck!
Nicht nur weil er, wie die Hüttenschuhe, Pflicht in vielen Hütten ist, sondern auch weil er dir mehr Hygiene, Komfort und Flexibilität bietet.
Was ist ein Hüttenschlafsack?
Ein Hüttenschlafsack – auch Schlafsackinlet / Schlafsackliner genannt – ist eine dünne, waschbare Innenschicht, in der du direkt schläfst.
Er ersetzt auf Hütten das Laken/den Schlafsackbezug und kann im Schlafsack als wärmende Zusatzschicht dienen.
Warum ein Hüttenschlafsack dazugehört:
Vorteil Warum es zählt
Hygiene Schützt dich vor fremder Bettwäsche & ist hygienischer
Komfort Weiches, angenehmes Gefühl auf der Haut
Wärme Gibt bis zu +5°C Zusatzisolation im Schlafsack
Pflegeleicht Lässt sich waschen → schützt den Hauptschlafsack
Leicht & kompakt Wiegt kaum etwas, nimmt kaum Platz ein
Flexibel nutzbar Auch als leichte Decke im Sommer geeignet
Materialvergleich – welches Inlet passt zu dir?
Material Vorteile
Baumwolle
Günstig, robust, angenehm weich
Seide Ultraleicht, temperaturausgleichend, sehr hautfreundlich
Mikrofaser
Merino
Günstiger als Seide, leicht, schnelltrocknend
Wärmt stark, geruchsneutral, atmungsaktiv
Nachteile Ideal für…
Schwerer, braucht viel Platz Klassische Hüttentouren
Teurer, empfindlicher
Etwas weniger Komfortgefühl
Schwerer & teuer
Sommer, Mehrtagestouren, ULFans
Preis-Leistungs-Tipp für Hütte
Kalte Nächte, längere Touren
Praxistipps:
• Mumienform → Wärmer & passender für Schlafsäcke
• Rechteckig → Mehr Platz zum Bewegen, angenehmer auf Hütten
• Nach der Tour waschen → Für Hygiene & Langlebigkeit
• Materialwahl je nach Tour → Sommer = Seide/Mikrofaser, Herbst = Merino
Tipp:
Auch im normalen Schlafsack verwenden – ein gutes Inlet gibt dir spürbar mehr Wärme und hilft die Lebensdauer deines Schlafsacks zu erweitern.
Ein Hüttenschlafsack ist leicht, klein, hygienisch und vielseitig – und damit ein Ausrüstungsstück, das mit minimalem Aufwand spürbaren Mehrwert liefert.
Nicht nur auf Hütten, sondern auch beim Reisen oder Zelten ein treuer Begleiter.
Begriff
IPX-Wert
Bedeutung / Warum wichtig
Schutzklasse gegen Wasser (IPX4 = Regenfest, IPX7 = untertauchbar)
Lumen Helligkeit von Stirnlampen → 200–400 reicht meist völlig
Hybridakku Kombinierbar: Akku + normale Batterien möglich
RECCO Reflektor in Kleidung → von speziellen Suchgeräten erkennbar
PLB / inReach Satelliten-Notrufgeräte → für absolute Notfälle ohne Handynetz
Z-Lock / Twist-Lock Verschlusssysteme bei Stöcken
Wenn du mehr willst: Sobald du länger draußen unterwegs bist, dich abseits der klassischen Routen bewegst oder gar draußen übernachtest, reicht die normale Grundausstattung nicht mehr aus. Jetzt kommen die speziellen Ausrüstungsgegenstände ins Spiel – all jene Dinge, die dir unterwegs Unabhängigkeit, Komfort und vor allem Sicherheit geben, wenn du keinen festen Stützpunkt hast.
In diesem Kapitel werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Ausrüstung, die aus einer einfachen Wanderung ein echtes Outdoor-Erlebnis macht: Vom passenden Kochsystem für warme Mahlzeiten unterwegs über Outdoorgeschirr und Besteck, das leicht, robust und praktisch sein muss, bis hin zur Auswahl der richtigen Outdoornahrung, die dich sättigt, stärkt und trotzdem wenig Platz braucht.
Ich zeige dir, wie du mit dem richtigen Schlafsetup – bestehend aus Zelt oder Biwaksack, Isomatte, Schlafsack und einem kleinen Kissen – auch draußen eine angenehme Nachtruhe findest. Und weil Hygiene auch unterwegs nicht zu kurz kommen darf, bekommst du Tipps für eine kompakte, durchdachte Outdoor-Hygiene-Ausrüstung, die selbst im kleinsten Rucksack Platz findet.
Diese Ausrüstung erweitert deine Möglichkeiten: Sie macht dich unabhängiger von Hütten, öffnet dir neue Wege und lässt dich Natur intensiver erleben – sei es auf mehrtägigen Touren, bei Biwaknächten unter freiem Himmel oder beim minimalistischen Trekking-Abenteuer. Mit der richtigen Auswahl bist du auch für längere Zeit draußen bestens gerüstet.
Ob heiße Brühe am Biwakplatz, Kaffee am Gipfel oder eine vollwertige
Mahlzeit: Ein Kocher bringt Komfort, Energie und Moral – besonders auf längeren oder kälteren Touren.
Doch Kocher ist nicht gleich Kocher. Welcher ist der richtige?
Kocherarten im Vergleich:
Gaskocher (Kartuschenkocher):
Verwendung von Schraubkartuschen (Butan, Propan oder Mischung)
➕ Leicht, kompakt, einfach zu bedienen

➖ Weniger effizient bei Kälte oder großer Höhe (spez. Gas benötigt)


➖ Kartuschen = Sondermüll (richtig entsorgen!)
Benzin- / Mehrstoffkocher:
Verwendet Benzin, Kerosin oder sogar Diesel
➕ Sehr leistungsstark, zuverlässig bei Kälte und Höhe

➕ Brennstoff weltweit verfügbar

➖ Schwerer, wartungsintensiv, rußt oft


➖ Handhabung braucht Übung
Spirituskocher:
Verbrennt einfachen Brennspiritus
➕ Leicht, leise, sicher

➕ Brennstoff fast überall erhältlich


➖ Weniger Leistung, schwer zu regulieren
Feststoffkocher (z. B. Esbit):
Verwendet Tabletten (Hexamin o.ä.)
➕ Ultraleicht & kompakt

➕ Keine beweglichen Teile

➖ Schwache Heizleistung, Rückstände & Ruß

➖ Tabletten manchmal schwer zu bekommen

Holzkocher (z.B. Bushbox):
Verwendet Zweige, Rinde, Zapfen etc.
➕ Brennstoff oft vor Ort – kein Schleppen

➕ Nachhaltig & naturnah

➖ Braucht trockenes Material

➖ Viel Rauch, schwer regulierbar

Hinweis: In vielen Bergregionen streng verboten – Waldbrandgefahr!
Integrierte Kochsysteme: (z. B. Jetboil)
Kocher + Topf + Wärmetauscher in einem System
➕ Extrem effizient, schnell und einfach zu bedienen

➕ Kompakt & windsicher

➖ Teurer, meist nur mit Kartuschen kompatibel

➖ Eher zum Wasserkochen als für echte Mahlzeiten


➖ Ersatzteile kaum erhältlich, wenig kompatibel
Wie wähle ich den richtigen Kocher?
Kriterium
Tourart & Gebiet
Empfehlung
Winter, Hochgebirge → Benzinkocher Sommer, Mittelgebirge → Gaskocher
Gewicht / Packmaß Ultraleicht → Feststoff- oder Spirituskocher
Flexibilität Weltreise / Expedition → Mehrstoffkocher
Essenstyp
Nur Wasser / Trockennahrung → Jetboil Richtig kochen → Gaskocher oder Benzin
Brennstoff richtig kalkulieren:
• Gaskartuschen wiegen → Verbrauch einschätzen
• Erfahrungswert: 100g Gas reicht ca. für 3–5 Mal Wasser kochen (je nach Wind, Temperatur & System)
• Immer Reserve einpacken!
Praxistipps:
• Windschutz mitnehmen! → Spart Brennstoff & Zeit
• Zündmaterial dabeihaben (z. B. Feuerstahl, Feuerzeug, Streichhölzer)
• Kocher vor der Tour testen! – besser jetzt als später
• Feuerverbote beachten! – besonders bei Holz- oder offenen Flammen
Hinweis: Verlass dich nie nur auf integrierte Piezozünder! Eine Zündquelle gehört IMMER separat ins Gepäck.
Der perfekte Kocher ist der, der zu deiner Tour passt – und den du bedienen kannst.
Es geht nicht um „der beste Kocher“, sondern um das beste System für deinen Einsatzzweck.
Je nach Kochsystem, Tourdauer und persönlichen Vorlieben brauchst du mehr oder weniger Zubehör.
Wichtig: Bei der Planung auch den Wasserbedarf für die Mahlzeiten mitdenken!
Was gehört ins Standard-Setup?
Gegenstand Funktion
Kochtopf Für Wasser, Suppe, Fertigmahlzeiten Tasse / Thermosflasche Tee, Kaffee, Brühe – oder als Wärmespeicher im Schlafsack
Besteck Göffel (Löffel+Gabel) mit langem Stiel für Tütennahrung
Die gängigsten Materialien im Überblick:
Auf der nächsten Seite ->
Empfehlungen nach Einsatzzweck:
Tourtyp Empfehlung
Ultraleicht-Trekking Titan oder faltbare Silikon-Geschirr
Kalte Bedingungen
Isolierte Tasse / Flasche
Klassisches Trekking Edelstahl – robust & bezahlbar
Stilvolles Lagerfeuer-Camping Emaille oder Holz für Atmosphäre
Praxistipps:
• Minimalismus gewinnt: Ein kleiner Topf + Tasse reicht oft völlig
• Langer Löffel = weniger Sauerei bei Tütenmahlzeiten
• Multifunktional denken: Thermosflasche = Trinkflasche & Wärmflasche
• Trockene Mahlzeiten = mehr Wasserbedarf → Planung beachten
• Messer? Ein kleines, vielseitiges reicht – Brotmesser, Spork oder Schweizer Taschenmesser
Auch hier gilt: Nicht das teuerste, sondern das für dich passende System zählt. Was zu dir, deiner Tour & deinem Rucksackstil passt, wirst du nach und nach selbst herausfinden.
Holz (z. B. Kuksa)
Karton/Kompostmaterial
Natürlich, warm, handgefertigt
Emaille
Schwerer, Pflege nötig (Handwäsche, ölen)
Kunststoff (BPA-frei)
Faltbares Silikon
Isoliert (doppelwandig)
Leicht, umweltfreundlich, teils wiederverwendbar
Geringe Robustheit, isoliert schlecht
Retro-Look, leicht & robust Kann bei Stößen abplatzen
Günstig, bunt, leicht, bruchsicher
Nimmt ggf. Gerüche an
Kompakt, leicht, bruchsicher Instabil bei Hitze, geringe Isolierung
Hält Getränke heiß/kalt, Kondensfrei
Edelstahl Langlebig, leicht zu reinigen, relativ günstig
Titan
Schwerer, teurer
Etwas schwerer als Titan
Ultraleicht, robust, rostfrei Teuer, sehr hitzeleitend (Vorsicht heiß!)
Material
Vorteile
Nachteile
Gefriergetrocknete Tütenmahlzeiten haben ihren Preis – aber auch eine ganze Reihe Vorteile, die sie besonders für Bergsteiger, Trekker und Weitwanderer attraktiv machen:
Warum gefriergetrocknete Mahlzeiten unterwegs so beliebt sind:
Vorteil
Warum’s zählt
Leichtgewicht Kaum Gewicht – ideal bei langen Touren
Lange Haltbarkeit Perfekt für Vorrat & Expeditionen – kein Verderben
Zubereitung Heißes Wasser rein, warten, fertig
Nährstoffreich Vitamine, Mineralien & Kalorien
Vielfalt
Pasta bis Thai-Curry – vegane & glutenfreie Option
Platzsparend Flach & kompakt → super zu verstauen im Rucksack
Warum sie wirklich sinnvoll sind:
• Vollwertige Mahlzeiten mit klarer Kalorienangabe pro Portion
• Für Touren, bei denen du deinen Energiebedarf abdecken musst
• Geeignet bei mehrtägigen Unternehmungen ohne Hüttenverpflegung
Nicht vergessen: Du brauchst heißes Wasser!
Je nach Gericht werden 300–500 ml Wasser pro Tüte benötigt.
→ Wasserbedarf bei der Tourenplanung unbedingt mit einberechnen!
Es gibt mehr als nur „Tütenpasta“:
• Hauptgerichte (Nudeln, Eintöpfe, Currys, Chili, Reisgerichte…)
• Frühstücksoptionen (Porridge, Rührei, süßer Milchreis…)
• Snacks & Desserts (Brownies, Mousse, Energy-Balls…)
• Specials: Gefriergetrocknetes Rindfleisch, Käsewürfel, Soja-Crunch…
Große Marken wie Trek'n Eat, Adventure Food, Real Turmat, Summit To Eat bieten teils hochwertige Zutaten & klare Herkunftsangaben.
Praxistipps für mehr Genuss unterwegs:
• Tüte vorher leicht knicken, damit sie stabil steht
• Löffel mit langem Griff verwenden – sonst wird’s klebrig
• Geschmack vorher testen! – nicht jeder Mix liegt jedem
• Abfälle mitnehmen! Wiegt fast nichts und gehört nicht in die Natur
• Viele Tütenmahlzeiten haben ein Feuchtigkeitspad das muss entfernt werden vor der Wasser hinzugabe!
Mentale Energie nicht vergessen:
Pack dir etwas ein, worauf du dich wirklich freust –sei es dein Lieblingsgericht oder ein kleines Extra wie Schokopudding oder ein Espresso-Beutel.
Motivation wirkt auch durch den Magen.
Kurz zusammengefasst:
• Leicht, lange haltbar, nahrhaft & unkompliziert
• Ideal für lange, kalte oder hochalpine Touren
• Große Auswahl für verschiedenste Geschmäcker & Bedürfnisse
• Heißes Wasser ist Pflicht – ohne geht nix
• Perfekt kombinierbar mit Kocher + Göffel + Thermoskanne
Tipp: Diese Tüten haben je nach Mahlzeit unterschiedliche Ziehzeiten. Es gibt diese Umschläge mit den kleinen Bläschen die wir früher (und auch heute noch) gern kaputt gedrückt haben. Diese dienen perfekt zur Isolierung und das Essen bleibt länger warm.
Das Übernachten unter freiem Himmel klingt nach Freiheit pur –ist aber in allen Regionen der Alpenländer streng reguliert bzw. verboten.
Warum „wild campen“ oft nicht erlaubt ist:
Grund Was dahinter steckt
Tier- & Naturschutz
Boden & Pflanzen sind sensibel – Wildzelten schadet oft mehr, als man denkt.
Eigentumsrechte Viele Flächen sind privat – wild campen = Hausfriedensbruch
Sicherheitsaspekt
TourismusOrdnung
Abgelegene = erschwerte Rettung & können selbst gefährlich sein
Offizielle Zeltplätze & Hütten sollen gezielt frequentiert werden
Wichtig: Wildcampen ist nicht nur "nicht gern gesehen" – es kann rechtlich verfolgt werden.
Die Ausnahme: Notfall-Biwak:
In echten Notsituationen ist ein Biwak in fast allen Alpenländern ausnahmsweise erlaubt:
Bedingung
Was zählt
Unvorhersehbar & notwendig z. B. Erschöpfung, Wettersturz, Stirnlampe leer etc.
Minimale Umweltbelastung
Keine Dauerlösung!
Sonderregel: Schweiz
Kein Feuer, kein Müll, keine Spuren
Nur eine Nacht, kein Aufbau von Lagerplatz
In der Schweiz ist das „Biwakieren oberhalb der Baumgrenze“ in vielen Regionen erlaubt, sofern keine Verbote bestehen. Trotzdem gilt:
• Kein Zelt, sondern Biwaksack / Tarp
• Klein, ruhig, sauber, dezent
• Lager bei Sonnenaufgang abbauen
Praxistipps für’s legale Biwakieren „mit Augenmaß“:
• Vor der Tour informieren: Regionale Regelungen checken (Nationalparks, Gemeinden, AV-Sektionen)
• Stark frequentierte Gebiete meiden – niemals auf Almen, in Naturschutzgebieten oder auf Weiden!
• Klein/unauffällig – kein Camp-Lager: Hängematte, Stuhl & Lichterkette
• Morgens früh abbauen, abends spät aufbauen
• Müll & Spuren unbedingt vermeiden – Leave No Trace!
• Lass es niemals nach einer geplanten Übernachtung aussehen!
Kommunikation hilft!
Wirst du entdeckt:
• Freundlich & respektvoll bleiben und sofort packen
• Argument: „Ich war erschöpft, es war dunkel, kein Empfang“ – als Notbiwak oft akzeptiert
• Kein Feuer! – das killt jegliche Toleranz
Zusammengefasst: Was geht – was nicht?
Verhalten
Zelt am Bergsee aufbauen
Notbiwak im Biwaksack
Tarp oder Poncho über Schlafplatz
Biwak unterhalb der Baumgrenze
Biwak auf Privatgrund mit Einverständnis
Einschätzung





→ In 90 % der Fälle verboten
→ Wenn diskret & begründet
→ Graubereich, je nach Region
→ Meist verboten / konfliktreich
→ Klare Sache: Erlaubt!
Tipp: Wildzelten ≠ Biwakieren. Wer gut vorbereitet, dezent & umsichtig handelt, kann draußen schlafen – ohne Schaden, Stress oder Strafe. Wer entdeckt wird - war nicht dezent genug!
Hinweis:
Dieser Abschnitt dient informativen Zwecken und ist keine Aufforderung/ Anleitung, unter freiem Himmel zu übernachten. In vielen Regionen ist das sogenannte „Wildcampen“ gesetzlich verboten – und die Bußgelder können empfindlich hoch ausfallen!
Ob du draußen biwakierst oder zelten willst, hängt nicht nur von persönlichen Vorlieben ab – sondern auch von Tourenziel, Wetter, Umgebung, rechtlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt: deinem Platz im Rucksack.
Was ist überhaupt was?
Schutzhülle für den Schlafsack – meist ohne Gestänge
Extrem leicht & klein im Packmaß
Geschlossener Schlafraum mit Gestänge & Außenzelt
Mehr Platz, mehr Komfort
Kein Aufbau nötig – einfach ausrollen Muss auf- und abgebaut werden
Minimalistischer Not- bis Wetterschutz Vollwertiger Schutz vor Wetter & Insekten
Zelt – tragbare Unterkunft mit Komfort
Ein Zelt bietet Sicherheit, Komfort und Wetterschutz, insbesondere bei längeren Aufenthalten oder schlechten Bedingungen.
Vorteile:
• Komplett geschlossener Raum (Regen-, Wind- & Insektenschutz)
• Platz für Ausrüstung, Kochen im Vorzelt (Achtung: Belüftung!)
• Je nach Modell auch bei Sturm & Schneefall tauglich
Nachteile:
• Größer & schwerer als Biwaksäcke (je nach Modell 1,5 – 3 kg)
• Aufbauzeit + evtl. Heringe nötig
• In vielen Regionen rechtlich problematisch („Wildcampen“)
Biwaksack – die minimalistische Lösung
Ein Biwaksack ist Schlafsackhülle & Notunterkunft in einem – er kann Leben retten oder als „unsichtbares Lager“ dienen. Biwacksack (Kein Notfall-Biwacksack) Zelt
Vorteile:
• Superleicht & kompakt – 200 g bis 600 g je nach Modell
• Schnell einsetzbar – ausrollen & reinlegen
• Sehr unauffällig (wichtig bei Grauzonen-Nächten)
• Ideal für: schnelle Touren, Solo-Abenteuer, Gipfelnächte
Nachteile:
• Kondenswasserproblem: Atemluft + Körperwärme → feucht!
• Wenig Platz für Ausrüstung oder Bewegung
• Kaum Schutz bei langanhaltendem Niederschlag
Material & Features: Worauf achten?
Merkmal Zelt
Wassersäule
Außenzelt: mind. 3.000 mm
Biwaksack
ab 1.500 mm (mehr = besser!)
Atmungsaktivität Mit Belüftungssystem Gore-Tex / Sympatex empfehlenswert
Packmaß Je nach Gestänge (25–50 cm)
Farbe
Extrem kompakt (kleiner als 1L)
Unauffällig: Grau, Oliv, Sand Tarnfarben sinnvoll bei Biwak
Innenraumhöhe ab 90 cm möglich (sitzen)
Gestänge
Kaum Platz zum Umziehen etc.
Leichtmetall oder Carbon (Optional: mit Mini-Gestänge bei High-EndModellen)
Was passt zu wem? – Entscheidungshilfe
Situation
Solo, leicht & schnell
Hüttentour mit Notfall-Backup
Empfehlung
Biwaksack
Biwaksack (Notbiwak)
Mehrtägiges Trekking, wechselhaftes Wetter Zelt
Zu zweit mit Ausrüstung
Alpenüberquerung, legal bleiben
Komfort-Trekking oder Basecamp
2P-Zelt mit Apsis
Biwak (nur oberhalb Baumgrenze / Notfall)
Zelt mit Vorzeltbereich
Praktische Tipps zur Nutzung
Zelt:
• Immer Footprint bzw. Plane unterlegen (Schutz)
• Bei Wind: Vorzelt gegen Windseite aufbauen
• Innenzelt möglichst belüften → reduziert Kondens
Biwaksack:
• Schlafsack in wasserdichtem Packsack transportieren
• Tarp drüber bei Dauerregen als Schutz
• Bei Frost: Biwak nicht ganz zuziehen – sonst Atemkondens
Tipp: Wer flexibel bleiben will, kombiniert: Leichter Biwaksack + Tarp = wetterfest, variabel, legaler
Ein Zeltkauf steht an?
Dann schau nicht nur aufs Gewicht, sondern vor allem auf den Innenraum. Ein „1-Personen-Zelt“ ist oft eher ein Schlafsack mit Dach –und bei einem 2-Personen-Zelt wird’s zu zweit schnell sehr gemütlich.
Tipp: Wenn du Platz für Ausrüstung, etwas Bewegungsfreiheit oder einfach dein eigenes Schlafklima schätzt, lohnt es sich, eine Nummer größer zu denken – zum Beispiel ein 2-Personen-Zelt für Solo-Touren oder ein 3-Personen-Zelt zu zweit.
Die Isomatte ist entscheidend für Wärme & Schlafkomfort – wichtiger als der Schlafsack selbst!
Warum du nie ohne Isomatte schlafen solltest:
Vorteil Erklärung
Isolation Schützt vor Bodenkälte → verhindert Auskühlung von unten
Komfort Polstert gegen Steine, Wurzeln, harte Untergründe
Feuchtigkeitsschutz Blockt aufsteigende Bodenfeuchte
Der R-Wert erklärt:
Der R-Wert gibt an, wie gut eine Matte isoliert.
Je höher der Wert, desto besser die Wärmeleistung:
R-Wert Temperaturbereich Einsatzbereich
1–2 über +10 °C
2–4 ca. 0 bis +10 °C
Sommernächte, Hängematte
Frühling / Herbst
4–6 bis –10 °C Hochgebirge, Frühjahr/Winter
6 mehr –10 °C und kälter
Wintertouren, Schneebiak
Tipp: Ein hoher R-Wert spart dir eine zweite Matte → ganzjährig einsetzbar! Aber auch mehr Gewicht.
Isomatten-Arten – welche passt zu dir?
Art
Vorteile
Nachteile / Hinweis
Schaumstoffmatte Robust, günstig, leicht Große Packmaße, geringe Isolation
Selbstaufblasbare Matte Komfortabel Etwas schwerer, begrenzter R-Wert
Luftmatratze (Isoliert) Top-Komfort & Isolation Teurer, evtl. pannenanfällig
Daunen-/Synthetikfüllung Hoher R-Wert
Pflegeaufwand höher, Empfindlich
Praxistipps zur Isomatte:
Achte auf gute Verpackung mit Flickzeug & Packsack
Pumpsack verwenden statt Mund:
→ Verhindert Feuchtigkeit im Inneren
→ Spart Kondenswasser & Schimmel
Nicht direkt auf scharfen Böden verwenden – Footprint hilft!
Wichtiger Hinweis:
Die Kältezonen, auf denen dein Körper aufliegt, drücken den Schlafsack platt – dort isoliert nur noch deine Isomatte. (Kältebrücke)
Ein top Schlafsack ohne gute Isomatte bringt wenig!
Deine Isomatte ist der unscheinbare Held deines Schlafsystems. Sie entscheidet, ob du wärmstabil & erholt aufwachst – oder zitternd in den Sonnenaufgang wartest.
R-Wert verstehen & passende Matte wählen = clever investieren.
Ein guter Schlafsack ist beim Bergsteigen und Wandern unverzichtbar, denn er schützt dich nicht nur vor Kälte – er ist deine Erholungszone nach einem langen Tag. Ohne erholsamen Schlaf kann keine Tour gut enden –erst recht nicht bei Minusgraden oder Wind.
Wärmeleistung & Isolation – das Herzstück eines Schlafsacks
Funktion Warum wichtig?
Wärmeisolierung Verhindert Wärmeverlust in Nächten durch Umgebung & Boden
Komfort Gute Schnittführung & Materialien = erholsamer Schlaf
Leicht & kompakt Lässt sich platzsparend verstauen → ideal für Bergtouren
Anpassbar Modell & Material für Sommer, Winter oder Expeditionen geeignet
Verwirrspiel Temperaturangabe – richtig lesen!
Herstellerangaben sind nicht immer das, was sie scheinen – besonders wenn mit der Extrem-Temperatur geworben wird:
Begriff Was bedeutet das?
Komfort Temperatur, bei der eine durchschnittliche Frau nicht friert
Limit Temperatur, bei der ein durchschnittlicher Mann gerade noch schlafen kann Extrem Überleben ohne Erfrierungen für begrenzte Zeit – nicht für Touren geeignet!
Wichtig: Die Komforttemperatur ist deine relevante Angabe – alles darunter ist im Zweifel unangenehm oder riskant.
Praxisbeispiele: Temperatur vs. Schlafsack-Wahl
Außentemperatur Empfohlene Komfort-Temperatur Schlafsack
+15 °C bis +20 °C +10 °C bis +15 °C
+10 °C bis +15 °C +5 °C bis +10 °C
+5 °C bis +10 °C 0 °C bis +5 °C
0 °C bis +5 °C –5 °C bis 0 °C
–5 °C bis 0 °C –10 °C bis –5 °C
–10 °C bis –5 °C –15 °C bis –10 °C
Aber nur in Kombi mit passender Isomatte! Sonst nützt dir der beste Schlafsack nichts, wenn von unten die Kälte durchzieht.
Material & Varianten: Was passt zu deinem Vorhaben?
Typ
Daune
Synthetik
Superleicht, extrem warm, klein verpackbar
Robust bei Nässe, günstiger, pflegeleicht
Mumienform Eng anliegend = beste Wärmeleistung
Feuchtigkeitsempfindlich, teuer
Kalte, trockene Touren / Winter
Schwerer, voluminöser Feuchte Touren / Hüttentrekking
Weniger Bewegungsfreiheit
Deckenschlafsack / Quilt Viel Platz, auch als Decke nutzbar Geringere Isolation durch offene Form
Kalte Touren, Hochlager
Sommer, Camping, wärmere Bedingungen
Pflege & Lagerung – so bleibt er langlebig & warm:
• Nicht zusammengerollt lagern! → Locker stopfen, nicht rollen
• Daune nur kurz im Kompressionssack lassen, dann: → auslüften, ideal: luftig & staubgeschützt
• Inlet verwenden → Hält Schlafsack sauber & verlängert Lebensdauer
• Lufttrocknen nach jeder Tour – auch bei Synthetik
• UV-Licht meiden! → Sonnenlicht beschädigt die Hülle & Füllung
Wissenswert: Was ist eigentlich „Cuin“?
Cuin steht für "Cubic Inches per Ounce" – ein Maß für die Bauschkraft von Daune. Je höher der Cuin-Wert, desto mehr Luft kann die Daune einschließen → besser isolierend bei gleichem Gewicht.
Cuin-Wert Isolationsqualität
400–500 Standard (günstiger, schwerer)
600–700 Guter Trekking-Komfort
750–850 Expeditionsfähig – top Wärme/Gewicht
900 High-End – ultraleicht & extrem isolierend
Beachte: Hoher Cuin = empfindlicher bei Feuchtigkeit → Daunenschlafsäcke immer gut verpacken!
Fazit: Dein Schlafsack – ein kleines Wärmewunder Er schützt, isoliert, lässt dich regenerieren – und kann im Ernstfall sogar Leben retten.
Tipp: Daunen-Schlafsäcke beim einpacken niemals zusammenrollen, da sonst die Daunen und Federn immer an den selben Stellen beansprucht werden. Stopfen ist hier die Devise!
Ein Kissen mag wie ein Luxusartikel wirken – doch wer schon einmal nackten Nacken auf hartem Untergrund hatte, weiß: Ein gutes Kissen kann den Unterschied zwischen Erholung und durchwälzter Nacht machen. Gerade auf mehrtägigen Touren ist Regeneration wichtiger denn je – und dazu gehört guter Schlaf.
Warum ein Kissen nicht fehlen sollte:
• Ergonomische Unterstützung für Nacken & Kopf
• Entlastet die Wirbelsäule & reduziert Verspannungen
• Mehr Schlafkomfort = mehr Energie für den nächsten Tag
• Kaum Gewicht, aber hoher Nutzen – besonders auf längeren Touren
Kissenarten im Überblick:
Typ Vorteile
Aufblasbares Kissen Ultraleicht & extrem kleines Packmaß, individuell aufblasbar
Komprimierbares Kissen
Hybrid-Kissen
Improvisiert (Kleidung)
Weicher Schaum, ähnlicher Komfort wie daheim, angenehme Haptik
Kombination aus Schaum + Luft → guter Kompromiss
Spart Gewicht, multifunktional
Materialien & Haptik – Komfort ist subjektiv:
Nachteile
Raschelt oft, eher „gummig“, ungewohnt im Gefühl
Etwas größer & schwerer, braucht Zeit zum Aufplustern
Teurer, teilweise schwerer
Kein echter Komfort, verrutscht, Isolierung fehlt
• Mikrofaserbezug → Angenehm weich, atmungsaktiv, geräuscharm
• Synthetikfüllung → Pflegeleicht, nimmt wenig Feuchtigkeit auf
• Daune → Superkomfortabel, aber feuchtigkeitsempfindlich & teurer
• TPU-Oberfläche (aufblasbaren Modelle) → robust, aber oft „rutschig“
Praxistipps für unterwegs:
• Aufblasbares Kissen nie prall füllen – weicher = besser für Nacken
• Daunenjacke als Kissen? Ja – nur, wenn du sie nicht selbst brauchst!
• Kleidung in Hüttenschlafsack stecken → Notlösung, besser als nichts.
• Komprimierbares Kissen mit Schlaufe? → Praktisch zum befestigen
Empfehlung:
Wenn du Platz sparen willst → aufblasbares Kissen mit Stoffbezug oder Hybridmodell. Wenn du Komfort willst → komprimierbares Kissen mit Memory-Schaum. Wenn du ultraleicht unterwegs bist → Kleidung in Packsack.
Tipp:
Ein kleines, gutes Kissen kann auf Tour mehr bringen als ein halbes Kilo extra Proviant. → Denn wer gut schläft, wandert besser.
Gute Hygiene ist auch beim Wandern, Trekking oder Bergsteigen keine Nebensache. Wer sich unterwegs wohlfühlen will, sollte ein paar Grundregeln beachten – nicht nur für sich selbst, sondern auch für Mitmenschen und Natur.
Hygiene bedeutet draußen nicht „klinisch rein“, sondern funktional sauber bleiben, Krankheiten vermeiden, den eigenen Körper pflegen –und dabei trotzdem minimalistisch unterwegs sein.
Was gehört in dein Outdoor-Hygieneset?
Gegenstand
Warum sinnvoll?
Outdoor-Seife (biologisch abbaubar) Zum Waschen von Händen, Körper, Geschirr – ohne Gewässer zu belasten Einmal-Waschlappen (z. B. Bambus) Ideal für die tägliche Körperpflege – es gibt sie auch mit Teebaumöl
Taschentücher (Papier) Für die Nase oder Toilettengang – bitte nicht vergraben, sondern mitnehmen Desinfektionstücher/-mittel Für Hände, kleine Verletzungen, Toilettengänge – schnell & praktisch Mikrofaser-Handtuch Ultraleicht, schnell trocknend, kompakt – ideal für Touren Zahnbürste + Zahnpasta/Tabletten Reisegröße, faltbar oder als Zahnputz-Tab – spart Gewicht & Wasser
Kleine Schaufel (trowel)
Fürs „große Geschäft“ → Loch graben, danach wieder mit Erde bedecken Müllbeutel Für eigenen Abfall – und für gefundenes Plastik (Hinterlassenschaften...)
Toilettengang – so geht’s draußen richtig:
Auch wenn’s unbequem ist: Respekt gegenüber Natur & anderen fängt beim „großen“ Toilettengang an.
1. Abseits vom Weg & Wasser gehen (mind. 50–70 m Abstand)
2. Loch graben (~15 cm tief) → mit Schaufel oder Stock
3. Geschäft verrichten
4. Toilettenpapier vergraben? → Nur, wenn es schnell zersetzbar ist! > KEINE Taschentücher! Die zersetzen sich erst nach Jahren
5. Loch wieder sorgfältig mit Erde bedecken
Zahnpflege unterwegs – minimal & effektiv:
• Reise-Zahnbürste: Faltbar, leicht, nimmt kaum Platz weg
• Zahnpasta: In kleine Behälter umfüllen oder Reisegröße
• Oder Zahnputztabletten: Keine Tube nötig, leicht dosierbar, Wasser- & Gewichtssparend, biologisch abbaubar
Tipp: Zahnputz-Tabletten in ein Mini Zip-Beutel – hygienisch & leicht.
Extra-Tipps & ergänzende Basics:
• Lippenbalsam mit LSF → gegen Sonne, Wind & Risse
• Kokosöl / kleine Pflegecreme → für trockene Haut oder Reibepunkte
• Nagelknipser & Pinzette → klein, aber nützlich!
• Feuchttücher → für schnelle Katzenwäsche
Sauber bleiben = wohlfühlen + gesund bleiben:
Wer sich auch draußen grundlegend sauber halten kann, ist weniger anfällig für Hautreizungen, Infekte oder einfach schlechte Laune durch Unwohlsein.
Zudem hilft es bei der Rückkehr zur Hütte oder Zeltgemeinschaft, sich nicht wie ein wandelnder Haufen Muff zu fühlen.
Tipp:
Plane kleine Routinen ein:
Zähneputzen + Waschlappen + Unterwäsche wechseln = Mini-Wellness
Auch im Biwak-Modus gilt:
Hygiene ist nicht optional, sondern ein Beitrag zu deiner Gesundheit
In den Bergen ist eines sicher: Nichts ist sicher. Besonders das Wetter nicht.
Ein strahlend blauer Himmel am Morgen kann am Nachmittag in dichte Nebelsuppe oder einen Gewitterschauer umschlagen – und genau dafür braucht es flexiblen und funktionalen Wetterschutz, über die StandardBekleidung hinaus.
Ein Muss auf jeder Tour – selbst bei strahlendem Wetter!
Eine gute Regenjacke ist dein Schutzschild gegen Wind, Regen und manchmal auch Schnee.
Worauf es ankommt:
• Wassersäule von mindestens 10.000 mm; besser 20.000 mm
• Membran (z. B. Gore-Tex, eVent) – damit du nicht von innen nass wirst
• Kapuze mit Volumenregulierung, die auch über den Helm passt
• Unterarm-Reißverschlüsse (Pit-Zips) zur Belüftung
• Regulierbare Bündchen, um bei Bewegung gut geschützt zu bleiben
Hinweis: Auch die beste Regenjacke versagt irgendwann – je nach Pflege, Alter und Dauer der Belastung. Deshalb: Imprägnierung regelmäßig auffrischen!
Ja, es klingt erstmal komisch. Aber wer schon mal im Dauerregen mit dem Kopf nach unten gewandert ist, wird überrascht sein, wie angenehm ein leichter, gut fixierter Trekking-Schirm sein kann.
Pro:
• Super Belüftung, kein Hitzestau
• Hände bleiben (relativ) trocken
• Auch als Sonnenschutz nutzbar
• Manche Modelle lassen sich befestigen → handsfree trekking
Contra:
• Windanfällig (nicht für Sturm oder Gratwanderungen!)
• Zusätzlicher Platzbedarf
• Für technisches Gelände eher ungeeignet
Fazit: Für moderate, längere Wanderungen oder Zustiege im Regen eine interessante, oft unterschätzte Option.
Feuchtigkeit ist der größte Feind für Komfort und Körperwärme. Daher macht ein Satz leichter Ersatzwäsche besonders bei Mehrtagestouren oder in kühlen Jahreszeiten absolut Sinn – nicht nur fürs Wohlbefinden, sondern auch zur Prävention von Unterkühlung.
Empfehlung für das Minimal-Set:
• 1x Unterwäsche (Funktionsmaterial oder Merino)
• 1x trockenes T-Shirt / Baselayer
• 1x trockene Socken
Tipp: Alles in Zip-Beutel oder wasserdichte Packsäcke verpacken. Denn was nützt die Ersatzkleidung, wenn sie auch nass ist?
• Regenhülle für den Rucksack
• Liner (z. B. großer Müllsack / Drybag) → Schutz vor eindringendem Wasser durch die Rückenpartie
• Überschuhe oder Gamaschen → für besonders nasse Bedingungen
Ein Regenumhang, welcher in Gewissen Ausführungen so groß ist, dass er dich und deinen Rucksack schützt. (Sieht man aus wie ein Kamel)
Vorteile:
• Deckt dich UND den Rucksack in einem ab → kein extra Cover nötig
• Bietet viel Belüftung → kein Hitzestau wie bei Jacken
• Kann als Tarp oder Notunterstand genutzt werden (je nach Modell)
• Geringes Gewicht & kleines Packmaß
Nachteile:
• Bei starkem Wind flattert er stark
• Für technisches Gelände ungeeignet
• Begrenzter Schutz bei Seitenwind oder Kälte
Fazit: Ideal für Wandertouren bei wechselhaftem Wetter, vor allem im Sommer oder im Wald, wo man nicht dauerhaft in Bewegung ist.
Praktisch als minimalistischer Wetterschutz mit mehreren Funktionen.
Ein leichter „Rock“ aus wasserdichtem Material, der über die Beine gezogen wird – oft mit Klett oder Druckknöpfen.
Vorteile:
• Bessere Belüftung als Regenhosen → kein Schwitzen
• Schnell an- und auszuziehen, auch mit Schuhen
• Leichter & kleiner im Packmaß als viele Regenhosen
• Keine Reibung im Schritt wie bei Regenhosen
Nachteile:
• Nicht ideal bei starkem Wind
• Bei viel Bewegung kann’s unbequem werden
• Kein Schutz für die Beine bei seitlichem Regen
Fazit: Für leichte bis mittlere Regenschauer und als schneller
Wetterschutz super geeignet – besonders, wenn man keine Regenhose mag.
Ein ultraleichtes Langarm-Shirt mit Kapuze und hohem UV-Schutz, meist aus dünner, schnell trocknender Kunstfaser.
Vorteile:
• Schützt vor Sonne, Wind und Insekten in einem Teil
• Sehr atmungsaktiv, ideal bei Hitze
• Kapuze schützt zusätzlich Ohren & Nacken
• Kombinierbar mit Kappe → kein Sonnenbrand mehr im Nacken
• Kann auch als dünne zusätzliche Schicht getragen werden
Fazit: Der SunHoody ist ein Geheimtipp für Touren in heißem, trockenem oder mückenreichem Gelände. Auch gut als Schicht unter einer Weste oder Softshelljacke.
– neben Regenjacke oder Poncho – ein essenzieller Bestandteil des Wetterschutzes, besonders bei längeren Touren, in alpinem Gelände oder bei unvorhersehbarem Wetterumschwung. Sie schützt nicht nur vor Regen, sondern auch vor Wind, Kälte und durchnässter Vegetation.
Warum eine Regenhose sinnvoll ist:
• Schutz vor Nässe:
Verhindert, dass Hose, Unterwäsche und Beine durchweichen –wichtig zur Vermeidung von Unterkühlung.
• Wärmehaltung:
Regen + Wind = gefährliche Kombination. Eine gute Regenhose wirkt wie eine isolierende Außenschicht.
• Schutz vor Wind: Auch bei Trockenheit bietet die Regenhose Schutz gegen kalten Wind und Auskühlung.
• Schutz vor Schmutz & Gestrüpp: Ideal bei hohem Gras, nassen Sträuchern oder schmalen Pfaden – hält sauber & kratzt nicht.
Wichtige Eigenschaften einer guten Regenhose:
Merkmal Bedeutung
Wassersäule Gibt an, wie wasserdicht der Stoff ist. 10.000 mm ist gut, 20.000 mm+ für extremes Wetter. Atmungsaktivität Je niedriger der RET-Wert, desto besser der Wasserdampfdurchlass → weniger Schwitzen. Lagen-Konstruktion Je höher die Zahl, desto robuster & langlebiger – aber auch schwerer.
Seitliche Reißverschlüsse Zum schnellen Anziehen über Schuhen oder Steigeisen – auch als Belüftung verwendbar. Verstellb. Beinabschlüsse Zum Anpassen über Schuhe, zum Schutz vor Spritzwasser. Gewicht & Packmaß Tageswanderungen → möglichst leicht & klein verstaubar. Für Expeditionen → robuster.
Unterschied: Regenhose vs. Regenrock vs. Poncho
Ausrüstun
g Vorteile
Regenhose Kompletter Schutz, winddicht, bei Kälte ideal
Regenrock Schnell überziehbar, luftig, leicht
Poncho Deckt auch Rucksack ab, gute Belüftung
Kauftipps für Regenhosen:
Nachteile
Schwitzt man schnell, muss ggf. ausgezogen werden
Weniger Schutz bei Starkregen, nicht für Kletterpassagen
Wenig Beinschutz, flattert im Wind
• Full-Zip / ¾-Zip: Erleichtert das Anziehen über Schuhe oder Steigeisen
• Stretch-Anteil: Bessere Bewegungsfreiheit beim Bergsteigen
• Membran (z. B. Gore-Tex): Schutz bei alpinen Bedingungen
• Gewicht & Packmaß prüfen: Je nach Tourentyp: ultraleicht oder robust
• Nicht zu eng kaufen: Muss über deine Wanderhose passen
Pflege- und Anwendungstipps:
• Regelmäßig Imprägnierung auffrischen (z. B. Spray oder Waschmittel)
• Nach Gebrauch trocknen & lüften – sonst droht Schimmelbildung
• Nicht dauerhaft im Packsack lagern – Material könnte leiden
Die Regenhose schützt zuverlässig vor Nässe, Wind und Kälte –besonders auf langen, nassen Etappen oder bei Touren über die Baumgrenze.
Wer dauerhaft trocken bleiben will, kommt um sie nicht herum. Ob ultraleicht für schnelle Wanderungen oder robust mit Technikfeatures für den alpinen Einsatz.
Speziallösungen für spezielle Situationen
Was am Ende dein perfektes Setup ist wirst du womöglich dann herausfinden,… wenns schüttet…
Nicht alles, was man mitnimmt, hat direkt mit Technik, Gewicht oder Wärmeleistung zu tun. Manches ist einfach persönlich und weniger praktisch – sorgt aber für ein bisschen Luxus unterwegs. Hier findest du eine Anregungsliste, die du nach Lust, Laune und Platz im Rucksack anpassen kannst. Nicht alles muss mit, aber es lohnt sich, einmal drüber nachzudenken.
Weil’s nicht nur ums Ankommen geht – sondern auch ums Dabeisein.
• DAV-Ausweis / Alpenvereinsausweis
Für Ermäßigungen bei Hütten, Seilbahnen & Versicherungsleistungen im Notfall. (Achtung: Gültigkeit prüfen!)
• Multitool / Taschenmesser (z. B. Leatherman, Victorinox)
Für Reparaturen, Kochen, Notfälle, Verpackungen,…
• Sitzkissen oder leichter Campstuhl (z. B. Helinox Chair Zero)
Wer’s ausprobiert hat, will’s nicht mehr missen – eine kleine KomfortOase nach dem Wandertag.
• Tierabwehrspray / Pfefferspray (Für Schisshasen wie mich)
In Ländern mit Wolf- oder Bärenvorkommen (z. B. Südtirol, Slowenien)
Die Bärenglocke gibt’s übrigens wirklich – aber… naja.
• Ohrstöpsel
Wer einmal in einem vollen Matratzenlager neben einem ambitionierten Sägetier geschlafen hat, nimmt die Dinger nie wieder raus aus dem Gepäck!
• Brille / Kontaktlinsen + Ersatz
Ersatz im Rucksack – falls die Hauptbrille bricht oder verloren geht
• Powerbank(s) & Ersatzbatterien + Kabel
Für Stirnlampe, GPS-Gerät, Handy. Tipp: Powerbank in Socken oder Beutel gegen Kälte einpacken – kalte Akkus geben schneller auf.
• Dokumente
Personalausweis, Krankenkassenkarte, Impfpass digital oder Kopie, ggf. Auslandsversicherungsnachweis
• Schlafmaske
Kann helfen sich auf der Hütte nicht wecken zu lassen von Stirnlampen mitten in der Nacht.
• Bargeld!
Viele Hütten haben keinen Empfang – und keine Kartenzahlung. Lieber 10 € zu viel als 1 € zu wenig.
• Mini-Reparatur-Set Flickzeug, Gaffa-Tape auf dem Feuerzeug aufgewickelt, Sicherheitsnadel, Kabelbinder, Nadel & Faden.
• Kleines Buch, E-Book-Reader oder Notizbuch Für Hüttenabende, stille Momente oder einfach zum Runterkommen. (Stift nicht vergessen!)
• Kartenspiel (Uno, Schwarzer Peter, klassische Spielkarten) Nichts verbindet auf der Hütte schneller als eine Runde Karten bei Stirnlampenlicht.
• Kopfhörer + Lieblingsmusik (offline!)
Mitten im Nirgendwo mal den Soundtrack des Lebens einschalten.
• Mini-Kleiderleine mit Halteschlaufen
Für nasse Socken oder den Buff – auch in der Hütte praktisch.
• Thermometer Nicht notwendig – aber: Nerd-Faktor +10
• Fernglas (kompakt)
Für die, die gern Tiere beobachten oder einfach nur schauen wollen, ob das da vorne ein Murmeltier oder ein Wanderer ist.
• Apps & digitale Helferlein für unterwegs (Wetter sowieso)
PeakFinder / PeakVisor
Smartphone in Richtung Gipfel halten und sehen, wie der Berg heißt. Funktioniert offline!
PlantNet / Flora Incognita
„Was blüht denn da?“ – Pflanzen mit der Kamera bestimmen, funktioniert erstaunlich gut.
iNaturalist / ObsIdentify
Tiere, Spuren, Pilze, Käfer – fotografieren und bestimmen lassen.
Alpenvereinaktiv / Komoot / Outdooractive
Navigation, Routenplanung, vorab Offline-Karten laden!
Schreib dir eine „Top-10-Persönlich-Liste“ nach deinen Touren. Was brauchst du wirklich, was war überflüssig, was hast du vermisst?
So entsteht deine ganz persönliche Packliste – besser als jede Internetliste!
Begriff
Bedeutung / Warum wichtig
BTU (British Thermal Unit) Maß für Heizleistung eines Kochers ; je höher = mehr Energieabgabe.
Piezo-Zündung Integrierte Zündvorrichtung an Gaskochern
Wärmetauscher Aluminiumlamellen unter dem Topf zur effizienteren Wärmenutzung
Elektrolyte Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Magnesium
R-Wert Maß für die Isolationsfähigkeit einer Isomatte
Footprint Separates Bodentuch zum Schutz vor Feuchtigkeit und Abrieb.
Wenn der Weg und die Ziele anspruchsvoller werden: Wer sich ins alpine Gelände wagt oder einen Klettersteig in Angriff nimmt, betritt eine neue Dimension des Bergsports – eine, in der Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und vor allem die richtige Ausrüstung unverzichtbar sind. Hier geht es nicht mehr nur ums Wandern, sondern ums sichere Bewegen im felsigen, ausgesetzten Gelände – und das verlangt nach speziellem Equipment.
In diesem Kapitel zeige ich dir, welche Ausrüstung du brauchst, wenn es steil wird: Ein Kletterhelm, der dich vor Steinschlag schützt; ein Klettergurt und das passende Klettersteigset, die dich bei jedem Schritt sichern; Grödel oder Steigeisen, die auf hartem Altschnee oder Eis für Halt sorgen – und vieles mehr, was dich bei anspruchsvollen Touren schützt und unterstützt. Und wertvolle Tipps die dich beim kauf unterstützen.
Sicherheit entsteht nicht nur durch Können – sondern durch Vorbereitung
Mit der passenden Ausrüstung eröffnen sich neue Möglichkeiten: spektakuläre Klettersteige, spannende Gipfelziele und atemberaubende Routen, die dir unvergessliche Bergerlebnisse bescheren – sicher und mit dem nötigen Respekt vor dem Gelände.
Ein Helm ist Pflicht – nicht nur für Klettersteige, sondern für jedes Gelände, in dem Steinschlag oder Absturzgefahr besteht.
Worauf du achten solltest:
Norm:
EN 12492 (für Bergsport & Alpinismus)
Einstellbarkeit:
→ Verstellrad oder Gurtband müssen sich mit einer Hand bedienen lassen – auch mit Handschuhen!
→ Der Helm muss fest sitzen, ohne zu drücken.
Belüftung:
→ Große Belüftungsöffnungen sorgen für angenehmes Tragen bei Hitze.
→ Bei Hochtouren ggf. geschlossener Helm, damit kein Schnee eindringt
Gewicht:
→ Leichte Helme (180–250 g) sind angenehmer, aber oft empfindlicher.
→ Robuste Hybridhelme wiegen meist 280–350 g – dafür haltbarer.
Wann tauschen?
• Nach jedem stärkeren Schlag (auch bei keinem sichtbarer Schaden)
• Spätestens nach 5–10 Jahren, je nach Herstellerangabe
• Auf Risse, Dellen und UV-Schäden regelmäßig prüfen
Helmarten im Überblick:
Helmtyp
Vorteile
Hartschale Sehr robust, langlebig
Nachteile
Schwerer, schlechter belüftet
Schaum Ultraleicht, gute Belüftung Empfindlich gegenüber Stößen
Hybrid Guter Kompromiss Gewicht & Schutz
Mittleres Gewicht, teurer
Worauf du beim Kauf auch achten solltest:
• Passform vor Gewicht:
Ein leichter Helm bringt nichts, wenn er nicht gut sitzt oder verrutscht. Probier verschiedene Modelle – jeder Kopf ist anders.
• Mit Mütze testen:
Beim Anprobieren auch eine dünne Mütze oder Stirnband aufziehen → wichtig für Touren in kühlen Bedingungen.
• Farbwahl bewusst treffen:
Helle Farben reflektieren Hitze besser. Signalorange oder -gelb sind besser sichtbar, auch aus der Luft.
• Stirnlampenhalterung:
Ist der Helm mit einer Halterung für meine Stirnlampe ausgestattet und passt diese dann auch wirklich da dran?!
Tipp:
Mit Brille/Sonnenbrille – unbedingt testen.
Viele Belüftungsöffnungen = gut, aber auf Kosten der Stabilität und Sicherheit.
Ein Klettersteigset ist das Verbindungsglied zwischen dir und dem Stahlseil – es muss zuverlässig, normgerecht und modern sein.
Besteht aus:
• 2 elastische Lastarme mit Karabinern (Typ K)
• Falldämpfer (Bandfalldämpfer)
• Verbindung zur Einbindeschlaufe (mit Ankerstich)
Wichtige Normen & Hinweise:
• EN 958:2017 → Aktuelle Norm für Klettersteigsets (angepasst auf Gewichtsspanne von 40–120 kg inkl. Ausrüstung)
• Karabinergröße: Groß, mit Handballenöffnung oder Palm-SqueezeSystem für schnelle Bedienung
• Karabiner müssen automatisch verriegeln und leicht zu öffnen sein
• Alter:
→ Maximal 10 Jahre ab Herstellungsdatum, auch unbenutzt!
→ Kein Ersatz nach Sturz → Set ist danach zu entsorgen
Wartung & Kontrolle:
• Auf Risse im Band, ausgerissene Nähte oder verhärteten Dämpferblock prüfen
• Karabiner leichtgängig? Dämpfungspackung nicht eingerissen?
Worauf du beim Kauf auch achten solltest:
• Neu kaufen! → Kein Gebrauchtkauf! Auch wenn das Set unbenutzt aussieht – das Alter zählt ab Herstellungsdatum, nicht ab Nutzung.
• Set muss zur Körpermasse passen: Wenn du mit schwerem Rucksack unterwegs bist, zählt dein Gesamtgewicht(mind. 40–120 kg beachten!).
• Karabinergriff ausprobieren: Ob Handballen-Mechanismus oder PalmSqueeze – probier beides im Laden mit Handschuhen.
• Kein Schnäppchen mit veralteter Norm (vor EN 958:2017) mehr kaufen – auch wenn es deutlich günstiger ist.
Deine Entlastung in Pausen oder an schwierigen Stellen. Eine Rastschlingen solltest du immer dabei haben.
Zusammensetzung:
• Bandschlinge 60–100 cm, am besten genäht (nicht geknotet!)
• HMS-Schraubkarabiner (EN 362 + EN 12275)
→ Muss groß genug sein für das Drahtseil (oft 12–14 mm Ø)
→ Leicht bedienbar mit Handschuhen
Technischer Hinweis:
Die Rastschlinge ist kein Fangstoß-absorbierendes System → sie darf auf gar keinen Fall als Klettersteigset-Ersatz verwendet werden! Nur statisch nutzen (z. B. Ausruhen, Sichern, Fotografieren, Routenlesen etc.).
Beim Kauf beachten:
• 60–80 cm sind oft die beste Länge für Klettersteige. 120 cm ist zu viel und hängt oft im Weg.
• Karabiner mit großem Schnapper wählen, der bequem ums Drahtseil greift – HMS-Form mit Schraubverschluss oder Twistlock.
Tipp: Selbstsicherungsschlinge von bspw. Petzl lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf die gewünschte Länge einstellen. Somit kann man variabel seine Position verändern.
Dein Gurt ist das Herzstück deines Systems. Er verbindet dich mit dem Sicherungssystem – und sollte sitzen wie ein Maßanzug.
Checkliste für den Hüftgurt:
• EN 12277 (Typ C = Hüftgurt, Typ B = Kombigurt für Kinder)
• Bequeme, breite Beinschlaufen & Hüftgurt mit guter Polsterung
• Verstellbare Beinschlaufen für Sommer- & Winterkleidung
• Schnallen selbstsichernd & leicht zu bedienen
• Einbindeschlaufe farblich markiert = keine Verwechslungsgefahr
Haltbarkeit:
• Max. 10 Jahre ab Herstellungsdatum
• Nach einem Sturz mit hohen Belastungen ersetzen
• Regelmäßig kontrollieren: Nähte, Gewebe, Schlaufen
Übungs-Tipp für Zuhause:
Teste deinen Klettergurt gemeinsam mit deiner Hose! Warum? Setz dich hinein - kommst du noch an dein Smartphone in der Hosentasche? Das kann im Ernstfall nach einem Sturz im Klettersteig problematisch werden.
Beim Kauf beachten:
• Bequem sitzen ist entscheidend! → Häng dich im Laden wirklich probeweise rein. Druckstellen = No-Go! Wichtig!!!
• Mit deiner Tourenbekleidung testen, am besten auch mit dem Rucksack. Der Gurt sollte sich nicht mit dem Hüftgurt des Rucksacks in die Quere kommen.
• Achte auf Materialschlaufen: Reichen dir 2 oder brauchst du 4 (z. B. bei Hochtouren)? Sind sie gut erreichbar?
• Für Hochtouren/Steigeisen-Kombi: Gurt mit weit öffnenden Beinschlaufen wählen, damit du ihn mit Schuhen anziehen kannst.
Das Drahtseil kann scharfkantig, rostig oder heiß sein. Handschuhe sind keine Pflicht – aber deine Hände werden dir danken.
Worauf du achten solltest:
• Material: Leder oder Leder-Kunststoff-Mix → robust & griffig
• Schnitt:
→ Fingerhandschuhe = besserer Schutz
→ Fingerlinge = besseres Feingefühl
• Gepolsterte Handflächen & starker Grip
• Verschluss: Klett am Handgelenk, damit sie nicht rutschen
Tipp:
Auch beim Seilhandling (z. B. beim Fixieren im Notfall, Abseilen) oder im Firnfeld sinnvoll → ein gutes Paar kann für viele Einsätze genutzt werden.
Worauf du beim Kauf auch achten solltest:
• Unbedingt anprobieren! Die Handschuhe müssen eng sitzen, aber nicht einschnüren. Kein Faltenwurf, sonst gibt’s Blasen.
• Leder oder Kunstleder ist robuster als reine Stoffhandschuhe
• Klettverschluss statt Gummizug → besser fixierbar, angenehmer bei längerem Tragen.
Tipp:
Wenn du mehr Gefühl brauchst, nimm Fingerlinge mit gepolsterter Innenfläche. Für reinen Schutz → Vollfinger-Version.
Nützliche Hinweise:
Herstellerangaben & Normen checken – besonders bei Onlinekäufen. Fotos vom Label mit Seriennummer und Datum machen – nützlich für Garantie und Überblick.
die „Schneeketten“ für deine Schuhe!
Eigenschaften:
• Gummi-Rahmen mit Metallketten & Stahlspikes
• Schnell montiert & leicht (150–300 g/Paar)
• Packmaß minimal → passt in jede Jackentasche
Einsatzbereich:
• Vereiste Forstwege, verschneite Wanderwege, leichte Schneefelder
• Kein technisches Gelände – kein Ersatz für Steigeisen!
• Ideal für Frühling/Herbst-Touren mit Altschneeresten
Vorteile:
✔ Extrem leicht & kompakt
✔ Schnell an- und auszuziehen
✔ Kein spezieller Schuh notwendig
Nachteile:
✘ Nur bedingt auf hartem Firn
✘ Kein Frontzacken → kein Halt in steilerem Gelände
✘ Begrenzte Haltbarkeit bei Felskontakt
Wartung & Haltbarkeit:
• Nach der Tour abspülen & trocknen lassen
• Kanten nicht nachschärfen bei Alu! → das schwächt das Material
• Bei Spannriemen & Körbchen regelmäßig auf Risse prüfen
• Elastische Bänder bei Lagerung nicht gespannt → sie leiern sonst aus
Kauf-Tipps:
• Ideal für Ganzjahresnutzer mit Stadt-/Land-Touren
• Nicht nach Preis kaufen – Elastik muss hochwertig sein, sonst reißt sie eventuell bei -5°C
• Modelle mit Zacken auch unter dem Mittelfuß (besserer Grip)
Gehören zur Sicherheitsgrundausstattung im alpinen und hochalpinen Bereich. Ob bei Gletschertouren, steilen Firnfeldern, vereisten Passagen oder beim Mixed-Klettern – ohne sie ist ein Vorankommen oft nicht möglich oder schlicht zu gefährlich.
Aber Steigeisen ist nicht gleich Steigeisen: Es gibt große Unterschiede in Material, Zackenanzahl, Bindungssystemen und Einsatzzwecken. Hier erfährst du alles, was du wissen musst:
Was sind Steigeisen?
Steigeisen (engl. crampons) sind Zackenrahmen aus Metall, die an Bergschuhen befestigt werden, um Halt auf Schnee, Firn und Eis zu gewährleisten. Sie bestehen aus:
• Einem Rahmen mit Zacken (meist 10–14)
• Einem Bindungssystem, das sie mit dem Schuh verbindet
• Antistollplatten verhindern das Schnee unter dem Eisen anklebt
Bindungssysteme – Was passt zu welchem Schuh?
Bindungssystem Beschreibung
Riemenbindung (Strap-on)
Halbautomatisch (Hybrid)
Gummizüge + Riemen fixieren Steigeisen
Hinten Kipphebel (Fersenbügel), vorne Körbchen
Automatisch (Step-in) Vorne + hinten Steg/Clip
Voraussetzungen am Schuh Vorteile Nachteile
Kein spezieller Schuh nötig (Kategorie B/C oder C)
Vielseitig, passt auf viele Schuhe Etwas fummelig, weniger präzise
Steigeisenlippe hinten am Schuh Guter Halt, schnelles Anlegen Passende Schuhe
Steigeisenlippe vorne & hinten
Maximale Präzision & Stabilität Kategorie DSchuhe
Achtung: Ein perfekter Sitz ist essenziell! → Steigeisen müssen mittig, spielfrei und ohne Druckpunkte sitzen.
Zackenanzahl & Zackenform – Was brauche ich?
Typ Zackenanzahl Frontzacken
Einsatzzweck
Allround-Eisen 10–12 Horizontale Frontzacken Hochtouren, Gletscher, Firn
Technik-Eisen 12–14 Vertikale Frontzacken
Mono-Point 1 Frontzacke
Sehr präzise (nur Profis)
Eis-/Mixedklettern
Technisches Eis, Drytooling
Modulare Eisen Austauschbare Zacken Horizontal oder vertikal wählbar Für individuelle Anpassung
Je mehr Zacken, desto besser der Halt – aber auch höheres Gewicht und eingeschränkte Beweglichkeit.
Antistollplatten (Anti-balling plates)
Diese Gummiplatten unter dem Steigeisen verhindern, dass sich nasser Schnee unter den Zacken verklumpt (sog. „Anstollen“) – was extrem gefährlich sein kann. Moderne Steigeisen sollten immer mit Antistollplatten verwendet werden!
Haltbarkeit & Pflege:
• Lebensdauer: Regelmäßigem Einsatz ~10 Jahre, je nach Abnutzung
• Kontrollieren: Vor jeder Tour auf Risse, gelockerte Schrauben, abgenutzte Zacken
• Nachschärfen: Nur Stahlzacken (nicht bei Alu!)
• Lagerung: Trocken, scharfkantig geschützt, idealerweise in einer Steigeisentasche
Kauf-Tipps:
• Kompatibilität prüfen – passt das Eisen zu deinem Schuhmodell?
• Einsatzbereich definieren – brauchst du Allround-, oder Technik-Eisen?
• Achte auf CE- / UIAA-Zertifizierung – geprüfte Produkte verwenden
• Tasche mitkaufen – schützt Ausrüstung & andere Gepäckstücke
Wann brauche ich richtige Steigeisen?
• Gletscherquerungen / Spaltenzonen
• Firnhänge ab 30°
• Eistouren
• Kombinierte Routen mit Felskontakt
• Hochalpine Touren ab Kategorie C/D
Wann benötige ich sie nicht?
✘ Normales Wandern
✘ Leichte Bergwege
✘ Querung mit wenig Altschnee → dafür sind Grödel besser
Eigenschaften:
• 10–12 Zacken aus Aluminium (teils mit Frontzacken)
• Gewicht: 400–700 g
• Für feste Bergstiefel/ steigeisenfeste Wanderschuhe (Kat. B/C oder C)
Bindungstypen:
• Körbchenbindung: vorne und hinten Körbchen → für steigeisengeeignete Trekkingschuhe
• Hybrid (Halbautomatisch): Fersenbügel hinten, Körbchen vorne → für C-Kategorie Schuhe mit Sohlenlippe hinten
Leichtsteigeisen passen nicht auf jeden Schuh – vorher Passform testen!
Einsatzbereich:
• Leichte Hochtouren, Gletscher ohne großen Eiskontakt
• Firnfelder, steile Schneehänge, Spätwintertouren
• Ideal als Notausrüstung bei „Restschneefeldern“
Vorteile:
✔ Gute Traktion auf Firn
✔ Viel leichter als vollwertige Steigeisen
✔ Kompakt & in vielen Sommertouren nützlich
Nachteile:
✘ Aluminium nutzt sich bei Felskontakt schnell ab
✘ Eingeschränkter Einsatz in Eis oder Mixed
✘ Nicht zum Frontzackengehen oder für vertikales Eis
Technische Tipps zur Auswahl & Nutzung:
Passform:
• Unbedingt mit dem richtigen Schuh testen
• Grödel & Leichtsteigeisen müssen fest sitzen, aber nicht einschneiden
• Bei Alu-Steigeisen: auf symmetrischen Sitz achten, da Alu weich ist
Zubehör:
• Antistollplatten bei Leichtsteigeisen verhindern das Anstollen (Schnee klumpt unter der Sohle)
• Packtasche verwenden → schützt restliche Ausrüstung im Rucksack
• Verlängerung der Bindung prüfen bei größeren Schuhgrößen (besonders mit dicker Gamasche oder Winterstiefeln!)
Kauf-Tipps:
• Nur kaufen, wenn dein Schuh zur Bindung passt
• Modelle mit Frontzacken = mehr Sicherheit in steilerem Gelände
• Aluminium = Gewichtsvorteil, aber keine Felsberührung!
„Zwischen Gehstock und Eisgerät – ein unterschätztes Multitalent.“
Ein leichter Pickel (auch „Wanderpickel“ oder alpin-light Pickel) ist in weglosem, steilem Schneegelände oder bei Querungen über Schneefelder mehr als nur Zierde. Und: Er gehört nicht nur in GletscherExpeditionen – auch viele Wanderer stehen irgendwann vor einem firnbedeckten Hang oder harten Altschneefeld.
Warum ein Pickel sinnvoll ist:
• Stabilität beim Gehen auf hartem Schnee oder Eis (z.B. Hochtouren)
• Selbstsicherung bei Querungen oder rutschigem Gelände
• Selbstrettung durch Bremstechniken bei einem Sturz
• Alternative zum Stock, wenn es steiler und glatter wird
Worauf du beim Kauf achten solltest:
Gewicht & Länge:
• Leicht (<400 g) → Ideal für Hochtouren oder lange Zustiege
• Länge: Faustregel: Im Stand sollte der Pickelgriff etwa bis zum Knöchel reichen.
→ Zu lang: unhandlich.
→ Zu kurz: kaum nutzbar zum Abstützen.
Material:
• Kopf & Haue aus Stahl → Besser für Haltbarkeit und Härte.
• Aluminium-Hauen sind leicht, aber nur bei weichem Schnee sinnvoll.
• Schaft aus Alu → Leicht & robust.
Schaftform:
• Gerader Schaft → besser zum Gehen, Abstützen, klassische Nutzung
• Gebogener Schaft → für Steilgelände, vereiste Rinnen – eher bei Eisgeräten relevant
Selbstrettung / Pickelbremse
• „Wie halte ich an, wenn ich ausrutsche?“ – > Das solltest du üben!
• Technik: Brust auf den Pickel, Spitze in den Hang drücken, Körpergewicht drauflegen – aber das ist kein Reflex, das muss man mal gemacht haben!
Tipp:
• Handschlaufe + Pickelhalterung am Rucksack einplanen.
• Auch ohne Steigeisen kann ein Pickel bei harten Altschneefeldern den Unterschied machen, ob du queren kannst – oder umdrehen musst
• Kaufe eine Abdeckung für die spitzen Enden deines Pickels dazu, um dich nicht zu verletzen, wenn du ihn nicht benötigst und um andere Ausrüstung nicht zu beschädigen.
„Wenn der Berg dich bis zum Knie einsinken lässt – zieh dir was drunter!“ Schneeschuhe sind für viele Touren im Winter oder Frühjahr die einzige Möglichkeit, effizient voranzukommen, ohne ständig hüfthoch einzusinken. Moderne Schneeschuhe sind längst nicht mehr klobige Holztrümmer, sondern technisch ausgeklügelte Tools, die auch in steilerem Gelände eine echte Hilfe sind.
Wann machen Schneeschuhe Sinn?
• Schneetiefe ab ca.20 cm, frischem Pulverschnee, weichem Untergrund
• Zustiege zu Winterräumen / unbewirtschaftete Hütten
• Schneefelddurchquerungen im Frühling
• Forstwege oder Almen mit geschlossener Schneedecke
• Schneeschuhtouren
Worauf achten beim Kauf:
Größe / Auflagefläche:
• Je mehr Gewicht (inkl. Rucksack), desto größer sollte die Auflagefläche sein.
• Faustregel: 55–70 kg = kleiner Schuh (~22 in), 70–90 kg = Standardgröße (~25 in), darüber XL (~30 in)
Bindung:
• Muss mit deinem Bergschuh kompatibel sein – fest und sicher!
• Ratschenbindung (einfach), Boa-System (schnell), Körbchenbindung (robust)
Steighilfe:
• Eine klappbare Fersenstütze entlastet die Waden beim Aufstieg.
• Unverzichtbar bei Touren mit Höhenmetern.
Harscheisen / Zacken:
• Je mehr Zacken unter dem Fuß, desto mehr Grip auf harten Passagen.
• Wichtig in steilerem oder vereistem Gelände.
Material / Gewicht:
• Kunststoffrahmen: leicht & gut für wechselhafte Bedingungen
• Aluminiumrahmen: robuster, besser bei hartem Untergrund
Hinweise:
• Nicht alle Schneeschuhe sind für steile Touren gedacht – bei viel Querung oder Hanglagen lieber tourentaugliche Modelle mit viel Grip wählen!
• LVS-Ausrüstung dabei haben - Lawinengefahr!
• Nicht vergessen: Schneeteller an die Trekkingstöcke, sonst sind sie nutzlos im Powder.
Tipp:
• Vor der Tour ausprobieren! Geh ein paar Runden im Gelände, um Bindung & Gangart kennenzulernen.
• Plane bei der Navigation eine niedrigere Geschwindigkeit ein –Schneeschuhwandern ist fordernder als man denkt!!!
Wer sich im Winter in lawinengefährdetes Gelände wagt - ob mit Schneeschuhen, Tourenski oder zu Fuß – kommt um die Heilige Dreifaltigkeit der Lawinenausrüstung nicht herum: LVS, Sonde, Schaufel. Und zwar nicht im Rucksackboden vergessen. Und vor allem: Benutzen können. Sonst bringt's nix.“
• LVS-Gerät (aktiv senden + empfangen, richtige Trageposition)
• Lawinensonde (Länge, Handling, Funktion)
• Schaufel (kein Billig-Plastik! Stabil & handlich)
Das übersteigt aber meine Kompetenzen derzeit um da ausführliche zu berichten und Tipps zu geben. Das erfolgt in zukünftigen Versionen dieser Fibel.
Ein Hüttenabend in den Bergen kann herrlich entspannt sein –vorausgesetzt, du hast die richtigen Dinge dabei. Denn auch wenn viele Hütten gut ausgestattet sind, gelten andere Standards als im Hotel. Mit dieser Packliste bist du auf der sicheren Seite – von Schlafkomfort bis Abendunterhaltung.
Schlaf & Komfort:
• Hüttenschlafsack (oft Pflicht!) – aus hygienischen Gründen notwendig
• Hüttenschuhe (ebenfalls oft Pflicht!) – keine Bergschuhe im Inneren
• Bequeme Wechselkleidung – für den gemütlichen Hüttenabend
• Ohrstöpsel – bei Schlaflagern: Gold wert!
• Schlafmaske – wenn du lichtempfindlich bist
• Stirnlampe – mit Rotlichtmodus, um andere nachts nicht zu blenden
Hygiene & Gesundheit:
• Leichtes Mikrofaser-Handtuch – trocknet schnell und spart Platz
• Tüte mit biologisch abbaubarer Seife, Zahnbürste & Zahnpasta
• Blasenpflaster & Mini-Erste-Hilfe-Set – für kleine Notfälle
• Desinfektionsmittel oder Handwaschgel – besonders sinnvoll bei Gemeinschaftseinrichtungen
Energie & Verpflegung:
• Powerbank & Kabel – Steckdosen sind oft Mangelware
• Snacks: Müsliriegel, Nüsse, Trockenfrüchte – falls du später ankommst
• Trinkflasche (min. 1 L) – nicht jede Hütte stellt Gläser zur Verfügung
Extras für Komfort:
• Bargeld – viele Hütten akzeptieren keine Kartenzahlung
• Mini-Spiele oder Lektüre – ideal für ruhige Abende ohne Netz
• DAV-Ausweis – wichtig für Mitgliederrabatte & Übernachtungen
"Nicht alle, die aufs Gipfelkreuz steigen, haben das Herz am rechten Fleck – leider kommt es auf Hütten auch mal zu Diebstählen.“
Wer an einer Hütte ankommt, ist meist erschöpft, hungrig – und froh, dass er erstmal angekommen ist. Und genau hier passiert’s: Die neuen Schuhe stehen unbeaufsichtigt vor dem Eingang, Jacken hängen im Trockenraum, der Rucksack hängt irgendwo auf einem Haken.
Was wird typischerweise entwendet?
• Schuhe (oft hochwertige Bergstiefel oder Zustiegsschuhe)
• Jacken (Hardshell, Daune – alles, was teuer aussieht)
• Rucksäcke, wenn sie unbewacht rumstehen
• Powerbanks & Elektronik beim Aufladen
• Geldbörsen, Uhren, Handys (selten, aber vorgekommen)
Warum ist Diebstahl ein echtes Problem?
• Ohne Schuhe oder Jacke ist ein sicherer Abstieg kaum möglich.
• Versicherungen zahlen nur selten oder schwerfällig.
◦ Der DAV kann in bestimmten Fällen helfen, aber Nachweise wie Quittungen und Seriennummern sind erforderlich.
• Es kommt nicht nur auf den finanziellen Schaden an – sondern auf das Risiko, das dadurch entsteht.
Was du tun kannst, um dich zu schützen:
Schuhe sichern:
• Sohlen (Einlagen) mitnehmen, wenn du sie vor der Tür stehen lässt –wer will schon in fremden Schuhen ohne Einlage absteigen?
• In einen Beutel packen.
• Schnürsenkel zusammenknoten und durch Karabiner sichern
Jacke & Bekleidung:
• Innen beschriften: Initialen, Name, Telefonnummer mit Textilmarker
• Mit Reißverschlussbeutel markieren oder farblich kennzeichnen
Wertgegenstände & Rucksack:
• Wertsachen in den Schlafsack nehmen: Handy, Geldbörse, Uhr
• Brustbeutel oder Bauchtasche als „Nacht-Portemonnaie“
• PACSAFE-Systemsicherung: Anti-Diebstahl-Netz (Drahtkäfig-Prinzip) für den Rucksack → an Bettgestell sichern
• AirTag oder Tracker im Rucksack verstecken (funktioniert gut, wenn andere iPhones in der Nähe sind)
Tipp: Viele Hütten sind offen für eine sichere Zwischenlagerung. Frag freundlich beim Personal, ob du deinen Rucksack dort „zwischenparken“ darfst – z. B. im Küchenbereich, in Personalräumen oder unter der Theke.
Verhalten & Haltung:
• Nicht paranoid werden – aber wachsam sein.
• Andere ansprechen, wenn dir etwas auffällt (z. B. jemand geht mit zwei Paar Schuhen raus...)
• Wertsachen nicht offen liegen lassen, auch nicht „nur kurz“ beim Zähneputzen
• Gruppendynamik nutzen – gegenseitig auf Sachen achten, gemeinsam unterwegs sein
Was im Fall der Fälle?
Wenn nun doch etwas fehlt:
1. Hüttenwirt*in sofort informieren
2. Fundbücher oder Gemeinschaftsräume durchsuchen
3. Anzeige erstatten bei Polizei (meist notwendig für Versicherung)
4. DAV-Sektion kontaktieren– manchmal gibt es Hilfe oder zumindest Rat
Fazit:
Bergfreundschaft, Kameradschaft – das ist das, was wir lieben. Aber Verantwortung beginnt bei dir selbst. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du den Großteil der Risiken minimieren – und deine Bergzeit bleibt genau das, was sie sein soll: unvergesslich – aber nicht wegen eines verschwundenen Rucksacks.
Zugegeben: Für viele von uns war es lange unvorstellbar, auf Bären oder Wölfe in den Alpen zu treffen. Doch durch die Rückkehr großer Beutegreifer in ihre ursprünglichen Lebensräume nimmt das Thema Tierkontakte auf Bergtouren an Bedeutung zu – vor allem in Österreich, Italien, Slowenien und zunehmend auch in Süddeutschland. Das bedeutet nicht, dass man panisch durch den Wald stapfen muss –aber Wissen, Respekt und Vorbereitung helfen, Konflikte zu vermeiden.
Welche Wildtiere begegnen uns in den Alpen?
• Bären (insbesondere im Trentino, Slowenien, Südtirol)
• Wölfe (v.a. in abgelegenen Regionen, Rudel meist scheu)
• Luchse (extrem scheu, keine Gefahr für Menschen)
• Schlangen (Kreuzottern & Aspisvipern – Biss möglich, selten tödlich)
• Herdenschutzhunde (Schafherden → das häufigste „Problem“)
• Wildschweine & Rotwild (besonders mit Frischlingen oder Brunft)
Wichtig zu wissen: Wildtiere sind selten aggressiv.
In den meisten Fällen vermeiden sie aktiv den Kontakt zum Menschen.
Unfälle oder Zwischenfälle passieren meist durch:
• Überraschung / Näherung auf kurze Distanz
• Futterquellen oder Müll
• Schutzhunde bei der Arbeit
• ungewollte Provokation oder Neugier (z. B. Fotografieren)
Verhaltenstipps zur Vorbeugung & Begegnung:
Allgemein bei Wildtiergebieten:
• Leise, aber hörbar unterwegs sein (kein Schleichen)
• Nie Wildtiere füttern!
• Müll mitnehmen – Essensreste locken Bären und Füchse an
• Zeltlager oder Biwak sauber halten
• Lebensmittel geruchsneutral verpacken (z. B. in Zip-Beuteln)
Bärenkontakt – was tun?
• Ruhe bewahren – Bären greifen Menschen äußerst selten an.
• Nicht rennen! – Das löst Flucht- oder Jagdverhalten aus.
• Langsam zurückziehen, laut und ruhig sprechen.
• Sich groß machen, Arme heben.
• Kein Augenkontakt aufbauen – wirkt wie Bedrohung.
Wenn der Bär sich aufrichtet: Kein Angriff! → Er nimmt Witterung auf.
Und wenn der Bär näher kommt?
• Pfefferspray bereithalten (sicher & legal z. B. in AT & IT → Tierabwehrspray)
• Nicht schreien, nicht wegrennen.
• Gegenstand fallen lassen, um Interesse umzulenken (z. B. Mütze, Stock)
Wölfe
• Meist nur Sichtkontakt → selten näher als 100 m
• Nicht anlocken, nicht füttern.
• Keine Angst zeigen, nicht weglaufen.
• Mit fester Stimme sprechen, ggf. mit Wanderstock deutliche Bewegungen machen
• Hunde unbedingt anleinen! (Wölfe könnten auf sie reagieren)
Herdenschutzhunde – die wahren „Schlüsseltiere“ für Konflikte
Weniger Wildtier – mehr Realität im Sommer. Diese Hunde schützen Schafherden & verteidigen „ihr Rudel“ – auch gegen dich. So gehst du sicher vorbei:
• Distanz halten – weiträumig umgehen, wenn möglich
• Langsam gehen, nicht rennen oder provozieren
• Stock sichtbar tragen, aber nicht auf den Hund richten
• Kein Augenkontakt
• Sprechen in ruhigem Tonfall
• Hund bellen lassen, ohne sich beeindrucken zu lassen
• Bei Aggression: Rückzug langsam und ruhig antreten
Tipp: Bei Unsicherheit kannst du auch Hirten oder Infotafeln nach Wegen fragen, die außerhalb der Herdenzone verlaufen.
Tierabwehr-Ausrüstung – was ist sinnvoll?
Tierabwehrspray (z. B. Bärenspray)
• Reichweite bis zu 10 m
• Wirkstoff: Capsaicin (hochdosiertes Chili)
• Wichtig: Ausschließlich zur Tierabwehr gedacht!
• Tragebereit außen am Rucksack befestigen
• Nur einsetzen, wenn direkter Angriff bevorsteht
Wanderstock / Teleskopstock
• Hilft als Verlängerung, Barriere – aber keine Waffe!
• Nicht „drohend“ verwenden
Bärenglocke / Geräuschmacher
• Soll durch Klingeln die Tiere frühzeitig warnen
• In Europa eher umstritten – viele halten es für überflüssig oder gar kontraproduktiv (ständig Lärm…)
Fazit
Die Natur ist kein Zoo – sie ist wild. Und du bist Gast in ihr.
Tierbegegnungen sind selten – aber möglich. Ein gutes Verhalten und einfache Maßnahmen sorgen dafür, dass es friedlich bleibt. Du musst keine Angst haben – aber Respekt & Vorbereitung gehören genauso ins Gepäck wie ein Erste-Hilfe-Set oder ein Schlafsack.
Alpine Fachverbände und Organisationen
• Deutscher Alpenverein (DAV)
www.alpenverein.de
Informationsportal für Bergsport, Ausrüstung, Sicherheit, Hüttenwesen, Tourenplanung und Naturschutz.
• Österreichischer Alpenverein (ÖAV) www.alpenverein.at
Fachinformationen u.a. zu Notfallausrüstung, alpinen Risiken, Erste Hilfe und Selbstversorgung.
• Schweizer Alpen-Club (SAC) www.sac-cas.ch
Veröffentlicht regelmäßig Hinweise zu Lawinenkunde, Biwakieren, Ausrüstung und Tourenverhalten.
• Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) www.vdbs.de
Fachverband der Berufsbergführer, mit Empfehlungen zu Klettersteigsets, Gurten, Helmen, Sicherungstechniken.
• UIAA – Internationale Union der Alpinisten www.theuiaa.org
Weltweite Sicherheitsstandards, u. a. für Helme, Steigeisen, Kletterausrüstung und Lawinenschutz.
Bergmedizin & Outdoor-Erste-Hilfe
• Bergwacht Bayern / Deutsches Rotes Kreuz www.bergwacht-bayern.de
Spezialisiertes Wissen zu Erster Hilfe in alpinem Gelände, Notfallstrategien, Signalen & Ausrüstung.
• Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) www.alpinesicherheit.at
Stellt regelmäßig Unfallanalysen und praxisnahe Empfehlungen zur Verfügung.
• UIAA Medical Commission
International empfohlene Standards zu Höhenerkrankungen, Wasserhaushalt, Thermoregulation, Ernährung.
• ISMM – International Society for Mountain Medicine www.ismm.org
Fachlich fundierte Beiträge zu Höhenkrankheit, Kälteschutz, Schlaf in der Höhe und Notfallmedizin.
Wetter, Orientierung & Sicherheit
• Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) – Österreich www.zamg.ac.at
Fundierte Informationen zu Bergwetter und Lawinenlagebericht.
• Deutscher Wetterdienst (DWD) www.dwd.de
Fachportal für Wetterwarnungen und Gebirgswetter.
• Lawinenwarndienste der Länder (z. B. Bayern, Tirol, Südtirol) Für Informationen zu Schneeprofilen, Lawinenwarnstufen und regionalen Besonderheiten.
Zusätzliche technische & praxisnahe Quellen
• Mountain Equipment, Ortovox, Petzl, Mammut, La Sportiva Technische Datenblätter, Produktinformationen & Sicherheitshinweise der Hersteller.
• Stiftung Warentest / Outdoor-Magazine (Bergsteiger, Outdoor) Als Orientierung zu Materialvergleichen, Praxisberichten und Produkttests.
• Bergschule & Bergführerbetriebe Eigene Erfahrungswerte und Austausch mit Profis vor Ort.
Hinweis zur Methodik:
Die Inhalte in diesem Buch sind eine Mischung aus persönlicher Erfahrung, alpinistischen Grundkenntnissen, aktuellen Sicherheitsstandards und Feldwissen. Obwohl viele Quellen öffentlich zugänglich sind, ersetzt dieses Buch keinen professionellen Kurs, sondern soll als praktische, verständliche und persönliche Ergänzung dienen.
Dieses Buch wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es basiert auf persönlichen Erfahrungen, öffentlich zugänglichen Informationen, Fachwissen aus dem Bereich des Bergsports sowie allgemein anerkannten Empfehlungen alpiner Organisationen. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte übernommen werden.
Die Ausübung von Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Klettersteigen oder Biwakieren im alpinen Raum erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Weder der Autor noch eventuelle Mitwirkende oder Herausgeber haften für Unfälle, Schäden oder gesundheitliche Folgen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der in diesem Buch enthaltenen Informationen stehen.
Bitte beachte:
• Naturverhältnisse, Wetterbedingungen und Geländegegebenheiten können sich jederzeit ändern.
• Die individuelle Eignung, körperliche Verfassung und Erfahrung müssen stets kritisch geprüft werden.
• Eine sorgfältige Tourenplanung, das Mitführen geeigneter Ausrüstung sowie das Erlernen und Anwenden alpiner Techniken (z. B. Erste Hilfe, Navigation, Lawinenkunde) sind unerlässlich.
• Dieses Buch ersetzt keine professionelle Ausbildung, keinen Erste-HilfeKurs und keinen Kontakt zu erfahrenen Bergführern oder Fachkräften.
Alle Hinweise und Empfehlungen in diesem Werk dienen der Inspiration und Orientierung – nicht der rechtlich verbindlichen Anweisung.
Zum Schluss ein paar letzte Worte – von Gipfel zu Gipfel
Du hast es bis hierher geschafft – und nein, dafür gibt’s (leider) keinen Kaiserschmarrn. Aber vielleicht einen wohlverdienten Applaus, ein Lächeln – oder den spontanen Wunsch, den Rucksack zu packen.
Denn genau darum ging es bei dieser kleinen, feinen Ausrüstungsfibel: nicht um Perfektion, sondern um Vorbereitung. Nicht um die eine richtige Marke, sondern um dein eigenes System. Und nicht zuletzt um ein Stück Leidenschaft, das uns alle verbindet – für Berge, für Draußen, für unterwegs sein.
Die Touren, auf die du dich vorbereitest, wirst du mit Herz, Verstand und vermutlich gelegentlichem Muskelkater bestreiten. Vielleicht mit zu viel Gepäck, vielleicht mit zu wenig Snacks – aber ganz sicher mit Geschichten, die du erzählen kannst.
Und wenn du beim nächsten Mal am Gipfel sitzt, die Brotzeit auspackst und an irgendwas aus diesem Buch denkst – vielleicht an die Tatsache, dass Socken wirklich wichtiger sind als man denkt, oder dass ein Buff mehr kann als manche Superhelden – dann hat sich alles gelohnt.
Zum Mitnehmen (nein, nicht der Müll – der bleibt nicht am Berg!):
• Du musst nicht alles dabei haben. Aber du solltest wissen, was du nicht dabei hast.
• Der beste Rucksack ist der, den du trägst – nicht der, den du nur anschaust.
• Blasen kommen nicht von Schwäche, sondern von falschen Socken.
• Die Sonne ist kein Kumpel – sie ist ein Brenner. Schütz dich.
• Ein voller Akku ist gut. Ein voller Bauch besser. Ein voller Rucksack? Ansichtssache.
• Und falls mal was fehlt: Improvisation ist die Mutter aller Abenteuer.
Bleib neugierig. Bleib respektvoll. Bleib draußen.
Ich wünsche dir von Herzen trockene Füße, gute Fernsicht und nette Hüttennachbarn, aber vor allem: viele unvergessliche Touren. Mit Gipfelglück, Sonnenaufgangs-Momenten, stillem Respekt vor der Natur –und der Erkenntnis, dass der Weg oft schöner ist als das Ziel.
Und vergiss nicht:
Ein Berg lacht nicht, wenn du stolperst. Aber Du darfst!
Gute Tour! Und bis bald auf einem schmalen Pfad.

Dieses Buch ist meinem geliebten Patenonkel gewidmet –meinem größten Fan, meinem Mentor, meinem treuen Wegbegleiter im Leben.
Sein letzter Brief an mich enthielt diese Worte – und ich möchte sie mit euch teilen:
„Und wenn du dann auf dem Gipfel des einen oder anderen Berges stehst, den Alltag im Tal gelassen hast, dein Kopf frei ist und ein Glücksgefühl deinen Körper durchfließt, wirst du erkennen, wie winzig doch der Mensch mit seinen „Problemen“ ist. Dann atme tief durch und danke dem Schöpfer für die Schönheit dieser Bergwelt.“
Für dich.
Für jeden stillen Moment am Gipfel, in dem du mir in Gedanken doch wieder neben mir stehst.
Danke für alles.
Peter Noll
*14.06.1949 - ✝15.04.2024
© 2025 - Pierre Weiß
Pierre Weiß
Zum Hainhof 3
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland
E-Mail: mail@pierreweiss.com
Telefon: 0173 4087072