
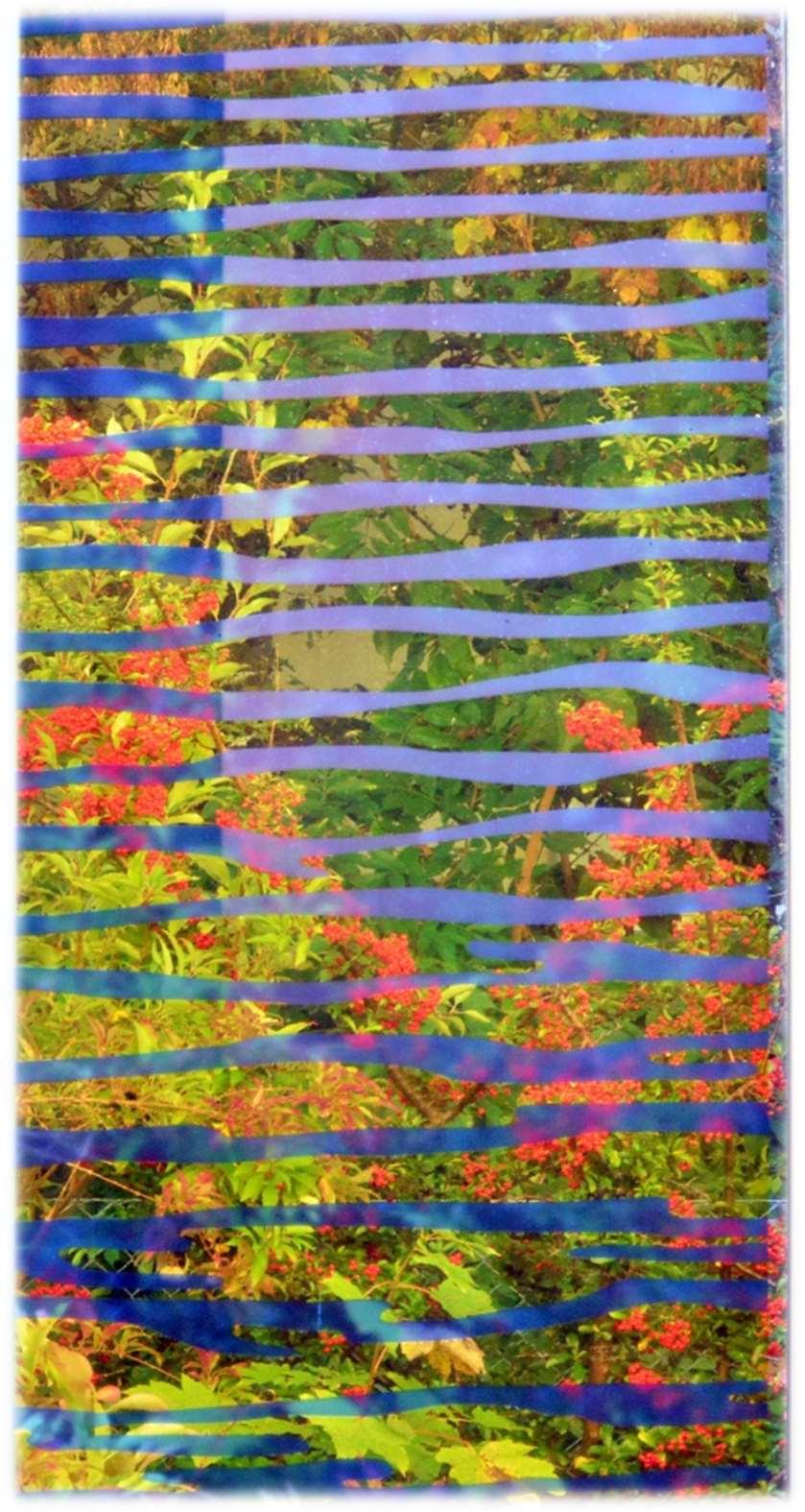


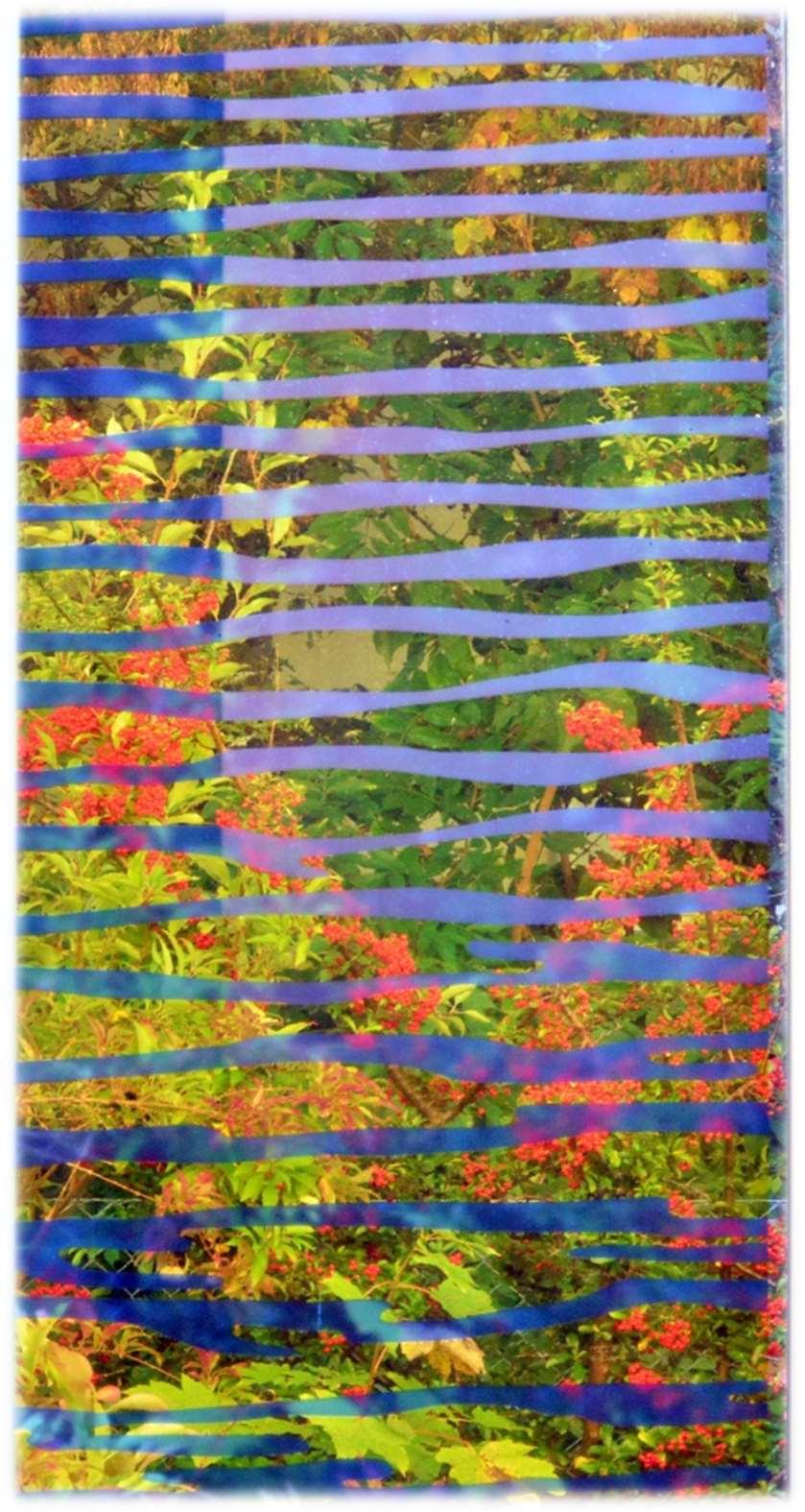
Eine Würdigung
Pfarrer Ernesto Vigne war von 1986 bis 2019 als erster katholischer Seelsorger der Psychiatrischen UniversitätsklinikZürich(PUK)tätig.
Dienststelle der kath. Spital- und Klinikseelsorge im Kanton Zürich
Editorial


Pfarrer Ernesto Vigne mit seiner damaligen Kollegin, Sabine Zgraggen, in der Spitalkirche der PUK im Winter 2018/19, Foto: Markus Breulmann
33 Jahre in einer psychiatrischen Klinik als Seelsorger zu wirken, das ist eine lange Zeit. Es ist so etwas wie ein ganzes Leben! Pfr. Ernesto Vigne war der erste katholische Pfarrer an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, ehemals „Burghölzli“ genannt. Im Mai 2019, im Alter von 75 Jahren, ging Pfarrer Vigne in seinen wohlverdienten Ruhestand. 1986 im reformierten Zürich beginnend, verkörperte er mit seinem Dienst in der Psychiatrie auch eine neue Ära der ökumenischen Zusammenarbeit.
Unaufdringlich, höflich, mit einer versierten Offenheit gelang es ihm schon immer, zu den leidenden Menschen – auch aus anderen Kulturkreisen – einen Zugang zu finden. Dabei halfen ihm seine Sprach-
kenntnisse von Italienisch über Rätoromanisch bis zu Französisch, aber auch Grundkenntnisse in Neugriechisch, Albanisch und anderen mehr. Ein paar Brocken in der Muttersprache der Patienten zu sprechen, sich auch in diesem Sinne um Verständigung zu bemühen, war bei ihm mehr als guter Stil. Es zeigte seine weltoffene Haltung und rang den Patienten gleich eingangs bei der Begrüssung schon ein Lächeln ab.
Religion verbindet Kulturen. Gleichzeitig war es ihm aufgrund seiner tiefenpsychologischen Ausbildung, die er seit den 1980er-Jahren am C.G. Jung-Institut pflegte, möglich, auf verschiedenen Klaviaturen zu spielen. Er vermochte das Seelisch-Geistige jenseits eines zu engen Religionsbegriffs zu verbinden. Was ihn ebenfalls auszeichnete, war sein wortwörtliches Musikgehör. Oftmals spielte er an der Klinikorgel nur für sich selbst, manchmal auch für Patienten. In der Musik öffnete sich für ihn ein weiter Horizont, und er drückte darin seine Empfindungen aus. Tragisches und Belastendes vom Tag konnte so verwandelt werden.
Da eines seiner Hobbys glücklicherweise die Fotografie war, konnte die folgende Fotosammlung mit seinen Beschreibungen – gleichsam als Erbe – der Dienststelle für Spital- und Klinikseelsorge übergeben werden. Dafür dankt ihm die jetzige Dienststellenleiterin und ehemalige Kollegin und wünscht allen Lesenden eine informative Lektüre.
Zürich, den 6.10.2020
Sabine Zgraggen
Alle Fotos und Bildbeschreibungen stammen von Pfr. Ernesto Vigne.


Dieses Foto ist eine Reproduktion aus der „Hauszeitung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich“, „Bli-Info“ genannt, Nr. 66/ April 1987. Darin beschreibt der damalige reformierte Klinik-Pfarrer Ueli Schwendener die Geschichte des reformierten Pfarramts in der Klinik. Der Text zum Bild: „Es muss von Anfang an eine Kapelle bestanden haben.“ Im Jahresbericht von 1929 ist vom „Gottesdienst im schönen Betsaal“ die Rede. 1935 wurde der Raum renoviert. Aus diesem Jahr stammt auch das Bild. 1970 fiel der Betsaal dem Umbau des Mitteltrakts zum Opfer.
Der Andachtsraum blieb vorerst ohne Ersatz.


Als ich am 1. Januar 1986 meine Tätigkeit in der PUK begann, fanden die Gottesdienste im damaligen Konzertsaal statt (dem heutigen Mehrzweckraum). Am Sonntag wurde vormittags jeweils ein reformierter Gottesdienst gefeiert, amAbend danneinekatholischeMesse. Der „Altartisch“ befand sich vor der Türe zum Seminarraum (in der Mitte des obigen Fotos; links davon stand eine elektronische Orgel). Dementsprechend war die Bestuhlung anders ausgerichtet. Die Zahl der Teilnehmer*innen belief sich erfreulicherweise regelmässig auf über zwanzig. In bester Erinnerung ist mir ein Senior, ein Langzeitpatient, dem es eine (nicht antastbare!) Ehre war, mit Stentorstimme jeweils die biblische Lesung vorzutragen.


Als im Jahre 2004 erneut ein Umbau des Mitteltrakts vorgenommen wurde, verloren wir unseren bewährten Gottesdienstraum. SozusagennachalttestamentlichemMuster ginges darumaufWanderschaft, zunächst in den „Untergrund“, nämlich in den Gymnastikraum B. Die Gottesdienste wurden deswegen aber nicht weniger besucht!



UnserenächsteStationwarderprovisorischeHörsaalimGebäude WA.WieschonimGymnastikraum,sotrugauchhiereinFastenopfertuchdazubei,eineAtmosphärederBesinnungzuschaffen. DankdemEinsatzdesHausdienstesundderGärtnereiwurdenbeide RäumezuvalablenNotkapellen.


Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine „richtige“ Kapelle hatte schon im März 2003 angefangen. Der Chefmagaziner Ruedi Frick hatte damals eine ausgezeichnete Idee: Im Parterre des Trakts P0 gebe es einige nicht mehr verwendete Räume, die leicht zu einem kleinen Seelsorgezentrum umfunktioniert werden könnten. Auf dem Foto befinden sie sich hinter den unteren drei Fenstern (von links).


Beim Gebäude mit der Sonnenuhrlag der Eingang zum ganzen Flügel.
Folgende drei Räume hatten ausgedient: ein Vorraum der Pathologie (mit Kühlaggregat zur Aufbewahrung der Leichen – siehe Fotos) …


…. dann der Sezierraum (Foto links) und eine Kammer mit Gerätschaften und Möbeln (Foto unten; Sezierraum im Hintergrund) und schliesslich ein diskreter Aufbahrungsraum (ohne Foto).



Das damalige Seelsorgeteam (v.l.n.r.): Urs Eisenhut, Elvira Baer und Ernesto Vigne
Die Verhandlungen zwischen Kanton und Landeskirchen verliefen positiv. Früh schon wurde deshalb zur Gestaltung eines kleinen „Seelsorgezentrums“ externe Beratung eingeholt (unten, v.l.n.r.): Johannes Stückelberger als Kunstsachverständiger und in Vertretung der Landeskirchen: Markus Köferli (kath.) und Irene Gysel (ref.).

Am 27. Januar 2006 wurde der Vertrag aufgesetzt zwischen der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich sowie der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich. Diese teilten sich die Baukosten von Fr. 480‘000.— (gemäss Voranschlag vom 19.2.2005) zu je einem Drittel. Geregelt wurden auch Benützung und Zutritt, die Zuständigkeiten für den Betrieb inkl. Reparaturen, Sicherheitsvorschriften, schliesslich auch die Vertragsdauer (vorerst auf zehn Jahre) inkl. Kündigungsfrist. Die Kosten (Fr. 6‘000.–) für den geplanten Tabernakel übernahm vollumfänglich die katholische Körperschaft; jene für die speziellen Fenster des Künstlers Hugo Suter, Birrwil, teilten sich die beiden Landeskirchen (je Fr. 20‘000.—).


Die Planung der Räume wurde seit 2005 dem Architekturbüro Meletta Strebel Zangger (Zürich und Luzern) übergeben. Dieses gestaltete mehrere Entwürfe, die selbstverständlich eingehend diskutiert wurden.


Ein Modell veranschaulicht die Umgestaltung der alten Räume.
Der Zugang zum Büroraum oben rechts hätte allerdings gemäss Modell nur durch das andere Büro erfolgen können. Das Problem wurde dadurch gelöst, dass beide Büros ein kleiner Korridor mit zwei Eingängen trennte: einer vom sakralen Raum her und einer von aussen (oben rechts). Von diesem Korridor aus konnte jedes Büro separat betreten werden. Die im Modell vorgesehene Türe zum einen Büro wurde in die Mitte der Wand verlegt, was den Platz für eine elektronische Orgel freigab. Dies als Beispiel, um zu zeigen, wie um jedes Detail gerungen wurde.

Oben: Der fertige Kirchenraum. Einziger Schmuck sind bislang die Fenster und der Tabernakel. Unten: Der Haupteingang auf der Südseite.


Am 22. Dezember 2006 übergab Felix Landolt (4) als Vertreter des Kantons offiziell und mit symbolischer Geste den Raum der Stille an den PUK-Verwaltungsdirektor Kurt Trösch (6). Weitere Anwesende:
1: Frau Suter (ihr Mann gestaltete die Fenster des Raumes), 2: Markus Köferli (kath. Zentralkommission), 3: Urs Eisenhut (ref. Pfarrer), 5: Fredi Sigg (Leiter Technik), 7: Theodor Suter (stv. Leiter Technik), 8: Irene Gysel (ref. Landeskirche)
Auf dem unteren Foto zu sehen sind: 1: Elvira Baer (ref. Pfarrerin), hinter ihr halb verdeckt: Balz Raillard (†), 2: José Pereira (als Vertreter des Hausdienstes)


1 + 2: Hugo Suter (gestaltete die Fenster), hier mit Ehefrau
3: Urs Eisenhut (ref. Pfarrer; zusammen mit Elvira Baer und Ernesto Vigne Initiant der Spitalkirche)

8: Theodor Suter (stv. Leiter Technik)
4: Fredi Sigg (Leiter Technik)
5: Felix Landolt (Vertreter des Kantons Zürich)
6: Kurt Trösch (Spitaldirektor)
7: Roberto Tavaretti (Bereichsleiter Pflege)
9: Irene Gysel (Vertreterin der evang. Landeskirche)
10: Daniel Hell (Professor PUK)
11: Erich Baumann (stv. Spitaldirektor)
12: Elvira Baer (ref. Pfarrerin)

Alskünstlerischüberzeugendundliturgischwürdig erwiessichderEntwurfdesTabernakels,diskretin dielinkeSeitenwandeingefügt.




Die vom Künstler Hugo Suter (Birrwil) entworfenen Fenster
Nächste Seite: Detail eines der Fenster









DerehemaligeKirchenratspräsidentRuediReich(links)hieltdieFestpredigt;WeihbischofPaulVollmar(rechts)sprachdieWeihegebete. NochfehltederWandschmuck(unten).






NachderBesichtigungeinesüberzeugendenWandschmucksvon ChristineSeiterleinderpsychiatrischenKlinikinSchaffhausen wurdederBeschlussgefasst,die KünstlerinmitEntwürfenfürein BildfürunsereKapellezubeauftragen.
AndiesenBesprechungennahm auchderstellvertretendeVerwaltungsdirektorErichBaumann (obenrechts)teil.
AuseinergrossenAnzahlvon Entwürfenwurdeüberraschend schnellundeinstimmigdasspätereBildgewählt.



DasfertigeBildwurdeangeliefertunddessenoptimalePositiongesucht.




StellvertretendfürdievielenHandwerker,dieanderVerwirklichungder Kapellemitgearbeitethaben,zeigtdasFotozweivonihnenbeidersorgfältigenMontagedesBildesam20.Februar2008.






DasBildvonChristineSeiterle:einBlickaufdaszuerreichende GelobteLand;derWegführtüberdasKreuz.


Die Kapelle im Dezember 2010
Ernesto Vigne wurde am 23.2.1944 in Sospirolo in Italien geboren. In den Kriegswirren verlor er früh seine Mutter. Nach dem Krieg suchte der Vater Arbeit in der Schweiz, wo er wieder heiratete. Nach zwei Jahren Primarschulein Italien folgte der siebenjährige Ernestoihm ins rätoromanische Salouf im Kanton Graubünden.
Im Anschluss an die Primarschule besuchte er die Klosterschule in Disentis und erlangte dort 1963 die eidgenössische Matura. Seiner Berufung zum Priester folgend, begann er das Studium der Theologie am Priesterseminar St. Luzi in Chur. Pfarrer Duri Lozza von Salouf hatte ihn für Religion und zudem auch für Kunst, Musik und Geschichte sensibilisiert.

Foto:UrsulaMarkus
Von 1968 bis 1981 war Ernesto Vigne Vikar an der Erlöserkirche in Chur. Als er 1981 als Vikar nach Zürich kam, war es auch hier eine
Erlöserpfarrei, die seinen Wirkungsraum absteckte. Zum Gebiet der Pfarrei gehörte die nahe gelegene Psychiatrische Universitätsklinik, damals noch „Burghölzli“ genannt. Dorthin wechselte er 1986 hauptamtlich als Klinikseelsorger.
Bereits ab 1981 hatte er sich berufsbegleitend am C.G. Jung-Institut in Tiefenpsychologie ausbilden lassen und die Lehranalyse bis 1990 weitergeführt. Dies sieht er als hilfreiche Ergänzung zum Studium der Theologie an, um Menschen – gerade auch psychisch erkrankte Menschen – hilfreich zu begleiten.
Nebst der Fotografie spielt das Orgelspiel eine wesentliche Rolle in Ernestos Leben. Klavierunterricht bekam er bereits in der Primarschule. In Disentis hatte er als 13-Jähriger in der Klosterkirche die Orgelfantasie „Wie schön leucht‘ uns der Morgenstern“ von Max Reger gehört. Das bewegte ihn derart, dass er sofort das Orgelspiel erlernen wollte. Er musste allerdings warten, bis er 17 Jahre alt war, um regulär in der Klosterkirche auf der Orgel spielen zu dürfen. In Chur war in der Folge vier Jahre lang Karl Kolly sen. sein Orgellehrer.
Nach seiner Pensionierung als Klinikseelsorger ist Ernesto Vigne gelegentlich als Aushilfspriester tätig.
Lieber Herr Vigne
Ihre Würdigung trägt den Titel „33 Jahre Burghölzli“. In den 33 Jahren Ihres Schaffens an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich hat sich vieles verändert, sei es baulicher Art oder auch bei den Patientinnen und Patienten. Während die PUK anfangs viele Langzeitpatientinnen und -patienten beherbergte, verlagerte sich der Fokus immer mehr in Richtung Akutpsychiatrie mit wesentlich kürzerer Aufenthaltsdauer. Es gab aber auch in jüngeren Jahren viele Patienten, die immer wieder in den Klinikaufenthalt kamen und zu denen Sie einen sehr guten Zugang fanden und auch eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen konnten. Eine Ihrer grossen Stärken sind die hervorragenden Sprachkenntnisse, die Sie auch bei den immer öfter in die Klinik eintretenden Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund sehr gut in der Spitalseelsorge einsetzen konnten. Sie selbst sagten dazu in einem Interview im „PUNKTUELL“, der Hauszeitschrift der PUK, dass die „Sprache als Schlüssel den Zugang zu den Herzen“ ermöglicht.
In baulichen Themen durfte ich Sie zusammen mit dem Spitalseelsorgeteam beider Landeskirchen ab dem Jahr 2003 begleiten. Es war allen Beteiligten klar, dass das Provisorium im Gebäude WA nicht zum Providurium werden sollte. Nachdem wir viele mögliche Standorte geprüft hatten, wurden wir schlussendlich im Gebäude PO fündig. So schmiedeten wir schon bald Pläne, den nicht mehr benutzten Sezierraum und den Aufbewahrungsraum für die künftige Spitalkirche vorzusehen. Es fanden Verhandlungen statt mit den beiden Landeskirchen, und man einigte sich schon bald darauf, die nicht mehr benötigten Räume in einen Sakralraum – die neue Spitalkirche – umzufunktionieren.
Eines Ihrer grossen Hobbys ist die Musik. An einem Gottesdienst durfte ich erleben, wie Sie selbst in die Tasten griffen und die Anwesenden mit Ihrem schönen Spiel in Bann schlugen. In meiner Zeit an der PUK habe ich Sie als stillen Schaffer erlebt, der dank seiner
Ausstrahlung und Ruhe bei den Patientinnen und Patienten auch im Sinne der Seelsorge und der Therapie viel Positives bewirkte.
Zu Ihren Zukunftsplänen ab dem 75. Altersjahr haben Sie einst im „PUNKTUELL“ gesagt, dass diese von der Psyche, dem Leib und dem Portemonnaie abhängen würden. Zum Portemonnaie erwähnten Sie, dass Sie auch inZukunft in den Pfarreien beim Gottesdienst aushelfen würden. Zu den beiden anderen Themen erklärten Sie, dass Sie weiterhin Albanisch und Neugriechisch lernen möchten und insbesondere Ihre grössten Hobbys, die Musik und die Fotografie, stärker pflegen möchten. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre bei guter Gesundheit, und dass Sie nach den langen Jahren im Dienste der Spitalseelsorge auch die Zeit und Musse für sich und Ihre Hobbys finden.
Erich Baumann
Ex-CEO der PUK

Jahren PUK
Timeline
Versorgungsmodelle / Therapie- und Pflegeformen
Seelsorge
Ein Blick zurück in die Geschichte
Das 150-Jahr-Jubiläum der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) bietet sich an, um einen Blick zurück auf die Entwicklung der Seelsorge im „Burghölzli“ zu werfen. Die nachfolgende Timeline vermag nicht mehr als einen flüchtigen Überblick über die Geschichte der (Klinik-)Seelsorge allgemein und die Seelsorgepraxis in der PUK bis in die Gegenwart zu geben.
Knappe Hinweise auf pastoraltheologische und -psychologische Strömungen sowie auf einzelne personell geprägte Episoden lassen erahnen, wie wechselvoll die Geschichte der Seelsorge in der PUK war. Unsere Timeline fügt sich ergänzend in die Zeitreise ein, wie sie im Jubiläumsjahr auf der Homepage der PUK aufgeschaltet ist.
Sonja Kaufmann, Teamleiterin kath. Seelsorgeteam PUK
Diese Timeline wurde vom ökumenischen Seelsorgeteam zusammengestellt
Zeitpunkt Ereignis Lead
1879 Auguste Forel beklagt sich über den ersten Anstaltspfarrer.
Neun Jahre nach Eröffnung der damaligen „Irrenanstalt Burghölzli“ wird Auguste Forel zum Direktor gewählt und beschreibt einen desolaten Zustand der Klinik. Er äussert sich wenig schmeichelhaft über den protestantischen Anstaltspfarrer Julius Studer, der von den Wärtern derbe Volkstücke aufführen lässt und gerne selber „kneipt“. Er empfiehlt ihm eher den Beruf eines Bier- oder
Erläuternder Inhalt
Eine mehr als 2000 Jahre alte Praxis der Seelsorge findet im 19. Jahrhundert erstmals zu einer reflexiven Seelsorgetheorie (Friedrich Schleiermacher) und einer wissenschaftlichen Diskussion verschiedener Konzepte.
Weiterführende Informationen
1905 Eine zweite teilzeitliche (reformierte) Pfarrstelle wird geschaffen.
Weinwirts und war auf Pfarrer im Allgemeinen nicht gut zu sprechen.
Die Pfarrer Ernst Trauvetter und Eduard Blocher bleiben lange Jahre für das Burghölzli und andere Zürcher Spitäler verantwortlich. Ab 1921 finden die Seelsorge, die Gottesdienste, der Religionsunterricht für jugendliche Patienten und die Austeilung von Bibliotheksbüchern unter dem Titel „Pastoration“ Aufnahme in die Burghölzli-Jahresberichte.
Die liberale Theologie sucht im beginnenden Entkirchlichungsprozess Brücken zur modernen Kultur und den Humanwissenschaften. Sie erkennt, dass der Persönlichkeit der Seelsorgenden grösste Bedeutung zukommt. Oskar Pfister (1902–1939 Pfarrer in Zürich) stösst 1908 auf die Psychoanalyse, nimmt Kontakt mit Sigmund Freud auf und steht mit diesem in regem Briefwechsel. Er entwickelt eine „analytische Seelsorge“. Sein Alterswerk „Das Christentum und die Angst“ (1944) macht ihn zu einem der ersten „Pastoralpsychologen“.
1929 „Gottesdienst im schönen Betsaal“
Es muss von Anfang an eine Klinikkapelle gegeben haben. Im Jahresbericht von 1929 ist vom „schönen Betsaal“ die Rede. 1935 wird der Raum renoviert. (1970 fällt er dem Umbau des Mitteltrakts zum Opfer.)
In den USA entsteht 1925 mit dem Chaplain Anton Boisen, der selbst Psychose-erfahren ist, die erste klinische Seelsorgeausbildungsgruppe. Die Theologiestudierenden lernen, ihre eigene Biografie zu ergründen und psychiatrische Patienten als „living human documents“ zu verstehen. Boisen initiiert CPE „clinical pastoral education“, ein Lernmodell, das international wirksam wird.
1943 Pfarrer Jacobus ten Doornkaat und die ersten weiblichen Kolleginnen
Ab 1943 wirkt Pfarrer ten Doornkaat als hochgeachteter, würdevoller Vertreter seiner Zunft. 1942 wird Ursula Kägi als erste, schlecht bezahlte „Pfarrhelferin“ gewählt. Sie und ihre Nachfolgerin Hedwig Roth müssen jedoch wegen Verheiratung zurücktreten. So
Das optimistische Menschenbild des Kulturprotestantismus hatte in den grauenhaften Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und des Nationalsozialismus versagt. Pfarrer Eduard Thurneysen entwickelt im Gespräch mit seinem Kollegen Karl Barth ein
1976 Der Regierungsrat bewilligt eine volle Pfarrstelle.
existiert damals in der reformierten Kirche eine Art Frauenzölibat.
In den Folgejahren werden die getrennte Männer- und Frauenseite von einem Seelsorger bzw. einer Seelsorgerin betreut.
Prof. Manfred Bleuler liegt viel an der Seelsorge.
Mit Pfarrer Ueli Schwendener zieht ein Vertreter der neuen Seelsorgebewegung ans Burghölzli. Er ist pastoralpsychologisch ausgebildet, nutzt Supervisionen, kollegiale Fallbesprechungen und BalintGruppen.
Es wird selbstverständlich, sich zur Professionalisierung und Qualitätssicherung der Seelsorgearbeit national und international zu vernetzen.
kerygmatisches Seelsorgeverständnis. Er versteht Seelsorge als die Verkündigung des Wortes Gottes von Gericht und Gnade an den Einzelnen.
In den USA trägt der gesprächstherapeutische Ansatz von Carl Rogers zum Aufschwung des CPT „clinical pastoral training“ bei.
Die Seelsorgebewegung im deutschen Sprachraum integriert Theorien und Methoden aus unterschiedlichsten therapeutischen Verfahren. Die „Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie“ wird zum Austauschforum für psychoanalytische, systemische, gruppendynamische und gestalttherapeutische Seelsorgeansätze. Die „Krankenseelsorge“ beider Konfessionen wandelt sich konzeptionell zur „Krankhausseelsorge“, die die Institution mit in den Blick nimmt, z.B. gemäss dem Ansatz des katholischen Pfarrers Josef Meyer-Scheu. Mit dem Niederländer Hans van der Geest, Seelsorger am Diakoniewerk Neumünster, kommt CPT in die Schweiz. Die Ökumenische Bewegung, eine politisch wache Befreiungstheologie und eine feministische Theologie prägen die neue Poimenik.
1986 Ernesto Vigne wirkt als erster katholischer Klinikseelsorger.
Pfarrer Vigne bringt eine Ausbildung am Jung-Institut mit. Die Gottesdienste finden im damaligen Konzertsaal (heutigen Mehrzwecksaal) statt, Sonntag vormittags ein reformierter Gottesdienst, am Abend eine katholische
Es kommt zu Spezialisierungen der Seelsorge in verschiedenen Berufsfeldern (z.B. Krankenhaus, Psychiatrie-, Gefängnis-, Alters, Telefon-, Kinderseelsorge). Systemische und lösungsorientierte Ausbildungsgänge werden
Eucharistiefeier. Von den kantonalen Kirchenleitungen ist eine konfessionell aufgeteilte Patientenbetreuung vorgesehen. entwickelt und insgesamt die Ausbildungsstandards für Seelsorgeanstellungen im Gesundheitswesen angehoben.
1984 erweitert die WHO das biopsycho-soziale Modell des Menschen um seine wesenhafte spirituelle Dimension.
2004 Erneuter Umbau des Mitteltrakts In alttestamentarischer Weise gehen die Gottesdienste auf Wanderschaft, gleichsam in den „Untergrund“, in den kellerhaften Gymnastikraum und später in den provisorischen Hörsaal im Gebäude WA. Dank dem Einsatz des Hausdienstes und der Gärtnerei werden beide Räume zu valablen Notkapellen und bleiben gut besucht.
Die Seelsorgenden pflegen eine Geh-Hin-Kultur. Sie besuchen die Patient*innen auf den Stationen, stellen sich vor, lassen sich gegebenenfalls wegschicken, bleiben niedrigschwellig ansprechbar.
Die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche, politische, ökonomische Kontexte, Pluralisierungen und ethische Fragestellungen erfordern eine weiter ausdifferenzierte Ausbildung. Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung machen eine interkulturelle und interreligiöse Seelsorge dringlich.
2007 Eröffnung eines Seelsorgezentrums.
Die katholische Dienststelle für Spital- und Psychiatrieseelsorge entsteht.
Die ehemaligen Räume der Pathologie werden nicht mehr benötigt. Das damalige Seelsorgeteam (Urs Eisenhut, Elvira Baer und Ernesto Vigne) verhandelt mit Kanton und Landeskirche für ein kleines „Seelsorgezentrum“ mit Spitalkirche und zwei Büros. Zur Gestaltung eines Raumes der Stille wird ein externer Kunstsachverständiger beigezogen. Die Fenster werden vom Künstler Hugo Suter gestaltet. Das Bild ist von der Künstlerin Christine Seiterle.
Die bislang kirchlich verantwortete Seelsorgeausbildung wird als Nachdiplomstudium von der Theologischen Fakultät der Universität Bern und der Theologischen Hochschule Chur akademisiert. Die ersten MasterAbschlüsse für PCPP „Pastoral Care and Pastoral Psychology“ werden anerkannt. In der palliativen Versorgung etabliert sich mit dem katholischen Theologen Simon Peng-Keller „Spiritual Care“ als vierte Säule einer biopsycho-sozial-spirituellen Begleitung von Patient*innen. Diese Entkonkretisierung von Religion
2013 Lernort für Psychiatrieseelsorge
Neben der Alltagsarbeit reflektieren Seelsorgende kontinuierlich ihre Praxis. Im ökumenischen Dialog vor Ort, auf kantonaler Ebene, an internationalen Tagungen arbeiten sie an einer Professionalisierung, die das Lernmodell CPT (clinical pastoral training) weiterführt: erfahrungsorientiert, personenspezifisch, identitätsbildend, systemisch, kontextbezogen. Die PUK wird mit CPT-Kursen, Einzelund Gruppensupervisionen und Symposien ein Lernort für Psychiatrieseelsorge.
in eine unbestimmte Spiritualität bleibt nicht unwidersprochen.
Die AWS „Aus- und Weiterbildung für Seelsorge“ an der Universität Bern initiiert zusammen mit der reformierten und der katholischen Spitalseelsorge einen ersten Schweizer Ausbildungsgang für „Muslimische Seelsorge“.
Bei knapper werdenden Ressourcen und der Zusammenlegung von Gemeinden suchen die christlichen Konfessionen nach einer vermehrten ökumenischen Zusammenarbeit. Zugleich erfordert das Aufkommen von Spiritual-Care-Ausbildungen eine Verhältnisbestimmung zwischen Seelsorge und Spiritual Care, siehe katholischerseits u.a. Doris Nauer, Eckhard Frick SJ.
2019 Religion als „Unterbrechung“
Das Team gestaltet eine Meditationsbroschüre, die Patient*innen und Mitarbeitende einlädt, besondere Orte in der PUK-Umgebung aufzusuchen und sich dabei im Tagesprogramm unterbrechen zu lassen.
Ernesto Vigne wird nach 33 Jahren an der PUK pensioniert. Ein neues Team erkundet die Möglichkeiten für eine verbindlichere Zusammenarbeit mit anderen Diensten und ambulante Angebote. Das Seelsorgeangebot wird katholischerseits mit mehr Stellenprozenten aufgewertet.
Seelsorge gehört zusammen mit Diakonie zu den zentralen Erwartungen, die Menschen an die Kirche richten. Sie steht jedoch nicht im hellen Licht der Öffentlichkeit und wird in kirchen- und gesundheitspolitischen Äusserungen mitunter vergessen. Sie ist herausgefordert, ihre Tätigkeit bei aller Diskretion transparent und verständlich zu machen.
Die Psychiatrie erweist sich aus Sicht der Seelsorge als ein ausgesprochen religiöses Praxisfeld, wo die Kernfragen nach dem Sinn des Lebens, der Existenz einer „geistigen Dimension“ ein virulentes Bedürfnis bleiben.
Meditations-Broschüre
2020 „Integrierte Seelsorge“
Die Kirchen engagieren sich ökumenisch für die Seelsorgepräsenz vor Ort, unter Berücksichtigung von Umfeldanalysen sowie der Definition von Zielgruppen. Sie ist aufsuchend, bietet Kontaktpunkte an, ist vernetzt mit anderen Akteuren, stellt die Erreichbarkeit sicher und leistet Öffentlichkeitsarbeit.
Ein ökumenisch verabschiedetes Positionspapier hält das aktuelle Verständnis und die offenen Fragestellungen fest.
Ein von der Spitalseelsorgevereinigung herausgegebenes „Indikationenset“ zeigt Kriterien auf, die den Seelsorgebedarf anderen Professionen transparent machen. Das gegenwärtige ökumenische Team arbeitet in regelmässigem inhaltlichem Austausch mit der Klinik weiter an einer zukunftsfähigen Seelsorge.
Psychiatrieseelsorge, wo sie von den beiden Kirchen finanziert wird, steht in doppelter (kritischer) Loyalität zur Kirche wie zur Klinik.
Sie hält das Spannungsfeld zwischen interdisziplinärer Zusammenarbeit und Eigenständigkeit, Dokumentation und Schweigepflicht, Zielorientierung und Absichtslosigkeit, Integration und Freiheit aus.
Sie nutzt diese Freiheit zum Wohle der Patient*innen.
Die ökumenische Klinikseelsorge bringt sich im interdisziplinären Gespräch als kompetente Partnerin ein für die Bereiche Sinnfindung, Transzendenz, Identität und Werte.
„Seelsorge gestalten“
Ökumenisches Positionspapier
Indikationenset
Brief von Rolf Mösli-Widmer (1981–1998 Stationsleiter im Pflegedienst; †6. April 2020) an Sabine Zgraggen, Leiterin der Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge der kath. Kirche im Kanton Zürich











Mit freundlicher Genehmigung der Ehefrau Jeanne Mösli-Widmer vom 12. Oktober 2020
Psychiatrie und Seelsorge: Diese beiden Begriffe verbindet eine lange, mitunter durchaus spannungsreiche Geschichte. Warum eigentlich? Immerhin hiess das heutige Fach Psychiatrie und Psychotherapie früher Seelenheilkunde und könnte somit sehr wohl Schnittstellen haben zur Seelsorge, die in einen religiösen Kontext eingebettet ist. Warum liegen die Dinge nicht so einfach?

Der Begriff Seele war in der Psychiatrie – und nur für sie kann ich hier sprechen – noch nie besonders gut definiert. Darüber hinaus ist er in den letzten Jahrzehnten recht aus der Mode gekommen. Und dennoch: Was mit Seele wohl immer (mit-)gemeint war, der personale Kern des Individuums nämlich, der auch durch eine psychische Erkrankung nicht grundsätzlich infrage gestellt wird, ist und bleibt für jedes Psychiatrieverständnis zentral, das auf die Autonomie von Patientinnen und Patienten ausgerichtet ist.
Die Psychiatrie ist, wie die gesamte Medizin, eine Handlungswissenschaft, also wesentlich auf das praktische Handeln, eben die Behandlung, bezogen. Zugleich ist sie stets von theoretischen Vorannahmen geprägt, von Menschenbildern, verschiedenen Wissenschaftskonzepten oder mitunter weit auseinanderliegenden Vorstellungen über das Verhältnis zwischen Psychiatrie und Gesellschaft. Aber sie muss, als personzentrierte Handlungswissenschaft, auch jenseits theoretischer Kontroversen praktikable Wege zur Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten finden sowie Wege zur Etablierung ihrer eigenen Identität als Wissenschaft. Der hier seit den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts am häufigsten benannte Referenzpunkt ist das bio-psychosoziale Modell psychischer Erkrankungen: Demnach hat die klinische und die forschende Psychiatrie unvoreingenommen sowohl die
biologische wie die psychologische und die soziale Dimension der erkrankten Person einzubeziehen.
Doch erledigen sich damit nicht einfach die grundsätzlichen Herausforderungen unseres Faches (so sehr sich die Vereinfacher dies auch wünschen mögen). Im Gegenteil: Das bio-psycho-soziale Modell kann sogar hinderlich werden, wenn es zum unreflektierten Drei-SäulenDogma erstarrt und so den Perspektiven-übergreifenden Dialog nicht mehr fördern kann. Aus dieser Sorge heraus wird das Modell in jüngerer Zeit vermehrt und deutlich infrage gestellt.
Ein anderer Einwand ist für den jetzigen Kontext noch relevanter: Wo bleibt, so insistieren Kritiker, die spirituelle Dimension des Menschen, die sich eben nicht ohne Zwängerei im Psychischen, Sozialen oder Biologischen „auflösen“ lasse? Im englischsprachigen Raum wird schon länger die Erweiterung zu einem bio-psycho-sozial-spirituellen Modell postuliert. Hier wiederum könnte man einwenden, dies löse doch die Frage nach der Definition von Spiritualität nicht, schon gar nicht, wenn man die markante Diversität spiritueller Erlebens- und Ausdrucksformen in verschiedenen Kulturen berücksichtige. Zwar ist ein solcher Einwand durchaus berechtigt, doch geht es in diesem Stadium der Konzeptentwicklung nicht (besser: noch nicht) um trennscharfe Definitionen, sondern um eine respektvolle Annäherung an die Lebenswirklichkeiten psychisch erkrankter Personen.
Genau hier schliesst sich der Kreis zur psychiatrischen Ideengeschichte: Richtungsweisende Figuren in der (für historische Verhältnisse) jungen, etwa 250-jährigen Geschichte der wissenschaftlichen Psychiatrie haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln die existenzielle Dimension des Menschen, die Sinnfrage sowie die Verortung von personaler Autonomie jenseits empirischer Einzelbefunde als unabdingbare Elemente psychiatrischer Arbeit verstanden. Beispielhaft genannt seien für das 19. Jahrhundert Johann Christian August Heinroth (1773–1843)1 und für das 20. Jahrhundert Karl Jaspers (1883–1969)2, Ludwig Binswanger (1881–1966)3 sowie Wolfgang Blankenburg (1928–2002)4 .
Für die zukünftige Beziehung zwischen Psychiatrie und Seelsorge bedeutet das aus meiner Sicht vor allem zweierlei:
1. Es gibt notwendige und substantielle Schnittmengen zwischen beiden Bereichen, speziell hinsichtlich der Themenfelder Personalität und Sinngebung im Kontext psychischer Erkrankungen.
2. Zugleich sind psychiatrisch-psychotherapeutische und seelsorgerische Herangehensweisen keineswegs identisch. Sie bilden vielmehr eintheoretischesundein–aufdenStationenundindenAmbulatorien erfahrbares – praktisches Spannungsfeld.
Notabene: Der Begriff Spannungsfeld ist hier positiv konnotiert, als Voraussetzung für den kritischen wissenschaftlichen Diskurs, der echte Weiterentwicklung erst ermöglicht. Freilich wird es entscheidend darauf ankommen, wie wir interprofessionell mit dieser Spannung umgehen:
▪ Indem beide Sichtweisen sich wechselseitig ausgrenzen oder gar abwerten?
Dann wird es zu einem unproduktiven Gerangel kommen um die Patientinnen und Patienten sowie um die Deutungshoheit hinsichtlich der anthropologischen Positionierung psychischer Erkrankungen. Beispiele für derartige Fehlentwicklungen, ja Sackgassen gibt es. Für die Wissenschaft sind sie deletär; und dem Wohl psychisch erkrankter Menschen sind sie garantiert auch nicht förderlich.
▪ Indem das Spannungsfeld dialogisch und in integrativer Absicht bearbeitet wird?
Dann kann ein offener Diskurs gelingen, der Gemeinsamkeiten erkennt und benennt sowie Unterschiede, die es stets geben wird, respektiert und gelten lässt.
Für das künftige Verhältnis von Psychiatrie und Seelsorge muss die letztgenannte Option das erklärte Ziel sein. Es ist ein anspruchsvolles, dem Thema aber (einzig) angemessenes und mit Blick auf die Qualität psychiatrisch-psychotherapeutischen Arbeitens lohnendes Ziel.
Literatur:
1 Heinroth J. C. A. (1818): Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung, Vogel, Leipzig
2 Jaspers K. (1946): Allgemeine Psychopathologie, 4. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, New York
3 Binswanger L. (1965): Wahn, Neske, Pfullingen
4 Blankenburg W. (1971): Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit, Enke, Stuttgart
Impressum
Herausgeberin
Dienststelle der katholischen Spital- und Klinikseelsorge im Kanton Zürich, Sabine Zgraggen
Gestaltung
Patrizia Ricci
Mit Beiträgen von
Pfr. Ernesto Vigne, Erich Baumann, Paul Hoff, Sabine Zgraggen, Sonja Kaufmann
Druck
Sautercopy AG
Centrum C66
Fotos
Markus Breulmann (S. 3)
Pfr. Ernesto Vigne (S. 5–26)
Ursula Markus (S. 27)
1. Auflage Februar 2021
200 Exemplare