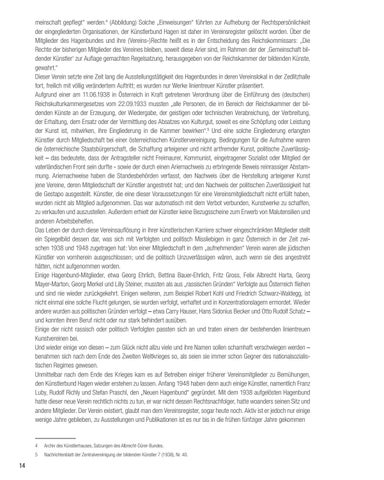meinschaft gepflegt“ werden.4 (Abbildung) Solche „Einweisungen“ führten zur Aufhebung der Rechtspersönlichkeit der eingegliederten Organisationen, der Künstlerbund Hagen ist daher im Vereinsregister gelöscht worden. Über die Mitglieder des Hagenbundes und ihre (Vereins-)Rechte heißt es in der Entscheidung des Reichskommissars: „Die Rechte der bisherigen Mitglieder des Vereines bleiben, soweit diese Arier sind, im Rahmen der der ,Gemeinschaft bildender Künstler‘ zur Auflage gemachten Regelsatzung, herausgegeben von der Reichskammer der bildenden Künste, gewahrt.“ Dieser Verein setzte eine Zeit lang die Ausstellungstätigkeit des Hagenbundes in deren Vereinslokal in der Zedlitzhalle fort, freilich mit völlig verändertem Auftritt; es wurden nur Werke linientreuer Künstler präsentiert. Aufgrund einer am 11.06.1938 in Österreich in Kraft getretenen Verordnung über die Einführung des (deutschen) Reichskulturkammergesetzes vom 22.09.1933 mussten „alle Personen, die im Bereich der Reichskammer der bildenden Künste an der Erzeugung, der Wiedergabe, der geistigen oder technischen Verabreichung, der Verbreitung, der Erhaltung, dem Ersatz oder der Vermittlung des Absatzes von Kulturgut, soweit es eine Schöpfung oder Leistung der Kunst ist, mitwirken, ihre Eingliederung in die Kammer bewirken“.5 Und eine solche Eingliederung erlangten Künstler durch Mitgliedschaft bei einer österreichischen Künstlervereinigung. Bedingungen für die Aufnahme waren die österreichische Staatsbürgerschaft, die Schaffung arteigener und nicht artfremder Kunst, politische Zuverlässigkeit – das bedeutete, dass der Antragsteller nicht Freimaurer, Kommunist, eingetragener Sozialist oder Mitglied der vaterländischen Front sein durfte - sowie der durch einen Ariernachweis zu erbringende Beweis reinrassiger Abstammung. Ariernachweise haben die Standesbehörden verfasst, den Nachweis über die Herstellung arteigener Kunst jene Vereine, deren Mitgliedschaft der Künstler angestrebt hat; und den Nachweis der politischen Zuverlässigkeit hat die Gestapo ausgestellt. Künstler, die eine dieser Voraussetzungen für eine Vereinsmitgliedschaft nicht erfüllt haben, wurden nicht als Mitglied aufgenommen. Das war automatisch mit dem Verbot verbunden, Kunstwerke zu schaffen, zu verkaufen und auszustellen. Außerdem erhielt der Künstler keine Bezugsscheine zum Erwerb von Malutensilien und anderen Arbeitsbehelfen. Das Leben der durch diese Vereinsauflösung in ihrer künstlerischen Karriere schwer eingeschränkten Mitglieder stellt ein Spiegelbild dessen dar, was sich mit Verfolgten und politisch Missliebigen in ganz Österreich in der Zeit zwischen 1938 und 1948 zugetragen hat: Von einer Mitgliedschaft in dem „aufnehmenden“ Verein waren alle jüdischen Künstler von vornherein ausgeschlossen; und die politisch Unzuverlässigen wären, auch wenn sie dies angestrebt hätten, nicht aufgenommen worden. Einige Hagenbund-Mitglieder, etwa Georg Ehrlich, Bettina Bauer-Ehrlich, Fritz Gross, Felix Albrecht Harta, Georg Mayer-Marton, Georg Merkel und Lilly Steiner, mussten als aus „rassischen Gründen“ Verfolgte aus Österreich fliehen und sind nie wieder zurückgekehrt. Einigen weiteren, zum Beispiel Robert Kohl und Friedrich Schwarz-Waldegg, ist nicht einmal eine solche Flucht gelungen, sie wurden verfolgt, verhaftet und in Konzentrationslagern ermordet. Wieder andere wurden aus politischen Gründen verfolgt – etwa Carry Hauser, Hans Sidonius Becker und Otto Rudolf Schatz – und konnten ihren Beruf nicht oder nur stark behindert ausüben. Einige der nicht rassisch oder politisch Verfolgten passten sich an und traten einem der bestehenden linientreuen Kunstvereinen bei. Und wieder einige von diesen – zum Glück nicht allzu viele und ihre Namen sollen schamhaft verschwiegen werden – benahmen sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so, als seien sie immer schon Gegner des nationalsozialistischen Regimes gewesen. Unmittelbar nach dem Ende des Krieges kam es auf Betreiben einiger früherer Vereinsmitglieder zu Bemühungen, den Künstlerbund Hagen wieder erstehen zu lassen. Anfang 1948 haben denn auch einige Künstler, namentlich Franz Luby, Rudolf Richly und Stefan Praschl, den „Neuen Hagenbund“ gegründet. Mit dem 1938 aufgelösten Hagenbund hatte dieser neue Verein rechtlich nichts zu tun, er war nicht dessen Rechtsnachfolger, hatte woanders seinen Sitz und andere Mitglieder. Der Verein existiert, glaubt man dem Vereinsregister, sogar heute noch. Aktiv ist er jedoch nur einige wenige Jahre geblieben, zu Ausstellungen und Publikationen ist es nur bis in die frühen fünfziger Jahre gekommen
14
4
Archiv des Künstlerhauses, Satzungen des Albrecht-Dürer-Bundes.
5
Nachrichtenblatt der Zentralvereinigung der bildenden Künstler 7 (1938), Nr. 40.