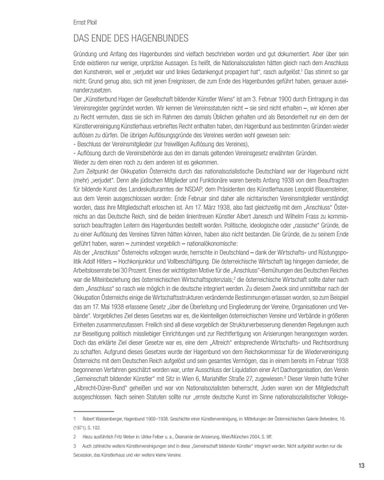Ernst Ploil
DAS ENDE DES HAGENBUNDES Gründung und Anfang des Hagenbundes sind vielfach beschrieben worden und gut dokumentiert. Aber über sein Ende existieren nur wenige, unpräzise Aussagen. Es heißt, die Nationalsozialisten hätten gleich nach dem Anschluss den Kunstverein, weil er „verjudet war und linkes Gedankengut propagiert hat“, rasch aufgelöst.1 Das stimmt so gar nicht; Grund genug also, sich mit jenen Ereignissen, die zum Ende des Hagenbundes geführt haben, genauer auseinanderzusetzen. Der „Künstlerbund Hagen der Gesellschaft bildender Künstler Wiens“ ist am 3. Februar 1900 durch Eintragung in das Vereinsregister gegründet worden. Wir kennen die Vereinsstatuten nicht – sie sind nicht erhalten –, wir können aber zu Recht vermuten, dass sie sich im Rahmen des damals Üblichen gehalten und als Besonderheit nur ein dem der Künstlervereinigung Künstlerhaus verbrieftes Recht enthalten haben, den Hagenbund aus bestimmten Gründen wieder auflösen zu dürfen. Die übrigen Auflösungsgründe des Vereines werden wohl gewesen sein: - Beschluss der Vereinsmitglieder (zur freiwilligen Auflösung des Vereines), - Auflösung durch die Vereinsbehörde aus den im damals geltenden Vereinsgesetz erwähnten Gründen. Weder zu dem einen noch zu dem anderen ist es gekommen. Zum Zeitpunkt der Okkupation Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland war der Hagenbund nicht (mehr) „verjudet“. Denn alle jüdischen Mitglieder und Funktionäre waren bereits Anfang 1938 von dem Beauftragten für bildende Kunst des Landeskulturamtes der NSDAP, dem Präsidenten des Künstlerhauses Leopold Blauensteiner, aus dem Verein ausgeschlossen worden: Ende Februar sind daher alle nichtarischen Vereinsmitglieder verständigt worden, dass ihre Mitgliedschaft erloschen ist. Am 17. März 1938, also fast gleichzeitig mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich, sind die beiden linientreuen Künstler Albert Janesch und Wilhelm Frass zu kommissorisch beauftragten Leitern des Hagenbundes bestellt worden. Politische, ideologische oder „rassische“ Gründe, die zu einer Auflösung des Vereines führen hätten können, haben also nicht bestanden. Die Gründe, die zu seinem Ende geführt haben, waren – zumindest vorgeblich – nationalökonomische: Als der „Anschluss“ Österreichs vollzogen wurde, herrschte in Deutschland – dank der Wirtschafts- und Rüstungspolitik Adolf Hitlers – Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung. Die österreichische Wirtschaft lag hingegen darnieder, die Arbeitslosenrate bei 30 Prozent. Eines der wichtigsten Motive für die „Anschluss“-Bemühungen des Deutschen Reiches war die Miteinbeziehung des österreichischen Wirtschaftspotenzials;2 die österreichische Wirtschaft sollte daher nach dem „Anschluss“ so rasch wie möglich in die deutsche integriert werden. Zu diesem Zweck sind unmittelbar nach der Okkupation Österreichs einige die Wirtschaftsstrukturen verändernde Bestimmungen erlassen worden, so zum Beispiel das am 17. Mai 1938 erlassene Gesetz „über die Überleitung und Eingliederung der Vereine, Organisationen und Verbände“. Vorgebliches Ziel dieses Gesetzes war es, die kleinteiligen österreichischen Vereine und Verbände in größeren Einheiten zusammenzufassen. Freilich sind all diese vorgeblich der Strukturverbesserung dienenden Regelungen auch zur Beseitigung politisch missliebiger Einrichtungen und zur Rechtfertigung von Arisierungen herangezogen worden. Doch das erklärte Ziel dieser Gesetze war es, eine dem „Altreich“ entsprechende Wirtschafts- und Rechtsordnung zu schaffen. Aufgrund dieses Gesetzes wurde der Hagenbund von dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich aufgelöst und sein gesamtes Vermögen, das in einem bereits im Februar 1938 begonnenen Verfahren geschätzt worden war, unter Ausschluss der Liquidation einer Art Dachorganisation, den Verein „Gemeinschaft bildender Künstler“ mit Sitz in Wien 6, Mariahilfer Straße 27, zugewiesen.3 Dieser Verein hatte früher „Albrecht-Dürer-Bund“ geheißen und war von Nationalsozialisten beherrscht, Juden waren von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Nach seinen Statuten sollte nur „ernste deutsche Kunst im Sinne n ationalsozialistischer Volksge1
Robert Waissenberger, Hagenbund 1900–1938. Geschichte einer Künstlervereinigung, in: Mitteilungen der Österreichischen Galerie Belvedere, 16.
(1971), S. 102. 2
Hiezu ausführlich Fritz Weber in: Ulrike Felber u. a., Ökonomie der Arisierung, Wien/München 2004, S. 9ff.
3
Auch zahlreiche weitere Künstlervereinigungen sind in diese „Gemeinschaft bildender Künstler“ integriert worden. Nicht aufgelöst wurden nur die
Secession, das Künstlerhaus und vier weitere kleine Vereine.
13