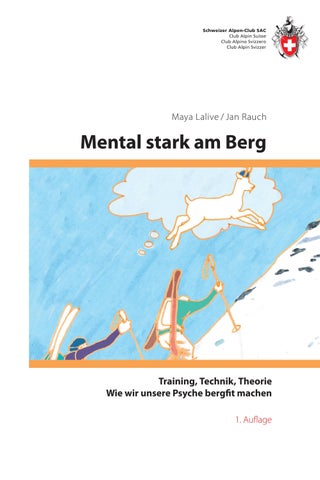4 minute read
1.2 Mentale Stärke – Erfolgsfaktor am Berg
Die sportliche Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden im Bergsport hängen bekanntlich von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören Technik, Können und Wissen, taktische Erfahrung, Kondition, Material, Ausrüstung, Ernährung und noch einige mehr.
Darüber hinaus – und dies gilt besonders für kritische Situationen – beeinflussen aber auch unsere Gedanken und Gefühle sowie unsere innere Einstellung unsere Leistungsfähigkeit wesentlich. Selbst wenn wir sporttechnisch bestens ausgebildet und konditionell trainiert sind, ist dies noch kein Garant dafür, dass wir auch unsere Gefühle und Gedanken im Griff haben.
Im Bergsport entscheidet deshalb oft die mentale Stärke über Erfolg oder Misserfolg, über Genuss oder Frust.
Kommen dir diese Beispiele bekannt vor?
Eigentlich war alles bestens: das Wetter, die Kollegen, die Hütte, die geplante Skitour. Vor deiner Abreise hast du mit deinem Partner über seinen Jobwechsel diskutiert. Das Gespräch lässt dich nicht los. Schon wieder ist der Ski weggerutscht, weil du mit deinen Gedanken zu Hause statt hier am Berg bist.
Morgen machst du eine voralpine Wanderung, die mit der Schwierigkeit T4 angegeben ist. Eigentlich kein Problem für dich als geübten Bergwanderer. Doch die Schlüsselstelle ist eine Gratüberquerung. Bereits am Vorabend plagen dich wirre Gedanken: Was, wenn ich ausrutsche? In deiner Fantasie siehst du dich bereits den Hang hinunterkollern. Entsprechend schläfst du schlecht. Am anderen Morgen bist du müde und ausgelaugt. Die Vorfreude ist einer tiefen Antriebslosigkeit gewichen. «Wenn ich nur nicht zugesagt hätte», denkst du und suchst bereits nach einer Ausrede, um dich noch kurzfristig auszuklinken …
Du bist als Seilerster am Vorsteigen in einer alpinen Kletterroute unterwegs. Die Hakenabstände sind sportlich. Das Gelände ist leicht geneigt, Platten, glatter Granit. Zwischen dem dritten und vierten Haken, gerade oberhalb eines kleinen Daches mit einem Sims darunter, rutscht dir der linke Fuss weg. Das verunsichert dich. Angst kommt auf. Was, wenn ich hier stürze? Du weisst: Ein Sturz an dieser Stelle hat höchstwahrscheinlich gröbere Verletzungen zur Folge und sollte deshalb unter allen Umständen vermieden werden. Dein Atem wird hektisch, dein Puls beschleunigt sich, deine Beine beginnen zu zittern. Deine Gedanken sind blockiert: «Ich darf nicht stürzen, ich darf nicht stürzen!»
Die drei Beispiele zeigen: Unsere Gedanken und Einstellungen wirken sich direkt auf unseren Bewegungsablauf und unsere Befindlichkeit aus. Kletterer beispielsweise kennen – wie im Beispiel auf Seite 19 beschrieben – in Angstsituationen das berühmte «Nähmaschinele» (unkontrolliertes Zittern der Beine); Angstschweiss und hektische Atmung sind weitere körperliche Indikatoren bei Angstempfinden. Umgekehrt motiviert uns eine erfolgreich gemeisterte Passage zu Höchstleistungen, unsere Bewegungen sind rund und flüssig und wir fliegen buchstäblich den Berg hinauf.
Mental stark – unter Druck leistungsfähig bleiben
Mental starke Sportler verstehen es, genau dann, wenn es darauf ankommt, ihre Gedanken und Gefühle besser unter Kontrolle zu bringen, Ruhe zu bewahren, die Übersicht zu gewinnen, ihre Motivation aufrechtzuerhalten und auch unter widrigen Umständen ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen.
« Der stärkste Muskel ist der Kopf. » Wolfgang Güllich, Sportkletterer
In der Tat: Von den Entdeckern und Abenteurern des 19. Jahrhunderts bis hin zu den berühmten Bergsteigerlegenden der Gegenwart war es der Kopf, der am Ende über Erfolg oder Misserfolg entschied. Was für Profis gilt, gilt auch für uns Freizeitsportler.
Mentale Stärke hilft im Besonderen bei:
• Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung. • Störenden Gedanken (positiven wie negativen, bei allem, was die Konzentration schwächt). • Nervosität, Stress. • Unsicherheit (z.B. bei der Querung eines Grates, aufziehendem
Unwetter, mangelhaftem Material und schlechter Ausrüstung, bei grossen Hakenabständen). • Orientierungsschwierigkeiten (beispielsweise falschen Weg eingeschlagen, Nebel). • Mangelndem Selbstvertrauen, ungenügendem Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten. • Übermässiger Erregung, Aktivismus, Übermotivation. • Geringer Motivation, mangelndem Willen. • Ablenkung (andere Tourengänger, Wetter, Lärm, Gedanken). • Heiklen Entscheidungsfindungen (Wahl von Abfahrtrouten unter schwierigen Schnee- oder Wetterbedingungen, bei
Unfällen, Abbruch einer Bergtour etc.). • Latenter und akuter Angst (wenn z.B. ein Sturz mit Verletzungsgefahr droht). • Erwartungs- und Erfolgsdruck (an sich selber, gegenüber oder durch Gruppe oder Kollegen, bei zu anspruchsvollen Zeitplänen, Frust über Zeitverlust etc.). • Vorstellung einer Route, einer Wegstrecke, eines Parcours. • Rehabilitation nach einer Verletzungspause (mentale Vorbereitung bis hin zu Vorstellungstraining von Bewegungsabläufen).
Bergsport ist eine Risikosportart. Am Berg herrschen andere Gesetze als auf dem Fussballplatz oder in der Tennishalle.
Rasche Hilfe bei einem Unfall, einem Schwächeanfall oder bei einem Wetterumbruch ist im Berggebiet auch im Zeitalter von Mobilfunk und GPS nicht immer möglich. Solche bergspezifischen Situationen sind nicht immer vorhersehbar, sie treten rasch und unerwartet ein und wir können sie kaum beeinflussen.
Trotz Vorsicht kann am Berg jeder in kritische Situationen geraten. Umso wichtiger ist es, dass wir für solche Herausforderungen nicht nur körperlich, sondern auch mental gerüstet sind.
Einzelsportler können von Mentaltraining ebenso profitieren wie Gruppen. Gerade im Bergsport kommen psychologische Stolpersteine oftmals erst in der Gruppe zum Vorschein. Wir vergleichen uns mit unseren Kollegen, geraten unter Druck oder lassen uns zu Handlungen verleiten, denen wir eigentlich gar nicht gewachsen sind.
Höchste Zeit also, dass wir unserem Kopf die notwendige Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen und ihn ebenso gut und intensiv wie unseren Körper trainieren, um noch möglichst viele weitere Erlebnisse am Berg zu geniessen.
Mentale Stärke ersetzt weder fachspezifisches Wissen noch Können. Für die Beurteilung von Chancen und Gefahren am Berg braucht es als Grundlage immer die entsprechende fachliche Ausbildung und Erfahrung, verbunden mit einer realistischen Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten.
Sowohl die grossen Alpenvereine wie auch kommerzielle Anbieter bieten entsprechende Ausbildungsmodule respektive Fachliteratur zu den Themenbereichen Bergsport Winter und Sommer, Bergsteigen, Sportklettern, alpines Klettern, Seilkunde, Erste Hilfe, Wetterkunde etc. an.