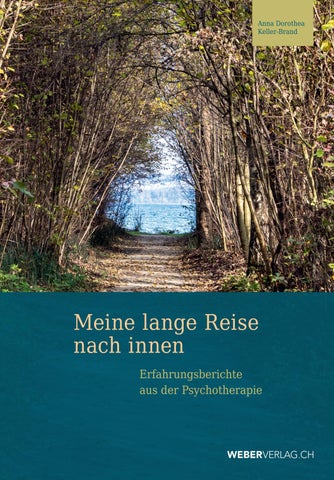25 minute read
Floëe «Ich wundere mich, dass ich so guter Dinge bin»
«ICH WUNDERE MICH, DASS ICH SO GUTER DINGE BIN»
FLOËE, 75 JAHRE
Zu meiner Person: Ich wurde als Bub geboren und bin transident. Auch wenn ich einen Männerkörper habe, lebe und vor allem fühle ich als Frau. Ich komme aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Nach der Schule habe ich ein Studium in Kunst- und Musikwissenschaften sowie Anglistik abgeschlossen. Gleichzeitig versuchte ich bis circa 30, eine Laufbahn als Filmemacher aufzubauen. Nach deren Scheitern übernahm ich den väterlichen Uhrenbetrieb, den ich 36 Jahre lang recht erfolgreich führte.
Was hat Sie dazu bewogen, eine Therapie zu beginnen?
Vor ein paar Jahren begleitete ich meine alkoholkranke Freundin zur Therapie. Nach der Therapiestunde, an der ich auch teilnahm, gab mir Anna einen Wink: Sie machte eine Bemerkung, mit der sie mir zu verstehen gab, dass sie meine Not sah. Das beschäftigte mich, und ich realisierte erst dann so richtig, dass bei mir etwas nicht stimmte. Ein paar Tage danach meldete ich mich bei ihr zu einer ersten Einzelsitzung an. Sie sagte mir später, dass sie sich gefragt hätte, wer hier eigentlich die Klientin sei, ich oder die Freundin. Mein ausgeprägtes Helferverhalten war ihr dabei besonders aufgefallen.
Mein Leben lang wollte ich es immer allen recht machen, das ging so weit, dass ich mich selbst jahrelang verleugnete. Mit 60 hatte ich mein Outing als Transidente. Doch trotz diesem grossen Schritt litt ich nach wie vor unter einer tiefen Unsicherheit und starken Einsamkeitsgefühlen. Ausserdem begab ich mich in eine Co-Abhängigkeit mit meiner alkoholkranken Freundin. So entschied ich mich, auf Annas Therapie-Angebot einzugehen.
Wo sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihrer Not und Ihrer Biografie?
Mein Leben war seit meiner Kindheit von Aussenseitertum und Einsamkeit geprägt. In der Schule war ich zwar gut, aber die Beziehungen zu meinen Eltern oder zu Freunden und Kollegen waren gestört.
Obschon sie viel und gerne lachte, war meine Mutter eine kalte Frau. Dass ich von ihr nie Zärtlichkeit und Zuneigung erhielt, realisierte ich erst in der Therapie. Die Jahre bis zu meiner Pubertät hatte ich vollkommen verdrängt. Diese Erkenntnis schockierte mich selbst. Zu meinem Vater hätte ich mir eine innige Beziehung vorstellen können, was er, selber aus einer problematischen Familie stammend, nicht zuliess.
Meine Kindheit war schon lange vor der Pubertät von grosser Freude an meinem Körper geprägt, doch diese Freude wandelte sich mit der Zeit in eine unglaubliche Scham. Wenn mich meine Mutter erwischte, wie ich onanierte, prügelte sie mich mit dem Teppichklopfer. Ich wurde erzkatholisch erzogen und musste schon mit sechs Jahren zur Beichte gehen. Selbstbefriedigung stand zuoberst auf der Sündenliste, obschon mir der Begriff lange Zeit gar nicht bekannt war (es hiess stattdessen «unkeusch» und Ähnliches). Wenn mich der Priester nach dem sechsten und neunten Gebot fragte, war meine Antwort immer: «Nichts», obschon ich dumpf ahnte, worum es ging. Ich verstand die Gebote nicht, alles, was sie verursachten, waren Schuldgefühle, die Gewissheit, etwas Verbotenes getan zu haben. Ich litt Höllenqualen, weil ich mich für absolut ungehorsam und verloren hielt. Beim Onanieren war dann mit der Zeit der Gedanke im Hinterkopf entstanden, meine verstorbenen Tanten könnten mir jetzt aus dem Himmel zuschauen und sich über meine Sünden erzürnen. Vor allem meine Lieblingstante, in die ich schon seit Kindestagen immer ein bisschen verliebt gewesen war. Ich onanierte übrigens nie mit der Hand, so wie Männer dies normalerweise tun, sondern meist auf der Seite liegend mit dem Glied zwischen den Schenkeln, mit denen ich Druck ausübte. So ähnlich, begann ich mir in der Pubertät auszumalen, würden es vielleicht die Frauen tun.
Ich erinnere mich auch noch an ein anderes, sehr prägendes Erlebnis: Als ich ungefähr 13 oder 14 Jahre alt war, kam meine Mutter frühmorgens zu mir in die Mansarde. Mein Vater und mein Bruder schliefen noch. Sie legte sich zu mir ins Bett. Obwohl sie sonst nichts tat, war dies für mich der blanke Horror. Meine Reaktion: Ich spielte «toter Mann» und war wie eingefroren, starr und leblos lag ich da. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich sonst nur in der Kirche – ganz automatisch – getan habe: Ich betete: «Lieber Gott, mach, dass das vorbeigeht!» Das Ganze wiederholte sich ein paar Mal, ich weiss aber nicht mehr, wie oft. Darüber gesprochen wurde nie, Verdrän-
gung war in unserer Familie Programm. Als ich viel später einmal meine Mutter darauf angesprochen habe, dass sie mich mit dem Teppichklopfer geschlagen hatte, meinte sie nur: «Spinnsch? Mach mi nid z lache» und leugnete alles. Sie nahm mich gar nicht ernst.
Das war nicht der einzige schwerwiegende Übergriff in meinem Leben. Während der Therapie hat sich herauskristallisiert, dass ich in ganz frühen Jahren einen Missbrauch erlebt haben muss. Und später hat mich eine Freundin, als ich betrunken und nackt war, im Schlaf vergewaltigt, was sie im Nachhinein zugab.
Später bin ich mir bewusst geworden, dass ich in meinen Jugendjahren in eine wahnsinnige Einsamkeit hineingedrängt wurde, sodass Isolation quasi zu meiner (Über-)Lebensdevise geworden ist, quasi eine Medizin, wie die Onanie.
Dass ich anders bin als andere Buben, habe ich bereits mit vier oder fünf Jahren gemerkt. Später, vielleicht mit neun oder zehn Jahren, habe ich mich in Abwesenheit der Eltern in ihr Schlafzimmer geschlichen, Mutters Kleider angeschaut und angezogen. Mit Klemmen habe ich den Stoff so befestigt, dass mir nicht alles hinunterrutschte. Besonders faszinierten mich Strümpfe. Ich fühlte mich extrem wohl dabei, das war ein Riesenspass. Aber natürlich wollte ich nicht erwischt werden, denn meine Eltern hätten das nie verstanden, weitere Prügel wären gefolgt. Deshalb wurde ich Meister im Ohrenspitzen.
Dass ich transident bin, war mir eigentlich lange vor meinem Outing klar, aber gegen aussen wollte ich den perfekten Mann spielen. Als Schüler und Jugendlicher war ich wütend, weil mir kein Bart wuchs und der Körper unbehaart blieb. Ich wollte so gern, wenn auch mit Widerwillen, ein männlicher Mann sein. Ich war ja schliesslich als Bub geboren, also wollte ich mich auch entsprechend verhalten, und zwar so perfekt wie möglich; wie in allen anderen Bereichen des Lebens übrigens auch. So war zum Beispiel das Weinen für Jahrzehnte aus meinem Leben gestrichen.
Im Sport war ich gut, und der Applaus der Mädchen war mir sicher. Ich sonnte mich in deren Aufmerksamkeit. Aber ich ergriff nie die Initiative, liess immer die Mädchen und später die Frauen auf mich zukommen. Ein typisch weibliches Verhalten, sagte ich mir, das archaischpaternalistische «Jäger-Beute-Schema», nur umgekehrt. Lange hatte ich keine gute Beziehung zu meinem Körper, besonders mein Penis war für mich wie ein Fremdkörper, ein unverständ-
liches Anhängsel. In meinem Inneren fühlte ich mich als Frau. Wie schön, stellte ich mir vor, auch äusserlich als Frau zu gelten. Oft habe ich nämlich nicht an mir runtergeschaut, um dieses supermännliche Geschlechtsteil nicht sehen zu müssen. Ich hasse es bis heute zu duschen. Es ist mir ein Graus. Das heisst nicht, dass ich unreinlich bin, denn ich wasche mich – vor allem seit meinem Outing – jeden Tag am Lavabo von Kopf bis Fuss. Dies vielleicht aus dem Bedürfnis heraus, mich von dem als männlich empfundenen Schmutz zu befreien.
Sexualität habe ich nur mit mir allein ausgelebt, zusammen mit Freundinnen war ich impotent. Ich hatte trotzdem verschiedene Beziehungen, einmal war ich sogar kurz verheiratet. Meine Impotenz verschwieg ich und versuchte mich in erektionslosen Orgasmen, da eine Freundin behauptet hatte, das gäbe es. Ich wollte der perfekte Liebhaber sein. Auch meine Transidentität verschwieg ich. Ein zaghafter Versuch, meiner damaligen Frau zu erklären, dass ich transident bin, wurde von ihr abgeblockt, sie nahm mich nicht ernst.
Natürlich konnte ich meine Impotenz über kurz oder lang nicht mehr verheimlichen. Die einen Frauen zeigten sich – zumindest vordergründig – verständnisvoll. Anderen spielte ich, wie erwähnt, etwas vor. Wieder waren meine Schuldgefühle enorm. Abhängig von den Frauen, konnte ich ihnen nicht bieten, was sie wollten. So kam es, dass ich versuchte, wenigstens auf der materiellen Ebene einigen Freundinnen etwas zu geben. In meiner ersten längeren Beziehung verlor ich deswegen mein gesamtes Vermögen in Höhe eines sechsstelligen Betrags.
Die ewigen Lügen, der Druck, es den Frauen recht zu machen, die ewige Scham und das Verbergen meiner wahren Identität nagten an mir und meinem Selbstbewusstsein.
Mit 60 Jahren kam dann der totale Zusammenbruch. Ich wollte mein Haus anzünden, alles war mir egal. Kurz vorher wurde ich mit einer extremen Verstopfung ins Spital eingeliefert. Verstopfung – welch Symbol für mein ungelebtes Leben! Die Notfallärztin verwies mich dann an einen Psychiater. Zu Hause war das totale Chaos ausgebrochen. Die Ehefrau war ausgezogen, die Adoptivtochter feierte wilde Feten im Haus, das entsprechend aussah. Mental und körperlich am Ende, liess ich alles gehen, auch im Geschäft. Die unbeachteten Faxe hatten sich schon zu einer dicken Rolle gesammelt. Dann kamen Wahrnehmungsstörungen. Wenn die Glocken der Kirche von
der linken Seite her läuteten, nahm ich das im rechten Ohr wahr und umgekehrt. Das Strassenbild verschob sich: Plötzlich war die Quartierstrasse vorne zur Hauptstrasse hinter dem Haus geworden. Eine schwere Depression und eine totale Dissoziation wurden diagnostiziert. Ich kam in die Waldau. Dort passierte in kurzer Zeit ziemlich viel. Meine wahre Identität drängte heraus. Ich dachte über weibliche Namen nach und stand zu meiner Transidentität. Aus der psychiatrischen Klinik entlassen, war ich wie neugeboren. Ich nannte mich von jetzt an nicht mehr Philippe, sondern Floëe, ein klangvoller Name, den ich erfunden habe. Ich wurde gesellig und positiv. Eine Wandlung hatte stattgefunden. Ich ging dann bald einmal zu meiner Coiffeuse und erzählte dort einer mir wildfremden Angestellten, dass ich jetzt als Frau weiterleben werde. Nachher dachte ich: «Was ist denn bloss in dich gefahren, spinnst du eigentlich?» Aber das war mein Outing. Ich empfand dabei etwas, was mir sonst absolut fremd war: Stolz.
In meinen späten Jahren spielte sich jedoch ein weiteres Drama ab: In meiner jetzigen Freundin hatte ich endlich einen Menschen gefunden, der mich so nahm, wie ich bin. Sie wusste von Anfang an über mich Bescheid und stiess mich nicht von sich. Sie kümmerte sich um mich und half mir enorm dabei, mich selbst – vor allem auch körperlich – zu akzeptieren. So konnte ich dank ihr sogar mit meinem Penis Frieden schliessen. Ich war sehr glücklich. Doch dann stellte sich heraus, dass sie mir ihre schwere Alkoholkrankheit verschwiegen hatte. Nach drei Monaten Hans (bzw. Floëe) im Glück war das wie eine Ohrfeige. Ich wurde ein weiteres Mal von einem nahen Menschen betrogen, verraten. Ich geriet in eine Co-Abhängigkeit. Das erkannte ich aber erst im Verlaufe der Therapie.
Was hat der therapeutische Prozess für Sie bedeutet?
In der therapeutischen Beziehung fand ich endlich jemanden, der mir zuhörte. Eine Person, die nicht über mich urteilte, mir Aufmerksamkeit schenkte und mich auch mal nach meinem körperlichen Befinden fragte. Anna war das, was ich mir von meiner Mutter gewünscht hätte. Ich hatte absolutes Vertrauen in sie und musste mich nicht verstellen. Eine grosse Erleichterung! Ich durfte ihr Vorgehen auch mal infrage stellen. Das hätte es früher nie gegeben, weil ich Angst vor den Konsequenzen, in erster Linie Verlassens-Angst gepaart mit Liebesverlust, hatte. So hatte ich zum Beispiel einen
Schulfreund, dem ich immer nachgeeifert habe. Mit ihm konnte ich seit Mittelschulzeiten auch filmisch zusammenarbeiten, und wir sind bis vor Kurzem in regem Kontakt gestanden. Doch ich habe erkannt, dass er immer sehr respektlos mit mir umgegangen ist, mich quasi als Marionette missbraucht hat. Aus Angst, ihn zu verlieren, habe ich immer alles hingenommen und geschwiegen. Mein Motto war: Nur keine Probleme machen. Das habe ich heute grösstenteils überwunden. Denn ich habe erkannt, dass ich mein Leben lang nicht nur andere Menschen, sondern vor allem mich selbst belogen habe.
Ich realisierte während des therapeutischen Prozesses, dass mir als Kind antrainiert worden war: Gefühle werden ignoriert, sie sind unwichtig. Der Kopf ist entscheidend. Deshalb habe ich meine Transidentität so lange verborgen beziehungsweise nur allein ausgelebt; ich habe ein Doppelleben geführt. Dasselbe mit der Sexualität. Ich traute meinem Gefühl nicht, sondern nur dem Verstand. Das geht Hand in Hand mit dem Mangel an Zärtlichkeit und Zuwendung in meiner Kindheit. Heute kann ich den Kloss, der sich in mir gebildet hat, heraushusten. Ich kann auch weinen, Gefühle zeigen, gerührt sein. Ich habe gelernt, aus mir herauszukommen, ohne Scheu zu sprechen. Ich muss nicht perfekt und makellos sein. 60 Jahre lang habe ich den Mund gehalten. Zugegebenermassen kommt es jetzt manchmal sogar vor, dass ich über das Ziel hinausschiesse, das ist wohl ein übertriebenes Korrektiv. Und manchmal meldet sich auch wieder die Angst zurück, etwas Falsches zu sagen. Ein Überbleibsel von früher. Aber ich bin mir bewusst: Der Prozess geht weiter.
Auch meine schwierige Beziehung zu meinem Körper hat sich in den Jahren der Therapie verändert. Ich liebe den Vergleich mit der Schlange, die sich häutet. Die grosse Scham vor mir selbst, vor meiner unerwünschten Geschlechtlichkeit, habe ich verloren.
Zwar habe ich einen Hang zur Bipolarität, aber gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, wieder in ein Loch zu fallen, ist es beruhigend zu wissen, dass in solchen Momenten Anna da ist für mich. Bei ihr habe ich auch Methoden gelernt, um mich zu beruhigen und zu mir zu finden (Bewusstseinsübungen, Atemübungen, Körpergewahrsein). Das hat mich oft vor Depressionen geschützt. Auch mit schwierigen Situationen mit meiner alkoholkranken Freundin kann ich dank den therapeutischen Sitzungen heute besser umgehen.
Ich habe in der Therapie eine neue, eigentlich meine erste authentische Identität erlebt, nicht als Frau oder Mann, sondern als
Mensch. Und ich habe gelernt, dass ich meiner Wahrnehmung trauen kann. Das ist eine ganz zentrale Erkenntnis. Plötzlich sah ich im Leben einen Sinn. Ich weiss jetzt, warum ich unter anderem da bin: Ich bin für mich da! Nicht für andere, nicht um die Erwartungen von anderen zu erfüllen und mich dann von ihnen abhängig zu machen. Nur für mich. Ich muss mich nun endlich nicht mehr sinnlos anstrengen. Ich bin sozusagen bei mir angekommen. Dabei habe ich gelernt, auf Wertungen zu verzichten. So versuche ich nun, Mitmenschen, Dinge und vor allem mich selbst nicht mehr zu benoten, sondern als das zu nehmen, was sie eben sind. «Es ist, wie es ist» (Zitat Anna), beziehungsweise: «Floëe ist, wie Floëe ist».
MEINE GRATWANDERUNG MIT FLOËE
Ich bin in meinem Rückzugsort in Frankreich. Nach einem Bad im kalten Fluss, Aufwärmen in der heissen Herbstsonne und Rückzug in den Schatten möchte ich nun die Essenz aus meiner Begleitung Floëes herausfiltern. Ich erwähne meine Situation, da die Natur und mein Gewahr-Werden in ihr seit Jahren die Kraftquelle für meine Arbeit sind; erst wenn ich in ihr und durch sie leer bin von meiner Person, kann ich anfangen. Vor mir stapelt sich viel Papier: Protokolle aus mehr als 100 Sitzungen, Therapieberichte, Briefe von der Opferhilfe, Briefe von Floëe, ihr angefangenes Buch, ihre mir anvertraute Lebensbeichte ... und das ausgedruckte Interview, mit dem sie sich unbedingt endlich eine Stimme geben möchte – ich habe sie dabei als sehr aufgewühlt erlebt aus dem Hintergrund. Kein Wunder, Floëe hat lange Jahre ein Schattendasein geführt in unserer Gesellschaft. Als ich sie kennenlernen darf, erscheint mir das Bild einer seltenen Pflanze, die im Verborgenen blüht – obwohl Floëe auffällig gekleidet ist mit ihrem roten Béret, ihrer engen Hose und ihrem leopardgemusterten Blüschen. Seit ihrem Outing steht sie zu sich mit ihrer Kleidung – ihr Anblick ist stadtbekannt –, und sie möchte in unserem Buch auch bewusst ihren Namen tragen, der vor Kurzem von den Behörden abgesegnet wurde. Ein Festtag für Floëe!
Als sie mit ihrer Gefährtin das erste Mal in meiner Praxis auftaucht, beide auffallend originell gekleidet, bin ich spontan sehr angetan, dass sie den Weg zu mir gefunden hatten. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich freue mich auf jede neue Begegnung; es ist immer spannend bei therapeutischen Begleitungen, jemanden zum ersten Mal begrüssen zu dürfen. Allerdings habe ich von klein auf ein besonders grosses Herz für die Schrägen und Unangepassten. Ich darf durch Floëe lernen, dass Kleider besondere Leute machen ...
In unserer ersten Sitzung hat sich für mich nicht herauskristallisiert, wer als Klientin gekommen ist, Floëe oder ihre Freundin, die ich hier Florence nennen möchte. Floëe legt ein ausgeprägtes Helfersyndrom an den Tag: Sie spricht für Florence, sie weiss, was gut für sie sei, woran sie arbeiten müsse usw. In Zusammenhang mit Florence’ jahrelanger, starker Alkoholabhängigkeit meine ich in Floëes Verhalten eine ausgeprägte Co-Abhängigkeit zu erkennen,
wie ich es ihr später auch erläutern kann. Vorerst gebe ich Floëe einen «Wink», wie sie es nennt. Oder habe ihr zugewinkt oder vielleicht auch abgewinkt, indem ich ihr einen kleinen Hinweis zu ihrer Helferrolle gebe? Überraschenderweise ruft sie mich wenig später an, um einen Termin in meiner Praxis für sich (!) abzumachen. Und schon in einer unserer ersten Sitzungen verstehe ich den tieferen Beweggrund von Floëes übereifrigem Verhalten gegenüber Florence. Sie ist tief enttäuscht und voller Angst. Nach vielen Jahren erlebter Einsamkeit hat sie Florence in einem Café kennengelernt. Die Begegnung schlägt wie ein Blitz bei beiden ein. Ich wage zu behaupten, dass es sich nicht nur um das Phänomen blinder Verliebtheit handelt, sondern dass da zwei «Schicksalsverwandte» (der Ausdruck «Seelenverwandte» ist mir ideologisch zu strapaziert) aufeinandergeprallt sind; es hat wohl bei beiden kurzzeitige Glücksexplosionen gegeben. Endlich ist da eine Person, die ähnlich denkt und fühlt, sich ähnlich fremdelnd in unserer Gesellschaft bewegt, beide traumatisiert durch sexuelle Ausbeutung, beide mutter- und vaterseelenallein. Floëe gesteht mir einmal, dass sie mit bald 70 Jahren bei Florence zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frau zu begehren vermeint habe, sich eine körperliche Vereinigung hätte vorstellen können und, obwohl biologisch unmöglich, sich sogar ein Kind von ihr gewünscht habe. Als sie dahinterkommt, dass Florence schon jahrelang trinkt und das zuerst vor ihr zu verbergen versucht, möchte sie sie mit aller Kraft retten, um selber nicht an ihrer EntTäuschung zu zerbrechen.
Es dauert mehr als ein Jahr, bis Floëe in einer Sitzung nur sich selber und nicht Florence zum Thema macht. Es dauert sieben Jahre, bis Floëe sich aus ihrer Co-Abhängigkeit so hinausentwickelt hat, dass sie Florence’ behördliche Zwangseinweisung in eine Anstalt, in der die Gescheiterten in der Schweiz gesammelt und versorgt werden, zulässt. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft Floëe vorher Florence mit vier bis fünf Promille notfallmässig ins Spital hat bringen lassen, wie oft wir davon ausgegangen sind, jetzt habe sie sich endgültig in den Tod gesoffen, sich umgebracht oder sei nach ihren Fluchten aus der Anstalt für immer verschollen. Floëe hat oft abgrundtief gelitten und hat es ausgehalten und überlebt. Sie hat gelernt, bei sich zu bleiben, sich selber lieber zu haben und sich immer treuer zu werden. Es braucht anscheinend oft einen Leidensweg, um sich selber zu finden ... Am Anfang unseres gemeinsamen Weges hat Floëe versucht, sich
ausschliesslich über ihren Verstand zu begreifen und so auf ihre Spur zu kommen. «Sie erscheint mir wie eine Analphabetin in ihrem Gefühlsleben, die über ihre Gedanken versucht, alles in den Griff zu bekommen», schreibe ich nach einer Sitzung im ersten Jahr. Oder: «Tapfer redet sie sich durch ihre innere Wüste ...»
Behutsam versuche ich, ihr neue Erfahrungen zu ermöglichen, indem ich ihr mein Erleben und meine Beobachtungen mitteile bzw. mit ihr teile. Z. B. frage ich sie, ob sie merke, wie stark sie meinem Blickkontakt ausweiche. Sie hält inne, wird sich dessen bewusst und spürt, dass sie diesem ausweicht, weil sie etwas darin irritiert, etwas «Liebevolles», meint sie schliesslich.
Sie gewinnt dann doch relativ rasch an Vertrauen zu mir, scheint sich geborgen und angenommen zu fühlen, beginnt, sich auf unsere Sitzungen zu freuen, die anfangs noch eine Ausnahmesituation für sie bedeuten. Sie möchte mir aber noch sehr lange gefallen, z. B. durch gewitzte und intelligente Äusserungen. Diese Gefall-Sucht gegenüber der Therapeutin ist weit verbreitet, und ich habe sie als Klientin in meinen Prozessen selbst erlebt. Sogar in der Therapie meinen wir uns noch anstrengen zu müssen, um «geliebt» zu werden. Das Aufräumen mit diesem Irrtum hat bei Floëe eine nachhaltige Wirkung ... Heute ist sie richtig frech geworden, zum Vergnügen von uns beiden!
Es ist für mich als ihre Wegbegleiterin sehr schnell spürbar, wie karg und unbehütet Floëe aufgewachsen sein muss und mit wie wenig Zärtlichkeit. Nähe war in ihrem Leben bisher ausschliesslich mit Ausbeutung und Missbrauch verbunden. So tut sich Floëe lange schwer, sich für Bewusstseins-Übungen in den roten Sessel in meiner Praxis zu setzen, sich längere Zeit zu entspannen, ohne dass ihr Verstand immer noch Kommentare dazu geben muss. Zu ihrem Glück macht sie die notwendigen (eine Wende tut not) Wahrnehmungs- und Atemübungen diszipliniert jeden Morgen daheim, und neben einigen Erfolgserlebnissen in der Praxis spürt sie plötzlich etwas, was sich neu in ihr auftut: eine liebevolle Beziehung zu sich selber über ihr KörpergeWAHRSEIN, d. h., die Gedanken treten zurück, sodass sie sich im Körper spüren und WAHRnehmen kann. Sie macht neue Erfahrungen, die sie als transformierend erlebt. Sie wird sich ihrer destruktiven Selbstgespräche bewusst, die ihre
dunklen Stunden schwer wie Blei werden lassen, und lernt, sich mit ihren Gedanken zu ermutigen statt zu entmutigen. Erst jetzt hat sie eine Ressource, um sich auf ihre Schmerzspur zu begeben, ihre traumatische Kindheit und Jugend und auch ihre Irr- und Umwege in ihrem Leben als Erwachsene zu verarbeiten. Ihr verpasstes Leben ist anfangs oft ein Thema und droht sie immer wieder in einen ihrer Abgründe zu reissen, in Schwermut und Depression. Ich begleite sie durch die Trauer hindurch, die sehr wichtig ist für die Verarbeitung schmerzhafter Erfahrungen und ihr auch die Möglichkeit gibt, liebevoll bei sich und ihren Gefühlen zu bleiben, ohne abzustürzen – Gratwanderung pur. Und gleichzeitig versuche ich, ihr die Kraft der Gegenwart aufzuzeigen, sei es durch gemeinsames Lachen oder ihr Berührt-Sein im Hier und Jetzt. Sie beginnt, mich als ihren Spiegel wahrzunehmen. Einmal stelle ich mich spontan hinter sie, lege meine Hände auf ihre Schultern und teile ihr mit, was ich an ihr wahrnehme. Eine nachhaltige Erfahrung für sie. (Ich bin absichtslos, wenn ich so handle, es geschieht aus einem tiefen Impuls heraus, nicht als Technik, von der ich irgendein spezielles Ergebnis erwarte, und ich frage immer um Erlaubnis, ob ich eine kleine Übung machen dürfe.)
Nach 14 Monaten Prozess steht in meinem Sitzungsprotokoll: «Es passiert immer häufiger, dass sie lächelt oder lacht, und wenn ich ihr das zurückspiegele, ist sie berührt. Immer häufiger erlebe ich kleine, feine Begegnungsmomente mit ihr. Es zeichnen sich neue Pfade ab, die einen Unterschied machen zu ihrer selbstdestruktiven Gedankenautobahn.» «Heute hat sie sich zum ersten Mal getraut, mir Fragen zu stellen, wie viele Klienten ich habe und wie ich es schaffe, so präsent zu sein», lese ich in einem weiteren Protokoll. Ohne Präsenz könnte ich nicht so viel arbeiten!
Erste Weiterentwicklungen und neue Schritte werden überschattet durch einen Schlaganfall, circa 18 Monate nach Therapiebeginn. Sie kann ihr Projekt, ein Buch zu schreiben über ihre Kindheit und ihre Transidentität, nicht weiterführen. Sie beklagt Libido-Verlust, kann nicht mehr Klavier spielen, fühlt keine Lebensenergie mehr. Und macht die bemerkenswerte Aussage, für sie sei der Zeitpunkt kein Zufall und nicht nur das Ergebnis physiologischer Tatsachen und ihres langjährigen Lebenswandels – zu viel Weisswein und zu
viele Zigaretten. Sie reduziert von 40 auf 4 Zigaretten, kurze Zeit danach gibt sie das Rauchen sogar ganz auf, vom Weisswein hat sie sich schon früher getrennt. Und sie weist sich selbst in eine psychiatrische Klinik ein. Obwohl Floëe nur ihre AHV hat, kann sie sich von ihrem kleinen Restvermögen eine private Krankenversicherung leisten, sodass sie in den zwei Monaten Privatklinik einen Sonderstatus geniesst – endlich. Sie wird gut versorgt, kann sich ihre Therapien auswählen und geniesst eine Florence-freie Zeit; ihre Gefährtin befindet sich gerade in einer psychiatrischen Institution. Mein Besuch bei Floëe in der Klinik bleibt mir unvergessen, ihre Dankbarkeit, dass ich diesen Besuch nicht verrechne, beschämt mich. Wir trinken Kaffee in der Herbstsonne, sie wirkt klar und aufgeblüht, meine Bedenken gegenüber solchen Kliniken kommen einen kurzen Moment ins Wanken. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass Floëe nun gar nichts mehr muss, nicht einmal mehr ein Buch schreiben. Und es gelingt ihr nachhaltig, ein Floëe-gerechteres Leben zu führen. Unser Körper ist unser erfolgreichster Therapeut.
Floëe kann ihren Prozess fortsetzen und lässt sich, in ihrem Rededrang durch den Schlaganfall gestoppt, mehr auf körperorientiertes Arbeiten und Hypnotherapie ein. Es wird noch deutlicher, wie dissoziiert* sie ist, d. h. zum Teil völlig abgeschnitten von ihrem Körper und ihren Empfindungen. Ihr wird auch ihre starke innere Unruhe und ihre Angst vor dem Ausgeliefertsein bewusst. Sie hat sich jahrelang in ihren Intellekt geflüchtet und ihr psychisches Überleben durch ununterbrochenes Nachdenken zu sichern versucht, während das emotionale Erleben im «Totstellreflex» geblieben ist (eine verbreitete Strategie von Opfern sexueller Ausbeutung: so passiert mir gar nichts). Begegnungs- und prozessorientiertes psychotherapeutisches Arbeiten heisst, dass immer das aktuelle Befinden und die therapeutische Beziehung im Vordergrund stehen. Vom Hier und Jetzt aus tauchen Verbindungen zur Vergangenheit meistens von selber auf. Bei Floëe steht lange das Thema ihrer Transidentität im Vordergrund; sie hat zeitweise unter Zweifeln gelitten, ob sie sich das alles nur einbilde. Die Bilder und die Erinnerungen, die aus ihrer Kindheit auftauchen, sprechen eine deutliche Sprache. Statt weiter darüber zu grübeln, ob ihre Mutter sie wirklich schon als Kleinkind sexuell missbraucht hat und ihre Transidentität ihre Wurzeln dort haben könnte, lernt Floëe, eine Beziehung zu
dem kleinen Philippe aufzubauen, der verloren in einer Atmosphäre aufwuchs, die von Angst und von religiös gefärbten Drohungen geprägt war. Es gelingt ihr, diesen einsamen Jungen zu sich zu nehmen, sie entwickelt dadurch ein Mitgefühl für sich, ohne in Selbstmitleid zu versinken, und sie begreift die Zusammenhänge zwischen ihren langjährigen Symptomen (Dissoziation, sexuelle Impotenz, depressive Verstimmungen, mangelndes Selbstbewusstsein, starke Obstipation, die mehrere Spitalaufenthalte erforderte, Verlust des Körpergewahrseins) und ihren traumatischen Erfahrungen. Sie lernt, ihren messerscharfen Verstand endlich für sich einzusetzen, nämlich zum liebevollen Reflektieren statt zum Grübeln. Diesem Entwicklungsschritt verdankt sie viele Erkenntnisse, die ihr Leben erhellen. Und sie beginnt immer mehr, sich so zu lieben, wie sie ist – mit und trotz ihrer leidvollen Geschichte.
Übrigens gehe ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung davon aus, dass Floëe schon als kleines Kind sexuell missbraucht worden ist. Der Körper erinnert sich untrüglich. Jeder gesunde Pubertierende würde seine Mutter aus dem Bett werfen und nicht in eine Schockstarre verfallen. Auch ihr Ekel vor den weiblichen Geschlechtsteilen und vor intimen weiblichen Gerüchen ist nicht angeboren, sondern muss auf einer frühen ekelerregenden Erfahrung beruhen.
Auffällig benimmt sich die Mutter auch in Floëes Kindheitsjahren, an die sie sich erinnert. Oft onaniert der kleine Philippe, früh sexualisiert (?), in ihrer Nähe und wird erwischt und geschlagen. Auch wenn das nur Indizien sind, spricht Floëes langjährige überangepasste und aufopferungsvolle Lebenshaltung eine deutliche Sprache. Ursula Wirtz drückt es so aus: «Beim Inzest haben wir das Kind verloren, das wir einst waren, und auch das Bild von dem Kind, das wir hätten werden können [...]. Wir leben im eigenen Körper wie im Exil, wir haben die Identität verloren, die Unschuld, die Gefühle, den Glauben an eine Gerechtigkeit in der Welt.» («Seelenmord», 2001, S. 215.)
Die Transidentität wird heute neben vielen anderen Geschlechtsidentitäten als eine mögliche menschliche Variante zumindest in Fachkreisen anerkannt; es gibt in der Schweiz inzwischen Beratungsstellen für betroffene Kinder. Ich gehe davon aus, dass Floëes
Geschlechtsidentität und der wahrscheinliche Inzest keinen Zusammenhang haben müssen; letztendlich spielt das auch keine Rolle, und das kausale Denken gilt auch in der modernen Psycho-Logik als veraltet.
Ihre tiefe Einsamkeit im Anderssein, ihre verzweifelten Anpassungsversuche, die erlebte sexuelle Ausbeutung und der ganz normale Erziehungs-Wahnsinn jener Zeit haben ihre gesunde psychische Entwicklung zu einem selbstbestimmten Leben verunmöglicht Mir ist der Titel «Gratwanderung mit Floëe» hier zum ersten Mal aufgetaucht, aus der Ferne. Aus der Rückschau erschien mir unser Weg oft äusserst schmal, sodass wir teilweise nicht nebeneinander gehen konnten. Mal ging ich voran, mal sie. Die Abgründe rechts und links waren oft so tief, dass sie auszurutschen und für immer zu verschwinden drohte. Floëe ging es körperlich immer wieder sehr schlecht auf unserer Wanderung, ich habe mehrmals befürchtet, sie sei am Aushauchen. Der emotionale Stress in ihrem Leben hat an ihr gezehrt. Die Wahrheitssuche und der Prozess der Bewusstwerdung lassen uns dünnhäutiger werden. Und trotz meinem zweigleisigen Ansatz (Stärken und Verarbeiten)** versuche ich bei Floëe angesichts ihres strapaziösen Lebens und ihres fortgeschrittenen Alters, besonders auf behutsames Voranschreiten zu achten. Trotzdem überholt sie mich immer wieder von links und verblüfft mich mit einer neuen Erkenntnis, z. B. mit der, dass sie ihre Maman jahrelang wie eine Heilige verehrt habe und wie unter Zwang regelmässig auf den Friedhof gegangen sei. Nun halte sie es aus, Mamans Schatten zu begegnen. Floëe hat ihre Prägung durch ihre Eltern erfasst, ohne sie anklagen zu müssen ... Sie ahnt deren eigene Prägung.
Floëe nimmt seit einigen Jahren an einer Gruppentherapie teil, die nur von Frauen besucht wird. Für sie sind diese Gruppensitzungen spannendes Übungsfeld und Herausforderung zugleich. Sie experimentiert mit dem Mass ihres Raumes, den sie sich nimmt, und verlangt nach authentischen Rückmeldungen, die leider manchmal ausbleiben. Ob die anderen Frauen sie oder sich selber schonen wollen? Obwohl unsere «Wahrheitssuche» abgeschlossen ist, gönnt sich Floëe ab und zu einige Einzelsitzungen, um ein aktuelles Thema mit mir anzuschauen. Neulich erlebten wir eine richtige «Sternstunde», in der Floëe von ihrer grossen Müdigkeit sprach, aber auch von ihrer tiefen Zufriedenheit mit und in sich selber. Auch zu ihren noch
spürbaren Widersprüchen und Ungereimtheiten könne sie sich sagen, das gehöre halt auch zu Floëe ... Das sei für sie ein Wunder. «Für mich auch», erwidere ich, was sie zu Tränen rührt. In dieser Sitzung prägt sie auch den Titel ihres Interviews: «Ich wundere mich, dass ich so guter Dinge bin!»
Ich danke dir, geschätzte Floëe, dass ich dich begleiten durfte. Von dir habe ich gelernt, dass es nie zu spät ist, dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben. Ich habe immer bewundert, wie bescheiden und dankbar du bist und dass du dir trotz deinem zurückgezogenen Leben deine humorvolle und gesellige Seite erhalten hast.
«Der Körper sagt immer die Wahrheit!»
PS: Floëe hat vor rund zwei Jahren noch eine reiche Zeit bei unserer Hypnose-Session in der Natur von Frankreich erlebt. Sie bezeichnet es als die schönste Zeit ihres Lebens, weil sie sich noch nie so erfüllt und ganz erlebt habe. Sie kann trotz ihrer inzwischen verschlimmerten Neurasthenie plötzlich über eine Woche wieder laufen. Voller Übermut spielt sie sich richtig als Diva auf, was für andere Teilnehmerinnen nervig ist, doch nachsichtig behandelt wird. Sie hat es sogar bewerkstelligt, sehr kurz nach dieser Zeit noch einmal auf eigene Faust ihren «Zauberort» aufzusuchen und sich im Städtchen ein Kleid zu kaufen.
Floëe kann sich auch noch darüber freuen, dass ihr gerichtlich das Geschlecht «weiblich» zugesprochen wird, ohne dass sie sich – wie bisher üblich – einer Operation unterziehen muss. Ein langer Weg und viel Arbeit mit Behörden finden ein gutes Ende
Ein halbes Jahr später erleidet sie einen sehr schlimmen Schlaganfall und liegt lange im Spital und in einer Reha-Klinik. Doch sie kann sich weder körperlich noch psychisch davon erholen. Sie dämmert in einem Altersheim vor sich hin und möchte niemanden mehr sehen.
* Dissoziation ist ein physiologischer Schutzmechanismus, der unser Gehirn bei traumatischen Erfahrungen in eine Art Notaggregat versetzt. Wir fühlen uns nicht mehr im Körper, stehen wie neben uns oder erleben alles wie im Film.
** S. Anhang: therapeutischer Ansatz.