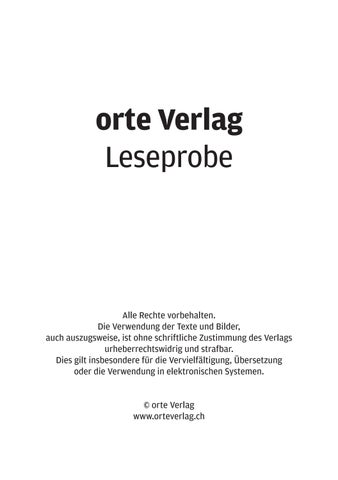5 minute read
Einleitung Monique Obertin
from orte 219
Einleitung
Der im Planquadrat angelegte Stadtkern ist das Wahrzeichen von La Chaux-de-Fonds. Jeder und jede kennt ihn aus den Schulbüchern. Aber wer hat ihn schon einmal besucht? Wir, die orteRedaktorinnen Regina Füchslin, Susanne Mathies und Monique Obertin unternahmen die Reise im vergangenen Mai. In weitläufigen Schlaufen ging es vom Neuenburgersee durch Tunnels und Wälder den Jurasüdhang hinauf – den glitzernden See noch die längste Zeit vor Augen – nach Chambrelien, wo der Interregiozug nach einem überraschenden Richtungswechsel rückwärts weitertuckerte, vorbei an Ortschaften mit geheimnisvoll klingenden Namen wie Les Geneveys-sur-Coffrane oder Les Hauts-Genevey. Unerwartet bald, nur eine kleine Stunde von Bern entfernt, trafen wir in La Chaux-de-Fonds ein, der höchsten Industrie- und Kulturstadt der Schweiz, auf fast tausend Metern über dem Meeresspiegel gelegen. Als wir aus der zum Kulturgut der Schweiz gehörenden Bahnhofshalle auf den grosszügigen Bahnhofplatz traten, empfing uns La Chaux-de-Fonds mit architektonisch einladend weiter Geste, aber empfindlich frisch und im Nieselschleier. So führten unsere ersten Handgriffe an die Knopfleisten unserer Mäntel und in die Taschen, um eiligst Regenschirme ans Tageslicht zu befördern.
Nach einem ersten Augenschein von La Chaux-de-Fonds trafen wir Julie Guinand und Urs Mannhart zum Gespräch. Die Offenheit der beiden und ihre Bereitschaft, für das vorliegende Heft etwas beizutragen, ermöglichte dessen Realisierung wesentlich. Die beiden seien an dieser Stelle nochmals herzlich verdankt! Die Schriftstellerin Julie Guinand wurde in La Chaux-de-Fonds geboren und ist heute wieder dort ansässig. Sie ist Mitglied der Gruppe AJAR (Association des Jeunes Auteurs Romands), deren Ziel die Veröffentlichung von gemeinsamen Texten ohne Einzelautorenschaft ist. Die AJAR-Autorinnen und -Autoren schrieben für uns eine Liebeserklärung an die Stadt La Chaux-de-Fonds, hinter deren Kulissen es ganz schön geheimnisvoll zu- und hergeht – wo ein Fussgängertunnel schon mal zum Sternentor wird oder das Licht Samthandschuhe trägt. Mythische Ausmasse nehmen auch die Schneemassen im winterlichen La Chaux-de-Fonds an, die der Schriftsteller und WahlChaux-de-Fonnier Urs Mannhart beschreibt. Sein neustes Buch, Lentille – Aus dem Leben einer Kuh, ist soeben bei Matthes und Seitz erschienen. Die Stadt stiftete zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Ernennung zum UNESCO-Kulturerbe den Literaturpfad 1000 mètres d’auteur.e.s. Die mit literarischen Zitaten von Autorinnen und Autoren der Romandie beschrifteten Hausfassaden wurden für uns von der Künstlerin Catherine Meyer fotografiert und illustrieren dieses Heft. Der orte-Redaktor Peter K. Wehrli wartet mit einer ungewohnten Sicht auf La Chaux-de-Fonds auf. Mehr sei hier nicht verraten. Unter dem Titel Sortir du bois (aus dem Wald treten) widmete das Musée des Beaux-Arts in La Chaux-de-Fonds den Werken von Künstlerinnen und Künstlern des Style Sapin eine Ausstellung. So nennt sich eine lokale Richtung des Jugendstils aus den 1920erJahren. Der Tannenstil wurde durch den Kunstgewerbeschul-
Haus im Style Sapin – eine lokale Richtung des Jugendstils aus den 1920er Jahren.
Foto: Monique Obertin
lehrer und Jugendstilkünstler Charles L’Eplattenier und dessen Schülerinnen und Schüler geprägt. Grundlage der ornamentalen Studien der Gruppe war die Tanne, weil sie nach Ansicht von L’Eplattenier im Ganzen oder im Detail unerschöpfliche dekorative Ressourcen bietet. Nebst der Tanne wurden auch andere einheimische Tiere und Pflanzen der Juraregion zu Hauptdarstellern in den Werken des Tannenstils, der nach seiner Entstehung fast hundert Jahre lang in einen Dornröschenschlaf fiel und kaum mehr ausgestellt wurde. Erst seit Kurzem finden die Werke wieder Beachtung. Ob das neu aufgekeimte Interesse an einheimischer Flora und Fauna zum Revival des Tannenstils beigetragen hat? Wir waren jedenfalls hingerissen von den Keramiken und Textilien mit Käfer-, Schmetterlings-, Tannen-, Kornblumen-, Mistel-, Efeu-, Löwenzahn- und Enzianornamenten. In gezeichneten und gemalten Studien liess sich in der Ausstellung die Umwandlung
der natürlichen Formen zu Ornamenten nachvollziehen und bewundern. Die Stadt La Chaux-de-Fonds hat keine Vororte und liegt in einer dünn besiedelten Gegend. Deshalb wird sie oft als Stadt auf dem Land (Ville à la campagne) bezeichnet, obwohl sie eigentlich eine Industriestadt ist. Hélène Bezençon geht in ihren tagebuchartigen Reflexionen auf diese besondere geografische Situation aus einer eigenwilligen Perspektive ein. Die Uhrmacherei nahm in La Chaux-de-Fonds bereits im frühen 19. Jahrhundert ihren Anfang, in den ersten Jahren vor allem in Heimarbeit. Der Wiederaufbau der Stadt erfolgte nach dem Brand im Jahr 1794 aus Stein und in einer zukunftsweisenden Art, die ihresgleichen sucht: Dem Abstand zwischen den Häusern, dem Lichteinfall in die Uhrmacherateliers, den Arbeitswegen und Wohnungen der Arbeiterinnen und Arbeiter wurde grösste Bedeutung beigemessen. Nicht umsonst fand die Stadt in Karl Marx’ Hauptwerk, dem Kapital, Erwähnung. Ihr Zentrum bildet die grosszügige Avenue Léopold-Robert, «le pod». Der Autor und Historiker Raoul Cop berichtet über die Ursprünge des schachbrettartigen Stadtplans von La Chaux-de-Fonds. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich La Chaux-deFonds zum wirtschaftlichen Mittelpunkt des jungen Kantons Neuenburg und gab sich 1848 ein republikanisches Staatsgrundgesetz. Die Schweizer Uhrenindustrie musste sich nach einer Krise in den 1870er-Jahren modernisieren, um mit den im Ausland aufkommenden industriellen Produktionsmethoden Schritt zu halten. Dies gelang nicht zuletzt dank zugezogener, meist jüdischer Investoren. La Chaux-de-Fonds zog in der Folge viele Arbeitskräfte an und wuchs schnell, erlebte aber über die Jahre mehrere Hochs und Tiefs, indem es sich als Magnet für Arbeitsuchende erwies oder aber, nach wirtschaftlichen Einbrüchen, hohe Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen hatte. Heute ist die Uh-
renindustrie durch Präzisionsmechanik, Mikromechanik und Elektronik teilweise ergänzt oder abgelöst. Gesellschaftlich und kulturell reflektiert La Chaux-de-Fonds Offenheit und Toleranz. Die Stadt brachte zahlreiche Schriftsteller, Architekten, Designer und Musiker hervor: Blaise Cendrars, Le Corbusier, Emile de Ceunick und Charles L’Eplattenier und viele andere. Der Club 44 an der Rue de la Serre 64, eröffnet 1944 durch den Industriellen Georges Braunschweig, hat zum Ziel, der ansässigen Bevölkerung unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt zu ermöglichen und objektive Informationen in einem demokratischen Geist zu fördern. Unter den eingeladenen Referierenden befanden sich unter anderem der französische Präsident François Mitterand, Jean-Paul Sartre, Hubert Reeves, Jeanne Hersch und François Truffaut. Kultur und Geschichte der Stadt La Chaux-de-Fonds wurden durch visionäre Persönlichkeiten geprägt. Ein Klima der Toleranz und eine gewisse Originalität ist in den rechtwinkligen Strassen heute noch spürbar und wir nehmen uns vor, der Stadt auch in Zukunft ab und zu einen Besuch abzustatten … vielleicht schon nächsten Winter, an einem Frosttag, um die sagenhaften Schneehaufen auf den Trottoirs zu bestaunen.
Monique Obertin