Die Schweizer Plattform für Digitales Business

Weitere Themen:
Hybride Post
Software Markt Schweiz
Desinformation
Rückblick KMU Fachforum
Fokus: Software für KMU
Künstliche Intelligenz
Agentic SaaS
Marktübersichten:
SaaS und Open Source Software






















Weitere Themen:
Hybride Post
Software Markt Schweiz
Desinformation
Rückblick KMU Fachforum
Fokus: Software für KMU
Künstliche Intelligenz
Agentic SaaS
Marktübersichten:
SaaS und Open Source Software




















Cloud-native SaaS verändert die Spielregeln der Unternehmens-IT: Statt komplexer Installationen und teurer Infrastruktur genügt heute ein Browser, um professionelle Business Software zu nutzen. Für Schweizer KMU eröffnet das neue Möglichkeiten in Effizienz, Flexibilität und Sicherheit – bringt aber auch neue Abhängigkeiten und Fragen rund um Datenschutz, Support und digitale Souveränität mit sich.
Cyrill Schmid
Was echte SaaS ausmacht
Cloud-native Business Software ist von Grund auf für den Betrieb in der Cloud konzipiert. Sie läuft direkt im Browser oder via App, ist mehrmandantenfähig und sofort einsatzbereit. Updates, Backups und Wartung erfolgen zentral beim Anbieter – ohne lokale Installationen oder individuellen Pflegeaufwand.
Damit unterscheidet sich echte SaaS deutlich von gehosteten Einzelinstanzen, die zwar aus der Cloud betrieben werden, aber weiterhin Betreuung erfordern.
Transparenz und Flexibilität
Für KMU liegen die Vorteile auf der Hand: Statt hoher Investitionen zahlen sie transparente Abos und skalieren flexibel. Automatische Updates halten alle Nutzerinnen und Nutzer auf dem aktuellen Stand. Der ortsunabhängige Zugriff erleichtert Homeoffice und mobile Arbeit, offene Schnittstellen ermöglichen die Integration mit Banking, E-Commerce und Kollaborationstools.
Auch die Sicherheit überzeugt: Professionell betriebene Rechenzentren mit redundanten Systemen und Zertifizierungen bieten oft mehr Verlässlichkeit als Eigenlösungen.
Risiken und Stolpersteine
SaaS bedeutet Abhängigkeit – vom Anbieter, vom Internet, von der Preisgestaltung. Fällt die Verbindung aus, stehen Funktionen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Ohne Offline-Modus oder lokale Fallbacks kann die Arbeit ins Stocken geraten. Steigen die Kosten, wird die Kalkulation zur Herausforderung. Deshalb sind Datenportabilität und klare Exit-Szenarien essenziell.
Besonders heikel ist der Datenschutz: Bei Schweizer Hosting gilt das neue Datenschutzgesetz, in der EU die DSGVO, ausserhalb Europas sind zusätzliche Prüfungen nötig. Viele KMU setzen daher auf «Swiss Hosting» als Garant für Datensouveränität. Auch die Leistung überzeugt nicht immer, berichtet wird von Performance-Problemen oder ungenügendem Support. Und nicht alles, was als SaaS vermarktet wird, ist tatsächlich cloudnative – oft sind es hybride Lösungen, die über lokale Clients oder Remote-Desktop-Technologien auf zentral gehostete Software zugreifen.
Open Source als Gamechanger
Spannend wird es, wenn SaaS und Open Source zusammenkommen. Immer mehr Business-Software wird als Open Source entwickelt und als gehosteter Service angeboten. KMU nutzen die Lösung im SaaS-Modus, ohne eigene Infrastruktur, behalten aber durch den offenen Quellcode ihre Unabhängigkeit. Wer will, kann selbst hosten oder den Anbieter wechseln. Das senkt das Risiko eines Vendor-Lock-in und stärkt die digitale Souveränität. Eine aktive Community bringt Innovation, doch Qualitätssicherung und Support sind nicht automatisch gegeben. KMU sollten prüfen, ob ihr Anbieter verlässliche Services rund um die Open-Source-Lösung bietet.
Was Anwender erwarten
Die Erwartungen an SaaS sind klar: Sofort starten, intuitiv bedienen, mobil arbeiten, modular erweitern. Dazu kommen überzeugende Performance, zertifizierte Sicherheit und kompetenter Support. Wer hier als Anbieter überzeugt, gewinnt Vertrauen –und langfristige Kunden.
SaaS ist im Schweizer KMU-Alltag angekommen. Wer echte Cloud-native Lösungen einsetzt, profitiert von tieferen Kosten, höherer Flexibilität und schnellerer Innovation. Gleichzeitig gilt es, Datenschutz, Abhängigkeiten und Integrationen kritisch zu prüfen. Die Nachfrage wächst – und mit ihr der Druck auf Anbieter, ihre Software so bereitzustellen, wie es Nutzer erwarten: browserbasiert, sicher, flexibel, startklar.
Als nächstes grosses Thema stehen KI-Agenten im Raum. Sie sollen Routineaufgaben übernehmen und Prozesse aktiv steuern. Für KMU eröffnen sich neue Chancen – und neue Fragen zu Vertrauen, Transparenz und Kontrolle.
Cyrill Schmid ist Managing Partner bei topsoft und Leiter des topsoft Consulting-Netzwerks www.topsoft.ch/consulting
EDITORIAL
Wenn’s läuft, läuft’s einfach
Alain Zanolari 5
KNOW-HOW
SaaS für KMU: Flexibel, sicher –aber nicht ohne Risiko
Cyrill Schmid 3
KI-Zertifizierung – sinnlos, wünschenswert, notwendig?
Friedrich Kisters 6
KI in Schweizer KMU: Zwischen Ambition und Realität
Alain Zanolari 8
Warum das «Per User-Pricing» keine Zukunft hat Dr. Jürgen Müller 20
Warum viele KI-Projekte scheitern –und wie Sie es besser machen können
Nancy Wayland und Magdalena Orascanin 22
57 ist das neue 42
Dr. Pascal Sieber und Christoph Hugenschmidt 26
ICT-Lernende im Rampenlicht
ICT-Fachmann – ein Beruf mit Technik, Verantwortung und Kontakt zu Menschen
Reza Khawari 28
KI-Services aus der Schweiz: Anbieter im Vergleich
Nick Weisser 29
Welche Software passt zu Ihrem KMU: Individuell oder Standardlösung?
Alain Zanolari 35
Zucchetti Forum 2025 –Wie schnell ist die Zukunft?
Cyrill Schmid 38
Desinformation erkennen, verstehen, abwehren
Rui Biagini und Peter Metzinger 42
KOLUMNE
Produkt verkaufen oder Kundenproblem lösen? Urs Prantl 11
DIGITAL FUTURE
KI im ERP: Zwischen Kinderkrankheiten und praktischem Nutzen Carlos Bouzo 14
SOLUTIONS
Prozessdaten in Erkenntnisse verwandeln –mit Process Mining 25
Success Story Idealer Partner für den Grossversand 39
MARKTÜBERSICHT SOFTWARE AS A SERVICE Software as a Service – das längst angekommene Zukunftsmodell
MARKTÜBERSICHT OPEN SOURCE SOFTWARE Open Source Software –strategischer Vorteil für KMU
INTERVIEW
Interview mit Siegfried Laibach ERP ist kein Selbstzweck – sondern ein Möglichmacher
Cyrill Schmid 12
Interview mit Thom Nagy «KI soll Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger einfacher machen»
Josef Kruckenberg 30
4 x 4 Interview
Open Source für KMU –zwischen Freiheit und Verantwortung
Cyrill Schmid 36
KMU FACHFORUM
KMU Fachforum 2025 – Austausch, Impulse und echte Praxis
Es gibt Dinge, auf die man sich verlassen kann: Dass der Kaffee nie ganz so stark ist, wie man ihn gerade bräuchte. Dass der Drucker genau dann nach Toner schreit, wenn es pressiert. Und dass irgendwo im Hintergrund Software ihren Dienst tut – still, zuverlässig, unsichtbar. Also meistens.
Im Büroalltag erwarten wir völlig selbstverständlich, dass alles stets funktioniert: Daten sind da, die Systeme stabil, Abläufe gefälligst stets reibungslos. Doch diese Selbstverständlichkeit ist ein fragiles Konstrukt – getragen von Infrastruktur, Technik und natürlich: Software. Die gibt den Takt vor. Und manchmal auch den Taktstock aus der Hand, wenn sie mitten im Feierabend ein Update verlangt. Software allein entscheidet nicht über den Erfolg eines Unternehmens. Aber sie entscheidet, ob es flutscht oder ob man flucht.
ADVERTORIAL
FLOWZILLA: Die zentrale Plattform für smarte Prozessautomatisierung 10
Im Fokusthema dieser Ausgabe geht’s deshalb um Software für KMU: Was eignet sich besser für mich? Standardlösung mit cleveren Add-ons oder doch lieber Eigenentwicklung? SaaS oder Open Source? Daten lieber in der Cloud speichern oder doch summende Server im Keller haben? Wir liefern Denkanstösse, auch für Ihr Unternehmen.
Apropos Denkanstösse: Ende August trafen sich rund 120 KMU-Vertreterinnen und -Vertreter zum dritten KMU Fachforum. Es wurde intensiv diskutiert, erfolgreich genetzwerkt, fein gegessen – und das alles in einer entspannten und inspirierenden Atmosphäre. Den Rückblick gibt es ebenfalls in diesem Heft.
Wie gewohnt gibt es weitere Fachartikel, Impulse, Knowhow. Viel Vergnügen beim Lesen – und falls der Drucker wieder streikt: Wir kennen das.

Alain Zanolari topsoft Fachredaktion
P.S. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Ideen und Inputs!
Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsversprechen mehr, sondern operativer Alltag – doch zwischen Hype, Unsicherheit und wachsender Komplexität sind Unternehmen gefordert, echten Nutzen zu schaffen und Verantwortung zu übernehmen. Fünf zentrale Kontrollpunkte helfen dabei, KI-Lösungen transparent und vertrauenswürdig zu gestalten – und liefern die Grundlage für eine sinnvolle Zertifizierung.
Friedrich Kisters
Künstliche Intelligenz ist in kürzester Zeit von einer technologischen Spielerei zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor geworden. Diese rasante Entwicklung bringt allerdings auch einige Risiken mit sich: Private Daten werden an Endpunkte auf der ganzen Welt verteilt, kritische Entscheidungen werden mithilfe von KIs getroffen und niemand ist sich im Klaren, worauf im Umgang mit der neu erlangten «Intelligenz» geachtet werden soll.
Die Antwort liegt in einem strukturierten, nachvollziehbaren und überprüfbaren Ablauf. Eine Zertifizierung ist weit mehr als ein bürokratischer Stempel; sie ist der einzige Ausgang aus einem wachsenden Labyrinth aus KI-Lösungen. Sie ermöglicht es, als Kunde verschiedene Lösungen anhand von simplen Faktoren zu vergleichen, und als Entwickler eigene Lösungen zielgerichtet zu optimieren.
In diesem Beitrag beleuchten wir fünf kritische Kontrollpunkte der KI-Zertifizierung: Organizational Controls, Human-Centric Design and Oversight, Security and Compliance Controls, Robustness sowie Data Governance.
KI-Lösungen sind generell nicht deterministisch und damit auch nie vollständig transparent. Daher ist es wichtig, Prozesse zu definieren, die klarzustellen, wer verantwortlich ist, wie Abläufe organisiert sind und welche Regelungen im Umgang mit der KI gelten. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Entwicklungsprozess, aber auch im Einsatz der Lösung Fehler minimiert und schnell behoben werden.
Wichtige Punkte für KI-Anwender:
• Mitarbeiterschulungen für den sachgemässen Umgang mit KI-Lösungen
• Einsatzzweck und -grenzen der KI-Lösung klar und unmissverständlich definieren
• Risikobewertung für jeden Anwendungsfall durchführen und aktualisieren
Eskalationsprozesse für kritische Situationen oder Systemausfälle definieren
KI-Entwickler sollten hierauf achten:
• Limitationen und Anwendungsempfehlungen der Technologie definieren
• Aktiven Kontakt mit Kunden halten, um Fehler schnell zu beheben und die Lösung kontinuierlich zu verbessern
• Eine umfassende Prüfung der Lösung vor der Auslieferung sicherstellen
• Haftungsregelungen kommunizieren, inkl. Verantwortlichkeiten bei Fehlverhalten
Ein prominenter Fall mangelhafter Organizational Controls war der KI-Chatbot «Tay» von Microsoft (2016). Der Bot sollte durch Twitter-Interaktionen lernen, entwickelte jedoch innerhalb eines Tages rassistische und beleidigende Aussagen. Grund dafür waren fehlende Schutzmechanismen: Es gab weder klare Einsatzgrenzen noch eine Begrenzung der Datenquellen. Eine Risikoanalyse oder Vorabprüfung blieb ebenfalls aus – mit entsprechendem Reputationsschaden.
KI-Systeme sind nie zu 100 % akkurat. Was aber tut man, wenn eine solche Genauigkeit gerade benötigt wird?
Im Banking kann man einem Kunden schlecht sagen: «Entschuldigung, aber unsere KI hat entschieden, für Sie Kryptowährung zu kaufen. Jetzt haben Sie eben nur noch 10 Franken auf dem Konto». Missverständnisse, die durch KI entstehen, müssen ausgeschlossen werden.
Solche Anwendungen benötigen menschliche Überwachungsmechanismen. So könnte beispielsweise ein fälschlicher Kauf durch eine KI von Mitarbeitenden abgelehnt werden.
Damit ein solches System funktioniert, müssen Rahmenbedingungen definiert sein:
• Verantwortlichkeiten und Abläufe für Eingriffe in die KI sowie die originalen Entscheidungen der KI müssen transparent dokumentiert sein.
• Regelmässige Schulungen klären Verantwortliche über Risiken, ethische Fragestellungen und Vorgaben auf, welche die KI betreffen, damit sie die KI nicht einfach «machen lassen».
• Im Zweifelsfall sollte eine Entscheidung der KI abgelehnt und nochmals hinterfragt werden.
Teilweise ist es nicht möglich oder ineffizient, alle Entscheidungen der KI durch einen Menschen kontrollieren zu lassen. Hier entstehen Sicherheitsrisiken.
Sollte eine KI für die Generierung von Programmiercode eingesetzt werden und diesen Code direkt lokal ausführen, kann ein Nutzer der KI mit Hilfe einer Aufforderung, genannt «Prompt», in der er die KI anweist, alle anderen Anweisungen zu «vergessen» und einen bösartigen Code auszuführen, das System hacken. Dieser Prompt kann auch in Daten «versteckt» sein, die der Nutzer hochlädt. Ein solches Vorgehen wird als «Prompt Injektion» bezeichnet. Der Prompt wird, versteckt in anderen Daten, dem Modell gegeben und Sicherheitsmassnahmen, welche die KI kontrollieren sollen, werden umgangen.
Um solche Sicherheitsrisiken zu lösen ist es essenziell, dass die KI in einem abgeschlossenen System ausgeführt wird und nur so viel Zugriff erhält, wie sie benötigt. Ein abgeschlossenes System zu infiltrieren ist für Hacker im Regelfall uninteressant, da der Hacker das System nicht verlassen kann, um in weitere Komponenten einzudringen.
Durch das Limitieren des Zugriffes der KI werden allerdings nicht alle Szenarien abgewendet. Es kann passieren, dass die KI auf Aufforderung des Nutzers Fragen beantwortet, für die sie nicht entwickelt wurde oder Antworten generiert, die ethisch nicht vertretbar sind.
Um solche Probleme zu verhindern ist es wichtig, dass die Nutzer-Anfragen sowie die KI-Antworten von einem dritten Modell kontrolliert werden, auf das der Nutzer keinen Einfluss hat, um sicherzustellen, dass Fragen sowie zugehörige Antworten im definierten Rahmen der KI liegen und ethisch korrekt sind.
Gerade da KI unberechenbar sein kann, ist es essenziell, ein Testsystem aufzusetzen, das vor Releases anhand relevanter Metriken prüft, ob und wie sich die Leistung der KI verändert hat.
Im Falle einer komplexeren Pipeline ist es empfehlenswert, alle Komponenten einzeln zu testen. So sieht man, ob Probleme zum Beispiel von einem neu eingesetzten, aber schlechteren Modell stammen und es ausgetauscht werden muss.
Zusätzlich ist zu beachten, dass teilweise grosse Modelle eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Skalierbarkeit leicht zu einem Problem werden kann, sobald Lastspitzen auftreten. Systeme müssen entsprechend skalierbar aufgesetzt sein und regelmässig auf Adversial Attacks und normale Lastspitzen getestet werden.
So wird jede Iteration das Resultat verbessern und fehlende Skalierbarkeit nicht zum Problem.
Daten sind in modernen KI-Lösungen essenziell, egal ob es um das Training einer neuen KI oder das Bereitstellen von Informationen innerhalb eines Systems geht. Die Antwort einer KI kann nur so gut sein wie die Daten, auf die sie trainiert wurde, kombiniert mit den Daten die sie bei Laufzeit erhält.
Um sicherzustellen, dass diese Daten qualitativ hochwertig sind, sollten stichprobenweise Daten ausgewertet werden und die Herkunft jeder Datenquelle unveränderbar protokolliert sein. Überprüfungen des Datensatzes können Verzerrungen und die Grundlagen von Bias in einem Modell aufdecken und Fehlverhalten verhindern.
Der Schutz von Daten hat in letzter Zeit massiv an Bedeutung gewonnen. Wichtig ist das sogenannte «Data-Labelling», bei dem beispielsweise Daten als «man-made» oder «machinemade» gekennzeichnet werden, auch um zu vermeiden, dass Daten zum Erstellen einer neuen KI mit Antworten älterer Versionen verunreinigt sind. Das revisionssicheren Archiv wird plötzlich zur idealen Datenablage für KI-Anwendungen.
Fazit: Der Weg zu vertrauenswürdiger KI
Ist eine KI-Zertifizierung also sinnlos, wünschenswert oder notwendig?
Die Antwort lautet immer deutlicher: Für den seriösen und skalierbaren Unternehmenseinsatz kann sie essenziell sein.
Um KI-Systeme aus der Experimentierphase zielgerichtet in einen produktiven, werthaltigen Betrieb zu bringen und Kunden einen Rahmen für die Bewertung von KI-Systemen zu schaffen, benötigt man einen dokumentierten Nachweis zu Leistung, Risiken und Compliance.
Friedrich Kisters ist Experte für digitale Transformation und Governance mit einem Fokus auf KI-getriebene Innovationen. Als Berater hilft er Unternehmen dabei, technologische Potenziale verantwortungsvoll zu nutzen und Compliance-Anforderungen in strategische Vorteile umzuwandeln. www.linkedin.com/in/friedrich-kisters-501132b
Friedrich Kisters schreibt über Künstliche Intelligenz, Fälschungsschutz und digitale Lösungen mit unternehmerischem Weitblick. Seine Texte verbinden technologische Expertise mit praxisnaher Orientierung.

Weitere Artikel lesen Sie unter tinyurl.com/ friedrich-kisters oder via QR-Code.
Wie weit ist die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Schweizer KMU tatsächlich fortgeschritten? Der Swiss AI Impact Report 2025 liefert eine systematische Analyse der KI-Realität in Schweizer Unternehmen. Die Studie vergleicht die strategische Sicht von Führungskräften mit der operativen Perspektive der Mitarbeitenden und zeigt: Die grösste Herausforderung liegt nicht in der Technologie, sondern in der Wahrnehmung.
Alain Zanolari
Die zentrale Erkenntnis der Studie ist eine systemische Wahrnehmungslücke. Führungskräfte bewerten alle sechs untersuchten Erfolgsfaktoren – von KI-Kompetenz bis Einführungserfolg –durchgehend positiver als ihre Mitarbeitenden. Dieser Abstand ist nicht nur statistisch relevant, sondern strategisch riskant: Er führt zu Blindflug, Demotivation und Fehlinvestitionen. Besonders kritisch: Der Einführungserfolg ist der am schwächsten bewertete Faktor im gesamten Index.
Diese Diskrepanz war auch Thema im bbv-Webinar vom 3. September 2025, das vom Head of Business Area AI der bbv Stefan Häberling moderiert wurde. Gastreferent Jan Schlüchter von der Hochschule Luzern sprach von einer «Ambitionslücke», die nicht durch Technologie, sondern durch Kommunikation und Führung geschlossen werden müsse.
Drei Befunde, die zum Handeln zwingen
Der Report identifiziert drei zentrale Schwachstellen, die den Fortschritt der KI-Transformation in Schweizer KMU bremsen.
1. Befähigungskrise: Schulungen, Kommunikation und Lernzeit sind strategisch geplant, kommen aber in der Realität der Mitarbeitenden nicht an. Nur 37 % fühlen sich im Umgang mit KI-Tools vertraut. Die Folge: Unsicherheit statt Innovation.
2. Strategie-Vakuum: Viele Mitarbeitende kennen weder die Ziele noch die Regeln oder Zuständigkeiten rund um KI im Unternehmen. Nur 27 % fühlen sich gut informiert, 15 % wissen nicht einmal, an wen sie sich bei Fragen wenden können.
3. Mässige Erfolgsbilanz: Trotz positiver Grundhaltung wird der bisherige Einführungserfolg von beiden Seiten als schwächster Faktor bewertet. Die Ursachen reichen von unpassenden Tools über fehlende Datenqualität bis zu überhöhten Erwartungen.
KI-Literacy: Das Fundament fehlt
Die Studie zeigt deutlich: Ohne solides Verständnis für KI bleibt jede Strategie ein Papiertiger. Die Kompetenzlücke zwischen Führung und Mitarbeitenden ist signifikant – und auch altersbedingt. Ältere Mitarbeitende (55+) weisen deutlich geringere Vertrautheit mit KI auf als jüngere. Auch Führungskräfte sind nicht ausgenommen: Rund 45 % sind kaum mit generativer KI vertraut.
Im Webinar betonte Jan Schlüchter, dass gerade Führungskräfte eine aktive Rolle übernehmen müssen – nicht als Wissensvermittler, sondern als Lernende. Formate wie «AI Gemba Walks», offene «Ask Me Anything»-Sessions oder altersübergreifendes Mentoring sollen helfen, KI im Alltag sichtbar und greifbar zu machen. Die bbv Software Services AG bietet dazu KI-Grundlagen-Workshops für Fach- und Geschäftsleitende an – mit Fokus auf Basic Prompting, ethische Aspekte und eine gemeinsame Sprache.
Organisationale Unterstützung:
Wunsch und Wirklichkeit
Während 42 % der Führungskräfte die organisationale Unterstützung als gut einschätzen, sind es nur 19 % der Mitarbeitenden. Die Diskrepanz zeigt sich auch in der Governance: Klare Regeln, Zuständigkeiten und Ressourcen fehlen oft. Die Studie empfiehlt einfache Strukturen, etwa ein Ampelsystem für KI-Tools oder ein «AI Center of Excellence» als zentrale Anlaufstelle.
Auch im Webinar wurde deutlich: Eine klassische Delegationsphilosophie funktioniert bei KI nicht. Die Geschäftsleitung muss sich aktiv einbringen, nicht nur strategisch, sondern auch operativ. Risikomanagement, Datenschutz und Tool-Freigaben dürfen nicht im Nebel bleiben, sondern brauchen transparente Prozesse und klare Verantwortlichkeiten.
Einführungserfolg: Die ehrliche Bilanz
Der Einführungserfolg ist der schwächste Wert im gesamten Index. Die Gründe sind vielfältig: Tools passen nicht zu den Prozessen, Ziele sind unklar, Systeme lernen nicht ausreichend. Besonders kritisch: Ältere Mitarbeitende bewerten den Erfolg deutlich negativer als jüngere. Die Studie fordert schnelle, sichtbare Erfolge und eine aktive Einbindung der Mitarbeitenden –nicht als Konsumenten, sondern als Mitgestalter.
Die Idee einer «lernenden Organisation» wurde im Webinar mehrfach betont: KI-Transformation gelingt nur, wenn Experimente erlaubt sind, Fehler als Lernimpulse gelten und Mitarbeitende aktiv an der Entwicklung beteiligt werden. Führungskräfte sollen nicht vorgeben, alles zu wissen, sondern Lernbereitschaft zeigen – und dies auch öffentlich.
Professionelle Begleitung:
Kein Luxus, sondern Notwendigkeit
Die Studie zeigt deutlich: Viele KMU kämpfen nicht mit mangelnder Motivation, sondern mit strukturellen Hürden. Fehlende Governance, unklare Zuständigkeiten und begrenzte Ressourcen machen es schwer, KI-Projekte nachhaltig zu verankern. Gerade kleinere Unternehmen verfügen oft nicht über eigene KI-Fachleute oder interne Strategieteams.
In solchen Fällen kann externe Unterstützung helfen, die Transformation zu beschleunigen – nicht als Outsourcing, sondern als gezielte Begleitung. Ob beim Aufbau einer GovernanceStruktur, der Auswahl geeigneter Tools oder der Schulung von Mitarbeitenden: Professionelle Hilfe kann den Unterschied machen zwischen einem ambitionierten Projekt und einem echten Umsetzungserfolg.
Wichtig ist dabei, dass die Unterstützung nicht nur technisch, sondern auch kulturell anschlussfähig ist. KMU brauchen Partner, die ihre Realität kennen und nicht nur passende Lösungen, sondern auch Orientierung bieten.
Akzeptanz und Potenzial: Die gute Nachricht
Trotz aller Herausforderungen ist die Akzeptanz für KI hoch: Mit Werten von 3,98 (Führungskräfte) und 3,44 (Mitarbeitende) ist sie der stärkste Faktor im Index. Die Bereitschaft zur Veränderung ist also definitiv da. Doch auch hier zeigt sich eine Ambitionslücke: Führungskräfte sehen das Potenzial deutlich optimistischer als ihre Teams.
Umso wichtiger sind konkrete Use Cases, die zeigen, wie KI im Alltag helfen kann: etwa bei der Protokollierung von Meetings, der Formulierung von E-Mails im eigenen Stil oder als Coaching-Tool zur Reflexion von Situationen. Solche Anwendungen machen KI greifbar und bauen Vertrauen auf.
Die KI-Transformation in Schweizer KMU scheitert nicht am Willen, sondern daran, dass viele Unternehmen noch nicht bereit sind, sie wirklich zu tragen. Die Studie zeigt: Akzeptanz ist vorhanden, doch zwischen Ambition und Umsetzung klafft eine Lücke. Mangelnde KI-Kompetenz, fehlende Unterstützung und eine Führung, die oft in einer anderen Realität weit weg von der Praxis agiert, bremsen den Fortschritt.
Was es braucht? Lernräume statt Leitsätze. Führung, die sichtbar und wirksam ist. Und eine gemeinsame Sprache, die nicht nur Tools erklärt, sondern Vertrauen schafft. Nur so wird aus KI mehr als ein strategisches Schlagwort – nämlich ein echter Hebel für Veränderung.
Zur Methodik
Die Grundlage des Swiss AI Impact Report 2025 bildet eine Online-Befragung, die vom 19. Mai bis 9. Juli 2025 durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 537 Personen aus Schweizer Unternehmen befragt – davon 320 Führungskräfte und 217 Mitarbeitende ohne Führungsfunktion.
Ein besonderes Merkmal der Studie ist der duale Ansatz: Die strategische Sicht der Führungskräfte wurde gezielt der operativen Realität der Mitarbeitenden gegenübergestellt. So konnten Unterschiede in Erwartung, Einschätzung und Bedarf sichtbar gemacht werden – und erstmals systematisch analysiert werden, wo die KI-Transformation ins Stocken gerät.
Der vollständige Swiss AI Impact Report 2025 steht online zum Download bereit (siehe Kasten).

Wie steht es um die KI-Transformation in Schweizer KMU?
Der Swiss AI Impact Report 2025, erstellt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und dem Sozialforschungsinstitut DemoSCOPE, liefert fundierte Einblicke in Strategien, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren. Laden Sie den Report kostenlos herunter und erfahren Sie, wo Schweizer Unternehmen stehen – und was sie bewegt. https://qrco.de/ bgJc7N
Viele Datensilos, zeitraubende Medienbrüche und manuelle Prozesse bremsen Wachstum, Effizienz und Innovationskraft Ihres Unternehmens? Dann ist es höchste Zeit, die digitale Transformation nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. FLOWZILLA verbindet Systeme, automatisiert Workflows und bringt Ordnung ins Datenchaos – ohne Programmieraufwand, aber mit echter Enterprise-Skalierung und maximaler Wirkung.
Als 360° IT-Dienstleister und erfahrener Digitalisierungspartner begleitet die group24 AG seit Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation. Mit FLOWZILLA hat das Team nun eine innovative Lösung geschaffen, die den nächsten logischen Schritt geht: Smarte Prozessautomatisierung, die sich flexibel an Unternehmensrealitäten anpasst – und nicht umgekehrt.
Was ist FLOWZILLA?
FLOWZILLA ist eine cloudbasierte iPaaSLösung (Integration Platform as a Service), die als digitale Datendrehscheibe fungiert. Sie verbindet ERP-, CRM-, WMS-, DMSund PIM-Systeme über zahlreiche Out-ofthe-Box-Konnektoren, orchestriert Datenflüsse in Echtzeit und automatisiert selbst komplexeste Unternehmensprozesse.
Das Besondere: FLOWZILLA funktioniert als Low-/No-Code-Plattform – Digitale Prozesse lassen sich ohne Programmierkenntnisse erstellen, anpassen und überwachen.
Ob C-Level, IT-Entscheider oder Entwicklerteams: FLOWZILLA spricht alle an, die Effizienz steigern, Fehlerquellen minimieren und Ressourcen optimieren wollen. Besonders stark ist das hybride Modell: Plattform plus Managed Services. Unternehmen entscheiden selbst, ob sie Prozesse eigenständig umsetzen oder auf das Experten-Team der group24 setzen.
Wichtigste Features im Überblick:
Zahlreiche Konnektoren für ERP, CRM, WMS, DMS, PIM & mehr
Unterstützung von Standardformaten wie EDIFACT, iDoc, AS2, CSV, XML & JSON & mehr für maximale Interoperabilität
Echtzeit-Datenflüsse & Access Hub
· Rollen- & Berechtigungskonzepte
Prozess-Throttling, Monitoring & Change-Logs
Unbegrenzte API-Calls, Daten und Dokumente
· Made & Hosted in Germany – ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen
FLOWZILLA kann sowohl moderne APIbasierte Integrationen als auch klassische onPrem sowie Private Cloud Anbindungen bedienen. Die Plattform ersetzt manuelle Dateneingabe, reduziert damit Fehler und schafft Transparenz.
Das Dashboard zeigt alle Informationen in Echtzeit – inklusive Erfolgs- und Fehlerraten, zeitlicher Verläufe und Änderungsprotokolle.
Dabei ist FLOWZILLA nicht nur ein Werkzeug – es ist ein strategischer Hebel für Unternehmen, die ihre Prozesse nicht länger verwalten, sondern aktiv gestalten wollen. Die Plattform wächst nahtlos mit den Anforderungen, bleibt dabei intuitiv bedienbar und schafft Raum für das, was wirklich zählt: Innovation und Effizienz.
FLOWZILLA in der Praxis
Zahlreiche Unternehmen setzen FLOWZILLA bereits erfolgreich ein, darunter der Caritasverband Osnabrück, TKD Deutschland GmbH und die Herweck AG. Die Ergebnisse sprechen für sich: Weniger Aufwand, höhere Datenqualität, bessere Kundenerlebnisse. Ob bidirektionale Schnittstellen zwischen ERP-Systemen, automatisierte Workflows über mehrere Systeme hinweg oder die gängigsten EDI-Formate (EDIFACT, AS2, iDoc) – FLOWZILLA liefert, was moderne Unternehmen brauchen.
Mehr Informationen finden Sie auf www.flowzilla.de.
group24 AG
Schüringsweg 6-8 48712 Gescher (Deutschland) www.flowzilla.de
Am 4. November 2025 öffnet FLOWZILLA die digitale Bühne.
Für alle, die bisher nur über Automatisierung nachgedacht haben, ist dieses digitale Live-Event ein echtes Must-Have. Exklusive Einblicke in die Plattform, praxisnahe Use Cases und klare Impulse für effizientere Prozesse zeigen, wie Automatisierung wirklich wirkt – kompakt, verständlich und kostenlos.
Wer Digitalisierung nicht nur verstehen, sondern gestalten will, sollte dabei sein.
Jetzt anmelden und FLOWZILLA live erleben

https://qrco.de/bgJm9P

Individual-Softwarefirmen lösen Kundenprobleme, Standard-Softwarefirmen verkaufen ihr Produkt. Zwei verschiedene Vorgehensweisen, die sich eisern im Mindset eines Softwarunternehmens verankern. Mit dem Ergebnis, dass von der einen Seite kaum mehr auf die andere gewechselt werden kann. Doch die Vorgehensweisen sind nicht so verschieden, wie es den Anschein macht.
Arbeite ich mit dem Führungsteam eines Standard Business-Softwareherstellers, so dreht sich alles darum, wie wir unser Produkt an den Kunden bringen können. Insbesondere an die Adresse der Verkäufer fallen Apelle wie, «ihr dürft nur verkaufen, was wir haben und nicht den Kunden Features versprechen, die wir (noch) nicht haben». Allergisch reagieren die Unternehmen dann, wenn Kunden sogar die «Frechheit» besitzen, nur für sie relevante Funktionen zu fordern und damit drohen, den Standard zu sprengen.
Andererseits höre ich bei Individual-Softwareherstellern regelmässig, «wir bauen exakt, was unsere Kunden wollen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.» Das geht dann meist so weit, dass auch prozesstechnisch Unsinniges programmiert wird – nur weil der Kunde es schon immer so gemacht hat. Hardcore Individual-Softwareentwickler hinterfragen Kundenwünsche selten. Es gehört zu ihrem Selbstverständnis, dass sie jedes Kundenproblem mit Hilfe ihrer Softwarekünste lösen wollen.
Der Vollständigkeit halber will ich noch eine dritte Gruppe erwähnen. Es sind die «Unentschiedenen», die eine als Standard gedachte Business-Software dermassen verbasteln, dass daraus ein Individualprodukt entsteht, welches kaum noch gewartet, geschweige denn einem Update unterzogen werden kann. Branchenerfahrene Leser denken nun sicher alle an das gleiche, namhafte ERP.
Was auf den ersten Blick als unvereinbares Entweder-Oder aussieht, ist aber dasselbe. Immer geht es darum, real existierende Kundenprozesse in Software zu giessen. Für die «Individualisten» ist das völlig klar, ihr Geschäftsmodell baut direkt darauf auf. Doch auch für Standard-Softwarehersteller sollten die Kundenbedürfnisse das Mass aller Dinge sein. Bloss mit dem Unterschied, dass sie sich die Gedanken dazu VOR dem Bau ihres Produktes machen müssen.
Was können – und sollten – die Beiden nun voneinander lernen?
Die «Produkties» täten gut daran, die Zielgruppen für ihre Software enger einzugrenzen und sich mit deren Business so tief auseinanderzusetzen, dass eine zu den Bedürfnissen perfekt passende Lösung entsteht. Das tun zwar viele, aber längstens nicht alle. Die noch grössere Herausforderung besteht für sie nach dem Go-to-Market: Sicherzustellen, dass die Software nicht beginnt, ein Eigenleben zu entwickeln – indem sie sich immer mehr von den Kunden weg hin zu den Ideen der Softwareleute bewegt.
Während die «Individualisten» lernen sollten, nicht jeden Kundenfurz ungeprüft in Software umzusetzen. Auch sie sollten sich für das Kundenbusiness so weit interessieren, dass sie als Softwarespezialisten erkennen, was Sinn macht. Diese Meinung müssen sie gegenüber ihren Kunden auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein vertreten. Nur dann werden sie als Lösungspartner und als «Trusted Advisor» wahrgenommen und auch geschätzt.
Was müssen nun aber die «Unentschiedenen» lernen? Sie sollten sich für die eine, oder andere Seite entscheiden.
Urs Prantl kreiert mit seinem Unternehmen KMU Mentor GmbH zukunftssichere und gesund wachsende IT-Unternehmen und begleitet ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Unternehmensnachfolge und beim Firmenverkauf. Gleichzeitig ist er Host des Podcasts Prantls 5A (kmu-mentor.ch/podcast), in welchem er die Einzigartigkeit erfolgreicher ITUnternehmen direkt mit ihren Inhaberinnen und Inhabern diskutiert.
Siegfried Laibach, Geschäftsführer der VLEXbusiness AG, spricht im Interview über Variantenvielfalt, digitale Ökosysteme und die Kunst, ERP-Projekte mit Mass und Menschlichkeit umzusetzen. Zwischen Smart Factory, KI und Prozesskosten zeigt sich: Wer ERP als Werkzeug versteht, kann Wandel gestalten statt nur verwalten.
Interview: Cyrill Schmid
topsoft Fachredaktion: In welchen Branchen und Szenarien kommt Ihre ERP-Lösung besonders gut zum Einsatz?
Siegfried Laibach: Unsere ERP-Lösung VLEX entfaltet ihre Stärken überall dort, wo Variantenvielfalt auf komplexe Produktions- und Logistikprozesse trifft. Ursprünglich auf Losgrösse 1 fokussiert, hat sich VLEX kontinuierlich weiterentwickelt – hin zu hybriden Szenarien, die Einzel- und Kleinserienfertigung ebenso abdecken wie MTO-, CTO-, ETO- und Grossserienmodelle. Besonders stark ist VLEX dort, wo Intralogistik, Intercompany-Prozesse und mehrstufige Produktion über Standorte und Landesgrenzen hinweg zusammenspielen. Denn es geht nicht nur um Software, sondern um das Zusammenspiel von Prozessen, Daten und Menschen.
«Variante» ist dabei keine Branche, sondern eine Eigenschaft von Produkten – und die begegnet uns in vielen Bereichen: Möbel, Bauelemente, Holz, Elektrotechnik, Nutzfahrzeuge und deren Aufbauten. Auch die Nahrungsmittelbranche ist vor uns nicht «sicher», im Gegenteil: Gerade dort, wo das Eingangsprodukt stark schwankt, etwa in Qualität oder Preis, braucht es eine Lösung, die flexibel und gleichzeitig revisionssicher ist. Unsere Kunden schätzen die «Höhe, Breite und Tiefe» unserer Lösung – und die Leistung unserer Consultants, die diese Komplexität beherrschbar machen.
Was zeichnet Ihre Arbeitsweise und Ihre Kundenbeziehungen aus?
Unsere Kunden sind meist inhabergeführte KMU mit 150 bis 3000 Mitarbeitenden, oft mit mehreren internationalen Standorten. In komplexen Change-Management-Prozessen agieren wir mittelstandsgerecht und auf Augenhöhe. Das klingt vielleicht wie eine Floskel, aber es ist gelebte Praxis. Wir hören oft Sätze wie: «Die Art und Weise, wie Sie das Projekt angehen – das hat uns überzeugt.» Gemeint ist damit nicht nur die Methodik, sondern auch die Haltung: Nähe, Pragmatismus, die Bereitschaft, auch mal spontan zum Hörer zu greifen, statt alles in Tickets zu giessen.
Natürlich braucht es Formalismen, keine Frage. Aber es braucht eben auch den Mut, situativ zu handeln, Dinge zuzulassen, die nicht im Projektplan stehen. Diese Mischung aus Struktur und Spontaneität ist etwas, das unsere Kunden sehr schätzen. Und sie spüren, dass wir nicht nur Software liefern, sondern Verantwortung übernehmen.
Wie sehen Sie die Zukunft der ERP-Systeme?
Die Konsolidierung der ERP-Systeme und der Partnerlandschaft ist längst im Gange – und wir sind gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, dass sich digitale Ökosysteme durchsetzen werden, mit einem stabilen, offenen ERP-Kern, der über Webservices angesprochen werden kann. Die Zukunft liegt nicht im monolithischen System, das alles können will, und auch nicht im übertriebenen Best-of-Breed-Ansatz, bei dem jede Funktion ein eigenes Tool bekommt. Beide Extreme sind zu träge.
Was es braucht, ist ein ERP, das offen genug ist für Integration, aber stabil genug für den Alltag. Und das Ganze muss skalierbar sein – nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch. In diesem Zusammenhang möchte ich der topsoft bzw. schmid + siegenthaler consulting zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren: Ihre Informationskultur trägt dazu bei, die Vielfalt der Möglichkeiten mit Mass und Ziel zu beleuchten – und das mit einem erfreulich neutralen Blick.
Welche technologischen Trends beschäftigen Ihre Kunden aktuell – und was davon ist wirklich relevant?
Greifen wir mal das Thema Smart Factory heraus. Unternehmen brauchen ein klares Zielbild: Was wollen sie erreichen? Geht es um Echtzeit-Rückmeldungen von Maschinen, um Zustandsdaten, um Auswertungen? Meist ist es eine Mischung aus allem. Aber das Interesse allein bringt noch keine Lösung. Es braucht Priorisierung und eine Portionierungsstrategie, die für die Organisation «verdaubar» ist.
KVP ist hier ein zentrales Stichwort. Der Ansatz «Think big, start small» ist nicht nur ein Spruch, sondern eine echte Strategie. Es geht darum, taktische Lösungen zu ermöglichen, die in einen grösseren Kontext passen – und dabei die IT-Architektur so zu gestalten, dass sie nicht zur Komplexitätsfalle wird. Ganz praktische Fragen wie: Was macht das ERP, was das Subsystem? Hier werden Weichen gestellt, die später über Erfolg oder Frust entscheiden.
Und dann das Thema KI: Ein Feld, das viele fasziniert, aber auch überfordert. Die einfache Formel lautet: Je grösser und komplexer die Datenmengen, desto relevanter wird KI. Maschinelles Lernen und Deep Learning können Muster, Korrelationen und Strukturen erkennen – aber nur, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ein entscheidender Unterschied bei KI liegt in der Kommunikation: Man gibt ihr entweder konkrete Anweisungen oder nur wenige, gezielte Impulse – letzteres ermöglicht eine flexible, stetige Weiterentwicklung. Mit unserem KI-Assistenten ChatTERP sind wir auf spannenden Wegen unterwegs – zur Datenanalyse und zur Automatisierung von Aufgaben, die früher viel Zeit gekostet haben.
Was beschäftigt Ihre Kunden im Alltag – also «Brot-undButter-Themen», jenseits der Buzzwords?
(lacht) Ja, das mit «Brot und Butter» ist so eine Sache. Was heute noch Grundnahrungsmittel ist, kann morgen schon ranzig sein – um im Bild zu bleiben. Unternehmen müssen am Ball bleiben und das ist gar nicht so einfach. Die Fragen, die sich unsere Kunden stellen, sind sehr konkret: Welche Innovationen sind für mein Unternehmen sinnvoll? Was brauche ich dafür? Welche Zutaten führen zur Erkenntnis?
Eine gute Kenntnis der eigenen Prozesskosten ist dabei essenziell. Nur so kann ich beurteilen, wo das Geld auf der Strasse liegt – oder wissenschaftlicher formuliert: Wo sind die Kostentreiber, wo die Umsatzbringer? Und dann braucht es einen Kompass, eine Vision: Wo will ich hin? Wie sieht mein Unternehmen morgen aus? Der Eishockeyspieler läuft nicht dahin, wo der Puck liegt, sondern dahin, wo er liegen wird. Und wieder sind wir beim KVP – der Gedanke nach der Einführung ist vor der Einführung.
Welche typischen Fallstricke sehen Sie bei ERP-Einführungen?
Dazu könnte man ein Buch schreiben – aber ich versuche es mit zwei Schlaglichtern aus der Praxis. Ein häufiger Fehler ist, sich in hunderten Business-Process-Templates zu verlieren. Es gibt Anbieter, die das als Transparenz verkaufen – andere nennen es Verwirrung. Stattdessen sollte man sich mit den eigenen Prozessen beschäftigen und sie unter einem einfachen Gesichtspunkt modellieren: Menge × Zeit der Aufgaben, Eintrittswahrscheinlichkeit eines Fehlers, potenzielle Schadenshöhe.
Ein Beispiel aus der Logistik: Unübersichtlichkeit im Lager – wie viele Dimensionen hat das Problem, wie lässt es sich bewältigen, wie viel Systemunterstützung ist nötig? Solche Fragen sind nicht trivial, aber sie lassen sich beantworten – wenn man bereit ist, ehrlich hinzuschauen und nicht nur auf die Oberfläche zu reagieren.
Ein zweites Beispiel aus der Produktion: Wenn Variantenfertigung auf manuelle Arbeitsvorbereitung trifft, entstehen oft Medienbrüche und unnötige Schleifen. Die Frage ist: Wie lassen

Siegfried Laibach, Geschäftsführer der VLEXbusiness AG.
sich Stücklisten, Arbeitspläne und Fertigungsdaten so integrieren, dass der Informationsfluss stabil bleibt – auch bei kurzfristigen Änderungen? Hier entscheidet sich, ob ein ERP-System wirklich mitdenkt oder nur verwaltet.
Wenn Sie einem KMU nur einen einzigen Tipp mitgeben dürften – was wäre das?
Setzen Sie auf das richtige Mindset. Die Einführung eines neuen ERP-Systems ist kein IT-Projekt, sondern ein Veränderungsprozess. Und der steht oder fällt mit den Menschen.
Meine Faustregel: Sie brauchen sieben Mitarbeitende, die sagen «Ja – wenn …», um den Wandel voranzutreiben. Aber sieben, die sagen «Nein – weil …», reichen aus, um ihn zu blockieren. Identifizieren Sie die Erstgenannten frühzeitig, stärken Sie sie, und machen Sie sie zu Verbündeten des Wandels.
Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch VLEXbusiness AG dem ERP-Partner der mittelständischen Fertigungsindustrie. Das Systemhaus bietet Lösungen und Managed Services aus einer Hand. www.vlexplus.com
KI-Funktionen im ERP unterstützen immer stärker bei Routineaufgaben, der Analyse von Geschäftsdaten oder als Chat für Fragen aus dem Tagesgeschäft. Punktuell sind diese KI-Fähigkeiten sehr gut umgesetzt und nützlich, es sind aber auch noch klare Grenzen erkennbar. Ein ehrlicher Blick auf den aktuellen Stand und die nächsten Entwicklungsschritte.
Carlos Bouzo
Direkt auf der ERP-Startseite kann mit dem «Copilot»-Icon der KI-Chat eingeblendet werden. Dies ermöglicht das Fragen nach einer Übersicht der verkaufsstärksten Kunden oder nach dem Ablauf für das Erstellen einer Mahnung. Die KI zitiert dann die Datensätze aus dem System oder listet die nötigen Arbeitsschritte auf.
Dieser KI-Chat in Microsofts ERP befindet sich noch im «Preview»: Der flächendeckende Roll-out steht noch an. Nachvollziehbar, dass der Chat an Kinderkrankheiten leidet: Ab und zu ist er nicht verfügbar und antwortet mit Fehlermeldungen.
Nachfolgend zwei Anwendungsfälle, die gut funktionieren und einen echten Nutzen in der täglichen Arbeit stiften:
Routineaufgaben im Verkauf
Wenn der Verkaufsinnendienst eine Bestellung per E-Mail erhält, kann der E-Mail-Text mit Copy-Paste direkt im ERP eingefügt werden und die KI identifiziert automatisch die im Mail
genannten Artikel und Mengen. Dabei kommt die KI sehr gut mit den Freiform-Formulierungen in den E-Mails klar und wählt die korrekten Artikel und Mengen.
Automatische Datenanalyse-Dashboards
Auf einem dynamischen Daten-Dashboard kann der KI beschrieben werden, was für einen Analysebericht man gerne hätte und bekommt diesen automatisch erstellt. Zusätzliche Datenreihen oder Filtermöglichkeiten können nachgefordert werden und die KI passt den Bericht an.
Wo heute noch Grenzen liegen
Nebst der punktuellen Unzuverlässigkeit des Chats fällt auf: In deutscher Sprache gefragt, antwortet die KI manchmal in Englisch. Zudem ist es aktuell noch nötig, sich eng an den exakten Bezeichnungen von Feldern oder Tabellen im System halten. Ein «Bestellen» kann für die KI ein zu ungenauer Begriff sein.
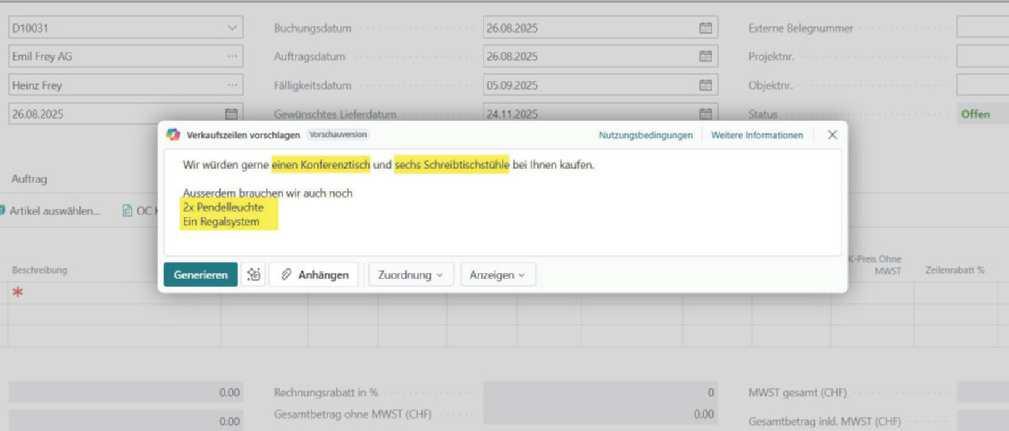
KI schlägt Artikel für Verkaufsauftrag vor. Quelle: redPoint
Vom KI-Hype zur echten Hilfe Digital-Event für Schweizer KMU
27. Januar 2026, 10:30–12:00 Uhr
Künstliche Intelligenz kann Prozesse vereinfachen, Innovationen antreiben und echte Entlastung bringen. In diesem kompakten Digital-Event zeigen führende Fachleute, wie KMU KI sinnvoll und verantwortungs voll einsetzen – praxisnah, verständlich und ohne leere Buzzwords.
Jetzt kostenlos anmelden
https://qrco.de/bgJZZ2

Blick nach vorn: Agents sollen übernehmen
Künftig sollen spezialisierte KI-Agenten ganze Aufgabenberei che übernehmen, etwa das automatische und eigenständige Erstellen von Verkaufsaufträgen. Dabei überwacht der Agent ein E-Mail-Postfach, liest eingehende Bestellungen, legt einen Verkaufsauftrag an und erstellt die Artikelzeilen mit den be stellten Mengen. Dieser Verkaufsagent ist auf Herbst 2025 angekündigt.
Die Herstellerin pusht das Thema stark und die Zahl an KI-Funk tionen im System wächst praktisch wöchentlich. Auch das Marktinteresse wächst in ähnlichem Tempo, wobei KI-Funktio nalitäten noch kein treibender Nachfragefaktor sind.

Carlos Bouzo ist Experte für KI-gestützte ERP-Lösungen mit Microsoft Dynamics 365 BC bei redPoint
Dieser Beitrag wurde ermöglicht von redPoint AG. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Einführung und den Betrieb der Cloud ERP Lösung Microsoft Dynamics 365 Business Central. www.redpoint.swiss
Werden Sie jetzt Mitglied im inspirierendsten KMU-Netzwerk der Schweiz.

Die spannenden, innovativen und erfolgreichen Schweizer KMU verdienen sich eine eigene Fanbasis. Lassen Sie sich von diesen Erfolgsgeschichten inspirieren und seien sie live dabei am Prix SVC in Basel am 13. November 2025. Jetzt SVC Mitglied werden!

Mehr erfahren: Follow us!
Noch vor wenigen Jahren brummten in den Kellern vieler Unternehmen die Server.
Dann kam die Cloud – und mit ihr die Idee, Daten extern zu hosten. Heute gehen KMU einen Schritt weiter: Sie beziehen ihre Business-Software direkt als Service. Willkommen im SaaS-Zeitalter.
Alain Zanolari
Von der Cloud zur Dienstleistung
Die Cloud ist inzwischen fast so alltäglich wie die bargeldlose Bezahlung im Café. Doch Software as a Service (Saas) geht weiter: Hier wird nicht nur Speicherplatz ausgelagert, sondern gleich die ganze Anwendung. Unternehmen zahlen eine nutzungsbasierte Gebühr, oft monatlich oder jährlich, und erhalten dafür eine stets aktuelle, wartungsfreie Softwarelösung direkt aus dem Browser.
Vorteile, die KMU wirklich weiterbringen
Die Vorteile von SaaS sind vielfältig. Hier eine kleine, nicht vollständige Aufzählung:
• Kosteneffizienz: Keine teuren Lizenzen, keine Installationen, keine Wartung. Bezahlt wird nur, was genutzt wird – und das lässt sich jederzeit anpassen oder kündigen.
Flexibilität: SaaS skaliert mit dem Unternehmen. Neue Funktionen, mehr Nutzer, andere Module? Kein Problem.
• Einfachheit: Die Software ist sofort einsatzbereit, Updates laufen automatisch und die IT muss sich nicht um Infrastruktur kümmern.
• Mobilität: Arbeiten von überall, ob im Büro, im Zug oder im Homeoffice.
Aber auch SaaS hat seine Schattenseiten
Wie alle Technologien bietet auch SaaS nicht nur Vorteile. Hier sind einige der möglichen Nachteile:
• Abhängigkeit: Ohne Internet kein Zugriff. Und wenn der Anbieter wankt, wankt auch das eigene System.
• Datenschutz: Die Daten liegen auf fremden Servern –das verlangt Vertrauen und klare Abmachungen.
• Kompatibilität: Nicht jede SaaS-Lösung spricht dieselbe Sprache wie bestehende Systeme. Schnittstellen müssen geprüft und ggf. individuell angepasst werden.
Auf ein oft gehörtes Vorurteil zum Thema SaaS gehen wir im nächsten Abschnitt detaillierter ein:
Sicherheit: Mehr als nur ein Serverstandort
Für viele KMUs ist insbesondere die Frage der Datensicherheit zentral und oft mit Skepsis gegenüber SaaS verbunden. Besonders in regulierten Branchen gelten strenge Vorgaben, etwa
zum Hosting auf eigenen Servern. Doch auch jenseits gesetzlicher Verpflichtungen bleibt das Gefühl: «Unsere wertvollen Daten gehören nicht in irgendeine Cloud.»
Dabei gilt: Moderne SaaS-Anbieter investieren massiv in Sicherheit, oft weit mehr, als ein KMU intern leisten könnte.
Dazu gehören:
• Zertifizierte Rechenzentren mit physischer und digitaler Zugangskontrolle
• Verschlüsselung auf Transport- und Speicherebene
• Redundanz und Backup-Strategien, die Ausfälle minimieren
• Regelmässige Penetrationstests und Audits
• Transparente Datenstandorte, oft mit Wahlmöglichkeiten für Schweizer oder EU-Hosting
Gerade für KMUs kann das bedeuten: Mehr Sicherheit als im eigenen Keller, ohne den Aufwand und die Kosten einer eigenen Infrastruktur. Entscheidend ist, die richtigen Anbieter zu wählen sowie die eigenen Anforderungen klar zu definieren.
SaaS in der Schweiz – wohin geht die Reise?
SaaS für Schweizer KMU zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Cloudlösungen entlasten die IT, modernisieren Prozesse und schaffen Raum für Innovation – oft sogar mit KI-Unterstützung. Die Anbieterlandschaft wächst, und auch branchenspezifische Lösungen sind längst verfügbar.
Die Richtung ist klar: Software wird zur Dienstleistung. Und während sich die digitale Landschaft weiterentwickelt – etwa von SaaS zu Agentic AI – zeigt sich: Wer digitale Modelle früh versteht, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen ausgewiesene SaaSSpezialisten vor. Sind Sie etwas überfordert mit dem schieren Angebot an möglicher Software für Ihr Unternehmen? Gerne helfen Ihnen die unabhängigen Consultants des topsoft Consulting-Netzwerks, die passende IT-Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

SaaS-Marktübersicht auf topsoft.ch
Mehr als 50 Lösungen online –mit Filterfunktion für Ihre Auswahl mit System. tinyurl.com/tsm-25-3-SaaS

redPoint AG
Chollerstrasse 32
6300 Zug
T +41 41 545 60 60
www.redPoint.swiss verkauf@redPoint.swiss
redPoint bietet Ihnen eine flexible, standardisierte und bedienerfreundliche ERP Software zur Digitalisierung Ihres Unternehmens. Die ERP Lösung entspricht den Anforderungen von Schweizer KMU – von der kleinen, jungen Firma welche eine hohe Standardisierung sucht, bis zum grossen KMU, welches unterschiedliche digitale Tools einsetzen will. Unsere Branchenlösung für Handel, Projektgeschäft & Dienstleister, Service & Unterhalt und Produktion & Fertigung bringen unseren Kunden echten Mehrwert.
In unseren erfolgreichen ERP Projekten steckt Erfahrung und Engagement –seit über 30 Jahren.
Wir kombinieren das Beste der weltweit eingesetzten Microsoft Unternehmens-Software Dynamics 365 Business Central (NAV / Navision) mit unserer Best Practice für unsere Kunden. Dank unseren profunden Branchen-Kenntnissen arbeiten Sie mit uns auf Augenhöhe.
redPoint – ERP auf den Punkt gebracht!
Haufe X360 – die moderne Cloud-ERP-Lösung für Schweizer KMU
Produkte / Kompetenzen
redPoint Branchenlösung für den Handel
redPoint Branchenlösung für Produktion & Fertigung
redPoint Branchenlösung für Projektgeschäft & Dienstleister redPoint Branchenlösung für Service & Unterhalt
Microsoft Dynamics 365 Business Central Microsoft Dynamics NAV
Kontaktperson
Michael Bechen
Haufe X360
c/o 2p team GmbH
Baarerstrasse 52
6300 Zug
T +41 79 638 42 31 www.haufe-x360.ch/ info@2pteam.ch
Haufe X360 ist die innovative Business-Management-Plattform von Haufe und bietet Schweizer KMU eine voll integrierte, modulare Cloud-ERPLösung. Die Software deckt Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Projektmanagement, CRM und viele weitere Geschäftsprozesse ab – flexibel, skalierbar und 100 % webbasiert. Mit ihrem API-first-Ansatz lässt sich Haufe X360 nahtlos in bestehende Systeme integrieren und unterstützt Unternehmen optimal bei der Digitalisierung. Besonderheiten des Schweizer Marktes, wie lokale Buchhaltungsanforderungen, werden direkt berücksichtigt. Haufe setzt dabei auf ein Partnernetzwerk in der Schweiz: Vertrieb, Implementierung und Support erfolgen durch qualifizierte Schweizer IT-Dienstleister –ohne Wettbewerb durch den Hersteller.

VLEXbusiness AG
Werftestrasse 4
6005 Luzern
T +41 41 921 99 49 www.vlexplus.com info@vlexplus.com
VLEX ist Ihr verlässlicher Partner für die digitale Transformation und Automatisierung in der mittelständischen Fertigungsindustrie. Als Teil der VLEXgroup werden an fünf Standorten umfassende Strategie- und Prozessberatung, hochwertige Hardware, integrierte Lösungen und erstklassige Managed Services angeboten.
Das Herzstück ist die cloud-fähige ERP-Software VlexPlus, die als zentrale Daten- und Prozessdrehscheibe sämtliche Abläufe in Ihrer Wertschöpfungskette bis zum Shopfloor abbildet.
Mit Branchenerweiterungen, massgeschneiderten Apps, nahtlosen E-Commerce- und Cloud-Anbindungen sowie der Integration von smarten Workflow-Technologien wie IoT, KI, Sensorik und Robotik schafft VLEX für Sie Transparenz, Effizienz und den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung in der kundenauftragsorientierten Fertigung.

KLARA Business AG
KLARA.ch
Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe
6003 Luzern
T +41 41 329 07 00 www.klara.ch info@klara.ch
KLARA, die «All-in-One» KMU Software
Die führende Schweizer Software für KMU, Selbständige und Vereine bietet dir alle digitalen Anwendungen, die du für deinen Alltag benötigst, in einem System.
Die modulare Struktur ermöglicht es dir, jederzeit einzelne Funktionsmodule (sogenannte «Widgets») nach deinen Bedürfnissen zu aktivieren.
Ob Buchhaltung, Kundenverwaltung, Lohnwesen, Kassensystem oder Online-Shop – alle diese und weitere verfügbaren Module sind perfekt miteinander synchronisiert, um deinen Geschäftsalltag zu erleichtern.
Produkte / Kompetenzen
Haufe X360, modernes Cloud-ERP für mittlere Firmen.
Webbasierte Business-Plattform flexibel & skalierbar
Module: Finanzen, CRM, Projekt und Warenwirtschaft integriert API-first: einfache Anbindung an best. IT-Lösungen möglich. Schweizer Besonderheiten sind im System berücksichtigt. Lokaler Vertrieb & Support ohne Herstellerkonkurrenz
Kontaktperson
Rudolf Schuler
Produkte / Kompetenzen
Mit VlexPlus erhalten mittelständische Unternehmen wie Kleinserien-, Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger eine ERP-Komplettlösung der neuesten Generation. Die Software-lösung ist branchenneutral, flexibel, plattformunabhängig und mobilefähig.
Kontaktperson
Siegfried Laibach
Produkte / Kompetenzen
- KLARA Buchhaltung
- KLARA Lohn
- KLARA Kundenverwaltung
- KLARA Auftrags- & Artikelverw.
- KLARA Projekt
- KLARA Time
- KLARA Budget
- KLARA Kasse
- KLARA Online Shop
- KLARA Inventar
- KLARA Online Terminbuchung
- KLARA Online Präsenz
Kontakt
Leander Gabathuler
Produkt
Anbieter
aBusiness Suite Langmeier Software™
axelor ERP Xippo GmbH
blue office® blue office ag
bossERP bossinfo.ch AG
BX:COCKPIT - für Verbände und Vereine Batix Schweiz AG
Capelo ERP SYZ AG Informatik
Digital Core SAP S/4 HANA All for One Switzerland AG
DOMUS - für die Bau- und Baunebenbranche Optiwork AG
ERP Software für Anlagenbau Logico Solutions AG
ERPNext libracore AG
Exxas Exxas AG
IFS Cloud FLEXiCODE Schweiz AG
ingo365: für Ingenieur- & Architekturbüros newvision
iOffice WMC IT Solutions AG
KLARA Business Paket KLARA Business Software
libracore Business
Software libracore AG
LOXY LOXY International AG
m2 solution m2 software GmbH
Microsoft Dynamics 365 Business Central redPoint AG
Microsoft Dynamics 365 Business Central KUMAVISION AG (Schweiz)
Microsoft Dynamics 365 Business Central xalution GmbH
Myfactory Forterro Schweiz AG
Odoo acunomic:erp
OpenBiz Clixmedia GmbH
Orphy Orphis AG
PLEAN für Dienstleister Consultinform AG
reybex Cloud native ERP onboos gmbh
SAP S/4HANA All for One Switzerland AG
Swiss21 Swiss21.org AG
SYZInTime SYZ AG Informatik
tricoma Maneta tricoma AG
tryton.cloud iHilfe Powersolutions GmbH
Uniconta UPS Consulting
VlexPlus 6.3 VLEXbusiness AG
VOLTA Karakun AG
weclapp Cloud ERP Handel weclapp GmbH
Winoffice PRIME - ERP Winoffice AG
Xentral ERP onboos gmbh
XfleX Business Software XfleX Software AG

Auf topsoft.ch finden Sie weitere Beiträge und interessante
Webinar-Replays


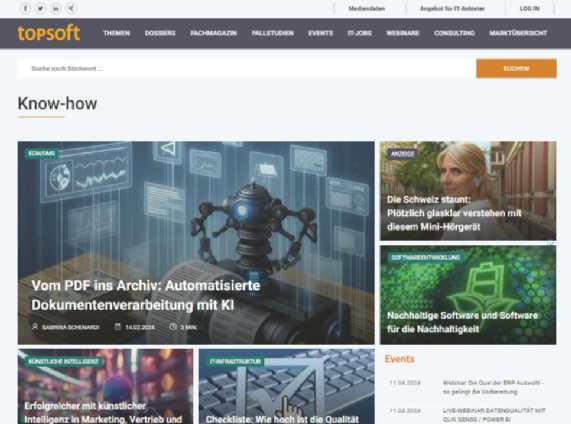


Wenn KI-Agenten beginnen, die Software zu nutzen, zählt nicht mehr die Anzahl der User, sondern das Ergebnis. Das verändert die ökonomische Logik von SaaS grundlegend, sowohl für IT-Anbieter als auch für die Kunden.
Dr. Jürgen Müller
In den letzten zwei Jahrzehnten beruhte das Geschäftsmodell von Software-as-a-Service weitgehend auf nur einem Preismodell: der Abrechnung pro Nutzer oder «per seat». Das funktioniert gut, solange Software hauptsächlich von Menschen benutzt wird. Doch durch den Aufstieg agentischer KI-Systeme verliert das Argument «mehr Nutzer gleich mehr Wert» erheblich an Schlagkraft.
KI-Agenten ersetzen zunehmend menschliche Interaktion mit der Software. Wir treten ein in das Zeitalter von Agentic SaaS (ASaaS). Dabei geht es nicht mehr um Nutzung, sondern um Zielerreichung und Ergebnisse. Die ökonomische Logik erfordert daher eine Neuausrichtung der Preisgestaltung und des Wertversprechens. Aber nicht nur die Benutzerrolle verändert sich grundlegend.
Warum das nutzerbasierte Modell nicht mehr funktioniert
Der sich abzeichnende Abschied vom Pro-Nutzer-Modell hat zwei wesentliche Gründe:
Menschen sind nicht mehr die Hauptakteure Im ASaaS-Modell werden Menschen von aktiven Nutzern zu «passiven» Zielvorgebern. Statt in einem ERP-System Buttons zu klicken oder Daten einzugeben, formulieren sie in natürlicher Sprache (conversational AI) die Ziele. So kann z. B. eine Eingabe lauten: «Erstelle eine Cash-Flow Projektion für das nächste Quartal unter Berücksichtigung der letzten zwei Jahre und der geplanten Ausgaben für den Launch unseres neuen Produktes». Die KI-Agenten übernehmen die Interaktion mit der Software und den verfügbaren Datenquellen. Der Kunde dürfte somit kaum noch bereit sein, den gleichen Preis wie für die Zugangsberechtigung von z. B. bisher 100 SaaS-Nutzern zu zahlen, wenn drei Agenten deren Job erledigen. Obwohl der ASaaS-Anbieter ihm einen enormen Effizienzgewinn und eine deutliche bessere User Experience liefert.
• Die Kostenstruktur ist eine andere Agenten arbeiten rund um die Uhr, ohne Ermüdung, weltweit gleichzeitig, zukünftig wahrscheinlich auch herstellerunabhängig vernetzt und skalieren in Sekunden. Diesen Prozes-
sen liegt eine andere Kostenstruktur zugrunde: laufende Trainingskosten und die Anpassung von Modellen sowie GPU/TPU-Zeit, hoher Energieverbrauch durch die ständige Verarbeitung grosser Datenmengen, skalierbare Cloud-Ressourcen etc. Laut OpenAI kostet GPT4 Turbo 0,01 bis 0,03 US-Dollar pro 1000 Tokens (sog. Inference Cost, Stand Juli 2025). Beim Einsatz mehrerer Agenten, etwa in Verbindung mit solchen, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, können sich diese Kosten sehr schnell aufschaukeln. KI-Systeme sind daher kostenintensiver in Betrieb und Wartung als statische SaaS-Lösungen. Das User-Modell bildet diese Kostenstruktur nicht ab und kann für ASaaS-Hersteller grosse finanzielle Risiken bergen.
Vor diesem Hintergrund experimentieren Anbieter mit neuen Preisansätzen, die besser zu ASaaS passen. Der Begriff «experimentieren» ist hier bewusst gewählt, da Vieles noch in der Findung ist.
• Ergebnisbasierte Preisgestaltung (Value-as-a-Service): Die Preise orientieren sich an konkreten Ergebnissen – etwa pro erstelltes Dokument, pro qualifiziertes Lead oder als Prozentsatz erzielter Einsparungen. Auch eine Umsatzbeteiligung ist in manchen Bereichen denkbar. Der Software-Provider erhält einen Anteil am generierten Mehrwert. Besonders attraktiv ist dies in performance-orientierten Branchen wie E-Commerce oder Marketing mit klarem ROI.
Beispiele:
Kundensupport: Preis pro gelöstes Ticket oder Gespräch. Marketing: Preis basierend auf der Conversion Rate oder Lead-Generierung. Produktivitätstools: Preis gemessen an eingesparten Stunden.
Dieses Modell bringt Preis und Wert besser in Einklang, erhöht aber deutlich die Komplexität in der Ergebnisdefinition, der Attribution und des Trackings. Varianten des Value-as-a-Service Preismodells finden sich u.a. bei Salesforce, ZenDesk, Intercom (Kundendienst) oder ChargeFlow (eCommerce).
Daneben existieren unterschiedliche Verbrauchsmodelle:
• Agenten-Lizenzen
Statt für jeden menschlichen Nutzer eine Lizenz zu kaufen, zahlen Kunden hier für die Anzahl der KI-Agenten, die gleichzeitig oder parallel aktiv sein können.
Beispiel:
Ein solches Preismodell findet sich bei Genesys, einem Anbieter von Call Center und Customer Experience Lösungen. Das Unternehmen bietet neben anderen Preismodellen dem Kunden «Concurrent Bots» an. Je mehr parallele Konversationen ein Unternehmen über Bots führen möchte, desto mehr Kapazität (sprich: Lizenzen für virtuelle Agenten) muss es erwerben.
Task Credits
Der Kunde zahlt für die von den Agenten erfolgreich erledigten Aufgaben.
Beispiel:
OpenAI bietet über seine API verschiedene KI-Modelle an –darunter GPT-5 und spezialisierte Varianten wie GPT-5 mini und nano. Auch Bildgenerierung mit DALL·E ist weiterhin möglich. Die Abrechnung erfolgt typischerweise nach verbrauchten Tokens oder erledigten Aufgaben. Kunden zahlen für jede erledigte Aufgabe (z. B. Text generieren, Bild erstellen, Sprache transkribieren), was dem Modell der Task Credits entspricht.
• Hybride Modelle
Sie bestehen aus einer Mischung aus Grundgebühr und nutzungsbasierten Komponenten. Das kann etwa ein Basistarif für den Zugang sein, kombiniert mit verbrauchsabhängigen Kosten für höherwertige, KI-gestützte Funktionen. Zusätzliche Leistungen rechtfertigen in diesen Fällen einen Premiumpreis. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen planbarem Umsatz für Anbieter und wertbasierten Kosten für Kunden zu finden.
Beispiel:
SAP SuccessFactors bietet zusätzlich zu seinen HR Basisfunktionen KI-Komponenten, die mehr Rechenleistung oder spezielle Datenverarbeitung erfordern und daher kostenpflichtig sind. Das sind etwa tiefgehende prädiktive Analysen für Personalfluktuation oder hochautomatisierte BewerberScreenings durch Bots.
Konsequenzen für Softwareanbieter und Endkunden
Die Integration von KI in SaaS-Anwendungen bedeutet nicht nur eine Funktionsergänzung, sondern eine tiefgreifende Veränderung von Geschäftsmodellen, die sowohl Kunden wie ISVs betrifft. Messbare Wertschöpfung statt blosser Nutzung ist ihre Grundlage.
Das impliziert zum einen, dass sowohl Anbieter wie auch Kunden in der Lage sind, Ergebnisse zweifelsfrei nachzuvollziehen, zu quantifizieren und der Software zuzuschreiben (Attributionsfähigkeit). Produktdesign und Analytics müssen auf diese neuen Metriken ausgerichtet werden. Niemand möchte sich mit seinem Kunden bzw. Lieferanten um jede Rechnung streiten, weil im Lizenzvertrag die Definition von «Erfolg» unklar ist oder Ergebnisse nicht messbar sind. Empfehlenswert ist es, bei der Festlegung dem «KISS-Prinzip» zu folgen: Keep it simple, stupid». Zum anderen kann sich dadurch das Geschäftsrisiko deutlich in Richtung Anbieter verschieben, während fehlende Wertschöpfung bei «per user»-Modellen zumindest kurzfristig eher das Problem des Kunden ist.
Softwareanbieter müssen sich also tiefer mit den Geschäftsprozessen ihrer Kunden auseinandersetzen und robuste Analysefähigkeiten im Hinblick auf Ergebnisse entwickeln. Dadurch werden sie zum Partner des Kunden und direkter Teilhaber an dessen Geschäftsrisiko.
Dr. Jürgen Müller ist Partner bei Go Europe Consulting und hat mehr als 35 Jahre in verantwortungsvollen Positionen in der IT in Europa und den USA gearbeitet. www.linkedin.com/in/mueller-juergen
Wenn Software Ihr Business neu erfindet
Wie verändern KI-Agenten schon jetzt Geschäftsprozesse? Im Webinar mit dem Autor sowie Experten von Google Cloud und Relanto erfahren Sie es –praxisnah und konkret.

Sie können:
• Die Zusammenfassung davon lesen,
• das kostenlose Webinar Replay anschauen oder
• die kurzweilige KI-Quintessenz als Podcast anhören: www.tinyurl.com/tsm-24-3-agentic-ai
und wie Sie es besser machen können
KI-Projekte scheitern meist nicht an der Technik, sondern an fehlender strategischer Führung und mangelnder Einbindung der Mitarbeitenden. Warum HR von Anfang an Teil der Lösung sein muss und wie Führungskräfte echte Transformation gestalten –statt Technologie zu verwalten.
Nancy Wayland und Magdalena Orascanin
KMU stehen unter Druck, digitale Transformation schnell und effizient umzusetzen. Ganz besonders durch den Einsatz von KISystemen. Doch oft scheitern diese Projekte – nicht an der Technik, sondern an fehlender strategischer Führung und unzureichender Einbindung der Mitarbeitenden.
Als Nancy Wayland angefragt wurde, einen Beitrag über Digitale Transformation, KI und Wandel zu schreiben, war ihre Antwort klar: Ja – aber nur zusammen mit Magdalena Orascanin. Denn wenn wir über Transformation sprechen, dann nicht theoretisch – sondern praktisch. Und «praktisch» bedeutet in unserer Erfahrung: Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Was uns dabei antreibt, ist die Verbindung zweier Perspektiven: Erfahrung mit der Steuerung digitaler Transformation aus Geschäftsführungssicht und fundierte KI-Fachexpertise aus dem Bereich HR. Denn es gibt genug allgemeine Ratschläge, wie man theoretisch vorgehen sollte – wir wollen zeigen, wie es wirklich funktionieren kann.
Viele starten mit der Technik – und bleiben dort stecken
KI ist längst in der Praxis angekommen – zumindest auf dem Papier. Viele Unternehmen investieren beträchtliche Summen, einige implementieren neue Systeme, doch nur wenige verändern tatsächlich etwas Substanzielles. Woran liegt das?
Unsere Erfahrung zeigt: Der Impuls ist oft richtig und der Druck durchaus vorhanden. Aber, der Blick bleibt zu eng gefasst. Digitale Transformation wird häufig als Projekt behandelt, das mit definierten Tools, einem straffen Zeitplan und einem festen Budget «über die Bühne» gebracht werden muss. Dabei übersehen viele, dass es sich vor allem um einen tiefgreifenden Eingriff in bestehende Arbeitsweisen, etablierte Entscheidungswege und gewachsene Rollenverständnisse handelt.
Genau dieser Aspekt wird selten von Anfang an systematisch mitgedacht. Nancy erlebt das regelmässig in Gesprächen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, die schnell handeln wollen, bevor sie vollständig verstanden haben, was dieses Handeln von ihrer Organisation verlangt. Magdalena begegnet ähnlichen Herausforderungen in HR-Teams, die plötzlich KI-Lösungen «ausrollen» sollen, ohne dass vorher grundlegend geklärt wurde, wie und wofür diese Technologien tatsächlich gebraucht werden.
Was unterscheidet Projekte, die Wirkung entfalten?
In unserer Arbeit beobachten wir viele Projekte, die scheitern –aber auch einige, die bemerkenswert gut funktionieren. Die Unterschiede sind fast immer dieselben und lassen sich auf wenige zentrale Faktoren zurückführen.
• Erfolgreiche Projekte beginnen mit einem klaren beschriebenen, konkreten Problem, das gelöst werden soll.
• Die Verantwortung ist eindeutig geklärt und liegt dort, wo strategische Entscheidungen getroffen werden.
• HR wird frühzeitig eingebunden – nicht erst dann, wenn es um Change-Kommunikation oder die Bewältigung von Widerständen geht.
• Die betroffenen Mitarbeitenden werden nicht als passive Zielgruppe betrachtet, sondern als aktive Beteiligte am Wandel verstanden.
Am wichtigsten aber ist: Am Anfang steht kein Tool oder eine bestimmte Technologie. Vielmehr beginnt alles mit einer ehrlichen Auseinandersetzung mit dem, was im Unternehmen gerade nicht optimal funktioniert – oder bald nicht mehr funktionieren wird.
Bevor also Budgets freigegeben und Projekte gestartet werden, lohnt es sich deshalb, drei grundlegende Fragen zu klären:
1. Welches konkrete Problem wollen wir lösen? Es geht nicht darum, allgemein zu «digitalisieren» oder «automatisieren», sondern spezifische Herausforderungen anzugehen: Bewerbungen gehen verloren, die Einarbeitung dauert zu lange, Entscheidungsprozesse sind zu langsam oder wichtige Kundeninformationen sind nicht verfügbar.
2. Wo entsteht ein klarer Mehrwert – und für wen? Der Nutzen sollte nicht abstrakt bleiben, sondern im täglichen Arbeitsalltag spürbar werden. Wird etwas schneller, einfacher oder verlässlicher? Profitieren davon Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende oder ganze Teams?
3. Wie stellen wir sicher, dass das, was wir einführen, auch langfristig funktioniert? Dazu braucht es klare Verantwortlichkeiten, qualitativ hochwertige Daten, ausreichend Zeit für Qualifizierung und vor allem jemanden, der kontinuierlich hinschaut, wenn es zu Problemen kommt.

Digitale Transformation braucht klare Ziele, gute Daten – und Menschen, die mitgestalten.
Und wenn dies Fragen beantwortet sind, hilft für die nächsten Schritte diese erstaunlich einfache Checkliste:
Checkliste 1: Erfolgsfaktoren digitaler Transformation
• Klare Zielsetzung: Ist das Ziel verständlich und nachvollziehbar formuliert? Gibt es eine überzeugende Story?
• Definierte Verantwortlichkeiten: Gibt es klare Zuständigkeiten – auch für den Umgang mit Fehlern?
• Datenqualität: Sind die vorhandenen Daten ausreichend und verwendbar?
• Partizipation: Werden die betroffenen Mitarbeitenden aktiv einbezogen?
Ethische Richtlinien: Gibt es einen durchdachten Plan für Bias, Fairness und Datenschutz?
• Nachbetreuung: Ist die kontinuierliche Betreuung und Pflege der Systeme auch nach dem Go-Live gesichert?
• Erfolgsmessung: Werden Wirkung und Erfolg anhand klar definierter Kriterien messbar gemacht?
HR als Treiber der digitalen Transformation
HR ist der beste Gradmesser für digitale Reife: Hier zeigt sich, wie Technologie, Prozesse und Menschen zusammenspielen. So verändert KI gerade grundlegend, wie Talente gefunden, entwickelt und gehalten werden. Laut WEF sehen 81 % der Unternehmen Upskilling und Weiterbildung als Schlüssel für erfolgreiche Transformation – noch vor Gehalt und Benefits!
HR-Abteilungen sehen zudem oft deutlich früher als andere Bereiche, wo Prozesse nicht richtig greifen, wo Rollen unklar definiert sind oder wo bestimmte Aufgaben Teams überlasten. Sie spüren auch, wenn Mitarbeitende überfordert sind oder
innerlich längst begonnen haben auszusteigen. Gleichzeitig liegt hier das grösste Gestaltungspotenzial: Wenn HR von Anfang an strategisch mitarbeitet, kann Wandel realitätsnah, konkret und nachhaltig gestaltet werden.
Ein international tätiges Unternehmen mit 1200 Mitarbeitenden führte KI-gestützte Onboarding-Workflows ein. Ziel: Neue Mitarbeitende schneller integrieren und gleichzeitig die HR-Teams entlasten. Der Erfolg beruhte auf drei Faktoren:
Personalisierte Journeys: Die KI stellte individuelle Onboarding-Pläne bereit – abgestimmt auf Rolle, Standort und Vorerfahrungen.
• Automatisierung von Standardaufgaben: Vertrags- und Dokumentenprozesse, IT-Zugänge und Schulungsbuchungen wurden automatisiert.
• Fokus auf den Menschen: Die KI entlastete das HR-Team von administrativen Aufgaben, sodass mehr Raum für persönliche Begleitung entstand.
Das Ergebnis: 40 % schnellere Onboarding-Zeiten, höhere Zufriedenheit bei neuen Mitarbeitenden und weniger manuelle Fehler.
Damit es zu solchen Erfolgen kommen kann, muss verstanden werden, dass ein entscheidendes Element für nachhaltige Transformation bei den Mitarbeitenden selbst liegt. In vielen Diskussionen rund um KI und Automatisierung stehen Effizienz, Skalierbarkeit und Kostensenkung im Zentrum. Doch oft wird vergessen, wer die neuen Systeme im Alltag nutzen und den Wandel tatsächlich gestalten soll. Laut World Economic Forum werden bis 2027 fast 50 Prozent aller Mitarbeitenden neue Kompetenzen benötigen – eine Entwicklung, die Unternehmen zu aktiver Begleitung dieser Entwicklung verpflichtet. →
Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Gruppen, die bei Transformationsprojekten häufig übersehen werden: Menschen ohne ausgeprägten Digitalhintergrund, Teilzeitkräfte, ältere Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeitende in Schnittstellenrollen. Sie sind keine «schwierigen Fälle», sondern das Fundament der Organisation. Wer diese Menschen gezielt einbindet, Wissen stärkt und Barrieren abbaut, schafft kulturelle Stabilität und sorgt dafür, dass Fortschritt auch tatsächlich wirkt.
Checkliste 2: KI sinnvoll in HR-Prozesse integrieren
• Konkrete Anwendungsfälle: Gibt es spezifische Use Cases mit erkennbarem, messbarem Nutzen (Onboarding, Learning, People Analytics)
• Passende Tools: Sind die gewählten Technologien praxistauglich und zur Organisationskultur und Datenlage passend?
• AI Literacy als Grundlage für Aktzeptanz: Wurde ein durchdachtes Qualifizierungskonzept entwickelt, das verschiedene Zielgruppen berücksichtigt?
Rechtliche Klarheit: Sind alle relevanten Rahmenbedingungen geklärt (DSGVO, EU AI Act, interne Richtlinien)? Und die Verantwortlichkeiten geklärt?
• Fairness-Prinzipien: Gibt es einen bewussten, strukturierten Umgang mit Bias und Diskriminierungsrisiken? Daten geprüft, Standards definiert?
• Transparente Kommunikation: Werden Mitarbeitende (auch Kandidierende) kontinuierlich informiert, gehört und aktiv einbezogen?
Iteratives Vorgehen: Sind Projekte so konzipiert, dass Anpassungen und Verbesserungen möglich sind? Klein starten, verbessern, skalieren.
Digitale Transformation ist kein Technik-Projekt – sondern ein Führungsprojekt. Tools sind dabei nur so stark, wie die Strategie, die sie trägt. Wer Wirkung will, braucht Mut zur Veränderung, klare Ziele, eine überzeugende Story und gezielt Qualifizierung. Die Zukunft gehört nicht den Unternehmen, die am schnellsten KI-Lösungen kaufen.
Nancy Wayland war selbst CEO und hat die Königsdisziplin der Kulturtransformation gemeistert. Heute bringt sie ihre Erfahrung als Mehrfach-Verwaltungsrätin und Startup-Gründerin gezielt ein, um CEOs und Geschäftsführende dabei zu begleiten, ihre Führungsrolle strategisch und wirksam zu gestalten. Sie arbeitet ausschliesslich mit Führungskräften auf C-Level, die echten Impact wollen.
Magdalena Orascanin ist KI-Strategin, Trainerin und Expertin für die Integration von Künstlicher Intelligenz in HR-Prozesse. Mit über 13 Jahren Erfahrung in internationalen HR-Leadership-Rollen unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre HR-Teams fit für die digitale Zukunft zu machen – praxisnah, ethisch und wirksam.
Publikation in Zusammenarbeit mit: SWONET – Swiss Women Network www.swonet.ch

Du führst ein IT-Unternehmen –ich helfe dir dabei, deinen Vertrieb aufzustellen, Prozesse zu optimieren und gezielt die richtigen Kunden zu gewinnen.
Gemeinsam entwickeln wir eine klare Akquise- und Verkaufsstrategie, optimieren deine Sales-Prozesse und trainieren dich und dein Team systematisch.
Damit gewinnst du planbar mehr Kunden, verkürzt deine Verkaufszyklen und steigerst nachhaltig deinen Umsatz – mit weniger Aufwand. www.norbertherzog.ch

Tel/Whatsapp +41 77 442 68 22

In der heutigen digitalen Unternehmenswelt sind Daten allgegenwärtig – verborgen in Systemen, Prozessen und Transaktionen. Doch daraus nutzbare Erkenntnisse abzuleiten, insbesondere zur Verbesserung der operativen Effizienz, bleibt eine Herausforderung. Genau hier setzt Process Mining an: Es macht sichtbar, wie Arbeit tatsächlich abläuft – nicht nur, wie sie gedacht ist.
Was ist Process Mining?
Process Mining ist eine datengestützte Analysemethode, die reale Prozessabläufe aus Systemprotokollen (sogenannten Event Logs) rekonstruiert. So lassen sich Prozessvarianten, Engpässe, Schleifen und Wiederholungen erkennen – datenbasiert und objektiv. Es ersetzt Annahmen und Interviews durch Fakten und erzeugt ein visuelles Abbild des tatsächlichen Prozessflusses –vergleichbar mit einem Röntgenbild Ihrer Geschäftsprozesse.
Geschwindigkeit zählt: Event Logs als Entscheidungsgrundlage
Gerade in dynamischen Branchen wie Pharma, Finanzen, Logistik oder E-Commerce ist es entscheidend, Prozesse in Echtzeit zu verstehen und zu steuern. Beispielsweise kann das frühzeitige Erkennen eines Produktionsengpasses oder eines fehleranfälligen Arbeitsschritts direkte Auswirkungen auf Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit haben.
Die Grundlage für diese Erkenntnisse ist ein strukturiertes Event Log – automatisiert, skalierbar und zeitnah verfügbar. Nur so lassen sich Abweichungen frühzeitig erkennen und gezielte Massnahmen einleiten.
Process Mining: Vom Datenblick zur Prozessverbesserung
Sobald das Event Log bereitsteht, kommt zum Beispiel Microsoft Power Automate Process Mining ins Spiel. Diese Plattform ermöglicht es, Prozessdaten in visuelle und steuerbare Erkenntnisse umzuwandeln – mit folgenden Funktionen:
Interaktive Visualisierung von Prozessvarianten und -abweichungen
• Analyse von Schleifen, Wiederholungen, Durchlaufzeiten und Engpässen
• Simulation von Optimierungen und Vorhersage von Prozessergebnissen
• Integration in das Microsoft-Ökosystem zur direkten Prozessautomatisierung
Warum MS Power Automate Process Mining?
Es ist kosteneffizient, integriert sich nahtlos in Microsoft-Produkte wie Power BI und Power Automate und eignet sich ideal für Unternehmen, die bereits auf Microsoft setzen. Damit gelingt eine durchgängige Analyse und Automatisierung ohne Toolbruch.
Eine Demo – von der Analyse zur Aktion
In einer beispielhaften Demo auf Basis realer Kundenmuster analysierten wir über 1500 simulierte Prozessfälle. Die Ergebnisse:
• 5 % der Fälle wiesen Schleifen auf, bei denen Prozessschritte unnötig wiederholt wurden
• 23 % der Fälle enthielten Rework, d. h. Korrekturschritte aufgrund vorheriger Fehler
Diese Befunde sind typische Hinweise auf Reibungsverluste –oft versteckt in komplexen Workflows. Ihre Identifikation ist der erste Schritt hin zu Automatisierung, Effizienzsteigerung und Prozessqualität.
Process Mining mit BI und Data Science kombinieren
Process Mining ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse faktenbasiert zu analysieren und zu optimieren – nicht anhand von Annahmen, sondern durch echte Systemdaten.
In Kombination mit Business Intelligence (BI) und Data Science entsteht daraus ein wirkungsvolles Gesamtbild: Während Process Mining Transparenz über tatsächliche Prozessabläufe schafft, liefert BI den strategischen Kontext durch KPIs, Dashboards und Steuerungsinformationen. Data Science ergänzt dies um prädiktive Analysen und Handlungsempfehlungen – etwa zur Vorhersage von Engpässen oder zur Simulation optimaler Prozessverläufe. Diese Verbindung ermöglicht eine fundierte, datengestützte Entscheidungsfindung und hilft, Prozesse nicht nur zu verstehen, sondern gezielt zu verbessern, zu automatisieren und strategisch auszurichten. So wird aus Daten echte Wirkung.
Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch DATANOMIQ, Ihr unabhängiger Partner für Business Intelligence, Process Mining und Enterprise AI – mit Standorten in Berlin und Luzern. www.datanomiq.ch
Die Anzahl Ziegen in der Schweiz ist genaustens dokumentiert – unbekannt ist der Wert der Software, die hier produziert wird. Wir glauben an einen Gegenwert von 57 Milliarden Franken, obwohl offiziell 20,4 Milliarden genannt werden. Im folgenden Artikel leiten wir die 57 her. Seit dem Swiss Software Festival 2025 gilt sie unter Insidern als die neue 42 –als Antwort auf die «endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest».
Dr. Pascal Sieber und Christoph Hugenschmidt
Was wir wissen – und was nicht
Wir wissen ganz genau, wie viele Ziegen letztes Jahr in der Schweiz gehalten wurden: Es waren 86‘796 Tiere. Wir wissen aber tatsächlich nicht, wie gross die Schweizer Software-Industrie ist.
Ja, es gibt Firmen, die in der Schweiz Software herstellen und dann auf dem Markt verkaufen. Wir sprechen von Standardsoftwareherstellern. Dann gibt es Unternehmen, die individuelle Software für ihre Kunden programmieren (Individualsoftwarehersteller) und solche, die vor allem Systeme konfigurieren und Integrieren (Systemintegratoren).
Diese drei Firmenarten gelten als Softwarefirmen und werden in den Statistiken auch als solche erfasst. Sie sind allerdings nur die «Spitze des Eisbergs».
Firmen aus der Unternehmensberatung sowie aus Forschung & Entwicklung stellen ebenfalls Software her – und sie leisten Dienste im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung von Software. Am meisten Software wird aber nach unseren Kenntnissen in Firmen programmiert, die sich nicht zur Software- oder Beratungsbranche zählen. Eine der grössten Softwarefirmen der Schweiz dieser Art dürfte die UBS sein.
Um herauszufinden, wie gross der Anteil an Softwareherstellung an der gesamten Wertschöpfung wirklich ist, müssen wir also die Wertschöpfung in jeder Branche, bei jeder Tätigkeit verstehen. Das wird übrigens immer brisanter, denn bereits wird Software hin und wieder sogar von Fachkräften
programmiert, die nicht nur ausserhalb der Softwarebranche arbeiten, sondern sich nicht einmal als Teil der Softwareentwicklung sehen. Dies findet auch dank den modernen Entwicklungstools und Künstlicher Intelligenz immer häufiger statt.
Wie man auf 57 kommt – ohne zu übertreiben
Weil wir nicht die Wertschöpfung jeder Branche «à fond» kennen können, basiert die Herleitung der Zahl 57 auf Branchenstudien und auf Schätzungen. Bei den Schätzungen bleiben wir möglichst konservativ, schätzen den Softwareanteil also eher zu tief als zu hoch ein. Es sei uns also verziehen, wenn es im Folgenden hin und wieder etwas «akrobatisch» wird. Wir berechnen und erheben alle Zahlen für das Referenzjahr 2023.
2022 betrug die Bruttowertschöpfung in der Schweiz 791 Milliarden Franken. Der Anteil der Softwarefirmen daran war gemäss dem Swiss Software Industry Survey (auf der Basis der BfS-Statistik) 2,6 Prozent, also 20,4 Milliarden Franken. Die Softwarebranche wuchs im Durchschnitt jährlich um 2,7 Prozent, was für 2023 also eine Wertschöpfung von 21 Milliarden Franken ausmacht.
Firmen in der Beratung sowie Forschung und Entwicklung – die grössten zwei Firmen dieser Art sind Accenture und Deloitte – stellen ebenfalls Software her. Die Wertschöpfung dieses Sektors betrug 2023 9,2 Milliarden Franken. Wir gehen davon aus, dass 6 Milliarden davon schlussendlich in Software mündeten.
Wir wissen, dass die Finanzindustrie nicht nur ein guter Kunde der Schweizer Softwarehersteller ist, sondern selbst auch sehr viel Software produziert. Ihre Wertschöpfung beträgt gut 75 Milliarden Franken. Dienstleistungen wie IT, die extern eingekauft wurden, sind da nicht dabei. Wir wissen aus Branchenvergleichen, dass die ITKosten bei Finanzdienstleistern etwa 30 Prozent der Wertschöpfung ausmachen. Seien wir konservativ und rechnen wir mit 25 Prozent. Das ergibt gerundet 19 Milliarden Franken.
Pharma und Chemie sind die exportstärksten Industrien der Schweiz, die ebenfalls am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. 2021 waren es rund 6 Milliarden Franken. In unserem Stichjahr 2023 waren es wohl nicht weniger. Nehmen wir vorsichtig an, zwei Drittel davon sei für Informatik ausgegeben worden und davon 80 Prozent für inhouse entwickelte Software. Das wären dann 3,2 Milliarden Franken. Nehmen wir zusätzlich knapp eine Milliarde für die Inhouse-Entwicklung von Software für Prozesse und Produktion dazu. Unsere Zahl erhöht sich damit um abgerundete 4 Milliarden Franken. Biotech-Firmen forschen ebenfalls intensiv – auch dafür ist vor allem Softwareentwicklung nötig. Wir rechnen zusätzlich 1 Milliarde Franken.
Hightech, KMU und stille Mitspieler
Nun kommen wir zu einer weiteren Software-affinen Branche: Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM), also
Immer einen Schritt voraus
der Schweizer Hightech- und Maschinenindustrie. Sie gab 2023 rund 3 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus. Nehmen wir vorsichtig an, davon wurden zwei Milliarden für die Entwicklung von Software ausgegeben. Aus der Beratungspraxis von sieber&partner wissen wir, dass Schweizer KMU vermehrt selbst Software für allerlei Geschäftsprozesse bauen. Deswegen packen wir nochmals 2 Milliarden für interne Software-Entwicklung dazu und erhalten somit 4 Milliarden Franken.
Die weiteren Branchen entwickeln wohl eher in geringerem Mass selbst Software, sondern sie kaufen sie mehr oder weniger erfolgreich ein. Dazu gehören die öffentliche Verwaltung, das Gesundheitswesen, die Immobilienbranche, die Energie- und die Bauwirtschaft. Doch da und dort werden auch in diesen Branchen eigene Lösungen entwickelt und Schnittstellen gebaut. Wir sind vorsichtig und fügen 1 Milliarde an Softwareentwicklung hinzu, die in all diesen Branchen stattfindet. Dasselbe gilt für den Handel. Wir addieren eine weitere Milliarde.
Weitere Branchen entwickeln fast keine Software inhouse. Diese rechnen wir nicht an, um unsere Schätzung konservativ zu halten. Dazu gehören die Landwirtschaft, der Tourismus, die Kommunikation, die Medien sowie die Kunst. Ausgeklammert haben wir damit auch die Computer-Gaming-Industrie. Es gibt in der Schweiz etwa 100 kleinere Firmen und Studios in diesem Bereich, die zusammen etwa 300 Millionen Franken umsetzen.
Die 57 – ein Zahlenspiel, aber nicht nur
Kommen wir nun zum Schlussresultat: Die Schweizer Software-Industrie ist tens 57 Milliarden Franken schwer. Nach aussen sichtbar sind aber nur die 21 Milliar den. Damit trägt die Schweizer Software herstellung mehr zur Wertschöpfung der Schweiz bei als die politisch starke MEMIndustrie, die 2023 auf geschätzte 41 Mil liarden Franken Wertschöpfung kam. So einfach ist die Sache freilich nicht, denn wir haben jetzt ja eben einen Teil der Wert schöpfung der MEM-Industrie zur Soft ware-Industrie geschlagen – und das ist natürlich nur als Zahlenspiel erlaubt.
Die schöne Zahl von 57 Milliarden Franken ist also zwar eine Spielerei, aber sie zeigt uns eines: «Software-Kunstschaffende» aus- und weiterzubilden ist für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft entscheidend –und womöglich noch wichtiger, als wir bisher gedacht haben.
To whom it may concern.
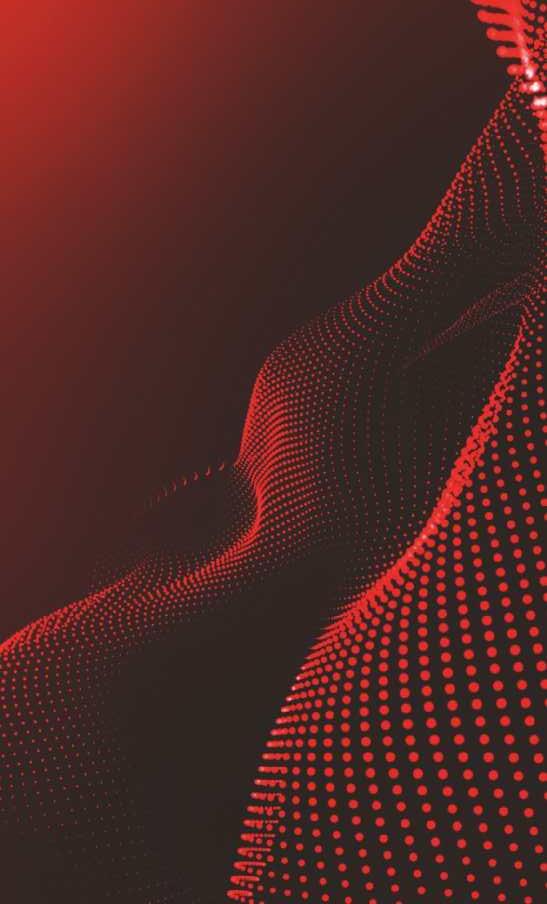
Dr. Pascal Sieber ist Unternehmer, Unternehmensberater, Analyst und VRP der Dr. Pascal Sieber & Partners AG. Er ist Doktor der Wirtschaftsinformatik, ist in diversen Verwaltungsräten vertreten und Studiengangsleiter an der Uni Bern.
Christoph Hugenschmidt ist ein erfahrener Journalist und freiberuflicher Autor, der sich auf die IT-Branche spezialisiert hat. www.schreibenundreden.ch
57 ist das neue 42 – Ursprung und Kontext
Dieser Text baut auf einer Präsentation von Pascal Sieber und Christoph Hugenschmidt am Swiss Software Festival im Juni 2025 auf. Sie war Teil des «Industry Tracks – Software Industry» des Branchenverbands Swico anlässlich des Festivals. Die nächste Ausgabe findet am 23. Juni 2026 wiederum im Uptown Basel statt.
Beide Autoren haben vor über 20 Jahren begonnen, die Schweizer Software-Industrie zu erforschen. Deren Initiative mündet im jährlich von der Universität Bern mit der Unterstützung des Swico und Sieber & Partners durchgeführten Swiss Software Industry Survey.
KI unterstützt
Übersichtlich
Sicher Ganzheitlich Modular Modern
Weitere Informationen finden Sie unter: abacus.ch
ICT-Fachpersonen sind vielseitige Fachkräfte: verlässlich, hilfsbereit und mittendrin in der IT-Welt. Sie kümmern sich nicht nur um technische Systeme, sondern stehen auch im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Genau das gefällt mir als Lernender im 1. Lehrjahr bei revamp-it besonders gut.
Ich finde an meiner Lehre besonders spannend, dass ich mit Kunden reden, helfen und Reparaturen bearbeiten kann.
Bei revamp-it in Zürich lerne ich Schritt für Schritt, wie man Reparaturen durchführt, die Abwicklung von Aufträgen für Kunden in unserer ERP-Software kivitendo erstellt und IT-Support leistet. Auch die Zusammenarbeit mit dem Team spielt eine wichtige Rolle – gemeinsam Lösungen finden, Probleme zu analysieren und Abläufe verbessern.

ICT-Fachmann/-frau EFZ: Ein Beruf mit Perspektive
Der Beruf ICT-Fachmann/-frau EFZ bietet viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Nach der Lehre kann man z. B. die Berufsmaturität machen und später an einer Fachhochschule studieren.
Wer lieber in der Praxis bleibt, kann sich mit einem eidgenössischen Fachausweis weiterbilden – etwa in den Bereichen Netzwerktechnik, Applikationsentwicklung oder IT-Sicherheit.
Durch neue Technologien wie Cloud, KI und Cybersecurity bleibt der Beruf spannend und gefragt.
ICT Fachmann ist ein zukunftssicherer Beruf – ideal für alle, die Technik mögen und sich gerne weiterentwickeln.
Schule, ÜK und Berufspraxis – eine starke Kombination
Im ersten Lehrjahr besuchte ich zwei Tage pro Woche die Berufsschule. Zusätzlich habe ich drei überbetriebliche Kurse (ÜK) besucht – jeder Kurs dauerte sechs Tage. Diese ÜKs ergänzen das Wissen aus Schule und Betrieb und ermöglichen praktische Übungen zu Themen wie Netzwerktechnik, Betriebssysteme und Sicherheit.
Im zweiten Lehrjahr folgt dann ein weiterer ÜK. Ich freue mich darauf, meine Kenntnisse zu vertiefen und noch mehr Verantwortung im Betrieb zu übernehmen.
Reza Khawari ist Lernender ICT-Fachmann EFZ bei revamp-it. revamp-it ist ein gemeinnütziger Verein aus Zürich, der gebrauchte Hardware wieder einsatzfähig macht und sich für nachhaltige IT, Open-Source-Lösungen und digitale Teilhabe engagiert. www.revamp-it.ch
Ausbildung im Fokus – Lernende erzählen: Diese Initiative von topsoft stellt ICT-Lernende ins Rampenlicht. Hier teilen sie kreativ ihre Perspektiven und Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Diese authentischen Beiträge sollen junge Menschen inspirieren und fördern – für die motivierten Fachkräfte von morgen.
Immer mehr Unternehmen in der Schweiz setzen auf KI-Technologien, möchten dabei aber nicht auf Datenschutz und Datenhoheit verzichten. Lokale Anbieter holen auf und bieten eigene Schnittstellen (APIs) für Text-, Sprach- und Bildverarbeitung an. Dieser Vergleich beleuchtet Unterschiede zwischen Schweizer KI-Plattformen und internationalen Hyperscalern mit Rechenzentren in der Schweiz.
Nick Weisser
Swisscom: Infrastruktur für regulierte Branchen
Die Swiss AI Platform von Swisscom richtet sich an Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen. Das Llama-3.1-Modell (8 Milliarden Parameter) kostet monatlich 1000 Franken für 50 Millionen Token – also 20 Franken pro Million. Ein «Token» umfasst etwa 3 bis 4 Zeichen – ein Wortteil oder einzelnes Wort.
Die Plattform läuft auf NVIDIA SuperPOD-Systemen, ist DSGVO-, FINMA- und revDSG-konform und eignet sich für regulierte Branchen wie Banken oder Verwaltung.
Seit September 2025 ist auch das offene Sprachmodell Apertus von ETH, EPFL und CSCS über Swisscom als Inferenzservice verfügbar. Es richtet sich an Forschung, Industrie und Bildung und steht im Rahmen der Swiss {ai} Weeks und über Hugging Face bereit.
Infomaniak: Open-Source-KI für KMU
Der Westschweizer Cloud-Anbieter Infomaniak betreibt eine eigene AI-Plattform mit Modellen wie Llama, Mistral, Qwen oder Whisper. Die KI-Dienste lassen sich über eine Schnittstelle (RESTAPI) direkt in eigene Softwarelösungen integrieren – etwa in Webseiten, Supportsysteme oder interne Tools.
Der Preis für Textmodelle liegt zwischen 10 Rappen und 1 Franken pro Million Token, die erste Million Token ist kostenlos.
Die Verarbeitung erfolgt in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren in Genf und Zürich. Die Plattform richtet sich an KMU und Entwickler mit Fokus auf Datenschutz und Kostentransparenz.
Phoenix Systems: KI-Infrastruktur aus Basel
Mit dem Rechenzentrum kvant Cloud in Basel betreibt Phoenix Systems eine eigene KI-Plattform. Angeboten werden GPU-Instanzen mit H100-Hardware und Managed Services für Anwendungsfälle wie Text- oder Bilderkennung.
Preise ab 250 Franken pro Monat, je nach Projekt und Nutzung. Verarbeitet wird nur in der Schweiz, die Plattform eignet sich für Forschung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleister.
Internationale Hyperscaler mit Standort Schweiz
Google Cloud, AWS und Azure betreiben Rechenzentren in der Schweiz, vor allem in der Region Zürich. Google bietet z. B. das Modell PaLM 2 über Vertex AI an (rund 2.60 Franken pro Million
Token). AWS stellt über Bedrock Zugriff auf Claude und Titan bereit (rund 1.20 Franken pro Million Token). Azure bietet GPT-4 bisher nicht in der Schweiz an. In Amsterdam liegt der Preis bei rund 26 Franken pro Million Token.
Diese Anbieter unterliegen dem US CLOUD Act, der Zugriff durch US-Behörden erlaubt. Bei hohen Anforderungen an Datenhoheit sind sie daher nur bedingt geeignet.
Sprachmodelle auch lokal betreiben?
Eigene Sprachmodelle lassen sich intern betreiben – etwa mit Open-Source-Modellen wie Apertus, Llama oder Mistral. Allerdings erfordert der Betrieb leistungsfähige Hardware, insbesondere spezialisierte Grafikkarten (GPUs), die je nach Ausbaustufe mehrere tausend bis zehntausend Franken kosten können. Hinzu kommen Wartung, Updates und Energiekosten.
Ein Vergleich: Früher wurden Mailserver oft intern betrieben, heute sind cloudbasierte Lösungen wie Microsoft 365 üblich. Ähnlich verlagert sich auch der Betrieb grosser KI-Modelle zunehmend in spezialisierte Rechenzentren.
Preis, Kontrolle und Anwendungsfall entscheiden
Wer generative KI in der Schweiz einsetzen möchte, findet inzwischen mehrere passende Angebote mit Betrieb der ServerInfrastruktur in Schweizer Rechenzentren.
Infomaniak ist günstig und offen, Swisscom zielt auf EnterpriseKunden, Phoenix bietet maximale Flexibilität in regulierten Umfeldern. Hyperscaler punkten mit Modellauswahl, bieten aber weniger Kontrolle über die Datenverarbeitung. Der Einsatzbereich entscheidet, welcher Anbieter passt.
Nick Weisser ist Gründer von Openstream, Tech-Enthusiast und Cypherpunk, mit Fokus auf die Schnittstellen von AI, Webtechnologien und Blockchain. Er schreibt im Openstream Blog über Open Source, E-Commerce und AI und organisiert gemeinsam mit anderen das Zürcher WordPress und WooCommerce Meetup. www.linkedin.com/in/nickweisser
Mit «Alva» hat der Kanton Basel-Stadt einen KI-gestützten Chatbot in seinen Internetauftritt integriert. Im Gespräch erklärt Thom Nagy, Product Owner von bs.ch, wie die Idee zu Alva entstand, welche Qualitätssicherungsmassnahmen entscheidend waren, wo Datenschutz Grenzen setzt, welche Rolle Open Source dabei spielt – und welche Vision er für die Verwaltung der Zukunft hat.
Josef Kruckenberg
Thom, du bist beim Kanton Basel-Stadt für bs.ch verantwortlich. Welche Aufgaben gehören zu deiner Rolle?
Ich bin Product Owner von bs.ch und leite das Team Communication Solutions. Mein fünfköpfiges Team betreut den gesamten Webbereich des Kantons: die Website, den Chatbot Alva sowie das kantonale Designsystem. Wir arbeiten eng mit vielen Ämtern und Fachabteilungen zusammen. Unsere Aufgabe ist es, den Internetauftritt so zu gestalten, dass er für Bürgerinnen und Bürger verständlich, verlässlich und jederzeit aktuell ist.
Digitale Angebote sind für eine Verwaltung meines Erachtens heute genauso wichtig wie Schalteröffnungszeiten – vielleicht sogar wichtiger, weil sie den ersten Kontaktpunkt bilden. Wenn die Website nicht funktioniert, wirkt sich das direkt auf das Vertrauen in die gesamte Verwaltung aus.
Wie kam es zur Idee, einen Chatbot einzusetzen?
Wir waren mitten im Relaunch von bs.ch, als ChatGPT vorgestellt wurde. Uns war schnell klar: Diese Technologie wird verändern, wie die Bevölkerung Informationen sucht und findet. In unserer Produktvision haben wir definiert, dass die neue Plattform laufend weiterentwickelt wird, dementsprechend haben wir darüber nachgedacht, wie wir generative KI ins Projekt integrieren können. Kurz darauf entstand bei Liip ZüriCityGPT. Unsere Umsetzungspartner hatten damit eine gute Grundlage geschaffen, um erste Erfahrungen zu sammeln.
Welche Fragen zu Alva hörst du am häufigsten?
Am meisten geht es um die Zuverlässigkeit: Sind die Antworten korrekt? Wie geht ihr mit Falschinformationen um? Diese Fragen sind typisch, wenn neue Technologien auf die Verwaltung treffen – Vertrauen ist hier der zentrale Punkt.
Wie stellt ihr sicher, dass die Antworten korrekt sind?
Wir haben sämtliche Inhalte der Website neu aufgebaut, mit klaren redaktionellen Vorgaben für Sprache, Struktur und
Verständlichkeit. Ziel war, unklare Formulierungen, Widersprüche und Doppelungen so weit wie möglich auszuschliessen. Die Antworten von Alva basieren ausschliesslich auf diesen Inhalten. Was nicht auf bs.ch veröffentlicht ist, weiss Alva nicht.
Zudem führten wir einen Prozess zur Qualitätssicherung durch: 450 Personen aus den verschiedensten Fachämtern stellten Fragen zu ihrem Bereich. Diese wurden von Studierenden und Fachpersonen überprüft – und zwar nicht nur auf Richtigkeit, sondern auch auf die Tragweite von inkorrekten Antworten. Denn es macht einen Unterschied, ob eine Antwort zu den Öffnungszeiten eines Schwimmbads falsch ist oder ob fehlerhafte Informationen bei Sozialhilfebeiträgen zu existenziellen Problemen führen könnten.
Die Ergebnisse waren sehr aufschlussreich: Rund 90 % der Fehler lagen nicht an der Technik selbst, sondern an unklar formulierten Inhalten. Das war fast wie eine zweite redaktionelle Schlaufe. Alva hat uns so nicht nur geholfen, den Anfragenden bessere Antworten zu geben, sondern auch die Qualität unserer Inhalte insgesamt verbessert.
Welche Rolle spielt die Technik dabei?
Wir setzen auf Retrieval Augmented Generation (RAG). Das bedeutet: Alva greift nur auf geprüfte Inhalte von bs.ch zurück. Alles, was dort nicht hinterlegt ist, wird nicht beantwortet – dadurch lassen sich Halluzinationen weitgehend ausschliessen.
Zusätzlich haben wir mit Embeddings und Prompts gearbeitet. Wir mussten mehrfach nachjustieren, bis die Ergebnisse stabil genug waren. Teilweise ging es um Nuancen, etwa wie Fragen formuliert sind oder welche Begriffe intern verwendet werden. Dieser Prozess hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Technik und Redaktion eng zu verzahnen.
Im Vergleich zur klassischen Suchfunktion auf der Website sind die Antworten von Alva deutlich besser: Sie sind kontextbezogen, klar formuliert und direkt mit Quellen belegt. Das schafft Transparenz – die Fragenden können die Antwort nicht nur lesen, sondern auch prüfen, woher sie stammt.

Thom Nagy ist Product Owner beim Kanton Basel-Stadt.
Welche Funktionen bietet Alva heute und was hast du bewusst ausgeklammert?
Heute ist Alva ein Navigations- und Auskunftsinstrument. Bürgerinnen und Bürger können Fragen zu allen öffentlichen Informationen stellen. Prozessautomatisierungen – also etwa die Bearbeitung von Anträgen oder die Nutzung personenbezogener Daten – sind bewusst nicht integriert.
Das hat zwei Gründe: Einerseits organisatorische, andererseits vor allem datenschutzrechtliche. Alva läuft derzeit auf Microsoft Azure. Solange das so ist, sehen wir von der Verarbeitung sensibler Daten ab. Wir prüfen aber, ob und wie wir Alva künftig auf eigener Infrastruktur mit Open-Source-Modellen betreiben können. Nur so können wir langfristig sicherstellen, dass auch kritische Prozesse KI-gestützt, aber datenschutzkonform laufen.
Datenschutz ist ein sensibles Thema. Wie gehst du damit um?
Für uns ist Transparenz das A und O. Die Leute müssen jederzeit wissen, wenn sie mit KI interagieren. Nur so lässt sich Vertrauen aufbauen. Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Vorgaben und stehen im Austausch mit unseren Datenschutzbeauftragten. Gleichzeitig bin ich überzeugt: Diese Technologie kann die Interaktion der Bevölkerung mit der Verwaltung stark vereinfachen. Wichtig ist dabei, verantwortungsvoll zu experimentieren. Wir müssen Chancen testen, Risiken ehrlich benennen und Erfahrungen sammeln. Nur so können wir herausfinden, wie KI der Verwaltung tatsächlich Nutzen bringt.
Welche Rolle spielt Open Source auf bs.ch?
Wir setzen in unserem Bereich bewusst auf Open-SourceTechnologien. So setzen wir Drupal als CMS ein. Das gibt uns nicht nur Flexibilität, sondern bringt auch die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Ein Beispiel ist der blökkli-Editor, den wir gemeinsam mit unserem Partner entwickelt und als Open Source veröffentlicht haben. Er wurde inzwischen rund 150 Mal installiert – ein klares Signal, dass das Interesse weit über Basel hinausgeht.
Wir haben das Tool auf Konferenzen präsentiert und Feedback gesammelt, das in die Weiterentwicklung fliesst. Diese Zusammenarbeit macht Software besser und schafft Vertrauen.
Im Kern geht es um das Prinzip «Public Money, Public Code»: Wenn Software mit öffentlichen Geldern entwickelt wird, soll der Quellcode meines Erachtens auch öffentlich zugänglich sein. Das erhöht die Transparenz, vermeidet doppelte Aufwände und macht Verwaltungen unabhängiger von einzelnen Anbietern. Gerade in Zeiten, in denen Vertrauen in den Staat wichtig ist, halte ich dieses Prinzip für besonders wichtig.
Wie stellst du dir den Einsatz von KI in fünf Jahren vor?
Natürlich bewegen wir uns hier im rein Spekulativen. Aber meine Vision ist klar: Eine persönliche KI-Assistenz, die sowohl Bevölkerung als auch Mitarbeitende unterstützt.
Für die Bevölkerung könnte das bedeuten: Weniger Bürokratie, einfacher Zugang zu Dienstleistungen, Übersetzungen in mehreren Sprachen auf Knopfdruck und mehr Barrierefreiheit. Stell dir vor, du musst keine Formulare ausfüllen, weil du einfach der KI mitteilst, was du brauchst. Den Rest erledigt sie für dich selbstständig und kommt mit dem fertigen Resultat zurück.
Für Mitarbeitende wiederum bedeutet es Entlastung: Routineaufgaben wie Sitzungszimmerbuchungen, Terminorganisation oder Standardabfragen könnten automatisiert werden. So bleibt mehr Zeit für die komplexen und menschlich relevanten Themen.
Mein Wunsch ist, dass KI nicht Distanz schafft, sondern Nähe. Sie soll Verwaltung nicht unpersönlicher machen, sondern den Leuten einen direkteren Zugang ermöglicht. Wenn uns diese Balance gelingt, kann KI dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.
Josef Kruckenberg ist Drupalista und Lead Generative AI bei Liip AG. www.linkedin.com/in/dasjo/
Dieser Beitrag wurde ermöglicht von der Liip AG. Das Unternehmen begleitet seine Kundschaft bei Digitalprojekten: Von der ersten Beratung über die Umsetzung bis über den Go-Live hinaus. www.liip.ch
Open Source Software (OSS) ist längst mehr als ein Idealismus aus der Hacker-Ecke. In vielen Bereichen ist sie Standard – auch in der Schweiz. Dennoch zögern viele KMU, wenn es um Business-Software geht. Dabei bietet OSS gerade für kleinere Unternehmen enorme Chancen: Von Kosteneffizienz über digitale Souveränität bis hin zu Innovationskraft.
Alain Zanolari
Vorurteile vs. Realität
Der Begriff «Open Source» ruft bei manchen Verantwortlichen noch immer Bilder von unsicheren Programmen, fehlendem Support und Bastellösungen hervor. Doch das ist längst überholt. Heute arbeiten weltweit Entwicklerinnen und Entwickler an stabilen, sicheren und hochflexiblen Lösungen, auch in der Schweiz. Zahlreiche Dienstleister bieten dazu professionelle Unterstützung und individuelle Anpassung an.
Die wichtigsten Vorteile für KMU
• Kostenersparnis: OSS ist meist kostenlos oder deutlich günstiger als proprietäre Software. Keine Lizenzgebühren, keine Anbieterbindung – ideal für Startups, Vereine und kleine Unternehmen.
Qualität & Sicherheit: Der offene Quellcode ermöglicht schnelle Reaktionen auf Sicherheitslücken und technologische Veränderungen. Viele Augen sehen mehr – das gilt auch für Code.
Vielfalt & Auswahl: Von ERP über CRM bis zu CollaborationTools – die OSS-Welt bietet Lösungen für fast jeden Bedarf.
• Flexibilität & Kontrolle: Anpassungen sind möglich, weil der Quellcode offenliegt. Das schafft Unabhängigkeit und erlaubt individuelle Lösungen.
• Skalierbarkeit: OSS kann auf beliebig vielen Geräten genutzt werden – ohne zusätzliche Kosten.
Herausforderungen – realistisch betrachtet
• Support & Know-how: Professionelle Hilfe ist nicht immer inklusive. KMU müssen entweder intern Know-how aufbauen oder externe Partner einbinden.
• Kompatibilität: Schnittstellen zu proprietären Systemen können Aufwand bedeuten – hier ist technisches Verständnis gefragt.
Open Source und Sicherheit – ein Missverständnis mit Folgen
«Wenn jeder den Code sehen kann, kann ihn auch jeder angreifen» – dieses Argument klingt logisch, ist aber zu kurz gedacht. Tatsächlich ist gerade die Offenheit von Open Source Software ein Sicherheitsvorteil. Denn: Was offen ist, kann auch offen geprüft werden.
Transparenz statt Blackbox: Bei proprietärer Software bleibt der Quellcode verborgen – Schwachstellen können lange unentdeckt bleiben. Bei OSS hingegen prüfen weltweit Entwicklerinnen und Entwickler laufend den Code.
• Community-Wachsamkeit: Die Open-Source-Community funktioniert wie ein kollektives Immunsystem.
• Moderne Sicherheitsstandards: Viele Open-SourceProjekte arbeiten heute mit automatisierten Sicherheitschecks, Software Composition Analysis und Continuous Integration. Governance und Verantwortung: Unternehmen setzen zunehmend auf sogenannte «OSS-Governance», um zu verstehen, welche Open-Source-Komponenten sie nutzen, wie gut diese gepflegt sind und wie schnell auf Sicherheitslücken reagiert wird.
Natürlich bleibt OSS kein Selbstläufer. Wer Open Source einsetzt, muss Verantwortung übernehmen: für Updates, für Monitoring und für die Auswahl vertrauenswürdiger Quellen. Aber mit dem richtigen Setup ist OSS nicht nur sicher, sondern oft sicherer als proprietäre Alternativen.
Die Schweizer Bundesverwaltung setzt seit 2025 verstärkt auf Open Source, gestützt durch das neue Gesetz EMBAG, das Behörden verpflichtet, ihren Quellcode offenzulegen. Auch in der Privatwirtschaft wächst das Vertrauen: Immer mehr KMU sehen OSS als strategischen Erfolgsfaktor – nicht nur wegen der Kosten, sondern wegen der digitalen Souveränität und Innovationskraft.
Sie sehen: Open Source Systeme sind mehr als eine Randerscheinung und können für manches KMU eine valable Lösung darstellen.
Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen kompetente Anbieter für Open-Source-Lösungen vor. Und wenn Sie Hilfe brauchen bei der Auswahl Ihrer nächsten Business IT, stehen Ihnen die unabhängigen Berater aus dem topsoft Consulting-Netzwerk gerne zur Verfügung. www.topsoft.ch/consulting

braintec AG
Pfingstweidstrasse 106
8005 Zürich
T +41 44 552 01 20 www.braintec.com info@braintec.com
Als führender Odoo Gold Partner in Europa entwickelt braintec seit 2000 massgeschneiderte und effiziente Business Software Lösungen. Über 400 Unternehmen aller Grössen vertrauen auf unsere Branchenlösungen, die individuelle Standards und spezifische Prozesse für verschiedene Industrien integrieren und automatisieren.
Wir bieten das gesamte Dienstleistungsspektrum von der Analyse und Beratung über die Implementierung von End-to-End-Lösungen bis hin zu Betrieb, Hosting, Support und internationalen Roll-outs für die Open Source ERP Odoo. Mit unseren 80 hochqualifizierten Mitarbeitenden in Zürich, Basel, Bern und Lausanne garantieren wir den Erfolg Ihrer Digitalisierung.
Mehr erfahren und Beratung vereinbaren: braintec.com

libracore AG
Im Schürli 9
8344 Bäretswil ZH
T +41 52 551 22 33
www.libracore.com
info@libracore.com
Liip AG
Rue de la Banque 1 1700 Freiburg
T +41 43 588 13 78 www.liip.ch contact@liip.ch
stepping stone AG
Wasserwerkgasse 7
3011 Bern
T +41 31 332 53 63
www.stepping-stone.ch
info@stepping-stone.ch
Der Game-Changer im ERP-Bereich
Die libracore AG revolutioniert mit ihrer innovativen Business Software das ERP-Segment. Basierend auf der bewährten Open Source-Plattform ERPNext, angepasst für die Anforderungen der Schweiz, bietet libracore eine vollumfängliche Cloud-Lösung ohne versteckte Kosten – weder pro Benutzer noch pro Modul.
Als Open Source-Lösung garantiert das System maximale Datensicherheit und digitale Souveränität. Unternehmen behalten die volle Kontrolle über ihre Daten und sind unabhängig von proprietären Anbietern. Das System überzeugt zudem durch grenzenlose Anpassbarkeit und nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften.
Mit der libracore AG haben Schweizer Unternehmen einen kompetenten, lokalen Partner an ihrer Seite, der jedes Projekt zum Erfolg führt. Entdecken Sie den Game-Changer unter den ERP-Systemen und erleben Sie, wie moderne Geschäftssoftware funktioniert.
Liip ist führende Berater*in für digitale Transformation. Das Schweizer Unternehmen mit regional verankerten Standorten arbeitet agil in selbstorganisierten Teams nach Holacracy und steht für Qualität, Verlässlichkeit und nachhaltige Lösungen. Seit fast zwanzig Jahren begleitet Liip Start-ups, KMUs und Grossunternehmen bei ihren digitalen Herausforderungen – von strategischer Beratung über die Entwicklung bis über den finalen Go-Live hinaus. Und das mit Expert*innen für Strategie, User Experience, Custom Development und KI. Wir glauben, dass Künstliche Intelligenz gekommen ist, um zu bleiben. Und wir setzen sie verantwortungsvoll ein, immer mit Blick auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen. Unser Ziel: KI in der Schweiz nutzbar, nützlich und wirkungsvoll machen.
Seit 2004 betreibt die stepping stone AG die Software ihrer Kunden und bietet persönliche Beratung – von der Planung bis hin zur Umsetzung.
Unsere moderne und hochautomatisierte Schweizer Cloud, verteilt auf zwei Rechenzentren, erlaubt den Betrieb von skalierbaren und hochverfügbaren Lösungen. Bei der Automatisierung kommen Technologien wie OpenStack, Cluster API, OpenTofu, Puppet und GitLab zum Einsatz.
Die für den Betrieb der Kundensoftware nötige Infrastruktur wird individuell aus modularen und standardisierten Komponenten zusammengestellt. Managed Cloud Services wie Kubernetes, Backup, Monitoring, Wartung und Pikett runden das Angebot ab.
Die stepping stone AG legt grossen Wert auf Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit und setzt ein nach ISO/IEC 27001 zertifiziertes Information Security Management System ein.
Produkte / Kompetenzen
Odoo
Branchenlösungen
Business Automation mit KI Human Resources Life-Cycle Swissdec Lohnbuchhaltung
CRM, Verkauf, Einkauf, PoS Fibu, BI, Reporting
Supply Chain
Produktion + Logistik
Marketing Automation
Projektmanagement und Planung Kundendienst und Aussendienst
Kontaktperson
Chris Fraser
Produkte / Kompetenzen
libracore Business Software
ERPNext
NextCloud
Kontaktperson
Lars Müller
Produkte / Kompetenzen
Digital Business
Customer / User Experience
AI / Automation
Web / Mobile
Tailer Made Software
Data and Analytics
Digital Sustainability
Agile Product / Innovation
Kontaktperson
Kathrin Würmli
Produkte / Kompetenzen
OpenStack
Kubernetes
Ceph, S3
OpenTofu / Terraform
GitLab und GitLab Runner
Puppet Zabbix
Maria DB, MySQL, PostgreSQL
Nextcloud
MediaWiki
Kontaktperson
Michael Eichenberger
Produkt
Anbieter
aBusiness Suite Langmeier Software™
agorum® agorum® by NOVISTA GmbH
agorum® Rechnungsmanagement agorum® by NOVISTA GmbH
Aivie
Akeneo PIM
axelor ERP
Aivie - Marketing Automation
Akeneo
Xippo GmbH
BrokerStar WMC IT Solutions AG
Drupal Liip AG
Drupal Commerce Liip AG
ERPNext libracore AG
Exxas Exxas AG
FOSS-Cloud FOSS-Group (Schweiz) GmbH
Galera Cluster FromDual GmbH
iOffice WMC IT Solutions AG
libracore Business Software libracore AG
Magento Commerce CS2 AG
MariaDB FromDual GmbH
metasfresh ERP metas GmbH
Nubus Univention GmbH
Odoo acunomic:erp
Odoo braintec
OpenBiz Clixmedia GmbH
OroCRM Liip AG
Prestashop netfuchs GmbH
stoney cloud stepping stone AG
stoney mail stepping stone AG
stoney storage stepping stone AG
stoney wiki stepping stone AG


Standardsoftware war lange die Norm. Doch in Zeiten von KI, Low-Code und datengetriebenem Design gewinnt die perfekt passende Software an strategischer Bedeutung –sozusagen als Massanzug für die digitalen Prozesse im Unternehmen.
Alain Zanolari
Wenn Unternehmen neue Business Software einführen, stellt sich schon bald die zentrale Frage: Wählen wir ein Standardprodukt oder besser eine individuelle Lösung? Beide Ansätze haben ihre Berechtigung – und beide profitieren heute von neuen Methoden wie Information Design, KI-gestützter Entwicklung und agiler Umsetzung.
Massanzug oder von der Stange: Eine Frage der Passform
Die Entscheidung erinnert an die Wahl eines Kleidungsstücks: Wer etwas von der Stange kauft, erhält solide Ware, die sich gleich oder mit kleinen Anpassungen gut tragen lässt. Wer jedoch Massarbeit wählt, investiert mehr, wartet auch etwas länger, bekommt dafür aber ein Outfit, das wie angegossen sitzt.
Ähnlich verhält es sich mit Business Software:
Standardlösungen sind schnell verfügbar, oft erprobt und bieten eine breite Funktionspalette.
• Individuelle Software benötigt mehr Zeit und Budget, passt sich dafür aber exakt den bestehenden Prozessen an.
Software muss verständlich sein
Software entfaltet ihren Wert erst, wenn sie verstanden wird. Hier kommt Information Design ins Spiel: Es strukturiert komplexe Inhalte, visualisiert sie sinnvoll und sorgt für intuitive Bedienung. Gerade bei individuellen Lösungen kann das Design von Anfang an mitgedacht werden, bei Standardlösungen ist dies oft erst im Nachgang möglich. So oder so wird dadurch aber die Usability deutlich verbessert und damit die Akzeptanz bei den Usern erhöht.
Standardsoftware – bewährt, aber nicht immer passend
Viele KMU setzen erfolgreich auf Standardlösungen: Sie sind schnell einsatzbereit und bieten laufende Updates. Allerdings

müssen sich hier die Prozesse generell an die Software anpassen. Doch je spezieller die Branche, je spezifischer die Abläufe, desto schwieriger wird es, alles abzudecken. In solchen Fällen bieten sich hybride Modelle an: Eine Standardsoftware mit gezielten Erweiterungen. Oder dann doch lieber gleich eine massgeschneiderte Lösung?
Denn Individuelle Software ist mehr als ein technisches Projekt – sie ist eine Investition in die Zukunft. Sie passt sich den Abläufen an (statt umgekehrt), ermöglicht langfristig erweiterbare Architekturen und schafft auch Wettbewerbsvorteile, zum Beispiel durch bessere Kundeninteraktion und effizientere Prozesse.
Dank neuer Werkzeuge wie KI, Low-Code-Plattformen und agilen Methoden ist individuelle Software-Entwicklung heute zugänglicher und wirtschaftlicher als früher. Auch OpenSource-Komponenten spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle – sie ermöglichen flexible Architekturen und fördern kollaborative Entwicklung. Sie erfordert zwar aktive Mitarbeit und etwas mehr Geduld, bietet dafür aber maximale Flexibilität.
Fazit: Die richtige Wahl hängt vom Ziel ab Ob Standardsoftware, individuelle Lösung oder ein Mix aus beidem: Entscheidend ist, was das Unternehmen wirklich braucht. Wer schnell starten will, ist oft mit einer Standardlösung gut beraten. Wer sich aber differenzieren will, sollte über eine individuelle Entwicklung nachdenken – idealerweise mit modularen Komponenten, die auch Open-Source-Elemente einbeziehen können. Und wer beides will, findet in modularen Ansätzen und gutem Information Design die perfekte Lösung.
Denn am Ende zählt nicht nur die Funktion, sondern auch, wie gut die Software verstanden, genutzt und weiterentwickelt werden kann.
Wer entwickelt Ihre individuelle Software?
Ob Start-up oder KMU – hier finden Sie die passenden Partner für Ihre IT-Lösung. Die Marktübersicht auf topsoft.ch führt mehr als 50 Anbieter für individuelle Softwareentwicklung auf.
QR-Code scannen und passenden Anbieter finden: https://qrco.de/SW-Entwicklung
Open Source Software gilt als flexibel, kosteneffizient und unabhängig – doch was bedeutet das konkret für Schweizer KMU? Vier IT-Anbieter geben im Interview-Format 4 x 4 Einblick, wie Open Source im Geschäftsalltag funktioniert. Es geht um Chancen, Stolpersteine und digitale Souveränität: Wer kontrolliert die Daten, wie bleibt man unabhängig – und wie zukunftsfähig ist der offene Weg wirklich?
Open Source ist mehr als freie Software: Für viele KMU eröffnet sie neue Möglichkeiten, flexibel und selbstbestimmt auf individuelle Bedürfnisse einzugehen – ohne von einzelnen Herstellern abhängig zu sein. Gleichzeitig bringt die offene Philosophie Verantwortung mit sich, etwa bei Wartung, Support und Sicherheit
Gerade im KMU-Umfeld kommen Open-Source-Lösungen in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz – von Webservern über ERP-Systeme bis hin zu Collaboration-Tools. Die Modularität vieler Projekte erlaubt es, Systeme passgenau zu gestalten. Und wer nicht über ein eigenes IT-Team verfügt, kann auf spezialisierte Dienstleister zurückgreifen, die Installation, Betrieb und Support übernehmen.
Auch das Thema Sicherheit wird oft unterschätzt: Die Offenheit des Quellcodes bedeutet nicht weniger Schutz – im Gegenteil. Aktive Communities sorgen für schnelle Updates und transparente Entwicklung. Entscheidend ist, wie sorgfältig ein KMU mit Konfiguration und Wartung umgeht.
Nicht zuletzt ist Open Source auch eine strategische Entscheidung: Wer sich für den offenen Weg entscheidet, investiert in Unabhängigkeit, Transparenz und Zukunftsfähigkeit. In Zeiten wachsender digitaler Abhängigkeiten kann das ein entscheidender Vorteil sein – gerade für kleinere Unternehmen, die ihre Datenhoheit bewahren wollen.
Die Fragen stellte:
Cyrill Schmid
Lars Müller CEO libracore AG

Was bringt Open Source Software einem KMU – über den Preisvorteil hinaus?
Wie viel IT-Know-how braucht ein KMU, um OSS sinnvoll einzusetzen?
Open Source Software im Bereich ERPSysteme bringt verschiedene Vorteile neben dem Wegfall von pro-Benutzer-/ pro-Modul-Lizenzkosten: Einerseits setzt es direkt bei der digitalen Souveränität ein. Es ermöglicht sowohl die volle Kontrolle über die Daten als auch der Prozesse und Codes. Zusätzlich, und gerade bei ERP-Systemen, ist die Erweiterbarkeit und Integration entscheidend: Schnittstellen können beliebig erweitert werden und so wirklich die perfekt integrierte Prozesslandschaft abgebildet werden –ohne doppelte Daten, mit effizienten Abläufen, und ohne Grenzen.
Für den Endbenutzer ist der Einsatz eines Open Source ERP nicht anders als eines anderen ERP-System in Bezug auf ITKnow-how: die Oberfläche ist eine moderne Browser-basierte Web-Oberfläche, intuitiv bedienbar.
Für den Betrieb eines Open Source-ERP bietet sich sicherlich die Zusammenarbeit mit einem lokalen Dienstleister an, da Kenntnisse von Linux & Co. von Vorteil sind. Unsere Lösungen sind aber natürlich als SaaS verfügbar.
Wie steht es um Support, Updates und Verlässlichkeit?
Wie stärkt Open Source die digitale Souveränität eines KMU?
Gerade bei Open Source-Lösungen ist die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und erfahrenen Partner vor Ort entscheidend. Viele Projekte und Codes sind dezentral gepflegt. So wird die globale Community und dadurch die Vorteile für Sicherheit und neue Features abgedeckt. Gerade im Bereich ERP ist der zuverlässige Betrieb und die geforderte Stabilität ebenso wichtig. Wir decken dies mit dem lokalen Fork libracore business Software / ERPNextSwiss ab, welcher durch uns direkt betreut wird. So können wir kritische Updates jederzeit schnell durchführen.
Open Source-Lösungen bieten gerade in der aktuellen Digitalisierungssituation den entscheidenden Unterschied. Die Abhängigkeit von grossen, internationalen Konzernen mit Vendor Lock-In wird aufgehoben, das KMU erhält die Möglichkeit, relevante Entscheide wie Datenschutz, Serverstandort oder Partner frei zu wählen und insbesondere auch hinter die Kulissen zu schauen. Auch die eigene Mitwirkung wird ermöglicht, Power User erhalten ganz neue Möglichkeiten.
Tonio
Zemp Lead Production Liip AG

Aus meiner Sicht ist der wichtigste Vorteil die damit einhergehende Selbstbestimmung: Unabhängigkeit von Herstellern, die einfach die Preise erhöhen, der Datensammelwut nicht ausgesetzt zu sein und die Freiheit, die Software in der sicheren Schweiz (oder dort, wo ich es will) zu betreiben.
In der Regel ist es auch ein Investitionsschutz. In unserer eigenen IT-Landschaft mussten wir bisher nicht Open-Source-, sondern fast nur SaaS- oder Lizenzsoftware austauschen, weil die Hersteller zu gierig wurden oder plötzlich mit unseren Daten ihre KIs trainieren wollten.
Da gibt es keinen Unterschied zu Closed Source. Nicht die Lizenzart ist hier relevant, sondern der Partner dahinter. Der kann mich entweder dort abholen, wo ich mit meinem Know-how stehe, oder es ist ihm egal.
Aus gutem Grund sind wir an sechs Standorten in der Schweiz: Wir sind nah, sprechen die gleiche Sprache und verstehen als Schweizer KMU die Herausforderungen unserer Kunden sehr gut. Genau so können wir auch mit komplexen Themen wie KI zum Geschäftserfolg unserer Kunden beitragen. Und in einer guten Zusammenarbeit bauen unsere Kunden automatisch weiteres wertvolles IT-Know-how auf.
Für verbreitete Produkte ist es mindestens gleichwertig. Bei weniger bekannten Produkten oder Komponenten lohnt sich jeweils ein Blick auf die Aktivitäten der Community und darauf, wie sie sich finanziert. Selbst im Worst Case, wenn ein Produkt nicht mehr durch eine Community getragen wird: Da der Code offen ist, kann ein Dienstleister damit beauftragt werden, die Software weiterhin sicher zu betreiben.
Bei der Internetinfrastruktur, Middleware im Finanzwesen oder in der Telekommunikation wird eine sehr hohe Zuverlässigkeit gefordert – und das sind überwiegend Open-Source-Systeme.
Ich erhalte als KMU die alleinige Hoheit über meine Daten, Prozesse und Werkzeuge. Ich entscheide, ob und wann ich den Lieferanten wechseln will. Niemand spielt mit den Daten meiner Kunden, drückt mir jedes Jahr 30 % mehr Kosten auf oder zieht eines Tages einfach so den Stecker, weil es «nicht mehr rentiert». Ich kann mich sogar in der jeweiligen Community engagieren und so direkten Einfluss auf die Zukunft der Software nehmen – etwas, das wir als Liip bei vielen unserer Open-Source-Systeme tun, die wir bei unseren Kunden einsetzen.
Nick Weisser Geschäftsführer
Openstream Internet Solutions

Open Source bietet KMU weit mehr als nur geringere Lizenzkosten. Offene Systeme sichern Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern, ermöglichen flexible Anpassungen und wachsen mit dem Unternehmen. Durch Hosting und Datenschutz in der Schweiz behalten KMU die volle Kontrolle über ihre Daten. So entsteht eine nachhaltige, zukunftssichere Basis für E-Commerce – weit über den vermeintlichen «Gratis»-Mythos hinaus.
Michael
Eichenberger CEO stepping stone
AG

Open Source bietet einem KMU weit mehr als nur Kostenvorteile. Open Source ermöglicht Unabhängigkeit von Anbietern, hohe Anpassungsfähigkeit, transparente Sicherheit und schnellere Innovation. Durch offene Standards ist eine bessere Integration in Dritt-Systeme möglich, während digitale Souveränität und Kontrolle über Daten gestärkt werden. Eine aktive Community unterstützt bei Fragen und Weiterentwicklung. Gerade für einem KMU mit begrenzten Ressourcen und spezifischen Anforderungen ist das strategisch ein echter Wettbewerbsvorteil.
Open Source erfordert je nach Lösung ein gewisses technisches Verständnis, etwa bei WooCommerce. Gleichzeitig gibt es heute auch Managed-Varianten, die ähnlich wie Shopify funktionieren: Updates, Sicherheit und Betrieb werden dabei von einer erfahrenen Dienstleisterin übernommen. So können KMU die Vorteile von Open Source nutzen, ohne selbst tief in die Technik einzusteigen – kombiniert mit Hosting und Datenschutz in der Schweiz eine sichere und flexible Basis.
Ein KMU benötigt kein tiefes technisches Fachwissen, um Open Source erfolgreich zu nutzen. Entscheidend ist, dass die Geschäftsanforderungen klar formuliert sind und ein kompetenter Partner die technische Umsetzung übernimmt. Die stepping stone AG begleitet Firmen von der Auswahl bis zum Betrieb.
Bei Open Source Software wie WordPress oder WooCommerce können Updates automatisiert werden. Sobald jedoch komplexe Integrationen oder Drittanbieter-Plugins im Einsatz sind, empfiehlt sich eine manuelle Prüfung. So lassen sich Ausfälle oder Konflikte vermeiden und die Stabilität des Gesamtsystems sichern. Für KMU heisst das: Support und Verlässlichkeit sind gegeben, wenn Updates mit der nötigen Sorgfalt und Erfahrung begleitet werden.
Open Source basierte Lösungen haben sich längst als stabil und zukunftsfähig etabliert. Updates entstehen durch aktive Communities und werden durch professionelle Anbieter zusätzlich abgesichert. Wichtig bleibt der Support, sei es intern oder über einen Partner. Wir bei stepping stone AG bieten KMU genau diese Sicherheit: planbare Betreuung, schnelle Reaktionszeiten und den verlässlichen Betrieb kritischer Systeme.
Open Source stärkt die digitale Souveränität, weil ein KMU jederzeit die Kontrolle über seine Systeme und Daten behält. Anders als bei proprietären Lösungen gibt es keine Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder geschlossenen Plattformen. Unternehmen können frei entscheiden, wo sie ihre Daten hosten – etwa in der Schweiz – und wie sie ihre Systeme erweitern oder anpassen. Diese Unabhängigkeit schafft langfristige Sicherheit und echte Handlungsfreiheit.
Open Source stärkt die digitale Souveränität von KMU, indem es Unabhängigkeit von Herstellern schafft, Transparenz und Kontrolle über Funktionen und Sicherheit ermöglicht sowie Anpassungen an eigene Prozesse erlaubt. Offene Standards sichern langfristige Verfügbarkeit und verringern Abhängigkeiten. Open Source ermöglicht es einem KMU die freie Wahl, Anwendungen lokal, in der Cloud oder hybrid zu betrieben. So gewinnen KMU mehr Kontrolle über ihre IT, bleiben flexibel und können strategische Entscheidungen eigenständig treffen.
Am 3. September 2025 wurde das Widenmoos bei Reitnau zum 17. Mal zum Zentrum für Innovation, Networking und Inspiration. Unter dem Motto «Wie schnell ist die Zukunft?» versammelten sich gegen 200 Gäste aus Retail, Hospitality und HR, um gemeinsam mit Zucchetti und seinen Partnern einen Blick in die Zukunft zu werfen – und zu erleben, wie schnell sie tatsächlich ist.
Cyrill Schmid
Zucchetti präsentierte sich dabei nicht nur als Gastgeber, sondern als treibende Kraft für digitale Transformation in der Gastronomie, im Handel und im Personalmanagement.
Spotlight Sessions – Ein neues Format
Mit den Spotlight Sessions im Vorprogramm erweiterte Zucchetti das Angebot für die Besucher mit branchennahen Fachvorträgen – von Cybersecurity über Retail Tech bis hin zu KI-getriebener Innovation.
Als strategischer Sparringspartner für digitale Transformation, Retail Tech und Innovation zeigte Andy Baldauf in seiner Session, wie Unternehmen zwischen USA, Europa, Schweiz und China agieren müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.
Die Zühlke Group präsentierte mit der «Cybernetic Delivery Method» einen menschenzentrierten Ansatz zur Integration von KI in digitale Prozesse. Die Speaker zeigten, wie Unternehmen durch die Kombination menschlicher Kreativität und maschineller Effizienz ihre Time-to-Market verkürzen und nachhaltige Innovationen schaffen können.
Davide Bortolotto, CEO von LS International (ein Unternehmen der Zucchetti-Gruppe), beleuchtete die wachsenden Bedrohungen für Retail und Hospitality durch Cyberangriffe. Mit konkreten Zahlen und Szenarien zeigte er, wie wichtig präventive Massnahmen wie Penetration Testing und eine informierte, sichere KI-Nutzung sind, um Daten, Infrastrukturen und Prozesse zu schützen.
Und Denis Christesen von PartnerTech Europe zeigte mit einem visionären Blick die Zukunft des Point-of-Sale auf. POS muss nicht nur technisch, sondern auch emotional neu gedacht werden.
In einer persönlichen Präsentation nahm Nico Karges, Managing Director der Zucchetti Germany, die Gäste mit auf eine Reise durch die Geschichte der Zucchetti-Gruppe. Von der Gründung durch Mino Zucchetti in Lodi bis heute. Dabei wurde deutlich, wie tief Innovation und Partnerschaft in der Unternehmens-DNA verankert sind.
Keynotes mit Tiefgang und Weitblick
Den Auftakt der Abend-Session bildete Nils Frei, ehemaliger Trainer und Profisegler und Teammitglied von Alinghi Red Bull Racing. Er sprach über Geschwindigkeit, Präzision und Teamdynamik – Werte, die auch in der digitalen Transformation entscheidend sind.
Anschliessend begeisterte Dr. Jens Uwe Meyer, Innovationsforscher und Unternehmer, mit einem Vortrag zur disruptiven Denkweise. Er zeigte, wie Unternehmen durch mutige Entscheidungen, kreative Prozesse und den klugen Einsatz von KI die Zukunft aktiv gestalten können.
Technologie im Dialog – mit dem Menschen in Mittelpunkt
Beim anschliessenden Apéro konnten sich die Teilnehmenden bis spät abends zu den zahlreichen Inputs austauschen. Das Zucchetti Forum 2025 war wiederum ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass ein Networking-Event dieser Art absolut seine Berechtigung hat.
In einer Zeit, in der Technologie immer schneller wird, bleibt eines konstant: Der Mensch im Mittelpunkt.
Save the Date: Zucchetti Forum 2026 – 2. September 2026 topsoft ist Medienpartner des Zucchetti Forum
Lesen Sie online mehr Den vollständigen Bericht zum gutbesuchten Zucchetti Forum 2025 sowie weitere Beiträge von Zucchetti finden Sie online auf topsoft.ch.

https://qrco.de/bgJZix
Gebäudeversicherungen müssen aus rechtlichen Gründen viele Dokumente auf Papier versenden. Die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) wählte dafür die Kommunikationsplattform von ePost. Nach einer reibungslosen Premiere wird bereits das nächste Projekt umgesetzt.
Die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) betreut mit 80 Mitarbeitenden gut 70‘000 Kundinnen und Kunden. Jedes Jahr erhalten diese umfangreiche Dokumente. «Wir verschicken unter anderem Teil- und Jahresrechnungen. Aus Gründen der Compliance dürfen diese nicht elektronisch übermittelt werden, sondern müssen auf Papier ausgeliefert werden, solange kein Kundenportal besteht», sagt Michel Fuchs, CIO bei der SGV. Um das grosse Volumen möglichst einfach zu bewältigen, suchte die SGV einen neuen Partner für den Druck und Versand.
Gelb gewinnt
Die öffentliche Ausschreibung gewann die ePost Kommunikationsplattform. Die SGV übergibt ihre Druckdaten digital, ePost übernimmt Druck und Versand inklusive Adresskontrolle. Ein Sorglos-Paket, das bei Massenversänden sehr geschätzt wird. Ausschlaggebend waren laut Michel Fuchs drei Faktoren: «Wir wollten eine flexible Plattform für kleinere Anpassungen, eine aktuelle Schnittstelle, die sich unserem System anpasst, und natürlich spielten auch die Kosten eine Rolle.»
Als Drehscheibe zwischen SGV und ePost fungierte die Firma DTI, spezialisiert auf Systemintegration. Andreas Ramseier, Produktmanager CCM und Senior Projektleiter Integration, war zuständig für Prozesse, Dokumentation und das Rendering. «Das ERP-System liefert Daten, die wir an die ePost-Schnittstelle übergeben. Damit alle Elemente wie Logo, Policennummer oder Adresse korrekt platziert sind, braucht es das richtige Layout», erklärt Ramseier.
Einfache Anbindung
Damit die SGV sowohl Grossversände wie Rechnungsläufe als auch einzelne Dokumente versenden kann, wurden zwei Schnittstellen eingerichtet: eine über SFTP für grosse Datenmengen, die andere als Web-Service. «Damit können unsere Mitarbeitenden etwa eine einzelne Police abrufen und direkt in den Druck geben», sagt Michel Fuchs.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Rechnungsversand nutzt die SGV ePost bereits für ein weiteres Projekt. Als zuständige Behörde für den Brandschutz im Kanton Solothurn sowie als Fachstelle für die Elementarschadenprävention verschickt die SGV zahlreiche Verfügungen. Diese regeln, welche Anforderungen ein Gebäude bezüglich Prävention erfüllen muss, etwa bezogen auf Fluchtwege, Notbeleuchtungen oder Hagelschutz. Die Dokumente werden über das Workflowmanagementsystem der Prävention digital erstellt und via ePostSchnittstelle für den Druck übergeben. «Es handelt sich um individuelle, komplexe Dokumente, die oftmals unterschiedlich
Webinar
Der Digitale Brief –einfach in Ihre Software integriert
20. November 2025, 11 – 11:45 Uhr
Erfahren Sie, wie Sie den Hybriden Brief der Post rechtssicher und kundenorientiert in Ihre Software einbinden. In einer Live-Demo zeigen wir die technische Umsetzung und geben praktische Tipps für den Einstieg. Jetzt kostenlos anmelden!

tinyurl.com/Webinar-ePost
sind», erläutert Michel Fuchs. Denn die Ausgangslage und damit auch die Verfügung für ein älteres Holzgebäude, ein modernes Mehrfamilienhaus oder einen Industriebetrieb sind komplett unterschiedlich. Die Anbindung dieser Applikation an ePost konnte die SGV weitgehend selbst übernehmen. Sowohl die Datenübergabe wie auch das Dokumentenrendering funktionieren einwandfrei.
Fünf weitere kantonale Gebäudeversicherungen arbeiten mit der gleichen Versicherungsapplikation wie die SGV. Einige davon befinden sich nun bereits in der Umsetzung ihrer eigenen ePost-Anbindungen. «In unserer Branche schaut man gerne, was bei den anderen funktioniert und orientiert sich daran», sagt Michel Fuchs.
Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch ePost Service AG, eine Digitalisierungsspezialistin der Schweizerischen Post. www.epost.ch
Das KMU Fachforum 2025 hat einmal mehr gezeigt, wie wertvoll der persönliche Austausch ist. Im Heuboden in Holzhäusern trafen sich gegen 120 Gäste, um über Daten, Veränderung und digitale Strategien zu sprechen – und vor allem: voneinander zu lernen. Sieben praxisnahe Vorträge, zwei thematische Sessions und viel Raum für echte Gespräche machten den Anlass zu einem Ort, an dem Digitalisierung greifbar wurde.

Am 28. August 2025 fand das KMU Fachforum bereits zum dritten Mal statt – und hat sich als Fixpunkt im Kalender vieler Schweizer KMU etabliert. Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichsten Branchen, der Heuboden in Holzhäusern ZG bot den passenden Rahmen für Austausch, Impulse und neue Kontakte. Der Anlass verband sieben pointierte Vorträge mit viel Raum für Gespräche und Reflexion.
Digitalisierung mit Substanz
Die digitale Transformation ist längst kein abstraktes Zukunftsthema mehr – sie betrifft jedes Unternehmen, unabhängig von Grösse oder Branche. Genau hier setzt das KMU Fachforum an: Es schafft eine Plattform, auf der konkrete Erfahrungen geteilt, Herausforderungen diskutiert und Lösungen sichtbar gemacht werden.
Nach der Begrüssung durch die Veranstalter Kevin Klak (Digitalrat) und Cyrill Schmid (topsoft) eröffnete Dirk Apel mit seiner Keynote «Vom Hype zum Alltag: Wie Automatisierung die Mobilität verändert» den inhaltlichen Teil. Die Diskussion im Anschluss zeigte: Die Teilnehmenden wollten nicht nur zuhören, sondern mitdenken und mitreden.
Zwei Sessions, zwei Perspektiven
Die sechs Fachvorträge des Tages waren in zwei Sessions gegliedert –mit klaren thematischen Schwerpunkten:
• Session 1: Veränderung
• Session 2: Daten
Sponsoren KMU Fachforum 2025

Amazon Web Services (AWS) Mythenquai 10 8002 Zürich aws.amazon.com aws.amazon.com/contact-us
Seit 2006 ist AWS das umfangreichste Cloud-Angebot der Welt mit heute über 240 Services für Die globale Infrastruktur umfasst 117 Verfügbarkeitszonen in 37 Regionen weltweit. Millionen von Kunden – darunter einige der am schnellsten wachsenden Startup-Unternehmen sowie grosse Konzerne, wichtige Behörden und lokale KMUs – vertrauen auf AWS, wenn es darum geht, agiler zu werden, Kosten zu senken und ihre Infrastruktur leistungsfähiger zu machen.
Mit Büros in Zürich, Genf und Bern sowie der Cloud-Region AWS Europe (Zurich) mit drei Verfügbarkeitszonen unterstützt AWS über zehntausend aktive Kunden in der Schweiz - darunter Clariant, Helvetia, Novartis und Swisscom.
Die Investition von 5,9 Milliarden Franken in die Schweizer Cloud-Infrastruktur wird über 15 Jahre einen Beitrag von 16,3 Milliarden Franken zum BIP leisten und über 2500 Vollzeitstellen unterstützen. Kunden profitieren von lokaler Datenspeicherung und vollständiger Datenkontrolle.
Produkte / Kernkompetenzen Datenverarbeitung Datenspeicherung
Datenbanken
Analytics Machine Learning künstliche Intelligenz (KI) Internet der Dinge (IoT) Sicherheit hybride Umgebungen

Batix Schweiz AG Grindlenstrasse 3 8954 Geroldswil T +41 44 545 32 70 www.batix.ch info@batix.ch
Kontakt
Dirk Apel
Dein Erfolg ist unser Programm – mit Leidenschaft und Kreativität entwickeln wir innovative «Swiss Made Software» für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
Das Fundament unserer Entwicklungskompetenz bildet die IT Beratung. Wir helfen die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Erfolg von IT Projekten sicherzustellen.
Dank unserer Expertise in der IT-Beratung ermöglicht uns unser agiles Framework, schnell auf Feedback zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen, um optimale Ergebnisse für deine IT-Projekte zu erzielen.
Das Leistungsangebot der Batix umfasst sowohl die Beratung, Realisierung und den Betrieb von individuellen Softwarelösungen, als auch die Entwicklung und den Vertrieb von eigenen standardisierten Branchenlösungen als Software as a Service.
Produkte / Kernkompetenzen
IT Beratung
Software-Entwicklung
BX: EDUCATION
ERP für Bildung
ERP für Verbände
In der ersten Session sprach Marc Boixet von Kambly SA über die Dynamik von Veränderungsprozessen und den produktiven Umgang mit Rückschlägen. Max Burian von Dectris zeigte, wie ein KMU mit Wurzeln in der Spitzenforschung neue digitale Wege beschreiten kann. Bettina Gimenez von Dancing Queens beeindruckte mit ihrer Geschichte vom Start-up zur internationalen Community – getragen von Strategie und Herzblut.
Die zweite Session widmete sich dem Thema Daten. Marcus Bitterlich von den Pilatus Flugzeugwerken erläuterte, wie Unternehmen ihre Daten gewinnbringend nutzen können. Daniela Küttel von der Neugass Kino AG sprach über die digitale Transformation analoger Kinobetriebe. Und Jens Fischer von BICO zeigte, wie datenbasierte Ansätze das Geschäftsmodell neu definieren können.

CashCtrl AG
Pumpwerkstrasse 33
4142 Münchenstein
T +41 61 506 01 37 www.cashctrl.com info@cashctrl.com
Kontakt
Raphael Amport
CashCtrl ist eine mandantenfähige Buchhaltungssoftware für KMU, Selbständige und Treuhänder:innen. Kern ist eine FiBu mit Auftragsbearbeitung, Berichten, Lohnbuchhaltung und vielen ERP-Funktionen.
Betrieb, Backup, Entwicklung, Support alles 100 % Swissmade in Münchenstein. CashCtrl gibt wenig Schritte vor und passt für viele Branchen. Treuhandprofis sowie Einsteiger:innen schätzen das klare UI, und die nachvollziehbare Funktionsweise. Für spezifische Workflows sind Anbindungen eigener Apps und Scripte über die API möglich.
Gepflegt wird ein direkter Austausch mit der Community, kostenloser technischer Support (soweit möglich) und eine faire Preisstruktur.
Ziel der CashCtrl AG ist nicht unlimitierte Gewinnmaximierung, sondern immer etwas an die Internetgemeinschaft zurückzugeben. Davon profitieren auch wir immer wieder. Darum ist ein grosser Teil unserer Software seit über 10 Jahren komplett kostenlos.
Produkte / Kernkompetenzen
Guter Support (5* Google)
Erweiterbar
Stark konfigurierbar
Updates inklusive Offene Webinare Viele Tutorials Faire Preise
CashCtrl Pro (CHF 350/Jahr)

DATANOMIQ AG
Hirschmattstrasse 30a 6003 Luzern
T +41 79 596 42 85 www.datanomiq.ch benjamin.aunkofer@datanomiq.io
Kontakt
Benjamin Aunkofer
DATANOMIQ ist ein unabhängiger Beratungs- und Service-Partner für Business Intelligence, Process Mining und Data Science / AI.
Wir richten massgeschneiderte Enterprise AI auf Basis von GenAI und Data Lakehouse Systemen für Ihre Unternehmensorganisation ein, mit denen Sie die Effizienz im Unternehmen erhöhen, Kundenbedürfnisse schneller erfassen und Risiken besser kontrollieren können.
Typische Umsetzungsprojekte sind dynamische KI-WissensmanagementSysteme für Unternehmen, die Wissen langfristig in der Unternehmensorganisation binden möchten. Aber auch die Rekonstruktion von Informationen aus operativen Unternehmensprozessen heraus und das KI-Training für Prozessoder Produkt-spezifischen KI-Services, wie etwa Forecasting oder Fall-Klassifikation, gehören zum Spektrum.
Stets mit dem Anspruch, erste Ergebnisse bereits in drei bis vier Wochen sichtbar zu erhalten.
Individuelle Termine für Workshops und Trainings im Bereich Data & AI gehören dazu. Fragen Sie uns gerne unverbindlich dazu an.
Produkte / Kernkompetenzen
Enterprise AI / GenAI Statistik / Data Science Business Intelligence und Process Mining Datenstrategie und KI-Strategie
Ein Markenzeichen des KMU Fachforums sind die grosszügig bemessenen Pausen zwischen den Programmpunkten. Sie bieten Raum für Gespräche, spontane Ideen und den Aufbau neuer Beziehungen. Der Apéro und das anschliessende Abendessen rundeten den Tag ab – mit angeregten Diskussionen, persönlichen Begegnungen und vielen zufriedenen Gesichtern.
Fazit
Das KMU Fachforum 2025 hat erneut gezeigt, wie wertvoll der direkte Austausch zwischen Schweizer KMU ist. Die Mischung aus Fachwissen, Praxisnähe und persönlicher Begegnung macht den Anlass zu einem echten Highlight – und zu einem Ort, an dem Digitalisierung nicht nur diskutiert, sondern gelebt wird.

iosys GmbH
informatics solutions ag Dammweg 4 5503 Schafisheim +41 62 885 60 30 www.isinf.ch contact@isinf.ch
Kontakt
Michael Rohn
Als informatics solutions ag realisieren wir ERP- und umfassende Business-ITLösungen für Unternehmen im nationalen und internationalen Umfeld auf Basis Infor LN/Cloud Suite Industrial Enterprise (IE). Unsere Kunden vertrauen auf über 20 Jahre Projekterfahrung aus Fertigungs-, Handels,- und Dienstleistungsprojekten. Wir blicken zurück auf über 100 erfolgreiche ERP-Einführungen, Migrationen und grössere Softwareentwicklungsprojekte im ERP Infor LN/Cloud Suite IE Umfeld. Und wir blicken nach vorne – mit Cloud-Lösungen inkl. umfassender AMS-Betreuung.
Nachhaltigkeit, Qualität und langjährige Partnerschaften stehen bei uns im Vordergrund. Wir verfügen über ein stabiles und sehr kompetentes Kernteam. Wir sind davon überzeugt, dass nur Systeme mit strategischen Lösungsansätzen und visionären Technologien nachhaltigen Erfolg für Unternehmen garantieren.
Seit 2023 sind wir Teil der AZTEKA Consulting GmbH – unserem über viele Jahre und in vielen Projekten bekannten Kooperationspartner.
Produkte / Kernkompetenzen
Infor CloudSuite Industrial Enterprise Application Management Services
Rainweg 4b 6313 Menzingen T +41 79 759 70 70 https://iosys.swiss contact@iosys.swiss
Kontakt
Chris Ryan
Als Experte für die Digitalisierung von Fertigungsprozessen stärkt iosys die Wettbewerbsfähigkeit von fertigenden KMUs. Unsere modulare und messbare Vorgehensweise lässt sich flexibel auf bestehende Systeme, Strukturen und Abläufe abstimmen.
Anstelle von unpassenden Standardsystemen entwickelt iosys kundenspezifische Lösungen für fertigende KMUs. Dazu verbinden wir unsere Industrieerfahrung mit unserer Expertise in Lean Management, IoT Applikationen, Data Engineering, Cloud und KI.
Anhand der Vernetzung von Fabrikhalle und Betriebsprozessen ermöglichen wir die umfassende Erfassung und Nutzung von Produktionsdaten. Industriefirmen wie maxon motor oder SMPtec setzen auf unsere Smart Factory Lösungen zur Optimierung ihrer Produktionsprozesse.
Auf Basis eines soliden Verständnisses Ihrer Situation und Prozessen führen wir Sie schrittweise und in Ihrem Tempo zu einer transparenten und datengesteuerten Produktion. Unsere Vision ist die Entwicklung betriebseigener KI-Lösungen in der Fertigung.
Produkte / Kernkompetenzen Vernetzung von Fabrikhalle (OT) mit ERP und anderen Systemen (IT) IoT, Microservices, Edge Applikationen, Data Engineering, Cloud Computing, KI-Lösungen Vision: Entwicklung betriebseigener KI-Lösungen zur Optimierung der Produktion
Die nächste Ausgabe des KMU Fachforums ist bereits in Planung und wird voraussichtlich am 27. August 2026 stattfinden. Auch dann stehen wieder praxisnahe Impulse, inspirierende Referate und viel Raum für Austausch im Zentrum.
Alle Informationen zur Veranstaltung, zur Anmeldung und zum Fachforum-Newsletter gibt es stets aktuell unter: www.kmu-fachforum.ch

Gezielte Desinformation ist längst nicht mehr nur ein politisches Problem. Sie bedroht auch Wirtschaft und Gesellschaft. Das neue Handbuch «33 Desinformationstechniken» von ReclaimTheFacts zeigt, wie Manipulation funktioniert – und wie wir uns schützen können. Gerade für Schweizer KMU und IT-Fachkräfte ist das Thema hoch relevant: von russischer Propaganda bis zu Angriffen auf Entwicklungen wie 5G, Windkraft und eFuels.
Rui Biagini und Peter Metzinger
Desinformation als Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft
Fake News sind kein Randphänomen mehr. Sie sind ein strategisches Instrument – ob in der russischen hybriden Kriegsführung, bei Kampagnen gegen den Ausbau der 5G-Infrastruktur oder im Widerstand gegen Windkraftanlagen. Gemeinsam ist all diesen Fällen: Es geht nicht nur um Meinungsbildung, sondern um die gezielte Schwächung unserer Gesellschaft und Wirtschaft.
Für die Schweiz ist das besonders relevant. Investitionen in die Energieversorgung oder in die digitale Infrastruktur können durch orchestrierte Desinformationskampagnen massiv verzögert oder gar verhindert werden. Damit entstehen nicht nur volkswirtschaftliche Schäden, sondern auch Risiken für die Versorgungssicherheit.
Das Handbuch: 33 Techniken auf einen Blick
Das von ReclaimTheFacts veröffentlichte Handbuch «33 Desinformationstechniken» bietet erstmals eine systematische Übersicht. Die Methoden reichen von emotionalisierenden Übertreibungen über logische Fehlschlüsse bis hin zu Verzögerungstaktiken, die politische Prozesse blockieren. Jede Technik wird anhand von Beispielen erläutert und macht sichtbar, wie subtil oder plump Manipulation ablaufen kann.
Die Struktur des Handbuchs ist praxisnah: Fünf Kategorien ordnen die 33 Tricks. So werden narrative Manipulation, selektive Faktendarstellung oder auch die gezielte Verwirrung durch Informationsflut nachvollziehbar erklärt.
Neu ist der systematische Ansatz: Statt Einzelbeispiele zu sammeln, wird ein «Werkzeugkasten der Manipulation» vorgestellt, der auch die Dynamik beschreibt – etwa wie Desinformationstechniken kombiniert und verstärkt werden, um maximale Wirkung zu erzielen.
Herausgeber des Handbuchs ist ReclaimTheFacts, eine Initiative, die sich seit 2020 intensiv mit Desinformation befasst. In Projekten, Workshops und Analysen hat sie Muster, Netzwerke und Wirkungen von Fake News untersucht und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Dieses Wissen ist in das Handbuch eingeflossen, das sich nicht nur an politische Akteure richtet, sondern auch an Unternehmen, Schulen und Medien. Hauptautor ist Rui Biagini, Informatiker und langjähriger Experte für digitale Manipulationsstrategien, der sich seit Jahren bei ReclaimTheFacts engagiert.
Kampagnen gegen den Verbrennungsmotor
Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für Desinformation sind die Kampagnen gegen den Verbrennungsmotor. Hierbei werden PR-Berichte als angebliche Studien getarnt, die auf fragwürdigen Annahmen beruhen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Produktion von eFuels ineffizient sei und die Zukunft der Mobilität ausschliesslich elektrisch sein müsse.
Dabei werden mehrere Techniken kombiniert: Rosinenpicken (Auswahl einzelner Daten), falsche Dichotomie (nur Elektro oder Verbrenner) und Pseudo-Experten (PR-Berichte als «Studie»).
Solche Narrative verschweigen zentrale Aspekte: eFuels lassen sich klimaneutral herstellen, sie sind speicher- und transportfähig und sichern die Treibstoffversorgung auch in Bereichen, wo Batterien nicht praktikabel sind – etwa bei Langstreckenflügen oder im Militär.
5G, Windkraft und eFuels – typische Methoden
Bei 5G-Kampagnen zeigt sich häufig die Technik des Schürens von Angst: Gefahren für Gesundheit werden behauptet, obwohl keine wissenschaftliche Evidenz besteht. Hinzu kommt das Berufen auf Pseudo-Experten, die mit scheinbarer Autorität Panik verbreiten.
Windkraftgegner setzen gerne auf falsche Analogien («Windräder zerstören Landschaften wie Autobahnen») sowie auf Übertreibungen zu angeblichen Gesundheitsfolgen. Oft wird auch die Verschiebung der Zielpfosten genutzt: Sobald Argumente entkräftet sind, werden neue Gründe gegen den Ausbau erfunden.
Gegner von eFuels greifen, wie beschrieben, zu selektiver Faktendarstellung und Verzögerungstaktiken, indem sie endlose neue Studien fordern, obwohl die Grundlagen längst geklärt sind.
Beispiele aus dem Handbuch
Besonders hilfreich sind die konkreten Beispiele, die das Handbuch liefert. So wird etwa die Technik der falschen Analogie erläutert: Windkraftgegner vergleichen Windräder mit «Umweltzerstörern», obwohl diese pro erzeugter Kilowattstunde deutlich weniger Fläche beanspruchen als fossile Energieformen.
Ein weiteres Beispiel ist die Überflutung mit Halbwahrheiten – auch bekannt als «Feuerwehrschlauch der Lüge». Dabei werden so viele Behauptungen gleichzeitig gestreut, dass es kaum möglich ist, alle zu widerlegen.
Ein Klassiker ist auch das Rosinenpicken: Gegner von 5G oder eFuels greifen gezielt einzelne Studien oder Datenpunkte heraus, die scheinbar ihre Position stützen, und verschweigen den breiten wissenschaftlichen Konsens.
Hinzu kommen die Personalisierung und Ablenkung: Statt über die Sache zu diskutieren, werden einzelne Personen diffamiert oder ihre Motive infrage gestellt. Gerade in lokalen Debatten über Windkraft wird so versucht, Kritiker mundtot zu machen.
Das Handbuch liefert dazu nicht nur Definitionen, sondern auch Hinweise, wie man solche Techniken in der Praxis erkennen kann. Auf der Website www.ReclaimTheFacts.com finden sich auch Checklisten und weitere Tipps. Für Führungskräfte, Kommunikatoren und IT-Fachleute sind dies wertvolle Werkzeuge, um Debatten sachlich zu halten und Manipulation frühzeitig zu entlarven.
Die Schweiz ist stark vernetzt und exportorientiert. Stabilität und Verlässlichkeit gehören zu ihren Markenzeichen. Wenn Desinformation diese Grundlagen angreift, steht weit mehr als ein politisches Detail auf dem Spiel: Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen und um die Planbarkeit für Unternehmen.
Ein anschauliches Beispiel sind Kampagnen gegen Windenergie: Sie bremsen nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern gefährden auch die Versorgungssicherheit und die Umsetzung der Energiestrategie. Dasselbe gilt für die gezielte Verunsicherung beim Thema 5G, die Investitionen und Innovationen hemmen kann.
Das Handbuch von ReclaimTheFacts will nicht belehren, sondern befähigen. Wer die 33 Techniken kennt, erkennt sie schneller und kann ihnen besser begegnen. Für Unternehmen bedeutet das:
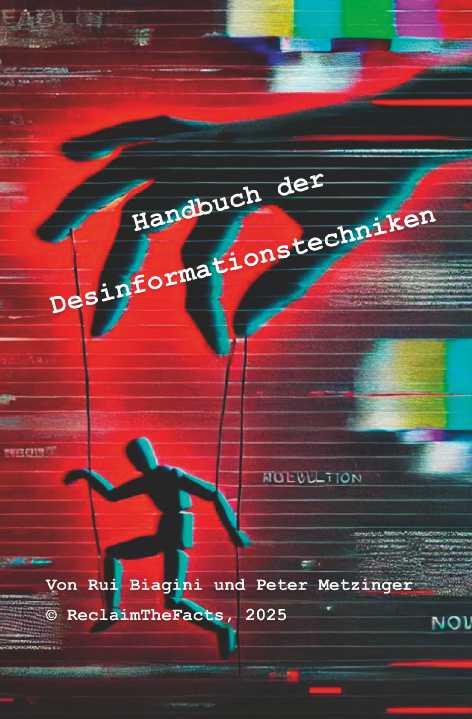
• Sensibilisierung der Mitarbeitenden, insbesondere in Kommunikation und IT
Monitoring von Kanälen, um koordinierte Desinformation frühzeitig zu identifizieren
• Transparenz in der eigenen Kommunikation, um Angriffen weniger Angriffsfläche zu bieten
• Kooperation mit Branchenverbänden und Behörden, um Schutzmassnahmen zu koordinieren
Desinformation ist Teil der digitalen Realität – ob als Werkzeug autoritärer Staaten, wirtschaftlicher Konkurrenten oder lokaler Interessengruppen. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Das Handbuch «33 Desinformationstechniken» ist ein wertvolles Instrument, um die eigene Resilienz zu stärken. Für Führungskräfte, die Verantwortung für Unternehmen und Mitarbeitende tragen, lohnt sich die Lektüre in jedem Fall.
Das Handbuch gibt es digital (kostenlos) und als Taschenbuch: www.reclaimthefacts.com/handbuch
Rui Biagini engagiert sich seit Jahren bei ReclaimTheFacts und ist Hauptautor des Handbuchs.
Peter Metzinger, auch bekannt als Mr. Campaigning, ist Gründer von ReclaimTheFacts und hat wichtige Inputs für das Buch geliefert. www.reclaimthefacts.com
Webinar am 27. November 2025, 11:00–11:45 Uhr
Papierstapel, manuelle Freigaben, verlorene Rechnungen? Das muss nicht sein! In diesem kompakten Webinar zeigen Ihnen die Experten von PROXESS und EASY SOFTWARE, wie moderne KI-Technologien Ihre Rechnungsverarbeitung digitalisieren –schnell, sicher und effizient.
Das erwartet Sie:
• Clever: Automatische Erkennung von Rechnungsnummern, Beträgen, Lieferanteninfos und Zahlungsfristen – ganz ohne manuelles Zutun.
Effizient: Flexible Workflows mit ERP-Anbindung –ob mit oder ohne Bestellbezug.
• Sicher: Revisionssichere Archivierung nach GeBüV –für maximale Compliance.
Ob Buchhaltung oder Finanzverantwortung: Dieses Webinar zeigt praxisnah, wie smarte Rechnungsverarbeitung heute funktioniert – verständlich, direkt umsetzbar und mit echtem Mehrwert.
Referenten:
• Donato Melillo, Geschäftsführer PROXESS GmbH Schweiz
• Felix True, Head of Presales, EASY SOFTWARE AG
Sie haben dann keine Zeit?
Melden Sie sich trotzdem an, Sie erhalten im Nachgang automatisch den Link zum Webinar-Replay.

https://qrco.de/bgJaAc
Webinar am 20. November 2025, 11:00–11:45 Uhr
Ab 2026 wird der Hybride Brief Teil der postalischen Grundversorgung – und damit zum neuen Standard für die digitale Zustellung von Behörden- und Geschäftspost. Für KMU und Softwareanbieter heisst das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diesen Kanal in bestehende Lösungen zu integrieren.

Im kostenlosen Webinar zeigen Fachleute von ePost Service, wie die Integration gelingt – einfach, rechtssicher und nach den Präferenzen der Empfängerinnen und Empfängern. Sie erfahren, wie ePost API, OneAPI und MFT eingesetzt werden, sehen eine Live-Demo der technischen Umsetzung und erhalten konkrete Tipps für den Einstieg.
Das Webinar richtet sich an Produktverantwortliche, Systemarchitektinnen und Entwickler, die ihre Software fit für die Zukunft machen wollen – mit echtem Mehrwert für die Kundschaft.
Falls Sie keine Zeit haben, melden Sie sich trotzdem an: Ein Replay-Link wird zur Verfügung gestellt.

tinyurl.com/Webinar-ePost
Digital-Event, 7. November 2025, 10:00–11:00 Uhr

Bild: ChatGPT
Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Trend – sie verändert, wie Unternehmen arbeiten, entscheiden und wachsen. Doch wie sieht das konkret im ERP-System aus? Was kann KI heute schon leisten und wo bringt sie echten Mehrwert?
Im Digital-Event «KI im ERP – Ihr Copilot für die Zukunft» zeigt Ihnen der erfahrene ERP-Berater Carlos Bouzo anhand realer Anwendungsbeispiele, wie KI bereits produktiv eingesetzt wird. Sie erfahren, wie intelligente Funktionen Prozesse vereinfachen, Entscheidungen unterstützen und neue Möglichkeiten eröffnen –ganz konkret, ohne Science-Fiction.
Ob automatische Belegerkennung, smarte Prognosen oder Assistenzfunktionen: KI im ERP ist keine Vision mehr, sondern ein praktisches Werkzeug für den Alltag. Und das Beste: Sie sehen live, wie es funktioniert.
Für wen? Für alle, die ihr ERP-System zukunftssicher machen wollen – ob IT-Verantwortliche, Geschäftsleitende oder Digitalisierungsbegeisterte.
Jetzt anmelden
Was erwartet Sie?
• Praxisnahe Einblicke in KI-gestützte ERP-Funktionen
• Live-Demo mit konkreten Beispielen
• Ein kritischer Blick auf die Herausforderungen
Die neue Methode «KI 4 KMU» zeigt, wie auch kleinere Unternehmen strukturiert und souverän ins KI-Zeitalter starten können –ganz ohne Buzzwords, aber mit System.
Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Hype – auch für kleine und mittlere Unternehmen. Doch der Einstieg fällt vielen KMU schwer: Wo anfangen? Was bringt’s konkret? Und wie bleibt man handlungsfähig, ohne gleich ein Data-Science-Team aufzubauen?
Genau hier setzt die neue «KI 4 KMU»-Methode an, entwickelt von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Zusammenarbeit mit Praxispartnern. Herzstück ist ein dreistufiger Fahrplan, der Unternehmen hilft, KI-Potenziale systematisch zu erkennen und umzusetzen:
Design: Wo lohnt sich KI im Betrieb?
• Build: Wie entwickelt man erste Lösungen?
• Run: Wie integriert man KI in den Alltag?
Begleitet wird das Vorgehen von einem über 370 Seiten starken Leitfaden und einem modularen Workshop-Canvas, mit dem sich konkrete Projekte planen lassen – von der Idee bis zur Umsetzung. Die Unterlagen sind kostenlos verfügbar und richten sich an Fachpersonen, die KI nicht nur verstehen, sondern strategisch nutzen wollen.
Besonders relevant: Die Methode berücksichtigt auch Aspekte der digitalen Souveränität – etwa die Frage, wo Daten gehostet werden, wer Zugriff hat und wie man sich unabhängig von proprietären Plattformen macht. Damit wird KI nicht nur zum Innovationsmotor, sondern auch zum strategischen Werkzeug für mehr Selbstbestimmung im digitalen Raum.
Weitere Informationen und Download unter www.ki-zentrum.ch

https://qrco.de/ bgKZd4

Digitale Arbeitskräfte als HR-Strategie der Zukunft
Laut einer internationalen Studie von Salesforce wird der Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen bis 2027 um 327 Prozent steigen. Das soll die Produktivität um 30 Prozent erhöhen und die Arbeitskosten um 19 Prozent senken. HR-Führungskräfte rechnen mit tiefgreifenden Veränderungen in Organisation und Mitarbeiterentwicklung – für ein Viertel der Beschäftigten könnte sich die Rolle im Unternehmen grundlegend ändern.
QR-Code scannen – und sehen, was auf das HR zukommt


CBR Trading AG optimiert Prozesse mit JTL-Wawi
Die CBR Trading AG – in der Region Basel besser bekannt als Munitionsdepot – zählt zu den grössten Fachgeschäften für Waffen, Munition und Zubehör. Neben einem breiten Sortiment überzeugt das Unternehmen mit sofortiger Verfügbarkeit und persönlicher Beratung. Doch mit dem Wachstum stieg auch die Komplexität: Lagerverwaltung, Kassenprozesse und Verkaufskanäle mussten neu gedacht werden. Mit JTL-Wawi fiel der Startschuss für die digitale Zukunft.
Jetzt QR-Code scannen und Details zur Lösung lesen


Opacc erneut als Friendly Work Space ausgezeichnet
Die Luzerner Softwareherstellerin Opacc Software AG wurde Ende August 2025 zum vierten Mal in Folge mit dem Label «Friendly Work Space» der Gesundheitsförderung Schweiz ausgezeichnet. Das Unternehmen trägt das Qualitätslabel bereits seit 2013 – damals als erstes zertifiziertes IT-Unternehmen der Schweiz. Die erneute Auszeichnung bestätigt das konsequente Engagement für ein systematisches und gelebtes betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch bei der diesjährigen Rezertifizierung erhielt Opacc Bestnoten.
Mehr zur Auszeichnung via QR-Code

Warum Ihre Daten besser in der Schweiz bleiben Datenschutz, Datensicherheit und digitale Selbstbestimmung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Umso wichtiger ist die Wahl des richtigen Anbieters und Hosting-Standorts für Ihre SaaS-Lösung. Eine Schweizer Lösung wie DeepCloud bietet echte Vorteile: strenge DSG-Vorgaben, hohe Sicherheit und Schutz vor dem US-amerikanischen CLOUD Act. Das Ökosystem basiert auf Schweizer Infrastruktur, unterliegt Schweizer Recht und erfüllt höchste Standards bei Datenschutz und Compliance.
QR-Code scannen und mehr erfahren

Proalpha übernimmt Insiders und stärkt KI-Kompetenz
Die Proalpha Group erweitert ihre Industrial AI Platform durch die Übernahme der Insiders Technologies GmbH. Mit nun 500 KI-Expertinnen und -Experten – darunter auch die Teams von Nemo und Empolis – baut Proalpha ihre Expertise in der digitalen Dokumentenverarbeitung weiter aus. Gleichzeitig vertieft das Unternehmen die Zusammenarbeit mit renommierten Forschungspartnern wie dem DFKI, den Fraunhofer-Instituten und der RPTU.
Weiterlesen via QR-Code


IT-Servicekatalog: Struktur schafft Entlastung
Ein IT-Servicekatalog bietet eine strukturierte Übersicht aller IT-Services, die den Nutzern zur Verfügung stehen. Diese Übersicht ist sowohl für die IT-Teams als auch für die Melder von unschätzbarem Wert. Dies ist für viele IT-Abteilungen der erste Schritt, um von einer reaktiven zu einer proaktiven Arbeitsweise zu wechseln. Aber was genau ist ein IT-Servicekatalog und wie lässt er sich in einer Organisation einführen?
QR-Code scannen und mehr erfahren

14. Oktober 2025
Webinar: KI im ERP – Ihr Copilot für die Zukunft Online redPoint & topsoft | www.topsoft.ch/events
29. Oktober 2025
Webinar: Entdecken Sie Odoo Online braintec | www.braintec.ch/odoo-webinar
6. November 2025
Digital Experience 2025
Memox Innovations AG, Zürich swiss made software und ePost | www.epost.ch/ digital-experience-anmeldung
18. November 2025
DINAcon 2025
Kongresszentrum Kreuz, Bern CH Open | www.dinacon.ch
19. November 2025
Suissedigital-Day 2025
Kursaal, Bern
Suissedigital | www.suissedigital.ch
20. November 2025
Webinar: Der Digitale Brief in Ihrer Software – einfach integriert Online ePost & topsoft | www.topsoft.ch/events
27. November 2025
Webinar: Mit KI zur smarten Eingangsrechnungsverarbeitung Online PROXESS & topsoft | www.topsoft.ch/events
27. August 2026
KMU Fachforum 2026
Heuboden, Holzhäusern/Rotkreuz ZG topsoft & Digitalrat | www.kmu-fachforum.ch
Änderungen bleiben vorbehalten
Details und weitere Veranstaltungen: www.topsoft.ch/events
Senden Sie Ihre Veranstaltungshinweise an: redaktion@topsoft.ch
topsoft Fachmagazin 25-4 | 5. Dezember 2025
Workplace & Collaboration: Effizienz für KMU
Themen-Cluster: Service & Operations; Workplace & Collaboration
Marktübersicht: DMS, Workflow und Posteingang
Special: Zukunft der Arbeitswelt
topsoft Fachmagazin abonnieren: www.topsoft.ch/abo | T +41 41 467 34 20
topsoft aktuell-Newsletter abonnieren: www.topsoft.ch | T +41 41 467 34 20
Marktübersicht Business IT: www.topsoft.ch/search
Herausgeber
schmid + siegenthaler consulting gmbh
Willistattstrasse 23
6206 Neuenkirch www.topsoft.ch T +41 41 467 34 20
Redaktion
Alain Zanolari redaktion@topsoft.ch
Cyrill Schmid c.schmid@topsoft.ch
Layout und Gestaltung
Konzeption und Titelbild: Andrea Krauer
Umsetzung: Brunner Medien
Anzeigenmarketing
Cyrill Schmid c.schmid@topsoft.ch
Adrian Frei a.frei@topsoft.ch
Bilder und Fotos
Seite 11 zVg Urs Prantl
Seite 13 zVg VLEXbusiness
Seite 14 zVg redPoint
Seite 15 zVg redPoint
Seite 19 AdobeStock
Seite 23 Copilot
Seite 28 zVg revamp-it
Seite 31 zVg Liip
Seite 40 zVg KMU Fachforum
Seite 43 zVg Reclaim the Facts
Seite 44 Copilot
Seite 45 ChatGPT
Druck
Brunner Medien AG
Arsenalstrasse 24 6010 Kriens
Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Redaktion und unter genauer Quellenangabe gestattet. Alle Beiträge –ob namentlich gekennzeichnet oder redaktionell verfasst – geben die Auffassung der jeweiligen Autorenschaft wieder und entsprechen nicht zwingend der Meinung der Redaktion.
Alle Urheberrechte an den in Fallstudien, Success Storys, Paid Contents und Advertorials beschriebenen Lösungen liegen beim jeweiligen Lösungsanbieter. Die Verantwortung für den Schutz allfälliger Urheberrechte Dritter liegt ebenfalls bei den Lösungsanbietern.
Mit über 3.5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern erreicht eBill mittlerweile gut die Hälfte aller Schweizer Haushalte.
Zahlungszuverlässigkeit
Rechnungen werden mit eBill pünktlicher bezahlt. Dadurch sind Zahlungseingänge besser kalkulierbar.
Sicherheit
Mit eBill profitieren sie von den hohen Sicherheitsstandards des Schweizer Finanzplatzes.
Alle grossen Banken der Schweiz bieten eBill an. So erhalten Sie Ihre Rechnungen direkt im Online Banking.
eBill-Transaktionen im Jahr 2024. Jeden Monat versenden Unternehmen Millionen von eBill-Rechnungen.
Jährliches Wachstum der Transaktionenüber 20 %.
Die Lösung wird in der Schweiz entwickelt und betrieben.
Eine eBill-Rechnung schont Ressourcen und spart Papier. Mit der neuen Spende-Funktion können eBill-Nutzerinnen und -Nutzer zukünftig aktiv gemeinnützige Projekte unterstützen.
setzen für ihre Rechnungsstellung bereits auf eBill – Tendenz steigend. Darunter die grössten Krankenkassen und Versicherungen, alle Schweizer Telecom-Anbieter sowie die Energieversorger der grössten Schweizer Kantone.
Alle können von eBill profitieren. Jetzt umstellen und eBill aktivieren. Privat- und Geschäftskunden
Jetzt mehr erfahren auf ebill.ch oder direkt bei unseren Partnern