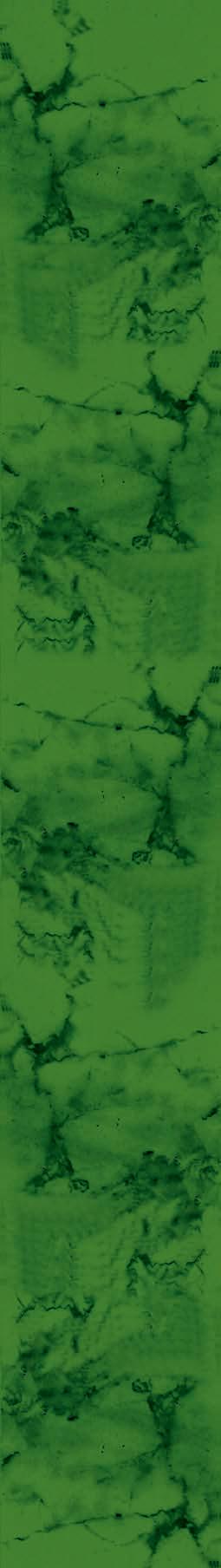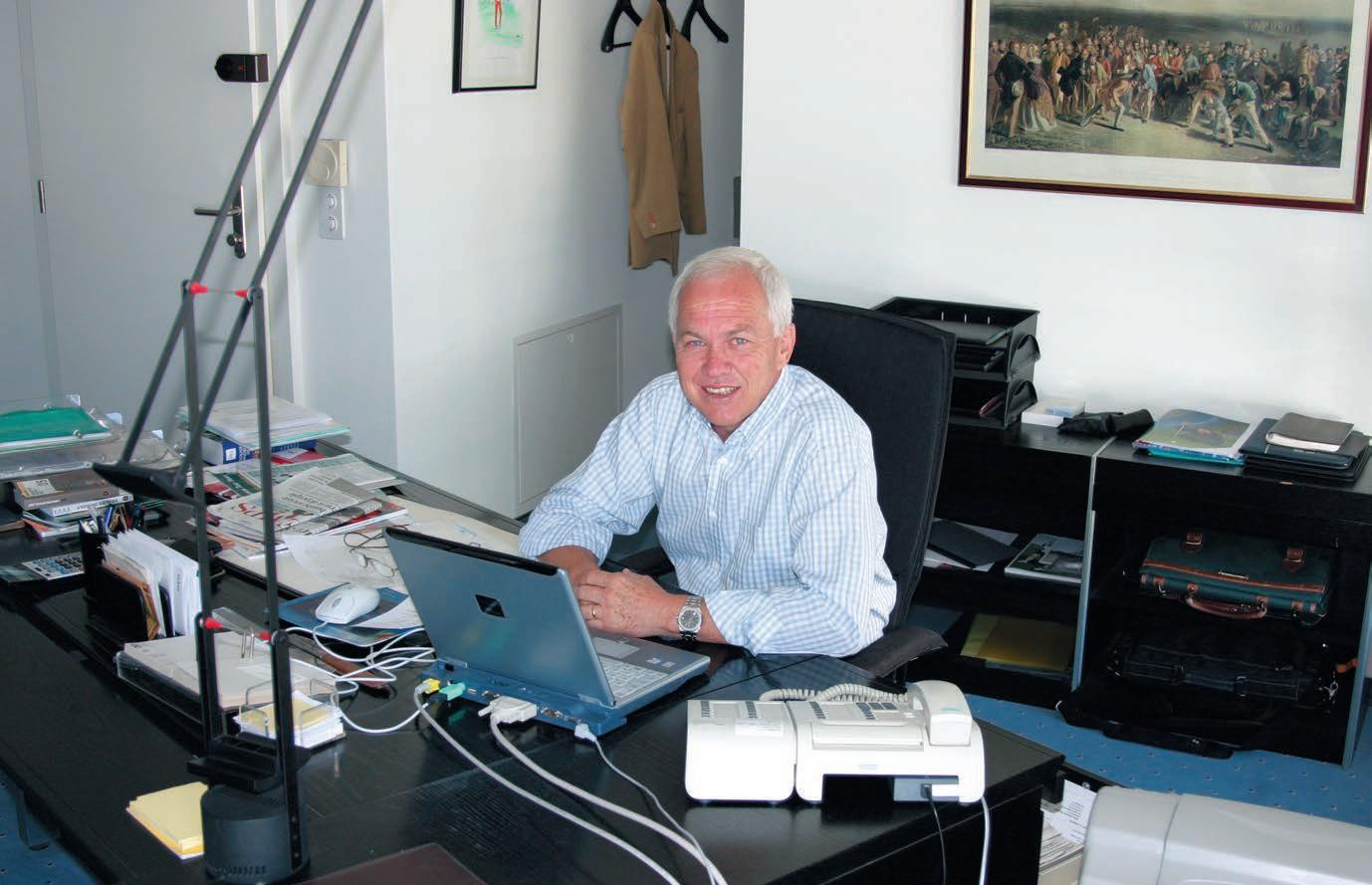
8 minute read
ASG «on the Move»
Einiges ist innerhalb der ASG in Bewegung geraten. Martin Kessler, seit Januar 2005 Präsident des Verbandes, hat in seinem Programm Schwerpunkte gesetzt, welche natürlich in erster Linie von der Geschäftsstelle umgesetzt werden müssen. Mitte Jahr war deshalb ein guter Zeitpunkt, um Generalsekretär Johnny Storjohann einige Fragen zu stellen – zu seiner Person, zu seinem Golf, zu seinem Job, zur Situation im Schweizer Golf ganz allgemein.
Ein Schweizer heisst nicht Storjohann, und er heisst meistens auch nicht Johnny. Der in Schweden geborene Johnny kam als zweijähriger Knirps mit seinen Eltern in die Schweiz; Vater Storjohann war in der Cellulose-Industrie, also Holzschlag bis Papierherstellung, tätig und wurde von seinem Arbeitgeber in die Schweiz entsandt. Die Familie blieb hier hängen; zuerst zehn Jahre in Zürich, dann in Villars und anderen Wohnorten in der Romandie. 1970 bewarb sich der junge Storjohann erfolgreich um das Schweizer Bürgerrecht. Beruflich war er seinem Vater gefolgt und verschob Cellulose von Schweden nach anderen Ländern Europas.
Advertisement
Im Golf Club Lausanne führte die Golf-Suisse-Redaktion mit Johnny Storjohann ein längeres Gespräch.
Zugegeben: anschliessend wurden auch einige freundschaftliche Löcher gespielt. Mässig konzentriert; denn die Materie ist so interessant, dass auch auf dem Parcours weiterdiskutiert wurde.
Johnny Storjohann, du bist ein ausgezeichneter Golfer und warst lange Zeit eine der Stützen der Nationalmannschaft.
Zum Golf bin ich eher zufällig gekommen. In Villars spielte ich als Jugendlicher Eishockey, fuhr Skirennen und spielte auch Tennisturniere. Ich war immerhin einmal Juniorenmeister der Romandie. Weil aber meine Eltern beide Golf spielten, schleppten sie mich auch den Parcours, wo ich als 13-jähriger schon die Grundlagen des Schwungs erlernte. Besonders begeistert war ich vom Golf damals allerdings noch nicht. Das kam erst, als ich schon erwachsen und berufstätig war. Zwischen 1970 und 1980 habe ich wohl an allen Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen, als Mitglied des Schweizer Nationalteams. Ich war sechs mal Schweizer Meister, und ausser den Championnats Internationaux habe ich alle wichtigen Turniere mindestens einmal gewonnen. Amateurturniere, natürlich…
Keine Ambitionen als Pro?
In den Siebziger Jahren gab es für Sportler kaum Perspektiven als Profi. Wir betrieben Sport als Hobby und dachten nicht im Traum daran, Profi zu werden. Es gab auch nicht viel zu verdienen, im Vergleich zu heute.
Habt ihr denn auch noch nicht richtig ernsthaft trainiert?
Golf war insgesamt ein weniger athletischer Sport. Aber die besten Amateure in dieser Zeit machten auch schon Sessions im Kraftraum und verstanden ihren Sport durchaus als ernstzunehmenden Wettkampfsport.
Was hattet ihr denn da für Vorstellungen von der Golf-Technik, von einem guten Schwung?
Das Spiel war früher ganz anders orientiert als heute. Power, lange Abschläge spielten eine weniger wichtige Rolle, dafür musste man die Technik der Ballkontrolle viel besser beherrschen, die Finesse im Approaching und im kurzen Spiel.
Das hängt doch sicherlich auch mit den Fortschritten beim Material zusammen… Selbstverständlich. Die damaligen Clubs und vor allem auch die Bälle waren schwieriger zu spielen; es gab noch keine fehlerverzeihenden Eisen und keine Oversize-Driver. Wir trainierten also sehr viel alle Arten von
Schlägen – Draws, Fades, hohe und flache Bälle, Spinkontrolle und so weiter. Auch der Pflegezustand der Plätze lässt sich in keiner Weise mit unseren heutigen Golfplätzen vergleichen. Am dramatischsten sind die Unterschiede bei den Greens. Früher war es ganz normal, dass der Ball hoppelte. Balltreues Rollen – davon wussten wir nichts.
Sicherlich war auch der Turnierbetrieb anders strukturiert? Das stimmt. Golf war bis vor rund 20 Jahren tatsächlich das Spiel einer gewissen Oberschicht. Man war Mitglied im Club, man traf sich im Club, und die gesellschaftlichen Aspekte waren mindestens so wichtig wie das Handicap. Man traf Kollegen, Freunde auf dem Golfplatz, und eigentlich war früher sogar die Nationalmannschaft eher eine Sache der Kollegialität. Selbstverständlich musste gut gespielt werden; aber es gab kaum eine grosse Auswahl, weshalb wir immer wieder etwa die gleiche Truppe waren, welche zu EM oder WM reiste. Und auch der Reisekomfort von damals kann sich mit dem, was wir heute gewohnt sind, nicht vergleichen!
Wie würdest du die Entwicklung im Sektor Material charakterisieren?
Die Vorwärtsschritte sind enorm. Insgesamt ist es viel einfacher geworden, ein gutes Golf zu spielen und gute Scores zu erzielen. Das hat zahlreichen Leuten – auch Golfern, die erst in einem gewissen Alter begonnen haben – die Chance gegeben, ein durchaus passables Golf zu spielen. Das Meistern der Golfplätze, die ja immer noch die gleichen sind, ist einfacher geworden. Aber am meisten haben die wirklich guten Spieler und die Pros profitiert; gerade mit den Abschlägen. Während ich früher auf die Besten punkto Länge vielleicht 15, 20 Meter verloren habe, dürften die Unterschiede heute eher bei 30 bis 50 Metern liegen. Man muss heute die Golfholes verlängern, und die Pros haben immer noch ein Wedge für den Approach in der Hand.
Sind die Pflegestandards der Tour ein gutes Beispiel für einen normalen Club?
Es gibt kaum etwas schöneres für einen guten Golfer, als auf schnellen, präzisen, balltreuen Greens zu putten. Das schätzen auch viele Amateure, obschon sie vielleicht mehr
Putts benötigen als auf weniger schnellen Greens. Was immer wieder vergessen wird, das ist das folgende: würde der Greenkeeper die Greens das ganze Jahr so schnell machen, wäre das Risiko enorm gross, dass sie an einigen heissen Tagen verbrennen. Schonender Umgang mit dem Platz heisst halt auch weniger kurz schneiden.
Wie bist du ins ASG-Sekretariat gekommen?
Das gab es damals noch gar nicht! 1982 fragte mich der Vorstand an, ob ich ein ASG-Büro führen könnte. Nebenamtlich natürlich. Der einzige Geschäftsbereich war der Sportbetrieb; also die Nationalmannschaft und die Turniere im Ausland. Das erste ASGBüro befand sich bei mir zu Hause im Keller. Der Verband hatte 28 Clubs mit total 8500 Mitgliedern…
Einer der Bereiche, in welchem die ASG heute neue Massstäbe setzen will, ist der Elitesport. Amateure und Pros als zwei Kategorien – ist das noch zeitgemäss?
Ich bin nicht nur von Amtes wegen ein Verfechter des Amateurgolf, sondern auch aus Überzeugung. Hier
Generalsekretär Johnny Storjohann in seinem Büro an der ASG-Geschäftsstelle inEpalinges… wird die Basis gelegt für eine erfolgreiche Karriere als Playing Pro. Als wir zu Beginn der Neunziger Jahre die Swiss Golf Foundation als Betreuungsbasis für Pro gewordene Amateure schufen, wollten wir damit ein Sprungbrett schaffen, ein Schaufenster auch. Die jungen Pros sollten nicht ohne Begleitung ins kalte Wasser springen. Martin Hodler, Peter Epp und Geri Heller von der CS arbeiteten kräftig mit am Konzept, das enorm von der Persönlichkeit des damaligen Nationalcoaches Jan Blomquist profitierte. Als dieser starb, zeigte sich die Wichtigkeit der richtigen Besetzung dieses Postens.
Aber sind Pros denn nicht ganz einfach Berufsleute, die keinen Verband mehr hinter sich benötigen?
Natürlich, und jeder Mensch wählt seinen Beruf selber und ist auch voll verantwortlich dafür. Jetzt ist eine Karriere als Playing Pro aber nicht gerade der einfachste Weg, wenn man erfolgreich sein will. Ich frage mich oft auch, ob unsere Nachwuchsgolfer denn überhaupt das richtige Berufsverständnis mitbringen. Golf auf der Tour, das ist alles andere als ein Spaziergang. Nichts von «Easy Life», und wenn man als vielleicht bloss mittelmässig talentierter Jungstar glaubt, man habe den schönsten Schwung und putte wie ein Grosser, dann muss einfach festgestellt werden, dass der Schritt zu einem erfolgreichen Tourspieler nochmals riesengross ist. Dem Dauerstress, der körperlichen Belastung, dem ständigen reisen und dem Leben ausserhalb des Schutzes eines Teams (wie der Nationalmannschaft zum Beispiel) ist keiner einfach so gewachsen.
Ist es denn Sache der ASG, das den Boys und Girls aus den Kadern zu erklären?
Bis zu einem gewissen Punkt schon. Ohne wirklich herausragende Resultate bei den Amateuren kann man es als Playing Pro ganz einfach vergessen. Wenn wir uns also während der Amateurzeit um unsere Besten kümmern, dann möchten wir ihnen auch bei der Zukunftsgestaltung helfen. Das kann in vielen Fällen bedeuten, ihnen begreiflich zu machen, dass sie bei den Amateuren besser aufgehoben sind.
Wie sieht das bei den Mitgliedern unserer gegenwärtigen Nationalmannschaft aus?
Gerade Nicolas Sulzer und Martin Rominger sind schon einige Jahre international sehr erfolgreich. Wenn diese beiden jetzt den Willen haben, auch den nächsten Schritt zu versuchen, also ihre vielen Vorinvestitionen in Training und Turnier auch auf höchstem Level zu testen, dann unterstützt das die ASG voll und ganz. Wir wollen ihnen bei diesem Versuch auch die bestmögliche Unterstützung geben (wie das Golf Suisse in der letzten Ausgabe schon sehr detailliert beschrieben hat. Die Red.).
Wie sehen also die konkreten Massnahmen aus?
Unsere besten Amateure werden beim Übertritt zu den Pros Mitglied des Swiss Golf Team; dieses wird jedes Jahr nach den erzielten Resultaten und dem Zukunftspotenzial, das jedem einzelnen zugebilligt werden kann, neu zusammengestellt. In diesem Team sind nur Pros; sie werden nun auf drei Arten unterstützt.
• Finanziell, mit einer Spesenpauschale pro Jahr, die einen vernünftigen Anteil ihrer effektiven Spesen ausmacht, und mit der Möglichkeit, Ende Saison dank einer guten Platzierung im «Credit Suisse Order of Merit» am Preisgeld zu partizipieren.
• Coaching, indem Nationalcoach Graham Kaye auch den Mitgliedern des Swiss Golf Teams als Coach zur Verfügung steht.

• Starts im Ausland, indem die ASG ab 2006 dank des Turniers der Challenge Tour, das wir neu in der Schweiz ausrichten, im Austausch zu rund 40 Startplätzen an ausländischen Turniere kommt.
Das tönt ja nach einem richtigen Herrenleben – man muss die Playing Pros wirklich beneiden. Dabei sollten sie ja vor allem gewinnen… Mit den erwähnten Unterstützungsmassnahmen wollen wir einfach dafür sorgen, dass der Schritt vom Amateur zum Playing Pro etwas sanfter wird. Wenn sich ein Spieler oder eine Spielerin auf der Tour aber durchsetzen will, dann muss er oder sie noch immer kompromisslos und konsequent auf den Erfolg hin arbeiten. Aber ich möchte hier jetzt auch einmal festhalten, dass kein anderer Verband auf der Welt die jungen Pros so gut unterstützt wie das die ASG tut – übrigens nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die Credit Suisse. Nicht die Franzosen, nicht die Schweden, die als Beispiel immer genannt werden – und zum Beispiel die Engländer tun kaum etwas in diesem Bereich.
Ein anderes Thema – die Integration des sogenannten Public Golf, die Präsident Martin Kessler in seinem Programm angesprochen hat. Was ist unterdessen geschehen?
Der Vorstand der ASG ist sich sehr wohl im Klaren darüber, dass das ein heisses Eisen ist. Gerade in manchen Regionen der Deutschschweiz begegnet man der Idee der ASGI und ihrer Umsetzung immer noch mit Vorbehalten. Man muss immer wieder sagen, dass die ASGI auf eine Initiative der ASG hin entstanden ist.
Aber es gibt immer wieder Friktionen.
Vom schnellen Wandel der letzten 10, 20 Jahre sind eben alle überrascht worden. Die ASGI wurde vor weniger als zehn Jahren geschaffen; und in dieser kurzen Zeit haben sich die Entscheidungsgrundlagen bereits wieder verändert. Es herrscht nicht mehr ungebremster Boom, sondern in einigen Teilen der Schweiz beispielsweise zeigen sich bereits Sättigungserscheinungen. Die ganze Gesellschaft ist im Wandel, und die Clubs müssen mitziehen. Das traditionelle Clubleben, das unsere Generation kennt und schätzt, verschwindet langsam, weil die heutigen Golfer andere Erwartungen an diesen Sport haben. Da mitzu- ziehen, das fällt nicht allen Leuten leicht!
Reden wir doch noch etwas konkreter von der ASGI!
Genau. Auch die Beziehungen zwischen ASG und ASGI sind im Wandel. Alle, ausnahmslos alle sind überrascht worden von der extrem dynamischen Entwicklung dieser Vereinigung. Über 12000 Mitglieder – das hätte niemand auch nur geahnt! Der ASG-Vorstand ist in ständigem Kontakt mit der Leitung der ASGI, und es geht jetzt darum, die gegenseitigen Beziehungen und die Vereinbarungen an diese Entwicklung anzupassen. Die beiden Gremien arbeiten gemeinsam an neuen Lösungen. Heute kann man so viel sagen, dass Änderungen in Sicht, aber noch nicht definitiv verabschiedet sind.
Was bringt der ASG dein Job als Generalsekretär der European Golf Association?
Es passt in die Tradition der Schweiz, dass wir internationale Organisationen bei uns ansässig haben. Konkret bringt es aber einen Beitrag an die Bürokosten sowie jede Menge Beziehungen und Kontakte. Wir sind eine Drehscheibe des Golf in Europa. Wir können einen guten Einfluss auf die Entwicklung im ganzen Kontinent nehmen, und der EGA-Sitz hier in Epalinges bringt auch Prestige. Dazu haben wir bisher viele internationale Top-Turniere hier bei uns ausrichten können.
Ist es schlimm, dass Golf jetzt weiterhin nicht olympisch ist?
Persönlich bin ich etwas enttäuscht, vor allem auch, weil Golf ja punkto Popularität zusammen mit Fussball, Basketball und wenigen anderen Sportarten weltweit in der Spitzengruppe rangiert. Es ist also irgendwie paradox, dass wir am wichtigsten Sportanlass der Gegenwart, an den olympischen Spielen, nicht dabei sind. Golf als olympische Sportart hätte wichtige Impulse gegeben in Regionen, wo unser Sport noch nicht Fuss gefasst hat – zum Beispiel in den Kontakten zwischen den Sportbehörden und den Regierungen. Aber am nächsten olympischen Kongress in vier Jahren sieht vielleicht alles wieder anders aus.
Johnny Storjohann, wir danken dir für deine interessanten Ausführungen.
■ Urs Bretscher, Jacques Houriet