HEIMAT FÜR RADIKALE NEUDENKER:INNEN
TAT–SACHEN
BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN
FEDERAL AGENCY FOR BREAKTHROUGH INNOVATION

HEIMAT FÜR RADIKALE NEUDENKER:INNEN
TAT–SACHEN
BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN
FEDERAL AGENCY FOR BREAKTHROUGH INNOVATION
Wir tun, was wir tun, weil wir es lieben. Innovator:innen, die ebenso denken, wollen wir bei ihrer Arbeit, bei ihrem Vorankommen unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir nicht auf Kontrolle, sondern auf gemeinsame Ziele und Werte setzen.
ZUKUNFT KANN MAN GESTALTEN
Chancen sehen und nutzen, Visionen entwickeln und umsetzen. Wir haben große Lust darauf, die Dinge anzupacken und etwas zu tun. Zukunft ist, was wir daraus machen.
FORTSCHRITT BRAUCHT
DENKEN UND HANDELN
Wir wollen Ideen in Produkte und Dienstleistungen transferieren, die einen langfristigen Nutzen für Deutschland und Europa bringen. Deshalb denken und handeln wir immer unternehmerisch – mit der Agilität eines Start-ups.
MENSCH UND GEMEINWOHL STEHEN IM MITTELPUNKT
Wir glauben an humanistische Werte, an Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. Das Gemeinwohl und gesellschaftliche Herausforderungen stehen im Vordergrund unserer Arbeit.
Neugierde ist unser Antrieb. Wir brennen für die Lösung der großen Probleme und gehen dafür bewusst Risiken ein. Niemand will scheitern, aber wir haben keine Angst davor.
Wir glauben an starke Netzwerke mit gemeinsamen Zielen –in Deutschland, in Europa und weltweit.
Wir schaffen eine Umgebung, in der sich Persönlichkeiten entfalten, auf ihre Stärken konzentrieren und mit anderen Innovator:innen kooperieren können.
Der Staat muss sparen. Aber bitte nicht an der Zukunft. Wie sich (auch) in der Innovation mit weniger mehr erreichen lässt: ↓
Die Innovationsforschung kennt das Phänomen sehr gut aus Fallstudien von großen Unternehmen im Krisenmodus: Wenn die Budgets knapp werden, müssen die neuen Projekte als Erstes dran glauben. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Das Geld für künftige Produkte oder Dienstleistungen ist noch nicht fest eingeloggt. Es bestehen noch keine Pfadabhängigkeiten zum Geschäftsmodell. Kein Manager muss zugeben, dass er in alten Projekten Geld versenkt hat, solange er die Zahlen noch halbwegs schönrechnen kann. Das Neue verschwindet dann still und leise, zunächst aus der Unternehmensstrategie, dann aus der Budgetplanung. Direkt spüren es nur die Mitarbeitenden in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Eine Case-Study zu der Abwärtsspirale aus Sparzwängen, sinkender Innovation und Wettbewerbsfähigkeit lässt sich gerade im Live-Ticker beim US-Flugzeughersteller Boeing beobachten. Leider lassen sich auch die Parallelen zu Status quo, Innovationskraft und Zukunftsaussichten vom deutschen Staat und der deutschen Volkswirtschaft nicht übersehen.
Der Bundeshaushalt 2024 beträgt knapp 500 Milliarden Euro. Nach einem Bericht des Bundesrechnungshofs sind davon rund 90 Prozent fest verplant oder durch gesetzliche Leistungen blockiert. Die Haushälter können entsprechend nur bei einem Zehntel der Ausgaben den Rotstift ansetzen. Die Investitionen in Innovation sind hiervon leider in besonders hohem Maße betroffen. In einer idealen Welt wäre Geld für die Erforschung und Entwicklung von Quantencomputern und Kernfusion, von antiviralen Breitbandwirkstoffen und Demenztherapien gar kein Thema, das groß diskutiert würde. Es wäre schlichtweg da. In Zeiten knapper Förderkassen müssen wir die staatliche Innovation selbst einem Innovationsprozess unterziehen. Das Zielbild liegt hier ebenfalls auf der Hand: mit weniger Geld mehr erreichen. Dies ist nicht nur nötig, es ist tatsächlich auch möglich. Nach fünf Jahren SPRIND sind wir überzeugt: Wenn deutsche Politik vier Stellhebel umlegt, steigt der gesellschaftliche „Return on Innovation“.
① WETTBEWERB ALS FÖRDERPRINZIP Überspitzt formuliert läuft Forschungsförderung heute in der Regel wie folgt ab: Kluge Forschende beantragen mit viel Aufwand Mittel aus einem großen Fördertopf. Setzen sie sich mit ihrem Antrag gegen die Konkurrenz aus anderen Forschenden durch, sind sie in der Regel erstmal für drei bis fünf Jahre ganz gut finanziert. Auch die Chancen, beim Anschlussantrag nochmals für einige Jahre Geld zu bekommen, stehen dann trotz diverser Evaluationsschleifen sehr gut. Die Konkurrenz geht derweil leider leer aus, denn der Steuerzahler soll ja keine Forschung „doppelt und dreifach“ finanzieren.
In der Grundlagenforschung mag dieser Ansatz noch halbwegs funktionieren. Für die sogenannte „Translation“, also die anwendungsorienterte Forschung der technischen Disziplinen, ist er problematisch. Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft. Die Erfahrung bei SPRIND, unter anderem bei unseren Entwicklungswettbewerben, den „Funken“ und „Challenges“, zeigt: Wenn mehrere Teams parallel arbeiten, steigen das Tempo der Entwicklung und zugleich die Qualität der (Zwischen)-Ergebnisse. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die Innovierenden nicht nur durch die anderen Teams unter Zeitdruck stehen – Zeit ist in der Innovation besonders viel Geld. Die Teams befruchten sich auch gegenseitig, weil Wissen von Team zu Team diffundiert. Der Modus der „Coopetition“, also der Verbindung aus Kooperation und Wettbewerb, belebt das Geschäft noch besser als die reine Konkurrenz. Wichtig hierbei ist es, klare Erfolgskriterien zu definieren, die in vergleichsweise kurzen zeitlichen Intervallen erreicht werden müssen. Es gibt bei solchen Challenges nicht viel Geld für fünf Jahre für einen, sondern erstmal ausreichend Geld für ein Jahr für einige. Nur wer erste Erfolge nach den definierten Kriterien nachweisen kann, wird weiter finanziert, und zwar unbürokratisch und ausreichend für den Erfolgsbeweis im nächsten Entwicklungsschritt. Kein Mittelnachweis, keine Evaluation, nur Resultate müssen geliefert werden. Wettbewerbsorientierung und kürzere Förderintervalle ließen sich leicht auf einen großen Teil der staatlichen Innovationsförderung ausweiten. Eine Voraussetzung hierfür wäre: Die Fördernden müssten lernen, hier und da etwas loszulassen.
Die staatliche Bürokratie ist durchdrungen von einem Geist des Misstrauens. Das ist kein schlechter Charakterzug der Bürokratinnen und Bürokraten, das ist im Wortsinn System. In seinem historischen Kontext machte das System auch Sinn. Der Mutter der modernen Verwaltung, die preußische Staatsbürokratie, gelang es im 19. Jahrhundert, wiederkehrende Abläufe zu standardisieren. Damit konnten diese nicht nur effizient durchgeführt werden, der gut organisierte Obrigkeitsstaat konnte auch endlich umfassend kontrollieren. Das war sehr innovativ. In der Forschungs- und Innovationsförderung hat aber leider die Dialektik des Fortschritts mit eiserner Faust zugeschlagen: Zu viel Kontrolle verhindert Innovation. Forschungsbürokraten müssen nach einem Regelwerk prüfen, das selbst jene kaum noch durchschauen, die es aufgesetzt haben. Sonst verstoßen sie gegen die Regeln, denen sie selbst unterliegen.
Das Irrsinnige an diesem Verfahren ist: Die Kontrolleure prüfen nicht die Ergebnisse der Projekte, sondern den Prozess. Wurde der Antrag nach allen Kriterien korrekt eingereicht? Wurden alle Mittel korrekt ausgegeben? Und die Prüfer der Prüfer prüfen sicherheitshalber nochmal, ob die Mittel nach allen Vergaberichtlinien überhaupt korrekt bewilligt wurden? Ob ein F&E-Projekt am Ende ein Ergebnis erbracht hat, gerät zur Fußnote im ganz formalen Wahnsinn.
Ein bisschen KONTROLLE ist gut, VERTRAUEN ist VORAUSSETZUNG, ERGEBNISSE sind besser.
Auf diese Formel lassen sich die Erfahrungen mit den Nerds mit Mission bringen, mit denen wir bei der SPRIND seit fünf Jahren arbeiten. Es ist nicht die Aufgabe der Innovationsmanagerinnen und -manager, darüber zu wachen, ob sie beim Einkauf von Druckerpapier drei Angebote eingeholt haben. Sie müssen schauen, ob nach sechs oder zwölf Monaten Finanzierung ein vereinbarter Entwicklungsmeilenstein erreicht wurde und was das dann für Marktreife, weiteren Finanzierungsbedarf, Kooperationen mit mögliche Partner etc. bedeutet.
③ KEINE BÖCKE ALS GÄRTNERBERATER
Jeder weiß es, keiner spricht es offen aus: Bei der Vergabe von staatlichen Forschungs- und Entwicklungsmitteln sind die Grenzen zwischen Beratung und Eigeninteressen fließend. Auch das ist in der Regel keine böse Absicht. Die politischen Entscheiderinnen und Entscheider holen sich Fachexpertise zu den großen Innovationsthemen natürlich von jenen ein, die vom Fach viel verstehen. Oft sind das aber genau jene, die dann die Mittel beantragen, wenn ihr Rat in der Politik Gehör fand und Mittel für ein bestimmtes Forschungsfeld in die Fördertöpfe eingespeist wurden. Wir alle, auch Forschende, halten das eigene Wirken und Tun nun mal für besonders wichtig. Im aktuellen Fördersystem empfehlen die Böcke den Gärtnern „zu erfolgreich“, welche Türen im Zaun sie öffnen sollen.
Kluge Köpfe und Institutionen mit Partikularinteressen müssen natürlich auch weiter in der Politik Gehör finden. Es braucht endlich eine Ebene der neutralen Fachberatung, die mit tiefer Kompetenz in tiefen Technologien politischen Entscheidern nicht nach eigenen Interessen Empfehlungen ausspricht, sondern die Wetten auf die Zukunft nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis der Daten der Gegenwart platziert. Zum (neutralen) Beratungsauftrag muss dann auch die wichtigste alle Technologiefragen gehören: Welche technologischen Wetten will eine Gesellschaft mit welchem Ziel eingehen?
Der Wiederaufbau einer europäischen Chipindustrie mithilfe von erheblichen Steuermitteln ist eine gut begründete Mission. Sie macht Europa resilient gegen Lieferkrisen. Sie erlaubt Forschenden Zugriff zu Wissen und Testumgebungen, mit denen Europa überhaupt erst wieder Anschluss an die Weltspitze des Chipdesigns und der Chipentwicklung finden kann. Ohne staatliche Ankerinvestitionen wird kein europäisches Start-up-Ökosystem rund um Chips und Rechner-Hardware entstehen. Nach nur wenigen Monaten sehen wir bereits, dass die Mission des EU-Chips-Act erste Früchte trägt und sehr schnell zu einer Investition werden kann, die sich volkswirtschaftlich rechnet. Was sind die Erfolgsfaktoren?
Das Ziel ist klar beschrieben. EU und Bundesregierung haben sich nicht im Förder-Klein-Klein verloren. Deutschland hat die globalen Größen der Chipindustrie wettbewerbsorientiert um Fördermittel konkurrieren lassen. Örtliche Verwaltung hat bei den nötigen Genehmigungsverfahren ungewöhnlich unbürokratisch agiert.
Auch wenn die Pläne für die Chip-Fabrik seitens Intel jetzt auf Eis gelegt wurden, so zeigt das Beispiel dennoch: Higtech-Missionen mit volkswirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gewinn sind möglich. Mit dem neuen Halbleiterwerk in Dresden - der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat sich dafür mit den deutschen Konzernen Bosch und Infineon und der niederländischen NXP-Gruppe zu ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) zusammengeschlossen – wird die Liefersicherheit mit Halbleitern für die deutsche und europäische Industrie langfristig deutlich verbessert. Welche Missionen wir wann mit wie viel Geld angehen wollen, müssen am Ende natürlich Parlament und Politiker nach demokratischen Regeln entscheiden. Aber zuvor gilt es, die wichtigste Hausaufgabe zu machen: Die staatliche Innovationsförderung muss einen gründlichen Innovationsprozess durchlaufen. Knappe Kassen sind ein guter Anlass hierfür. Denn auch das wissen wir aus Fallstudien der Innovationsforschung: Oft ist ein Überfluss an Ressourcen für die Innovation gar nicht förderlich.
Not macht erfinderisch.
4 LERNERFAHRUNGEN AUS 5 JAHREN SPRIND:
MISSION POSSIBLE
DIE EINREICHUNGEN MIT SPRUNGPOTENTIAL KOMMEN AUS ALLEN TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSBEREICHEN.
BISHERIGE EINREICHUNGEN GESAMT
2.111
DAVON VON SPRIND FINANZIERT
163
DAVON GROSSFINANZIERUNGEN (3-90 MIO.)
21
AUS WELCHEN FELDERN WIRD EINGEREICHT?
ENERGIETECHNIK
HARDWARE UND ELEKTRONIK
BAUWESEN UND
INFRASTRUKTUR
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
BIOTECHNOLOGIE UND MEDIZINTECHNIK
FERTIGUNGS-, INDUSTRIEUND WERKSTOFFTECHNIK
UMWELT- UND AGRARTECHNIK
ZENTRAL IST, DASS DIESE DIENSTLEISTUNGEN, PRODUKTE ODER SYSTEME UNSER LEBEN NACHHALTIG BESSER MACHEN.




DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil CPTx antivirale Mittel mit Breitbandwirkung entwickelt und wir endlich effiziente Therapien gegen Viren brauchen. Weil CPTx gegen Viruserkrankungen so wirksam sein könnte wie Penicillin gegen bakterielle Infektionen. Wir wollen nichts weniger als virale Krankheiten disruptieren. Weil wir nie wieder eine Pandemie erleben wollen und wir zukünftig nur noch Viren in Quarantäne bringen wollen, keine Menschen. Damit wir nicht nur Schaden von unserer Gesellschaft abwenden, sondern auch diese wichtige Schlüsseltechnologie in Deutschland etablieren.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Die Challenge motivierte die Innovatoren aus dem Forschungsprojekt, ein Unternehmen zu gründen. Jetzt unterstützen wir das Projekt, hebeln privates Investment und geben dem Team Freiraum, um ihre Entwicklung voranzubringen.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN
Eine Welt, in der Virusinfektionen schnell und effektiv behandelt werden. Ein wichtiger Beitrag, um gegen zukünftige Pandemien gewappnet zu sein.
SPRIND BRINGT IHRE NEUEN INSTRUMENTE ZUM EINSATZ
Das SPRIND-Freiheitsgesetz erlaubt es uns, direkt und maßgeschneidert in CPTx zu investieren. So behalten die Innovator:innen ihre Flexibilität und können private Investments hebeln.
Die Entdeckung und der vermehrte Einsatz von Antibiotika nahmen vielen bakteriellen Erkrankungen im vergangenen Jahrhundert den Schrecken. Wenn es nach dem Gründerteam von CPTx geht, soll es Vireninfektionen bald ähnlich ergehen. Denn für Viren gibt es bis heute nur wenige Behandlungsmöglichkeiten. Dabei stellen virale Infektionskrankheiten häufig enorme sozioökonomische Belastungen dar – für Individuen und für die Gesellschaft. Jährlich erkranken viele 100 Millionen Menschen an Virusinfektionen, ein großer Teil davon lebensbedrohlich.
„Das aktuelle Beispiel dafür ist natürlich die CoronaPandemie, die uns in vielerlei Hinsicht den Bedarf antiviraler Wirkstoffe aufgezeigt hat“, erklärt Prof. Dr. Hendrik Dietz, Lehrstuhlinhaber für Biomolekulare Nanotechnologie an der Technischen Universität München und Gesellschafter der CPTx. „Virusinfektionen bedeuten nicht nur großes persönliches Leid für die Betroffenen, sondern auch hohe Kosten für das Gesundheitssystem sowie indirekte Kosten, die zum Beispiel durch Produktionsausfälle verursacht werden. Krankheitsleid zu mildern oder ganz zu verhindern, ist sozial und wirtschaftlich relevant.“
SARSCoV2 demonstrierte auch nachdrücklich, wie schwer es ist, einer Pandemie etwas entgegenzusetzen. „Impfstoffe sind ein guter Weg, laufen aber immer zeitversetzt und sind auch nicht für jedermann zugänglich. Es gibt zum Beispiel viele Menschen mit einer Immunschwäche, bei denen Impfen gar nicht hilft. Wir benötigen also auch eine medikamentöse Strategie, um akute Infektionen zu behandeln“, ist Hendrik Dietz sicher, der CPTx gemeinsam mit Biophysiker Dr. Christian Sigl, Virologe Prof. Dr. Ralf Wagner und Rechtsanwalt Georg Lindner gegründet hat.
NANOMETERGROSSE SCHALEN FANGEN UND NEUTRALISIEREN VIREN
Viren besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und nutzen Zellen des Organismus, den sie befallen, um sich zu vermehren. CPTx verhindert mit seiner neuen Wirkstoffplattform, dass Viren überhaupt in Zellen gelangen. „Unsere Herangehensweise beruht auf nanometergroßen Schalen, die etwas größer als Viren sind, und diese einfangen und verkapseln. Die Viren sind dann nicht mehr infektiös und werden im Körper zusammen mit den Schalen abgebaut“, erläutert CTO Sigl. Diese hochkomplexen „Virenfallen“ sind aus DNAMolekülen mithilfe der sogenannten DNAOrigamiTechnik aufgebaut.
DAS ZIEL: EIN BREITBANDMEDIKAMENT GEGEN VIREN
CPTxs Plattform soll ein Breitbandmedikament ermöglichen. Dafür sieht es bislang sehr gut aus: „Wir haben bereits zehn verschiedene Virentypen mit der Virenfalle verkapseln können. Wir konnten auch zeigen, dass Infektionen mit Influenza, Corona, Hepatitis und Chikungunyaviren in Zellkultur mit menschlichen Zellen mit der Virenfalle verhindert werden können“, erklärt Ralf Wagner von der Universität Regensburg, versierter Virologe sowie Unternehmer im DNAUmfeld mit jahrzehntelanger Erfahrung.
Das Vorgehen ist in jedem Fall ungewöhnlich, Medikamente dieser Art gibt es bisher nicht: „Die meisten bestehen aus winzigen Molekülen, chemischen Verbindungen, Antikörpern, sie sind immer klein im Vergleich zu Pathogenen und greifen typischerweise in Stoffwechselprozesse ein“, führt Wagner aus. „Wir verkapseln ‚einfach nur‘ Viren, damit sie nicht in Zellen eindringen können, und fahren damit eher einen physikalischen Ansatz. Und das Konzept funktioniert!“
ERFOLGREICHE TIERSTUDIEN LAUFEN BEREITS
Die neuartige Virenfalle und das Ziel, Therapien für verschiedene Viren zu entwickeln, stehen dabei auch in regulatorischer Sicht vor Herausforderungen. Klinische Studien sind nicht plattformbasiert; vielmehr müssen der Anwendungszweck und vor allem das Medikament spezifisch zugeschnitten sein – für jede Virusart müsste der gesamte Prozess erneut durchlaufen werden. „Wir sind optimistisch, dass wir dann Lösungen finden uns konzentrieren und zu Beginn auf die Erkrankungen mit großer Dringlichkeit: Influenza und Chikungunya. Dazu finden nach den Invitro bereits InvivoWirksamkeitsstudien im Tiermodell statt“, berichtet Dietz.
Das Ganze ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden – weshalb sich das Team im Sommer 2021 vom Aufruf zur ersten SPRIND Challenge zu BroadSpectrum Antivirals sofort angesprochen fühlte. Die Virusfalle fand Anklang und SPRIND wurde zum Katalysator. „Wir wussten die ganze Zeit schon, dass wir mehr daraus machen müssen. Noch im November 2021, kurz nach dem Start der Challenge, haben wir dann capsitec gegründet“ – heute heißen sie CPTx, die beträchtlichen Visionen bleiben aber: „Wir möchten Viruserkrankungen aus der Welt schaffen – und so viele wie möglich verhindern und heilen“, gibt Christian Sigl die Marschrichtung an.
Die SPRIND unterstützt CPTx dabei, ihre anitivirale Plattform um eine wichtige Anwendung der Plattformtechnologie DNAOrigami auf den Weg zur klinischen Anwendung zu bringen.
„ETWAS, DAS SO GUT SEIN KÖNNTE, DAS SO EINEN GROSSEN EINFLUSS HABEN KÖNNTE, KANN MAN NICHT IGNORIEREN, DAS MUSS MAN MIT ALLER KRAFT BETREIBEN.“




SPRIND UND OLIMENT
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS Neben dem wesentlichen Effekt, CO 2 einzusparen und mit Oliment eine Grundlage zum umweltfreundlichen Bauen zu liefern, kann diese neue Rezeptur helfen, die Klimaziele zu erreichen, ohne hohe Investitionen für Carbon Capture and Storage-Anlagen. Dies wäre ein enormer Vorteil – nicht nur für Deutschland.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Derzeit finanzieren wir die Herstellung und den Zulassungsprozess von Oliment in Form einer Tech nikumsanlage. Mit der Forschung in einer solchen Anlage außerhalb des Labormaßstabes kann ein wesentlicher Schritt zur Zulassung von Oliment gelingen.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN
Im Bereich der Baubranche einen CO 2 -neutralen und günstigeren Ausgangsstoff bereitzustellen und so die Herstellung von Zement weltweit zu revolutionieren.
OLIMENT, SPRIND UND NECONA
Die Oliment GmbH hat eine Kooperation mit der necona, einer 100 Prozent Tochtergesellschaft der SPRIND. In der Kooperation wird das Vorhaben, einen CO 2 -freien Zement herzustellen und die bauaufsichtliche Zulassung des Zements zu erlangen, durch ein Darlehen der SPRIND finanziert. Durch das neue SPRIND-Freiheitsgesetz erhoffen sich alle drei Parteien noch mehr Möglichkeiten in der Finanzierung des Wissenstransfers, um auf diese Weise in den nächsten Jahren einen merkbaren Schritt nach vorne zur Etablierung dieses Bindemittels zu machen.


In der heutigen Welt, in der Nachhaltigkeit zur Notwendigkeit avanciert, zeigt sich in der Bauindustrie ein Paradox auf: Beton steht nicht nur als massiver Grundpfeiler moderner Infrastrukturen, sondern auch als essentieller Klimaschädling im Fokus. Mit einem Anteil von 8 Prozent an globalen CO2Emissionen rückt die Betonproduktion in das Zentrum vieler Debatten um Umweltschutz. Insbesondere durch die Herstellung von Zement, dem Bindemittel, das Sand und Kies als Beton zusammenhält, entstehen die Emissionen, die unsere Umwelt belasten. Hier greift Oliment gemeinsam mit der von SPRIND ins Leben gerufenen Forschungsgesellschaft necona an: Das Leipziger Unternehmen hat sich der Mission verschrieben, durch disruptive Technologie die Zementherstellung von Ballast zu befreien. „Das Hauptziel von Oliment ist es, ein CO2neutrales Bindemittel für Betonanwendungen im Bauwesen zu etablieren“, erklärt Dr. Frank Bellmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter der BauhausUniversität Weimar und Gründer der Oliment. „Die ersten Schritte umfassten die Rezepturentwicklung und die Herstellung eines Bindemittels auf Basis von Olivin im Tonnenmaßstab.“
Frank Bellmann beschäftigt sich bereits seit Beginn der 2000erJahre mit mineralischen Werkstoffen im Bauwesen; seine Schwerpunkte: Zementchemie und die Erforschung von Bindemitteln für Beton. In seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter der BauhausUniversität Weimar fand er dazu ein geeignetes Umfeld. Bereits sein Doktorvater Prof. Jochen Stark hatte vor über 30 Jahren ein ähnliches Vorhaben umgesetzt: Dabei ging es um die Überführung sogenannter Belitzemente vom Labor in die Anwendung.
Auch damals mussten ähnliche Probleme der Skalierung gelöst werden. Von diesen Erfahrungen profitieren Bellmann und das Team und setzen den Weg fort, den Stark und seine damaligen Mitstreiter:innen eingeschlagen haben.
Im Juli 2023 erfolgte schließlich die Finanzierung durch die SPRIND, kurze Zeit später die Unterstützung durch den kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Butt. Das OlimentTeam bündelt umfangreiches Wissen in der Verfahrenstechnik, Chemie, Betontechnologie und in den Geowissenschaften. Diese wissenschaftliche Basis ist das Grundgerüst der Oliment GmbH. Die treibende Kraft ist dabei nicht allein der technologische Fortschritt, sondern das Streben des gesamten Teams, die Zementproduktion nachhaltig zu verändern. „Das erstaunliche Engagement und der Glaube an unser Projekt haben uns gezeigt, dass selbst aus der vermeintlichen Abgeschiedenheit Sachsens heraus die Kraft haben, global etwas zu bewegen“, so Alexander Butt.
OLIVIN: NEUER PROTAGONIST
DER NACHHALTIGEN
MATERIALWISSENSCHAFT
Olivin ist ein Bestandteil von Gesteinen; ein grünlich schimmerndes Mineral, das global in großen Mengen vorhanden ist. Die Besonderheit des Olivins offenbart sich in seiner Zusammensetzung: eine Mischung aus Magnesium, Eisen und Siliziumoxid. Diese ermöglicht es, ein Bindemittel herzustellen, das mit Wasser nicht nur fest wird, sondern auch Kohlenstoffdioxid bindet. Gegensätzlich zum traditionellen Ausgangsstoff Kalkstein enthält Olivin kein CO2, welches somit auch nicht freigesetzt werden kann.
„Olivin als Bindemittel kann schnell in bestehende Zementanwendungen integriert werden, um die CO2Emissionen zu reduzieren“, so Frank Bellmann. „Olivin benötigt keinen energieintensiven Brennprozess mit fossilen Brennstoffen, was nicht nur CO2Emissionen ausschließt, sondern auch die Abhängigkeit von den Brennstoffen verringert. Die Herstellung erfolgt durch die Verwendung von Elektroenergie.“
In dem Vorhaben werden Anwendungsfelder für das Bindemittel und Synergien im Zusammenhang mit weiteren nachhaltigen Baustoffen erforscht. Das umfasst die Entwicklung einer komplexen Anlagenarchitektur; massive Produktionsanlagen füllen die Halle in der Kleinstadt Rötha im Süden Leipzigs.
„Wir sind dabei, eine Technikumsanlage für die Produktion im Tonnenmaßstab sowie Prototypanlagen für die Herstellung von Hunderten Tagestonnen zu entwickeln. Das Ziel ist es, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erlangen und das Bindemittel in Forschungs und Demonstrationsprojekten einzusetzen, um seine Effektivität unter Beweis zu stellen“, berichtet Alexander Butt. „Diese Anlagen sind sowohl für den Einsatz in wissenschaftlichen Untersuchungen konzipiert als auch daraufhin getestet, ihre Eignung für die Produktion von Beton zu demonstrieren.“
Gemeinsam mit SPRIND, der Bundesagentur für Sprunginnovationen, tritt das Team an, die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen und das übergeordnete Ziel zu erreichen.
„OLIVIN ALS BINDEMITTEL KANN SCHNELL IN BESTEHENDE ZEMENTANWENDUNGEN INTEGRIERT WERDEN, UM DIE CO2EMISSIONEN ZU REDUZIEREN.“




UND MEMLOG
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil mithilfe von TECHiFABs (TiF) Memristor bestehende Einschränkungen überwunden und neue Grundsteine für höhere Rechenleistung und Energieeffizienz gelegt werden.
Weil der TiF-Memristor nicht nur das Potential hat, die aktuelle Von-Neumann-Architektur zu ergänzen, sondern zudem die Rechenarchitektur der Zukunft ermöglicht.
Weil der TiF-Memristor das Potential hat, eine Vielzahl von Innovationen in verschiedenen Märkten zu begründen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Aus dem Forschungsprojekt ein Unternehmen. Den Entwickler:innen sollen der Raum und die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Memristor-Technologie weiterzuentwickeln.
SCHLÜSSELTECHNOLOGIE IN EUROPA AUFBAUEN Mithilfe der TiF-Memristor-Technologie soll eine Schlüsseltechnologie in Deutschland aufgebaut und damit der Innovationsstandort Deutschland gefördert werden.
NETWORKING UND GRÖSSER DENKEN
Die SPRIND setzt auf ihr eigenes breit aufgestelltes Expert:innennetzwerk, um TECHiFAB zu unterstützen. Mit ihren vielfältigen Kontakten zu Partner:innen und Anwender:innen treibt die SPRIND das Projekt voran und trägt dazu bei, die Technologie schnellstmöglich in Anwendungen umzusetzen.



Elektrische Schaltungen bestehen aus einer Vielzahl aktiver und passiver elektronischer Bauelemente. Zu den grundlegenden Bauteilen gehören Spulen, Kondensatoren und Widerstände. Mit ihnen können Strom, Spannung, Ladung und magnetischer Fluss gemessen und verbunden werden. Doch bereits 1971 postulierte der Physiker Leon Chua, dass es aus Symmetriegründen ein viertes, passives elektronisches Bauelement geben müsse, das Ladung und magnetischen Fluss direkt miteinander verbindet. Eine Besonderheit dieses Bauelements sollte darin bestehen, dass es ein „Gedächtnis“ für die geflossene Ladung und den erzeugten magnetischen Fluss besitzt. Chua nannte dieses Bauelement Memristor, ein Kunstwort aus Speicher (engl. memory) und Widerstand (engl. resistor).
Obwohl viele Ansätze für memristive Bauelemente entwickelt wurden, gab es bisher keinen Memristor, der digitale und analoge Daten speichern und selbst Berechnungen im Bauelement durchführen
konnte. Dies änderte sich, als Prof. Dr. Heidemarie Schmidt und ihr Team am HelmholtzZentrum DresdenRossendorf begannen, die magnetischen Eigenschaften von Materialien zu erforschen. Im Jahr 2011 entdeckten sie ein eisenbasiertes Material, das den von Chua beschriebenen Eigenschaften entsprach.
Während Heidemarie Schmidt den Fund im Rahmen eines HeisenbergStipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft untersuchte und weiterentwickelte, traf sie im Jahr 2016 auf Stephan Krüger, der nach anderthalb Jahrzehnten in der Halbleiterindustrie seit 2015 beim HelmholtzZentrum DresdenRossendorf als Manager für Technologietransfer tätig ist. „Es gibt bei Helmholtz viele tolle Patente, doch ihre stachen heraus. Wir tauschten uns aus und recht schnell war klar, dass wir daran gemeinsam weiterarbeiten würden“, berichtet der Physiker.
WIE EINE SYNAPSE IM GEHIRN –EIN BAUELEMENT
MIT ERINNERUNGSWERT
„Der Memristor ist ein Bauelement mit einem bestimmten Widerstand, den man messen und gezielt verändern kann. Sein Verhalten ist dem einer Synapse im Gehirn ähnlich, ein Bauelement mit Erinnerungswert. Unser TiFMemristor rechnet zertifizierbar, also transparent, wiederholbar und vertrauenswürdig und merkt sich das Rechenergebnis.“
Schnell sind Heidemarie Schmidt und Stephan Krüger zu einem perfekten Team avanciert, sie die passionierte Forscherin, die Anwendungen entwickelt, er der Halbleiterexperte und versierte Netzwerker, der im Hintergrund die Fäden spinnt und das Ganze größer denkt: raus aus dem Labor, rein in die hochskalierte Fertigung und in die Wirtschaft. Durch die von Krüger initiierte Bewerbung bei der SPRIND kam weiteres Tempo in die Angelegenheit. 2021 startete die Validierung des Projekts, bei der sich zeigte,
dass der Memristor den Anforderungen an ein Speichermedium entspricht – und sogar besser ist, nämlich digitale sowie analoge Daten speichern kann. Den Weltmarkt erobert man am besten mit einer eigenen Firma, dachten Schmidt und Krüger, und gründeten die TECHiFAB, um die neuen Bauelemente für ressourceneffiziente elektronische Schaltungen herzustellen, die Massenproduktion vorzubereiten, Applikationen zu entwickeln und zu vertreiben. In der SPRIND Challenge New Computing Concepts von 2022 bis 2023 erprobten die Wissenschaftler:innen der TECHiFAB neue Technologien rund um neuromorphe Rechnerstrukturen. Im Frühjahr 2023 folgte schließlich die Gründung der SPRINDTochter MemLog. Sowohl mit dem HelmholtzZentrum DresdenRossendorf als auch mit weiteren Forschungsinstitutionen wird eng zusammengearbeitet.
FUSION VON SPEICHER UND PROZESSOR
Der TIFMemristor kann rechnen, Daten verarbeiten und eine völlig neue RechnerArchitektur begründen. Der Bedarf für die neuen elektronischen Bauelemente ist immens: Herkömmliche Rechnerarchitekturen stoßen längst an ihre Grenzen und verbrauchen enorm viel Energie durch das Speichern der Daten. Bisher erhöhte sich der Energiebedarf für Rechentechnik durch die exponentiell zunehmende Verwendung von Geräten im Zehnjahrestakt um den Faktor 1,38, beispielsweise im Zeitraum von 2010 bis 2020 von 1,67 auf 2,31 Petawattstunden. Für das Jahr 2030 wird ein Energiebedarf für KIRechentechnik
von 3,18 Petawattstunden prognostiziert. Ein Großteil des Energiebedarfs der Rechentechnik wird innerhalb der Prozessoren zwischen Speichern und Kernen für den kontinuierlich stattfindenden Datentransfer benötigt, der zugleich die Rechenleistung massiv bremst. So verzehnfacht sich seit 2010 jedes Jahr die Rechenzeit zum Trainieren komplexer KINetzwerke. All das werden neue, neuromorphe Rechenarchitekturen durch den Einsatz von Memristoren, in denen die Funktion des Speichers und die des Prozessors im selben Bauelement vereint wird, umgehen.
„Wenn es uns gelingt, unsere Produktion in Sachsen, Deutschland und Europa zu etablieren und zu halten, dann besteht vor Ort die Chance auf eine Spitzentechnologie, die uns wirtschaftlich voranbringt, die positiven Einfluss auf die Umwelt, auf die Natur und Gesellschaft hat und die uns in die Lage versetzt, die exponentiell anwachsende Datenmenge auch ressourceneffizient zu verarbeiten“, erklärt Heidemarie Schmidt.
Von sich selbst sagt die Physikerin, die 2017 von der Universität Jena als Professorin für Festkörperphysik mit dem Schwerpunkt Quantendetektion berufen wurde, dass sie schon immer einen großen Forscherdrang verspürt habe, aber –wie so viele Wissenschaftler:innen – nie auch nur ans Gründen gedacht hätte; das Labor war ihr immer genug. Umso glücklicher ist sie heute, dass ihre Entdeckung nun den Weg in die Anwendung finden wird, zeitnah in der Edge Sensorik für Quantendetektion und perspektivisch im Edge Computing für neuromorphe Rechnerarchitekturen.
Nun gilt es für die MemLog und für die TECHiFAB, die MemristorHardware zu entwickeln und damit neue Applikationen auf den Markt zu bringen. Dazu möchte das sympathischzurückhaltende Gründerduo auf Partnerschaften mit denen setzen, die nur auf die MemristorTechnologie gewartet haben: „Wir sprechen all jene an, die ihre Applikationsideen für KI testen möchten – in Hardware und in Echtzeit – erst in kleinen Stückzahlen und perspektivisch hochskaliert.” Erste Bauteile dafür gibt es schon –den CORRiSTOR Demonstrator. Mit dem CORRiSTOR hat TECHiFAB ein erstes voll betriebsfertiges Produkt mit TECHiFABs Memristoren – den TiFMemristoren –speziell für die hochpräzise EchtzeitKorrelationsanalyse von Sensordaten in den Bereichen Predictive Maintenance und Infrastrukturüberwachung konzipiert und auf den Markt gebracht. TECHiFABs CORRiSTOR ermöglicht die Identifizierung linearer und nichtlinearer Korrelationen von Daten direkt am Sensor bei einer auf nahezu 0 Prozent reduzierten ClusterFehlerrate und einer fundamentalen Minimierung des Hardware und Energiebedarfs.
„Kollaborationen zu begründen und Erstanwender zum Beispiel in der AutomobilIndustrie, im Fahrzeug und Maschinenbau, in Medizin oder Messtechnik, in der Energieversorgung oder Halbleiterherstellung zu finden, gehört zu unseren großen Zielen“, bekräftigt Heidemarie Schmidt.
„FUSION VON SPEICHER UND PROZESSOR:




SPRIND UND PLECTONIC
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil jedes Medikament gegen Krebs immer auch gesunde Zellen tötet. Somit leiden immer noch Millionen Patient:innen nicht nur an Krebs, sondern auch an der Behandlung selbst. Wir wollen Krebs gezielt heilen – ohne Nebenwirkungen. Weil wir Medikamente brauchen, die nur Krebszellen töten und sonst nichts. Weil wir zukünftig Medikamente gezielt gegen ganz bestimmte Krankheiten konstruieren werden.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir geben den Innovator:innen alle Mittel, um aus dem Forschungsprojekt ein Unternehmen zu schaffen. Über das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND Kontakte zu Partner:innen ermöglichen und die besten Köpfe für das Projekt begeistern. Die Entwicklungsschritte über fünf Jahre konkretisieren.
BLUTKREBS MIT NANOROBOTERN BEKÄMPFEN Aus DNA bauen die Innovator:innen Nano-Roboter, die im Körper gezielt Krebszellen aufsuchen. Und nur wenn diese gefunden sind, wird die körpereigene Superwaffe zum Einsatz gebracht – unser Immunsystem. Wir wollen endlich eine Krebsbehandlung schaffen, die nicht nur wirksam, sondern auch extrem zielsicher ist. Damit Patient:innen bei der Behandlung nicht mehr an den Nebenwirkungen leiden müssen.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN
Mit DNA-Origami entwickeln wir eine vollkommen neue Klasse an Medikamenten. Diese sollen nicht nur verbesserte, sondern auch bisher nicht vorhandene Behandlungen ermöglichen. Und damit das Gesundheitssystem revolutionieren.
Mit einem „AnundausSchalter“ immens viel Krankheitsleid verhindern –das ist die große Vision der Physiker Dr. Klaus Wagenbauer und Dr. Jonas Funke sowie des Verfahrenstechnikers Dr. Benjamin Kick. Die drei Gründer von Plectonic wollen das schärfste Schwert im Kampf gegen Krebserkrankungen noch besser und effizienter zum Einsatz bringen: das Immunsystem. „Wir wollen Krebsimmuntherapien verändern, sie wirksamer und zugleich nebenwirkungsärmer machen“, postuliert Klaus Wagenbauer, CEO der Plectonic. „Das eigene Immunsystem gegen den Krebs zu richten, kann viel bewirken. Wenn man Krebs hat, hat das Immunsystem initial schon einmal versagt. Es anschließend wieder gezielt lokal zu reaktivieren, kann sehr erfolgsversprechend sein.“
GEZIELTE REAKTION DES IMMUNSYSTEMS AUS
Um das zu ermöglichen, stattet das PlectonicTeam aus München Nanostrukturen mit Antikörpern aus; die so konstruierten Moleküle sind fähig, auf ein entsprechendes externes Signal zu reagieren: „Wir bauen dafür einen Schalter, der so groß ist, dass er verschiedene Biomoleküle aufnehmen kann und der in der Lage ist, seine Konformation zu ändern, wenn er eine Tumorzelle erkennt. In diesem Fall wird der Schalter „umgelegt“, sodass zuvor „versteckte Antikörper“ zum Vorschein kommen. Diese werden von körpereigenen Immunzellen erkannt, die damit für die Bekämpfung der Krebszellen rekrutiert werden“, erklärt Jonas Funke, der das Vorhaben als CSO im wissenschaftlichen Bereich führend betreut. „Bei einer gesunden Zelle
wird der Schalter nicht aktiviert und Immunzellen werden einfach vorbeifliegen, um gesundes Gewebe zu schonen.“ Aufgrund dieser WenndannLogik hat das Team dem AntikörperSchalter den Namen LOGIcgated AntiBODY oder kurz LOGIBODY gegeben.
Das Gerüst von LOGIBODY wird aus DNA konstruiert. Das Forschungsteam nutzt dafür die langjährige Erfahrung mit der DNAOrigamiTechnologie, die maßgeblich am Lehrstuhl für Biomolekulare Nanotechnologie der Technischen Universität München von Prof. Dr. Hendrik Dietz, ebenfalls CoGründer von Plectonic, vorangebracht wurde. Dabei wird DNA als Baustoff für die Werkzeuge in Nanogröße genutzt. Nach fast 15 Jahren Grundlagenforschung besitzt das Team genügend Verständnis über DNAOrigami, um damit hochspezifische Wirkstoffe gegen Krebs zu entwickeln.



„WENN UNS DAS MIT EINEM UNSERER WINZIGEN,
ABER KOMPLEXEN
NANOROBOTER
GELINGT, DANN ERÖFFNET
SICH IN DER MEDIZIN UND DER THERAPIE VON KRANKHEITEN EINE VÖLLIG NEUE WELT.“

„QUASI DER SPRUNG HINTER DER SPRUNGINNOVATION.“
REDUKTION DER HERSTELLUNGSKOSTEN UM
DAS TAUSENDFACHE
Die erst 2006 erfundene Technologie besetzt immer noch eine Nische. Das größte Problem war längere Zeit, dass die Herstellung von DNAOrigami unheimlich teuer ist – etwas, das Verfahrenstechniker Benjamin Kick zusammen mit Kolleg:innen am Lehrstuhl Dietz innerhalb seiner Promotion lösen konnte: Die Kosten ließen sich damit um den Faktor 1.000 reduzieren. Angestachelt von den neuen technischen Möglichkeiten widmeten sich die drei jungen PostDocs seit 2018 der Frage, wie sie ihre gesammelten Erkenntnisse am besten in die Anwendung bringen. Dass sie ein Unternehmen gründen möchten, war immer die Vision –um das Erforschte in die Welt zu bringen.
„Damals haben noch alle gesagt, das funktioniert nicht. Wir haben aber daran geglaubt und unsere Forschung zu den LOGIBODIES mit staatlichen Förderungen vorangetrieben“, erinnert sich Benjamin Kick, heute COO und
verantwortlich für das operative Geschäft. Und siehe da: InvivoStudien gaben den eifrigen „Grants“Sammlern recht und sicherten seit Ende 2021 auch das Interesse der SPRIND an der durchaus risikobehafteten Idee. Im Mai 2022 startete sodann die Validierung; unter dem Dach der eigenen SPRINDTochter Plectonic Logibody GmbH wurde ab Dezember 2023 eine Forschungskooperation besiegelt. Seitdem hat das inzwischen etwa 25köpfige Team eigene Labore außerhalb der TUM bezogen.
NÄCHSTER SCHRITT:
EINEN LEAD-KANDIDATEN FÜR DIE KLINISCHE
FORSCHUNG ENTWICKELN
Nun gilt es, für die LOGIBODIES innerhalb der nächsten Jahre einen geeigneten LeadKandidaten zu finden, der den langen Weg für klinische Studien ebnet. Dazu müssen die regulatorischen Hürden genommen und auch die pharmazeutische Produktion muss entsprechend aufgesetzt werden. „Vorrangig konzentrieren
wir uns zunächst auf die Anwendung gegen Blutkrebs. Und vor allem müssen Patientinnen und Patienten das Medikament gut vertragen“, erläutert Jonas Funke.
Da es sich um eine Plattformtechnologie handelt, entwickelt Plectonic diese parallel in einem zweiten Strang weiter, um neue Indikationen zu ermöglichen. So steht die Therapie solider Tumore, für die es derzeit noch schlechtere Behandlungsmöglichkeiten gibt, als späteres Etappenziel an. „Wir wollen unseren LOGIBODY so bauen, dass er noch effizienter und sicherer wird, so dass wir ihn mit anderen Molekülen kombinieren können, um verschiedene Wirkmechanismen zu testen und das volle Potential der Technologie, auch beispielsweise im Bereich von Autoimmunerkrankungen, auszuschöpfen“, berichtet Klaus Wagenbauer.





UND BICONY
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil uns das Wohl der Patient:innen am Herzen liegt. Weil es nach jahrelanger und intensiver Forschung gelungen ist, eine erfolgversprechende Plattform zu entwickeln, die das Potential hat, vielen Patient:innen zu helfen. Weil wir daran glauben, mit diesem Ansatz solide Tumore erfolgreich behandeln zu können.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN
Neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten und Ablösung von nebenwirkungsreichen Standardtherapien.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Toxizitätsstudien durchführen. Eine klinische Phase-I-Studie an Patient:innen mit metastasiertem Prostatakarzinom und eine klinische Phase-I-Studie an Patient:innen mit metastasiertem Kolonkarzinom vorbereiten und durchführen. Neue und innovative Wirkstoffkombinationen für weitere solide Tumorerkrankungen entwickeln. Wissenschaftliche Ergebnisse sammeln und der Gesellschaft zugänglich machen.
QUANTENSPRUNG IN DER KREBSIMMUNTHERAPIE
Am Ende des Vorhabens soll eine Pipeline mit potentiell bahnbrechenden Wirkstoffen für die Arzneimittelentwicklung zur Bekämpfung solider Tumore zur Verfügung stehen.


„ES IST ERFREULICH, DASS DIE T-ZELL-BASIERTE IMMUNTHERAPIE MITTLERWEILE FEST IN DER KREBSMEDIZIN VERANKERT IST.“
In der Forschung braucht es häufig einen langen Atem. Das gilt vor allem für die Entwicklung neuer Medikamente, wo nicht nur die Entwicklung im Labor, sondern auch die stetig zunehmenden behördlichen Auflagen und Vorschriften Zeit und Geld kosten. Diese Erfahrung mach(t)en auch Prof. Dr. Gundram Jung und Prof. Dr. Helmut Salih in den vergangenen 35 Jahren. Jung beschäftigt sich bereits seit Anfang der 80er Jahre mit der Immuntherapie von Krebs. Im Mittelpunkt stehen dabei Antikörperkonstrukte, die in der Lage sind, TZellen als effektivste Zellen des Immunsystems gegen Tumorzellen zu rekrutieren. In den 90ern stieß Helmut Salih dazu, als er als Assistenzarzt an einer klinischen Studie mit von Jung entwickelten bispezifischen Antikörpern mitwirkte. „Mich hat dieser Ansatz sofort überzeugt, und es ist großartig, dass ich schon vor 25 Jahren dabei sein durfte, als wir Gundram Jungs bispezifische Antikörper bei einigen Patienten mit Leukämie und Glioblastom eingesetzt haben – und zwar durchaus mit Erfolg“, erinnert sich Salih, heute ärztlicher Direktor und Professor für Translationale Immunologie am Universitätsklinikum Tübingen und am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).
BISPEZIFISCHE ANTIKÖRPER
KÖNNEN T-ZELLEN
STIMULIEREN UND GEZIELT AUF KREBSZELLEN LENKEN
„Es ist erfreulich zu sehen, dass die TZellbasierte Immuntherapie mittlerweile fest in der Krebsmedizin verankert ist. Sogenannte CheckpointHemmer, CARTZellen und bispezifische Antikörper sind zu einem Eckpfeiler bei der Behandlung zahlreicher Krebserkrankungen geworden und selbst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien wirksam. Diese Ansätze benutzen Antikörper entweder dafür, die TZellen direkt oder indirekt zu stimulieren oder sie gezielt auf Krebszellen zu lenken. Bispezifische Antikörper können beides und sind deshalb besonders vielversprechend. Allerdings erzielen sie zurzeit – wie die anderen genannten TZellrekrutierenden Strategien auch –nur bei bestimmten Krebsarten und in wenigen Patienten dauerhafte Erfolge“, erzählt Gundram Jung. „Die Schwierigkeiten beginnen mit der scheinbar einfachen Frage, wie man die Immunzellen dazu bringen kann, in ausreichender Zahl das Blutgefäßsystem zu verlassen und in einen soliden Tumor einzuwandern. Wir unterstützen diesen Prozess, indem wir unsere Antikörperkonstrukte gegen ‚Zielmoleküle‘ richten, die nicht nur auf Tumorzellen selbst, sondern auch auf den speziellen Blutgefäßen des Tumors exprimiert sind. Dadurch erreichen wir den erforderlichen Einstrom von TZellen“, führt Salih aus.
ZWEI-SCHLÜSSEL-PRINZIP Eine zweite wesentliche Verbesserung, die die Strategie von Salih und Jung ermöglicht, betrifft die Effizienz und Dauer der TZell Aktivierung. Es ist schon seit über 30 Jahren bekannt, dass die Natur bei der Aktivierung von TZellen, quasi aus Sicherheitsgründen, so etwas wie ein ZweiSchlüsselPrinzip verwendet, das heißt, es müssen zwei unterschiedliche Eiweißmoleküle auf der Zelloberfläche mehr oder weniger gleichzeitig stimuliert werden, ein erster Antigenspezifischer und ein zweiter kostimulatorischer Rezeptor. Fehlt das zweite, kostimulierende Signal, dann ist die Aktivierung relativ kurz und wird schnell wieder „abgeschaltet“. Die beteiligten Rezeptoren können mit Antikörpern – oder in CARTZellen – gezielt manipuliert werden. Während moderne CARTZellen mit beiden Signalen ausgestattet (und erst seitdem klinisch effektiv) sind, können die verfügbaren bispezifischen Antikörper bisher nur das Erstsignal simulieren. „In Tübingen haben wir eine spezielle Kombination von bispezifischen Antikörpern entwickelt, die sowohl das Erstsignal als auch das zweite Signal stimulieren. Dadurch dass die beiden in Kombination verwendeten bispezifischen Antikörper funktionell voneinander abhängig sind und zwei verschiedene Zielantigene auf Tumorzellen und gefäßen erkennen, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, erläutert Jung.
ZWEI ZIELANTIGENE
UND ZWEI SIGNALE: TWYCE Die beiden Zielantigene sind gemeinsam auf den Tumorzellen vorhanden, kommen jedoch auf gesunden Geweben nicht gleichzeitig vor. Somit wird zum einen eine überlegene Tumorspezifität erreicht, zum anderen mit der Doppelstimulation der TZellen eine verbesserte, weil anhaltende Effektivität der Immunantwort.
„Nach jahrzehntelanger Arbeit denken wir, dass wir mit unserem Konzept einen Quantensprung bei der Therapie mit bispezifischen Antikörpern erzielen können“, berichtet Helmut Salih. „Allerdings ist seit den ersten Schritten in den 90ern ein neues Problem aufgetaucht: der stetig zunehmende regulatorische Aufwand, der sowohl für die Herstellung als auch die klinische Erprobung erforderlich ist und den Weg neuer Medikamente wie unsere Antikörper vom Labor zum Patienten erheblich verlangsamt. Umso mehr freue ich mich, dass wir in der klinischen Kooperationseinheit Translationale Immunologie am Universitätsklinikum Tübingen mit dem DKFZ Heidelberg diesen
Prozess angehen und mittlerweile mehr als zehn neue Therapiekonzepte in klinischen Studien erproben.“ Für alle Schritte des Herstellungsprozess und der Durchführung klinischer Studien gibt es im Team engagierte Mitarbeiter mit jahrelanger einschlägiger Erfahrung. Um den Herstellungsprozesses kümmert sich, als gelernter Pharmazeut, Dr. Martin Pflügler, die Durchführung der klinischen Studien organisiert Dr. Jonas Heitmann, Internist und Onkologe.
2019 wurde eine erste Studie mit einem bispezifischen Antikörper, der das Signal 1 liefert, bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom gestartet. Die Patienten sprachen an, allerdings nur kurz. Basierend auf den Ergebnissen wird der Antikörper seit Ende 2022 bei Patienten mit einem sogenannten biochemischen Rezidiv des Prostatakarzinoms und somit geringer Tumorlast eingesetzt. Bei ihnen kann eine relativ kurze Aktivierung der TZellen für einen wirksamen Antitumoreffekt ausreichen. Für Patienten in fortgeschrittenem Stadium ist eine Studie geplant, bei der dieser
Antikörper erstmals in Kombination mit einem bispezifischen Kostimulator (BiCo) eingesetzt wird, der das Zweitsignal liefert und so die Dauer der TZellAktivierung deutlich verlängert. Diese Studie soll 2026 beginnen. Weitere bispezifische Antikörper, die die Behandlung anderer Krebsarten, wie des Darms oder der Brust, allein und in Kombination mit weiteren BiCos ermöglichen sollen, sind in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen Das alles ist aber alleine mit öffentlichen Mitteln nicht zu bewältigen. Deshalb haben Salih, Jung und Pflügler vor kurzem die TWYCE GmbH gegründet. Gemeinsam mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen und der im Mai 2023 gegründeten SPRINDTochter BiconY tritt das Team nun einmal mehr an, die bestehenden Hürden zu überwinden und das große Ziel zu erreichen, dem Krebs den Kampf anzusagen.
„WIR KÖNNTEN EINEN QUANTENSPRUNG BEI DER KREBSTHERAPIE ERZIELEN.“






„DAS
KERNSPALTUNGSKRAFTWERKS.“
SPRIND UND PULSED LIGHT TECHNOLOGIES
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS Weil wir davon überzeugt sind, dass Kernfusion eine der Energiequellen der Zukunft ist und die Laserfusion ein möglicher Weg sein kann. Wir haben die PLT gegründet, um Lasersysteme zu entwickeln, die nicht nur technologisch bahnbrechend sind, sondern auch den Weg für den kommerziellen Betrieb von Fusionskraftwerken ebnen können.DAS
MACHEN WIR KONKRET
Die PLT konzentriert sich auf die Entwicklung und den Bau von Lasersystemen, die die Kernfusion in einen kommerziell sinnvollen Bereich bringen. Wir arbeiten auch daran, die notwendigen Kapazitäten und Lieferketten frühzeitig aufzubauen, damit eine Infrastruktur zur Verfügung steht, wenn die Kernfusionstechnologie ausgereift ist.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN Wir wollen Deutschland als führenden Standort in der Fusionsforschung und -industrie positionieren. Eine breite Unterstützung der Industrie ist wichtig, nicht nur, um die Fusionstechnologie selbst zu nutzen, sondern auch um weltweit liefern zu können.
Wird Deutschland in wenigen Jahrzehnten Kernfusion zur Energiegewinnung nutzen können? Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn aktuell fördert SPRIND zwei vielversprechende Startups, die Kernfusion ermöglichen wollen: Focused Energy und Marvel Fusion. Die Unternehmen verfolgen unterschiedliche Ansätze, aber beide brauchen vor allem eines: intensive Laser.
Mit bisherigen Lasersystemen ist Kernfusion, die mehr Energie erzeugt, als für ihren Betrieb benötigt wird, kaum möglich. SPRIND hat daher die TochterGmbH Pulsed Light Technologies, kurz PLT, ins Leben gerufen. „Die PLT wurde gegründet, mit dem Ziel, Lasersysteme zu entwickeln, die so gebaut sind, dass sie später einen kommerziell sinnvollen Kraftwerksbetrieb unterstützen können“, erklärt Antonia Schmalz, Geschäftsführerin der PLT und Innovationsmanagerin bei SPRIND.
Die Effizienz aktueller Laser ist bislang sehr gering. PLT strebt Lasersysteme mit einer Effizienz von mehr als 10 Prozent an, die mindestens zehn Lichtimpulse pro Sekunde ausstrahlen. „Zehn Hertz wären ein gewaltiger Fortschritt und sind auch nötig, um einen sinnvollen Kraftwerksbetrieb aufrechtzuerhalten“, sagt Antonia Schmalz.
Das Unternehmen Focused Energy benötigt für seine Forschung einen Kompressionslaser und einen Zündlaser. Es will eine Brennstoffkugel von allen Seiten mit Laserpulsen bestrahlen, um sie zu komprimieren. Ein zweiter, kürzerer Laserstrahl soll Protonen beschleunigen und den komprimierten Brennstoff entzünden. Den dafür benötigten Nanosekundenlaser und Pikosekundenlaser entwickelt PLT gemeinsam mit dem Unternehmen und weiteren Partnern bis 2028.
Marvel Fusion hingegen benötigt einen Femtosekundenlaser. Das Unternehmen verfolgt einen unkonventionellen Ansatz: Es will einen nanostrukturierten Festkörper nutzen. Das Laserlicht trifft auf den Festkörper, dringt ein und läuft im Inneren eine stabähnliche Struktur entlang. Dabei stößt der Laserstrahl Elektronen aus dem Weg. Zurückbleiben die schwereren, positiv geladenen Atomkerne, die durch das entstehende elektrische Feld
hinter den Elektronen hergezogen werden. Aufgrund eines ringförmigen Aufbaus prallen die schweren Ionen dabei so auf den eingelagerten Brennstoff, dass dieser komprimiert wird und eine Fusionsreaktion stattfinden kann. Bereits 2026 könnten die ersten Tests mit dem PLTLaser anlaufen.
Trotz der geplanten LaserEntwicklung ist ein Kernfusionskraftwerk noch in weiter Ferne: „Was bei uns entstehen wird, sind nur Demonstratoren einer zentralen Kraftwerkskomponente. Demonstratoren, die aber natürlich möglichst viele Aspekte der Technologie schon zeigen sollen, die später für das Kraftwerk relevant sind“, erklärt Antonia Schmalz. „Bereits eine größere Demoanlage würde je nach Fusionsansatz 10 bis 100 Lasersysteme benötigen. Ein tatsächliches Kraftwerk um die 500.“ Wenn man bedenkt, dass bereits ein einzelnes Lasersystem aktuell etwa 70 Meter lang ist und auch nach den Entwicklungen der PLT noch ein bis zwei Schiffscontainer groß sein wird, werden die Dimensionen deutlich. „Weltweit gibt es bislang gar keine Fertigungskapazitäten, um innerhalb von ein bis zwei Jahren eine richtige Demoanlage aufzubauen“, erzählt Antonia Schmalz. Und nicht nur an den technischen Fertigungskapazitäten mangelt es, sondern auch am Geld: „Eine Demoanlage würde etwa 800 Millionen bis eine Milliarde Euro kosten. Doch die Finanzierung steht aus und verursacht ein HenneEiProblem“, sagt Antonia Schmalz und erläutert: „Solange nicht klar ist, ob eine solche Anlage finanziert wird, wird auch niemand in der Lieferkette Geld in die Hand nehmen, um sowohl die Entwicklung voranzutreiben als auch die nötigen Kapazitäten aufzubauen.“
SPRIND und die PLT versuchen, das Dilemma zu lösen, indem sie sich auch auf politischer Ebene für die Finanzierung einer Demoanlage einsetzen. „Wir wollen nicht nur das Geld beschaffen, sondern auch das Ökosystem mit aufbauen“, erklärt Antonia Schmalz. Denn das primäre Ziel der PLT ist die Entwicklung von Lieferketten rund um das künftige Kernfusionskraftwerk.
Von den Entwicklungen der PLT würde nicht nur die Fusion profitieren. „Die verschiedenen Lasersysteme haben noch sehr viele andere Anwendun
gen“, schwärmt Antonia Schmalz, die selbst promovierte Physikerin ist. „Man könnte zum Beispiel über verschiedene Mechanismen Strahlen von hochenergetischen Teilchen, wie Elektronen oder Neutronen erzeugen sowie intensive Röntgenstrahlen. Für die Diagnostik und Bestrahlung von Krebs, aber auch für verschiedene Materialuntersuchungen gäbe es viele Einsatzmöglichkeiten.” Als mögliche Standorte für eine solche Demoanlage und ein künftiges Fusionskraftwerk kommen zum Beispiel die Gelände alter Atom oder Kohlekraftwerke infrage. „Das hat mehrere Vorteile: Zum einen käme man den ehemaligen Betreibern entgegen, denn die müssten die Atomkraftwerke sonst eigentlich komplett zurückbauen, zum anderen könnte man von vorhandenen Strukturen profitieren“, erklärt Antonia Schmalz und führt aus: „Die Anlagen bieten Platz und mehr als genug Sicherheitsvorkehrungen. Das Risikoprofil eines Fusionskraftwerks ist drastisch entspannter als das eines Kernspaltungskraftwerks. Und dann wäre natürlich auch die Anbindung ans Stromnetz schon vorhanden.“
Es ist sinnvoll, schon heute darüber nachzudenken, was am Ende für ein Fusionskraftwerk benötigt wird und zur Verfügung stehen muss. „Wenn ich warte, bis technologisch alles demonstriert ist, und erst dann anfange, entsprechende Kapazitäten und Lieferketten aufzubauen, ist das keine gute Idee, weil wir dann zu langsam sind“, sagt Antonia Schmalz. Denn selbst wenn das erste Fusionskraftwerk am Ende nicht in Deutschland stehen sollte, könnte sich die vorausschauende Planung auszahlen: „Wir haben in Deutschland eine sehr starke Industrie, sowohl auf der Optik als auch auf der Laserseite. Das gilt im Übrigen auch für die Technologien der Magnetfusion. Eine breite Unterstützung dieser Industrie ist wichtig, nicht nur um die Fusionstechnologie selbst zu nutzen, sondern auch um weltweit liefern zu können.“
① DRINGEND BENÖTIGTE
RAHMENBEDINGUNGEN
→ Die Fusionsforschung galt lange Zeit als Grundlagenforschung. Mittlerweile haben die leistungsstärksten Supercomputer, Fortschritte in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, neue Laserdioden oder Hochtemperatursupraleiter die Fusion einer kommerziellen Anwendung jedoch deutlich nähergebracht. Diese technologischen Entwicklungssprünge haben im Zusammenhang mit einer kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach Energie in den letzten Jahren erstmals auch private Kapitalgeber zu Investitionen in die Fusionsindustrie motiviert. Weltweit konnten 43 Start-ups aus dem Bereich der Fusion, davon 4 in Deutschland, in Summe über sechs Milliarden Dollar an privaten Investitionen einsammeln (Fusion Industry Association 2023)
Die Start-ups verfolgen eine sehr breite Palette von technologischen Ansätzen und jedes Start-up einen eigenen. Durch die verschiedenen Technologien, die über alle Start-ups hinweg erforscht werden, steigen die Chancen, dass schnell ein wirtschaftlicher Ansatz gefunden wird. Im jetzigen Entwicklungsstadium ist es aber noch nicht möglich vorherzusagen, welche Technologien letztendlich den Markt erreichen werden. Daher ist die Fokussierung auf eine oder wenige Technologien heute nicht wissenschaftlich begründbar und auch nicht zu empfehlen (Metzler und Messinger 2023)
→ Damit Deutschland im Rennen um die beste Technologie bleibt und seine technologische Souveränität in Schüsseltechnologien bewahren kann, muss der Staat entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Diese Rahmenbedingungen sind eine Mindestanforderung an das politische Handeln und betreffen vor allem die Regularien und die Gestaltung der Ausbildung in Hochschulen und Unternehmen. Darüber hinaus sollte der Staat gezielt Anreize für die Wirtschaft setzen und Risiken reduzieren, indem sowohl ausbildende Organisationen als auch die Industrie strukturell durch die Bildung von konzentrierten Fusionshubs mit lokalen Ökosystemen unterstützt werden.
REGULARIEN
AUSBILDUNG
MEILENSTEINBASIERTE ÖFFENTLICHPRIVATE PARTNERSCHAFT, INDUSTRIEGEFÜHRTE KOOPERATIONSPROGRAMME
→ Es müssen verlässliche und risikoangepasste regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Bei Fusionskraftwerken existieren nur wenige Gefahren, die zudem auch ein deutlich geringeres Risiko aufweisen als bei Kernspaltungskraftwerken. Wenn bereits jetzt ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird, der auf das Gefahren- und Risikoprofil von Fusionskraftwerken zugeschnitten ist, kann ein planbares, vertrauenswürdiges Umfeld für die Start-ups und deren Investoren geschaffen werden. Zu strenge Vorschriften aus der Regulierung von Kernspaltungskraftwerken zu übernehmen, triebe die Kosten für Fusionskraftwerke in die Höhe. Nicht zuletzt erhöhen strenge Vorschriften auch die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Start-ups erste Erfolge im Ausland erzielen werden, denn die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich arbeiten bereits an der fusionsspezifischen Anpassung ihrer regulatorischen Rahmenbedingungen. Die beiden Länder verkündeten zudem vor kurzem, dass sie eine eigene gemeinsame Fusions-Entwicklungspartnerschaft geschlossen haben (Leake 2023).
→ Die Expertise, die in Deutschland in bestimmten Bereichen der Grundlagenforschung schon auf Weltspitze vorhanden ist, muss weiter ausgebaut und ergänzt werden. Jenseits der Physiker:innen, die sich mit den physikalischen Prozessen hinter der Fusionsenergie befassen, werden zukünftig zum Beispiel auch Ingenieur:innen, Anlagenbauer:innen oder Materialwissenschaftler:innen mit Spezialwissen benötigt, um die Prozesse großskalig umzusetzen und Kraftwerke zu entwickeln.
→ Mit einer breitgefächerten Ausbildung in Deutschland kann eine starke internationale Position erreicht werden, indem auch andere und zukünftige Fusionstechnologien kompetenter bewertet werden können.
→ Der Zeit- und Kostenplan des Versuchs-Fusionsreaktors ITER wurde in den letzten Jahren mehrfach revidiert. Daran lässt sich erkennen, wie bei komplexen Rahmenbedingungen, mit Ausschreibungspflichten, ineffektiver Zusammenarbeit, politischer Diplomatie und einer fehlenden Marktausrichtung, die mit einer rein staatlichen Finanzierung und langfristigen Forschungsplänen einhergehen, ein potentiell exzellentes Projekt ausgebremst wird.
POLITISCHES HANDELN
→ Getrieben durch ihre privaten Investoren verfolgen die Fusions-Start-ups eine strikt einzuhaltende, meilensteinbasierte Roadmap und arbeiten sehr zielgerichtet an der Wirtschaftlichkeit ihrer Fusionskraftwerke. Anders als staatlich finanzierte Projekte können sie ihre Strategie sehr flexibel und schnell an neue Erkenntnisse, Technologien und Marktentwicklungen anpassen. Wird ein Meilenstein nicht erreicht, werden sofort Maßnahmen ergriffen, die ggf. zu drastischen Konsequenzen und sogar zum Aus eines Projektes führen können.
→ In Deutschland und Europa gibt es zudem einen sehr anpassungsfähigen und versierten Mittelstand sowie Industriekonzerne, bspw. in der Automatisierungstechnik, Sensorik, Diagnostik, Materialentwicklung, Magnettechnik oder der Photonik-/Optik-Industrie. Diese Unternehmen können sowohl Komponenten für Fusionskraftwerke als auch Plattform- und Querschnittstechnologien liefern, die für verschiedene Fusionsansätze nutzbar sind. Bei geeigneten Anreizen könnten sie die Entwicklung und Industrialisierung jenseits der reinen Fusionsforschung gemeinsam mit den Fusions-Start-ups antreiben. Dabei wären sie in dieser Konstellation deutlich schneller als einzelne Forschungseinrichtungen. Ihre Technologien können zudem Innovationen in anderen Anwendungsbereichen und Branchen auslösen und sind nicht auf die Fusion beschränkt.
→ Start-ups sollten durch meilensteinbasierte öffentlich-private Partnerschaftsmodelle unterstützt werden. Ein meilensteinbasiertes Vorgehen, ähnlich einer SPRIND Challenge, stellt sicher, dass auch risikoreiche Projekte mit hohem Gewinnpotential gefördert werden, während Ansätze, die sich als ungeeignet erweisen, aussortiert werden können, um finanzielle Schäden zu begrenzen. Die Möglichkeit zu scheitern muss antizipiert und auch toleriert werden.
→ Der Beitrag der öffentlichen Hand sollte auch Zugang zu Forschungseinrichtungen und -anlagen sowie zu Rechenzentren beinhalten. Vorbildliche Programme finden sich bereits in den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich (Hsu 2023)
→ Der Mittelstand sollte gemeinsam mit Industriekonzernen, Fusion-Start-ups und Forschungsein-
FUSIONSHUBS, -DEMOANLAGEN UND -ÖKOSYSTEME
richtungen in Kooperationsvorhaben unterstützt werden. Dabei ist wichtig, dass baldmöglichst die wirtschaftlichen Partner die Führung übernehmen und nicht die Forschungseinrichtungen. Das neue Förderprogramm des BMBF zur Förderung von Verbundprojekten ist ein erster Schritt für solche Kooperationsvorhaben, die einen Weg in Richtung Marktreife fokussieren.
→ Ein Important Project of Common European Interest (IPCEI) wäre ebenso ein weiterer Schritt in Richtung Markt. Ein IPCEI zum Thema Fusion könnte Zwischenergebnisse aus Fusionsgrundlagenforschungsprojekten wie ITER, JET und WendelsteinX ausschleusen und zum Aufbau von Fertigungskapazitäten in den oben genannten Industrien nutzen bzw. zum Aufbau eines Demokraftwerks führen. Ein IPCEI zum Thema Photonik könnte sowohl die Fusionstechnologie mit Nebenanwendungen als auch die Fertigung von photonischen Schaltkreisen und Sensoren in einer Strategie vereinen.
→ Auch andere Modelle zur Unterstützung der Zulieferindustrie sind denkbar. So finanziert SPRIND derzeit bereits die Entwicklung von Lasertechnologie mit insgesamt 90 Mio. Euro über die nächsten fünf Jahre in einer Tochter-GmbH. Eine weitere Querschnittstechnologie sind Supraleiter, die neben der Fusion auch Anwendung in der Medizintechnik, Windrädern, Elektroflugzeugen oder Hochleistungskabeln für Stromtrassen finden können.
→ Für die Beschleunigung der Fusionskraftwerksentwicklung müssen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit umfangreichen Investitionen größere Zentren oder Cluster für ein aktives Ökosystem aufbauen. Diese Zentren oder Cluster benötigen entsprechende Infrastruktur, wie bspw. Rechenzentren, Messanlagen oder größere Demoanlagen. In diesem Rahmen sollten z. B. Laser-Anlagen und Raum für Tests und Experimente angeboten werden, auf die auch die Fusions-Start-ups zugreifen können sollten bzw. deren Spezifikationen sogar durch die Start-Ups gesteuert werden. Ein solcher Zugang reduziert den Kapitalbedarf der Unternehmen, unterstützt den Transfer aus der Grundlagenforschung und unterstützt vor allem auch die Entwicklung von Nachwuchs, wie bspw. beim Culham Center for Fusion Energy im Vereinigten Königreich.
→ In Deutschland gibt es bereits Forschungsstandorte, die hervorragend als Keimzellen solcher Aktivitäten geeignet wären, wie z. B. Darmstadt mit der Gesellschaft für Schwerionenforschung und der Technischen Universität München mit dem MaxPlanck-Institut für Plasmaphysik, dem Center for Advanced Laser Applications und zwei Universitäten, Dresden mit dem Helmholtz-Zentrum DresdenRossendorf und der TU Dresden, das KIT in Karlsruhe, das Forschungszentrum Jülich oder auch Hamburg mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY). Bei all diesen Standorten wären auch Nutzer jenseits der Fusion adressierbar, vor allem bei den Laserforschungseinrichtungen.
→ Die Forschung hat in den letzten Jahrzehnten hervorragende Grundlagen für die wirtschaftliche Anwendung der Fusion geschaffen. Die Entwicklung von wirtschaftlichen Kraftwerken wird aber nicht als Ergebnis aus dem Forschungsbetrieb abfallen, sondern muss durch die Industrie und die Start-ups getrieben werden. Dieser Entwicklungsprozess zu einer Fusionsenergiewirtschaft muss strukturell und durch Maßnahmen öffentlich-privater Partnerschaften gestärkt und durch die Forschung flankiert werden. Da noch nicht klar ist, welche Konzepte es wirklich an den Markt schaffen und langfristig tragfähig sein werden, muss mit flexiblen, meilensteinbasierten Programmen gearbeitet werden. Es sollten zudem verstärkt Plattform- und Querschnittstechnologien früh in der Wertschöpfungskette unterstützt werden. Zwingend nötige regulatorische Rahmenbedingungen und eine verbesserte Ausbildung können nur vom Staat vorangetrieben werden und sollte daher zu seinen Hauptaufgaben gehören.
→ Anders als der Brennstoff heutiger Atomkraftwerke ist das Sicherheitsrisiko bei Fusionskraftwerken äußerst niedrig, da ein Fusionsprozess keine Kettenreaktion auslöst – ganz unabhängig vom Brennstoff. Die meisten technologischen Ansätze zur Erzeugung von Fusionsenergie nutzen als Brennstoff Tritium und Deuterium. Tritium und Deuterium sind sogenannte Wasserstoff-Isotope, die im Vergleich zum „leichten“ Wasserstoff zusätzliche Neutronen aufweisen. Nur wenige Startups zielen bisher darauf ab, als Brennstoff Helium3-Kerne oder Bor mit Wasserstoff zu kombinieren. Tritium existiert in natürlicher Form nur in kleinen Mengen auf der Erde. Es kann aber aus Lithium, welches in großen Mengen verfügbar ist, direkt im Fusionskraftwerk hergestellt werden. Tritium besitzt eine Halbwertszeit von lediglich 12,3 Jahren. Es ist nur leicht radioaktiv und zudem nur in geringen Mengen gleichzeitig im Brennraum vorhanden, sodass es sich bei einer Verteilung in der Luft zusätzlich stark verdünnen würde. Die Radioaktivität von Tritium ist derart energieschwach, dass sie menschliche Haut von außen nicht durchdringen kann (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 2023). Der Tritium-Kreislauf und die im Prozess entstehenden schnellen Neutronen, welche die Wände der Reaktoren radioaktiv aktivieren können, erschweren zwar das Design des Fusions-Kraftwerks, jedoch sind die anderen, nichtradioaktiven Brennstoffe, die kaum schnelle Neutronen erzeugen, signifikant schwerer zu fusionieren.
→ Es werden vorwiegend zwei Pfade verfolgt, um den Brennstoff zu fusionieren: langfristiger Einschluss des zu fusionierenden Plasmas durch externe Magnetfelder, sog. Magneteinschluss, oder kurzfristiger Einschluss durch die Trägheit der involvierten Masse selbst, sog. Trägheitsfusion. Dazu kommen verschiedene Zündmechanismen.
→ Beim Magneteinschluss wird in großen ringförmigen Anlagen mit verschiedenen Techniken das erzeugte Plasma aufgeheizt und durch eine Vielzahl supraleitender Magnete zusammengehalten. Die zwei prominentesten Ansätze sind der sog. Tokamak (einfache Geometrie plus externer Strom) und der Stellarator (komplexe Geometrie). Der Tokamak ist das am gründlichsten erforschte Konzept, das jedoch mit Plasmainstabilitäten zu kämpfen hat.
Diese Instabilitäten entstehen durch die Dynamik der wechselseitig wirkenden Magnetfelder, denn die extern angelegten Magnetfelder werden durch ein Magnetfeld im Inneren ergänzt, das durch elektrischen Strom erzeugt wird, der permanent direkt durch das Plasma geleitet wird. Der Stellarator ist zwar stabiler, benötigt aber, um auf das innere Magnetfeld verzichten zu können, ungleichmäßig gebogene Magnetspulen, deren Form nur schwer zu berechnen und herzustellen ist.
→ Für die Trägheitsfusion wird ein Treibstoff-Pellet meist durch hochintensive Laserstrahlen komprimiert und aufgeheizt. Je nach Konzept wir das Pellet zum Beispiel durch weitere externe Treiber wie Teilchen- oder Laserstrahlen gezündet. Der Betrieb erfolgt gepulst.
→ Mittlerweile ist das initiale, erstmalige Zünden des Fusionsprozesses mit wenigen Kernen grundsätzlich keine Herausforderung mehr. Die Herausforderung liegt bei allen Ansätzen aktuell vielmehr darin, den Fusionsprozess stabil auszulösen und möglichst ohne wiederholte Zündungen laufen zu lassen. Wenn sich der Fusionsprozess nach initialer Zündung selbst erhält, so wie beispielsweise in der Sonne, verbraucht seine Aufrechterhaltung weniger Energie, als durch ihn erzeugt wird, und das Kraftwerk beginnt wirtschaftlich zu werden. Kritische Bestandteile sind unter anderem die Lasersysteme oder auch herkömmliche Magnete, die aktuell energetisch ineffizient sind.
→ In Deutschland existieren bereits mehrere FusionsStart-ups: Proxima Fusion und Gauss Fusion – jeweils mit dem Ziel, einen Stellarator (Magneteinschluss) zu entwickeln, sowie Focused Energy und Marvel Fusion, die mit unterschiedlichen Herangehensweisen die Laser(trägheits)fusion verfolgen. Dazu kommt die SPRIND-Tochter Pulsed Light Technologies.
PULSED LIGHT TECHNOLOGIES
→ Die Pulsed Light Technologies GmbH (PLT) ist eine hundertprozentige Tochter der SPRIND und soll über die nächsten fünf Jahre ein Darlehen in Höhe von ca. 90 Millionen Euro aus dem SPRINDHaushalt erhalten. PLT entwickelt keine Produkte, sondern Demonstratoren / IP von Kerntechnologien, die für zukünftige Laserhersteller oder andere Zulieferer das hohe technische Risiko und indirekt auch das wirtschaftliche Risiko im derzeit sehr unsicheren Markt reduzieren.
→ Ziel der PLT ist es, die für eine lasergetriebene Fusion notwendige Infrastruktur zu entwickeln. Es sollen Themen bearbeitet werden, die für die Fusion zwingend nötig, aber nicht Kernentwicklung und Kern-IP derjenigen Start-ups sind, die auf die Entwicklung eines Fusionskraftwerks abzielen.
→ Aktuell werden in Zusammenarbeit mit den in Deutschland ansässigen Laserfusions-Start-ups Lasersysteme entwickelt, die deren zentrale Elemente der nachweisen, die für einen späteren Kraftwerksbetrieb nötig sind. Die beiden Kooperationspartner Marvel Fusion (München) und Focused Energy (Darmstadt) verfolgen im Detail unterschiedliche Ansätze, die auch unterschiedliche Anforderungen an die Lasersysteme stellen.
REFERENZEN
Metzler, Florian and Messinger, Jonah, The Spectrum of Nuclear Energy Innovation (June 1, 2023).
Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=4531998
Leake, Jonathan (2023): UK strikes nuclear fusion deal with US after snub from EU , The Telegraph. URL: www.telegraph.co.uk/ business/2023/11/08/ukstrikesnuclearfusiondealwithus afterbrexitsnubeu/. Abgerufen am 10.11.2023.
Hsu, Scott C. (2023): U.S. Fusion Energy Development via Public-Private Partnerships , in: Journal of Fusion Energy, 42(12). URL: https://link.springer.com/ article/10.1007/s10894023003579.
Fusion Industry Association (2023): The global fusion industry in 2023.
URL: www.fusionindustryassociation.org/news/ fromthefia/#industryreports
MaxPlanckInstitut für Plasmaphysik (2023): Tritium . URL: www.ipp.mpg.de/84503/tritium. Abgerufen am 10.11.2023.
WEITERFÜHRENDE LITERATUR Public-Private Partnership Program (https://science.osti.gov/fes//media/grants/ pdf/foas/2022/SC_FOA_0002809.pdf)
UK: Strategy
(https://assets.publishing.service.gov.ukmedia/ 65301b78d06662000d1b7d0f/towardsfusionenergystrategy2023update.pdf)
Culham Center for Fusion Energy (https://ccfe.ukaea.uk)
Es ist Zeit für Veränderung: Mit den Projekten adlunas und Mein Bildungsraum will die SPRIND die Transformation im Bildungswesen fördern und vorantreiben. Was genau sich hinter der Bildungsmission der SPRIND verbirgt, verraten Jelka Seitz und Johannes Koska, die die Bildungsmission von Beginn an vorantreiben, im Interview.
MIT ADLUNAS MÖCHTET IHR
DEN AKTUELLEN SCHULBETRIEB ÄNDERN – WARUM?
JOHANNES KOSKA: Unser Schulsystem ist in keinem guten Zustand. Schulen sind die wichtigsten Bildungsorte in Deutschland und stehen zurzeit vor vielen verschiedenen Problemen: Jeder vierte Grundschüler kann nicht mehr richtig lesen und schreiben. Wir haben einen riesigen Lehrkräftemangel. Hinzu kommen Probleme durch mangelnde Digitalisierung innerhalb des Systems bei gleichzeitig rasanter Digitalisierung im Äußeren, vor allem im Bereich der KI.
JELKA SEITZ: Das System steht unter Druck. In den letzten Jahrzehnten ist einfach ein enormer Innovationsstau entstanden und das Schulsystem hat sich kaum verändert, während unsere Welt und Gesellschaft völlig anders sind. Mittlerweile geht es auch nicht mehr nur um inkrementelle, sondern um grundlegende Veränderung. Eine Transformation.
NOTWENDIG?
JS: Schulen müssen Kinder und Jugendliche auf eine veränderte Außenwelt vorbereiten. Auf eine neue Realität mit einem hohen Technologisierungs und Vernetzungsgrad. Das bringt neue Chancen mit sich, aber auch Herausforderungen wie Deep Fakes oder immer drängendere Umwelt und Demokratiethemen …
JK: Schüler und Schülerinnen müssen vor allem lernen, mit dem ständigen Wandel umzugehen. Aber sie brauchen auch weitere Metakompetenzen wie z. B. kritisches Denken oder Kreativität. Außerdem müssen wir wegkommen von der Standardisierung hin zu einer Individualisierung, damit jeder nach Bedarf und Interesse lernen kann. In unserem Projekt adlunas geht es aber nicht darum, dass Kinder und Jugendliche anders oder andere Inhalte lernen sollen, sondern darum, das Schulsystem im Transformationsprozess zu unterstützen und zu befähigen, mit den ständigen Veränderungen erfolgreich umzugehen. Denn das heutige System ist dafür gebaut, Bestehendes zu bewahren.
DAS HEISST, BEI ADLUNAS GEHT ES NICHT UM BILDUNGSINHALTE?
JK: Wir schauen bei adlunas weder auf die Pädagogik in den Schulen noch auf die Bildungsinhalte. Das ist nicht unsere Aufgabe und da gibt es auch
schon sehr viel Gutes. Wir wollen uns stattdessen anschauen: Wie muss sich das System verändern – unabhängig von den Inhalten?
JS: adlunas wurde ins Leben gerufen, um Veränderungen und Innovationen im Schulsystem zu erleichtern. Wir schauen uns an, welche Faktoren die Umsetzung einer zeitgemäßen Pädagogik verhindern. Sowohl in der Schule als auch im Ökosystem rund um Schule. Mit Ländern, Kommunen und Schulen, die das interessiert, arbeiten wir zusammen.
WIE GENAU WILL ADLUNAS LÄNDER, KOMMUNEN UND SCHULEN BEI TRANSFORMATIONSPROZESSEN HELFEN?
JS: Eine Sache zuerst: Es gibt überall in den Schulen, auf allen Ebenen der Verwaltung und in der Politik, der Wissenschaft sowie außerhalb des Systems tolle Menschen und Initiativen, die bereits sehr viel Energie in Veränderungen und Verbesserungen des Schulsystems stecken. Weil das System aber nicht mit dem Umsetzen von Neuem umgehen kann, ist es für alle, die etwas verändern wollen, unglaublich anstrengend. Viele stoßen dabei immer wieder auf dieselben Probleme, die sie aber alleine nicht bewältigen können.
JK: Außerdem unterschätzen viele außerhalb des Schulsystems, wie enorm die Arbeitsbelastung sowohl in den Schulen als auch innerhalb der Verwaltung ist.
„ES IST UNS WICHTIG, IMMER AUF BESTEHENDEM AUFZUBAUEN, BEVOR WIR ETWAS NEUES MACHEN.“
Da macht man Neues nicht, schon gar nicht, wenn es so schwer umzusetzen ist, einfach mal nebenher. Wir als adlunas verstehen uns als externe Kollegen, die Ressourcen und Kompetenzen zur Verfügung stellen und dabei unterstützen, Veränderungshürden zu identifizieren und zu bearbeiten.
WIE GEHT IHR DIE VERÄNDERUNGSHÜRDEN KONKRET AN?
JS: Wir fokussieren uns auf technologische und systemische Hürden. Letztere umfassen auch Organisationsthemen. Schulen werden z. B. als nachgelagerte Behörde gesehen, nicht als eigenständige Organisation, die entsprechend geführt wird. Leistungsfähige Schulsysteme im Ausland und Schulen, die sich hierzulande bereits erfolgreich transformiert haben, zeichnet das aber aus. In einem unserer ersten Projekte schauen wir auf diesen Aspekt: Wie kann man Schulen in der Transformation prozessual auf der Organisationsseite unterstützen?
JK: Dazu zählt aus technologischer Sicht auch, wie man z. B. Verwaltungsprozesse automatisieren oder vereinfachen und grundsätzlich Entlastung ins System bringen kann. Andere Hürden ergeben sich z. B. durch rechtliche Themen. Denn durch die Transformation braucht es neue Rechtsrahmen oder Rechtsauslegungen. Dabei geht es oft auch darum, zu
verstehen, welche persönlichen Risiken man eingeht. Momentan sind viele verunsichert, was erlaubt ist und was nicht. Neben Haftungsfreistellungen könnten Leitfäden helfen, die wir bei Interesse seitens der Länder oder Kommunen bzw. der Schulträger erarbeiten lassen.
JS: Wir sehen unsere Kernaufgabe zum einen darin, Prozesse und Formate zu etablieren, mit denen man sowohl relevante Hürden zur Veränderung identifiziert, als auch Innovationstreiber oder Initiativen, die entweder bereits Lösungen oder Lösungsideen haben. Von denen gibt es einige, oft auch abseits des Rampenlichts. Zum anderen geht es darum, dass am Ende immer Lösungen respektive Produkte entstehen, die für die jeweilige Zielgruppe tatsächlich im Alltag nutzbar sind. ES GEHT ALSO VOR ALLEM DARUM, BEREITS EXISTIERENDE LÖSUNGEN ZU FINDEN?
JK: Grundsätzlich kann man sagen, dass es für viele Probleme bereits Lösungen gibt. Diese sind nur nicht für alle zugänglich oder nicht so aufbereitet, dass sie im eigenen Kontext umsetzbar sind. Es mag sich für Leute aus dem TechBereich sehr merkwürdig anhören, aber zum Beispiel digitale Endgeräte oder auch nur WLAN an Schulen zu bringen kann unfassbar schwierig sein – und da sprechen wir noch nicht mal von Fragen rund um den sinnvollen Einsatz von digi
talen Technologien im Schulalltag. Aber an manchen Orten klappt es auch gut: Lübeck ist so ein Beispiel für gelungene Digitalisierung im Schulbetrieb. Das ist ein recht prominentes Beispiel, aber solche Beispiele lassen sich überall finden. Die Frage ist: Wie können die dort gewonnenen Erkenntnisse übertragen werden. Diesen Transfer können die Akteure nicht selbst stemmen, dafür fehlen ihnen die Ressourcen. Das ist auch eine Art von Veränderungshürde.
JS: Es gibt also schon sehr viel Wissen, aber oft wird das Rad immer wieder neu erfunden, allein, weil es keinen Überblick darüber gibt, was funktioniert und was nicht. Daher wird es ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein, aufzuzeigen, was funktionieren kann, weil es schon woanders erfolgreich gemacht wurde, und dabei die Ressourcen und Kompetenzen bereitzustellen, um es zur Nutzung für andere aufzubereiten.
DAS HEISST, ADLUNAS VERSUCHT, PROTOTYPISCHE INNOVATIONEN UND ENTWICKLUNGEN ALLEN IM SCHULSYSTEM ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN?
JK: Ja, dabei ist es uns wichtig, immer auf Bestehendem aufzubauen, bevor wir etwas Neues machen. Zum Beispiel beim Datenschutz. Bevor wir selbst eine Übersicht oder eine Blaupause machen,
in der steht, was datenschutzkonform ist und welche ITLösungen möglich sind, schauen wir erst einmal, ob es jemanden gibt, der sich damit schon beschäftigt hat. Manche Sachen müssen aber auch neu entwickelt werden, da sie bislang nur in den Köpfen existieren.
JS: Generell ist uns wichtig, dass die Entwicklungen kollaborativ entstehen. Wir wollen dazu mit verschiedenen Partnern aus Schulen, Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Im Grunde sehen wir uns als Katalysator ihres Handelns. NEBEN ADLUNAS GIBT ES SEIT KURZEM EIN WEITERES GROSSES BILDUNGSVORHABEN. DAS BMBF HAT DER SPRIND DAS PROJEKT „MEIN BILDUNGSRAUM“ ÜBERGEBEN. WAS GENAU IST „MEIN BILDUNGSRAUM“?
JK: „Mein Bildungsraum“, davor bekannt als „nationale Bildungsplattform“ und „digitale Vernetzungsstruktur Bildung“, ist ein groß angelegtes Digitalisierungsprojekt. Es ist der Versuch, innerhalb des föderalen deutschen Systems die Basis dafür zu schaffen, dass Bildung überall digital wird. Das soll zum einen die Verwaltungsprozesse betreffen, zum anderen soll es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden, online Bildungsangebote zu finden, die zu ihrer persönlichen Qualifikation passen. Mit

Übernahme durch die SPRIND werden wir uns zunächst einmal nur auf die Verwaltungsprozesse konzentrieren.
WARUM HAT DIE SPRIND DAS PROJEKT ÜBERNOMMEN?
JS: Zum einen kann die SPRIND an bestimmten Stellen einfach anders handeln, als es ein Bundesministerium kann. Außerdem ist die Lage zwischen dem Bund und den Ländern im Bildungsbereich eher angespannt. Aber wir haben nicht automatisch das Stigma, dass wir der Bund sind. Das macht es für viele leichter, mit uns zu sprechen. Zum anderen hat die SPRIND bereits in der Vergangenheit zeigen können, dass sie lösungsorientiert und als staatliches Unternehmen möglichst agil arbeitet.
WELCHE KONKRETEN
ZIELE VERFOLGT DIE SPRIND BEZÜGLICH DES BILDUNGSRAUMS?
JK: Wir werden uns zunächst auf die technische Umsetzung einer digitalen Identität, eines Wallets, in dem Bildungszertifikate gespeichert werden können, und auf ein Siegelungs und Zertifizierungssystem konzentrieren. In Zukunft soll es möglich sein, dass Schulen direkt digitale Zeugnisse ausstellen, die signiert und zertifiziert sind. Diese sollen dann problemlos, vollständig digital an die Hochschulen weitergeleitet werden können, was den gesamten Einschreibeprozess
erheblich beschleunigen wird. Langfristig sollen alle bildungsrelevanten Bescheinigungen digitalisiert werden. Bei der Umsetzung werden wir eng mit dem SPRINDProjekt „EUdi Wallet“ zusammenarbeiten.
JS: Außerdem werden wir ein Betriebs und Betreiberkonzept entwickeln. Denn selbst wenn die technischen Lösungen heute schon funktionieren würden, gibt es noch kein Konzept, wie die Umsetzung im Rahmen der föderalen Struktur langfristig funktionieren kann. Wir werden daher viele BundLänderGespräche, aber auch Dialoge mit der Zivilgesellschaft führen, um eine gemeinsame Lösung für Politik, Verwaltungen, Kommunen und Schulen zu finden. WAS KOMMT DANACH?
JK: Wir werden jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen, indem wir uns auf diesen Anwendungsfall konzentrieren. Natürlich haben wir aber noch viele weitere Ideen. Zu gegebener Zeit werden wir darüber sprechen.
Mit dem EUdi Wallet soll es in Zukunft möglich sein, sich digital auszuweisen und amtliche Dokumente digital zu speichern und zu verwalten. SPRIND wurde vom Bundesministerium des Innern (BMI) beauftragt, die Entwicklung des EUdi Wallet voranzutreiben.
Projektleiter des Konsultationsund Architekturprozesses ist Dr. Torsten Lodderstedt. Im Interview erläutert er, wie das Portemonnaie der Zukunft aussehen wird.
EUDI WALLET IST EINE ABKÜRZUNG FÜR „EUROPEAN DIGITAL IDENTITY WALLET“ ABER WAS GENAU IST DAS EIGENTLICH?
DR. TORSTEN LODDERSTEDT: Viele Menschen nutzen bereits digitale Brieftaschen auf ihren Smartphones. Sie hinterlegen zum Beispiel ihre Kreditkarte, um mit dem Handy bezahlen zu können. Oder sie speichern Konzertkarten und Boardingpässe für Flüge. Das EUdi Wallet entwickelt diese Idee weiter und soll dabei für das erforderliche Niveau an Datenschutz und Sicherheit sorgen. Wir wollen eine digitale Brieftasche für alle ermöglichen. Alles, was heute Plastik, Pappe oder Papier ist, soll in Zukunft auch digital verfügbar sein.
DAS HEISST, SPRIND WILL EINE ENTSPRECHENDE APP BAUEN?
TL: Die sogenannte eIDASVerordnung schreibt vor, dass ab 2027 jeder die Möglichkeit haben soll, eine digitale Brieftasche zu nutzen, deshalb arbeiten wir zurzeit an einem staatlichen Wallet für Deutschland. Unser Wallet soll in Form einer App für Android und iOS angeboten werden. Die Meinungsbildung dazu findet gerade im Konsultationsprozess statt.
ABER KÖNNTE MAN NICHT
EINFACH DIE BEREITS
BESTEHENDEN WALLETS BENUTZEN?
TL: Die eIDASVerordnung gibt einige Spielregeln vor, wie ein sicheres Wallet auszusehen hat. Nur wenn alle Regularien der Verordnung erfüllt werden, bekommt man das Label „EUdi Wallet“. Das heißt, Anbieter wie Apple, Google oder Samsung könnten theoretisch auch ein EUdi Wallet anbieten. Unser staatliches Wallet wird aber vermutlich das erste Wallet für deutsche Bürger und Bürgerinnen sein, das den eIDASAnforderungen entspricht. Weitere EUdi WalletAnbieter würden wir begrüßen, denn wir glauben, dass es gut ist, wenn jeder selbst wählen kann, welchem Anbieter er vertraut.
MUSS DENN JEDER AB 2027
EIN EUDI WALLET BESITZEN?
ZUM EINEN HABEN NICHT ALLE BÜRGER:INNEN EIN SMARTPHONE, ZUM ANDEREN WILL VERMUTLICH AUCH NICHT JEDER EINE DIGITALE BRIEFTASCHE.
TL: Was immer wir tun, darf natürlich kein Mitglied der Gesellschaft ausschließen. Insofern, und das sieht auch die eIDASVerordnung vor, darf es keinen Zwang geben. Um zum Beispiel öffentliche Services zu nutzen, muss es also immer eine Alternative zur Identifikation mit dem EUdi Wallet geben. Das EUdi Wallet ist ein komplett freiwilliges Angebot. Wir wissen, dass viele befürchten, sich überall im Internet mit dem elektronischen Wallet ausweisen zu müssen. Aber wenn ich anonym unterwegs sein möchte, muss ich das Wallet gar nicht benutzen. Außerdem soll das Wallet nicht nur die Verwendung der eigenen Identität, sondern auch die Verwendung von Pseudonymen ermöglichen. WELCHE WEITEREN VORTEILE BIETET DAS EUDI WALLET?
TL: Im EUdi Wallet wird man viele verschiedene Nachweise speichern können, zum Beispiel Schul und Arbeitszeugnisse könnten so immer griffbereit sein. Heutzutage werden Papierzeugnisse für eine Bewerbung oft eingescannt und danach als PDF verschickt. Die Echtheit der Dokumente ist für den Arbeitgeber schwer überprüfbar.
Mit dem EUdi Wallet würde sich das ändern. Die Schulen und Hochschulen generieren für jedes Zeugnis einen kryptografischen Fingerabdruck, der mit einem geheimen Schlüssel verschlüsselt wird. Dadurch entsteht eine elektronische Signatur, die ähnlich wie ein Wachssiegel funktioniert. Versucht jemand, ein Dokument nachträglich zu verändern, sieht man dies direkt. Außerdem ist immer einsehbar, wer das Dokument ausgestellt hat. Dank der elektronischen Signaturen könnte man in Zukunft auch sehr einfach, komfortabel und vor allem rechtssicher an OnlinePetitionen teilnehmen. Das ist toll für unsere Demokratie. ANGENOMMEN, DAS EUDI WALLET IST VOLLGEPACKT MIT WICHTIGEN DOKUMENTEN – WIE GUT IST DIE DIGITALE BRIEFTASCHE VOR HACKERANGRIFFEN GESCHÜTZT?
TL: Wir stellen sicher und tragen Sorge dafür, dass die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Neben dem Einsatz moderner Verschlüsselungsalgorithmen werden zusätzlich Hardwarekomponenten des jeweiligen Smartphones für die individuelle Verschlüsselung genutzt. Die Verschlüsselung des Wallet ist daher wirklich sehr sicher. Anwender haben die Sicherheit natürlich auch selbst in der Hand, zum Beispiel durch die Wahl einer schwer zu erratenden PIN. „123456“ ist
offensichtlich keine gute Idee. Es gibt im Fall eines Handydiebstahls jedoch auch die Möglichkeit, alle Nachweise im Wallet sperren oder löschen zu lassen. WIE IST DER AKTUELLE STAND DES STAATLICHEN WALLETS?
TL: Wir starten momentan mit dem digitalen Personalausweis; dieser erste Schritt wird auch als „Evolutionslösung“ bezeichnet. Das ist das Herzstück der digitalen Brieftasche, denn damit wiederum wird man sich dann gegenüber Hochschulen und anderen Institutionen ausweisen können, um zum Beispiel ein Zeugnis ausgestellt zu bekommen. Unser Hauptfokus liegt jedoch auf dem Konsultations und Architekturprozess, den wir begleiten und gestalten. Das heißt, unser primäres Ziel ist es, im Dialog mit der Gesellschaft ein Konzept zu entwickeln, wie Wallets und das gesamte Ökosystem, inklusive der Aussteller und Konsumenten von Nachweisen, in Deutschland implementiert werden können. Wir haben im letzten Jahr angefangen und werden im nächsten Jahr im Sommer ein Konzept dazu abgeben. Zur Evaluation der initialen technischen Ideen und zur Unterstützung des Findens weiterer innovativer Ideen für die Implementierung der EUdi Wallets haben wir im Rahmen des Projekts einen Innovationswettbewerb gestartet, den sogenannten Funken „EUdi Wallet Prototypes“.

WAS IST DAS ZIEL DES FUNKENS?
TL: Bei unserem Funken stellen sich elf Teams der Herausforderung, einen Prototypen für das EUdi Wallet zu entwickeln. Wir haben im Projekt Konzepte entwickelt, aber die Teams müssen diese wirklich implementieren. Dabei ist die größte Herausforderung, ein Wallet zu implementieren, das die hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz erfüllt und gleichzeitig einfach nutzbar ist und für viele interessierte Nutzende zur Verfügung steht. Ich bin daher sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Alle FunkenTeams (im Funded Track) publizieren ihre Ergebnisse öffentlich. Das heißt, jeder kann den Source Code benutzen. Das ist bewusst so gewollt. Und die Erkenntnisse, die wir jetzt gewinnen durch den Funken, fließen natürlich auch direkt in die konzeptionelle Entwicklung des staatlichen Wallets mit ein.
Wenn Forschende aus einer Universität, einem Institut oder einer Forschungseinrichtung ausgründen wollen, ist das nicht immer einfach. Denn die Schutzrechte, auf denen das Start-up basiert, gehören in der Regel der Einrichtung und nicht dem Gründerteam. Wie kann der Transfer des geistigen Eigentums – des „Intellectual Property“ – von der Universität zum Gründerteam erfolgreich gestaltet werden? Wie SPRIND sowohl Gründerteams als auch Einrichtungen unterstützen will, erklärt Barbara Diehl, die bei SPRIND die Initiative „IP-Transfer 3.0“ leitet, im Interview.
WARUM IST DER IP-TRANSFER, ALSO DIE ÜBERTRAGUNG DER SCHUTZRECHTE AUF DAS GRÜNDERTEAM, BISHER OFT PROBLEMATISCH?
BARBARA DIEHL: Bisher ist es gängige Praxis, dass eine Einrichtung, wenn sie Schutzrechte in eine Ausgründung überträgt, ein Lizenzmodell wählt. Das bedeutet, die Einrichtung sagt zu dem Startup: „Du kannst das Schutzrecht nutzen und erhältst eine Lizenz, aber dafür sind Lizenzzahlungen fällig.“ Diese Lizenzzahlungen und die damit verbundenen Zahlungsströme stellen für das Startup häufig ein Problem dar. Denn zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen noch keine Einnahmen. Jeder Geldabfluss ist in dieser frühen Phase Gift für das junge Unternehmen.
BD: Statt eines Lizenzmodells könnte die Einrichtung auch Anteile an den Ausgründungen nehmen. Gesellschaftsanteile sind jedoch mit sehr vielen Verpflichtungen verbunden. Dieses Modell kommt daher meist nicht infrage, da die Hochschulen oft weder personaltechnisch noch Knowhowtechnisch darauf ausgerichtet sind, solche Gesellschafterverantwortlichkeiten professionell wahrzunehmen. Ein spannender Lösungsansatz sind virtuelle Anteile. Virtuelle Anteile sind im Wesentlichen normale Gesellschaftsanteile mit der Besonderheit, dass sie kein Stimmrecht enthalten. Sie müssen auch – anders als stille Beteiligungen – nicht notariell eingetragen sein. Bei einem Verkauf des Unternehmens bekommt die Einrichtung – wie jeder andere Gesellschafter – gemäß ihres prozentualen Anteils eine entsprechende Auszahlung. Theoretisch ist auch ein früherer Verkauf der virtuellen Anteile möglich, wenn dies vorab vertraglich festgehalten wurde.
WELCHE VORTEILE HABEN
DIE VIRTUELLEN ANTEILE FÜR
DAS GRÜNDERTEAM?
BD: Dass die Lizenzzahlungen entfallen, ist natürlich ein großer Vorteil, aber es gibt noch weitere: Bei einem Lizenzmodell verbleiben die Schutzrechte bei der Universität. Virtuelle Anteile werden hingegen – idealerweise – im Tausch gegen eine komplette Übertragung der Schutzrechte vergeben. Das gibt dem
Gründerteam und den Investoren Sicherheit. Und auch die Beziehung zwischen den Innovatoren und der Universität verändert sich. Die Universität geht gemeinsam mit dem Gründerteam und allen übrigen Investoren ins Risiko. Alle sitzen im selben Boot.
ABER VERSCHLECHTERN VIRTUELLE ANTEILE NICHT DIE SITUATION DER HOCHSCHULEN? DURCH LIZENZZAHLUNGEN BEKOMMEN SIE KONTINUIERLICH GELD, DURCH VIRTUELLE ANTEILE ERST IRGENDWANN IN DER ZUKUNFT.
BD: Ist das Startup erfolgreich, steigt der Wert des Unternehmens und damit auch der Wert der virtuellen Anteile der Hochschule. Für die Hochschulen kann es daher finanziell sehr attraktiv sein, das Unternehmen nicht von Anfang an zu schröpfen, sondern sich am Risiko zu beteiligen.
WIE SCHAFFT MAN ES, DASS SICH GRÜNDERTEAM UND HOCHSCHULE AUF DIE HÖHE DER VIRTUELLEN ANTEILE EINIGEN?
BD: Bevor über die Höhe der Beteiligung verhandelt werden kann, muss zunächst der Wert des IP bewertet werden. Die Kernfrage lautet: Wie wichtig und zentral sind die Schutzrechte für das Geschäftsmodell und den Erfolg des Unternehmens? Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein Tool entwickelt, das sowohl das Gründerteam als auch die Institution bei der IPBewertung unterstützen
kann. Dieses Tool heißt „IPScorecard“ und kann helfen, die Bewertung zu vereinfachen und zu objektivieren. Zusätzlich haben wir im Rahmen des Projektes ein „IPWahlOMeter“ entwickelt. Das ist im Grunde ein Fragebogen, den das Gründerteam und idealerweise auch die Transferstelle der Universität ausfüllen, um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie die IPSituation ist. Idealerweise sollte das Ergebnis des IPWahlOMeters einen Hinweis geben, welches Transfermodell für das jeweilige Szenario am besten geeignet sein könnte.
WIE GEHT ES DANN WEITER?
BD: Dann kommt die schon erwähnte IPScorecard zum Einsatz. Beide Parteien setzen sich zusammen und bewerten eine Reihe von Faktoren. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine 10 bedeutet, dass das IP essentiell für das Geschäftsmodell und damit für den Erfolg der Ausgründung ist. Eine 10 ist zum Beispiel im Bereich Pharma wahrscheinlich, wenn an einer Universität ein Wirkstoffkandidat entdeckt wurde und das Gründerteam nun ein entsprechendes Medikament entwickeln und vermarkten will.
WIE HOCH KÖNNTEN IN DIESEM SZENARIO DIE VIRTUELLEN ANTEILE SEIN?
BD: Letztendlich ist und bleibt dies eine Verhandlungssache zwischen dem Gründerteam und der Institution. Wir haben aber eine Umfrage in der Investment Community gemacht, weil uns diese Frage auch interessiert hat. Dabei kam heraus, dass die maximale Beteiligung, die
eine Institution realistischerweise aushandeln kann, bei 10 Prozent liegt. WIE GUT FUNKTIONIERT DAS PRINZIP DER DIGITALEN ANTEILE UND DER SPRIND-TOOLS BISLANG?
BD: Das testen wir zurzeit: Wir haben eine Pilotgruppe, bestehend aus 17 Einrichtungen aus Deutschland. Dazu zählen Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsverbünde sowie außeruniversitäre Einrichtungen. Die Idee, virtuelle Anteile gegen Schutzrechte zu tauschen, ist ursprünglich an der TU Darmstadt entstanden. Wir haben diese Idee aufgegriffen und wollen mit unseren Tools den IPTransfer unterstützen. Bislang ist die Resonanz positiv, die Diskussion über die Schutzrechte wird versachlicht und das verbessert die Beziehungen zwischen den Gründerteams und den Einrichtungen sehr.
WELCHES ZIEL VERFOLGT
SPRIND BEIM IP-TRANSFER?
BD: Unser Anliegen ist in erster Linie mehr Transparenz. Die Transferstellen können nach außen wie ein Machtmonopol wirken. Die Gründerteams verhandeln meistens zum ersten Mal in ihrem Leben über Schutzrechte und eine Ausgründung. Für viele Gründer und Gründerinnen ist der ganze Prozess eine Blackbox. Das wollen wir ändern. Neben dem IPWahlOMeter und der IPScorecard stellen wir daher auch Musterverträge zur Verfügung. Die meisten Einrichtungen haben bereits Standardverträge, aber die Musterverträge können dem Gründer

team schon einen ersten Eindruck geben, was in etwa auf sie zukommen wird. Dadurch wird es den Gründerteams ermöglicht, mit der Transferstelle auf Augenhöhe zu verhandeln. Unser eigenes Selbstverständnis ist, dass wir in der Diskussion um die Verbesserung und Vereinfachung des IPTransfers als Treiber, aber auch als Broker unterstützen.
WAS BEDEUTET DAS?
BD: Wir sind Treiber in dem Sinne, dass wir die Institutionen antreiben, ihre eigenen Prozesse und Modelle kritisch zu hinterfragen und neue Ansätze auszuprobieren. Gleichzeitig fungieren wir als Broker, also als Vermittler, zwischen den Einrichtungen und der Politik. Die Politik fordert von den Hochschulen mehr Transferaktivitäten, während die Hochschulen aufgrund unzureichender Finanzierung gezwungen sind, kurzfristige Einnahmen zu erzielen. Wir fördern den Politikdialog, um alle Beteiligten – Politik und Hochschulleitungen – an einen Tisch zu bringen. Wir treiben die Universitäten an, werfen uns aber auch schützend vor sie, um gemeinsam mehr Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
STRUKTUR
SPRIND IST EINE GMBH UND DER BUND ZU 100 PROZENT GESELLSCHAFTER. VERTRETEN DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG UND DAS BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ.
PRESSESPRECHER PODCAST
INNOVATIONSMANAGEMENT
ANALYSE
STRATEGISCHE PROJEKTE
IT/ INFRASTRUKTUR EINKAUF WISSENSCHAFTLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
CHALLENGEOFFICE
PROJEKTMANAGEMENT
PARTNERMANAGEMENT GREMIENBÜRO
PERSONAL
OFFICEMANAGEMENT
MARKETING
RECHNUNGSWESEN
CONTROLLING RECHT
MARIO BRANDENBURG
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG
PROF. DIETMAR HARHOFF, PH. D.
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR INNOVATION UND WETTBEWERB
DR. H. C. SUSANNE KLATTEN
SKION GMBH
DR.-ING. E. H. PETER LEIBINGER
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS
TRUMPF GMBH & CO. KG
DR. GESINE OSIEKA
BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN
DR. FRANZISKA BRANTNER
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ
DEUTSCHER BUNDESTAG RONJA KEMMER
CELONIS SE REMY A. LAZAROVICI
DEUTSCHER BUNDESTAG HOLGER MANN
PROF. DR. BIRGITTA WOLFF
STELLV. VORSITZENDE DES AUFSICHTSRATS
BERGISCHE UNI WUPPERTAL
VERTRETERINNEN DES GESELLSCHAFTERS
CHRISTINA DECKER
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ
DR. TINA KLÜWER
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG


EINE STAATLICHE AGENTUR, DIE SPRUNGINNOVATIONEN IDENTIFIZIEREN, FINANZIEREN UND INKUBIEREN SOLL? → DAS IST DER AUFTRAG DER SPRIND.
DIE BEIDEN GESCHÄFTSFÜHRER:INNEN RAFAEL LAGUNA DE LA VERA UND BERIT DANNENBERG ERKLÄREN IM INTERVIEW, WELCHEN BEITRAG DIE BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN SPRIND ZUR ERNEUERUNG DES WIRTSCHAFTSSTANDORTS DEUTSCHLAND LEISTEN KANN.
DEGENERIERT DER STANDORT DEUTSCHLAND LANGSAM ZUM INDUSTRIEMUSEUM?
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA: Diese Frage höre ich heute in Wirtschaftskreisen immer häufiger und mit einem zunehmend pessimistischen Unterton. Um sie zu beantworten, lohnt ein Blick zurück in die Phase unseres Landes, in der wir die meisten Innovationen zu neuen Industrien entwickelt haben, die sogenannte Gründerzeit, die 1871 begann. Innovatoren wie Robert Bosch, Gottlieb Daimler, Friedrich Bayer und Alfred Krupp haben Industrien wie Pharma, Automobil, Chemie und Stahl begründet und daraus die Wirtschaftsnation Deutschland gebaut. Nach Krieg und Wiederaufbau haben wir diese weiterentwickelt, auch mittelständische „Hidden Champions“ entstanden. Davon leben wir bis heute.
BERIT DANNENBERG: Allerdings erleben wir gerade, wie die Gründerzeitinnovationen langsam auslaufen. Selbst in der Automobilindustrie scheinen uns mittlerweile andere zu zeigen, wie’s geht. Das gibt durchaus Anlass zur Sorge. Dennoch sind wir nach wie vor ein hochinnovatives Land. Wir haben großartige Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, schaffen es jedoch nicht mehr, aus den Erkenntnissen und Erfindungen neue Unternehmen und Industrien zu machen, die volkswirtschaftlichen Nutzen stiften.
EINE URSACHE DAFÜR LIEGT WOHL IN DER GERINGEN DURCHLÄSSIGKEIT VON WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND POLITIK.
BD: So ist es. Es gibt keinen nennenswerten Karrierepfad von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Für Menschen aus der Wirtschaft wiederum existieren kaum Incentives, in die Politik oder öffentliche Verwaltung zu wechseln –und umgekehrt. Unter den Bundestagsabgeordneten finden sich jeweils nur eine Handvoll Quereinsteiger, also Unternehmer:innen und Wissenschaftler:innen.
RL: In den USA ist das ganz anders. Bei meinem Aufenthalt an der Universität Harvard hat mich überrascht und begeistert, dass gefühlt 70 Prozent der Professor:innen im Business-Bereich der Uni Unternehmer oder Managerinnen waren, die in den letzten zehn Jahren ihrer Karriere ihr Wissen weitergeben. In Deutschland wäre das undenkbar. Ohne Promotion, trotz 40 Jahren unternehmerischer Erfahrung, wird bei uns niemand ordentliche:r Professor:in.
DIE SCHLECHTE NACHRICHT LAUTET DAHER:
WIR SIND NICHT GUT IM INDUSTRIALISIEREN UNSERER TECHNOLOGIEN.
RL: Entsprechend liegen wir im internationalen Innovationsranking aktuell auf einem ordentlichen achten Platz, sind jedoch nicht mehr Weltspitze. Die gute Nachricht lautet: Wir haben nach wie vor jede Menge kluger Köpfe, die ihre Erfindungen in die Welt bringen wollen. Wir verfügen über herausragende Wissenschaftler:innen, die gleichzeitig erfolgreiche Unternehmer:innen sind. Ein Paradebeispiel sind Özlem Türeci und Uğur Şahin, die den Impfstoff BNT162b2 gegen das Corona-Virus entwickelt haben. Wie bei den BioNTech-Gründern handelt es sich bei Innovatoren auffällig häufig um Menschen mit Migrationshintergrund – die oft unkonventionell agieren müssen, wenn sie in unserer Gesellschaft erfolgreich sein wollen.
ABER DIE GRÜNDER VON MORGEN SIND DA, SIE LEBEN UNTER UNS.
WIR MÜSSEN IHNEN NUR EINE PLATTFORM GEBEN. DAFÜR GIBT ES AUCH DIE SPRIND.
BD: Unsere wesentliche Aufgabe lautet, aus unseren Innovationen wieder Industrien zu formen, die künftigen Wohlstand sichern. Sprunginnovationen zeichnen sich im Gegensatz zu „normalen“ Innovationen dadurch aus, dass sie nicht lediglich Verbesserungen des Existierenden sind. Kommt eine Sprunginnovation in die Welt, ist diese – die Welt – danach merklich anders als zuvor. Wenn es uns gelingt, die „Siloisierung“ unserer Systeme zu überwinden, wird die Wirtschaftsnation Deutschland eine enorme Kraft entwickeln. Wir bei SPRIND sind so etwas wie ein Reallabor dieser Transformation.
RL: Mit KI erleben wir gerade das „In-die-Welt-Kommen“ einer Plattform für Sprunginnovationen, auch das Internet und die mRNA-Impfstoffe gehören in diese Kategorie. Mit SPRIND wollen wir solche vielversprechenden Innovationen identifizieren und mithelfen, diese auf die Straße zu bringen. Daneben analysieren wir die wesentlichen Systemhemmnisse für Innovation und überlegen, wie man unsere Leistung verallgemeinern und Translation zum gesellschaftlichen Standard machen könnte.
BD: Ein Beispiel dafür ist der heute noch sehr schwierige IP-Transfer von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft. Noch ist es für „Sciencepreneure“ an den Universitäten oftmals unglaublich mühsam und zeitraubend, ihr Intellectual Property (IP) in ein Unternehmen zu übertragen und wirtschaftlich zu nutzen.
Nicht wenige geben nach zwei, drei Jahren Verhandlungen entnervt auf oder müssen Verträge abschließen, die die Weiterentwicklung des Start-ups behindern. Um diese Hemmnisse zu überwinden, haben wir mit 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen Bewertungsmodelle und Musterverträge für einen vereinfachten und standardisierten IP-Transfer erarbeitet, die wir Ende 2023 veröffentlicht haben.
EINE HÄUFIG GESTELLTE FRAGE LAUTET: WAS HAT DER STAAT ÜBERHAUPT IM INNOVATIONSGESCHÄFT ZU SUCHEN?
RL: Auch hier hilft der Blick zurück in die erste Gründerzeit. Damals hatte das Kaiserreich Reparationsgelder aus dem Deutsch-Französischen Krieg Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, womit diese ihre Unternehmen bauen konnten. Die Wurzeln von Bayer, Daimler und BASF reichen alle in diese Zeit zurück. Alle drei waren „Heavy IP“Gründungen, die mit Millionen Reichsmark – nach heutigem Wert mehrere Milliarden Euro – ausgestattet wurden, um ihre Innovationen auf die Straße zu bringen. Gleichzeitig waren die Systeme sehr viel durchlässiger als hier und heute. Im Kaiserreich gab es herausragende Forscher, die ihre Professuren sehr wirtschaftsnah geführt haben und ihren Doktoranden den Wechsel in die Wirtschaft und zurück erleichterten.
Das junge Kaiserreich löste also einen jahrzehntelangen Boom inklusive Börsenhype und -crash aus. Genauso muss der Staat heute wieder inkubieren und nebenbei Innovationshemmnisse aus dem Weg räumen. Geld ist genug da, denn der „Return on Investment“ wird gewaltig sein. Wir müssen einfach nur machen. Dafür allerdings braucht es den Mut des Staates, sich gewaltig aus dem Fenster zu lehnen. Unsere Agentur ist so etwas wie das Reallabor für diesen Mut.
IST SPRIND EIN DEUTSCHES PENDANT ZUR US-AMERIKANISCHEN INNOVATIONSAGENTUR DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY (DARPA)?
BD: Als wir vor fünf Jahren SPRIND entwickelten, war eines unserer Vorbilder natürlich die 1958 von US-Präsident Eisenhower gegründete DARPA. Diese stattet Gründer mit Finanzmitteln aus, die dann dank des US-Militärs als größtem Kunden über volle Auftragsbücher verfügten. Auf diese Weise entstanden unter anderem Spionagesatelliten, aus denen später GPS hervorging, die Vorläufer des Internets, fahrerlose Fahrzeuge, Spracherkennungssoftware und andere Sprunginnovationen, die die USA groß gemacht haben. Die DARPA war und ist ein staatlich üppigst subventionierter und atemberaubend effizienter Brutkasten. Der Mythos, der freie Markt habe das Silicon Valley hervorgebracht, ist deshalb genau das: ein Mythos.
RL: Wir haben uns die DARPA und ihren Vorgänger ARPA sehr genau angeschaut und vieles übernommen. Allerdings setzt die DARPA wesentlich früher im technologischen Entwicklungszyklus ein und hört auch früher auf. Wir engagieren uns nicht in der Grundlagenforschung, da wir in Deutschland über eine sehr gute Grundlagenforschungslandschaft verfügen. Unsere Domäne sind die angewandten Wissenschaften, also die Übersetzung von Grundlagenerkenntnissen in wirtschaftlich tragfähige Unternehmen. Wir können unsere Projekte daher sehr viel länger begleiten und sind als SPRIND mittlerweile selbst Vorbild für Länder, die ähnliche Innovationsagenturen aufbauen.

BD: Im Jahr 2022 haben wir erstmals über 100 Millionen Euro investiert, 2023 waren es 160 Millionen, 2024 werden es bereits mehr als 220 Millionen Euro sein. Das macht uns zu einem der größten Deep-TechFinanzierer Europas. Wir haben uns bis jetzt 2.111 Projekte angeschaut, 163 davon finanziert und 21 in Großfinanzierungen gebracht. Darin enthalten sind die derzeit 40 Teams, die durch 8 SPRIND Challenges und Funken ihre Finanzierung erhalten. All diese Teams arbeiten an den großen Fragen unserer Zeit, wir können daher aus eigener Erfahrung sagen: Wir haben viele hervorragende Erfinderinnen und Erfinder!
RL: Sofern wir genug Geld bekommen, um unsere Arbeit zu finanzieren – denn unser Budget muss jedes Jahr erneut vom Bundestag freigegeben werden –, ist es schon fast zwingend, dass sich daraus in den kommenden Jahren zwei bis drei Sprunginnovationen ergeben. Spieltheoretisch könnte man sagen: Der Roulette-Tisch ist voll. Doch während es im Casino unwirtschaftlich ist, auf jede Zahl einen Chip zu legen, ist dies bei Sprunginnovationen hochwirtschaftlich. Denn ihr Benefit ist gewaltig, wie wir bei der Durchbruchsinnovation mRNA-Impfstoffen gesehen haben. Allein der BioNTech-Erfolg hat dazu geführt, dass Rheinland-Pfalz im Bundesfinanzausgleich vom Empfänger- zum Geberland aufgestiegen ist. Und diese Firma läuft ja gerade erst fünf Jahre auf Betriebstemperatur.
Zu unserem Projektportfolio gehören Firmen, die an neuartigen Wirkstoffen gegen Krebs, Alzheimer und Virus-Infektionen arbeiten. Nehmen wir mal an, nur eines der Projekte hebt ab, und bedenken wir gleichzeitig, wie groß Themen wie Krebs und Alzheimer sind, dann erhalten wir eine Vorstellung, wie gewaltig der Impact einer einzigen Sprunginnovation sein kann.
IST SPRIND EIN PATENTREZEPT GEGEN DEN WEIT VERBREITETEN PESSIMISMUS?
BD: Pessimismus ist wie Angst: Es gibt Situationen, in denen beide Emotionen durchaus angebracht sind. Mitunter können sie sogar überlebensnotwendig sein. In den allermeisten Fällen aber sind sie als archaische Bremsen absolut überflüssig. Schauen wir uns die Welt an, in der wir leben: Es gibt furchtbare Probleme, aber unterm Strich bessert sich die Situation auf unserem Planeten seit 300 Jahren nachweislich signifikant. Viele große Herausforderungen unserer Zeit – Energie/Klima, Wasser, Krankheiten – lassen sich technologisch lösen. Dazu braucht es soziale Innovationen, die zum einen für den „Go to Society“ sorgen und so die Menschen mitnehmen und sie zum anderen auf unsere neue Welt vorbereiten: Bildung.
RL: Dass es möglich ist, sehen wir an der letzten großen Sprunginnovation, die von Deutschland ihren Weg auf die Straße gefunden hat, den mRNA-Impfstoffen. Warum haben gerade die funktioniert? Weil wir in der Corona-Krise ausnahmsweise mal „Fünfe gerade sein ließen“, zwei Teams – Curevac und BioNTech – schnell mit Geld ausgestattet und die Regulatorik geändert haben. Und genau so müssen wir jetzt auch in anderen Bereichen handeln: beherzt Innovationshemmnisse beseitigen und loslegen, und das auch ohne fette Krise im Nacken. Ähnlich haben wir die Gas-Krise bewältigt. Eine Menge Regulierung und Gesetze wurden einfach außer Kraft gesetzt, um in Rekordzeit z. B. die LNG-Terminals zu bauen. Geht doch!
WAS KANN JEDE UND JEDER EINZELNE BEITRAGEN, UM
BD: Bei SPRIND-Projekten lassen wir diejenigen, die nicht tief in Pfadabhängigkeiten hängen, bestimmen, wo’s langgeht, und statten sie mit Geld aus. Dabei ist uns klar, dass die allermeisten neuen Ansätze scheitern werden. Wenn nicht die meisten scheitern, heißt es ja nichts anderes, als dass wir nicht hoch genug ins Risiko gegangen sind. Scheitern macht also nichts, solange einige Innovationen abheben. Und wir brauchen ja nur zwei bis drei neue Industrien.
RL: Deshalb lieben wir unseren Job. Wir sehen jeden Tag Innovationen, die das Zeug haben, unser Land und unser Leben zum Besseren zu verändern. Deshalb sind wir aus gutem Grund optimistisch, was wiederum eine Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein. Wer sich vom Pessimismus wegtragen lässt, nimmt sich seine Chancen. Schon allein deshalb sollte jeder unternehmerisch denkende Mensch über eine optimistische Grundeinstellung verfügen.
Meine Bitte an die Unternehmerinnen und Unternehmer: Geht als Gastdozenten an die Universitäten! Unterstützt Forschende bei ihren Ausgründungen, erzählt von Entrepreneurship! Öffnet eure Unternehmen für Innovationen von außen, verteilt Geld in Venture Capital Fonds und setzt euch in deren Beiräte, auf dass ihr die Projektpipeline seht. Und wenn ihr dabei ein Start-up seht, das euch richtig gut gefällt: Bringt euch ein, investiert und profitiert. Unterm Strich wird es sich zigfach auszahlen; für euch, euer Unternehmen und die Gründerzeit, die vor uns liegt.
Die gelernte Juristin BERIT DANNENBERG ist seit Frühjahr 2021 kaufmännische Geschäftsführerin von SPRIND. Sie war vorher im klassischen Wissenschaftsmanagement tätig, so in verschiedenen Einrichtungen der HelmholtzGemeinschaft und zuletzt als Verwaltungsleiterin der Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin.
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mit 16 gründete er sein erstes Start-up, Elephant Software. Er baute zahlreiche weitere Technologieunternehmen auf und arbeitete als Technologieinvestor, Interimsmanager und Berater für Venture Capital Fonds. Sein Engagement bei der Open-Xchange AG und bei SUSE Linux begründeten seinen Ruf als Open-SourcePionier und Kämpfer für das offene Internet.

ALLE ANGABEN IN DER EINHEIT: TAUSEND EURO
B BETRIEB
C CHALLENGES
P PROJEKTE
* Zahlen aus dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2023. Diese stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln.
SPRUNGINNOVATIONEN BRAUCHEN PASSGENAUE UNTERSTÜTZUNG – MIT DEM SPRINDFREIHEITSGESETZ HABEN WIR DIE MÖGLICHKEIT ERHALTEN, POTENTIELLEN SPRUNGINNOVATIONEN NOCH FLEXIBLER, AGILER UND INDIVIDUELLERE FINANZIERUNG BEREITZUSTELLEN.
Die SPRIND-Validierung ist häufig der erste Schritt der Finanzierung. Wir finanzieren Experimente und Versuche zur Weiterentwicklung der Technologie, um die Machbarkeit und das Potential zu validieren und darauf aufbauend über die weitere Finanzierung zu entscheiden. In aller Regel stellen wir dafür bis zu 200.000 Euro im Rahmen eines Forschungsauftrags bereit.
Mit der Gründungsfinanzierung unterstützen wir junge Unternehmen, die noch keine ausreichend private Finanzierung akquirieren können. Wir nutzen die Gründungsfinanzierung für den Unternehmensaufbau, die Technologieentwicklung und gegebenenfalls erste Schritte in Richtung der Kommerzialisierung. Die Finanzierung beträgt bis zu einer Million Euro.
BETEILIGUNGEN UND WANDELDARLEHEN
Falls der private Wagniskapitalmarkt keine ausreichende Finanzierung anbietet, können wir direkt in Start-ups investieren. Neue private Investoren müssen mindestens 30 Prozent der Finanzierungsrunde bereitstellen und als Lead Investor die Bedingungen verhandeln, zu denen SPRIND dann pari passu investiert. Wir können hier Beteiligungen, Wandeldarlehen und jegliche andere beteiligungsähnlichen Instrumente nutzen.
UNSER ZIEL IST ES, SPRUNGINNOVATIONEN BESTMÖGLICH ZU UNTERSTÜTZEN UND DAMIT MÖGLICHST FRÜH PRIVATES KAPITAL ZU MOBILISIEREN.
WIR STELLEN DIE INDIVIDUELLE SPRUNGINNOVATION IN DEN VORDERGRUND UND ENTWICKELN GEMEINSAM MIT DEM START-UP EIN PASSGENAUES FINANZIERUNGSKONZEPT. WIR KOMBINIEREN UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE UND UNTERSTÜTZEN AKTIV DURCH KONTAKTE ZU WAGNISKAPITAL-INVESTOREN.
FÖRDERUNG FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Wir unterstützen Sprunginnovationen bei der kapitalintensiven Forschung und Entwicklung und finanzieren einen Teil der Entwicklungskosten. Die restlichen Kosten werden durch private Investments gedeckt. Unsere Finanzierung bewegt sich typischerweise im einstelligen Millionenbereich, kann aber im Einzelfall bis zu 35 Millionen Euro betragen. Die SPRIND-Finanzierung muss nur im Erfolgsfall zurückgezahlt werden, also wenn das Start-up an die Börse geht, das Unternehmen erfolgreich verkauft wird oder anfängt, Gewinne auszuschütten.
SPRIND CHALLENGES
Bei den SPRIND Challenges erhalten Teams mit Sprunginnovationspotential aktuell pro Wettbewerbsstufe zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt als vorkommerzieller Auftrag für Forschungs- und Entwicklungsleistungen.
SPRIND FUNKEN
Jeder SPRIND Funke kann ein kleiner Schritt hin zu großen Veränderungen sein. Die Challenges sind Innovationswettbewerbe für Weltveränderer. Die SPRIND Funken auch – nur noch schneller. Aktuell erhalten die Teams pro Wettbewerbsstufe bis zu 350.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt ebenso wie bei den SPRIND Challenges über die vorkommerzielle Auftragsvergabe.





SPRIND CHALLENGES finden da statt, wo dringender Handlungsbedarf für gesellschaftliche Probleme besteht, und formulieren eine klare Vorgabe, die auf ganz unterschiedlichen Wegen gelöst werden kann.
Die Vielzahl dieser unterschiedlichen Ansätze erhöht die Wahrscheinlichkeit, das Challenge-Ziel zu erreichen und die gesellschaftliche Herausforderung zu bewältigen.

INNOVATIONSFINANZIERUNG NEU AUFGEZOGEN
BEGLEITUNG AUF DEM WEG ZUR SPRUNGINNOVATION
Unsere Challenges wollen all diejenigen Akteure ansprechen, die fähig sind, die vorgegebene Herausforderung zu meistern. Diese Akteure weisen ganz unterschiedliche Hintergründe auf. Sie kommen aus Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen, Start-ups oder etablierten Unternehmen. Um all diesen Akteuren ein unbürokratisches, flexibles und schnelles Finanzierungsinstrument anbieten zu können, nutzt die SPRIND das Instrument der vorkommerziellen Auftragsvergabe. Diese erlaubt eine attraktive Finanzierung, die mit minimalem administrativem Aufwand einhergeht, schnell umgesetzt werden kann und einen flexiblen Mitteleinsatz ermöglicht.
Neben der Finanzierung ihrer Arbeit unterstützt die SPRIND die Fortschritte der Teams durch eine enge Begleitung und spezifisches Coaching. Die Umsetzung von Sprunginnovationen erfolgt oft im Kontext bestehender Märkte und Strukturen mit starken Beharrungstendenzen. Um diese Hürden zu bewältigen, steht die SPRIND den Teams beratend zur Seite und unterstützt sie mit Coachinnen und Coaches mit bedarfsorientierter Expertise.
ES GIBT KEINE VERLIERER:
DAS INNOVATIONSÖKOSYSTEM
Alleingelassen sind die ausscheidenden Teams dennoch nicht, denn im Verlauf der Challenge unterstützt die SPRIND die Teilnehmer:innen im Rahmen der Aufbauarbeit eines starken Innovationsökosystems unter anderem mit Kontakten zu anderen Geldgebern. Die Geschichte hat zudem gezeigt, dass aus Misserfolgen in Innovationswettbewerben trotz alledem wichtige Innovationen werden können. So konnte zwar ein gewisser Galileo Galilei in einem Innovationswettbewerb nicht das Rätsel um die Bestimmung des Längengrads auf See lösen, erfand dabei aber die beste Methode zur Bestimmung des Längengrads an Land.
KONZEPT

KONZEPTDEMONSTRATION
TEAMS START ZWISCHENEVALUATION
ZUSAMMENSTELLUNG
FUNKTIONELLE ERWEITERUNG

ANZAHL TEAMS
DEMONSTRATION DER LÖSUNG WEITERE ENTWICKLUNG
JEDE:R KANN SICH BEWERBEN, ABER NUR HERAUSRAGENDE IDEEN WERDEN FINANZIERT UND NUR WER MIT SEINEN FORTSCHRITTEN ÜBERZEUGT, WIRD IN DER NÄCHSTEN STUFE DER CHALLENGE WEITER UNTERSTÜTZT.

BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN ERFORDERN BESONDERE FORMATE. IM INTERVIEW SPRICHT CHALLENGE-CHEF JANO COSTARD ÜBER DEN WETTBEWERB, DER AUS IDEEN SPRUNGINNOVATIONEN MACHT.

JANO, DIE WELT STEHT DERZEIT VOR SO VIELEN HERAUSFORDERUNGEN – WIE WÄHLT
MAN DA EIN CHALLENGE-THEMA AUS?
Es gibt wirklich viele drängende Probleme, aber in einigen Bereichen, wie zum Beispiel KI, gibt es in Deutschland bereits viel öffentliche und private Unterstützung. Wir schauen also: Wo fehlt es an Finanzierung, welche Themen sind wichtig, werden aber vernachlässigt? Unsere Challenge BROAD-SPECTRUM ANTIVIRALS hat zum Beispiel ein riesiges gesellschaftliches Potential, gleichzeitig ist dort eine enorme technologische Lücke, die von anderen Akteuren wahrscheinlich nicht geschlossen wird. Dieses Marktversagen müssen wir ausgleichen.
PRINZIPIELL KANN JEDER AN EINER SPRIND CHALLENGE TEILNEHMEN. WARUM IST ES WICHTIG, MIT DEN CHALLENGES AUCH FACHFREMDE ANZUSPRECHEN?
Wenn man Fachfremde auffordert, sich zu bewerben, bekommt man auch Einreichungen, die es normalerweise nicht in eine staatlich finanzierte Projektförderung schaffen. Aber wir wissen, dass die Menschen mit den besten Ideen, mit dem größten Potential, oft eben nicht aus dem Kreis der etablierten Expertinnen und Experten kommen. Diesen Menschen wollen wir vermitteln, dass es Sinn macht, sich auf ein neues Gebiet zu begeben. Denn das kann dazu führen,

dem Thema der jeweiligen Challenge auskennen. Und wir arbeiten schon im Entstehungsprozess einer Challenge und natürlich auch währenddessen viel mit externen Akteuren zusammen, um deren Feedback zu bekommen. Die Herausforderung ist allerdings nicht so sehr, sich Expertise zu holen, sondern zu entscheiden, welches Feedback Gewicht hat. Letztlich sind die SPRIND Challenges getrieben von der Einsicht, dass wir nicht sicher sein können, welche Innovation tatsächlich zur Sprunginnovation wird, wenn wir es nicht ausprobieren. Deshalb lassen wir bei jeder Challenge mehrere Teams und Technologien im Wettbewerb gegeneinander antreten.
WER ES SCHAFFT, IN DIE CHALLENGE
AUFGENOMMEN ZU WERDEN, KANN SICH ÜBER EINE GUTE FINANZIERUNG FREUEN.
Ja, denn die Kombination aus einem sehr frühen Entwicklungsstadium und einer nicht validierten Technologie macht es oft notwendig, dass wir die Teams zu 100 Prozent finanzieren. Bei unseren Challenges gibt es kein großes Preisgeld am Ende, sondern wir finanzieren rundenbasiert. Und die Teams bekommen auch nicht alle gleich viel Geld, sondern bewerben sich um eine bestimmte Finanzierungshöhe. Das ist für uns auch ein Bewertungskriterium und
„SCHEITERN IST BEWUSST TEIL DES PLANS.“
dass sie noch einmal ganz neu über sich und ihre bisherigen Technologien nachdenken. Deshalb ist unser Stufenmodell so sinnvoll: Wir geben vielen scheinbar noch utopischen Ansätzen eine Chance und sortieren im weiteren Verlauf der Challenge aus, um uns auf die vielversprechendsten Innovationen zu konzentrieren, sobald die Potentiale von Technologien und Teams klarer absehbar sind. UNSINNIGE FANTASIEN UND BRILLANTE GEISTESBLITZE KÖNNEN SICH AUF DEN ERSTEN BLICK DURCHAUS ÄHNLICH SEHEN. WIE BEURTEILT IHR, WAS WAS IST?
Wir haben erfahrene Expert:innen mit unterschiedlichen Perspektiven in der Jury, die sich speziell mit
wir sehen es natürlich gerne, wenn es den Teams gelingt, zusätzliches Geld – egal ob öffentlich oder privat – einzuwerben. Denn das ist nicht nur ein Signal, dass die Teams schneller Fortschritte erzielen können, sondern es spricht auch für ihre Fähigkeit, sich später unabhängig von uns weiter zu finanzieren.
ABGESEHEN VOM GELD:
WIE UNTERSTÜTZT DIE SPRIND DIE TEAMS?
Unsere Begleitung und Unterstützung sind immer sehr spezifisch auf das Thema der Challenge und die jeweiligen Teams zugeschnitten. Wir haben Teilnehmende, die bereits eine komplette akademische Karriere aufgebaut haben, aber zum ersten Mal
ein Unternehmen gründen. Es ist ganz normal, dass diese Erstgründer plötzlich viele neue Sachen lernen und auch ihre Arbeit ganz anders strukturieren müssen. Wir schenken ihnen das Vertrauen und die Ermutigung, dass man das machen und schaffen kann. Wir können klare Empfehlungen geben, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie man zu möglichst guten Konditionen aus der Universität ausgründet, und wir können die Teams aktiv mit anderen Expertinnen und Experten vernetzen. Und wir vernetzen natürlich auch die Teams untereinander.
ABER STEHEN DIE TEAMS NICHT IN DIREKTER KONKURRENZ ZUEINANDER?

Zeit oder es müssen aufwendige Prototypen gebaut werden. Und manchmal ist es auch nicht so leicht, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das ist der Punkt, der erreicht werden muss, um weiterzukommen. Je mehr wir auf quantifizierbare Kennzahlen setzen, desto besser können wir die Teams vergleichen und desto mehr Wettbewerb haben wir. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite laufen wir Gefahr, wichtige Lösungsansätze, die nicht zu diesen Kennzahlen passen, auszuschließen. Deshalb kommunizieren wir den Teams vor allem verbal, worum es uns geht, wo aus unserer Sicht die Herausforderungen liegen und was das Ziel
„ZU SEHEN, WAS ALLES GEHT, IST WAHNSINN UND MOTIVIERT ENORM.“
Der eigentliche Wettbewerb findet außerhalb der Challenge statt, auf den bestehenden Märkten, die es zu disruptieren gilt. Bei unseren Teams steht daher nicht so sehr der Gedanke
„Ich will unbedingt die Challenge gewinnen“ im Mittelpunkt. Vielleicht auch, weil es am Ende der Challenge kein Preisgeld gibt, um das alle konkurrieren. Stattdessen sind die Innovator:innen getrieben vom Ziel, das übergeordnete Problem zu lösen. Wenn die Teams glauben, dass sie das Challenge-Ziel erreichen können und dass es ein disruptives Potential hat, dann brennen sie einfach für das, was sie tun.
DIE CHALLENGES LAUFEN IN DER REGEL
ÜBER MEHRERE JAHRE. JEDES JAHR WIRD
NEU BEWERTET, OB DIE TEAMS IN DIE NÄCHSTE RUNDE KOMMEN. GIBT ES KLARE ZIELE, DIE ERREICHT WERDEN MÜSSEN, UM WEITERZUKOMMEN?
Die Grundidee ist, dass wir etwas demonstriert sehen wollen. Wir wollen nicht irgendwie die zweite Iteration eines Konzepts sehen, sondern wir wollen Daten sehen, die uns sagen, ob das, was man sich vorgenommen hat, funktionieren kann oder nicht. Dabei schauen wir uns natürlich an, was die typische Fortschrittsgeschwindigkeit im jeweiligen Bereich ist. Manche Experimente benötigen einfach viel
der Challenge ist. Dazu gehören manchmal auch Kennzahlen, die aber in erster Linie der Orientierung dienen, wir sagen also nicht: „Wenn ihr in den nächsten drei Monaten nicht Level soundso erreicht habt, seid ihr automatisch raus.“
ABER AUCH POTENTIELL
ERFOLGVERSPRECHENDE TEAMS SCHAFFEN
ES NICHT ZWANGSLÄUFIG IN DIE NÄCHSTE CHALLENGE-STUFE.
Es ist immer eine schwere Entscheidung, wenn man Teams verabschieden muss, die hart an der Lösung eines Problems gearbeitet haben. Je nachdem, um was für ein Team es sich handelt, wo es gerade steht und was es in seinem Bereich braucht, versuchen wir deshalb auch, andere Investoren zu finden, die es weiter unterstützen. Aber auch wenn es nicht einfach ist, den Teams diese Entscheidungen zu vermitteln, glaube ich, dass Wettbewerb und Konkurrenz sehr wertvoll sind, weil es die Teams dazu bringt, Fortschritte zu machen, die sie sonst nie gemacht hätten. Es gibt Teams, die uns nach dem Ausscheiden sagen: Das, was wir in der SPRIND Challenge in einem Jahr erreicht haben, hätten wir normalerweise in drei Jahren nicht geschafft. Und ich glaube, dann haben sich dieses Jahr das investierte Geld und

die investierte Zeit wirklich gelohnt, auch wenn es danach – zumindest im Moment mit uns – nicht weitergeht.
DASS TEAMS SCHEITERN, LÄSST SICH VERMUTLICH GAR NICHT VERHINDERN, ODER?
So sehen wir das nicht. Denn im Grunde genommen sind alle Teilnehmenden Gewinner. Denn innerhalb der Challenge findet ein großer Lernprozess statt, wenn die Teams ihre Lösungen weiterentwickeln und wenn die Teams sich selbst weiterentwickeln. Technologieoffenheit bedeutet für uns, dass wir und die Teams natürlich im Laufe einer Challenge auch lernen, dass ein bestimmter Ansatz nicht das Potential hat, das wir erwartet oder erhofft haben. Aber auch, dass vielleicht ein Team nicht das Potential hat, das wir uns erhofft haben. Auf der anderen Seite lernen wir, dass bestimmte Ansätze vielleicht ein viel größeres Potential haben, als wir dachten, oder dass ein Team sich auf eine Weise ent wickelt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Und diese Offenheit für Entwicklungen, positive wie negative, ist total wichtig.
WIE UNTERSCHEIDEN SICH DIE SPRINDFUNKEN VON DEN SPRIND CHALLENGES?
Der Hauptunterschied ist, dass die SPRIND-Funken nicht zwei oder drei Jahre laufen, sondern nur ein halbes oder drei viertel Jahr. In dieser Zeit kann man, zumindest in Hardware, nicht viel grundlegendes Neues entwickeln. Deshalb konzentrieren wir uns bei den Funken darauf, den Teams zu ermöglichen, die Grenzen des Machbaren einer Technologie aufzuzeigen. Unser Hauptaugenmerk liegt also darauf, schnelle Demonstrationen zu liefern. Das funktioniert besonders gut im Bereich der Softwareentwicklung. Aber nicht nur dort: Zum Beispiel gibt es bereits Ansätze für 3D-gedruckte Organe. Mit unserem Funken „TISSUE ENGINEERING“ wollen wir die Weiterentwicklung beschleunigen. Denn wenn andere sehen, was schon möglich ist, sind sie eher bereit zu investieren. Mit den Funken geben wir Entwicklungen den letzten Schubs zum Durchbruch oder ermöglichen neue Investitionen.
WIE UNTERSCHEIDEN SICH DIE CHALLENGES UND FUNKEN VON ANDEREN FÖRDERUNGEN AUS ÖFFENTLICHER HAND?
Wir und im Prinzip auch andere öffentliche Einrichtungen wollen, dass Start-ups gegründet werden, die die Welt erobern. Aber die Teams, die sich auch um andere öffentliche Finanzierungen bewerben, erzählen mir oft, dass sie teilweise eineinhalb oder sogar zwei Jahre warten, bis sie Geld bekommen. Mit den SPRIND Challenges und Funken haben wir gezeigt, dass wir Gründer:innen nicht bremsen, sondern sie als Partner schnell und umfassend unterstützen. Deshalb legen wir großen Wert auf kurze Fristen und wenig Bürokratie. Mit unserem Finanzierungsinstrument sorgen wir für Transparenz und Planbarkeit. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir unsere Finanzierungen nicht auf Deutschland beschränken, sondern europaweit vergeben. Denn die Herausforderungen, die wir mit den Challenges angehen wollen, sind so groß und wichtig, dass wir es uns nicht leisten können, nicht über den eigenen Tellerrand zu blicken.
WAS BEGEISTERT DICH PERSÖNLICH AN DEN CHALLENGES UND FUNKEN AM MEISTEN?
Zu sehen, was alles geht, motiviert enorm. Wir arbeiten unter anderem daran, die Chemieindustrie zu dekarbonisieren und gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aber vielleicht ist es wirklich möglich. Die Teams machen mir einfach Mut, dass wir die Herausforderung unserer Zeit wirklich lösen können.
CHALLENGE: BROAD-SPECTRUM ANTIVIRALS
STUFE 0 1
TEAMS: 9
LAUFZEIT: 01. NOV 2021 – 31. OKT 2022

STUFE 0 2
STUFE 0 3
TEAMS: 6 TEAMS: 4
LAUFZEIT: 01. NOV 2022 – 31. OKT 2023
LAUFZEIT: 01. NOV 2023 – 31. OKT 2024
CHALLENGE: CARBON-TO-VALUE
STUFE 0 1 STUFE 0 2
TEAMS: 5 TEAMS: 3
LAUFZEIT: 01. MAI 2022 – 30. APRIL 2023
LAUFZEIT: 01. MAI 2023 – 30. SEPT 2024
CHALLENGE: LONG-DURATION ENERGY STORAGE
STUFE 01 STUFE 02
TEAMS: 5
LAUFZEIT: 01. DEZ 2022 – 30. NOV 2023

TEAMS: 4
LAUFZEIT: 01. DEZ 2023 – 31. MAI 2025
CHALLENGE: CIRCULAR BIOMANUFACTURING
STUFE 0 1
TEAMS: 8
LAUFZEIT: 01. NOV 2023 – 31. OKT 2024
STUFE 0 2
TEAMS: 2–6
LAUFZEIT: 01. NOV 2024 – 31. OKT 2025
STUFE 0 3
TEAMS: 2–4
LAUFZEIT: 01. NOV 2025– 31. OKT 2026

CHALLENGE: BROADSPECTRUM ANTIVIRALS




CHALLENGE: LONG-DURATION ENERGY STORAGE





CHALLENGE: CARBON-TO-VALUE



CHALLENGE: CIRCULAR BIOMANUFACTURING










Viren sind eine unberechenbare Bedrohung für die weltweite Gesundheit, für Wirtschaft und Gesellschaft – das wissen wir spätestens seit der SARS-CoV-2 Pandemie. Seit Beginn der Pandemie sind mehrere Millionen Tote zu beklagen. Noch immer fehlt es an wirksamen Therapeutika gegen SARS-CoV-2 und neu auftretende Varianten. Tatsache ist: Auch gegen viele andere Viren gibt es bis heute keine Therapeutika. Potenzierende Viruslast, hohe Mutationsraten und limitierte Angriffspunkte sind Viren inhärent, machen sie zu wahren „Überlebenskünstlern“ und stellen hohe Anforderungen an die Wirkstoffentwicklung. Das große Verlangen, die Pandemie zu überwinden, verhalf neuen Technologien auf der Basis von mRNA und ebenso neuen Wegen in der „Drug delivery“ zum schnellen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung – entgegen den Erwartungen vieler Experten.
Analog dazu braucht es Durchbrüche in der antiviralen Wirkstoffentwicklung. Es braucht hochinnovative Ansätze, die eine Bekämpfung von viralen Infektionen ermöglichen. Deswegen unterstützt die SPRIND mit dieser Challenge neue technologische Ansätze für Sprunginnovationen zur Bekämpfung von viralen Infektionen. Die Teilnahme an der Challenge fordert die Teams voll und ganz. Wir begleiten und fördern sie deshalb intensiv und individuell. Dazu gehört die Finanzierung der Teams genauso wie eine individuelle Betreuung durch eine:n Challenge-Coach:in, der:die einschlägige Erfahrung im Challenge-Bereich und selbst schon Innovationen mit hohem Impact umgesetzt hat.
ZIEL DER CHALLENGE
… ist es, mit bahnbrechenden Technologien das Repertoire an antiviralen Therapeutika zu erweitern, damit in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und Patient:innen schnell geholfen werden kann. Dafür entwickeln die Challenge-Teams Ansätze für Breitbandvirostatika und Plattformtechnologien zur schnellen Entwicklung antiviraler Wirkstoffe.

SHORTFACTS
LAUFZEIT
3 Jahre (Herbst 2021–Herbst 2024)
GESAMTBUDGET
25 Mio. €
STUFEN 2023/24
4 Teams (von 9 in Stufe 1) in der finalen Stufe 3 der Challenge
AUSGRÜNDUNGEN
• AVOCET (ausgegründet 03/2023)
• MUCOSATEC (ausgegründet 12/2023)
• CPTx
FINANZIERUNGSRUNDEN seit Beginn der Challenge
• CPTx 5 Mio. € Seed WOFÜR GIBT ES DIESE CHALLENGE?
Für Gesundheit und Pandemieprävention.
Wir wollen eine Plattformtechnologie, um virale Infektionen schnell und wirksam zu bekämpfen.

Nicht nur Menschen, sondern auch Bakterien müssen sich gegen Viren wehren. Dazu nutzen sie ein antivirales Abwehrsystem namens CRISPR/Cas. In den letzten Jahren hat vor allem CRISPR/Cas9 hohe mediale Aufmerksamkeit erhalten – denn das Enzym lässt sich auch beim Menschen einsetzen: als Genschere.
„CRISPR/Cas9 wurde ursprünglich von Bakterien zur Bekämpfung von DNA-Viren etabliert und wird bereits vielfältig in der Klinik eingesetzt, zum Beispiel für die Therapie von Erbkrankheiten“, erklärt die Medizinerin Prof. Dr. Elisabeth Zeisberg von der Universität Göttingen. Aber Bakterien wehren sich nicht nur gegen DNA-Viren: Dank eines Enzyms namens CRISPR/Cas13 können Bakterien auch RNA-Viren zerschneiden und die Viren damit unschädlich machen.
Als die Corona-Pandemie 2020 ausbricht, wird eine Therapie gegen RNA-Viren dringend benötigt. „Da fanden wir es naheliegend, dass wir CRISPR/Cas13 als antivirale Therapie für uns Menschen nutzen können, sozusagen als Geschenk der Natur“, sagt Zeisberg, Gründerin der Avocet Bio GmbH. Tatsächlich kann Zeisberg mit ihrem Team innerhalb kürzester Zeit zeigen, dass CRISPR/Cas13 in mit SARS-CoV-2 infizierten Zellen die Infektiosität zu 99 Prozent reduziert. Und nicht nur der Proof of Concept in den Zellen gelingt, auch die ersten Tierversuche sind erfolgreich: „Bei mit SARS-CoV-2 infizierten Hamstern kam es zu einer deutlichen Reduktion der Lungenschäden“, berichtet Elisabeth Zeisberg.
Damit das Enzym CRISPR/Cas13 die virale RNA zerschneiden kann, muss es zunächst an die richtige Stelle gebracht werden. Dazu werden sogenannte Guide-RNAs – kleine RNA-Schnipsel – benötigt. Die Guide-RNAs leiten Cas13 zur Ziel-RNA-Sequenz. Dort bindet Cas13 und zerschneidet die RNA zielgerichtet.
Wo genau die RNA zerschnitten werden soll, wird vorher am Computer analysiert. Zeisberg hat drei Kriterien für eine optimale RNA-Stelle aufgestellt: Das Virus muss an einer relevanten Stelle getroffen werden, die ausgesuchte RNA-Stelle sollte möglichst nicht von Mutationen betroffen sein und es darf kein Äquivalent im menschlichen Genom geben. „Im Falle von SARS-CoV-2 haben wir 31 solcher RNA-Stellen zusammen mit den entsprechenden Guide-RNAs identifiziert, von denen sich sieben in einem Modellsystem als optimal herausgestellt haben.“
Dass die ausgewählten RNA-Stellen eher nicht von Mutationen betroffen sind, bestätigte sich bereits in der Pandemie. „Alle von uns als optimal befundenen GuideRNAs, die wir wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt identifiziert haben, als es nur die Wuhan-Variante des SARS-CoV2-Virus gab, decken alle weiteren bisherigen Varianten zu 100 Prozent ab“, erzählt Elisabeth Zeisberg und fügt optimistisch hinzu: „Das macht es wahrscheinlich, dass auch zukünftige Varianten, die wir heute noch nicht kennen, effektiv behandelt werden können.“
Derzeit beschäftigt sich Elisabeth Zeisberg vor allem mit der Frage, wie das Verpackungsmaterial rund um die CRISPR/Cas13-Enzyme aufgebaut wird: „Also wie bekommen wir die Therapie dahin, wo wir sie brauchen, also im Fall von SARS-CoV-2 in die Atemwege? Das ist jetzt der Schwerpunkt unserer Arbeit, hier eine Formulierung zu entwickeln, damit wir ein effektives Nasenspray beziehungsweise einen effektiven Inhalator entwickeln können.“



Neben SARS-CoV-2 konzentriert sich Zeisberg mit ihrem Team mittlerweile auch auf eine weitere Erkrankung: Tollwut. „Das ist eine Erkrankung, wo es bis heute, wenn man nicht innerhalb kürzester Zeit behandelt wird, einfach keine wirksame Therapie gibt, wenn man nicht geimpft ist. Deshalb sterben etwa 60.000 Menschen jedes Jahr an Tollwut“, erklärt Elisabeth Zeisberg ihre Motivation.




Zeisberg verfügt über langjährige Erfahrungen mit der CRISPR-Technologie. Als Kardiologin setzt sie CRISPR vor allem zur Erforschung der Organfibrose ein – der fehlerhaften Vernarbung von Organen wie dem Herzen. An ihrer Arbeit fasziniert die Wissenschaftlerin vor allem die Entwicklung von Neuem und die Perspektive, etwas zu bewegen. „Aber auch die Lehre und die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern macht mir Freude“, sagt Zeisberg. Als Mentorin ist es ihr besonders wichtig, anderen Frauen ein Vorbild zu sein. Die Mutter von vier Kindern weiß: „Frauen haben es immer noch schwerer als Männer, wenn sie Kinder haben und Vollzeit arbeiten. Ich möchte jungen Frauen Mut machen, das zu tun, was sie wollen.“


Prof. Dr. Hendrik Dietz hat eine Vision: Viren einfangen und unschädlich machen. Dazu will er kleine flache Schalen nutzen, die im Blut umher schwimmen und sich an Viren heften. Die Beschichtung verhindert, dass die Viren mit Zelloberflächen in Kontakt kommen. „Die Idee ist, die Oberfläche der Viruspartikel so zu beeinträchtigen, dass es nicht mehr erfolgreich eine menschliche Zelle infizieren kann“, erklärt Dietz, der an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Biomolekulare Nanotechnologie innehat.
Die kleinen Schalen bauen der 45-Jährige und sein Team aus DNA-Molekülen. Diese werden als Bausteine für den Aufbau präziser dreidimensionaler Strukturen im Nanometerbereich verwendet. Die Technik basiert auf den komplementären Basenpaaren der DNA, die es ermöglichen, bestimmte Sequenzen zu entwerfen, die sich zu stabilen Strukturen zusammenfügen, die aus mehrfach verkreuzten DNA-Doppelhelices bestehen.
Mit dieser als DNA Origami bekannten Fabrikationsmethode beschäftigt sich der Physiker schon lange. „Das Ziel war immer, irgendwann neue Medikamente zu machen“, erzählt Hendrik Dietz und fügt hinzu: „Aber die Frage war: Wo setzt man DNA-Origami am sinnvollsten ein, in welchem Kontext erzielt man Wirkung, die man nicht ohne weiteres mit existierenden Methoden erreichen kann?” 2018 hat es dann Klick gemacht: „Ich hatte damals zwei Bildschirme. Auf dem einen waren die Schalenprototypen, die wir damals eher als Forschungsprojekt ohne unmittelbare Anwendung entworfen hatten, und auf der anderen Seite hatte ich ein Bild von einem Virus. Und dann dachte ich, was passiert eigentlich, wenn ich das Virus in so eine Schale stecke?“
Ein Gedanke, der ihn nicht mehr losließ. Dietz beginnt sich für Viruserkrankungen zu interessieren. „Ich fand es schockierend, dass man gegen die große Mehrzahl von
Viruserkrankungen nicht viel tun kann. In manchen Fällen kann man mit Impfungen vorbeugen, aber wenn ich erstmal krank bin, habe ich meistens Pech gehabt: entweder ich komme durch oder nicht.“
Die DNA-Schalen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Viren einzukapseln. Dazu wird die Innenseite der Schale modular je nach Virustyp mit unterschiedlichen Klebstoffen beschichtet. Je nach Zielvirus verwendet das Team spezielle Polymere und Antikörper, um die Viren an die Schalen zu binden. „Die Antikörper werden einfach eingekauft und auf die Schalen aufgetragen“, sagt Dietz. „Der Nachteil ist, dass die Herstellung der Antikörper teuer ist, was auch die Kosten für potentielle Medikamente in die Höhe treibt. Langfristig wollen wir daher von Antikörpern wegkommen und mithilfe von Künstlicher Intelligenz Virusbinder konstruieren, die zu den Oberflächeneigenschaften der Viren passen und die wir leichter herstellen können.“
Die Qualität des Klebers muss dabei nicht perfekt sein und auch die Platzierung auf der Schale muss nicht optimal sein. Denn die Schalen erhöhen die Haftwirkung durch ihr Design selbst deutlich.
Derzeit konzentriert sich das Virustrap-Team darauf, die Eindämmung von Virusinfektionen mit der Virusfalle in Tierversuchen nachzuweisen. Ein Testvirus, mit dem sich das Team beschäftigt, ist das Chikungunya-Virus. Chikungunya ist eine tropische Infektionskrankheit, die durch Mücken übertragen wird. Eine Behandlung oder Impfung gibt es bisher nicht. In einer ersten Reihe von Tierversuchen wurde Mäusen eine tödliche Dosis der Viren gegeben. Während die Kontrollgruppe an Tag fünf verstarb, überlebten alle Mäuse, die mit ChikungunyaVirusfallen behandelt wurden. „Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben, weil es einfach so gut funktioniert hat. Es war ein geradezu binärer Effekt“, freut sich Dietz über den Erfolg.





Die Virusfallen sollen außerhalb der Zellen wirken. Es ist am naheliegendsten, sie zu spritzen. Aber auch Anwendungen über ein Nasenspray oder in Form einer Tablette sind denkbar, müssen allerdings noch getestet werden. Wie der Körper auf die Virenfallen reagieren wird, muss ebenfalls noch gründlich getestet werden. Dietz ist optimistisch: „Bei Mäusen scheinen unsere Virenfallen soweit gut verträglich zu sein. Strukturierte DNA, wie sie in den Schalen vorkommt, kommt in der Natur auch so gar nicht vor. Die Virenfallen könnten also gewissermaßen unter dem Radar der Immunabwehr fliegen.“



Was andere vielleicht erstmal eklig finden, findet Prof. Dr. Daniel Lauster faszinierend: Schleim. Gut zwei Liter Schleim, auch Mucus genannt, produziert unser Körper täglich neu. Als erste innere Verteidigungslinie des Körpers fängt er ständig Krankheitserreger für uns ab. Doch manche Viren lassen sich von der Schleimbarriere nicht aufhalten und infizieren uns. Das will der Biophysiker Daniel Lauster ändern, indem er die natürliche Schutzfunktion des Schleims stärkt.
„Wenn wir die Schwachstellen des Schleims mit virusbindenden Eiweißmolekülen auffüllen, können wir dem Schleim ein evolutionäres Upgrade verpassen“, erklärt der Leiter des MucBoost-Teams. Konkret kann man sich die Eiweißmoleküle als kleine Verbindungselemente vorstellen: Mit dem einen Ende verankern sie sich im Schleim, mit dem anderen Ende docken sie an ein Virus an. Klebt das Virus dann erfolgreich an einem Schleim-Anker, wird es zusammen mit dem Mucus über die Bewegung der Flimmerhärchen auf der Schleimhaut bis in den Rachen und von dort in den Magen abtransportiert, wo die Magensäure es zerstört.
Als Daniel Lauster vor eineinhalb Jahren in die BroadSpectrum Antivirals Challenge der SPRIND startete, war die Corona-Pandemie im vollen Gange, weshalb sich das MucBoost-Team zunächst auf die Entwicklung eines Nasensprays gegen SARS-CoV-2 konzentrierte. Mittlerweile ist das Team auf die Bekämpfung von Influenza-Viren umgeschwenkt. Grundsätzlich lässt sich das MucBoostKonzept aber auf viele – auch noch unbekannte – Virustypen übertragen.
Denn sobald die viralen Oberflächenproteine – auch Spikeproteine genannt – biotechnologisch hergestellt werden können, kann die Suche nach einem passenden Virus-Adapter beginnen: „Wir drucken auf eine Oberfläche verschiedene Peptidvarianten und schauen dann, woran das Virus bzw. dessen Spike, das uns interessiert, am besten bindet“, erläutert Lauster, der die Binder auf molekularer Ebene identifiziert. „Ich bin ein großer Fan davon, antivirale Moleküle mithilfe von biophysikalischen Methoden zu entwickeln, weil man mit einer sehr hohen Auflösung darstellen kann, was wirklich passiert.“
Durch das modulare Konzept ist es möglich, sehr spezifisch auf ein neues Virus zu reagieren. Das MucBoostNasenspray kann aber auch als Breitbandtherapeutikum
eingesetzt werden. „Für uns sind konservierte Regionen –das sind Regionen, die trotz Evolution bei vielen Viren bislang gleich geblieben sind – besonders interessant. Unser Influenza-Binder bindet daher nahe der Sialinsäure-Bindungsstelle. Diese ist ziemlich gut konserviert, weil Viren immer an Sialinsäure binden müssen, um in die Zelle zu gelangen“, sagt Lauster. Erste Laborversuche zeigen, dass das Konzept aufgeht: „Wir können an mehrere Stämme des saisonalen Grippevirus H3N2 binden, ebenso an H1N1 und an den Vogelgrippestamm H7N1“.
Während andere sich mit Grundlagenforschung beschäftigen, reizt Daniel Lauster etwas anderes: „Ich möchte keine exotischen Strukturen kreieren, die man eventuell nur publizieren kann. Ich will etwas entwickeln, was praktisch anwendbar ist, um es für den Menschen nutzbar zu machen.“
Das Nasenspray, das demnächst erste Tierstudien durchlaufen wird, könnte direkt auf zwei verschiedene Weisen nutzbar sein: Da es die Viruskonzentration reduziert, könnte es bei frisch Erkrankten für einen abgeschwächten Krankheitsverlauf sorgen, zum anderen könnte es aber auch präventiv verwendet werden. „Also ich sehe es als Ergänzung zu einer Maske. Wir nennen es deswegen auch die unsichtbare Maske, weil es eben Situationen gibt, wo man keine Maske tragen kann, zum Beispiel beim Essen und Trinken“, erklärt Lauster seine Vision. Die krankmachenden Viren würden beim Kontakt mit dem Mucus durch MucBoost direkt herausgefiltert werden, was eine Ansteckung verhindert.
Daniel Lauster hat sich ganz dem Thema Schleim verschrieben. Während es bei MucBoost darum geht, die Wirksamkeit des Schleims zu erhöhen, sucht er in einem anderen Forschungsprojekt (MucPep) nach Möglichkeiten, den Schleim zu reduzieren – zum Beispiel bei der bislang unheilbaren Krankheit Mukoviszidose. Aber nicht nur der Mucus der Lunge interessiert ihn: „Wir haben in unserem Körper circa 200 Quadratmeter Schleimoberfläche, die Zusammensetzung des Schleims ist aber je nach Gewebe unterschiedlich.“ Gut möglich, dass MucBoost künftig auch in anderen Schleimregionen – wie dem Darm – Anwendung finden könnte. „Man kann unseren Schleimbinder entsprechend anpassen. Er ist bereits stabil bei Körpertemperaturen und kann auch die Magenpassage überstehen. Eine orale Therapie gegen Darmviren oder bakterielle Toxine wäre folglich denkbar.





Langeweile kommt bei Daniel Lauster also nicht auf. Auch weil der 38-Jährige nicht nur seit Mai 2023 Juniorprofessor für Biopharmazeutika am Institut für Pharmazie der FU Berlin ist, sondern weil er zeitgleich selbst noch studiert. Nebenher zu seiner Doktorarbeit in Experimenteller Biophysik begann er zusätzlich mit einem Medizinstudium. „Wenn man sich wirklich der Wissenschaft widmet, muss man mit vollem Einsatz dabei sein. Man muss intrinsisch motiviert sein, sonst wird das nichts“, erklärt er und fügt hinzu: „Aber das Schöne ist, wenn die Ideen funktionieren. Translationale Forschung ist das, was mich begeistert, weil ich glaube, dass ich den Erfolg meiner Forschung selbst erleben werde und man auch etwas Gutes für die Gesellschaft tut.“
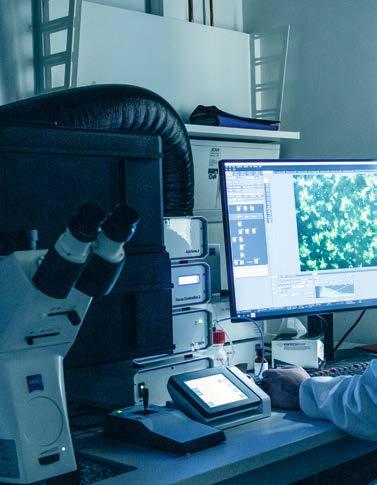



Auf die nächste Pandemie will Prof. Dr. Dr. Axel Schambach vorbereitet sein: „Unser Ziel ist es, sehr schnell maßgeschneiderte Therapien entwickeln zu können“. Normalerweise dauert die Entwicklung eines neuen Medikaments mehrere Jahre bis Jahrzehnte – für Viren eine enorme Zeitspanne. „Wir haben bei SARS-Cov-2 gesehen, wie schnell ein Virus mutieren kann. Erst kam die Alpha-Variante, dann die Delta-Variante, dann Omikron, und jetzt haben wir wieder neue Varianten, sodass die Impfstrategien, die ursprünglich sehr schnell entwickelt wurden, nicht ganz gegriffen haben“, erklärt Schambach, der Professor für Molekulare Medizin und Gentherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover ist. „Was wir aber immer sehr früh wissen – und das war auch bei dem Virus aus Wuhan der Fall –, ist, wie das Virus genetisch aufgebaut ist.“ Mithilfe Künstlicher Intelligenz will er diese Informationen mit anderen Virenstämmen abgleichen. „Wir schauen, ob es bestimmte Achillesfersen gibt, die man gut angreifen kann, sodass das Virus Schwierigkeiten hat, entsprechend zu mutieren.“
Derzeit konzentriert sich das Team um Axel Schambach auf Parainfluenzaviren. Das ist eine Virusfamilie, die eine leichte Erkältung, aber auch schwerere Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Lungenentzündung auslösen kann, was besonders bei immunsupprimierten und transplantierten Patienten lebensbedrohliche Konsequenzen haben kann. Die bisherige Behandlung von Parainfluenza-Infektionen konzentriert sich nur auf die Linderung der Symptome, da es keine spezifische antivirale Therapie gibt.
Das soll sich ändern. „Wir haben uns im Prinzip das ganze Genom mit KI angeschaut und untersucht, welche Bereiche der viralen mRNA besonders vulnerabel und zugleich resistent gegen Mutationen sind“, erklärt Schambach. An die ausgewählten Bereiche sollen kleine komplementäre RNA-Schnipsel – sogenannte siRNAs (small interfering RNA) – andocken. „Im Prinzip müssen die RNASchnipsel nur zwischen 16 und 20 Basenpaare lang sein. Da ein Virusgenom relativ groß ist, können wir es mit den RNA-Schnipseln an mehreren Stellen angreifen“, erklärt der Forscher.
Sobald die siRNA in die Wirtszelle gelangt, durchsucht die Zelle die virale mRNA nach einem komplementären Abschnitt. Wurde das genetische Gegenstück zur siRNA identifiziert, verbinden sich mRNA und siRNA zu einem Doppelstrang. „Wenn das passiert, sprechen wir von RNAInterferenz“, erklärt Schambach.
Der Doppelstrang wird von einem Enzym, einem Bestandteil der Argonautenproteine, erkannt und in kleine Stücke zerschnitten. Die mRNA hat die Aufgabe, die genetische Information des Virus zur Proteinsynthese zu transportieren. Die zerschnittenen mRNA-Fragmente können aber nicht mehr als Vorlage für die Proteinproduktion genutzt werden. Dadurch wird die Replikation des Virus empfindlich gestört: Es kann sich nicht mehr vermehren. „Wir erzeugen also körpereigene Signale, die dem Körper helfen, das Virus selbst zu zerstören“, fasst der Mediziner zusammen.
„Nach dem Prinzip ‚Simplicity is beautiful‘ brauchen wir eigentlich nur die siRNA zu geben. Den Rest erledigt die Zelle selbst”, erläutert Schambach die Eleganz der Methodik. “Wir müssen nur wie beim Dominospiel den ersten Anstoß geben, was unsere Darreichungsform natürlich extrem einfach macht.“
Da sich das Team auf Atemwegsviren konzentriert, will es ein inhalierbares Therapeutikum entwickeln. „Das ist besonders spannend, weil es in der Pharmaindustrie relativ wenige Firmen gibt, die sich darauf fokussieren“, sagt Schambach. „Das heißt, wir haben hier wirklich Neuland betreten und dann in der Zellkultur gezeigt, dass es funktioniert. Nicht nur im Tierversuch, sondern auch in lebenden Lungenzellen, die wir Patienten entnommen haben.“
Therapeutika, die auf RNA-Interferenz (RNAi) beruhen, stellen eine neue Klasse von Medikamenten dar. Das erste RNAi-Therapeutikum wurde 2018 für die Behandlung von Patienten zugelassen. Derzeit werden RNAi-Medikamente für verschiedene Indikationen in klinischen Studien untersucht. „RNAi ist breit anwendbar für alle möglichen Virusinfektionen und vor allem auch für solche, die wir noch gar nicht kennen“, schwärmt Schambach und fügt hinzu: „Außerdem gibt es einfach sehr viele Krankheiten, bei denen die Überexpression eines Proteins das Problem ist. Auch da können wir gezielt angreifen und das selbstregulierend wieder auf das richtige Niveau bringen.“



Der große Vorteil der Technologie ist vor allem, dass durch die Unterstützung des KI-Algorithmus und der darauf abgestimmten präklinischen Entwicklungspipeline sehr schnell geeignete siRNAs gefunden und synthetisiert werden können. Axel Schambach, der selbst längere Zeit in Zentralafrika gearbeitet hat, ist es wichtig, dass neue RNAi-Medikamente nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig produziert werden: „Jeder Patient, der die Therapie braucht, sollte auch davon profitieren können. Und das schließt für mich explizit auch Entwicklungs- und Schwellenländer ein.“


Vom Erfolg seiner Forschung ist Schambach vor allem wegen seiner Kollegen und Kolleginnen überzeugt: „Wir haben ein ganzes Team von Leuten, die sich für neue Themen begeistern, die vor Herausforderungen nicht zurückschrecken, die auch nicht beim ersten Problem aufgeben, sondern bestrebt sind, innovativ neue Dinge voranzutreiben.“ Vor allem das Fördern und Fordern junger Kolleginnen und Kollegen liegen ihm am Herzen: „Es ist uns besonders wichtig, junge Leute im Team zu haben, die solche Entwicklungen langfristig tragen können und auch in den nächsten Jahrzehnten am Ball bleiben.“ Das iGUARD-Team rund um Axel Schambach, Philippe Vollmer Barbosa, Prof. Armin Braun und Prof. Adrian Schwarzer versucht, Menschen mit unterschiedlichen Kernkompetenzen zusammenzubringen: „Dementsprechend ist vieles von dem, was wir machen, eine synergistische Teamleistung, bei der wir gemeinsam die richtigen Lösungen für die Medizin von morgen finden.“



MICHAEL KREMER
Faculty Director des Market Shaping Accelerator an der University of Chicago und Wirtschaftsnobelpreisträger 2019
Mit Unterstützung der University of Chicago hat SPRIND neue Finanzierungsmodelle zur Förderung der Entwicklung antiviraler Medikamente zur Pandemievorsorge vorgestellt. Neue Forschungsergebnisse von SPRIND zeigen, dass durch die frühzeitige Verfügbarkeit antiviraler Therapeutika bei einer zukünftigen, mit COVID-19 vergleichbaren Pandemie Millionen von Menschenleben gerettet und finanzielle Verluste in Höhe von 28,2 Billionen Dollar vermieden werden könnten.
In Modellrechnungen, basierend auf den COVID-19-Daten der WHO und Our World in Data, hat SPRIND insgesamt 135 Szenarien modelliert. Das Referenzszenario geht davon aus, dass antivirale Medikamente 100 Tage nach Ausbruch der Pandemie zur Verfügung stehen und 50 Prozent Schutz gegen die Übertragung und 50 Prozent Wirksamkeit gegen die Sterblichkeit bieten. Die Berechnungen ergeben, dass 6 Millionen Menschenleben gerettet und 91 Prozent der wirtschaftlichen Verluste vermieden werden könnten.
INTERNATIONAL DIE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERER ZEIT MEISTERN SPRIND arbeitet bei diesem Projekt im Rahmen einer Innovation Challenge mit dem Market Shaping Accelerator der University of Chicago, unter der Leitung des Nobelpreisträgers Michael Kremer, zusammen. Das Team hat dazu beigetragen, einen marktgestaltenden Mechanismus zu entwickeln und die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Auszahlungen, den regulatorischen Fragestellungen und den derzeitigen kommerziellen Perspektiven dieser antiviralen Medikamente anzugehen.
„Pandemien drohen, unserer Wirtschaft und Gesellschaft enormen Schaden zuzufügen. Innovationen können dazu beitragen, uns vor künftigen Pandemien zu schützen, wie die Wirkung neuartiger mRNA-Impfstofftechnologien bei COVID-19 gezeigt hat. Leider bleiben die bestehenden Anreize für Investitionen in Innovationen zur Pandemievorsorge weit hinter dem gesellschaftlichen Bedarf zurück. Indem die Nachfrage nach erfolgreichen Produkten garantiert wird, kann das von SPRIND mit Unterstützung vom MSA konzipierte AMC die Energie und Kreativität des Privatsektors nutzen, um in die Entwicklung von antiviralen Breitbandmedikamenten zu investieren, die für die Bekämpfung künftiger Pandemien äußerst wertvoll wären.“
THOMAS KALIL
CEO von Renaissance Philanthropy und ehemaliger stellvertretender Direktor im Büro für Wissenschaftsund Technologiepolitik des Weißen Hauses

JANO COSTARD
Head of Challenges bei SPRIND
LEHREN AUS COVID-19
Die Notwendigkeit neuartiger antiviraler Therapeutika, die nach einem neuen Ausbruch frühzeitig zur Verfügung stehen können, wird auch von der der US-amerikanischen Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), und der Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) sowie vom Deutschen Zentrum für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI) betont. Den Herstellern fehlen die kommerziellen Anreize, um in diese Forschung zu investieren, die möglicherweise nicht vergütet wird, da das Auftreten von Pandemien ungewiss ist. Das Schließen dieser Lücke zwischen dem Nutzen für die öffentliche Gesundheit und der finanziellen Attraktivität der Pandemievorsorge wird der Schlüssel für die Finanzierung und Entwicklung dieser Wirkstoffe sein.
Da die bestehenden kommerziellen Finanzierungsmodelle ungeeignet sind, werden alternative Ansätze benötigt. Ein staatlich finanziertes AMC ermöglicht eine neue Form der Risikoteilung zwischen Steuerzahlern und Investoren. Wenn neue Technologien mithilfe staatlicher Forschungsförderung entwickelt werden, zahlen Steuerzahler für die unvermeidlichen Misserfolge auf dem Weg zu neuen Medikamenten. Da das AMC nur für erfolgreich entwickelte Medikamente zahlt, übernehmen die Investoren einen Teil des Risikos gescheiterter Versuche, diese neuen Medikamente zu entwickeln. Auf diese Weise können Regierungen ehrgeizige Ziele von großem Nutzen für die Gesellschaft verfolgen und gleichzeitig einen Teil des technologischen Risikos mit privaten Investoren teilen.
„Die Regierungen können und sollten mehr tun, um die Bedrohung durch künftige Pandemien zu verringern, insbesondere angesichts der tragischen Verluste an Menschenleben im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den enormen Kosten für die Weltwirtschaft. Die Arbeit von SPRIND und MSA hat gezeigt, dass der Marktgestaltung bei der Entwicklung von antiviralen Breitbandmedikamenten eine Schlüsselrolle zukommt, da diese Medikamente einen hohen gesellschaftlichen Nutzen und unsichere private Erträge haben könnten. Ich hoffe, dass Regierungen und andere Geldgeber sich zusammenschließen, um diesen Vorschlag zu unterstützen. Millionen von Menschenleben könnten davon abhängen.“
Im Rahmen der SPRIND Challenge „Broad-Spectrum Antivirals“ wurde eine Reihe unterschiedlicher Ansätze finanziert, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Darüber hinaus existieren weitere Ansätze aus anderen therapeutischen Bereichen oder gänzlich neue Technologien, die sich erst noch beweisen müssen. Ein AMC würde es ermöglichen, diesen Forschungsbereich organisch weiterzuentwickeln und die Methoden zu belohnen, die sich als erfolgreich erweisen, ohne die Bandbreite der Möglichkeiten zu beschneiden. Durch die Abstimmung der Anreize auf umfassendere gesundheitspolitische Ziele wie behördliche Genehmigungen und Produktionskapazitäten kann ein AMC wirksame Anreize für die rechtzeitige Verfügbarkeit antiviraler Behandlungen bei Ausbruch einer Pandemie schaffen.
„Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen das bahnbrechende Potential neuartiger Therapeutika für die Pandemiebekämpfung. Wichtig ist, dass diese neuen Technologien auch außerhalb von Pandemien ein transformatives Potential haben, um respiratorische Viren zu bekämpfen, für die es bislang keine geeigneten Medikamente gibt. Die große Bedeutung liegt jedoch darin, wie wir Technologien ermöglichen, die Leben retten können, was durch präventives Investieren erreicht werden kann. Ich danke den Teams von SPRIND, MSA und UChicago für ihr Engagement bei dieser bahnbrechenden Arbeit.“


Die Klimakatastrophe zwingt uns, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Extreme Wetterereignisse nehmen bereits zu und werden in Zukunft noch häufiger und intensiver auftreten: Sie zerstören Lebensgrundlagen, bedrohen unsere Gesundheit und verursachen einen gigantischen wirtschaftlichen Schaden. Um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, müssen wir nicht nur unsere derzeitigen CO2-Emissionen drastisch reduzieren, sondern auch enorme Mengen an Treibhausgasen aus der Atmosphäre entfernen, die in der Vergangenheit durch die Menschheit ausgestoßen wurden.
Doch wie können große Mengen CO2 in einem langlebigen, nachhaltigen und wirtschaftlich tragbaren Produkt gespeichert werden? Um diese Frage dreht sich die Carbon-to-Value-Challenge der SPRIND, die 2022 startete. In der ersten Stufe der Challenge wurden fünf Teams mit jeweils bis zu 600.000 Euro finanziert. Drei Teams konnten dabei besonders überzeugen: Carbo Culture, enaDyne und Macrocarbon. Sie wurden im April 2023 für die zweite Stufe ausgewählt und erhalten bis zum Ende der Challenge am 30.09.24 bis zu 2.300.000 Euro.
Einen besonders schlechten CO2-Fußabdruck hat die Baubranche: Derzeit ist die Zementproduktion für etwa dreimal so viel CO2 verantwortlich wie der gesamte globale Flugverkehr. CARBO CULTURE will das ändern. Dazu bindet das Unternehmen Kohlenstoff aus Abfallbiomasse in Form von Pflanzenkohle. Die Pflanzenkohle kann nicht nur als kohlenstoffnegativer Ersatzstoff den CO2-Abdruck von Beton verbessern, sondern auch seine Eigenschaften. Denn durch das eigens entwickelte Pyrolyseverfahren wird die Biokohle ähnlich elektrisch leitend wie Graphit. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel Fertigbetonbauteile oder durch die Leitfähigkeit beheizbare Böden. Im September 2024 will das Team in Finnland eine beheizbare Treppe bauen.
• Das Unternehmen ENADYNE will grüne Chemikalien, unter anderem zur Herstellung von E-Fuels aus CO2, herstellen. Durch eine nichtthermische Plasmakatalyse ist das Team in der Lage, CO2 aus biologischen Quellen mit geringem Energieaufwand in Methanol, Ethylen und andere Kohlenwasserstoffverbindungen umzuwandeln. Bislang werden diese Verbindungen, die für die chemische Industrie eine große Rolle spielen, fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen gewonnen. Aktuell bereitet ENADYNE den Einsatz des Plasmakatalyse-Reaktors in Biogasanlagen vor.
Auch das Unternehmen MACROCARBON stellt chemische Rohstoffe her. Geht dabei aber ganz andere Wege: Es setzt auf Algen. Algen speichern CO2 von Natur aus sehr effizient. Deshalb baut MACROCARBON zurzeit eine Ozeanfarm auf den Kanaren auf, in der die Algen Sargassum und Ulva kultiviert werden. Durch Fermentation ist das Unternehmen in der Lage, das durch die Algen gebundene CO2 beispielsweise zu Naphtha und SAFs weiterzuverarbeiten.

SHORTFACTS
LAUFZEIT
2,5 Jahre (Frühling 2022–Herbst 2024)
GESAMTBUDGET
18 Mio. €
STUFEN 2023/24
3 Teams (von 5 in Stufe 1) in der finalen Stufe 2 der Challenge
AUSGRÜNDUNGEN
MACROCARBON (03/2023)
FINANZIERUNGSRUNDEN seit Beginn der Challenge
CARBOCULTURE: 25 MIO. € SERIES A (Q4/2023)
• ENADYNE: 3,9 MIO. € PRE-SEED
WOFÜR GIBT ES DIESE CHALLENGE?
Für Klimaschutz durch wirtschaftliche Anreize in der Emissionspolitik. Wir wollen der Atmosphäre große Mengen CO2 langanhaltend entziehen und in kommerziellen Produkten binden.
AUF WELCHEM WEG UNSERE CHALLENGE-TEAMS IHR ZIEL
ERREICHEN UND AUF WELCHER TECHNOLOGISCHEN GRUNDLAGE DAS CO2 DER ATMOSPHÄRE ENTNOMMEN WIRD, BESTIMMEN SIE SELBST.
TIEFERE EINBLICKE IN DIE
CARBON-TO-VALUE-CHALLENGE
GIBT ES AUF UNSERER WEBSITE.

Einen besonders schlechten CO2-Fußabdruck hat die Baubranche: Derzeit ist die Zementproduktion für etwa dreimal so viel CO2 verantwortlich wie der gesamte globale Flugverkehr. CARBO CULTURE will das ändern. Dazu bindet das Unternehmen Kohlenstoff aus Abfallbiomasse in Form von Pflanzenkohle. Die Pflanzenkohle kann nicht nur als kohlenstoffnegativer Ersatzstoff den CO2-Abdruck von Beton verbessern, sondern auch seine Eigenschaften. Denn durch das eigens entwickelte Pyrolyseverfahren wird die Biokohle ähnlich elektrisch leitend wie Graphit. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel Fertigbetonbauteile oder durch die Leitfähigkeit beheizbare Böden. Im September 2024 will das Team in Finnland eine beheizbare Treppe bauen.


Das Unternehmen enaDyne will grüne Chemikalien, unter anderem zur Herstellung von E-Fuels aus CO2 herstellen. Durch eine nicht-thermische Plasmakatalyse ist das Team in der Lage CO2 aus biologischen Quellen mit geringem Energieaufwand in Methanol, Ethylen und andere Kohlenwasserstoffverbindungen umzuwandeln. Bislang werden diese Verbindungen, die für die chemische Industrie eine große Rolle spielen, fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen gewonnen. Aktuell bereitet enaDyne den Einsatz des Plasmakatalyse-Reaktors in Biogasanlagen vor.

Das Unternehmen Macrocarbon stellt chemische Rohstoffe her. Geht dabei aber ganz andere Wege: Es setzt auf Algen. Algen speichern CO2 von Natur aus sehr effizient. Deshalb baut Macrocarbon zurzeit eine Ozeanfarm auf den Kanaren auf, in der die Algen Sargassum und Ulva kultiviert werden. Durch Fermentation ist das Unternehmen in der Lage, das durch die Algen gebundene CO2 beispielsweise in Naphtha und SAFs weiterzuverarbeiten.



Um im Kampf gegen den Klimawandel seinen Beitrag zu leisten, muss Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und die Energieversorgung aus ausschließlich erneuerbaren Energien sicherstellen. Der Handlungsdruck hat sich zudem infolge des Ukrainekriegs erhöht, denn Gas hat als Übergangstechnologie an Attraktivität verloren – und Deutschlands Unabhängigkeit hat bei der Energieversorgung massiv an Bedeutung gewonnen. Angesichts dieser neuen existenziellen Bedrohungen, der immer häufiger werdenden Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen muss der Anteil der erneuerbaren Energien in den kommenden zwei Jahrzehnten stark ansteigen. Gleichzeitig sollen die grundlastfähigen Atom- und Kohlekraftwerke bis 2038 vollständig vom Netz genommen und durch Wind- und Solarkraft ersetzt werden. Dabei stellen lange Perioden ohne nennenswertes Solarund Windenergiepotential eine besondere Herausforderung dar, sogenannte Dunkelflauten. Während andauernder Dunkelflauten liegt die Leistung von Wind- und Solarkraft nur bei einem Bruchteil der üblichen Durchschnittsleistung, sodass der Energiebedarf auch mithilfe von Lastmanagement und Kurzzeitspeichern nicht abgedeckt werden kann. In Deutschland treten mehrere solcher Flauten mit einer Länge von über 48 Stunden pro Jahr auf, im Einzelfall können sie sich aber auch über bis zu zehn Tage hinziehen. In diesen Zeiträumen spielen langfristige Energiespeicher, also Energiespeicher mit einer Speicherdauer von mindestens zehn Stunden, eine essentielle Rolle, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Zudem erstrecken sich meist durch den Winter lange Perioden, in denen in Zukunft die Energieerzeugung hinter dem Energiebedarf zurückbleibt. Langfristige Energiespeicher sind ein zentraler Baustein für die Energieautonomie und die Erreichung der Klimaziele, parallel auch ein heranwachsender Multi-Milliarden-Markt, der allerdings mit den aktuell marktreifen Technologien nur unzureichend bedient werden kann.
SHORTFACTS

LAUFZEIT
2,5 Jahre (Winter 2022–Frühling 2025)
GESAMTBUDGET
18 Mio. €
STUFEN 2023/24
4 Teams (von 5 in Stufe 1) in der finalen Stufe 2 der Challenge
• Radikal einfaches Design – das ist das Geheimnis hinter der neuen Flussbatterie von UNBOUND POTENTIAL. Das Unternehmen arbeitet an einer membranlosen Batterie, die Lithium-Ionen-Akkus Konkurrenz machen soll.
• REVERION arbeitet an einem System, das in weniger als einer Minute vom Energiespeicher zum Energielieferanten wird. Dazu nutzt die Firma eine keramische Brennstoffzelle, die bei sehr hohen Temperaturen arbeitet.
HALIOGEN POWER entwickelt eine neue Generation von RedoxFlow-Batterien: eine membranfreie Batterie. Das bedeutet: 30 Prozent geringere Herstellungskosten und gleichzeitig eine läng ere Lebensdauer der Batterie.
• Eisen, Luft und Wasser: Mit diesen drei Elementen will ORE ENERGY die Batteriebranche revolutionieren. 100 Stunden lang soll die Eisen-Luft-Batterie des Teams Strom liefern und immer dann einspringen, wenn keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen.
AUSGRÜNDUNGEN
HALIOGEN POWER
FINANZIERUNGSRUNDEN seit Beginn der Challenge REVERION: Covertible Notes (Wandelanleihen) in Höhe von 8,5 Mio. € ORE ENERGY: 10 Mio. € Seed
• UNBOUND POTENTIAL: Seed in Q2/2024
WOFÜR GIBT ES DIESE CHALLENGE?
Für eine klimaneutrale Zukunft und Energieautonomie.
Wir wollen eine langfristige und nachhaltige Energiespeicherlösung.

Radikal einfaches Design – das ist das Geheimnis hinter der neuen Flussbatterie von Unbound Potential. Das Unternehmen arbeitet an einer membranlosen Batterie, die Lithium-Ionen-Akkus Konkurrenz machen soll. Membranlose Batterien sparen Kosten und sind effizienter, bringen aber einige Herausforderungen mit sich. „Das trivialste Problem, das darin besteht, dass sich die Flüssigkeiten ohne trennende Membran mischen, lässt sich lösen, indem man zwei nicht-mischbare Flüssigkeiten verwendet – vergleichbar mit Öl und Wasser“, erklärt David Taylor, CEO bei Unbound Potential. „Die eigentliche Challenge bei der Skalierung von membranlosen Systemen besteht darin, dass man aktive Kontrollschleifen benötigt, um die Ein- und Ausflussrate jeder Flüssigkeit in jeder Zelle zu steuern.“
Flussbatterien funktionieren, indem durchgängig zwei verschiedene Elektrolyt-Flüssigkeiten in die Batterie fließen, wo sie je nach Ladevorgang entweder geladen oder entladen werden, und dann wieder aus der Batterie herausfließen. „Man hat eine Einflussrate und eine Ausflussrate für zwei Flüssigkeiten. Das heißt, man hat vier Regelgrößen pro Zelle“, erklärt Taylor. Eine Membran sorgt unter anderem dafür, dass das Verhältnis zwischen den beiden ElektrolytFlüssigkeiten gleich bleibt. Fehlt die Membran jedoch, muss jeweils exakt gleich viel Elektrolyt-Flüssigkeit in die Batterie einfließen und wieder ausfließen, damit sich die unsichtbare Trennschicht zwischen den Flüssigkeiten in der Batterie nicht verschiebt.
„Wenn man eine Batterie hat, also ein geschlossenes System, und auf der einen Seite Flüssigkeit hinein pumpt, erhöht man den Druck im System. Dieser Druckanstieg führt automatisch dazu, dass auf der anderen Seite Flüssigkeit austritt. Man hat aber keine Kontrolle darüber, wie viel Anolyt und wie viel Katholyt genau herausgedrückt wird“, erläutert Taylor das Problem. „Wenn die Flusswiderstände am Ausfluss nicht perfekt auf die Viskosität der jeweiligen Flüssigkeit abgestimmt sind, die sich wiederum temperaturbedingt schnell ändern kann, kann es zum Beispiel passieren, dass etwas mehr Katholyt aus- als einströmt – und sich die Grenzfläche entsprechend verschiebt, wodurch die Batterie nicht mehr optimal arbeitet.“
Eine effektive und aktive Kontrolle der Zu- und Abflussraten der Elektrolyt-Flüssigkeiten sei, so Taylor, im großen Maßstab nicht realisierbar. Deshalb wagt Unbound Potential etwas Revolutionäres: „Wir messen, steuern und regeln gar nichts. Wir haben ein komplett anderes Designkonzept, das fluidische Randbedingungen ausnutzt und so dafür sorgt, dass automatisch immer gleich viel Flüssigkeit ausund einströmt“, sagt Taylor stolz.
Dieses passive Konzept wird zum Game Changer für membranlose Flussbatterien: „Die Idee hinter Unbound Potential ist, das einfachste stationäre Speichersystem zu
bauen, das man bauen kann, weil wir überzeugt davon sind, dass Einfachheit und Robustheit Kernkriterien sind für die Skalierbarkeit der Technologie“, verkündet Taylor.
Da die Flussbatterie von Unbound Potential grundlegend anders aufgebaut ist als bisherige Flussbatterien, kommt das Unternehmen auch mit 90 Prozent weniger Dichtflächen aus. „Es gibt keine Kanäle, keine Membranen, nichts muss gespannt oder abgedichtet werden“, erklärt der 37-Jährige. „Das senkt die CapEx, also die Vorabinvestitionen, massiv.“
Unbound Potentials Hauptkonkurrent sind LithiumIonen-Batterien, die günstig in China produziert werden. Neben den Kosten für die Lithium-Ionen-Zellen fallen jedoch auch Kosten für das Batterie-Management-System an, das die gleichmäßige Belastung der Zellen steuert. Ebenfalls einkalkuliert werden müssen ein Temperatur-ManagementSystem, das die Zellen kühlt und die Abwärme abführt, sowie Kupferkabel, die die einzelnen Zellen miteinander verbinden. „Diese ganze Peripherie muss bei Lithium-IonenBatterien immer mitskaliert werden“, erklärt Taylor. „Unser Ziel ist es, nicht günstiger als die Zelle selbst zu sein, aber günstiger als das Gesamtpaket. Unser System ist so einfach, dass wir diesen bei Lithium-Ionen-Batterien unvermeidlichen Kostenpunkt unterbieten und damit Marktführer für stationäre Speicherlösungen werden können.“
Aber Unbound Potential überzeugt nicht nur durch niedrigere Kosten, sondern auch durch eine bessere Leistung. „Wenn die Batterie sehr oft pro Tag geladen und entladen wird, haben wir einen Performance-Vorteil gegenüber Lithium-Ionen-Akkus“, sagt Taylor. Das liegt an der guten Zyklenfestigkeit der Flussbatterie, die eine Lebensdauer von 20 Jahren hat. Unbound Potential will vor allem Strom aus Wind- und Solaranlagen für vier bis zehn Stunden speichern, theoretisch lässt sich das System aber erweitern, so dass auch 20 Stunden möglich sind.
Das Batteriesystem wird in großen Containern untergebracht. „Eine Batterieanlage wird aus etwa 40 Containern bestehen, das entspricht einer Leistung von zehn Megawattstunden“, sagt Taylor und räumt ein: „Energiedichte ist nicht unsere Stärke, aber wir können unsere Container platzsparend stapeln. Bei Lithium-Containern geht das nicht, die müssen wegen der Brandgefahr mehrere Meter auseinander stehen.“ In den Containern von Unbound Potential kann hingegen nichts brennen, so dass alle Container dicht an dicht stehen können. Der Platzbedarf für die gesamte Anlage ist daher nicht größer als bei einer Lithium-Batterieanlage.
Das Konzept von Unbound Potential überzeugt: Ab Ende 2025 startet das Unternehmen ein gemeinsames Pilotprojekt mit Amazon. Zuvor sind allerdings noch einige Testläufe im frisch eingerichteten Testlabor nötig.



Taylor hat Spaß daran, kreative technische Lösungen zu entwickeln, gleichzeitig macht es dem Wissenschaftler, der zuvor an der ETH Zürich forschte, Freude, ein Team um sich zu versammeln. „Als ich über meine Zukunft als Forscher nachdachte, fragte ich mich, ob es angesichts der ganzen Probleme, die wir haben – und in Anbetracht der Energiewende im Besonderen –, überhaupt Sinn ergibt, die nächsten 20 Jahre an irgendeinem Forschungsprojekt rumzubasteln. Ich hatte das Gefühl, dass die Konzepte, die wir entwickeln, eigentlich direkt um- und einsetzbar sind, zugleich hatte ich das starke Verlangen, etwas Handfestes zu bauen“, erinnert sich Taylor und sagt: „Ein Unternehmen zu gründen war die ideale Möglichkeit, das, was ich gut kann und was mir Spaß macht, mit maximaler Wirkung umzusetzen, mit einem klaren Ziel und einer klaren Wirkung, die man jeden Tag spürt.“






„Die neue Energiewelt ist binär“, sagt Felix Fischer: „Es gibt entweder einen Stromüberschuss oder einen Strommangel.“
Scheint die Sonne, sinken die Strompreise, scheint sie nicht, steigen die Preise an und die schnelle Bereitstellung von gespeicherter Energie wird immer wichtiger.
Reverion arbeitet deshalb an einem System, das in weniger als einer Minute vom Energiespeicher zum Energielieferanten wird. Dazu nutzt die Firma eine keramische Brennstoffzelle, die bei sehr hohen Temperaturen arbeitet. „Immer wenn Strom günstig zur Verfügung steht, wird die Festoxid-Zelle als Elektrolyseur betrieben und produziert Wasserstoff“, erklärt Fischer, COO von Reverion. „Aber –und das ist das Schöne – auf Knopfdruck kann dasselbe System den Wasserstoff wieder aufnehmen und daraus erneut Strom erzeugen.“
ENTKOPPLUNG VON SPEICHERLEISTUNG UND SPEICHERDAUER
Der Clou: Anders als bei Batterien ist eine Entkopplung von Speicherleistung und Speicherdauer möglich. „Wir verwenden einen Energiewandler und einen davon unabhängigen Gasspeicher“, erklärt Fischer. Im Extremfall heißt das: Weht beispielsweise zwei Wochen lang ununterbrochen Wind, produziert Reverion zwei Wochen lang Wasserstoff. „Andere Batterien wären schon nach wenigen Stunden voll, aber wir können ohne physikalische Begrenzung weiter Wasserstoff produzieren.“
Der Energiewandler des Systems, die keramische Brennstoffzelle, befindet sich in einem Container. In einem separaten Aggregat kann der Wasserstoff verdichtet oder verflüssigt werden. „Dadurch hat man eine hohe Energiedichte. Man braucht also relativ wenig Platz, um viel Energie zu speichern“, erklärt Fischer. Der Wasserstoff kann direkt vor Ort gespeichert werden, es ist aber auch möglich, die Anlage an das Erdgasnetz anzuschließen. So kann der Wasserstoff in großen Mengen abtransportiert und zum Beispiel direkt in der Industrie genutzt werden – oder an einem anderen Ort durch Reverion wieder in Strom umgewandelt werden.
EFFIZIENTER DURCH RAFFINIERTE SYSTEMKOMBINATION
Die Möglichkeit, schnell zwischen dem Speichermodus und dem Stromerzeugungsmodus umschalten zu können, ist nicht nur praktisch, sondern auch wesentlich energieeffizienter als zwei getrennte Systeme. „Hätte man zwei verschiedene „Stand-alone-Lösungen“, einen Elektrolyseur und eine Brennstoffzelleneinheit, dann bräuchte der Elektrolyseur immer eine Hochlauflaufphase. Er muss erst warm
werden. Das dauert bei einer Hochtemperaturelektrolyse sehr lange, bei einem Kaltstart würde man stundenlang warten“, sagt der 36-Jährige. Und auch Brennstoffzellen brauchen eine gewisse Anlaufzeit. „Da bei uns alle Komponenten immer in Betrieb sind, haben wir dieses Problem nicht. Beim Umschalten müssen nur die Gaswege gespült und zwei, drei Ventile umgestellt werden. Elektrisch erfolgt die Umschaltung in Millisekunden“, erzählt Fischer.
WÄRMEINTEGRATION
Das Erfolgsgeheimnis: Reverion legt großen Wert auf die Wärmeintegration. Abwärme wird immer sinnvoll genutzt: „Dadurch wird auch der Wirkungsgrad bei der Elektrolyse noch einmal gesteigert.“ Eine weitere Innovation verbirgt sich in der Stromerzeugung. „Die Verstromung von Wasserstoff ist technisch relativ einfach, aber normalerweise nicht sehr effizient“, berichtet Fischer und fährt geheimnisvoll fort: „Wir haben einen Hebel gefunden, wie man das ändern kann.“
„Die Kombination der Technologien, die wir entdeckt haben, sorgt dafür, dass wir einen Roundtrip-Wirkungsgrad, also von Strom zurück zu Strom, von 75 Prozent haben“, sagt Fischer und räumt ein: „Wir können Energie nicht verlustfrei speichern, aber unsere Energieverluste bei der Um- und Rückwandlung von Strom in Wasserstoff sind geringer als so ziemlich alles, was bisher erreicht wurde.“
Kein Wunder, dass es bereits einige Interessenten gibt. Neben Solar- und Windparks interessieren sich auch Brauereien für die Anlage von Reverion. Für Reverion ein perfekter Anwendungsfall. Denn Brauereien, die eine Solaranlage auf dem Dach haben und am Wochenende nicht produzieren, können mit dem Reverion-System das Sonnenlicht am Wochenende speichern und den Strom am Montagmorgen, wenn es noch dunkel ist, selbst nutzen. Würden die Brauereien den Strom stattdessen am Wochenende ins Netz einspeisen, wäre er kaum etwas wert.
SKALIERUNG: SERIENPRODUKTION ABSEHBAR Bereits Ende 2024 soll die erste 100-Kilowatt-Anlage im Dauerbetrieb getestet werden. „Danach wollen wir um den Faktor 10 hochskalieren. Das sollte innerhalb weniger Wochen möglich sein, denn dafür sind keine weiteren Innovationssprünge nötig, sondern nur ganz saubere, klassische Ingenieursarbeit“, erklärt der ausgebildete Energie- und Prozessingenieur.



Skalierung spielt bei Reverion auch personell eine große Rolle: Innerhalb von zwei Jahren ist aus einem ursprünglich fünfköpfigen Team ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden geworden. Den Anstoß zu Reverion gab Dr. Stephan Herrmann, der am gleichen Lehrstuhl wie Fischer promovierte. Fischer erinnert sich: „Uns war klar, Solaranlagen allein reichen nicht für die Energiewende. Da ist eine Lücke, die wir schließen müssen.“ Herrmann und Fischer verspüren den Drang, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. „Ich wollte nie ein Unternehmen gründen, weil ich Gründer sein wollte, sondern weil ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, etwas Sinnvolles, etwas Sinnstiftendes tun wollte. Das ist meine intrinsische Motivation“, macht Fischer klar und sagt über sein Team: „Was uns auszeichnet, ist, dass wir leidenschaftlich dafür brennen, technische Lösungen für ein extrem akutes Problem zu finden.“






Dünne Trennwände schützen Redox-Flow-Batterien vor Kurzschlüssen und ermöglichen gleichzeitig den Ionenaustausch zwischen den Elektrolyten: Membranen sind in Batterien seit Jahrzehnten im Einsatz. Doch das könnte sich ändern. „Wir entwickeln eine neue Generation von Redox-Flow-Batterien: Eine membranfreie Batterie“, fasst Dr. Lewis Le Fevre den innovativen Ansatz von HalioGen Power zusammen. Keine Membran, das bedeutet: 30 Prozent geringere Herstellungskosten und gleichzeitig eine längere Lebensdauer der Batterie. „Die Membran einer Redox-Flow-Batterie versagt nach etwa acht Jahren, dann muss sie ausgetauscht werden, sonst funktioniert die Batterie nicht mehr“, erklärt Le Fevre, CTO und Mitbegründer von HalioGen Power.
Der Verzicht auf die Membran ist aber nicht die einzige Innovation. „Wir haben einen der teuersten Bestandteile weggelassen, nämlich Vanadium“, sagt Le Fevre. „Vanadium ist ein noch knapperes Gut als Nickel und Kobalt und kommt zu 70 Prozent aus China.“
ZINK UND BROMID STATT VANADIUM
Das neunköpfige Team von HalioGen Power arbeitet stattdessen an einer Batterie, in der Zink und Bromid zum Einsatz kommen. Zink-Brom-Batterien gibt es schon länger, doch sie haben eine Membran – und einige Probleme. „Bei der Oxidation von Bromid entstehen verschiedene Bromverbindungen, darunter auch Bromgas, das sehr giftig ist“, erklärt Le Fevre. Und auch das Zink bereitet Schwierigkeiten: „Auf der Zinkelektrode bilden sich Ablagerungen, sogenannte Dendriten. Diese wachsen ungleichmäßig, so dass man am Ende baumähnliche Strukturen hat, die von der Elektrode abstehen.“ Die Dendriten können die Membran der Batterie durchstoßen und dadurch einen Kurzschluss verursachen. Damit das nicht passiert, muss der Abstand zwischen den Elektroden relativ groß gewählt werden. „Das bedeutet aber einen höheren Widerstand und damit eine geringere Leistung“, fasst Le Fevre die Komplikationen zusammen.
„Es ist uns gelungen, diese Probleme grundlegend zu lösen“, verkündet er stolz. „Während meiner Zeit als Doktorand habe ich an zinkbasierten Energiespeichersystemen gearbeitet, und im dritten Jahr meiner Doktorarbeit habe ich eine Lösung gefunden.“ Doch er gibt zu: „Es ist ein sehr komplizierter chemischer Prozess, der sehr langsam und nicht skalierbar war.“
SCHUTZSCHICHT STATT MEMBRAN
Le Fevre und seine Kollegen bei HalioGen Power arbeiten deshalb an einer elektrochemischen Lösung, die den Prozess beschleunigt und besser kontrollierbar macht. Mit Erfolg: „Wir haben eine Möglichkeit gefunden, auf elektro-
chemischem Weg eine Schutzschicht auf die Zinkoberfläche aufzubringen, die die Korrosionsbeständigkeit erhöht und das Dendritenwachstum deutlich reduziert.“
Woraus die regulierbare Schutzschicht besteht, ist noch geheim, aber Le Fevre verrät: „Es handelt sich um eine sogenannte Festelektrolyt-Grenzfläche, die hauptsächlich aus einem weit verbreiteten Lebensmittelzusatzstoff besteht und sehr dünn ist. Wir können eine Schutzschicht mit einer einstellbaren Dicke von weniger als 100 Mikrometern erzeugen.“
Die Schutzschicht reguliert den Zinkfluss zur Elektrode: Denn nur Zink kann bestimmte Stellen der Schutzschicht durchdringen, für Brom ist sie nicht durchlässig. Gleichzeitig verhindert die Schutzschicht die Selbstentladung der Batterie: „Wir haben bei unserem Prototyp im Labor nachgewiesen, dass die Selbstentladung bei einer Ladezeit von 15 Stunden unter einem Prozent liegt. Das ist ein wichtiges Verkaufsargument für uns“, sagt Le Fevre. Durch die Schutzschicht können die Elektroden näher beieinander liegen, was wiederum eine höhere Leistung bedeutet. „Dank einiger chemischer Veränderungen, die wir vorgenommen haben, ist unsere Zink-Brom-Batterie 30 Prozent effizienter und 160 Prozent energiedichter als ein herkömmliches Vanadium-System.“
HalioGen Power plant ein 10-Kilowattstunden-System, das die Größe einer Klimaanlage hat und daher leicht am oder im Haus installiert werden kann, um Solarenergie zu speichern. Die Batterie selbst ist nicht brennbar, und auch die Toxizität konnte das Team im Vergleich zu bisherigen Zink-Brom-Batterien reduzieren. Denn in der Batterie befindet sich kein Bromgas, sondern flüssiges Brom.
HITZEBESTÄNDIG BIS 90 GRAD
Ein weiterer Pluspunkt der Zink-Brom-Batterie ist ihre Hitzebeständigkeit. Wie wichtig diese ist, weiß Le Fevre aus eigener Erfahrung: „Meine Familie lebt in Australien. In Westaustralien gab es eine große Lithium-Ionen-Batterieanlage. Als es mehrere Tage heißer als 45 Grad war, fiel das Kühlsystem der Batterie aus und die Lithium-IonenBatterie ging in Flammen auf“, berichtet er. „Es besteht ein Bedarf an Energiespeichersystemen, die extremen Temperaturen, insbesondere Hitze, standhalten können. Hinzu kommt: Extreme Hitzewellen werden durch die Klimakrise immer häufiger.“
„Unser System funktioniert auch noch bei 90 Grad“, sagt Le Fevre. Das eröffnet für HalioGen Power einen neuen Markt: „Wir können unser Produkt auch in Ländern vertreiben, in denen Redox-Flow-Batterien bisher nicht oder nur mit aufwendiger Kühlung eingesetzt werden konnten. Daher haben wir vor allem Länder in Afrika südlich der Sahara, in Südostasien, in Südamerika und Australien im Blick.“





Neben dem 10-Kilowattstunden-System für Privathaushalte arbeitet HalioGen Power auch an einem 100-Kilowattstunden-System für Gewerbegebiete. „Wir hoffen, dass wir bis 2027 beides vollständig kommerzialisiert haben“, erklärt Le Fevre. Den technischen Hürden sieht der 32-Jährige gelassen entgegen. Respekt hat der Wissenschaftler, der kürzlich mit HalioGen Power aus der Universität Manchester ausgegründet hat, vor allem vor der Geschäftswelt und der Herausforderung, ein Unternehmen zu führen. „Ich habe immer zu den Leuten gesagt, ich könnte es besser machen. Jetzt will ich es wirklich besser machen.“




Eisen, Luft und Wasser: Mit diesen drei Elementen will Ore Energy die Batteriebranche revolutionieren. 100 Stunden lang soll die Eisen-Luft-Batterie des Teams Strom liefern und immer dann einspringen, wenn keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen.
WIE EINE LUNGE, DIE EIN- UND AUSATMET
Die Batterie von Ore Energy besteht aus einer eisenhaltigen Anode, die von Wasser umgeben ist, während die Kathode einer Membran ähnelt. Beim Entladen dringt Sauerstoff durch die Membran in die Batterie ein. Durch dieses „Einatmen“ rostet die eisenhaltige Anode und der Oxidationsprozess setzt Energie frei. Wird der Batterie hingegen Energie zugeführt, regeneriert sich die Anode durch den Ladevorgang und Sauerstoff wird durch die Membran ausgeatmet. „Die Batterie ist wie eine Lunge, die ein- und ausatmet und Eisen in Rost verwandelt und umgekehrt“, erzählt Dr. Aytac Yilmaz, Mitbegründer von Ore Energy.
Eisen-Luft-Batterien sind keine neue Erfindung. Das Konzept wurde bereits in den 1960er-Jahren entwickelt. Die Umsetzung stieß jedoch bisher auf Schwierigkeiten, da Eisen zwar leicht rostet, der Prozess aber nur schwer rückgängig gemacht werden kann. „Wenn man sich z. B. eine rostige Brücke anschaut, dann handelt es sich um eine sehr stabile Form von Rost. Es ist sehr schwierig, den wieder in Eisen zu verwandeln“, erklärt Yilmaz. Aber Rost ist nicht gleich Rost: Ob er reversibel ist, hängt von seiner Beschaffenheit ab.
VÖLLIG ANDERS ALS ALLES, WAS BISHER VERWENDET WURDE
Wie also schafft es Ore Energy, reversiblen Rost zu erzeugen? „Unser Anodenmaterial basiert zwar auf Eisen, ist aber völlig anders als alles, was bisher verwendet wurde“, gibt Yilmaz stolz zu. Welche Materialien sich sonst noch in der Anode verbergen, bleibt allerdings Betriebsgeheimnis.
Etwas mehr lässt sich über die Kathode erzählen: Die Kathode ist im Wesentlichen eine Membran, die den Sauerstoff ein- und ausströmen lässt. „Das geschieht durch eine spezielle Struktur“, sagt der 35-Jährige und fährt fort: „Auf der Membran befindet sich eine Region, die wir Dreiphasen-
grenze nennen. Dort treffen die Feststoffe der Membran mit den Elektrolyten, also auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite Luft, zusammen.“ Und genau dort findet auch die Reaktion statt, die die Batterie „atmen“ lässt: Beim Entladen wird Sauerstoff zu Hydroxyl-Ionen reduziert, beim Laden werden die Hydroxyl-Ionen wieder zu Sauerstoff.
GÜNSTIGE UND RECYCLEBARE MATERIALIEN
„Eisen ist billig und deshalb werden wir eine sehr kostengünstige Batterie anbieten können, was ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Batterien ist“, sagt Yilmaz und präzisiert: „Die Kosten liegen bei nur 16 Euro pro Kilowattstunde.“ Zum Vergleich: 2023 war der Preis für LithiumIonen-Akkus etwa zehnmal so hoch.
Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit der Batterie. Sie ist weder giftig noch brennbar. Die Kapazität soll mehrere Megawattstunden betragen, der Wirkungsgrad im Bereich von Durchflussbatterien liegen. Die Lebensdauer schätzt Yilmaz auf 20 Jahre – danach kann das enthaltene Eisen recycelt werden. Die Batterie ist modular erweiterbar und soll vor allem Energieversorger ansprechen, die eine netzgebundene Anwendung suchen.
Hinter der Batterie, die in einem großen Container untergebracht ist, steht ein stetig wachsendes Team von derzeit 30 Mitarbeitenden aus 14 Nationen. Yilmaz selbst wurde in der Türkei geboren, studierte in den USA und promovierte in Materialwissenschaft in den Niederlanden. Dort begann er mit der Erforschung der neuen Eisen-Luft-Batterie. Für Yilmaz war schnell klar, dass aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen eine effektive Technologie werden kann, die in die Gesellschaft getragen werden muss. Doch der Schritt aus der Universität heraus war eine Herausforderung: „Die europäische Forschung kann sich durchaus sehen lassen. Betrachtet man die Zahl der Publikationen mit hohem Impact im Vergleich zu den USA oder anderen Teilen der Welt, so zeigt sich, dass Europa gut abschneidet. Allerdings ist die Zahl der Unternehmen, die aus der Universität heraus gründen und erfolgreich sind, im Vergleich zu den USA verschwindend gering. Das ist bedauerlich“, fasst Yilmaz die Problematik zusammen.



ENTSCHEIDENDER SCHUB DURCH DIE SPRIND
Für Ore Energy kam die SPRIND Challenge Long-Duration Energy Storage daher genau zum richtigen Zeitpunkt. „Wir standen noch ganz am Anfang und die Unterstützung von SPRIND hat uns den entscheidenden Schub gegeben. So konnten wir viel schneller wachsen und unsere Technologie weiterentwickeln“, erinnert sich Yilmaz, der CEO von Ore Energy. Im nächsten Jahr will Ore Energy die Batterie im Pilotmaßstab herstellen. Die nächste große Herausforderung ist die Skalierung. Dabei kann es Yilmaz nicht schnell genug gehen, denn die Zeit drängt: „Der Klimawandel ist das größte Problem der Menschheit. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir gestern damit anfangen.“






CHALLENGE: WIR

Bislang basiert unsere Produktion fast vollständig auf der Nutzung neu geförderter Rohstoffe oder Materialien und nicht auf der Wiederverwendung bestehender Ressourcen. Dies stellt eine enorme Belastung für Umwelt und Gesellschaft dar. Zusätzlich bleiben Abhängigkeiten in Lieferketten bestehen, die durch lokale Stoffkreisläufe reduziert werden könnten.
Eine Kreislaufwirtschaft, in der neue Produkte auf Basis bereits bestehender Rohstoffe und Materialien hergestellt werden, ermöglicht dagegen eine nachhaltigere und resilientere Produktion.
Dafür müssen biotechnologische Verfahren zur Marktreife entwickelt und unmittelbar mit modernen Produktionsverfahren integriert werden. Wissenschaftliche Fortschritte der letzten Jahre haben neue Erkenntnisse und Methoden hervorgebracht, die die Leistungsfähigkeit biotechnologischer Verfahren erheblich steigern und neue Anwendungsmöglichkeiten erschließen können. Und das ist dringend nötig: Obwohl in verschiedenen Entwicklungsansätzen alternative Wege zur Herstellung verschiedenster Produkte aus der konventionellen petro-chemischen oder chemischen Industrie demonstriert wurden, gelangen Durchbrüche bislang nur in Nischenanwendungen. Ziel muss jedoch sein, einen Großteil der Produktion auf die Verwendung lokal verfügbarer Rohstoffe umzustellen.
SURFACYCLE der belgischen Biotechnologiefirma AmphiStar konzentriert sich auf die Herstellung verschiedener Biotenside aus Abfällen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. altes Speiseöl.
C3 BIOTECHNOLOGIES (Acrylics) stellt aus Kartoffelstärke, Abfällen der Biodieselproduktion und Zuckerrübenschnitzeln den Kunststoff PMMA her – besser bekannt unter dem Handelsnamen Plexiglas.
CircuMat-3D um Dr. Mahmoud Masri produziert in Hefen Fette und langkettige Kohlenwasserstoffe, um daraus viele verschiedene technisch interessante, teilweise sogar essbare, Polymere herzustellen.
EVERYCARBON verwendet organische Abfälle und produziert daraus eine wichtige Chemikalie für die Herstellung hochwertiger Kunststoffe.
• Die INSEMPRA GMBH produziert mit ihrem Team „BioTreasure“ aus Pflanzenresten, altem Speiseöl oder PET-Abfällen mithilfe einer speziellen Hefe Materialien wie Polyester und Polyamide.
• Da Abfallströme wie Plastikmüll oder alte Textilien oft verunreinigt sind, setzt das Team MATERI-8 um Dr. Patricia Parlevliet sowie ihre Mitstreiter von der University of Nottingham nicht auf einen einzigen Mikroorganismus, sondern auf eine Co-Kultur aus gleich drei verschiedenen Mikroorganismen, um einen möglichst großen Anteil des Abfallstroms verwerten zu können.
• QUANTUM LEAP arbeitet mit Reststoffen der Papierrecyclingindustrie, Rückständen aus der Bioethanolproduktion mit Brauereiabfällen und Molasse.
Das Team SYMBIOLOOP entwickelt Kunststoffe, die in ihrer Funktionalität konventionellen Kunststoffen in nichts nachstehen, aber im Unterschied zu Letzteren nahezu grenzenlos recycelbar sind.
SHORTFACTS
LAUFZEIT
3 Jahre (Herbst 2023–Herbst 2026)
GESAMTBUDGET
40 Mio. €
STUFEN 2023/24
8 Teams in Stufe 1 der Challenge
FINANZIERUNGSRUNDEN seit Beginn der Challenge
C3: 4 MIO. £ SERIES A
• INSEMPRA: 20 MIO. $ SERIES A
• AMPHISTAR: 8 MIO. € SEED
WOFÜR GIBT ES DIESE CHALLENGE?
Für Nachhaltigkeit und Resilienz.
Wir wollen eine Kreislaufwirtschaft, in der neue Produkte auf Basis bereits bestehender Rohstoffe und Materialien hergestellt werden.
CIRCULAR BIOMANUFACTURING CHALLENGE DER SPRIND.
INSGESAMT TRETEN ACHT TEAMS GEGENEINANDER AN.
INTERVIEW, WELCHE HERAUSFORDERUNGEN DIE CHALLENGE BEREITHÄLT UND WAS SIE PERSÖNLICH MOTIVIERT.
WORUM GEHT ES BEI DER SPRIND CIRCULAR BIOMANUFACTURING CHALLENGE?
Bei der Challenge geht es darum, mit Hefen und Bakterien, also mit Mikroorganismen, Produkte und Materialien herzustellen. Traditionellerweise füttert man die Mikroorganismen dabei mit Zucker. Das Besondere an der Circular Biomanufacturing Challenge ist jedoch, dass nicht Zucker, sondern Abfallstoffe verwendet werden, um die Mikroorganismen zu füttern und Produkte herzustellen. Alle Teams haben die Aufgabe, insgesamt drei verschiedene Abfallströme zu benutzen und am Ende der Challenge auch drei verschiedene Produkte herzustellen.
GIBT ES WEITERE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER CHALLENGE?
Am Ende der dreijährigen Challenge soll die Fermentation nicht wie gewöhnlich drei bis fünf Tage dauern, sondern 180 Tage. Während dieser Zeit soll der Abfallstrom kontinuierlich hinein- und der Produktstrom kontinuierlich herausströmen. Die Idee dahinter ist, dass man so theoretisch billiger und effizienter produzieren kann. Eine weitere ChallengeBedingung ist, dass wir keine konventionellen Mikroorganismen verwenden dürfen. Das heißt, die Bäckerhefe S. cerevisiae und auch E. coli Bakterien, sogenannte Model-Organismen, mit denen die meisten an den Universitäten und in der Industrie arbeiten, können wir nicht benutzen. Stattdessen brauchen wir einen Nicht-Model-Organismus, also nicht so bekannte und genetisch erkundete Hefen oder Bakterien.
WARUM WERDEN DIE BEKANNTEN MIKROORGANISMEN BEI DER CHALLENGE AUSGESCHLOSSEN?


Der Grund dafür ist, dass wir bereits seit über 100 Jahren an diesen Modellorganismen forschen und sie daher sehr gut verstehen. Aber es gibt einfach noch viel mehr Mikroorganismen, die womöglich ein großes Potential besitzen. Bei dieser Challenge wurde gesagt, jetzt arbeiten wir mal bewusst an etwas anderem, damit das Spektrum erweitert wird und vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet werden.
WORAN ARBEITEN SIE MIT IHREM TEAM KONKRET?
Wir nutzen pflanzliche Agrarabfälle, zum Beispiel Stroh und Holzabfälle, sowie Altfett aus Küchenabfällen, also beispielsweise altes
Frittenfett. Unser dritter und auch schwierigster Abfallstrom besteht aus PET-Plastik. Unsere drei Zielprodukte sind: ein Monomer, das zu Nylon polymerisiert werden kann, ein Monomer, das zu Polyester polymerisiert werden kann, und die Faserform eines Proteins. Unsere Endprodukte können verwendet werden, um neues Plastik 3D zu drucken, oder aber auch gesponnen werden, um neue Kleidung und andere Materialien zu produzieren.
WELCHER ABFALLSTROM FÜHRT ZU WELCHEM ZIELPRODUKT? UND WELCHE MIKROORGANISMEN NUTZEN SIE FÜR DIE UMWANDLUNG?
Die Idee ist, dass alles zu allem werden kann. Es ist also egal, ob wir mit altem Frittenfett oder Agrarabfällen arbeiten. Wir arbeiten mit einer Ölhefe, die sich durch die Nährstoffe aus dem Abfallstrom ernährt. Mithilfe von Enzymen können wir unsere Hefe so verändern bzw. programmieren, dass sie uns das jeweils gewünschte Endprodukt herstellt. Es gibt also drei verschiedene metabolische Pfade, um die Produkte herzustellen. Aber was die Hefe frisst, sollte keinen Einfluss haben auf das, was sie herstellt.
AUCH UNABHÄNGIG VON DER SPRIND CHALLENGE BESCHÄFTIGEN SIE SICH JEDEN TAG MIT FERMENTATION. SIE SIND FORSCHUNGSLEITERIN BEI INSEMPRA, EINEM BIOTECHNOLOGIE-START-UP IN DER NÄHE VON MÜNCHEN. AN WAS ARBEITEN SIE DORT?
Bei Insempra stellen wir durch Fermentation Produkte her, die normalerweise aus Erdöl synthetisch hergestellt oder aus raren Pflanzen extrahiert werden. Konkret bedeutet das: Mithilfe von Hefen und Bakterien stellen wir Öle für Kosmetika her und verschiedene Produkte für die Lebensmittelindustrie: Geruchs- und Geschmacksstoffe
„DIE

müssen wir wirklich niedrige Preise erreichen, um mit Erdöl konkurrieren zu können. Es ist toll, dass wir jetzt die SPRIND-Finanzierung haben, um die Prozesse so zu verbessern, dass wir in Zukunft mit dem ErdölNylon auf dem Markt konkurrieren können.
WELCHE ERINNERUNGEN HABEN SIE AN DEN ERSTEN PITCH BEI SPRIND?
Für mich persönlich war der Pitch schon etwas Ungewöhnliches. Unser CEO ist es gewohnt, vor Investoren zu pitchen, aber als Wissenschaftlerin macht man Forschungsanträge normalerweise schriftlich. Deshalb war ich schon etwas nervös, vor einem Panel von Experten zu pitchen, aber die Atmosphäre in Leipzig war gut und es war spannend, die anderen Teams auf dem Gang zu treffen, die auch alle ziemlich aufgeregt waren – ein bisschen wie bei einer Gameshow. Und dann ging es sehr schnell. Einen Tag nach dem Pitch kam der Anruf: IHR SEID DRIN! Das ganze Team hat sich natürlich super gefreut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen praktisch heute anfangen, um die Ziele zu erreichen. Bei SPRIND gibt es keine Verschnaufpause: Du kriegst die Zusage und dann läuft das Projekt.
SIE SIND SOWOHL IN DEUTSCHLAND ALS AUCH IN DEN USA AUFGEWACHSEN, HABEN IN HARVARD IHREN MASTER UND DOKTOR IN CHEMIE UND CHEMISCHER BIOLOGIE GEMACHT. DANACH HABEN SIE AN BIOTREIBSTOFFEN AN DER UNIVERSITÄT IN KALIFORNIEN GEFORSCHT UND SCHLIESSLICH ACHT JAHRE LANG DAS START-UP BIOSYNTIA IN KOPENHAGEN MIT HOCHGEZOGEN, DAS DURCH FERMENTATION VITAMINE HERSTELLT. VOR DREI JAHREN HABEN SIE BEGONNEN, INSEMPRA MIT AUFZUBAUEN. WAS TREIBT SIE BEI IHRER ARBEIT AN?
BILLIG GENUG HERSTELLEN, DAMIT WIR WIRKLICH GEGEN ERDÖL KONKURRIEREN KÖNNEN? “
sowie Antioxidantien. Im Gegensatz zur Challenge nutzen wir dabei keine Abfallströme, sondern füttern die Mikroorganismen mit verschiedenen Zuckern. Mit Abfallströmen zu arbeiten ist deutlich schwieriger, denn diese sind nicht immer gleichmäßig. Für die Challenge haben wir uns deshalb eine sehr robuste Ölhefe ausgesucht. Das heißt, sie ist nicht so pingelig, wächst nicht nur bei pH 7 und kann Veränderungen besser überstehen.
WAS GEFÄLLT IHNEN AN DER CHALLENGE BESONDERS?
Bei Insempra stellen wir normalerweise hochwertige Produkte her. Das liegt vor allem daran, dass es schwieriger ist, mit günstigen Massenprodukten zu konkurrieren, die traditionell aus Erdöl hergestellt werden. Aber durch die Challenge arbeiten wir zum ersten Mal an einem Massenprodukt: Nylon. Hier
Was mich am meisten motiviert, ist, etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Mein Lebenslauf ist also geprägt von der Frage: Wie kann ich mich einbringen, um mit meinen Fähigkeiten die Nadel in die richtige Richtung zu bewegen? Deshalb beschäftige ich mich schon lange damit, wie man durch Mikroorganismen biologische Stoffe herstellen kann. Das Ziel ist es, erdölbasierte Prozesse zu ersetzen. Und wir können tatsächlich auch schon viele Produkte herstellen. Die Frage ist nun, können wir auch Massenware billig genug herstellen, damit wir wirklich gegen Erdöl konkurrieren können? Ich finde es großartig, dass SPRIND dieses Thema beleuchtet und so viele verschiedene Teams zusammenbringt, um daran zu forschen.




Viele Patient:innen sind auf Spendergewebe oder Organspenden angewiesen. Der hohe Bedarf an Spendergewebe und -organen kann aber bei weitem nicht gedeckt werden. Deshalb leiden Patient:innen unter langen Wartelisten und unzähligen medizinischen Herausforderungen oder sterben, noch bevor eine Spende verfügbar ist. Künstlich erzeugtes Gewebe dagegen verspricht eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität für diese Menschen.
In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler:innen, Ingenieur:innen und Ärzte und Ärztinnen Werkzeuge entwickelt, um biologische Ersatzstoffe zu konstruieren, die natürliches Gewebe nachahmen. Das ultimative Ziel, die Grenzen der herkömmlichen Organtransplantation zu überwinden, ist jedoch weiterhin unerreicht.
DIE CHALLENGE: DIE DEMONSTRATION DER MACHBARKEIT EINES NEUARTIGEN ANSATZES VON TISSUE ENGINEERING FÜR EINE ERSTE TRANSPLANTATION BEIM MENSCHEN.
Ziel ist es, ein fortschrittliches Konzept zu entwickeln, welches das bisher am weitesten entwickelte künstliche Gewebe hervorbringt. Dieses Gewebe muss dem natürlichen Gewebe des Menschen so nahe wie möglich kommen (Größe, Struktur, Komplexität) und kann Elemente wie das Engineering von Zellen, die Entwicklung von Gewebearchitektur oder technische Materialien umfassen.

Am 1. November 2023 ist der SPRIND-Funke mit insgesamt vier Teams in Stufe 1 gestartet. Ziel der ersten Stufe mit einer Laufzeit von zehn Monaten war die Demonstration der Eigenschaften des künstlichen Gewebes. Die SPRIND unterstützte mit bis zu 500.000 EUR. Nach eingehender Evaluation der Ergebnisse aus Stufe 1 kann der Wettbewerb leider nicht in einer zweiten Stufe fortgeführt werden. Aufgrund der großen Herausforderung und des eng gesteckten Zeitrahmens konnten sich nicht genügend Teams für die Stufe 2 qualifizieren, bei der die SPRIND mit bis zu 100.000 EUR unterstützt hätte, um die Planung eines Firstin-human Trial voranzutreiben.
Ohne eine funktionierende Leber bricht der Stoffwechsel des Körpers zusammen. Deshalb hat sich das Team von CELLBRICKS GmbH zum Ziel gesetzt, fehlende oder gestörte Leberfunktionen zu ersetzen. Gemeinsam mit ihren klinischen Partnern an der Charité Berlin wollen sie menschliches Lebergewebe in großem Maßstab nachbilden. Mittels 3D-Bioprinting soll komplexes Lebergewebe aus Biotinten mit extrazellulärer Matrix und menschlichen Leberzellen hergestellt werden. Diese Gewebetherapeutika werden im Labor biotechnologisch hergestellt und schließlich in den Körper der Patient:innen implantiert.
• Das Team von ZONALCARTHT um Dr. Solvig Diederichs und Dr. Uwe Freudenberg entwickelt einen neuartigen Knorpelersatz, der Gelenkfunktionen wiederherstellen soll. Durch die Kombination aus biohybriden Hydrogelen und Stammzellen wird eine komplexe zweischichtige Matrix entwickelt, die den natürlichen Übergang zwischen Knochen und Knorpel spiegeln soll. Gleichzeitig sollen die eingesetzten Materialien eine nachhaltige Funktion und Belastbarkeit ermöglichen, um Gelenkfunktionen wiederherzustellen und einen mehrmaligen Gelenkersatz zu verhindern.
Um Muskelverletzungen und -krankheiten besser behandeln zu können, will das MUSCLE ENGINEERING FOR HUMAN TRANSPLANT Team von Dr. Bruno Cadot (Institut de Myologie, Paris), Dr. Francisco Fernandes (Sorbonne Université, Paris) und Dr. Léa Trichet (Sorbonne Université Paris) große transplantierbare Muskeleinheiten herstellen. Das vom Team genutzte Ice-Templating ermöglicht die Herstellung makroskopischer und komplexer Gewebearchitekturen aus Kollagen und Fibrin. Diese sollen anschließend mit verschiedenen Zelltypen des Muskelgewebes besiedelt werden, um funktionale und Muskeleinheiten zu erhalten, die anschließend beschädigtes Gewebe ersetzen sollen.
• Obwohl Insulin vielen Menschen mit Diabetes Typ 1 eine wirksame Behandlung bietet, besteht bis heute keine Aussicht auf eine Heilung, da das körpereigene Gewebe für die Insulin-Produktion fehlt. Riccardo Levato (Utrecht University Medical Center) und sein Team FUNCTIONAL BIOPRINTED PANCREAS TISSUE wollen der Heilung einen entscheidenden Schritt näherkommen. Mithilfe des Licht-induzierten Bioprinting kombinieren sie zeitgleich Stammzellen, biologisch aktive Moleküle und Extrazellulärmatrix zu einer funktionalen Gewebeeinheit. Das entstehende Gewebe ähnelt der endokrinen Bauchspeicheldrüse und kann ebenfalls Insulin produzieren. Weitere Funktionalisierungen sollen das neue Gewebe aber auch vor der Zerstörung durch das Immunsystem schützen, um so das Grundproblem von Diabetes Typ 1 zu lösen.



Digitale Identitätsnachweise sind eine bedeutende Grundlage für die Digitalisierung unseres Lebens. Digitale Brieftaschen, sogenannte Wallets, ermöglichen es Nutzenden, im Rahmen von digitalen Prozessen Identitäts- und andere Nachweise zu empfangen, zu verwalten und vorzuweisen. Damit werden Wallets ein essentieller Bestandteil der digitalen Infrastruktur unserer Gesellschaft sein. Sie ermöglichen eine vollständige Digitalisierung von Prozessen und damit auch völlig neue Herangehensweisen an Probleme, was sie auch zur Basis von Sprunginnovationen macht.
Derzeit werden unterschiedliche Ansätze für die Implementierung von Wallets diskutiert, es gibt aber zu wenig Implementierungserfahrung, um eine fundierte Entscheidung über den am besten geeigneten Ansatz zu treffen. Ziel des Funken „EUdi Wallet Prototypes“ ist daher die Erprobung von technischen Lösungen für zukünftige deutsche EUdi Wallets in Form von Prototypen. Die Erkenntnisse des Funken werden in die Entwicklung sicherer, datensparsamer, nutzbarere und reichenweitenstarker EUdi Wallets einfließen.
Hintergrund ist die aktuelle eIDAS-Verordnung 2.0, die die Grundlagen zur verstärkten Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel und digitaler Nachweise in Europa regelt und dazugehörige Rahmenbedingungen festlegt. Deutschland braucht nun einen Weg für die eIDAS-konforme Infrastruktur. Deshalb wurde das Projekt „Architektur- & Konsultationsprozess für EUdi-Wallets“ ins Leben gerufen, um ein Konzept für eine digitale Brieftasche zu entwickeln, mit der sich Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen künftig sicher digital ausweisen können. SPRIND führt dieses Projekt im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) durch. So wurden bisher verschiedene Architekturvorschläge für die Implementierung von EUdi Wallets in Deutschland auf Basis der existierenden Infrastruktur der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises entwickelt.
AUFTAKT DER ERSTEN STUFE
EUDI WALLET PROTOTYPE hat eine Laufzeit von 13 Monaten in 3 Stufen. Dabei wird SPRIND in Stufe 1 sechs Teams finanzieren, in Stufe 2 bis zu vier Teams und in Stufe 3 bis zu zwei Teams. In Stufe 1 bekommen die ausgewählten Teams von SPRIND bis zu 300.000 Euro. Für Stufe 2 erhalten die Teams jeweils bis zu 300.000 Euro. Für Stufe 3 sind bis zu 350.000 Euro pro Team geplant. In der zweiten und dritten Stufe wird die Begleitung des LSP POTENTIAL angestrebt. Die Entscheidung über die Teilnahme wurde im Anschluss an eine Präsentation, die im Mai 2024 in Leipzig stattfand, von einer Fachjury getroffen. Direkt im Anschluss startete die Stufe 1 und dauert drei Monate. Stufe 2 beginnt im September 2024 und dauert ebenfalls drei Monate. Stufe 3 beginnt im Dezember 2024 und endet im Juni 2025.
• SPHEREON hat die Vision, die Nutzung persönlicher und unternehmerischer Identitäten neu zu definieren, um Vertrauen in einer digitalen Welt zu schaffen. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Identitätsnachweise zu entwickeln, die einen effizienten, fälschungssicheren und datenschutzkonformen Informationsaustausch ermöglichen. Der Ansatz besteht darin, Innovation und Konformität miteinander zu verbinden, damit die digitalen Identitätsnachweise den strengen Anforderungen regulierter Sektoren gerecht werden.
• Eine moderne E-ID-Infrastruktur muss auf soliden kryptografischen Verfahren basieren, die Datenschutz, Sicherheit und ein hohes Vertrauensniveau gewährleisten. Damit eine solche Infrastruktur erfolgreich wird, muss sie von den Nutzer:innen akzeptiert waerden und einen echten Mehrwert bieten. Das Projekt HEIDI – Human-centered E-ID Infrastructure des Teams von Ubique adressiert beide Herausforderungen gleichzeitig. Das interdisziplinäre Team des Zürcher Digitalunternehmens vereint tiefgehendes technisches Wissen mit herausragenden UX-Fähigkeiten.
• ANIMO EASY-PID hat sich auf die Entwicklung von Low-LevelOpen-Source-Komponenten spezialisiert. Animo Solutions hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in mehreren Open-SourceCommunities, mit langfristigen Investitionen in das Credo-Framework, ein TypeScript SSI-Framework, das mit React Native kompatibel ist und hauptsächlich für die Erstellung von IdentitätsWallets verwendet wird.
• Das Team EID-CLIENT WALLET-EVOLUTION setzt sich aus den Spezialisten der „Kompetenzeinheit sichere Identitäten“ zusammen. So kann auf die jahrelange Erfahrung mit der Entwicklung funktionsorientierter Lösungen wie der „AusweisApp“, des eID-Servers „Governikus ID Panstar“, der eIDAS-Middleware und weiterer eID(AS)-Projekte zurückgegriffen werden.
• TICE versucht, optimale Lösungen im Spannungsfeld zwischen hohen Anforderungen an die UX auf der einen und Sicherheit und Datenschutz auf der anderen Seite zu finden. Der Ansatz verfolgt eine Wallet-Lösung mit einer Smartphone-App als zentralem Baustein für Millionen von Bürger:innen. Dabei wird vorrangig auf Open-Source-Komponenten und bereits existente Protokolle gesetzt.
• EEWA vom Cybersecurity-Unternehmen AUTHADA. Banken, Versicherer, Telekommunikationsanbieter oder auch eCommerceUnternehmen können mit AUTHADA ihre Kunden nach Wunsch online oder vor Ort sekundenschnell und gesetzeskonform über die elektronische Identität (eID) des Personalausweises identifizieren. Zertifiziert durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie nach ISO27001, erfüllt AUTHADA die höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen.

Logistik und Mobilität bilden die Basis für eine florierende Wirtschaft und Gesellschaft. In Anbetracht des demografischen Wandels, des abnehmenden Fachkräftebestands und der gleichzeitig hohen und wachsenden Anforderungen an den Personen- und Güterverkehr erscheint die Gestaltung der Mobilität der Zukunft als eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Unbemannte, weitestgehend manuell gesteuerte Fluggeräte sind heute schon eine wichtige Ergänzung in vielen Anwendungsbereichen wie der Lieferung von Waren, der Wartung von Industrieanlagen, der Vermessungstechnik oder auch bei der Brandwache und bei Rettungseinsätzen. Die Nutzung von Drohnen – ob privat oder kommerziell betrieben – steigt seit Jahren kontinuierlich an. Unbemannte Fluggeräte werden unsere Verkehrssysteme in Zukunft tiefgreifend verändern. Der sichere autonome Betrieb von Drohnen steht allerdings noch vor ungelösten Herausforderungen, gerade unter wechselnden Umwelteinflüssen und anderen Störfaktoren.
DIE CHALLENGE: DEMONSTRATION EINES AUTONOM FLIEGENDEN SYSTEMS BIS 25 KG MAXIMALGEWICHT, DAS OHNE MENSCHLICHES EINGREIFEN EINEN VORHER DEFINIERTEN PARCOURS AUCH UNTER EINFLUSS DIVERSER STÖRFAKTOREN SICHER BEWÄLTIGT.
Ziel ist es, ein System zu entwickeln, das völlig autonom verschiedene herausfordernde Hindernisse und Aufgaben bewältigen kann. Unterstützend können weitere autonome Systeme, z. B. am Boden, hinzugezogen werden.

AUFTAKT DER ZWEITEN STUFE
Im April 2024 hat die Expertenjury im Auftrag der SPRIND die Teilnehmer für die zweite und letzte Stufe des Funkens „Fully Autonomous Flight “ ausgewählt. Zehn Teams konnten sich qualifizieren und haben die Chance, sich beim großen abschließenden Drohnen-Race im September 2024 vor Branchenkennern und potentiellen Investoren zu präsentieren. Auf dem Weg dorthin stellt die SPRIND den Teams bis zu 80.000 EUR zur Verfügung. In Stufe 1 unterstützt die SPRIND die Teams mit bis zu 70.000 EUR.
Für die Challenge präsentiert AEROTATE zusammen mit der UAVDEV GmbH, die auf die Entwicklung von Flugsteuerungen spezialisiert ist, ein Konzept, das die Ausdauer der Drohne durch den Einsatz eines Bodenfahrzeugs optimiert.
• Das Team von PATHSTRIDER präsentiert einen Ansatz, der auf erprobten Technologien und konsequent umgesetzten Sicherheitskonzepten basiert. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige Drohne, die durch die Kombination verschiedener Sensortechnologien eine bemerkenswerte Navigationsleistung in GPS-abgeschirmten Umgebungen und durch spezielle Antriebslösungen batteriebasierte Flugzeiten im Stundenbereich ermöglicht.
• SIMON entwickelt KI-basierte Steuerungssysteme für autonome Anwendungen, die sich durch Adaptivität und Modularität auszeichnen. Mit ihrem Ansatz rücken sie Systeme mit einem bereits hohen Automatisierungsgrad weiter in Richtung Autonomie.
• Das Team um BEYOND VISION stellt ein modulares Drohnensystem vor, das mit einer Vielzahl von Sensoren und Kameras ausgestattet werden kann und so eine unerreichte Autonomie im Flug ermöglichen soll. Die eigens entwickelte Drohnensteuerung kann Missionen mühelos entwerfen, überwachen und analysieren – mit integrierten Funktionen wie Kartenerstellung, Fernsteuerung und umfassender Flughistorie.
• Das Team HYBRID AEROSPACE HYPOGRIFF ist auf die Entwicklung von Drohnen spezialisiert, die auch mit eingeschränkter Satellitennavigation und Funkkommunikation flugfähig sind. Im Rahmen des Funkens präsentieren sie ihren Quadrocopter „Hypogriff“, der eine präzise, autonome Nutzlastlieferung unter schwierigen Bedingungen zum Ziel hat.
• Die Gründer des norwegischen Start-ups AVIANT AS haben sich 2020 am Massachusetts Institute of Technology kennengelernt. Seitdem sind Lars Erik Fagernæs und sein Team zu Pionieren der VTOL-Technologie geworden.
Das Team von FLY4FUTURE, einem Spin-off der Technischen Universität Prag, verfolgt einen Multi-Drohnen-Ansatz. Dabei kommt ein eigens entwickeltes System zum Einsatz, das auf der autonomen Zusammenarbeit von Drohnen basiert.
• Das Team UBIQUITOUS um Prof. Uijt de Haag von der Technischen Universität Berlin setzt auf ein innovatives, duales Drohnensystem, das Aufgaben gemeinsam löst.
• Prof. Markus Ryll und sein AMI TEAM verfolgen einen Ansatz, der auf der Integration fortschrittlicher Navigation und intelligenter Bewegungsstrategien sowie der Nutzung zuverlässiger Steuerungssysteme und Künstlicher Intelligenz basiert.


FUNKE: TISSUE ENGINEERING
STUFE 0 1
TEAMS: 4
LAUFZEIT: 01. NOVEMBER 2023 – 31. AUGUST 2024

STUFE 02
URSPRÜNGLICH GEPLANTE LAUFZEIT: 01. SEP 2024 – 31. OKT 2024
STUFE 0 1
FUNKE: EUDI WALLET PROTOTYPES
STUFE 02
TEAMS: 6
LAUFZEIT: 17. MAI 2024 – 31. AUG 2024
STUFE 0 3
TEAMS: 2–9 TEAMS: 2–8
LAUFZEIT: 01. SEP 2024 – 30. NOV 2024
LAUFZEIT: 01. DEZ 2024– 30. JUN 2025

STUFE 01 STUFE 02
TEAMS: 13
LAUFZEIT: 01. FEB 2024 – 15. APR 2024
TEAMS: 9
LAUFZEIT: 16. APR 2024 – 31. OKT 2024
STUFE 01 STUFE 02
TEAMS: MAX. 14
LAUFZEIT: 01. NOV 2024 – 31. MAI 2025
TEAMS: MAX. 8
LAUFZEIT: 01. JUN 2025 – 31. NOV 2025


Der Ablauf einer SPRIND Challenge folgt einem Stufenmodell.
An die Bewerbungs- und Auswahlphase schließen sich mehrere Stufen an, auf denen denen die Teilnehmenden ihre innovative Idee maßgeblich voranbringen sollten.
Am Ende jeder Stufe gibt es eine weitere Auswahlrunde –die Anzahl der teilnehmenden Teams nimmt im Verlauf der Challenge ab.
So gibt SPRIND auch hochambitionierten Teams mit unkonventionellen Lösungen eine Chance auf Umsetzung, stellt sie kontinuierlich auf den Prüfstand und sorgt dafür, dass nur die besten Teams weiter von SPRIND finanziert werden.
Das ambitionierte Ziel einer SPRIND Challenge werden die meisten Teams nicht erreichen.
Deshalb ist es essentiell, das Potential der Teams und ihrer Konzepte regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und nur die vielversprechendsten Teilnehmer:innen weiter zu unterstützen
Hierfür bauen die SPRIND Challenges auf einen mehrstufigen Prozess, bei dem kontinuierlich Teams aus der Challenge ausscheiden.
So konzentrieren sich sowohl SPRIND als auch die Teams auf schnelle Lernprozesse und erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit.
DAS FEEDBACK UNSERER CHALLENGE TEAMS *

WIR HABEN ALLE CHALLENGE TEAMS
ANONYM NACH IHREM FEEDBACK GEFRAGT. DAS SIND IHRE ANTWORTEN.
WÜRDEST DU DICH NOCHMALS
FÜR DEINE CHALLENGE BEWERBEN?
① UNTERSTÜTZUNG UND NETWORKING
KONTINUIERLICHE UNTERSTÜTZUNG
DURCH DAS SPRIND-TEAM
Die Befragten schätzten die offene Kommunikation, die schlanken Prozesse und das unterstützende Umfeld, das das SPRIND-Team bietet.

MÖGLICHKEITEN ZUR VERNETZUNG
Viele betonten den Wert der Vernetzung innerhalb des Ökosystems und der Begegnung mit erfahrenen Unternehmern, Mentoren und Investoren. Diese Vernetzung wurde als wichtiger Vorteil angesehen, der Verbindungen schafft und Türen für weitere Möglichkeiten öffnet.
② SCHNELLIGKEIT UND EFFIZIENZ
SCHNELLE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
UND UMSETZUNG
Gelobt wurde der schnelle und effiziente Entscheidungsfindungsprozess, der es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Projekte im Vergleich zu anderen Finanzierungsprogrammen schnell zu starten.
NIEDRIGER VERWALTUNGSAUFWAND
Im Vergleich zu nationalen und EU-Förderungen waren die administrativen Anforderungen minimal, so dass sich die Teilnehmenden auf ihre Wissenschaft und ihr Geschäft konzentrieren konnten.
③ AMBITIONIERTE HERAUSFORDERUNGEN UND FLEXIBILITÄT
HOHE ZIELE UND HERAUSFORDERUNGEN
Die ehrgeizigen Herausforderungen ließen die Teilnehmer aus ihrer Komfortzone heraustreten, förderten die Innovation und ermutigten sie, das fast Unmögliche zu versuchen.
FLEXIBLE FINANZIERUNG
Die flexible Finanzierung ermöglichte schnelle Anpassungen an neu auftretende Probleme, was bei konventioneller Finanzierung oft nicht möglich ist.
④ COACHING UND MENTORING
EINSCHLÄGIGES COACHING UND MENTORING
Das von SPRIND angebotene Coaching und Mentoring waren entscheidend für die Geschäftsentwicklung der Teilnehmer und verbesserten die Gesamtqualität ihrer Programme.
* KI-GENERIERTE ZUSAMMENFASSUNGEN ALLER FREITEXT-ANTWORTEN
Die Textblöcke auf dieser und der nächsten Doppelseite wurden mit ChatGPT 4.0 über Microsoft Copilot erstellt.

vermutlich schon mit kleinen Änderungen
HÄTTEST DU DEIN PROJEKT DURCH ALTERNATIVE ÖFFENTLICHE ODER PRIVATE QUELLEN FINANZIEREN KÖNNEN? wahrscheinlich nicht oder nur mit großen Veränderungen
07
① EIN ENGER ZEITPLAN UND DRUCK
HOHER DRUCK AUFGRUND DES ENGEN ZEITRAHMENS
Der straffe Zeitplan erzeugte einen erheblichen Druck auf die Teams, was es schwierig machte, neues Personal einzustellen und in notwendige Nebenaspekte wie Toxizität oder Lead-Optimierung zu investieren.
② AUSWAHLKRITERIEN UND KPIS
UNKLARE AUSWAHLKRITERIEN
Die Kriterien für das Vorrücken in weitere Phasen waren nicht immer klar, was zu einiger Verwirrung führte.

UNZUREICHEND DEFINIERTE KPIS
Die KPIs für den gesamten Prozess waren nicht klar definiert, insbesondere für vorund nachgelagerte Materialien, was in einigen Fällen zu fragwürdigen Entscheidungen führte.
ANDERE ERWÄHNENSWERTE PUNKTE
GROSSARTIGE VERANSTALTUNGEN UND NETWORKING
Die von der SPRIND organisierten Veranstaltungen fanden großen Anklang.
KONSTRUKTIVER ANSATZ UND UNTERSTÜTZUNG
Der konstruktive Ansatz aller SPRIND-Mitarbeitenden und die verschiedenen Vernetzungsmöglichkeiten wurden sehr geschätzt.
WARTEN AUF DEN NÄCHSTEN FÖRDERAUFRUF Einige Befragte warten noch immer auf die Ankündigung der versprochenen Aufforderung zur Weiterfinanzierung.
INSGESAMT WIRD IN DEN RÜCKMELDUNGEN DER GROSSE NUTZEN DER SPRINDUNTERSTÜTZUNG, DER VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN UND DER FLEXIBLEN FINANZIERUNG
HERVORGEHOBEN, ABER AUCH AUF VERBESSERUNGSWÜRDIGE BEREICHE WIE ZEITDRUCK UND KLARERE AUSWAHLKRITERIEN HINGEWIESEN.

OFFENHEIT
Was zählt, ist, das Ziel der Challenge zu erreichen, der Weg dahin ist den Teams überlassen. Diese Offenheit gegenüber technologischen Ansätzen, institutionellem Hintergrund oder geografischer Herkunft ermöglicht die Einbindung der größten Talente – unabhängig davon, woher sie kommen. Nicht weniger braucht es zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit.
UMSETZUNG
Anträge lösen keine Probleme, Innovationen tun es. Daher ist das Bewerbungsverfahren so schlank und unbürokratisch wie nur möglich gestaltet. Eine Teilnahme an den Challenges ist so auch ohne Förderantrags-Know-how möglich. Damit können sich alle Beteiligten auf das Wichtigste konzentrieren: die Entwicklung der nächsten Sprunginnovation.
ÖKOSYSTEM
Die Welt verändert sich nicht im Alleingang. Die Teams einer Challenge bilden mit ihrer gemeinsamen Mission den Kern sich entwickelnder Ökosysteme um neue Technologien und Märkte. SPRIND selbst gestaltet diese Ökosysteme aktiv mit.

DR. THOMAS RAMGE IST TECHNIKSOZIOLOGE UND HAT MEHR ALS 15 PREISGEKRÖNTE SACHBÜCHER VERÖFFENTLICHT.
ER DENKT, SCHREIBT UND SPRICHT AN DEN SCHNITTSTELLEN VON TECHNOLOGIE, ÖKONOMIE UND GESELLSCHAFT.
ALLE 14 TAGE INTERVIEWT ER IM SPRIND-PODCAST NERDS MIT MISSION.

WIE TICKEN SPRUNGINNOVATOR:INNEN? EMPIRISCHE STUDIEN HIERZU GIBT ES KAUM. ABER IM SPRIND-PODCAST ERHEBEN WIR ZUMINDEST NÄHERUNGSWERTE. Warum wurdest Du Wissenschaftler:in? Wie bist Du auf Deine grundlegende Entdeckung gestoßen? Und wie schaffst Du es nun, aus Deiner wissenschaftlichen Erkenntnis eine radikal bessere Lösung zu schaffen, die auch im Markt erfolgreich ist? Das sind drei Grundfragen, die ich unseren Gästen im SPRIND-Podcast regelmäßig stelle. Mein Ziel ist es, die Sprunginnovator:innen am Mikro ins Plaudern zu bringen, natürlich auch über ihre Innovation und die Technologie, aber vor allem über sich selbst, ihre Motivation, wo sie ihre Stärken und Schwächen sehen, was sie frustriert und was sie glücklich macht. Intern bei der SPRIND nennen wir die radikalen Innovator:innen „HiPos“. Das hat nichts mit Nilpferden zu tun, sondern steht für „High Potentials“. Leider gibt es meines Wissens keine große Studie, welche die Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale von potentiellen Sprunginnovator:innen systematisch erkundet. In unserem Podcast sammeln wir aber zumindest anekdotische Evidenz zum Psychogramm der HiPos. Hochintelligent sind sie alle. Selbstverständlich können sie als begabte Wissenschaftler:innen abstrakt und kombinatorisch denken. Aber das scheinen uns eher Hygienefaktoren zu sein. Die Gespräche im Podcast, Tiefeninterviews im Zuge der Bewerbungsgespräche der SPRIND und auch die biografische Literatur zu den großen Erfinder:innen der Geschichte lassen auf mindestens fünf weitere Persönlichkeitsmerkmale bzw. Verhaltensweisen in hoher Dosis schließen.*
⑤ KOMPETENZEN UND PERSÖNLICHKEITSMERKMALE VON HIPOS:
❶ EXTREMES INTERESSE
HiPos entwickeln oft bereits in ihrer Jugend ein extremes Interesse an einem Spezialgebiet. Für andere scheint dieses Interesse oft die Grenze zur Obsession zu überschreiten. Befragt man Sprunginnovator:innen nach ihrem extremen Interesse mit der Bitte um Selbstreflexion, werden drei Muster erkennbar. Erstens können die so klugen HiPos meist nicht begründen, warum sie sich ausgerechnet für ihr Spezialgebiet so stark interessieren. Das kam halt so. Zweitens sehen sie die frühe Spezialisierung als Voraussetzung dafür an, dass sie auf ihrem Gebiet erfolgreich wurden. Und drittens mussten sie insbesondere in der Schule ihre frühe Spezialisierung oft verteidigen und wurden aufgefordert, andere Fächer oder Interessen nicht zu vernachlässigen. Dagegen haben sie sich dann erfolgreich gewehrt. Zum Glück für den technischen Fortschritt.
← Ausführliche Informationen zum Psychogramm der HiPos finden Sie im aktuellen Buch von Thomas Ramge und Rafael Laguna „ On the Brink of Utopia – Reinventing Innovation to Solve the World’s Largest Problems “ auf den Seiten 80 bis 99. Das E-Book gibt es kostenlos zum Download auf der Webseite von MIT Press.
❷ BISS/GRIT
Die US-amerikanische Neurowissenschaftlerin Angela Duckworth hat das Konzept des „Grit“ in der Psychologie popularisiert. Diverse Studien der Arbeitswissenschaft zeigen, dass Biss und Ausdauer allgemein einer der wichtigsten Faktoren für beruflichen Erfolg sind. Für Sprunginnovator:innen scheint dies in noch stärkerem Maße zu gelten. Denn ihre Forschung und auch ihre Ausgründungserfahrungen sind geprägt von Rückschlägen. Warum? Weil jede:r Sprunginnovator:in einen wissenschaftlichen Konsens anzweifelt und dafür von den Kolleg:innen in der Regel stark negatives Feedback bekommt. Der Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell ist ein Musterbespiel hierfür. Kaum hatte Stefan seine bahnbrechende Entdeckung zur Beugungsgrenze von Lichtwellen in der Mikroskopie gemacht, bekam er in Deutschland keine Anschlussfinanzierung für seine Forschung. Er ging dann nach Finnland. Die Bedenken der wissenschaftlichen Zweifler zu überwinden, erfordert besondere Hartnäckigkeit. Und Ausgründungen aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb erst recht. Stefan ist heute nicht nur Direktor von zwei Max-Planck-Instituten, sondern auch der Gründer und Inhaber einer der Weltmarktführer für STED-Mikroskope, die auf seiner Entdeckung basieren.
❸ NEUGIER UND OFFENHEIT
Der Treibstoff des technischen Fortschritts ist Wissen. Genauer: geteiltes Wissen. Unsere Gäste im Podcast wirken im doppelten Sinne „neu-gierig“. Sie wollen als radikale Innovator:innen natürlich Neues in die Welt bringen. Aber sie sind auch gierig nach neuen Ideen und Informationen, die ihnen und ihrer Innovation nützen. Die Neugier –und die mit ihr verbundene Offenheit – unterliegen dabei einer interessanten Ambivalenz. Auf der einen Seite müssen die HiPos die konstruktiven Impulse von außen permanent aufnehmen. Zugleich aber dürfen sie sich nicht zu stark von den Zweifeln anderer beirren lassen. Auf uns wirken Sprunginnovator:innen daher oft in der Sache zugleich „offen“, jedoch bezogen auf die eigene Grundidee extrem „selbstbewusst“.
❹ INSPIRIEREN
Gelingt ein großer Sprung in Wissenschaft und Technik, stehen oft einzelne Personen im Mittelpunkt: Marie Curie oder Robert Bosch, Jennifer Doudna oder Elon Musk. Wir Menschen lieben Geschichten mit Heldinnen und Helden. Wer einen großen Innovationsprozess einmal aus der Nähe beobachten durfte, weiß: Innovation ist ein Teamsport. Ein differenzierter Blick ist hilfreich. Die sichtbaren Innovationshelden haben oft die Fähigkeit, andere mit der Begeisterung für die eigene Idee anzustecken. Sie sind oft Rollenmodelle für moderne Führung. Sie inspirieren und ermöglichen jedem Einzelnen und hochmotivierten Teams, das Beste aus sich herauszuholen –im Sinne des gemeinsamen Ziels. Eitelkeit soll derweil ein Phänomen sein, das auch schon bei HiPos beobachtet wurde.
❺ WIRKUNG
Grundlagenforscher:innen begründen ihr tiefes Interesse an Erkenntnis meist mit ihrem Interesse an Erkenntnis. Der Zirkelschluss ist in diesem Fall total fein. Mit dieser Haltung lassen sich Nobelpreise gewinnen. HiPos aber wollen mit ihrem Wissen eine Wirkung in der physischen Welt erzielen und sich dabei nicht ausschließlich auf andere verlassen. Als Wissenschaftler:innen machen sie eine Entdeckung, welche die theoretische Möglichkeit einer radikal besseren Lösung in sich trägt. Und dann gründen sie ein Start-up, das mit praktischer Wucht das Neue in die Welt bringt.
MANUEL HÄUSSLER
03.06.2024
Kann Bioplastik (fast) so gute Materialeigenschaften haben wie Polyethylen? Wie ließen sich Kunststoffe ohne Erdöl in Megatonnen bezahlbar herstellen? Und was hieße das für die Chemieindustrie und die Kreislaufwirtschaft?
THORSTEN ZANDER
20.05.2024
Wann kommt die nächste Generation von Hirn-Computer-Schnittstellen? Können KI-Systeme dann Gedanken lesen? Und wie verändert sich das Verhältnis von Mensch und Maschine, wenn künstliche Intelligenz uns besser versteht?
CLAUDIO HASLER
06.05.2024
Was sind Voice Biomarker? Welche Erkrankungen lassen sich mit Stimmbildern diagnostizieren? Und wann werden KI-getriebene Stimm-Diagnose-Systeme in Kliniken in den Einsatz kommen?
LUKAS PORZ
22.04.2024
Was ist blaues Licht? Warum lassen sich damit Keramik, Stahl und andere Werkstoffe besonders energieeffizient erhitzen? Und wie könnten LEDs viele großindustrielle Produktionsprozesse dekarbonisieren?
THORSTEN LAMBERTUS
Was genau sind eigentlich tiefe Technologien? Warum haben Innovationsökosysteme für Deep-Tech eine noch wichtigere Bedeutung für andere Innovationsfelder? Und wie heben wir wieder mehr Schätze der Wissenschaft für radikale Innovationen?
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA
Was verändert sich für die SPRIND mit dem sogenannten SPRIND-Freiheitsgesetz? Wie können die nationalen Innovationsagenturen in Europa besser zusammenarbeiten?
GUIDO HOUBEN 04.03.2024
L ässt sich mit Transmutation das Atommüllproblem lösen? Wie funktioniert das Verfahren? Und könnte der Kernkraftaussteiger Deutschland zum Vorreiter beim Recycling von radioaktivem Müll werden?
CYRIAC ROEDING
Wie lässt sich Krebs deutlich früher erkennen? Könnten künstliche Biomarker das Immunsystem auf Krebszellen hetzen? Und warum ist es in den USA so viel einfacher, ein Biotech-Unternehmen zu gründen?
DIANA KNODEL 05.02.2024
Können Roboter gute Lehrer sein? Warum nutzen menschliche Lehrer die Korrektur-KI so gerne? Und bremst der Datenschutz die Innovation an deutschen Schulen aus?
VERONIKA GRIMM
M acht Knappheit erfinderisch? Wie hängen Innovation und Produktivitätswachstum zusammen? Und welches Marktdesign braucht eine grüne Wasserstoffwirtschaft?
CARL
Was ist Neugier? Was fördert und was tötet Neugier? Und welche Rolle spielt die Gier nach dem Neuen im Innovationsprozess?
CASEY HANDMER 04.12.2023
How can you bring down the costs of direct air capture and electrolyzers for hydrogen? What happens if you turn CO 2 and H 2 into green natural gas? And why is a former NASA engineer just doing this to shake down the fossil fuel industry?
FRANK WIPPERMANN
L assen sich Kameralinsen in Smartphones noch deutlich verbessern? Wie können Massenmarkt-Linsen mit neuen Herstellungsprozessen wieder in Europa hergestellt werden? Und wie innovativ ist der Optikstandort Jena noch?
ANDREAS OSCHLIES
W ie lässt sich massenhaft CO 2 aus der Atmosphäre heraussaugen? Welche Rolle spielen die Weltmeere als langfristige CO 2 -Speicher? Und ist Geoengineering unser letzter Strohhalm?
DANIELA BEZDAN 23.10.2023
Was ist Space-Biology? Warum könnten medizinische Durchbrüche für uns Erdlinge ausgerechnet aus Weltraumstationen kommen? Und züchten Space-Biologen extraterrestrisches Leben?
WOLFRAM ZIMMERMANN
L assen sich Herzen (bzw. Herzmuskel) reparieren? Welche Rolle spielen dabei pluripotente Stammzellen? Und wie könnte die gleiche Technologie auch noch massenhaft künstliches Fleisch produzieren?
AMELIE REIGL
Was ist künstlich gezüchtete Haut? Wie lassen sich mit ihr Tierversuche drastisch reduzieren? Und was kann die Wissenschaftskommunikation von TikTok-Influencern lernen?
HENRIK JUNGABERLE
11.09.2023
Können Psychedelika Depressionen und Traumata heilen? Welche Gefahren sind mit bewusstseinserweiternden Wirkstoffen in der Psychotherapie verbunden? Und kann Deutschland bei der Zulassung bei Psychedelika zum Vorreiter werden?
PHILIPP STRADTMANN
28.08.2023
W ie schmeckt Fleisch aus der Petrischale? Wird Gen-Editierung die pflanzenbasierte Ernährungsrevolution beschleunigen?
PATRICK ROSE
17.07.2023
Welche Innovationen wird die synthetische Biologie in den kommenden zehn Jahren hervorbringen? Worum geht es in der neuen SPRIND Challenge „Circular Biomanufacturing“? Und was hat das alles mit Star Trek und Jurassic Park zu tun?
ELISABETH ZEISBERG
03.07.2023
W ie gut sind wir auf die nächste Pandemie vorbereitet? Wie könnte eine Plattform für antivirale Medikamente entstehen? Und welche Rolle spielt dabei die Genschere CRISPR?
GERNOT WAGNER
19.06.2023
Können wir nicht einfach die Sonne dimmen? Welche Folgen hätte solares Geoengineering?
MARTIN CHAUMET 05.06.2023
Wie baut man das größte Windrad der Welt? Wie viel stärker bläst der Wind in 300 Metern Höhe? Und wo ließen sich Höhenwindräder aufstellen?
VINCE EBERT
22.05.2023
Wann ist Wissenschaft witzig? Welche Rolle kann Humor in der Wissenschaftskommunikation spielen? Und wie bleiben wir in der Klimadebatte trotz allem heiter?
WOLFGANG DRECHSLER 08.05.2023
W ie werden Staaten „unternehmerisch“? Welche Rolle spielt dabei eine funktionstüchtige Bürokratie? Und wie würde Max Weber heute auf die deutsche Verwaltung blicken?
NICOLA WINTER
24.04.2023
W ie wird man Astronautin? Welche Kompetenzen bringen Kampfpilot:innen hierfür mit? Und was heißt es eigentlich, im Raumschiff „teamfähig“ zu sein?
KLAUS WAGENBAUER 24.04.2023
Was sind DNA-Nanoschalter? Wie lassen sich mit ihnen Krebszellen stoppen? Könnte der Ansatz die Onkologie revolutionieren?
MARIELLA BENKENSTEIN UND MARIT KOCK
27.03.2023
Was ist eine Redox-Flow-Batterie? Wie kann sie die Kosten für die Speicherung von Energie radikal senken?
CHRISTIAN HILDEBRAND
13.03.2023
Warum haben wir Mitleid mit Robotern? Wie verändern große Sprachmodelle wie ChatGPT die Mensch-Maschine-Interaktion? Und mit welchen Ansätzen fördern Entwickler:innen das Vertrauen in neue Technologien?
ANIA MUNTAU 27.02.2023 #50
Was läuft bei angeborenen Stoffwechselkrankheiten in den Zellen schief? Wie lassen sich Wirkstoffe gegen diese meist seltenen Krankheiten in Serie entwickeln? Und wie können Biomedizin-Start-ups und Big Pharma besser zusammenarbeiten?
DIETMAR HARHOFF
13.02.2023
Leben wir in überdurchschnittlich innovativen Zeiten? Brauchen wir eine neue Forschungsdisziplin „ Fortschrittswissenschaft“?
Und wie steht es um die Rahmenbedingungen hochinnovativer Unternehmen in Deutschland?
SEBASTIAN THRUN 30.01.2023
W ie gelang Google der Durchbruch beim autonomen Fahren? Ist das Silicon Valley noch innovativ?
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA 16.01.2023
Wo steht die SPRIND drei Jahre nach der Gründung? Wie entwickeln sich Projekte und Challenges? Auf welche Technologietrends schaut die Agentur im kommenden Jahr mit besonderer Aufmerksamkeit?
ADRIANA GROH 12.12.2022
Was ist technologische Souveränität? Welche Rolle spielt dabei Open-Source-Software? Sollte der Staat die Entwickler:innen von offenen digitalen Systemen finanziell unterstützen?
CHRISTIAN VOLLMANN
Was ist grünes Methanol? Wie ist es einem kleinen Start-up gelungen, die Methanol-Katalyse zu revolutionieren? Und warum könnten wir uns mit einer Methanol-Ökonomie komplett aus der Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas befreien?
MAREN URNER 14.11.2022
Warum nehmen wir die Welt schlechter wahr, als sie ist? Wie können wir den Negativitätsbias unseres Steinzeithirns überwinden?
MARKUS ANTONIETTI 31.10.2022 #43
Was ist nachhaltige Chemie? Wann kommen endlich Durchbrüche in der Batterieentwicklung? Und warum brauchen wir ein „Tinder der Innovation“?
STEFAN HELL 17.10.2022
W ie widerlegt man ein wissenschaftliches Dogma? Welche Charaktereigenschaften verbinden Sprunginnovator:innen?
Und warum hat eine kleine deutsche Schule in Rumänien gleich zwei Nobelpreisträger:innen hervorgebracht?
JAN BUSS 04.10.2022
W ie funktioniert die Datenbank der Zukunft? Was hat ihr Aufbau mit dem menschlichen Gehirn zu tun? Und welche neuen Anwendungen werden möglich, wenn es keine Datensilos mehr gibt?
MIRCO BECKER 19.09.2022 #40
Bauen Roboter im Jahr 2050 unsere Häuser? Wie werden Stoffkreisläufe die Bauwirtschaft verändern? Und kann KI die Entwürfe von Architekt:innen kreativer machen?

JACOB BEAUTEMPS möchte junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern. Auf seinem YouTubeKanal BREAKING LAB erklärt er neue Technologien aus einer wissenschaftlichen Perspektive. In Zusammenarbeit mit SPRIND berichtet er bei Breaking Lab auch regelmäßig über die Projekte und Challenges der SPRIND. Warum ihn Innovationen so faszinieren, erklärt der 30Jährige im Interview.
@BreakingLab � 635.000 ABONNENTEN � 735 VIDEOS
JACOB, WORUM GEHT ES IN DEINEN VIDEOS? Um die Zukunft und die Gegenwart: Ich versuche, neue Entwicklungen und Technologien wissenschaftlich einzuordnen und dabei tiefer zu gehen, als es normalerweise in den Nachrichten möglich ist. Ich schaue also, was wirklich hinter neuen Innovationen steckt.
WELCHE WISSENSCHAFTLICHEN THEMEN INTERESSIEREN DICH AM MEISTEN UND WARUM?
Am meisten interessieren mich Innovationen, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Also alles rund um das Thema Energiegewinnung. Aber auch die Themenfelder Künstliche Intelligenz oder auch Ernährung und Gesundheit sind wichtig. Besonders spannend finde ich Themen immer dann, wenn man merkt, okay, das ist was, das unser Leben besser machen könnte. Das macht total Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, weil man dabei einen Einblick bekommt, was die Zukunft Positives bringen kann.
WIE SCHAFFST DU ES, KOMPLEXE WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE VERSTÄNDLICH ZU ERKLÄREN?
Bevor man ein Thema erklären kann, muss man es selbst wirklich verstanden haben. Dabei hilft mir einerseits mein Physikstudium und andererseits meine Berufserfahrung. Mit vielen Themen beschäftige ich mich schon sehr lange. Oft sind die Ansätze ähnlich, und dann geht es um die Frage: Was genau wird jetzt anders gemacht? Forschende sind oft so tief in ihrem Thema, dass es ihnen schwerfallen kann, Komplexes verständlich zu erklären. Es hilft enorm, sich zu fragen: Welchen Wissensstand hat mein Publikum? Dieses Bewusstsein fürs Publikum ist entscheidend.
APROPOS PUBLIKUM … WER SCHAUT DEINE VIDEOS BESONDERS GERNE? Die meisten, die meine Videos sehen, sind zwischen 14 und 29 Jahre alt. Viele haben keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sind aber naturwissenschaftlich interessiert. Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die mir sagen: „Du hast mir da etwas aufgezeigt, deine Videos haben meine Studien- oder Berufswahl beeinflusst.“ Breaking Lab hat also einen echten Einfluss auf junge Menschen, und ich freue mich natürlich, wenn meine Videos Menschen motivieren, selbst an Innovationen zu forschen.
SEIT 2022 HAST DU EINE KOOPERATION MIT DER SPRIND – WARUM?
Weil es das perfekte Match ist. Es gibt so viele tolle Innovationen hier in Deutschland und diese zusammen mit der SPRIND sichtbar zu machen, macht mir unfassbar viel Spaß. Ich war schon bei SPRIND-Startups, bei denen sich dann herausgestellt hat, dass dort Leute arbeiten, die erst durch Breaking Lab auf das jeweilige Unternehmen aufmerksam geworden sind. Auch viele Bewerbungen für die SPRIND Challenges kommen durch Breaking Lab zustande. Und auch an den hohen Reichweiten der Videos sieht man den Erfolg der Kooperation. Mich persönlich hat die Zusammenarbeit mit SPRIND ganz maßgeblich zu meinem Buch „Unsere Zukunft neu denken“ inspiriert, das Anfang 2025 erscheinen wird. Darin geht es unter anderem um einige der SPRIND-Innovationen und die Köpfe dahinter.
WAS FASZINIERT DICH AN DER SPRIND GANZ BESONDERS?
Als ich Rafael Laguna de la Vera kennengelernt habe, hat er gesagt: “Wir sind zwar eine Behörde, aber wir laufen anders.” Prozesse in Deutschland sind meist sehr langsam und überbürokratisiert. Mich fasziniert, dass die SPRIND wirklich anders ist und viel Power in wichtige Themen bringt – nicht nur finanziell, sondern auch durch die vielfältige Betreuung und Unterstützung der verschiedenen Teams. Rafael spielt dabei eine wichtige Rolle, weil er den Innovationsstandort Deutschland versteht und weiß, was Innovator:innen brauchen.
WELCHE SPRIND-KOOPERATIONSVIDEOS FINDEST DU PERSÖNLICH BESONDERS SPANNEND?
Ich finde wirklich alle grandios. Aber besonders aufregend war es für mich, als ich für das Video zum höchsten Windrad der Welt einen Windmessmast hochklettern durfte. Das war nicht nur für mich persönlich toll, sondern das Video hat wirklich viele Leute begeistert. Im ersten Moment denkt man, das höchste Windrad der Welt wird bestimmt in China oder in den USA gebaut, aber es wird in Deutschland stehen. Vielleicht sollten wir manchmal ein bisschen stolzer auf das sein, was in unserem Land passiert: auf die coolen Innovationen, die hier entstehen und den Durchbruch schaffen!
SPRIND FINANZIERT IDEEN UND PROJEKTE, DIE DIE WELT BESSER MACHEN SOLLEN. GIBT DIR DAS SELBST HOFFNUNG, DASS WIR DIE GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER ZEIT BEWÄLTIGEN WERDEN?
Ich bin grundsätzlich unglaublich optimistisch und halte es mit Karl Popper, der gesagt hat, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Die Projekte der SPRIND bestätigen das für mich. Alle Innovatorinnen und Innovatoren, die ich getroffen habe, waren Optimisten und überzeugt, dass ihre Ideen die Welt verbessern können. Es gibt so viele tolle Ideen, wenn wir uns darauf einlassen und sozusagen optimistisch mitgehen. Dann können wir wirklich was bewegen.
„PROZESSE
NEUGIERIG GEWORDEN? EINFACH SCANNEN UND STREAMEN:
SO DRUCKT DIESER 3D-DRUCKER MENSCHLICHES GEWEBE!
DIESE FÜNF TECHNOLOGIEN MACHEN CO2ENTFERNUNG WIRTSCHAFTLICH!
LIVESTREAM: FUSIONSENERGIE START-UP + TEST EINES MODERNEN ANALOGCOMPUTERS VIDEO
MIT RAFAEL LAGUNA DE LA VERA, HEIKE FREUND UND PROF. BERND ULMANN
LIVESTREAM: EIN MITTEL GEGEN ALLE VIREN? SECHS NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE MIT PROF. HELMUT SALIH, PROF. HENDRIK DIETZ UND SIGRID KOETH
WIESO IST ES SO SCHWER, KREBS ZU HEILEN? STELLT EURE FRAGEN LIVE AN DIE FORSCHENDEN!
SMARTE MICROBUBBLES: NIE WIEDER SCHMUTZIGES WASSER?





Wer kann mit seiner Innovation neue Investoren:innen überzeugen? Rund 200 VC-Fonds aus der ganzen Welt waren angereist. In der Location „Alte Münze“ in Berlin lernten sie insgesamt 61 Start-ups aus dem SPRIND-Portfolio kennen, die Einblicke in ihre potentiellen Sprunginnovationen gaben. Auch die teilnehmenden Investor:innen stellten sich den Teams in Pitches vor und gaben einen Überblick zu ihrem Investmentfokus, Ticket Size und Value Add. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat zudem in einem ausführlichen Gespräch mit Rafael Laguna de la Vera noch Einblicke in die staatliche Unterstützung und Relevanz von Start-ups gegeben.

“A
– JACQUELINE CAMPBELL, WILBE





“LAST TIME I FOUND ALL MY INVESTORS FROM MY SEED-ROUND AT THIS EVENT.”
–
→ Die deutsche und europäische Forschung bietet enormes Potential für Wirtschaft und Gesellschaft. Getrieben durch staatliche Förderung und private Frühphasen-Investitionen werden in den nächsten Jahren viele weitere aussichtsreiche Deep-TechStart-ups entstehen.
→ Deep-Tech-Start-ups nutzen proprietäre Technologien und sichern sich damit einen weltweiten Wettbewerbsvorteil. Damit entsteht die Chance, eine neue Generation an Weltmarktführern aus Deutschland hervorzubringen, die einen wesentlichen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten und maßgeblich zur europäischen technologischen Souveränität beitragen können.
→ Deep-Tech-Start-ups benötigen in der Regel erhebliche Summen an Wagniskapital, um eine schnelle und erfolgreiche Etablierung am Markt zu ermöglichen. Diese Finanzierungssummen werden bisher kaum von europäischen Investoren bereitgestellt. Stattdessen sichern sich oft außereuropäische Investoren Einfluss durch großvolumige Investments. Das betrifft besonders Sprunginnovationen, die bereits für die Technologieentwicklung viel Kapital benötigen.
→ Das mangelnde europäische Angebot an Wachstumskapital führt dazu, dass Unternehmen vorzeitig in andere Teile der Welt verkauft werden oder ins Ausland abwandern. Der für Deutschland angestrebte Innovationsschub kann nur mit einem geschlossenen Finanzierungskreislauf erreicht werden, weshalb dringend Finanzierungsangebote für großvolumige Finanzierungsrunden geschaffen werden müssen.
→ Bisher fokussieren sich öffentliche Förderung und Wagniskapitalangebote fast ausschließlich auf frühphasige Start-ups und schaffen es hier, die Finanzierungslücke zu schließen. Es mangelt aber an Initiativen, die disruptive Innovationen finanzieren, deren Geschäftsmodelle noch nicht abschließend erprobt sind und die gleichzeitig großvolumige Investitionen im hohen zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich tätigen können.
→ Insbesondere Deep-Tech-Start-ups im Bereich der Ingenieurwissenschaften haben große Schwierigkeiten, ihre sogenannten First-of-a-Kind-Anlagen – also erste große Anlagen zur Demonstration der Innovation – zu finanzieren. Für den kapitalintensiven Anlagenbau müssen Projektfinanzierungen, die Wagniskapital, Kredite und öffentliche Fördergelder kombinieren, strukturiert werden. Auch viele Startups aus Pharmazie und Biotechnologie kämpfen mit dem Mangel an europäischem Kapital.
→ Die SPRIND schlägt daher den Aufbau eines Investitionsfonds zur Kapitalisierung von Deep-TechStart-ups vor – den D-CATALYST. Der D-CATALYST soll vorwiegend in hochinnovative Deep-Tech-Startups mit hohem Kapitalbedarf investieren und damit den Mangel an europäischem Kapital kompensieren. Der Fonds soll als Katalysator für neue europäische Technologie-Champions einen bedeutenden volkswirtschaftlichen Beitrag leisten.
③ D-CATALYST: FREIHEIT UND BÜROKRATIEVERZICHT ALS ERFOLGSVORAUSSETZUNG
→ Um erfolgreich agieren zu können, benötigt der D-CATALYST Freiheitsgrade, wie sie teilweise schon für die SPRIND gelten. Eine Ansiedlung des D-CATALYST unter dem Dach einer der bereits bestehenden Organisationen öffentlicher Förderung würde Synergiepotentiale heben und Overheads einsparen. Das Fondsmanagement, bestehend aus Personen mit substanzieller Gründungs- bzw. Investitionserfahrung, muss mit hoher unternehmerischer Verantwortung Entscheidungen zu risikoreichen Wagniskapitalinvestitionen treffen dürfen. Ein Aufsichtsrat soll grundlegende Entscheidungen beaufsichtigen und die Einhaltung der strategischen Ausrichtung betreuen.
Darüber hinaus soll es keine politischen beziehungsweise ministeriellen Einflussnahmen oder Genehmigungsvorbehalte bezüglich der Investitionsentscheidungen geben.
→ Der D-CATALYST muss durch ein wissenschaftlich-technisch und wirtschaftlich exzellentes Team geführt werden, um qualifizierte, risikobewusste Investitionsentscheidungen treffen zu können. DeepTech-Start-ups bieten die Möglichkeit, attraktive Renditen zu erwirtschaften, dennoch muss bei Investoren und Aufsichtsrat eine Akzeptanz für die im Wagniskapitalmarkt übliche Abschreibung einzelner Investments bestehen. Um die notwendigen Expertinnen und Experten zu gewinnen, ist ein Verzicht auf das Besserstellungsverbot unabdingbar.
QUELLE: CO2-PREIS
→ Der CO2-Preis ist ein hervorragendes, zielgerichtetes Steuerungsinstrument, um den Umstieg von fossiler auf CO2-arme Technologie zu incentivieren. Parallel müssen fortlaufend Innovationen in den Bereichen Energie und Umwelt entwickelt werden, die langfristig die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern.
→ Die Einnahmen aus dem CO2-Preis auf der Grundlage des nationalen Brennstoffemissionshandels und des reformierten europäischen Emissionshandelssystems ETS I und zukünftig ETS II sollen grundsätzlich den Bürgern zugutekommen. Dafür sollte für einen langfristigen und gesamtgesellschaftlich optimalen Effekt ein kombinierter Ansatz aus den bisher vorgesehenen unmittelbaren Auszahlungen und – neu – zukunftsgerichteten Investitionen umgesetzt werden. Investitionen in innovative Wachstumsunternehmen im Bereich der grünen Technologien würden dazu beitragen, neue Weltmarktführer aus Europa zu schaffen und die CO2-Neutralität bis 2045 zu erreichen.
→ Hierfür schlagen wir vor, ein Viertel der aus dem CO2-Preis erzielten Einnahmen in den D-CATALYSTFonds anzulegen und gezielt in Wachstumsunternehmen zu investieren, um sowohl wirtschaftliche als auch klimapolitische Zielsetzungen zu erreichen. Auch andere bzw. zusätzliche staatliche Finanzierungsquellen für den D-CATALYST sind möglich, z. B. das Kapitalstockbasierte Generationenkapital oder das Sondervermögen.
⑤ HEBELWIRKUNG DURCH PRIVATE
INVESTITIONEN
→ Der staatliche Kapitalstock aus den Einnahmen des CO2-Preises und / oder anderen Instrumenten kann durch die Öffnung des D-CATALYST für privates Kapital erheblich erweitert werden. Ein professionell und unbürokratisch agierender D-CATALYST mit einer kritischen Masse an staatlicher Finanzierung wird in der Lage sein, privates Kapital zu attrahieren.
→ Bisher sind in Deutschland, gerade im Vergleich zu den USA, klassische Kapitalsammelstellen wie Lebensversicherer und Pensionsfonds nur zu einem geringen Anteil in der Assetklasse Venture Capital engagiert. Erste Modelle wie der Wachstumsfonds Deutschland zeigen aber, dass ein grundsätzliches Interesse aufseiten dieser Kapitalmarktakteure besteht und bei hinreichender Fondsgröße und Flexibilität Investitionen getätigt würden. Angemessene regulatorische Rahmenbedingungen sind eine weitere wichtige Voraussetzung für die Attraktivität des D-CATALYST für private Investoren. → Ferner zeigen die Erfahrungen der staatlich geförderten Investitionen in frühe Start-up-Finanzierungsrunden, dass von ihnen eine positive Signalwirkung für private Co-Investoren ausgeht. Dies darf umso mehr vom D-CATALYST erwartet werden, der aufgrund seiner wissenschaftlichen Expertise und seines professionellen Risikomanagements als Qualitätsinvestor im Bereich der Deep-Tech-Sprunginnovationen wahrgenommen werden wird und auf diese Weise in erheblichem Umfang Mittel privater Investmentfonds für einzelne Finanzierungsrunden seiner Portfoliounternehmen generieren wird.
BIOTECHNOLOGIE UND MEDIZINTECHNIK
ENERGIETECHNIK
HARDWARE UND ELEKTRONIK
FERTIGUNGS-, INDUSTRIE- UND WERKSTOFFTECHNIK
AATEC MEDICAL
ACTIVE INFERENCE
↳ STANHOPE AI
AEVOLOOP
AKHETONICS: EIN OPTISCHER PROZESSOR
ALZHEIMERMEDIKAMENT
ANALOGE MEMRISTORBAUELEMENTE
AQUAHARA
BAUSTAHLMATTE AUS
EINEM GUSS
BESCHLEUNIGERFUSION
BESCHLEUNIGERGETRIEBENE NEUTRONENQUELLE
BIOSENSORIK / EIN OPTISCHES BIOSENSORIK-SYSTEM
CARBON ONE
CELLBRICKS
CERA COVER als nachhaltiger Separator
↳ PROTONEN-AKKUMULATOR
UMWELT- UND AGRARTECHNIK
BAUWESEN UND INFRASTRUKTUR
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Ein molecular Mundschutz gegen die nächste Pandemie
Maschinen und Robotern eine menschliche Denkweise ermöglichen
Recycling ohne Qualitätsverluste: Bausteine für nachhaltige AllzweckKunststoffe aus Plastik und Bioabfällen
Mit rein optischen Prozessoren den Energiebedarf von Rechenzentren radikal reduzieren
Alzheimer stoppen durch die Disassemblierung von Proteinfehlfaltungen
Durch analoge Memristoren die Datenflut verarbeiten und speichern
Solarer atmosphärischer Wassergenerator: Destillation durch Sonnenwärme
Durch das Umdenken im Herstellungsprozess von Baustahlmatten Betonbedarfe drastisch reduzieren
Ein neuer Weg zur Kernfusion – sichere Energie für eine grüne Zukunft
Die Strahlungszeit von Atommüll drastisch reduzieren
Hochempfindliche optische BiosensorikSysteme für eine schnelle VorOrtDiagnostik in Krankenhäusern
Effiziente Katalysatoren für die Synthese von nichtfossilen Basischemikalien
Organe mit Biotinte drucken – 3DOrgandruck als Schlüssel zur Regenerationsmedizin
Durch eine neuartige Keramik Bleibatterien ohne Blei betreiben
D
CHAPERON THERAPIE
E G
H I
CYFRACT
DEEP SCAN
DEINE ENERGIE, WANN IMMER DU SIE BRAUCHST
↳ ENERA ENERGY GMBH
DNAZYME
DRIVEBLOCKS PLATFORM
EIN FREIES 5G-CAMPUSNETZ IN SOFTWARE
EMROD
ETABLIERUNG DER BAKTERIOPHAGENTHERAPIE
EUDI WALLET
EUROPEAN RADIOPHARMACY TECHNOLOGY
EYE2AI
GAPLESS TEC
HYDROSIC
ILLUTHERM
INCARI AI
INTRABODIES
Fehlfaltung von Proteinen korrigieren, ihre Funktion wiederherstellen und Stressreaktionen unterbinden
Mit Fluidkräften Partikel aus Flüssigkeiten energiearm filtern
Entwicklung eines hochauflösenden Röntgensystems für die zerstörungsfreie, dreidimensionale Darstellung von Materialien und Strukturen
Neuartige Energiespeicherlösung: Mit Wasser und CO2 Stromspeicher revolutionieren
NextGenerationGenscheren zur biotechnologischen und therapeutischen Anwendung
Eine modulare, skalierbare Plattform als Grundlage für autonomes Fahren
Neue Mobilfunknetze: frei und quelloffen auf breiter Hardwarebasis
PowerBeaming – kabellose Energieübertragung zur Transformation der globalen Energiebereitstellung
Durch Phagen Antibiotikaresistenzen bekämpfen
Die Zukunft der digitalen Identität – Konzept zur Erweiterung der deutschen eID durch leichtgewichtige elektronische Identitätsnachweise
Entwicklung völlig neuer Strahlentherapien mit Astat
Mit dem Holodeck eine AugmentedRealityUmgebung ermöglichen
Wärme direkt in elektrische Energie umwandeln –die thermionische Energieumwandlung
Photokatalytische Zelle – direkte Nutzung von Sonnenlicht zur Wasserelektrolyse
Dekarbonisierung von Hochtemperaturprozessen: direkte Erhitzung mit blauem LEDLicht
NoCodePlattform – Programmieren ohne Programmierkenntnisse ermöglichen
Leberkrebs aus der Zelle heraus behandeln
MICROFOLD
MICROBUBBLES: MIKROPLASTIK
MIMOTYPE
MYRIAMEAT
NANOFALLEN GEGEN VIREN
↳ CPTX
NANOGAMI
↳ TILIBIT
NEUE BINNENWINDANLAGE
↳ BEVENTUM
NIEDERDRUCKTURBINE
↳ FLUDEMA
OFFENER 5G-ROUTER
OLIMENT
↳ NECONA
OVID
PACEVAL
PELICAAN
PLANTS FOR PLANTS
↳ LIGNILABS GMBH
POLYMERACTIVE
POWER TO FOOD
Polymeroptiken durch ein disruptives Herstellungsverfahren verbessern und Einschränkungen der bisherigen Produktionstechnologie überwinden –ein Baukasten für Optiken
Ein Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Oberflächen
Eine Makrolösung für das Mikroplastikproblem
Die Dynamik von Proteinen nutzen, um Licht zu modifizieren und kontrollieren
Tierfreies Fleisch: nachhaltige Produktion von tierischem Muskelfleisch aus induzierten pluripotenten Stammzellen
Viren im Nanomaßstab einfangen – eine DNAOrigamifalle, um Viren zu umschließen und zu neutralisieren
DNAbasierte Biochips für eine neue Generation der Diagnose
Mit Hochwindrädern die Energiegewinnung in neue Höhen bringen
Überschusswärme effizient nutzen – eine Revolution im Turbinendesign
Ein herstellerunabhängiger Ansatz für einen 5GMultiserviceRouter
Die Revolution in der Bindemittelherstellung –Oliment, ein CO2neutraler Zement
Metamorphose der Psychiatrie: mit Psilocybin Depressionen und Angststörungen behandeln
Effiziente Verarbeitung mathematischer Modelle: eine drastische Energiereduktion für Rechner
Unbemannte Rettungs und Transporteinsätze durch eine eVTOLDrohne / ein Hybrid aus Flugzeug und Drohne
Pflanzen gegen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts impfen!
Kunststoffabfällen einen zweiten Produktlebenszyklus geben und Aktivkohlefilter ersetzen
Nahrung aus erneuerbaren Energien: dezentrale, nachhaltige Produktion von mit Vitaminen angereichertem Protein aus Strom, Luft und Wasser
PRECISION CRISPR-MEDICINE
AMR INFECTIONS
Antimikrobielle Resistenzgene zerstören: Bakterien resensitivieren, um mit bestehenden Antibiotika handeln zu können
REPAIRON IMMUNO:
NOVEL IPSC-BASED CELL DRUG PLATFORM
RULEMAPPING
↳ KNOWLEDGE-TOOLS
SCHALTER GEGEN TUMORE
↳ PLECTONIC
SCS – SOVEREIGN CLOUD STACK
SHAZAM DER GESUNDHEIT
SMART CONTRAST
SMART MATERIALS AUS BIOPOLYMEREN
SPARK
SPHEROSCAN ↳ FLUIDECT
SPINNAKER
STELLARATOR FUSION
POWER PLANT
↳ PROXIMA FUSION GMBH
SUPER-RESOLUTION
QUANTUM SENSING
↳ QUANTUM DIAMONDS GMBH
THEION
THIN-G
VAIONIC
WEATHERTEC
Neue Form der Zelltherapie: CanvasZellen sollen Kampf gegen den Krebs unterstützen
Die digitale Revolution der Rechtsanwendung: die Automatisierung von Recht im offenen Standard
Immuntherapeutika für Krebserkrankungen –mit DNAOrigami Tumorzellen abschalten
Etablierung eines offenen und wettbewerbsfähigen CloudÖkosystems auf Basis europäischer Werte
Erkennung von Krankheiten durch die Auswertung akustischer Signale über SpeechBiomarker
Durch den Einsatz einer Software die Standarddosis von Kontrastmitteln im MRT bedeutend reduzieren
Biopolymere aus Hyaluronsäure: die industrielle Verarbeitung von Biopolymeren als Werkstoff ermöglichen
Mit Chemical Looping chemische Prozesse flexibilisieren – CO2 nutzbar machen!
Schadstoffe in Flüssigkeiten sicher und sofort detektieren
Gehirninspirierte Prozessoren zur neuromorphen Verarbeitung für schnelles und effizientes maschinelles Lernen
Stellaratorbasiertes Fusionskraftwerk: sichere Energie für eine grüne Zukunft
Quantum Sensing: Magnetfelder mit Quanteneffekten hochgenau vermessen
SchwefelBatterien: hohe Energiedichten ohne kritische Rohstoffe dank kristalliner Schwefelkathoden
Ein massenmarkftfähiger Hochleistungsdämmstoff
Die Elektrifizierung des Nutzverkehrs durch einen schichtweise aufgebauten Axialflussmotor
Mit gezielter Ionisierung der Umgebungsluft die Wolkenbildung begünstigen und das gezielte Abregnen ermöglichen
5G-VOSSS
SoftwareKomponenten für einen Cloudnativen virtualisierten OpenSourceSoftwareStack ( VOSSS )


SPRIND UND PEAKPROFILING
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS Weil wir ein enormes Potential in der Stimmanalyse zur Früherkennung von Krankheiten sehen. Denn frühe Diagnosen erhöhen die Überlebensrate. Darüber hinaus kann die telemedizinische Diagnostik auch räumliche Distanzen, insbesondere in ländlichen Regionen, überbrücken. PeakProfiling verfolgt einen technisch sehr vielversprechenden Ansatz, der sich deutlich vom üblichen Vorgehen im Feld unterscheidet.
DAS WIRD KONKRET GEMACHT
PeakProfiling analysiert Sprachaufnahmen, um Krankheiten wie Depression, ADHS und Demenz zu diagnostizieren. SPRIND unterstützt PeakProfiling bei der Validierung ihrer Algorithmik.
DIE SPRUNGINNOVATION – EIN NEUER SYMPTOMGEBER Das Anwendungsspektrum der Technologie ist breit und könnte perspektivisch zur Erkennung von deutlich über hundert Krankheiten genutzt werden, darunter neurologische, psychiatrische und Atemwegserkrankungen. Die Früherkennung und -diagnose könnte so weltweit jährlich Millionen von Todesfällen verhindern. Eine langfristige Option ist es, die Technologie in Smartphones zu integrieren – ein Schritt auf dem Weg zu einer revolutionären Gesundheitsversorgung.



Die Art und Weise, wie wir sprechen, vermittelt viel mehr als nur Worte: Klingen wir euphorisch oder gedämpft? Sind wir verschnupft oder heiser? Spricht ein Kind oder ein älterer Mensch? All das erkennt unser Gehirn mühelos in Sekunden durch die Art und Weise, wie jemand spricht. Das von Dr. Jörg Langner und Claudio Hasler gegründete Startup PEAKPROFILING analysiert genau dies – das „Wie“ der Stimme, sozusagen die Musik – und geht dabei noch einen Schritt weiter: Es werden nicht nur für das menschliche Ohr erkennbare Zustände erkannt, sondern auch viel komplexere Phänomene, insbesondere Erkrankungen. Mit solchen sogenannten „Voice Biomarkers“ möchten die Gründer maßgeblich zur (Früh)Erkennung von Krankheiten beitragen.
STARTPUNKT: VON MOZART ZUM VOICE BIOMARKER
Jörg Langner, promoviert in quantitativer Musikwissenschaft und langjähriger Forscher an der HumboldtUniversität zu Berlin, widmete sich bereits vor Jahrzehnten musikalischen Phänomenen und stellte sich unter anderem die „MozartFrage“: „Warum ist Mozart so faszinierend? Es gibt auch andere hervorragende Komponisten, aber gerade seine Musik hat die Menschen immer besonders fasziniert. Ich habe nach einer mathematischen Lösung gesucht, um solche komplexen musikalischen Fragestellungen beantworten zu können“, erinnert sich Langner. Noch bevor maschinelles Lernen ein Breitenthema wurde, stellte der leidenschaftliche Wissenschaftler und Musikfan fest, dass seine Untersuchungen auch auf Gesang und schließlich auf Sprache projizierbar sind. In der Folge widmete sich Langner der Erforschung der menschlichen Stimme in einem industriellen Kontext: Über ein Jahrzehnt führte er kommerzielle
Auftragsforschung durch, unter anderem für DAXUnternehmen wie große deutsche Automobilkonzerne. Themen waren in dieser Zeit beispielsweise Müdigkeits und Emotionserkennung anhand der Stimme. 2017 lernte er Claudio Hasler kennen, einen ehemaligen GoogleMitarbeiter und zu diesem Zeitpunkt hochrangigen Manager in der Arzneimittelindustrie. Hasler sah in dem Ansatz enormes Potential und schloss sich mit Langner zusammen. 2018 entstand die PeakProfiling GmbH. Bald kamen weitere Mitstreiter an Bord, insbesondere Experten für Künstliche Intelligenz, um Langners außergewöhnliche Kerntechnologie mit modernsten KIVerfahren zu kombinieren. Auch im universitären Umfeld stieß das Thema Voice Biomarker zunehmend auf Interesse: Bis heute wurde in hunderten von medizinischen Studien eindeutig gezeigt, dass die Stimmerkennung von vielen Erkrankungen grundsätzlich möglich ist. Allein auf dem Medizinportal PubMed finden sich mittlerweile fast 500 Studien zu „voice biomarker“ .
Stimmliche Biomarker sind besonders interessant, weil sie im Vergleich zu anderen digitalen Biomarkern wie Bewegungsmessungen, SchlafTracking oder Pulsmessung für eine breite Anzahl von Erkrankungen im Labor nachweislich hohe Trefferquoten liefern und gleichzeitig durch die einfache Nutzung über das Telefon nahezu allen Menschen zugänglich sind. Hasler präzisiert: „Wir sehen Voice Biomarker als die Speerspitze der digitalen Biomarker, die zukünftig durch weitere Marker ergänzt werden.“
Trotz der guten wissenschaftlichen Validierung steht derzeit der Sprung vom „Labor“ hin zu einem relevanten Einsatz in der medizinischen Praxis noch aus. Grund dafür ist die massiv steigende Komplexität beim Wechsel in die Praxis – oder wie Hasler es ausdrückt: „Die Realität ist vielschichtig und komplex. Es gibt zahlreiche Einflussvariablen, die dazu kommen, wenn man den Schritt vom Labor in die medizinische Praxis macht: Begleiterkrankungen, die sich überlagern, Einfluss von Medikamenten, verschiedene Aufnahmegeräte, schwankende Mikrofonabstände, unterschiedliche Sprachaufgaben, Sprachen und Dialekte, gute oder schlechte Tage der Patienten oder verrauschte Daten mit Hintergrundlärm, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese Komplexität zu beherrschen, das ist die größte Herausforderung und ein langer Prozess.“
FOKUS HEUTE:
MEDIZINPRODUKTEZULASSUNG
Die Komplexität zu meistern und den Sprung vom Labor zum Durchbruch in der Praxis als Erste zu schaffen, das ist die Ambition von PeakProfiling. Ein einzigartiger technologischer Ansatz soll dies ermöglichen: die Kombination von musikwissenschaftlichen Erkenntnissen mit Künstlicher Intelligenz – PeakProfiling spricht von „Musicology AI“. Hasler erläutert: „Wir befinden uns in einem Feld, in dem Trainingsdaten knapp sind: Wir schätzen, dass 95 Prozent der akademischen Studien mit N < 100 arbeiten, also mit weniger als 100 Probanden. Herkömmliche KIAnsätze können hier wenig ausrichten – sie bräuchten Tausende oder besser Millionen von Daten. Klassisch versucht man dies zu lösen, indem man vorgibt, welche
Merkmale („Features“) im Signal per Machine Learning auf Muster untersucht werden sollen. Dabei nutzt das akademische Feld einige wenige Toolboxen mit den immer gleichen, aus unserer Sicht recht limitierten Merkmalen. Dieser Ansatz kann allerdings die komplexen, praxisrelevanten Probleme bisher nicht generalisierbar lösen. Vor dem Hintergrund des Erfolges von generativer KI, z. B. ChatGPT, geht zudem der Trend dahin, mit großen nichtmedizinischen Datensätzen Modelle vorzutrainieren und diese dann im letzten Schritt an unsere medizinischen Fragestellungen anzupassen. Auch hier gibt es viel Potential für den Durchbruch.“
PeakProfiling verfolgt beide Stoßrichtungen, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Musikalisches Wissen wird als Input genutzt, um die KI vereinfacht gesagt in ihrer Mustersuche zu unterstützen. Technisch gesprochen: „Auf der klassischen MLRoute nutzen wir viel komplexere, musikwissenschaftlich geprägte Features. Im Bereich der generativen KI liefern uns musikalische Repräsentationen effizienteren Input.“
Unterstützt von SPRIND, hat PeakProfiling in Zusammenarbeit mit der Charité und dem Forschungszentrum Jülich Aufgabenstellungen im Bereich Stimmerkennung von Depression bearbeitet, die deutlich näher an die Komplexität der medizinischen Praxis heranreichen. Entsprechende Veröffentlichungen sind auf dem Weg. Gerade im Bereich der Depression können Voice Biomarker zukünftig einen großen Mehrwert liefern: „Die Versorgungslage bei Depression ist selbst in Deutschland bekanntermaßen angespannt – von weniger entwickelten Ländern ganz zu schweigen. Der größte Teil der Menschen mit Symptomen hat überhaupt keine Diagnose. Die ärztliche Diagnostik ist aufwendig und würde genauer, wenn sie auf harte Biomarker zurückgreifen könnte. Kommt es zur Behandlung, wäre ein engmaschiges Monitoring wichtig, kann aber durch beschränkte Ressourcen nur schwer geleistet werden. Im Ergebnis erleiden ein Großteil aller Patienten einen Rückfall. An all diesen Stellen der ‚Patientenreise‘ könnte eine einfache und regelmäßige Messung über Stimmbiomarker wertvolle Unterstützung für Patienten und Ärzte leisten.“ PeakProfiling
ist auf diesem Weg weit vorangekommen. In Kürze soll der Status als Medizinprodukt erreicht werden – zunächst für ADHS, dann für weitere Erkrankungen.
DIE GROSSE ZUKUNFTSVISION Neben der Spezialisierung auf einzelne Erkrankungen wie Depression könnte die Software zukünftig auch als breites ScreeningTool funktionieren. „Wir glauben, dass man in Zukunft viele Krankheiten schon früh über die Stimme erkennen kann. Unsere Schätzungen liegen aktuell bei rund 100 Erkrankungen (500 ICDCodes), für die Voice Biomarker relevant sein werden. Die wissenschaftliche Studienlage deckt heute schon ein breites Feld an Erkrankungen ab – neurologische Themen wie Parkinson und Alzheimer, psychiatrische Erkrankungen wie Depression oder posttraumatische Belastungsstörung, respiratorische Krankheiten wie Asthma oder COPD, um nur einige zu nennen“, führt Claudio Hasler aus.
Die längerfristigen Ausbaumöglichkeiten sind daher enorm: „Natürlich ist das ‚bold‘ – aber langfristig sehen wir die Chance, für bis zu 100 Erkrankungen mit unseren Voice Biomarkern einen Mehrwert zu liefern. Wenn man sich beispielsweise die zehn Erkrankungen anschaut, die die meisten Todesopfer nach sich ziehen, dann können sieben davon perspektivisch sicher an der Stimme erkannt werden und zwei weitere mit hoher Wahrscheinlichkeit. 27 Millionen Todesfälle pro Jahr sind dadurch potentiell weltweit verhinderbar –und dazu wollen wir beitragen.“
Doch selbst an dieser Stelle wird der technologische Fortschritt weitergehen. Danach gefragt, wohin denn eine solche Entwicklung überhaupt noch führen kann, antwortet Hasler: „irgendwann in der Zukunft werden wir in unserem Bereich vermutlich eine ‚Allgemeine Künstliche KlangIntelligenz‘ erleben, die weit über medizinische Anwendungen hinausgeht. Diese Technologie wird in der Lage sein, jede Art von Klang dieser Welt zu analysieren, zu interpretieren und zu generieren – sei es die Lautäußerung von Menschen, Maschinen, Instrumenten oder Umweltgeräusche. Wir sind überzeugt davon, dass hierfür musikalische Prinzipien letztlich eine Schlüsselrolle spielen werden.“






SPRIND UND ILLUTHERM
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS Thermische industrielle Prozesse zu elektrifizieren und damit zu dekarbonisieren – das wäre ein echter Meilenstein für die Energiewende. Illutherm hat hierfür auf Basis von kostengünstigen LEDs eine Plattformtechnologie entwickelt. Die Wärmeübertragung mit blauem und UV-Licht kann in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung finden und thermische Prozesse drastisch beschleunigen und effizienter gestalten. Die neu gewonnene Flexibilität lässt es zu, grünen Strom geschickter zu nutzen, und kann dabei helfen, netzdienlich zu agieren.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Das langfristige Ziel von Illutherm ist es, fossil betriebene Öfen durch eine hochskalierbare Technologie breitflächig zu ersetzen. Dabei liegt der Fokus zunächst auf dem Sintern von Keramik, aber auch dem Brennen von Kalk und Zement. SPRIND unterstützt Illutherm bei dieser Vision.
Gemeinsam haben wir die LED-basierte Heiztechnologie mit verschiedenen Ansätzen im Detail evaluiert. Zusätzlich unterstützt SPRIND das Team bei Aufgaben rund um Business Building und Fundraising.
DIE SPRUNGINNOVATION
Illutherm entwickelt ein Verfahren, mit dem Hitze ohne Ofen und nur mit direkter Beleuchtung in großer Skala erzeugt wird. So kann z. B. Keramik innerhalb von Sekunden gebrannt werden. Die Herausforderung: eine kostengünstige Lichtquelle mit der Fähigkeit zur Bereitstellung und Steuerung von Licht mit hoher Energiedichte und kurzen Wellenlängen.
Die Technologie von Illutherm ist hochskalierbar, beschleunigt die durchführbaren Experimente um den Faktor 100 und kann, je nach Material, bis zu 50 Prozent Energie gegenüber herkömmlichen Öfen einsparen.



Eigentlich wollte Lukas Porz während seiner Promotion die Eigenschaften von Keramiken verändern, indem er sie schneller erhitzt. Das Experiment scheiterte, seine Keramiken blieben unverändert. Doch Lukas Porz ging ein Licht auf: Er entdeckte, dass er Keramik innerhalb von wenigen Sekunden erhitzen kann, anstatt sie stundenlang im Brennofen zu brennen – durch blaues Licht.
Brennöfen haben eine jahrtausendealte Tradition. Sie werden zum Teil mit Wasserstoff, vor allem aber mit fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas befeuert. Diese Heizprozesse verursachen mehr als 10 Prozent der weltweiten CO2Emissionen – eine Klimakatastrophe. Hinzu kommt: Der Verbrennungsprozess ist energetisch ineffizient. Denn in den Brennöfen werden nicht nur Keramik, Stahl, Zement oder Glas erhitzt, sondern auch die gesamte Umgebung – dabei geht viel Energie verloren. Wird Keramik mit blauem Licht bestrahlt, absorbiert es die Licht und UVStrahlen fast komplett. Innerhalb weniger Sekunden wird die Keramik erhitzt, alles andere bleibt kalt. Die Energie wird also nur dort genutzt, wo sie auch gebraucht wird, und eine aufwendige Isolierung ist nicht mehr nötig. In InfrarotÖfen wird Strahlungswärme bereits genutzt. Blaues Licht wird jedoch deutlich besser als rotes absorbiert, wodurch Geschwindigkeit und Effizienz sprunghaft steigen.
Im Mai 2022 stellte Lukas Porz zusammen mit seinem Studienkollegen Michael Scherer seine Idee der SPRIND vor. Kein Jahr später gründeten sie ge
meinsam mit dem industrieerfahrenen Miltiadis Vlachos die ILLUTHERM GmbH. Mittlerweile besteht das Team aus sieben Personen und auch die Visionen sind größer geworden: ILLUTHERM will nicht nur den Brennprozess von Keramik revolutionieren, sondern auch Metalle, Glas und Zement mit blauem Licht erhitzen, um die hohen CO2Emissionen in der Industrie zu reduzieren.
MIT VIELEN VERSUCHEN ZUR RICHTIGEN TEMPERATUR
Die größte Herausforderung war und ist dabei zunächst die Entwicklung der LEDTechnologie. Das Ziel war zunächst, mit blauen LEDs Materialien auf 1.000 Grad zu erhitzen. Ein Jahr später schaffte der ILLUTHERMPrototyp schon 1.400 Grad. Das Testen von neuen Anwendungen geht zum Glück schnell: Probe rein, Knopf drücken, zehn Sekunden warten, abkühlen lassen, rausholen, fertig. Ein Test kann in weniger als einer Minute durchgeführt werden. Durch den stark beschleunigten Brennprozess können daher viele Tests in kurzer Zeit durchgeführt werden.
Der ILLUTHERMPrototyp ist ungefähr so groß wie eine Mikrowelle und lässt sich mitsamt seinen Komponenten im Kofferraum transportieren. Er eignet sich zum Erhitzen von kleinen Materialteilen. Ein solches Gerät kann zum Beispiel zum Brennen von kleinen Keramikteilen wie z. B. Zahnimplantaten verwendet werden: Als Zahnärzt:in könnte man so in kürzester Zeit die Implantate direkt in der Praxis brennen und dadurch wertvolle Zeit einsparen.
Langfristig will ILLUTHERM vor allem dort ansetzen, wo es am dringendsten nötig ist: in der energieintensiven Industrie. Da die ILLUTHERMTechnologie skalierbar ist, kann sie gut in industriellen Heizprozessen eingesetzt werden. Und da der Strom für die blauen LEDs aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden kann, ist das Verfahren besonders klimafreundlich. Mehr noch: Die Schnelligkeit des Verfahrens erlaubt es, den Stromverbrauch an die minutenaktuelle Verfügbarkeit und den Preis von grünem Strom anzupassen. Das macht eine teure Energiespeicherung überflüssig. Keramik in Sekundenschnelle zu brennen – statt wie sonst üblich in Stunden oder sogar Tagen –, allein das ist ein bahnbrechender Fortschritt. Doch für ILLUTHERM ist dies erst der Anfang. Das Ziel lautet: blaues Licht statt fossiler Brennstoffe in der Industrie.
DAS POTENTIAL
SPRIND wird ILLUTHERM bei ihren weiteren Schritten mit ihren Netzwerken unterstützen: Die Technologie von ILLUTHERM hat das Potential, die energieintensive Industrie grundlegend zu verändern und den CO2Ausstoß deutlich zu reduzieren. Anstatt fossile Brennstoffe zu verbrennen, können Materialien wie Keramik, Metall, Glas und Zement mit blauem Licht erhitzt werden. Dieser Prozess ist nicht nur effizienter, sondern kann auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dadurch leisten die Innovationen von ILLUTHERM einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
„BLAUES LICHT STATT FOSSILER BRENNSTOFFE.“

Die Vision: Videokonferenzen lebensecht erleben im Holodeck. Das Holodeck ist ein echter Raum, den ein echter Mensch betritt, um sich dort „virtuell“ mit einem, zwei, drei oder fünfzehn anderen echten Menschen zu treffen und zu kommunizieren. Ohne dass alle am gleichen physischen Ort sein müssen. Im Holodeck nimmt man andere Personen und Dinge visuell und akustisch ganz realistisch wahr. Man ist mit ihnen so in Kontakt, dass es sich „total echt“ anfühlt – und nicht wie in einer unterkomplexen, überermüdenden Videokonferenz.
Die erste Generation des Holodeck war ein statisches System. Über dem Nutzer war ein Bildschirm an der Decke montiert. Der Nutzer konnte also nur direkt unter dem Bildschirm in die Augmented Reality eintauchen – für Videomeetings war das schon super, im mobilen Alltag konnte das System aber nicht verwendet werden.
Die VIAHOLO hat deshalb das Ziel, das Holodeck mobil zu machen, und konnte Ende 2023 die zweite Generation vorstellen. Im Brillengestell ist jetzt ein speziell entwickeltes Display integriert, der Bildschirm an der Decke wird damit obsolet. Die Brille ist nach wie vor schlank, viel schlanker als andere Produkte am Markt – trotzdem aber noch nicht so schlank und nicht so leichtgewichtig, wie man es sich für die alltägliche Nutzung wünschen würde.

Deshalb arbeitet die VIAHOLO schon mit Hochdruck an der 3. Generation. Eine Neuentwicklung der Optik soll dazu führen, dass die Augmented-RealityBrille der VIAHOLO kaum noch von einer handelsüblichen Brille zu unterscheiden sein wird. Das Holodeck kann dann ein alltäglicher Begleiter werden.

Der Bedarf an Kameras wächst. Bislang ist die Herstellung von Kameralinsen teuer, doch das könnte sich bald ändern. Denn die SPRINDTochter FabuLens entwickelt in Kooperation mit der mcd – modern camera designs GmbH ein neues Verfahren zur Herstellung kostengünstiger und hochpräziser Abbildungsoptiken. Die bahnbrechende UV-Replikationstechnologie ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von bis zu 1.000 asphärischen, monolithischen Linsen aus Polymer in Abbildungsqualität in einem einzigen Arbeitsschritt. Dabei revolutioniert das Unternehmen das bisherige Spritzgussverfahren: Es produziert bei Raumtemperatur, parallelisiert Prozesse stärker und benötigt gleichzeitig weniger Maschinen. So will das Unternehmen den Energieverbrauch auf bis zu 5 Prozent des bisher üblichen Wertes senken.
In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Mitarbeitenden bei FabuLens auf zwölf gestiegen und der Aufbau der Infrastruktur wurde erfolgreich vorangetrieben.
Je höher Windkraftanlagen sind, desto effizienter arbeiten sie, denn in der Höhe weht der Wind konstanter und stärker. Warum also baut man Windräder nicht einfach höher? Mit dieser Frage hat sich das beventum-Team beschäftigt. Die Antwort lautet im Wesentlichen: Es hat sich noch niemand getraut. Bis jetzt: Die beventum hat inzwischen drei vielversprechende Konzepte validiert – und wird gegen Ende 2024, zusammen mit dem Ingenieursdienstleister GICON, die weltweit erste Höhenwindenergieanlage bauen. Der über 350 Meter hohe Prototyp wird in der Gemeinde Schipkau in Brandenburg stehen. Im Jahr 2023 hat die beventum GmbH erfolgreich den Bauantrag für das erste Höhenwindrad gestellt. Im letzten Schritt erfolgt nun nur noch die Prüfung durch das Landesumweltamt Brandenburg, bevor voraussichtlich im dritten Quartal 2024 der Grundstein gelegt werden kann.
Doch die beventum, die mittlerweile aus mehr als zehn Mitarbeiter:innen besteht, will nicht nur hoch hinaus, sie hat weitere wegweisende Ziele: Sie möchte nicht weniger, als das Standortproblem für Windenergieanlagen an Land zu lösen. Als zweiten Schwerpunkt entwickeln die Mitarbeiter:innen deshalb Anlagen mittlerer Höhe, die unkompliziert auf ohnehin schon genutzten Flächen, wie in Gewerbe- und Industriegebieten, gebaut werden. Bei rund 70.000 Gewerbegebieten allein in Deutschland ergibt sich grob geschätzt eine installierbare Leistung in der Größenordnung von mehreren Kraftwerken, die direkt bei Verbraucher:innen zur Eigenversorgung eingespeist werden könnten.

Im Segment der Windenergieanlagen (WEA) unter 50 Metern bereitet die beventum für den Einsatz in Gewerbe- und Industriegebieten die Kommerzialisierung eines wartungsfreien und kostengünstig zu errichtenden Anlagenkonzeptes vor.
Die innovative Idee von Roland Damann ist es, Gewässer mithilfe von mikroskopisch kleinen Luftblasen von Mikroplastik zu befreien. Ein schwimmendes Modul erzeugt Mikrobläschen mit einem Durchmesser von 10 bis 50 Mikrometern, die eine nebelartige Blasenwolke bilden.
Die Luftblasen ziehen Mikroplastikpartikel an und transportieren sie an die Wasseroberfläche, wo sie entfernt werden können. Das System funktioniert ohne Chemie, wartungsfrei und mit geringem Energieaufwand und zielt speziell auf feinste Verunreinigungen wie Reifenabrieb und kleinste Kunststoffpartikel ab.

Künftig will Damann Wege und Instrumente finden, um Mikroplastik-Hotspots zu identifizieren. Damit haben sich die Forschungsfelder von MicroBubbles entscheidend erweitert, denn die bloße Entfernung von Mikroplastik ohne begleitenden Nachweis der erzielten Reinigungsleistung wäre nicht zielführend. So macht das eigene Zentrum für Mikroplastikanalytik deutliche Fortschritte. Die Pilotanlagen sind weiterhin unverzichtbar für die Skalierung und Integration der Technologie in bestehende Wassermanagementsysteme und unterstützen die laufenden Forschungs- und Anwendungsarbeiten.
Die Entwicklung einer Mikroplastikdatenbank zur Erstellung einer umfassenden Mikroplastikkarte ist ein weiterer wichtiger Fortschritt.
Und auch die Kooperationen mit dem Bayreuther Start-up ZAITRUS und dem Münchner Start-up CyFract zeigen das unermüdliche Engagement von MicroBubbles, fortschrittliche Lösungen für drängende Umweltprobleme zu entwickeln.
In der zweiten Projekthälfte beginnt nun der Transfer der Forschungsarbeit in mögliche Businesscases und -modelle. Der Fokus liegt vorerst auf der Eliminierung von Reifenabrieben und der Bereitstellung von Mikroplastik-Detektionsund Analyseleistungen. MICROBUBBLES
Die Bedeutung einer funktionierenden Infrastruktur wird uns oft erst bewusst, wenn sie ausfällt. Im analogen Bereich sind Schwachstellen oder Investitionsrückstau schneller erkennbar, aber auch im digitalen Bereich gibt es viele Beispiele: der 2014 entdeckte Heartbleed-Bug, die massive Sicherheitslücke Log4j, die 2021 entdeckt wurde, oder auch der xz-utils-Vorfall in 2024. Diese Probleme verdeutlichen die weitreichenden Abhängigkeiten und Auswirkungen von Software-Infrastrukturen auf die Wirtschaft, auf den öffentlichen Sektor und auf die gesamte Gesellschaft.
Ohne funktionierende Infrastruktur ist auch keine Innovation möglich. Besonders innovative digitale Technologien bauen selten von Grund auf neu, sondern nutzen bestehende Softwarekomponenten oder passen vorhandenen Code an, um neue Anwendungen zu entwickeln. Der Einsatz von offenen digitalen Basistechnologien kann die Neuentwicklung erheblich vereinfachen und die Kosten senken, da auf zahlreiche Module und CodeBibliotheken zurückgegriffen werden kann. Durch eine ordentliche Wartung der Infrastruktur lässt sich somit die Innovationskraft und das Entwicklungstempo steigern, was insbesondere für die Entwicklung disruptiver Technologien entscheidend ist.
Diese unsichtbare Infrastruktur und das gesamte Open-Source-Ökosystem stärkt der Sovereign Tech Fund seit 2022. Über 45 kritische Technologien werden unterstützt und viele weitere werden bisher identifiziert, über eingereichte Anträge und unsere eigene Recherche. Die Beauftragungen in Gesamthöhe von ca. 18,5 Mio. € finanzieren relevante Entwicklungsarbeiten, wichtige Wartungen und nachhaltige Verbesserungen in offenen digitalen Basistechnologien, deren Maintainer:innen oft unbezahlt und überlastet sind.
Zudem werden Initiativen wie das Bug-Resilience-Programm, die Contribute-BackChallenges, Maintainer:in-Fellowships aufgebaut und getestet, um weitere Instrumente zu pilotieren und zu evaluieren. Das Ziel dabei ist die digitale Souveränität, also die selbstbestimmte Nutzung digitaler Technologien und Systeme durch Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen zu stärken und neue Wege zu finden, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Herausforderungen im Open-Source-Ökosystem zusammen mit den Communities zu adressieren.

FlulDect ist auf dem besten Weg, die Lebensmittelanalyse zu revolutionieren. Statt wie bisher Tage und Wochen, kann FlulDect binnen Sekunden Pathogene wie Legionellen oder Salmonellen in Flüssigkeiten aufspüren und so unser Trinkwasser und unsere Lebensmittel sicherer machen.

So funktioniert es: In ein schuhschachtelgroßes Analysegerät gibt das Team zu den Flüssigkeitsproben zehn Mikrometer große Fluoreszenzmarkierte Plastikkügelchen aus Polystyrol. Die Kügelchen werden mit Licht bestrahlt und fluoreszieren. Lagern sich nun an den Plastikkügelchen Pathogene an, verschiebt sich die durch die Kügelchen ausgestrahlte Wellenlänge. Und somit ändert sich, leicht messbar, die emittierte Farbe. FluIDect kann so in Produktionsanlagen kostengünstig, dezentral, inline-fähig und ohne Labor Mikroben detektieren. So schnell, dass prozessbegleitend noch während der Produktion, zum Beispiel von Milch oder Milchersatzprodukten, reagiert werden kann – nicht erst, wenn bereits ganze Tanks kontaminiert sind. Ende 2023 konnte FluIDect einen großen Erfolg vermelden: Das Unternehmen konnte eine Seed-Finanzierungsrunde in Millionenhöhe erfolgreich abschließen. Die bm-t aus Thüringen, die b.value aus Dortmund und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland investierten in das Start-up aus Jena.

In naher Zukunft wird sich der Diagnose-Alltag verändern: Menschen werden Gewebe- oder Flüssigkeitsproben nicht mehr in ein Labor schicken, sondern direkt in der Arztpraxis oder zu Hause analysieren können.
Dies wird schneller, günstiger, detaillierter und exakter sein. Denn das Unternehmen Nanogami entwickelt neuartige Biochips. Diese enthalten hochkomplexe, programmierbare Nano-Strukturen – Milliarden kleinster DNA-Maschinen, die spezifische Aufgaben erfüllen. Doch Nanogami will die Nano-Strukturen nicht nur auf Biochips einsetzen, sondern auch auf Computerchips. Wenn das klappt, kann Nanogami weitere Märkte revolutionieren: etwa die Datenspeicherung. Oder die Herstellung von Quantencomputern. Oder die Schadstoffüberwachung in der Luft. Das Potential, das in nano steckt, ist gigantisch.
In den letzten zwei Jahren ist das Team seinem Ziel neuartiger Biochips einen Schritt nähergekommen. Die Innovator:innen entwickeln erste Prototypen, die helfen sollen, bisherige DNASequenzierungen um ein Vielfaches effizienter zu gestalten. Damit sollen Kosten stark gesenkt und eine breitere Anwendung ermöglicht werden.

Pleodat arbeitet an der Entwicklung des Datenspeichers der Zukunft der CortexEngine. Inspiriert vom menschlichen Gehirn und ähnlich arbeitend wie unser Gehirn soll die darauf basierende Informationsplattform (Cortex-IP) in der Lage sein, eine Vielzahl von Eingaben gleichzeitig zu analysieren.
Der Fokus des Systems liegt darauf, Beziehungen zwischen Daten herzustellen, um daraus Informationen abzuleiten und Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Tochtergesellschaft der SPRIND, Pleodat, wird die Cortex-IP systematisch für eine kommerzielle, umfassende und skalierbare Weiterentwicklung vorbereiten. Der Verlust des Innovators Peter Palm im Jahr 2023 und die aktuellen Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz haben einen Neuausrichtungsprozess im Unternehmen eingeleitet.
Pleodat besteht mittlerweile aus über 20 Mitarbeitenden und untersucht, wie die Cortex-IP mit KI-Anwendungen integriert werden kann, um disruptive Lösungen anzubieten.
Alzheimer: eine Diagnose, die das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen nachhaltig verändert. Der Zerstörungsprozess im Gehirn verläuft mit perfider Unaufhaltsamkeit. Im Gehirn gibt es harmlose Einzelproteine, sogenannte Monomere, darunter auch Abeta-Moleküle. Diese verklumpen, verlieren ihre ursprüngliche Funktion und schädigen die Nervenzellen und deren Verbindungen – sie werden neurotoxisch. Schlimmer noch: Die giftigen Knäuel, die Oligomere, vermehren sich im Gehirn auf Kosten der Monomere und schädigen immer mehr Nervenverbindungen, sogenannte Synapsen, und Neuronen. Es gilt, das Gleichgewicht zwischen dem guten Einzelprotein und dem toxischen Knäuel zu verschieben. Und das geht, so Innovator Dieter Willbold, indem man einen Wirkstoff hinzufügt, der seine Wirkung im Gehirn entfaltet und dafür sorgt, die MonomerStruktur zu stabilisieren und die Oligomere in ungefährliche Monomere direkt und ohne Zutun des Immunsystems zu zerlegen. So könnten sich vielleicht sogar geschädigte Synapsen erholen und wieder funktionell werden. Genau diesen anti-prionischen Wirkmechanismus, der die Ausbreitung und Vermehrung der Oligomere stoppt und verhindert, hat Willbold mit seinem Unternehmen Priavoid, einer Forschungsausgründung, untersucht und den entsprechenden Wirkstoff entwickelt. PRI-002 ist ein sogenanntes All-D-Peptid, relativ günstig herstellbar und oral verabreichbar.
Drei klinische Phase-1-Studien an gesunden Proband:innen und Patient:innen, in denen es um Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs geht, sind bereits erfolgreich verlaufen und haben sehr hohe Sicherheit und gute Verträglichkeit von PRI-002 demonstriert.

Zudem wurden noch benötigte präklinische Studien erfolgreich abgeschlossen: Die Ergebnisse deuten ebenfalls auf eine sehr hohe Sicherheit und Verträglichkeit von PRI-002 auch bei langer Behandlungsdauer hin. Um das überzeugende und vorteilhafte Sicherheitsprofil weiter zu untermauern sowie die Wirksamkeit zu zeigen, wird PRI-002 nun in einer Placebokontrollierten Phase-II-Studie an insgesamt 270 Patienten in sechs europäischen Ländern getestet. Die Genehmigung der Phase-2-Studie, der sogenannten PRImus-AD-Studie, erfolgte am 30.10.2023. Für die PRImus-AD-Studie wurde der Wirkstoff bereits vollständig hergestellt und derzeit zur Prüfmedikation weiterverarbeitet und an schon in die Studie eingeschlossene Patient:innen abgegeben. Die endgültigen Ergebnisse der Phase-2-Studie werden 2026 erwartet. Es wird angestrebt, dann nahtlos in eine entsprechende Phase-3-Zulassungsstudie zu gehen.
↳ KI-STRATEGIE FÜR DEUTSCHLAND
↳ VERSION # 1.4 02/11/2023
↳ DEUTSCHLAND SOLLTE SICH IN DER ENTWICKLUNG VON KI AUF
SEINE KOMPETENZEN KONZENTRIEREN UND DIE BEDÜRFNISSE, ABER AUCH DIE
ASSETS DER HIESIGEN TECHNOLOGISCH FÜHRENDEN INDUSTRIEN, DER GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT BERÜCKSICHTIGEN.
↳ NUR DANN UND NUR MIT ZÜGIGEM HANDELN KÖNNEN TROTZ DES DERZEITIGEN RÜCKSTANDES BALD EINIGE ENTSCHEIDENDE WETTBEWERBSVORTEILE ENTSTEHEN.
STRATEGIEPAPIER
↳ FÜR DIE ERREICHUNG DIESES ZIELS SCHLÄGT SPRIND VIER PARALLELE HANDLUNGSSTRÄNGE VOR:
SPRIND CHALLENGES
ZUR ENTWICKLUNG
ANWENDUNGSSPEZIFISCHER KI
→ für die konkrete Nutzung und Weiterentwicklung der KI in den Verticals
SPRIND CHALLENGES
ZUR ENTWICKLUNG VON DATENPOOLS
→ zur Bereitstellung und Kuration von hochwertigen, einzigartigen Datenpools aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Gesellschaft
FÖRDERUNG VON OPENSOURCE-LLMS
→ analog zum Modell des Sovereign Tech Funds, für einen Aufbau hiesiger, zukünftiger Champions
BEREITSTELLUNG VON RECHENKAPAZITÄT
→ mit paralleler Entwicklung von spezieller Hardware
Dieses Dokument beschreibt eine missionsorientierte Vorgehensweise, die schnell in Aktion gebracht werden kann. SPRIND kann als Instrument für die Durchführung von Challenges und zur Projektfinanzierung genutzt werden. SPRIND kann per In-Haus-Vergabe beauftragt werden.
DESHALB SIND WIR BESONDERS STOLZ AUF UNSERE ERFOLGREICHEN ALUMNI, DIE DIESEN WICHTIGEN NÄCHSTEN SCHRITT SCHON GEGANGEN SIND.
PROJEKT → INNOVATION
SPINNCLOUD
Spinoff der TU Dresden
→ Neuromorphes Computersystem SpiNNaker2
GRANT EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC)
↓
2,5 MIO. €
FLUIDECT
DIVERSE INVESTOREN
AKHETONICS
BEAUFTRAGUNG
Validierungsauftrag SPRIND: 2021
2021 bekam SpiNNcloud, ein Spinoff der TU Dresden, einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Das Unternehmen entwickelt das neuromorphe Computersystem SpiNNaker2. Für seine Expansion erhielt es als erstes sächsisches DeepTechStartup anschließend eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro vom European Innovation Council. Die Förderung ermöglicht es, SpiNNaker2 auf mobile Anwendungen wie die MenschMaschineInteraktion auszuweiten und in realistischen Industrieumgebungen zu testen.
→ SpheroScanSensor untersucht flüssige Produkte in Echtzeit auf Pathogene
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
Das Unternehmen FluIDect erhielt 2022 einen Validierungsauftrag von der SPRIND zur Weiterentwicklung seines SpheroScanSensors. Dieser Sensor untersucht flüssige Produkte in Echtzeit auf Pathogene und kann in verschiedene Prozessschritte der Lebensmittelherstellung integriert werden. Nach dem Validierungsauftrag sammelte das Team mehrere Millionen Euro zur weiteren Produktentwicklung von Investoren ein.
→ Optischer Allzweckprozessor
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
DIVERSE INVESTOREN
↓
2,3 MIO. €
Zur Weiterentwicklung eines optischen Allzweckprozessors bekam das Unternehmen Akhetonics 2022 einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Im Nachgang gewann es 2,3 Millionen Euro von privaten Investoren für die Entwicklung eines ersten vollumfänglichen Prototyps.
CELLCIRCLE
UG
→ Verfahren zum direkten Recycling von LiIonenBatterien
PROJEKTPARTNER DES FRAUNHOFER-PROJEKTS „ReUse“
DRIVEBLOCKS GMBH
DIVERSE INVESTOREN
2,2 MIO. €
RELIOS.VISION GMBH
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
2022 wurde das Unternehmen CellCircle von der SPRIND für sein Verfahren zum direkten Recycling von LiIonenBatterien unterstützt. Inzwischen ist das Startup Projektpartner des FraunhoferProjekts „ReUse“, das durch das European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme finanziert wird.
→ Modulare Plattform für autonomes Fahren
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
Driveblocks erhielt 2022 einen Validierungsauftrag von der SPRIND zur Entwicklung einer modularen Plattform für autonomes Fahren. 2,2 Millionen Euro sammelte das Team anschließend von privaten Investoren zur Weiterentwicklung der Kerntechnologie, der Mapless Autonomy Platform, ein.
→ Erforschung von SmartContrast – einer KISoftware, die das Kontrastmittel bei MRTScans minimiert
TEIL DES WOMEN TechEUFÖRDERPROGRAMMS
DEVERITEC / LAST MILE SEMICONDUCTOR
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
relios.vision erhielt 2022 Unterstützung durch die SPRIND. Das Ziel: die weitere Erforschung von SmartContrast, einer KISoftware, die das notwendige Kontrastmittel bei MRTScans minimiert. Nach dem Validierungsauftrag wurde relios.vision Teil des Women TechEUFörderprogramms des European Innovation Council.
→ Anwendungsspezifischer Mikrokontroller für einen neuen Funkstandard
GRANT EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC)
↓
2,5 MIO. €
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
2022 erhielt Last Mile Semiconductor einen Validierungsauftrag von der SPRIND zur Entwicklung eines anwendungsspezifischen Mikrokontrollers für einen neuen Funkstandard. Durch eine Förderung vom European Innovation Council erhielt das Startup anschließend 2,5 Millionen Euro.
STANHOPE AI
DIVERSE INVESTOREN
→ Mithilfe neurowissenschaftlicher Forschung, Maschinen menschenähnliche Entscheidungen beibringen
Validierungsauftrag SPRIND: 2023
↓
2,3 MIO. £
YELLOW SIC GROUP
DIVERSE INVESTOREN
↓
3,5 MIO. €
FOCUSED ENERGY
Stanhope AI bekam 2023 einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Das Unternehmen nutzt neurowissenschaftliche Forschung, um Maschinen menschenähnliche Entscheidungen beizubringen. Im Anschluss an den Validierungsauftrag gewann das Team 2,3 Millionen Pfund von Investoren zur Weiterentwicklung ihrer „agentic AI“.
→ Photokatalytische Zelle, die Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser elektrolysiert
Validierungsauftrag SPRIND: 2023
Yellow Sic entwickelt eine photokatalytische Zelle, die Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser elektrolysiert. 2023 erhielt das Unternehmen dabei Unterstützung durch die SPRIND. Nach dem Validierungsauftrag schloss das Startup eine Finanzierungsrunde ab und gewann 3,5 Millionen Euro von privaten Investoren. Anfang 2025 soll eine erste Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung eröffnet werden.
→ Technologieentwicklung für ein lasergetriebenes Fusionskraftwerk
Kooperationspartner der PLT
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
↓ 11 MIO. $
MARVEL FUSION
Focused Energy ist Kooperationspartner der PLT – einer Tochtergesellschaft der SPRIND – und konnte neben weiterem Funding 2023 eine Finanzierungsrunde von ca. elf Millionen USDollar abschließen, um die Technologieentwicklung für ein lasergetriebenes Fusionskraftwerk voranzutreiben. In der Kooperation mit PLT wird die Lasertechnologie hierfür entwickelt.
→ Theoretische und experimentelle Aktivitäten zur Entwicklung eines neuen Konzepts für die Fusionsenergie
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
↓ 35 MIO. €
Kooperationspartner der PLT
Auch Marvel Fusion kooperiert mit der PLT. Das Team konnte in seiner SeriesAFinanzierungsrunde 35 Millionen Euro einsammeln. Damit will es seine theoretischen und experimentellen Aktivitäten zur Entwicklung eines neuen Konzepts für die Fusionsenergie vorantreiben. In der Kooperation mit PLT wird die Lasertechnologie hierfür entwickelt.
QUANTUM DIAMONDS
→ Weiterentwicklung einer NanoskalaBildgebung
Validierungsauftrag SPRIND: 2023 DIVERSE INVESTOREN
↓
7 MIO €
THEION
Quantum Diamonds, ein Startup im Bereich Quantensensorik, erhielt 2023 einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Das Münchner Team konnte danach sieben Millionen Euro von Investoren gewinnen, um seine NanoskalaBildgebung weiterzuentwickeln, und kann nun seine Finanzierung bereits mit ersten Pilotkunden ausbauen.
→ Weiterentwicklung einer LithiumSchwefelBatterie
STRATEGISCHE INVESTITION VON ENPAL
CELLBRICKS
DIVERSE INVESTOREN
C1 GREEN CHEMICALS AG
DIVERSE INVESTOREN
↓
13 MIO. €
Validierungsauftrag SPRIND: 2023
Zur Weiterentwicklung einer LithiumSchwefelBatterie bekam das Startup Theion 2023 einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Enpal tätigte darauffolgend eine strategische Investition, um bei der Kommerzialisierung der Technologie zu kooperieren.
→ Drucken voll funktionsfähiger Organe
Validierungsauftrag SPRIND: 2023
Cellbricks erhielt 2023 einen Validierungsauftrag von der SPRIND. Das Startup hat das langfristige Ziel, voll funktionsfähige Organe zu drucken. Nach dem Validierungsauftrag gewann das Team mehrere Investoren.
→ Katalysator für die großtechnische Synthese von Methanol
(+ FÖRDERUNG VON BMDV)
ARX
DIVERSE INVESTOREN
↓ 9 MIO. €
Validierungsauftrag SPRIND: 2022
Durch die Unterstützung der SPRIND 2022 konnte das Unternehmen C1 Green Chemicals seinen Katalysator für die großtechnische Synthese von Methanol weiterentwickeln. Nach dem Validierungsauftrag gewann es 13 Millionen Euro von Investoren zur Markteinführung der Technologie. Außerdem wird das Projekt „Leuna100“ mit über zehn Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert.
→ Weiterentwicklung eines Systems zur autonomen Robotersteuerung
Validierungsauftrag SPRIND: 2024
Anfang 2024 bekam ARX Robotics einen Validierungsauftrag der SPRIND zur Weiterentwicklung eines Systems zur autonomen Robotersteuerung. Damit möchte das Team seinen Teil zur technologischen Souveränität Europas leisten. Bereits im Juni 2024 schloss es eine Finanzierungsrunde über neun Millionen Euro ab.
SPRIND CHALLENGES
BIOMANUFACTURING
→ Kunststoff PMMA (Plexiglas) aus Kartoffelstärke, Abfällen der Biodieselproduktion und Zuckerrübenschnitzeln
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
INSEMPRA
SPRIND CHALLENGE: 2023
Ende 2023 startete die CIRCULAR BIOMANUFACTURING CHALLENGE. C3 Biotechnologies stellt dabei den Kunststoff PMMA (Plexiglas) aus Kartoffelstärke, Abfällen der Biodieselproduktion und Zuckerrübenschnitzeln her. Während der Challenge schloss das Team eine Series A Finanzierungsrunde ab.
→ Polyester und Polyamide aus Pflanzenresten, altem Speiseöl oder PETAbfällen
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
↓ 20 MIO. $
AMPHI STAR
SEED-RUNDE
↓ 6 MIO. € C3
SPRIND CHALLENGE: 2023
Insempra ist ebenfalls Teil der Circular Biomanufacturing Challenge. Das Team „BioTreasure“ produziert aus Pflanzenresten, altem Speiseöl oder PETAbfällen Materialien wie Polyester und Polyamide. Es schloss eine Series A über 20 Millionen USDollar ab.
→ Verschiedene Biotenside aus Abfällen der Lebensmittelindustrie
SPRIND CHALLENGE: 2023
Ein weiteres ChallengeTeam, AmphiStar, stellt verschiedene Biotenside aus Abfällen der Lebensmittelindustrie her. Im Laufe der Challenge konnte das Team bereits sechs Millionen Euro in einer SeedRunde einsammeln.
SPRIND CHALLENGES ○ LONG DURATION ENERGY STORAGE
REVERION
SERIES A
WANDELDARLEHEN ↓
8,5 MIO. €
62 MIO.$
ORE ENERGY
SEED-RUNDE
↓
10 MIO. €
→ System, das in weniger als einer Minute vom Energiespeicher zum Energielieferanten wechselt
SPRIND CHALLENGE: 2022
Reverion arbeitet an einem System, das in weniger als einer Minute vom Energiespeicher zum Energielieferanten wechselt. Es basiert auf einer keramischen Brennstoffzelle, die bei sehr hohen Temperaturen arbeitet.
Das Team erhielt 8,5 Millionen Euro in Form von Wandeldarlehen.
→ Entwicklung einer EisenLuftBatterie, die 100 Stunden Strom liefert
SPRIND CHALLENGE: 2022
Das LDESTeam Ore Energy entwickelt eine EisenLuftBatterie, die 100 Stunden Strom liefern soll. Zehn Millionen Euro wurden bereits in einer SeedRunde eingesammelt.
SPRIND CHALLENGES ○ CARBON-TO-VALUE
CARBO CULTURE
→ Kohlenstoff aus Abfallbiomasse in Form von Pflanzenkohle binden
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
↓ 18 MIO. $
SPRIND CHALLENGE: 2022
Die CARBON-TO-VALUE CHALLENGE startete Mitte 2022.
Das Team von Carbo Culture bindet Kohlenstoff aus Abfallbiomasse in Form von Pflanzenkohle. Diese kann in Beton zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks und als Wärmeleiter verwendet werden. Im Zuge der Challenge akquierierte Carbo Culture 18 Millionen USDollar in einer SeriesARunde.
SPRIND CHALLENGES ○ NEW COMPUTING CONCEPTS
SEMRON
→ Entwicklung neuartiger Computerchips
→ Aktuell Vorbereitung der ersten Fertigung von Testchips
SERIES A FINANZIERUNGSRUNDE
↓
7 MIO. €
SPRIND CHALLENGE: abgeschlossen
Semron entwickelt neuartige Computerchips und bereitet aktuell die erste Fertigung von Testchips vor. Das Unternehmen hat sieben Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde im Anschluss an die SPRIND Challenge NEW COMPUTING CONCEPTS bekommen.
Vor zwei Jahren haben wir vorhergesagt, dass das SPRIND-Gesetz uns endlich die Freiheiten geben wird, so zu handeln, wie es für unsere Aufgabe richtig ist: schnell, unbürokratisch, ergebnisorientiert, vertrauensvoll. Am 30.12.2023 war es so weit und unser „Freiheitsgesetz“ trat in Kraft. In 2024 haben wir die neuen Finanzierungsinstrumente entwickelt und schon zum Einsatz gebracht. Einige Resultate davon stehen bereits hier in den TAT-SACHEN.
In der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts scheint man vieles richtig gemacht zu haben, was die Translation von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Produkte, Industrien und soziale Innovationen anging. Schöne Häuser hat man dazu auch noch gebaut.
Vieles von SPRIND Gelerntes und Ermöglichtes muss nun in die Breite. Auch Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen leiden beispielsweise unter dem Besserstellungsverbot und überbordender Bürokratie. Wissenschaftsfinanzierung kann auch in einen „SPRIND-Modus“ schalten. Wir können sofort den IP-Transfer verbessern, die neuen Instrumente wie Startup Factories und DATI können für einen breiten Ausgründungsboom und die SPRIND für noch mehr Sprünge sorgen. Statt Förderprogrammen können Challenges, die schnell und für alle zugänglich sind, neuen Schwung in die staatliche Innovationsfinanzierung bringen. Innovativer staatlicher Einkauf kann Märkte schaffen, die es noch nicht gibt.
Bessere Anschlussfinanzierungen für die Scale-ups – also die Start-ups, die nun groß werden wollen und dafür erhebliche Mittel benötigen – müssen dafür sorgen, dass wir die neuen Industrien nicht nur hier erfinden, sondern auch hier halten. Dafür brauchen wir beispielsweise eine aktiengebundene Rente und eine funktionierende europäische Börse, die Liquidität für die Wachstumsfinanzierung neuer Unternehmen bereitstellen. Mit dem Erfolg kommt dann auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, um an diesem neuen Wohlstand zu partizipieren.
Auch Bildung müssen wir radikal neu denken. Wir müssen den Bildungseinrichtungen Zeit, Vorbilder und Mittel geben, um ein neues „Betriebssystem“ einzuspielen, das dem 21. Jahrhundert gerecht wird.
Herausgeber
SPRIND
BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN
Lagerhofstraße 4 04103 Leipzig
info@sprind.org www.sprind.org
Geschäftsführung
BERIT DANNENBERG
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA
Vorsitzender des Aufsichtsrats
DR.-ING. E. H. PETER LEIBINGER
Handelsregister Amtsgericht Leipzig (HRB 36977)
Redaktion
ELKE JENSEN
Editorin und Autorin
VERENA BÖTTCHER
Texte SPRIND-TEAMS
Fotografie
FELIX ADLER
MATTIA BALSAMINI
TILLMANN FRANZEN
Konzeption
MEIRÉ UND MEIRÉ
Art Direction
SVENJA WITTMANN
MEIRÉ UND MEIRÉ
Lithografie
MAX-COLOR, Berlin
Druck
DRUCKHAUS SPORTFLIEGER
Sportfliegerstraße 7 12487 Berlin
Redaktionsschluss
September 2024
Nachdruck nur mit Genehmigung gestattet. Alle enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

SPRIND.ORG
