HEIMAT FÜR RADIKALE NEUDENKER:INNEN
WIR FREUEN UNS AUF DIE ZUKUNFT –UND WOLLEN SIE MITGESTALTEN.
UNSER ZIEL IST ES, VON DEUTSCHLAND AUS NEUE SPRUNGINNOVATIONEN ZU SCHAFFEN:
PRODUKTE, SYSTEME ODER DIENSTLEISTUNGEN,
PRINZIPIEN
INNOVATIONEN ENTSTEHEN DURCH LEIDENSCHAFT
Wir tun, was wir tun, weil wir es lieben. Innovator:innen, die ebenso denken, wollen wir bei ihrer Arbeit, bei ihrem Vorankommen unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir nicht auf Kontrolle, sondern auf gemeinsame Ziele und Werte setzen.
ZUKUNFT KANN MAN GESTALTEN
Chancen sehen und nutzen, Visionen entwickeln und umsetzen. Wir haben große Lust darauf, die Dinge anzupacken und etwas zu tun. Zukunft ist, was wir daraus machen.
FORTSCHRITT BRAUCHT UNTERNEHMERISCHES DENKEN UND HANDELN
Wir wollen Ideen in Produkte und Dienstleistungen transferieren, die einen langfristigen Nutzen für Deutschland und Europa bringen. Deshalb denken und handeln wir immer unternehmerisch – mit der Agilität eines Start-ups.
MENSCH UND GEMEINWOHL STEHEN IM MITTELPUNKT
Wir glauben an humanistische Werte, an Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. Wir unterstützen ausschließlich zivile und keine militärischen Projekte. Das Gemeinwohl und Gesellschaftsthemen stehen im Vordergrund unserer Arbeit.
SCHEITERN GEHÖRT DAZU
Neugierde ist unser Antrieb. Wir brennen für die Lösung der großen Probleme und gehen dafür bewusst Risiken ein. Niemand will scheitern, aber wir haben keine Angst davor.
SPRUNGINNOVATIONEN BRAUCHEN STARKE NETZWERKE
Wir arbeiten über ganz Deutschland verteilt – und darüber hinaus. Wir glauben an starke Netzwerke – mit gemeinsamen Zielen.
ERFOLG BRAUCHT PERSÖNLICHKEIT UND TEAMARBEIT
Wir schaffen eine Umgebung, in der sich Persönlichkeiten entfalten, auf ihre Stärken konzentrieren und mit anderen Innovator:innen kooperieren können.
ESSAY
THOMAS RAMGE UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA DER GROSSE SPRUNG
» Innovare « heißt » erneuern «. Es heißt nicht » ein bisschen besser machen «.
Eine Sprunginnovation verändert unser Leben grundlegend zum Besseren und macht es nicht nur ein wenig bequemer. Sprunginnovator:innen finden mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik eine neue Lösung für ein relevantes Problem. Eine Sprunginnovation zerstört oft alte Märkte und schafft neue. Sie wirkt wirtschaftlich disruptiv und gefährdet jene, die in Pfadabhängigkeiten nur schrittweise innovieren, also erfolgreiche Technologien in kleinen Schritten verbessern. Manchmal durchlaufen Sprunginnovationen schmutzige Phasen, bevor sie viel nutzen und nicht mehr schaden. Gelingt ein großer wissenschaftlicher und technischer Sprung, zeigt er sich in Bildern und Statistiken, in Sprache und Kunst. Die Welt sieht nach ihm anders aus, und wir nehmen sie anders wahr. Manchmal haben Sprunginnovationen sogar die Kraft, politische Systeme zu Fall zu bringen und neue zu erschaffen. Sprunginnovationen sind oft Grundlage sozialer Innovationen.
Die erste Kulturpflanze war eine Sprunginnovation, das Einkorn vor rund 10.000 Jahren. Die Erfindung des Segelboots vor 6.000 Jahren hat die Welt verändert, wie später der Nagel, der Zement und das Papier. Der Buchdruck und optische Linsen waren Sprunginnovationen und natürlich Dampfmaschine, elektrischer Strom, Fotoapparat und Flugzeug. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es viele Innovationssprünge aus Deutschland, die unser Leben bis heute stark prägen: Röntgenapparat, Automobil, Kunstdünger, Aspirin. Doppelte Buchführung, industrielle Stahlproduktion und das Fließband sprunginnovierten weltweit die Wertschöpfung. War Penicillin die größte Sprunginnovation der Medizingeschichte? Oder das Wasserklosett? Oder doch die Antibabypille? Die Digitalcomputer der 1940er Jahre lösten die digitale Revolution und eine Reihe von Sprunginnovationen aus, darunter den Mikrochip, den PC und natürlich das Internet, das unser Leben in den letzten drei Jahrzehnten so stark verändert hat wie keine andere neue Technologie.
Mit dem ersten Internet-Smartphone, 2007 von Steve Jobs in die Welt gebracht, tragen wir eine Sprunginnovation in der Tasche und können die Finger nicht mehr von ihr lassen. Die Sprunginnovation der mRNA-Impfstoffe hilft uns, mit Wissenschaft und Technik aus Mainz und Tübingen die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Corona-Pandemie, zu bewältigen und uns gegen neue Epi- oder Pandemien zu wappnen. Was kommt als Nächstes? Niemand kann es sicher wissen, denn die Unberechenbarkeit liegt im Wesen der Sprunginnovation. Wohl aber kann man ihr auf die Sprünge helfen. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen sucht zum Beispiel seit Sommer 2021 in einem offenen Ideenwettbewerb nach einer radikal besseren Lösung, mit der Pharmakolog:innen künftig sehr viel schneller Medikamente gegen Viren entwickeln können. Wissenschaft und Technik sind bei der antiviralen Wirkstoffentwicklung erstaunlich erfolglos. Trotz steigender Gefahr werden beschämend wenige neue Wirkstoffe zugelassen. Hier braucht es endlich einen großen Sprung mit einem Medikament mit Breitbandwirkung ähnlich wie bei Antibiotika – nur eben nicht gegen bakterielle Krankheitserreger, sondern gegen Viren.
Wir bei der SPRIND sind Technikoptimist:innen. Wir sind davon überzeugt, dass Wissenschaft und Technik in den kommenden Jahrzehnten viele Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit finden werden. Sie werden uns grüne Energie aus Wind und Sonne, Wasserkraft und Kernfusion im Überfluss bringen. Diese könnte so günstig sein, dass es sich kaum noch lohnt, sie abzurechnen. Durch CO2-freie Energie für weniger als zwei Cent pro Kilowattstunde lassen sich Armut und Hunger weltweit radikal senken. Mit ihr können wir der Atmosphäre in großen Mengen Kohlendioxid entziehen und den Klimawandel aufhalten. Die Welt wird so deutlich friedlicher werden. Weniger Menschen müssen dann aus ihrer Heimat fliehen.
Forschende der Biomedizin verstehen mittlerweile den Bauplan des Lebens immer besser. Mithilfe von Gentechnologie und Gesundheitsdatenrevolution stehen wir an der wissenschaftlichen Schwelle, die großen Krankheiten kleinzukriegen: Krebs und Demenz, Herz-KreislaufErkrankungen und Autoimmunkrankheiten, psychische Erkrankungen und Lähmungen, Blindheit und schwere Hörschäden. Wir hoffen, dass es gelingt, den Alterungsprozess der Zellen deutlich zu verlangsamen, sodass wir gesünder älter werden können. Und vielleicht sogar Zeit mit unseren Ururenkeln verbringen.
» WIR
Durch Wissenschaft und Technik werden wir Biodiversität erhalten und den Tierschutz stärken. Denn ultraintensive Landwirtschaft, gerne vertikal und mit resistenten Züchtungen, kann den Flächenverbrauch für die Nahrungsmittelproduktion reduzieren. Fleisch kommt hoffentlich alsbald nicht mehr aus dem Mastbetrieb, sondern naturidentisch aus einer riesigen Petrischale. Wir werden elektrisch fliegen, in autonomen Drohnen, die keine Straßen brauchen. Für die Langstrecke gibt es CO2-neutrale Kraftstoffe, und vielleicht nehmen wir beim Flug nach Australien bald eine (zeitliche) Abkürzung durchs All. Digital sprunginnovierte Bildung wird so viel Spaß machen wie ein gutes Computerspiel, mit Robolehrern und menschlichen Pädagogen, die Peer Learning im Kleinen unterrichten. Vielleicht macht diese Art Bildung dann sogar ein wenig süchtig.
Wir wagen die Prognose: In zehn Jahren werden wir alle KI-Assistenten benutzen, die uns bei unseren Entscheidungen unterstützen und dabei unsere Interessen vertreten, und nicht jene von Amazon, Google oder Apple. Wir werden in den kommenden 20 Jahren ein System entwickeln, um große Asteroiden umzulenken, die auf die Erde zusteuern. Und obwohl nicht alle von uns bereit wären mitzufliegen: Wir hoffen, dass wir bis 2050 eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars gründen. Warum? Weil das uns Menschen helfen wird, unseren alten Pioniergeist neu zu entdecken und wieder den Mut zu entwickeln, wirklich große Sprünge zu wagen. Dieser Entdeckergeist ist so dringend nötig wie zu Zeiten von Christoph Kolumbus und Marco Polo.
MÜSSEN UNS ZUNÄCHST VON EINEM GEGENWARTSMYTHOS
VERABSCHIEDEN: WIR LEBEN IN WENIGER INNOVATIVEN ZEITEN, ALS WIR ZUMEIST GLAUBEN. «
Neue Technologie muss die Fehler der alten Technologie wieder ausbügeln. Nur durch Innovationssprünge werden wir wirtschaftlich und ökologisch aus Pfadabhängigkeiten wieder herausfinden, in die wir uns seit der Industrialisierung begeben haben und in denen wir festzuhängen scheinen wie die Nadel eines Plattenspielers in der Rille einer Schallplatte mit tiefem Kratzer. Für Deutschland, das Land des Automobils und der Spaltmaße, gilt dies in ganz besonderem Maße. Global gesehen kann uns nur radikal bessere Technologie helfen, die wachsende Weltbevölkerung ressourcenschonend zu versorgen, den Weltfrieden zu wahren und weitere regionale Kriege zu vermeiden. Dazu müssen wir uns jedoch zunächst von einem Gegenwartsmythos verabschieden: Wir leben in weniger innovativen Zeiten, als wir zumeist glauben.
In den letzten 15 Jahren kam der Fortschritt allenfalls in Trippelschritten voran. Die angeblich so disruptiven Plattformen aus dem Silicon Valley lösen Probleme, die wir eigentlich nie hatten. Auch vor Amazon konnten wir schon ganz gut einkaufen, vor Airbnb in Urlaub fahren und vor Uber ein Taxi telefonisch bestellen. Ja, auch wir bei der SPRIND hängen ständig auf Twitter rum und wollen die Bequemlichkeit einiger digitaler Dienste nicht mehr missen. Und ja, ein selbstfahrendes Auto wäre schon eine feine Sache. Aber selbst dieser Innovationssprung erschiene uns deutlich kleiner als jener bei der Erfindung des Fahrrads. Das Fahrrad machte das Reisen nicht bequemer, es vervielfachte den Bewegungsradius eines großen Teils der Bevölkerung. Es war eine Ermächtigungsinnovation. Das selbstfahrende Auto macht uns zu Beifahrern. Was wir zurzeit allenthalben sehen, ist die Simulation von Innovation. Innovationstheater. Rasenden Technologiestillstand.
Vielleicht brauchen wir keine weiteren Apps, Gadgets, Plattformen und digitalen Geschäftsmodelle, die unser Leben angeblich einfacher machen, aber uns de facto infantilisieren und überwachen. Wir brauchen also genau nicht jene Art von Scheininnovation, für die weltweit nahezu unbegrenzt Risikokapital zur Verfügung steht. Wir brauchen sprunghafte Innovationen, die das Leben einer größtmöglichen Anzahl von Menschen in größtmöglichem Umfang besser machen. Sinnvollen und sinnstiftenden Nutzen finden wir, wenn wir den Fokus bei der Suche nach neuen Anwendungen auf menschliche Bedürfnisse richten, von basalen Lebensgrundlagen bis zur Möglichkeit zu individueller Selbstverwirklichung, basierend auf der Ethik des britischen Philosophen und Sozialreformers Jeremy Bentham: auf die Maximierung des Glücks und Minimierung des Unglücks.
Doch wer bringt eigentlich Technologie in die Welt, die das Glück möglichst vieler Menschen maximiert und nicht den Gewinn weniger BigTech-Unternehmen? In der SPRIND-Sprache heißt die Antwort HiPos –High Potentials. Diese Sprunginnovatorinnen und -innovatoren sind Nerds mit einer Mission. Sie haben ein für andere schwer nachvollziehbares Interesse an einem Spezialgebiet, gerne an der Grenze zu manischer Besessenheit. HiPos sind ungewöhnlich resilient gegen Rückschläge. Und sie haben den tief verankerten Wunsch, mit ihrem Wirken auch Wirkung zu erzielen. Ihre Begeisterung steckt an. HiPos reißen ihre Teams mit. Bei der SPRIND haben wir das große Glück, schon eine Reihe davon kennengelernt zu haben – und Projekte zu starten.
Wie kann der Staat zugunsten der Sprunginnovation sinnvoll unternehmerisch tätig werden? Die USA und China machen in zwei unterschiedlichen Modellen vor, wie ein „Entrepreneural State“ (Mariana Mazzucato) die Technologieentwicklung erfolgreich beschleunigt, Wertschöpfung im eigenen Land hält und natürlich auch geopolitische Interessen verfolgt – oft auf Kosten der technologischen Souveränität in Europa. Bei der Gründung der SPRIND haben wir uns unter anderem die US-amerikanische Innovationsagentur DARPA genau angeschaut, wie sie arbeitet und warum sie Sprunginnovationen in Serie hervorbringt, wie das Internet, GPS und Rettungsroboter. Und auch bei der mRNATechnologie hat die DARPA maßgeblich mitgemischt.
Deutschland und die Europäische Union können von Unternehmerstaaten lernen, im „Tal des Todes der Innovation“ als risikofreudige Akteure aufzutreten. Das Tal beginnt, wo die Förderung von Grundlagenforschung endet, aber die Technologie noch nicht reif für einen Markt ist. Wagniskapitalgeber sind keineswegs so wagemutig, wie der Begriff vermuten lässt. Der Staat muss hier zum einen viel stärker seine Einkaufsmacht nutzen, indem er hochinnovative Produkte bestellt, bevor sie kommerziell fertig entwickelt sind. Das müssen nicht zwingend Impfstoffe oder Quantencomputer sein. Auch günstige Wärmepumpen und Fassadenisolation, 20-GW/h-Windparks oder 100.000 Wohnungen in gutem Ökostandard für 1.500 Euro pro Quadratmeter wirken gesellschaftlich sprunginnovativ. Zweitens coinvestieren erfolgreiche Unternehmerstaaten wie die USA, Taiwan, Südkorea, Singapur und natürlich auch China massiv in Innovationen und erzielen dabei, volkswirtschaftlich gerechnet, einen sehr guten Schnitt. Staat und Gesellschaft haben ein anderes Rückflussmodell als Wagniskapitalfonds. Bei Letzteren zählt nur das Geld, in Gesellschaften auch bessere Gesundheit, gute Arbeit, saubere Umwelt, höhere Steuereinnahmen, erfolgreicher Strukturwandel und geopolitischer Anspruch.
Bemerkenswert dabei ist: Kapital ist nicht die knappe Ressource. Alleine das Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland beträgt rund 8 Billionen Euro. Die knappe Ressource ist Risikointelligenz. Wir müssen endlich verstehen: In Zeiten technologischer Paradigmenwechsel besteht das größte Risiko darin, keine Risiken einzugehen und auf die lineare Fortschreibung der Gegenwart zu setzen. Doch genau das tun wir mit unserem volkswirtschaftlichen Fimmel für „mündelsichere Anlagen“ und unserer Skepsis gegenüber Wagniskapital, besonders wenn es in der Wachstums- und Exitphase ums Klotzen geht und nicht ums Kleckern bei den Frühphasen-Investitionen von Start-ups. Umso bedenklicher ist, dass die wenigen Rosinen hochinnovativer Start-ups aus Deutschland von nichteuropäischen Investoren gepickt werden, sobald sich ihr Erfolg abzeichnet und dreistellige Millionenbeträge für den letzten Sprung zum Weltunternehmen mit Technologieführerschaft nötig sind. 5 Prozent von 8 Billionen Euro sind 400 Milliarden. Dies wäre eine sinnvolle Risikostreuung einer Gesellschaft, die technologische Zukunft mitgestalten – und an dieser mitverdienen – möchte und letztlich auch muss.
Die gute Nachricht ist: Wir haben die Forscher:innen. Wir haben die Ingenieur:innen. Wir haben das Kapital. Wir müssen die Sprunginnovierenden eigentlich nur machen lassen. Der deutsche Staat kann mit innovativer Förderpolitik dabei helfen, eine neue Kultur offener Innovation zu schaffen.
Daran glauben wir, und daran arbeiten wir.
PS: Einige werden unser Zukunftsbild als zu technikbestimmt und technikoptimistisch wahrnehmen. Einige werden diesen Optimismus gar als naiv empfinden. Das können wir nachvollziehen, zumindest teilweise. Frei nach Odo Marquard: Das Neue muss beweisen, dass es besser ist als das Alte. Nicht umgekehrt. Das stimmt. Doch das Alte und Erprobte erscheinen uns in Anbetracht von mehreren existenziellen Bedrohungen der Menschheit nicht mehr so wirklich zukunftsfähig.
PPS: Pessimismus ist Zeitverschwendung und macht schlechte Laune.
SINNVOLLEN UND SINNSTIFTENDEN NUTZEN FINDEN WIR, WENN WIR DEN FOKUS BEI DER SUCHE NACH NEUEN ANWENDUNGEN AUF MENSCHLICHE BEDÜRFNISSE RICHTEN:
AUF DIE MAXIMIERUNG DES GLÜCKS UND MINIMIERUNG DES UNGLÜCKS.
FINANZIERUNG
PROJEKT-GMBHS
NACH EINEM ERFOLGREICHEN ANALYSEUND BEGUTACHTUNGSPROZESS KÖNNEN FÜR PROJEKTE, IN DENEN WIR SPRUNGINNOVATIONSPOTENTIAL ERKENNEN, PROJEKT-TOCHTER-GESELLSCHAFTEN GEGRÜNDET UND BEDARFSGERECHT MIT AKTUELL ZWISCHEN 4 UND 15 MILLIONEN EURO PRO JAHR FINANZIERT WERDEN.
WÄHREND DES BEGUTACHTUNGSPROZESSES KÖNNEN FÜR EINE VERTIEFTE PRÜFUNG EINZELNER FRAGEN VALIDIERUNGSAUFTRÄGE VERGEBEN WERDEN.
CHALLENGES
BEI DEN SPRIND CHALLENGES ERHALTEN TEAMS MIT SPRUNGINNOVATIONSPOTENTIAL AKTUELL PRO WETTBEWERBSSTUFE ZWISCHEN 500.000 UND 3 MILLIONEN EURO. DIE FINANZIERUNG ERFOLGT ALS VORKOMMERZIELLER AUFTRAG FÜR FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSLEISTUNGEN.
WENN AUS WEGWEISENDEN IDEEN WEGWEISENDE UNTERNEHMEN WERDEN:
PROJEKTE

MICROBUBBLES

MÜSSEN MIKROFLOTATION NOCH INTELLIGENTER MACHEN. «



MAKROLÖSUNG FÜR DAS MIKROPLASTIK-PROBLEM
DER INNOVATOR: ROLAND DAMANN, ERFINDER UND WELTREISENDER IN SACHEN WASSERQUALITÄT
DIE GROSSE NEUE IDEE, DIE IHN UMTREIBT: MIKROFLOTATION DIREKT IN FLÜSSE UND MEERE BRINGEN
SPRIND UND MICROBUBBLES
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil Mikroplastik ein ernstzunehmendes globales Problem ist – mit bisher kaum abschätzbaren negativen Auswirkungen auf unser Ökosystem. Weil wir Vorreiter sind und Lösungen entwickeln wollen, noch bevor rechtliche Bestimmungen uns dazu zwingen. Weil uns die Leidenschaft und Energie des Innovators von der ersten Sekunde an überzeugt haben.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Aus der Idee haben wir eine GmbH gegründet. Wir liefern die Rahmenbedingungen, damit sich der Innovator und sein Team zu 100 Prozent auf die Arbeit konzentrieren können. Wir promoten das Thema auf Messen und Kongressen und unterstützen dabei, öffentlich sichtbar zu werden.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die Entwicklung einer revolutionäre Technologie zur Wasserund Abwasserreinigung – kostengünstig, mit geringem Energiebedarf, autonom. Mit der wir einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und zur proaktiven Verbesserung aller Gewässer leisten können. Das große Ziel: sauberes Wasser, frei von Mikroplastik und Mikroschadstoffen.
WEITERDENKEN
Die Technologie bietet weitreichendes Innovationspotential, auch außerhalb der Mikroplastikproblematik. Was ist möglich und wie helfen uns kleine Bubbles dabei, die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen? Das wollen wir wissen.

» WIR MÜSSEN MEHR BEWUSSTSEIN SCHAFFEN –
NICHT NUR FÜR PLASTIKVERBRAUCH, SONDERN GENERELL KONSUM, UND DAZU BEITRAGEN, BEIDES ZU REDUZIEREN. «
Wenn man Roland Damann fragt, wie er zu SPRIND kam, kann er sich begeistern: „Ich habe den Podcast Start-up-DNA gehört, in dem Rafael Laguna mit Unternehmer Frank Thelen über SPRIND gesprochen hat. Ich fand das gut, neu und ziemlich inspirierend. Also habe ich mich gleich mit meinem Projekt bei SPRIND gemeldet. Irre war allerdings, dass ich schon am nächsten Tag eine Antwort erhalten habe.“
Aber fangen wir vorne an, werfen wir einen kurzen Blick auf Damanns rastloses Leben als leidenschaftlicher Ingenieur, Erfinder, Unternehmer und Weltreisender in Sachen Wasserqualität: In den 1980ern entwickelte er ein Sauerstoffeintragssystem, das die Aquakultur und Fischzucht weltweit revolutionierte. In den 1990ern avancierte er mit seiner Ingenieurfirma zum Experten für Schmutzwasserbehandlung durch Flotation, ein Verfahren, das auf den ersten Blick schon im Mittelalter bekannt war. Das Prinzip – hydrophobe Partikel lagern sich an Gasblasen an und werden von ihnen an die Oberfläche transportiert – hat sich nicht verändert und Damann hat daraus eine hochenergie-
effiziente und perfekt regelbare Mikroflotation mit über 350 Referenzen in über 50 Ländern geschaffen, die diesen Begriff mit perfektem Inhalt füllt. Für seinen unermüdlichen Einsatz, diese Mikroflotation zum Standard für Abwasserbehandlung zu machen, ist er unter anderem mit dem Innovationspreis Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Was er aber nicht als Ruhekissen, sondern als Anfeuerung und Verpflichtung begreift. Aus dem kleinen Paderborn heraus denkt Roland Damann groß: „Wir müssen Mikroflotation noch intelligenter machen.“
DIE INNOVATION: MIKROBLASEN GEGEN MIKROPLASTIK
Nüchtern betrachtet ist es so: Mikroflotationssysteme funktionieren hervorragend, aber nur, indem man sie „neben ein Gewässer stellt“. Man muss das Wasser aus Seen oder Meeren herauspumpen bzw. isolieren, um es zu reinigen. Für überschaubare Wassermengen (von Kommunen und Industrieanlagen) genial, für Großgewässer und ihre Riesenverschmutzungsprobleme leider irreal. Bis jetzt.
Die große neue Idee, die Roland
Damann umtreibt: mikroskopisch kleine Luftbläschen direkt und autonom in Regenrückhaltebecken, Seen, Flüsse und Meere zu injizieren. „Wir werden unter anderem ein kompaktes Schwimmmodul als Träger aufs Wasser setzen. In der Mitte des Rings produzieren wir bei einem minimalen Energieaufwand Mikrobläschen mit einem Durchmesser von 10 bis 50 Mikrometern, das ist etwa ein Drittel eines Haars. Sie bilden eine nebelartige Blasenwolke mit extrem hoher Dichte, zwei Millionen Blasen pro Liter, die alle ganz langsam aufsteigen, dabei auch feinste Mikroplastikpartikel wie ein Magnet anziehen, festhalten und an die Oberfläche transportieren. Dort ziehen wir alles ab – und haben dann so gut wie 100 Prozent schwebstoff- und dann auch Mikroplastik-freies Wasser. Ohne Chemie, wartungsfrei, mit extrem geringem Energieaufwand. Dabei zielen wir speziell auf feinste Verunreinigungen, wie zum Beispiel Reifenabriebe und die extremen Feinstkunststoffpartikel, im Wasser ab. Roland Damann und sein Team arbeiten derzeit intensiv an einem schwimmfähigen Prototyp, um hydraulische Studien im offenen Wasser durchzuführen.
KANN ZUM ERSTEN MAL
SPRUNGINNOVATION IN DER UMWELTTECHNOLOGIE
Er nennt das seinen Lebenstraum. Wir nennen das: eine Sprunginnovation in der Umwelttechnologie. Um dieser zum Durchbruch zu verhelfen, wurde im April 2021 mit Unterstützung der SPRIND die MicroBubbles GmbH gegründet – und seither ist viel passiert. Nicht nur soll der SchwimmringPrototyp im Herbst 2022 seinen Stapellauf erleben. Auch das Team mit einer für den Bereich Umwelttechnik geradezu sensationellen Frauenquote von 40 Prozent ist angewachsen auf elf Mitarbeiter:innen, die ihre vielfältigen Fachkenntnisse zum Beispiel aus den Bereichen Anlagenbau, Meteorologie, Ozeanografie, Maschinenbau sowie Kunststoff- und Verfahrenstechnik mit großer Leidenschaft einbringen. Dafür entstand im Inventors’ Labspace in Bad Lippspringe in der Nähe von Paderborn auch der richtige Rahmen: eine 400 Quadratmeter große Laborfläche inklusive Versuchswerkstatt. „Dort können wir nun Experimente im skalierbaren Maßstab vornehmen, kreativ sein, testen und noch besser an praktischen Umsetzungen arbeiten“, ist Damann begeistert.
Auf einer weiteren Testfläche auf dem Gelände des Stadtentwässerungsbetriebs Paderborn kann das Team seine Technik zur Elimination von Mikroplastik aus Abwasser ebenfalls ab Herbst 2022 in der Praxis unter Beweis stellen. Drei Laborund Büro-Container mit Messtechnik und eine Pilotanlage sind dann zur Untersuchung von Abwasserströmen in Betrieb. An einer zweiten Pilotanlage in Bad Lippspringe wird ab dem gleichen Zeitpunkt Oberflächenwasser untersucht.
All das betrifft noch immer den Kern der ursprünglichen Idee, doch MicroBubbles will noch viel mehr Neues wagen und künftig ein ganzes Ökosystem etablieren: „Einfach nur die Technik bereitzustellen, reicht nicht aus. Deswegen werden wir auch überhaupt erst Wege und Instrumente finden, die Mikroplastik-Hotspots zu identifizieren, um die Mikroflotation dann dort zum Einsatz zu bringen.“ Das Ökosystem zu verändern, bedeutet dabei für Damann und sein Team auch, frühestmöglich einen Wandel zu bewirken: „Wir müssen mehr Bewusstsein für Plastikverbrauch und Konsum schaffen und dazu beitragen, sie zu reduzieren.“ Eine weitere Vision ist
zudem, eine Wissensdatenbank als riesigen Datenlieferanten rund um Plastik und Mikroplastik zu entwickeln.
Nicht zuletzt haben sich Damann und seine ambitionierten Mitarbeiter:innen eine Global-Water-Strategie auf die Fahne geschrieben: „Eine halbe Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Trinkwasser und erhält Wasser zum Teil aus Trinkbeuteln, die immens viel Plastik, Spuren- und Mikroschadstoffe bedeuten, die in die Umwelt gelangen. 3,6 Milliarden Menschen haben überdies keinen Zugang zu sanitären Anlagen.“ Die heutige Klärtechnik ist im Wesentlichen älter als 2.000 Jahre und in vielen Teilen der Welt nicht verfügbar. „Konkret bedeutet das, wir brauchen eine neue Architektur der Wasser- und Abwassertechnologie, die auch in Ländern ohne Abwasserinfrastruktur funktioniert und dort unkompliziert eingesetzt werden kann“, schildert Roland Damann – große Ziele für kleine Bubbles.
» ICH
ETWAS MACHEN, WOVON ICH WIRKLICH ÜBERZEUGT BIN. UND BEI DEM NICHT DER WIRTSCHAFTLICHE ERFOLG DER TREIBER IST, SONDERN ALLEIN DER ERFOLG DER IDEE. «
VIAHOLO



IN WEITER FERNE GANZ NAH:
DAS HOLODECK REVOLUTIONIERT UNSERE ART ZU KOMMUNIZIEREN
DER INNOVATOR: MIRO TAPHANEL, PASSIONIERTER INGENIEUR UND PROBLEMKNACKER
SPRIND UND VIAHOLO
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil wir mit dem Projekt Augmented Reality alltagstauglich machen. Weil der technische Ansatz bisherige Grenzen sprengt. Weil das Potential unermesslich ist.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Aus einem Forschungsprojekt ein Unternehmen schaffen. Brillanten Innovatoren das Netzwerk und das Kapital bereitstellen, um ihre Innovation in die Anwendung zu bringen.
FREIRÄUME SCHAFFEN, ZIELSETZUNG VORGEBEN
Die Innovatoren definieren die technische Ausrichtung, die SPRIND begleitet das Projekt als enger Partner und unterstützt bei wegweisenden Entscheidungen.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die Revolution der Online-Meetings. Augmented Reality als Zukunftsbranche. AR-Brillen als täglichen Begleiter und Plattform-Technologie.
DAS HOLODECK MACHT ALLES MÖGLICH, WAS KOMPLEXE MENSCHLICHE KOMMUNIKATION AUSZEICHNET.



Miro Taphanel wollte immer schon Ingenieur werden. Denn Ingenieure erschaffen die Produkte, mit denen wir uns umgeben. Sie knacken existenzielle Probleme. So studierte er zunächst Maschinenbau und ging dann zur Informatik über, weil ihn da die noch höhere Komplexität besonders reizte. Man kann sagen: Miro Taphanel fühlt sich ziemlich wohl in der Technologie- und Komplexitätsgesellschaft von heute. Er lebt, forscht und entwickelt nach dem Motto: „Alles, was man nicht weiß, ist interessant.“ Den privaten Taphanel gibt es auch: Er geht, falls er es zeitlich schafft, segeln – nicht gemütlich, sondern mit Regattaehrgeiz. Ansonsten lebt er mit Frau, Klein-Sohnemann und -Tochter „gut in Karlsruhe“, wie er sagt, in einem selbst gebauten Häuschen.
Von Karlsruhe aus treibt Dr.-Ing. Miro Taphanel auch seine eigene Firma Gixel voran. Zusammen mit seinen Mitgründern Felix Nienstädt und Dr.-Ing. Ding Luo ist er gerade dabei, ein massives Problem zu lösen: die Remote-Kommunikation der Zukunft. Felix Nienstädt, Informatiker und Diplom-Ingenieur-Architekt, verfügt über vielfältige Erfahrung in der Datenverarbeitung und in allem, was KI ist. Er hat unter anderem Datawarehouses aufgesetzt und betreut. Er nutzt sein umfassendes Programmierwissen, um Software zu entwickeln, die so exzellent gedacht wie wartungsfreundlich ist. Ding Luo hat in einem höchst komplizierten Feld promoviert: in Hochgeschwindigkeits-Oberflächenprofilometrie auf Basis von adaptiver Mikroskopie. Er gilt als Experte auf den Gebieten Optische Messsysteme und Computational Imaging. Seine Spezialität: die rapide Übersetzung von Theorie in funktionierende Software.
DAS HOLODECK HEBT DIE REMOTE-KOMMUNIKATION AUF EIN NEUES LEVEL
Was ist das ominöse Holodeck? Ein echter Raum, den ein echter Mensch betritt, um sich dort „virtuell“ mit einem, zwei, drei oder 15 anderen echten Menschen zu treffen und zu kommunizieren. Ohne dass alle am gleichen physischen Ort sein müssen. Im Holodeck nimmt man andere Personen und Dinge visuell und akustisch ganz realistisch wahr. Man ist mit ihnen so in Kontakt, dass es sich „total echt“ anfühlt – und nicht wie in einer unterkomplexen, überermüdenden Videokonferenz.
Das Realistische, Echte, Natürliche der Remote-Kommunikation ist das ganz Neue, die „Killer-Applikation“, wie Miro Taphanel das nennt. Und um diese Natürlichkeit zu erzeugen, ist das Holodeck vollgepackt mit perfekt abgestimmter Technik, mit hochpräziser Lokalisierungs- und Videotechnologie. Und: Der Mensch im Holodeck trägt eine AR-Brille, die Gixel komplett selbst entwickelt hat. Sie hat ein extrem großes Sichtfeld und erzeugt damit ein immersives Gefühl von Nähe. Außerdem ist sie so klein und leicht, dass man sie wie eine normale Brille tragen kann – während man gleichzeitig zum Beispiel an einer Tastatur sitzt und arbeitet, also produktiv im Hier und Jetzt ist. „Zusammengehalten wird das ganze Holodeck-System übrigens von brillanter Software“, betont Taphanel.
Also: Die Kommunikation im Holodeck ist so natürlich, menschenfreundlich und vielschichtig, wie sie als RemoteKommunikation nur sein kann. Der menschliche Körper wird hier in Lebensgröße erfasst, man hat echten Augenkontakt und kann nonverbal über Gesichtsausdrücke,
Gesten, Körperhaltung und -bewegungen kommunizieren. Ganz wichtig: Man kann mit mehreren Personen gleichzeitig in Kontakt sein, die Dynamik von Gruppen spüren und nutzen.
Miro Taphanel ist sicher: Das Holodeck macht alles möglich, was komplexe menschliche Kommunikation auszeichnet. Es hebt damit die Remote-Kommunikation auf ein neues Level. Und das wird unsere Gesellschaft massiv verändern, weil der physische Ort an Bedeutung verliert, wenn ein „gefühlt reales“ Treffen im Holodeck jederzeit möglich ist. Für international operierende Unternehmen heißt das zum Beispiel: Warum sollten Mitarbeiter:innen immense Reisekosten und Klimaschäden produzieren, weil sie stundenlang im Auto oder Flugzeug sitzen müssen, um sich dann übermüdet zu Meetings zu treffen. Da stellt man doch lieber ein Holodeck auf, trifft sich stressfrei, kommuniziert ganz natürlich und nicht zuletzt: schützt das Klima. Sind wir denn wirklich schon so weit? „Absolut“, sagt Miro Taphanel. „Bei Gixel machen wir schon jetzt keine Videokonferenzen mehr. Wir treffen uns nur noch im Holodeck.“
Den Prototyp gibt es also schon. Auch Bundesforschungsministerin Bettina StarkWatzinger konnte diesen bei ihrem Besuch bei der SPRIND am 14. März 2022 testen. Um intensiv am nächsten Schritt zur Serienreife zu arbeiten, wurde im Oktober 2021 die SPRIND-Tochter VIAHOLO gegründet. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung durch die Bundesagentur für Sprunginnovationen soll das Holodeck nun die wichtigen nächsten Stufen erklimmen.



PRINNOVATION



HEILSAME ZERSTÖRUNG
WIE DIE ALZHEIMERSCHE KRANKHEIT BESIEGT WERDEN KANN
DER INNOVATOR: DIETER WILLBOLD, ALZHEIMER-REVOLUTIONÄR
SPRIND UND PRINNOVATION
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil wir die Alzheimer-Demenz heilen wollen. Weil wir An gehörige entlasten wollen. Weil wir die immensen Kosten und somit die Last für die Gesellschaft deutlich senken wollen. Weil wir von der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit unseres Wirkstoffs überzeugt sind. Weil wir den neuartigen anti-prionischen Wirkmechanismus gegen sich selbst vermehrende, toxische fehlgefaltete Moleküle in Patient:innen beweisen wollen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Langzeit-Toxizitätsstudien durchführen. Klinische Phase-IIStudie zur Testung der Wirksamkeit unseres innovativen Wirkstoffs in Patienten mit Alzheimer-Demenz vorbereiten. Klinische Phase-II-Studie an Patient:innen mit Alz heimerDemenz durchführen. Wissenschaftliche Ergebnisse sammeln und der Gesellschaft zugänglich machen.
BLOCKBUSTER- POTENTIAL AUF DEM MARKT Alzheimer-Demenz ist eine der betreuungsintensivsten Krankheiten und verursacht entsprechend hohe Kosten für die Gesundheitssysteme – wir wollen die hohen Betreuungskosten von Alzheimer-Patient:innen senken. Es gibt einen milliardenschweren Markt für Alzheimermedikamente.
PLATTFORMVALIDIERUNG
Neuer anti-prionischer Wirkmechanismus wird validiert. Bei Erfolg kann die Erforschung weiterer neurodegenerativer Krankheiten mit prionischem Ursprung angestoßen werden.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Aufhalten des Krankheitsfortschritts und Heilung der Alzheimer-Demenz. Altern in Würde ermöglichen. Eine enorme Aufwertung des Wirtschaftsund Wissenschaftsstandortes Deutschland. Weltverbesserung.

Die Alzheimer’sche Krankheit: eine Plage, die Gehirne, Leben, Menschen zerstört. Der Zerstörungsprozess läuft in perfider Unaufhaltsamkeit so ab: Da gibt es ungefährliche Einzelproteine, die Monomere, im Gehirn, die Abeta-Moleküle. Diese ballen sich zusammen und schaffen es dabei irgendwie, toxisch zu werden. Noch schlimmer: Die toxischen Knäuel, die Oligomere, vermehren sich selbst auf Kosten der Monomere und lassen immer mehr Neuronen im Gehirn sterben. Die Hirnmasse nimmt ab, der Mensch verliert nach und nach alles, was seine Menschlichkeit ausmacht.
„SIND DIE TOXISCHEN STRUKTUREN BESEITIGT, KANN MAN DIE VERHEERENDE KRANKHEIT STOPPEN.“
Prof. Dr. Dieter Willbold schaut auf diesen Horrorprozess schon lange mit wissenschaftlicher Abgeklärtheit und Akribie. Einerseits als Experte für alles, was mit der Struktur, Funktion und Dysfunktion von Proteinen zu tun hat. Vor allem aber – und das ist revolutionär – schaut er urphysikalisch, gleichgewichtsorientiert. So wird ihm klar, wo der Hebel für eine Heilung angesetzt werden muss: Es gilt, das Gleichgewicht zwischen dem guten Einzelprotein und dem toxischen Knäuel zu verschieben. Und das geht nur, so Willbold, indem man einen Wirkstoff hinzufügt, der effizient ins Gehirn gelangt und dafür sorgt, die Monomer-Struktur zu stabilisieren und die Oligomere in ungefährliche Monomere zu zerlegen.
Genau diesen geradezu magischen Wirkstoff hat Dieter Willbold – mit seinem Unternehmen Priavoid, einer ForschungsAusgründung – entwickelt. PRI-002 ist ein sogenanntes All-D-Peptid, relativ günstig herstell- und oral verabreichbar. Es muss also zum Beispiel nicht intravenös injiziert werden – ein riesiger Vorteil für Patient:innen. „Der Wirkstoff ist
wichtig, die Sprunginnovation liegt aber im mode of action“, stellt Willbold klar. „Der Prozess ist das Bahnbrechende, das Zerlegen neurotoxischer Protein-Verbünde in harmlose Monomer-Bausteine.“ Und er führt weiter aus: „Sind die toxischen Strukturen beseitigt, kann man die verheerende Krankheit stoppen.“
Die klinische Phase-I-Studie an gesunden Proband:innen, in der es um Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs geht, ist bereits erfolgreich verlaufen. Um das Therapeutikum zusammen mit der SPRIND weiterzuentwickeln, wurde im August 2021 die PRInnovation GmbH, ein Tochterunternehmen der SPRIND, gegründet; die PRInnovation GmbH übernimmt dabei die Aufgaben und Pflichten des Sponsors der klinischen Studie. PRInnovation und Priavoid bilden eine Forschungskooperation, bei der inzwischen rund zehn Mitarbeiter:innen angestellt sind, um die Wirksamkeit von PRI-002 im nächsten Schritt im Rahmen einer klinischen Phase-II-Studie an AlzheimerPatienten unter Beweis zu stellen. Rund ein Jahr nach Gründung der PRInnovation standen die Chancen dafür nie besser. So konnte 2022 eine klinische Phase-Ib-Studie unter Beteiligung von Patient:innen, die unter leichter kognitiver Beeinträchtigung, einer Vorstufe von Demenz, oder an leichter Alzheimer-Demenz leiden, mit erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen werden. Unter anderem war die Studienmedikation gut verträglich und es waren keine Nebenwirkungen mit Bezug zur Behandlung zu verzeichnen. Zusätzlich konnten wichtige Erkenntnisse zur Aufnahme des Wirkstoffes gewonnen werden. „Besonders eine Behandlung über einen Zeitraum von Jahren, wie er bei der Alzheimererkrankung notwendig ist, um therapeutische Erfolge zu erreichen, verlangt eine hohe Verträglichkeit des Wirkstoffes, gute Praktikabilität der Applikation und
die Abwesenheit von Nebenwirkungen“, erklärt Prof. Dr. Oliver Peters, der von klinischer Seite zum Team gekommen ist und als Chief Medical Officer neue Impulse setzt, „die Ergebnisse der aktuellen klinischen Studie mit PRI-002 stimmen uns in diesem Kontext sehr positiv.“
Dem Leiter der Gedächtnissprechstunde und des Zentrums für Demenzprävention an der Berliner Charité, der seit über 20 Jahren zu Alzheimer forscht, ist wichtig, wie praktikabel die Behandlung im Kontext anderer Erkrankungen und notwendiger Begleitmedikation ist. „Im zumeist hohen Alter unserer Patient:innen müssen wir davon ausgehen, dass bereits viele andere Medikamente, wie Blutdrucksenker und Blutverdünner, eingenommen werden. Wichtig ist, Interaktionen zwischen den Medikamenten zu vermeiden. Diesbezüglich sind wir aufgrund des Wirkmechanismus von PRI-002 äußerst optimistisch.“
Der größte Meilenstein, den es bis zur klinischen Phase-II-Studie, der Langzeitstudie mit Erkrankten, noch zu erreichen gilt, ist die Langzeittoxikologie. Die komplexe Sicherheitsprüfung wurde bereits im Frühjahr 2021 in die Wege geleitet; die Untersuchungen dauern noch an. Verläuft alles gut, kann Phase II, die im Idealfall im Spätsommer 2023 beginnt, beantragt werden. Diese wird multizentrisch durchgeführt, das heißt, ca. 30 Krankenhäuser nehmen als Prüfzentren in Deutschland und Europa mit Patient:innen teil. „Es sind keine Wunder zu erwarten, dass wir plötzlich schneller fertig sind, denn täglich können neue Hürden auftauchen, die unser Vorhaben verzögern – zumal wir uns in einem äußerst dynamischen und kompetitiven Umfeld bewegen“, sagt Dieter Willbold. „Doch bisher verläuft alles erfreulich nach Plan.“
HINTERGRUND:
Dieter Willbold ist Professor für Physikalische Biologie an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf und Direktor des Instituts für Strukturbiochemie im Forschungszentrum Jülich. Aber natürlich forscht er nicht allein, sondern ist in ein Netz hochkompetenter Kolleg:innen und wissenschaftlicher Freunde eingebunden. So hat ihn zu seinem Unternehmen PRIAVOID der Biophysiker und PrionForscher Prof. Dr. Detlev Riesner animiert: „Willbold, das ist eine tolle Idee, jetzt müssen Sie mal in die Pötte kommen und ausgründen.“ Riesner ist Mitbegründer
mehrerer Biotech-Unternehmen, unter anderem des Diagnostikunternehmens QIAGEN . Und ihn verbindet eine lange Freundschaft mit Prof. Dr. Stanley Prusiner, der 1997 den Medizinnobelpreis erhielt –für die Entdeckung, dass es Krankheitserreger gibt, die nicht aus DNA oder RNA bestehen, sondern aus Proteinen. Ihnen gab er den Namen PRION. Die anti-prionische Wirkweise von PRI-002 inspirierte Dieter Willbold dazu, seine Ausgründung PRIAVOID zu nennen. PRIAVOID überträgt das anti-prionische Wirkprinzip von PRI-002 auf weitere Proteinfehlfaltungserkrankungen wie zum Beispiel Parkinson.


BEVENTUM


DEN WIND ERNTEN
DIE BINNENWINDANLAGEN DER ZUKUNFT
DER INNOVATOR: HORST BENDIX, DER MANN FÜRS SCHWERE
SPRIND UND BEVENTUM
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
In Deutschland ist der Mangel an Standorten für Windenergieanlagen ein starker Hinderungsgrund für eine unabhängige und zukunftssichere Energieversorgung. Das von Prof. Bendix vorgeschlagene Konzept bietet zwei Möglichkeiten, diese Hinderungsgründe zu überwinden: einerseits durch Windräder, die so groß sind, dass sie einfach den Wind oberhalb existierender Windparks ernten können, andererseits durch eine so einfache wie findige Art, Windräder für alle erschwinglich zu machen und so unzählige weitere Standortpotentiale außerhalb von Windparks zu nutzen. So ist beispielsweise auch ein Strukturwandel für existierende Braunkohlegebiete denkbar.
DAS IST DAS POTEN TI AL, DAS WIR SEHEN
Bei der Aufstockung bestehender Windparks um eine zweite Ebene ist das Potential offensichtlich. Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern kommen wir in Höhen, die bisher völlig ungenutzt blieben und bei der Aufstockung bestehender
Windparks mit deutlich geringerem Genehmigungsaufwand zu erreichen sind. Die günstige Lösung mit mittleren und kleinen Windrädern wird attraktiv für jegliche Industriegebiete in Deutschland, ob ein Windrad mit 20 Metern Nabenhöhe auf jedem Hinterhof oder ein sechs Meter hohes und sehr leichtes Windrad auf allen Flachdächern, das irgendwann so alltäglich ist wie Solaranlagen auf diesen Dächern.
EINEN IMPULS SETZEN
Das Ziel der Windenergiebranche ist die ständige Optimierung technischer Eigenschaften und die weitere Steigerung der Effizienz. Das hat uns weit gebracht. Gleichzeitig verspielen wir viel Potential, weil wir nicht auf rechtliche Rahmenbedingungen blicken oder viele Regionen als nicht ertragreich ansehen. Wir fokussieren uns bewusst auf Windräder, die nicht technisch auf Effizienz getrimmt, sondern derart gestaltet und günstig sind, dass sie ohne allzu großen Genehmigungsaufwand auf Hinterhöfe und Dächer gestellt werden können und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung idealerweise fast schon hinfällig wird – so wird die Windenergie für jeden interessant.
Ka um ein Thema wird derzeit so heiß gehandelt wie das um erneuerbare Energien, ihren schnellstmöglichen Ausbau auf mehr Flächen, um Unabhängigkeit der Energieversorgung von anderen Ländern und den Kampf gegen den Klimawandel. Der Wirbel um Wind gibt dabei nicht zuletzt der beventum GmbH, Tochter der SPRIND, Auftrieb.
Ausgangspunkt für ihre Gründung im Dezember 2020 waren die jahrzehntelangen Arbeiten an einer Höhenwindanlage von Prof. Horst Bendix, einem Ur-Leipziger, der viele Jahre lang Technik- und Forschungschef beim Leipziger Schwermaschinenbauer Kirow gewesen war, zudem auch Hochschul-Professor und Berater in Ingenieurdingen, enthusiastischer Maschinenbauer und Erfinder. Mit insgesamt 60 Neu- und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Fördertechnik und des Schwermaschinenbaus war er in internationalen Wettbewerben erfolgreich – und lancierte mit seiner Einreichung sein Herzensprojekt bei der SPRIND.
HOCH HINAUS
Je höher Windräder sind, desto effizienter arbeiten sie, weil der Wind in der Höhe deutlich stetiger ist und stärker weht. Warum baut man sie dann nicht einfach höher? Angestoßen durch Horst Bendix hat sich mit dieser Frage das inzwischen auf über zehn Mitarbeiter:innen angewachsene Team der beventum beschäftigt. Die Antwort lautet im Wesentlichen: Es hat sich noch niemand getraut. Bis jetzt: Die beventum hat inzwischen drei vielversprechende Konzepte validiert – und
will nun den Versuch wagen, das weltweit erste Höhenwindrad zu bauen. Derzeit sucht das junge Unternehmen Partner aus, die den über 350 Meter hohen Prototyp errichten.
Das Mehr an Wind in der Höhe senkt die Stromentstehungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Windrädern in vergleichbaren Windzonen, sodass sich der höhere Aufwand für den Bau mehr als lohnt. Die Vision besteht darin, diese Höhenwindräder, die etwa doppelt so groß sind wie bisherige Windräder, als zweite Ebene in die bestehenden Windparks zu integrieren. Zusätzlich können und sollen Höhenwindräder zur innovativsten, wirtschaftlichsten und schnellsten Lösung der Neuausrichtung der ehemaligen Braunkohlereviere werden. Sowohl die laufenden Reviere in Sachsen und Nordrhein-Westfalen als auch die ehemaligen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg können so ganz realistisch zu windenergiebasierten Innovations- und Produktionsregionen werden und bekunden teilweise selbst schon ihr Interesse daran gegenüber der beventum. Außerdem wird für die Produktion von „Grünem Wasserstoff“, wie von der Bundesregierung geplant, der Bedarf an regionalem und nachhaltigem Strom stark steigen.
Doch die beventum will nicht nur hoch hinaus, sie hat weitere wegweisende Ziele: Sie möchte nicht weniger, als das Standortproblem für Windenergieanlagen an Land zu lösen. Als zweiten Schwerpunkt entwickeln die Mitarbeiter:innen deshalb Anlagen mittlerer Höhe, die unkompliziert auf ohnehin schon genutzten Flächen, wie in Gewerbegebieten, gebaut werden
können. Auch hier wird das herkömmliche Windrad einmal komplett neu gedacht. Bei rund 70.000 Gewerbegebieten allein in Deutschland ergibt sich grob geschätzt eine installierbare Leistung in der Größenordnung von mehreren Kraftwerken, die direkt bei Verbraucher:innen zur Eigenversorgung eingespeist werden könnten.
Ein weiterer Baustein der Windenergiewende sind kleine Anlagen für Einund Mehrfamilienhäuser: radikal neu konzipiert mit untenliegendem Antrieb, drehbarem Turm, ausgelegt als Langsamläufer mit sechs bis zwölf Rotorblättern –und damit viel leiser als bisherige drei bis fünf Meter hohe Anlagen. Einfach und mit wenig Aufwand montierbar, erschließt das Mini-Windrad bisher ungenutzte Dachflächen und optimiert für Selbstversorger:innen die Energiegewinnung.
AMBITIONIERTES ZIEL: VERDOPPLUNG DER ENERGIE AUS WINDKRAFT
Der beventum ist vor allem daran gelegen, die Errichtung so unkompliziert und regional wie möglich zu gestalten – damit möglichst viele Unternehmen ihre Windräder bauen können und die Versorgung mit Windenergie deutschland-, europa- und bestenfalls weltweit endlich an Fahrt aufnimmt. Als SPRIND-Tochter möchte die beventum die Energie aus Windkraft hierzulande verdoppeln und dafür beschreitet sie neue, mutige Wege und riskiert dabei auch zu scheitern –doch nicht ohne dabei Staub aufzuwirbeln und ihrem Namen folgend für „bene vento“ zu sorgen, den guten Wind.
HÖHER WINDRÄDER SIND, DESTO EFFIZIENTER ARBEITEN SIE. WARUM BAUT MAN SIE DANN NICHT EINFACH HÖHER? «



NANOGAMI


DIE NEUE INDUSTRIELLE REVOLUTION IST NANO
WIE NANOGAMI DAS GESUNDHEITSWESEN REVOLUTIONIERT (UND NICHT NUR DAS)
DIE INNOVATION: SUPERFUNKTIONALE, EXAKT PROGRAMMIERBARE NANO-STRUKTUREN
SPRIND UND NANOGAMI
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil wir damit die Führungsposition in einer zukünftigen Schlüsseltechnologie in Deutschland einnehmen können. Weil das Potential riesig und real ist. Weil wir mit DNA-Origami eine industrielle Revolution auf Nano-Ebene ent fachen wollen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Aus dem Forschungsprojekt ein Unternehmen machen. Über das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND Kontakte zu Partnern ermöglichen und die besten Köpfe für das Projekt begeistern. Die Entwicklungsschritte über fünf Jahre konkretisieren.
EINE MARKT-FOKUSSIERUNG HERSTELLEN
Aus den unendlich vielen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, einen Markt-Fokus herstellen; zunächst: Molekular-Diagnostik-Markt, später: noch komplexere Anwendungen. Das Projekt marktfähig machen.
RESSOURCEN IN FORM VON BUDGETS UND EXPERTEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN
Auch Human Resources für die GmbH stellen: eine Innovationsmanagerin und einen Projektmanager, die konkrete Management-Verantwortung übernehmen.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die reale Erschließung des Nano-Bereichs.



„Um klarzumachen, was Nano-Strukturen aus DNA in Zukunft leisten können, müssen wir ein bisschen ins Gestern und Heute gucken“, sagt Dr. Jean-Philippe Sobczak, CSO der Nanogami. Und holt etwas aus: Seit 50 Jahren gibt es eine Entwicklung hin zur immer genaueren Diagnose von Krankheiten: die molekulare Diagnostik. Antigen-Tests, die für so viele in letzter Zeit zur Lebensroutine geworden sind, stehen exemplarisch dafür: Man prüft, ob ein Antigen, also ein Molekül, im Körper vorhanden ist, um eine Krankheit zu diagnostizieren.
Sobczak nennt das „schon fortschrittlich, aber noch relativ unkompliziert“. Denn eigentlich würde man sich gerne eine Riesenmenge von Molekülen gleichzeitig anschauen: Welche gibt es und wie viele davon? Und dazu benötigt man Hochdurchsatz-Technologien. Sogenannte Biochips können Hochdurchsatz-MolekularDiagnostik möglich machen, und zwar so: Ein Biochip enthält Patient:innenProben mit vielen verschiedenen Molekülen. Der Chip wird in ein Lesegerät gesteckt, und das Gerät kann Milliarden von Sensoren auf dem Biochip parallel auslesen. So erfährt man, welche Moleküle vorhanden sind oder auch nicht. Und ob Patient:innen angesteckt oder krank sind oder nicht. Mit den heutigen BiochipTechnologien molekularer Diagnostik kann man also schon viel herausfinden. Viel mehr als vor 50 oder 20 Jahren. Aber noch lange nicht genug. Und auch nicht schnell und günstig genug.
Jean-Philippe Sobczak erklärt weiter: „Wenn Sie heute zum Arzt gehen und eine Blutprobe abgeben, um verschiedene Stoffmengen im Blut bestimmen zu lassen, dann muss das erst in ein Labor geschickt werden, wird dort durch speziell ausgebildetes Personal und dann mit sehr teuren Lesegeräten verarbeitet. Die Daten werden dann zurückgeschickt an den Arzt, oftmals erst einige Tage nach der Probennahme. Und dabei können nur sehr wenige Arten von Molekülen analysiert werden.“ Warum ist das bisher alles so aufwendig? Grob zusammengefasst: Moleküle sind sehr klein. Die Geräte oder Maschinen, mit denen man sie analysiert und auswertet, auch die erwähnten Biochips, sind groß. Zu groß. Sie sind bisher nicht oder nur mit unverhältnismäßig immensem Aufwand in
der Lage, einzelne Moleküle zu greifen und zu bearbeiten, zum Beispiel woanders zu platzieren, zu markieren usw. Das große Diagnostik-Problem lautet: Moleküle und Analyse-Maschinen passen nicht zu sammen, sind nicht fein genug aufeinander abgestimmt.
Dieses Riesenproblem löst Nanogami mit seinen Nano-Strukturen bzw. -Maschinen aus DNA. Sobczak führt aus: „Wir konstruieren sozusagen Schnittstellen: winzige Objekte, die einerseits groß genug sind, um sie gezielt in Halbleiterchips oder anderen Mikrosystemen einzubauen. Auf der anderen Seite sind unsere Objekte wiederum klein genug, um in ihnen gezielt einen Steckplatz für ein jeweils gewünschtes Zielmolekül einzubauen.“ Geradezu genial: Diese „Steckerstrukturen“ setzen sich dann von selbst zusammen, so ähnlich wie biologische Systeme. Und zwar milliardenfach. Die Innovation ist also eine hochkomplexe, superfunktionale, exakt zweckmäßig programmierbare NanoStruktur in der genau richtigen Zwischengröße. Diese Struktur wird dann in etwas Makroskopisches wie zum Beispiel einen Biochip integriert. So entsteht ein Chip, der Milliarden kleinster Maschinen enthält, die jeweils ganz bestimmte, vordefinierte Aufgaben erfüllen.
DEN GESUNDHEITSMARKT REVOLUTIONIEREN
In naher Zukunft wird der Diagnose-Alltag deshalb so aussehen, ist sich Sobczak sicher: Menschen werden Gewebe- oder Flüssigkeitsproben nicht mehr zur Auswertung in ein Labor schicken, wo das x Millionen Euro teure Analysegerät steht, sondern das direkt in der Arztpraxis oder sogar selber zu Hause erledigen. Schneller, günstiger, detaillierter, exakter. Kein Wunder, dass Nanogami vor allem von Lebenswissenschafts- und Pharmafirmen, die komplizierte molekulare Diagnostik machen, starke Interesse-Signale empfängt: Man ist dort schon lange auf der Suche nach Lösungen der Einzelmolekül-Bearbeitung, um zum Beispiel die Protein-Zusammensetzung von Geweben und Körperflüssigkeiten besser verstehen zu können. Für Sobczak ist klar: Mit nanobasierter molekularer Diagnose werden dann auch wirklich maßgeschneiderte Therapien möglich. Bald wird man höchst
persönliche, absolut individuelle Informationen schon in der Diagnose erkennen –und die Therapien exakt darauf abstimmen können. Das ist „personalisierte Medizin“, sagt Jean-Philippe Sobczak. „Und wir sind schon ganz nah dran.“
EIN TEAM VON NANO-EINGEWEIHTEN
Nanogami ist die 2022 gegründete SPRIND-Tochter. Dahinter steht eine Kooperation mit der tilibit GmbH, die neben Jean-Philippe Sobczak durch Prof. Dr. Hendrik Dietz gegründet wurde, eine der Koryphäen für Biomolekulare Nanotechnologie, der tilibit und Nanogami als wissenschaftlicher Berater beisteht. Ursprünglich war die tilibit GmbH als reiner Serviceprovider für einige wenige Unis und Organisationen tätig, die Bedarf an DNA-Nanostrukturen anmeldeten. Schnell wurde aber klar: In tilibit steckt viel mehr – und Dietz’ Ideen und Lösungen sind brennend interessant für eine Vielzahl von Kunden und Playern in diversen Märkten. Seit 2019 widmet sich JeanPhilippe Sobczak deshalb mit einem sorgfältig selektierten multidisziplinären Team ausschließlich der Perfektionierung und Kommerzialisierung der Nano-Technologie. Unterstützt durch die SPRIND soll diese Entwicklung nun in Form der Nanogami auf die nächste Stufe gehoben werden.
Dieses Team von Nano-Eingeweihten hat viel vor in den nächsten Jahren. Sobczak drückt es nüchtern-visionär aus: „Unser Plan sieht so aus: Wir fangen einfach an. Der Fokus liegt erst mal darauf, einzelne Moleküle mit den Nano-Maschinen zu greifen und gezielt an bestimmten Orten in Biochips zu integrieren. Dann werden wir immer vielschichtiger.“ Die nächsten Schritte lauten konkret: Funktional immer komplexere Nano-Maschinen und Biochips bauen. Und diese dann an Computerchips koppeln. Denn wenn man es schafft, NanoMaschinen mit digitalen Chips zu koppeln, werden ganz verrückte Sachen möglich. Dann kann tilibit weitere Märkte und Lebensbereiche revolutionieren. Etwa die Datenspeicherung. Oder die Herstellung von Quantencomputern. Oder die Schadstoffüberwachung in der Luft. Das Potential, das in nano steckt, ist gigantisch.
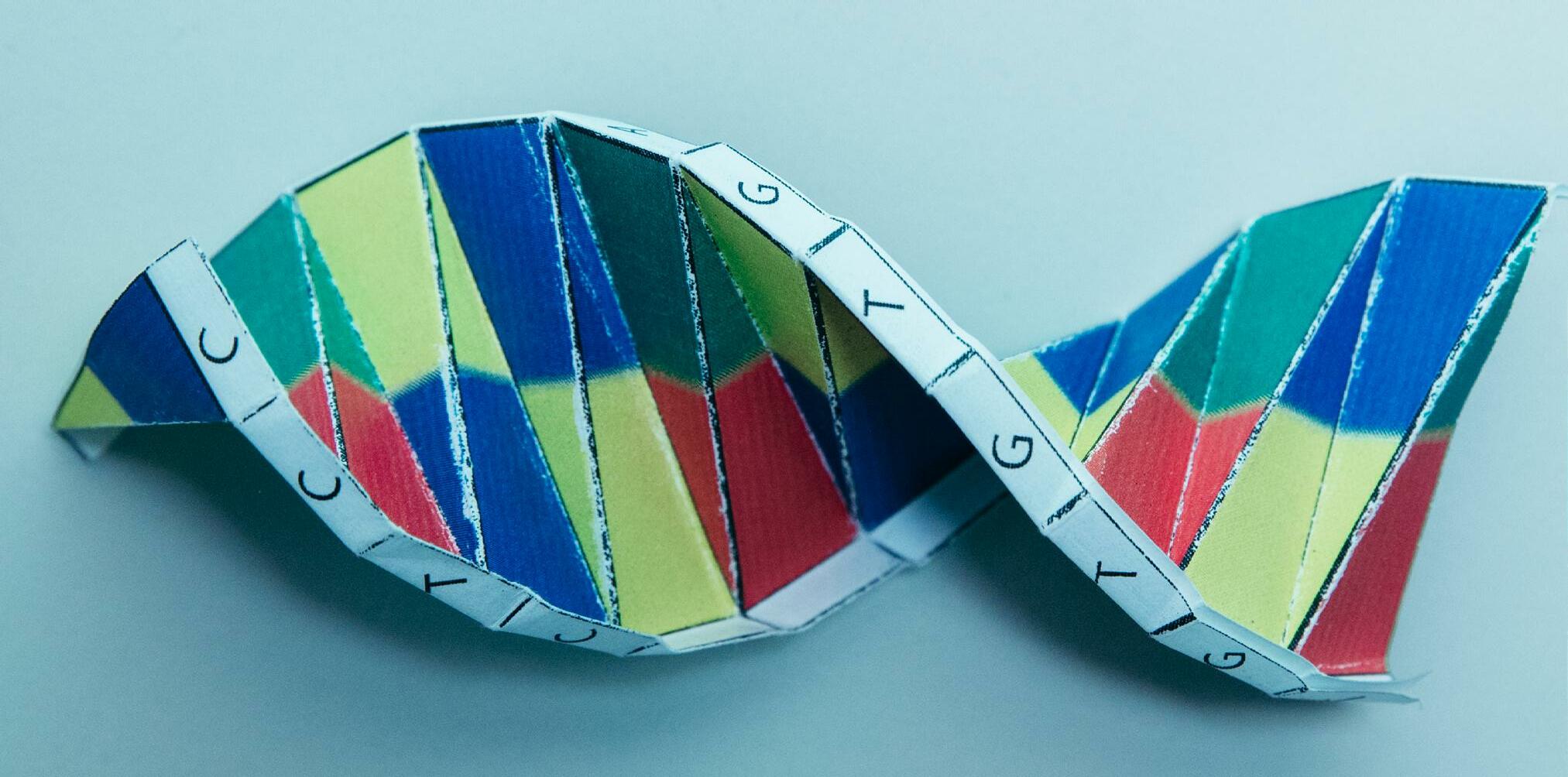
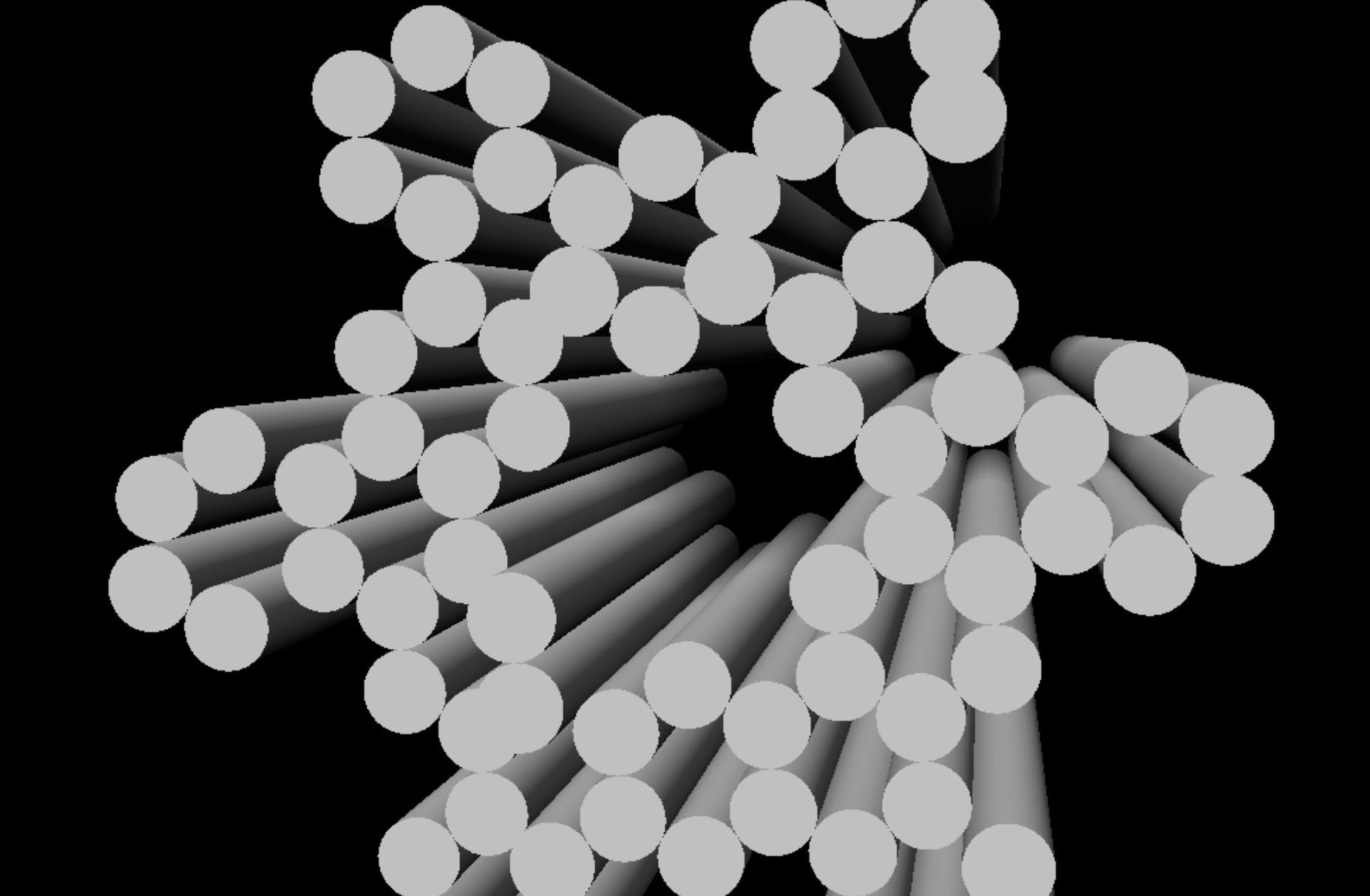
PLEODAT


VOM GEHIRN LERNEN FÜR DIE KOGNITIVE DATENBANK DER ZUKUNFT
DER INNOVATOR:
PETER PALM, FREIGEIST UND DATENBANKVISIONÄRSPRIND UND PLEODAT
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil Daten das Gold des digitalen Zeitalters sind. Weil aber erst Informationen und Wissen einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Weil zurzeit der Umgang mit Daten schwerfällig, kompliziert, unsicher, intransparent ist. Weil zurzeit Wissen nicht einfach entsteht. Weil die digitale Zukunft auf einem stabilen Fundament entstehen sollte.
DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN
Cortex kann ein universeller Datenspeicher sein, der operative mit analytischen Daten zusammenbringt und Streaming-Daten integriert. Abfragen werden ohne tiefes Expertenwissen möglich. Das in den Daten enthaltene Wissen wird für jedermann zugänglich. Vielfältige Daten können so zusammengeführt werden, dass sie eine neue, informative Sichtweise auf Kunden, Prozesse und Zusammenhänge aufzeigen. Cortex kann eine Plattform sein, in der Daten sicher aufgehoben
sind und Zugriffe einfach, dabei detailliert und individuell gesteuert werden können. Cortex kann agile Prozesse unterstützen, die IT vereinfachen und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.
DAS MACHEN WIR KONKRET
In einer Forschungsgesellschaft aus der vorhandenen Cortex- Plattform eine Informationsbank bauen. Ressourcen zur Verfügung stellen und den Entwickler:innen Raum für die wichtigen Aufgaben geben. Kontakte herstellen zu mög lichen Anwendern mit Herausforderungen, die die CortexTechnologie glänzen lassen.
EINEN BREITEN MARKT ADRESSIEREN Funktionen entwickeln, die der Cortex-Kerntechnologie einen breiten Einsatz ermöglichen.
THINK TANKEN UND GRÖSSER DENKEN
Das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND nutzen, um mit Köpfen zu diskutieren, die die Reichweite und das Potential des neuen Ansatzes verstehen.

Manchmal sind es Zufälle, die den Impuls fürs Leben geben. Bei Peter Palm, geboren 1954, Elektrotechnik-Ingenieur und leidenschaftlicher Informatiker, war es Mitte der 90er-Jahre eine ganz bestimmte Begegnung, die ihn in eine völlig neue Richtung denken ließ. Zuvor war er schon viele Jahre in der Industrie tätig und oft unzufrieden mit den Informationen, die über die Kunden vorlagen. 1984 hatte der Tüftler deshalb ein Customer-Relationship-Management-System entwickelt, als es diese Namensgebung noch gar nicht gab, wofür er weithin skeptisch beäugt wurde. Doch schon damals war sein Motto: „Wenn einer sagt, es geht nicht, soll er die nicht stören, die es gerade machen“, erzählt Palm grinsend. „Harmony“ war schnell ein Renner und entpuppte sich im Laufe der Jahre als die Lösung für etliche Firmen, die viele Kundeninformationen verarbeiten müssen.
Dann traf er 1995 eher zufällig auf einen Freund seines Zahnarztes, einen Psychologen. „Dieser untersuchte für seine Doktorarbeit den Übergang bei Kindern von der Kritzel- in die Malphase. Denn ein Kind kritzelt erstmal, dann sucht es nach interpretierbaren Elementen, die so aussehen wie etwas dem Kind Bekanntes, und dann erst probiert es, diese identifizierbaren Objekte zu zeichnen“, erinnert sich Peter Palm – und dass er dachte: „Wenn das stimmt, machen wir in der IT alles falsch. Denn dort verarbeiten wir Daten im Nachhinein, das Gehirn hingegen bildet erst mehrere Hypothesen und schaut dann, ob sie sich bestätigen.“
DAS MENSCHLICHE GEHIRN IST EINE VORHERSAGEMASCHINE
Es versucht permanent, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen, und kann viele
Erwartungen gleichzeitig verarbeiten. Dabei reduziert es sich auf bestimmte Aspekte; die Datenverarbeitung erfolgt über verschiedene kognitive Kontexte. So sollte es auch mit Datenbanken sein, fand Peter Palm –und entwickelte ein neuartiges System: die Cortex-Datenbank.
„Daten werden nur dann zu Information, wenn der Zusammenhang mit anderen Daten geklärt ist. In der Cortex-Datenbank ist die Bildung von Kontexten bereits in ihrer Architektur berücksichtigt. Dabei orientiert sich die Datenbank am menschlichen Gehirn, dem Cortex“, führt Palm voller Energie aus, „dafür habe ich mir eine ganz neue, schemafreie Struktur überlegt: Man kann Objekte mit beliebig vielen Elementen beschreiben und Objekte bestehen aus Eigenschaften in unterschiedlichen Kontexten. Unsere Datenbank ist dabei nicht aus Optimierungsüberlegungen entstanden, sondern beruht auf einem völlig neuen Ansatz“. Durch den neuen Aufbau werden Datenbank-Operationen ermöglicht, die in bisherigen Datenbanken unmöglich erscheinen – auch in sehr großen Datenmengen wie Big Data.
PARADIGMENWECHSEL IM INFORMATIONSMANAGEMENT
Lange arbeiteten Peter Palm und sein Team parallel für Harmony und am Cortex-Datenbank-Server – „doch irgendwann blockierten uns die alten Strukturen zu sehr. Wir machten Tabula rasa und widmeten uns nur noch unserem neuen Projekt“, berichtet Palm. 2008 war das.
Jan Buß , Business-DevelopmentSpezialist und Geschichtenerzähler im Team, hat bereits zu Harmony-Zeiten mit dem innovativen Freigeist zusammengearbeitet und ist bei Cortex schon viele Jahre
dabei. Er ist sich sicher: „Wir haben hier ein grundsätzliches Problem der Informationsverarbeitung so generisch gelöst, dass man damit ganz viele Probleme lösen kann. Die Cortex-Datenbank hat das Potential, einen Paradigmenwechsel im Informationsmanagement auf atomarer Basis von ganz unten einzuleiten.“
Was jetzt noch fehlt: „Dass wir die ‚early adopter‘ finden, die das bahnbrechende Potential von Cortex schätzen“, so der Betriebswirtschaftler. „Es ist schwer, in großen Firmen Fuß zu fassen, weil dort ein Spannungsverhältnis von Marketing- und Vertriebsmächten herrscht – Organisation frisst Innovation zum Frühstück“, beschreibt er ein Dilemma visionärer Ideen. Denn die Datenbank ist aktuell als kommerzielles Produkt verfügbar, aber noch kein schlüsselfertiges Massenprodukt. Sie kann dafür aber passgenau auf die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens zugeschnitten werden und zum Beispiel Daten verschiedener, bereits genutzter Datenbanken zusammenführen, um sie für analytische oder operative Anforderungen in einem Data Hub nutzbar zu machen.
Peter Palm und sein Team – dazu gehört seit der Unterstützung durch die SPRIND auch Dr. Georg Loepp als Geschäftsführer der neu gegründeten SPRIND-Tochter Pleodat – sind vom Sprungpotential absolut überzeugt: „Im Grunde sind alle heutigen Datenbanken nur Sonderformen unserer Cortex-Datenbank“, stellt der verschmitzte Erfinder mit der passenden Weisheit für jede Lebenslage fest. „Ich hatte damals die Erkenntnis: ‚Eine gute Lösung lässt sich auf jedes Problem anwenden.‘ Genau das macht unsere Datenbank – und ich sprudele noch immer vor Ideen.“

» WENN EINER SAGT, ES GEHT NICHT, SOLL ER DIE NICHT STÖREN, DIE ES GERADE MACHEN. «
101 BERLIN
57 NIEDERSACHSEN
NRW
MIT BERIT DANNENBERG UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA GESPRÄCH
BOCK AUF ZUKUNFT


SEIT BALD DREI JAHREN GIBT ES DIE SPRIND GMBH. WIR BLICKEN IM INTERVIEW MIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN, BERIT DANNENBERG UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA, ZURÜCK UND NACH VORN.
WARUM BRAUCHT ES SPRIND?
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA:
Wir leben in Deutschland heute überwiegend noch vom Wohlstand, der seinen Ursprung im Erfindungs- und Gründungsboom der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat: Apotheke der Welt, Chemiefabrik der Welt, Autofabrik der Welt. In dieser Zeit haben wir neue Industrien erfunden und groß gemacht. Das ist uns in dieser Form in den letzten knapp 80 Jahren nicht mehr so gut gelungen. Die heute relevanten Unternehmen und Industrien – insbesondere Hard- und Software – sind in den USA und Asien entstanden beziehungsweise groß geworden. SPRIND soll mithelfen, dass wieder neue Industrien in Deutschland entstehen und dass diese ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hier entfalten.
WAS MUSS BESSER WERDEN?
BERIT DANNENBERG:
Es mangelt uns nicht an Talent und gut ausgebildeten Köpfen, die etwas bewegen wollen. Die Grundlagenforschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist Weltspitze. Allerdings haben wir es verlernt, aus neuem Wissen auch neue, innovative Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen zu machen. Ein klein wenig sind wir jetzt auch Opfer des eigenen Erfolgs, weil Auto-, Elektro-, Chemie-, Maschinenbau- und andere Industrien in den letzten Jahrzehnten so überaus erfolgreich darin waren, mit schrittweisen Verbesserungen im globalen Wettbewerb zu brillieren. Zukünftig wird das jedoch nicht reichen. Um Wertschöpfung und technologische Souveränität in den nächsten Jahrzehnten zu sichern, brauchen wir auch in Deutschland wieder echte Innovationen und Unternehmen, die diese neuen Technologien beherrschen.
WELCHE AUFGABE HAT DABEI EINE BUNDESAGENTUR?
RL: Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist es eben nicht so, dass die großen Innovationen einfach so im freien Markt entstehen. Das gilt auch für die USA. Die staatliche Innovationsagentur DARPA – 1958 von Präsident Eisenhower zusammen mit der NASA gegründet, um angesichts des Sputnik-Schocks das „Space Race“ gegen die Sowjetunion zu gewinnen – gilt heute als Geburtshelfer für die Hard- und Softwareindustrien im kalifornischen Silicon Valley. Entscheidend dafür war und ist, dass die DARPA die Weiterentwicklung neuer Technologien in der Phase finanziert, in der noch kein privater Kapitalgeber bereit ist, das finanzielle Risiko zu übernehmen.
BD: Dieses DARPA-Prinzip hat sich SPRIND zu eigen gemacht. Denn auch SPRIND finanziert das „Tal des Todes“ zwischen Grundlagenforschung und Marktreife. Dabei konzentrieren wir uns auf technische Innovationen, die das Potential haben, unser Leben entscheidend zu verbessern und neue Industrien in Deutschland zu begründen. Bei der Wahl der Themenfelder sind wir offen, solange sie primär zivilen Zwecken dienen.
RL: Neben den Projekteinreichungen, wo wir themenoffen inzwischen mehr als 1.000 Vorschläge gesichtet und bewertet haben, haben wir mit den SPRIND Challenges ein neues Werkzeug geschaffen, um damit gezielt nach Lösungen für bestimmte technische Fragestellungen zu suchen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind. Im Gegensatz zu den bislang praktizierten Innovationswettbewerben finanzieren wir nicht nur ein oder zwei Teams zu einem Thema, sondern bis zu zehn Teams parallel mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Auch können wir nun Teams finanzieren, die nicht nur aus dem üblichen „Förderempfangskreis“ kommen, also auch Start-ups, KMUs und Einzelpersonen.
Nach jedem Jahr bewerten Fachleute den Fortschritt des Teams und entscheiden, ob und welches Team auch im kommenden Jahr eine Finanzierung erhält. Auf diese Weise müssen wir uns nicht vorab auf eine einzige Technologie festlegen, können unterschiedliche Lösungswege beschreiten und sehen, welcher zum besten Erfolg führt. Um diese „Parallelfinanzierung“ beihilferechtskonform zu realisieren, verwenden wir ein innovatives, neues Finanzierungswerkzeug, die „vorkommerzielle Auftragsvergabe“. Bis heute haben wir insgesamt vier SPRIND Challenges zu unterschiedlichsten Themen gestartet, für die sich Teams aus dem In- und Ausland beworben haben.
BD: Die rechtlichen Grundlagen der SPRIND sehen vor, dass wir für Projekte mit Sprunginnovationspotential nach Genehmigung durch den SPRIND-Aufsichtsrat eine Tochter-GmbH gründen, die der Bund über mehrere Jahre hinweg mit großvolumigen Darlehen von mehreren zehn Millionen Euro unterstützt. Um das Sprunginnovationspotential zu prüfen, können wir im Vorfeld einer GmbH-Gründung sogenannte Validierungsaufträge vergeben. Bislang haben wir mehr als 40 Validierungsaufträge vergeben und finanzieren sechs Tochter-GmbHs.
RL: Das ist richtig. Die Praxis hat gezeigt, dass die Tochter-GmbH in vielen Fällen nicht passt oder zu unflexibel ist, beispielsweise wenn im Rahmen einer Anschlussfinanzierung privates Kapital aufgenommen werden soll oder wenn die Mitarbeiter:innen am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass diese Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der SPRIND-Werkzeuge auch seitens der neuen Bundesregierung bestätigt wurde, die in ihrem Koalitionsvertrag in Aussicht stellt: „Wir werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovationen umgehend substanziell verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann.“ Dies soll nun im Rahmen eines Gesetzes erfolgen, das SPRIND eine Flexibilisierung bei den Finanzierungsinstrumenten und den haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen bringen wird, sodass wir unsere Aufgaben effizienter und agiler fortführen können.
WAS MACHT IHR NEU UND ANDERS? WELCHE FINANZIERUNGSWERKZEUGE HAT SPRIND?WELCHE ZUSÄTZLICHEN FINANZIERUNGSWERKZEUGE WÜRDEN EUCH HELFEN, UM INNOVATOR:INNEN SCHNELLER UND UNBÜROKRATISCHER ZU UNTERSTÜTZEN?
RL: SPRIND möchte eine maßgeschneiderte, staatliche F&E-Projektförderung etablieren, ohne starre Fördermittelrichtlinien. Dazu möchten wir die bewährten Instrumente aus dem Venture-Capital-Geschäft für die Frühphasenfinanzierung anwenden. Mit zunehmender Marktreife des Projekts nimmt die staatliche Unterstützung ab, während die Finanzierung durch private Mittel zunimmt.
BD: Dieser differenzierte Ansatz zur Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Projekts hebt sich stark von aktuell verfügbaren Förderprogrammen ab und erhöht die Erfolgschancen der Projekte. Wir möchten das bestehende Instrumentarium um zwei Werkzeuge ergänzen. In der Projektfinanzierung wird die Unterstützung eines kleinen Pauschalprojekts eingeführt – SPRIND Start. Es gibt zusätzlich eine Projektfinanzierung, die zwischen zwei Phasen unterscheidet. Je näher an der Grundlagenforschung, desto höher ist die Förderintensität. Die zweite Phase der Projektfinanzierung ist an einen privaten Eigenanteil gebunden. Im Rahmen der Unternehmensfinanzierung kann SPRIND die Unternehmensgründung unterstützen. Für weiter fortgeschrittene Projekte wird die Möglichkeit einer sogenannten pari-passu-Beteiligung vorgesehen.
UM DIES ZU ERMÖGLICHEN, MÜSSTE SPRIND IM RAHMEN EINES BUNDESGESETZES „BELIEHEN WERDEN“ – WAS BEDEUTET DAS?
BD: Mit der „Beleihung“ kann eine hoheitliche Aufgabe auf juristische Personen des privaten Rechts oder auf natürliche Personen übertragen werden. Durch ein Gesetz zur Förderung und Finanzierung von Sprunginnovationen soll die SPRIND direkt beliehen werden. Diese Beleihung kann mit folgender Aufgabe verbunden werden: Der SPRIND wird das Recht und die Pflicht übertragen, eigenständig Projekte für Sprunginnovationen systematisch zu ermitteln, zu evaluieren und bedarfsgerecht zu finanzieren.
RL: Im Rahmen der Beleihung könnte SPRIND eigenständig über die Projektauswahl entscheiden und würde freie Hand bei der Wahl von Finanzierungsinstrumenten und -bedingungen im Rahmen haushaltsrechtlicher und beihilferechtlicher Vorgaben erhalten. Ergänzt um einen bundeshaushaltsrechtlichen Selbstbewirtschaftungsvermerk würde SPRIND weitgehende Freiheit hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Finanzierungen erhalten. Selbstverständlich gibt es weiterhin eine umfangreiche Berichtspflicht, um die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung zu dokumentieren. Unserer Meinung nach ist eine Beleihung der beste Weg, um einen Rechtsrahmen zu schaffen, der es ermöglicht, eine öffentliche Mittelverwendung mit den finanziellen Entscheidungsmöglichkeiten und der Agilität privatwirtschaftlicher Instrumente zu vereinen. Nur so können wir Sprunginnovationen mit dem notwendigen „geduldigen Kapital“ in ausreichender Höhe finanzieren und in Europa entwickeln sowie auch halten.
SPRIND WURDE NAHEZU ZEITGLEICH MIT DEM BEGINN DER CORONA-PANDEMIE GEGRÜNDET. INWIEFERN HAT CORONA DEN AUFBAU DER BUNDESAGENTUR BEHINDERT UND VERLANGSAMT?
RL: Bei meiner Bewerbung als Direktor der Agentur habe ich eine verteilte Organisation mit digitalisierten Prozessen vorgeschlagen, bei der alle Mitarbeiter:innen vollständig remote arbeiten können. Denn es ist wichtiger, die besten und motiviertesten Leute zu bekommen, als dass alle Leute stets physisch in einem Büro zusammen sind. Das hat die Ministerien überzeugt und so haben wir es dann auch umgesetzt. Deshalb hat uns Corona in unseren Abläufen nicht so stark behindert, aber natürlich
war das Umfeld insgesamt schwieriger. Manche Kolleg:innen hat man erst nach einem Jahr endlich mal in „echt“ kennengelernt! Inzwischen haben wir eine „betriebsfähige“ Personalstärke von rund 50 Mitarbeiter:innen erreicht. Und wir haben seit Dezember 2021 auch ein eigenes Büro für die rund 25 Mitarbeiter:innen in Leipzig, das als zentraler Treffpunkt dient.
BD: Rückblickend betrachtet haben uns die administrativen und regulatorischen Vorgaben stärker ausgebremst als das Virus. Ein Beispiel: Wir mussten erst ohne Personal eine Ausschreibung für eine Personalagentur machen, bevor wir diese beauftragen konnten, uns bei der Personalsuche zu unterstützen. Im Nachhinein, wenn man das geschafft hat, kommt man sich ein wenig wie Münchhausen vor, der behauptete, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen zu haben.
SPRIND IST LAUT KABINETTSBESCHLUSS VOM AUGUST 2018 „ZUNÄCHST BEFRISTET ALS EXPERIMENTIERPHASE FÜR EINE LAUFZEIT VON ZEHN JAHREN GEPLANT“ MIT EINEM MITTELBEDARF VON INSGESAMT RUND EINER MILLIARDE EURO. WIE FÄLLT NACH DREI JAHREN EUER ZWISCHENFAZIT AUS?
BD: Sowohl seitens der beiden Ministerien BMBF und BMWK, welche die Governance ausüben, als auch von Vertreter:innen des Bundestages erhalten wir sehr viel Zuspruch zum bisher Erreichten. Das spiegelt sich auch in einer deutlichen Erhöhung der finanziellen Mittel für SPRIND in den Jahren 2022 und 2023 wider. Das freut uns sehr und ist natürlich ein enormer Ansporn. Stellvertretend für alle Unterstützer:innen danken wir an dieser Stelle unseren Ansprechpartner:innen in BMBF und BMWK ebenso wie unseren Aufsichtsrät:innen für ihre Zeit und ihr außergewöhnliches Engagement: Ohne sie hätten wir es nicht so weit geschafft!
RL: Gemeinsam wollen wir – dem Motto des Koalitionsvertrages folgend –auch in den nächsten Jahren „Mehr Fortschritt wagen“. Wir wollen SPRIND zum „One-Stop-Shop“ für die Identifizierung und Inkubation von bahnbrechenden Zukunftstechnologien, zum Reallabor für niedrigschwellige, effiziente und schnelle Innovations-Entwicklung und -Finanzierung weiterentwickeln. Das ist unsere Mission.
Die gelernte Juristin BERIT DANNENBERG ist seit Frühjahr 2021 kaufmännische Geschäftsführerin von SPRIND. Sie war vorher im klassischen Wissenschaftsmanagement tätig, so in verschiedenen Einrichtungen der HelmholtzGemeinschaft und zuletzt als Verwaltungsleiterin der Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin.
RAFAEL LAGUNA DE LA VERA ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mit 16 gründete er sein erstes Start-up, Elephant Software. Er baute zahlreiche weitere Technologieunternehmen auf und arbeitete als Technologieinvestor, Interimsmanager und Berater für Venture Capital Fonds. Sein Engagement bei der Open-Xchange AG und SUSE Linux begründeten seinen Ruf als Open-Source-Pionier und Kämpfer für das offene Internet.

TEAM

» DIE ERSTE SPRUNGINNOVATION DER BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNG


UNSERE WETTBEWERBE FÜR WELTVERÄNDERER CHALLENGES

UNSER ZIEL:

VISIONÄRE LÖSUNGEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER GROSSEN FRAGEN UNSERER ZEIT (ER-)FINDEN

INNOVATIONSWETTBEWERBE HABEN BEWIESEN, DASS SIE AUSGANGSPUNKT FÜR RADIKALE NEUERUNGEN UND TIEFGREIFENDE VERÄNDERUNGEN SEIN KÖNNEN.
DAS PRINZIP: EIN AMBITIONIERTES ZIEL – UND EIN WETTBEWERB UM DIE BESTE LÖSUNG.
Institutionen im Ausland führen derartige Wettbewerbe seit langem durch. Mit den CHALLENGES hat SPRIND nun auch in Deutschland einen professionellen Rahmen geschaffen, um im Wettbewerb Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden.

SPRIND widmet sich mit den Challenges ausschließlich Themen, bei denen ein Durchbruch von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung besteht. Zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, die Bereitstellung nachhaltiger Energie, der Kampf gegen den Klimawandel oder die Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien. Hoch ambitionierte Ziele, die Neudenker:innen anziehen, also Menschen, die das Potential haben, Sprunginnovationen zu schaffen – und sich dabei nicht von Unwägbarkeiten oder der Möglichkeit des Scheiterns abschrecken lassen.

HILFT BEI UNTIEFEN: DAS COACHING-TEAM
Bei einer SPRIND Challenge starten zwischen 5 und 15 Teams. Im laufenden Wettbewerb steht für die Teams dann nicht nur spannende Forschungs- und Entwicklungsarbeit an, sondern es warten oftmals auch unbekannte Anforderungen aus Prüfungs- oder Zulassungsverfahren sowie die Ausrichtung auf neue Geschäftsmodelle und Märkte, die in den meisten Fällen noch gar nicht existieren.
Deshalb werden alle Teams neben finanzieller Unterstützung von einem Coaching-Team begleitet, das mit komplementärem Knowhow hilft, diese Untiefen zu meistern.
FINANZIERUNG DER CHALLENGES
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Bundesministerium für Bildung und Forschung
ANTIVIRALE MITTEL CARBON-TO-VALUE LONG-DURATION ENERGY STORAGE
• NEW COMPUTING CONCEPTS
EXPERTEN
SPRIND CHALLENGES VERSAMMELN TEAMS, DIE UNSERE WELT NEU DENKEN UND NEU FORMEN
















 NEUE TECHNOLIGIEN? JETZT SCANNEN
NEUE TECHNOLIGIEN? JETZT SCANNEN
ANTIVIRALER THERAPEUTIKA MIT BREITBANDWIRKUNG
Viren sind eine unberechenbare Bedrohung für die weltweite Gesundheit, für Wirtschaft und Gesellschaft – das wissen wir spätestens seit der SARS-CoV-2-Pandemie. Seit ihrem Beginn sind mehrere Millionen Tote zu beklagen. Noch immer fehlt es an wirksamen Therapeutika gegen SARSCoV-2 und neu auftretende Varianten. Tatsache ist: Auch gegen viele andere Viren gibt es bis heute keine Therapeutika. Potenzierende Viruslast, hohe Mutationsraten und limitierte Angriffspunkte sind Viren inhärent, machen sie zu wahren „Überlebenskünstlern“ und stellen hohe Anforderungen an die Wirkstoffentwicklung. Das große Verlangen, die Pandemie zu überwinden, verhalf neuen Technologien auf der Basis von mRNA und ebenso neuen Wegen in der „drug delivery“ zum schnellen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung – entgegen den Erwartungen vieler Expert:innen. Analog dazu braucht es Durchbrüche in der antiviralen Wirkstoffentwicklung. Zusätzlich zu bekannten Viren braucht es Möglichkeiten, heute noch unbekannten Viren zu begegnen, um zukünftige Pandemien im Keim zu ersticken. Es braucht also vollkommen neue, hochinnovative Ansätze, die eine Bekämpfung von viralen Infektionen ermöglichen. Deswegen unterstützt die SPRIND mit dieser Challenge neue technologische Ansätze für Sprunginnovationen zur Bekämpfung von viralen Infektionen.
Viren sind eine unberechenbare Bedrohung für die weltweite Gesundheit, für Wirtschaft und Gesellschaft – das wissen wir spätestens seit der SARS-CoV-2-Pandemie. Seit ihrem Beginn sind mehrere Millionen Tote zu beklagen. Noch immer fehlt es an wirksamen Therapeutika gegen SARSCoV-2 und neu auftretende Varianten. Tatsache ist: Auch gegen viele andere Viren gibt es bis heute keine Therapeutika. Potenzierende Viruslast, hohe Mutationsraten und limitierte Angriffspunkte sind Viren inhärent, machen sie zu wahren „Überlebenskünstlern“ und stellen hohe Anforderungen an die Wirkstoffentwicklung. Das große Verlangen, die Pandemie zu überwinden, verhalf neuen Technologien auf der Basis von mRNA und ebenso neuen Wegen in der „drug delivery“ zum schnellen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung – entgegen den Erwartungen vieler Expert:innen. Analog dazu braucht es Durchbrüche in der antiviralen Wirkstoffentwicklung. Zusätzlich zu bekannten Viren braucht es Möglichkeiten, heute noch unbekannten Viren zu begegnen, um zukünftige Pandemien im Keim zu ersticken. Es braucht also vollkommen neue, hochinnovative Ansätze, die eine Bekämpfung von viralen Infektionen ermöglichen. Deswegen unterstützt die SPRIND mit dieser Challenge neue technologische Ansätze für Sprunginnovationen zur Bekämpfung von viralen Infektionen.
Ziel der Challenge ist es, mit bahnbrechenden Technologien das Repertoire an antiviralen Therapeutika zu erweitern, damit in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und Patient:innen schnell geholfen werden kann. Dafür entwickeln die Challenge-Teams Ansätze für Breitbandvirostatika und Plattformtechnologien zur schnellen Entwicklung antiviraler Wirkstoffe.
Ziel der Challenge ist es, mit bahnbrechenden Technologien das Repertoire an antiviralen Therapeutika zu erweitern, damit in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und Patient:innen schnell geholfen werden kann. Dafür entwickeln die Challenge-Teams Ansätze für Breitbandvirostatika und Plattformtechnologien zur schnellen Entwicklung antiviraler Wirkstoffe.
WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG VON VIRALEN INFEKTIONEN. WIR BRAUCHEN MUTIGE
WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG VON VIRALEN INFEKTIONEN. WIR BRAUCHEN MUTIGE IDEEN!
IDEEN!
Zu diesem Thema haben die SPRIND 45 Projektvorschläge erreicht. Im Herbst 2021 wählte die Jury neun Teams aus, die umgehend in die insgesamt dreijährige Challenge gestartet sind. Nach einem Jahr fand im Oktober 2022 eine erneute Jury-Sitzung zur Zwischenevaluation der bisherigen Ergebnisse statt.
Zu diesem Thema haben die SPRIND 45 Projektvorschläge erreicht. Im Herbst 2021 wählte die Jury neun Teams aus, die umgehend in die insgesamt dreijährige Challenge gestartet sind. Nach einem Jahr fand im Oktober 2022 eine erneute Jury-Sitzung zur Zwischenevaluation der bisherigen Ergebnisse statt.
Zum Erscheinen dieser Publikation sind noch maximal sechs Teams weiter im Rennen.
Zum Erscheinen dieser Publikation sind noch maximal sechs Teams weiter im Rennen.
TEAMS
TEAMS
• VIRUSTRAP nutzt die DNA-Origami-Technologie, um Fallen für Viren im Nanomaßstab zu bauen. Dafür konstruiert das Team um Prof. Dr. Hendrik Dietz (Capsitec GmbH) Halbschalen aus einzelsträngiger DNA, die Viren umschließen und sie so neutralisieren. Größe und Form der Schalen lassen sich dabei flexibel an unterschiedliche Viren anpassen.
• VIRUSTRAP nutzt die DNA-Origami-Technologie, um Fallen für Viren im Nanomaßstab zu bauen. Dafür konstruiert das Team um Prof. Dr. Hendrik Dietz (Capsitec GmbH) Halbschalen aus einzelsträngiger DNA, die Viren umschließen und sie so neutralisieren. Größe und Form der Schalen lassen sich dabei flexibel an unterschiedliche Viren anpassen.
• EXIGENT entwickelt universelle antivirale Wirkstoffe der nächsten Generation auf Basis eines ausgesuchten Proteins. Dr. Barbara Ensoli (ISS) arbeitet daran zu zeigen, wie dieses Protein das menschliche Immunsystem stärkt und den Zelleintritt sowie die Vermehrung des Virus unterbindet.
• EXIGENT entwickelt universelle antivirale Wirkstoffe der nächsten Generation auf Basis eines ausgesuchten Proteins. Dr. Barbara Ensoli (ISS) arbeitet daran zu zeigen, wie dieses Protein das menschliche Immunsystem stärkt und den Zelleintritt sowie die Vermehrung des Virus unterbindet.
• RNA-DRUGS unter Leitung von Prof. Dr. Harald Schwalbe (Universität Frankfurt) erarbeitet eine Plattform für die Entwicklung antiviraler niedermolekularer Inhibitoren, die auf virale RNAs abzielen. Im Fokus stehen dabei RNAAbschnitte, die nicht in Proteinsequenzen übersetzt werden. Diese Abschnitte sind seltener von Mutationen betroffen und bieten so ein robustes Ziel.
• RNA-DRUGS unter Leitung von Prof. Dr. Harald Schwalbe (Universität Frankfurt) erarbeitet eine Plattform für die Entwicklung antiviraler niedermolekularer Inhibitoren, die auf virale RNAs abzielen. Im Fokus stehen dabei RNAAbschnitte, die nicht in Proteinsequenzen übersetzt werden. Diese Abschnitte sind seltener von Mutationen betroffen und bieten so ein robustes Ziel.
• MUCBOOST, geleitet von Dr. Daniel Lauster (FU Berlin), entwickelt ein Upgrade gegen Krankheitserreger: Die antivirale Wirksamkeit des Mukus, dem Schleim, der unsere Atemwege überzieht, wird gezielt verstärkt. Dieses Upgrade funktioniert nach einem Baukastenprinzip und kann so flexibel an unterschiedlichste Viren angepasst werden. Gleichzeitig hat der Ansatz das Potential, die Übertragbarkeit zu verringern, indem die Viren verstärkt am Mukus haften bleiben: Er wirkt also wie eine molekulare Maske.
• MUCBOOST, geleitet von Dr. Daniel Lauster (FU Berlin), entwickelt ein Upgrade gegen Krankheitserreger: Die antivirale Wirksamkeit des Mukus, dem Schleim, der unsere Atemwege überzieht, wird gezielt verstärkt. Dieses Upgrade funktioniert nach einem Baukastenprinzip und kann so flexibel an unterschiedlichste Viren angepasst werden. Gleichzeitig hat der Ansatz das Potential, die Übertragbarkeit zu verringern, indem die Viren verstärkt am Mukus haften bleiben: Er wirkt also wie eine molekulare Maske.
PROTAC-POWERED ANTIVIRALS schafft eine Plattform für die beschleunigte Entwicklung von antiviralen Arzneimitteln der nächsten Generation mit breitem Wirkungsspektrum, indem es sich Strategien der in-silicoModellierung und des gezielten Proteinabbaus zunutze macht. Prof. Dr. Mark Brönstrup (HZI) und sein Team rekrutieren dafür Enzyme in der Zelle, die Virusproteine abbauen. Nach Abbau des Virusproteins durch das Enzym kann das Enzym wiederverwendet werden und so dem rasanten Wachstum der Viren Einhalt gebieten.
PROTAC-POWERED ANTIVIRALS schafft eine Plattform für die beschleunigte Entwicklung von antiviralen Arzneimitteln der nächsten Generation mit breitem Wirkungsspektrum, indem es sich Strategien der in-silicoModellierung und des gezielten Proteinabbaus zunutze macht. Prof. Dr. Mark Brönstrup (HZI) und sein Team rekrutieren dafür Enzyme in der Zelle, die Virusproteine abbauen. Nach Abbau des Virusproteins durch das Enzym kann das Enzym wiederverwendet werden und so dem rasanten Wachstum der Viren Einhalt gebieten.
• BACDEFENSE unter Leitung von Prof. Dr. Chase Beisel macht sich die Vielfalt der bakteriellen Abwehrkräfte als neue Quelle für antivirale Wirkstoffe zunutze. Die Evolution hat Bakterien über Jahrmillionen mit Abwehrmechanismen gegen Viren ausgestattet. Viele dieser Mechanismen wurden kürzlich entdeckt. Dieses Repertoire soll nun auch dem Menschen zugutekommen.
• BACDEFENSE unter Leitung von Prof. Dr. Chase Beisel macht sich die Vielfalt der bakteriellen Abwehrkräfte als neue Quelle für antivirale Wirkstoffe zunutze. Die Evolution hat Bakterien über Jahrmillionen mit Abwehrmechanismen gegen Viren ausgestattet. Viele dieser Mechanismen wurden kürzlich entdeckt. Dieses Repertoire soll nun auch dem Menschen zugutekommen.
COACHING
COACHING
• CRISPR ANTIVIRALS nutzt das antivirale Abwehrsystem CRISPR/Cas13, das in Millionen Jahren der Evolution von Bakterien perfektioniert wurde, um die Vermehrung und die zytopathischen Wirkungen von RNA-Viren wie SARS-CoV-2 durch Spaltung ihres viralen Genoms und mRNA zu blockieren. Prof. Dr. Elisabeth Zeisberg (UMG) und Team haben einen Weg gefunden, der verspricht, besonders robust gegen Mutationen eines Virus zu sein.
• CRISPR ANTIVIRALS nutzt das antivirale Abwehrsystem CRISPR/Cas13, das in Millionen Jahren der Evolution von Bakterien perfektioniert wurde, um die Vermehrung und die zytopathischen Wirkungen von RNA-Viren wie SARS-CoV-2 durch Spaltung ihres viralen Genoms und mRNA zu blockieren. Prof. Dr. Elisabeth Zeisberg (UMG) und Team haben einen Weg gefunden, der verspricht, besonders robust gegen Mutationen eines Virus zu sein.
DR. DIANE SEIMETZ und ihre Kolleg:innen der BIOPHARMA EXCELLENCE BY PHARMALEX unterstützen die Teams dabei, herausragende Wissenschaft in Sprunginnovationen zu überführen, die eines Tages Patient:innen zugutekommen können. Sie bauen dabei auf langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Zulassung innovativer Arzneimittel, sowohl aus eigenen Biotech-Unternehmen als auch aus führenden Positionen in den relevanten Regulierungsbehörden.
DR. DIANE SEIMETZ und ihre Kolleg:innen der BIOPHARMA
EXCELLENCE
BY PHARMALEX unterstützen die Teams dabei, herausragende Wissenschaft in Sprunginnovationen zu überführen, die eines Tages Patient:innen zugutekommen können. Sie bauen dabei auf langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Zulassung innovativer Arzneimittel, sowohl aus eigenen Biotech-Unternehmen als auch aus führenden Positionen in den relevanten Regulierungsbehörden.
• IMMUNOPEC schafft eine Plattform für ein schnelles und sicheres Eingreifen bei Ausbrüchen von Viruserkrankungen, um Patient:innen lebensrettende therapeutische Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Dr. Oliver Reimann und sein Team der Belyntic GmbH setzen dabei auf neuartige therapeutische Peptid-Impfstoffe.
• IMMUNOPEC schafft eine Plattform für ein schnelles und sicheres Eingreifen bei Ausbrüchen von Viruserkrankungen, um Patient:innen lebensrettende therapeutische Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Dr. Oliver Reimann und sein Team der Belyntic GmbH setzen dabei auf neuartige therapeutische Peptid-Impfstoffe.
• IGUARD um Prof. Dr. Axel Schambach (MHH) entwickelt molekulare Therapeutika der nächsten Generation auf RNAi-Basis gegen respiratorische Virusinfektionen und nutzt dazu maschinelles Lernen zur automatischen Identifizierung von Zielstrukturen sowie eine optimierte Vektorplattform für die Verabreichung und präklinische Validierung in humanen, patientenrelevanten Modellen. Durch diese automatische Identifizierung von Zielstrukturen sollen sich antivirale Therapeutika deutlich schneller entwickeln lassen als bisher.
• IGUARD um Prof. Dr. Axel Schambach (MHH) entwickelt molekulare Therapeutika der nächsten Generation auf RNAi-Basis gegen respiratorische Virusinfektionen und nutzt dazu maschinelles Lernen zur automatischen Identifizierung von Zielstrukturen sowie eine optimierte Vektorplattform für die Verabreichung und präklinische Validierung in humanen, patientenrelevanten Modellen. Durch diese automatische Identifizierung von Zielstrukturen sollen sich antivirale Therapeutika deutlich schneller entwickeln lassen als bisher.
ANTIVIRALE MITTEL
ANTIVIRALE MITTEL
Viren im Dr. Hendrik die Viren Schalen nächsten Gene Ensoli (ISS) Immunsystem unterbindet. Frankfurt) niedermolekularer dabei RNAAbschnitte robustes Ziel. entwickelt ein des Mukus, verstärkt. Dieses so flexibel der Ansatz verstärkt Maske. beschleu Generation in-silicoProf. Dr. der Zelle, durch das rasanten sich die antivirale WirkJahrmillionen mit AbMechanismen Menschen
Viren im Hendrik Viren Schalen Gene(ISS) Immunsystem unterbindet. Frankfurt) niedermolekularer RNAAbschnitte Ziel. ein Mukus, Dieses flexibel Ansatz verstärkt beschleuGeneration in-silicoProf. Dr. Zelle, das rasanten die WirkAbMechanismen Menschen
CRISPR/Cas13, perfektioniert wurde, RNA-Viren wie blockieren. gefunden, zu sein. sicheres Ein Patient:innen lebens Dr. Oliver neuartige molekulare The respiratorische automatischen Vektorplattform humanen, patien Identifizierung von schneller
CRISPR/Cas13, wurde, wie blockieren. gefunden, sein. EinlebensOliver neuartige Therespiratorische automatischen Vektorplattform patienvon schneller
 LASSEN SIE SICH BEWEGEN! JETZT SCANNEN
LASSEN SIE SICH BEWEGEN! JETZT SCANNEN
CHALLENGE: GROSSE MENGEN CO2 LANGFRISTIG DER ATMOSPHÄRE ENTZIEHEN UND ÖKONOMISCH IN PRODUKTEN BINDEN
Die Menschheit hat seit der Industriellen Revolution gigantische Mengen Kohlenstoff in Form von Öl, Kohle oder Erdgas gefördert und verbrannt. Die dabei freigesetzten Treibhausgase verändern das Leben der Menschen weltweit in dramatischer Weise. Wetterextreme und ihre Auswirkungen wie Dürren, Überflutungen oder Waldbrände nehmen seit Jahren zu. Sie zerstören Existenzgrundlagen, bedrohen die Gesundheit und das Leben der Menschen. Die Weltgemeinschaft ist sich einig: Die globale Erwärmung muss auf unter zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung begrenzt werden. Deshalb haben Länder wie Deutschland Ziele und Schritte formuliert, wie sie die Emission von Treibhausgasen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten reduzieren wollen. Und in der Tat gibt es Fortschritte. Die Emissionen sinken – aber viel zu langsam. Klima-Expert:innen sind sich einig: Die CO 2-Emissionen (weiter) zu reduzieren, reicht nicht. Wir müssen es schaffen, enorme Mengen Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen und so Emissionen der Vergangenheit rückgängig zu machen. Innovator:innen aus aller Welt haben bereits gezeigt, dass dies technisch-methodisch möglich ist. Diese Metho den sind jedoch immens teuer, oft selbst sehr energieintensiv und nur begrenzt skalierbar.
Die Menschheit hat seit der Industriellen Revolution gigantische Mengen Kohlenstoff in Form von Öl, Kohle oder Erdgas gefördert und verbrannt. Die dabei freigesetzten Treibhausgase verändern das Leben der Menschen weltweit in dramatischer Weise. Wetterextreme und ihre Auswirkungen wie Dürren, Überflutungen oder Waldbrände nehmen seit Jahren zu. Sie zerstören Existenzgrundlagen, bedrohen die Gesundheit und das Leben der Menschen. Die Weltgemeinschaft ist sich einig: Die globale Erwärmung muss auf unter zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung begrenzt werden. Deshalb haben Länder wie Deutschland Ziele und Schritte formuliert, wie sie die Emission von Treibhausgasen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten reduzieren wollen. Und in der Tat gibt es Fortschritte. Die Emissionen sinken – aber viel zu langsam. Klima-Expert:innen sind sich einig: Die CO 2-Emissionen (weiter) zu reduzieren, reicht nicht. Wir müssen es schaffen, enorme Mengen Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen und so Emissionen der Vergangenheit rückgängig zu machen. Innovator:innen aus aller Welt haben bereits gezeigt, dass dies technisch-methodisch möglich ist. Diese Metho den sind jedoch immens teuer, oft selbst sehr energieintensiv und nur begrenzt skalierbar.
WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN, UM CO 2 AUS ATMOSPHÄRE ZU ENTFERNEN. NACHHALTIG.
WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN, UM CO 2 AUS DER ATMOSPHÄRE ZU ENTFERNEN. NACHHALTIG.
SKALIERBAR.
SKALIERBAR.
WIRTSCHAFTLICH.
WIRTSCHAFTLICH.
WIR BRAUCHEN MUTIGE IDEEN.
WIR BRAUCHEN MUTIGE IDEEN.
WIR BRAUCHEN SIE.
WIR BRAUCHEN SIE.
Wir haben deshalb Ende 2021 zu dieser zukunftsrelevanten Challenge eingeladen – um im Kampf gegen den Klimawandel eine Lösung zu entwickeln, die CO 2 langfristig aus der Atmosphäre entfernt, skalierbar ist und in einem wirtschaftlichen Geschäftsmodell umgesetzt werden kann. Der Kern der Challenge: Das CO 2 muss in langfristig haltbare Produkte mit negativem CO 2-Fußabdruck integriert werden.
TEAMS
TEAMS
• CARBON-TO-CONCRETE ist das sächsische Team der OCS GmbH, das durch die Verwendung des Minerals Olivin die Betonproduktion CO 2negativ werden lassen könnte. Das Team arbeitet an Synthesewegen, durch die Olivin Bestandteile von Beton ersetzen kann und somit eine Revolution in der Baubranche anstoßen könnte.
• CARBON-TO-CONCRETE ist das sächsische Team der OCS GmbH, das durch die Verwendung des Minerals Olivin die Betonproduktion CO 2negativ werden lassen könnte. Das Team arbeitet an Synthesewegen, durch die Olivin Bestandteile von Beton ersetzen kann und somit eine Revolution in der Baubranche anstoßen könnte.
Das Unternehmen CARBO CULTURE mit Sitz in Finnland hat eine Technologie entwickelt, mit der sich biologische Abfälle in funktionale Biokohle umwandeln lassen. Durch ihre elektrische Leitfähigkeit lässt sich die Biokohle als Zusatz in Zement einsetzen und macht ihn zum Beispiel beheizbar. Somit wird CO 2 in Form von Biokohle gebunden und zusätzliche Emissionen bei der Herstellung von Zement und durch die Funktionalität des Baustoffs werden vermieden.
Das Unternehmen CARBO CULTURE mit Sitz in Finnland hat eine Technologie entwickelt, mit der sich biologische Abfälle in funktionale Biokohle umwandeln lassen. Durch ihre elektrische Leitfähigkeit lässt sich die Biokohle als Zusatz in Zement einsetzen und macht ihn zum Beispiel beheizbar. Somit wird CO 2 in Form von Biokohle gebunden und zusätzliche Emissionen bei der Herstellung von Zement und durch die Funktionalität des Baustoffs werden vermieden.
• ROBINIA , geleitet von Dr. Jens Standfuß vom Fraunhofer IWS Dresden, entwickelt einen neuen Holz-Verbundstoff aus Robinienholz. Dieses Material ist so widerstandsfähig, dass es als Alternative zu Beton und Stahl zum Beispiel im Brücken- und Windkraftanlagenbau zum Einsatz kommen kann.
• C-CAUSE , ein Konsortium von Start-ups und Forschungseinrichtungen rund um Dr. Mar Fernández-Méndez vom AWI, plant den Betrieb riesiger Algenplantagen im Atlantik. Über Fermentation wird die gewonnene Biomasse in Ausgangsmaterialien zur Kunststoffherstellung umgewandelt. Somit wird sowohl atmosphärisches CO2 gebunden, als auch ein Ersatz für fossile Rohstoffe zur Herstellung von Chemikalien produziert.
• C-CAUSE , ein Konsortium von Start-ups und Forschungseinrichtungen rund um Dr. Mar Fernández-Méndez vom AWI, plant den Betrieb riesiger Algenplantagen im Atlantik. Über Fermentation wird die gewonnene Biomasse in Ausgangsmaterialien zur Kunststoffherstellung umgewandelt. Somit wird sowohl atmosphärisches CO2 gebunden, als auch ein Ersatz für fossile Rohstoffe zur Herstellung von Chemikalien produziert.
• ROBINIA , zusammengesetzt aus Vertretern des Fraunhofer IWS Dresden, Fraunhofer WKI Braunschweig, STRAB Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH und der LEAG Cottbus, forscht an einem Baumaterialersatz für Beton- und Stahlkonstruktionen. Dabei entwickeln sie einen Verbundstoff aus dem schnellwachsenden und sehr robusten Baum Robinie. Dieser Verbundstoff soll zum Bau von Brücken und Windkraftanlagen verwendet werden und selbst unbehandelt 80 bis 100 Jahre der Witterung standhalten.
Wir haben deshalb Ende 2021 zu dieser zukunftsrelevanten Challenge eingeladen – um im Kampf gegen den Klimawandel eine Lösung zu entwickeln, die CO 2 langfristig aus der Atmosphäre entfernt, skalierbar ist und in einem wirtschaftlichen Geschäftsmodell umgesetzt werden kann. Der Kern der Challenge: Das CO 2 muss in langfristig haltbare Produkte mit negativem CO 2-Fußabdruck integriert werden.
Auf welchem Weg unsere Challenge-Teams dieses Ziel erreichen, auf welcher technologischen Grundlage das CO 2 der Atmosphäre entnommen wird, bestimmen sie selbst: ob via Direct Air Capture, Bioenergie mit CO 2Abscheidung, Verarbeitung organischer Stoffe oder Ähnliches. Die Teams demonstrieren, wie sie das CO2 der Atmosphäre in Rohstoffe oder Produkte verwandeln, die den Kohlenstoff über Jahrzehnte binden; und wie ihre Lösung den gesamten Prozess von der CO 2-Abscheidung bis hin zum produzierten Rohstoff oder Produkt wirtschaftlich macht und zudem skalierbar ist.
Auf welchem Weg unsere Challenge-Teams dieses Ziel erreichen, auf welcher technologischen Grundlage das CO 2 der Atmosphäre entnommen wird, bestimmen sie selbst: ob via Direct Air Capture, Bioenergie mit CO 2Abscheidung, Verarbeitung organischer Stoffe oder Ähnliches. Die Teams demonstrieren, wie sie das CO2 der Atmosphäre in Rohstoffe oder Produkte verwandeln, die den Kohlenstoff über Jahrzehnte binden; und wie ihre Lösung den gesamten Prozess von der CO 2-Abscheidung bis hin zum produzierten Rohstoff oder Produkt wirtschaftlich macht und zudem skalierbar ist.
ROBINIA , zusammengesetzt aus Vertretern des Fraunhofer IWS Dresden, Fraunhofer WKI Braunschweig, STRAB Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH und der LEAG Cottbus, forscht an einem Baumaterialersatz für Beton- und Stahlkonstruktionen. Dabei entwickeln sie einen Verbundstoff aus dem schnellwachsenden und sehr robusten Baum Robinie. Dieser Verbundstoff soll zum Bau von Brücken und Windkraftanlagen verwendet werden und selbst unbehandelt 80 bis 100 Jahre der Witterung standhalten.
• Das Team von ENADYNE arbeitet an einer ressourcenschonenden Form der Plasmakatalyse. Durch die Technologie des sächsischen Unternehmens lassen sich CO 2 und Wasserstoff energiearm zu Kohlenwasserstoffen für die chemische Industrie synthetisieren.
Das Team von ENADYNE arbeitet an einer ressourcenschonenden Form der Plasmakatalyse. Durch die Technologie des sächsischen Unternehmens lassen sich CO 2 und Wasserstoff energiearm zu Kohlenwasserstoffen für die chemische Industrie synthetisieren.
Erfolgreiche Teams unterstützen wir im gesamten Verlauf der Challenge mit über zwei Millionen Euro. Ende April 2022 entschied sich unsere externe Jury für fünf Teams aus über 60 Einreichungen.
Erfolgreiche Teams unterstützen wir im gesamten Verlauf der Challenge mit über zwei Millionen Euro. Ende April 2022 entschied sich unsere externe Jury für fünf Teams aus über 60 Einreichungen.
CARBON-TOVALUE
CARBON-TOVALUE
BEREIT FÜR WIND? JETZT SCANNEN

Um im Kampf gegen den Klimawandel seinen Beitrag zu leisten, muss Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und die Energieversorgung aus ausschließlich erneuerbaren Energien sicherstellen. Der Handlungsdruck hat sich zudem infolge des Ukrainekriegs erhöht, denn Gas hat als Übergangstechnologie an Attraktivität verloren – und Deutschlands Unabhängigkeit bei der Energieversorgung massiv an Bedeutung gewonnen. Angesichts dieser neuen existenziellen Bedrohungen, der immer häufiger werdenden Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen muss der Anteil der erneuerbaren Energien in den kommenden zwei Jahrzehnten stark ansteigen. Gleichzeitig sollen die grundlastfähigen Atom- und Kohlekraftwerke bis 2038 vollständig vom Netz genommen und durch Wind- und Solarkraft ersetzt werden. Dabei stellen lange Perioden ohne nennenswertes Solar- und Windenergiepotential eine besondere Herausforderung dar, sogenannte Dunkelflauten. Während andauernder Dunkelflauten liegt die Leistung von Wind- und Solarkraft nur bei einem Bruchteil der üblichen Durchschnittsleistung, sodass der Energiebedarf auch mithilfe von Lastmanagement und Kurzzeitspeichern nicht abgedeckt werden kann.
In Deutschland treten mehrere solcher Flauten mit einer Länge von über 48 Stunden pro Jahr auf, im Einzelfall können sie sich aber auch über bis zu zehn Tage hinziehen. In diesen Zeiträumen spielen langfristige Energiespeicher, also Energiespeicher mit einer Speicherdauer von mindestens zehn Stunden, eine essenzielle Rolle, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Zudem erstrecken sich meist durch den Winter lange Perioden, in denen in Zukunft die Energieerzeugung hinter dem Energiebedarf zurückbleibt. Langfristige Energiespeicher sind ein zentraler Baustein für die Energieautonomie und die Erreichung der Klimaziele, parallel auch ein heranwachsender Multi-Milliarden-Markt, der allerdings mit den aktuell marktreifen Technologien nur unzureichend bedient werden kann.
CHALLENGE: ENTWICKELN.
ERFOLGTE ENDE NOVEMBER (NACH REDAKTIONSSCHLUSS).
In einer um uns aus unzähligen ausgelesen, in größere geführt. Dazwischen nehmen, komplexe Doch Wenn der mit der Jahr 2040 nehmen. turen immer nun an autonomen bis zur umsetzen gefunden
FAQ
WELCHE KOSTEN KÖNNEN ÜBER DIE FINANZIERUNG GETRAGEN WERDEN?
Alle Ausgaben, die der Erreichung des Challenge-Ziels dienen, können mit den Mitteln der SPRIND finanziert werden. Dazu können zum Beispiel Personalkosten, Geräte und Materialien oder die Miete von Laborflächen gehören.
WIE LANGE IST DIE LAUFZEIT DER CHALLENGE?
Die Challenge hat eine Laufzeit von insgesamt zweieinhalb Jahren. Dabei findet nach Ende der einjährigen Stufe 1 der Challenge eine weitere Auswahlrunde statt, in der sich herausstellt, welche der Challenge-Teams auch in Stufe 2 der Challenge durch die SPRIND finanziert werden.
WELCHE NACHWEISE MUSS EIN TEAM IM VERLAUF DER CHALLENGE ERBRINGEN?
Alle Challenge-Teams sind im Verlauf der Challenge in einem engen Austausch mit der SPRIND und dem Coaching-Team. Dadurch wird ein zielgerichteter Innovationsprozess sichergestellt, in dem aufkommende Herausforderungen frühzeitig identifiziert und adressiert werden können. Darüber hinaus sind keine detaillierten Aufstellungen zur Verwendung der Finanzierung erforderlich.
WER KANN AN DER CHALLENGE TEILNEHMEN?
Es können sowohl Einzelteilnehmer:innen als auch Teams teilnehmen. Bewerben können sich Teams in allen Rechtsformen wie Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, etablierte Unternehmen, Start-ups und Inkubatoren; auch ein Verbund aus mehreren Entitäten ist möglich. Teilnehmer:innen und Teams sind antragsberechtigt, wenn sie ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, in der Europäischen Freihandelszone (EFTA), dem Vereinigten Königreich oder Israel haben.
WELCHE UNTERSTÜTZUNG ERHALTE ICH DURCH DIE SPRIND?
Die SPRIND unterstützt alle Teams darin, das Ziel der Challenge zu erreichen. Dazu gehört, dass die SPRIND die Arbeit der Teams von Beginn der Challenge an finanziert. Darüber hinaus stellen wir allen Teams eine:n Coach:in zur Seite, der:die umfassende Erfahrung in der Umsetzung von bahnbrechenden Innovationen hat. Aus dieser Erfahrung heraus unterstützt der:die Coach:in die Teams zum Beispiel bei der Planung der Arbeitspakete und Experimente, auch in Hinblick auf die Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen, oder bei der Vernetzung mit Kollaborationspartner:innen oder Unterauftragnehmer:innen. Darüber hinaus nutzt die SPRIND ihr Netzwerk, um die Umsetzung von Sprunginnovationen zu befördern.
FAQ
GEHT Es geht neue Konzepte Implementierungen WELCHE SPRIND Beginn Innovationen KANN Für die Teams Rahmen Innovationen themenoffenen
KÖNNEN Die SPRIND entwickeln. auch
LONG-DURATION ENERGY STORAGE
BEREIT FÜR WIND? JETZT SCANNENNEUE SYSTEME? JETZT SCANNEN

CHALLENGE:
In einer digitalen Welt der Zukunft werden der Alltag und die Arbeitswelt um uns herum permanent durch Künstliche Intelligenz unterstützt. Daten aus unzähligen Sensoren und Aktoren werden durch kleinste Rechner ausgelesen, verarbeitet, über ein Netz von Datenstrecken zusammengeführt in größere Knotenpunkte mit mehr Rechenleistung, interpretiert, zurückgeführt. Sie verändern, steuern, unterstützen, bewegen unser Leben. Dazwischen sitzen riesige Rechenzentren, die die großen Aufgaben übernehmen, Daten verwalten und lenken, künstliche Gehirne trainieren und komplexe wissenschaftliche Probleme lösen.
Doch diese Vision einer vernetzten Welt hat derzeit einen hohen Preis. Wenn der weltweite Energieverbrauch für Computing und Kommunikation mit der gleichen Geschwindigkeit zunimmt wie bisher, wird er bereits im Jahr 2040 die gesamte, weltweite Kapazität zur Energieproduktion einnehmen. Lange ist der Energieverbrauch gesunken – weil die Chipstrukturen immer kleiner geworden sind. Doch hier stoßen die Entwicklungen nun an ihre physikalischen Grenzen. Um unsere Zukunftsvisionen – vom autonomen Fahren über eine computergestützte Medikamentenentwicklung bis zur intelligenten Steuerung unzähliger erneuerbarer Energiequellen –umsetzen zu können, müssen daher grundlegend neue Rechenkonzepte gefunden werden.
FAQ
DIE
HERAUSFORDERUNG : Computing-Ansätze entwickeln, die eine signifikante Reduktion im Ressourcenverbrauch bezogen auf Energie, Zeit oder Platz versprechen, oder Fragestellungen angehen, die bisher gar nicht lösbar sind.
Ziel der Challenge ist es, grundlegend neue Computing-Konzepte in der Theorie zu entwickeln und stufenweise in die Praxis zu überführen. Die Ansätze müssen einen großen Hebel in der Anwendung erzielen. Es soll entweder ein spezifisches Problem mit hohem Vorkommen in der Anwendung gelöst werden, zum Beispiel die Lösung von partiellen Differentialgleichungen, oder ein spezifisches Problem, dessen Lösung einen signifikanten Wissensgewinn verspricht. Ebenso kann ein generalistischer Ansatz entwickelt werden.
BIS ANFANG OKTOBER 2022 KONNTEN SICH TEAMS FÜR DIE CHALLENGE BEWERBEN. DIE AUSWAHL DER TEAMS ERFOLGTE ENDE OKTOBER (NACH REDAKTIONSSCHLUSS).
GEHT ES IN DER CHALLENGE UM THEORETISCHE KONZEPTE ODER DARUM, HARDWARE ZU ENTWICKELN?
Es geht um beides. Dieser Wettbewerb besteht aus zwei Teilen. In Teil 1 arbeiten die Teams an theoretischen Konzepten für neue Ansätze in der Datenverarbeitung und leiten Hardware-Spezifikationen ab, die für die Umsetzung der theoretischen Konzepte benötigt werden. Teil 2 beginnt nach dem Ende von Teil 1 der Challenge. In Teil 2 entwickeln die Teams HardwareImplementierungen für neue Computingkonzepte.
WELCHE UNTERSTÜTZUNG ERHALTEN TEAMS VON SPRIND?
SPRIND unterstützt alle Teams dabei, das Challenge-Ziel zu erreichen. Dazu gehört, dass SPRIND die Arbeit der Teams von Beginn der Challenge an finanziert. Darüber hinaus nutzt die SPRIND ihr Netzwerk, um die Umsetzung von bahnbrechenden Innovationen zu fördern.
KANN ICH MICH ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT FÜR DEN WETTBEWERB BEWERBEN?
Für die Teile 1 und 2 des Wettbewerbs können Sie sich nur bis zum Ablauf der Frist für die jeweilige Ausschreibung bewerben. Teams können sich für Teil 2 der Challenge bewerben, auch wenn sie nicht an Teil 1 teilgenommen haben. Wenn Ihnen dieser Rahmen nicht genug Flexibilität bietet und Sie an Lösungen für New Computing Concepts mit Potential für bahnbrechende Innovationen arbeiten, können Sie uns gerne kontaktieren oder einen Projektvorschlag über das Einreichungsformular unseres themenoffenen Programms einreichen.
KÖNNEN
INNOVATIONEN NACH DER CHALLENGE WEITER DURCH SPRIND UNTERSTÜTZT WERDEN?
Die SPRIND ist entschlossen, Sprunginnovationen umzusetzen und Innovator:innen darin zu unterstützen, Innovationen zu entwickeln. Falls die SPRIND während der Challenge Sprunginnovationspotential in den Teams identifiziert, kann deren Arbeit auch nach Abschluss der Challenge weiter unterstützt werden.
NEW COMPUTING CONCEPTS

ANZAHL TEAMS


HAT EINE IDEE DAS ZEUG ZUR SPRUNGINNOVATION? DAZU PRÜFEN WIR SIE AUF HERZ UND NIEREN.
ESSENTIELL BEI JEDER CHALLENGE:
DER PRÜFSTAND
Das ambitionierte Ziel einer SPRIND Challenge werden die meisten Teams nicht erreichen. Deshalb ist es essentiell, das Potential der Teams und ihrer Konzepte regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und nur die vielversprechendsten Teilnehmer:innen weiter zu unterstützen. Hierfür bauen die SPRIND Challenges auf einen mehrstufigen Prozess, bei dem kontinuierlich Teams aus der Challenge ausscheiden. So konzentrieren sich sowohl SPRIND als auch die Teams auf schnelle Lernprozesse und erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit.
ES GIBT KEINE VERLIERER:
DAS INNOVATIONSÖKOSYSTEM
Allein sind die ausscheidenden Teams dennoch nicht, denn im Verlauf der Challenge unterstützt SPRIND die Teilnehmer:innen im Rahmen der Aufbauarbeit eines starken Innovationsökosystems unter anderem mit Kontakten zu anderen Geldgebern. Die Geschichte hat zudem gezeigt, dass aus Misserfolgen in Innovationswettbewerben dennoch wichtige Innovationen werden können. So konnte zwar ein gewisser Galileo Galilei in einem Innovationswettbewerb nicht das Rätsel um die Bestimmung des Längengrads auf See lösen, erfand dabei aber die beste Methode zur Bestimmung des Längengrads an Land.

KERNELEMENTE DER SPRIND CHALLENGES
OFFENHEIT
Was zählt, ist, das Ziel der Challenge zu erreichen, der Weg dahin ist den Teams überlassen. Diese Offenheit gegenüber technologischen Ansätzen, institutionellem Hintergrund oder geografischer Herkunft ermöglicht die Einbindung der größten Talente – unabhängig davon, woher sie kommen. Nicht weniger braucht es zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit.
UMSETZUNG
Anträge lösen keine Probleme, Innovationen tun es. Daher ist das Bewerbungsverfahren so schlank und unbürokratisch wie nur möglich gestaltet. Eine Teilnahme an den Challenges ist so auch ohne Förderantrags-Know-how möglich. Damit können sich alle Beteiligten auf das Wichtigste konzentrieren: die Entwicklung der nächsten Sprunginnovation.
ÖKOSYSTEM

Die Welt verändert sich nicht im Alleingang. Die Teams einer Challenge bilden mit ihrer gemeinsamen Mission den Kern sich entwickelnder Ökosysteme um neue Technologien und Märkte. SPRIND selbst gestaltet diese Ökosysteme aktiv mit.
HABEN SIE FRAGEN ZU DEN SPRIND CHALLENGES? CHALLENGE OFFICER:
DR. JANO COSTARD SCHREIBEN SIE UNS UNTER CHALLENGE@SPRIND.ORGCHALLENGES

CHALLENGE DAYS
TREFFEN DER ANTIVIRALS-TEAMS IN LEIPZIG JUNI 2022
» FOR TODAY I THOUGHT I WAS SUPPOSED TO SPEND THE DAY BASICALLY SITTING IN PROGRAM. AND ACTUALLY WHAT I DID WAS TALKING TO SO MANY PEOPLE, SO I KIND OF DEVIATED QUITE A BIT FROM THE ACTUAL SCHEDULE. «
— PROF. DR. HENDRIK DIETZ/TEAM VIRUSTRAP

Im Herbst 2021 ist die Challenge „EIN QUANTENSPRUNG FÜR NEUE ANTIVIRALE MITTEL“ der SPRIND angelaufen. Seitdem forschen alle neun Challenge-Teams an ihren Ideen, erproben diese und entwickeln sie weiter. Um abseits vom Laboralltag die anderen Teams, Coaches, Expert:innen und nicht zuletzt die SPRIND besser kennenzulernen, hat die Bundesagentur für Sprunginnovationen am 27. und 28. Juni 2022 die ersten Challenge Days in Leipzig veranstaltet.
Die rund 60 Gäste nutzten zudem die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und in Leipzig eine Menge neuer Eindrücke und Ideen zu sammeln. Dabei konnten die Teilnehmer:innen auf Input aus erster Hand bauen, Feedback von CurevacGründer INGMAR HOERR oder Viratherapeutics-COO LISA EGERER erhalten. Zusätzlich profitierten sie von den Ausgründungserfahrungen von Forscher und Mehrfachgründer EICKE LATZ und THOMAS HANKE von Evotec.












» IT WAS FASCINATING! YOU COULD REALLY FEEL THE DRIVE AND AMBITION AND JUST GET TOUCHED BY THE IDEA TO CREATE SOMETHING NEW. «
— MARIO BRANDENBURG/PARLAMENTARISCHER STAATSSEKRETÄR IM BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (LINKS, MIT AUFSICHTSRATSVORSITZENDEM DR.-ING. E. H. PETER LEIBINGER)DR. BARBARA ENSOLI/TEAM EXIGENT

» IT WAS REALLY INSPIRING TO SEE FRIENDS OF MINE BUT ALSO NEW TEAMS THAT ARE ACTUALLY TRYING TO CHANGE THE WORLD. TO ME THAT IS WHAT SCIENCE IS ABOUT. «
— PROF. DR. EICKE LATZ/UNIVERSITÄTSKLINIKUM BONN (LINKS, MIT DR. NADJA BERGER/TEAM IMMUNOPEC)JETZT SCANNEN UND DIE CHALLENGE DAYS IM BEWEGTBILD ERLEBEN
SPRINDVERSITY
DURCH VIELFALT DEN SPRUNG SCHAFFEN KATJA SPECK
Noch immer sind weibliche Teams bei Unternehmensgründungen, besonders bei Ausgründungen aus der Wissenschaft, deutlich unterrepräsentiert. Leider bilden auch die Projekteinreichungen bei SPRIND keine Ausnahme.
Als SPRIND 2020 auf die ersten Einreichungen seit Gründung im Oktober 2019 blickte, machten reine Männerteams oder einzelne, männliche High Potentials, unsere HiPos, mehr als 98 Prozent unter sich aus – schwer hinnehmbar für eine Bundesagentur, die sich die Diversität und damit auch die Gleichstellung und Unterstützung der Frauen zur Maxime macht. Daraufhin wurde an vielen Stellschrauben gedreht und insbesondere die Außenwahrnehmung der SPRIND kritisch hinterfragt. So war unser ursprüngliches Außenbild mit den gezeigten Persönlichkeiten und den ersten tollen Projekten leider zwangsläufig durchweg maskulin. Aber auch unsere Sprache auf der Website und in Social Media war sehr männlich geprägt. Unser Ziel war und ist es aber eben auch, die smarten Innovatorinnen, von denen wir wissen, dass es sie gibt, anzusprechen und zu erreichen. Quoten interessieren uns dabei nicht. Uns interessieren Menschen, die die Zukunft entwickeln wollen – und deshalb können wir uns keinesfalls die klugen, visionären Ideen der Hälfte der Gesellschaft entgehen lassen. Bei SPRIND glauben wir an Diversität. Diverse Teams sind der Katalysator für kreative Lösungsansätze, für Innovationen und deren erfolgreiche Umsetzung. Wir sind davon überzeugt, dass es da draußen zahlreiche talentierte Innovatorinnen, Agender und neutrois HiPos mit innovativen Projektideen gibt. Ziel ist es deshalb, potentielle Innovator:innen und Expert:innen jedes oder nicht näher bestimmten Geschlechts anzuziehen und sie dazu zu ermutigen, ihr Projekt bei SPRIND einzureichen. Unser Credo lautet: „Bei uns bist du richtig, wenn du dafür brennst, eines der großen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. (Fast) Alles andere ist uns egal.“
Vielfältigkeit ist essenziell für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und um die großen Themen unserer Zeit zu lösen. Wir schaffen den „Sprung“, weil wir die Themen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln angehen.
» WOMEN BELONG IN ALL PLACES WHERE DECISIONS ARE BEING MADE. IT SHOULDN’T BE THAT WOMEN ARE THE EXCEPTION. « — RUTH BADER GINSBURG
Was die Altersspanne der Einreichenden oder auch die Herkunftsbundesländer betrifft, sehen wir eine gute Verteilung. Leider gilt das noch nicht für den Geschlechter-Mix: Innovator:innen bleiben nach wie vor deutlich in der Unterzahl.
Die ersten SPRIND-Projekte waren durchgehend von männlichen Teams besetzt. Dabei sind und waren die Themen sowie die Innovatoren die Richtigen. Sie abzulehnen, war selbstverständlich keine Option. Das Ausbleiben weiblicher Einreichungen hinzunehmen, ist genauso wenig eine Option und bleibt eine unserer großen Aufgaben. Von knapp unter zwei Prozent Frauen unter den ersten 200 Einreichungen konnten wir uns im Jahr 2022 bei mehr als 1.000 auf über acht Prozent steigern. Es ist ein Aufwärtstrend zu sehen, aber längst nicht auf dem Niveau, das uns vorschwebt und das wir brauchen.
„If she can see it, she can be it“, dieser Leitgedanke wurde durch viele Initiativen erfolgreich geprägt und wir haben ihn uns zum Vorbild genommen: SPRIND gibt deshalb „Role Models“ aus dem Expert:innennetzwerk, aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und dem SPRIND-Team, eine Bühne und ein Gesicht: „If she can see her, she can be her.“
So haben wir beispielsweise mit Falling Walls einen gut besuchten SPRINDversity Workshop für mögliche Gründerinnen aus Wissenschaft und Wirtschaft gestartet und durchweg sehr positives Feedback erhalten. Erfolgreiche Vorbilder werden nahbar; Fragen, die sich viele Innovatorinnen vor einer Einreichung oder Gründung stellen, können im kleinen Kreis direkt und viel besser thematisiert werden. Damit werden Fragezeichen und Ängste aufgelöst sowie Perspektiven aufgezeigt.
DIGITAL-AKTION: GIRLS JUST WANNA HAVE FUNDING FOR THEIR SPRUNGINNOVATION
Dieses exklusiv für SPRIND gestaltete und limitierte T-Shirt tragen unsere SPRINDfluencer:innen postend, twitternd, auf Konferenzen oder auf der Straße und unterstützen damit unser gemeinsames Anliegen: mehr Kapital für Gründerinnen und mehr Mut von Innovatorinnen.
Viele großartige und zu Recht erfolgreiche Frauen setzen sich dafür ein, dass wir uns in hoffentlich naher Zukunft gar keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie wir Innovatorinnen erreichen. Es gibt viele exzellente Netzwerke und Initiativen, die DIVERSITY –nicht nur in Bezug auf Geschlechter – fördern. Je mehr wir davon im Alltag sehen und zeigen, desto mehr Frauen trauen sich, ihre Ideen als Sprunginnovation an die SPRIND heranzutragen.
















ESSAY
SCHLUSS MIT DEM INNOVATIONSTHEATER
GASTBEITRAG VON PROF. DR. KATHARINA HÖLZLE
LEITERIN DES INSTITUTS FÜR ARBEITSWISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIEMANAGEMENT DER UNIVERSITÄT STUTTGART SOWIE DES FRAUNHOFER-INSTITUTS FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION

Deutschland ist noch die größte Volkswirtschaft in Europa und international führend mit Blick auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. Die verarbeitende Industrie und technologische Innovationen sind ein zentrales Fundament für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und ein wichtiger Garant für das sozioökonomische Wohlergehen. Dabei spielt die Chemie- und Pharmaindustrie eine bedeutende Rolle, aber auch die Elektro-, Maschinenbau- und Automobilindustrie. Auf der anderen Seite lässt sich eine fallende Beteiligung insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen an der gesamtwirtschaftlichen Innovationsleistung feststellen. Zunächst hervorgerufen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktuell durch die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit, sind die geplanten Ausgaben für neue Maschinen und Anlagen sowie für alle Arten von Innovationsvorhaben stark zurückgegangen. Weiterhin hat sich Deutschlands Position bei zentralen Schlüsseltechnologien im internationalen Vergleich drastisch verschlechtert, dies insbesondere bei digitalen Schlüsseltechnologien wie beispielsweise Künstlicher Intelligenz, digitalen Sicherheitstechnologien oder in der Mikroelektronik. Doch nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Verwertung passiert in Deutschland viel zu wenig. So liegt die Gründungsquote in Deutschland, also der Anteil der Erwerbsbevölkerung, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren ein Unternehmen gegründet hat, laut Handelsblatt mit knapp fünf Prozent auf Platz 41 von 43 Vergleichsländern. Die Zeichen auf Innovation stehen nicht gut und das gibt in einer Zeit, die im Angesicht großer Herausforderungen dringend radikale Lösungsansätze benötigt, großen Anlass zur Sorge.
BEVOR ICH MÖGLICHE LÖSUNGSWEGE SKIZZIERE, MÖCHTE ICH FÜNF TREIBER FÜR DIE AKTUELLE SITUATION NENNEN:
Die GERINGE DIGITALISIERUNGSRATE, hervorgerufen durch eine sehr heterogene digitale Infrastruktur und allgemein langsame Adaption digitaler Werkzeuge und Dienstleistungen.
Ein NICHT-INKLUSIVES INNOVATIONSSYSTEM: Große Unternehmen und wenige Regionen sind Innovationstreiber in Deutschland. Der Frauenanteil bei Patentanmeldungen und in den MINT-Bereichen ist im OECD-Vergleich sehr gering. Geringe Innovationsbeteiligung und wenig Dynamik bei Start-ups und jungen Unternehmen.
ZUNEHMENDER FACHKRÄFTEMANGEL, der sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt hat; Experten gehen aktuell von 450.000 bis 600.000 unbesetzten Stellen aus.
FEHLENDER
TRANSFER AUS DER FORSCHUNG IN DIE ANWENDUNG, hier insbesondere in die Gründung. Deutschland hat trotz sehr hoher Investitionen in die universitäre und außeruniversitäre Forschung und Entwicklung eine viel zu geringe Gründungsquote von wissenschaftsbasierten und Deep-Tech-Start-ups.
ZUNEHMENDE FORMALISIERUNG UND BÜROKRATISIERUNG
Ein immer größerer Anteil der (staatlichen) Forschungs- und Innovationsausgaben fließt in nicht direkt innovationsbezogene Strukturen wie Verwaltung, Administration und Regulatorik.
WAS MUSS SICH ÄNDERN?
Das deutsche Streben nach Perfektion, Normierung und Standardisierung war für viele Jahre eine wichtige Zutat auf dem Weg zum Innovationsweltmeister. Deutsche Unternehmen sind in vielen Bereichen Qualitätsweltmeister; der deutsche Weg etwa zur Spaltmaßoptimierung ist bezeichnend. Doch diese Fähigkeiten sind vor allem für schrittweise Innovation wichtig. Das reicht heute nicht mehr – stattdessen brauchen wir radikale Innovation. Und diese spielt nach völlig anderen Regeln: Radikale Innovation braucht Mut, Lust auf Risiko, die Möglichkeit und die Akzeptanz von Scheitern sowie Freiräume zum Ausprobieren. Sie braucht andere Fähigkeiten wie unternehmerisches Denken und Handeln, Kollaboration sowie kritische Reflexion. Es reicht für Unternehmen und Organisationen nicht mehr, sich einen innovativen Anstrich zu geben, indem hier ein Innovationslab, dort ein Accelerator gegründet oder eine Zusammenarbeit mit einem Start-up oder einer Wissenschaftsorganisation groß angekündigt wird. Diese Initiativen haben in den vergangenen Jahren in den meisten Fällen die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt. Das liegt vor allem daran, dass Wandel und Innovation nicht wirklich gewollt waren. Denn sie sind anders, sie sind anstrengend, unbequem und daher nicht willkommen. Sie bedeuten, dass vorhandene Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen abgeschafft oder verändert werden müssen. Viele Führungskräfte waren und sind aber nicht bereit, wirklich Freiräume zu geben, ins Risiko zu gehen, existierende Strukturen abzuschaffen und fundamental neu zu denken. Diese Diagnose gilt für Unternehmen, aber auch für politische, Bildungs- und Forschungsorganisationen.
Wir müssen feststellen, dass dieses Innovationstheater nicht reicht. Wir müssen jetzt aufhören, uns vormachen zu wollen, dass eigentlich doch alles ganz gut läuft, ein paar kleine Veränderungen und Anpassungen ausreichen und unsere Stärken der Vergangenheit auch die der Zukunft sein werden. Stattdessen werden wir uns von Liebgewordenem verabschieden müssen, wir werden verzichten und uns auf bisher nicht Dagewesenes einstellen müssen. Das ist nicht leicht, speziell da uns die Flexibilität, die Resilienz, der Mut und der Umgang mit dem Neuem verloren gegangen sind. Unser Innnovationsmuskel ist schwach geworden und wir müssen schnellstens anfangen, ihn zu trainieren. Was wir jetzt brauchen, ist Lust auf Zukunft, Lust auf Innovation, Lust auf Risiko. Die SPRIND hat uns in den letzten Jahren gezeigt, wie so etwas funktionieren kann. Wir haben erlebt, wie schwer sich das Establishment damit tut, wie stark die Beharrungstendenzen waren (und sind). Aber der Weg der SPRIND zeigt, dass es möglich ist, althergebrachte Denkweisen infrage zu stellen und sie zu verändern. Die SPRIND war nie Innovationstheater, sie war von Anfang an „echt“. Der Weg der SPRIND war nicht gradlinig und wird es auch in Zukunft nicht sein. Er zeigt uns, dass wir manchmal für einen Schritt vorwärts zwei zurückgehen müssen. Dinge müssen ausprobiert werden, um sagen zu können, das funktioniert und das nicht. Strukturen und Institutionen können sich verändern, auch wenn zu Beginn alle (bis auf einen) sagen, das geht nicht. Die SPRIND ist für mich Vorbild, Provokation und echte Veränderung.
Wir wissen aus der Innovationsforschung, dass radikale Innovationen dann passieren, wenn nichts anderes mehr geht. Innovationsschübe kommen in Zeiten der Krise. Gibt es den einen, wahren Weg dorthin? Nein, den gibt es nicht. Wichtig für egal welchen Weg ist eine Kultur, die innovationsfreundlich und veränderungsbereit ist. Dafür braucht es alle Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wenn diese alle mitgenommen werden und mitgestalten dürfen, bin ich optimistisch, dass wir als Gesellschaft, als Land es schaffen können, die Potentiale, die es in diesem Land gibt, gemeinsam auszuschöpfen, gemeinsam den Weg der Innovation zu gestalten und die großen Herausforderungen, die auf uns warten, mit innovativen Lösungsansätzen anzugehen und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. SPRIND sei Dank, dass wir ein Rollenmodell auf diesem Weg haben.
NEU DENKEN, NEU MACHEN UNNACHGIEBIG SEIN UND BESTEHENDES HINTERFRAGEN NUR SO ENTSTEHEN SPRUNGINNOVATIONEN
VALIDIERUNGEN
MODERN CAMERA DESIGNS



KLEINE LINSEN, GROSSE WIRKUNG
MODERN CAMERA DESIGNS WILL DIE HOCHVOLUMENPRODUKTION KLEINER ABBILDUNGSOPTIKEN NACH EUROPA ZURÜCKHOLEN
SPRIND UND MODERN CAMERA DESIGNS
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil wir mit der mcd-Produktionstechnologie eine Branchenrevolution anstoßen. Weil wir mit der Technologie eine Produktionstechnologie haben, die alle Anwendungen für Miniatur- und Mikrolinsen adressiert. Weil diese Produktionstechnologie bestehende Einschränkungen überwindet und neue Grundsteine für Abbildungsinnovationen legt.
EUROPAS UNABHÄNGIGKEIT FÖRDERN
Mithilfe dieser Produktionstechnologie wird eine Schlüsseltechnologie zurück nach Deutschland geholt und damit der Innovationsstandort Deutschland gefördert.
NETWORKING UND GRÖSSER DENKEN
Die SPRIND unterstützt mcd mit seinem umfangreichen Expert:innennetzwerk und Kontakten zu Partner:innen und Anwender:innen, um das Potential des Projektes auf dem schnellsten Weg voranzutreiben und die Technologie in Anwendungen zu bringen.

» UNSER VERFAHREN BERUHT AUF REPLIKATION. DAS KENNT JEDER VOM SANDKASTEN. «


Das ist der Spirit ganz im Sinne der SPRIND: Die beiden Mikrooptik-Spezialisten Dr.-Ing. Frank Wippermann und Dr. Jacques Duparré der mcd – modern camera designs GmbH aus Jena – bringen nicht nur ihre eigene Sprunginnovation auf den Weg, sondern bereiten diesen auch für die von morgen. Denn mit ihrer Innovation revolutionieren sie den Fertigungsprozess für miniaturisieren Abbildungsoptiken auf bahnbrechende Weise.

Dass bei diesem Prozess noch viel Luft nach oben ist, beweisen die beiden aktuell vorherrschenden Verfahren für die Herstellung von Mikrolinsen: „Spritzguss ermöglicht das in erforderlich hoher Qualität, wobei der Nachteil ist, dass das Verfahren für kleine Stückzahlen sehr teuer und nur begrenzt parallelisierbar ist“, erklärt Frank Wippermann, der sich der Miniaturisierung von Kameras verschrieben hat. „Die an die Halbleiterfertigung angelehnte WaferLevel-Optik hingegen kann eher für die Sensorik, nicht aber für hochauflösende Kameralinsen eingesetzt werden. Dafür bietet sie die Möglichkeit, energieeffizient und günstig – da hochparallel – hohe Stückzahlen zu produzieren.“ Der Markt für kleine
Abbildungsoptiken, der derzeit durch Fernost dominiert wird, ist riesig: In Kameras für die Endoskopie, für Auto, PC, Tablet und Smartphone sind jeweils mehrere Linsen im Einsatz. Gleichzeitig findet man mehrere Kameras in einem einzelnen Produkt, bis zu fünf in einem Smartphone und gar bis zu 16 in einem einzigen Auto. „Es ist eine Kunst, die Optiken in perfekter, gleichbleibender Qualität zu einem guten Preis hinzubekommen“, weiß Frank Wippermann, studiert und promoviert in Physikalischer Technik –und will genau das ermöglichen: Das vierköpfige mcd-Team hat einen Weg gefunden, die Nachteile beider Verfahren zu eliminieren und ihre Vorteile zu fusionieren. Dies führt zu neuen Freiheiten in der Objektiventwicklung und spart gleichzeitig Maschinen, Platz, Geld und enorm viel Energie.
ENERGIEVERBRAUCH SENKEN
Das Ganze wird auch dadurch so attraktiv, weil es neue Grundsteine für andere Innovator:innen im Bereich der Optik legt: Am Anfang großer Visionen stehen oft kleine Stückzahlen – diese sind derzeit extrem teuer und stellen daher ein großes Hemmnis dar. „Die geringen Einstiegskosten, die mit
der Fertigung von Linsen über unseren Prozess auch in kleinsten Mengen verbunden sind, gestatten eine leichtere Überprüfung neuer Ideen“, berichtet Physiker Jacques Duparré, der sich hobbymäßig mit Bionik beschäftigt und wie sich die Sehprinzipien von Insekten vorteilhaft in die Welt der digitalen Bildgebung übertragen lassen.
Auf die Energieersparnis sind die Gründer besonders stolz: Denn beim herkömmlichen Spritzgussverfahren werden Polymere bei hohen Temperaturen aufgeschmolzen, unter hohem Druck in die Form gespritzt und dann abgekühlt. Man braucht viele Maschinen, riesige Anlagen unter Reinraumbedingungen. „Indem wir das Verfahren auf Raumtemperatur umstellen, stärker parallelisieren und weniger Maschinen benötigen, senken wir den Energieverbrauch auf bis zu fünf Prozent“, gibt sich Frank Wippermann ambitioniert. Dafür setzen die Gründer auf eine UV-Replikationstechnologie, die es in einem einzigen Arbeitsschritt erlaubt, gleichzeitig bis zu 1.000 asphärische, monolithische Linsen aus Polymer in Abbildungsqualität herzustellen, die zum Beispiel für High-End-SmartphoneKameramodule benötigt werden.
Dass mcd ausgerechnet in Jena seinen Sitz hat, ist natürlich kein Zufall: „Deutschland- oder sogar weltweit ist Jena eine der Top-Adressen für Optik – und wir sind seit unseren Diplomarbeiten vor rund 25 Jahren im selben Jenaer Unternehmen immer wieder beruflich verbunden gewesen“, erklärt Duparré, der zwischendurch sieben Jahre für ein Start-up im Silicon Valley tätig war. So waren und sind er und Wippermann auch am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF beschäftigt, wo sie Ideen für Kameras entwickeln, die nicht mehr aus der Smartphone-Rückseite herausragen. Mit ihrer EXIST-geförderten Unternehmensgrün-
dung im Jahr 2019 planten sie zunächst nur den Entwurf und Bau von Prototypen und Kleinserien für Miniaturkameras, zum Beispiel für medizinische Einmalendoskope. Weil das fast schon überraschend gut funktioniert hat und der Zuspruch bei den Kunden so groß war, haben die beiden dann „einfach“ weitergemacht – und denken jetzt ganz groß. Nicht weniger als die Hochvolumenproduktion von Miniaturund Mikrolinsen wollen sie nach Europa bzw. Deutschland holen.

Mit der SPRIND möchten die zwei Gründer und ihr Team nun vor allem die Produktion ausweiten, „bis wir mehrere 100 Linsen mit einem Mal fertigen kön-
nen – bei immer höherer Komplexität und geringeren Toleranzen“, schildert Wippermann den nächsten anvisierten Meilenstein. Sowohl für Einmalendoskopie als auch Automotive-Anwendungen sind drei Linsenlagen ausreichend. Hierfür kann das Unternehmen bereits „asphärische Menisken mit großer Pfeilhöhe“ herstellen –Superlative in der Mikrolinsenfertigung. Ziel der ehrgeizigen Gründer: „Objektive für Kameras in Smartphones sehen wir als Hauptanwendung. Diese haben bis zu sieben Linsen mit höchsten Qualitätsanforderungen – und da wollen wir hin.“


» MAN KÖNNTE SAGEN, WIR BAUEN DIE PERFEKTEN FÖRMCHEN UND ERSCHAFFEN DAMIT DIE SCHÖNSTEN UND GLEICHMÄSSIGSTEN SANDFIGUREN. «

SOVEREIGN TECH FUND

STÄRKUNG DER DIGITALEN SOUVERÄNITÄT
SOVEREIGN TECH FUND WILL STABILES OPEN-SOURCE-ÖKOSYSTEM UNTERSTÜTZEN
FUNKTIONIERENDE INFRASTRUKTUR GELINGT AUCH KEINE INNOVATION. «
SPRIND UND SOVEREIGN TECH FUND
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil Offene Digitale Basistechnologien die Grundlage von Innovation und digitaler Handlungsfähigkeit bilden. Weil die Stärkung des Open-Source-Ökosystems für eine digitale und souveräne Gesellschaft unerlässlich ist. Weil sichere digitale Infrastruktur als Aufgabe der digitalen Daseinsvorsorge verstanden werden muss.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir inkubieren den Sovereign Tech Fund. Wir investieren in Offene Digitale Basistechnologien in einer Pilotrunde.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Eine starke digitale Grundlage für die Zukunft. Digitale Souveränität für Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung in Europa. Eine nachhaltige und effiziente Nutzung Offener Software. Ein sicheres und vitales Open-Source-Ökosystem ermöglicht Innovation, neue Geschäftsmodelle und nachhaltig nutzbare Ressourcen für alle.
OFFENHEIT, NUTZBARKEIT UND SICHERHEIT
Wir wollen mit dem Sovereign Tech Fund die selbstbestimmte Nutzung und Gestaltung digitaler Technologien absichern.

Wie kritisch eine funktionierende Infrastruktur für unser Leben ist, bemerken wir häufig erst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Im Digitalen gibt es viele Beispiele dafür: Der 2014 entdeckte Heartbleed Bug, Probleme in der Datenerfassung und in mangelhaft digitalisierten Verwaltungsstrukturen in der Corona-Pandemie oder die 2021 entdeckte massive Schwachstelle Log4j. Diese Probleme zeigen, wie weitreichend die Abhängigkeiten und wie großflächig die Auswirkungen auch von Software-Infrastruktur auf Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sind. Ein Fakt, den Fiona Krakenbürger und Adriana Groh nicht länger hinnehmen wollen: Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität in der Technologieentwicklung sowie demokratischen Innovationen treten sie für die digitale Souveränität Europas ein.
„Ohne funktionierende Infrastruktur gelingt auch keine Innovation. Denn insbesondere innovative digitale Technologien sind so gut wie nie von Grund auf neu“, erklärt Fiona Krakenbürger, die über
langjährige Erfahrung im Open-SourceFunding verfügt, die sie unter anderem im Open Technology Fund in Washington D. C. gesammelt hat. „Es werden stets existierende Softwarekomponenten verwendet oder bestehender Code ausgebessert und angepasst, um darauf aufbauend neue Anwendungen zu schreiben.“ Die Nutzung von solchen Offenen Digitalen Basistechnologien, kurz ODB, kann somit die Neu- und Weiterentwicklung stark vereinfachen und die Entwicklungskosten senken, da auf die Vielzahl von Modulen und Code-Bibliotheken zurückgegriffen werden kann. Damit lassen sich durch ordentliche Infrastruktur-Instandhaltung die Innovationskraft und das Entwicklungstempo erhöhen, das vor allem entscheidend ist, um disruptive Technologien zu entwickeln.
Adriana Groh, ehemalige Leiterin des Prototype Fund, eines Programms für Innovationsförderung im Bereich OpenSource-Software, und Fiona Krakenbürger, die dort ebenfalls tätig war, begannen daher mit der Arbeit an einem Förderpro-
gramm für ODB im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. Diese wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durchgeführt und zeigt im Bereich Open Source viele Defizite, aber auch Potentiale auf. „Die Pflege von Offenen Digitalen Basistechnologien, von denen sehr viele Anwendungen und Produkte abhängig sind, ist zu häufig die ehrenamtliche Arbeit Einzelner“, berichtet Fiona Krakenbürger. ODB sind von zentraler Bedeutung für eine innovative Wirtschaft und sichere Verwaltung, denn sie sind in der gesamten Lieferkette vielfach verbaut. Beispiele für solche Basistechnologien sind Code-Bibliotheken oder standardisierte Protokolle, die von Entwickler:innen benutzt werden, um Anwendungssoftware zu schreiben und sicherzustellen, dass diese funktioniert. Während viele kommerzielle Nutzer:innen die Software einsetzen, prüfen bisher noch zu wenige die Funktionalität und Aktualität und geben Weiterentwicklungen bzw. Verbesserungen an das Open-SourceÖkosystem zurück.
OFFENE BASISTECHNOLOGIEN
ALS TEIL DER DIGITALEN DASEINSVORSORGE
„So entsteht ein strukturelles Problem: Dadurch, dass ODB in guter Qualität durch leichte Verfügbarkeit und Lizenzen in zahlreichen Systemen verbaut werden, wird ihre Skalierung häufig größer, als es die Ressourcen der Code-Entwickler:innen zulassen“, erläutert Adriana Groh. „Offene Digitale Basistechnologien sind als digitales öffentliches Gut und als Teil einer digitalen Daseinsvorsorge zu verstehen.“
Sie entziehen sich einer individuellen Zuständigkeit und das sogenannte Trittbrettfahrerproblem entsteht: Jede:r Nutzer:in geht davon aus, dass sich jemand anderes darum kümmern wird, das Gut weiter zur Verfügung zu stellen bzw. es zu pflegen. „Um diese negativen Effekte auszugleichen und ein solides digitales Fundament für die Zukunft zu stärken, brauchen wir gezielte Investitionen.“
Die Lösung, die die Machbarkeitsstudie nahelegt: der Sovereign Tech Fund, der genau dies übernehmen soll und von
Krakenbürger, Groh und weiteren Mitstreiter:innen konzipiert wurde und nun von der SPRIND unterstützt wird. Die Sorge um und der Wunsch nach besserer Pflege der digitalen Infrastruktur wird international in Open-Source-Communities diskutiert und das Wissen aus diesem Netzwerk, zum Beispiel die Arbeit der Technikforscherin Katharina Meyer und die Erfahrungen von Felix Reda, ehemaliges Mitglied des Europaparlaments und Fellow an der Harvard University, sind in die Entstehung des Sovereign Tech Fund eingeflossen.
„Indem ein langfristig resilientes und nachhaltiges Open-Source-Ökosystem unterstützt wird, können die Entwicklung und Wartung von relevanten Softwarekomponenten verbessert und damit Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft sowie eine effiziente Verwaltung und handlungsfähige Zivilgesellschaft gestärkt werden“, führt Fiona Krakenbürger aus. Das Ziel der digitalen Souveränität, also der selbstbestimmten Nutzung und Gestaltung digitaler Technologien und Systeme durch
Individuen, private Organisationen und den Staat, ist ohne ein robustes Open-SourceÖkosystem nicht zu erreichen. Offene Digitale Basistechnologien sind hierbei von besonderer Wichtigkeit. „Wir müssen die Gestaltung und Pflege unserer digitalen Infrastruktur als öffentliche Aufgabe begreifen“, sagt Adriana Groh, „denn nicht nur in Krisen ist es zukunftsentscheidend, dass unsere Infrastruktur resilient und zugänglich ist. Die Effektivität und Schnelligkeit unserer Innovationen hängen immer davon ab.“

CYFRACT

OHNE OBSESSION KEINE INNOVATION
TAYYAR BAYRAKCI HAT CYFRACT ERFUNDEN –EIN GERÄT UND VERFAHREN, MIT DEM MAN SCHMUTZ BZW. SCHWEBSTOFFE AUS DEM WASSER ENTFERNEN KANN
OHNE FILTER UND OHNE CHEMIE
SPRIND UND CYFRACT DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil das Projekt theoretische Grenzen sprengt und eine wirkliche Veränderung bringen kann. Weil Tayyar Bayrakci ein hoch interessanter Weiterdenker und im besten Sinne des Wortes obsessiver Forscher ist. Und weil viele Expert:innen das Potential dieser Innovation nicht erkannt beziehungsweise abgelehnt haben.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Sprunginnovationspotential entdecken, checken, entfalten. Wir recherchieren in die Tiefe von Zyklonen, Fluidtechnik, Rohrgeometrien, Wasserreinigung etc. Wir starten einen Validierungsauftrag. Mit einem relativ kleinen Betrag können wir bereits ziemlich große Ergebnisse erreichen.
KONTAKTE HERSTELLEN
Wir besprechen mit Expert:innen, wie man das Projekt für die Anwendung breiter aufstellen kann. Wir sorgen dafür, dass Unterstützung aus renommierten Instituten intensiviert wird (Uni BW in München).
NEUE MÖGLICHKEITEN SCHAFFEN
Wir machen Tayyar Bayrakci handlungsfähiger: Wir schaffen neue Möglichkeiten für Experimente und professionalisieren die Infrastruktur, zum Beispiel durch 3D-Drucker für den Prototypenbau.
GESCHÄFTLICH WEITERDENKEN
Wir haben vor, das CyFract-Projekt weiter zu validieren, idealerweise, bis es reif ist für die freie Wirtschaft.
DAS IST DAS POTEN T IAL, DAS WIR SEHEN
Die Umgestaltung der Schmutzwasserwirklichkeit. Tausende konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Eine große Chance, die Welt zu verbessern.


» IN DER STRÖMUNG HERRSCHT NICHT CHAOS, SONDERN RUHE. «


Tayyar Bayrakci ist freundlich und bescheiden, im Gespräch zurückhaltend, in der Arbeit aber im besten Sinne des Wortes besessen. 2009 hat er, mit 40 Jahren als Spätstudent, ein Stipendium der Stiftung Begabtenförderung bekommen und genutzt, um sich in ein, wie er sagt, „superrelevantes Thema“ zu vertiefen. Er studierte Regenerative Energien und kam während der Bachelorarbeit mit dem Thema „Rotierende Strömungen in Rohren“ in Berührung. Der Beginn einer Forschungs-Obsession –von der wir alle profitieren werden. Seit zwölf Jahren steckt Bayrakci zu 100 Prozent in seinem Projekt – und in einem extrem bescheidenen Lebens- und Tüftelumfeld. Er wohnt in München, sein Labor befindet sich in einem LKW-Container, 6 × 2,5 × 2,5 Meter. „Mein Weg zur Arbeit beträgt acht Meter. Und ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich in zwei Schichten arbeite. Also quasi durcharbeite.“ Aber woran genau eigentlich?
AN DER REVOLUTIONIERUNG
DER WASSERREINIGUNG
Die Innovation: Fluid-Kräfte und ZyklonTechnologie für die Wasserreinigung nutzen. Tayyar Bayrakci hat CyFract erfunden, ein Gerät und Verfahren, mit dem man Schmutz bzw. Schwebstoffe aus dem Wasser entfernen kann. Ohne Filter und Chemie. Filterlose Schmutzabscheidung funktioniert konventionell per sogenannter Zyklon-Technologie. Staubgeladene Luft zum Beispiel wird in eine Abscheidekammer geleitet und in Rotation versetzt. Die Fliehkraft bewirkt, dass schwere Partikel nach außen und leichte nach innen gedrängt werden. Das funktioniert gut zur Abscheidung von Staub aus der Luft, etwa in Schreinereien. Bayrakcis Forschungsfeld aber ist das Wasser, und für Schwebstoffe im Wasser sind solche – auf bestehenden Zyklon-Technologien basierende – Abscheider ungeeignet. Denn hier hat man es oft mit Schmutzpartikeln zu tun, die eine ähnliche Dichte haben wie Wasser. Das Ergebnis: Partikelchaos. Bestehende Zyklon-Technologien können solche Schwebstoffpartikel wie zum Beispiel Mikroplastik, wenn überhaupt, dann nur mit sehr hohem Energieaufwand und extrem hohen Drücken abscheiden. Deshalb basiert Bayrakcis Erfindung auf einer neuartigen Gleichstrom-HydrozyklonTechnologie. Das Wasser durchläuft ein spezielles Rohr, die Strömung wird zu einem nicht für möglich gehaltenen Grad optimiert,
Partikel reichern sich nahe der Außenwand an und zwei Wasserstromanteile verlassen den Bauraum in gleicher Richtung, deswegen Gleichstrom. Das allein ist schon komplex und neu – aber noch lange nicht alles, was an Innovation in CyFract steckt. Das Verfahren nutzt nämlich nicht die Zentrifugalkräfte, sondern die deutlich dominanteren Fluidkräfte. Diese ermöglichen beispielsweise, dass Flugzeuge fliegen, weil Luft eine Tragfläche oberhalb schneller umströmt als unterhalb. Es entsteht ein Unterdruck auf der Oberseite, und die Tragfläche wird quasi nach oben gesogen.
Bayrakci hat in unendlicher Detailarbeit – und mit seiner ganzen Kompetenz als ausgezeichneter Bootsbaumeister – ein Rohr mit einer ganz speziell geriffelten Innengeometrie entwickelt. Eine Schrauben-Geometrie mit mehreren Gewindegängen, deren Steigung sich im Rohrverlauf auch noch verändert. Diese Innengeometrie schafft optimierte Strömungsbedingungen, um Partikeln einen Auftrieb nach außen zu verleihen. Das ist das sensationell Neue: die Überlagerung von Fluidkräften und Zyklon-Technologie für die Wasserreinigung. Das hat es so, in dem Ausmaß und mit diesem Fokus, noch nicht gegeben. Das eröffnet ein ganz neues, spannendes Forschungsfeld.
In der Konsequenz bedeutet Bayrakcis Erfindung einen krassen Bruch mit der bisherigen wissenschaftlichen Modellvorstellung: Im CyFract-Rohr fliegt nämlich alles nach außen – im Grunde unabhängig von der Dichte. Zudem herrscht in solch einer Strömung nicht Chaos, sondern es stellt sich quasi Ruhe ein – die Strömung erfährt eine sogenannte Relaminarisierung. Sodass Schmutzpartikel gezielt abgeschieden werden können – sogar Teilchen, die leichter sind als Wasser. „Das funktioniert schon jetzt. Es gibt überzeugende Ergebnisse mit Polypropylen und Polyethylen, dem am meisten produzierten Plastik“, sagt der Erfinder und lächelt dezent.
JETZT WIRD HOCHSKALIERT
Erstaunlicherweise hat diese Entdeckung lange Zeit nur Bayrakci selbst überzeugt. Professoren der Fluid-Mechanik hörten seine Argumente, konnten oder wollten sie aber nicht annehmen. Gutachter steckten ihn in falsche Schubladen. Finanzierungsoptionen lösten sich in Luft auf. Der Neudenker war jahrelang fast ganz auf sich
allein gestellt, musste quälend kleine Prozessschrittchen gehen, gab aber nie auf: ein Stehaufforscher.
Jetzt entwickelt sich endlich alles rasant. Es gibt mittlerweile einen vorzeigbaren, voll funktionsfähigen Prototyp: ein Rohr mit zwei Metern Länge und 25 Millmetern Durchmesser, durch das pro Stunde fünf Kubikmeter Wasser fließen. Damit kann Bayrakci am entscheidenden Parameter für „sauberes Wasser“ weiter experimentieren: dem Abscheidegrad. „Die Sprünge sind jetzt immens. Anfangs lagen wir bei 70 Prozent. Jetzt kommen wir auf 80 bis 90 und bald auf 95 und mehr Prozent.“ Der nächste Schritt wird nun entweder eine Parallelschaltung von mehreren Rohren der jetzigen Größenordnung oder eine Hoch-Skalierung sein – also viel größere Rohre mit viel größeren Volumenströmen. Dazu sagt der Erfinder lächelnd: „In meiner Vorstellung ist das mit sehr geringem Aufwand sehr hoch skalierbar.“ Der Plan für 2022 lautet daher: eine Pilotanlage in eine handfeste Konstruktion überführen, aufstellen und testen, was CyFract in der Schmutzwasser-Wirklichkeit bewirken kann.
DIE SCHMUTZWASSERWIRKLICHKEIT UMGESTALTEN
Wir dürfen einiges von CyFract erwarten. Denn es ist einfacher, billiger, effizienter und umweltfreundlicher als etablierte Methoden der Wasserreinigung, vor allem Filteranlagen. CyFract muss weder aufwendig gereinigt noch ständig ausgetauscht werden. Es ist ein durchlaufendes Verfahren, funktioniert im Grunde per plug and play, ohne Filter, ohne Chemie, ohne große Wartungskosten. Bayrakci möchte es vor allem bei der Meerwasserentsalzung einsetzen, konkret beim Prozess der Vorreinigung. Er glaubt, mit seinem einfach genialen Verfahren die Kosten der Entsalzung um bis zu 25 Prozent senken zu können, ideal zum Beispiel für Entwicklungsländer – und für Investor:innen dort. Aber CyFract ist auch hoch interessant für die Abscheidung von Mikroplastik aus den Weltmeeren. Für die Kühlwasseraufbereitung in Industrieanlagen. Für die Abwasserbehandlung in Kläranlagen. Und natürlich für die Trinkwassergewinnung, eins der „Sustainable Development Goals“. CyFract wird die Wasserreinigung revolutionieren. Und damit die Welt ein Stückweit besser machen.

WIRD DIE WASSERREINIGUNG REVOLUTIONIEREN. UND DAMIT DIE WELT EIN STÜCKWEIT BESSER MACHEN. «

AKHETONICS


ES WERDE LICHT
WIE OPTISCHE PROZESSOREN DIE COMPUTERINDUSTRIE NACHHALTIGER GESTALTEN KÖNNEN
LICHT KANN GLEICHZEITIG MEHRERE WELLENLÄNGEN TRANSPORTIEREN UND JEWEILS EINZELN MIT INFORMATIONEN CODIEREN.
SPRIND UND AKHETONICS
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil optische Datenverarbeitung hohe Geschwindigkeit und geringen Energieverbrauch verspricht und in vielen Variationen und an extrem vielen Stellen Sinn ergibt. Weil der neue Chip hier große Lücken schließen kann. Weil daher das Einsatzpotential und die Hebelwirkung riesig sind. Auch weil die Chips in Europa entwickelt, verstanden und gebaut werden können und von hier aus die digitale Welt ein bisschen (energie-)effizienter machen können.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Sprunginnovationspozential checken, entdecken, freisetzen.
Netzwerke aktivieren, Zugänge schaffen, Türen öffnen. Wir starten einen Validierungsauftrag, das heißt auch: Wir geben Geld. Mit einem relativ kleinen Betrag helfen wir bereits über die ersten Hürden.
PARTNER FINDEN – SICHTBARKEIT SCHAFFEN
Wir haben Fachexpert:innen, die wissen, was und auch wen man benötigt, um diese Aufgabe zu bewältigen. Wir kennen jemanden, der jemanden kennt.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Eine digitale Welt, in der mit minimalstem Energieverbrauch riesige Datenmengen überall um uns herum so verarbeitet und genutzt werden, dass der Mensch informiert, transportiert und unterstützt wird. Ohne Ressourcenverschwendung.
Während andere Kinder Harry Potter oder TKKG lesen, hatte es Michael Kissner vor allem das Programmierbuch „Code“ von Charles Petzold angetan. Schon früh wusste er, dass er eines Tages selbst einen Prozessor bauen möchte, auch wenn er damals nie einen optischen Prozessor im Sinn gehabt hätte. Die Serie „Stargate“ aus den 90er-Jahren nahm er nicht für voll: „Dort waren alle Alienprozessoren Kristalle, die mit Licht funktionieren. Was für ein Unsinn.“ Science Fiction eben – bis Microsoft Ende 2019 verkündete, Daten in Quarzglas, einem „Kristall“, gespeichert zu haben. Sofort war die alte Begeisterung entfacht und Michael Kissner, der inzwischen Mathematical Engineering und Mathematische Physik studiert sowie in Künstlicher Intelligenz promoviert hatte, nutzte die Pandemie, um sich nun endlich in seinen Kindheitstraum zu vertiefen.
„In den vergangenen 40 Jahren gab es viele Ansätze für optische Computer“, berichtet Dr. Kissner, der zuletzt im Bereich Cybersicherheit tätig war, „die Ansätze waren nur zu sehr von unten nach oben gedacht. Ich habe mir hingegen überlegt: Das muss ein optischer Prozessor können. Und wenn er das können muss, dann muss so der Transistor aussehen, und dann brauche ich diese physikalischen Effekte. Dann erst habe ich angefangen, einen optischen Transistor zu suchen, der das erfüllt.“ So ist Kissner auch auf seinen Mitgründer Dr. Leonardo del Bino gestoßen. „Ich habe hunderte Paper über optische Transistor-Designs gelesen. Das, was perfekt passte, war das von Leonardo.“
„Licht interagiert ungern mit Licht. Über Elektronen, die sich gegenseitig abstoßen, ist es deutlich leichter, Daten zu
verarbeiten – allerdings gibt es dabei immer hohe Verluste durch Widerstände“, führt Kissner, der erst mit 18 nach Deutschland gezogen und im Iran, in Indonesien und Singapur aufgewachsen ist, leidenschaftlich aus. „Selbst der Mensch nimmt über 80 Prozent aller Informationen mit den Augen auf. Die Informationsdichte ist mit Licht unendlich viel größer.“
KNACKPUNKT: LICHT ZUM INTERAGIEREN ANIMIEREN
Licht kann gleichzeitig mehrere Wellenlängen transportieren und jeweils einzeln mit Informationen codieren. Im Kern beruht der Ansatz auf der Idee, optische Nodes als Logikschaltungen zu verwenden. „Die Informationen, die wir verarbeiten, sind in Form von Licht vorhanden. Wir verarbeiten Licht, ohne es zwischendurch in ein elektronisches Signal und wieder zurück umzuwandeln“, schildert der gebürtige Italiener del Bino. „Unser Prozessor lässt sich in jegliche Anwendung integrieren, doch zu Beginn ist er besonders sinnvoll für Geräte, die Informationen in Form von Licht erhalten und weitergeben, zum Beispiel im Netzwerkbereich bei Routern und Switches.“ Licht effizient zum Interagieren zu animieren, ist der Knackpunkt. In der Theorie klappt das trotzdem – jetzt gilt es, diese in der Praxis auf den Prüfstand zu stellen und Prototypen zu bauen. „Ein Lichtprozessor spart unendlich viel Energie und kann viel schneller viel mehr Daten verarbeiten, wobei es keine Latenz durch die Umwandlung gibt“, erläutert del Bino. Dadurch verringere sich der Strom- und Kühlungsbedarf gegenüber konventionellen Prozessoren enorm.
Umweltfreundlichkeit ist überhaupt ein zentraler Antrieb für die Gründer. So verbrauchen elektronische Prozessoren in der Herstellung immense Mengen ultrareines Wasser zum Durchspülen. Die optische Variante dagegen hat nicht so viele Prozessschritte, ist robuster und benötigt viel weniger Wasser. „Wir wollen eine Alternative anbieten, die nachhaltiger ist, dafür werden wir nicht die Kleinsten sein.“ Zudem kann die Technologie in Europa gefertigt werden: „Wir planen Chips in der Größenordnung von 130 Nanometern, dafür gibt es hier bereits zig Fabriken“, berichtet Leonardo del Bino, der spezialisiert ist auf Materialwissenschaften und nichtlineare Photonik.
Das fünfköpfige Team von Akhetonics hofft auf ähnliche Bestrebungen in der Start-up-Szene. Im Quanten- und AnalogBereich gibt es zahlreiche Ansätze für optische Computer. „Da herrscht ein ziemlicher Hype. Digital gehören wir aber zu den wenigen, die versuchen, einen optischen Prozessor zu bauen, dabei sind Kooperationen natürlich immer wünschenswert.“ Michael Kissner lacht: „Was wir machen, ist mehr die Hausmeisterebene und nicht sexy, aber ein digitaler optischer Prozessor ist am vielseitigsten und kann viele Felder abdecken, auch im Bereich KI.“ Die gesamte technische Infrastruktur müsste erst nachziehen: „Aus meiner Sicht ist das der einzig richtige Schritt, weil das meiste, das wir benutzen, ohnehin optisch ist: Netzwerkverkehr, Webcam, Bildschirm, wir haben eine optische Maus, einen Laserdrucker – einfach an allen Ecken und Enden wird Laserlicht benutzt und umgewandelt in Elektronik. Deswegen: Lasst Laserlicht Laserlicht sein und uns alles optisch machen.“
» SELBST DER MENSCH NIMMT ÜBER 80 PROZENT ALLER INFORMATIONEN MIT DEN AUGEN AUF. DIE INFORMATIONSDICHTE IST MIT LICHT UNENDLICH VIEL GRÖSSER. «


SPHEROSCAN


VORTEILE ZWEIER WELTEN VERBINDEN
MIT PHOTONIK UND MIKROBIOLOGIE TRINKWASSER UND LEBENSMITTEL SICHERER MACHEN KOSTENGÜNSTIG, DEZENTRAL, IN-LINE-FÄHIG UND OHNE LABOR MIKROBEN DETEKTIEREN
SPRIND UND SPHEROSCAN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Es ist das erste Verfahren, das in unglaublich kurzer Zeit Schadstoffe wie Legionellen oder Salmonellen nachweisen kann. Selbst wenn man den Ansatz nur auf die Lebensmittelindustrie herunterbricht, ist dies ein massiver Hebel. Wenn SpheroScan durch die Kombination des Whispering-Gallery-Modes mit funktionalisierten und fluoreszierenden Micro-Beads eine unmittelbare Detektion von Schadstoffen ermöglicht, wird die Zeit zum direkten Handeln immens reduziert. Wenn dann auch noch Rückrufaktionen bei Lebensmittelherstellern entfallen und somit gesundheitsgefährdender Verzehr deutlich reduziert wird, haben alle gewonnen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Dem Team von FluIDect die Sicherheit geben, die es in den ersten Monaten braucht. Durch unseren
Validierungsauftrag wollen wir von FluIDect einen ersten Technologiedemonstrator sehen. Unser Auftrag ermöglicht dem Team eine klare Fokussetzung auf die Weiterentwicklung der Technologie statt auf komplizierte Förderaufträge.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Wir sehen die Beauftragung von SpheroScan als wichtige Investition in eine Schlüsseltechnologie, die aus Deutschland kommt und deren Anwendung ebenfalls in Deutschland entstehen sollte. Allein der Markt in Europa für die Bereiche Gesundheit und Lebensmittelherstellung ist riesig und noch gar nicht richtig greifbar.
GESCHÄFTLICH WEITERDENKEN
Einen groben Blick für die geschäftliche Weiterentwicklung hat das Team schon – dabei möchten wir auch in der zukünftigen Zusammenarbeit notwendigen Support bieten und so den „Start-up“-Aufbau hilfreich unterstützen.
Eines haben SpheroScan und das Team dahinter gemeinsam: Sie sind wahnsinnig schnell. Während SpheroScan binnen Sekunden Pathogene wie Legionellen oder Salmonellen in Flüssigkeiten aufspüren und somit unser Trinkwasser und Lebensmittel sicherer machen kann, hat das Führungstrio vom Kennenlernen bis zur Gründung einer gemeinsamen Firma nur ein Jahr gebraucht – und nur weitere vier Monate, um die SPRIND völlig von seiner Innovation zu überzeugen.
Das alles geht so rasant, weil Dr. Michael Himmelhaus, der Tüftler im Team, bereits seit 18 Jahren intensiv zur zugrunde liegenden Technologie forscht und nur auf diese eine Chance gewartet hat. 2004 hat er entdeckt, dass nicht nur größere Plastikkügelchen, sondern auch winzige, Auskunft über ihre Oberflächenbelegung geben – ob sich also Moleküle dort anlagern – und von 2005 bis 2009 hatte der Oberflächenphysiker in Japan bei der Weiterentwicklung entsprechender Biosensorik forschungstechnisch die beste Zeit seines Lebens. Jedenfalls bis jetzt: Im August 2021 hat er gemeinsam mit Dr. Tobias Schröter und Klaus Schindlbeck, die sich über verschie-
dene Jobs und Firmen getroffen haben, FluIDect zur Untersuchung von Flüssigkeiten auf Keime gegründet.
„Ich fand Michaels Forschung spannend und habe mich gefragt, warum er sie auf den kleinen Bereich der Laboranalyse beschränken sollte. Sein Sensor hat Potential für den großen Markt, für riesige Industrieanlagen“, erklärt MaschinenbauIngenieur und Röntgenoptik-Spezialist Tobias Schröter. Das sehen viele Firmen genauso: „Wir rennen überall offene Türen ein, denn wir gehen ein massives Problem an.“ Verunreinigung von Trinkwasser und Lebensmitteln lautet dieses, und es verursacht allein in den USA 18 Milliarden Dollar an Schäden pro Jahr und kostet hunderte Menschenleben.
PROZESSBEGLEITEND WÄHREND DER PRODUKTION REAGIEREN
Doch was genau macht SpheroScan, das nur schuhschachtelgroße Gerät, das die Pathogenanalyse völlig revolutionieren kann? In Produktionsanlagen kann es kostengünstig, dezentral, in-line-fähig und ohne Labor Mikroben detektieren. So schnell, dass prozessbegleitend noch während der Produktion, zum Beispiel von Milch oder
Milchersatzprodukten, reagiert werden kann – nicht erst, wenn bereits ganze Tanks kontaminiert sind.
Langfristig wäre es sogar denkbar, schon am Melkstand die Milch der Kühe zu untersuchen und Antibiotika dementsprechend gezielt einzusetzen, ebenso bei der Schweinemast oder auf Geflügelfarmen. Das schafft völlig neue Möglichkeiten zur Wahrung der öffentlichen Gesundheit und der Nachhaltigkeit. Auch beim Trinkwasser: „In Mehrfamilienhäusern oder in Krankenhäusern gibt es regelmäßig Spülvorgänge, also eine thermische Desinfektion durch große Mengen heißes Wasser“, erläutert Schröter. „SpheroScan ermöglicht, zielgerichteter vorzugehen und nur bei zu hoher Keimbelastung zu handeln. Das spart wertvolle Ressourcen.“
Das Ganze funktioniert über eine neuartige Kombination zweier Disziplinen: „Wir verbinden Vorteile aus zwei Welten, der Mikrobiologie und der Photonik“, sagt Klaus Schindlbeck, der als Diplomkaufmann und Mastermind der Organisation und Verwaltung den Machern im Vordergrund den Rücken freihält. „Aufgrund eines mikrobiologischen Vorgangs untersuchen wir die Flüssigkeiten auf biologische und
» WIR VERBINDEN VORTEILE AUS ZWEI WELTEN –DER MIKROBIOLOGIE UND DER PHOTONIK. «
chemische Substanzen und erhalten dann durch das emittierte Licht Informationen über den Vorgang: eine geniale Idee“, betont Schindlbeck, der bereits seit 30 Jahren für Medizintechnikunternehmen in Deutschland und den USA tätig ist.
So gibt das FluIDect-Team Beads, zehn Mikrometer große, fluoreszenzmarkierte Plastikkügelchen aus Polystyrol, in das Analysegerät, das in der laufenden Produktion kleine Proben abzapft. Die Kügelchen werden mit Licht beschossen, das sie über Fluoreszenz zum Leuchten bringt. Das Fluoreszenzlicht birgt dabei die genaue Geometrie der Kügelchen. Lagern sich nun an den Beads Pathogene an, verschiebt sich die durch die Kügelchen ausgestrahlte Wellenlänge. Somit ändert sich, leicht messbar, die emittierte Farbe. Bislang erfordern die meisten Analysemethoden eine aufwendige Proben -
vorbereitung, bevor die Messung beginnen kann. Das kostet vor allem Zeit. „Wir dagegen können unsere Beads direkt in die Probe geben, die dann auf die Suche nach den Mikroben gehen, und Informationen über deren Natur und Präsenz anschließend optisch auslesen“, verdeutlicht Himmelhaus einen der enormen Vorteile.
In drei Jahren soll die Produktvision, der Prototyp, getestet werden. Und schon heute träumt das hochmotivierte Trio von nächsten großen Schritten. „Die zweite Generation soll auf mehrere Targets, bis zu 32, untersuchen können“, erzählt Tobias Schröter begeistert. „In ferner Zukunft denken wir an ein Handgerät, das nur noch mit einer Pipette mit einer Probe beträufelt werden muss und sogar noch mehr Erreger erkennen könnte.“ Sowohl bei der SPRIND als auch am Optikstandort Jena fühlen sich die drei bestens aufgehoben: „Das
Feedback und die wissenschaftliche wie finanzielle Unterstützung sind für uns Gold wert“, freut sich Himmelhaus, der sich dadurch voller Schaffenskraft in die SpheroScan-Optimierung vertiefen kann. So konnte die Mikrobiologin Dr. Sarah Hofbrucker MacKenzie als wertvolle Ergänzung ins Team geholt werden, und das Unternehmen konnte in neue Räume im Technologie- und Innovationspark Jena umziehen. „Die Jenaer Firmen bieten genau das, was wir brauchen, um den Sensor zu entwickeln, gemeinsam zu bauen und zu verbreiten. Und die Leute hier sprechen genau unsere Sprache.“

WEITERE LAUFENDE VALIDIERUNGEN
IT: SOFTWARE
SPRIND UND DIE OPEN-SOURCE-OFFENSIVE IM AUTONOMEN FAHREN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil durch einen Open-Source-Ansatz Software fürs autonome Fahren in Zukunft partnerschaftlich und effizient in einem Ökosystem aus Industrie, Start-ups und Hochschulen entwickelt werden soll. Weil autonomes Fahren unser aller Leben grundlegend verändern und einen neuen Wirtschaftszweig erschließen wird. Weil ein kollaborativer Open-Source-Ansatz Synergien zwischen AutomobilKonzernen, Fahrzeugherstellern, Start-ups und Hochschulen erschließt. Weil zukünftigen Partnern eine solide Plattform für die weitere Entwicklung bereitgestellt werden soll.
INTELLIGENZ
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil es das Ziel des interdisziplinären Teams aus Informatik, Mathematik und Radiologie ist, mit Künstlicher Intelligenz die gesamte Pipeline von der Bilddaten-Akquisition bis zum fertigen MRT-Bild zu revolutionieren.
BESSEREN ZUGANG ZUM MRT SCHAFFEN
Wir wollen einen breiten Zugang zur MRT-Technologie für alle Patient:innen ermöglichen. Dabei steht für uns die
SPRIND UND DIE DIGITALISIERUNG
VON VERWALTUNGSPROZESSEN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil die Digitalisierung von Gesetzen, Normen und Vorschriften Folgendes verspricht:
• Beschleunigung bei der Entwicklung
• deutlich höhere Transparenz, speziell für Bürger:innen
• Automatisierung der darauf aufbauenden Verfahren mit der Möglichkeit, auf Basis der verarbeiteten Daten die zugrunde liegenden Gesetze zu verbessern
• Kostentransparenz, damit Legist:innen Konsequenzen von neuen Regeln und Normen besser nachvollziehen können.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Die SPRIND finanziert die Evaluierung, wie ein Open-SourceAnsatz im Bereich autonomes Fahren umgesetzt werden kann. Hierbei wird unter anderem an einer Architektur gearbeitet, die verschiedene Anwendungsfelder unterstützt, die Functional-Safety-Anforderungen in der kollaborativen Entwicklung werden geprüft und gemeinsam mit ersten Partner:innen mögliche Geschäftsmodelle für beteiligte Unternehmen evaluiert.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Ein konsequenter Open-Source-Ansatz bietet das Potential, bestehende Hürden proprietärer Software-Produkte zu umgehen und eine Plattform für die kontinuierliche Optimierung des autonomen Fahrens zu bieten. Damit können Ressourcen und Kompetenzen zielgerichtet orchestriert werden und es kann aus Deutschland und Europa heraus ein schlagkräftiges Ökosystem entstehen.
maximale diagnostische Aussagekraft der MRT-Bilder im Vordergrund, wobei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Untersuchung derart optimiert, dass Zeit, Kontrastmittel und damit Kosten eingespart werden können – zum Wohle der Patient:innen.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die ganzheitliche KI erlaubt eine Bildoptimierung, die einen neuen Goldstandard definiert und neuer, demokratischer MRT-Technologie den Weg bereitet. Der Ansatz überwindet bestehende Paradigmen und ist der Grundstein für MRTSoft- und Hardware von morgen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir untersuchen die Möglichkeit, den Lebenszyklus von Gesetzen und Normen, von ihrer Entstehung bis zur Ausführung durchgängig digital, mit einer visuell orientierten Methodik abzubilden. Dabei betrachten wir den Nutzen für alle Beteiligten, ausgehend vom Gesetzgeber bis hin zu den Anwendern wie beispielsweise Behörden und Unternehmen.
FREIRÄUME SCHAFFEN, ZIELSETZUNG VORGEBEN
Im Rahmen der Validierung soll überprüft werden, ob sich die Integration und Usability des Systems so entwickeln lassen, dass eine bruchlose digitale Werkbank mit Transparenz für alle beteiligten Nutzer-Perspektiven, speziell auch NichtExpert:innen, entsteht. Ferner wird überprüft, ob sich die Methodik erweitern lässt, sodass ein offener Standard für digitale Normgebung und Umsetzung etabliert werden kann.
SPRIND UND OPEN-SOURCE-ROUTER
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil die Diskussion um die Souveränität Deutschlands und Europas bei zukünftigen Technologien Fahrt aufnimmt. Weil insbesondere der Bereich der Daten- und Telekommunikationsnetze geprägt ist von etablierten Herstellern außerhalb der EU.
NEUE MÖGLICHKEITEN SCHAFFEN
Etablierte Hersteller halten ihre Systeme und Schnittstellen geschlossen, damit lediglich ihre eigenen Produkte miteinander kompatibel sind. Regionale Netze, sogenannte Campusnetze, müssen deshalb bisher mit der Hard- und Software nur eines einzelnen Herstellers ausgestattet werden. Weil ein Umstieg eine extrem teure Erneuerung
des gesamten Campusnetzes erfordern würde, sichern sich die Hersteller so kontinuierliche Verkäufe und können hohe Preise verlangen. Während diese Situation für die Hersteller äußerst vorteilhaft ist, stellt dies für die Kund:innen durch die hohe Abhängigkeit eine Herausforderung dar: Allein der Hersteller bestimmt, ob und wann Innovationen in seine Produkte einfließen.
EUROPAS UNABHÄNGIGKEIT FÖRDERN
Ein offener 5G-Multiservice-Router soll für die herstellerunabhängige Steuerung von Campusnetzen entwickelt werden, der mit einer Vielzahl an Services und Schnittstellen verschiedener Hersteller kompatibel ist. Die langfristigen Ziele sind die Entwicklung von offenen Netzkomponenten, basierend auf Open Source, und das Etablieren eines EU-27Herstellers für Telekommunikationsausrüstung.
SPRIND UND NANOBODIES IN DER MRNA-FORSCHUNG
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil es bisher keinen Antikörper-Wirkstoff gibt, um Krankheiten direkt im Inneren der Zelle zu behandeln. Weil die Idee, Nanobodies über mRNA in die Zelle zu schleusen, außergewöhnlich clever ist und der nächste Sprung in der Antikörperrevolution. Weil wir in Deutschland geballte Expertise bei der Nanobody- und mRNAForschung haben. Weil wir mehr Frauen als Gründerinnen sehen wollen und aktiv unterstützen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Eine große Idee in eine noch größere Möglichkeit verwandeln. Erstmalig mRNA-kodierte Nanobodies mittels
SPRIND UND DIE DNA-ORIGAMI-TECHNOLOGIE
Lipid-Nanopartikel in (Krebs-)Zellen transportieren. Mit dem Proof of Concept die Technologieplattform beweisen, die es ermöglicht, für unzählige (bisher schwer oder gar unbehandelbare) Krankheiten Therapieansätze zu schaffen. Den Weg für eine Zukunft der Firma in Deutschland ebnen. Die Gründer:innen mit den Expert:innen aus dem Feld vernetzen.
ZIELSTELLUNGEN SCHÄRFEN, WEITERDENKEN
Die Gründer:innen haben eine klare Vision. Zusammen können wir diese optimal ausrichten und in Richtungen lenken, die auch in Zukunft erfolgversprechend sein werden. Wir ziehen an einem Strang und wissen, welche Daten und Experimente wir für die nächsten Schritte benötigen, um zukünftig größere Investitionen zu rechtfertigen. Gemeinsam fokussieren wir uns darauf.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Die Anwendung von DNA-Origami in lebenden Organismen vorbereiten und testen. Über das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND Kontakte zu Partner:innen ermöglichen und die besten Köpfe für das Projekt begeistern. Dem Team bei der Konzipierung eines skalierbaren Unternehmens helfen.
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil wir in Form von DNA-Origami eine junge und absolut vielversprechende Technologie unterstützen und gleichzeitig das Potential besteht, mit Krebs eine der häufigsten Todesursachen der Welt zu bekämpfen – ohne tiefgreifende Nebenwirkungen.
EINE KLINISCHE STUDIE VORBEREITEN
Wir helfen, die strategisch wichtigen und richtigen Schritte in der Vorbereitung auf eine spätere klinische Studie zu planen. Im Rahmen dieser Vorbereitung soll das Projekt weiter validiert werden, idealerweise, bis es reif ist für die ersten Studien im Menschen.
SPRIND UND BAKTERIOPHAGEN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil das Ergebnis des Projekts den entscheidenden Baustein im Kampf gegen multiresistente Bakterien darstellen kann. Weil wir innerhalb des Projekts Forschung und Phagentherapie sehr eng miteinander verbinden können. Weil nur durch eine Bündelung anwendungsnaher Spitzenforschung und den gleichzeitigen Aufbau einer Phagenproduktion der baldige Zugang zur Phagentherapie möglich wird.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir identifizieren Forschungs- und Entwicklungsgebiete, um eine völlig neuartige Infektionsdiagnostik und eine schnell verfügbare individualisierte Phagentherapie in die breite klinische Anwendung zu bringen. Wir identifizieren
die hierfür europaweit aktivsten Forschungsgruppen und bilden einen Spitzen-Forschungscluster. Wir finden heraus, wie die Zulassung der Phagentherapie vorangetrieben werden kann. Wir bilden Brücken zwischen den aktivsten Phagenexpert:innen und ihren Netzwerken und erschaffen damit eine bisher nicht dagewesene, hocheffektive, anwendungsorientierte europaweite Forschungsstruktur.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Eine grundlegende Veränderung von Phagenforschung und -herstellung, um bis 2030 die Phagentherapie für den größten Teil der Bevölkerung zu etablieren. Etablierung eines Phagenzentrums, das alle Bereiche der Forschung, Anwendung und Produktion der Phagen vereint und somit den Kampf gegen krankheitserregende Bakterien maßgebend aufnehmen kann. Die Vorteile der Phagenanwendung auf die Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit zu übertragen (One-Health-Ansatz), um so das Potential noch besser auszuschöpfen.
CHEMIE, BIOLOGIEDARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil das interdisziplinäre Team aus Physik, Chemie und Informatik ein Verfahren zur Herstellung gewünschter mikrostrukturierter Oberflächen entwickelt, die mithilfe eines digitalen Algorithmus gefaltet werden. Weil die Technologie Prinzipien aus der Hirnfaltung nutzt, um neuartige Mikrostrukturen herzustellen. Weil auf diese Art dynamische veränderbare Mikrostrukturen realisiert werden können, um neue Anwendungen in der Mikrofluidik zu erschließen.
SPRIND UND DIE GRÜNE TRANSFORMATION DER CHEMIEINDUSTRIE
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil die Innovation eine homogene und grüne Methanolsynthese zu wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen könnte. Weil Methanol als Grundchemikalie Basis für ganze Wirtschaftszweige ist. Weil über 99 Prozent der Methanolproduktion nicht nachhaltig und damit allein für 0,6 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Weil grünes Methanol ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung von Industrie und Logistik ist.
SPRIND UND DIE PRODUKTION VON NAHRUNGSMITTELN AUS WASSER, LUFT UND STROM
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil mithilfe von Mikroorganismen die weltweite Proteinversorgung aus wenigen 1.000 Reaktoren bereitgestellt werden könnte. Weil Bevölkerungswachstum und Klimawandel zukünftig den Nahrungsmangel verschärfen. Weil Viehzucht einer der größten CO 2Emittenten ist. Weil eine weitere Alternative zu tierischen Proteinquellen geschaffen werden soll.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Mithilfe der SPRIND wird die Technologie weiterentwickelt und hinsichtlich bestimmter Materialeigenschaften untersucht.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Als Plattformtechnologie kann das Verfahren als Fundament und Multiplikator für viele andere Entwicklungen und Anwendungen, beispielsweise im Bereich der smarten Biochips, fungieren.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir finanzieren eine Machbarkeitsstudie zur kontinuierlichen Methanolproduktion aus Synthesegas durch einen homogenen Katalysator. Damit legen wir die Grundlage für den Bau einer Produktionsanlage und unterstützen beim ersten Schritt in Richtung Skalierung.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die skalierbare und wettbewerbsfähige Produktion von grünem Methanol. Die Validierung von einem quantenchemischen Simulationsansatz als Ursprung neuer Chemikalien, der als plattformtechnologie Grundlage für die Entwicklung zahlreicher neuer Produktionsprozesse genutzt werden kann.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir finanzieren die techno-ökonomische Analyse und unterstützen den Aufbau einer ersten Pilotanlage zur Produktion von Proteinen im Bioreaktor.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Aufbau einer klimaneutralen, flächeneffizienten und resilienten Proteinversorgung für die Weltbevölkerung. Adaption des gewonnenen Know-hows zur Produktion weiterer Nährstoffe.
MASCHINENBAU, ELEKTROTECHNIK
SPRIND UND AUTARKE MEERWASSERENTSALZUNG
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil Brauch- und Trinkwasser bereits ein knappes Gut ist und immer knapper wird. Weil kleine dezentrale Meerwasserentsalzungsanlagen wirtschaftlich konkurrenzfähig gegenüber zentralen großen Anlagen zu machen, einen wesentlichen Ausgleich für viele Regionen bedeuten kann.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Das komplette System basiert auf der Kombination existierender Technologien. Es wird um eine neu entwickelte
Dampfturbine erweitert, die einen Teil der eingebrachten Wärme in elektrischen Strom umwandelt, mit dem die gesamte Anlage betrieben werden kann. So kann solarthermisch erhitztes Meerwasser kostengünstig entsalzt werden; die einfache Skalierung stellt einen dezentralen Einsatz sicher. Im laufenden Validierungsauftrag soll durch Versuche an einem Funktionsdemonstrator der bisher simulierte Prozess bestätigt werden.
LANGFRISTIG STABILE PERSPEKTIVEN SCHAFFEN
Durch den energiearmen Ansatz kann eine autarke Meerwasserentsalzungsanlage entstehen. Ihr Einsatz in aktuell trockenen Regionen kann eine langfristig stabile Perspektive für viele Menschen auf der Welt bieten.
BAUWESEN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil die Bauindustrie revolutioniert werden muss, indem wir Baustoffe verwenden, die Treibhausgase vermeiden. Weil wir damit den Einsatz von Zement, der einer der größten Treiber für CO 2-Emissionen in der Welt ist, vermeiden und nachhaltige Rohstoffe verwenden, die auch in Europa in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Weil wir mit diesen Baustoffen zusätzlich noch CO 2 speichern können und unseren CO 2-Fußabdruck dadurch signifikant senken.
SPRIND UND DIE DÄMMUNG DES 21. JAHRHUNDERTS
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil der entwickelte Dämmstoff auf Basis von evakuierten Glasröhrchen eine herausragende Dämmwirkung bei niedrigen Kosten erzielen könnte. Weil Haushalte etwa 70 Prozent ihrer Energie fürs Heizen verbrauchen. Weil herkömmliche Dämmstoffe nur in hohen Dicken die aktuellen Effizienzstandards erfüllen. Weil Bestandsgebäude oftmals mit herkömmlichen Dämmstoffen nicht nachträglich saniert werden können.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Die Verwirklichung einer zukünftigen kohlenstofffreien Bauindustrie und eine Senkung der thermischen und elektrischen Energie im Herstellungsprozess, der sich auf die gesamte Bauindustrie auswirkt. Materialien, die wiederverwendbar und langlebig im Bauen integriert sind und ein ressourcenschonendes und kosteneffizienteres Bauen ermöglichen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir vergeben einen Validierungsauftrag und unterstützten das Team in der Carbon-to-Value-Challenge, um einen Zementersatzstoff zu finden. Dadurch lässt sich ein Bindemittel entwickeln, das ähnliche oder bessere Eigenschaften als Zement aufweist und sogar kohlenstoffneutral oder kohlenstoffnegativ ist. Wir identifizieren geeignete Marktlösungen und bringen die Innovation auf verschiedenen Ebenen voran. Wir unterstützen Teams der Challenge, indem wir sie miteinander, aber auch mit externen Expert:innen vernetzen.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir finanzieren die Validierung und Optimierung von neuartigen Vakuum-Dämm-Paneelen, die kostengünstig und ohne hohen Energieaufwand produziert werden können.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Ermöglichung der energetischen Sanierung von über zehn Millionen Bestandsgebäuden. Deutliche Senkung des Energiebedarfs und der Heizkosten trotz raumsparender Dämmung. Etablierung eines nachhaltigen und recyclingfähigen, kostengünstigen Dämmstoffs am Weltmarkt.
SPRIND UND DIE DISRUPTION VON STAHLBETONKONSTRUKTIONEN
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil hochwertige Stahlbetonwerke zu ermöglichen und dabei den notwendigen CO 2-Ausstoß zu reduzieren, ein wesentliches Argument für das Projekt zur Disruption von Stahlbetonkonstruktionen ist. Weil durch einen neuartigen Herstellungsprozess der erforderlichen monolithischen Stahlmatten diese stabiler werden und eine wesentliche Einsparung von Stahl und Beton bei gleichbleibendem Einsatz erlauben.
SPRIND UND DIE BEDARFSORIENTIERTE REGELUNG FÜR HEIZUNGSSYSTEME
DAS MACHEN WIR KONKRET
Im Rahmen des laufenden Validierungsauftrages wird das theoretische Potential der neuartigen monolithischen Stahlmatte in Zusammenarbeit mit einer Prüfanstalt praktisch anhand mehrerer Prüfkörper analysiert.
WEITERDENKEN
Der Aufbau und die Form der monolithischen Stahlmatte können beispielsweise eine zusätzliche Verzinkung ermöglichen und so die Nutzungsdauer von witterungsbelasteten Bauwerken deutlich erhöhen. Dadurch wird langfristig in die Zukunft geblickt und geplant. Durch den konkurrenzfähigen Einsatz von hochwertigem Stahl kann die lokale Stahlindustrie profitieren und erhalten bleiben.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Das Projekt untersucht den Ersatz einer feinfühligen, am Wärmegefühl der Benutzer:innen orientierten Regelung für Fußbodenheizungen, mit der die Energieeffizienz im Gebäudebereich deutlich gesteigert werden kann. Im Rahmen eines Validierungsauftrages werden die Auswirkungen einer schnellen, proaktiven und raumweisen intelligenten Fußbodenheizung quantitativ simuliert und der Einsparungseffekt bestimmt.
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil 16 Prozent der gesamten CO 2-Emissionen Deutschlands aus dem Gebäudesektor kommen und 60 Prozent der Gebäudeenergie für das Heizen benötigt werden. Weil das Potential der Gebäude-Anlagentechnik zum Einsparen von Energie noch lange nicht ausgeschöpft ist und Heizungen viel schneller angepasst werden können als die Gebäudehülle.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Durch einen relativ simplen und kleinen Eingriff kann diese bedarfsorientierte Regelung im Verbund mit mehreren Maßnahmen eine Effizienzsteigerung von bis zu 30 Prozent in Neubauten und Bestandsgebäuden gleichermaßen erreichen. Die Effizienzsteigerung führt zu einer Einsparung von mehreren 1.000 Tonnen CO 2 bei gleichzeitiger Komfortsteigerung durch Räume, die weder zu warm noch zu kalt sind.
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil alternative Energiespeicher, die gleichzeitig auf Konfliktrohstoffe verzichten, wesentlich zur Energiewende beitragen. Weil das Projekt Protonen-Akkumulator eine neue Batterie vorstellt, bei der es sich im Kern um eine modifizierte Bleibatterie handelt. Weil dabei die Blei-Gitterelektrode durch Carbonfasern ersetzt und die Kathode vollkommen bleifrei ausgeführt ist. In Kombination mit einem neuen Elektrolyten und einem keramischen Separator entsteht eine konfliktrohstofffreie Batterie.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Konventionelle Batterien verwenden meist Konfliktrohstoffe wie Lithium oder Kobalt, die meist schwer rezyklierbar sind. Das Ziel der neuen Technologien ist es, auf einen Preis von einem Cent pro Ladezyklus und Kilowattstunde zu kommen, um einen günstigen Energiespeicher bereitzustellen. Dabei soll der Blei-Anteil unter Beibehaltung der bestehenden Produktionsmethode komplett entfallen.
ALTERNATIVE MÖGLICHKEITEN SCHAFFEN
Im Rahmen eines Validierungsauftrages versucht die SPRIND, Antworten auf Fragen zur Lebensdauer, zum Verhalten bei Schnellladung sowie zur tatsächlichen Skalierbarkeit der Batterie zu finden. Auf diese Weise soll eine alternative Möglichkeit zur Speicherung von Energie geschaffen werden, unter Beibehaltung der weltweit bestehenden Produktions- und Recyclinginfrastruktur von Bleibatterien.
IT: HARDWARE
SPRIND
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil Hardware-Bausteine für die digitale Informationstechnologie in ihrer Weiterentwicklung bezüglich Energieeffizienz, Lernrate, Miniaturisierung und Genauigkeit an ihre Grenzen stoßen. Weil das interdisziplinäre Team einen neuen Memristor entwickelt hat, der sowohl Daten verarbeiten als auch Daten speichern kann. Weil mithilfe der Memristoren neue ressourcenschonende Rechnerarchitekturen für eine analoge Informationstechnologie möglich werden.
Auf dem visionären Weg hin zum Rechnen mit reellen Zahlen werden neue Lösungen für die KI, beispielsweise für das Edge Computing in Echtzeit und für das fehlerfreie Clustern, sowie für das zertifizierbare Klassifizieren mit künstlichen neuronalen Netzen entwickelt.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Das Memristor-Material hat das Potential, zu zahllosen neuen Lösungen und Anwendungen zu führen. Damit könnten wir die Führungsposition in einer zukünftigen Schlüsseltechnologie in Deutschland einnehmen.
MEMRISTOREN MADE IN EUROPE
Ziel ist es, eine neue Wertschöpfungskette in Europa aufzubauen, die als Enabler zu neuen Innovationen in der Mikroelektronik führt.
SONSTIGES
SPRIND UND DER KAMPF GEGEN DIE DÜRRE
DARUM ENGAGIEREN WIR UNS
Weil durch die Ionisierung der Umgebungsluft die Bildung von Regenwolken verstärkt und damit die absoluten Niederschlagsmengen erhöht werden sollen. Weil die Gesamtschäden durch die Hitze- und Dürresommer in den Jahren 2018 und 2019 fast 35 Milliarden Euro betragen haben. Weil auch 2022 die Böden stark ausgetrocknet und Wasserstraßen nur eingeschränkt schiffbar waren. Weil Dürre weltweit zu Armut und Hunger führt.
DAS MACHEN WIR KONKRET
Wir validieren die Ionisierungstechnologie und prüfen, ob tatsächlich eine Ionisierung der Umgebungsluft erreicht wird. Wir finanzieren den Bau einer mobilen Anlage, um die potentiellen Effekte zu vergrößern. Wir unterstützen bei der Planung eines Feldversuchs zur abschließenden Validierung.
DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN
Dürre wird infolge des Klimawandels auch für Europa ein immer größeres Problem mit weitreichenden Folgen. Ein Ansatz, um die Regenmengen zu erhöhen, stiftet enormen Mehrwert für Landwirtschaft, Logistik, Waldbesitzer:innen und wirkt gleichzeitig den Folgen des Klimawandels entgegen.
SPRIND SCHAFFT
PERSPEKTIVEN UND BAHNT EINEN WEG.
GRADUIERT
ANALOG INTELLIGENCE





EIN QUADRATMILLIMETER ZUKUNFT DER ANALOGRECHNER AUF EINEM CHIP
DER INNOVATOR: ANALOGPIONIER BERND ULMANN

Prof. Dr. Bernd Ulmann ist ein Passionsdenker und -täter. Schon seit Teenagerzeiten fasziniert von Analogrechnern, scheint sich sein Enthusiasmus immer weiter zu verstärken. Sein Haus ist halb Werkstatt, halb Museum, randvoll mit zum Teil riesigen Analogrechnern, Lötstationen, Mikroskopen. Seine Frau toleriere das und „wohne netterweise woanders“. Man sehe sich aber täglich und liebe sich sehr, beruhigt Ulmann.
Der Tag hat zu wenige Stunden für den FH-Professor, Museumsdirektor, Sammler, Reparateur und Vaxman, wie er in der Szene genannt wird – nach dem legendären Computer VAX. Für ihn kann es nur analog geben. Digital ist unterkomplex und auch nicht menschlich genug. Denn: Ein normaler digitaler Computer arbeitet programmgesteuert, durch einen Algorithmus, das heißt, er führt einzelne Schritte aus, arbeitet diese nacheinander ab. Ein Analogrechner kennt keine Schritt-für-Schritt-Ausführung, alle Rechenelemente arbeiten hier parallel. Im Prinzip so wie ein Nervensystem, wie das menschliche Gehirn. Ganz biologisch. Nichts in der Biologie kann es sich leisten, sequenziell zu rechnen. Die Zukunft sind deshalb Analogrechner, erklärt Ulmann mit vaxmanischer Vehemenz.
INNOVATION: ANALOG-RECHNER
AUF EINEM CHIPDas Problem mit herkömmlichen digitalen Rechnern, betont Ulmann, ist also, dass sie zu viel Energie verbrauchen und an physikalische Grenzen stoßen. „Klassi-
sches Rechnen ist an ein Ende gekommen. Wir brauchen neue Ideen für High-Performance-Computing – und genauso für energieeffizientes Computing.“
Ulmanns Traum und Ziel lauten deshalb: einen Analogrechner zu bauen, der schneller ist als jeder Digitalcomputer und dabei nur ein Minimum an Energie schluckt. Die eigentliche Innovation besteht darin, den Analogrechner auf einen Chip zu bringen, so wie wir heute Digitalrechner auf einem Chip haben, und neben der Minimalisierung die Möglichkeit, den Analogrechner gesteuert durch einen Digitalrechner zu programmieren: Es geht darum, einen Analogrechner auf einem Chip von der Größe einiger weniger Quadratmillimeter zu entwickeln. Ein Sprung, der die Signalverarbeitung in Handys oder medizinischen Implantaten, zum Beispiel für Hirnschrittmacher, revolutioniert.
Laut Ulmann ist das keine Magie, sondern möglich. Für die Realisierung gründete Bernd Ulmann gemeinsam mit Visionären aus verschiedenen Branchen die anabrid GmbH.
ANABRID BAUT ANALOGRECHNER FÜR DAS DLR
Mehr als zwei Jahre hat SPRIND das Projekt „Analogcomputer auf einem Chip“ inkubiert. SPRIND stellte mit Validierungsaufträgen die erste Finanzierung zur Entwicklung des Projekts bereit und erarbeitete gemeinsam mit dem Team eine Roadmap für den Analogcomputer auf einem Chip. Anschließend sollte das
Projekt durch die Gründung und Finanzierung der SPRIND-Tochtergesellschaft Analog Intelligence vorangetrieben werden. Mit intensiver Unterstützung der SPRIND entwickelte die anabrid GmbH ein erstes Produkt zum Kennenlernen der Analogtechnologie für Forschung und Lehre sowie interessierte Geeks: „The Analog Thing“, kurz THAT. Dabei handelt es sich um einen kostengünstigen Open-Source- und Open-Hardware-Analogcomputer. THAT wurde bereits den elf Millionen Abonnenten des populären Wissenschaftskanal „Veritasium“ vorgestellt.
Im Herbst 2021 konnte SPRIND anabrid im Kontext des Konjunkturprogramms für Quantencomputer in Ulm vorstellen. Als Teil der Quanteninitiative des Instituts für Quantentechnologien am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und unterstützt von der SPRIND wird die anabrid ihre Technologie für die Erforschung von Quantentechnologien sowie zur Erforschung hybrider Rechnerarchitekturen zur Verfügung stellen.
Aufgrund der vorliegenden Doppelförderung mit dem DLR können die ursprünglichen Pläne der Analog Intelligence GmbH nicht weiter umgesetzt werden. Deswegen haben die beteiligten Parteien im Juni 2022 einvernehmlich entschieden, dass die Analog Intelligence GmbH ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeit nicht wie geplant weiterführt und die anabrid GmbH sich stattdessen voll auf den Auftrag des DLR konzentriert.

SOVEREIGN CLOUD STACK


EINE EUROPÄISCHE SUPERWOLKE IT-INFRASTRUKTUR FÜR DAS DRITTE JAHRTAUSEND
DIE INNOVATOREN: EIN TEAM AUS CHRISTIAN BERENDT, PETER GANTEN, KURT GARLOFF, DIRK LOSSACK UND OLIVER MAUSS – OPEN-SOURCE-VORDENKER UND IT-STRATEGEN
» WIR BRAUCHEN HEUTE NICHT NUR EIN NEUES BEWUSSTSEIN FÜR DATENSOUVERÄNITÄT, SONDERN AUCH DIE IT-INFRASTRUKTUREN DAFÜR. WIR BRAUCHEN GANZ NEUE OPEN-SOURCE-INFRASTRUKTUREN. «
Immer mehr Wertschöpfung findet mithilfe von Softwaretechnologie statt. Vor diesem Hintergrund steckt die Industrie in Europa in einem komplexen IT-Dilemma – mit technischen, ökonomischen, rechtlichen und sozialen Dimensionen. Firmen und Private müssen sich entscheiden: Entweder sie betreiben weiter altmodisch-europäische IT – mit eigenen Rechenzentren, Serverräumen, aber auch mit langwierigen Bestell-, Genehmigungs-, Implementierungs- und ChangeManagementprozessen. Das schützt die Daten, ist aber träge und teuer. Oder sie modernisieren sich infrastrukturell mithilfe der großen amerikanischen oder chinesischen Cloud-Lösungen. Denn immer mehr Wertschöpfung ist gar nicht mehr ohne diese Anbieter denkbar oder findet nur direkt durch diese statt. Das aber heißt: Man gibt die Kontrolle über seine Daten komplett auf und macht sich abhängig, was rechtlich, strategisch und ökonomisch ein massives Problem darstellt.
Die europäische Politik hat mittlerweile erkannt, dass es dringend eine technisch-ökonomisch-rechtlich-soziale Lösung für Europa braucht. Sie will deshalb mithilfe von GAIA-X IT-Strukturen aufbauen, welche die europäischen Werte „Transparenz“ und „Datenschutz“ sicherstellen, digitale Souveränität ermöglichen und damit eine echte Alternative schaffen.
DIE ERSTE KOLLABORATIVE CLOUD-INFRASTRUKTUR
Sovereign Cloud Stack (SCS) heißt diese europäische Alternative: Es ist die erste kollaborative Cloud-Infrastruktur – mit Computern, Speichersystemen, Netzwerken und Daten, unter europäischer Kontrolle. Kein Nachbau, kein Imitat der großen außereuropäischen IT-Plattformtechnologien, sondern ein eigenes, sprunginnovatives Projekt.
Die Initiatoren der SCS stellten sich die entscheidende Frage: Wie können wir Transparenz, Gestaltungsmöglichkeiten und Kontrolle herstellen, um Wertschöpfung via IT zu ermöglichen? Die simple Ant-
wort lautet: Open Source. Denn Sovereign Cloud Stack bedeutet: Man nutzt existierende und reife Open-Source-Technologien, baut diese vielen Technologien zu einer konsistenten, modularen, zuverlässigen, gut getesteten und betreibbaren Plattform zusammen – und lässt sie von Communities in einem offenen Prozess weiter entwickeln, inklusive Open Operations als Weiterentwicklung der Open-Source-Idee im DevOpsZeitalter. Also: Alles wird als Open-SourceSoftware entwickelt. Und dank zertifizierbarer Standards, intelligenter Vernetzung, dem konsequenten Aufbau einer SCS-Community und echter Nutzerföderierung kann der SCS eine große, effiziente, innovative Plattform kreieren.
VIELE FRAGEN, EINE VALIDIERUNG
Die SCS-Idee wurde von Mitgliedern der Open Source Business Alliance e. V. und ihrem Vorstandsvorsitzenden Peter Ganten entwickelt. Mit PlusServer und dem damaligen CEO Dr. Oliver Mauss fanden sie den idealen Vorreiter für die Entwicklung eines solch innovativen ITÖkosystems. Folgenden Fragen galt es auf den Grund zu gehen: Bekommt man eine Community aufgebaut? Ist SCS technologisch mit den vorhandenen Open-SourceTechnologien umsetzbar? Geben die Cloudbetreiber auch tatsächlich Betriebswissen weiter? Können sie sich auf Technologiestandards einigen? Ist eine Föderierung gewünscht? Erreicht man eine kritische Masse an Unterstützer:innen? Wie kann man das Projekt strukturieren, sodass es nachhaltig durch kommerzielle Interessen getragen wird – ohne dass nur wenige Unternehmen mit ihren wirtschaftlichen Eigeninteressen dominieren und neue Abhängigkeiten entstehen? Um all das zu klären, erteilte die SPRIND einen Validierungsauftrag. Ein Experten-Trio bestehend aus Dirk Loßack, Christian Berendt und Kurt Garloff prüfte das SCS-Konzept im Sinne eines Reallabors – mit vielversprechenden, positiven Resultaten.
GESAMTGESELLSCHAFTLICHE
RELEVANZ: DAS BMWK STEIGT EIN Ein Ergebnis der Validierung: Die SPRIND ist als Förderer nicht mehr nötig und zieht sich zurück. Denn seit Mitte 2021 wird der SCS zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, zuvor BMWi) unterstützt. Es entsteht also eine starke, neutrale, im gesamtgesellschaftlichen Interesse arbeitende Instanz. Getragen wird der SCS nun von einem etablierten Wirtschaftsverband, der Open Source Business Alliance (OSBA). Angestellte Mitarbeiter:innen, die wachsende, freiwillig arbeitende Community sowie beauftragte Unternehmen können den Fortschritt ab sofort in etablierten Strukturen sicherstellen.
DIE TECHNOLOGIE BEWEIST SICH IM ECHTEN LEBEN
Inzwischen engagieren sich diverse Unternehmen bei der Entwicklung von SCS und belegen, dass sie darin eine zukunftsbasierte Cloud-Infrastruktur und spannende Business-Cases sehen. Seit der Validierung wächst die Community kontinuierlich und freut sich jedes halbe Jahr wieder über ein neues SCS-Release. Nach der PlusCloud Open und der Betacloud startete im September 2022 eine dritte komplett SCS-basierte Public Cloud in den Markt. Auch die Gaia-X Federation Services setzen komplett auf SCS-Technologien.
Klar ist dabei: Die Erkenntnisse und Strukturen, die in der durch die SPRIND beauftragten Validierungsphase erarbeitet wurden, tragen das Projekt und seine wichtige Idee weiterhin: viele kleine und mittelgroße Cloud-Anbieter, die offen und einsehbar zusammenarbeiten, kompatibel sind, deren Lösungen gemeinschaftlich genutzt werden und die gemeinsam Mehrwert schaffen. Ein solches IT-Ökosystem aus Dienstleistern und Nutzer:innen bietet große Chancen für nachhaltige, selbstbestimmte und Souveränität fördernde Plattformen –weit über das SCS-Projekt hinaus.
» EINE DIGITALE ABHÄNGIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN PLATTFORMBETREIBERN IST NOCH GEFÄHRLICHER ALS DIE ABHÄNGIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN ENERGIELIEFERUNGEN. «


SPINNAKER2





Prof. Christian Mayr ist ordentlicher Professor für hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik an der TU Dresden. Er hält ordentlich Vorlesungen, liest Paper, organisiert Akademisches. Aber er ist auch außerordentlich. Denn er versteht sich als Mittler zwischen dem hochschulischen Elfenbeinturm und der kühl operierenden Industrie. Sein Ideal: wissenschaftlich exzellente Ideen in exzellente Ingenieurarbeit zu transferieren. Manchmal kommen ihm solche übergreifenden Ideen auch in seiner überschaubaren freien Zeit; wenn er – gerne gemeinsam mit seinem kleinen Sohn – an Schaltungen, Mikrocontrollern und Steuerungen für das Haus bastelt, das er im Dresdner Vorort Radebeul gebaut hat.
EIN SUPERCOMPUTER, DER DIE ARBEIT DES MENSCHLICHEN GEHIRNS SIMULIERT
Eine dieser Ideen heißt SpiNNaker2, ist Teil des Human Brain Projects und stellt ein Simulationsmodell des menschlichen Gehirns dar. Das heißt, zunächst mal ist es eigentlich ein Chip, in dem Beschleu-
niger stecken, die Neuronen und Synapsen simulieren können. Man könnte auch sagen: der Chip als natürlich inspiriertes künstliches Intelligenz-Netz. Aus diesem einen Chip bauen Mayr und sein Team eine 70.000-Chip-Maschine namens SpiNNcloud, verteilt auf 16 Serverschränke, also ein gedanklich wie räumlich ziemlich großes Ding.

DOPPELTE INNOVATIONSSPRÜNGE
Im Juni 2021 wurden erste Prototypen des SpiNNaker2-Chips gefertigt und elektrisch sowie funktional „auf Herz und Nieren“ getestet. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird der Entwurf des SpiNNaker2-Chips optimiert und schließlich auf großen Wafern mit 300 Millimetern Durchmesser in großer Stückzahl bei Globalfoundries in Dresden für die SpiNNcloud produziert.
Das besonders Faszinierende an SpiNNaker2: Er macht zwei Innovationssprünge in einem – nämlich, was die Energieeffizienz und die Geschwindigkeit von Informationsverarbeitung betrifft. Zum Verständnis: Egal ob man zum Beispiel auf
heutige Versionen des autonomen Fahrens oder auf Robotikanwendungen schaut –beides verbraucht, so Mayr, noch viel zu viel Energie. Etwa 100 mal so viel, wie es müsste und dürfte. Weil dabei viel zu viel Unnötiges, sogenannte Redundanzen, berechnet wird. Es sei deshalb sinnvoll, sich das menschliche Gehirn zum Vorbild zu nehmen, das nach folgendem Prinzip arbeitet: Einer „Kommunikation“ gehen immer Informations-Verarbeitungsstufen voraus.
In diesen wird darüber entschieden, welche Informationen, die für ein Problem relevant sind, tatsächlich übertragen werden – und entsprechend Energie verbrauchen. Was über den Energieverbrauch entscheidet, ist also der Prozess, der vor der „Kommunikation“ abläuft. Genau dieses Prinzip hat Christian Mayr, der sich selbst als „stark biologieinspiriert“ bezeichnet, ins gesamte SpiNNaker2-System übernommen. Deshalb ist dieser Supercomputer, der Künstliche Intelligenz und Hirnbiologie zusammenbringt, „klassischer KI“ deutlich überlegen.
„Im ersten Schritt wollen wir eine neue Generation Chips auf den Markt bringen, die die Sprachverarbeitung inklusive kompletter Sprachanalyse direkt ermöglicht. Dadurch, also ohne Umweg über die Cloud, spart SpinNNaker2 nicht nur Zeit, sondern ermöglicht auch einen besseren Datenschutz bei ‚always-on‘-Anwendungen“, sagt Christian Mayr. Denn SpiNNaker2 ist viel schneller in der Informationsverarbeitung, verbraucht deutlich weniger Energie
und wird dafür sorgen, dass Menschen, Maschinen und Systeme viel effizienter interagieren – in der Zukunft auch etwa in der Medizintechnik, beim autonomen Fahren sowie in der Robotik. Das Team um Christian Mayr arbeitet deshalb bereits an der nächsten SpiNNaker-Generation: „In Zukunft könnte in jedem Robotergelenk einer unserer Chips verbaut sein und den Umweg über einen Zentralrechner in vielen Fällen obsolet machen. Das wird das
Training der robotereigenen Kinematik deutlich verbessern.“
Das Projekt SpiNNaker2 wird seit Sommer 2021 und dem Abschluss der von SPRIND beauftragten Validierung innerhalb der von Prof. Mayr mitbegründeten SpiNNcloud Systems GmbH weiterentwickelt. Mit dieser steht die SPRIND auch weiterhin in regelmäßigem Austausch.

TALKING NERDS THOMAS RAMGE SPRICHT MIT MENSCHEN, DIE NEUES NEU DENKEN.
OBSESSIV PROGRESSIV
THOMAS, WELCHE SPRUNGINNOVATION FÜR DAS JAHR 2050 WÜNSCHST DU DIR AM MEISTEN?
THOMAS RAMGE: Eine riesige Sonnenjalousie am Lagrange Punkt 1, mit der wir die Sonneneinstrahlung auf der Erde so feingranuliert herunterdimmen können, dass wir nur die Temperatur senken, ohne chaotische Nebeneffekte in Klima und Wetter auszulösen.
Ja, muss aber auch sein. Weil ich nicht glaube, dass wir auf den aktuellen technischen und sozialen Entwicklungspfaden den Klimawandel ausreichend schnell in den Griff bekommen. Mir sind die mit solarem Geoengineering verbundenen Dilemmata schon bewusst, aber es erscheint mir fahrlässig, die technologischen Möglichkeiten nicht mit voller wissenschaftlicher Energie auszuforschen.
Im Technikdiskurs in Deutschland dominieren oft die dystopischen Szenarien, nicht die utopischen. Dieser pessimistischen Grundhaltung wollen wir auch im Podcast etwas entgegensetzen, nämlich Entwürfe von wünschenswerten Zukünften, in denen Technologie von morgen die Probleme von heute in den Griff bekommt. Unsere Gäste sind in großer Mehrheit Technikoptimisten, die an diesen technischen Lösungen forschen und entwickeln. Da liegt die technische Wunschkonzert-Frage natürlich nahe. Aber ich stelle sie ja auch mit einer Einschränkung. Die Gäste müssen sich eine Sprunginnovation wünschen, die außerhalb des Feldes ihrer eigenen Expertise liegt. Man merkt vielen an, dass sie eigentlich sagen wollen: „Das, woran ich selbst gerade arbeite …“ Durch die Einschränkung wird das Ganze zu einer interdisziplinären Kreativübung, und im Idealfall hat eine solche Übung natürlich auch immer etwas Unterhaltungswert. Und ich stelle die Frage immer am Ende des Gespräches in der Hoffnung, dass möglichst viele unserer Stammhörerinnen und -hörer bis zum Schluss dranbleiben, weil sie die Antwort des Gastes dazu auch noch hören wollen. Ich bin jedenfalls immer ganz gespannt.
DU NENNST DEINE GÄSTE
„NERDS
Wir suchen zunächst nach Innovatorinnen und Innovatoren, die selbst zum großen Sprung ansetzen, also den Typus forschende Unternehmerin oder unternehmerischer Forscher, die eloquent und lehrreich von ihren Entwicklungen erzählen. Das sind oft jene, die SPRIND fördert, aber eben nicht nur sie. Der DARPA-Podcast sieht sich als Schaufenster der DARPA-Projekte und der Organisation. Wir pflegen sehr bewusst ein wenig mehr Offenheit und Austausch mit spannenden Köpfen aus der gesamten Innovationslandschaft in Deutschland. Der Podcast erfüllt da aus meiner Sicht eine doppelte Funktion. Er macht uns als Agentur in der Forschungs- und Innovationszene etwas bekannter. Aber wir bekommen auch Zugang zu Leuten, die wir noch nicht kennen.
MIT MISSION“. WIE WÄHLST DU SIE AUS?
A BER DU INTERVIEWST JA NICHT NUR POTENTIELLE ODER NACHGEWIESENE INNOVATORINNEN
Nein, wir laden auch immer gerne Menschen ein, die klug und wissenschaftlich fundiert über die Meta- und Querschnittsthemen rund um günstige Rahmenbedingungen für Innovation nachdenken. Wie viel Wettbewerb braucht Innovation? Welche Formen der Finanzierung? Oder wie beschleunigt man die Entwicklung von medizinischen Wirkstoffen, indem man Bürokratie an welcher Stelle schreddert? Spitzenwissenschaftler mit Mission für ihr Fachgebiet sind natürlich auch sehr willkommen – und mit BENJAMIN LIST und STEFAN HELL hatten wir ja auch schon zwei Nobelpreisträger am Mikro. Gelegentlich nutzen wir den Podcast auch, um
ZIEMLICH GROSS UND KONKRET GEDACHT. WARUM STELLST DU DEINEN GÄSTEN IMMER DIE UTOPISCHE 2050-FRAGE? UND INNOVATOREN … DR. THOMAS RAMGE IST TECHNIKSOZIOLOGE UND HAT MEHR ALS 15 PREISGEKRÖNTE SACHBÜCHER VERÖFFENTLICHT. ER DENKT, SCHREIBT UND SPRICHT AN DEN SCHNITTSTELLEN VON TECHNOLOGIE, ÖKONOMIE UND GESELLSCHAFT.von der Arbeit der SPRIND zu berichten. Dann stellt beispielsweise JANO COSTARD eine neue Challenge vor, oder BARBARA DIEHL spricht über Wissenstransfer. In der ersten Folge des Jahres interviewe ich RAFAEL LAGUNA immer zur Bilanz des letzten Jahres und bitte ihn um einen Ausblick auf das kommende, kritische Nachfragen inklusive. Aber die ist er ja gewohnt.
WANN EMPFINDEST DU EIN PODCAST-GESPRÄCH
Wenn die Hörerinnen und Hörer und ich als Moderator in die Gedankenwelt der Gäste reingesaugt werden. Wenn ihre nerdige Begeisterung für ihre technischen Lösungen uns ansteckt, auch wenn wir in dem Moment nicht immer einschätzen können, wie realistisch eigentlich die Pläne sind, die sie in 30 bis 60 Minuten oft sehr detailverliebt und selbstbewusst vorstellen. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, im Gespräch der Person und ihren Motiven nahe zu kommen. Das ist im Kern journalistisches Handwerk mit dem Ziel, dass der oder die Interviewte während des Gesprächs vergisst, dass gerade die Festplatte mitschneidet. Dann lassen sich die Gäste auf einen offenen Austausch ein; so als ob sie ihre Geschichte gerade einem Freund erzählen, den sie lange nicht gesehen haben. Das erreicht man als Host am besten, wenn man sich eher zurückhält, neugierig nachfragt und nicht ständig bewertet, was der Gast sagt. Gleichzeitig versuche ich immer, eine gute Balance zwischen wissenschaftlicher oder technologischer Tiefe und Allgemeinverständlichkeit zu schaffen.
„WISSENSCHAFTLICHE
ODER TECHNOLOGISCHE TIEFE ALLGEMEINVERSTÄNDLICH MACHEN“ – WIE GEHT DAS?
DAS MUSST DU EIN BISSCHEN ERKLÄREN …
Unsere Zielgruppe sind kluge, wissenschafts- und technikinteressierte Hörerinnen und Hörer. Die wollen wir natürlich nicht unterfordern, indem wir komplexe Themen so weit herunter didaktisieren, dass kaum noch etwas an Substanz übrig bleibt. Gleichzeitig müssen fachfremde Köpfe gut folgen können und das Thema auch nicht nur das Doktorandenkolloquium interessieren, das unser Gast nebenher leitet. Wenn es zu speziell wird und auch meine Inkompetenz-Kompensations-Kompetenz nicht mehr ausreicht, um zu folgen, haue ich eine Verständnisfrage dazwischen. Oder ich versuche, das Gespräch wieder auf eine allgemeinverständlichere Ebene zu heben.
ORGANISATIONEN
Unser Ziel ist es, der relevanteste Science&Innovation-Podcast in Deutschland zu werden. Das ist ein hoch gestecktes Ziel, besonders für eine öffentliche Institution, bei der Wissenschaftsjournalismus ja nicht das Kerngeschäft ist. Aber ich glaube, wir haben die Chance dazu, weil wir die Einschätzungskompetenz haben, wo wirklich gerade Spannendes passiert und wir zugleich einen leichten Zugang zu interessanten Gästen finden. Wir haben noch nicht die Reichweite, die wir uns wünschen. Die meisten Folgen erreichen über alle Podcast-Plattformen zusammen 5.000 Klicks. Aber die qualitativen Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigen: Wir erreichen die Richtigen. Nämlich die Nerds mit Mission und viele optimistische Menschen im deutschen Innovations-Ökosystem, die mit Wissenschaft und Technik die großen Herausforderungen unserer Zeit anpacken.
 EIGENTLICH ALS GELUNGEN?
VIELE
MACHEN PODCASTS. WARUM AUCH SPRIND?
DANKE, THOMAS.
EIGENTLICH ALS GELUNGEN?
VIELE
MACHEN PODCASTS. WARUM AUCH SPRIND?
DANKE, THOMAS.
FREIE AUSWAHL. WUNSCHKONZERT.
26.04.2021 #07
Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die Menschheit flügge wird und andere Planeten, vielleicht zuerst mal den Mars, besiedelt, und zwar ernsthaft besiedelt. Durchaus auch ohne Rückflugticket. Damit wir unseren Pioniergeist wiedererhalten und damit wir es auch langsam schaffen, uns von dieser Erde zu lösen. Was wir perspektivisch eines Tages sowieso tun müssen, allein aus astronomischen Gegebenheiten. Wir müssen unsere Wiege verlassen. Und ich hoffe, dass ich das noch erleben werde. Mitfliegen werde ich nicht, ich habe Flugangst, aber ich wünsche es mir durchaus für die gesamte Menschheit, so ein Abenteuer wieder einzugehen.
Weil das nämlich so eine harte Nuss ist, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass die Zurverfügungstellung von öffentlichen Verwaltungsdaten und eine komplette digitale Infrastruktur für Bürger-Services, für meine Uni-Verwaltung, für politisches Handeln, komplett auf digitale Füße gestellt werden würden. Das ist ein großer Bereich, aber ich glaube, das würde so sehr das Leben erleichtern, mit unseren täglichen Bürgerrechten, aber auch Bürgerpflichten, alle Meldebescheinigungen etc. digital zu bekommen. Aber ich glaube, es könnte auch politische Partizipation fördern, weil ich plötzlich auch sehen würde, wofür der Senat genau sein Geld ausgibt, wie die Sitzungstermine sind, dass ich stärker einbezogen werden könnte in Sitzungsverläufe und meine Petition abgeben könnte. Das könnte wirklich eine tolle User Experience werden, also ein Citizenship-Data-Portal, das zu bedienen unglaublich Spaß macht, wo Gruppen sich zusammentun. Wo man auch so eine bestimmte Schönheit der Daten zelebrieren kann, weil man einfach begreift, wie eine Stadt, wie eine Kommune, wie vielleicht sogar ein Staat funktioniert, was Verwaltung bedeutet. Das wäre mal richtig groß und könnte, glaube ich, richtig was heben und vieles schneller machen und vielleicht auch den Begriff des Bürgers und der Bürgerin neu mit Leben füllen.
13.12.2021
BIOTECH-START-UPS
Wenn man sich anguckt, woran in den westlichen Nationen die Leute leiden, sind eigentlich mehr als die Hälfte dieser Erkrankungen vermeidbar. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir nicht nur Medikamente generieren und nicht nur Ärzte ausbilden, die Erkrankungen erkennen und behandeln, sondern dass man tatsächlich versucht, die Erkrankung zu vermeiden. Und eine Sprunginnovation wäre es meiner Meinung nach, wenn man mit einer besseren Aufklärung der Bevölkerung diese vermeidbaren Erkrankungen verhindern könnte. Und man würde damit den sogenannten Health Span verlängern, also die Zeit, in der man ohne Krankheiten lebt, wir leben nun mal bis 80 heutzutage, aber es macht ja auch keinen Spaß, wenn man ab 60 sehr krank ist. Und das wäre auch so, dass man durch eine verbesserte BevölkerungsGesundheitserziehung sich auch besser schützen könnte zum Beispiel vor Infektionserkrankungen, die man im Moment erleben kann. Ich denke, es sollte für ein Kind einfach gemacht werden zu verstehen, welche Risiken das moderne Leben mit sich bringt und wie es damit selbst die richtigen Entscheidungen treffen kann. Städtebauer, Architekten sollten verstehen, wie man mit dem Schaffen von Flächen zum Gehen und Radfahren die Bewegung in der Bevölkerung vermehrt und die Bevölkerung auch langfristig gesünder macht. Und unsere Politiker sollten auch verstehen, dass Werbung für Fast Food und Rauchen nicht unbedingt förderlich ist. Und diese vielen kleinen Dinge können tatsächlich einen großen Einfluss haben.
05.07.2021 #12
FÜR KARDIOVASKULÄREIch hätte gern selbstfahrenden Personenverkehr, der multifunktional ist. Wir sind ja alle sehr viel auch im Homeoffice und immer, wenn ich zurzeit ins eigentliche Office fahre, denke ich, was für eine Zeitverschwendung. Ich sitze hier, ich fahre Auto oder ich fahre S-Bahn. Ich stelle mir vor, es gibt ökologisch sauber für mehrere Personen vielleicht zeitgleich zu nutzenden Verkehr, der einen Transport von A nach B ermöglicht. Und innerhalb dessen habe ich eine Kapsel, wo ich mein Homeoffice habe oder wo ich vielleicht mein Fitnesstraining machen kann oder wo ich schlafe oder wo ich mit meiner Familie sitze und was auch immer ich tue, ein Spiel spiele. Also die Option, dass man Dinge, die man tut, die wir bisher statisch tun, in einen Bewegungsmodus mit einbauen kann.
PROF. DR. SILKE RICKERT-SPERLING PROFESSORIN GENETIK AN DER CHARITÉ BERLIN UND HEALTH-START-UP-INVESTORIN08.11.2021
Kernfusion. Wenn man alle Probleme und alle Herausforderungen dieser Welt zusammennimmt, dann ist es am Ende die Energie. Wir brauchen einfach Energie, und zwar saubere Energie. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann geht auch alles andere viel, viel, viel einfacher. Gerade in Bezug auf Recycling, das braucht manchmal mehr Energie, als es neu zu machen. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann kann ich schon ruhiger schlafen.
25.05.2021 #09
DURCH MIKROFLOTATION
Ich wünsche mir eine Künstliche Intelligenz, ich wünsche mir eine App, die es ermöglicht, zwischen Information und Meinung und Kommentar zu unterscheiden. Das war in Amerika toll, früher war mehr Lametta, sagt man, früher war mehr Trump, das war unterhaltsam, aber das war natürlich mit einem ganz, ganz traurigen und ernsten Hintergrund. Aber da habe selbst ich gemerkt als Mensch, der auch eine humanistische Bildung hinter sich hat oder über sich ergehen lassen musste, mir fällt es schwer, zwischen Meinung und Information zu unterscheiden. Und was ich heute sehe in vielen Diskussionen, da wird eine Meinung kommuniziert, da möchte ich erkennbar irgendwann machen können, dass jemand mir gerade eine Meinung auftischt, obwohl er mir eine Information verkaufen will. Dann kann auch hinterher niemand sagen, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Das ist ganz früher gewesen in der FAZ, machen die heute noch, die haben Meinungen in einer anderen Schriftart verfasst und die Information ist davon getrennt. Das verfließt in unserer heutigen Gesellschaft.
13.09.2021 #17
Dekarbonisierung. Ich glaube, dass der Klimawandel als eine der größten Herausforderungen unserer Generationen unterschiedlichste Versuche und unterschiedlichste Ansätze braucht, um unter diesen Tausenden von Ansätzen den einen zu finden, der uns vielleicht wirklich skalierbar dabei helfen kann, den Klimawandel aufzuhalten beziehungsweise unsere Klimaziele weltweit zu erreichen.
DR. ANNE LAMP GRÜNDERIN DES HAMBURGER START-UPS TRACELESS, DAS „NATÜRLICHE KUNSTSTOFFE“ ENTWICKELTKATRIN SUDER VORSITZENDE DES DIGITALRATS DER BUNDESREGIERUNG
29.03.2021 #05
Als Kind habe ich mir natürlich immer gewünscht, dass Beamen endlich funktioniert. Beamen fand ich immer super. Und das würde auch ganz viele Probleme lösen. Allerdings habe ich mich immer gefragt, wie das dann in dem Raum organisiert wird, dass die nicht alle übereinander ankommen. Aber das ist halt eine Nerd-Diskussion.
Ein Haushaltsroboter. Bitte, ein Haushaltsroboter. Persönlich habe ich den Eindruck, die Digitalisierung schreitet unglaublich fort, aber die Robotik kommt nicht entsprechend nach. Haushaltsroboter, Pflegeroboter, ja. Ganz ehrlich, wir beschreien alle den menschlichen Faktor, den wir brauchen, aber überlegen Sie es sich mal, ob Sie selber, wenn Sie alt und gebrechlich sind, wirklich nicht vielleicht doch lieber vom Roboter gewaschen werden wollen als von einem Mitmenschen, vor dem Sie sich vielleicht auch irgendwo genieren. Robotik ist meines Erachtens ein bisher nicht ausreichend bearbeitetes Gebiet. Da ist noch viel Potential drin. 02.08.2021
Das Interessante ist, dass wir im Jahr 2050 den Krebs besiegt haben werden und dass uns erneuerbare Energien aus den Ohren kommen werden. Und so vieles wird wahrscheinlich, eine Art lineare Innovation sein, von der wir wissen, wo wir landen müssen. Aber eines würde ich mir wirklich wünschen, denn wir schreiben das Jahr 2050 und es ist eine „Sprunginnovation”, und es gibt etwas, das wirklich nicht passiert. Das Einzige, was im Moment wirklich nicht passiert, ist die Frage: Wie können wir eine funktionierende Gesellschaft haben? Denn im Jahr 2050 werden wir in der Lage sein, fast alles zu automatisieren. Dann wird man nicht mehr krank, dann wird jeder 90 Jahre alt, wir haben alle nützlichen Aktivitäten im Leben automatisiert, aber man kann seine schlechtesten Meinungen rund um die Uhr über die sozialen Medien mit der ganzen Welt teilen.
PROF. DR. URSULA MÜLLER-WERDAN FORSCHERIN UND KLINIKDIREKTORIN AN DER KLINIK FÜR GERIATRIE UND ALTERSMEDIZIN AN DER CHARITÉ BERLINDR. KATERINA DEIKE-HOFMANN 05.09.2022 #39
Was tut sich an den Schnittstellen von Medizin und Datenwissenschaft? Wie machen KI-Algorithmen bildgebende Verfahren in der Medizin günstiger und besser? Und gibt es bald kleine, mobile MRT-Geräte für alle?
JONAS ANDRULIS 22.08.2022 #38
Wie schlau wird die nächste Generation Künstlicher Intelligenz? Versteht sie das Warum? Und droht eine menschenfeindliche Superintelligenz?
FRANK WERNECKE 18.07.2022 #37 Wann kommen die Flugtaxis? Was leisten Transportdrohnen heute? Und wie verändern Drohnen die Kriegsführung?
DR. MAR FERNANDEZ-MÉNDEZ 04.07.2022 #36
Welchen Beitrag können Algenfarmen gegen den Klimawandel leisten? Wozu lassen sich Algen verarbeiten? Und wie sollten sich Wissenschaftlerinnen in die Technologieentwicklung einbringen?
ROBERT BÖHME 20.06.2022 #35 Wann startet die Ariane 6? Was hat ein Berliner New-Space-Start-up damit zu tun? Und brauchen wir eine Back-up-Kopie der Menschheit auf dem Mars?
PROF. DR. URSULA MÜLLER-WERDAN 06.06.2022 #34 Ist ewiges Leben denkbar? Was sind die biotechnologischen Möglichkeiten, um den Alterungsprozess der Zellen aufzuhalten oder gar umzukehren? Und wäre ein Leben ohne Tod überhaupt wünschenswert?
PROF. DR. JOHANNA SPRONDEL 23.05.2022 #33 Wie kommt das Neue in die Welt? Wann ist neu auch besser als alt? Und welche Denkfehler machen Transformation träge?
PROF. DR. HELMUT SALIH 09.05.2022 #32 Wo steht die Krebsforschung? Warum könnten bispezifische Antikörper einen Durchbruch bringen? Und wie beschleunigen wir die Entwicklung von besseren Krebstherapien insgesamt?
PROF. DR. JUSTUS HAUCAP 25.04.2022 #31 Wie viel Wettbewerb ist gut für Innovation? Wie innovativ sind die Big-Tech-Monopole wirklich? Und leben wir eigentlich in innovativen Zeiten?
KATHARINA KREITZ 04.04.2022 #30 Schlafen Astronauten in der Embryonalstellung? Welche Rolle spielen Sensoren in der Luft- und Raumfahrt? Und haben Gründerinnen auch Vorteile gegenüber Gründern?
DR.-ING. MIRO TAPHANEL 22.03.2022 #29 Was ist ein Holodeck? Beamt es uns aus der Zoom-Hölle? Und wie kann ein kleiner Start-up-David aus Karlsruhe bei Augmented Reality die Big-Tech-Goliaths schlagen?
STEFANIE ENGELHARD 07.03.2022 #28
Wie lässt sich die Binnenschifffahrt elektrifizieren? Wann kommt der Autopilot für Boote? Und wie viel Geld braucht ein Start-up, das beide Herausforderungen in einem Rutsch angeht? DR. DIANE SEIMETZ UND DR. JANO COSTARD 28.02.2022
DR. MAX GULDE 11.10.2021 #19
Wie lässt sich aus dem Weltraum heraus Wasser in der Landwirtschaft einsparen? Welche Rolle spielen dabei Satelliten mit Wärmebildkameras? Und warum werden diese Satelliten ab nächstem Jahr aus Freiburg kommen?
PROF. DR. SASCHA FRIESIKE 27.09.2021 #18
Wie innovativ können große Organisationen sein? Wann müssen sie ihr Kerngeschäft kannibalisieren? Und unterliegen Manager:innen manchmal einem Innovationsfetisch?
CHRISTIAN MIELE 13.09.2021 #17
Ist die deutsche Start-up-Szene wirklich innovativ? Gibt es zu viel Kapital für schlechte Ideen und zu wenig Geld für gute? Und brauchen wir eine europäische Tech-Börse?
PROF. DR. DIETER WILLBOLD 30.08.2021 #16
Was passiert bei Alzheimer im Gehirn? Warum gibt es bisher keine wirksamen Medikamente? Und kann ein radikal anderer Ansatz endlich den Durchbruch bringen?
PROF. DR. REBECCA SAIVE 16.08.2021 #15
Wie lässt sich der Wirkungsgrad von Solarzellen deutlich erhöhen? Wie lernen US-Studierende das Gründen? Und sind die Arbeitsbedingungen für junge Forschende in Deutschland wirklich so schlecht wie oft behauptet?
BERT HUBERT 02.08.2021 #14 What can innovators learn from open source software development? Why are big companies not as good in innovation as they think? And how do secret services bring new technology into the world?
WOLFGANG SCHLEICH 19.07.2021 #13 Wie funktioniert ein Quantencomputer? Was kann der besser als sein digitaler Kollege? Und wann kommt der erste Quantencomputer „Made in Germany“?
PROF. DR. SILKE RICKERT-SPERLING 05.07.2021 #12
Welche Herzfehler sind genetisch? Wie hat das Human Genom Project die Medizin revolutioniert? Und warum gründen US-Studierende mehr Biotech-Start-ups?
PROF. DR. BENJAMIN LIST 21.06.2021 #11 Was ist eine perfekte chemische Reaktion? Hilft antiautoritäre Erziehung bei Sprunginnovationen? Und warum ist Chemie die wichtigste Technologie überhaupt?
DAN WATTENDORF 07.06.2021 #10 How does DARPA work? Can you force disruptive innovators to collaborate? And why is it sometimes better to walk alone?
ROLAND DAMANN 25.05.2021 #09 Wie kommt Mikroplastik ins Wasser? Wie bekommen wir es dort wieder heraus? Und wie sähe eine Welt aus, in der alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser hätten?
DR. MAI THI NGUYEN-KIM 10.05.2021 #08 Warum ausgerechnet Chemikerin? Wie tanzt man die Ergebnisse seiner Doktorarbeit? Und was ist die kleinste gemeinsame Wirklichkeit?
PROF. DR. BERND ULMANN 26.04.2021 #07 Was sind Analogcomputer? Sind Mathematikstudierende heute dümmer als früher? Und warum sollten wir Menschen eigentlich den
PROF.
PROF.
RAFAEL

DIE HEIMAT DER SPRIND IST: LEIPZIG.
VON HIER AUS MACHEN WIR RADIKALE INNOVATIONEN MÖGLICH.

Wir haben eine flexible Sphäre kreiert, in der wir beweglich bleiben können und die trotzdem unseren speziellen professionellen Anforderungen gerecht wird.


Die SPRIND-Räumlichkeiten bilden eine Art Inkubator – ein urbanes Labor für das Erforschen, Besprechen und Entwickeln von großen Ideen und Konzepten. Es entsteht eine offene, kreative, angenehme und moderne Raum- wie auch Arbeitsumgebung.



SPRIND sorgt dafür, dass bahnbrechende Ideen aus ganz Deutschland schnellstmöglich realisiert werden. In einer angenehmen, offenen und aktivierenden Umgebung.


STRATEGIE
DIRIGENT:IN GESUCHTRAFAEL LAGUNA DE LA VERA
» Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. « – Dies habe ich oft bei meinen Gesprächen mit Forschung, Verwaltung und Wirtschaft gehört. Ich habe gelernt: An den großen innovations- und industriepolitischen Themen arbeiten vielerorts kluge und engagierte Köpfe – zumeist jedoch unabhängig voneinander. Entsprechend bleibt vieles hierzulande Stückwerk.
Bei SPRIND haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch vor „dicken Brettern“ nicht zurückschrecken. Wir haben die Erfahrung gemacht: Wenn wir die richtigen Akteure zu einer Fragestellung zusammen- und in einen offenen Austausch miteinander bringen, dann kann dies sehr schnell eine große Wirkung entfalten. Das Beispiel, an dem wir das deutlich sehen konnten, war unsere Halbleiterstrategie. Bereits bevor die Autoindustrie wegen ausbleibenden Chip-Nachschubs aus Asien Kurzarbeit anmelden musste, haben wir bei SPRIND im Sommer 2020 die Notwendigkeit gesehen, dass wir unseren Rückstand bei Entwicklung und Herstellung von Halbleitern reduzieren müssen. Denn Lieferengpässe bei diesen Produkten können komplette Industrien bei uns lahmlegen. Diese Abhängigkeit macht uns auch erpressbar. Das müssen wir am Beispiel des russischen Erdgases momentan schmerzhaft erfahren.
Klar ist für uns stets, dass die großen technologischen Herausforderungen nie nur national, sondern immer mindestens europäisch gedacht und gemacht werden müssen. Um jedoch das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, starteten wir bei der Halbleiterstrategie zunächst mit Gesprächen und Workshops mit den Vertreter:innen der deutschen Industrie, Forschung und Politik. Erst im zweiten Schritt kommunizierten wir – auf Wunsch der Bundesregierung – die Zwischenergebnisse mit den anderen europäischen Ländern sowie der Europäischen Union und ergänzten deren Perspektive und Anforderungen.
Da sich alle Beteiligten im finalen Dokument wiederfanden, verwundert es nicht, dass das SPRIND-Positionspapier zur Blaupause für den „EU Chips Act“ wurde, der im Februar 2022 vorgestellt wurde. Das Gesetz mobilisiert 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen, um unter anderem die Leistungsfähigkeit in den Bereichen Design, Herstellung und Packaging hochmoderner Chips EU-weit zu verbessern. Es schafft den Rahmen, dass staatliche Beihilfen für die Produktion von Halbleitern gewährt werden konnten wie zum Beispiel für den Bau der Intel-Fabrik, die bis 2027 in Magdeburg entstehen wird. Doch damit wollen wir uns bei SPRIND nicht zufriedengeben. Wir werden auch in den kommenden Jahren Kontakt halten mit allen, die an Bau und Betrieb des Werkes in Magdeburg beteiligt sind, um sicherzustellen, dass das investierte Steuergeld auch zum angestrebten Know-howTransfer und -Aufbau in Deutschland führt.
STRATEGIEN AUCH UMSETZEN
Die rückenstärkende Resonanz aller Akteure bei der Entwicklung und Implementierung der Halbleiterstrategie hat uns bestärkt, diese Rolle auch bei anderen innovations- und industriepolitisch relevanten Themen zu ergreifen. Dazu gehört beispielsweise der Vorschlag für die Entwicklung einer offenen, interoperablen Software-Implementierung des 5G-Mobilfunkstandards im Rahmen eines europäischen Open-Source-Konsortiums. Somit würde die EU-Telekommunikationsindustrie dazu befähigt werden, wieder bei der Ausstattung der europäischen Netzbetreiber mitzuwirken. Indem alle EUUnternehmen Zugang zu dieser Open-Source-Software bekämen und diese einsetzen könnten, entstünde ein neues Ökosystem für radikale technologische Neuerungen, das die digitale Souveränität Europas im Bereich der sensiblen Mobilfunkinfrastruktur erheblich verbessern würde.
Weitere Strategien erarbeitet SPRIND derzeit unter anderem für das Thema „Skalierung der industriellen Produktion von Klimaschutztechnologien wie Wärmepumpen und Energiespeicher“ und „Startschuss für eine krisensichere, regenerative Windstromerzeugung“. Gemeinsam haben all diese Themen, dass SPRIND hier nicht nur ein beratender Think Tank sein will, sondern zugleich auch mitgestaltender Akteur. SPRIND hat die finanziellen Mittel, um viele dieser Projekte zumindest anzustoßen und zum Laufen zu bringen. Und sollten die eigenen Haushaltsmittel für den großen Wurf nicht ausreichen, dann finden wir mit unseren Strategien bei Bundesministerien, Europäischer Kommission und Industrie ausreichend Gehör, sodass vieles möglich wird, was lange nicht möglich schien.
STRATEGIE
IP-TRANSFER SCHNELLER UND EINFACHER MACHEN BARBARA DIEHL
Die Feststellung ist nicht neu: Wir betreiben in Deutschland eine sehr gute Grundlagenforschung, schaffen es jedoch kaum, daraus prosperierende Unternehmen zu machen, die volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Ein erstes, richtig großes Hindernis auf diesem Weg ist die Übertragung beziehungsweise Lizenzierung von geistigem Eigentum (IP) aus der Hochschule oder Forschungseinrichtung an das ausgründungsbegeisterte Team. Nicht wenige scheitern bereits hier, weil sich die Verhandlungen über den Wert und die Modalitäten der Nutzung des IP nicht selten über viele Monate, manchmal Jahre, hinziehen und die Hochschulen und deren Technologietransferorganisationen (TTOs) häufig einen kurz- bis mittelfristigen Mittelrückfluss höher bewerten als den langfristigen Erfolg der Ausgründung. Dies resultiert oft in finanziellen Forderungen, welche die in den Kinderschuhen steckende Ausgründung nicht stemmen kann und die das Unternehmen in nachfolgenden Finanzierungsrunden durch externe Kapitalgeber unattraktiv machen.
Auch bei SPRIND stellen wir immer wieder fest, dass es oftmals zwischen Gründer:innen und TTOs im Ausgründungsprozess zu schweren Konflikten kommt, die das Verhandlungsklima nachhaltig negativ beeinflussen. Das kann dazu führen, dass Gründungen deswegen nicht stattfanden oder Gründer:innen gezwungen wurden, sich auf Konditionen mit hohen finanziellen Folgelasten einzulassen. Darüber hinaus ist die derzeitige Praxis der TTOs extrem uneinheitlich.
DAS WOLLEN WIR ÄNDERN!
Ende April 2022 haben wir ein Positionspapier für einen „IP-Transfer 3.0“ veröffentlicht. Das Papier ist das Ergebnis von Gesprächen mit einer Gruppe von Transfer-Fachleuten mit dem Ziel, die gegenwärtigen Fehlstellungen im Transfer von IP aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu benennen und einen Lösungsvorschlag für einen vereinfachten und zugleich rechtssicheren IP-Transfer zu erarbeiten.
Die Methode, die sich bei den Gesprächen als am vielversprechendsten herauskristallisierte, geht auf die TU Darmstadt zurück und nennt sich „Virtuelle Beteiligung gegen Überlassung der IP-Rechte“, oder kurz: virtuelle Beteiligung. Dabei werden Patente sowie Nutzungs- und Eigentumsrechte an Arbeitsergebnissen gegen eine liquiditätsschonende, virtuelle Beteiligung auf Ausgründungen übertragen. Der entscheidende Vorteil dieses Modells ist: Es gibt für das Start-up in der Gründungsphase keine Zahlungsverpflichtungen.
Eine virtuelle Beteiligung ist eine rechtliche Konstruktion, die finanziell einer Unternehmensbeteiligung gleichgestellt ist. Im Falle eines Exits wird eine virtuelle Beteiligung genauso behandelt wie eine herkömmliche. Der wichtige Unterschied zu einer „normalen“ Beteiligung besteht darin, dass sie kein Stimmrecht beinhaltet. Die virtuelle Beteiligung muss nicht aktiv administriert oder entwickelt werden und setzt kein aktives Portfoliomanagement innerhalb der Hochschulen und Forschungseinrichtungen voraus. Sie ist also eine Beteiligung mit den finanziellen Vorteilen einer Unternehmensbeteiligung, jedoch ohne deren Verpflichtungen. Gerade im Kontext der geringen Expertise und knapper personeller Ressourcen bei vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist die einfache Abwicklung somit ein großer Pluspunkt und ermöglicht Institutionen eine virtuelle Beteiligung, die diese sonst aufgrund des Aufwands real nie vollzogen hätten.
KOALITION DER WILLIGEN GESUCHT UND GEFUNDEN
Der SPRIND-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Juni die Zustimmung erteilt, ein Pilotprojekt zur Vereinfachung des IP-Transfers durchzuführen. Dafür steht in den kommenden Jahren etwas mehr als eine Million Euro zur Verfügung. Es sollen 10 bis 15 Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Partner für ein Pilotprojekt zur Validierung der virtuellen Beteiligung gewonnen werden. Angedacht ist zunächst eine Laufzeit von 36 Monaten. Der Pilot versteht sich als Reallabor, in dem die Einrichtungen das im Positionspapier vorgeschlagene oder auch andere Modelle für einen effizienteren IP-Transfer ausprobieren und implementieren können.
Die teilnehmenden Einrichtungen verstehen sich hierbei als Lerngemeinschaft und als „Koalition der Willigen“, vereint durch das Ziel und die Ambition, den IP-Transfer grundlegend zu vereinfachen, zu beschleunigen sowie mit Blick auf den zukünftigen Erfolg der Gründung zu gestalten. Sich in diesem Zuge als Einrichtung zudem selbst herauszufordern und ambitionierte Ziele zu setzen, soll dabei Bestandteil der Experimentiererfahrung sein.
BLICK IN DIE ZUKUNFT
DIE PRAXIS HAT GEZEIGT, DASS DIE FINANZIERUNGSWERKZEUGE DER SPRIND FLEXIBLER UND VIELSEITIGER WERDEN MÜSSEN. DAHER HABEN DIE REGIERUNGSPARTEIEN IM KOALITIONSVERTRAG 2021 FESTGELEGT:
Derzeit wird ein Gesetz zur Förderung und Finanzierung von Sprunginnovationen vorbereitet, durch oder aufgrund dessen die Bundesagentur für Sprunginnovationen direkt beliehen werden soll. Im Rahmen dieser Beleihung können SPRIND das Recht und die Pflicht übertragen werden, eigenständig Projekte für Sprunginnovationen systematisch zu ermitteln, zu evaluieren und durch finanzielle Mittel, die in der Regel im Rahmen einer Beteiligung der SPRIND an der „Innovationsgesellschaft“ gegeben werden, zu fördern. Im Rahmen der Beleihung kann die SPRIND eigenständig über die Projektauswahl entscheiden und erhält freie Hand bei der Wahl von Finanzierungsinstrumenten und -bedingungen im Rahmen haushaltsrechtlicher und beihilferechtlicher Vorgaben. Ergänzt um einen bundeshaushaltsrechtlichen Selbstbewirtschaftungsvermerk würde die SPRIND weitgehende Freiheit hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Finanzierungen erhalten.
Die damit einhergehenden Berichtspflichten berücksichtigen die Anforderungen einer agilen Projektentwicklung, um Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung sicherzustellen. Es gilt durch die Beleihung einen Rechtsrahmen zu schaffen, der es ermöglicht, öffentliche Mittelverwendung und die damit einhergehende, dem Allgemeinwohl verpflichtete Zielsetzung mit den finanziellen Entscheidungsmöglichkeiten und der Agilität privatwirtschaftlicher Instrumente zu vereinen.
Herausgeber
BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN (SPRIND)
Lagerhofstraße 4 04103 Leipzig info@sprind.org www.sprind.org
Geschäftsführung
BERIT DANNENBERG RAFAEL LAGUNA DE LA VERA
Vorsitzender des Aufsichtsrats DR.-ING. E. H. PETER LEIBINGER Handelsregister Amtsgericht Leipzig (HRB 36977)
Redaktion
JULIANE DÖLITZSCH ELKE JENSEN
Fotografie FELIX ADLER MATTIA BALSAMINI Konzeption MEIRÉ UND MEIRÉ
Art Direction SVENJA WITTMANN Meiré und Meiré
Lithografie max-color, Berlin Druck Druckhaus Sportflieger Sportfliegerstraße 7 12487 Berlin
Redaktionsschluss September 2022
Nachdruck nur mit Genehmigung gestattet. Alle enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bedarf der Zustimmung des Herausgebers.
BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN FEDERAL AGENCY FOR DISRUPTIVE INNOVATION

