Schatzbuch Religion 1

Roswitha Pendl-Todorovic | Kerstin Seneca Jensen
Schatzbuch Religion 1
HANDBUCH
Schatzbuch Religion 1
Schulbuch Nr. 215.700
Unter Mitarbeit von: Anna Almer, Veronika Feiner, Heinz Finster, Hans Neuhold, Carmen Stürzenbecher, Magdalena Wünscher
FinsterVerlag 2024
Roswitha Pendl-Todorovic , Kerstin Seneca Jensen: Schatzbuch Religion 1. HANDBUCH Handbuch zu: Schatzbuch Religion 1 | Schulbuch Nr. 215.700, ISBN: 978-3-903330-48-1
Unter Mitarbeit von: Anna Almer, Veronika Feiner, Heinz Finster, Hans Neuhold, Carmen Stürzenbecher, Magdalena Wünscher
Produktentwicklung: Private Pädagogische Hochschule Augustinum (Graz) | Kompetenzzentrum für Religionspädagogische Schulbuchentwicklung pph-augustinum.at/ueber-uns/kompetenzzentren/religionspaedagogischeschulbuchentwicklung-1/
© FinsterVerlag 2024, Höf-Präbach. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Verbreitung oder des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten. Auflage 1/2024
ISBN: 978-
Layout und Satz: Kerstin Seneca Jensen, Heinz Finster Notensatz: Veronika Feiner Bestellungen: service@finsterverlag.at www.finsterverlag.at
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Liebe Religionslehrerin!
Lieber Religionslehrer!
Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Handbuch zum Schulbuch „Schatzbuch Religion 1“ auch eine Schatzkiste voller Ideen, theologischer Hinweise, Erklärungen der Elemente, Möglichkeiten zur Arbeit im Unterricht, Arbeitsblätter, Schnappschüsse, Geschichten, Lieder u. v. m. mitliefern können.
Uns als Autor*innenteam ist es ein großes Anliegen, euch Religionslehrer*innen etwas unter die Arme zu greifen und die Planung der einzelnen Unterrichtsstunden, Themenblöcke und des Schuljahres zu erleichtern. Natürlich obliegt es jeder Lehrperson selbst, gemeinsam mit ihren Schüler*innen einen individuellen Weg durch jedes Schuljahr zu finden, doch freuen wir uns, wenn wir sowohl mit unserem Schulbuch „Schatzbuch Religion 1“ als auch mit unserem „Schatzbuch Religion 1. HANDBUCH“ den Religionsunterricht ein Stück weit mitgestalten können und wie in einer Schatzkiste Vieles bereitstellen dürfen, aus dem Religionslehrer*innen in diesem einzigartigen Unterrichtsfach schöpfen können.
So wünschen wir allen Religionslehrer*innen viel Freude mit unserem umfangreichen und vielfältigen Angebot im „Schatzbuch Religion 1. HANDBUCH“ und bei der gemeinsamen Schatzsuche mit ihren Schüler*innen.
Herzlichst,
Roswitha Pendl-Todorovic, Kerstin Seneca Jensen und das gesamte Team vom „Schatzbuch Religion“.
Buchcover von „Schatzbuch Religion 1“
Am Cover des „Schatzbuch Religion 1“ sind drei Kinder zu erkennen, die bereit für eine Schatzsuche sind. Mit der Schatzkarte in der Hand und einem Rucksack als Gepäck scheinen sie sich darauf zu freuen, sich auf den Weg zu machen, um Schätze zu finden und einzusammeln. Vom „Schatzbuch Religion 1“ werden auch die Schüler*innen der ersten Klasse eingeladen, sich miteinander auf den Weg zu machen, einander kennen zu lernen, Neues zu entdecken, hinter die Dinge zu schauen, sich Gedanken zu machen und viele Schätze des Lebens und des Glaubens zu entdecken.
Der Edelstein an allen Schatzkästchen und auch am Cover signalisiert, dass die Gedanken, Ideen, Gestaltungen usw. der Schüler*innen als wertvoller Schatz anzusehen sind und laden dazu ein, durch das Befüllen Schätze zu sammeln.
Ein besonderer Schatz ist auch das Namensfeld am Cover: Das Schatzbuch gehört den Schüler*innen und soll nicht einfach ein Schulbuch sein, sondern durch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zu dem je eigenen Schul- und Arbeitsbuch werden. Am Ende des Jahres gleichen sich die Bücher nicht mehr, denn jedes Kind hat sein Schatzbuch mitgstaltet. Es wird dazu eingeladen, das „Schatzbuch Religion 1“ als einen Schatz des Religionsunterrichtes mit nach Hause zu nehmen und auch Jahre später noch die je eigene Auseinandersetzung damit sichtbar zu machen.
Inhalt des „Schatzbuch Religion 1“
Das „Schatzbuch Religion 1“ ist am Lehrplan orientiert und beinhaltet somit zahlreiche Möglichkeiten, um die angestrebten Kompetenzen für die erste Schulstufe zu erwerben.
Auf den nächsten Seiten befindet sich eine Übersicht über die Kapitel im Schatzbuch Religion 1 und deren Zuordnung zum Lehrplan. Diese Zuordnung dient als Grundlage für eine Jahresplanung, vor allem auch deshalb, weil das Schatzbuch Relgion 1 neben dem Lehrplan auch am Kirchen- und Schuljahr orientiert, aufgebaut ist. Des Weiteren enthält sowohl das Schulbuch als auch das Handbuch Hinweise über die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Fächern in den Kapiteln.
Lexikon im „Schatzbuch Religion 1“
Im Lexikon findet sich die alphabetisch geordnete Ansammlung der i-Wörter inkl. kurzer, kindgerechter Beschreibungen von deren Bedeutungen. Die Bilder, die den Begriffen zugeordnet sind, greifen ein Motiv der Doppelseiten auf, auf denen das jeweilige i-Wort vorkommt.
Mit Methoden arbeiten
Im Methodenlexikon wird über vier Schuljahre eine Methodenkompetenz aufgebaut. In der ersten Schulstufe geht es um erste Methoden zur Bildarbeit und zum Erstellen von Legebildern.
Nicht nur die Lehrpersonen, sondern vor allem die Schüler*innen sollen nach und nach Methoden, wie man Bilder „lesen“ kann, wie man mit Texten arbeiten kann, wie man mit Bibeltexten umgehen kann … kennenlernen.
Zuordnungen der Schatzbuchkapitel zum Lehrplan
Schatzbuch Religion
Lehrplanbezug
Kompetenzbereich A1a: Menschen und ihre Lebensorientierungen
KAPITEL 1
Ankommen, einander begegnen –ICH – DU – WIR
KAPITEL 2
Staunen, fragen, danken – GOTT UND DIE WELT
Leitkompetenz: Beziehung verantwortungsvoll gestalten können – zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können sich in ihrer Einmaligkeit als von Gott geliebt8 wahrnehmen und sich und ihre Lebenswelt beschreiben.
Unterrichtshinweise: Mein Name; Psalm 139
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können ihre Lebenswelt beschreiben und sich mit der Zusage, von Gott geliebt zu sein, auseinandersetzen.
Kompetenzbereich A2: Menschen und ihre Lebensorientierung
Leitkompetenz: Sich mit den großen Fragen der Menschen auseinandersetzen können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können ihre Fragen und Gedanken über Gott und die Welt zum Ausdruck bringen und sich mit biblischen Gottesvorstellungen auseinandersetzen.11
Anwendungsbereiche: Welt- und Gottesbilder der Schüler*innen5; Selbstoffenbarung Gottes: Jahwe
Unterrichtshinweise: Gott als Schöpfer (Gen 1 in Auswahl); staunen – fragen –danken; Psalm 8
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können ihre Fragen und Gedanken zu einer biblischen Gotteserfahrung ausdrücken.
Kompetenzbereich C5: Religiöse und weltanschauliche Vielfalt in Gesellschaft und Kultur
KAPITEL 3
Schauen, hören, begegnen – SPUREN VON RELIGION
KAPITEL 4
Erwarten und feiern – ADVENT UND WEIHNACHTEN
Leitkompetenz: Medien, Kunst und Kultur im Kontext religiöser Weltwahrnehmung interpretieren, beurteilen und gestalten können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können Spuren des Christlichen in der Umgebung wahrnehmen und religiöse Motive deuten.
Anwendungsbereiche: Heilige Räume, heilige Zeiten, heilige Menschen
Unterrichtshinweise: Allerheiligen und Allerseelen
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können Christliches im Lebensumfeld beschreiben.
Kompetenzbereich B4a: Gelehrte und gelebte Bezugsreligion
Leitkompetenz: Kirchliche Grundvollzüge kennen und religiös-spirituelle Ausdrucksformen gestalten können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen kennen zentrale Feste im Kirchenjahr und können deren Inhalte gestalterisch zum Ausdruck bringen.
Anwendungsbereiche: Advent- und Weihnachtszeit – die Kindheitsgeschichte nach Lukas
Unterrichtshinweise : Zeichen, Symbole und Traditionen im Weihnachtsfestkreis; die Huldigung der Sterndeuter (Mt 2,1–12)
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können darstellen, was im Advent und in der Weihnachtszeit gefeiert wird.
KAPITEL 5
Hören und erzählen – JESUS, FREUND DER MENSCHEN
KAPITEL 6
Voll Vertrauen leben und wachsen –TAUFE – NEUES LEBEN FEIERN
Kompetenzbereich B3: Gelebte und gelehrte Bezugsreligion
Leitkompetenz: Grundlagen und Leitmotive des christlichen Glaubens kennen und für das eigene Leben deuten können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können über Begegnungen von Menschen mit Jesus erzählen.
Unterrichtshinweise: Lebenskraft: Freundschaft; die Segnung der Kinder (Mk 10,13–16), die Begegnung mit Zachäus (Lk 19,1-10)
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können über eine Begegnung Jesu mit Menschen erzählen.
Kompetenzbereich B4b: Gelebte und gelehrte Bezugsreligion
Leitkompetenz: Kirchliche Grundvollzüge kennen und religiös-spirituelle Ausdrucksformen gestalten können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen kennen die Symbole und Zeichenhandlungen der Taufe und können das Fest beschreiben.
Unterrichtshinweise: Sakrament: Taufe, Jesusnachfolge
Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können wichtige Elemente der Taufe benennen.
KAPITEL 7
Einander vertrauen –DIE WELT IST BUNT
KAPITEL 8
Sprechen und einander verstehen –GEMEINSAM UNTERWEGS
Kompetenzbereich C6: Religiöse und weltanschauliche Vielfalt in Gesellschaft und Kultur
Leitkompetenz: Unterschiedlichen Lebensweisen und Glaubensformen reflexiv begegnen können.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können erkennen, dass Gemeinschaft in Verschiedenheit gelebt wird und können zu einem guten Miteinander beitragen.5
Unterrichtshinweise: Lebenskraft: Vertrauen; (Spiel-)Regeln für das Miteinander Kompetenzniveau 1: Die Schüler*innen können ausdrücken, was gebraucht wird, um sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen.
Kompetenzbereich A1b: Menschen und ihre Lebensorientierung
Leitkompetenz: Beziehung verantwortungsvoll gestalten können – zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung.
Kompetenzbeschreibung: Die Schüler*innen können verschiedene Ausdrucks- und Kommunikationsformen wahrnehmen und anwenden.10
Unterrichtshinweise: Sprache(n) in ihrer Vielfalt, Körpersprache, unterschiedliche Kommunikationsmittel, gewaltfreie Kommunikation
KAPITEL 1: Ankommen, einander begegnen. ICH - DU - WIR
Seiten 5 – 22 im Schulbuch
Impuls
Anfangen
Der Rabe Felix erzählt:Der erste Schultag! Der war sicher spannend, so viele neue Schulsachen! Und erst die Frau Lehrerin und die vielen Kinder.Hast du dich auf die Schule gefreut? Und wenn es manchmal schwierig wird, vertraue darauf: Da ist einer, der sagt: „Ich bin mit dir!“
Hans Neuhold
Allgemeine Hinführung
Die Transition (Übergang vom Kindergarten zur Schule) bedeutet eine große Herausforderung mit vielen Ambivalenzen. Kinder und auch Lehrpersonen sind durch diese Ambivalenz stark mit sich selbst beschäftigt und zugleich geht es um die Ausrichtung auf andere hin: Ich freue mich auf dich. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“, formuliert der Dichter Hermann Hesse und versucht so die Spannung, die in jedem Anfang (auch) steckt, zu beschreiben. Der Zauber des Anfangs erweist sich den Kindern und auch Lehrpersonen als ambivalent und vielschichtig: von positiven Erwartungen, Vorfreude, Anspannung, … zu „Endlich ist es so weit …“ bis hin zu diffusen Ängsten „Wie wird es werden?“, „Wie werde ich es schaffen?“, „Wie werde ich mit dem Neuen zurechtkommen?” …
Es geht dabei um den Kontakt mit sich selbst, damit Kontakt und Beziehung mit den anderen und der Welt möglich wird. Transitionen (Übergänge) konfrontieren Menschen mit großen inneren Unsicherheiten; gerade in diese Situation hinein will der Glaube im Sinne einer Unterstützung bei der Kontingenzbewältigung eine Hilfe sein. Dies drückt sich zuinnerst in einem Beziehungsaufbau und -geschehen aus. Kontakt, Beziehung, Dasein sind auf Seiten der Lehrpersonen zunächst häufig der wichtigste Inhalt des Unterrichts und stärken dadurch die Selbstkompetenz und die soziale Kompetenz der Kinder. Glaube verwirklicht sich im alltäglichen Kontakt- und Beziehungsgeschehen. „Von den Beziehungen her zu denken, für die Beziehungen zu sensibilisieren und religiöse Bildung beziehungsorientiert zu initiieren ist ein zentrales religionspädagogischesAnliegen unserer Zeit.Dazu gehört wesentlich auch die Beziehung zur Welt, in der wir leben.“ (Biesinger/Boschki/Hermann, 2015, 33).
Darin wird das dialogische Prinzip Martin Bubers (1973) menschlichen Seins deutlich: das Ich wird am Du zum Ich (Buber, 1973, 32). In dieser dialogischen Wechselseitigkeit entwickeln sich Personalität und Einmaligkeit, die sich im Namen verdeutlichen. Buber verweist damit darauf, was für heutige Ohren einer manchmal fast krankhaft individualistisch-solipsistischen Lebenseinstellung, die auch global zu ausgewachsenen Krisen führt, ganz wesentlich werden kann, dass es das ICH nur in seiner Verbundenheit mit dem DU gibt und sich
nur in dem Verhältnis zum DU im WIR letztlich verwirklichen kann. „Nur in der lebendigen Beziehung ist dieWesenheit des Menschen, die ihm eigentümliche,unmittelbar zu erkennen.Auch der Gorilla ist ein Individuum,auch derTermitenstaat ist ein Kollektiv,aber Ich und Du gibt es in unsererWelt nur,weil es den Menschen gibt,und zwar das Ich erst vomVerhältnis zum Du aus.Von der Betrachtung dieses Gegenstandes ‚der Mensch mit dem Menschen‘ muss die philosophischeWissenschaftvomMenschenausgehen.“(Buber,1982,168).
Im christlichen Verständnis schließt dieses dialogische Prinzip, wie auch im Lehrplan vorgesehen, auch das Du Gottes mit ein: in der jüdisch-christlichen Tradition weiß sich der Mensch in seiner Geschichte von Gott gesegnet und begleitet und kann daraus Hoffnung und Mut schöpfen. Im Psalm 139, in einer ersten Begegnung mit Jesus, jenem besonderen Menschenfreund, und im Kreuzzeichen kann für gläubige Menschen dieser Glaube und dieses Vertrauen seinen Ausdruck finden. Der Bonner Religionspädagoge Rainer Boschki spricht deshalb von der Notwendigkeit einer „dialogisch-beziehungsorientiertenReligionsdidaktik“(Boschki,2012,173), die Glaube und Leben miteinander ins Gespräch bringen will. Er sieht in der dialogischen Beziehung den Leitbegriff allen religiösen Lehrens und Lernens, „denn religiöseVollzüge,religiöseLebensweisenundGlaubenssystemesind stets beziehungsorientiert – ebenso religiöses Lehren und Lernen“ (Boschki, 2012, 173). Diese dialogisch-beziehungsorientierte Religionsdidaktik vollzieht sich im Unterricht in diesem Kapitel konkret im Wahrnehmen und im Kontakt miteinander, im Erzählen über sich selbst und die eigene Lebenswelt, im Aufeinander-Hören; so werden Einander-Kennenlernen (Name, Herkunft, besondere Vorlieben …), Beziehung und Begegnung ermöglicht und kann Gemeinschaft anfanghaft wachsen.
Lehrplanbezüge des 1. Kapitels
Kompetenzbereich | A1a Menschen und ihre Lebensorientierung Leitkompetenz | Beziehung verantwortungsvoll gestalten können – zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können sich in ihrer Einmaligkeit als von Gott geliebt8 wahrnehmen und sich und ihre Lebenswelt beschreiben.
Unterrichtshinweise | Mein Name; Psalm 139 Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können ihre Lebenswelt beschreiben und sich mit der Zusage, von Gott geliebt zu sein, auseinandersetzen.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte: Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
Gottesliebe und Menschenliebe: Das jüdisch-christliche Gottes- und Menschenbild steht für eine lebensbejahende Grundhaltung zu sich selbst, den Mitmenschen und der Welt. Das Beziehungsgeschehen
zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander ist getragen von der bedingungslosen Liebe Gottes. Unabhängig von Fähigkeiten und erbrachten Leistungen ist der Mensch in seiner Würde unantastbar.
Bezüge zu fächerübergreifenden Themen laut Lehrplan ★ 8 – Reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung
Titelseite: Ankommen,
einander begegnen.
ICH – DU – WIR
Hoffnung, aber auch Angespanntsein und Sorge scheinen die Augen und das Gesicht zu zeigen. Schließlich geht es dabei immer auch um ein Loslassen und Zurücklassen des Vertrauten und ein Sich-Einlassen auf das Neue, Fremde, noch Unbekannte. Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Seite 5 im Schulbuch | Kapitel 1
Das Titelbild zeigt im Vordergrund ein Mädchen auf dem Weg zur Schule, im Hintergrund leicht verschwommen eine Gruppe von Schüler*innen, die miteinander im Gespräch sind. Das Mädchen wendet seinen Körper und besonders sein Gesicht Betrachter*innen zu und winkt mit der rechten Hand heraus. Das Gesicht scheint etwas zu spiegeln von der vielschichtigen Ambivalenz der Anfänge: Freude,
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite Bildarbeit: Gib dem Mädchen eine Stimme: Was würde sie vom ersten Schultag erzählen? Wie war der erste Schultag für sie? Wer hat sie zur Schule begleitet? Wie war der Abschied? Wie war das Ankommen in der Klasse? Wer sitzt neben dem Mädchen? Gibt es bekannte Gesichter in der Klasse? Der Anfang könnte so lauten: „Ich bin dieses Mädchen am Bild. Also, am ersten Schultag. Ich…”
Bild anfertigen: Ein Bild von sich selbst am ersten Schultag gestalten. Ggf. kann eine Vorlage für den Körperumriss verwendet werden.
Klassenwand gestalten: Aus den einzelnen Bildern der Schüler*innen ein gemeinsames Bild entstehen lassen und ggf. auf einer Klassenwand aufhängen.
Fotos: Kerstin enecas Jensen

Kapitel_1_Ankommen, einander begegnen. ICH - DU - WIR
Ich bin ich, ich freue mich auf dich
Seiten 6 und 7 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
„Die vielen Namen … und der eine Name, der nur mich meint …“ Im Namen wird Einzigartigkeit sichtbar und erlebt: „Ich bin es, ich bin gemeint!“ Manche Eltern machen sich viele Gedanken über den Namen ihrer Kinder und wählen diesen sehr bewusst aus. Manchmal ist der Name deshalb auch fast wie ein Lebensprogramm, das auch einengen kann. Wegen dieser besonderen Bedeutung von Namen gilt es diese wertschätzend zu „behandeln“, u. a. ist die Kenntnis der Namen der Kinder wichtig. Die vielen unterschiedlichen Namen auf der Schulbuchseite – auch aus anderen Kulturen und Religionen – laden ein, den eigenen zu finden und damit „sich selbst“ zu entdecken. Das unbedingte Erwünscht- und Gewolltsein, das so manche Kinder nicht erleben können, bleibt in der Bedeutung des Namens zumindest als Sehnsucht und Wunsch nach Kontakt, Beziehung, Bindung und Zugehörigkeit erhalten und wird benannt.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … Namen erkennen, rund um den Namen etwas erzählen. verstehen und deuten
… Namen mit Einzigartigkeit in Verbindung bringen. gestalten und handeln
… den eigenen Namen schreiben. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… sich miteinander über Namen austauschen. entscheiden und mit-tun die Namen der Mitschüler*innen kennen.
… Menschen mit ihrem Namen ansprechen.
3 | Lernanlässe
★ Schulbeginn: dazugehören, dabei sein dürfen, erwünscht sein, sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen, die Befürchtung, übersehen zu werden, einen Namen haben, Angst haben, nicht allein sein wollen, u. v. m.
★ Einander kennenlernen (im Kontext Schule)
★ Sich vorstellen (Name, Alter, Familie …)
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Im Schulbuch findet sich eine Ansammlung von Namen, die einerseits Kinder einlädt, den eigenen Namen bzw. (wenn sie schon lesen können) bekannte Namen zu suchen und andererseits auf die bunte Vielfalt aufmerksam macht. Bewusst finden sich in dieser Grafik auch Namen, die eher anderen Ländern, Regionen, Sprachen und Religionen zugeordnet werden können, um Diversität sichtbar
zu machen. Jeder Name steht für Einmaligkeit und Einzigartigkeit. Im Schatzkästchen „Dein Name“ können die Kinder ihren Namen schreiben und bunt gestalten. So findet auf jeden Fall der Name jedes einzelnen Kindes Platz.
Das Bild „Miteinander“ von Stefan Karch zeigt ein buntes und fröhliches Miteinander von Kindern mit Tieren und Spielsachen und lädt durch das Schatzkästchen „Das bin ich“ dazu ein, sich selbst darin zu verewigen und vermittelt so die Botschaft „Ich gehöre dazu“. Der Satz „Du kennst meinen Namen …” geht in zweierlei Richtungen. Er kann sowohl für Menschen gelten (Eltern, Freunde und Freundinnen …) als auch in biblischer Tradition für Gott selbst, der nach jüdisch-christlicher Tradition jede*n beim Namen kennt. Die Einzigartigkeit jedes Menschen ist in christlich-jüdischer Tradition in diesem Von-Gott-gerufen-sein begründet. Durch die beiden weiteren Sätze „Ich bin einzigartig. Du bist einzigartig“ wird noch eine weitere Dimension eingebracht, denn auch wenn es manche Namen doppelt (vielleicht auch in der Klasse) gibt, so sind wir doch über unsere Namen hinaus, nämlich mit unserer Persönlichkeit, unserem Aussehen ... alle einzigartig.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Namen finden: Den eigenen Namen oder bekannte Namen in der Grafik suchen und etwas über den eigenen Namen erfahren oder erzählen.
Schatzkästchen befüllen: Den eigenen Namen schreiben und mit Lieblingsfarben gestalten.
Schatzkästchen „Das bin ich“: Sich selbst im Bild von Stefan Karch verewigen, mit einem Bild, einem Foto, einer Zeichnung, einem Fingerabdruck oder Ähnlichem.
Vor- und Nachmalen: Den Namen jedes Kindes im Heft, auf der Tafel, auf einem Blatt vorschreiben. Die Schüler*innen spuren ihren Namen mit verschiedenen Farben nach, wodurch ihre ganz persönliche „Ausstrahlung” gestaltet wird. Es bietet sich an, alle Namen anschließend (z. B. im Sesselkreis, durch eine Wandgestaltung) zusammenzulegen und die Vielfalt an Namen und Gestaltungen wahrzunehmen. Namen- und Rufspiele spielen: Sich spielerisch kennenlernen, indem man verschiedene Spiele ausprobiert.
➜ Name + Bewegung: Jedes Kind sagt den eigenen Namen und zeigt eine Bewegung dazu, alle anderen machen die Bewegung nach. Die Schwierigkeit steigert sich, je mehr Bewegungen und Namen dazukommen.
➜ Funken: Die Schüler*innen sitzen im Sesselkreis und ein Kind bleibt in der Mitte. Kind A sucht sich ein anderes Kind B aus und beginnt mit diesem zu funken. Dazu muss Kind A seine Hände zu Antennen am Kopf formen und „A funkt an B“ sagen. Jetzt muss das Kind in der Mitte das angefunkte Kind B berühren, bevor Kind B an Kind C weiterfunkt. Denn dann muss das Kind in der Mitte nicht mehr Kind B sondern Kind C berühren. Schafft das Kind in der Mitte, das angefunkte Kind schneller zu berühren als das Kind weiterfunkt, bekommt es dessen Platz und das andere Kind geht in die Mitte.
➜ Mein rechter Platz ist frei
Mitbringen und Erzählen: Einen Gegenstand von zu Hause mitbringen und mit diesem etwas über sich selbst erzählen. Die Gegenstände dann in der Kreismitte sammeln.
Mein Name im Religionsheft : Den Heftumschlag oder die erste Heftseite mit dem Namen des Kindes gestalten.
Fingerabdrücke oder Unterschriften sammeln: Auf einer Heftseite die „einzigartigen” Fingerabdrücke, die Namen oder die Unterschriften von Mitschüler*innen sammeln. Mein Name in meiner Hand: Handabdrücke gestalterisch abbilden lassen (Abdruck, nachspuren, anmalen) und die Namen in die Handflächen schreiben lassen (u. a. ein Klassenplakat gestalten. Nachdenken über Einzigartigkeit: Gemeinsam überlegen, was das Wort „einzigartig” bedeutet und besprechen, was mich und dich einzigartig macht.
6 | … und noch mehr Ideen
Vornamen besprechen: Anhand der folgenden Fragen können die Vornamen der Schüler*innen besprochen werden: So heiße ich, wie heißt du? Was bedeuten unsere Namen? Woher stammen die Namen (Herkunftsland)? Wer hat den Namen ausgesucht? Namenskärtchen gestalten Arbeitsblatt „Das bin ich” ausfüllen Klassenplakat z. B. mit Regenbogenfarben mit den Fotos der Kinder gestalten. Möglicher Titel: „Wir gehören zusammen, wir sind eine bunte Gemeinschaft!”


Spots in movement und freeze: Bei Musik durch die Klasse gehen; wenn die Musik stoppt, wird jeweils eine Begrüßungsform oder Bewegung angeleitet, die die Schüler*inne nachmachen. Die Schüler*innen können sich u. a. in einer vorgegebenen Anzahl zusammenfinden (z. B. bei 2 müssen 2 Kinder nebeneinander stehen).
7 | Kinderbücher
Dumas, K., Worms, I. (2016). Anna, Anton, Augenstern oder wie man auf der ganzen Welt zu seinem Namen kommt. Annette Betz Hübner, M., Wolfermann, I. (2013). Heute heiße ich Jakob! NordSüd.
Lobe, M., Weigel, S. (1972). Das kleine Ich-bin-ich. Jungbrunnen.
8 | Lieder
Deinen Namen T./M.: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse



Das bin ich
➜ Male ein Bild von dir oder klebe ein Foto ein.
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
➜ Suche alle Buchstaben, die du für deinen Namen brauchst, und kreise sie ein.
➜ Schreibe deinen Namen in das Kästchen.
Schätze bei dir und bei mir entdecken
Seiten 8 und 9 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite lädt dazu ein, sich näher kennenzulernen, miteinander in Kontakt und Berührung zu kommen, die vielen Facetten und bereichernden Schätze bei sich und bei anderen zu entdecken, die für gläubige Menschen ihren letzten Grund, wie im Psalm 139 der Bibel betend ausgedrückt, darin haben, dass der Mensch sich als wunderbares Geschöpf Gottes erfährt, der mit „Du” angesprochen werden kann, dem sich der Mensch verdankt. So ist das Danken die einzig logische Konsequenz. „Dankbarkeit ist das Maß der Lebendigkeit”, benennt es der Mystiker und Benediktiner Bruder David Steindl-Rast. Das eigene Selbstverständnis und Ich-Bewusstsein erwächst entwicklungspsychologisch aus dem Angesprochen- und Gespiegeltwerden durch die wichtigsten Bezugspersonen. In dem Satz „Der Mensch wird am Du zum Ich“ (Buber 1973, 15) bringt der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878–1965) sein dialogisches Prinzip und Verständnis vom Menschen auf den Punkt. An der Nicht-Verbundenheit (häufig auch die fehlende sichere frühe Bindung), „Vergegnung“ statt Begegnung nennt es Buber, leiden vielfach Menschen, auch Kinder. Gerade deshalb sind im schulischen Kontext Kontakt, Beziehung und wirkliche Begegnung so zentral. Damit hängt auch zusammen, dass die Kinder gespiegelt bekommen, was sie einem bedeuten, dass sie Bedeutung haben und uns wichtig sind. Kinder sind darauf angewiesen zu spüren, dass andere an ihnen Interesse haben, dass sie für jemand Bedeutung haben. Das zeigen mittlerweile auch die Erkenntnisse der Neurobiologie. Studien der Neurowissenschaft zeigen nach Joachim Bauer ganz deutlich, dass „soziale Ausgrenzung oder Isolation Gene im Bereich der Motivationssysteme inaktiviert.“ (Bauer 2007, 20). Umgekehrt: Entscheidende Voraussetzungen für die biologische Funktionstüchtigkeit der Motivationssysteme im Menschen sind das Interesse, das einem Menschen (Kind) entgegengebracht wird, die soziale Anerkennung und die persönliche Wertschätzung, die einem von anderen entgegengebracht werden. Bereits die bloße Aussicht auf Anerkennung und Wertschätzung aktiviert diese Systeme. In der Regel geschieht dies durch die engsten Bezugspersonen (Familie, aber auch Lehrer*innen…). Kinder und Jugendliche erleben dadurch, dass ihnen Bedeutung zukommt, dass jemand Interesse an ihnen hat. Beziehung, Interesse, Bedeutung werden für Kinder konkret erfahrbar – so die vorliegende Doppelseite – im Einander-Wahrnehmen, im Interesse aneinander, im Neugierigsein auf den anderen, auf dessen „Schätze” und Interessen. Deshalb sollte für diese anfängliche Beziehungsarbeit reichlich Zeit sein.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Besonderheiten und „Schätze” von sich und anderen.
verstehen und deuten … dass jede*r besonders ist und Schätze in sich trägt. gestalten und handeln … spielen, gestalten, pantomimisch zeigen, was sie an sich als Schatz empfinden.
(be-)sprechen und (be-)urteilen … darüber reden und nachdenken, was man nur mit den Augen des Herzens sehen kann, was mich unverwechselbar und einzigartig macht.
entscheiden und mit-tun … Menschen als einzigartig und wertvoll betrachten.
3 | Lernanlässe
★ Schulbeginn und Fragen nach den anderen: Wer bist du? Wer sitzt neben mir? …
★ Schatztruhe „Religion“
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Bild „Teile von mir“ auf der linken Seite mag erinnern, dass wir uns in Anfangsituationen, Kennenlernspielen usw. immer nur bruchstückhaft kennenlernen und begegnen. Diese Teile möchten aber im Laufe der Zeit zu einem Ganzen zusammenwachsen. Im Teil begegnen wir immer dem ganzen Menschen, wird immer das Ganze sichtbar. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, gilt als eine wichtige Prämisse im Holismus. Erst wer das „Ganze“ in den Blick nimmt, wird auf die Tiefendimension und religiöse Verwurzelung aufmerksam. Sobald wir aber genauer hinschauen und zu analysieren beginnen, zerteilen und zerlegen wir wieder. In dieser Hin- und HerBewegung spielt sich häufig auch Unterricht ab: Einerseits einzelne Teile wahrzunehmen und zu betrachten, und dann wieder „auf das Ganze“ zu schauen.
Der Text vom Raben Felix handelt vom Kennenlernen des anderen und stellt die Frage, ob man jemanden kennt, sobald man dessen Namen weiß. Dadurch regt er neben dem Bild dazu an, nachzudenken, was man von anderen schon weiß und zu überlegen, wie sich das Kennenlernen aus der Betrachtung einzelner Teile zusammensetzt. Durch die Erkenntnis von Max, dass man nur mit den Augen des Herzens die wichtigsten Schätze sieht, wird eine weitere Dimension des Einander-Begegnens und Kennenlernens eingebracht, die für zwischenmenschliche Beziehungen wichtig ist.
Auf der rechten Seite finden sich vier Schatzkästchen, die darauf warten, individuell mit Zeichnungen, Beschreibungen etc. ausgefüllt zu werden. Was hier mit den typischen Kennenlernfragen in den Schatzkästchen zunächst vielleicht als oberflächlich erscheint, verweist letztlich auf die Tiefendimension und Einmaligkeit jedes Kindes, die dann im Psalmvers vertrauensvoll und dankbar zum Ausdruck kommt.
Der Psalm 139,14 „Ich danke dir…“ erzählt von der Erfahrung der engen Verbundenheit zwischen dem Betenden und Gott selbst. Es ist der dankbare Blick des Menschen auf seinen Schöpfer, von dem sich alle von Anfang an – schon im Mutterleib – und bis in die letzte Faser geliebt und erwünscht wissen dürfen. Er versteht, dass er sich das Leben nicht selbst gegeben oder erleistet hat, sondern sich einem Größeren verdankt. Dieses bergende Wissen wird dankbar zum Ausdruck gebracht – im Schulbuch durch den Vers 14.
Der Satz „Wertvoll wie ein Schatz“ ist die Anerkennung gegenüber jedem Menschen, als von Gott so gedacht und erwünscht, so wertvoll wie ein Schatz zu sein. Der QR-Code führt zu einem Lied zum Thema Einzigartigkeit.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Schatzkästchen ausfüllen: Im Schulbuch ausfüllen und gestalten und sich damit bei einzelnen Klassenkolleg*innen oder im Plenum kurz vorstellen.
Über sich nachdenken: Was macht mich aus? Was gehört alles zu mir? Was wissen andere über mich? Was wissen sie (noch) nicht?
Hier kann das Augenmerk auf unterschiedliche Punkte wie äußerliche Merkmale, Vorlieben, Eigenheiten u. v. m. gelenkt werden. Über sich erzählen: Was ich gut kann, was ich gerne mache, worauf ich stolz bin. Die Kinder gehen zu zweit zusammen und erzählen sich gegenseitig von sich. Im Plenum stellt dann jeweils das eine Kind das andere den Mitschüler*innen vor. Überlegen und besprechen: Was bedeutet es, zu sagen: „Du bist wertvoll wie ein Schatz!” Was kann man nur mit den Augen des Herzens sehen?
Schatztruhe mit dem größten Schatz der Welt: Eine geschlossene Schatztruhe, in der ein Spiegel liegt, im Kreis herumreichen. Dazu sagt die Lehrperson: „Ich habe euch heute den wertvollsten Schatz der Welt mitgebracht.” Die Kinder raten, was das für ein Schatz sein könnte. Danach wird die Schatztruhe herumgereicht. Jede*r darf kurz hineinschauen, aber noch nicht verraten, was entdeckt wurde. Die Botschaft dieser Übung lautet folgendermaßen: „Du bist wertvoll wie ein Schatz, dich gibt es nur einmal.”
Sich selbst genau anschauen: Mit einem Spiegelteilchen (Sticker) das eigene Gesicht genau erforschen. Dabei sieht man immer nur einen kleinen Ausschnitt. Was ist deine Lieblingsstelle? (Muttermal, Auge, Nase, Falte, Mund, Zahnlücke …) Das Spiegelsteinchen kann dann in eine Heftarbeit integriert werden. Arbeitsblätter „Das bin ich – Das sind wir“: Anhand der ausgefüllten Arbeitsblätter eine Klassenwand oder Heftseite gestalten. Die Schüler*innen zeichnen sich in den vorgezeichneten Umriss und denken dabei darüber nach, woran man sie erkennen kann. Auch dadurch können sie erkennen, dass jeder mit seinen Besonderheiten ein Schatz ist und dazugehört. Es kann auch ein Spiegel zur Verfügung gestellt werden.
6 | … und noch mehr Ideen
Spiel „Was ist anders”: Ein Kind verlässt die Klasse und wartet vor der Tür. Die anderen Kinder tauschen Plätze, Haarspangen, Brillen, Hausschuhe usw. Wenn das Kind zurückkommt, muss es versuchen, alle Veränderungen zu finden. Thematisch gesehen, kann man aufgreifen, dass man sogar bei Äußerlichkeiten feststellt, was zu wem gehört. Als Erkenntnis gilt, dass man Inneres nicht austauschen kann und es uns somit „unverwechselbar” macht.
Spiel „Alle, die …” (vgl. „Obstsalat”): Alle Kinder, die etwas gemeinsam haben, tauschen die Plätze. Zum Beispiel „Alle, die gerne Pizza essen, schwimmen, ein Haustier haben, eine Zahnlücke haben, Geschwister haben …
Spiel „Activity”: Die Schüler*innen teilen durch Gesten (ohne Worte), Zeichnungen oder Beschreibungen (in denen das gesuchte Wort nicht vorkommen darf) etwas über sich mit, das die anderen erraten
sollen. Zum Beispiel Hobbys, Lieblingstiere, -speisen, -farben … Beziehungsnetz knüpfen (mit Wolle): In einem Kreis stehen und die Wolle jemandem zuwerfen, mit dem die Schüler*innen besonders verbunden sind oder den sie gerne besser kennenlernen möchten. Das Netz verbindet alle.
Hausübung „Du bist ein Schatz”: Das Arbeitsblatt Schatzkiste ausdrucken und mit diesem Auftrag an die Erziehungsberechtigten (oder andere) mitgeben: Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: „Name, du bist ein Schatz, weil …” Im Unterricht kann die Lehrperson die Sätze den Kindern vorlesen. Die Schatzkiste kann auch zum (zu Hause) Aufhängen oder für das Heft gestaltet werden.
7 | Kinderbücher
Brooks, F. (2021). Alle anders – Das sind wir! Usborne.
Kleinhaut, B. (2024). Vom Glück, besonders zu sein. Ravensburger.
Kunkel, D. (2016). Das kleine WIR. Carlsen.
Lucado, M. (2022). Du bist einmalig. (12. Aufl.) SCM Hänssler.
Teich, K. (2014). Wir sind 1a. Carlsen.
8 | Lieder
Du bist außergewöhnlich T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Du bist du T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Du bist ein Schatz T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Einfach spitze T./M. v. D. Kallauch: www.danielkallauch.de
In Gottes Garten T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Voll, voll, Volltreffer T./M. v. D. Kallauch: www.danielkallauch.de
9 | Schnappschüsse


Schatzbuch Religion
Das bin ichdas sind wir!
➜ Zeichne dich selbst in den Umriss ein und schreibe deinen Namen darunter. Woran können dich andere erkennen?
➜ Sammle die Unterschriften von anderen Kindern aus deiner Klasse.

Schatzbuch Religion
Das bin ichdas sind wir!
➜ Zeichne dich selbst in den Umriss ein und schreibe deinen Namen darunter. Woran können dich andere erkennen?

Du bist ein Schatz!
Du bist ein Schatz!
➜ Trage deinen Namen ein und lass jemanden den Satz für dich fertig schreiben.
Trage deinen Namen ein und lass jemanden den Satz für dich fertig schreiben.


Ausgefüllt von: Datum:
Ausgefüllt von: ___________________________ Datum: _____________________
Wie wir in der Schule leben
Seiten 10 und 11 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite thematisiert den für die meisten Kinder völlig neuen und fremden Lebensort Schule, der ja nicht nur ein Lernort ist, sondern an dem die Kinder von nun an ein großen Teil ihres Lebens verbringen. Der Begriff „Lebensort” verdeutlicht, dass es nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen und damit um schulisches Wissen und Können geht, sondern tatsächlich um unser Leben, das hier auch zur Sprache kommen will. Es sei hier auch auf die von Jürgen Baumert (2002) formulierten vier Modi der Weltbegegnung verwiesen, die Schule auszeichnen: kognitive Rationalität (Naturwissenschaften, Mathematik etc.), die ästhetisch-expressive Rationalität (Kunst, Musik,…), die normativ-evaluative Rationalität (Recht, Politik …) und die konstitutive Rationalität (Philosophie, Religion), mit ihren je eigenen Wegen und Fragen. Erst im Zusammenspiel aller vier kann von ganzheitlicher und umfassender Bildung gesprochen werden. Hier findet auch der Religionsunterricht seinen besonderen Platz mit den konstitutiven Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu unseres Lebens.
Diese Vielfalt und der Reichtum von Schule und Lernen will hier seinen Platz finden und auch angesprochen werden. Die vielen Facetten von Lernen, die im gemeinsamen Tun immer auch soziales Lernen beinhalten, sind für so manche Kinder auch sehr herausfordernd, manchmal auch überfordernd. Diese seelischen und emotionalen Seiten von Schule und Lernen, sollen auch bewusst wahrgenommen und kommuniziert werden in dem Grundvertrauen, dass da einer ist, der meinen Namen kennt und mich nicht allein lässt. Dieses Grundvertrauen wurzelt in der alltäglichen Erfahrung, dass die Schüler*innen und Lehrpersonen einen sehen, wahrnehmen, ernst nehmen, einen zuhören und dass sie Interesse an einem selbst haben.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … den Lebensraum Schule erkunden. verstehen und deuten … dass die Schulwelt vielfältig ist, dass alle Personen verschieden und in ihrer Individualität ein wichtiger und wertvoller Teil der Gemeinschaft sind. gestalten und handeln … Gefühle, die es im Schulleben gibt, ausdrücken. (be-)sprechen und (be-)urteilen …Gefühle in Verbindung mit (Schul-)Erlebnissen. … was es braucht, damit man sich wohlfühlen kann. entscheiden und mit-tun … Klassenregeln befolgen.
3 | Lernanlässe
★ Das Leben in der Klasse
★ Erkundung des Lebensortes Schule
★ Schüchterne, mutige, stille, laute … Kinder
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Wimmelbilder von Stefan Karch zeigen unterschiedlichste Kinder und Erwachsene, die unterwegs sind, zusammenstehen; manche sind sich näher, manche distanzierter, manche halten sich an den Händen. Die Kinder auf dem Bild spiegeln die Diversität unserer heutigen Welt. Zugleich strahlt das Bild etwas positiv Heiteres aus, das wesentlich auch zum Kindsein gehört, selbst wenn sich Kindheit manchmal unter schwierigen Verhältnissen vollzieht. Zusammensein und Zugehörigkeit sind wesentlich für die kindliche Entwicklung, da der Mensch nunmal ein soziales Wesen ist.
Der Text vom Raben Felix spricht einerseits von der Notwendigkeit des bergenden Nestes, welches auch jeder Mensch braucht, und andererseits im Bild vom Fliegen von Freiheit und Sich-EntfaltenKönnen, von der Notwendigkeit, sein Leben bewegen zu können. Beides ist von zentraler Bedeutung auch im schulischen Kontext. Die Frage, ob die Schule auch ein „guter Ort” für die Kinder ist, ob sie sich geborgen und angenommen fühlen, ob sie wertgeschätzt und geliebt werden, bleibt nachdenklich offen.
In der grünen Leiste befinden sich Verben, die in Verbindung mit dem Schulalltag stehen, sie zeigen, dass Schule vielfältig ist und können einen Gesprächsanlass über das, was für die Kinder zur Schule gehört, bieten.
Das Foto von der Gefühlsampel hilft den Schüler*innen auszudrücken, wie es ihnen geht. Die Gefühlsampel zeigt, dass jede und jeder unterschiedliche Gefühle hat. Manchmal geht es mir supergut und ein anderes Mal geht es mir richtig schlecht. Alle Gefühle sind wichtig und richtig.
Im Schatzkästchen „Meine Gefühle“ können die Schüler*innen ihre Stimmungen, die sie im Kontext Schule erleben, in die Gesichter zeichnen, um sich dann darüber auszutauschen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Schulhaus und die Klasse erkunden
Wimmelbild-Elemente finden und sprechen lassen: Menschen, Tiere, Dinge auf den Bildern entdecken und „zum Leben erwecken“. Ein Beispielsatz wäre: „Ich bin das Mädchen in der Mitte und ich fühle mich …“
Lieblingsplatz im Wimmelbild finden: Einen Lieblingsplatz aussuchen und ihn beschreiben. Wenn ihn alle gefunden haben, erklären, warum man diesen Platz gewählt hat.
Szene(n) darstellen und erraten : Eine Szene aus dem Bild darstellen, sodass die Zuseher*innen die dazupassende Szene im Bild finden können. Anschließend Wahrnehmungen besprechen. Beispielfragen wären: „Wie ist es mir ergangen? Was habe ich gefühlt? Was habe ich nicht verstanden?“
Situationen finden und erzählen: Die Schüler*innen anleiten, mit offenen Augen durch das Schulhaus zu gehen. In der nächsten Stunde können sie erzählen, ob sie ähnliche Situationen beobachten konnten. Einstieg „Heute geht es mir so, weil …“: Jedes Kind darf sich ein Emoticon aussuchen und einen Satz dazu sagen, warum es dieses Emoticon gewählt hat, wie es ihm*ihr heute geht. Man kann hier auch z. B. (laminierte) Kreise austeilen und jedes Kind zeichnet selbst ein Gesicht auf oder den Kindern verschiedene Smileys vorlegen und sie auswählen lassen.
Gefühlsampel für die Klasse: Mithilfe von Wäschekluppen, auf denen die Namen der Schüler*innen stehen, können sich die Schüler*innen einem Smiley zuordnen und etwas über ihren Gefühlszustand erzählen. Die Gefühlsampel kann auch zur Reflexion eingesetzt werden, z. B. „Bei diesem Arbeitsauftrag habe ich mich so … gefühlt.” Arbeitsblatt „Gefühle in der Schule“ ausfüllen
Besprechen: Was brauchen wir, damit wir uns in der Schule wohlfühlen? Ideen auf einem Plakat sammeln. Eventuell können Klassenregeln davon abgeleitet werden. Beispielfragen:Wasmagichbesonders? Wo tue ich mich schwer? Was fehlt mir? Was wünsche ich mir?
6 | … und noch mehr Ideen
Lesen und Basteln zum Bilderbuch „Heute bin ich“: Das Kinderbuch z. B. im Sesselkreis vorlesen und die Bilder vorzeigen. Nach der Besprechung können die Schüler*innen mit Zuckerkreiden auf schwarzem Papier einen eigenen „Heute-bin-ich-Fisch” gestalten. Anschließend kann mit den Fischen eine Gefühlswand gestaltet werden. Übung „Wir sind alle verbunden“: Die Schüler*innen stehen in einem Kreis und dürfen jeweils etwas über ihre Erfahrungen in der Schule erzählen. Sie werfen sich gegenseitig ein Wollknäuel zu – wer es bekommt, erzählt als nächstes. Der Teil der Wolle, den man in der Hand hat, wird auch beim Weiterwerfen festgehalten. So entsteht ein Netz, eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Erzählungen.

Gemeinschafts- oder Wanderbild gestalten: Die Schüler*innen malen entweder zeitgleich in Kleingruppen oder versetzt für einen bestimmten Zeitraum gemeinsam an einem Bild. Nach diesem Zeitraum kann das Bild zwischen den Gruppen weitergegeben und von der nächsten Gruppe weitergemalt werden. Wichtig ist, von Anfang an klarzustellen, dass ein Gemeinschaftsbild entsteht und die Werke anderer nicht kritisiert oder gar ausradiert werden dürfen. Genauso wie alle Kinder in der Klasse willkommen sind, haben auch alle gezeichneten Beiträge Platz. Die fertigen Werke anschließend aufhängen.
7 | Kinderbücher
Brooks, F. (2019). Gefühle – So geht es mir! Usborne.
Oziewicz, T. (2023). Vertrauen und Mut kennen sich gut. Knesebeck.
Van Hout, M. (2012). Heute bin ich. Aracari.
8 | Lieder
Das alles steckt in mir T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Es ist normal, verschieden zu sein T./M. v. K. Mikula: www.mikulakurt.net
9 | Schnappschüsse


Gefühle in der Schule
➜ Zeichne Gesichter in die Smileys, wie man sich in der Schule fühlen kann.
➜ Überlege dir im letzten Smiley, wie du dich selbst (heute) in der Schule fühlst.
fröhlich ängstlich
➜ So fühle ich mich heute:
mutig
Wie Menschen leben
Seiten 12 und 13 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Vielfältig und sehr divers sind die Ursprungssituationen unserer Kinder in der Schule, in ihnen spiegelt sich die Pluralität der Gesellschaft wider. Herkunft, insbesondere die soziale Herkunft, prägt Menschen zutiefst. In ihr werden Lebensvorstellungen, Sprache, Werte, Kultur, Religion u. v. m. erworben, die ein Leben lang vertraut bleiben und ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbindung vermitteln. Über das ganz alltägliche Zusammenleben wie Wohnen, Essen, Brauchtum, Landschaft, Sprache etc. werden zugleich grundsätzliche Werte und Lebensmöglichkeiten erworben. Durch die verschiedene (auch soziale) Herkunft unterscheiden sich diese auch bei den Kindern und bringen oft eine spannungsreiche Vielfalt in die Klasse. Neugier und Interesse an den anderen, aber auch ein achtsamer Umgang mit Andersartigkeit und Fremdheit bedürfen sorgsamer Begleitung im schulischen Kontext. So werden eine Gesprächskultur und konstruktive Kommunikation gefördert und eine tolerante Grundhaltung eingeübt. Diese Doppelseite will aufzeigen, dass Vielfalt neben der Herausforderung v. a. ein wertvoller Schatz ist, der einlädt, entdeckt zu werden und letztlich von Gott gewollt ist, weil jede*r sein geliebtes Geschöpf ist. Weiter macht sie aufmerksam auf die weltweite Vernetzung und Verbindung aller Menschen. In Zeiten der Globalisierung, die nicht nur ökonomische Aspekte umfasst, und auch durch Flüchtlingsströme darf nicht davon ausgegangen werden, dass ein Land eine unabhängige Insel sei. Es braucht eine weltweite Perspektive und ein Öffnen des engen Blickes dafür, wie es im schulischen Kontext auch durch die „Global Citizenship Education“ angestrebt wird. Nach der Österreichischen Nationalkommission der UNESCO geht es dabei um die Vermittlung und den Erwerb von Kenntnissen, Kompetenzen, Werten und Einstellungen, die dazu befähigen, globale Herausforderungen zu bewältigen und für eine gerechtere, die Menschenrechte achtende Welt tätig zu werden. Es braucht ein Bewusstsein für die Verbindung und Abhängigkeit aller Menschen dieser Erde als Schwestern und Brüder. So bekennen es Christ*innen, denn jede*r ist nach Psalm 139 von Gott her „gewoben im Schoß seiner Mutter“.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … wie unterschiedlich Menschen leben, spielen, wohnen … verstehen und deuten
… dass Verschiedenheit interessant und herausfordernd ist. … was an Vielfalt schön und was schwierig ist. gestalten und handeln
… die Vielfalt in der Klasse. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Auswirkungen von unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten, Sprachen und unterschiedlicher (sozialer) Herkunft. entscheiden und mit-tun
… Einzigartigkeit und Vielfalt miteinander in der Klasse feiern.
3 | Lernanlässe
★ Verschiedene Lebensweisen, -räume, Sprachen, Kleidung, Spiele, Jause …
★ Anfangen – Anfangsrituale
★ Verschiedene Wertvorstellungen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Wimmelbild „Wie Menschen leben“ greift unterschiedliche Kinderwelten auf: Stadt und Land, unterschiedliche Religionen, Wohnsituationen in Österreich, Schulen … Das Bild versucht durch das gemeinsame Sitzen am Tisch Inklusivität zu veranschaulichen und lädt zum gemeinsamen Wahrnehmen und Entdecken des je Anderen und möglicherweise fremd Erscheinenden ein. Es will nicht nur eine heile Welt beschreiben, sondern eine große Vielfalt darstellen und verschiedene Assoziationen hervorrufen.
Die grüne Leiste versteht sich als Gesprächsanlass über die unterschiedlichen Lebenswelten der Schüler*innen.
Der Satz „Wir sind bunt …“ verweist auf die gleiche Würde aller Menschen, in ihrer ganzen Individualtiät. Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll unabhängig davon, wie er ist.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Wimmelbild erkunden: Ich sehe …; Mir fällt auf, dass …; Ich frage mich …; Bei mir zu Hause …; Eine Lupe oder ein Papierrohr zum genauen Schauen zu Hilfe nehmen. Dabei kann auch thematisiert werden, welche Herausforderungen sich aus Unterschiedlichkeit ergeben können.
Tisch mit mitgebrachten Dingen: In der Klasse wird ein Tisch (oder die Kreismitte) mit einem schönen Tuch gestaltet, auf dem alle Schüler*innen Dinge ablegen können, die zu ihrem Leben passen. Das können auch Schätze aus anderen Ländern, von den Großeltern u. v. m. sein. Es entsteht eine bunte Vielfalt, wie im Schulbuch. Die Gegenstände (z. B. mit einem Klebeetikett) den Schüler*innen zuordnen, damit alle ihre Gegenstände wieder zurückbekommen. Mit dem ausgefüllten Arbeitsblatt vom eigenen Leben erzählen und vom Leben anderer hören: Die Schüler*innen können, geleitet durch die Verben in der grünen Leiste, durch mitgebrachte Dinge oder das gestaltete Arbeitsblatt erzählen, wie sie selbst leben und hören, wie andere leben.
Satz „Wir sind bunt und …“ besprechen: Es ist von Anfang an wichtig, den Schüler*innen näherzubringen, dass alle Menschen unabhängig von ihren Attributen gleich wertvoll sind und wie ein würdevoller Umgang miteinander aussieht. Dieser Satz lädt zum Überlegen und zur Besprechung dieser Thematik ein und hilft, trotz möglicher Konflikte, auch das Positive von großer Vielfalt zu entdecken.
6 | … und noch mehr Ideen
Lieblingsplatz auf der Welt gestalten: Die Schüler*innen können mit verschiedenen Materialien oder einfach mit Buntstiften ihren Lieblingsplatz auf der Welt zeichnen und anschließend in der Klasse präsentieren.
Bilder diverser Lebenswelten entdecken: In der Kreismitte legt die Lehrperson viele Bilder von Gegenständen, Landschaften, Aktivitäten usw. aus aller Welt auf. Gemeinsam werden diese erkundet
und besprochen. Die Schüler*innen können selber überlegen und ihre Ideen zu den Bildern miteinander besprechen.
7 | Kinderbücher
Edwards, N., Stegmaier, A. (2022). Ich zeig dir meine Welt. Entdecke wie wir Kinder leben. Penguin Junior. Spier, P. (2021). Menschen. Thienemann-Esslinger.
8 | Lieder
Du bist da, wo Menschen leben LB „Du mit uns” Nr. 519
9 | Schnappschüsse

So lebe ich ...
➜ Schreibe oder zeichne in die Schatzkästchen
So wohne ich ...
Das esse ich am liebsten ...
Das spiele ichamliebst en
Das will ich einmal machen ...
Das ist für mich sehr wertvoll ...
Hier bin ich am liebsten ...
Woran Menschen glauben
Seiten 14 und 15 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Erfahrung des An-der-Hand-Nehmens bzw. Gehalten-Werdens gehört zu den menschlichen Urerfahrungen: An der Hand der Eltern lernen wir stehen und gehen, machen unsere ersten Schritte und gehen auch im übertragenen Sinn ins Leben hinein. Die Erfahrung bzw. die Sehnsucht danach, wenn manche Kinder dies real nicht erleben oder nur selten erleben, ermöglicht Geborgenheit und sichere Bindung, die sich als grundlegend für den Aufbau psychischer Stabilität erweist. Religionen mit ihrem positiven Zuspruch und ihrer Zusage sind in diesem Sinne als eine wesentliche Ressource anzusehen, die ein Hinein-Bergen ins Leben, das für gläubige Menschen letztlich von Gott getragen wird, ermöglichen bzw. bestärken kann. Religionen halten einen riesigen Pool an Erzählungen bereit, die von der Möglichkeit „sicherer Bindung” in Gott berichten. Vieles ist allerdings in Fragen der Religionen und religiöser Erfahrung brüchig geworden und deshalb nur bedingt abrufbar und benennbar. Erfahrung braucht einerseits das Erlebnis und andererseits die Kommunikation und Deutung, damit das Erlebnis zur Erfahrung werden kann. Kindern, die keine Begegnungen mit Religion bzw. keine Deutung solcher erlebt haben, wird der Zugang zum Religiösen erschwert. Dies gilt es sehr ernst zu nehmen, deshalb versucht das Buch auch wie im Text auf der Seite 14 eher behutsam zu formulieren. Die Doppelseite will positiv vermitteln: Du bist getragen und gehalten. Du bist nicht allein. Du bist von Gott umgeben und geliebt, so wie du bist. Sie will im Sinn der Mindestanforderung des Lehrplans einladen, „sich mit der Zusage, von Gott geliebt zu sein, auseinanderzusetzen.”
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… was Menschen, Bilder, Lieder … von Gott sagen und erzählen.
… was Menschen über Gott sagen. verstehen und deuten
… dass Gott für viele Menschen eine Bedeutung hat.
… dass Menschen sich von Gott geliebt wissen dürfen.
… die Bedeutung von Freundschaft und Liebe. gestalten und handeln
… gemeinsam eine Klassenkerze. (be-)sprechen und (be-)urteilen … wann es gut tut, wenn uns einer die Hand reicht und lieb hat. … ob Gott mit uns gehen kann und uns die Hand reicht. … wie wir Gottes Nähe spüren können. entscheiden und mit-tun
… das Lied „Geh mit uns” mitsingen.
3 | Lernanlässe
¬ Kinderfragen: Warum beten Menschen? Gibt es Gott überhaupt? Warum kann man Gott nicht sehen?
¬ Religionsunterricht und die Rede von Gott ¬ Ambivalente Bedürfnisse, sich festzuhalten aber auch loszulassen, am Schulanfang
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Foto „Meine Hand in deiner Hand“ zeigt eine große Hand und eine kleine Hand. Leicht hält sich die große Hand bereit, damit sich die kleine Hand an ihr anhalten kann; das ermöglicht Sicherheit. Die kleine Hand ergreift die große nicht fest, sondern hält sich eher nur leicht an, es entsteht eine leichte Berührung. Kinder brauchen diese leichte Berührung und Nähe oft gerade bei Übergängen, wie sie auch der Schuleintritt darstellt, um Sicherheit und Stabilität zu finden in der neuen Situation. Dennoch kann es eine „leichte” Berührung sein, die loslassen kann, damit das Kind seine eigenen Schritte und Wege gehen kann.
Der Text „Manche sagen” bringt die religiöse Deutung der Erfahrungen von Geborgenheit, Gehaltenwerden und Sicherheit zur Sprache und lädt ein, sich auch selbst mit der Möglichkeit des Vertrauens in Gott auseinanderzusetzen.
Das Lied „Geh mit uns auf unserm Weg” und die vielen bunten Hände, mit den gemalten Gesichtern darauf, zeigen eine frohen und positiv gestimmten heiteren Glauben als Möglichkeit und wollen das Vertrauen in Gott als tiefsten Grund unseres Lebens fördern und unterstützen. Im Lied wenden sich die Menschen vertrauensvoll an Gott mit der Bitte um Begleitung und Segen.
Bildarbeit „Die Hände sprechen lassen“: Die kleine Hand sagt zur großen Hand ….
Das Foto „Bunte Hände unter dem herbstlichen Himmel” zeigt die Buntheit und Verschiedenheit von Kindern, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit als von Gott, und hoffentlich auch von Menschen, geliebt verstehen dürfen.
Der Satz „Du bist von Gott geliebt“ verdeutlicht die Zusage Gottes, Menschen in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen und ihnen schon vor jedem Handeln seine Zuwendung zuzusichern. Die Liebe Gottes versteht sich als bedingungslose Liebe.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Über Gott nachdenken und sprechen: Wo entdecke ich Gott in meinem Umfeld? Welche Erzählungen kenne ich? Welche Bedeutung hat Gott für Menschen in meinem Umfeld? Wann tut es gut, jemanden zu haben, der mir die Hand reicht? Wie kann man die Nähe Gottes spüren? …
Lied „Geh mit uns” singen
Liedruf „Geh mit uns” mit Sätzen verbinden: wiederholt singen und die Schüler*innen dazwischen einen Satz sagen lassen. Beipielsatzanfänge: Ich bin nicht allein, weil … / Die kleine Hand sagt zur großen Hand … / Die große Hand sagt zur kleinen Hand … /Wenn mir jemand seine Hand reicht, fühle ich … / Wenn du mich an der Hand nimmst, …
Klassenkerze gestalten: Mit verschiedenen Farben und Material eine Kerze, die Gottes Nähe sichtbar macht.
Um eine unsichtbare Mitte versammeln: Über Möglichkeiten, die Nähe Gottes zu spüren, sprechen und durch die bewusste Versammlung um eine „unsichtbare Mitte“ die Anwesenheit Gottes „sichtbar“ machen.
6 | … und noch mehr Ideen
Heftarbeit oder Arbeitsblatt „Gott du nimmst mich an der Hand” gestalten: Die Hände der Kinder mit Fingerfarben bestreichen und den Handabdruck auf dem Arbeitsblatt oder im Heft abdrucken. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Schüler*innen einander gegenseitig eine Hand abpausen und diese dann ganz frei gestalten. Legearbeit „Gott ist wie …”: Die Schüler*innen mit verschiedenen Materialien ihre Vorstellungen über Gott kreativ darstellen lassen. Anschließend können sie dem Bild einen Titel geben und ihr Werk den anderen vorstellen.
7 | Kinderbücher
Monari, M. (2018). Der rote Faden. (3. Aufl.) Tyrolia.
Stracke, S. (2018). Gott ist wie Himbeereis. Paulinus.
Thomas, Ch., Hanson, S. (2019). Gott lässt dich nie allein. Gerth Medien.
Wölfel, U. (1985). Hinter dem Hügel. Patmos.
8 | Lieder
Gottes Liebe ist so wunderbar LB Religion Nr. 17
Er hält das Leben in der Hand LB Religion Nr. 53
9 | Schnappschüsse


„Gott ist für mich da, egal wie es mir geht.“

„Gott ist weich und bunt.“

„Gott ist groß.“

„Gott beschützt mich mit seinem Beschützerstab.“
„Gott, du nimmst mich an der Hand ...
➜ Hier kannst du deinen Handabdruck gestalten:
Jesus – einzigartiger Mensch, Sohn Gottes und Freund der Menschen
Seiten 16 und 17 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Der Glaube der Menschen, der auf der vorigen Doppelseite angesprochen wurde, erfährt nun seine besondere Akzentuierung für den konfessionellen Religionsunterricht, indem nun erstmalig im Buch von Jesus erzählt wird: Jesus, ein besonderer Mensch, der Sohn Gottes und Freund der Menschen. In Jesus wird Gott selber sichtbar, erhält ein menschliches Gesicht. Er verkörpert die Nähe und die Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen. In Geschichten über ihn wird konkret, was es heißt, dass Gott die Menschen in ihrer Einmaligkeit liebt. In Jesus wird sichtbar, wer und wie dieser Gott in der jüdischchristlichen Tradition ist: ein Gott mit und für die Menschen. Es ist keine abstrakte Rede von Gott, sondern die Nähe und Liebe Gottes bekommt in Jesus von Nazaret Hand und Fuß, in ihm bekommt Gott ein Gesicht. Jesus zeigt durch sein Reden und Tun, dass Gott die Menschen liebt. Wer Jesus begegnet, spürt: Gott ist den Menschen nahe. Im Sinne der „KommunikationdesEvangeliums”(Mette,2005) steht am Anfang der Rede Jesu „,dieunbedingteZusage‘,undzwarin Form eines Indikativs:,Die Zeit ist erfüllt,das Reich Gottes ist nahe‘” (Mette, 2005, 83). Das Ankommen und Wirken Gottes im Hier und Jetzt wird proklamiert und ins Gespräch gebracht. Ein Teil der Kinder hat vielleicht schon im Kindergarten oder zu Hause etwas von Jesus gehört und innerlich auch schon eine Beziehung zu ihm angebahnt. Zunächst geht es sicherlich auch darum, diesen Ist-Stand zu erheben, um zu wissen, wo die Kinder stehen, was sie schon wissen. Im Buch wird Jesus als Erwachsener in seiner damaligen jüdischen Umwelt, der den Menschen nahe ist, der von der Liebe Gottes erzählt und in seinem Tun vorgestellt. Im Duktus des Kapitels ist nach der Frage, wie Menschen leben, und einem ersten Blick auf den Glauben an einen menschenfreundlichen Gott, der uns nahe ist, Jesus als die erfahrbare Verdeutlichung und Konkretisierung der Nähe Gottes thematisiert. Nach dieser Seite wird das für Christ*innen zentrale Zeichen der Nähe Gottes, nämlich das Kreuzzeichen thematisiert. So gibt es zum Text „Im Namen des Vaters und des Sohnes …” bereits einen inhaltlichen Bezug. „Sein Gottesbild hat nichts von der Schwere und Askese, die der Frömmigkeit so oft eigen ist… In der Sprache heutiger Psychologie: JesushatdenmanipulierendenÜber-Ich-Gottentthrontundmitdem himmlischen Vater in der Tiefe seines Herzens kommuniziert. Er hat aus seiner Gotteserfahrung heraus gelebt und sie durch sein ganzes Menschsein weiterzugeben gesucht“ (Trummer, 2021,18). Dieser positive Zugang soll auch auf dieser Doppelseite mit den Texten und Bildern verdeutlicht werden.
Später wird im Buch im Kontext von Advent und Weihnachten auf die Erwartung und Geburt Jesu und danach nachweihnachtlich intensiver auf Jesus, den Freund der Menschen geschaut - entsprechend dem Kompetenzbereich B3 – und eine Beziehung aufgebaut.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… was auf den Wimmelbildern zu entdecken ist. verstehen und deuten
... dass Begegnungen mit Jesus von Gottes Liebe erzählen. gestalten und handeln
… ein Jesusbild kostbar schmücken, verzieren.
… sich selbst und andere zu Jesus dazuzeichnen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… warum Menschen Jesus als Freund erlebt haben. entscheiden und mit-tun
… mit Jesus reden, ihm von Freude und Sorgen erzählen.
… Freude- und Sorgenzeichen zu einem Jesusbild legen.
3 | Lernanlässe
★ Fragen nach Jesus, z. B. zum Kreuzzeichen: „und des Sohnes …” – wer ist das?
★ Kinderbibeln: Erzählungen von Jesus
★ Warum weiß man etwas über Gott und Jesus?
★ Wie können Menschen spüren, dass Gott nahe ist?
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die beiden Wimmelbilder von Jesusgeschichten von Marijke ten Cate sind Ausschnitte aus einem großen Wimmelbild über das Leben Jesu und der Menschen in der damaligen Welt. Es gibt auf den Bildern viel zu entdecken. Wie die Menschen gelebt haben, wie ihre Häuser ausschauen, wie Menschen gekleidet sind, wie sich das Leben am See Gennesaret abgespielt hat, wie und was Kinder spielen … Die Bilder erzählen einerseits aus dem Leben Jesu, aber besonders auch vieles vom Leben der Menschen, vom Land und der Lebensart in dieser damaligen Zeit. Es besteht eine Fülle an Kleinigkeiten zum Entdecken. Das erste Bild spielt am See Gennesaret . Man sieht den See, die vielen Menschen um Jesus, zwei Boote. Bei einem Boot ist ein Mann mit seinen Alltagsarbeiten beschäftigt. Ein Mann geht mit einem Korb voller Fische an Land. Die normale Arbeit von Fischern am See Genessaret. Kinder spielen im Wasser, jemand fischt vom Strand aus, Tiere sind mit dabei … Im zweiten Boot sitzt eine Person mit einem roten Mantel, die offenbar zu den Menschen spricht. Viele Menschen, Erwachsene und Kinder, sind ihm zugewandt und schenken ihm Aufmerksamkeit. Man kann dabei an Jesus denken, der zu den Menschen geredet hat. Er kennt das Leben der Fischer und ihrer Familien. Er ruft Fischer in seine Nachfolge. Er hat eine ermutigende Botschaft für Kinder und Erwachsene. Im zweiten Bild sieht man eine Szene mitten in einem Dorf. Häuser mit Flachdächern, ein Baum, ein Brunnen, spielende Kinder, Erwachsene, die interessiert zu der Person mit dem roten Mantel hinschauen. Es sind junge und alte, ganz rechts ein Mann mit einem Stock, etwas weiter hinten ein römischer Soldat, Tiere, eine Frau holt beim Brunnen Wasser, ein Baum spendet in der Hitze des Tages Schatten … Etwas weiter hinten, zusammengedrängt Männer in einheitlicher dunkler Kleidung, wohl eine Gruppe frommer Pharisäer, die in eine Richtung schauen und miteinander reden … Sie blicken auf den Mann am Brunnen – im Kontext des Bildes wohl Jesus - ihm laufen die Kinder zu. Man kann daran denken, dass dieser Jesus auf alle Menschen zuging, für alle
ein gutes und ermutigendes Wort hatte. Seine Zuwendung besonders auch zu den Kindern, – eines davon hebt er gerade spielerisch hoch in die Luft – wird sichtbar. Man kann dabei auch an die Kindersegnung denken. Es geht eine Menschenfreundlichkeit von ihm aus, die sich mitten im Alltag der Menschen zeigt. Die Überschrift und die Kurztexte zu Jesus „Jesus erzählt …“ und „Wer Jesus begegnet …“ versuchen in wenigen Worten einzufangen, wer dieser Jesus, den wir Christ*innen als Christus bekennen, für uns Menschen sein will und kann. Sie sind als Einladung, um in eine Glaubenskommunikation, in eine „KommunikationdesEvangeliums” (Mette 2005, 14; Neuhold 2022, 35) einzutreten, zu verstehen. Ikonen (eikon = Abbild) und so auch die angebotene Christus-Ikone wollen in ihrer langen Tradition als Kultbilder das Göttliche durchscheinen lassen, in diese Welt, und setzen deshalb ihre Gestalten auf den Goldhintergrund des Himmels und des Göttlichen. Für orthodoxe Christ*innen ist in den Ikonen und in ihrem Licht das Göttliche selbst anwesend, deshalb ist ihre Herstellung von Gebet und Meditation begleitet. Sie werden nach genau festgelegten Regeln „geschrieben”. Die im Buch dargebotene Christusikone stammt aus dem syrischen Raum aus dem 6. Jhdt., vermutlich aus einem Evangeliar, einer syrischen Pergament-Handschrift der vier Evangelien. Der Blick Jesu geht von links oben nach rechts leicht gesenkt auf die Menschen zu, die Gesichtszüge sind sanft und nicht so streng wie bei anderen Christus-Ikonen. Die segnende Hand ist nach vorne auf die Betrachter*innen gerichtet. Der goldene Nimbus um den Kopf Jesu bringt sein himmlisches Licht und seine himmlische Herkunft zum Ausdruck, die purpurrote Kleidung verweist auf sein Königsein. In diesem menschlichen Gesicht Jesu wird Gott selber sichtbar und kommt uns Menschen nahe.
5 | Möglichkeiten zur
Doppelseite
Wimmelbilder gemeinsam betrachten: Erzählen und benennen, was ich entdeckt habe. Die Personen und Figuren auf den Bildern sprechen lassen. Fragen an die Bilder, Personen, Situationen formulieren. Bilder mit einer Lupe erkunden: Dazu ein kleines Loch in ein Blatt Papier schneiden und über das Wimmelbild legen. So ist immer nur ein kleiner Teil des Bildes sichtbar und kann genauer betrachtet und entdeckt werden.
„Jesus-Wand“ oder „Jesus-Seite“ gestalten: Gemeinsam sammeln, was von Jesus gewusst wird. Mit Begriffen, Symbolen, Zeichnungen eine Jesus-Wand in der Klasse oder Schule gestalten und im Laufe des Schuljahres wachsen lassen. Es kann auch ein gemaltes Bild von Jesus ausgeteilt werden, welches die Schüler*innen in ihrem Heft kostbar verzieren können sowie sich selbst und andere dazuzeichnen. In Bezug dazu kann darüber gesprochen werden, inwiefern Jesus ein Freund für Menschen ist.
6 | … und noch mehr Ideen
Ein Jesus-Buch oder Jesus-Wimmelbild gestalten: Zu jeder neuen biblischen Erzählung von Jesus wird eine Seite im kleinen Jesusbuch oder ein Teil eines Jesusbildes gestaltet. Das Jesus-Buch kann stetig weiterwachsen.
Gemeinsam an Jesus denken: Beten, Singen, Stille spüren, eine Kirche besuchen … Im Gespräch mit Jesus können die Schüler*innen von ihren Freuden und ihren Sorgen erzählen und Zeichen dafür zu einem Jesusbild legen.
Eine Zeitreise machen: Das Land Israel zur Zeit Jesu gemeinsam entdecken: Große Wimmelbilder anschauen, besondere Orte auf der Israel-Landkarte suchen, Berufe kennen lernen, Häuser bauen und daraus ein ganzes „Dorf zur Zeit Jesu“ entstehen lassen und bestaunen oder eine Ausstellung machen … Activity spielen (siehe unten)
7 | Kinderbücher
Jeschke, T., ten Cate, M. (2019). Suchbibel. Deutsche Bibelgesellschaft.
8 | Lieder
I love Jesus deep down in my heart Schatzbuch Religion 1, S. 86
9 | Schnappschüsse




Activity Die Lebenswelt von Jesus
➜ Das gesuchte Wort beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen.
Jesus
Israel
Esel Ziege
Fladenbrot
Soldat
Schaf
Fischer
Maria
Jordan
Haus kochen
Auf allen Wegen – Von Gott gesegnet und beschützt
Seiten 18 und 19 im Schulbuch | Kapitel 1
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Überschrift dieser Seite fasst eine wesentliche Botschaft zusammen, auf allen Wegen von Gott gesegnet und beschützt zu sein. Sie greift die mögliche und zumindest in Ansätzen meist erlebte menschliche Erfahrung des Vertrauens auf und deutet sie auf den größeren Zusammenhang des Weltganzen in seiner Tiefendimension, die schon in den Seiten davor immer wieder angeklungen ist. Diese Möglichkeit des Sich-gesegnet-und-beschützt-Wissens steht aber in einem direkten Zusammenhang mit der menschlichen Erfahrung von Beziehung (siehe auch: Einleitung zum Kapitel). Gott liebt nicht am Menschen vorbei, sondern wir Menschen dürfen uns gerade auch angesichts der konkreten Kinder vor uns als Werkzeug der Liebe Gottes verstehen. Einer Liebe, die auch leiblich im Kreuzzeichen erfahren werden will.
Das Kreuz will also auf dieser Seite in erster Linie als Segens- und Schutzzeichen interpretiert werden. Später im Osterkapitel wird es auch im Sinne des Kompetenzaufbaus mit dem Leiden, dem Tod und der Auferstehung Jesu verbunden. So wird das für manche Kinder vielleicht in einer Erstbegegnung mit dem Kreuzzeichen als schützender Bogen über den Körper interpretiert. Christus ist hier – wie auch im Bild deutlich wird – nicht der leidende Mensch, sondern der kosmische Christus in den Sternen, der alles Leben und den ganzen Kosmos umfängt, dem wir uns als Kinder und Erwachsene ganz anvertrauen können, in den wir uns hinein bergen und als „von Gott geliebt wahrnehmen” können (Lehrplan).
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… unterschiedliche Kreuze und Kreuzformen. verstehen und deuten
… das große Kreuzzeichen als Schutz- und Segenszeichen. gestalten und handeln
… ein Kreuz gestalten oder legen.
… das Kreuzbild im Buch nachstellen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… für wen wir uns Schutz (von Gott) wünschen.
… warum Menschen ein Kreuzzeichen machen. entscheiden und mit-tun
… mit dem Kreuzzeichen vertraut sein und es mitbeten.
… sich gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn machen.
3 | Lernanlässe
★ Eröffnungsgottesdienst
★ Das Kreuz als Schmuck
★ Fragen zum Kreuz, z. B. zum Kreuz in der Klasse: „Welcher Mann
ist am Kreuz?”
★ Beten – Was ist das? Wie geht das?
★ Kreuzzeichen auf der Stirn als Segenszeichen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix nimmt den Aspekt des Geborgenseins mitten im Leben auf. Wenn Angst das Leben schwer macht, dann tut eine Umarmung, ein schützender „Bogen“ gut. Im Kontext der Doppelseite ist der schützende Bogen des großen Kreuzzeichens ein Zeichen der Umarmung, der Geborgenheit und des Schutzes. An der alltäglichen Erfahrung, die der Rabe Felix beschreibt, kann inhaltlich gut angeknüpft werden.
Der Text „Beim Kreuzzeichen“ ist eine Beschreibung und gleichzeitig eine Deutung des großen Kreuzzeichens. Es geht mehr als nur um eine Geste oder eine Bewegung. Das Kreuzzeichen ist ein Gebet, ein Sich-Erinnern an die Geborgenheit in Gott und eine Bitte um Segen. Schon aus der frühesten Zeit der Kirche war das Kreuzzeichen einerseits ein Bekenntnis der Zugehörigkeit zu Christus, aber auch Schutz- und Segenszeichen. So wird es von Anfang an in der Liturgie, vor allem bei allen Sakramenten und Sakramentalien, verwendet (Segnung von Menschen, Gegenständen etc.). Das vermutlich älteste Zeugnis dafür, dass das Kreuzzeichen mit der trinitarischen Formel bei der Taufe verbunden war, findet sich in der Predigt beim Kirchenlehrer Ephraem dem Syrer (306–373): „Anstatt mit dem Schild bedecke dich mit dem kostbaren Kreuz, indem du damit alle deine Glieder und dein Herz besiegelst. Tue das aber nicht bloß mit der Hand, sondern auch in Gedanken, bei allen deinen Verrichtungen, sooft du ein- und ausgehst, beim Sitzen und Aufstehen; dein Bett und alles, wo immer du hinkommst, versiegle zuerst mit dem Kreuz im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Deutsche Bischofskonferenz Hg., 2006, 11). Die christliche Tradition kennt zwei Arten des Kreuzzeichens: Das „große Kreuzzeichen“ (die ganze ausgestreckte rechte Hand wird zunächst zur Stirn, danach zur Mitte des Körpers, zur linken und zur rechten Schulter geführt) und das „kleine Kreuzzeichen“ (mit dem Daumen der rechten Hand wird jeweils ein Kreuz auf die Stirn, auf den Mund und auf die Brust gezeichnet). Das Bild und der Text darunter legt didaktisch das große Kreuzzeichen nahe, weil bei diesem auch der Schutzgestus – „Gott wie ein schützender Bogen über mir und meinen Körper” – körperlich für Kinder eher nachzuvollziehen ist.
Der QR-Code führt zu einem Lied zum Kreuzzeichen. Mit diesem Lied kann das Kreuzzeichen gemeinsam gebetet und gesungen werden.
Das Bild „Christus in den Sternen“ ist eine Steinplastik, die aus vorromanischer Zeit stammt. Sie befindet sich auf einem Brunnen in Südfrankreich. Zunächst sticht eine große stehende Figur ins Auge, die mit ihren ausgebreiteten Händen die Achsen eines Kreises bildet. Da die Figur den Kreis ganz ausfüllt, bilden sich vier Felder, die jeweils einen an Blüten erinnernden Stern zeigen. Es ist zwar kein Kreuz zu sehen und doch erinnert es Christ*innen wohl schnell an ein Kreuz und damit an den kosmischen Christus, der seine Arme ausbreitet. Die ausgebreiteten Arme sind die Haltung der Umarmung und der Liebe. Diese baut bildlich gesprochen den ganzen Kosmos auf und durchströmt ihn. Als Betrachter*in stehe ich dieser Steinplastik gegenüber und kann so in den Dialog eintreten: „Du liebst mich. Ich vertraue dir.“ Zugleich aber werden die Kinder selbst, wenn sie das Bild mit dem eigenen Körper nachstellen, in diese Bewegung der
Liebe und des Vertrauens mit hinein genommen (Zisler, 1994, 67f.). Der Text „Von oben bis unten …“ bietet eine Deutung der Gebärde des großen Kreuzzeichens in kindgemäßer Sprache an. Der Text kann ergänzend zum eigentlichen Wortlaut des Kreuzzeichens gesprochen werden. Die Gebärde, die über den ganzen Körper gezeichnet wird, erinnert mit diesem Text an die Liebe Gottes, die uns von allen Seiten umgibt.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Mit dem Körper ein Kreuz formen Kreuz als Körpergebet beten: Sich dabei zuerst ganz strecken, dann verkleinern, dann die Hände ausbreiten, bis zum „großen” Kreuzzeichen.
Bild „Christus in den Sternen“ zusammen nachstellen: Ausgestreckte Hände, einen Kreis formen, den Bogen mit den Händen über den Körper als Kreuzzeichen „nachzeichnen”. Dabei wird folgender Text gesprochen: „Von oben bis unten, von einem Ende bis zum anderen. Du liebst mich. (Handflächen über der Brust überkreuzen). Ich vertraue dir (Hände nach vorne ausstrecken – Gestus des Empfangens).
Vom Kreuz umarmt: Die Schüler*innen dürfen sich mit einer Decke oder Tuch den Körper einhüllen und beschreiben, wie sich das anfühlt und wann sie sich dieses Gefühl wünschen.
Gemeinsam überlegen:Wann habe ich schon einmalAngst gehabt? Was macht mir Angst? Was hilft mir dabei, dass die Angst weniger wird und das Herz wieder leicht ist?
Kreuze oder Kreuzformen kreativ gestalten: Malen, zeichnen, nachfahren, mit Legematerialien (aus der Natur) legen, nachgehen, aus Papier reißen, in eine kleine Sandkiste zeichnen, stempeln, mit Knetmasse formen, aus bunten Papierresten aufkleben, Kreuzformen ausstanzen und aufkleben, armenische oder irische Kreuzsteine nachzeichnen oder bemalen, Kreuzschablonen mit Ölkreiden durchrubbeln usw.


Kreuzzeichen singend beten: u. a. mithilfe des Liedes vom QR-Code. Kreuzzeichen weiterschenken und einander segnen: Mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn oder auf den Handrücken zeichnen. Wichtig ist hierbei, auf Freiwilligkeit zu achten.
6 | … und noch mehr Ideen
Heftarbeit „Von Gottes Liebe umgeben“: Die Kinder zeichnen sich in eine bunte Papierscheibe mit ausgestreckten Armen. Die wichtige Botschaft dabei lautet, dass sie umhüllt und beschützt von der Liebe Gottes sind.
Arbeitsblatt „Im Zeichen des Kreuzes sind wir mit Gott und den Menschen verbunden“: Das Kreuz gestalten und ggf. Menschen seitlich dazuzeichnen und Farben, Formen … „für das Göttliche“ oberhalb hinzeichnen.
Klassenkreuz gestalten: Beispielsweise mit Handabdrücken auf Papier oder mit den verschiedensten Materialien (z. B. Glassteine, Pfeifenputzer, Eisstäbchen, Naturmaterial, usw.) gestalten. Möglicherweise ein großes Kreuz aus vielen kleinen Kreuzen entstehen lassen.
7 | Kinderbücher
Rose, H. (2014). Christliche Symbole den Kindern erklärt. Butzon & Bercker.
8 | Lieder
Im Namen des Vaters und des Sohnes LB Religion Nr. 60
Über dir, unter dir T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Von guten Mächten wunderbar geborgen LB „Du mit uns” Nr. 711
9 | Schnappschüsse


Im Zeichen des Kreuzes sind wir
mit Gott und den Menschen verbunden
Im Zeichen des Kreuzes sind wir mit Gott
und den Menschen verbunden
Gestalte das Kreuz so wie es dir gefällt. Du kannst unten und seitlich Menschen und oben Farben und Formen für Gott dazuzeichnen.
➜ Gestalte das Kreuz so, wie es dir gefällt. Du kannst unten und seitlich Menschen und oben Farben und Formen für Gott dazuzeichnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes


Lied zum Thema: Kreuzzeichen

Gebetswürfel

Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 20 und 21 im Schulbuch | Kapitel 1
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in Religion beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …) sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 22 im Schulbuch | Kapitel 1
Die Schlussseite ist eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Ein Gebet als spirituelles Angebot steht im Mittelpunkt. So kann über das ganze Schulbuch ein kindgemäßer Schatz an Gebeten, Liedern oder Geschichten bzw. Sätzen zum Nachdenken aufgebaut werden.
Das grafische Element des steirischen Künstlers Alois Neuhold nimmt das Symbol des Regenbogens auf, der etwas verfremdet nicht nach oben gewölbt ist, sondern eher an einen Arm erinnert, in den man sich bergen kann. Aufgefangen, getragen, geschützt vor dem, was sich ganz unten in bedrohlichen Farben und Formen zeigt. Das Leben von Menschen ist nicht nur schön. Auch Kinder nehmen Gefährdungen wahr, sie sind auch mit Schicksalsschlägen konfrontiert, mit Gewalt, Trennung … Der Arm Gottes und hoffentlich vieler Menschen bietet sich wie ein bergendes Nest, wie eine schützende Hand an, um in dieser oft auch bedrohlichen Welt gut und vertrauensvoll leben zu können.
Literatur zum 1. Kapitel
Baumert, J. (2002). Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. In: Killius, N./Kluge, J./Reisch, L. Die Zukunft der Bildung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag. S. 100–151.
Bauer, J. (2007). Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag. Biesinger, A./Boschki, R./Hermann, D. (2015). Fazit, Diskussion der Ergebnisse und Ausblick. In: Altmeyer, St./Biesinger, A./Boschki, R. u. a.: Werte – Religion – Glaubenskommunikation. Eine Evaluationsstudie zur Erstkommunionkatechese. Wiesbaden: Springer VS Fachmedien.
Boschki, R. (2012). Dialogisch-beziehungsorientierte Religionsdidaktik. In: Grümme, B./Lenhard, H./Pirner, M. (Hrsg.). Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. Buber, M. (1973). Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider.
Buber, M. (1982). Das Problem des Menschen. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider.
Mette, N. (2005). Einführung in die katholische Praktische Theologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Neuhold, H. (2022). Glaubenskommunikation statt Belehrung und Indoktrination – eine neue Kommunikationskultur auf dem Hintergrund der gemeinsamen Taufe und des gemeinsamen Priestertums. Ljubljana: Teoloska fakulteta.
Österreichische UNESCO-Kommission (o. J.). Global Citizenship Education https://www.unesco.at/bildung/global-citizenship-education/ Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (2006). Der Glaube an den dreieinen Gott. Eine Handreichung der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz zur Trinitätstheologie.Die Deutschen Bischöfe 83. 11.
Trummer, P. (2021). Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben. Freiburg i. B.: Verlag Herder.
Zisler, K. (1994). Christus in den Sternen. In: Neuhold, H./Pendl, R./ Zisler, K.: Freude am Glauben 1. Handbuch zum Religionsbuch VS 1 „Ich bin mit dir“. Linz: Veritas Verlag.
KAPITEL 2: Staunen, fragen, danken. GOTT UND DIE WELT
Seiten 23 – 38 im Schulbuch
Impuls
Was macht die Farben bunt?
Sag mir, was lässt die Pflanzen sprießen, lässt Bäche, Flüsse, Ströme fließen?
Was lässt der Blumen Duft entstehen, und warum kann ich ihn nicht sehen?
Sag mir, was lässt die Sonne scheinen und ab und zu die Wolken weinen? Was lässt dieVögel morgens pfeifen, was lässt mich fühlen und begreifen? Was lässt die Erde ständig drehen, den Wind mal stark, mal sachte wehen?
Stimmt es, dass Apfelkerne träumen, sie würden mal zu Apfelbäumen? …
Marcus Pfister
Allgemeine Hinführung
Das zweite Kapitel des Religionsbuches „Schatzbuch Religion 1“ nimmt die Fragen und Gedanken der Kinder über Gott und die Welt in den Fokus. Auch Kinder der ersten Schulstufe haben große Fragen und wertvolle Gedanken zu dem, was sie umgibt, was sie erleben, was sie freut oder auch erschüttert. Sie nehmen neben ihren eigenen Erfahrungen und Deutungen auch Gedanken und Deutungsmuster ihrer Umgebung auf und bauen an ihrem Bild über Gott und die Welt weiter. Das Kapitel thematisiert Elemente aus der Welt, in der wir leben und lädt zum Fragen ein. Es lädt ein, auf die Wunder der Natur zu schauen und zu fragen, woher denn das alles kommt und ob es in einer guten Hand geborgen ist, ob man dieser Welt vertrauensvoll begegnen kann. Es geht der Frage nach, wer dieser Gott denn sei, wie Menschen ihn erleben und über ihn erzählen. In Auszügen aus großen biblischen Erzählungen werden unterschiedliche menschliche Erfahrungen angeboten. Beispielhaft wird gezeigt, dass sich Gott den Menschen liebevoll zugewandt hat und beziehungsreich zuwendet, dass er ihnen seine Nähe und verlässliche Freundschaft geschenkt und seinen Namen geoffenbart hat. Diese Nähe und Zuwendung gilt für alle Menschen und zu allen Zeiten. Die Seiten mit den biblischen Erzählungen möchten Resonanzräume für die Kinder und ihre Lebenserfahrungen eröffnen, für ihre Fragen, ihr Bedürfnis nach Nähe und Begleitung. Sie möchten mit dem Leben der Kinder in Kontakt kommen und möchten zum Nachdenken, Fragen und zum Austausch anregen und das Vertrauen der Kinder in sich selbst und in die Welt stärken. Zugleich sind sie immer auch eine Einladung, sich diesem Gott, der sich den Menschen liebevoll zuwendet, mit allem, was das Herz bewegt, anzuvertrauen.
Lehrplanbezüge des 2. Kapitels
Kompetenzbereich | A2 Menschen und ihre Lebensorientierungen. Leitkompetenz | Sich mit den großen Fragen der Menschen auseinandersetzen können.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können ihre Fragen und Gedanken über Gott und die Welt zum Ausdruck bringen und sich mit biblischen Gottesvorstellungen auseinandersetzen.11
Unterrichtshinweise | Welt- und Gottesbilder der Schüler*innen5; Selbstoffenbarung Gottes: Jahwe Unterrichtshinweise | Gott als Schöpfer (Gen 1 in Auswahl); Staunen – fragen – danken; Psalm 8 Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können ihre Fragen und Gedanken zu einer biblischen Gotteserfahrung ausdrücken.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte
Gottesliebe und Menschenliebe: Das jüdisch-christliche Gottes- und Menschenbild steht für eine lebensbejahende Grundhaltung zu sich selbst, den Mitmenschen und der Welt. Das Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander ist getragen von der bedingungslosen Liebe Gottes. Unabhängig von Fähigkeiten und erbrachten Leistungen ist der Mensch in seiner Würde unantastbar.
FreiheitundOffenbarung:Quellen der Offenbarung sind die Bibel und die kirchliche Tradition in ihrer Vielfalt. Auf der darin grundgelegten Freiheit des Menschen basiert die Achtung der Religionsfreiheit jeder Schülerin und jedes Schülers.
Zusage und Verantwortung: Ausgehend vom Verdankt-Sein allen Lebens wissen sich Christ*innen beauftragt und befähigt, Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Dabei leiten sie Hoffnungsperspektiven, die auf biblischen Zusagen aufbauen.
Bezüge zu fächerübergreifenden Themen laut Lehrplan
★ 5 Interkulturelle Bildung
★ 11 Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung
Titelseite: Staunen, fragen, danken. GOTT UND DIE WELT
Seite 23 im Schulbuch | Kapitel 2
Das Titelbild, ein Ausschnitt aus dem Bild „Schöpfung” von Espen Hanefelt Kristensen, lenkt den Blick in die wunderbare und unendliche Weite des Weltalls mit Sonnen, Monden und Sternen. Staunenswert wird der Himmel in seiner Vielfalt, Unendlichkeit und Zauberhaftigkeit vor Augen gestellt und regt die Phantasie der Kinder an. Da irgendwo ist auch unser Planet Erde, sind auch wir Menschen, bin auch ich. Und gleichzeitig ist mit dem Blick auf die Weite des Himmels auch der Gedanke an das Große, Unfassbare, vielleicht auch Göttliche möglich. Es eröffnet sich eine Einladung zu einer Schatzsuche, die die Fragen und Gedanken über Gott und die Welt im Blick hat. Es lädt auch ein, dass eventuell einzelne interessierte Kinder ihr Wissen vom Himmel, von den Sternen und Planeten mit anderen Kindern teilen.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Bildarbeit:Das Bild betrachten, beschreiben, was zu sehen ist (Farben, Formen …), woran es erinnert, was schon bekannt ist. Suche dir einen Platz in dem Bild, der dir besonders gefällt. Schließe die Augen. Wenn du von deinem Platz aus auf die Erde schaust, was siehst du, was denkst du, was wünschst du der Erde? … Öffne die Augen, schaue dich um und erzähle den anderen deine Gedanken.
Klassenwand gestalten: Sterne ausschneiden, mit Glitzer verzieren, mit Schmucksteinen bekleben, Namen oder gemaltes Bild der Kinder hineinkleben. Überschrift: Ein Himmel voller Sterne. Schön, dass du da bist!

Die Welt, in der wir leben
Seiten 24 und 25 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite lädt dazu ein, anhand der Fotos und Bilder die Welt im Großen und im Kleinen wahrzunehmen und zu entdecken. Dadurch wird sowohl all das staunenswert Wunderbare, Geheimnisvolle und Geschenkhafte der Welt, alles, was unser Herz mit Freude erfüllen kann, in den Blick gerückt, wie auch all das, was Angst machen kann, die Gefahren für das eigene Leben, das Gefährdete der Welt, die Zerstörung der Mitwelt und des eigenen Umfeldes. So bewegt sich das Buchkapitel zunächst von außen (Wahrnehmung der Welt, wie sie eben ist) nach innen und deutet die Welt als besonderen, von Gott anvertrauten Schatz für alle Menschen. Die Schüler*innen werden angeregt, über die Welt, die sie umgibt, nachzudenken und auf ihren Wahrnehmungen basierend Fragen zu entwickeln. Durch die Beschäftigung mit den auftauchenden Themen und Fragen haben die Schüler*innen die Möglichkeit, ihre eigene Lebenswelt als geheimnisvoll und staunenswert zu verstehen, aber auch die Gefährdungen, Sorgen und Ängste wahrzunehmen und zu artikulieren. Sie werden durch eigene, aber auch durch die Fragen und Wahrnehmungen anderer zum Nach- und Weiterdenken angeregt. Grundsätzlich gilt für das Fragen und für einen fragehaltigen Unterricht, dass sie anregen, nach Antworten zu suchen, dass eine Suchbewegung ausgelöst werden kann nach möglichen Antworten, die eben nahe bei den Fragen wohnen und zu finden sind: „Wer fragt, weiß schon etwas!”
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können:
wahrnehmen und beschreiben
… Entdeckungen und Gedanken zum Leben auf dieser Welt.
… Fragen über „Gott und die Welt“. verstehen und deuten
… dass die Welt und das Leben bunt und vielfältig sind.
… dass vieles schön, rätselhaft, traurig, gefährdet … ist.
… Fragen als Hilfe, um die Welt zu verstehen. gestalten und handeln
… ein Plakat oder Legebild zur Welt (inkl. Ambivalenzen). (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was die Bilder erzählen.
… eigene Fragen und Gedanken zu Gott und zur Welt. entscheiden und mit-tun
… Fragen und Gedanken an Gott richten.
… die Welt schützen.
3 | Lernanlässe
★ Das vielfältige Miteinander in der Schule
★ Weltgeschehen, von dem auch die Kinder hören und betroffen sind: Umwelt, Klima, Artensterben …
★ Fragen und Interessen, die von Kindern thematisiert werden
★ Große und kleine Welt: Lebenswelt der Schüler*innen und Leben auf der Welt
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Bildcollage zeigt eine Auswahl von dem, was zu unserem Leben auf der Welt gehört, was fasziniert, beglückt, erstaunt, erschreckt … Es sind Blitzlichter, die zum Schauen, Erzählen und Fragen einladen. Die Themen und Lebensbereiche sind: Das Foto einer belebten Gasse in einer Stadt als Beispiel für den städtischen Raum, in dem viele Menschen leben, arbeiten, einkaufen u. v. m. Das Foto der Menschen bei der Arbeit ist ein Hinweis auf die vielfältige Arbeitswelt, in der Menschen einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Das Foto eines Kindes, welches einen Kuss auf die Wange einer Frau gibt, zeugt von den Beziehungen und geliebten Gesten. Das Bild „Kinder“ eröffnet den Raum zum Denken an die Vielfalt und Buntheit der Menschen. Das Foto des Eisbärs als faszinierendes Tier, das vom Aussterben bedroht ist und der Müll um ihn herum erinnern an die Zerbrechlichkeit der Welt und die Notwendigkeit, diese zu schützen. Der Globus in der Mitte, der in seiner Größe und Zerbrechlichkeit viele Wahrnehmungen und Fragen thematisiert, u. a. auch die Zusammengehörigkeit der Menschen auf der Welt (alle leben auf einem Planeten usw.).
Das Schatzkartenstück und die herumtanzenden Fragewörter „Wo? Was? Warum?” verdeutlichen die fragehaltige (Schatz-)Suchperspektive auf die Welt und das Leben und wollen helfen, eigene Fragen in Worte zu fassen.
Der Text vom Raben Felix motiviert, die Schönheiten der Welt und des Lebens wahrzunehmen und sich daran zu freuen.
Die Schatzkästchen laden Kinder ein, die eigenen Wahrnehmungen der Welt und des Lebens kreativ einzubringen, sich selbst zu fragen, was sie in Bezug auf die Welt, in der sie leben, überrascht, was sie mögen und was sie traurig macht – die Möglichkeiten sind hierbei so vielfältig wie die Kinder selbst.
Das Fragezeichen zum Anmalen hat den Sinn, die fragende Perspektive zu verdeutlichen und für jeden einzelnen festzuhalten.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Wahrnehmen und fragen: Bilder anschauen, Statements zu den Bildern sammeln: Was siehst du? Was denkst du? Welche Fragen fallen dir ein? Welche Gedanken hast du?
Schatzkästchen gestalten: Es kann den Feststellungen in den Schatzkästchen nachgegangen werden und somit die Collage durch die eigenen Wahrnehmungen der Schüler*innen ergänzt werden. Die Schatzkästchen können befüllt werden mit zu den Impulsen passenden Bildern, symbolhaften Farben oder durch Worte oder Erzählungen. Fragezeichen nachspuren: Das meditative Nachspuren des Fragezeichens eröffnet die Möglichkeit, der Buntheit von Fragen durch Farben Ausdruck zu verleihen.
Bildarbeit: Ein Bild auswählen und ein Element (Tier, Mensch, Wasser …) sprechen, erzählen, fragen … lassen.
6 | … und noch mehr Ideen
Zum Fragen anregen: Karten mit Fragewörtern auflegen und so das Fragen und miteinander und mit Gott (auch über Fragen) Kommuni-
zieren anregen, z. B. indem Fragen in ein Gebet einbezogen werden. Fotos und Dinge sammeln und ein Plakat oder Legebild gestalten: Mitbringen von „etwas Besonderem“ (u.a. auch Symbole). Das können sowohl besonders tolle Dinge sein (wunderbare Blumen usw.) oder Fotos von besonders schönen Orten, Dingen die man gefunden hat (Steine usw.), aber auch negativen Dingen, die einen traurig machen oder nicht auf den ersten Blick schön sind. Diese können gemeinsam betrachtet werden, wodurch Gespräche entstehen und Fragen auftauchen und u.a. Perspektiven sichtbar werden.
Arbeitsblatt „Mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen“: Die Welt, in der wir leben. Was ich höre, was ich sehe, was ich schmecke, was ich fühle … (Auge, Ohr, Hand …) über verschiedene Stationen wahrnehmen und auf dem Arbeitsblatt z. B. durch Zeichnungen oder Wörter festhalten. Folgende Stationen wären u. a. möglich:
Sehen: Durch eine Lupe Naturmaterialien betrachten
Hören: Geräusch-Memory: Unterschiedliche Materialien in Überraschungseier einfüllen (von jedem Material zwei Eier) und wie ein Memory spielen lassen
Schmecken: Obst und Gemüse kosten und erraten
Riechen: Unterschiedliche Gewürze (Zimt, Anis, Fenchel, Orangenschale, Weihrauch, Lavendel, Minze, Oregano, Kümmel, Erde …) in Gläschen füllen und erraten lassen
Tasten: Unterschiedliche Materialien in Stoffsäckchen oder Schachteln füllen und ertasten lassen.

7 | Kinderbücher
Bone, E. (2016). Aufklappen und Entdecken. Unsere Erde. Usborne.
Damm, A. (2012). Frag mich! Moritz.
Damm, A. (2003). Ist 7 viel? Moritz.
DeWitt, D., Grove, Ch. (2021). Hallo Gott, kann ich dich mal was fragen? Tom und Laura finden Antworten auf knifflige Fragen. Gerth Medien.
Jeffers, O. (2018). Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde. NordSüd.
Kässmann, L., Walczyk, J. (2020). Der kleine Waschbär fragt nach Gott. bene.
8 | Lieder
Du bist da wo Menschen leben LB „Du mit uns“ Nr. 519
Jeder Tag ist ein Geschenk LB Religion Nr. 50
9 | Schnappschüsse



Die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen
➜
Stationenlernen
Bunt die Welt, voll das Herz
Seiten 26 und 27 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite richtet den Fokus auf die Fragen rund um die Natur, auf die bunte Welt und das staunende und dankbare Wahrnehmen und Annehmen all dessen, was uns geschenkt und zugleich auch anvertraut ist. Es lädt ein, in „Resonanz” zu gehen (Rosa), Beziehung aufzunehmen gegen alle mögliche Entfremdung. Der Herbst spiegelt dies als ganz besondere Jahreszeit wider, auch mit seiner ganzen Fülle an Farben, Buntheit, an Früchten, die geerntet werden. Menschen, Pflanzen, Tiere – alles gehört zusammen und ist miteinander verwoben – „Connectedness” (Hüther). Gerade in unserer Zeit wächst auch bereits bei Kindern ein starkes Bewusstsein dafür, dass vieles in unserer Welt, Mitwelt, Umwelt gefährdet ist, besonderen Schutz braucht und alles miteinander verflochten, kostbar und schützenswert ist.
Ausgehend von Franziskus, diesem besonderen Heiligen aus Assisi, wird dem Gedanken und der Erfahrung Raum gegeben, dass alles, was lebt, dass Menschen, Tiere und Pflanzen Geschwister sind und dass wir einander anvertraut sind, weil alles von Gott geschenkt wird. So wird nochmals der Blick vom zunächst Vordergründigen auf das Hintergründige gelenkt. So kann die Schöpfung wie bei Franziskus als einziger Lobgesang betrachtet werden bzw. Lob und Dank herausfördern. Dadurch öffnen sich Frageräume hin zu vielen Themen rund um die dankbare Wertschätzung der Schöpfung und der Geschöpfe, Bewahrung der Schöpfung, Erntedank u. v. m. Die Welt als Schöpfung kann so als „Fingerabdruck Gottes” (E. Cardenal) gelesen werden.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … die Buntheit der Menschen, der Natur, was sie zum Staunen bringt, ihre Fragen und wofür sie dankbar sind.
… die Buntheit des Herbstes in der Umgebung. verstehen und deuten … jede und jeden als einzelnen Teil der Schöpfung.
… Franziskus’ Gedanken über die geschwisterliche Verbundenheit von Menschen, Tieren, Pflanzen. gestalten und handeln
… mit Naturmaterialien.
…etwas für die Natur tun. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Dankbarkeit für die Schöpfung ausdrücken.
… Ideen zur Bewahrung der Schöpfung.
… Ideen, um geschwisterliche Verbundenheit zu leben. entscheiden und mit-tun
… das Staunen, Danken und Fragen kreativ zum Ausdruck bringen durch Singen, Beten, Legearbeiten usw.
3 | Lernanlässe
★ Schönheit und Buntheit des Herbstes und der Natur (Schulgelände, Parks, zu Hause …)
★ Gedenktag Hl. Franziskus und Welttierschutztag 04.10.
★ Erntedankfest
★ Freude an der Natur, an den Tieren (Haustiere, Nutztiere)
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Foto „Hand und Ähren” nimmt wie mit einer Lupe das Kostbare und Geheimnisvolle dieser Kornähren in den Blick. Die Hand, die achtsam über das Korn streicht, lädt ein, selber achtsam und mit allen Sinnen die Natur wahrzunehmen und lässt die Gedanken und Fragen rund um das Staunenswerte und Kostbare entstehen.
Der Text vom Raben Felix lädt ein, auf das Selbstverständliche zu schauen. Achtsam wahrzunehmen was ist. Die Worte von Max verweisen vom Vordergründigen auf das Hintergründige, nämlich, dass die Getreideähren auf etwas Großes verweisen, dass in ihnen etwas vom Wunder des Lebens zu erahnen ist. Felix stellt mit seiner Reaktion in den Raum, dass das Wachsen und Werden für ihn Grund zum Staunen und Danken ist. Der Gedanken- und Frageraum für die Assoziationen der Kinder ist eröffnet. So kann der Text zum Lernanlass werden.
Die Schatzkästchen öffnen Räume, die die Kinder einladen, zu überlegen und zu fragen, inwiefern Elemente der Schöpfung für sie Geschwister sein können. Welche Geschöpfe ihnen besonders nahe und wichtig sind, Brüder und Schwestern sind …
Das Bild „Vogelpredigt” entstammt einem Kinderbuch (siehe Kinderbuch) und zeigt den heiligen Franziskus (1181–1226) und seine Predigt, die er den Vögeln hält. Die Legende erzählt, dass Franziskus unterwegs mit seinen Gefährten im Tal von Spoleto einer Vogelschar begegnet, die ihm aufmerksam zuhört. Er ermutigt seine „Brüder und Schwestern”, ihren Schöpfer zu loben und zu lieben, weil Gott sie besonders liebt und schützt. Schließlich segnet er sie und die Vögel antworten mit einem vielstimmigen Gesang. Franziskus und viele Legenden um ihn eröffnen einen Resonanzraum und laden ein, zu überlegen, inwiefern man mit der Natur in Beziehung und Kommunikation gehen kann, was Kindern oft sehr nahe liegt, und sie nicht nur beiläufig erleben.
Der QR-Code führt zu Informationen über den heiligen Franziskus, wer er war und was ihn besonders auszeichnet, was wir von ihm lernen können.
Der Satz „Menschen, Tiere Pflanzen …“ regt zum Nachdenken und Fragen an, in welchem Verhältnis der Mensch zu den Tieren, Pflanzen … seiner Umwelt steht. Durch das in Frage gestellte „unsere Geschwister” ist bereits eine Zugangsmöglichkeit angeboten, nämlich die des heiligen Franziskus.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
„Ein Kürbis in der Kirche“ vorlesen und besprechen (siehe Erzählvorlage unten).
Erntedankfest besprechen, vorbereiten, mitgestalten, mitfeiern: Über die Buntheit des Herbstes und die Freude über eine gute Ernte sprechen. Es kann auch darüber nachgedacht werden, warum für eine gute Ernte gedankt wird und warum dieser Dank an Gott gerichtet wird.
Leben des heiligen Franziskus erzählen: Wichtige Informationen (siehe Infotext unten) vermitteln.
Legende von der Vogelpredigt erzählen und besprechen (siehe Text unten).
Sonnengesang vertonen: Zu den einzelnen Bildern Klänge mit OrffInstrumenten finden. Mögliche Klänge: Sonne: warme Töne, Mond: kalt klingender Ton, Sterne: Glockenspiel … (Gemeinschafts-)Bild zum Sonnengesang gestalten (siehe Arbeitsblatt unten): Für diese Gestaltung bietet es sich an, entweder das Lied im Vorhinein anzuhören und die Schüler*innen dann in Gruppen je eine Strophe gestalterisch verarbeiten zu lassen oder das Lied anzuhören und nach jeder Strophe stoppen, damit die Felder von den Schüler*innen ausgefüllt werden können. Davor ist es ratsam zu besprechen, um was es in der jeweiligen Strophe geht.
Nachdenken über die Geschwisterlichkeit aller Lebewesen: Sind alle Lebewesen Geschwister? Was bedeutet das, würde dies für unser Leben bedeuten?
Dinge, für die wir dankbar sind, gestalten: Für Plakat, Heftarbeit oder als Kirchendeko zu Erntedank.
6 | … und noch mehr Ideen
Sonnengesang singen: Beispielsweise bei einer Schulerntedankfeier (oder die Kinder in die Kirche einladen).
Gegenstände und Fotos vom Erntedankfest: Mitbringen, an-


schauen und ein Plakat oder eine Wand gestalten. Es kann auch ein Erntedankkörbchen gebastelt werden. Erntedanktisch aufstellen: In der Schule (z. B. in der Aula oder an einem präsenten Ort) einen Erntedanktisch aufstellen. Dort können z. B. haltbare Lebensmittel für Bedürftige gesammelt werden.
Unsere „Geschwister“ gut behandeln: Etwas tun, was der Sichtweise, dass alle Lebewesen Geschwister sind, was unserer Erde zugutekommt. Beispiele wären ein Vogelhaus im Schulhof aufzustellen, Mistkübel mit Danke-Plakaten beschriften, Müll einsammeln usw.
7 | Kinderbücher
Gaisbauer, H., Heiksel, B. (2017). Franz von Assisi. Tyrolia.
Visconti, G., Landmann, B. (2003). Franziskus und Klara. Eine Geschichte aus Assisi. Hans-Nietsch.
8 | Lieder
Danke, o Lord LB Religion Nr. 265
Höchster, allmächtiger und guter Gott LB Religion Nr. 140
In jeder Blume LB Religion Nr. 11
Laudato Sii LB Religion Nr. 13
Schwester Sonne T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse











Der Sonnengesang des heiligen Franziskus
Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus
… f ü r Schwester Sonne , sie strahlt und lacht vom Himmel für Bruder Mond und die Sterne , sie erhellen die Nacht … für Bruder Wind und die Luft , sie schenk e n uns Atem … für Schwester Wasser , das erfrischt und Leben schenkt … Guter Gott, wir singen dir Lieder. Unsere Welt ist so wunderbar! Wir danken dir und loben dich …
… für Bruder Tod u nd für neues Leben

… für Menschen , die sich entschuldigen und einander verzeihen..
… für Mutter Erde , mit allen Blumen und Früchten..
… für Bruder Feuer , das stark und kräftig ist und uns wärmt.
Die Legende von der Vogelpredigt
Die Legende von der Vogelpredigt
Eine Erzählung zum heiligen Franziskus von Assisi
Eine Erzählung zum Heiligen Franziskus von Assisi
Franziskus zog mit seinen Brüdern durch die italienische Landschaft. Er atmete die wunderbare Luft ein. Es duftete nach Wiese und Kräutern. Da kamen sie auf eine Wiese und staunten. Eine große Schar Vögel war da versammelt. Ganz unterschiedliche: Tauben und kleine Krähen und viele andere. Größere und kleinere, bunte und weniger bunte Vögel…
Als Franziskus sie bemerkte, strahlte er und lief auf sie zu. Er spürte eine große Liebe zu diesen wunderbaren Geschöpfen in seinem Herzen. Es war erstaunlich, dass die Vögel, obwohl sie ihn bemerkten, nicht wie sonst normalerweise auf und davon flogen. Da war Franzis kus sehr glücklich und sagte: „Ich bitte euch, hört mir zu, liebe Vögel! Wir sind doch alle Geschwister. Ich will euch von Gott erzählen.“ Und er fnn n den Vneln vo nguen vuu zg erzählen. Und er nuee „Meine lieben Geschwister Vögel! Denkt daran, dass Gott euch geschaffen hat und euch lieb hat. Ihr sollt ihn dafür loben und ihn lieb haben. Er hat euch Federn als Gewand gegeben und Flügel, damit ihr fliegen könnt. Die Luft ist für euch wie ein Zuhause. Ihr braucht nicht zu säen und nicht zu ernten. Got t sorgt für euch und schützt euch, ohne dass ihr euch um etwas kümmern müsst.“ Bei diesen Wv r uen zwiu cher uen gnd jgbeluen die Vnel gf ihre Ar u . Sie fnnen n n die äl e zu strecken, die Flügel auszubreiten, die Schnäbel zu öffnen und schauten Franziskus an. Er aber spazierte mitten im Vogelschwarm auf und ab, wobei seine Kutte ihnen über Kopf und Körper streifte. Dann segnete er sie.
„Nun könnt ihr wieder in die Luft fliegen und euch vom Wind treiben lassen.“
Dann gingen auch Franziskus und alle anderen weiter. Sie waren froh und dachten noch lange über das nach, was geschehen war.
Die Legende von der Vogelpredigt nach Thomas von Celano, Erste Vita 58; Übersetzung Anton Rotzetter http://franciscan-compassion.org/index.php/franziskus-predigt- tieren.html

Die Lebensgeschichte des Franziskus von Assisi
Franziskus wurde entweder 1181 oder 1182 als Sohn reicher Kaufleute geboren. Sein Vater Pietro Bernadone war ein Tuchgroßhändler. Die Familie Bernadone gehörte aufgrund ihres erwirtschafteten Reichtums zum aufstrebenden Bürgertum der Stadt Assisi.
Jugend in Assisi
Franziskus wollte zunächst das elterliche Unternehmen übernehmen. Eine der Voraussetzungen dafür war eine gewisse Schulbildung. So lernte er das kaufmännische Latein und auch Französisch, da sein Vater geschäftliche Kontakte nach Südfrankreich pflegte. Franziskus genoss das Leben in finanzieller Sicherheit. Aufgrund des Reichtums der Familie konnte er mit seinen Freunden in Unbeschwertheit rauschende Feste feiern oder in Sachen Mode einen extravaganten Geschmack ausleben, indem er hin und wieder die unterschiedlichsten Stoffe in einem Gewand kombinierte.
Franziskus war ein ganz normaler junger Mann mit altersentsprechenden Interessen. Sein großer Traum war, in den Stand des Adels erhoben zu werden. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sollte der Ritterschlag werden.
Kriegsjahre
1198 lehnte sich die Bürgerschaft von Assisi gehen den Adel der Stadt auf, der – in den Augen der Bürger – viele ungerechte Privilegien genoss. Die Adeligen mussten in die benachbarte Stadt Perugia fliehen. Dadurch kam es im Jahr 1202 zum Krieg zwischen Perugia und Assisi.
Franziskus beteiligte sich an den Auseinandersetzungen und wurde gefangengenommen. Vermutlich über ein Jahr musste er in Gefangenschaft ausharren. Als er nach Hause zurück kam, war er – im Kerker krank geworden – nicht mehr derselbe wie vorher. Er war ernster, ein suchender Mensch geworden. Trotz allem brannte nach einiger Zeit wieder seine Leidenschaft für das Rittersein auf, und er schloss sich einem Feldzug nach Apulien an. In Spoleto, nicht weit von Assisi, hatte er jedoch einen Traum, in dem ihn Gottes Stimme zur Umkehr bewog. So ritt Franziskus zurück nach Assisi, wo ihm wohl viel Spott und Unverständnis entgegenschlug.
Auf der Suche
Von nun an zog er sich oft zurück in Wälder und an einsame Orte, um zu beten und nach Gottes Willen zu fragen. Das Evangelium wurde für sein Tun Richtschnur. An ihm richtete er von nun an sein gesamtes Leben aus.
1206 hatte er zwei prägende Erlebnisse. Als am meisten bedeutsam nannte er am Ende seines Lebens die Begegnung mit einem Aussätzigen (einem Leprakranken). Um sein eigenes Leben zu schützen, hatte er die Leprakranken bisher gemieden. Doch eines Tages wurde ihm der Mut geschenkt, auf einen Leprosen zuzugehen, ihn zu umarmen und ihm den Friedenskuss zu schenken. Diese Begegnung wurde für ihn im Nachhinein zum Augenblick seiner Bekehrung auf Gott hin.
Ein zweites wichtiges Erlebnis ereignete sich, als Franziskus betend vor einer Kreuzikone in der zerfallenden Kirche San Damiano verweilte. Jesus sprach ihn vom Kreuz aus an und gab ihm den Auftrag, die zerfallene Kirche wieder aufzubauen. Das tat Franziskus – und er stellte im übertragenen Sinne noch viel mehr wieder her.
Zwischenzeitlich war es zum Bruch mit Pietro Bernadone – seinem Vater – gekommen, der das „verrückte“ Tun seines Sohnes nicht nachvollziehen konnte. So zog der junge Mann aus Assisi weg und lebte außerhalb, in der Nähe der Stadt.
Die Gemeinschaft
Ab 1209 schlossen sich ihm andere Männer an. Die ersten stammten aus seinem alten Freundeskreis und waren angesehene Bürger der Stadt. Es faszinierte sie, dass er – trotz häufigem Hunger (er lebte von Erbetteltem) – fröhlich und dankbar war. Sie spürten, dass dies nicht aus eigener Kraft kam, sondern dass er von etwas anderem getragen war. Und so begannen sie mit Franziskus das „Leben der Buße“ (Buße bedeutete für Franziskus die Hinkehr zu Gott). Sie nannten sich die Minderen Brüder – im Gegensatz zu den damals – wie heute – herrschenden Tendenzen, Macht auszuüben.
Als ihre Schar auf 12 Brüder angewachsen war, entschieden sie, nach Rom zu ziehen, um den Papst um die Genehmigung ihrer Lebensweise zu bitten.
Es gab zu dieser Zeit einige Gruppen, die, ähnlich wie die Minderen Brüder, arm und predigend umherzogen. Da diese sich oft abschätzig und urteilend gegenüber dem Klerus verhielten (die Kritik war sicher nicht immer unberechtigt, da es teilweise verheerende Missstände in der Kirche gab) und es auch zu Überfällen auf kirchliche Amtsträger kam, wurden diese Gruppierungen mit großer Härte verfolgt. – Es war Franziskus aber ein Anliegen deutlich zu machen, dass er nicht gegen die Amtskirche, sondern mit ihr die frohe Botschaft Jesu Christi verkündigen wollte. Nach einigem Zögern bestätigte Papst Innozenz III. die kleine Brüdergemeinschaft und gestattete ihr das Wanderleben und die Bußpredigt. Die Gemeinschaft breitete sich nach und nach aus. Immer mehr Brüder kamen dazu. Durch Missionsreisen in andere Länder – auch über die Alpen nach Deutschland – schlossen sich der Brudergemeinschaft auch in jenen Ländern neue Mitglieder an.
Dieses rasche Wachstum hatte aber auch Schattenseiten. Franziskus, der – wie Jesus – keinen Besitz haben wollte, war auf Dauer gezwungen, Häuser bauen zu lassen, da seine Gemeinschaft schon zu seinen Lebzeiten auf mehrere tausend Brüder angewachsen war. Und nicht jeder dieser Brüder konnte (und wollte) die in seinen Augen harten Bestimmungen der Ordensregel einhalten. So kam es zu Reibereien und Auflehnung gegen Franziskus, die ihn in eine große Krise stürzten. Er befürchtete, alles falsch gemacht zu haben. Eigentlich war es ja nie in seinem Sinne gewesen, einen Orden zu gründen.
Schwere Jahre
Zu dieser seelischen Belastung erkrankte Franziskus über die Jahre hinweg auch körperlich schwer. Man vermutet, dass er sich auf einer Missionsreise ins Heilige Land mit Malaria infiziert hat. Er litt an einer schweren Augenkrankheit, die ihn langsam er-
blinden ließ, und seine Organe waren – auch durch seine strenge Askese – krank geworden. Franziskus erlebte eine lange Leidenszeit und auch manche dunkle Stunde, in der er um seinen Glauben rang.
Weihnachten in Greccio
Zu Weihnachten 1223 feierte Franziskus die Menschwerdung Jesu Christi in einer nie dagewesenen Weise. In Greccio, einem kleinen Dorf in den Bergen, veranlasste Franziskus ein Krippenspiel zusammen mit den Dorfbewohnern. Ihm haben wir unsere heutige Weihnachtskrippe zu verdanken.
Die Stigmatisation
Im September 1224 hält sich Franziskus auf dem Berg La Verna – nördlich von Assisi – auf. Dort empfängt er am 17. September die Wundmale Christi. Er versucht sie zu verbergen; nur seine engsten Getreuen wissen um dieses Ereignis.
1226 verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Franziskus zusehends. Die immer blutenden Wundmale und auch seine beständige Askese (am Ende seines Lebens entschuldigte sich Franziskus bei seinem Leib, er sei zu hart mit ihm umgegangen) wirkten sich nicht förderlich auf den sowieso schon durch Krankheit geschwächten Mann aus.
Vollendung
Am Abend des 3. Oktober 1226 stirbt Franziskus, umringt von seinen treuesten Mitbrüdern, bei der Kirche Portiuncula.
4. Oktober 1226: Franziskus, der schon zu Lebzeiten im Volk als Heiliger verehrt wurde, wird vorübergehend in der Kirche San Giorgio in Assisi beigesetzt. Zwei Jahre später erfolgt seine tatsächliche Heiligsprechung durch Papst Gregor IX.
1230 wird der Leichnam von Franziskus in der neu errichteten Basilika San Francesco in Assisi beigesetzt.
Die „Lebensgeschichte des Franziskus von Assisi“ http://www.franziskanerinnen-gengenbach.de/index.php/franziskus-von-assisi

Ein Kürbis in der Kirche
Ein Kürbis in der Kirche
Eine Erzählung zum Erntedank
Eine Erzählung zum Erntedank
Klaus trägt eine große Tüte. Man sieht, dass sie schwer ist. „Was schleppst du denn da?“, fragt Volker. Klaus setzt die Tüte vorsichtig ab und antwortet: „Dreimal darfst du raten.“ „Hm, sieht aus wie ein großer Fußball“, meint Volker, „aber der ist ja nicht so schwer!“ Klaus lacht: „Das ist es auch nicht. Es ist ein Kürbis.“ „Ein Kürbis?“, ruft Volker überrascht. „Warum trägst du den denn spazieren?“ „Den bring ich in die Kirche.“ „Du heiliger Bimbam! Wohin?“ „In die Kirche. Morgen ist doch Erntedankfest.“
Ja, Volker erinnert sich. So etwas stand auf dem Kalender. Und ihm fällt ein, dass an diesem Tag viele Leute in die Kirche gehen. Aber was in aller Welt soll der Kürbis in der Kirche? Klaus versucht es ihm zu erklären: „Beim Erntedankfest danken wir doch Gott dafür, dass er uns eine gute Ernte geschenkt hat. Und als Dank dafür bringt jeder etwas davon mit in die Kirche. Ich bringe eben den Kürbis. Warum nicht?“
„Was soll denn die Kirche damit? Die braucht doch keinen Kürbis.“ „Nein, die Kirche nicht. Aber alle Früchte, die am Erntedanktag den Altar geschmückt haben, werden nachher an Leute verteilt, die selber nichts haben und sich auch nicht so viel kaufen können.“ Das leuchtet Volker ein. Aber als Klaus weitererzählt, wie sie in der Kirche Gott loben, weil er alles hat wachsen lassen und weil er die Sonne und den Regen geschickt hat, protestiert er: „Aber manchmal ist das Wetter ganz verkehrt. Dann ist es zu trocken. Und wenn wir dann im Garten nicht gießen, dann geht alles ein. Aber ich muss gießen oder Mama oder Papa, das macht Gott doch nicht. Oder hast du Gott schon mal mit der Gießkanne gesehen?“
Klaus muss lachen. „Gott kann man doch nicht sehen. Aber wenn er nicht will, dass etwas wächst, dann könnt ihr so viel gießen, wie ihr wollt. Es kommt trotzdem nichts.“
„Wenn ich nicht will, dass etwas wächst, kommt auch nichts…“ „Wieso?“ „Na, wenn ich deinen Kürbis ausgerissen hätte, als er noch ganz klein war, was dann? Der wäre nicht weitergewachsen. Da hätte Gott sonst noch was machen können.“ „Ja. Rausreißen kannst du. Aber wachsen lassen nicht.“
„Na gut, das stimmt vielleicht“, sagt Volker. „Aber trotzdem verstehe ich nicht, was Gott damit zu tun haben soll. Schließlich wächst alles von allein, wenn es nur die richtige Erde hat und schön begossen wird.“ „Ich glaube aber, dass Gott dabei hilft. Und dafür bedanke ich mich morgen.“
„Naja, schließlich kann jeder glauben, was er will“, meint Volker, „ich gehe jedenfalls morgen nicht in die Kirche…“ „…aber soll ich dir deinen Kürbis tragen helfen?“
Eine Erzählung zum Erntedank
Gisela Schütz, in: Vorlesebuch Religion 3. Lahr/Schwarzwald: Kaufmann, Vandenhoeck & Ruprecht, Patmos, Kohlhammer 1992.

Alles in Gottes guter Hand
Seiten 28 und 29 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite führt nochmals etwas tiefer und auch direkter zur Frage nach dem Ursprung der Schöpfung und damit zur Frage nach dem Schöpfer in der jüdisch-christlichen Tradition: Woher? und Warum? = Sinn der Schöpfung. Es tun sich damit viele Fragen auf: Woher kommt alles und woher kommen wir? Gibt es eine gute Hand, die alles liebevoll will und Vertrauen erweckend wider alle Angst trägt? Oder sind wir rettungslos verloren, ausgeliefert einem Schicksal, das wir nicht kennen? Damit sind wir bei ganz zentralen Fragen des Religionsunterrichtes und unseres Menschseins. Die biblische Tradition lädt ein, hinter all dem, dem Gott der Schöpfung zu erahnen, diesem guten Schöpfergott zu vertrauen, aus dessen Hand alles stammt, der alles liebevoll erdacht hat und uns Menschen als sein Abbild geschaffen hat, die ganze Schöpfung mit seinem mütterlichen Geist durchatmet und am Leben erhält. Fragen und Suchen, Wahrnehmen mit allen Sinnen und Erforschen bis hin zum Schauen auf das, woraus glaubende Menschen ihr ganzes Vertrauen und ihre Hoffnung beziehen: Alles ist in Gottes guter Hand. Diese Doppelseite lädt die Lehrperson und die Kinder ein, sich anfanghaft auf die Reise zu den größten Fragen der Menschheit hineinzubegeben und staunenswert mit wachen Augen und Herzen Neues zu entdecken und den geheimnisvollen Tiefengrund der Welt zu erspüren und sich daraus resultierend auch der Frage nach Gott zu stellen. Aus einer solchen gelingenden Auseinandersetzung kann ein Vertrauen erwachsen, das tief in diesen Erfahrungen des Geschenkund Gnadenhaften allen Lebens wurzelt, das durch das ganze Leben tragen kann und darüber hinaus.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Wissen über die Welt. verstehen und deuten
… Gott als verbindendes Element.
… die Schöpfung als etwas Gutes, trotz offener Fragen. gestalten und handeln
… ein Dankes- oder Schöpfungsplakat gestalten.
…Bilder betrachten.
(be-)sprechen und (be-)urteilen
… Fragen nach dem Woher und Warum.
… Fragen nach Mensch und Gott.
… was sie faszinierend finden. entscheiden und mit-tun
… (Mit-)Verantwortung für die Schöpfung übernehmen.
3 | Lernanlässe
★ Eigene Erfahrungen in der Natur (Schöpfung)
★ Aktuelle Anlässe von Gefährdungen
★ Fragen der Kinder nach dem Ursprung der Welt (u.a. in Form von Gedanken des Raben Felix)
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Im Text vom Raben Felix stellt er eine Frage, die sich aus dem einfachen Schauen und Wahrnehmen dessen ergibt, was uns umgibt. Er tut damit das, was Kinder tausendfach tun und womit sie Eltern und andere begleitende Menschen oft überraschen und herausfordern. Felix stellt damit einen Lernanlass her.
Der Bibeltext „Gott sah alles an…“ (Gen 1,1.31a) ist ein Teil des großen Schöpfungsliedes, das die Bibel eröffnet und die bildnerische Kunst, aber auch in der Musik viele Menschen inspiriert hat. In diesem Text (Mythos), diesem Schöpfungslied, steht ursprünglich nicht die Frage nach dem Wie der Weltentstehung im Mittelpunkt. Es ist kein Text, der ein Problem der Naturwissenschaft klären will (Logos). Der historische Hintergrund der Entstehung dieses Textes ist eine Erfahrung, die auch Kindern und Erwachsenen unserer Zeit vertraut ist: Es ist die Erfahrung, dass die Welt bedroht ist, dass Leben und Schöpfung gefährdet sind. Die Erfahrung des Exils, in der alles in Frage gestellt ist und das Vertrauen, dass alles gut wird, schwer fällt, lastet schwer auf den Menschen. Und da hinein erinnert dieses Schöpfungslied daran, dass von Urbeginn her und bis in alle Zeit eine gute Hand, ein liebender Blick, ein wirkmächtiger Gott Welt und Mensch in seinen guten Händen hält. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und sah, dass es gut war. Sehr gut. Das Schauen auf diesen Anfang kann wie ein Vorwort das Vertrauen stärken, dass diese guten Hände Gottes weitertragen und begleiten. Das Bild „Schöpfung” stammt vom Künstler Esben Hanefelt Kristensen. Staunenswert wird die ganze Schöpfung in Anlehnung an die Texte des Buches Genesis 1 (Schöpfung in sieben Tagen) und Genesis 2–3 (Erschaffung des Menschen, Paradies, Baum der Erkenntnis) ins Bild gebracht und interpretiert. Die unendliche Vielfalt des Lebens, das Geheimnisvolle und die Zauberhaftigkeit wird vor Augen geführt. Es kann – als Wimmelbild gestaltet – die Phantasie und die Gedanken der Kinder anregen. Es gibt viel zum Schauen und zum Entdecken. Es kann einerseits einladen, Bekanntes zu erzählen, aber andererseits neugierig machen, Fragen zu stellen und miteinander ins vertiefende Gespräch zu kommen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Wimmelbild gemeinsam entdecken: Welche Farben, Formen, Figuren sind zu sehen? Was könnten die Tiere und Menschen im Bild denken, sprechen, fühlen …?
Wimmelbild gestalten: Mit Buntstiften oder Ölkreiden das für mich besonders Staunenswerte und Wertvolle an Gottes Schöpfung malen, die Bilder können dann in der Klasse oder im Schulhaus, als großes Wimmelbild zusammengefügt, die Buntheit der Schöpfung ausdrücken.
Perikope als Klanggeschichte erzählen: Verse der Perikope Gen 1 (in Auswahl) erzählen und mit Orff-Instrumenten zum Klingen bringen.
Arbeitsblatt „Alles ist gut“: Die Schöpfungstage mit Farben und Materialien (Klebepunkt, Watte, …) kreativ gestalten.
Schöpfungseinheiten wahrnehmen: Die einzelnen Tage des Schöpfungsliedes mit Bildern auflegen lassen. Zu den Tagen Instrumente suchen und Klänge, die dazu passen, ausprobieren (Orff-Instrumente, Stimme, Körpergeräusche).
Spiel „Mmmh, das schmeckt“: Kleine Kostproben werden in Stückchen vorbereitet (Apfel, Brot, Karotte, Essiggurke, Mais, Käse, Kuchen, Weintraube …). Die Kinder dürfen nacheinander die Augen verbinden, verschiedene Speisen kosten und sollen erraten, was es ist.
6 | … und noch mehr Ideen
Schöpfungsbilder gestalten: Mit Ölkreiden, Wasserfarben, weiteren Materialien alleine oder in der Gruppe zu einzelnen Elementen des Schöpfungsliedes großflächig Bilder entstehen lassen. Ist auch als Gemeinschaftsarbeit von mehreren Kindern möglich. Heftarbeit „Ich und die Welt“: Ein Bild von sich ins Heft zeichnen. Mögliche Überschriften könnten wie folgt lauten: „Gott hat mich wunderbar geschaffen”, „Ich, am schönsten Ort der Welt” usw. Legebild zu den Schöpfungstagen gestalten
Waldausflug: Die Schüler*innen können im Wald die Herrlichkeit der Schöpfung entdecken. Anhand der Vorlage (siehe unten) werden sie zu verschiedenen Wahrnehmungen angeleitet. Auch das gemeinsame Spielen im Wald hat einen positiven Effekt auf die Erkenntnis der Schönheit der Natur.
7 | Kinderbücher
Damm, A. (2018). Was wird aus uns? Nachdenken über die Natur. Moritz.
Hornung, H. (2000). Lalu und die Schöpfung. rex.
Kasuya M., Kageyama A. (2015). Schöpfung. Lutherische.
Oberdieck B., Griebler L. (1986). Die Erde ist dein Haus, der Himmel ein Fenster. Von der Entstehung der Welt. ars edition.
Schwarz, A., Schmidt, X. (2011). Die Schöpfungsgeschichte. Herder.


8
| Lieder
Du gibst uns die Sonne T. von R. Krenzer, M. von D. Jöcker
Du hast uns deine Welt geschenkt T. von R. Krenzer, M. von D. Jöcker
Er hält die ganze Welt LB Religion Nr. 53
Gottes Handschrift T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Gottes Liebe ist so wunderbar LB Religion Nr. 17
Sag mal danke T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Wir loben dich, Herr unser Gott LB Religion Nr. 161
Wunderschön ist diese Erde T./M. v. S. Reitlinger: www.musikager.at; Nr. 2 im HB-Anhang
9 | Schnappschüsse


Im Wald die Schöpfung entdecken
Im Wald die Schöpfung entdecken
Anhand von verschiedenen Stationen kann der Lebensraum Wald für Schüler*innen gut erfahrbar gemacht werden. Bei einem gemeinsamen Spaziergang zum Wald kann die Lehrperson mit folgenden Sätzen die Aufmerksamkeit der Kinder auf die verschiedenen Sinneserfahrungen lenken. Anschließend können die Erfahrungen ausgetauscht werden.
Zwischen Schule und Wald gehst du über unterschiedliche Bodenarten.
Was fällt dir auf? Wie fühlen sich diese Böden an?
Such dir im Wald einen Platz und sei ganz leise. Schließe deine Augen.
Welche Geräusche kannst du wahrnehmen?
Fühle den Waldboden mit deinen Händen.
Was kannst du auf dem Boden ertasten?
Was ist das Kleinste, das Weichste, das Spitzeste …?
Umarme einen Baum.
Was könntest du ihm sagen? Was könnte er dir sagen?
Suche dir ein paar Dinge mit unterschiedlichem Geruch.
Such dir ein Kind, das diese Dinge mit geschlossenen Augen riechen möchte. Vielleicht kann das Kind erraten, was du entdeckt hast.
Suche dir einen Baum und ertaste die Rinde des Baumes.
Was ist an der Rinde „deines“ Baumes ganz besonders? Was spürst du?
Im Wald die Schöpfung entdecken Handbuch zum Schatzbuch Religion 1

Die Welt in Gottes guter Hand
Noach sieht im Regenbogen: Gott ist treu für immer
Seiten 30 und 31 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Immer wieder holen stürmische Zeiten uns Menschen ein und selbst Kinder bleiben vor diesen Wirren und Stürmen nicht verschont. In solchen schwierigen Zeiten stellen sich Fragen wie: Wem kann ich vertrauen? Was trägt in diesen Zeiten? Worauf kann ich meine Hoffnung bauen, wenn alles zusammenzubrechen scheint, wenn die Wasser des Lebens bedrohlich über mich hereinstürzen und nirgends Schutz und kein „Obdach für die Seele” (Zulehner) zu finden ist? Die auch erschreckenden Seiten des Lebens dürfen und können nicht ausgeblendet werden, wenn man die Kinder und ihre Erfahrungen ernst nehmen will, denn zum Teil sind diese oft selbst von solchen Erfahrungen betroffen oder sie kennen sie aus ihrem Umfeld bzw. auch aus den Medien. Zugleich braucht es hoffnungsvolle Erzählungen, die das Fragen und Suchen nach Antworten in eine Vertrauen erweckende Richtung zu lenken vermögen bzw. die Seele der Kinder wider alle Angst nähren können. Es braucht dazu die vielen Mythen und Geschichten. Die Erzählung von Noach und der rettenden Arche kann eine solche sein, die gleichzeitig auch viele Fragen aufwirft. Sie erzählt davon, wie sich Gott mit den Menschen verbündet und sich zu Rettung und Segen verpflichtet. Aber ein Bund ist immer gegenseitig. So bindet sich auch der Mensch an Gott. Das Wie wird an der Gestalt des Noach sichtbar: ein Mensch, der achtsam (gerecht) und hörend Gott gegenüber ist, das Unheil spürt, das auf die ganze Schöpfung zukommt, die Warnungen ernst nimmt und den Willen Gottes umsetzt.
Gerade menschliche Krisen und Lebensschicksale, die uns manchmal zu überfluten und gänzlich hinunterzuziehen drohen, zeigen, wie das Leben – oder auch unser Körper und unsere Seele – im religiösen Verständnis letztlich Gott selber – uns mit unterschiedlichsten Stimmen warnen und uns ermahnen, der Stimme des Herzens, wie wir es oft nennen, gegenüber achtsam zu sein. Gott lässt uns in der Not nicht allein, wir können seine Stimme hören und den schützenden Bogen erahnen bzw. sehen, der nach dem Unwetter am Himmel leuchtet. Rettung und Erlösung, Geborgensein und Gehaltenwerden sind durch Gottes Begleitung die Grundmuster dieser Welt.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben …die biblische Erzählung von Noach. verstehen und deuten …Notwendigkeit von Begleitung in stürmischen Zeiten. …Gott als Beistand für Gläubige in schwierigen Zeiten. gestalten und handeln
…einen Regenbogen.
…einen Regenbogen entstehen lassen.
(be-)sprechen und (be-)urteilen …was die Welt bedroht. …was in stürmischen Zeiten Hoffnung gibt. entscheiden und mit-tun …anderen in schwierigen Situationen helfen und damit ihr Leben wieder bunter machen.
3 | Lernanlässe
★ Notsituationen bei Kindern in der Klasse oder weltweit ★ Naturschauspiel Regenbogen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text „Gott spricht …“ fasst die zentrale Botschaft dieser Doppelseite zusammen. Abgeleitet vom Bibeltext Gen 9,12 wird die Botschaft Gottes an uns Menschen und seines Freundschaftsbundes, die sich im Regenbogen, aber auch in der Arche zeigt, in einfachen Worten zusammengefasst: Was auch immer geschieht in deinem Leben „Ich bin mit dir, selbst wenn die Zeiten noch so stürmisch sind“. Durch diese Zusage ergeben sich aber neue Fragen für die (möglicherweise leidvollen) Erfahrungen der Kinder oder ihrer Mitmenschen. Das Wimmelbild „Arche Noach“ von Esben Hanefeld Kristensen erinnert an die biblische Erzählung von der Arche, die wie eine bergende Nussschale geformt erscheint, die Noach, seine Familie, die ganz oben in der Arche dargestellt werden, und alle Tiere vor den das Leben bedrohenden Wassern schützt. Noach wird in der Oranten-Haltung, wie um Segen und Schutz betend, dargestellt. Die Taube, die später den Rückgang des Wassers und damit den Frieden anzeigen wird, auf seiner Schulter. Die Wassertiere schwimmen im Schutz der Arche außerhalb. Der Regenbogen im Hintergrund deutet die einkehrende Ruhe an. Dieses faszinierende Naturschauspiel kann nur entstehen, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Durch dieses Faktum verdeutlicht sich die biblische Botschaft, in welcher der Regenbogen eben ein Zeichen für die Verbindung zwischen Himmel und Erde und ein Symbol für den Bund Gottes mit den Menschen ist. Das Schatzkästchen regt an, nachzudenken, wer für die Schüler*innen eine wichtige Vertrauensperson ist. Wem vertraue ich? Wer ist mir besonders wichtig? Zu wem kann ich auch gehen, wenn es mir schlecht geht?
Der QR-Code führt zu einem Lied zum Thema Regenbogen. So wie der Regenbogen erst durch all seine Farben bunt wird, spielt auch unser Leben unterschiedliche Farben. Farben der Freude, Hoffnung, Dunkelheit, Trauer, Liebe, usw.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Noach-Perikope erzählen und nachspielen: Kinder sind jeweils Paare von Tieren und werden auf die Arche gerufen. Die Tische werden so zusammengeschoben, dass sie das Schiff darstellen. Beim Betreten dürfen die Schüler*innen die Laute der Tiere nachmachen. Es zeigt sich, dass die Arche voller Leben (= Lebewesen) ist. Zum Erzählen kann auch die Playmobilarche o. ä. verwendet werden. Schatzkästchen zum Vertrauen befüllen: Die Namen ihrer Vertrauenspersonen hineinschreiben, Unterschriften der Personen einholen, sie hineinzeichnen, Fotos einkleben … Schul- oder Klassen-Arche gestalten: Eine Arche mit Tierbildern sowie Fotos von den Kindern, Lehrer*innen, Eltern, Schulwart*innen gestalten.
Wimmelbildbetrachtung: Was siehst du? Welche Tiere entdeckst du? Was fällt dir auf? Was denkt das Tier? Was ist dein Lieblingsplatz auf diesem Bild?
Heftarbeit „Arche und Regenbogen”: Ggf. ein Ausmalbild von der Arche Noach sowie den Ausschnitt eines Regenbogens oder alternativ Papier zum Basteln einer Arche, des Regenbogens zur Verfügung stellen, damit die Schüler*innen eine Heftseite gestalten können. Nachdenken über Freundschaft: Wie sind Freunde? Was magst du an Freunden? Wie fühlt sich Freundschaft an?
Zum Lied „Regenbogen buntes Licht“ bewegen: Während das Lied angehört oder gesungen wird, können die Schüler*innen sich z. B. wie „rot” durch den Raum bewegen oder einzelne Strophen mit bunten Chiffontüchern visuell zum Ausdruck bringen.
6 | … und noch mehr Ideen
Regenbogen erzeugen: Mit einem Wasserschlauch in der Sonne einen Regenbogen erzeugen und besprechen, wie ein Regenbogen entsteht (Vernetzung: Sachunterricht).
Tiermemory spielen: Tierbilder an die Schüler*innen verteilen. Sie sehen sich die Kärtchen an und machen das jeweilige Geräusch des Tieres nach. Anhand dieses Geräusches müssen die Paare gefunden werden.
Regenbogenarmband basteln: Ein buntes Armband (aus Perlen, gedrehten Fäden, Papierstreifen usw.) kann als Freundschaftszeichen dienen und verschenkt werden.
Über die Folgen von Regen nachdenken : Warum ist es gut, wenn es regnet? Was passiert, wenn es (bei uns) zu viel regnet? Wann sieht man einen Regenbogen?
Tüchertanz zu den Farben des Regenbogens.
7 | Kinderbücher
Langen, A. (2021). Die Arche Noah. Herder.
8 | Lieder
Ein bunter Regenbogen LB Religion Nr. 149
Gottes Regenbogen über unserm Land LB Religion Nr. 148
Regenbogen, buntes Licht LB Religion Nr. 147



Mose hört im Feuer: Ich bin der ICH-BIN-DA
Seiten 32 und 33 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite lädt zu einer tieferen Auseinandersetzung und zu einem tieferen Verständnis und Kennenlernen von Gott ein. Durch die „Selbstoffenbarung Gottes: Jahwe”, wie es im Lehrplan im Anwendungsbereich A2 für die erste Schulstufe heißt, soll einerseits ein erstes Kennenlernen der zentralen jüdisch-christlichen Gotteserfahrung ermöglicht werden – ein Gott, der „herab steigt” zu den Menschen, ihre Not sieht, ihre Klage hört, seinen Namen als DERMIT-DIR kundtut und befreit – und andererseits ein Artikulieren der eigenen Erfahrungen und Fragen ermöglicht werden. So können sich die eigenen Lebenserfahrungen von Not und Hilfe, Alleingelassen und In-die-Arme-Geschlossen, Verzweifelt-Sein und Getröstet-Werden … mit der großen biblischen Tradition Knechtschaft und Befreiung durch JHWH verschränken, herausfordern, vertiefen. Die Offenbarung des Gottesnamens ist eingebettet in die Erzählung der Gottesbegegnung des Mose beim brennenden Dornbusch. Gott benutzt die mindere Dornenwelt, zerstört sie durch sein Feuer aber nicht, sondern bringt sie zum Leuchten. In der Stelle Ex 3,1–25 zeigt sich Gott als einer, dem die Menschen ein Anliegen sind, der Interesse an ihnen hat, der Auge und Ohr ist für Leidende, der Unterdrückte befreit und Menschen zum Befreien ruft. Gott gibt sich zu erkennen als einer, der für die Menschen da ist. Der Name „Ich bin der ICHBIN-DA” präsentiert ein Versprechen, welches über zeitliche Grenzen hinweg immer aktuell gültig bleibt. Gott umarmt den Menschen mit diesem Versprechen, auch wenn es nicht besagt, dass deshalb immer alles nur gut und schön ist. Gott ist auch in harten Zeiten und bei Herausforderungen da, auch wenn diese Zeiten hart und herausfordernd bleiben. Sich zu überlegen, wo und auch wie Gott im eigenen Leben anwesend sein könnte, ist ein weiterer Schritt, zu dem die Seite einlädt. Die Wärme, die vom Feuer ausgeht, kann gefährlich sein und für Verbrennungen sorgen, und gleichzeitig, hält man den richtigen Abstand zum Feuer ein, geht von ihm eine wohlige Wärme aus, die man nicht sehen aber fühlen kann – dort, wo man die Wärme sieht, kann es gefährlich werden.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Feuer als Bedrohung und Wärme- bzw. Lichtspender.
… Erfahrungen von Not und Hilfe, Alleingelassen und In-die-ArmeGeschlossen, Verzweifelt-Sein und Getröstet-Werden, … verstehen und deuten
… die Bedeutung des Gottesnamens. gestalten und handeln
… Feuerbilder und kostbare ICH-BIN-DA-Bilder. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… wie Menschen Gott erleben: Gott ist wie …
…Gott ist wie Feuer, das kraftvoll brennt, aber nicht zerstört. entscheiden und mit-tun
…Licht einer Kerze als Symbol für Gottes Dasein erleben.
3 | Lernanlässe
★ Erfahrungen von Not und Hilfe
★ Erlebnisse des Verbundenseins trotz „Getrenntseins” von Familienmitgliedern in der Schule, in Patchwork-Settings …
★ Namen: Kennenlernen heißt Namen lernen
★ Kerzen anzünden: Schönheit (mit Vorsicht) wahrnehmen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text „Gott spricht …“ am Beginn der Seite 32 fasst die zentrale Botschaft dieser Doppelseite zusammen und versucht den Bibeltext Ex 3,14 aufgreifend und interpretierend in eine heutige Sprache zu bringen.
Der Text vom Raben Felix weist auf die Ambivalenz des Symbols Feuer hin. Feuer ist gefährlich und kann Leben vernichten. Feuer spendet aber auch wohlige Wärme und Licht. Der Rabe greift die Gedanken und Gefühle der Kinder auf, indem er erzählt, dass er Angst vor dem Feuer hat. Feuer kann bei aller Faszination eben auch unberechenbar und sehr gefährlich sein.
Das Bild „Mose kniend vor dem leuchtenden Dornbusch” entstammt einer Kinderbibel, die von Esben Hanefelt Kristensen gestaltet wurde. Die abgelegten Schuhe und das Verhüllen des Gesichtes bei Mose verweisen auf die Heiligkeit des Geschehens. Der Dornstrauch wird mit Blüten dargestellt, Schmetterlinge umschwirren ihn und geben dem Bild eine gewisse Leichtigkeit; im Hintergrund ziehen Vögel dahin über das Sinaigebirge. Hineingestellt ist die hier dargestellte Gottesoffenbarung in die Erzählung von der Befreiung der MoseSchar aus der Unterdrückung Ägyptens. Ägypten repräsentierte die reiche, machtvolle Welt der Hochkultur, während Israel, das Judentum hingegen die arme, unterdrückte, kleine Welt darstellte. Der Exodus ist das Paradigma des befreienden Gottes, der sich ständig aktualisiert, denn JHWH ist ein Gott der Befreiung: Ich bin JHWH, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus. JHWH sieht das Elend und die Not der Menschen, er hört ihre Klage und ihren Schrei, er kennt ihr Leid und steigt herab, um sie der Hand der Unterdrücker zu entreißen. (vgl. Gen 3,7–8). Dieser kraftvolle Gott symbolisiert sich im Feuer, das leuchtet, aber den Dornbusch, die irdische Wirklichkeit, erleuchtend nicht verbrennt. Dies ist zunächst die Erfahrung der Mose-Schar, die später zur Erfahrung des ganzen Volkes Israel und des jüdischen Glaubens wird. Diese Freiheit wird geschenkt durch den Bund, durch die Bindung an JHWH, ihren Gott. Das Schatzkästchen zeigt eine Übersetzung des Gottesnamens. „Gott spricht: Ich bin der ICH-BIN-DA. So ist mein Name.” Diese Übersetzung ist ein jederzeit aktuelles Versprechen der Anwesentheit Gottes, welches die Schüler*innen durch ihre Gestaltung verinnerlichen können.
Der QR-Code führt zu einem Lied über Gottes Anwesenheit in allen Dingen. In Zusammenhang mit dem Bild wird durch dieses zum Ausdruck gebracht, das Gott sich nicht beschränken lässt und überall sein kann.
5
| Möglichkeiten zur Doppelseite
Perikope vorlesen oder erzählen
Bodenhaftung bzw. Erdung spüren: Kinder anleiten, so wie Mose im Bild im Schulbuch das Feuerknistern zu hören (YouTube), die Schuhe ausziehen, unter den Füßen den Boden (Wiese, Sand, angenehme Böden, Teppich …) bewusst zu spüren. Dabei schließen sie die Augen und versuchen zu beschreiben, wie sich das für sie anfühlt. Feuerknistern als Hintergrundgeräusch hören
Heftarbeit „Brennender Dornbusch“: Brennenden Dornbusch (siehe unten) mit gelb, orange, rotem Papier kleben oder mit Wasserfarben und Strohhalmen pusten.
Namen im Sand: Den Gottesnamen in Sand schreiben.
Bedeutung des Gottesnamens kennenlernen: Der Name Gottes JHWH bedeutet „Ich bin da“. Manche Exegeten meinen, eine gute Übersetzung wäre auch „Ich bin der MIT-DIR“. Nach dem „MIT-DIR“ kann alles von den Schüler*innen eingesetzt werden: Ich bin der, der mit dir ist, mit dir lacht, mit dir weint, mit dir … Schatzkästchen ausfüllen : Die Bedeutung des Gottesnamens mit den Fingern nachspüren und mit goldenem Stift oder auch bunten (Lieblings-)farben kostbar gestalten.
Bedeutung des eigenen Namens herausfinden: Während der Heftarbeit können die Bedeutungen der Namen einzeln im Namenslexikon oder im Internet gesucht werden.
6 | … und noch mehr Ideen
Feuer wahrnehmen: In einer Feuerschale (im Freien, unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen) ein Feuer entzünden, das Feuer, die Wärme, das Knistern, den Geruch des Rauches usw. bewusst wahrnehmen.
Fühlstraße: Eine Leiter auf den Boden legen, die einzelnen Bereiche mit unterschiedlichen Materialien befüllen (runde Steine, Moos, Sägespäne, Schafwolle, Watte, Blätter, Sand, Rindenmulch …) und die Kinder barfuß (ggf. verbundene Augen) über die einzelnen Stationen führen und begleiten.
Nachdenken und Philosophieren: Wie kann Gott da sein, wenn wir ihn nicht sehen können?
7 | Kinderbücher
Stracke, S. (2018). Gott ist wie Himbeereis. Paulinus.
8 | Lieder
Du bist der „ICH BIN DA“ LB Religion Nr. 151 Gottes Liebe ist so wunderbar LB Religion Nr. 17




Mirjam singt und tanzt vor Freude: Gott rettet und befreit
Seiten 34 und 35 im Schulbuch | Kapitel 2
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite bringt den für Kinder so wichtigen Aspekt von Freude, Bewegung, Tanz, Musik, Ekstase, Befreiung in den Kontext der möglichen Erfahrung Gottes: das Leben als Geschenk, als Gnade, als Glück und Lust, als Befreiung und Erlösung. Sie lädt ausgehend von der weiblichen Identifikationsfigur Mirjam dazu ein, sich mit Momenten auseinanderzusetzen, in denen es eine unerwartet positive Wendung oder Rettung gab, die zur Ressource für das ganze Leben werden kann und die Selbstwirksamkeit, das Gefühl eigener Kompetenz stärkt. Es geht auch darum, Begeisterung und Freude über Gelungenes und Erlebtes auszudrücken und herauszufinden, wie man Freude mit anderen teilen und gemeinsam einen „Siegeszug” feiern kann. Selbst aktiv zu werden und Freude durch gemeinsames Bewegen und Tanzen, gemeinsames Musizieren oder auf andere kreative Weise auszudrücken kann auch als ein Ziel der Auseinandersetzung mit dieser Doppelseite gesehen werden. Wenn es im Lehrplan um die Auseinandersetzung mit den „Welt- und Gottesbildern der Schüler*innen” geht, dann bietet diese Doppelseite die Möglichkeit, die freud- und lustvollen, bewegten Seiten des Lebens einzubringen und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse und Fragen ins Spiel und Gespräch zu bringen, aber auch einfach ausgelassen sein zu können und zu dürfen und dies auch als besonderes Geschenk (Gottes) deuten zu können.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … wann sie Hilfe brauchen, wie sie anderen helfen können. … wann/ob sie schon einmal vor Freude getanzt haben. verstehen und deuten … dass gläubige Menschen beim Bewältigen von schwierigen Situationen Gott als Unterstützer deuten.
… dass auch wenn es nicht immer so aussieht, Gott auch in harten Zeiten bei uns ist und uns Raum für Freude schenkt. gestalten und handeln
… Erfahrungen von Glück, Begeisterung, Befreiung mit Farben, Musik, Bewegungen … ausdrücken. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was sie vor Freude springen lässt.
… wie sich Freude und Freiheit anfühlen. entscheiden und mit-tun
… durch Singen, Tanzen oder in kurzen Gebetssätzen Lob und Dank für Gelungenes ausdrücken.
3 | Lernanlässe, Themen, Ausgangspunkte
★ Jubel und Freude im Sport, Siegestanz
★ Erfahrungen von Freude, Glück, Begeisterung
★ Mirjam als weibliche Identifikationsfigur
★ Erfahrungen von Situationen in denen man dachte, dass etwas schief gehen, und es dann doch gut ausging
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Bibeltext „Singt dem Herrn…“ (Ex 15,20f.) aus dem Buch Exodus fasst in einem Loblied kurz zusammen, was zur Grunderfahrung Israels und der Bibel wird: Gott hält sein Versprechen und befreit; er ist ein Gott der Rettung und Befreiung. Wer hindurch findet durch das Meer der Not, der Angst und des Schreckens, durch das Meer der Tränen, dessen Leidensgeschichte wird in einen Lobgesang und in einen Tanz verwandelt. Befreiung wird im Letzten so erlebt, dass es nicht unsere eigene Tat ist, auch wenn man alles an Kräften eingesetzt hat, was möglich und notwendig war, sondern sich einem Größeren verdankt. Es ist eine Erfahrung, die über uns selbst hinausweist. Zumindest für den religiösen Menschen ist das letztlich eine gnadenhafte Erfahrung Gottes und geschenkter Freiheit. Ihm gebührt der Tanz und das Hallel-JHWH. Das Bedrückende weicht der Lebensfreude und der Ekstase. Der Text bietet die Möglichkeit eines kurzen inhaltlichen Einstiegs, ohne die Erzählung der gesamten biblischen Befreiungsgeschichte, die in der vierten Schulstufe kommt, vorwegzunehmen. Ausgehend von der Begegnung von Mose mit Gott beim brennenden Dornbusch, der Offenbarung des Namens und dem damit einhergehenden Versprechen, dass Gott da ist, befreit und rettet, wird in diesem Vers dazu aufgefordert, ihm ein Loblied zu singen, denn er hält dieses Versprechen. Die Schüler*innen werden in diesen Lobgesang und Tanz, und damit auch in die Bewegung der Befreiung und Freude mit hineingenommen. Mirjam, die ältere Schwester des Mose, führt nach dem Auszug aus Ägypten als Prophetin den Freudentanz der Frauen an. Sie ist eine der drei Führungsgestalten aus der Befreiungsgeschichte des Volks Israel – die tanzende Prophetin. Im Pentateuch ist sie die einzige Frau, die als Prophetin bezeichnet wird (Fischer). Sie ist in der Rettungsgeschichte von Beginn an eine bedeutende Persönlichkeit. Das sog. Mirjamlied gilt als einer der ältesten Texte des Alten Testamentes. Das, was Mirjam, die Prophetin, von Gott hört, erfährt, versteht und glaubt, behält sie nicht für sich, sondern singt es hinaus. So kann sie mit ihrer Freude auch andere begeistern.
Der Text vom Raben Felix veranschaulicht für die Schüler*innen, was es in ihrem Lebenskontext bedeuten könnte, „befreit” und „gerettet” zu werden. Saltos zu schlagen ist für Volksschüler*innen etwas Cooles. Sie springen und hüpfen und singen in freudigen Situationen vor sich hin.
Das Bild „Tanzende Mirjam” stammt von deutschen Künstler und katholischen Priester Sieger Köder (1925–2015). Mirjam im blau-weiß-gold gestreiften lockeren Kleid bewegt sich auf feurigem Hintergrund. In Rot, Orange, Gold bildet sich zugleich das geteilte Meer. Ganz am Horizont sind noch die Pyramiden angedeutet, das zurückgelassene Ägypten, der Ort der Knechtschaft. In ihrer Hand hat sie eine kleine Trommel, die sie im Rhythmus dazu spielt. Mit ganzer Seele und mit ihrem ganzen Leib tanzt sie und singt Gott ein Danklied: „Singt dem JHWH ein Lied, denn er ist hoch und erhaben! Rosse und Reiter warf er ins Meer.“ (Ex 15,20) Es ist die gesungene
und getanzte Antwort der Frauen auf die Rettung, die gerade geschieht – das sogenannte Mirjamlied (Ex 15,19–21).
Der Satz „Du hast meinen Füßen weiten Raum …“ greift die Erfahrung der Menschen, die Rettung erlebt haben, auf. Unendlich froh, erleichtert und dankbar singen und tanzen sie vor Freude. Sie deuten das, was geschehen ist, von Gott her. Er hat sie befreit, er hat ihnen Schritte in die Freiheit ermöglicht. Außerdem erinnern die Worte auch an Worte des Psalms 31,9, in dem Gott für Rettung und Zuflucht gedankt wird. Mirjam tranzt und freut sich, ihre Freude ist ansteckend. Der QR-Code führt zu einem Lied zum Thema Befreiung.
5 | Möglichkeiten zur Arbeit mit der Doppelseite
Perikope mit Fokus auf die Person Mirjam erzählen
Bildbetrachtung „Tanzende Mirjam”: Hilfreich können die folgenden Fragen sein: Welche Farben entdeckst du? Was ist im Vordergrund, was im Hintergrund? Wo schaut Mirjam hin? Wie ist ihr Gesichtsausdruck? Was hat sie in der Hand? Was könnte Mirjam sagen oder singen?
Freude ausdrücken: Freude mit dem Körper darstellen und ausdrücken. Beispiele: Jubeln, lachen, springen, tanzen, klatschen, Hände hochheben, einklatschen … Handtrommeln basteln, darauf spielen und Freudesätze im Rhythmus dazu rufen: „SingtdemHerrneinfrohesLied!Erhatunsgerettet. Singt dem Herrn ein frohes Lied! Gott lässt uns nicht allein!”
Heftarbeit „Mit Mirjam tanzen“: Zum Beispiel kann blaues Papier in zwei Teile wie das Meer gerissen werden und die tanzende Menge dazwischen eingezeichnet werden. Die Schüler*innen können sich selbst im Bild dazumalen und überlegen, ob ihnen ein Erlebnis zu dieser Stimmung einfällt. Arbeitsblatt/Heftarbeit „Mirjam singt ein Loblied“: Eine Note ausschneiden und einkleben. Dazu die Seite gestalten, indem dazu gezeichnet wird, was einem selbst Freude macht (siehe unten). Zum Mirjamlied musizieren und tanzen: Mit Handtrommeln und anderen Rhythmusinstrumenten musizieren und Bewegungen zum Rhythmus des Mirjamliedes (z.B. Mirjamlied von C. Mitscha-Eibl) ggf. mit Tüchern tanzen lassen.
6 | … und noch mehr Ideen
Vortanzen und Mitmachen: Schüler*innen stehen in einem Kreis, zu passender Musik (z.B. Happy Pharrell Williams) kommt ein Kind nach dem anderen in die Kreismitte und tanzt vor, die anderen machen die Bewegungen des Kindes in der Mitte nach. Sie klatschen einander ab und kommen nacheinander dran. Malen nach Musik: Ein Musikstück (ggf. Mirjamlied) einspielen, nach Rhythmus, Lautstärke, Geschwindigkeit der Musik malen die Kinder mit verschiedenen Stiften auf einem Blatt Papier oder im Heft.
7 | Kinderbücher
Meiss, A. R. (2021). Mirjam. Francke Buch. Stracke, S. (2018). Gott ist wie Himbeereis. Paulinus.
8 | Lieder
Du bist ein Ton in Gottes Melodie T./M.v. K. Mikula: www.mikulakurt.net
Jeder Tag ist ein Geschenk T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net Mirjamlied LB Religion Umschlagseite hinten
9 | Schnappschüsse aus dem Unterricht



Mirjam singt ein Loblied
Mirjam singt ein Loblied
➜
Gestalte den Notenschlüssel und die Noten. Schneide die Noten dann aus und klebe sie in die Notenzeile. Verwende bunte Farben, um die Freude von Mirjam sichtbar zu machen.
Gestalte den Notenschlüssel und die Noten. Schneide die Noten dann aus und klebe sie in die Notenzeile. Verwende bunte Farben, um die Freude von Mirjam sichtbar zu machen.





Mirjam singt ein Loblied
Mirjam singt ein Loblied
Mirjam singt ein Loblied


Gestalte den Notenschlüssel und die Noten. Schneide die Noten dann aus und klebe sie in die Notenzeile. Verwende bunte Farben, um die Freude von Mirjam sichtbar zu machen.



Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 36 und 37 im Schulbuch | Kapitel 2
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in Religion beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …), sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 38 im Schulbuch | Kapitel 2
Die Schlussseite ist eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Ein Lied zum Mitmachen und Mitzeigen steht als spirituelles Angebot im Mittelpunkt. So kann über das ganze Schulbuch ein kindgemäßer Schatz an Gebeten, Liedern oder Geschichten bzw. Sätzen zum Nachdenken aufgebaut werden. Das grafische Element des steirischen Künstlers Alois Neuhold nimmt das Symbol des Regenbogens auf, der etwas verfremdet nicht nach oben gewölbt ist, sondern der an einen Arm erinnert, in den man sich bergen kann. Aufgefangen, getragen, geschützt vor dem, was sich ganz unten in bedrohlichen Farben und Formen zeigt. Das Leben der Kinder ist nicht nur schön. Sie nehmen auch Gefährdungen wahr, sie sind auch konfrontiert mit Schicksalsschlägen, mit Gewalt, Trennung, … Der Arm Gottes und hoffentlich vieler Menschen bietet sich wie ein bergendes Nest, wie eine schützende Hand an, um in dieser oft auch bedrohlichen Welt gut und vertrauensvoll leben zu können.
Literatur zum 2. Kapitel
Cardenal, E. (1977). Ufer zum Frieden. Wuppertal: Jugenddienst Verlag.
Rosa, H. (2016). Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp Verlag.
Zulehner, P. M. (1994). Ein Obdach der Seele. Geistliche Übungen – nicht nur für fromme Zeitgenossen. Düsseldorf: Patmos Verlag
KAPITEL 3: Schauen, hören, begegnen. SPUREN VON RELIGION
Seiten 39 – 54 im Schulbuch
Impuls
„Ich löschte das Licht, um den Schnee und die Bäume zu sehen. Und ich sah den Schnee und die Bäume durch das Fenster, und ich sah den Neumond. Doch dann sah ich, dass Schnee, Baum und Mond nur wieder Fenster sind, und durch diese Fenster sahst Du mich an.”
Ernesto Cardenal
Allgemeine Hinführung
Wie im Impulstext von Ernesto Cardenal angedeutet, kann alles zum durchscheinenden Fenster auf das Heilige hin werden und zugleich umgekehrt zum Angeschaut-Werden durch das Heilige. Eine besondere Rolle spielen dabei sicherlich die vielen „Zeugen” des Glaubens, der Spiritualität, die uns Menschen umgeben. Glaube wird immer auch nach außen sichtbar, und so können Menschen mit ihm in Kontakt treten bzw. bieten sich für Kinder Lernanlässe. Gerade die großartige Kultur in Form von Kirchengebäuden, Kapellen, Kunst, Bildern… bietet viele Möglichkeiten des religiösen Lernens. Der christliche Glaube hat nicht nur in den Texten Gestalt angenommen, sondern genauso in Stein. „Das Christentum – obwohl wortgebunden – hat sich im Laufe seiner Geschichte auch in architektonischer Hinsicht als eminent gestaltungsproduktiv erwiesen, wobei die Erschließung dieser Formen zugleich dieses selbst in seiner jeweiligen Zeitverwobenheit erschließen hilft.“ (Degen et. al,.2009,71f.) Dies will die am Ende des 20. Jhdt. sich entwickelnde sogenannte Kirchenraumpädagogik nützen: der liturgische Raum als religionspädagogisches und katechetisches Medium. Architektur und religiöse Gebäude sind demnach nicht nur funktionale Gehäuse, sondern lebendige Kommunikation, Gespräch zwischen Menschen mit ihren jeweiligen Lebensvorstellungen, der biblischen Tradition, der Zeittradition und ihrem Glauben, der darin sichtbar wird. Sie bieten sich als ästhetische Erfahrungsräume an. Ganz ähnlich gilt dies auch für traditionelle heilige Zeiten und natürlich für heilige Menschen. In all dem wird das Heilige selbst sichtbar, erlebbar und kommunizierbar. Auf diese Möglichkeiten zielt dieses Kapitel ab: Glaube wird sichtbar durch heilige Orte, heilige Räume und heilige Zeiten. In ihnen zeigt sich, was den Menschen in der jeweiligen Zeit besonders wichtig war, was sie erhofft haben, wie sie Gott gesehen und erfahren haben bzw. diese Erfahrungen gedeutet haben. Zugleich fordern diese durch
die Begegnung auch zum Fragen heraus, wie es mit uns Heutigen steht, wie heutiges Fragen und Suchen nach dem letzten Grund beantwortet werden bzw. sich in diesem Kontext von Räumen und Zeiten wiederfinden können oder eben nicht. In der Kompetenz C5 des Lehrplanes, insbesondere im Kontext des Kompetenzbereichs für die 1. Schulstufe geht es im Blick auf die Schüler*innen darum, Spuren christlicher Religion wahrzunehmen, heilige Orte und Räume zu beschreiben, heilige Zeiten und Feste zu kennen und von heiligen Menschen zu erzählen.
Durch die Begegnung mit heiligen Räumen, heiligen Zeiten und heiligen Menschen passiert wesentlich mehr als nur ein „Wissen um“; es ist zugleich im Sinne ästhetischen Lernens eine Schulung der Sinne, aber auch ein Sich-herausfordern-Lassen: „Das Fördern der leiblich-sinnlichenWahrnehmungjedesEinzelnenundderLerngruppe (‚Was ist hier zu hören, zu sehen, zu spüren? Was tut dieses Hören, Sehen, Spüren mit uns? Wie ordnen, deuten, werten wir es?‘) leitet an zu selbstreflexivem Umgang mit Wahrnehmung auf dem Weg zu Erfahrungen …“ (Bitter, 2009, 237). Es kann ja tatsächlich zur „Begegnung mit dem Heiligen“ werden und Kommunikations- und Deutungsräume eröffnen.
Lehrplanbezüge des 3. Kapitels
Kompetenzbereich | C5 Religiöse und weltanschauliche Vielfalt in Gesellschaft und Kultur
Leitkompetenz | Medien, Kunst und Kultur im Kontext religiöser Weltwahrnehmung interpretieren, beurteilen und gestalten können. Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können Spuren des Christlichen in der Umgebung wahrnehmen und religiöse Motive deuten.
Anwendungsbereiche | Heilige Räume, heilige Zeiten, heilige Menschen
Unterrichtshinweise | Allerheiligen und Allerseelen Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können Christliches im Lebensumfeld beschreiben.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte:
Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
FreiheitundOffenbarung:Quellen der Offenbarung sind die Bibel und die kirchlichen Traditionen in ihrer Vielfalt. Auf der darin grundgelegten Freiheit des Menschen basiert die Achtung der Religionsfreiheit jeder Schülerin und jedes Schülers.
Titelseite: Schauen, hören, begegnen. SPUREN VON RELIGION
Seite 39 im Schulbuch | Kapitel 3
Das Titelbild ist eine geheimnisvolle Spur des Glaubens. In der linken Bildhälfte ist ein eher dunkel scheinendes Vortragekreuz zu sehen, wie es in vielen Kirchen zu finden ist. Den Großteil des Bildes bildet jedoch ein Tuch in grün-gelber Farbe. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man durch das Tuch hindurch noch Formen, Figuren, ein Kreuz dahinter. Das dunkle Kreuz und die helle, grün-gelbe Farbe bilden einen Kontrast. Dunkles und Durchkreuztes, aber auch Helles und Faszinierendes sind in unser aller Leben zu finden. Und manchmal muss man genau schauen und ein wenig verweilen, damit man Dinge, die sich nicht so plakativ aufdrängen, wahrnehmen oder zumindest erahnen kann. Das Foto stammt aus einer Aktion der Diözese GrazSeckau, in der im Jahr 2013 gelbe Tücher anstelle der traditionellen violetten Tücher in der Fastenzeit viele Altäre, Kreuze, Bildstöcke, usw. verhüllt haben. Damit wurde der Blick auf wesentliche Spuren unseres Glaubens in dieser Zeit bewusst verhüllt. Das irritiert, erregt Aufmerksamkeit und lädt ein zum Fragen. Wo ist Gottes Gegenwart
verhüllt und geheimnisvoll und letztlich verborgen? Wo finden sich Spuren des Glaubens? Wo verbirgt sich Gott vielleicht im Menschen und in der ganzen Schöpfung? Das Bild weist darauf hin, dass Gott auch im Leben der Kinder verhüllt und geheimnisvoll vorkommt. Nicht plakativ, meist nicht ausdrücklich kirchlich, manchmal schemenhaft und doch da. Gott im Leben der Kinder, im Kontext Schule, in unserer säkularen Zeit als der verborgen Anwesende.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Bildbetrachtung: Das Bild betrachten und beschreiben. Was sehe ich? Was kann ich gut sehen? Was ist verhüllt? Woher kommt das Licht? Welche Farben sehe ich? Wo stehe ich?
Etwas verhüllen und besprechen: Was bleibt erkennbar, was hat sich verändert?

Warum verhüllen Menschen Dinge?
Foto: armenc türzenbechers
Spuren des christlichen Glaubens
Seiten 40 und 41 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Das eigene Zuhause, der Schulweg, die Schule selbst, die unmittelbare Umgebung wird zunächst in den Blick genommen, um Spuren des Glaubens, des Fragens und Suchens nach Gott wahrzunehmen, zu entdecken und auf diese aufmerksam zu werden. All dies lädt zu einer Schatzsuche und Entdeckungsreise ein und soll die Wahrnehmung schärfen, mit offenen Augen verborgene Schätze zu finden. Ortsnamen und Straßenbezeichnungen, Kirchen und Kapellen, Bildstöcke und Kreuze, Musik und Lieder, religiöse Handlungen und Feste (Kindergarten), Feiern und Sakramente u. v. m. – und natürlich der Mensch selbst – können die transzendente Wirklichkeit durchscheinen lassen und als Zeichen des christlichen Glaubens wahrgenommen und entdeckt werden, sie können Lernanlass sein, über Religion und damit auch über Gott ins Gespräch zu kommen. In einem ersten Schritt geht es wie bei jedem Kapitel zunächst um ein Aufmerksamwerden, um ein Wahrnehmen und ein Schulen der Wahrnehmung und der Augen für diese Zeichen, die uns so selbstverständlich umgeben, ohne dass wir sie wirklich wahrnehmen, weil unser Blick sich schon so sehr daran gewöhnt hat, in denen sich die verborgene Wirklichkeit des Heiligen und Transzendenten ausdrücken kann. Manche Zeichen und Dinge sind für heutige Kinder, die nur wenig oder gar nicht religiös sozialisiert sind, denen die „religiöse Muttersprache” fehlt, wohl auch völlig fremd geworden und haben ihnen nichts mehr zu sagen – wie eben eine nicht verstehbare Fremdsprache. Diese Situation will sehr ernst genommen werden, hier braucht es ein sanftes Hinführen und Aufschließen von religiöser Wirklichkeit, Kommunikation und Gespräch.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… christliche Spuren im Alltag, in der Schule, in den Straßen und Häusern, in der Natur… verstehen und deuten … Symbole, Statuen… als Spuren des christlichen Glaubens. gestalten und handeln
… Dinge, Fotos, Wörter, Zeichnungen… die vom Glauben erzählen, mitbringen und auf einen Schatztisch ausstellen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was Dinge und Zeichen, Elemente der Natur, des Lebens vom Glauben erzählen. entscheiden und mit-tun … Spuren von Religion beachten und (mit-)gestalten. … miteinander singen und beten.
3 | Lernanlässe
★ Kreuz als Anhänger einer Halskette
★ Kreuze in der Klasse, Schule, bei Großeltern, zu Hause …
★ Bildstock, Marterl am Schulweg
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
In der Fotocollage sind verschiedene Blitzlichter zu sehen, die auf Spuren des Glaubens hinweisen. Das Ortsschild macht darauf aufmerksam, dass viele Städte und Orte, aber auch Straßen die Namen von Heiligen tragen. Marterln, Kirchen, Halsketten mit christlichen Symbolen … all das kann auf die transzendente Dimension der Wirklichkeit verweisen, auf das Darüberhinaus dieser Welt. Auch Feste, die die Kinder vielleicht schon bewusst miterlebt haben, sind Spuren des Glaubens mitten im Alltag.
Das Ortsschild erinnert an die vielen Ortsnamen, die nach heiligen Menschen benannt sind. St. Martin, Groß Sankt Florian, Mariazell, St. Stefan … landauf, landab sind solche Spuren des christlichen Glaubens zu entdecken. Auch in den Städten gibt es Straßennamen (z. B. Elisabethstraße) oder Namen von Apotheken u. v. m., die religiöschristliche Namen haben, also Spuren des christlichen Glaubens sind. Die Basilika von Mariazell in der nördlichen Steiermark ist als Marienwallfahrtsort ein bekanntes Zeichen für den christlichen Glauben. Hoch ragen die Türme in den Himmel und deuten so eine Verbindung des Himmels mit der Erde an. Viele tausende Menschen kommen jedes Jahr dorthin, um zu beten. Viele gehen tagelang zu Fuß, andere kommen von weit her, um mit ihren Anliegen zu Gott bzw. zu Maria als Fürsprecherin zu kommen.
Das Foto von der Taufe eines Kindes erzählt von den Festen und Sakramenten, die Knotenpunkte des Lebens und des christlichen Glaubens sind. Vielleicht haben die Kinder schon miterlebt, dass ein Kind ihrer Umgebung getauft wurde. Es schwingt immer auch die Hoffnung mit, dass Gott dieses Kind schützen möge. Jede Taufe ist eine Spur des Glaubens und Vertrauens in den guten Gott, der das Leben schenkt, der es begleiten und schützen möge.
Das Foto mit dem Kind nimmt das Tragen christlicher Zeichen in den Blick. Das Mädchen trägt ein Ketterl mit einem Kreuz um den Hals. Viele Eltern schenken ihrem Kind eine Halskette mit einem Kreuz oder einem Schutzengel. Sie drücken damit eine tiefe Sehnsucht und den Wunsch aus, dass das Kind beschützt durch das Leben gehen möge. Das Selfie vor dem Stephansdom erzählt davon, dass dieses Kirchengebäude und auch viele anderen Kirchen für Menschen bedeutsam sind. Menschen fahren auf Urlaub und schauen sich Kirchen an, fotografieren sich vor diesen Gebäuden, die an etwas Größeres erinnern. Kirchen erinnern an die geheimnisvolle Gegenwart Gottes mitten in der Alltagswelt der Menschen. Sie erzählen davon, dass das Leben mehr ist als die Betriebsamkeit und Hektik des Alltags und sind somit Hoffnungszeichen. Das Bild mit dem Marterl erinnert an die vielen Marterln, Wegkreuze und Statuen, die an Wegen, auf Bergen oder auch mitten in den Städten aufgestellt werden. Sie alle erzählen vom Glauben der Menschen, die diese Marterln erbaut haben, die sie pflegen und schmücken. Die Glocken als Bild in der Mitte sind eine akustische Erinnerung an Gott, hier in einem Kirchenraum. Im Hintergrund sind bunte Glasfenster zu erahnen. Die Glocken werden geläutet, wenn ein Gottesdienst beginnt. Sie erinnern, dass es ein inneres Bereitmachen, eine Achtsamkeit für das Göttliche braucht. Glocken läuten auch von den Kirchtürmen und erinnern an den
christlichen Glauben, an das Gebet und die Feiern des Glaubens mitten im Leben.
Die Schatzkästchen laden ein, in der eigenen Umgebung die Augen aufzumachen, Spuren christlichen Glaubens zu entdecken und sie in die Kästchen als Schätze hineinzuzeichnen oder wenn möglich zu schreiben, natürlich können auch Fotos hineingeklebt werden. Der Text vom Raben Felix bietet mit seiner Bemerkung einen Lernanlass, sich auf die Suche zu machen, selbst zu entdecken und das Wahrgenommene zu benennen. Der QR-Code führt zu einem „Halleluja”-Lied. Mitunter begegnen auch Lieder aus der Welt der Popmusik als Spur von Religion auch in säkularer Welt.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bildbetrachtung : Mögliche Satzanfänge sind: Das habe ich schon einmal oder noch nie gesehen … Ich weiß, … Ich frage mich, … Ich denke, … Bildcollage gestalten: Collage mit Spuren des Glaubens z. B. aus Kirchenzeitungen, Pfarrblättern usw. Schatzkästchen befüllen und besprechen Lied erkunden: Das Lied mittels QR-Code aufrufen und in der Klassengemeinschaft anhören. Welches Wort wird hier immer wieder gesungen? Wo habe ich dieses Wort vielleicht schon einmal gehört?
6 | … und noch mehr Ideen
Spuren suchen und entdecken: Einen Spaziergang im Schulhaus, rund um die Schule, durch das Dorf oder die Stadt machen und Spuren christlichen Glaubens suchen und entdecken. Anschließend gemeinsam besprechen, Fragen stellen und im Heft festhalten, was man entdeckt und erfahren hat. Mögliche Entdeckungen: Statuen, Bildstöcke, Kapellen, Kirchen, Kreuze … Kirche besuchen und erkunden: In eine Kirche gehen und Spuren des Glaubens entdecken, zum Beispiel durch die Betrachtung der Gestaltungselemente. Durch eine Papierrolle zu schauen erleichtert es, sich auf einzelne Elemente zu fokussieren.
Spuren hinterlassen: Die Schüler*innen können selbst Spuren hinterlassen, indem beispielsweise in einem (Buchstaben-) Sandkasten Spuren eingezeichnet werden.
Schnitzeljagd machen: Durch eine „Schnitzeljagd” kann Schüler*innen spielerisch nähergebracht werden, dass Spuren etwas erzählen und als Hinweise verstehbar sind.
Spuren unserer Gemeinschaft sammeln: Gemeinschaftlich können die Spuren der Schüler*innen innerhalb einer Form gesammelt werden (z. B. Handabdrücke, Fußabdrücke, Unterschrift etc.), um eine „gemeinsame Spur” zu legen und darüber nachzudenken, was Spuren erzählen. In diesem Fall wäre es zum Beispiel so, dass die Spur von Gemeinschaft erzählt. Um die gesamte Schulgemeinschaft einbeziehen zu können, ist es möglich, eine neutrale Form (z. B. passend zur Jahreszeit) als Grundlage zu wählen (siehe unten).
Heftarbeit „Mein Fußabdruck“: Die eigenen Fußabdrücke oder nachgezeichneten Füße bieten einen Rahmen, um über Spuren, die von einem selbst erzählen, nachzudenken und diese auch, z. B. innerhalb dieser, festzuhalten. Des Weiteren können auch Spuren, die an Religion erinnern (u. a. als Collage), in diesen Rahmen (Fußabdruck) eingefügt werden.
Spuren legen: Spuren des Glaubens durch verschiedene Legemateri-
alien individuell oder gemeinsam auflegen und über diese sprechen. Lieder als Spuren des Glaubens singen: Zum Beispiel das Lied „In jeder Blume…” singen und sich eigene „In…”-Sätze überlegen (und ggf. als eigene Strophe singen). Mögliche „In …“-Sätze: In jeder Kirche …, In jedem Bildstock …, In jedem Wegkreuz …, In jeder Hilfsaktion …seh, spür, glaub ich, Gott ist da!
7 | Kinderbücher
Muller, G. (2008). Was war hier bloß los. Ein geheimnisvoller Spaziergang. (7. Aufl.) Moritz.
8 | Lieder
In jeder Blume LB Religion Nr. 11
9 | Schnappschüsse



Schatzbuch Religion 1
Glaube erleben, bedenken, tun
Seiten 42 und 43 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Nach der Spurensuche außen führt diese Doppelseite mehr ins Innen von Religion und Glaube: zum Erleben und Tun. Glaube will gelebt, im Herzen vollzogen, aber auch mit dem Kopf durchdacht werden. Religion braucht die Erfahrungsdimension, damit sie von innen her „verstanden” werden kann. Wie viel davon ist in einer säkular geprägten Schule möglich bzw. notwendig? Darf man Kerzen entzünden, zu einem Gebet einladen, religiöse Lieder (die ja Glaubensausdruck sind) singen? Im Kontext einer performativen Religionspädagogik formuliert der deutsche Religionspädagoge Hans Mendl dazu: „Wenn sich der Religionsunterricht nicht stärker hin zu einer performativen Gestalt ändert, erweist er sich als nicht zukunftsfähig, weil es ihm nicht gelingt, den Gegenstand adäquat didaktisch ins Spiel zu bringen.” (Mendel, 2008, 15). Es verweist in Richtung auch vieler reformpädagogischer Ansätze, die einer „verkopften” Schule einen ganzheitlichen Gegenpol setzen wollen, aber auch anderer praxisorientierter Fächer wie Musik, Turnen etc., die auch ohne konkretes Tun nicht ins Eigentliche ihres Faches kommen können. Auf diese wesentliche Dimension von Glaube verweist diese Doppelseite im Buch und lädt ein, hier Erfahrungen von Glaube und Religion ansatzhaft zu machen oder auch auszutauschen, was den Schüler*innen bereits bekannt ist, was sie schon erlebt haben, wo sie vielleicht selbst dabei waren; manches wird auch aus dem Kindergarten an Erlebnissen und Erfahrungen bekannt sein, wo doch viele christliche Feste gefeiert werden (Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten, Ostern …) oder auch manche religiöse Rituale vollzogen werden. Auf diese Erfahrungen kann sinnvollerweise auch zurückgegriffen werden. Natürlich soll auch das Singen und Feiern nicht zu kurz kommen, weil sich für Kinder gerade auch darin Glaube ausdrücken kann. Diese Erlebnisse sollen besprochen und reflektiert werden, damit sie zu tatsächlichen Erfahrungen verankert werden können.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben …wie Menschen ihren Glauben ausdrücken und leben. verstehen und deuten …dass es in Religionen viele Zeichen, Symbole und Rituale gibt, die das Herz für Gott öffnen können. gestalten und handeln
…eine Kerze anzünden, Stille üben, die Wirkung einer Kerze in einem dunklen Raum erleben, miteinander in meditativer Stille ein Mitte-Bild legen.
(be-)sprechen und (be-)urteilen …welche Spuren des Glaubens besonders wichtig sind. entscheiden und mit-tun …gemeinsam beten, singen, still werden.
3 | Lernanlässe
★ Kinderfragen: Warum gibt es Religionsunterricht? Warum singen wir „religiöse” Lieder? Warum beten wir? usw.
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Zeichnung „Singende Kinder“ von Stefan Karch zeigt auf erfrischende Weise eine bunte, fröhliche Kindergruppe, die beim gemeinsamen Singen viel Freude und Spaß hat. Singen ist ein wichtiger Ausdruck des Lebens und des Glaubens. „Wer singt, betet doppelt”, heißt es beim heiligen Augustinus. Die Zeichnung ist eine Einladung, selbst zu singen, mit zu zeigen und sich am religiösen Tun zu freuen. Das Gebet bzw. Lied „Halt zu mir, guter Gott” ist ein einfaches Reimgebet, das einlädt, es mit den Kindern zu sprechen. Bewegungen dazu können gemeinsam gefunden werden. Es kann über eine gewisse Zeit die Religionsstunden begleiten. Da es auch der Anfang eines Liedes ist, kann es auch gesungen werden.
Das Foto „Hände mit Kerze” lädt zum Betrachten und zum Stillwerden ein. Es zeigt eine Kerze, die von zwei Händen geschützt und behütet wird. Durch das Licht der Kerze werden die Hände selbst hell und erstrahlen in einem orange-gelben Licht. Emotional werden dadurch Freude, Wärme und Sicherheit ausgestrahlt.
Der QR-Code führt zum Lied „Halt zu mir, guter Gott”. Es ist ein wunderbares und einfaches religiöses Kinderlied.
Der Satz „Ein einziges Licht …“ beschreibt die Erfahrung, dass tatsächlich ein einziges Licht die Dunkelheit durchbrechen bzw. vertreiben kann. Von eben dieser Erfahrung geht eine große Faszination aus. Licht wird als rettend erfahren, weil es stärker ist als die Dunkelheit und all das, was uns Angst macht. Es drängt Menschen in der dunklen Jahreszeit dazu, Kerzen anzuzünden und ihre Kraft und wohlige Ausstrahlung zu erleben. Für Christ*innen ist dieses Anzünden von Kerzen ein Tun, das an Gott bzw. an das Licht Christi erinnern kann.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Zeichnung betrachten: Was machen die Kinder hier? Was fällt auf? Was ist besonders? Wann bin ich fröhlich? Welche Anlässe lassen mich strahlen? Was braucht es dazu?
Überlegen und Erzählen : Was mache ich gern, wenn ich meine Freude zum Ausdruck bringen will?
Tanz erfinden: Sich zu fröhlicher, ausgelassener Musik miteinander bewegen und gemeinsam Spaß haben.
Beten & ggf. Bewegungen finden: Das Gebet gemeinsam sprechen (bzw. singen). Es kann zu Beginn von der Lehrperson vorgesprochen und von den Kindern nachgesprochen werden. Es können Bewegungen und Körperhaltungen dazu gefunden werden. Vielleicht begleitet es über eine gewisse Zeit hinweg die Religionsstunden und eröffnet so einen Gebetsschatz für die Kinder.
Stilleübungen: Bewusst atmen und zur Ruhe kommen. Den Kopf bequem in die Arme legen und dabei still sein und die Gedanken fliegen lassen, ganz nach dem Motto „Die Gedanken sind frei“.
Überleitung zum Bild : Klassenzimmer abdunkeln. Die Kinder schließen die Augen und die Lehrkraft besucht jedes Kind mit einer brennenden Kerze am Sitzplatz. Wenn alle Kinder das Licht in ihrer Nähe hatten, gemeinsam darüber sprechen, was den einzelnen Kindern aufgefallen ist, welche Wirkung Licht hat. Wie fühlt es sich an, wenn
das Licht ganz nah bei mir ist?
Lieblingslieder aus dem Religionsunterricht singen
Bildbetrachtung: Bild anschauen und beschreiben, die Hände sprechen lassen (Was sagen die Hände zum Licht?), Dunkelheit sprechen lassen (Was sagt die Dunkelheit zum Licht?), Licht sprechen lassen (Was sagt das Licht zu den Händen? Was sagt das Licht zur Dunkelheit?).
Bilder gestalten: Das Licht, wie es die Dunkelheit durchbricht, ist ein passendes Motiv – z. B. Kratzbilder/Kratzpapier, Buntpapier reißen und kleben, Ölkreiden usw.
6 | … und noch mehr Ideen
Kerze verzieren
Windlichter gestalten: Schraubverschlussgläser außen mit buntem Seidenpapier bekleben und danach ein Teelicht hineinstellen. Dieses Licht kann man dann von einer Hand zur nächsten weiterreichen und sich daran erfreuen, dass der helle Schein zu jedem von uns kommt. Stilleübungen

7 | Kinderbücher
Biehl, P. (2020). Mein kleines Gotteslob. Katholisches Bibelwerk. Wissmann, M. (2010). Meine allerliebsten Kindergebete. Coppenrath.
8 | Lieder
Halt zu mir, guter Gott LB Religion Nr. 85
Zünd ein Licht an T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse


Orte und Räume, die berühren
Seiten 44 und 45 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite fokussiert auf heilige Orte und Räume durchaus im Sinne einer Kirchenraumpädagogik und will diese als besondere Berührungspunkte mit dem Heiligen erschließen: Räume voll von Leben und Glauben in den vielfachen Dimensionen, Riten und Feiern, Fragen und Hoffen, Vertrauen und Glauben: „Kirchenräume sind dabei mehr als museale Denkmäler einer Religion: sie sind liturgische Begegnungsräume, Gedächtnisspeicher des Glaubens, Räume öffentlichen Lebens … Heilige Räume erfahren ihren tieferen Sinn erst bei der Feier des jeweiligen Ritus durch die Religionsgemeinschaft.“ (Mendl, 2008, S. 89).
Unsere Kultur weist einen großen und kunstvollen Schatz an solchen Orten, Räumen und Gebäuden auf, der vielfach nur mehr kunsthistorisch und touristisch vordergründig genutzt wird. Die Botschaft dieser zum Teil mit viel Geschichte und Tradition erfüllten Räume aber verweist auf die dahinter liegende Wirklichkeit der Anwesenheit Gottes mitten in unserer Welt, die betend, meditierend, feiernd und singend erfasst werden will, damit ansatzhaft ein Stück Beheimatung darin geschehen kann.
In diesen Räumen wird gelebt, gefeiert, gebetet, gesungen, gelitten, … Kirchen sind Lebens- und Glaubensräume der Menschen, die erst dadurch ihre Sakralität erhalten, weil sie das Gottesgedächtnis mitten im Leben feiernd wachhalten und deshalb auch Kinder von heute noch ansprechen können. Diese Bedeutung heiliger Räume gilt es Kindern zu erschließen, damit auch sie diese für sich und ihr Hoffen und Sehnen, ihr Beten, Bitten und Danken nützen können. Sie erschließt sich aber gerade auch über die direkte Wahrnehmung mit allen Sinnen (ästhetische Bildung), weniger übers Erklären. Deshalb soll in solchen Räumen möglichst mit allen Sinnen wahrgenommen werden: sehen, hören, spüren, riechen, schmecken … Gerade das Katholische zeichnet sich durch das sinnenhafte Erfahren des Religiösen aus: die vielen Bilder, Weihrauch, Weihwasser, Lichter und Kerzen, Bibel und Wort, Brot und Wein … Für manche Schüler*innen werden diese Erfahrungen fremd oder nur über die Medien bekannt sein; sie sind eher als sehr gering einzuschätzen. Zugleich aber ergeben sich daraus auch besondere Möglichkeiten, weil sie damit auch nicht mit negativen Erfahrungen konnotiert sind. Wo irgendwie möglich, wird es sinnvoll sein, diese Orte und Räume zu besuchen, sich mit ihnen anzufreunden und diese als besondere Orte der möglichen Gottesbegegnung zu erschließen. Die vielen Entdeckungen, Eindrücke und damit verbundenen Fragen können und sollen das Gespräch anregen, Deutung und Bedeutung ermöglichen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben …Orte und Räume, die ganz besonders für einen sind.
verstehen und deuten …dass manche Orte und Räume für Menschen heilige Räume sind, an denen sie Gottes Nähe spüren und sich an Gott erinnern. gestalten und handeln …einen Kirchenraum besuchen und auf sich wirken lassen. …mit Legematerialien einen „besonderen” Raum gestalten. (be-)sprechen und (be-)urteilen …einander von besonderen Räumen und Orten erzählen. entscheiden und mit-tun …in einem Kirchenraum o. ä. still werden und ein Hallelujalied miteinander singen.
3 | Lernanlässe
★ (Kinder-)fragen: Warum stehen Kirchen mitten in Orten und Städten? Warum soll man in der Kirche still sein und nicht herumlaufen? Warum sagt man zur Kirche „Haus Gottes”? Warum bauen und schmücken Menschen Marterln, Kapellen, Gipfelkreuze,…
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix versucht über die sinnlichen Wahrnehmungen, die in einem Kirchenraum möglich sind, einen spirituellen Zugang zu eröffnen. Das Sinnliche des Goldes und des Leuchtens eröffnet zugleich die Möglichkeit, darin das Leuchten des Heiligen zu sehen und die Anwesenheit Gottes darin zu verstehen bzw. zu erfahren. Im Ton des Irdischen kann das Himmlische durchleuchten. Solche Wahrnehmungen und Erfahrungen ermöglichen eine Tiefensicht der Welt, die letztlich zentral für eine Sinnerschließung ist. „Die Eigenart des Gegenstands Religion kann nur verstanden werden, wenn dieser in seiner eigenen Form nicht nur präsentiert, sondern auch erlebbar wird.“ (Mendl, 2008, S. 85.)
Die drei Fotos zeigen Blitzlichter von Orten und Situationen, die berühren, die über sich selbst hinausweisen. Ein Kind liegt mit seinem Vater und einem Kuscheltier in einem Zelt. Eine Situation der entspannten Geborgenheit. Sie schauen nach oben… was sie sehen, bleibt offen. Aber es ist ein Staunen und es ist Freude in ihren Gesichtern. Was sie wohl sehen, entdecken, sich erzählen, fühlen und wahrnehmen? Die Quelle ist oft ein besonderer Ort. Wer auf einer Wanderung erhitzt und durstig zu einer Quelle kommt, erlebt, dass sie erfrischt, dass sie die Lebensgeister wieder weckt. In vielen Orten gibt es „heilige Quellen” bzw. „heilige Brunnen”. Sie erzählen vom Wasser, das heilt, das die Augen öffnet. Wasser ist ein Sinnbild für die Lebendigkeit, die Heilung, die Erfrischung, die Gott den Menschen immer wieder schenkt.
Bei dem Bild „Bunte, lichtdurchflutete Kirche“ handelt es sich um eine Aufnahme aus dem Stephansdom in Wien, in dem durch eine Lichtinstallation die mystische Dimension des Kirchenraumes verstärkt wird. Das Licht gibt dem Raum eine kosmische Atmosphäre und „verwandelt” den Kirchenraum bzw. öffnet ihn auf eine größere Dimension hin, die nicht greifbar ist, aber erahnt werden kann. Der QR-Code führt zu bekannter Orgelmusik. Die Orgel als „Königin der Kirchenmusik” gehört in jede Kirche und erklingt festlich, aber auch den unterschiedlichen Lebensabschnitten und kirchlichen Festzeiten entsprechend, von freudig, hoffnungsvoll bis traurig. Man kann sich ihrem Klang nicht entziehen. Orgelkonzerte werden auch von Menschen geschätzt, die selbst von der Kirche weit entfernt sind.
Das Lied „Halleluja” lädt ein zum Singen und Mitklatschen. Von der Wortbedeutung „Hallel – JHWH“ – „Preiset Jahwe“ her ist der Liedruf der aus der hebräischen Sprache kommende urtümliche Ruf zu Gott. Wo das Herz berührt ist, kann Singen und Loben die Folge sein.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Von Orten und Räumen erzählen: Konkret können die Schüler*innen erzählen, welche Orte und Räume für sie besonders sind und inwiefern sie sie berührt haben.
Bilder betrachten, beschreiben, dazu erzählen: Von Assoziationen mit den Bildern erzählen und Geschichten zu den Bildern erzählen oder erfinden.
Eigenen „heiligen“ Raum gestalten: Der Text vom Raben Felix lädt ein, über die Tiefendimension von Kirchenräumen ins Gespräch zu kommen. Mit verschiedenen Materialien, Tüchern, Bauklötzen, Gegenständen meinen eigenen heiligen Raum als Gebetsraum oder Stille-Oase gestalten.
Orgelmusik (QR-Code) anhören (u. a. innerhalb eines Kirchenraumes): Es bietet sich auch an, in einer Kirche Lieder zu singen oder auch innerlich und äußerlich still zu werden, wie auch ein Gebet gemeinsam zu beten.
6 | … und noch mehr Ideen
Kirche (spielerisch) entdecken: In der Kirche gibt es viel zu erleben und zu entdecken, folgende Möglichkeiten bieten sich an: Genau


hinschauen, z. B. durch eine Papierrolle einzelne Elemente in der Kirche genau entdecken, Fragen stellen (z. B. „Warum ist ein Loch oben in der Kirche?“…), Lieblingsplatz in der Kirche finden oder auswählen, Geschichte aus der Bibel vorlesen, die besondere Akustik entdecken (z. B. durch das Läuten einer Glocke, die Nutzung einer Klangschale oder eines anderen Instruments und durch Töne, die man nachhallen lässt oder durch ein gemeinsam gesungenes Lied), Dinge mit einer Taschenlampe in den Fokus rücken, „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist …” in der Kirche oder anhand eines vielfältigen Bildes einer Kirche spielen.
7 | Kinderbücher
Färber, M. (2012). Wir erleben Gottes Haus: Mit Kindern Kirchenräume entdecken. Don Bosco.
Gremmelspacher, C., Hitzelberger, P. (2022). Kinder entdecken den Kirchenraum. Don Bosco.
Schütz, A. (2010). Mein kleines Buch von der Kirche. Coppenrath.
8 | Lieder
Kommt herein T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse

Besondere Tage – Allerheiligen, Allerseelen
Seiten 46 und 47 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Bestimmte Tage stellen sich für uns Menschen als „besonders” heraus und lassen die Tiefendimension des Lebens erahnen, ermöglichen eine Berührbarkeit und Offenheit im Herzen. Im weitesten Sinne sind die damit verbundenen Erlebnisse und Erfahrungen wohl als Berührungspunkte mit dem Religiösen zu deuten, weil sich darin auch die Grundfragen unseres Menschseins nach dem Woher, Wohin und Wozu unseres Lebens wie von selbst stellen und nach Antworten suchen. Allerheiligen und Allerseelen werden von einem großen Teil der Menschen nach wie vor stark wahrgenommen und zum Friedhofsgang genutzt, weil man der Frage nach dem Tod und dem Darüberhinaus nicht entkommt. Die Liebe und die Verbindung zu unseren Verstorbenen und die eigene Endlichkeit ist eine wesentliche Lebensfrage und lässt sich nicht übergehen, da es um das Leben im Hier und Jetzt geht.
Gerade Kindern stellen sich diese großen Fragen zum Teil mit großer Vehemenz und sie dürfen auch aus pädagogischen Gründen nicht übergangen werden. Die sich ergebenden Fragen brauchen eine kindgemäße Deutung und achtsame Beantwortung, die das kindliche Denken und Fühlen ganz ernst nehmen. Die Religionen, insbesondere auch das Christentum, stellen viele große Erzählungen als Deute-Angebot zur Verfügung, um den Tod und die letzten Fragen nach Himmel und Auferstehung positiv bewältigen zu helfen. Dazu lädt diese Seite ein und bietet mit ihren Texten und Bildern viele Gesprächsmöglichkeiten.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wie sich die Natur im Herbst verändert.
… wie Menschen rund um Allerheiligen und Allerseelen Gräber besuchen, schmücken, Kerzen anzünden … verstehen und deuten … Blumen und Kerzen als Hoffnungszeichen.
… das Schmücken der Gräber und das Erinnern an Verstorbene als Zeichen der Liebe und der Hoffnung. gestalten und handeln … Kerzen mit Hoffnungszeichen verzieren. … eine himmlische Stadt. (be-)sprechen und (be-)urteilen … Fragen nach dem Tod und dem Himmel. entscheiden und mit-tun ... einen Friedhof besuchen.
… Kerzen entzünden und zu Gott für Verstorbene beten.
3 | Lernanlässe
★ Allerheiligen und Allerseelen als schulfreie Tage
★ Friedhofsgang von Eltern, Omas und Opas
★ Fragen nach dem Tod: Wo sind die Verstorbenen? Können uns die Verstorbenen hören? Warum schmückt man die Gräber? U. v a. m.
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix beschreibt eine Beobachtung. Sie geht auf die kürzer werdenden Tage im Spätherbst ein und erzählt davon, dass in dieser Zeit viele Menschen zum Friedhof gehen. Es ist damit eine Brücke zu den beiden Festtagen Allerheiligen und Allerseelen geschaffen. Der Rabe interpretiert nicht, sondern beschreibt, was er sieht. Diese Beschreibungen können Anlass sein, dass die Kinder ihre Beobachtungen, Wahrnehmungen und ihre Gedanken miteinander teilen.
Da Philosophierfragen zum Thema Tod und Sterben und ähnliche Fragen zu den großen Fragen der Menschen und auch der Kinder gehören, laden sie zum gemeinsamen Philosophieren ein. Sie verstehen sich als Impulse zu eigenen Fragen und zum gemeinsamen Nachdenken. Es werden unter anderem christliche Bräuche zu den besonderen Tagen Allerheiligen/Allerseelen benannt. Die Leute gehen zu den Gräbern ihrer Toten. Zu denen, die ihnen wichtig sind, wo es eine Beziehung der Liebe gibt, die über den Tod hinausreicht. Sie bringen Kerzen und Blumen. In diesem Zusammenhang sind es Zeichen der christlichen Hoffnung, dass es neues Leben über den Tod hinaus gibt.
Das Bild „Himmlisches Jerusalem” stammt vom Künstler Henning Hauke, geboren 1961 in der Nähe von Hildesheim in Deutschland (Jahr 2000). Die Rede vom „Himmlischen Jerusalem” erinnert an Texte des Neuen Testaments – im Besonderen an das Buch der Offenbarung des Johannes Kapitel 20 – die in enger Beziehung zur Vorstellung von einer endzeitlichen Errichtung einer Gottesstadt in Glanz und Herrlichkeit steht (z. B. Tobit 14,5). Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem steht als Hoffnungsbild dafür, dass Gott bei den Menschen wohnen und ihr Gott sein wird. Der Künstler ließ sich bei diesem Bild von der mittelalterlichen Buchmalerei inspirieren. Er beginnt mit einer hellen Grundierung und komponiert dann verschiedene farbige Akzente hinein. Rote Elemente, die zum Teil an Blumen und Pflanzen erinnern, goldene Elemente aus Blattgold, die das Göttliche, das Himmlische durchscheinen lassen. Mit unterschiedlichen Farben und Formen kann man vielleicht Elemente wie Bögen, wie angedeutete Gebäude des himmlischen Jerusalem, entdecken. In der Mitte bleibt das Lichtquadrat, ohne Formen. Geheimnisvoll und unaussprechlich. Es lässt offen, was nicht „gewusst” werden kann, weil es der Hoffnung, dem Glauben und dem Ahnen vorbehalten bleibt, dass auch am Ende des Lebens ein liebender Gott auf uns wartet. Ein Hoffnungsbild, das dem Tod den Schrecken nimmt.
Der Vertrauenssatz „Bei dir …“ fasst die christliche Hoffnung in einfacher Sprache zusammen. Mit der Rede vom „zu Hause sein” greift es in gewisser Weise die Sprache des Bildes vom Himmlischen Jerusalem auf, das von der Stadt als Symbol für Heimat und Gemeinschaft erzählt.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bilder der Jahreszeiten (Fokus Herbst): Veränderungen der Natur im Herbst feststellen und darüber sprechen. Das Gestalten einer Collage oder eines Jahreszeitenbildes bieten sich an (Vernetzung: Sachunterricht, Kunst und Gestalten).
Hoffnungszeichen gestalten und verschenken: Kerzen, Kreuze, Blüten, Sterne, Regenbogen, Steine und Hoffnungssprüche bunt gestalten und verzieren und damit Gräber schmücken oder Trauernde beschenken.
Bildarbeit „Himmlisches Jerusalem”: Die Schüler*innen werden angeleitet, das Bild anzuschauen. Es können folgende Fragen gestellt werden: Welche Farben entdeckst du? Welche Formen entdeckst du? Woran erinnert dich das Bild? Finde einen Lieblingsplatz auf dem Bild, zeige ihn den anderen und erzähle, was dir an ihm gefällt. Bildarbeit „Ein Leben bei Gott“: Das Bild „Himmlisches Jerusalem“ erzählt vom Leben bei Gott. Die Schüler*innen überlegen, was das Bild über das Leben bei Gott erzählt. Dabei kann aus Sicht verschiedener Elemente gesprochen werden. Die Schüler*innen können eigene Ideen zum Leben bei Gott benennen.
Legearbeit „Bei Gott zu Hause sein”: Eine helle Kreismitte (evtl. mit Kerze) anbieten und durch Legematerial erweitern lassen. In Zusammenhang mit dem Bild „Himmlisches Jerusalem“ v. a. mit roten, goldenen, bunten Elementen. Als Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit möglich, in Stille oder mit ruhiger, besinnlicher Musik. Arbeitsblatt „Allerheiligen, Allerseelen“: Das Arbeitsblatt lädt ein, selbst ein Bild zum Thema „Bei Gott zu Hause sein” mit unterschiedlichen Farben, Formen und Elementen zu zeichnen bzw. weiterzuzeichnen.
Philosophisches Gespräch: Setting für ein philosophisches Gespräch herstellen, wie z. B. durch einen Sesselkreis, Fragezeichen, Gedankenblase, Rufezeichen als Symbole bzw. Gesprächskärtchen und ruhige Mitte. Wichtig ist es, die Gesprächsregeln zu klären. Beim Vorlesen der Fragen sammeln, welche Gedanken es dazu gibt, ob einem noch weitere Fragen einfallen usw. Die Schüler*innen sollen zuhören, was andere sagen und überlegen, welche Gedanken, Fragen, Vorstellungen sie dazu haben.


6 | … und noch mehr Ideen
Bilder vom Friedhof: Gemeinsam kann man verschiedene Friedhofsbilder – bei Nacht, (un-)geschmückte Gräber, alternative Gräber … – betrachten, besprechen, eigene Erfahrungen erzählen und Fragen stellen. Friedhofsbesuch: Lebens- und Hoffnungszeichen auf dem Friedhof entdecken.
Klassenwand gestalten: Gestaltung durch Fragen der Kinder, Gesprächskärtchen, selbst gestaltete Hoffnungszeichen, Symbole zum Philosophieren und Hoffnungsbotschaften wie z. B. „Bei dir Gott sind wir zu Hause im Leben und im Tod.”
7 | Kinderbücher
Dieckmann, S., Zeitz, S. (2021). Morgen bin ich Sternenlicht. Loewe.
Hubka, Ch. (2004). Wo die Toten zu Hause sind. Tyrolia.
Nilsson, U., Eriksson, E. (2006). Die besten Beerdigungen der Welt. Moritz.
Saalfrank, H., Goede, E. (2020). Abschied von der kleinen Raupe. Echter.
Schindler, R. (2008). Pele und das neue Leben. (13. Aufl.) Ernst Kaufmann.
Teckentrup, B. (2013). Der Baum der Erinnerung. ars edition.
8 | Lieder
Alles hat seine Zeit LB Religion Nr. 49
Wo ich gehe, bist du da LB Religion Nr. 56
Zünd ein Licht an T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse


Allerheiligen und Allerseelen
Zeichne das Bild mit Formen und Farben der Hoffnung weiter.
Allerheiligen und Allerseelen
➜ Zeichne das Bild mit Formen und Farben der Hoffnung weiter.
ICH BIN DA
Bei dir, Gott, sind wir zu Hause, im Leben und im Tod.
Besondere Menschen – Heilige Frauen und Männer
Seiten 48 und 49 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Menschliches Leben lebt vom Geben und Nehmen, wir Menschen sind soziale Wesen, aufeinander angewiesen und brauchen einander. Menschliche Entwicklung wird von den Mitmenschen wesentlich beeinflusst und mitgestaltet, zunächst besonders von der Herkunftsfamilie. Vom Säugling und vom kleinen Kind an wird dem Heranwachsenden das Leben von anderen Menschen geschenkt. Am Du wird der Heranwachsende selbst zum Ich, wie es Martin Buber in seiner dialogischen Philosophie benennt. Es braucht diese „besonderen” Menschen, die unser Leben heilsam begleiten und eine Vision von einem geglückten Leben vermitteln können, indem sie es selbst leben und verkörpern. Damit ermöglichen sie den jungen Menschen Orientierung und geben Sicherheit, wie es mittlerweile auch die Neurobiologie in vielen Forschungen nachweisen kann (Joachim Bauer, Gerald Hüther etc.). Diese Vorbildwirkung ist nicht an überragende Fehlerlosigkeit gebunden. Wir Menschen können aufgrund der Spiegelneuronen mit den Gehirnen unserer Mitmenschen in Resonanz treten und so auch mitbekommen, welche Bilder und Vorstellungen, Empfindungen und Gefühle in ihnen sind bzw. was der andere von einem denkt. Dasselbe gilt auch im pädagogischen Kontext für Kinder und Jugendliche. „Sie leben sich gewissermaßen in den Korridor der Vorstellungen und Visionen hinein, die sich ihre Bezugspersonen – vorausgesetzt, sie haben welche – von ihnen machen. Gibt es keinen solchen ‚Zukunftskorridor‘, dann weiß das Kind nicht, wohin die Reise gehen soll.“ (Bauer 2007, 27). Hier wird deutlich, wie wichtig in pädagogischen Prozessen die Visionen und Vorstellungen sind, die wir von Schüler*innen haben. Früher wurde das in der Pädagogik „der Glaube an die positiven Möglichkeiten jedes Kindes und Jugendlichen“ genannt. Lebensbegleiter*innen, die das Leben der Heranwachsenden fördern, ermutigen und unterstützen, Orientierung und Sicherheit geben können, werden in den Bildern und Texten angesprochen und als „Lichtgestalten“ wahrgenommen und gedeutet. Im Rückblick können Erwachsene oft erkennen, dass diese Gestalten wie Engel oder Heilige im Sinne von „heilbringend“ und vorbildlich in ihrem Leben waren, weil sie ihr Werden und Wachsen liebevoll unterstützt haben. Paulus bezeichnet in seinen Briefen in der Bibel alle Getauften als „Heilige in Christus” und zur Heiligkeit berufen – schon im Hier und Jetzt.
Die Doppelseite kann Schüler*innen dazu einladen, nachzudenken, welche Personen sie in ihrem Leben bisher liebevoll und stärkend begleitet haben. Dann wird durch die Erinnerung an den eigenen Namen an Heilige erinnert. Sie haben in einer bestimmten Zeit in besonderer Weise Licht und Liebe in das Leben der Menschen gebracht. Ihr Leben kann auch als ein Programm des eigenen Lebens den Heranwachsenden voranleuchten. Dargestellt werden im Buch Heilige, die den Kindern möglicherweise schon bekannt sind: Nikolaus, Maria, Elisabeth, Martin. Sie alle verweisen letztlich auf Jesus, der
das eigentliche Licht ist bzw. die Liebe Gottes zu den Menschen in besonders dichter Form gelebt hat.
Es geht im Sinne einer Schatz- und Spurensuche auch darum aufzuzeigen, wie diese Heiligen (oder auch andere regionale Heilige) dargestellt werden, wie sie medial sichtbar werden bzw. was von ihnen bis heute bleibt: unsere Vornamen, Orts- und Straßennamen, Statuen und Bilder, Bräuche, Feste und Riten.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… welche Heiligen sie kennen.
… ob und welche Heiligenstatuen und Bilder sie aus ihrer Umgebung kennen und was sie mit diesen verbinden. verstehen und deuten
… dass heilige Menschen in verschiedenen Formen versuchen, Liebe zu leben.
… zuordnen, wo die Handlungsweisen von Heiligen in der heutigen Zeit zu finden sind. gestalten und handeln
… eine Legende von einem heiligen Menschen nachspielen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… von Menschen erzählen, die uns Licht und Liebe bringen. entscheiden und mit-tun
… selber etwas tun, das Licht und Liebe in das Leben bringt.
3 | Lernanlässe
¬ Erinnerungen an das Laternenfest im Kindergarten
¬ Heiligenbilder und Statuen
¬ Brauchtum rund um heilige Menschen
¬ Hl. Nikolaus – Kinderfrage: Gibt es den Nikolaus wirklich?
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix beschreibt die Beobachtung eines MartinsUmzuges von Kindern mit Laternen und ermöglicht so einen Lernanlass als Einstieg, weil sich Kinder an das Martinsfest im Kindergarten oder an das Basteln von Laternen erinnern. Sein Menschenfreund Max deutet das Geschehen und stellt den Bezug zum heiligen Martin her.
Die Grafik „Zwei Kinder mit Blumen” zeigt Kinder, die einander Blumen schenken. Sie greift den letzten Satz der Erzählung vom Raben auf, dass jede*r für andere ein*e Heilige*r sein kann. Das Schatzkästchen lädt ein, den Kindern schon bekannte Heilige hineinzuschreiben oder diese hineinzuzeichnen, wenn möglich mit den jeweiligen Attributen und Symbolen, an denen sie erkennbar sind. Die rechte Seite zeigt Namen und Bilder von Heiligen und Fotos aus der heutigen Zeit. Im Hintergrund der Seite ist ein Kirchenraum mit vielen Kerzen und einem lichtdurchfluteten Glasfenster zu sehen: Heilige und heilbringende Menschen eröffnen einen heiligen Raum und lassen das Licht des Himmels in diese Erde hereinstrahlen. Die einzelnen Fotos zeigen heute lebende Menschen, die durch ihre heutigen Handlungen den Heiligen zuzuordnen sind: a) zwei Hände, die sich halten (Hl. Maria, die sich ihrem Kind zuwendet); b) Mutter, die ein Pflaster auf das verletzte Knie des Kindes gibt (Hl. Elisabeth, die einem Kranken hilft); c) Martinslaternen (Hl. Martin, der den Mantel
teilt); d) Erwachsener als Nikolaus verkleidet (Hl. Nikolaus mit Buch). Der Satz „Heilige sind Menschen …“ fasst zusammen, warum manche Menschen heiliggesprochen wurden.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bildarbeit: Die Grafik „Zwei Kinder mit Blumen” betrachten, besprechen und nachspielen. Die Schüler*innen können die Kinder sprechen lassen.
Heftarbeit: „Ich schenke dir ein Licht“: Das Weiterschenken eines Lichtes zuerst ausprobieren (unter strengen Sicherheitsvorkehrungen) und als Heftarbeit festhalten. Beispielsweise kann hier dunkles Papier verwendet werden, auf dem die Schüler*innen mit hellen Papierresten ein Bild zum Thema „Wir tragen dein Licht“ kreativ gestalten. Blumen gestalten und mit guten Worten weiterschenken Vorwissen zu Heiligen sammeln: Eingeleitet durch den Text vom Raben Felix können die Schüler*innen Heilige benennen und ggf. bereits bekannte Geschichten kurz erzählen.
Von Heiligen und deren Legenden erzählen: Erzählungen mithilfe von Bilderbüchern, Videos etc. anschauen oder mithilfe von Legematerial oder als Bildgeschichte erzählen. Bilder und Fotos zuordnen: Welches Bild eines*r Heiligen passt zu welchem Foto von heute?
Heiligenmemory basteln und spielen: Es müssen jeweils zwei Bilder zusammenpassen. Es können verschiedene Schwierigkeitsstufen durch unterschiedliche Kombinationen wie gleiche Bilder, Bilder damals + Bilder heute, Bild + Text usw. ermöglicht werden (siehe unten).
Über „Lichtbringer*innen“ nachdenken: Es gibt besondere Menschen, die „Lichtbringer*innen” genannt werden. Was stellst du dir darunter vor? Was muss er*sie deiner Meinung nach können oder tun … wie muss er*sie sein?
6 | … und noch mehr Ideen
Nachdenken über Redewendungen rund um Licht: „Das Licht der Welt erblicken”, „Mir geht ein Licht auf”, „Ein Lichtblick sein”, „Lichtbringer*in sein“, „Da geht die Sonne auf“ etc. an die Tafel schreiben oder in die Kreismitte legen und darüber sprechen. Lehrausgang zu Statuen und Heiligenbildern: Im Ort oder der Stadt auf die Suche machen und vieles entdecken. Laternen basteln: Eine Malvorlage auf normalem Kopierpapier ausdrucken, mit Buntstiften anmalen, das Bild auf der Rückseite mit Speiseöl auf Küchenpapier bestreichen und mit Klammern zusammenheften, die Laterne über ein kleines LED-Licht oder ein Teelicht in einem kleinen Gläschen stellen und leuchten lassen. „Erzählung vom Schuster Martin“ erzählen, besprechen, nachspielen.


7 | Kinderbücher
Bagdaschwili, W. (2004). Die Geschichte von Sankt Martin. Coppenrath.
Janisch, H., Heiskel, B. (2016). Der rote Mantel. Die Geschichte vom heiligen Martin. Tyrolia.
Jooss, E. (2014). 33 Heiligenlegenden zum Vorlesen. Herder.
Sloan, M., Summer, M. (2020). Superheldinnen der Bibel. 16 furchtlose Frauen. Herder.
8 | Lieder
Martin, Martin LB Religion Nr. 141
Sankt Martin LB Religion Nr. 142
Tragt in die Welt nun ein Licht LB Religion Nr. 95
Wer feiert heute Namenstag LB Religion Nr. 139
Wir tragen dein Licht LB Religion Nr. 129
9 | Schnappschüsse







Bildkarten – Heilige Menschen
Bildkarten - Heilige Menschen
Kopiervorlage für Zuordnung, Memory u. v. m.
Kopiervorlage für Zuordnung, Memory, uvm.


Heiliger
Nikolaus
Menschen verkleiden sich als Bischof Nikolaus und beschenken einander.
Heiliger
Martin
Bei Laternenfesten wird nachgespielt, wie Martin seinen Mantel teilte.
Heilige
Maria
Maria ist für viele wie eine Mutter und ein Vorbild, liebevoll miteinander zu sein.
Heilige
Elisabeth
Armen und Kranken zu helfen war für Elisabeth wichtig und ist es auch heute.
Ein ungewöhnlicher Gast nach Leo
Ein ungewöhnlicher Gast nach Leo Tolstoi
Die Erzählung vom Schuster Martin
Die Erzählung vom Schuster Martin
Tolstoi
Martin ist Schuster. Er lebt alleine in einem Haus in der Stadt. Als er noch jung war, hatte er einen starken Glauben. Dann kam aber eine Zeit, wo es Martin nicht so gut ging. Er suchte nach Gott, konnte ihn aber in seinem Leben nie fnnenn AAmmäAiiä eeAle Me rin seinen AMabenn
DMs Feaee im KMmin knisreer ann eebeeirer eine wläAige Wmeme D eMaßen isr es birrerkalt. Martin ist müde. VieAe Siäaäe äMr ee äeare eepMeieern Seine agen weenen siäwee ann ee nösr ein „Wl sinn wläA nie garen alten Zeiten hin?“, siäeeikr Merin äliän „Iiä eeinneee miiä nliä Mn nie wanneesiäönen EezmäAangen übee die Liebe Gottes. Aber als es mir einst sehr schlecht ging, äMbe iiä Mafgeäöer, Mn lrr za gAMaben! Wie slAA ich glauben, was iiä niiär seäen kMnn!“, besrmrigr siiä Merin in seinee HMArang „ iä, nee MAre NMiäbMe rar mir leid!“, Martin schaut zum Fenster hinaus und beobachtet den greisen Mann beim Schneeschaufeln. Martin geht zur Tür, öffnet sie und ruft hinaus: „Komm doch herein, der Tee ist soeben fertig, er wird dich wmemen!“ DMnkenn kAlpfr nee Are nen Siänee ln nen Siäaäen ann reirr in nie Srabe „Einen warmen Schluck schlMge iiä niiär Mas, be le iiä mir meinee ebeir weireemMiäe “
NMiä einee WeiAe sir zr Merin wienee MAAeine le seinem Fensree ann bAiikr äinMas Eesiäeliken eebAiikr ee eine jange FeMa, sie remgr ein kAeines Kinn auf dem Arm. „Die Arme zittert ja am ganzen Leib, und das Kindlein friert, wie schrecklich!“ Martin öffnet abermals seine Haustür. „Kommt doch herein! Ihr holt euch ja nen siiäeeen Tlnn WMeam sein iäe nliä sl spmr anree wegs?“, wiAA Merin ln nee jangen FeMa wissen „ iä, weißr na, mein Mnn isr le einigen Wliäen eesrleben Wie äMben niiärs meäen Zam Aüik kMnn iiä in einem Gasthaus am anderen Ende der Stadt arbeiten und dort auch wohnen. Dann wird es uns wieder besser gehen!“, antwortet die fröstelnde FeMan Merin wmemr iäe einen TeAAee Sappe, unn be le sie weiree will, legt er ihr noch seinen Mantel um ihre Schultern: „Da, nimm, du kannst ihn besser gebrauchen als ich, damit du und dein Kind nicht frieren müssen!“ ir niesen Wleren eeMbsiäiener ee nie UnbekMnnre Merin kann sich nicht einmal hinsetzen, da klopft es an seiner Tür. „Guter Mann, bitte darf ich eintreten und die NMiär bei eaiä eebeingen?“ Ein kAeinee Bab siäMar Merin mir fAeäennen agen Mn „WMeam bisr na nliä za sl einee spmren Sranne anree wegs?“, will Martin wissen. „Ich musste noch dringend Medizin für meine keMnke elßmarree älAen! Den Heimweg siäMffe iiä Mbee niiär meäe!“, eekAmer nee Bab „JM, nMnn klmm äeeein, iiä eiiäre nie einen SiäAMfpAMr z le nem KMmin äee!“, feear siiä Merinn Merin isr slnsr immee MAAeinen „Ein bisschen eseAAsiäMfr rar mie siiäee gar!“, nenkr ee bei siiän Zeirig Mm legen eiiärer ee nem Baben ein Feüäsrüik ann siäneiner nliä eine niike Siäeibe Belr Mb „Hiee, nMmir na niiä anree wegs srmeken kMnnsr!“, meinr Merin ann sreikr nMs Belr in nie JMikenrMsiäe nes Jangen Nan wien es eaäig in nee Srabe und Martin richtet seine Arbeit her. Viele Schuhe müssen heute wieder geflickt werden. Sogar den Auftrag für ein neues Paar hat Martin in den letzten Tagen erhalten.
„Klmisiä, sl ieAe ensiäen äMben miiä in nee NMiär besaiärn VieAe sinn in mein HMas eingekeäern bee Jesas, ln nem iiä sl ieA eeälffre, nee wMe nliä nie bei mien“ Langsam fallen ihm die Augen zu. Martin hat in nee eegMngenen NMiär wläA ieA za wenig gesiäAMfen, sl siäAmfr ee übee seinee ebeir ein. Es dauert nicht lange. „Martin, Martin!“, hört er eine Stimme, die im Traum nach ihm ruft. „Martin, warum zweifelst du an mir? Du hast einem Durstigen zu trinken gegeben, du hast einer hungernden und frierenden Mutter Essen und Kleidung geschenkt. Ein Bab, nen na gMe niiär kMnnresr, wMe nein Msr! Merin, warum zweifelst du noch? Denn immer wenn du anderen Menschen hilfst, genau dann bin iiä bei nie!“ Merin fmäer Mas nem SiäAMf äliä ann beMaiär niiär meäe AMnge za geübeAn „Jesas, iiä zweifAe niiär mehr!“ Zufrieden blickt Martin aus dem Fenster und wieneeälAr nie Wlere, nie ee eben im TeMam eenlmmen äMr: „Die Liebe lrres wien dort sichtbar, wo Menschen einander Gutes tun.“
Die Erzählung vom Schuster Martin
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, Heft 06 2020/21

Besondere Zeiten und Feste
Seiten 50 und 51 im Schulbuch | Kapitel 3
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Besondere Zeiten und Feste sind überlebenswichtig und strukturieren die Zeit, sie heben uns Menschen heraus aus dem Alltäglichen und immer Gleichen, sie ermöglichen Distanz zum Irdischen und verbinden mit dem Tiefengrund des Lebens. Feste, Feiern und fixe, sich wiederholende Zeiten haben aus psychologischer Sicht eine wichtige entlastende Funktion: sie strukturieren, sie geben Sicherheit und spiegeln Verlässlichkeit. Sie stärken das Urvertrauen in die Welt und das Leben, sie geben selbst den Schattenseiten des Lebens wie dem Tod einen Platz. Sie wirken gemeinschafts- und beziehungsstiftend. „DieFeiermachtdenanihrbeteiligtenIndividuendasWoher,Warum und Wozu ihres Lebens, ihrer Gruppe oder der Institution, der sie –immerodernurpartiell–angehören,bewusst.“(Gebhardt2017,39). In Fest und Feier kommt die Sinnebene sehr bewusst und reflektiert zum Tragen, das Mitfeiern ermöglicht die Erfahrung von Sinn, stützt die Wertvorstellungen der jeweiligen Gemeinschaft und rechtfertigt diese als besonders wertvoll. Sie erheben über das Alltägliche, ermöglichen Resonanz und positiven Weltbezug, stiften Gemeinschaft, stärken die Identität, zeigen, was wichtig und wertvoll ist. Fest und Feier haben zweifellos eine das Leben bejahende und fördernde Seite. Sie bejahen das Menschsein-Dürfen und die Freude und Lust am Leben. Josef Pieper benennt diese positive Seite mit ‚Zustimmung zur Welt’. „Es steht ja die Erfüllung der menschlichen Existenz zur Rede und in welcher Gestalt diese Erfüllung sich realisiere.Unvermeidlich also kommt dieVorstellung ins Spiel,die einer von der ‚Vollendung‘ des Menschen hat, vom ‚Ewigen Leben‘, von der ‚Glückseligkeit‘, vom ‚Paradies‘.“ (Pieper 1963,33). So können Fest und Feier wie ein Vorgriff auf die erfüllte Ewigkeit erlebt werden bzw. diese ins Hier und Jetzt hereinholen – sofern Gemeinschaft und Kommunikation, wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung ehrlich miteinander gelingen und nicht nur hohle Klischees bespielt werden.
Die Sehnsucht des Menschen und der Menschheit nach paradiesischen Zuständen auch angesichts des stets gegenwärtigen Todes, nach Erheben aus dem Alltäglichen, nimmt in Fest und Feier, aber auch in den „besonderen Zeiten” Gestalt an. „Ein Fest feiern heißt: die immer schon und alleTage vollzogene Gutheißung derWelt aus besonderemAnlassaufunalltäglicheWeisebegehen.“(Pieper1963, 33). Damit beschreibt Pieper drei wichtige Aspekte des Feierns: a) die schon benannte Bejahung des Lebens, „Gutheißung der Welt“ aus der dankbaren Erfahrung des Lebens, der Welt als Geschenk; b) der „besondere Anlass“ – Feste brauchen einen Anlass und c) „auf unalltägliche Weise begehen“ – Fest und Feier heben aus dem Alltag heraus.
Von dieser Begründung her wird nochmals deutlicher, warum besondere Festzeiten und Feiern besonders auch für Kinder so große (religionspädagogische) Bedeutung haben und als besondere „Lernorte” zu sehen sind. Sie öffnen den Blick über das Alltägliche und Irdische hinaus und ermöglichen eine positive Zustimmung zu sich selbst, zum anderen und zur Welt.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
... Feste, die sie kennen oder auf den Bildern erkennen. verstehen und deuten
... Bräuche zu bestimmten Festanlässen. gestalten und handeln
... Bilder den entsprechenden Festen zuordnen.
…Einladungskarten für Festanlässe gestalten. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Wissen über besondere Zeiten und Feste austauschen.
… was Menschen zu diesen Zeiten und Festen tun. entscheiden und mit-tun
… Feste mitfeiern.
3 | Lernanlässe
★ Heiligenfeste z. B. Martinsfest, Nikolaustag …
★ Vorbereitungen für den Advent
★ Beobachtungen in Geschäften, Straßen und Häusern, in Zusammenhang mit Advent und Weihnachten
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text „In besonderen Zeiten …“ nimmt auf das Feiern in den verschiedenen Lebenslagen Bezug. Für Kinder gehört das Hüpfen und Springen dazu, das Singen, die Lust und Freude am Leben, die Sehnsucht, dass es gut ist und bleibt – eine „Zustimmung zur Welt” (Josef Pieper).
Die Grafik „Kinder“ von Stefan Karch bringt die Freude beim Feiern und die Buntheit des Miteinanders ins Bild. Da gibt es Kinder, die ausgelassen sind, andere, die zurückhaltend beobachten, die neugierig sind, die viel Bewegung brauchen und die einander umarmen … und es gibt Tiere, die mitfeiern und mittollen. Die Grafik zeigt, dass es beim Feiern u. a. um die Sehnsucht nach paradiesischen Zuständen geht. Das Schatzkästchen lädt ein, Typisches von einem oder mehreren Festen, die den Kindern bekannt sind, zu zeichnen, zu malen und davon zu erzählen.
Die Wortreihe und die Bilder bieten einerseits die Namen wichtiger christlicher Feste an und in den Fotos Konkretisierungen, Bräuche … so wie sich Feste eben darstellen. So werden neben im Buch schon vorgekommenen Festen und Darstellungen auch Advent und Weihnachten, die in der Umwelt, in Geschäften und in den Häusern bereits sehr präsent sind, thematisiert. Auch Ostern ist, obwohl es erst später im Jahreslauf im Unterricht vorkommt, zu finden. Es gehört inhaltlich wesentlich zu den großen Festen der Christ*innen dazu und ist durch das Foto von den Ostereiern leicht zuordenbar. Inhaltlich wird es später vertieft.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bilder beschreiben und Assoziationen finden: Dabei die Kinder erzählen lassen, indem sie ihre eigenen Erinnerungen erzählen oder Geschichten zu den Bildern erfinden können. Es lohnt sich, die Unterschiedlichkeit der Kinder auf dem Bild wahrzunehmen und die Gesichtsausdrücke zu interpretieren.
Schatzkästchen ausfüllen: Feste und besondere Zeiten, die die
Kinder kennen, sammeln. Dabei können im Sesselkreis eine Mitte mit Zeichen für Feste (diverse Kerzen, besticktes Tischtuch, Papierschlange, Luftballon, Stern …) gestaltet und im Gespräch noch mehr Ideen gesammelt werden.
Text „Besondere Feste“ lesen: Text vorlesen und besprechen, welche besonderen Zeiten und Feste es gibt und wie die Schüler*innen Verschiedenes feiern.
Activity spielen: Wörter und Gesten, die zu Festen gehören, beschreiben und pantomimisch (alleine oder in Kleingruppen) darstellen. Beispiele wären: begrüßen, essen, singen, gratulieren, Fotos machen, Kerzen anzünden oder ausblasen, spielen … Legearbeit zu Festen und Traditionen: Die Schüler*innen können in einer Legearbeit die verschiedenen Traditionen einem Fest zuordnen.


6 | … und noch mehr Ideen
Einladungen, Karten usw. für ein Fest basteln: Mögliche Anlässe wären z. B. Adventkranzsegnung, Nikolausfeier, Familiengottesdienst, Kindermette, u. v. m. Kirchenjahr kennenlernen: Einfachen Jahreskreis (Kirchenjahr) mit den Festen, die im Buch genannt sind, legen und durch die Ideen der Kinder ergänzen. Mitwachsender/s Jahreskreis bzw. Kirchenjahr: Für die Klassenwand lohnt es sich, auch das Kirchenjahr mitwachsen zu lassen. Möglich wäre z. B. wie bei einem Adventkalender, dass Feste aufgedeckt oder hinzugefügt werden, wenn sie (bald) stattfinden.
7 | Kinderbücher
Biehl, P. (2019). Das Kirchenjahr für Kinder. Camino. Schwikart, G. (2014). Vom Kirchenjahr den Kindern erzählt. Butzon & Bercker.
8 | Lieder
Wir feiern heut’ ein Fest T. von R. Krenzer, M. von L. Edelkötter; Nr. 3 im HB-Anhang
9 | Schnappschüsse


Das kann ich … das weiß ich …
Seite 52 und 53 im Schulbuch | Kapitel 3
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient wieder der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in Religion beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anlangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …) sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten.
Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 54 im Schulbuch | Kapitel 3
Die Schlussseite ist eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Ein Gebet als spirituelles Angebot steht im Mittelpunkt. So kann über das ganze Schulbuch ein kindgemäßer Schatz an Gebeten, Liedern oder Geschichten bzw. Sätzen zum Nachdenken aufgebaut werden. Auch hier taucht als grafisches Element des Künstlers Alois Neuhold das Symbol des Regenbogens auf, der etwas verfremdet nicht nach oben gewölbt ist, sondern der an einen Arm erinnert, in den man sich bergen kann. Aufgefangen, getragen, geschützt vor dem, was sich ganz unten in bedrohlichen Farben und Formen zeigt. Das Leben der Kinder ist nicht nur schön. Sie nehmen auch Gefährdungen wahr, sie sind auch konfrontiert mit Schicksalsschlägen, mit Gewalt, Trennung … Der Arm Gottes und hoffentlich vieler Menschen bietet sich wie ein bergendes Nest, wie eine schützende Hand an, um in dieser oft auch bedrohlichen Welt gut und vertrauensvoll leben zu können. Hinein in dieses bergende Nest, in den schützenden Arm gibt es ein Gebet, das in übertragenem Sinn und auf eine andere Art und Weise auch ein „bergendes Nest” für die Kinder sein kann. Ein klares und kraftvolles Vertrauensgebet als Beitrag zu einem noch weiter aufzubauenden Gebetsschatz.
Literatur zum 3. Kapitel
Bauer, J. (2007). Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.
Bitter, G. (2009). Ästhetische Bildung. In: Bitter, G./Englert, R./Miller, G./Nipkow, K. E. (Hrsg.). Neues Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe. München: Kösel Verlag.
Degen, R./Hansen, I. (2009). Architektur und Kirchenraum. In: Bitter, G./Englert, R./Miller, G./Nipkow, K. E.: Neues Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe. München: Kösel-Verlag.
Englert, R. (2012). Heimat: Warum uns Orte so wichtig sind. In: KatBl 137 (2012), 163–169. München: Kösel-Verlag.
Gebhardt, W. (2017). Vom Verschwinden der festlichen Freiheit. Über das „Management“ der Gefühle in hybriden Events, in: Betz, Gregor J./Hitzler, Ronald (Hg.). Hybride Events: Zur Diskussion zeitgeistiger Veranstaltungen. Wiesbaden: Springer Verlag, 37–50. Mendl, H. (2008). Religion erleben. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht. 20 Praxisfelder. München: Kösel-Verlag.
Pieper, J. (1963/2012). Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes. München: Kösel-Verlag.
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, Heft 06 2020/21
KAPITEL 4: Erwarten und feiern. ADVENT UND WEIHNACHTEN
Seiten 55 – 70 im Schulbuch
Impuls
Gottes Menschwerdung ist die große Mitteilung
Seiner Liebe.
In ihr schaut der Mensch Gott ins Angesicht.
Hildegard von Bingen
Allgemeine Hinführung
Wohl kaum eine Zeit ist für Schüler*innen so emotional aufgeladen und so interessant wie die Advent- und Weihnachtszeit und deshalb auch für Kinder so gut zugänglich. Es ist eine Zeit voller Geheimnisse und Geschehnisse, es liegt für die meisten Kinder ein besonderer Schleier und Zauber über dieser Zeit, der das Dahinterliegende, das Transzendente erahnen lässt. Zwei Aspekte stehen in diesem Buchkapitel im Vordergrund: einerseits das Warten auf das Kind (letztlich auf Christus) und auch die Symbolik des Lichtes wird immer wieder aufgegriffen bzw. klingt immer wieder an; schließlich sind Advent und Weihnachten auch die Zeit der Lichter, wie schon das Titelbild andeutet.
Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, wird in den Häusern, Straßen und Geschäften, in den unzähligen Lichtern, in den vielfältigen Bräuchen sichtbar und erlebbar, was Menschen erhoffen und ersehnen. In manchen dieser Bräuche zeigt sich die jüdisch-christliche Tradition, in manchen weniger offensichtlich. Kinder werden in dieses Geschehen rund um sie herum mit hineingenommen, ohne dass es Räume des Reflektierens und des Gesprächs darüber gibt. Dieses Kapitel im Buch gibt Anregungen dazu. Das Buch stellt das kindliche Erleben und Erfahren bewusst in den Kontext der christlichen Tradition und sucht Korrelation, Lern- und Gesprächsanlässe zwischen außen, vor Ort für Kinder Erlebbarem und der spirituellen Tiefendimension dieser Zeit. Da gibt es große Persönlichkeiten und Heilige wie Bischof Nikolaus, besondere prophetische Texte, Lieder und Gebete, Bräuche und Rituale, die in dunkler Zeit Licht und Hoffnung bringen und auf den Geburtstag von Jesus vorbereiten, auf den alles hinausläuft und fokussiert. Gott kommt als Menschenkind und ist angewiesen auf die menschliche Zuwendung und Liebe wie jedes andere Kind, ein Kind auf Herbergsuche: großer Gott ganz klein –keine heroische Gotteserscheinung wie in vielen anderen Religionen, sondern von Anfang an auch mit Schwachheit und Verletzlichkeit verbunden bis zum Kreuz. Allerdings ist mit Rudolf Englert vom di-
daktischen Modell her ernst zu nehmen, dass es dabei nicht um die „richtigen Antworten“ geht, „sondernumHerausforderungenandas eigeneDenken.SolcheModellewollennichtangeeignet,sondernfür gedankliche Selbsttätigkeit in Dienst genommen werden.“ (Englert 2013, S. 20) – eine wahrlich große Herausforderung.
Im Warten auf das Kind wird das göttliche Geschehen, das sich in jedem Kind ereignet, geerdet und die Geburt Jesu des Erlösers, das besondere Weihnachtsgeschenk für die ganze Menschheit, vorbereitet, die in den erzählenden Bildern und Texten der Kindheitserzählungen nach Lukas breit geschildert wird und den zentralen Platz einnimmt. Texte, Bilder und Lieder sind Angebote, die Schüler*innen vom Wahrnehmen zur Deutung hinführen und der Möglichkeit von Mitgestaltung und Mitfeiern. Wie es der Lehrplan auch vorsieht (Kompetenzbereich B4), soll es zu einer grundsätzlichen Einführung in die „gelebte und gelehrte Bezugsreligion” kommen, wie auch zu einem Grundverständnis, was im Advent und zu Weihnachten gefeiert wird.
Lehrplanbezüge des 4. Kapitels
Kompetenzbereich | B4a Gelebte und gelehrte Bezugsreligion Leitkompetenz | Kirchliche Grundvollzüge kennen und religiös-spirituelle Ausdrucksformen gestalten können.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen kennen zentrale Feste im Kirchenjahr und können deren Inhalte gestalterisch zum Ausdruck bringen.
Anwendungsbereiche | Advent- und Weihnachtszeit, die Kindheitsgeschichte nach Lukas Unterrichtshinweise | Zeichen, Symbole und Traditionen im Weihnachtsfestkreis; die Huldigung der Sterndeuter (Mt 2,1–12) Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können darstellen, was im Advent und in der Weihnachtszeit gefeiert wird.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte: Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
FreiheitundOffenbarung: Quellen der Offenbarung sind die Bibel und die kirchliche Tradition in ihrer Vielfalt. Auf der darin grundgelegten Freiheit des Menschen basiert die Achtung der Religionsfreiheit jeder Schülerin und jedes Schülers.
Mögliche Vernetzungen und Projekte
★ 9 Sexualpädagogik
★ 10 Sprachliche Bildung und Lesen
Titelseite: Erwarten und feiern. ADVENT UND WEIHNACHTEN
Seite 55 im Schulbuch | Kapitel 4
Das Titelbild „Weihnachtskrippe” zeigt eine aus dem Hintergrund beleuchtete Weihnachtskrippe, neben der sich ein Weihnachtsbäumchen mit einer Lichterkette befindet. Durch diese Komposition werden zwei Dimensionen des Weihnachtsfestes ins Bild gebracht, zum einen die zu Grunde liegende Weihnachtsgeschichte und zum anderen auch auf Adventmärkten und privaten Grundstücken zu entdeckende, mit Lichtern geschmückte Bäume. Das Weihnachtsfest bietet inmitten der dunklen Jahreszeit Anlass, sich durch das Erstrahlen von Lichtern verzaubern zu lassen und darüber nachzusinnen, welche Sehnsüchte und Wünsche der Menschen sich (oft in der Dunkelheit) verbergen und darauf warten, von Licht erfüllt zu werden. Wie auch im Bild stellt das Licht das verbindende Element zwischen dem Religiösen und Säkularen der Weihnacht dar und kann insbesondere Schüler*innen, für die mit der Adventzeit eine ganz besondere Zeit beginnt, verzaubern. Außerdem lädt es in einer Zeit des hektischen Konsumierens zum Innehalten und Durchatmen, zum Ruhe-Finden und entdecken der erhellenden Kraft des Lichtes ein.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeit für die Arbeit mit der Titelseite
Krippenfiguren allmählich zur Krippe stellen: Mit Beginn der Adventzeit kann man mit den Schüler*innen gemeinsam das Geschehen rund um die Weihnachtskrippe nachempfinden, indem in mehreren

Schritten Krippenfiguren zu einem Krippengebäude gestellt werden. Mit der Anzahl der Schafe bzw. der Hirt*innen kann man auf die Klassenstärke Rücksicht nehmen und gleich von Beginn an planen, dass es für jedes Kind eine Krippenfigur gibt, die zu gegebener Zeit zur Krippe gestellt werden kann. Anfangs ist das Krippengebäude ein einfacher Stall (Stall aufstellen). Ein Schaf sucht bereits Unterschlupf und legt sich unter das Dach (Schaf in den Stall stellen lassen). Hirt*innen hüten die Schafe, die auf den Feldern ringsum weiden. Noch richtet sich ihr Blick in die Ferne. Manche wenden auch noch ihren Rücken dem Stall zu (Hirtinnen, Hirten und Schafe rund um den Stall hinstellen lassen). Nach und nach kommen mehr Schafe näher an den Stall heran (weitere Schafe dazustellen lassen). Ein Ochse gesellt sich nun zu ihnen (Ochse in den Stall stellen). Noch ist die Futterkrippe mit Heu gefüllt (ev. Krippe mit etwas Heu befüllen). Hin und wieder fressen die Tiere gemeinsam daraus (Ochse und Schafe zur Futterkrippe stellen). In der Ferne kann man schon Maria und Josef erblicken (Maria, Josef und einen Esel etwas weiter entfernt aufstellen). Je näher wir auf das Weihnachtsfest zugehen, umso näher kommt die hochschwangere Maria, sie wird von Josef begleitet (Maria und Josef mit dem Esel stückweise immer näher zum Krippengebäude stellen). Erst mit dem Weihnachtsfest (im Religionsunterricht ev. die letzte Stunde vor den Ferien) wird das Geschehen in und um die Krippe ganz auf die Geburt Jesu ausgerichtet. Das Kind liegt in der Krippe (Jesuskind hineinlegen lassen), Maria und Josef sind ganz nah. Auch Ochse und Esel rücken näher. Die Hirt*innen gehen auf die Krippe zu und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Man hat das Gefühl, als versucht auch die Schafe durch ihre Nähe das Jesuskind zu wärmen (Figuren entsprechend näherrücken, alle schauen auf Jesus). Ein Engel verkündet die Geburt Jesu (Engel ev. auf das Dach des Krippengebäudes stellen). Andächtig konzentriert sich nun sämtliches Geschehen auf das Kind in der Krippe.
Ist nach den Weihnachtsferien eine Unterrichtseinheit zu den Sterndeutern geplant, so können auch diese dann noch zur Krippe gestellt werden. (Vielleicht von den Kindern aufstellen lassen, die bei der Dreikönigsaktion mitgemacht haben).




Advent – Auf Weihnachten warten
Seiten 56 und 57 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Grafiken und Fotos auf der linken Seite laden dazu ein, die verschiedenen Formen, wie sich Advent in der Welt zeigt, wahrzunehmen und sich darüber auszutauschen. Wie bei jedem Kapitel geht es auf der ersten Doppelseite um ein Aufmerksamwerden, um ein Wahrnehmen und Schulen der Wahrnehmung für das Naheliegende und Offensichtliche, das den Kindern in ihrer Umgebung begegnet, das es zu entdecken gilt, aber es lädt auch ein zum Fragen und zum Gespräch über das Dahinterliegende, über die Tiefendimension des Lebens. Das Alltägliche wird gern übersehen, weil sich unser Auge schon so sehr daran gewöhnt hat. So braucht es immer wieder auch einen Blick-Umbruch, ein Umkehren der Wahrnehmung und ein Hinweisen darauf und ein Sich-nicht-so-schnell-zufrieden-Geben, sondern weitersuchen, Neugier und Interesse wecken und sich der verborgenen, dahinter liegenden Wirklichkeit öffnen. Für viele Kinder, die heute nicht mehr religiös sozialisiert sind, braucht es ein vorsichtiges und achtsames Herantasten an das Geheimnisvolle, das im Advent und zur Weihnacht als zentrales christliches Ereignis gefeiert wird. Kirchliche Sprache – z. B. dogmatische Begriffe wie „Gottes Sohn”, „Erlöser” … – sind vielen Kindern und ihren Eltern völlig fremd und nichtssagend geworden, wenn nicht gar missverständlich. Da braucht es eine achtsame Sprache, viel an Gespräch und kindgemäßer Kommunikation, damit sich das Geheimnis der Weihnacht erschließen kann, das viele ersehnen, erwarten und erhoffen, damit Christus tatsächlich auch sie berühren kann bzw. in ihren Herzen „geboren” werden kann (Angelus Silesius). Schließlich geht es um nicht weniger als Erlösung und Befreiung … und „Erlösung will erfahrbar sein”(Höfer 2002). Damit dies gelingen kann, braucht es kindadäquate Zugänge, Korrelationen zu ihrem Leben, ihrem Sehnen, ihren Wünschen und Hoffnungen, damit aber auch zu ihren Unerlöstheiten, weil wir nicht über das Heil sprechen können, ohne im Hintergrund auch das Unheil zu benennen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… adventliche Veränderungen in Straßen, Geschäfte … verstehen und deuten
… dass sich im Advent Wünsche und Hoffnungen der Menschen ausdrücken.
… dass gläubige Menschen die Hoffnung auf Jesus, das erlösende Licht für die Welt, haben. gestalten und handeln
… Hoffnungssterne z. B. als Klassenadventkalender. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Dinge und Erlebnisse, die vom Advent erzählen.
… wie Licht ins Dunkel gebracht werden kann.
… Wünsche und Hoffnungen. entscheiden und mit-tun
… eine Adventfeier (mit-)gestalten.
… Advent- und Weihnachtslieder singen.
3 | Lernanlässe
★ Kinder freuen sich auf Weihnachten
★ Fragen, warum es Adventkalender, Adventkranz, Christbäume, Weihnachtsmänner usw. gibt
★ Allgegenwärtige Accessoires von Festen (in Geschäften)
★ Nicht alle feiern die gleichen Feste
★ Kerzen, Sterne und Lichter in der dunklen Jahreszeit
★ Advent in der Schule
★ Geschmückte und beleuchtete Städte, Wohnungen,…
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Fotocollage zeigt Elemente der Advent- und Weihnachtszeit. Das Schmücken der Schulklassen, der Adventkranz, das Keksebacken, das Krippenspiel … und laden zu einer Schatz- und Spurensuche nach Zeichen des Advents und von Weihnachten im Umfeld der Schüler*innen ein. So wird diese besondere Zeit durch die vielen äußeren Zeichen und Symbole, Bräuche und Feiern erlebbar, sichtbar, riechbar, spürbar. In der Mitte der Collage, verhalten und transparent, das Zentrum des ganzen Tuns, Feierns und Vorbereitens: der Blick auf die Geburt Jesu, die Christ*innen zu Weihnachten feiern. Die folgenden Themen werden durch die Bilder aufgemacht:
Das dekorierte Fenster erinnert an die geschmückten Schulklassen, Schulhäuser und auch Wohnungen, welche die Schüler*innen wahrnehmen können. Das Schmücken für einen bestimmten Anlass ist eine gut sichtbare Vorbereitung auf eine besondere Zeit und spiegelt oft deren Kennzeichnen wieder. In diesem Bild stehen die Sterne für das Licht, welches die Dunkelheit erhellt und als Metapher für die Ankunft Jesu.
Das Keksebacken ist eine weitere Besonderheit in der Adventzeit. Oft wird es gemeinschaftlich in der Familie durchgeführt, doch auch wenn nicht zusammen gebacken wird, erfüllt der Duft von frisch gebackenen Keksen den einen oder anderen Raum, ob zu Hause oder bei Oma und Opa, und bringt Advent- und Weihnachtsstimmung. Das Bild der verkleideten Kinder bei der Krippe weist darauf hin, dass auch heute noch in vielen Pfarren ein Krippenspiel am Heiligen Abend aufgeführt wird, welches in der Adventzeit vorbereitet und einstudiert wird. Häufig spielen dabei Schüler*innen der VS eine Rolle. Vielleicht spielt ein Kind aus der Klasse mit oder sie kennen Darsteller*innen. Der Junge mit einer Laterne kann an das Austeilen des Friedenslichtes von Betlehem oder an die an manchen Orten übliche Herbergsuche als Weihnachtstradition erinnern oder einfach auf die Dimension des „Lichts in der Dunkelheit” verweisen. Der Adventkranz ist in vielen Häusern und Wohnungen anzutreffen, aber auch in Schulen, öffentlichen Gebäuden und Geschäften weit verbreitet. Er kann heute unterschiedliche Formen annehmen, jede Woche wird eine weitere Kerze entzündet und bringt uns so näher an das Weihnachtsfest. Zugleich ist das Licht der Kerzen aber auch das, was uns verbindet, wenn wir uns ums Licht einer Kerze versammeln, und schenkt Geborgenheit, Stille und Frieden. All das korreliert mit dem menschlichen Wunsch und Bedarf der Kinder nach Angenommen-, Gewollt- und Erwünschtsein, nach bergendem Ein-
gebundensein ins große Ganze dieser Welt, um Sinn zu finden trotz aller Fragilität der Welt. Mit dem Bild des Adventkalenders wird ein heutzutage teilweise überdimensioniertes Zeichen zum Verkürzen der Wartezeit bis Weihnachten eingebracht. Adventkalender sind den Schüler*innen meist bekannt und auch häufig in den Schulen und Klassen anzutreffen.
In den Schatzkästchen ist wieder Platz für das, was die Kinder in ihrer konkreten Lebenswelt entdecken und wahrnehmen. Durch die Begriffe „hören, sehen, tun …” wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Advent mit vielen Sinnen entdeckt werden kann. Durch das Tun wird ein weiter Raum für die eigenen Erfahrungen eröffnet. Das Bild vom Sternenhimmel zeigt ein Mädchen, das fasziniert und staunend nach oben blickt. In der dunklen Zeit leuchten viele kleine Lichtpunkte. Ob es Schneeflocken oder Sterne sind, bleibt offen. Aufmerksames Schauen, Warten, Wahrnehmen und Erwarten sind wesentliche Merkmale des Advent. In der Zeit, in der es kurze Tage und lange Nächte gibt, ist das Schauen auf das Licht ein Element der Hoffnung.
Der Text vom Raben Felix erzählt, was er wahrnimmt: Lichter und Adventkränze. Er stellt einen Lernanlass her und deutet darauf hin, dass die Advent- und Weihnachtszeit gerade stattfindet bzw. kommt. Der QR-Code führt zu einem Video zum „Advent entdecken”. In diesem Video wird in kindgerechter Weise über die Symbole des Advents gesprochen und auf das eingegangen, um was es im Advent geht, das Warten auf die Ankunft Jesu.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Advent(-bilder) entdecken: Die Bilder zur Adventzeit anschauen und entdecken, Assoziationen besprechen und einander erzählen, was man sieht, ob man das auch kennt, welche Fragen man dazu hat usw. Es kann auch gefragt werden, welches Bild die Schüler*innen als Lieblingsbild auswählen würden und warum. Der Erzählanlass zur Frage „Wo wir etwas vom Advent entdecken” bringt eine Vielzahl an Orten ein, an denen der Advent erlebt werden kann, ob in der Schule, zu Hause, an öffentlichen Plätzen (z. B. Adventmärkten), Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen, in der Kirche, usw. Adventbilder aussuchen: In der Klasse werden Bilder und Fotos aufgelegt, die etwas mit dem Advent zu tun haben. Jedes Kind darf sich ein Bild aussuchen und erzählen, was es auf diesem Bild entdeckt und warum uns dieses Bild etwas vom Advent erzählt. Die Bilder werden in der Mitte gesammelt (Sesselkreis) oder auf ein Tuch gelegt. In der Mitte kann der Adventkranz oder eine Kerze stehen. Arbeitsblatt „Der Advent“ gestalten und über die Symbolik des Adventkranzes nachdenken. Zur Beantwortung der Fragen wird „Was der Adventkranz erzählt“ (siehe unten) vorgelesen und besprochen. Schatzkästchen befüllen: Zeichnen oder schreiben, was man im Advent sehen, hören, riechen, tun … kann.
6 | … und noch mehr Ideen
Kerze anzünden und Licht weiterschenken: Eine Kerze (ggf. am Adventkranz) anzünden und ggf. ihr Licht unter strengen Sicherheitsvorkehrungen „weiterschenken“. Dazu könnte vom Adventkranz ein Licht an ein Teelicht weitergegeben werden. Dieses wird dann durch die Klasse sehr vorsichtig weitergegeben. Stilleübung „Wenn eine Kerze brennt“: Während der Stilleübung (siehe unten) können die Schüler*innen die damit verbundene Ruhe
wahrnehmen und genießen. Sie nehmen wahr, was man hört, riecht, sieht, wenn eine Kerze brennt. Die Stille unterstreicht den besonderen Charakter der Adventzeit und macht diesen spür- und erlebbar. Das ist von Bedeutung, da der Advent im privaten Umfeld als hektische Zeit gekennzeichnet sein kann.
Adventlieder singen: Durch das Singen von Adventliedern wird der besondere Charakter dieser außergewöhnlichen Zeit hervorgehoben und die Schüler*innen können sich auf diese einstimmen. Adventfeier gestalten: Während des Advents können kurze Adventfeiern in der Schule stattfinden, an denen die ganze Schulgemeinschaft beteiligt ist. Da es vier Adventwochen gibt, könnte man es so einteilen, dass jede Klasse einmal bei der Gestaltung der Feier beteiligt ist. Die Schüler*innen können entweder selbst überlegen, wie die Feier ablaufen könnte und ihre Ideen einbringen oder werden für verschiedene Aufgaben (z. B. Anzünden einer Kerze am Adventkranz, Aufsagen eines Gedichts, Singen eines Lieds, usw.) eingeteilt. Adventkranz zeichnen oder basteln: Im Heft, auf der Pinnwand, am Fenster einen Adventkranz mit Papier gestalten. Jede Woche eine Kerze „anzünden“ bzw. mit einer Flamme versehen und so wie ein Adventkranz die Wartezeit vor Weihnachten verkürzen.
7 | Kinderbücher
Bartoli y Eckert, P. (2019). Mit 24 kurzen Geschichten durch den Advent. Verlag an der Ruhr.
Biehl, P. (2019). Das Kirchenjahr für Kinder. Camino.
Bollinger, M. (2017). Wunder geschehen ganz leise. 24 Weihnachtsgeschichten. Verlag am Eschbach.
Hebert, E., Rensmann, G. (2021). Advent und Weihnachten. Minibilderbuch. Don Bosco.
8 | Lieder
Wenn uns’re Kerze brennt T./M. v. Detlev Jöcker; Nr. 4 im HBAnhang
Wir sagen euch an, den lieben Advent LB Religion Nr. 92
9 | Schnappschüsse






Der Advent
Der Advent
Religion
Im Advent warten wir auf die Geburt von Jesus. Wir machen uns bereit . Gestalte den Adventkranz und überlege: Was erzählen die grünen Zweige? Was erzählt der runde Kranz? Was erzählen die vier Kerzen und ihr Licht?
Im Advent warten wir auf die Geburt von Jesus. Wir machen uns bereit!
➜ Gestalte den Adventkranz und überlege: Was bedeuten die Symbole?
grün – rund – vier Kerzen – Licht

Schatzbuch Religion
Was der Adventkranz erzählt
Was der Adventkranz erzählt …
RUND, WIE EIN KREIS
Ich bin rund wie ein Kreis. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Ich erzähle dir, dass Gottes Liebe immer da ist. Sie hat kein Ende, wie dieser Kreis. Er ist immer da und lässt dich nie allein.
GRÜN, MITTEN IM WINTER
Ich bin grün. Mitten im Winter, wenn alles kalt und kahl ist, erzähle ich dir, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Mitten im Winter erinnert mein Grün an das Leben und das Blühen des Frühlings.
VIER KERZEN
Ich habe vier Kerzen. Sie zeigen in alle Himmelsrichtungen. Überall, an allen Enden der Erde, ist Gott mit seiner Freundschaft für die Menschen da. Im Advent, wenn draußen alles fnster st, w rd Snntaa für Sonntag immer eine weitere Kerze angezündet So wird es immer heller.
JESUS IST DAS LICHT GOTTES
Die Kerzen erinnern an das Licht, das von Gott kommt. Jesus ist das Licht von Gott für die Welt. Zu Weihnachten feiern wir seinen Geburtstag.
Was der Adventkranz erzählt Handbuch zum Schatzbuch Religion 1

Erzähltext zum Schatzbuch Religion 1
Finster Verlag
Stilleübung: Wenn eine Kerze brennt
Stilleübung: Wenn eine Kerze brennt
Vorbereitung: Den Raum abdunkeln und evtl. ganz ruhige Musik im Hintergrund abspielen. Alle Schüler*innen machen es sich auf ihrem Platz gemütlich und schließen die Augen. Besonders bietet sich ein Setting an, in dem die Schüler*innen ohne den Platz zu verlassen eine Mitte betrachten können (evtl. Sesselkreis oder U-Form der Tische). Beim Vortragen des Textes ist darauf zu achten, dass mit einer besonders ruhigen Stimme gesprochen wird. Die im Text vorgetragenen Schritte werden nebenbei ausgeführt. Dazu werden eine möglichst große Kerze in die für alle sichtbare Mitte gestellt und Streichhölzer vorbereitet.
Du befinees ndic di ediee ucdiein bienui kelsei R ue uin wd es eelbes i i z esdll. Du eicldeßs nedie Auiei . Du cö esn n ee edie Sic icsel ieöffies wd n.
Du cö esn wde edic edi Feue bede Ss edic ei i ne Sic icsel eisf ics. Vdelledics deices nu nei Ge u ic ediee Züinc olzee. Du öff iees ledee nedie Auiei. Du eic u es n e Ldics e Ss edicc olz i . Jes zs beweis edic n e Ldics di Rdicsuii ne Ke ze. Ee wd n i nei Doics iec lsei … bde nde Fl eee übe ep diis. Jes zs b eiis nde Ke ze.
D e Ss edicc olz wd n i i z ledee ueiebl eei. Du deices jes zs vdelledics nei Dufs nee e loeiceiei Ss edicc olzee de R u e uin eic ues uf nde Ke zen nde iui b eiis . Ic Ldics e fülls nei nui klei R u e Du eselles nd vo n iäce i ne Ke ze zu eedi uin dc e Wä ee zu epü ei . D deeee w ee Gefücl ideees nu nd eds di nediei Kö pe . Du seees sdef edi uin wdene u e
Nui seees nu sdef nu icn nu es edices eds nediei Häinei übe nedi Geedics Du es ei kes ndic uin eic ues ledee ue ndic ce ue. Du ideees nei R ue uin nde ine ei Kdine wdene w c …
Wenn alle Schüler*innen die Übung abgeschlossen haben, kann diese gemeinsam reflektiert werden. Je nach der angestrebten Weiterarbeit wird auch der Raum wieder erhellt
Stilleübung: Wenn eine Kerze brennt
Handbuch zum Schatzbuch Religion 1

Advent – Sich freuen und Gutes tun
Seiten 58 und 59 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
In vielen Liedern wird der Advent als „stille Zeit“ besungen, manchmal romantisierend, manchmal wohl in echter Sehnsucht nach Stille in einer lauten und hektischen Welt, die das Fragen und Suchen übertönt und verunmöglicht, weil alles Fragen und Suchen auch uns selbst und unser Leben manchmal unangenehm in Frage stellt. Die ständige Beschallung und Musik in den Shoppingzentren sowie auf den Advent- und Weihnachtsmärkten sind ein markantes Zeichen für diese Verdrängungsmechanismen. Es geht aus einem kommerziellen Blickwinkel um konsumorientiertes Wohlgefühl und Happysein, da ist für ernsthaftes Fragen kein Platz mehr. All das wird aber durch das christliche Advent- und Weihnachtsgeschehen irritiert, denn da geht es um Gottes Geburt in einem Stall am Rande der Gesellschaft, bei den Armen und Hirten, um Flucht und Unbehaustheit: das Kind von Betlehem als das wahre Weihnachtsgeschenk, keine Idylle. Dazu dient auch diese Doppelseite, die Bischof Nikolaus und das Tun des Guten, das Beschenktwerden und unser von Gott her Beschenktsein ins Zentrum rückt, wie es sich in der Geburt Jesu zu Weihnachten nochmals verdichtet. Insbesondere im Advent empfangen Kinder u. a. durch Adventkalender (Klasse, Schule, zu Hause, bei Oma und Opa, usw.) sowie den Besuch vom Nikolaus größere und kleinere Geschenke, die ihnen das Warten auf das Weihnachtsfest, bei dem wiederum meist viel geschenkt wird, verkürzen. Zu beobachten ist, dass viele Kinder sich auch selbst gerne als Gebende verstehen und Freude daran haben, andere, zum Beispiel mit Selbstgebasteltem, zu beschenken. Das Schenken in unserer Zeit als Ausdruck des Gebens allgemein zu verstehen und auch das Tun des Guten am anderen als Geschenk deutbar zu machen, ist eine wesentliche Aufgabe des Religionsunterrichts. Denn in dieser oft von Geschenken überhäuften Zeit geht es im Wesentlichen eben nicht darum, das größte, teuerste, beste Geschenk zu bekommen, sondern darum, selbst zum Licht für andere zu werden, um Jesus den Weg zu bereiten aus dem Wissen heraus, dass jeder und jede zutiefst schon beschenkt ist (Gnade) und selbst deshalb zum Geschenk wird: der Geber ist die Gabe. Nach Bernhard Dessler (2012) werden im „ReligionsunterrichtgrundlegendeFragen derSelbst-undWeltdeutungaufgeworfen.Erzieltaufmehrab,alsauf diekulturhermeneutischeFähigkeit,religiöseTraditionsspureninden Museen undTheatern,in der Literatur,im Kino,in der Popkultur und nicht zuletzt in unserem Rechts- und Sozialsystem lesen zu können. Daswärenichtnichts,liefeaberletztlichnuraufeineTraditionspflege hinaus,diefürdieLebensdeutungund-orientierunginderGegenwart kraftlos bliebe.“ (Dessler, 2012, S. 70–71). Gerade auch der Advent und die Weihnachtszeit bieten in diese Richtung grundlegende Möglichkeiten, die weit über „Traditionspflege“ hinausgehen und uns die Tiefendimension unseres Lebens bewusst machen, die nach Antwort sucht. Bischof Nikolaus von Myra, Namenstag 06.12, also mitten im Advent, dient in der Auseinandersetzung mit dieser Doppelseite als Vorbild, um den Kindern näherzubringen, was es heißen kann, die
Not der Menschen zu sehen, Gutes zu tun und anderen Menschen –besonders im Advent und mit Blick auf das Weihnachtsfest – Freude zu schenken. Dazu dient die Erzählung von den drei goldenen Äpfeln, die mittels QR-Code angehört werden kann.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Gefühle beim Tun und Empfangen von Gutem.
… Legende von Bischof Nikolaus. verstehen und deuten
… verstehen und deuten, was es heißt „Gutes zu tun”.
… verstehen, wie Bischof Nikolaus Gutes getan hat. gestalten und handeln
… Nikolauslegenden nachspielen.
… ein Heiligen-Licht gestalten. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… von Lichtbringer*innen in meinem Leben erzählen. entscheiden und mit-tun
… Mitgestalten od. Mitfeiern einer Adventheiligenfeier.
3 | Lernanlässe
★ Namenstag von Schüler*innen in der Adventzeit
★ Nikolaus und Weihnachtsmann in der Lebenswelt
★ Gedenktag des heiligen Nikolaus am 6. Dezember
★ Nikolausfeier in der Schule
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Nikolausspruch „Lieber Bischof …“ versucht in Reimform das Zentrale dieser besonderen Heiligengestalt zu benennen: das Kommen zu allen Menschen, Segen bringen, Helfen, Freude bringen, bedenken, was es wohl für heute bedeutet. Durch ihn werden die beiden Dimensionen des Empfangen (von Segen) und des Gebens (Freude schenken) eingebracht.
Durch das Bild des Raben Felix , der einen Stern über seinem Kopf trägt, wird bildlich die Botschaft des Liedes „Wir tragen dein Licht“ (LB Religion 129) verarbeitet. Dass Gutes tun mit Licht bringen assoziiert wird, trägt zu einem tieferen Verständnis des Ziels vom guten Handeln bei.
Das Foto „Begegnung mit dem Nikolaus“, bei dem ein Kind einer Frau die Nikolausmütze aufsetzt, greift die Tradition des verkleideten Nikolaus auf und weist darauf hin, dass in jedem von uns ein „Nikolaus steckt” und wir nach seinem Vorbild handeln können.
Das Bild „Geschenk verpacken” macht deutlich, dass am Nikolausabend oft kleine oder größere Geschenke verteilt werden, es aber darum geht, den Menschen in ihren Herzen Freude zu schenken. Der grüne Zweig, der als Dekoration in das Päckchen geschoben wird, zeugt von Hoffnung.
Im Infofeld „Nikolaus“ werden wesentliche Informationen über den heiligen Nikolaus zusammengefasst, die als Gesprächsanlass dienen können.
Das Bild „Nikolaus und die drei goldenen Äpfel“ auf der rechten Seite entstammt einem Erzähltheater „Kamishibai zum heiligen Nikolaus“ des Don Bosco Verlags. Es veranschaulicht wesentliche Elemente aus der Erzählung, zum einen den verzweifelten Vater,
der seinen drei Töchtern keine Mitgift für eine Hochzeit bereitstellen kann und zum anderen die heimlich ausgeführte gute Tat von Bischof Nikolaus. Dass Bischof Nikolaus nicht sofort als dieser (durch die Darstellung seiner heute üblichen Kleidung oder seiner Bischofsmütze) erkennbar ist, erweitert die Möglichkeit zur Identifikation für die Schüler*innen. Der rote Umhang erinnert auch an Superhelden, die für die Schüler*innen dieser Altersgruppe oft auch Vorbilder sind. Der QR-Code führt zu einer Erzählung über den heiligen Nikolaus.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Nikolausspruch aufsagen und auswendig lernen
Die drei Bilder anschauen und besprechen: Was sieht du? Was fällt dir dazu ein? Welche Fragen tauchen auf?
Nikolauslegenden anhören oder vorlesen (siehe unten)
Bildarbeit: Bild analysieren und mit dessen Hilfe die Geschichte nacherzählen. Mögliche Fragen für die Bildanalyse: Welche Farben, Formen erkennt man auf dem Bild? Welche Personen sind erkennbar? Was denkst du, wie geht es dem sitzenden Mann? Was denkt er? Was könnte der Mann mit dem Umhang denken und sagen? Woran erinnert dich sein roter Umhang? Aktion veranstalten: Bei dieser können die Schüler*innen selber für jemanden wie Nikolaus sein.
Ich als Nikolaus: Die Schüler*innen dürfen im Rahmen einer kleinen Feier (innerhalb der Klasse) ausprobieren, wie es ist, Nikolaus zu sein. Dazu dürfen die Schüler*innen in ein Kindernikolauskostüm schlüpfen: Bischofsstab, Mitra, weißes (Ministranten-) Kleid, roter Bischofsumhang). Dabei können Ideen gesammelt werden, was wir von Bischof Nikolaus lernen können: Gutes tun, jemandem helfen, geheim liebe Botschaften hinterlassen … Anschließend kann der „kleine” Nikolaus eine Runde durch den Sitzkreis, die Klasse gehen, dabei wird ein Nikolauslied (z. B. „Lasst uns froh und munter sein”) gemeinsam gesungen. Nikolaustraditionen und individuelle Feiermöglichkeiten besprechen
6 | … und noch mehr Ideen
Nikolauslegenden verschenken: Eine Nikolauslegende auf schönem Papier ausdrucken oder auf Geschenkspapier o. ä. aufkleben. Das Papier mit der Erzählung zusammenrollen und mit einem Geschenksband versehen, um es jemandem weiterzuschenken (siehe unten). Erzählungen über Heilige nachspielen und beim Vorlesen mitspielen: Eine einfache Methode, welche nicht vieler Vorbereitung bedarf, ist die Schüler*innen dazu anzuleiten, beim Vorlesen mitzuspielen. Dazu werden Rollen verteilt und z. B. wenn der Nikolaus die drei goldenen Kugeln ans Fenster legt, legt das Kind mit der Rolle des Nikolaus symbolhaft drei Kugeln in die Kreismitte. Auch die gesprochenen Texte können von den Kindern mit der dazugehörigen Rolle nachgesprochen werden. Es ist möglich, die Geschichte mit verschiedenen Accessoires auszuschmücken. Beispiele für Accessoires: Mantel, Helm, Korb, Schwert, Umhang, Mitra, Bischofsstab, in goldenes Papier eingewickelte Kugeln … Als Bischof Nikolaus verkleiden: Dadurch lernen die Schüler*innen Elemente wie die Bischofsmütze, den Bischofsstab, sein Gewand … kennen und verstehen.
Eine Nikolausfeier in der Klasse oder Schule veranstalten Heiligen-Legenden (u. a. Nikolaus, Barbara, Lucia) vorlesen
Adventaktion mit dem Kinderbuch „Das rote Paket“: Das Bilderbuch erzählt von einem geheimnisvollen roten Paket. Es bringt Glück und Zufriedenheit. Doch das Wichtigste, man darf es nicht öffnen, nur weiterschenken. Die Geschichte lädt ein, diese Aktion in der Schule oder Klasse durchzuführen – das ist auch interreligiös oder -konfessionell möglich. Ein rotes Paket wandert gemeinsam mit dem Buch jeden Tag oder jede Woche in eine andere Klasse oder von Kind zu Kind und bringt so jedem einzelnen Glück und Freude. Das rote Paket kann ganz einfach selbst gebastelt werden (siehe unten) oder anhand der Vorlage, die im Bilderbuch inkludiert ist. Nikolaus aus rotem Frottierhandschuh basteln: Dazu einen roten Frottierhandschuh bis zur Hälfte mit Füllwatte befüllen. Dann die offenen Ecken zur Mitte falten, sodass eine Spitze entsteht. Den Zipfel (als Mitra des Nikolaus) mit einem Gummiband befestigen. Für die beiden Arme mit zwei weiteren Gummibändern den seitlichen Stoff abbinden. Den Bart unter dem Gummiband des Kopfzipfels befestigen. Gesicht und Hände können entweder mit hautfarbenem Schleifenband oder Leukoplast abgehoben werden. Zum Schluss Wackelaugen in das Gesicht und ein goldenes Kreuz auf die Mitra kleben.
7 | Kinderbücher
Alberti, G., Wolfsgruber, L. (2017). Das rote Paket. Bohem Press. Fastenmeier, C., (2018). Die heilige Barbara und der Kirschblütenzweig. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco.
Fastenmeier, C., (2019). Die heilige Lucia und der Lichterkranz. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco.
Fritsch, M., (2020). Das große Buch der Heiligenlegenden. Bilderbuch. Paulinus.
Grün, A. (2016). Die Legende vom heiligen Nikolaus. Bildkarten fürs Erzähltheater Kamishibai. Don Bosco.
Jakobs, G., (2019). Das ist für dich. Carlsen.
Schneider, A.. (2019). Die Geschichte vom Heiligen Nikolaus. Coppenrath.
Trimmer, C., (2022). Eine gute Tat. Eine Geschichte über die Magie des Mitgefühls. Zuckersüß.
8 |
Lieder
Lasst uns froh und munter sein LB „Sim Sala Sing“ S. 200
Tragt in die Welt nun ein Licht LB Religion Nr. 95
Wir tragen dein Licht LB Religion Nr. 129
9 | Schnappschüsse





Ein „rotes“ Paket basteln
Ein „rotes“ Paket basteln
Gestalte den Grundriss mit roten Farben. Schneide ihn aus. Falte das Papier an allen strichlierten Linien. Falte dann die Laschen um. Klebe die Laschen auf denen KLEBEN steht so hin, dass ein Würfel entsteht. Die letzte Lasche wird dann nur reingesteckt. Du kannst dein fertiges „rotes“ Paket mit Geschenk sband zubinden.





Schatzbuch Religion
Das steinerne Herz
Das steinerne Herz
Nach einer alten Nikolauslegende
Nach
einer alten
Nikolauslegende
Ein Kaufmann war sehr reich geworden, konnte aber nie genug bekommen und wollte immer noch mehr verdienen. Als er eines Tages auf Reisen war, erschien ihm ein seltsamer Mann.
„Möchtest du reicher als alle werden?“, fragte er ihn. „Natürlich! Wer will das nicht? Sag mir, was ich dafür tun muss!“, antwortete der Kaufmann. – „Du musst mir dafür dein Herz verschreiben.“
Ohne lange nachzudenken tauschte der Kaufmann sein Herz gegen einen harten, kalten Stein. Dann verschwand der seltsame Mann.
In den folgenden Jahren wurde der Kaufmann reicher und reicher, aber auch immer verlassener und einsamer. Als er eines Tages wieder dorthin kam, wo e r sein Herz verloren hatte, begegnete ihm Bischof Nikolaus. „Warum bist du so traurig?“, fragte er den Kaufmann. Da erzählte ihm der reiche Mann seine Geschichte.
Bischof Nikolaus war bekannt für sein gutes Herz. Er tröstete ihn: „Du kannst wieder glücklich werden. Lass die Armen spüren, dass dein Herz wieder für sie schlagen will. Hilf ihnen mit deinem Geld. Geh zu den Kranken und Hungernden und lerne wieder, die Not der Menschen zu sehen.“
Der Kaufmann tat, wie Bischof Nikolaus ihm geraten hatte. Mit je dem guten Wort und jeder helfenden Tat schmolz der Stein in seiner Brust tatsächlich und sein Herz kam wieder an den rechten Fleck. Als er starb, war aus dem armen Reichen ein reicher Armer geworden.
Das steinerne Herz nach einer alten Nikolauslegende Handbuch zum Schatzbuch Religion 1
Erzähltext zum Schatzbuch Religion 1

Finster Verlag
Der vergoldete Apfel
Der vergoldete Apfel
Eine Nikolausgeschichte von Rolf Krenzer
Eine Nikolausgeschichte von Rolf Kren zer
Einmal lebte ein Mann. Dem war seine Frau gestorben. Er hatte drei Töchter. Ihm ging es sehr schlecht. Er hatte keine Arbeit und musste deshalb das, was er für sich und seine Töchter benötigte, von anderen borgen. Weil er aber über lange Zeit keine Arbeit fand, konnte er denen, die ihm etwas geborgt hatten, nichts zurückgeben. So hatte er viele Schulden. Mit der Zeit ärgerten sich die Leute, von denen er etwas geborgt hatte, über ihn und verlangten viel Geld von ihm zurück. Als er ihnen aber nichts zurückzahlen konnte, verlangten sie: „Dann musst du deine älteste Tochter verkaufen. Sie kann als Dienerin zu einem reichen Mann gehen und dort für ihn arbeiten. Er kauft sie dir ab, und sie gehört ihm!"
Da weinte der arme Mann, weil er seine Töchter so lieb hatte und niemals eine verkaufen wollte.
Doch die Polizisten, denen die Leute die Sache gemeldet hatten, sagten: „Wenn du morgen deine Schulden nicht zurückzahlen kannst, werden wir dich ins Gefängnis sperren und deine Tochter wird verkauft!" Als der arme Mann seinen Töchtern alles erzählte, weinten sie sehr und gingen traurig schlafen. Zufällig aber erfuhr der Bischof Nikolaus von dem armen Mann und von dem, was mit ihm und seiner ältesten Tochter geschehen sollte. Nikolaus hatte vor langer Zeit vom Kaiser einen vergoldeten Apfel geschenkt bekommen. Dieser Apfel war rundherum mit kostbaren Edelsteinen besetzt. So nahm Nikolaus den Apfel und schlich in der Nacht zu der Wohnung des armen Mannes. Er stieß ganz vorsichtig das Fenster auf und legte den wertvollen Apfel heimlich auf die Fensterbank: Dann ging er mit leisen Schritten wieder nach Hause zurück. Am nächsten Morgen entdeckte die jüngste Tochter den kostbaren Apfel auf der Fensterbank. Sie weckte sogleich den Vater und ihre beiden Schwestern.
„Uns hat bestimmt der Nikolaus geholfen!“, rief sie überglücklich. So konnte der arme Mann all seine Schulden mit dem vergoldeten Apfel bezahlen. Er brauchte nicht ins Gefängnis zu gehen, und seine Tochter brauchte nicht verkauft zu werden.
Der vergoldete Apfel eine Nikolausgeschichte von Rolf Krenzer Handbuch zum Schatzbuch Religion 1

Advent – Auf das Kind warten
Seiten 60 und 61 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite lädt dazu ein, dass die Schüler*innen das Werden und die Geburt eines Kindes als großartiges Wunderwerk und Geschenk wahrnehmen: jedes Kind, ein besonderes Geschenk Gottes, das uns auf seinen Geber, auf Gott selbst, verweist. Es gibt kein größeres Geschenk als unser Leben. Ausgangspunkt dafür kann sein, dass eine Mutter von Mitschüler*innen ein Kind erwartet und diese in die Klasse eingeladen wird. Das Gespräch mit der werdenden Mutter in der Klasse kann Kindern helfen, dieses Wachsen und Werden als wunderbares Geschenk zu sehen. Dadurch werden sie auch an ihr eigenes Geborensein und ihre eigene Geburtsgeschichte erinnert. Auch das muss dann zur Sprache kommen können, wenn auch nicht alle Geschichten nur positiv, leicht und angenehm sein werden. Die Erwartung eines menschliches Kindes steht hier auch in Zusammenhang und Korrelation mit der Geburt Jesu, auf den die Menschen sehnsüchtig gewartet haben und der wie wir als Menschenkind geboren wurde. Menschliches Leben wird durch die Deutung des Glaubens noch vertieft und der Glaube wird durch die menschlichen Erfahrungen lebendig.
Der Advent findet im Geburtsfest, in der Menschwerdung zu Weihnachten seine Erfüllung. In der praktischen Arbeit mit den Kindern ist bei den Gesprächen auf große Behutsamkeit zu achten, da die einzelnen Lebensanfänge und Lebensgeschichten sehr unterschiedlich und manchmal auch sehr nüchtern verlaufen. Manche werdende Mutter hatte vielleicht zuerst Mühe, sich auf ein Kind einzustellen, manche Kinder haben die wärmende Fürsorge nur wenig erlebt, manche wurden von ihren Eltern voll Freude und Glück ersehnt und erwartet. Grundsätzlich geht es für die Kinder aber um die Botschaft, dass in jedem Kind Gottes „Ja“ zur Welt sichtbar wird. Jedes Kind erzählt vom Wunder des Lebens. Jedes Kind darf in diesem Kontext hören: Schön, dass es dich gibt. Auch wenn dein Leben manchmal schwierig ist – du bist von Gott gewollt und geliebt. In dir kommt etwas von Gottes großem Geheimnis auf die Welt.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… eigene Geburts- und Kindheitsgeschichten.
… (eigene) Baby- und Kinderfotos. verstehen und deuten
… dass Christ*innen zu Weihnachten die Geburt Jesu feiern …dass Gott in jedem Kind Ja zur Welt sagt. gestalten und handeln
… Fotos und Dinge zur Vorbereitung auf ein Baby. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Schatzgedanken über Mitschüler*innen sagen. entscheiden und mit-tun
… Adventlieder singen, Advent feiern und beten.
… für Kinder in Not Geld, Kleidung usw. sammeln.
3 | Lernanlässe
★ Adventzeit
★ Adventfeiern
★ Warten auf das Kind Jesu
★ Geburt im Bekanntenkreis
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix nimmt die Vorfreude auf Weihnachten in den Blick. Wie beim Raben, so ist auch für Kinder die ungeduldige Vorfreude ein wesentliches Element des Advent. Es geht für viele Kinder dabei stark um die Freude und Neugierde auf Geschenke. Max bringt ein, was das große Geschenk des Weihnachtsfestes und sein Zentrum ist: der Geburtstag von Jesus.
Das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent” gilt als Impuls, in jeder Woche des Advents eine Kerze am Adventkranz anzuzünden, Advent zu feiern, zu singen und zu beten. Die Strophen erzählen von Grundhaltungen christlicher Menschen im Advent: An Jesus denken und ihm die Wege bereiten, einander annehmen, die Güte in die Welt tragen, Licht werden. Das Erlernen dieses Liedes ermöglicht Kindern auch, in den Familien bzw. den Pfarrgemeinden ein zentrales Adventlied mitzusingen.
Die Bildreihe „Mensch werden“ zeigt Blitzlichter aus dem Leben eines kleinen Kindes. Ein Neugeborenes, getragen von einer Hand; drei Paar Füße, die der Größe entsprechend zu Vater, Mutter und einem Kind gehören; ein Kinderportrait, das uns mit großen Augen anschaut. Wie in einer Bildgeschichte erzählen die Fotos davon, dass menschliches Leben durch Menschen weitergegeben wird und dass dieses neue Leben ein Wunder ist. Sie sprechen von der Zuwendung der Menschen zum Kind. Sie erzählen von der Zerbrechlichkeit dieses neuen Lebens, vom Angewiesensein auf liebende und fürsorgende Nähe.
Der Satz „In jedem Kind …“ sagt aus, dass jedes Kind ein Wunder ist Gott in ihm immer wieder neu sein Ja zur Welt gibt. Das Kind am rechten Foto, welches Betrachter*innen mit großen Augen anschaut, stellt Kontakt her, erzählt, hat Fragen, Bedürfnisse … Das Schatzkästchen nimmt auf den Geburtstag von Schüler*innen Bezug. Kinder freuen sich meist schon lang auf ihren Geburtstag. Im Schatzkästchen ist Platz für das eigene Geburtsdatum. Der Satz „Ich freue mich auf meinen Geburtstag …” kann weitergeschrieben werden, z. B. indem der Geburtsmonat oder anderes eingesetzt wird: Ich freue mich auf meinen Geburtstag im Dezember, weil es der tollste Tag ist …
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Adventlied(er) singen Eine werdende Mutter einladen: Mit ihr über die „Ankunft“ ihres Babys sprechen. Mit den Kindern vorab Fragen sammeln, die sie stellen möchten. Die werdende Mama kann bei Ihrem Besuch auch frei erzählen, wie sie sich auf ihr Kind vorbereitet und über ihre Freude und Hoffnung berichten. Vorbereitungen auf ein Baby besprechen: Was braucht man für ein Baby? Wie bereitet man sich auf seine Ankunft vor? Dazu Bildkarten mit Kinderbett, Fläschchen usw. sowie Gegenstände oder Fotos (Schnuller, Schmusetuch etc.), die Schüler*innen mitbringen, zu Hilfe nehmen.
Baby- & Kinderfotos zum Gestalten: Mit Baby- und Kinderfotos ein Band gestalten, das mit goldenen Fäden oder Bändern (oder durch einen goldenen Hintergrund) auf das Geheimnis Gottes hindeutet. Auch eine Darstellung der Geburt Jesu kann dazugehängt werden. Geschenk für die Eltern basteln: Einen Dankesstern oder eine „Ichhab-dich-sooo-lieb-Karte“ nach folgender Anleitung basteln. Man schneidet einen Streifen Papier mit den Maßen 41x15 cm von einem Zeichenblock. Dann faltet man den Streifen wie auf dem Beispielbild zu sehen. Außen lässt man die Kinder ihre Hände abdrucken. Innen zeichnen sie sich selbst. Dabei sollen die Arme bis zu den bedruckten Händen reichen. Ein Satz wie „Mama/Papa, ich hab dich soooooo lieb“ wird hineingeschrieben.
6 | … und noch mehr Ideen
Kurze Adventfeier: Eine Feier um den Adventkranz gestalten. Dazu kann der Raum abgedunkelt werden und gemeinsam gesungen, gebetet und eine Adventerzählung angehört oder vorgelesen werden. Liedrufe mit „Lieblingsgedanken“ singen: Einen Liedruf oder Refrain singen. Dazwischen die Kinder beim Vornamen nennen und
folgenden Satz sagen: „… du bist ein Lieblingsgedanke Gottes. Schön, dass es dich gibt.”
Stilleübung im Sitzkreis: Es wird von Ohr zu Ohr ein schöner Satz, wie z. B. „Schön, dass du da bist!” weitergeflüstert. Das letzte Kind darf den Satz laut sagen.
7 | Kinderbücher
Herzog, A. (2015). Ein Baby in Mamas Bauch. Fischer Sauerländer. McBratney, S., Jeram A. (2022). Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? (7. Aufl.) Fischer Sauerländer.
8 | Lieder
Das Licht einer Kerze LB Religion Nr. 93
Macht euch bereit! T./M. v. S. Reitlinger: www.musikager.at; Nr. 5 im HB-Anhang
Wir sagen euch an den lieben Advent LB Religion Nr. 92
9 | Schnappschüsse

Und Gott wird Menschenkind
Seiten 62 und 63 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Auf dieser Doppelseite wird die Weihnachtsgeschichte, der Weg von der Verkündigung bis zu den Sterndeutern, in Wort und Bild angeboten. Sie ist also eine Einladung, die Geschichte rund um die Geburt von Jesus zu hören, kennenzulernen sowie damit spielerisch kreativ und feiernd umzugehen. Aber der biblische Text ist immer „Wort Gottes an mich”, wirkmächtiges Wort, das in unser Herz hinein gesprochen werden will und Wandel und Veränderung will. Im weihnachtlichen Geschehen will also diese Botschaft der Geburt und des Erscheinens Gottes in diesem Kind von Betlehem ins Herz gesprochen werden: „Heute ist euch der Heiland geboren”, verkünden die Engel. Es geht um das Heute, Hier und Jetzt. Der große, unbegreifliche Gott wird Kind und angreifbar, berührbar, klopft ans Herz der Menschen, ist auf die Liebe von Maria und Josef angewiesen, wie jedes Kind auf die Liebe seiner Eltern, verletzlich und gefährdet. Diese Einfachheit und Schlichtheit wird später zum Lebensprogramm von Jesus: er ist ganz Mensch bis hinein in seinen Tod und darin zeigt sich die ganz andere Art der Liebe Gottes.
„Das Entscheidende ist also, dass mit Jesus nicht eine vollkommene Übermenschengestalt auftritt. Ihr gegenüber könnten die Menschen in die ästhetische Distanz der Bewunderung gehen, die andringende Gegenwart Gottes ganz ihr überlassen, im Privileg des einmaligen Genies gefangensetzen.JesusträgtinseinermenschlichenSchlichtheitdasFeuer der göttlichenAnwesenheit mitten hinein,an alle heran.Er ist in Person das Zeugnis für die ganz andereArt der Liebe Gottes.“ (Bachl 1994,40). Manche Kinder kennen die Weihnachtsgeschichte von zuhause oder vom Kindergarten. Für manche geht es um eine Erstbegegnung mit dieser Erzählung. Wie in Bilderbüchern oder in anderen Schulbüchern ist die Form einer Bildgeschichte gewählt, die mit einfachen Motiven zum Schauen und Hören einlädt, um diese „ganz andere Art der Liebe Gottes” ansatzhaft zu begreifen bzw. in dieses Geheimnis einzutauchen. Das weihnachtliche Geschehen hat etwas unheimlich überraschend Zärtliches, was nur kleine Kinder hervorzurufen vermögen, und etwas sehr Zerbrechliches. Die Zärtlichkeit „will eine fröhliche Geselligkeitschaffen,einelebendigeResonanz,wodasLebenLeben hervorruft und in einem unendlichen Prozess Gemeinsames aufbaut.” (Guanzini 2019, 25). Um diese Weise und Weisheit der Zärtlichkeit (Gottes), die das Geschehen von Betlehem hervorruft, geht es auf dieser Seite, die auch in den Bildern von Štěpán Zavřel so spürbar wird. Weihnachten ist kein lautes triumphales Geschehen, kein Gott, der Trompeten und Posaunen, mit himmlischen Heerscharen und großem Gefolge erscheint, sondern eine stille Geburt am Rande der Stadt, draußen bei den Hirten, die am Rand der damaligen Gesellschaft stehen. Selbst die Engel wirken ein wenig zurückhaltend.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können … wahrnehmen und beschreiben
… die Bilder der Bildgeschichte.
verstehen und deuten
… das Kind Jesus als Sohn Gottes, Engel als Boten Gottes. gestalten und handeln
… spielend mit Klängen die Bibelstelle begleiten. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… die Weihnachtsgeschichte mithilfe der Bilder. entscheiden und mit-tun
… eine Adventfeier mitfeiern.
3 | Lernanlässe
★ Weihnachten steht vor der Tür
★ Advent- bzw. Weihnachtsfeiern in der Schule
★ Weihnachtsvorbereitungen zu Hause
★ Kinderfragen: Gibt es das Christkind wirklich? Kommt zu Weihnachten das Christkind oder der Weihnachtsmann?
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
In diesem kurzen Ausschnitt des Bibeltextes „Da sagte der Engel …“ nach Lk 1, aus der Verkündigungserzählung, ist die zentrale Botschaft des Engels an Maria abgedruckt. Es wird davon ausgegangen, dass die ganze Erzählung frei erzählt oder aus einer Kinderbibel vorgelesen wird. Der Text aus Lk 1 erzählt vom Feierinhalt des Hochfestes von der Verkündigung des Herrn, das die Kirche am 25. März feiert. Die Kinder werden hineingenommen in das Hoffen, Warten, Fragen und Glauben des jungen Mädchens Maria von Nazareth und in das Wahrwerden der Zusage Gottes, dass er die Menschen nicht vergisst, sondern ihnen Zukunft und Licht schenkt. Die Worte des Gottesboten an Maria „Sei gegrüßt, du Begnadete … Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden“ sind letztlich Worte und gute Nachricht für alle Menschen, auch für die Kinder von heute. Erfahrungen der Kinder, bei denen dieses „Hab keine Angst! Ich bin ja bei dir …”, gesprochen von Müttern und Vätern oder anderen Vertrauenspersonen, als Hoffnungsbotschaft gegen alle Angst, allen Schmerz und alles Dunkle schlechthin erlebt werden, können hier mit hineingenommen werden in die große Zusage Gottes an uns Menschen, konkretisiert und wie in einem Brennpunkt hier Maria zugesprochen. Wo ein Mensch sich im Vertrauen öffnet für die vertrauensvolle Hoffnung, kann Gott Hand und Fuß bekommen und in diese Welt hineingeboren werden.
Die Bilder für die Bildgeschichte zur Weihnachtserzählung stammen vom tschechischen Künstler Štěpán Zavřel. Sie zeigen Szenen der Verkündigungs- bzw. Geburtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Das eigentliche Weihnachtsbild steht auf der nachfolgenden Doppelseite im Mittelpunkt. Maria begegnet dem Engel : Das jugendliche Mädchen Maria, in ein weißes Kleid gehüllt, ist in einem Innenraum eines vornehmen Hauses zu sehen. sie bewegt sich nach links vorne und streckt die Hände aus. Die Ursache der Bewegung ist wohl der Engel, der von außen, von links oben in den Lebensraum Marias tritt. Der feierlich gekleidete Engel trägt eine Blume, eine Lilie in der Hand. Es scheint, als ob die Hände des Engels und die Hände Marias sich sehr bald treffen würden. Das ist wohl die Botschaft, die der Engel Maria zu überbringen hat und die Maria fragend, staunend und vertrauend aufnimmt. Maria und Josef ziehen nach Betlehem : Kaiser Augustus hatte zur Volkszählung aufgerufen. Deshalb reisen Maria und ihr Verlobter Josef nach Betlehem. Die schwangere Maria sitzt auf dem Rücken des Esels. Der weite Weg ist angedeutet. Auch,
dass viele Menschen auf diesem weiten Weg unterwegs sind. Hirten hören die frohe Nachricht : Die Hirten auf dem Feld wärmen sich zusammengekauert in der Nacht an einem Feuer. Von rechts oben kommen hell und zauberhaft Engel auf sie zu und verkünden die überraschende Nachricht von der Geburt Jesu. Der größte, mittlere Engel deutet mit seinen Händen bzw. Fingern einerseits nach oben zum Himmel und andererseits in eine bestimmte Richtung. Staunen und Überraschung ist den Hirten ins Gesicht geschrieben. Sie, die einfachen und am Rande der Gesellschaft lebenden Hirten, sind die ersten, die diese unglaubliche Botschaft hören: Gott ist Mensch geworden. Ein Gott, der sich den Armen und Außenstehenden als Erstes zuwendet. Ein Grund zur Freude und zum Aufbruch. Die Weisen folgen dem Stern : Drei Weise haben einen Stern gesehen. Man sieht den Stern auf dem Bild nicht, aber der erste der Männer streckt seine Hand aus und zeigt in eine Richtung. Sie sitzen auf Kamelen und sind in der Dunkelheit unterwegs. In ihnen, die von weit herkommen, kommt die ganze Welt zu diesem Jesus, der Licht für die ganze Welt ist.
Der QR-Code führt zur eingelesenen Bibelerzählung „Der Engel kommt zu Maria” aus Lk 1.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Erzählung „Der Engel kommt zu Maria“ verarbeiten: Es gibt viele Möglichkeiten wie die Erzählung vorlesen, erzählen, als Rollenspiel einüben, mit Standbildern nachstellen usw. Gedanken von Maria formulieren: Die Gedanken von Maria, dem Engel, einem Beobachter usw. in Worte fassen.
Arbeitsblatt „Füchte dich nicht“ ausfüllen: Den wesentlichen Satz „Fürchte dich nicht“ aus der Erzählung von dem Engel, der zu Maria kommt, nachspuren und den Stern mit Farben der Hoffnung gestalten. Heftseite zur Weihnachtserzählung gestalten: Eine Szene gestalterisch abbilden. Bei einer Heftarbeit können Engelsflügel zum Beispiel aus Muffinförmchen gemacht werden.

6 | … und noch mehr Ideen
Scherenschnittsterne gestalten: Quadratisches oder rundes Papier in gelber, oranger, goldener, hellroter Farbe und unterschiedlichen Größen nehmen und einige Male in der Hälfte falten. Die offene Seite spitz zuschneiden und von beiden Enden zur Mitte hinein schneiden, so erhält man eine Sternform. Aus den Kanten können verschiedene Formen ausgeschnitten werden. Wenn das Papier aufgefaltet wird, erhält man einen Stern. Das ist auch mit dunklem, schwarzen Papier möglich, dann klebt man helles Seidenpapier dahinter. Durch die entstehenden Sterne können Klassenzimmer, Schulhaus, Heftseiten u. v. m. gestaltet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, der Gestaltung nach und nach immer mehr Sterne hinzuzufügen, sodass es bis Weihnachten immer heller wird.
7 | Kinderbücher
Bolliger, M. (2017). Weihnachten ist, wenn … Bohem Press.
Jenkins, D., Jenkins, A., Hendricks, K. (2022). Der kleine Hirte und das Licht von Betlehem. Eine „The Chosen Weihnachtsgeschichte”. Gerth Medien.
Slegers, L. (2003). Das Kind in der Krippe. Tyrolia.
Wilkón, J. (2005). Warum der Bär sich wecken ließ. (6. Aufl.) Patmos.
8 | Lieder
Feliz Navidad LB „Sim Sala Sing“ S.138
Gott ist ganz leise T./M. v. F. Kett
Gott macht sich ganz klein T./M. v. S. Reitlinger: www.musikager.at; Nr. 2 im HB-Anhang
9 | Schnappschüsse





Der Engel spricht zu Maria
Der Engel spricht zu Maria
➜ Schreibe die Botschaft „Fürchte dich nicht“ weiter, indem du die Wörter nachspurst. Gestalte dann den Stern in Farben der Freude.
Schreibe die Botschaft „Fürchte dich nicht“ weiter, indem du die Wörter nachspurst. Gestalte dann den Stern in Farben der Freude.


Fürchte dich nicht!
Lk 1,30
Weihnachten – Jesus ist das Licht Gottes für uns Menschen
Seiten 64 und 65 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Was uns Weihnachten zunächst einmal vermittelt als inhärente Botschaft: Im Zentrum des christlichen Glaubens steht keine abstrakte Lehre, sondern eine konkrete Person: Jesus, den gläubige Christ*innen als Christus bekennen. Von ihm erzählt das Weihnachtsgeschehen und ermöglicht so einen lebendigen Zugang und Kontakt auch für uns Heutige. Wenn Jesus im Prolog zum Johannesevangelium als das „Wort“ bezeichnet wird, verdeutlicht dies die Kontakt- und Beziehungsbewegung, die im jüdisch-christlichen Glaubensverständnis von Gott ausgeht und auf den Menschen zukommt und konkret in Jesus Gestalt annimmt. In seinem Reden, Tun und Handeln wird seine Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft konkret. Erlöstes Menschsein, den Menschen zu sich selbst erheben (Selbstermächtigung) ist Jesu Anliegen im Sinne der Propheten. Dieses Erlösungsgeschehen nimmt in diesem Kind von Betlehem seinen Anfang und geschieht mitten unter uns, deshalb wird er als Retter besungen wie im Lied „Stille Nacht”. Kinder und Erwachsene sind in den meisten Fällen freudig aufgeregt, wenn es um das Weihnachtsfest geht. Die Geschäftswelt, aber auch die Medien und die Gestaltung der Städte und Dörfer überschütten uns mit Weihnachtsmotiven, die voll von menschlichen Sehnsüchten, Wünschen und Erwartungen sind, in denen aber der transzendente Blickwinkel meist schon verloren gegangen ist und vieles damit allzu irdisch bleibt. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um christliche Motive oder um den Kamin hinauf kletternde Weihnachtsmänner geht. Die Kindheitserzählung nach Lukas erzählt ganz anders und tiefgehender. Sie erzählt: „Gottes Solidarität gilt den Armen und Außenseitern, nicht den Mächtigen und Reichen. Verachtete Hirten auf dem Feld sind die Ersten, die die Botschaft vom Krippenkind, für das in der Herberge kein Platz ist, erfahren.” (Trummer 2021, 46). Und durch diesen Jesus kommt der weihnachtliche Friede, nicht die Macht der Römer und ihrer Pax Romana, die in konsequenter Kriegsvorbereitung, in Angst und Schrecken bestand. Diese Gegensätzlichkeit ist wichtig, um das Weihnachtsgeschehen verstehen zu können. Und gerade dadurch ist es auch für Kinder so leicht zugänglich. Auf dieser Doppelseite wird nun, in aller Einfachheit, sehr stimmungsvoll und sensibel das zentrale Ereignis in das Zentrum gestellt und auf den eigentlichen Feieranlass fokussiert. Jesus ist geboren. Der große Gott wird Mensch und kommt den Menschen nahe. Jesus ist das Licht Gottes für die Menschen. Diesen Geburtstag feiern Christ*innen in aller Welt. Dieses Feiern findet häufig auch in den Schulen seinen Platz und Ausdruck, auch in einer säkularen, multireligiösen Welt. Hier gilt es sehr achtsam zu sein. Dabei bewegt sich der Religionsunterricht bei diesen Feiern im Bereich des „mystagogischen Lernens“ als eines wichtigen Zugangs und Weges des Religionsunterrichts. Mirjam Schambeck fragt berechtigt zum mystagogischen Lernen im schulischen Kontext: „Ist es möglich, im Raum Schule Räume und Zeiten zu eröffnen, für Gotteserfahrungen aufmerksam zu werden?
ÜberfordertesdenReligionsunterricht,aufdieErfahrungsdimension des christlichen Glaubens anzuspielen? Wie sieht es mit der Freiheit der am Lernprozess Beteiligten aus? … Es gilt die Skepsis der Schüler*innen ernst zu nehmen, ob es überhaupt etwas gibt, was über diese Welt hinausgeht, ob Gott existiert, ob er etwas mit den Menschen zu schaffen hat und ob er gewillt ist, den Menschen zu helfen. Ob sie den christlichen Glauben als Deutemöglichkeit ihres Lebens und der Welt in Anspruch nehmen, steht in ihrer Freiheit.“ (Schambeck, 2010, S. 401).
Da werden wesentliche Haltungen für den Religionsunterricht und religiöse Feiern im schulischen Kontext angesprochen: der Respekt vor der Freiheit, die Aufmerksamkeit für das Gottesvorkommen in der Skepsis, in der Schwierigkeit zu glauben; die Welt der Schüler*innen eben nicht als „gott-los“ zu denunzieren, sondern nach dem Gottesvorkommen zu befragen. Nach Schambeck besteht mystagogisches Lernen nicht in der Anleitung, „…Gotteserfahrung erstmals zu machen,sondern sie als immer schon gegebene zu erkennen und diese je neu zu entfalten und Gestalt annehmen zu lassen“ (Schambeck, 2010, S. 404).
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Bildern und Krippendarstellungen zur Geburt von Jesus. verstehen und deuten
… dass Jesus das Licht Gottes für die Menschen ist und Weihnachten deshalb ein Fest der Lichter ist. gestalten und handeln
… Weihnachtserzählung als Bild, mit Klängen, Krippenspiel. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was zum Geburtstagsfest von Jesus dazu gehört. entscheiden und mit-tun
… einen vorweihnachtlichen Gottesdienst mitfeiern.
3 | Lernanlässe
★ Weihnachten steht vor der Tür
★ Krippenspiel in der Schule
★ Weihnachtliches Brauchtum: Christbaum, u. v. m.
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Bibelstelle „Maria und Josef …“ nach Lk 2,4–11 bildet den Kern der Weihnachtserzählung. Das Weihnachtsfest mit der Geburt Jesu gehört zentral zum christlichen Glauben und Feiern. Gott wird Mensch. Gott wird ein Kind. Es ist für den menschlichen Verstand unfassbar, dass der große Gott als armes, hilfloses Kind menschliches Leben angenommen hat und unser menschliches Leben mit all seinen Facetten teilt. Mitten hinein in eine zerrissene und sehnsüchtig hoffende Welt wird von einem Kind erzählt, in dem der Heiland der Welt entdeckt werden kann. Kaiser Augustus wird erwähnt und damit der Gedanke an das goldene Zeitalter, das angeblich mit ihm ausgebrochen war, ein Friedensreich durch diesen großen Kaiser – ein Friede (Pax Romana), der in Abschreckung für alle Völker bestand. Wie ein Kontrapunkt erzählt die Weihnachtsgeschichte von einem kleinen, schwachen Kind, das quasi am Rande der Welt in einem Stall geboren wurde. Im Schatten des goldenen prunkvollen Reiches wird unspek-
takulär ein in Israel lang ersehnter Friedensfürst geboren. Nicht die Großen und Mächtigen, sondern die Kleinen und am Rande stehenden Hirten sind die ersten Adressaten. Vor ihren Augen leuchten Engel auf und verkünden das Unfassbare. Was soll das bedeuten? Wie wird sich das für ihr Leben auswirken? Nach dem gleichsam kosmischen Ereignis mit den Engeln und dem hell erleuchteten Himmel werden sie schnell in die Realität zurückgeholt. Die Nacht ist wieder da, es ist wieder still, doch die Sehnsucht ist in ihre Herzen gelegt. Sie ist so stark, dass sie sich auf die Suche machen und tatsächlich das Kind finden. Ein Kind, hilflos und in einfache Windeln gewickelt, so wie jedes Kind, das klein und zerbrechlich geboren wird. Und die Hirten sind berührt, sodass sie in dem Kind den Heiland und den Retter der Welt erkennen. Das historische Geburtsdatum Jesu kennen wir nicht. Das heutige Weihnachtsdatum hat sich im 4. Jahrhundert als symbolischer Geburtstermin herauskristallisiert. Damals wurde am 25. Dezember die Wintersonnenwende gefeiert. Der Tag, an dem die Tage wieder länger werden und das Licht stärker ist als das Dunkel, erinnert nun an die Geburt Jesu Christi, der als das wahre Licht der Welt gefeiert wird.
Der QR-Code führt zur biblischen Erzählung über die Geburt von Jesus.
Das Foto vom Friedenslicht, das zu Weihnachten auf der ganzen Welt verteilt wird, erinnert einerseits an den biblisch genannten Geburtsort Jesu und an ein wichtiges Anliegen von Weihnachten, nämlich, dass das Schauen auf Jesus den Frieden in der Welt wachsen lassen möge.
Das Foto vom Schmücken eines Christbaums nimmt die Lebenswelt der Schüler*innen mit all den Erfahrungen rund um Weihnachten als Lernanlass in das Buch herein. Es könnte auch ein Anlass sein zu überlegen, warum Menschen mitten im Winter Christbäume ins Haus holen, sie schmücken und Lichter anzünden.
Das Weihnachtsbild „Geburt Jesu” von Štěpán Zavřel erzählt in warmen Farben von der Geburt Jesu. In der Mitte des Bildes ist eine Höhle zu sehen, die hell erleuchtet ist, als ob eine Sonne mitten in der Höhle aufgehen würde. Drinnen befindet sich Jesus in der Krippe, umgeben von Maria im festlichen Kleid und Josef, der mit dem Feuer für Wärme sorgt. Dahinter stehen Ochs und Esel. Jesus hat seine Arme weit ausgestreckt, als ob er Maria und vielleicht alle Menschen umarmen möchte. Vielleicht sind die ausgebreiteten Arme auch schon eine Anspielung auf die ausgebreiteten Arme am Kreuz. Im Vordergrund sind Hirten mit ihrem Hirtenstab und den Schafen zu sehen. Sie als die gesellschaftlich und kulturell Niedrigen sind die ersten, die von der Geburt Jesu erfahren. Schon hier wird programmatisch angedeutet, dass die Armen, die Ausgestoßenen … bei Gott besonders im Mittelpunkt stehen. Manche Hirten knien, manche haben Geschenke mit, manche kommen gerade an. Alle sind hin auf dieses Kind Jesus zentriert. Auch Ochs und Esel sind im Hintergrund auf das Kind hin ausgerichtet. Sie wurden nach dem Wort des Propheten Jesaja (Jesaja 1,3) als Bilder verstanden: Wie Ochs und Esel ihren Herrn erkennen, so sollen die Menschen in dem hier geborenen Kind ihren Herrn erkennen.
Das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht” ist durch Textausschnitte angedeutet und lädt ein, das Lied zu hören, zu lernen, zu singen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Weihnachtsbildgeschichte erzählen und vorlesen: Es bietet sich an, die Erzählung mithilfe der Bilder (möglicherweise groß ausgedruckt) zu vermitteln. Zur Festigung können die Schüler*innen sich die Geschichte dann gegenseitig mit Hilfe der Bilder im Schatzbuch erzählen.
Arbeitsblatt „Durch Jesus scheint das Licht Gottes auf uns Menschen“ gestalten: Durch die Grundlage des Kirchenfensters ist der Lichtmetapher doppelt gedient. Die Schüler*innen sollten helle, leuchtende Farben verwenden. Man kann vor der Gestaltung gemeinsam in die Kirche gehen, um Kirchenfenster und deren besonderes Licht auf die Schüler*innen wirken zu lassen. Die Fenster der Schüler*innen könnten auch ausgeschnitten und als Fensterdekoration verwendet werden.
Eine (gemeinsame) Weihnachtskrippe basteln oder im Heft gestalten: Dazu können verschiedene Materialien angeboten werden oder z. B. ein Stück Goldpapier, welches die Schüler*innen in ihr Bild integrieren sollen. Außerdem kann man die Schüler*innen einladen, sich selbst und die eigene Familie zur Krippe zu zeichnen. Weihnachtskrippe anschauen und die Figuren benennen: In der Schule, Pfarre, Kirche usw. gibt es häufig Krippen zum bestaunen. Dabei wird die Weihnachtsgeschichte wiederholt, häufig erkennen die Schüler*innen die Figuren wieder und können sie benennen.
6 | … und noch mehr Ideen
Krippenausstellung besuchen oder veranstalten : Indem zum Beispiel in unterschiedlichen Schulstufen verschiedene Krippen gebastelt und und an einem „öffentlichen“ Ort in der Schule ausgestellt werden, kann eine Krippenausstellung eröffnet werden. Beim Gestalten kann die Kreativität der Schüler*innen gefördert werden, indem sie eigene Ideen umsetzen können. Möglicherweise könnte man diese Ausstellung dann auch für die Eltern oder eine größere Öffentlichkeit zugänglich machen und z. B. Spendengeld für einen guten Zweck sammeln.
Weihnachtserzählung mit (Orff-)Instrumenten zum Klingen bringen
Krippenspiel einstudieren und aufführen: z. B. beim Schulgottesdienst oder der Kinderkrippenfeier der Pfarre. Eine einfachere Form wäre auch, dass die Schüler*innen die Weihnachtserzählung „mitspielen“, während diese von der Lehrperson vorgelesen wird, und Sätze, die die Figuren sprechen, nachsprechen.
Weihnachtsgottesdienst mitgestalten und mitfeiern: Lieder und Gebete lernen und Fürbitten zum Vorlesen anbieten.
7 | Kinderbücher
Jeschke, T., Möltgen, U. (2013). Die Weihnachtsgeschichte. Sauerländer.
Kollreider, E. (2013). Das Kind von Betlehem. Die Weihnachtsgeschichte. Tyrolia.
Rokus, P. (2019). Die Weihnachtsgeschichte. Gabriel.
8 | Lieder
Ihr Kinderlein kommet LB „Sim Sala Sing“ S. 220
Hallo, ich bin Maria T./M. v. S. Janetzko
Stille Nacht, Heilige Nacht LB „Sim Sala Sing“ S. 221
9 | Schnappschüsse








Gottes auf uns Menschen
Durch Jesus scheint das Licht
Gestalte die Weihnachtskrippe wie ein leuchtendes Kirchenfenster.
➜

Weihnachten feiern
Seiten 66 und 67 im Schulbuch | Kapitel 4
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Eine faszinierende Spannung liegt über diesem hier erzählten Geschehen: zwischen Groß und Klein, der Hauptstadt Jerusalem und Betlehem, König Herodes und dem Kind, den Sterndeutern („Könige“) aus dem Osten und den einfachen Leuten, zwischen dem Palast und der Krippe, zwischen der Heils- und Friedensbotschaft und den Todesschergen des Herodes beim Kindermord, dem Gesucht-Werden und Erwünscht-Aein und der späteren Flucht, zwischen dem Zauber der Weihnacht und der oftmals auch grauenvollen Realität hier und heute - wenn auch auf dieser Altersstufe sicherlich die freudigen Seiten des Geschehens hervorzuheben sind. Zu Recht meint die Wiener Theologin Regina Polak (2022), dass Weihnachten zuinnerst eine „subversiveBotschaft” in sich trägt, und sie macht das Revolutionäre der biblischen Logik am Lied „Stille Nacht” fest. Das verdeutlicht sich im Geburtsgeschehen: Gott wird Mensch. Es ist kein harmloses, nettes Geschehen, sondern eine Herausforderung: das Große wird im Kleinen sichtbar. Darin zeigt sich die „ganz andere Art“ Gottes, die dann auch beim erwachsenen Jesus sichtbar wird und am Kreuz endet. Schon bei der Geburt Jesu wird dies deutlich, dem man sich nicht entziehen kann, sondern das auch Kinder in den Bann zieht, weil eben der große Gott zugleich ganz klein wird, zum Geschenk für alle wird und sich darin seine wahre Größe zeigt: Der Stern leuchtet über der Geburt, letztlich über jeder Geburt, denn eigentlich geht es „um die Erkenntnis,dass alle Kinder etwas Himmlisches,Göttliches in sich tragen. Die Magier beten das ,göttliche Kind‘ an, und das zu einer Zeit, wo der römische Paterfamilias noch über Leben oderTod eines Neugeborenen entscheidet …”(Trummer 2021,47). Man kann sich diese Gegensätze nicht radikal genug und subversiv genug vorstellen, die eben manchmal durch das christliche, dogmatische Lehrgebäude und ihre Tradition verstellt und unzugänglich werden. Dann bleiben die Menschen und besonders die Kinder sprachlos zurück, weil nichts von Erlösung und Befreiung oder ihrer Sehnsucht danach, mehr erfahren und spürbar wird. Die Kinder werden auf diesen Seiten eingeladen, den Wegen und Spuren nachzuspüren und nachzugehen, mit den Magiern zu den einzelnen Orten und Personen mitzugehen, ihren Spuren zu folgen, dem Stern zu folgen und so auch die ganze Ambivalenz von innen zu erleben, wo dann letztlich doch der Engel immer wieder verkündend und rettend eingreift bzw. sich zu Wort meldet und sich alles zum Guten wendet. Gerade die Erzählung von den Sterndeutern spiegelt schon zu Beginn den späteren Jesusweg, der gewaltsam am Kreuz und im Widerspruch endet. Auch dort wird ein Engel die Botschaft von der Auferstehung und vom Sieg des Lebens verkünden. Sicher keine einfache und leichte Auseinandersetzung für die Kinder. Die Kinder dürfen nicht überfordert werden, aber es darf ihnen auch keine heile „Gottes-Welt“ vorgespielt werden, die ihrem Fragen nicht standhalten kann. Sondern auch im Unheilsein dieser Welt müssen Möglichkeiten der Gottesspuren und hoffnungsvolle Zeichen am Sternenhimmel gefunden werden. Erlösung beginnt im Kleinen und meint Befreiung aus allen Unfreiheiten und Ängsten und lenkt hin zu Liebe, Gerechtigkeit, Frieden …
dies gilt es ansatzhaft immer wieder neu zu begreifen. Dann wird „die BotschaftdesWeihnachtsevangeliumsschonjetztaufErdenzueinem GegengiftgegenResignation,HoffnungslosigkeitundVerzweiflung.Sie immunisierengegeneineausschließlichnegativeSichtderWelt,heilen unsvonPassivität–undspornenunsan,selbstzuMit:Retter:innender Welt zu werden und sich solcherart an der Heilsökonomie Gottes zu beteiligen.”(Pollak2022).Die Gottesfrage und damit zusammenhängend die Frage nach dem Wie des konkreten Lebens im Kontext heutigen Lebens und Erlebens ist das Herzstück des Religionsunterrichts und die große Herausforderung an die Lehrperson. Die Sternsingeraktion zeigt diesen Zusammenhang von damals und heute, von Gottes Handeln und unserem Handeln wider alle Ungerechtigkeit in der Welt sehr deutlich.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wie Weihnachten gefeiert wird.
… Bräuche zu Weihnachten und was sie erzählen. verstehen und deuten
… Jesu Bedeutung für die drei Weisen und viele Menschen. gestalten und handeln
… Sterne, Bild nachstellen, Personen sprechen lassen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… warum sich Große vor dem kleinen Kind klein machen. entscheiden und mit-tun
… still werden, Sterne verschenken, gemeinsam feiern.
3 | Lernanlässe
★ Weihnachten feiern
★ Krippenspiel, Kindermette
★ Sternsingeraktion
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Gedicht „Werde still und staune” von Christa Peikert-Flaspöhler fasst in poetischer Weise die wesentlichen Inhalte des Weihnachtsgeschehens zusammen. Zuerst ist die Haltung des Menschen angesprochen. In der Haltung der Stille und des Staunens kann der Mensch das Ereignis von Weihnachten erfassen. Wo die menschliche Aktivität und Kraft am Ende ist, dort beginnt Gott zu handeln. Er schenkt sich den Menschen als Mensch, als Erdenkind. Damit ist eine neue Zeit, eine neue Hoffnung angebrochen. Und der Stern singt Freude. Der Stern ist Licht im Dunkel der Nacht, er zeigt den Menschen den Weg und gibt Orientierung. Für den damaligen Menschen kündeten besondere Sterne oder Sternkonstellationen große Ereignisse an. Für gläubige Menschen ist die Geburt Jesu Licht, Orientierung und ein großes Ereignis, weil Gott einer von uns geworden ist. Das ist Grund und Anlass zu singen, zur Freude und zum Neubeginn. Der QR-Code führt zur Erzählung der Sterndeuter, die zu Jesus kommen.
Die drei Fotos erzählen von Bräuchen rund um Weihnachten: das gemeinsame Öffnen von Geschenken, die in vielen Schulen und Pfarren aufgeführten Krippenspiele und die weit verbreitete Sternsingeraktion. Sie sind Lernanlass, Erinnerung und zugleich Impuls, selbst aktiv zu werden. Verstehen des Weihnachtsgeheimnisses vollzieht sich in dieser Altersstufe stark im Tun.
Das Bild „Besuch der Sterndeuter” ist von Štěpán Zavřel. Dieses in warmen Farben gehaltene Bild erzählt vom Besuch und von der Anbetung der drei Weisen beim neugeborenen Jesus. Der Hintergrund erzählt eher von einer Wohnküche als von einem Stall. Man sieht Küchengeräte, Geschirr, Feuer, einen Herd. Durch eine offene Tür sieht man hinaus in eine weite südländische Landschaft mit einem rötlichen Himmel und Bäumen. Links vorne sitzt Maria in einem weißen Gewand und hält das ebenfalls weiß gekleidete Kind auf dem Schoß. Das Kind breitet die Arme aus und schaut mit großen offenen Augen zu den drei prachtvoll gekleideten Männern. Vom rechten Rand bis zur Mitte des Bildes ist eine Bewegung vom Großen zum Kleinen zu sehen. Die festlich gekleideten drei Weisen tragen Geschenke in ihren Händen und halten sie dem Jesuskind hin. Der vorderste macht sich klein und kniet, der mittlere beugt sich und der dritte ist (noch) aufrecht. Die Großen machen sich klein vor dem Kind, denn sie erkennen, dass Jesus, der Kleine, das Kind der wahrhaft Große ist. Der Bibeltext „Wir haben einen Stern…“ aus Mt 2,2b verweist auf die biblische Erzählung des Besuchs der Sterndeuter bei Jesus, die gekommen sind, um dem Kind zu huldigen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Gedicht „Werde still und staune“ gemeinsam aufsagen : Die Klasse kann dabei auch in vier Gruppen geteilt werden, sodass immer eine Gruppe ihren Satz gemeinsam laut spricht und erst nacheinander das Gedicht entsteht.
Bilder betrachten und Assoziationen finden: Die Bilder anschauen und die Assoziationen der Schüler*innen sammeln. Mögliche Fragen: Was stellen die Kinder in den beiden Bildern dar? Wer hat eine Idee, wieso in der Weihnachts- und Winterzeit oft Sterne zur Dekoration von Fenstern u. v. m. genutzt werden? Habt ihr schon einmal ein Krippenspiel gesehen oder mitgemacht? Was wisst ihr über die Sternsingeraktion? Welche Erfahrungen habt ihr mit den Sternsingen gemacht? Waren sie schon einmal bei euch zu Hause oder habt ihr sie woanders gesehen?
Erzählung von den Sterndeutern anhören und besprechen Bildarbeit: Bild von der Krippe mit den Sterndeutern betrachten und besprechen.
Weihnachtserzählung wiederholen: Mit Hilfe von Bildern im Schulbuch die Weihnachtsgeschichte wiederholen.
Eine Heftseite zu den Sterndeutern gestalten: Dazu können die Schüler*innen z. B. aus einem Handabdruck den Besuch an der Krippe gestalten.
6 | … und noch mehr
Ideen
Sternsingeraktion besprechen: Vorwissen der Schüler*innen zur Sternsingeraktion aktivieren, und anhand der Vorlage „Wissenswertes zur Dreikönigsaktion“ (siehe unten) können Informationen weitergegeben werden. Zur Veranschaulichung kann z. B. eine Dreikönigskrone verwendet werden, welche die Schüler*innen anschauen und aufsetzen können.
Legearbeit „Stern“: Mit verschiedenen hellen Materialien einen Stern legen. Dem eigenen Stern einen Titel geben und in einer Schaurunde die Sterne anderer entdecken.
Sterndeuter-Kerzen basteln
Plakat oder Heftseite zu den Sterndeutern gestalten: z. B. mit Handabdrücken, mit Geschenkspapier, Zeichnungen,…
7 | Kinderbücher
Motschiunig, U., Dailleux, F. (2014). Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht. G&G.
Pfister, M. (2009). Der Weihnachtsstern. (14. Aufl.) NordSüd.
8 | Lieder
Ein Stern steht hoch am Himmelszelt T./M. v. K. Mikula: www. mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse







Wissenswertes zur Dreikönigsaktion
Wissenswertes
zur Dreikönigsaktion
In der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar sind in ganz Österreich ~85.000 Kinder und Jugendliche als Könige verkleidet unterwegs, um für Entwicklungshilfeprojekte Geld zu sammeln. Sie ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
Die Bibel spricht eigentlich nicht von Königen, sondern von Weisen. Auch die Zahl drei ist nicht biblisch belegt, sie wurde wahrscheinlich von den drei Geschenken abgeleitet.
Die Geschenke – Gold, Weihrauch und Myrrhe – sind als Symbole für Christus, den König, anzusehen. Gold ist das Zeichen der Königswürde, Weihrauch das Sinnbild des Gebetes und der Gottesverehrung und Myrrhe ebenfalls ein königliches Zeichen.
Caspar, Melchior und Balthasar galten als Vertreter der damals bekannten Erdteile Afrika, Europa und Asien. Auch ihre Namen haben symbolische Bedeutung: „Caspar“ kommt aus dem Persischen und bedeutet „Schatzmeister“. Er bringt Weihrauch mit. „Melchior“ bedeutet im Hebräischen „König des Lichts“. Er schenkt dem Jesuskind Gold, und „Balthasar“ heißt auf Aramäisch so viel wie „Gott schütze das Leben des Königs“. Myrrhe ist sein Geschenk.
ist die Abkürzung des lateinischen Segens „Christus Mansionem Benedicat“, das bedeutet „Christus segne dieses Haus“.
Wissenswertes zur Dreikönigsaktion Handbuch zum Schatzbuch Religion 1


Ein Licht strahlt auf
Das kann ich … das weiß ich …
Seite 68 und 69 im Schulbuch | Kapitel 4
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient wieder der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in Religion beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …) sind die Arbeitsimpulse wieder mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten.
Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 70 | Kapitel 4
Die Schlussseite ist eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Eine Geschichte zum Nachdenken steht als spirituelles Angebot im Mittelpunkt. Es weist darauf hin, dass Himmel und Erde sich immer wieder berühren. Das grafische Element wurde an die Weihnachtszeit angepasst. Es handelt sich um ein zauberhaftes Sternenbild, welches versinnbildlicht, dass Jesus als Licht auf die Welt gekommen ist und dadurch Himmel und Erde verbunden hat. Der Text von Hugo von Hofmannsthal erinnert daran, dass die Sterne, die uns an die Wunder der Weihnacht und des Lebens erinnern, nicht nur weit weg am Himmel, sondern auch mitten unter uns auf der Erde zu entdecken sind. Im Geheimnis von Weihnachten kommt der Himmel zur Erde, berühren sich Himmel und Erde.
Literatur zum 4. Kapitel
Bachl, G. (1994). Der schwierige Jesus. Innsbruck: Tyrolia. Dessler, B. (2012). „Religiös reden“ und „über Religion reden“ lernen – Religionsdidaktik als Didaktik des Perspektivenwechsels. In: Grümme, B./Lenhard, H./Pirner, M. L. (Hrsg.). Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Englert, R. (2013). Religion gibt zu denken. Eine Religionsdidaktik in 19 Lehrstücken. München: Kösel-Verlag.
Guanzini, I. (2019). Zärtlichkeit. Eine Philosophie der sanften Macht. München: Verlag C. H. Beck.
Höfer, A. (2002). Erlösung will erfahrbar sein. Erlösungsvorstellungen und ihre heilende Wirkung. München: Don Bosco Verlag. Mendl, H. (2008). Religion erleben. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht. 20 Praxisfelder. München: Kösel-Verlag.
Polak, R. (2022). Die subversive Botschaft von Weihnachten – wie ein Fest und ein Lied dem Kommerz widerstehen. In: theocare. network bzw. https://www.stillenacht.at/forschung/festakt50-jahre-stille-nacht-gesellschaft.
Schambeck, M. (2010). Mystagogisches Lernen. In: Hilger, G. u. a.: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. (6. Aufl.) München: Verlag-Kösel
Trummer, P. (2021). Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben. Freiburg i. B.: Verlag Herder.
KAPITEL 5: Hören und erzählen. JESUS, FREUND DER MENSCHEN
Seiten 71 – 86 im Schulbuch
Impuls
Weil du mich magst, kann ich fliegen ohne Angst übers Haus.
Weil du mich magst, lach ich abends die Gespenster aus.
Ich kriege Herzklopfen, wenn du nach mir fragst, weil du mich magst, weil du mich magst.
Weil du mich magst, bin ich stärker als der Löwe im Zoo.
Weil du mich magst, bin ich mutig und ich freue mich so.
Ich kriege Herzklopfen, wenn du nach mir fragst, weil du mich magst.
Jutta Richter
Allgemeine Hinführung
„Der Glaube kommt vom Hören”, so sagt unsere Tradition und weist den biblischen Erzählungen damit einen wesentlichen Platz zu. Erzählungen ermöglichen eine Begegnung mit dem Dahinterliegenden, den verborgenen Personen, in den Jesuserzählungen mit Jesus selbst und den Menschen von damals. Es geht um Kontakt, Begegnung und Beziehung. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung”, formuliert der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1973, S. 15) in seiner dialogischen Anthropologie und Pädagogik und verweist auf den zentralen Punkt jüdisch-christlicher Tradition, dass Gott ein Gott der Beziehung und Begegnung ist, weil eben das ICH des Menschen nur am DU zum ICH werden kann; der Mensch wird zum Menschen, indem er angesprochen wird. Insofern sind Freundschaft, Beziehung, Kontakt und Begegnung zentral für unser Menschwerden und auch für unser Glauben. Im Zentrum christlichen Glaubens steht keine abstrakte Lehre, sondern eine konkrete Person: Jesus Christus. In ihm hat Gott selbst Kontakt zu uns Menschen aufgenommen, wie eben das Reich Gottes in Jesu Heilungen und seinen heilsamen Begegnungen erfahrbar wird. Es zeigen sich hier die humanistischen Ausprägungen von Religion. Religion als Erhebung des Menschen, als Selbstermächtigung, damit der Mensch in Freiheit und Verantwortung sein Selbst leben kann. Insofern, so nach Eugen Biser, „… weiß sich Jesus gesandt, die ‚gebrochenen Herzen‘ zu heilen und den mit der Todeswunde geschlagenen Menschen aus seiner Verfallenheit im zweifachen Sinn des Ausdrucks zu sich selber zu erheben“ (Biser 2000, S.363). Jesus erweist sich als Freund der Menschen und lässt die Menschenfreundlichkeit Gottes lebendig werden. In all dem spielen Erzählungen, wie sie in der Bibel festgehalten
sind, eine zentrale Rolle. Überall dort, wo vom Heil erzählt wird, geschieht auch schon ein Stück Heil und Erlösung. Das Christentum als „Erzähl- und Erinnerungsgemeinschaft“ (Weinrich 1973, S.329ff) weiß auch am „Ende der großen Erzählungen“, wie sie von Philosophen wie Lyotard am Ende der Moderne postuliert werden, um diese besondere Bedeutung von Hören und Erzählen und hält dieses Erbe aufrecht und lebendig. Erzählungen ermöglichen Kontakt und Begegnung miteinander, aber auch mit den erzählten Personen; in diesem Buchkapitel: besonders mit Jesus, diesem wunderbaren Menschen aus Nazaret, an dem sichtbar wird, wie geglücktes und heiles Menschsein gehen kann.
„In alledem erwies er sich vor allem als der göttliche Arzt, der gekommen war, die aus vielen Wunden blutende Menschheit zu heilen.ImZugeseinerNeuentdeckungkommtfolgerichtigauchdiese therapeutische Funktion seiner Sendung ans Licht.An sie knüpft die aktuelleGlaubenserwartungan.Sieerwartet…HilfeimDiesseitsund zumal gegenüber den das Dasein beschwerenden und verstörenden Faktoren,inersterLiniegegenüberdersichepidemischausbreitenden Lebensangst.“ (Biser 1997, S. 189).
Wie kann da die „Freude am Evangelium“ (Papst Franziskus 2013) wachsen? Wie kann da Erlösung erfahrbar werden? Welchen Zuspruch brauchen die Kinder, aber auch deren Eltern in den liquiden, vielgestaltigen Familien- und Beziehungsformen, die vielfach so brüchig geworden sind?
Es geht christlich gesprochen um eine Rückbesinnung darauf, dass Erlösung schon geschehen ist und ständig geschieht, dass Unheil, Angst und Tod nicht das letzte Wort haben und wir zu neuem Menschsein befreit sind. „Versteht euch als neue Menschen!“, sagt Paulus, „Macht euch auf die Spurensuche nach Erfahrungen von Erlösung inmitten aller Unerlöstheit, entwickelt Interesse aneinander und tut das Gute!“ (Paulus).
Heil und Erlösung geschehen mitten im Hier und Heute, wenn auch immer nur fragmentarisch. Achtsam, mit Freude und Interesse das Gute, das Heil inmitten von Unheil suchen: Im Herzen des Taifuns ist die totale Stille! Deshalb können spirituelle Menschen mit einem blinden Pessimismus nichts anfangen: Er ist blind für das Himmlische, für das Reich Gottes mitten auf Erden. Die Bibel erzählt auf all ihren Seiten von der Möglichkeit des Heils inmitten von Unheil, weil es Gott um das Heil der Menschen geht. Damit bewegt sich der Religionsunterricht bei diesem Kapitel auch im Bereich des „Mystagogischen Lernens“ als eines wichtigen Zugangs und Weges des Religionsunterrichts.
Lehrplanbezüge des 5. Kapitels
Kompetenzbereich | B3 Gelehrte und gelebte Bezugsreligion
Leitkompetenz | Grundlagen und Leitmotive des christlichen Glaubens kennen und für das eigene Leben deuten können.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können über Begegnungen von Menschen mit Jesus erzählen.
Unterrichtshinweise | Lebenskraft: Freundschaft; die Segnung der
Kinder (Mk 10,13–16), die Begegnung mit Zachäus (Lk 19,1–10) Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können über eine Begegnung Jesu mit einem Menschen erzählen.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte
Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
Jesus der Christus: Das Christentum orientiert sich am Reden und Handeln Jesu, das die vergebende und heilende Zuwendung Gottes zu den Menschen zeigt. In seiner den Tod überwindenden Auferstehung kann in der Brüchigkeit des Lebens Versöhnung und Erlösung erfahrbar werden.
Titelseite: Hören und erzählen.
Jesus, Freund der Menschen
Seite 71 im Schulbuch | Kapitel 5
Das Titelbild zeigt die koptische Ikone „Christus und Abt Menas”. Diese stammt aus dem 8. Jahrhundert nach Christus und ist die älteste koptische Ikone, die bekannt ist. Das Original dieser Ikone der Freundschaft befindet sich heute im Louvre in Frankreich. Am Titelbild ist die Ikone aufgestellt auf einem Podest mit rotem Untergrund und Kerzen, die einen Weg hin zum Bild andeuten. Auf der Ikone sind zwei Personen zu sehen, welche die Betrachter*innen direkt mit großen, offenen Augen anschauen. Christus ist durch das Kreuz in seinem Heiligenschein erkennbar. Er hält ein kostbares Buch in seiner Hand, die andere Hand legt er der zweiten Person freundschaftlich um die Schulter. Rechts von ihm steht in griechischen Buchstaben das Wort „soter”, was auf Deutsch „Retter” bedeutet. Die zweite Person trägt auch einen Heiligenschein und hält die Hand in einer segnenden Haltung. In der anderen Hand ist eine Schriftrolle zu sehen, möglicherweise die Klosterregel. Links von ihm stehen die Buchstaben Apa Mena Proeistos, was so viel wie „Vater Menas Wächter” heißt. Im erdfarbenen Hintergrund ist andeutungsweise eine Landschaft mit
grünen Gewächsen erkennbar. Hinter den Köpfen von Christus und Abt Menas ist durch den orange-roten Farbton ein Sonnenuntergang erahnbar. Die Ikone wird manchmal als Beispiel gesehen, dass Jesus jeden Menschen wie ein Freund umarmt, jede und jeden beschützt und begleitet. Sie kann für Schüler*innen die Botschaft anbieten, dass auch sie in ihrer Einzigartigkeit freundschaftlich von Jesus gesegnet und begleitet sind.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Bildarbeit: Das Bild in Stille betrachten und möglichst viele Kleinigkeiten entdecken. Dann das Bild beschreiben: Was sehe ich, welche Farben entdecke ich, was ist bei den Personen zu entdecken, beim Hintergrund … Den Kindern sagen, welche Personen dargestellt sind. Den Personen Worte geben: Was sagt Jesus zu Abt Menas? Was sagt der Abt zu Jesus?
Bildarbeit: Je zwei Kinder stellen sich in genau der gleichen Haltung wie die Personen der Ikone auf. So spüren sie nach, wie sie dieses Nebeneinander wahrnehmen. Sprechen aus ihrem Gefühl heraus in diesen Rollen. Was sagt Abt Menas, wenn er so, von Jesus umarmt, nach vorne schaut? Was sagt Jesus zu Abt Menas? Was sagt einer der beiden zu denen, die das Bild anschauen?
Gestalten: Ein Bild von Jesus mit einem selbst.

Menschen mit Herz
Seiten 72 und 73 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Wie immer geht es zunächst auf der ersten Doppelseite um eine Schulung der Wahrnehmung und Sensibilität, um ein interessiertes und freudiges Entdecken des Alltäglichen und ein Aufmerksamwerden auf das Alltägliche, in dem sich aber das Hintergründige verbirgt bzw. zeigt.
Die menschliche Sehnsucht und Notwendigkeit nach freundschaftlichem Angenommen- und Geliebtsein symbolisiert sich auf dieser Doppelseite im Bild vom Herz bzw. „Menschen mit Herz”. Jeder und jede von uns braucht Menschen mit Herz, die uns so annehmen, wie wir eben sind in all unseren Begrenztheiten. Menschen mit Herz, die uns mögen, selbst dann, wenn wir es selbst nicht mehr vermögen. Dies ermöglicht die freudige Erfahrung, dass es gut ist, in und auf der Welt zu sein, und die dadurch den Selbstwert stärkt. Zunächst sind es die Eltern bzw. die ersten Bezugspersonen, die eine sichere Bindung in dieser Welt ermöglichen. John Bowlby hat am Ende des vorigen Jahrhunderts mit seiner Bindungstheorie (A Secure Base, 1988, deutsch: Bindung als sichere Basis 2018) die Bedeutung sicherer Bindung aus psychoanalytischer Sicht herausgearbeitet und gezeigt, dass diese die Basis für eine gesunde, weltoffene Persönlichkeit darstellt. Misslingt diese Bindung, kann dies einen Menschen ein Leben lang belasten. Menschliches Leben baut auf sicheren freundschaftlichen Bindungen auf. In ihnen kann - religionspädagogisch betrachtet – das liebevolle Wirken Gottes erfahrbar werden.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… was die Bilder von Freundschaft erzählen. … wo selbst Freundschaft erlebt wird. verstehen und deuten
… dass sich Freundschaft in verschiedenen Formen äußert.
… dass das Herz ein Symbol für Freundschaft sein kann. gestalten und handeln
… Freundschaftszeichen, Freundschaftskarten usw. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Menschen mit Herz: ihr Handeln, ihre Worte. …die Notwendigkeit von Freundschaft im eigenen Leben. entscheiden und mit-tun
… Worte, Zeichen, Handlungen von Freundschaft schenken.
3 | Lernanlässe
★ Freundschaft zu anderen Kindern
★ Freundschaftsbücher ausfüllen
★ Bilderbücher über Freundschaft
★ Zerbrochene Freundschaft
★ Sehnsucht nach Freund*innen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Bildcollage knüpft an die Lebenswelt der Schüler*innen an und regt dazu an, über das nachzusinnen, was Menschen mit Herz auszeichnet, in welchen Situationen, an welchen Orten man sie antrifft und vor allem, was die Bilder über Freundschaft erzählen. Es handelt sich um Blitzlichter, die zum Schauen, Erzählen und Fragen einladen. Das Foto „Kinder am Rücken“ getragen von der Familie zeigt eine frohe Szene, in der Kinder umgeben sind von sie liebenden Menschen; sie haben Spaß und werden lachend am Rücken getragen. Viele Kinder kennen diese Erfahrung. Familie wird oft als Ort erlebt, wo Menschen einander das Herz öffnen und einander von Herzen gernhaben. Für Kinder, die das in ihrem Alltag nicht oder kaum erfahren, ist es wohl ein Sehnsuchtsbild: Menschen zu haben, die es gut mit einem meinen, denen man vertrauen kann, die ein geöffnetes Herz nicht missbrauchen. Das Foto „Nase an Nase“ zeigt ein Mädchen in einem Rollstuhl, das mit einer Vertrauensperson Nase an Nase in Berührung ist. Vertrauen und Spaß, aber auch Begegnung auf Augenhöhe werden sichtbar. Die Zeichnung „Welt und Menschen“, von einem Kind gezeichnet, zeigt ein Sehnsuchts- und Vertrauensbild, dass die Welt erfüllt sein möge mit Menschen, die ein Herz füreinander und für die ganze Schöpfung haben. Menschen mit Herz begegnen sich, in alle Kontinente sind Herzen eingezeichnet, Menschen, Bäume, Häuser … ein farbenfrohes Hoffnungsbild, das Vertrauen ausdrückt, dass es mit Mensch und Schöpfung gut sein wird, wenn Menschen mit Herz darin wohnen. Das Foto Herz aus Händen beim Konzert nimmt in eine Stimmung hinein, die eine große Verbundenheit ausdrückt. Gemeinsam zur Musik, zu Rhythmen, die alle verbinden, wird getanzt, werden Zeichen der Zuwendung und Begeisterung gemacht. Musik kann Menschen verbinden und kann das Gemeinsames vor das Trennende stellen. Das Foto „Miteinander-Kuscheln“ zeigt eine nahezu himmlische Situation für die meisten Kinder. Kuscheln mit einem geliebten Menschen und einer vertrauensvoll schlafenden warmen und weichen Katze. Eine Friedensvision, in der Menschen und Tiere in Geborgenheit beieinander sind. Das Foto „Herz aus den Händen der Freundinnen“ zeigt die Verbundenheit der beiden Mädchen. Herzen sind Zeichen der Freundschaft und der Liebe, die keiner weiteren Erklärung bedürfen.
Der Text „Was Kinder brauchen” geht darauf ein, was Kinder brauchen, damit sie gut und glücklich leben können. Die Freundschaft von Menschen mit Herz hat viele Gesichter und macht glücklich.
Die Schatzkästchen laden dazu ein, ins Gespräch über Menschen mit Herz zu kommen und darüber nachzudenken, wem man an den verschiedenen Orten begegnet. Die Kinder können entweder „Menschen mit Herz”, die ihnen an diesen Orten begegnen, hineinzeichnen oder deren Namen hineinschreiben.
Der QR-Code führt zu einer Freundschaftsgeschichte.
Die Lupe möchte einladen, auf Entdeckungsreise zu gehen und genau hinzuschauen. Was brauchen Kinder, damit sie gut leben können und es ihnen gut geht?
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Herzen gestalten: Herzen gestalten und den Namen von jemandem (oder mehreren) hineinschreiben. Wenn man die Papierrolle von Küchenrollen in Herzform einknickt, erhält man eine praktische Vorlage, die man auf ein Blatt halten kann, um mit einem Pinsel die Herzform nachzuzeichnen.
Text „Was Kinder brauchen” weiterdichten : Den Text hören oder lesen und selbst Beispiele finden, was Kinder brauchen. Der Satzanfang „Kinder brauchen ...” kann einfach vervollständigt werden, beispielsweise: Kinder brauchen Eltern.
Text „Was Kinder brauchen” darstellen: Den Text lesen und besprechen. Anschließend ein Beispiel aus dem Gedicht wählen oder ein eigenes Beispiel finden und mit jemandem aus der Klasse pantomimisch darstellen. Es kann erraten werden, was gezeigt wird.
6 | … und noch mehr Ideen
Gemeinsam eine Collage, Klassenwand, ein Plakat gestalten: Sätze über Freund*innen oder „Menschen mit Herz” wie eine Mindmap sammeln. In die Mitte kommt eine dieser beiden Bezeichnungen und rundherum werden die gefundenen Vervollständigungen angeordnet. Beispielsätze: Menschen mit Herz … helfen anderen, teilen, geben ein gutes Gefühl … Freundinnen und Freunde spielen miteinander, haben Geheimnisse miteinander, treffen sich … Kinderbuch „In deinem Herzen wohnt das Glück” vorlesen und besprechen Herzensvogel (zum Kinderbuch) gestalten: Nach einer Vorlage

(siehe unten) den eigenen Herzensvogel gestalten. Dieser kann ins Heft geklebt und die Seite gestaltet werden (z. B. ein Ort, an dem sich dein Herzensvogel wohlfühlt). Es kann auch eine Klassenwand mit den Herzensvögeln der Schüler*innen und z. B. einem Baum gestaltet werden, der sich auch über die Jahreszeiten verändern kann (bunte Blätter, Schneeflocken, grüne Blätter, Blumen …).
7 | Kinderbücher
Boehme, J., Dahle, S. (2020). Wassili Waschbär. Zum Glück hat man Freunde. Arena.
Friedl, R. (2021). In deinem Herzen wohnt das Glück. Cbj.
Van Hout, M. (2021). Freunde. Aracari.
8 | Lieder
Hand in Hand – Jedes Kind braucht T. v. M. Ehrhardt, M. von R. Horn
Ich brauch dich, du brauchst mich Nr. 7 im HB-Anhang
9 | Schnappschüsse




Mein Herzensvogel
Mein Herzensvogel
➜ Gestalte deinen Herzensvogel und schneide ihn aus. Klebe ihn entweder in dein Heft und gestalte einen Ort, an dem er sich wohlfühlt, oder gestaltet eine Klassenwand mit einem Baum für eure Herzensvögel.
Gestalte deinen Herzensvogel und schneide ihn aus. Klebe ihn entweder in dein Heft und gestalte einen Ort, an dem er sich wohlfühlt oder gestaltet eine Klassewand mit einem Baum für eure Herzensvögel.



Lebenskraft: Freundschaft
Seiten 74 und 75 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Wie wichtig und wertvoll Freundschaften sind, die manchmal ein Leben lang tragen können, und wie groß oft die Sehnsucht danach ist, soll anhand dieser Doppelseite thematisiert werden. Es gibt Platz für Kommunikation und Austausch von Erfahrungen mit Freundschaft. Freundschaftsbeziehungen sind in dieser Altersstufe meist noch sehr instabil und können häufig wechseln, was zu großen Verletzungen führen kann. Sie laufen meist über das gemeinsame Tun – besonders über das Spielen. Durch Freundschaften geschieht eine stärkere Ablöse von den ersten Bezugspersonen und wird Selbstständigkeit eingeübt. Die vielen Fragen, die sich aus den oft sehr unterschiedlichen Erlebnissen und manchmal auch schmerzlichen Erfahrungen ergeben, brauchen einen Gesprächsraum und Gesprächspartner*innen, die deutend weiterhelfen können. Die Doppelseite lädt natürlich auch dazu ein, durch Miteinander-Tun, Spielen sowie Kontakt- und Begegnungsspiele das Freundschaftsnetz in der Klasse zu stärken und zu Begegnungen zu ermutigen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wie Freundschaft gezeigt und erlebt wird. verstehen und deuten
… dass Freund*innen wie Schätze sind. gestalten und handeln
… Freundschaftsbänder, -zeichen, -spiele, usw. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Fragen zur Freundschaft, zu Streit in Freundschaften. entscheiden und mit-tun
… „Schön, dass es dich gibt”-Botschaften verschenken.
3 | Lernanlässe
★ Freude über Freundschaft
★ Freundschaftsbücher, -bänder …
★ Gruppenarbeiten: Wer möchte mit mir arbeiten?
★ Streit mit Freundinnen und Freunden
★ Fragen zu Freundschaft
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Im Text vom Raben Felix erzählt Felix von einer Situation, die für jedes Kind nachvollziehbar ist. Der Gedanke, dass man sich ganz allein fühlt, dass man das Gefühl hat, dass man niemanden hat, der oder die einen mag, ist zutiefst traurig. Kinder brauchen Bezugspersonen, brauchen Freund*innen. Wenn sich nun jemand, wodurch auch immer ausgelöst, so ganz allein fühlt, wenn das Leid groß ist, dann braucht es mehr als Worte, um zu trösten. Dann ist das Da-Sein gefragt. Keine leeren Trostworte, sondern sich Zeit nehmen, zuhören, miteinander
etwas tun, miteinander spielen. Freund*innen zu haben, ist gerade auch in der Schule ein ganz wesentlicher Beitrag zum Glücklichsein.
Das Foto „Gemeinsam in den Himmel schauen” zeigt zwei Kinder, die in der Wiese liegen und in den Himmel schauen. Das Kind im Hintergrund zeigt mit der linken Hand nach oben, so als möchte es dem anderen Kind etwas zeigen, dabei lachen beide. Das Strahlen der Kinder und das gemeinsame In-eine-Richtung-Schauen, sind symbolhaft für Freundschaften.
Die Schatzkästchen regen an, über Freundschaft nachzudenken und miteinander zu den gestellten Fragen ins Gespräch zu kommen und über mögliche Antworten zu philosophieren.
Die Bibelstelle „Ein treuer Freund…“ aus Jesus Sirach, 6,14, ist ein Ausschnitt einer Sammlung von Sprüchen und Lebensweisheiten im Buch Jesus Sirach. Wahrscheinlich wendet es sich an die Jugend und möchte sie auf das Leben vorbereiten. Der Spruch, der im Schulbuch zu finden ist, ist wohl eine Erfahrung, die Menschen aller Zeiten machen und gemacht haben: dass es ein Schatz ist, wenn man gute Freund*innen gefunden hat. Auf einen Schatz gibt man Acht, man geht sorgsam mit ihm um. Weiter heißt es: Eine Freundin, ein Freund ist ein starker Schutz. Gemeinsam geht es besser, gemeinsam schafft man mehr und traut man sich mehr – das ist wohl auch eine Erfahrung, die für Kinder aller Zeiten möglich ist.
Der QR-Code führt zu einem Lied zum Thema „Freundschaft“. Der Satz „Schön, dass es dich gibt“, ist eine Botschaft, die in einfacher Sprache das grundsätzliche Geliebtsein, Gewünschtsein und Geschätztsein ausdrückt. Wenn Eltern das ihren Kindern oder Freund*innen einander sagen, ist die Welt in Ordnung. Es gibt eigentlich keine schönere Botschaft. In diesen Worten kann für religiöse Menschen auch die Zusage Gottes durchklingen, die er jedem einzelnen Menschen von Anfang an liebend zuspricht.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bibelstelle Sir 6,14 besprechen: Zur Besprechung können die Bilder zur Bibelstelle groß ausgedruckt in die Mitte gelegt werden, also ein Zelt, ein Schatz und Bilder zur Freundschaft. Assoziationen der Schüler*innen dazu sammeln. Ausgehend davon kann die Biblstelle anschließend vorgelesen und auch in die Mitte gelegt und besprochen werden. Hilfreiche Fragen können sein: Was ist Treue? Was zeichnet einen treue Freund*innen aus? Inwiefern sind treue Freund*innen wie ein festes Zelt? Was bedeutet es, einen Schatz zu finden? Wie geht man mit einem Schatz um? u. v. m. Philosophieren über Freundschaft: Nachdenken über die Fragen in den Schatzkästchen. Zum Philosophieren eignet sich im Besonderen ein Sesselkreis und eine gestaltete Mitte, z. B. können Fragen und Satzanfänge (siehe Schulbuch) in die Mitte gelegt werden. Freundschaftskarten für Menschen mit Herz: Die Schüler*innen können entweder selbst Freundschaftskarten basteln, z. B. könnte man ihnen dazu vorgeschnittenes Papier Größe A6 anbieten, welches sie dann mit dem Namen ihrer Freund*innen und Herzen ganz wie sie es wollen gestalten können. Außerdem können auch die Vorlagen (siehe unten) verwendet und verschieden gestaltet werden, u.a. mit Buntstiften, Filzstiften, Wasserfarben ... außerdem können diese Karten auch auf buntes Papier geklebt werden und so einen Rahmen erhalten.
„Schön, dass es dich gibt“-Botschaften verschenken Freundschaftsarmbänder gestalten: Perlen auffädeln, mit Gummibändern, aus Fäden flechten, drehen …
Gemeinschaftsspiele spielen: Die folgenden und weitere Spiele miteinander spielen und die Gemeinschaft stärken.
Mein rechter Platz ist frei, ich wünsche mir Name herbei. Reise nach Jerusalem: Die eine Hälfte der Stühle wird nebeneinander in einer Reihe aufgestellt. Die zweite Hälfte wird so dagegen gestellt, dass die Stuhlrücken aneinanderstoßen. Die Anzahl der Stühle entspricht einem weniger als Kinder mitmachen. Die Kinder stellen sich nun um die Stühle herum auf. Es wird Musik gespielt. Solange die Musik klingt, laufen die Kinder im Gänsemarsch hintereinander um die Stühle im Kreis herum. Stoppt die Musik, müssen sich die Kinder blitzschnell auf einen Stuhl setzen. Ein Kind erwischt keinen Stuhl. Dieses Kind scheidet aus oder ist am Reiseziel angelangt. Alle Kinder stehen wieder auf. Ein Stuhl am Reihenende wird weggestellt und die Reise beginnt erneut beim Einsetzen der Musik. Das wird so lange fortgeführt, bis nur noch ein Kind übrig geblieben ist. Das ist das Siegerkind.
Alle, die: Die Kinder sitzen im Sesselkreis. Ein Kind steht in der Mitte und sagt beispielsweise: „Alle, die gerne Eis essen.” Alle Kinder, auf die diese Aussage zutrifft, stehen auf und suchen sich einen neuen Sessel. Auch das Kind in der Mitte hat jetzt die Möglichkeit, sich einen Sitzplatz zu schnappen. Das Kind, das keinen Sessel erreicht, ist in der Mitte und darf den Satz vervollständigen: „Alle, die …”
6 | … und noch mehr Ideen
Fragen über Freundschaft stellen: Die Schüler*innen können weitere Fragen über Freundschaft stellen, welche entweder beantwortet

werden oder über welche gemeinsam nachgedacht werden kann. Freundschaftsgeschichten erzählen: Über Erlebnisse mit Freund*innen erzählen, u. a. Erlebnisse, in denen Freundschaft ihnen Kraft oder Schutz gegeben hat – als Hinführung dient die Rabengeschichte. Ein Kinderbuch über Freundschaft vorlesen und besprechen. Zum Kinderbuch mit Zuckerkreiden gestalten: Mit Zuckerkreiden ein Bild von Freund*innen und sich selbst auf schwarzem Papier zeichnen, sodass es ähnlich aussieht wie die Bilder im Buch.
7
| Kinderbücher
Günther, A. (2020). So wunderbar sind Freunde. Kawohl.
Island-Olschewski, B. (2023). Zusammen sind wir richtig stark! Carlsen.
Köhnen, M. Hoefs, H. (2018). Ferdinand sucht einen Freund. Ullmann.
Smallman, S. (2022). Weil wir Freunde sind. Ravensburger.
Van Hout, M. (2021). Freunde. Aracari.
8 | Lieder
Mit einem*r Freund*in an der Seite LB Religion Nr. 66
Wenn einer sagt: „Ich mag dich...” LB Religion Nr. 70
9 | Schnappschüsse



Freundschaftskarten
Freundschaftskarten
➜ Gestalte die Freundschaftskarten und schneide sie aus. Verschenke sie an deine Freundinnen und Freunde.
Gestalte die Freundschaftskarten und schneide sie aus.
Verschenke sie an deine Freundinnen und Freunde.








Freundschaft leben – Einander Gutes sagen: Lebensworte
Seiten 76 und 77 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Menschliches Leben ist auf Interaktion und Kommunikation angewiesen. Schon im Mutterleib erkennt das heranwachsende Kind seine ersten Bezugspersonen. Durch Sprache werden wir Menschen ins Leben gerufen. Das Angesprochenwerden von Anfang an ist zentral für die kindliche Entwicklung. Sprache, Angesprochenwerden und Sich-Aussprechen sind wesentliche Merkmale des Menschen und wichtiges Lebensmittel. Ohne Sprache verarmen und vereinsamen Menschen, wie es oft bei alten Menschen beobachtet werden kann. Es geht um den kostbaren Schatz der guten Worte, um den kostbaren Schatz der Bücher, speziell auch der „heiligen Schriften“. Für gläubige Christ*innen besteht die Bibel als Heilige Schrift nicht nur aus schönen Erzählungen und aufbauenden Worten, sondern in ihnen wird Gottes Wort selbst vernehmbar. Es sind Worte des Lebens und des Heils: Gottes Wort in Menschenwort. Dies braucht und kann sich Kindern in dieser Altersstufe, die vielfach sehr säkular aufwachsen, nicht so schnell erschließen, aber deutet die Richtung an, sich auch der geheimnisvollen transzendenten Dimension zu öffnen und den Mehrwert zu erahnen. Bilder, Texte und das Lied dieser Doppelseite wollen einen Zugang zur Bibel ermöglichen und zur Begegnung mit dem kostbaren Schatz der Bibel einladen. Aber es muss dabei immer um das Leben (auch der Kinder) gehen, denn nichts Menschliches ist der Bibel fremd; alle freudvollen Höhepunkte, aber auch alle Tiefpunkte des Lebens kommen darin zur Sprache. Gott kommt mitten in der Begegnung mit Menschen, mitten im Leben zur Sprache. So sind die biblischen Erzählungen Einladungen, darin auch mit dem „erzählten Gott“ in Kontakt zu kommen, der das Leben und Glück der Menschen will. Konkret wird dies sichtbar für Christ*innen in Jesus. Die Form der Erzählungen ermöglicht auch Kindern, die mit dem christlichen Glauben und religiöser Bildung vielleicht bisher zum Teil wenig in Kontakt waren, einen Zugang von ihrem Leben her. Erzählungen sind allgemein verständlich und von den meisten Kindern sehr geliebt. So wird es bei diesem Buchkapitel immer wieder sinnvoll sein, zu erzählen, vorzulesen, Bücher mitzubringen und die Atmosphäre der Erzählung im Kreis zu erleben und zu genießen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben welche Worte gut tun, heilsam sind, Hoffnung schenken. verstehen und deuten
… dass die Bibel ein besonderes Buch mit Hoffnungsgeschichten und Lebensworten ist. gestalten und handeln
… „Gute-Worte”-Klassenwand.
… Bibelausstellung in der Klasse.
(be-)sprechen und (be-)urteilen
… besonderes bedeutsame Lebensworte. entscheiden und mit-tun einander Worte der Freundschaft sagen.
3 | Lernanlässe
★ Fragen nach der Bibel: Warum ist die Bibel ein besonderes Buch? Was steht in der Bibel drinnen? Wie lange gibt es die Bibel? Wie viele Seiten hat die Bibel? Kann man die ganze Bibel durchlesen? Wie viel kostet eine Bibel? U. v. m.
★ (Kinder-) Bibeln im eigenen Lebensumfeld
★ Bekannte biblische Erzählungen
★ Lieblingsbücher, Lieblingsgeschichten
★ Freundschaftsbücher der Schüler*innen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Foto „Flüstern“ zeigt zwei Kinder, die lebensfroh Worte austauschen. Etwas wird ins Ohr gesagt. Es lässt die Augen leuchten, es ist ganz speziell für dieses eine Kind gemeint. Eine geheime Botschaft?
Eine Neuigkeit? Eine … ?
Im Schatzkästchen ist Platz für Worte der Freundschaft. Schon gehörte Worte, neu erfundene, gerne gehörte oder gesagte Freundschaftsworte … diese können geschrieben, weitergesagt, verziert
… werden.
Die Sätze bzw. Lebensworte in den Sprechblasen sind Botschaften aus der Bibel, die Menschen zu allen Zeiten, auch heute, Mut machen, Freude machen, trösten …
Das Bild „Bibel“ auf der rechten Seite zeigt den Einband einer „Einheitsübersetzung” der Bibel, so wie sie in manchen Familien im Bücherregal steht. Grün, die Farbe des Lebens, ein kleiner Rest dunkel, auch das gehört zum Leben, ein helles Kreuz, das von der Auferstehung und von der Lebenskraft der biblischen Texte erzählt, und das alles auf dem hellgelben Hintergrund, der an die Sonne, an das Licht, an die heile Welt Gottes erinnert. Das goldene Feld rechts in der Mitte des strahlenden Kreuzes verweist des Weiteren auf Gott, das Heilige, die Liebe Gottes und verdeutlicht auch, wie kostbar die heilige Bibel ist.
Auf dem Bild „Kostbarer Buchstabe“ ist der Anfangsbuchstabe B (eines Davidpsalms) mit dem Motiv des Königs David, der auf der Harfe spielt, malerisch auf Goldhintergrund und mit goldener Farbe eingerahmt gestaltet. Gold steht in religiöser Kunst für Gott, für das Heilige, für die Liebe Gottes. In alten Zeiten wurden Bibeln mit der Hand geschrieben und durch Buchmalerei kostbar gestaltet. Mönche haben zum Teil ein Leben lang an einer Bibel geschrieben und sie als echte Schatzbücher gestaltet.
Die Aufzählungen zur Bibel beschreiben, was die Bibel ist und was in ihr zu lesen ist. Sie ist ein Freundschaftsbuch zwischen Gott und den Menschen. Menschen erzählen vom Leben mit all seinen Facetten und deuten es aus der Sicht ihres Glaubens. Erzählungen des Alten und des Neuens Testaments basieren auf dem Vertrauen, dass – egal, was geschieht – Gott als Freund der Menschen begleitet, ruft, herausfordert, segnet … Mit all den Fragen, die die Menschen haben, können sie aus dem Grundvertrauen in Gott Hoffnung schöpfen. Das Lied „Wort des Lebens” bringt singend zum Ausdruck, dass gute Geschichten und speziell die Erzählungen der Bibel gut tun, dass es Lebensgeschichten sind, die die gute Botschaft von Gott und den
Menschen thematisieren. Erzählungen und Worte der Bibel erzählen von Themen des Lebens aus der Perspektive des Glaubens; um es in der Sprache der Ikonen und Buchmalereien zu sagen: Lebensgeschichten auf dem Goldhintergrund, des menschenfreundlichen Gottes.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bibeln besonders präsentieren: Besondere Präsentation der Bibel z. B. in einer Schatzkiste oder auf einen besonderen Hintergrund. Verschiedene Bibeln in Szene zu setzen macht die Vielfalt deutlich. Bibel(n) anschauen: Das Bild von der Bibel im Schulbuch und mitgebrachte Bibeln gemeinsam anschauen. Die Titelbilder können wie bei einer Bildarbeit angeschaut werden. Ein besonderes Highlight bilden auch Bibeln in anderen Sprachen, die ggf. von Kindern mitgebracht werden können. Wenn es sich um eine illustrierte Kinderbibel handelt, kann man sich z. B. gemeinsam auf die Suche machen, ob Erzählungen wiedererkannt werden. Informationen über die Bibel besprechen Über heilsame Worte aus der Bibel nachdenken: Die Bedeutung der Bibelworte gemeinsam erschließen und überlegen, in welchen Situationen man diese Worte gerne hört oder hören möchte. Worte der Freundschaft: Gemeinsam Worte finden, die zu Freundschaft passen wie z. B. Liebe, teilen, spielen, helfen … Stille Freundschaftspost: Es werden Worte der Freundschaft, freundliche Botschaften usw. in das Ohr des Nachbarn gesagt – am besten im Sesselkreis. Neugierig warten alle, ob dieselbe Botschaft auch noch beim letzten Kind ankommt. Die Botschaften können anschließend auf der Tafel, im Heft usw. gesammelt werden. Besondere Buchstaben: Den ersten Buchstaben des eigenen Namens in besonderer Weise gestalten (Größe, Farben, Symbole, Muster).



6 | … und noch mehr Ideen
Ein Klassenfreundschaftsbuch aus den Arbeitsblättern gestalten: Jedes Kind füllt eine Seite des Freundschaftsbuches (siehe unten) aus. Aus den ausgefüllten Seiten ergibt sich zusammen ein Klassenfreundschaftsbuch. Es kann auch gemeinsam ein Einband gestaltet werden. Das Klassenfreundschaftsbuch kann von den Schüler*innen abwechselnd mit nach Hause genommen und z. B. mit der Familie durchgeschaut werden.
7 | Kinderbücher
de Lestrade, A., Docampo, V. (2012). Die große Wörterfabrik. mixtvision.
Pauli, L., Schärer, K. (2009). Mutig, mutig. (17. Aufl.) Atlantis.
Pauli, L, Schärer, K. (2014). Nur wir alle. Atlantis.
Zagarenski, P. (2022). Der Fuchs und die verlorenen Buchstaben. Knesebeck.
8 | Lieder
Mit einem*r Freund*in an der Seite LB Religion Nr. 66
Gottes Wort gibt mir Kraft T./M. v. S. Reitlinger: www.musikager.at; Nr. 9 im HB-Anhang
9 | Schnappschüsse





Damals und heute: Jesus ruft Freundinnen und Freunde
79 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Angesprochenwerden von Gott her oder vom Leben, Berufung und Gerufensein sind wesentliche Leitmotive im Christentum, und zugleich wird es auch immer von Menschen im Alltäglichen so erfahren, wenn sie spüren, dass sie „für ihren Beruf wie berufen sind”. Menschen werden also von Gott gerufen bzw. verstehen ihre Lebensentscheidungen unter diesem Blickwinkel. Zu Beginn des Markusevangeliums steht diese Berufung der Jünger nach dem Wort Jesu vom Reich Gottes: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Die Berufungen der Jünger stehen im Zusammenhang mit dem Reich Gottes, mit dem Wirken Gottes. Menschen bekommen dadurch eine besondere Aufgabe: dem Reich Gottes – damit den Menschen – zu dienen. Für Kinder wird zunächst wohl naheliegender und reizvoller sein, in die Nähe von Jesus zu kommen und weniger die besondere Aufgabe, die damit verbunden ist. Aber es ermöglicht auch den Blick in die Richtung, das Leben grundsätzlich als Aufgabe zu sehen und zu verstehen bzw. die unterschiedlichen Aufgaben von Menschen in unserer Gesellschaft im Dienst an den anderen wahrzunehmen und zu besprechen. Hat nicht jede*r eine wichtige Aufgabe und Bedeutung im Leben, auch die Kinder? Der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor Frankl, der als österreichischer Jude selbst vier KZ-Aufenthalte überlebte und den Tod seiner ganzen Familie erleben musste, dreht die Denkrichtung ähnlich um, wenn er postuliert: „Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten – das Leben zu ver-antworten hat.“
(Frankl, V. E. 1997, S. 96).
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wer sie ruft, von wem sie sich gerne rufen lassen, mit wem sie gerne mitgehen und warum. verstehen und deuten
… dass Jesus Menschen Freundschaft schenkt, sie ruft.
… dass Jesus Menschen fasziniert und sie mit ihm gehen wollen. gestalten und handeln
… Rufspiele spielen.
… Berufung von Simon und Andreas nachspielen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… warum Menschen alles verlassen und mit Jesus mitgehen. teilhaben und entscheiden
… auf den Ruf anderer, den Ruf Gottes hören.
3 | Lernanlässe
★ Beim Namen gerufen werden: Ich bin gemeint.
★ Von anderen Menschen, mit denen man mitgehen soll.
★ Verschiedene Arten des Rufens.
★ Sätze von Erwachsenen: Geh nicht mit Fremden mit! Hör auf das, was deine Lehrerin sagt!
★ Besondere Berufe, Berufungen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix erzählt von einer alltäglichen Erfahrung. Besonders Kinder werden oft gerufen. Wenn man mit Erwachsenen mitkommen darf, ist das oft aufregend, weil man Dinge erlebt, die man alleine nicht erleben würde. Gerade Kinder können nicht einfach losgehen und Neues erleben. Sie sind darauf angewiesen, dass jemand sie ruft und mitnimmt. Mitgehen heißt im Normalfall auch, im Schutz der Erwachsenen, der Lehrerin … zu sein. Da kann sich eine neue Erfahrung, eine neue kleine Welt eröffnen.
Die Bibelstelle „Als Jesus am See …“ nach Mk 1,16–18 zur Jüngerberufung lässt erkennen, dass „Berufen” mit „Rufen” zu tun hat. In der Nachfolge Jesu geht immer ein Ruf von Jesus voraus. Wenn man auf die Markusstelle hinschaut, dann fällt auf, dass Jesus zuerst einmal den Menschen wahrnimmt. Mitten im Alltag, mitten in der Berufsausübung „sieht” Jesus den Menschen. Er ruft nicht einfach in die Menge, sondern er meint jemanden ganz konkret. Er nimmt Beziehung auf, es geht um Personen mit einem konkreten Namen. Sie sind gemeint und niemand anderer. „Kommt her, mir nach!” Und sie lassen alles liegen und folgen ihm nach, so heißt es. Sie vertrauen Jesus, sie gehen mit, gehen ihm nach, sie lernen von ihm, schauen und hören, wie er das Reich Gottes verkündet, um es selbst auch zu tun. Jesus sagt, sie sollen Menschenfischer werden. Als Fischer verstehen sie dieses Bild und machen sich mit Jesus auf diesen Beziehungsweg, auf diesen Lernweg, auf diesen Vertrauensweg.
Das Bild zur Bibelstelle ist aus einer von Štěpán Zavřel illustrierten Kinderbibel (Schindler, R., Zavřel, S.: Mit Gott unterwegs, Bohem Press). Es zeigt eine Szene aus den Berufungsgeschichten. In der Mitte des Bildes sieht man einen Mann in einem hellen Kleid und in Sandalen. Er neigt sich einem Menschen zu, der vor ihm am Boden kniet, und berührt ihn. Man kann erkennen, dass diese Begegnung auf einem Steg an einem Gewässer stattfindet. Zwei weitere Männer sind auf einem Boot und beobachten die Szene. Sie arbeiten in ihrem Boot, haben aber ihren Blick nicht auf ihre Arbeit, sondern auf die beiden Männer am Steg gerichtet. Einige Möwen fliegen durch die Lüfte. Die Kinder werden diese Figur in der Mitte schnell mit Jesus assoziieren. Er ist es, der hier eine Person berührt. Er tut es im Bild äußerlich. Aus dem Kontext der Bibelerzählung erkennt man aber, dass in dieser Begegnung mit Jesus auch eine innerliche Berührung stattfindet. Eine Ergriffenheit, ein Ruf, der das ganze Leben verändert. Die Bilder „Lehrerin der Herzen“ und „Lehrerin im Einsatz“ erzählen davon, dass Jesus auch in unserer heutigen Zeit Menschen ruft, ihm zu folgen. Nachfolge hat viele Gesichter. Hier ist eine Religionslehrerin, die als Gerufene von der Hoffnungsbotschaft Jesu erzählt. Sie wendet sich dem je einzelnen Kind zu und „übersetzt” für Kinder unserer Zeit die Botschaft Jesu ins Heute. Das Foto mit dem Herzen wurde von Kindern für ihre Religionslehrerin gebastelt und als Überraschung an die Tafel geheftet. Ein Mensch mit Herz zu sein, nicht nur mit Worten, sondern in der konkreten Begegnung, ist
eine schöne Umschreibung für die Nachfolge Jesu. Der Text „Jesus sagt …“ kann auch heute noch als Aufforderung an uns Menschen verstanden werden, Jesus nachzufolgen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Rufspiele spielen: Wie „Mein rechter Platz ist frei, ich wünsche mir (Name) herbei“ oder „Obstsalat mit Jünger*innen“: Die Kinder sitzen im Sesselkreis. Die Lehrperson teilt jedem Kind einen Jüngernamen zu. Auch die Namen von Jüngerinnen (Maria Magdalena oder Salome) können/sollen dabei sein. Es gibt einen Sessel weniger als Mitspieler*innen. Ein Kind stellt sich in die Mitte und nennt einen der Namen, z. B. „Petrus“. Dann müssen sich alle Kinder mit dem aufgerufenen Namen und das Kind in der Mitte einen neuen Platz suchen. Die anderen Kinder bleiben sitzen. Der/Die keinen Platz findet, geht in die Mitte und ruft den nächsten Namen. Wird „Jünger von Jesus” gerufen, tauschen alle Mitspieler*innen die Plätze. Heftarbeit „Jesus findet Freunde”: Anhand von 13 Papierstücken gestalten die Schüler*innen Jesus und seine 12 Jünger auf einer Doppelseite im Heft. Die Papierstücke dienen als Körper der Figuren, der Kopf sowie die Hände und Füße werden, wie die Umgebung, von den Schüler*innen selbst gestaltet bzw. dazu gezeichnet. Fische für Heft oder Klassenwand gestalten (siehe unten) Nachdenken und besprechen: Wie können wir noch heute mit Jesus mitgehen, ihm nachfolgen?


6 | … und noch mehr Ideen
Gottes Boot der Liebe gestalten: Dass Jesus die Jünger und Jüngerinnen auffordert: „Kommt, lasst uns Menschen fischen”, kann man so verstehen, dass er Menschen in „Gottes Boot” holen möchte. So, wie auch die Redewendung „jemanden ins Boot holen“ verstanden wird. Dazu passend ein Boot Gottes im Heft oder groß auf einem Plakat gestalten. Dort können die Kinder ihre eigenen Namen hineinschreiben, aber auch Personen, denen Jesus hilft bzw. die er zur Umkehr bewegt und die sie kennenlernen (Zachäus, Bartimäus, Jünger …).
7 | Kinderbücher
Deutsche Bibelgesellschaft (2019). Die Bibel. Einsteigerbibel. SCM.
8 | Lieder
Gott ist mit uns unterwegs T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Hand in Hand mit Jesus gehen T./M. v. S. Reitlinger: www.musikager.at; Nr. 10 im HB-Anhang
Jesus mein Freund, du sprichst zu mir T./M. v. Birgit Minichmayr; Nr. 1 im HB-Anhang
Mit einem*r Freund*in an der Seite LB Religion Nr. 66
9 | Schnappschüsse





Jesus sagt: „Folgt mir nach!“
Jesus sagt: „Folgt mir nach !“
In Gottes Boot der Liebe haben alle Platz. ➜ Gestalte die Fische und schneide sie aus.
In Gottes Boot der Liebe haben alle Platz. Gestaltet die Fische und schneidt sie aus.





Jesus sagt: Du bist gesegnet
Seiten 80 und 81 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Segnung der Kinder spricht zuinnerst Menschen groß und klein auch heute an, weil darin die Sehnsucht jedes Menschen bzw. des Kindes in uns wieder geweckt wird: angenommen, geliebt, gesegnet zu sein. Jesu nimmt die Kinder in seine Arme und segnet sie; jene, die in der Zeit von Jesus und durch die Jahrhunderte hindurch keine Bedeutung hatten, werden jetzt bei ihm in den Mittelpunkt gerückt. Soziokulturelle Untersuchungen ergaben: Kinder hatten zur Zeit Jesu nichts zu lachen; Kinder galten als noch unvernünftig, unnütz, unproduktiv, wertlos. Oft wurden Kinder vernachlässigt und ihrem Schicksal überlassen. Sie lebten wie heute Straßenkinder. Entwurzelte, elternlose Kinder trieben sich in regelrechten Kinderbanden um. Kinder hatten keine Rechte, konnten ausgenutzt, ausgebeutet und misshandelt werden. Vermutlich handelt es sich bei der Kindersegnung gerade auch um solche Kinder am Rande … „Ihnen gehört das Reich Gottes!“, sagt Jesus (V 14c). Das ist etwas Revolutionäres und kann nicht hoch genug beurteilt werden. In dieser Begegnung mit Jesus werden die Kinder eingeladen, sich selbst „in die heilsame“ – für manche vermutlich auch befremdende – Nähe Jesu zu begeben und darin etwas von diesem Getragen-Sein und Gesegnetsein von Gott zu erspüren und erfahren zu können. Vielleicht weckt es auch nur die Sehnsucht danach: ganz erwünscht und gehalten zu sein. Dies kann gerade im Erzählen auch erlebt werden. Erzählungen eröffnen einen inneren Raum der Begegnung (D. Winnicott: „potential space”), laden zur Identifikation ein und nehmen die Zuhörer*innen mit in diesen Begegnungsraum. In der Unterschiedlichkeit der religiösen „Vorbildung“ und Sozialisation der Kinder muss und darf hier vieles offen bleiben, selbst die Distanz oder mögliche Ablehnung darf sein und ist zu beachten.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben wie Jesus mit den Kindern seiner Zeit umgeht. verstehen und deuten … was es bedeutet, jemanden zu segnen. gestalten und handeln
… sich selbst bei Jesus. (be-)sprechen und (be-)urteilen … was das Wissen, dass mich jemand gern hat, bewirkt. entscheiden und mit-tun
… Segen empfangen und Segen weitergeben.
3 | Lernanlässe
★ Segnen mit einem Kreuz auf der Stirn
★ Fragen nach Jesus
★ Fragen nach dem, was hilft, wenn man Angst hat
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Zeichnungen „Kinder auf dem Weg“ und „Miteinander“ sind vom steirischen Künstler Stefan Karch. Sie zeigen Kinder, die zum Teil unterwegs sind, zum Teil zusammenstehen und miteinander kommunizieren. Die Kinder spiegeln die Diversität unserer Schulen und Klassenzimmer wider. Es ist manchmal ein Miteinander, manchmal ein Nebeneinander. Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Religion, unterschiedliches Geschlecht – in der Verschiedenheit und Buntheit spielt sich Schulleben ab. Das Bild strahlt etwas positiv Heiteres aus, das wesentlich zum Kindsein gehört. Gerade weil das Leben von Kindern nicht immer nur einfach und heiter ist, sind Zugehörigkeit und Zusammensein wesentlich für die kindliche Entwicklung. Der Bibeltext „Da brachte man Kinder …“ Mk 10,13a.16 ist ein Ausschnitt aus der Erzählung von der Kindersegnung Markus 10,10–16. Kindsein hat sich zur Zeit Jesu ganz anders dargestellt als heute. Es war kein verwöhntes Leben, es war normal, dass Kinder arbeiten mussten. Holz sammeln, Öl herstellen aus Oliven, die zuerst mühsam gesammelt werden mussten, mithelfen in den Handwerksbetrieben der Väter und vieles mehr. Auch Jesus musste mit großer Wahrscheinlichkeit im Betrieb von Josef, dem Zimmermann, mithelfen. Es gab keine Kinderrechte und Kinder standen gesellschaftlich ziemlich am unteren Ende in einem Dorf. Auf diesem Hintergrund ist die Erzählung von der Kindersegnung ziemlich verblüffend. Jesus zeigt hier, dass er auf der Seite der Rechtlosen und derer, die am Rand der Gesellschaft stehen, ist. Wenn es im V13 heißt, dass die Jünger die Kinder schroff abwiesen, ist das auf dem damaligen Hintergrund nichts Außergewöhnliches. Doch Jesus lässt es nicht zu, im Gegenteil: er sagt den Kindern das Reich Gottes zu. Wie an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments werden bei Jesus die Werte umgekehrt. Den scheinbar Wertlosen wird das Reich Gottes zugesagt, die Kleinen werden gesegnet und sind groß in den Augen Gottes.
Das Gedicht bzw. Lied „Weil du mich magst, kann ich fliegen” von Konstantin Wecker kann sowohl aufgesagt als auch gesungen werden. Der Text beschreibt, dass Freundschaft ungeahnte Dinge möglich macht: Angst vergeht, Mut wächst, Herz klopft freudig, Leben ist schön.
Das Bild „Jesus und Abt Menas“ nimmt das Titelbild des Kapitels auf. So, wie Jesus freundschaftlich dem Abt Menas die Hand um die Schulter legt, so legt er sie jedem Menschen um die Schulter. Dieses Bild erinnert im Kontext dieser Doppelseite, daran, dass Jesus auch in unserer Zeit Kinder, Jugendliche und Erwachsene segnet und begleitet. Nähe und Umarmung von Jesus wird konkret spürbar, wenn Kinder, wie im Bild von Karch angedeutet, einander den Arm um die Schulter legen, man einander die Hände reicht …
Das transparente Bild vom Regenbogen über den Bildern von Stefan Karch stammt vom Künstler Alois Neuhold und taucht immer wieder im Buch auf. In verschiedenen Kontexten bettet er das Gezeigte und Geschriebene ein in die Zusage der Freundschaft Gottes. In der Noacherzählung ist der Regenbogen das Zeichen des Freundschaftsbundes zwischen Gott und den Menschen. Wenn Jesus die Kinder in die Mitte stellt und segnet, wenn Kinder einander in Freundschaft begegnen, da verwirklicht sich die Freundschaft Gottes mitten unter den Menschen.
Der Satz „Bei Jesus hast du einen guten Platz“ ermutigt zum Vertrauen, dass jedes Kind, egal in welcher Zeit und unter welchen Umständen es lebt, bei Jesus einen guten Platz hat. Das Angebot ist da. Ob es jemand nützt, bleibt der Freiheit der Einzelnen überlassen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bibelgeschichte vorlesen: Die Bibelgeschichte zur Kindersegnung (evtl. mit Hilfe des Kamischibai Erzähltheaters oder Bilderbuches) vorlesen und mit den Schüler*innen besprechen. Einander segnen und gesegnet werden: Die Kinder zeichnen einander (freiwillig) ein Kreuzerl auf die Stirn und wünschen sich dabei etwas Gutes für den anderen. Heftarbeit „Ich bin gesegnet”: Die Schüler*innen zeichnen sich selbst über eine Doppelseite (längs) zur Überschrift „Jesus sagt: Du bist gesegnet! (Name) ist ein wunderbares Kind Gottes“. Sie können u. a. auch Jesus dazuzeichnen (siehe unten).
Über die Bedeutung eines „guten Platzes bei Jesus“ nachdenken: Was braucht ein Platz, um ein guter Platz zu sein? Was brauchen Kinder? Welchen Platz auf der Welt magst du besonders? Warum? Wie kann man auch heute noch einen „guten Platz bei Jesus“ haben?
6 | … und noch mehr Ideen
Segensfeier gestalten: U. a. im Turnsaal eine eigene Segnung für die Kinder der ersten Klassen gestalten. Dazu können auch Menschen u. a. aus der Pfarre (Pfarrer, Pastoralreferent*innen, Wortgottesfeierleiter*innen, Eltern, usw.) eingeladen werden. Heftarbeit „Jesus segnet uns Kinder“: Jedes Kind bekommt einen kleinen Streifen Papier (ca. 4x8cm) und die Aufgabe, sich selbst auf diesen Streifen zu zeichnen. Anschließend werden die Zeichnungen



eingesammelt, auf ein A4 Blatt geklebt und in Klassenstärke kopiert. So hat jede*r Schüler*in die Zeichnungen der anderen Kinder. Nun kleben sie in die Mitte ein Jesusbild, schneiden die gezeichneten Kinder aus und kleben sie um Jesus herum.
Heftarbeit „Jesus umarmt auch mich“: Den Kindern wird die Vorlage „Jesus ist ein Freund der Kinder“ (siehe unten) gegeben. In diese können sie sich mittig selbst zeichnen. Anschließend gestalten sie die Figur als Jesus. Die Arme werden dann nach innen geklappt, sodass es aussieht, als würde Jesus sie umarmen.
7 | Kinderbücher
Brandt, S., Nommensen, K. (2023). Jesus segnet die Kinder. Mini Bilderbuch. Don Bosco.
Gliori, D., Treiber J. (2012). So wie du bist. Annette Betz.
Hübner, F., Humbach, M. (2013). Weißt du schon, wie lieb Gott dich hat? Gütersloher Verlagshaus.
8 | Lieder
Jesus ist bei dir T./M. v. D. Kallauch: www.danielkallauch.de
Gottes Liebe ist so wunderbar LB Religion Nr. 17
Mit einem Freund/einer Freundin an der Seite LB Religion Nr. 66
Wo ich gehe, bist du da LB Religion Nr. 56
9 | Schnappschüsse


Jesus - Freund der Kinder
Jesus – Freund der Kinder
➜ Schneide die Figur aus und gestalte sie, wie du dir Jesus vorstellst. Biege anschließend die Arme ein, sodass Jesus dich umarmen kann. Du kannst dich selbst auch dazumalen oder ein Bild von dir aufkleben.
Schneide die Figur aus und gestalte sie, wie du dir Jesus vorstellst. Biege anschließend die Arme ein, sodass Jesus dich umarmen kann. Du kannst dich selbst auch dazumalen oder ein Bild von dir aufkleben.

Weil du mich magst, kann ich fliegen
Weil du mich magst, kann ich fliegen
Weil du mich magst, kann ich fliegen
Ohne Angst übers Haus.
Weil du mich magst, lach ich abends
Die Gespenster aus.
Ich kriege Herzklopfen,
Wenn du nach mir fragst,
Weil du mich magst.
Weil du mich magst, bin ich stärker
Als der Löwe im Zoo.
Weil du mich magst, bin ich mutig
Und ich freue mich so.
Ich kriege Herzklopfen,
Wenn du nach mir fragst,
Weil du mich magst.
Weil du mich magst, seh ich Sterne
In der dunkelsten Nacht.
Weil du mich magst, leb ich gerne,
Und ich geb auf mich Acht.
Ich kriege Herzklopfen,
Wenn du nach mir fragst,
Weil du mich magst.
Weil du mich magst, will ich singen:
Mal ganz leise, mal laut.
Weil du mich magst, bin ich glücklich, Habe Gänsehaut.
Ich kriege Herzklopfen,
Wenn du nach mir fragst,
Weil du mich magst.
Weil du mich magst, kann ich fliegen
Ohne Angst übers Haus.
Weil du mich magst, lach ich abends
Die Gespenster aus.
Ich kriege Herzklopfen, wenn du nach mir fragst, weil du mich magst.
Weil du mich magst, kann ich fliegen
Text von Jutta Richter

Hoffnung für alle Menschen: Jesus zeigt, wie Gott ist
Seiten 82 und 83 im Schulbuch | Kapitel 5
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Den Kern dieser Doppelseite bildet die Erzählung von „Jesus im Haus des Zöllners Zachäus“ im Lukasevangelium (Lk 19, 1–10). Die Erzählung ist im Bild von Štěpán Zavřel angedeutet. Zöllner galten zur Zeit Jesu – die Steuereintreiber für die römische Besatzungsmacht – als Kollaborateure und Sünder (kultisch unrein). Gläubige Juden vermieden jeden Kontakt mit ihnen. Die Römer verpachteten ihre Zollstationen an einheimische Zöllner. Diese versuchten, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Dies gelang durch willkürliche und betrügerische Handhabung der Tarife. Gerade bei einem solchen Zöllner kehrt Jesus ein. Er ruft ihn vom Baum herunter, um sein Gast zu sein. Damit werden von Jesus die öffentlichen Schranken durchbrochen und Zachäus wird gemeinschaftliche Zugehörigkeit ermöglicht. Jesus rechtfertigt dies mit seinem Auftrag: „Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ (V 10). So zeigt sich im Handeln Jesu die Suchbewegung Gottes: das Verlorene zu suchen und zu retten. Niemand soll vom Tisch Gottes ausgeschlossen bleiben, jeder und jede hat bei Gott einen guten Platz. Diese Zugehörigkeit kann, wie die Erzählung von Zachäus zeigt, Umkehr und völlige Veränderung des Lebens ermöglichen: „Heute ist auch diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.“ (V 9). Jesus eröffnet dem kleinen Mann eine neue Möglichkeit, wirklich groß zu sein. Zugehörigkeit ist für alle Menschen von zentraler Bedeutung und gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Auch Kinder sind von diesen Grunderfahrungen betroffen: Wo und wieweit fühle ich mich zugehörig? Wo werden ich oder andere ausgeschlossen? Die Sehnsucht nach Seindürfen und Angenommensein, die auch in der biblischen Erzählung von Zachäus anklingt, zeigt sich bei allen Menschen und besonders auch bei Kindern. Sie sind in ihrer Entwicklung noch mehr angewiesen auf Erfahrungen der Zuwendung, Liebe und des Angenommenseins.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben wie Jesus Zachäus begegnet. verstehen und deuten dass Jesus allen Menschen als Freund begegnet. … dass Gott für alle Menschen da ist. gestalten und handeln
… Bild zur Bibelerzählung.
…Jesuserzählung(en) nachspielen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
Jesus Umgang mit Außenseitern im Vergleich zu unserem. entscheiden und mit-tun
… wertschätzendes Verhalten von Jesus nachahmen.
3 | Lernanlässe
★ Dazugehören, Ausgeschlossen- und Angenommensein
★ Beachtung (nicht) erfahren: Außenseiter heute
★ Bibelgeschichten wiedererkennen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix fasst zunächst das besondere Anliegen Jesu zusammen und beschreibt danach hinführend die Person des Zöllners Zachäus.
Das Lied „Einfach nur so“ verweist auf das bedingungslose Angenommen- und Geliebtsein. Die frühe und sichere Bindung sind laut Psychoanalyse, aber auch nach den Erkenntnissen der Neurobiologie zentrale Voraussetzungen für die gesunde Entwicklung von Kindern und ihre spätere Resilienz in schwierigen Lebenssituationen. Die Bibel sieht diese Bindung gerade auch in den religiösen Zusprüchen und im Vertrauen auf die Liebe Gottes. Davon zeugt auch der Liedtext: „Einfach nur so bist du von Gott geliebt.“ Gott nimmt die Menschen an und liebt sie, so wie sie sind.
Das Bild „Zachäus im Baum“ von Štěpán Zavřel, hauptsächlich in roten und blauen Farbtönen gehalten, scheint zweiteilig aufgebaut: in ein oben und ein unten. Betrachter*innen schauen wie aus der Vogelperspektive von oben ins Bild hinein bzw. so, als ob man mit Zachäus auf gleicher Höhe wäre. Damit werden sie eingeladen, das Geschehen aus der Perspektive des Zachäus zu betrachten. Sichtbar wird eine große Menschengruppe fast in einem Halbkreis, die zu dem Mann am Baum hinauf schaut, und Zachäus mit ängstlichem Blick, der sich hinter den Blättern des Baumes zu verstecken scheint. Sein Blick geht mehr in die Ferne als zu die Menschen unter ihm, er wirkt irgendwie eigenartig abwesend. Die Gestalt in weiß, Jesus, scheint hinauf zu winken, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und den Blick des Zachäus auf sich zu ziehen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bibelgeschichte erzählen oder aus der Kinderbibel vorlesen Bild betrachten: Was ist auf dem Bild zu sehen? Wo befindet sich Jesus? Wo ist Zachäus? Was verraten die Blicke der Personen (Jesus, Zachäus, die anderen …)? Was könnte eine dieser Personen denken, sagen oder fragen?
Heftarbeit „Das Herz von Zachäus öffnet sich”: Die Schüler*innen erhalten ein oder zwei Herzen aus rotem Papier (siehen unten). Sie gestalten ein Bild zur Begebenheit (Zachäus im Baum, mit Jesus bei Tisch usw.) in welches sie das Herz integrieren.
Gemeinschaftsbild „Im großen Herz Gottes haben alle Platz”: Die Kinder gestalten Herzen, in die sie hineinschreiben, wer in ihrem Herz einen besonderen Platz hat. Die kleinen Herzen der Kinder werden dann in das große Herz Gottes (schon vorher vorbereitet) eingefügt oder ergeben gemeinsam ein großes Herz.
Erzählung von Jesus und Zachäus nachspielen bzw. als Standbild stellen: Bild 1: Jesus kommt, die Menschen sammeln sich um ihn, Zachäus kommt nicht durch. Bild 2: Zachäus auf dem Baum – Jesus spricht ihn an. Bild 3: Jesus und Zachäus bei Tisch; die Menschen drehen ihnen den Rücken zu und lehnen sie ab. Bild 4: Zachäus wendet sich an die Menschen und bittet um Vergebung.
6 | … und noch mehr Ideen
Zachäus in Gottes Boot der Liebe einfügen: Wenn passend zur Aussage Jesu „Kommt, lasst uns Menschen fischen“ (also in Gottes Boot holen) ein Boot Gottes gestaltet wurde, kann nun die Figur des Zachäus in dieses Boot Gottes integriert werden.
Nachspielen: Heilende Begegnungen mit Jesus: Den Schüler*innen werden verschiedene Rollen aus den Erzählungen zugeteilt. Entweder sie spielen die Begegnungen mit Jesus einfach nach oder sie spielen während des Lesens der Texte mit, wobei auch die Texte, die die Figuren sprechen, von den Schüler*innen in dieser Rolle nachgespielt oder -gesprochen werden können.
Spielen „Gastmahl bei Zachäus“: Um das Gastmahl bei Zachäus zu spielen, wird ein Tisch mit ein paar Stühlen rund herum in die Mitte gestellt. Schüler*innen die Zachäus verkörpern, richten schnell alles schön her, als Jesus zu Gast kommt, dann setzen sich die beiden. Dabei begleitet sie die Frage, was Jesus und Zachäus miteinander gesprochen haben könnten.
Spielen „Gastmahl“: Mehrere Tische werden zusammengeschoben, ein Tischtuch wird aufgelegt, evtl. werden eine oder mehrere Kerzen

hingestellt, ggf. könnte es auch etwas zu essen geben. Jetzt sollen die Schüler*innen sich nach und nach vorstellen: Wen verkörpern sie? Was möchten sie Jesus bzw. anderen Gästen sagen? Die folgenden Sätze stellen Beispiele dar: „Ich bin Zachäus, mich mag keiner… Ich bin ein Kranker, niemand will in meiner Nähe sein … (auch heutige „Arme” einbringen) Du aber, Jesus …“.
7 | Kinderbücher
Deutsche Bibelgesellschaft. (2019). Die Bibel. Einsteigerbibel. SCM.
Willmore, A. (2023). Das Reichhörnchen.Dragonfly.
8 | Lieder
Mit einem Freund/einer Freundin an der Seite LB Religion Nr. 66
Zachäus LB Religion Nr. 166
9 | Schnappschüsse

Das Herz von Zachäus öffnet sich als Jesus zu ihm kommt Das Herz von Zachäus öffnet sich, als Jesus zu ihm kommt.
Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 84 und 85 im Schulbuch | Kapitel 5
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich im Religionsunterricht beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anlangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …), sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 86 im Schulbuch | Kapitel 5
Die Schlussseite ist eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Ein Lied zum Mitmachen und Mitzeigen steht als spirituelles Angebot im Mittelpunkt. So kann über das ganze Schulbuch ein kindgemäßer Schatz an Gebeten, Liedern oder Geschichten bzw. Sätzen zum Nachdenken aufgebaut werden.
Diesmal wird das Lied „I love Jesus” angeboten, das uns wieder auf Glaube und Liebe als Herzensangelegenheit verweist und damit auf unser innerstes Zentrum.
Der Bibeltext Lk 4,40 ist ein sogenanntes Summarium, eine Zusammenfassung des Heilshandelns Jesu am anbrechenden Abend, im Licht der untergehenden Sonne, der den See Gennesaret wie vom göttlichen Licht golden erscheinen lässt. Es wird durch Jesus eine Hoffnung geweckt, die alle erfasst und ergreift, sodass sie alle ihre Kranken bringen, und Jesus beugt sich zu ihnen hinunter und legt ihnen die Hände auf. In dieser Handlung wird das liebevolle Wirken Gottes sichtbar: ein Gott, der sich hinunterbeugt zur leidenden und geschundenen Menschheit und sie erlöst und befreit.
Literatur zum 5. Kapitel
Biser, E. (1997). Einweisung ins Christentum. Düsseldorf: Patmos Verlag.
Biser, E. (2000). Die Entdeckung des Christentums. Der alte Glaube und das neue Jahrtausend. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
Bowlby, J. (2018). Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. (4. Aufl.) München: Ernst Reinhardt Verlag.
Buber, M. (1973). Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider.
Frankl, V.E. (1997). Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Frankfurt a. M.: Fischer Verlag.
Papst Franziskus (2013). Evangelii gaudium – Freude am Evangelium. Apostolisches Lehrschreiben.
Weinrich, H. (1973). Narrative Theologie. In Concilium 9, 329ff. Einsiedeln: Benziger Verlag; Mainz: Mattias Grünewald Verlag.
KAPITEL 6: Voll Vertrauen leben und wachsen.
TAUFE – NEUES LEBEN FEIERN
Seiten 87 – 106 im Schulbuch
Impuls
Es ist gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer Fülle bereit liegt, aber verhängt in derTiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigenWort, beim richtigen Namen, dann kommt sie.
Aus: Franz Kafka,Tagebücher, Kapitel 13, 18.10.1921
Allgemeine Hinführung
Dieses Kapitel des Buches wird um Ostern und die Passion und Auferstehung Jesu angesiedelt und steht ganz im Zeichen des Frühlings, des Wachsens und Werdens, des lebendigen Aufbrechens und Aufblühens in der Natur. Zugleich aber kann dieses Wachsen und Werden auch Sinnbild für das Leben an sich sein: nicht die Kälte der Beziehungslosigkeit, der Einsamkeit oder Gewalt, nicht der Tod haben das letzte Wort und sind Ziel menschlichen Lebens, sondern Leben, Aufbruch, Neubeginn, denn Gott ist im christlichen Verständnis ein Gott des Lebens und der Freude; Erlösung und Befreiung ist somit die Grundmelodie christlichen Lebensverständnisses. Diese Grundmelodie muss auch durch die ganze Passions- und Ostererzählung durchklingen. Diese Tiefendimension will die Titelseite des Kapitels zum Ausdruck bringen: Freude am Leben über das Dunkel hinaus, Freude am Glauben. All das Hintergründige darf im Vordergründigen des Frühlings und des österlichen Aufblühens gesehen, wahrgenommen und dankbar so gedeutet werden – auch als Ruf Gottes hinein ins Leben. Das Kapitel lädt ein, zu fragen und zu hinterfragen, wovon wir Menschen letztlich leben, was im Letzten auch vertrauensvoll als Ursprung und Quelle des Lebens gesehen werden kann und dankbar angenommen werden darf, aber auch als Fragen nach den dunklen Seiten des Lebens, die an der Passion Jesu sichtbar werden. Aber: es ist ein Hineintauchen mit Christus in den Tod und ein Auferstehen mit ihm, so der Apostel Paulus. In der Taufe wird diese lebendige Lebensquelle Gottes angerufen und gefeiert; lebendiges Wasser ergießt sich über den Täufling: Wasser, das leben lässt. Ursprünglich war der Taufritus ein Untertauchen mit dem Kopf und Wiederauftauchen, Erinnerung an den Tod und die Auferstehung von Jesus: wir werden mit Christus leben als neue Menschen, als neue Schöpfung, dem Tod entrissen, wie es Paulus nennt. Lebendige Quelle und Mitte bildet demnach Christus, der die Menschen zusammenruft und miteinander verbindet als Kirche aus lebendigen Steinen, die heute tun, was er getan hat. Ein großer Anspruch, eine große Herausforderung, aber
auch ein großes Zutrauen von Gott her, dass Menschen fähig sind, das Gute zu tun, als „Auferstehungsmenschen“ zu leben und sei es noch so bruchstückhaft. Und die Kinder mit ihrem Leben, ihren Hoffnungen, Freuden, Sorgen und Ängsten? Das religionspädagogisch Entscheidende und die große Herausforderung bleiben wohl immer, wie es gelingt, Verbindungen und Brücken zum Leben der Kinder herzustellen, um sie dabei zu unterstützen, für ihr Leben Wahrnehmungs-, Verstehens- und Deutehilfen zu finden als Orientierung und Lebensermutigung. Vielleicht können sie so im Blick auf das Hintergründige erahnen, dass ihr Leben, dass sie als Person ganz und gar erwünscht und geliebt, aber auch bergend aufgehoben sind in jener Quelle und Kraft, die wir mit dem Wort Gott bezeichnen und die in Jesus konkrete Menschengestalt angenommen hat. So kann – wie vieles in diesem Buch – dieses Kapitel als Wahrnehmungsschulung und Gesprächsanlass zur Tiefensicht des Lebens dienen, die es ermöglicht zu verstehen, was es bedeutet „Es muss im Leben mehr als alles geben“. Es geht dabei um eine Elementarisierung im umfassenden Sinn, die zunehmend mehr an Bedeutung gewinnt in einer zum großen Teil säkular geprägten Gesellschaft, in der Kindern nicht selbstverständlich ein Weg in die Tiefenschichten des Lebens eröffnet wird. Mit Friedrich Schweitzer bezeichnet Elementarisierung „ein religionsdidaktischesModellfürdieVorbereitungundGestaltungvon (Religions-)Unterricht,daseineKonzentrationaufelementare–also von den Inhalten ebenso wie von den Kindern und Jugendlichen her grundlegend bedeutsame und für sie zugängliche – Lernvollzüge unterstützen soll.“ (Schweitzer, 2012, S. 234). Zu Kommunikation und Gespräch über diese elementaren Fragen und Lernmöglichkeiten wollen diese Buchseiten anregen und einladen.
Im Lehrplan wird die Thematik von Passion und Ostern in der zweiten und dritten Schulstufe vorgeschrieben, die Praxis möglicher Lernanlässe zeigt aber, dass wir auch schon in der ersten Schulstufe beginnend bei Kreuzesdarstellungen, Osterbräuchen etc. im Religionsunterricht Jahr für Jahr nicht umhinkommen, uns damit elementarisierend auseinanderzusetzen bzw. ein Gesprächsforum für die Kinder zu bieten. Im Sinne des Kompetenzaufbaus werden diese Themen in den nachfolgenden Schulstufen vertieft. Zudem bilden Tod und Auferstehung Jesu die theologische Basis für die Taufe und sind deshalb gut in diesem Kapitel angesiedelt.
Lehrplanbezüge des 6. Kapitels
Kompetenzbereich | B4b Gelehrte und gelebte Bezugsreligion Leitkompetenz | Kirchliche Grundvollzüge kennen und religiös-spirituelle Ausdrucksformen gestalten können. Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen kennen die Symbole und Zeichenhandlungen der Taufe und können das Fest beschreiben. Unterrichtshinweise | Sakrament: Taufe; Jesusnachfolge. Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können wichtige Elemente der Taufe benennen.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte
Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
Jesus der Christus: Das Christentum orientiert sich am Reden und Handeln Jesu, das die vergebende und heilende Zuwendung Gottes zu den Menschen zeigt. In seiner den Tod überwindenden Auferstehung kann in der Brüchigkeit des Lebens Versöhnung und Erlösung erfahrbar werden.
Gottesliebe und Menschenliebe: Das jüdisch-christliche Gottes- und Menschenbild steht für eine lebensbejahende Grundhaltung zu sich selbst, den Mitmenschen und der Welt. Das Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander ist getragen von der bedingungslosen Liebe Gottes. Unabhängig von Fähigkeiten und erbrachten Leistungen ist der Mensch in seiner Würde unantastbar.
Titelseite: Voll Vertrauen leben und wachsen.
Taufe – Neues Leben feiern
Seite 87 im Schulbuch | Kapitel 6
Das Titelbild zeigt das Glasfenster in der Taufkapelle der Pfarrkirche in Bärnbach (Steiermark) und wurde vom österreichischen Künstler
Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) entworfen, der die ganze Kirche künstlerisch umgestaltet hat (1988). Das Glasfenster wurde für die Taufkapelle der Kirche gestaltet und erstrahlt im Sonnenlicht über dem Taufbrunnen in der Form eines Kreises, der bei genauerer Betrachtung einen Weg in Form einer Spirale darzustellen scheint, der auf die Mitte, symbolisiert in einem Kreuz, zuläuft oder umgekehrt von der Mitte weg sich nach außen zieht. In einem zweiten Blick wird deutlich, dass es sich eigentlich um zwei spiralförmige Wege handelt: einer in Rot gehalten und einer in Blau, der aber durchbrochen ist von einem Feld in Grün- und Brauntönen, das dann wieder in Blautönen mündet. Das Blau mag an das Wasser erinnern, aus dem alles Leben kommt, das Rot an das Feuer und Licht, aber auch an das Blut und das Lebendige … Grün und Braun erinnern wohl an Erde, Wachsen und Werden, Blühen und Gedeihen. Durch das Kreuz in der Mitte wird das Fenster christlich von der Taufe her gedeutet: „Wiedergeboren aus Wasser und Geist“, wie es im Johannesevangelium heißt, um neu zu leben auf Christus hin und von ihm heraus in die Welt hinein. Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Spirale legen: In einem Sesselkreis erhalten alle Schüler*innen mehrere Glassteine. In der Mitte wird z. B. mit einem Tuch oder ausgedruckt die Spiralform aufgelegt. Nun können die Schüler*innen nach und nach ihre Steine zum Bild legen. Es entsteht ein einzigartiges Gebilde, das an das auf der Titelseite abgebildete Kirchenfenster in Bärnbach erinnert. Das entstehende Bild mag auch an das Gedicht von Rilke erinnern: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen.

Foto: Kerstin s eneca Jensen
Lebenskraft: Liebe
Seiten 88 und 89 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Zunächst geht es in diesem Kapitel, wie immer bei der ersten Doppelseite, um das Wahrnehmen, Beschreiben und Erzählen, was die Kinder mit der „Lebenskraft Liebe” verbinden, von der die Bilder und Texte erzählen. Dadurch werden sie für das Thema und die Inhalte sensibilisiert. Diese Schulung der Wahrnehmung gewinnt in den zum Teil medial überfluteten Kinderwelten heutiger Tage besondere Bedeutung und lenkt den Blick auf die mögliche Tiefendimensionen des Lebens, die aber zunächst die Kunst der Wahrnehmung im Alltäglichen voraussetzt.
Nachdem Ostern – Tod und Auferstehung – das Zentrale des christlichen Glaubens und der christlichen Botschaft sind und jede*r Christ*in durch die Taufe in dieses Geschehen mit hineingenommen wird, zeigt sich gerade in diesem Geschehen und dem Weg Jesu das Besondere der Liebe und Hingabe, die das letzte Wort hat, nicht Gewalt und Tod. Dadurch geschieht Erlösung, denn Gott ist die Liebe (1 Joh). Das muss das tragende Grundmotiv und die Grundmelodie zu diesem Buchkapitel sein. So ist der didaktisch logische Ansatz, um dies anfanghaft zu begreifen, bei den Erfahrungen von Liebe im Leben der Kinder und in deren Umgebung, die eben jede*r braucht, um Mensch werden zu können, von Anfang des Lebens an. „Erlösung will erfahrbar sein” (Höfer 2002) kann als wesentlicher Grundsatz zum Verständnis von Ostern, aber auch der Taufe gelten. Damit geht es immer auch um diesen Erfahrungsansatz unserer Welt und besonders in der Welt der Kinder.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Zeichen der Liebe in der Lebenswelt. verstehen und deuten
… Liebe als notwendige Kraft in unserem Leben. gestalten und handeln
… Liebeszeichen gestalten und ggf. verschenken. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Zeichen von Liebe in Zeiten der Not.
… wie wirkungsvoll Liebe ist. entscheiden und mit-tun
… Zeichen der Liebe setzen.
3 | Lernanlässe
★ Liebe (mit Höhen und Tiefen) erleben
★ Menschen im Umfeld, die (nicht) geliebt werden
★ Liebe in der Familie, zu Freund*innen, Mitmenschen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Fotocollage bietet verschiedene Bilder, die unterschiedliche
Aspekte von der Lebenskraft Liebe aufzeigen. Sie verstehen sich als Beispiele und Impulse zum Nachdenken über Liebe im Lebenskontext der Kinder. Das Foto „Menschen mit Kindern“ erzählt von der Liebe in der Familie. Sie äußert sich in den Alltäglichkeiten: Vertrauen, Geborgenheit, Spaß … und das gemeinsame Entdecken des Lebens. Das Foto „Herz an der Autoscheibe“, dahinter ein lächelndes Gesicht – vielleicht ein Gruß zum Abschied, nachdem das Kind vom Auto ausgestiegen zum Schuleingang geht, vielleicht … Kinder können assoziieren und ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken dazu äußern. Das Foto „Spaziergang mit Unterstützung“ erzählt von der helfenden und unterstützenden Kraft der Liebe. Eine Frau, vielleicht eine Pflegerin, vielleicht die Tochter … stützt einen alten Mann, trägt die Einkaufstasche, unterhält sich mit ihm. Das Bild lädt ein, sich zu fragen, worüber sie sich unterhalten und was die Personen denken könnten, wie sie sich fühlen. Das Foto „Mutter mit Kind“ macht auf den tröstenden Aspekt der Liebe aufmerksam. Eine Frau hat ein Kind am Schoß und hält es liebevoll. Das Kind darf sich ausruhen, es kann sich sicher und geborgen fühlen. Ist das Kind krank, ist es traurig, ist es müde …? Liebe ist auch dann da, wenn es im Leben schwierig wird. Liebe hält, tröstet und lässt nicht allein. Das Foto „Trauriges Kind am Schulhof“ zeigt ein Mädchen im Vordergrund, das allein und mit traurigem Gesichtsausdruck an einer Mauer lehnt. Im Hintergrund stehen mehrere Kinder zusammen und unterhalten sich. Niemand scheint das einsame Kind zu bemerken. Was ist vorgefallen? Was würde das Kind brauchen und sich wünschen? Wie könnte die Lebenskraft Liebe sich hier auswirken? Das Foto der zwei Hände, die sich halten, kann viele Assoziationen hervorrufen. Liebe, verliebt sein, Händchen halten, gemeinsam durch dick und dünn gehen,… was sagen die Hände bzw. die Menschen wohl zueinander, was hoffen und wünschen sie, worauf vertrauen sie?
Die Schatzkästchen ermöglichen den Kindern, verschiedene Aspekte der Lebenskraft Liebe zu bedenken. Dabei werden unterschiedliche Zugänge angeboten: Sich an liebe Menschen aus dem eigenen Lebensumfeld zu erinnern kann zur Ressource werden, sich an die Liebe von Jesus zu erinnern und an Beispielen festzumachen, kann das Vertrauen stärken, dass seine Liebe auch heute ganz persönlich da ist. Sich an Zeichen der Liebe zu erinnern bzw. Zeichen selbst zu gestalten fördert die Symbolkompetenz und damit die religiöse Sprachkompetenz. Und schließlich öffnet der Hinweis, Liebe zu entdecken in Zeiten der Not, auch den Blick für die helfende, caritative Liebe, die sich im kleinen, aber auch im großen sozialen Bereich ereignet.
Der Nachdenkspruch „Eine Blume braucht …“ ist eine Anregung zum Philosophieren mit den Kindern. Gemeinsam kann über die Bedeutung diese Vergleichs nachgedacht werden und Fragen wie u. a. die folgenden werden gestellt: Was geschieht, wenn ein Mensch keine Liebe bekommt? Kann man ohne Liebe leben? Was bewirkt die Sonne bei der Blume, was bewirkt die Liebe bei den Menschen?
Der QR-Code führt zu einer Erzählung über Verbundenheit und Liebe.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bilder besprechen: Beim Besprechen der Bilder können die folgenden Fragen hilfreich sein: Wie und wodurch wird die Lebenskraft Liebe auf den Bildern oder in unserem Leben sichtbar? Was könnten die Geschichten zu den Bildern sein?
Bilder mitbringen, malen: Die Schüler*innen bringen selbst Fotos von ihnen, mit ihren Familienmitgliedern, Freunden, Haustieren usw.
mit oder malen welche. Diese können aufgelegt oder auf der Wand als Collage aufgehängt werden. Die Kinder können Geschichten zu den Bildern und über die darauf erkennbaren Menschen (und Tiere) erzählen.
Nachdenken und Philosophieren: Darüber nachdenken, inwiefern Liebe eine Lebenskraft ist und philosophieren, ob man auch ohne Liebe leben kann bzw. welche, von wem und wieviel Liebe Menschen brauchen. Hierzu lädt vor allem der vergleichende Spruch „Eine Blume braucht …“ ein.
Bilderbuch „Eine Dose Kussbonbons“ vorlesen oder anhören und dazu basteln: Impulsfragen zur Besprechung der Erzählng wären z. B. Was hat Zeo Angst gemacht? Was hat Zeo von seinen Eltern bekommen und mit auf die Reise genommen? Was haben die Kussbonbons bewirkt? Anschließend Kussbonbons basteln und verschenken. Man braucht kleine Zettelchen und ein paar Lippenstifte. Die Schüler*innen dürfen sich Lippenstift auftragen und mit dem Mund auf ein kleines Stück Papier einen Kussmund drücken. Die Kussbonbons können ausgeschnitten, verziert und verschenkt werden oder in der Klasse in einem Gefäß aufbewahrt und bei Bedarf benutzt werden (z. B. wenn ein Kind traurig ist …).
6 | … und noch mehr Ideen
Heftarbeit „Liebe Menschen in meinem Herzen“: Die Schüler*innen schreiben die Namen der Menschen, die ihnen besonders wichtig sind, in ein ausgeschnittenes oder vorgezeichnetes Herz und kleben
dieses in ihr Heft. Die Personen können auch gemalt oder es können Fotos von ihnen eingeklebt werden.
Symbole der Liebe finden: Mündlich oder malerisch sammeln, welche Symbole der Liebe es gibt. Die Schüler*innen können diese Symbole aufzeichnen, woraus eine Collage oder Heftarbeit entstehen kann.
Symbole der Liebe gestalten & verschenken: Die Schüler*innen können selbst kreativ werden und anhand von verschiedenen Materialien Symbole der Liebe (z. B. Herzen, Freundschaftsbänder etc.) gestalten und diese anschließend verschenken.
7 | Kinderbücher
Beck, A., Czwienczek, K., Franke, C., Henning, S. & Knauer, R. (2007). Zeichen der Liebe. Das Kinderbuch. St. Benno. Bohlmann, S. (2023). Die Liebe wohnt auf Wolke 7. Loewe. Weisbrod, L. (2022). Weißt du, wo die Liebe wohnt? dtv.
Zylla, A. (2023). So hört sich Liebe an. Edel Kids Books.
8 | Lieder
Gottes Liebe ist so wunderbar LB Religion Nr. 17
Nur die Liebe bleibt T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse

Jesus geht mutig den Weg der Liebe
Seiten 90 und 91 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite geht von der Frage aus, wie die Menschen in ihrer Zeit Jesus erlebt haben. Nach den Berichten der Evangelien haben sie erfahren, dass Jesus alle Menschen bedingungslos angenommen hat. Diese Nähe hat das Leben der Menschen, wie am Beispiel des Zachäus ersichtlich, verändert und ihnen neue Chancen und Möglichkeiten des Lebens eröffnet. Allerdings hat dieser besondere inklusive Umgang Jesu bei bestimmten Gruppen auch schärfste Kritik und Widerstand ausgelöst. Dass Jesus sich auch Menschen zugewandt hat, die wegen ihres Lebenswandels als Sünder aus der Gesellschaft und dem religiösen Leben ausgeschlossen waren, war schlichtweg eine Gotteslästerung. So heißt es im Lukasevangelium: „Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: ,Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen.‘(Lk 15,1–2). Manches mag ein wenig anachronistisch erscheinen und doch funktionieren diese Mechanismen tatsächlich – wie z. B. der Sündenbockmechanismus –nach wie vor auch heute noch gleich: anders sein genügt manchmal. Es wird mit den Kindern die Frage und das Gespräch wichtig sein, wo und wie denn diese Mechanismen heute sind, wo und warum Menschen heute ausgeschlossen, an den Rand gedrängt, verfolgt etc. werden. Es wird in der Auseinandersetzung mit Jesus auch nochmals deutlich, welch revolutionäre und provokative Kraft die Liebe ist, obwohl sie letztlich ohnmächtig gegenüber Macht und Gewalt scheint. Jesus begründet sein Verhalten mit dem Handeln Gottes. Das wird in den Gleichnissen vom Verlorenen (verlorenes Schaf, verlorene Drachme, verlorener Sohn) sichtbar, die Jesus erzählt, und das göttliche Handeln mit dem Bild vom guten Hirten, der suchenden Frau und dem barmherzigen Vater beschreibt. Dies kann jedoch die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht überzeugen. Dieser Konflikt, wie man Gott verstehen und nach seinen Geboten handeln muss, führt schließlich dazu, dass Jesus angeklagt und zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Jesus geht konsequent den Weg der Liebe und riskiert dabei sein Leben, riskiert den Tod, weil eben die Liebe nicht anders kann.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Bild vom Einzug Jesu in Jerusalem. verstehen und deuten
… dass die Botschaft und das Handeln Jesu für viele Menschen hoffnungsvoll sind, für manche aber ein Ärgernis. gestalten und handeln
… Bild zum Einzug in Jerusalem machen. …Einzug in Jerusalem nachspielen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Jesus, von vielen geliebt, von manchen nicht verstanden.
entscheiden und mit-tun
…Palmbuschen binden.
…Palmweihfeier oder -prozession mitfeiern.
3 | Lernanlässe
★ Palmsonntag und Osterferien
★ Worum geht es zu Ostern?
★ Was bedeuten die Osterbräuche (Palmbuschen)?
★ Warum wird Jesus (trotz seiner Liebe) gekreuzigt?
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text „Bei Jesus haben alle …“ von Hans Neuhold versucht das Geschehen um Jesus interpretierend zusammenzufassen und Gründe für sein kommendes Leiden und Sterben anzuführen, die in seinem besonderen Handeln an den Ausgestoßenen zu finden sind: Wer sich mit denen draußen an den Tisch setzt, setzt sich selbst aus und wird zum Ausgestoßenen. Doch wie der Weg Jesu auch hoffnungsvoll zeigt: Gott lässt Jesus nicht im Stich.
Der Text des Raben Felix spricht einerseits die emotionale Seite an, die Trauer, den Schmerz ob des Leidens Jesu, und lädt die Kinder zur Identifikation ein, andererseits verweist er dankbar auf das Handeln Gottes.
Das Bild „Jesus zieht in Jerusalem ein“ von Štěpán Zavřel zeigt den Einzug Jesu in Jerusalem. Wir sehen die Stadt mit ihren vielfältigen Türmen. Auf zwei Ebenen sind Menschen zu sehen, alle mit nach oben gestreckten Händen. Sie halten grüne Palmzweige in der Hand und winken Jesus zu. Jesus reitet auf einem Esel. Er hat die rechte Hand segnend erhoben. Die Komposition des Bildes zeigt Jesus auf einem Brückenbogen zwischen zwei Mauern. Hinter ihm eröffnet sich die Weite der Landschaft und des Himmels. Sie strahlt im gelben Licht, das von der Sonne am oberen Bildrand ausgeht. Dadurch wird das Ereignis des Einzugs in besonderer Weise gedeutet: Das Kommen Jesu eröffnet einen Weg der Hoffnung und bringt Licht. Der Liedruf „Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden“ nimmt ein Motiv aus dem Psalm 29,10–1 auf. Es wird hier in der Gotteslobversion (Nr. 263) von Josef Seuffert angeboten. Es bindet die Adventzeit und die Osterzeit zusammen. Jesus, der im Advent als Friedensbringer erwartet wird, reitet am Palmsonntag als Friedenskönig in Jerusalem ein.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bibelgeschichte erzählen oder vorlesen: Die Begebenheit erzählen oder vorlesen. Dabei können auch Bilder (z. B. des Kamishibai Erzähltheaters) gezeigt werden. Anschließend wird die Bibelstelle besprochen und von Schüler*innen nacherzählt. Fragen wie z. B. Warum reitet Jesus auf einem Esel (und nicht auf einem Pferd)? Aus welchem Grund legen die Menschen ihre Kleider auf den Boden? rücken wesentliche Inhalte in den Vordergrund.
Bildbetrachtung: Welche Farben sieht man auf dem Bild? Welche Farben sind eher oben, welche eher unten? Welche vorne, welche hinten? Wer ist auf dem Bild erkennbar? Wo ist Jesus im Bild? usw. Liedruf singen: Beim Singen des Liedrufs können die Schüler*innen z. B. in einem Spalier aufgestellt stehen und mit grünen Tüchern die Palmzweige simulieren und diese an bestimmten Stellen bewegen oder mit diesen winken.
6
|
… und noch mehr Ideen
Heftarbeit „Einzug in Jerusalem“: Die Schüler*innen erhalten zwei Papierstreifen in verschiedenen Grüntönen und ein Bild von Jesus, der auf einem Esel reitet. Zur Verfügung steht ihnen außerdem buntes Papier. Aus den beiden grünen Papierstreifen schneiden sie Palmzweige aus, aus dem bunten Papier wird der Teppich gelegt. Jesus reitet mit dem Esel durch. Zu den Palmzweigen werden Personen (u. a. ich, die eigene Familie …), die diese halten, gezeichnet.
Bodenbild gestalten: Den Einzug von Jesus in Jerusalem mit Materialien wie z. B. Tücher, Holzfiguren, Palmzweigen etc. als Bodenbild auflegen und nachspielen.
Gestalten „Jesus auf dem Esel”: Jesus auf dem Esel aus Papier und zwei Wäscheklammern basteln. Dazu die Vorlage (siehe unten) ausmalen, ausschneiden und in der Mitte falten (so ist Jesus von beiden Seiten zu sehen). Anschließend zwei Wäscheklammern aus Holz mit grauer Acrylfarbe bemalen und nach dem Trocknen als Beine an den Esel zwicken. Optional kann man dem Esel einen Schweif aus Wolle ankleben oder einen dazuzeichnen.
Palmbuschen binden und in der Schule segnen: In die Vorbereitung und Feier können auch Eltern oder Großeltern einbezogen werden. Man kann sie zum Palmbuschenbinden und zu einer Segensfeier in die Schule einladen.
Passionsspiel einüben: Für den Palmsonntag kann ein Passionsspiel eingeübt werden.
7 | Kinderbücher
Frisch, H. J. (2004). Der Chamäleonvogel. Eine Ostergeschichte für Kinder und ihre Eltern. Gütersloher Verlagshaus.
Langenbacher, A. (2019). Die Ostergeschichte. Pattloch Geschenkbuch.
Oberthür, R., Seelig, R. (2022). Die Ostererzählung. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco.
8 | Lieder
Jesus zieht in Jerusalem ein LB Religion Nr. 107
Hosanna LB Religon Nr. 207
9 | Schnappschüsse



Jesus zieht in Jerusalem ein Jesus zieht in Jerusalem ein


Jesus zieht in Jerusalem ein

Die Liebe ist stärker als der Tod
Seiten 92 und 93 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite lädt die Schüler*innen ein, sich auf die Leidensund Todesgeschichte Jesu einzulassen und seinen Weg gedanklich hin zur Auferstehung mitzugehen. Durch die Bilder und Erzählung, aber auch durch das Aneignen und Sich-Ausdrücken, durch die eigene kreative Tätigkeit kann dieses so schwierige und zugleich zentrale Thema unseres Glaubens zugänglich und von innen her verstehbar werden, was es heißen kann: „Ich darf vertrauen, Gott lässt mich nicht hängen, wenn ich in Not und Verzweiflung bin. Alles wird letztlich gut, weil Gott gut ist.” Das Kirchenjahr mit seinen Festen kann als ein Strukturprinzip des Religionsunterrichts innerhalb des Schuljahres gelten und wird vielfach auch so durchgeführt, deshalb bieten wir in den Büchern in jedem Jahr einen jeweils anderen und erweiternden Akzent der großen Feste des Kirchenjahres an: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Auch wenn man das Prinzip der Lernanlässe ernst nimmt, wird man davon ausgehen können und müssen, dass die Kinder den österlichen Themen und dem Osterfest in irgendeiner (meist säkularen) Form begegnen, die einen wichtigen Gesprächsanlass bieten können. Im Buch der ersten Klasse wird die Leidensgeschichte, begleitet von einem Foto vom Ölberg in Jerusalem als Bildgeschichte – wie auch beim Weihnachtsgeschehen – mit Bilder des tschechischen Künstlers und Kinderbuchillustrators Štěpán Zavřel angeboten, die zum Schauen und Erzählen, wie eben bei einem Kinderbuch einladen, dazu wird der Text kurz gefasst.
Biblisch kommt neben der Erzählung ein Zitat aus der Ölbergszene des Evangeliums nach Markus zum Tragen, wo Jesus mit seiner Todesangst kämpft und sich Hilfe suchend an seinen Vater wendet und erhört wird. Vom Markusevangelium sagen Bibelwissenschaftler, es ist eine Passionserzählung mit einer langen Einleitung. Diese beschreibt das Handeln Jesu und macht sichtbar, dass Jesus sich im Namen Gottes den Menschen zuwendet und sie gesund macht. Das Vorzeichen seines ganzen Handelns ist die Liebe zu den Menschen. Die Einleitung macht aber auch verständlich, dass Jesus durch dieses Handeln auch mit der religiösen Oberschicht in Konflikt kam. Das führte schließlich zu seiner Verurteilung und zu seinem Tod. In der Begegnung mit der Leidensgeschichte sollen die Schüler*innen erfahren, dass Jesu Leben eine Geschichte der Liebe ist. Auch wenn sie durch den Tod führt, so wird in ihr auch sichtbar, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Bilder zur Passionserzählung. verstehen und deuten
… Angst Jesu trotz Vertrauen auf Gott und seinem Mut. gestalten und handeln
… Kreuze mit Hoffnungselementen als Lebenszeichen.
(be-)sprechen und (be-)urteilen …warum Jesus nicht aufgibt, sondern dem Weg der Liebe trotz Angst und dem Leiden am Kreuz treu bleibt. entscheiden und mit-tun …an einem Kinderkreuzweg (Schule, Pfarre) teilnehmen.
3 | Lernanlässe
★ Kreuze und Kreuzwege
★ Ostern in Geschäften, geschmückten Häusern …
★ Bilder und Bilderbücher über Ostern
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Bild „Ölbäume im Garten Getsemani“ erinnert an die Erzählung der Evangelisten, die davon sprechen, dass Jesus mit seinen Begleiter*innen nach dem letzten Abendmahl zum Ölberg hinauf gegangen ist. „Getsemane” bedeutet „Ölpresse” oder „Tal des Öls”. An diesem Ort wird in der biblischen Erzählung die schreckliche Todesangst Jesu und seine Festnahme beschrieben. Hier wird die ganze Menschlichkeit Jesu sichtbar. Er hat große Angst, Todesangst und fleht Gott aus tiefstem Herzen an. Er möchte nicht allein sein in dieser Situaton und wünscht sich die Nähe und das Gebet seiner Freunde. Er ist kein Übermensch, sondern zutiefst menschlich. Er vetraut, dass Gott ihn in seiner Angst hört. Von seinen Freunden wird er missverstanden und alleingelassen. Erst nachdem Jesus seine Todesangst durchlitten hat, kann er kraftvoll und vertrauensvoll den Weg des Leidens und Sterbens gehen.
Das Bild „Umarmung“ zeigt ein Kind, dass sich an eine Person schmiegt. Im Gesicht des Kindes ist Angst, Sorge, vielleicht Trauer … erkennbar. Es klammert sich an, es braucht Nähe, Schutz, Geborgenheit. Jedes Kind der Welt sollte jemanden haben, der es in Angst und Sorgen auf den Arm nimmt, trägt, tröstet, beschützt, und der*die zuhört. Im Bibeltext „Meine Seele ist…“ Mk 14,34 klagt Jesus und beschreibt, wie er sich innerlich fühlt. Das erinnert an Worte aus den Psalmen (Ps 42,6a oder Ps 42,12a oder Ps 43,5a). Er wendet sich an seine engsten Freunde und bittet sie, dass sie ihn in dieser Situation nicht alleinlassen, sondern mit ihm wachen. Er scheut sich nicht, seinen engsten Vertrauten zu beschreiben, wie es in ihm aussieht, scheut sich nicht, Gefühle zu zeigen. Er spielt nicht den starken Übermenschen, sondern steht zu seiner Angst und seiner Traurigkeit. Und Jesus scheut sich auch nicht, seine Freunde zu bitten, dass sie ihn nicht alleinlassen und mit ihm wach bleiben. Jesus wird hier ganz als Mensch sichtbar, der die Not, die Angst und Traurigkeit durchlebt hat und der deshalb auch unsere Not zutiefst kennt und mitfühlen kann.
Mit dem Bild des abgeblühten Löwenzahns ist auf das Kinderbuch „Das verspreche ich dir” verwiesen, dieses kann begleitend zur Ostergeschichte vorgelesen werden. Es behandelt das Thema des Vertrauens, denn wenn das Leben eines Löwenzahns scheinbar endet, werden zahlreiche Samen in die Welt gesät, die zu einem Wachsen vieler weiterer Blumen führen. Ähnlich wie beim Tod Jesu ist der Tod eben nicht das Ende. Als Symbol für die Auferstehung findet sich dann der aufgeblühte Löwenzahn.
Ähnlich wie zur Weihnachtserzählung wird im Schulbuch eine Bildgeschichte zur Ostererzählung mit Bildern von Štěpán Zavřel angeboten.
Bild 1 „Das letzte Abendmahl“: Jesus sitzt mit zwölf Männern in orientalischer Kleidung um einen Tisch. Hinter ihm sind drei Fenster, die eine abendliche Stimmung erkennen lassen. Vor ihm ein Tisch mit Brot, einigen gefüllten Schüsseln, einem Krug und Bechern. Die Menschen auf dem Bild unterhalten sich, man hat den Eindruck, einige diskutieren, einige sind still und wirken nachdenklich. Jesus hält eine Hand segnend über das Mahl und die Menschen.
Bild 2 „Verhaftung Jesu“: Man sieht im Vordergrund Jesus in einem langen weißen Gewand und Sandalen an den Füßen. Zwei in römische Uniformen gekleidete Soldaten halten ihn links und rechts fest. Dahinter stehen noch zwei Soldaten mit Speeren in den Händen. Zwei Soldaten schauen zu Jesus hin, die anderen schauen geradeaus. Sie stehen auf einem Keramikboden, hinter ihnen sind Mauern zu erkennen. Die Szene wirkt sehr geordnet. Von Jesus strahlt Ruhe und Stärke aus. Er ist der Mittelpunkt des Bildes. Bild 3 „Jesus stirbt am Kreuz“: Am Bild begegnen uns nur wenige Farbtöne: Braun, dunkles Grau, Weiß, Schwarz und ein zartes Rosa. In der Mitte ist das Kreuz aufgerichtet. Jesus hängt bzw. steht mit weit ausgebreiteten Armen vor den Betrachtenden. Hinter ihm leicht angedeutet Berge und eine Stadt und rechts die verdunkelte Sonne. Sie ist zum Großteil dunkelgrau verdeckt, aber dennoch leuchtet sie an den Rändern durch. Im Vordergrund sind links zwei Frauen, beide hell bekleidet, die sich anschauen und sich in den Armen halten. Rechts ein Mann mit jüdischer Kopfbedeckung, der in seinem Schmerz ganz allein da steht. Der zarte rosarote Farbton durchzieht einen Großteil des Bildes. Wie ein Hoffnungsrot oder der Atemhauch der Liebe durchdringt er ahnungsvoll das ganze Geschehen. Bild 4 „Die Frauen entdecken: Das Grab ist leer!“: Auf diesem Bild ist eine Grabhöhle zu sehen, die in Felsen gehauen ist. Vom Eingang gehen Stufen hinunter zu einem steinernen Sarg. Neben den Stufen gehen Abgründe hinunter. Der schwere Stein, der auf dem Steinsarg liegen sollte, liegt daneben, weiße Tücher liegen gefaltet darauf. Gefühlt weit hinten, beim Eingang, stehen dicht gedrängt drei Frauen in dunkle Kleider gehüllt. Sie tragen etwas in den Händen und schauen ratlos und erschrocken zum leeren Grab. Sie gehen aber nicht in das Grab hinein. Obwohl dort, wo die Frauen stehen, der Eingang in die Höhle ist, ist es dort dunkler als im Inneren der Höhle, wo das leere Grab ist. Die Engel, von denen die Bibel erzählt, sind noch nicht zu sehen. Die Frauen müssen den Moment des Erschreckens und der Ratlosigkeit noch aushalten. Es braucht Zeit und Engel, bis sie in die Hoffnung hineinwachsen können.
Um die Aussage „Gott lässt Jesus nicht hängen” zu verstehen, ist deren Rekurrenz auf die Redewendung „Jemanden (nicht) hängen lassen” wichtig. Denn in der Ostererzählung ist der Tod (das AmKreuz-Hängen) nicht das Ende der Erzählung über Jesus, da Gott ihn wie auch uns nicht hängen lässt. Auch wenn noch so schwere Situationen über uns kommen, die unseren Mut erfordern, bleibt Gott an unserer Seite.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bildbetrachtung „Umarmung” & Bibelstelle Mk 14,34: Betrachtet man das Bild in der Mitte der Seite, so könnten z. B. folgende Fragen an die Schüler*innen gestellt werden: Was ist auf dem Bild erkennbar? Woran könnte das Kind gerade denken? Was könnte es fühlen? Wen umarmt es? Inwiefern hilft eine Umarmung, wenn man betrübt, voller Angst etc. ist? Des Weiteren kann nun das abgedruckte Bibelzitat vorgelesen und mit dem besprochenen Bild in Verbindung
gebracht werden. An dieser Stelle könnte auch auf das große Bild im Hintergrund, welches Ölbäume im Garten Getsemani zeigt, verwiesen und über Jesus an diesem Ort erzählt werden.
Die Personen auf dem Bild sprechen lassen: Das Kind sagt, denkt, wünscht sich … Die Person, die das Kind trägt und hält, sagt, denkt, wünscht sich … Bibelgeschichte vom Tod und der Auferstehung Jesu erzählen oder vorlesen: Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass die Erzählung kindgerecht vermittelt wird, weshalb es von Bedeutung ist, den guten Ausgang dieser Geschichte in Aussicht zu stellen. Bildgeschichte erzählen & Texte zuordnen: Die Schüler*innen wiederholen die Erzählung über den Tod und die Auferstehung von Jesus anhand der Bilder und ggf. der Texte. Die Bilder und der Text können ggf. auch vergrößert und als ausgedruckte Karten verwendet, aufgelegt und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Es bietet sich auch an, von einer Partnerarbeit in eine größere Gruppe überzugehen und schließlich die Erzählung im Plenum zu wiederholen. Kinderbuch „Das verspreche ich dir” vorlesen: Das Kinderbuch „Das verspreche ich dir” begleitend zur Ostergeschichte vorlesen. Neben dem abgeblühten Löwenzahn, bei dem sich bereits die Samen auf die Reise machen, ist auf der nächsten Seite ein blühender Löwenzahn als Symbol für Auferstehung zu entdecken.
Aussage „Gott lässt Jesus nicht hängen” besprechen: Die Redewendung „Jemanden (nicht) hängen lassen” hilft dabei zu verstehen, dass der Tod nicht das Ende der Geschichte über Jesus ist und Gott auch uns nicht hängen lässt. Auch wenn noch so schwere Situationen über uns kommen, die unseren Mut erfordern, bleibt Gott an unserer Seite und lässt uns, wie auch Jesus, „nicht hängen”.
6 | … und noch mehr Ideen
Heftarbeit „Vom Tod zum Leben“: Ein Kreuz, das sich verwandelt vom Zeichen des Todes zu einem Zeichen von Leben (Auferstehung), gestalten. Die Schüler*innen erhalten zwei leere Kreuze, eines soll in dunklen Farben (vorwiegend schwarz) gestaltet werden und vom Tod erzählen (z. B. Muster mit Zacken etc.) und das zweite soll von der Auferstehung und dem Leben erzählen. Die Schüler*innen können für dieses zweite Kreuz vor allem helle, leuchtende Farben verwenden, einen Sonnenaufgang hineinzeichnen und sowohl Blumen, Bäume, Schmetterlinge u. v. m. als Symbole von Auferstehung in der Natur hineinzeichnen und die Kreuze mithilfe verschiedener Materialien (z. B. Sticker mit Blumen, Herzen, farbige Punkte u. v. m.) und ihrer eigenen Kreativität gestalten. Hoffnungszeichen gestalten: Die Schüler*innen gestalten Zeichen für Hoffnung wie zum Beispiel bunte Kreuze, Regenbogen, Sonne, usw. Diese können als Heftarbeit festgehalten oder z. B. in der Klasse oder dem Schulhaus aufgehängt oder verschenkt werden. Es bietet sich auch an, diese Hoffnungszeichen z. B. mit einem Bibelspruch zu versehen und bei einem Ostergottesdienst der Pfarre an die Kirchenbesucher*innen zu verteilen.
7 | Kinderbücher
Deutsche Bibelgesellschaft. (2019). Die Bibel. Einsteigerbibel. SCM.
Oberthür, R., Seelig, R. (2022). Die Ostererzählung. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco.
Ospelkaus, S. (2020). Auf Wiedersehen, Elias! SCM.
Schindler, R. (2008). Mit Gott unterwegs. Die Bibel für Kinder und Erwachsene neu erzählt. Bohem press.
Tharlet, E. (2017). Das verspreche ich dir. Knister.
8 | Lieder
Mit dir geh ich alle meine Wege Gotteslob Nr. 896
Seht das Zeichen, seht das Kreuz LB Religion Nr. 110
Wo zwei oder drei LB Religion Nr. 178
9 | Schnappschüsse





Halleluja, Jesus lebt! Er ist auferstanden
Seiten 94 und 95 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite möchte durch Bilder und Texte die zentrale Botschaft von Ostern nahebringen: Jesus ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! Weil Jesus auferstanden ist und lebt, darum wird der Ostersonntag zum großen Fest des Lebens und der Freude, denn Gott lässt uns nicht hängen, sondern befreit und erlöst selbst aus Kreuz und Tod. Diese Freude wird in der Liturgie des Ostertages gefeiert und besungen und lebt vielfach im Brauchtum, in der Volksfrömmigkeit weiter. Schüler*innen sollen die Möglichkeit bekommen, auch selbst nachzuspüren, dass Jesus lebt und ganz nahe ist, wenn sie draußen die aufblühende Natur, aber auch die Bilder im Buch betrachten und die Erzählungen der Evangelien hören, die Lieder singen und so in ihrem Vertrauen und in ihrer Hoffnung bestärkt werden, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass die Liebe letztlich in Gott wurzelnd alle Gewalt zu überwinden vermag, das Gott herausholt aus allen Gräbern des Lebens. Dieser Glaube an die Auferstehung – letztlich: dieses Vertrauen in die Lebenskraft und Leben spendende, schöpferische Kraft der Liebe Gottes – kann aber nicht gemacht werden, sondern wird, wie bei Maria von Magdala, durch die Begegnung mit ihm von ihm selbst geschenkt und stellt sich im Morgengrauen des ersten Ostermorgens als besondere Gnade und Geschenk heraus. Indem Jesus Maria bei ihrem Namen persönlich anspricht, erkennt sie ihn. „Allesaus?OderetwamitJesuSterbennichtallesaus?GrößteBehutsamkeit ist gerade hier angebracht. Es darf der Projektionsverdacht Feuerbachs bestätigt werden, für den Jesu Auferstehung nur das befriedigte Verlangen des Menschen nach unmittelbarer Vergewisserung seiner persönlichen Unsterblichkeit ist.” (Küng 2012, 235).
Durch die Begegnung mit der aufblühenden Natur, durch die Bilder und Texte, durch die Erzählungen von der Auferstehung bzw. den Begegnungen mit dem Auferstandenen kann ansatzhaft erspürt und erfahren werden, dass nicht Gewalt und Tod das letzte Wort haben, sondern ein zum Leben erweckender Gott. „Gerade in den Auferstehungserzählungen bleibt vieles nur angedeutet; man kann Jesus, dem Auferstandenen, begegnen, darüber stimmen alle Texte der Bibel überein. Wie bei Maria von Magdala kann er aber nicht festgehalten und festgemacht werden,vieles bleibt in Schwebe,der Auferstandene entzieht sich.” (Neuhold 2023, 188).
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben …frühlingshafte Zeichen des Lebens. …Zeichen des Osterfestes in Lebenswelt und Brauchtum. verstehen und deuten
…Ostern als Fest der Verwandlung vom Tod zum Leben.
…dass Gott Jesus neues Leben geschenkt.
gestalten und handeln
…vom Leben und von der Freude singen, tanzen, basteln … (be-)sprechen und (be-)urteilen
… wo Verwandlung vom Tod zum Leben erlebbar ist. entscheiden und mit-tun
… Ostern mitfeiern.
3 | Lernanlässe
★ Frühling und neues Leben in der Natur
★ Ostern mit den unterschiedlichen Bräuchen
★ (Geheimnisvolle) Ostererzählungen
★ Karwoche und Osterferien
★ Frage, ob ein Mensch auferstehen kann
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text des Raben Felix greift das Emotionale und Überraschende des Auferstehungsgeschehens, das Unglaubliche, was da passiert, auf. Zugleich bleibt die Frage offen und wichtig: Warum können wir den Auferstandenen heute nicht sehen? Oder doch?
Das Foto „Osterfeuer und Osterkreuz“ erzählt vom österlichen Brauch, dass Feuer entzündet werden und Menschen gemeinschaftlich das Feuer betrachten. Diese Feuer werden meist nach dem Auferstehungsgottesdienst bzw. nach der Osterfeier in der Familie entzündet. Auch in der Osterliturgie spielt Feuer eine wichtige Rolle. Zu Beginn der Osternachtsliturgie wird vor der Kirche ein kleines Feuer entfacht und gesegnet, an dem der Priester die Osterkerze entzündet und dann mit der Osterkerze in die dunkle Kirche einzieht. Feuer erzählt von Kraft, von Helligkeit im Dunkel, von Wärme in der Kälte, aber auch vom Erschaudern und dem Abstand, den man vom Feuer halten muss. Neben gemeinschaftlichen Osterfeuern gibt es auch den Brauch, dass auf Bergen weithin sichtbar Kreuze gestaltet werden, die mit Feuerelementen bzw. elektrischem Licht weit ins Land hinein vom Glauben an die Auferstehung erzählen. Sie deuten im christlichen Glauben, dass Christus als Licht der Welt die Finsternis vertrieben hat.
Das Foto „Osterstrauch mit Ostereiern“ zeugt von dem Brauch, blühende Sträuße mit Ostersymbolen zu schmücken. Sie sind Zeichen der Sehnsucht und der Freude über das neu erwachende Leben. Der Brauch, zu Ostern Eier zu segnen, geht bis ins christliche Altertum zurück. Das Ei als Symbol für das erwachende Leben wird von Christ*innen als Sinnbild für die Auferstehung Jesu gesehen.
Das Foto „Obstbäume im Frühling“ erzählt vom Erwachen der Natur im Frühling. Die blühenden Bäume und Wiesen sind Sinnbild für das neue Leben, das jedes Jahr im Frühling geschenkt ist. Für den glaubenden Menschen erzählen sie von der Hoffnung auf das Leben, dass Gott den Menschen schenkt: immer wieder mitten im Alltag, wenn es dunkel und schwierig ist, aber auch am Ende des Lebens als Auferstehungshoffnung nach dem Tod.
Mit dem Bild „Blühender Löwenzahn“ ist wiederum auf das Kinderbuch „Das verspreche ich dir” verwiesen, welches begleitend zur Ostergeschichte vorgelesen werden kann.
Das Bild „Auferstehung“ von Štěpán Zavřel führt weiter, was davor durch die Bilder der Passion angeklungen ist. Das Bild beschreibt und interpretiert die frühmorgendliche Szene, in der, wie im Johannesevangelium beschrieben, Maria von Magdala im Morgengrauen – nach den Grauen der Nacht und des Todes Jesu – zum Grab von
Jesus gehen will, um ihn nach jüdischer Begräbnissitte zu salben. Doch sie findet ihn nicht und als sie eine Person sieht, vermutet sie nicht den Auferstandenen im Grau des Morgens, sondern den Gärtner. Sie erkennt Jesus, den Auferstandenen, nachdem er sie beim Namen anspricht. Das Grau bzw. Grautöne sind die prägende Farbe des Bildes, vielleicht erzählen sie vom Grauen der Nacht des Todes, die eben weicht durch die Auferstehung, andererseits hebt es die Begegnung zwischen Maria und Jesus in den Bereich des Geheimnisvollen. „Weil es der Mensch hier mit Gott, und das heißt per definitionem mit dem Unsichtbaren, Ungreifbaren, Unverfügbaren zu tun hat, ist nur eine Form des Verhaltens angemessen, herausgefordert: gläubiges Vertrauen, vertrauender Glaube.” (Küng 2012, 257).
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Biblische Erzählungen über die Auferstehung von Jesus erzählen oder vorlesen: Biblische Erzählungen von der Auferstehung mit dem Bild von Štěpán Zavřel in Verbindung bringen. Dabei können Fragen beantwortet werden: Wer ist auf dem Bild zu sehen? Welche Farben sind zu erkennen? Wo sind helle oder dunkle Stellen? Was löst das Bild aus, wenn man es anschaut? Wo würde ich auf diesem Bild am liebsten stehen? Was könnte den Figuren durch den Kopf gehen? Was fühlen sie?
Bilder betrachten: Die verschiedenen Fotos betrachten und mit der Auferstehung und dem Osterfest in Verbindung bringen: Was ist zu sehen? Kenne ich diese Bräuche? Was gibt es bei Pflanzen im Frühling zu entdecken? Wie hängt das mit der Auferstehung von Jesus zusammen?
Heftarbeit „Begegnungen am Grab von Jesus”: Die Schüler*innen erhalten ein ausgedrucktes Bild davon, wie das Grab von Jesus von außen ausgesehen haben könnte. Sie malen die Besucher des Grabes hin und können auch sich selbst dazuzeichnen, wie sie das Grab Jesu besuchen, als ob sie dabei gewesen wären, als die Frauen erkennen, dass Jesus auferstanden ist (siehe unten).
Nachdenken und Philosophieren anhand des Rabentextes: Mit den Schüler*innen gemeinsam darüber nachdenken, wie es für die Freund*innen von Jesus gewesen sein muss, ihn wiederzuerkennen, und auf philosophische Weise der Frage nachgehen, warum wir Jesus heute nicht mehr sehen können bzw. inwiefern wir ihn heute noch erkennen können.
Gemeinsam Beispiele für die Auferstehung in der Natur sammeln: Angeregt durch den freigestellten Löwenzahn, das Bild des österlichen Strauches und der Bäume in ihrer Blüte Zeichen für Auf-
erstehung in der Natur und im Leben allgemein ausfindig machen und davon berichten, was vom neuen Leben erzählt. Als Festigung eine Collage gestalten. Kinderbuch „Das verspreche ich dir“ vorlesen: Das Buch begleitend zur Ostererzählung vorlesen und besprechen, was diese Erzählung von der Auferstehung erzählt. Anschließend kann eine Heftarbeit dazu gestaltet werden. Um die Blume zu gestalten, braucht man zwei verschiedene Gelbtöne und drei verschieden große Kreise (der mittlere in einem anderen Gelbton). Diese werden ausgeschnitten und jeweils rundherum ca. 1cm eingeschnitten und in der Mitte aufeinandergeklebt. Dann klebt man einen Stängel und die ausgeschnittenen Blätter des Löwenzahns dazu. Zur Blume dürfen die Kinder sich selbst oder auch Bruno aus der Erzählung zeichnen. Rundherum können sie in „Kritzi-Kratzi-Technik“ viele weitere Löwenzahnblumen gestalten.
6 | … und noch mehr Ideen
Lied „Alle Knospen springen auf“ singen und mit Tüchern mitmachen: Das Lied „Alle Knospen springen auf” um eine Mitte herum einüben. Alle Kinder erhalten ein farbiges Chiffontuch, welches sie „zusammenknüllen” und in ihren Händen verborgen halten. Während des Liedes öffnen sie ihre Hände langsam und lassen das Tuch wie eine Knospe aufblühen. In der Zeile „Knospen blühen, Nächte glühen” nehmen die Schüler*innen das Tuch an einer Ecke und wedeln, so entsteht ein bewegtes, buntes Miteinander.
7 | Kinderbücher
Deutsche Bibelgesellschaft. (2019). Die Bibel. Einsteigerbibel. SCM.
Frisch, H. J. (2008). Wie das Ei zum Osterei wurde. Patmos.
Oberthür, R., Seelig, R. (2022). Die Ostererzählung. Kamishibai Bildkartenset. Don Bosco.
Tharlet, E. (2017). Das verspreche ich dir. Knister.
8 | Lieder
Alle Knospen springen auf LB Religion Nr. 116
Du bist das Licht der Welt LB Religion Nr. 16
Halleluja („Taizé”) LB Religion Nr. 196
In jeder Blume LB Religion Nr. 11
9 | Schnappschüsse





Alles beginnt neu
Seiten 96 und 97 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Das christliche Osterfest fällt mit dem Frühlingsbeginn zusammen und so verbinden sich auch ihre großen Themen: Leben, Aufbruch und Neubeginn. Auf diesem österlichen Hintergrund will das Kapitel verstanden werden. Das Wachsen und Blühen in der Natur, der Frühling in seiner Vielfalt will zunächst wahrgenommen, gesichtet, begrüßt, bestaunt und bedankt werden. In einem weiteren Schritt kann der Frühling auf das Hintergründige befragt und das Geheimnisvolle entdeckt werden: Was braucht es zum Wachsen? Woher kommt überhaupt alles Wachsen? Worin hat es seinen letzten Grund? Die heilige Hildegard von Bingen prägt in diesem Zusammenhang den Begriff „Grünkraft“ (lateinisch: viriditas); eine Kraft, die in ihrer prophetischen und visionären Sicht im ganzen Kosmos, aber auch in der Seele des Menschen wirkt. In der Natur bewirkt sie das Wurzeln, Wachsen, Blühen und Reifen der Früchte. Für Hildegard ist die Grünkraft eine Lebenskraft, Fruchtbarkeit und Lebendigkeit, die von Gott stammt und in seinem Geist ihren Ursprung hat. In einer ihrer Hymnen heißt es: „Durch dich träufeln die Wolken, regt ihre Schwingen die Luft.Durch dich bricht dasWasser das harte Gestein, rinnen die Bächlein und quillt aus der Erde das frische Grün“ (zit.in: Riedel 1997, 59). Das Offensichtliche und Naheliegende kann zum Fenster oder zur Tür für das Nicht-Sichtbare werden; das Sichtbare ist durchscheinend auf das Unsichtbare, Verborgene, Geheimnisvolle, im Vordergründigen zeigt sich das Hintergründige und verweist damit weit über sich hinaus. Aber zunächst geht es im konkreten Unterricht immer um das Naheliegende und Offensichtliche, das die Kinder dann weiterführen und weiterfragen lassen kann. Kinder haben große Freude und großes Interesse am Entdecken, am Suchen und Finden; aber auch Säen und Pflanzen kann gut ihr Interesse wecken und auf das Hintergründige aufmerksam machen. Der Frühling mit seiner wahrlichen Grünkraft kann dazu eine gute Schule sein.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Veränderungen der Natur im Frühling.
… geheimnisvolles Wachsen: Pflanzen, Tiere, Menschen. verstehen und deuten
…dass es zum Wachsen Unterschiedliches braucht. ge stalten und handeln
… Samen ansäen, pflegen und ihr Wachsen beobachten.
… das Wachsen nachspielen.
… kreative Bilder zum Wachsen finden. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… das Wunder des Lebens.
… sorgsamer und dankbarer Umgang mit dem Leben. entscheiden und mit-tun … füreinander sorgen.
… Gott und Menschen danken.
3 | Lernanlässe
★ Freude und Lebendigkeit des Frühlings
★ Wachsen in der Natur nach dem Winter
★ Erwartung eines Kindes im Umfeld
★ Gestalten eines Schulgartens
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Bild „Vom Samenkorn zur Pflanze“ deutet das geheimnisvolle Wachsen und Werden vom kleinen Samenkorn bis zur reifen Blüte an und was es dazu braucht: Erde, Licht und Wasser.
Im Schatzkästchen kann in einfachen Worten nochmals verschriftlicht und eingefügt werden, was im Gespräch über das Wachsen und Werden herausgefunden wurde.
Der Liedtext „Jedes Leben fängt …“ nimmt alle Menschen in den Plan Gottes herein und verdeutlicht die Zusage, dass jedes Leben von Gott gewollt ist, wenn auch noch so geheimnisvoll.
Das Foto „Geborgen in Mamas Bauch” versucht, Kontakt aufzunehmen, das Wunder wahrzunehmen und so Beziehung und Bindung aufzubauen. Es berührt, weil es die freudige Erwartung und die Achtsamkeit im Blick auf das werdende Leben im Bauch der Mutter durch das Mädchen sichtbar werden lässt.
Im fragehaltigen Text „Wer kann es …“ wird versucht, dieses Geheimnisvolle allen Lebens zur Sprache zu bringen.
Der Bibeltext „Du, Gott …“ nach Psalm 139 spricht in Dankbarkeit Gott an. Es wird das innerste Wissen und Vertrauen ausgedrückt, dass hinter allem Leben die gute Hand Gottes steckt. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist nicht zufällig oder – auch wenn Menschen es manchmal so nennen – gar ein Unfall, sondern es ist erwünscht und wunderbar. Es sind dankbare Worte eines Menschen, der sich von Anfang an von Gott erwünscht und geliebt weiß.
Der QR-Code führt zu einem Lied über das Geheimis des Lebens und des Wachsens. Alles Leben und Wachsen ist letztlich ein Geheimnis und ein wunderbarer Teil in Gottes Mosaik.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Nachdenken, was es zum Wachsen braucht: Gemeinsam überlegen, was es zum Wachsen braucht und woher man das bekommt. Diese Auseinandersetzung soll dazu führen, dass der Mensch zwar viel machen kann, aber es letztendlich Gottes Gnade ist, die Leben schenkt, durch den Regen, die Sonne, die Liebe usw. Dazu kann auch das Schatzkästchen ausgefüllt werden.
Philosophieren und Nachdenken: Die Frage des Raben Felix, woher das Leben kommt und wie es angefangen hat, als Anlass gemeinsam nachzudenken, wie Leben beginnt und wodurch Wachsen möglich wird. Als Setting eignet sich insbesondere ein Sesselkreis, verschiedene Bilder können in die Mitte gelegt werden und Denkanstöße geben. Bild „Geborgen in Mamas Bauch”: Über eigene Erfahrungen mit Schwangeren erzählen lassen. Es kann zum Beispiel nachgefragt werden, wie über die noch nicht geborenen Babys gesprochen wird und wie diese behandelt werden (z. B. ob sich eine Mama den Bauch hält oder diesen streichelt usw.) In Bezug auf das Bild kann gefragt werden, was die Schüler*innen glauben, was das Mädchen hören könnte oder gerne hören würde?
Miteinander beten und singen: Den Psalm 139,14a (oder 139,13b) miteinander als Dankgebet sprechen und das Gebet mit Worten der
Dankbarkeit in Bezug auf das Wachsen und das Leben erweitern. Arbeitsblatt „Geheimnisvoll wächst neues Leben“ ausfüllen
6 | … und noch mehr Ideen
Schmetterlinge als Boten der Auferstehung gestalten (Kopiervorlage siehe unten)
Samen säen, pflegen und das Wachsen beobachten Samenkugeln herstellen: 4–5 EL Blumenerde, 4–5 EL Tonerde und 1 TL heimische Blumensamen gut vermischen. Ein bisschen Wasser hinzufügen und die Masse kneten, bis ein geschmeidiger „Teig” entsteht. Anschließend 6 Kugeln formen. Diese zum Trocknen 2–3 Tage auf ein Stück Zeitungspapier legen oder in einen leeren Eierkarton. Den Eierkarton als Verpackung ggf. mit Blumenmotiven und bunten Mustern verzieren, v. a. wenn er verschenkt wird. Die fertigen Samenkugeln einfach im Garten verteilen und etwas angießen. Durch Regen und Gießwasser lösen sich die Kugeln langsam auf und die enthaltenen Samen sprießen.
Frühlings- oder Dankesfeier gestalten: Gemeinsam eine Feier organisieren, in der das Wachsen, Aufblühen und Danken im Vordergrund steht. Sie kann von einer kleinen Feier z. B. nach der Hofpause im Freien mit einer Feier gemeinsam mit der Schulgemeinschaft, Eltern und Geschwistern, dem Kindergarten, Personen aus der Pfarre usw. gestaltet werden. Es bietet sich an, eine frühlingshafte Kulisse auszuwählen, eine Geschichte und selbst formulierte Dankesätze vorzulesen und gemeinsam zu singen.


7 | Kinderbücher
Carle, E. (2020). Nur ein kleines Samenkorn. Gerstenberg.
Herzog, A. (2015). Ein Baby in Mamas Bauch. Fischer Sauerländer.
Knowles, L. (2019). Aus klein wird groß. Wie aus einem winzigen Samenkorn ein mächtiger Baum wächst. Annette Betz.
8 | Lieder
Alle Knospen springen auf LB Religion Nr. 116
Danke, danke für die Sonne LB Religion Nr. 23
In jeder Blume LB Religion Nr. 11
Sag mal danke T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Sing mit mir ein Halleluja LB Religion Nr. 14
9 | Schnappschüsse



Geheimnisvoll wächst neues
Leben
Geheimnisvoll wächst neues Leben
Schatzbuch Religion
➜ Setze die richtigen Buchstaben ein und male dazu passende Bilder (an).
Setze die richtigen Buchstaben ein und male dazu passende Bilder (an). Von der



Mit dir kann ich fliegen
Mit dir kann ich fliegen
Schneide die beiden Herzen aus und falte sie an der strichlierten Linie. Klebe sie nur an diesem Mittelteil gegengleich zusammen. Gestalte nun die Flügel. Was kann ein Schmetterling von Auferstehung erzählen?
➜ Schneide die beiden Herzen aus und falte sie an der strichlierten Linie. Klebe sie nur an diesem Mittelteil gegengleich zusammen. Gestalte nun die Flügel. Was kann ein Schmetterling von Auferstehung erzählen?


Quelle des Lebens
Seite 98 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Seite einlädt
Diese Doppelseite bildet den Übergang zum Thema „Taufe“. Das Blau erinnert an das Wasser, das Meer, aber auch an den Himmel und die Weite des Kosmos. Das Wasser ist das zentrale Symbol der Taufe, der Urquell, aus dem alles Leben kommt. Die Symbolik des Wassers ist natürlich vieldeutig und ambivalent: Leben spendend und auch Tod bringend. Dieser Doppelaspekt will wie bei aller Symbolik ernst genommen und nicht zu schnell harmonisiert und nur „zum Guten gewendet“ werden. Die Benediktinerin und Mystikerin Photina Rech (✝ 1983) beschreibt die Symbolik des Wassers in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom frühen Christentum weg: „So ist dasWasser für die Alten wahrlich arché und origo, ‚Urgrund‘ der Welt und ‚Ursprung‘, nie versiegender Born des Lebens und der Fruchtbarkeit, die Allmutter,in der alle Möglichkeiten enthalten sind und die Keime alles Lebendigen schlummern und gedeihen.“ (Rech 1966, S. 307). Eine große Zahl an Märchen und Mythen durch alle Kulturen erzählt von der besonderen Bedeutung: Wasser kann Leben und Segen spenden, kann heilen, erlösen. Deshalb wird Wasser in allen großen Kulturen und Religionen als heilig oder göttlich betrachtet und für die verschiedensten Riten verwendet. „InMythenundMärchensind Flüsse, Seen, Quellen und Meere mit einem phantastischen Reigen von Wasserwesen bevölkert. Das Wasser lebt! Im Wasser leben die Göttlichen.Die Quelle ist im Mythos göttlicher Ort derVerwandlung und Erneuerung.“ (Stamer 1994, S. 103). Als ein kleines Beispiel sei ein Märchen aus der Südsee angeführt: Das Mädchen stand an einer Quelle, aus der das wunderbare Wasser des Lebens sprudelte. Tagtäglich tranken Götter an dieser Quelle. Das Wasser heilte von Krankheiten und mancherlei Übel. Über die Quelle geneigt stand ein sprechender Baum.
Kinder haben zunächst wohl einen sehr natürlichen und positiven Zugang zu Wasser, „ihrem“ Urelement: baden und schwimmen, im Regen herumlaufen, von Pfütze zu Pfütze springen, am Bach spielen, einen Staudamm bauen … bis zum erfrischenden Schluck zum Trinken u. v. m. Die Symbolik des Wassers ist für Kinder vielfach erlebnisgesättigt und mit vielen positiven Ereignissen verbunden, die im konkreten Unterricht ihren Platz haben können und sollen. Der Lehrplan ordnet die Taufe dem Kompetenzbereich B4 zu. Es lässt sich sicherlich die Bedeutung von Wasser in seiner ganzen Symbolik erarbeiten und der Zusammenhang mit der Taufe als Lebensquelle. Bei allen Sakramenten kann es zunächst immer nur um ein ansatzhaftes Verstehen und Erläutern gehen und um ein graduelles Hineinwachsen Schritt für Schritt. Kompetenzen werden nicht in einer Unterrichtseinheit erworben.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Erlebnisse und Erfahrungen mit Wasser.
verstehen und deuten
… dass Wasser lebensnotwendig ist.
… Wasser bei der Taufe als Hinweis auf das Leben. gestalten und handeln
… Wasserbilder gestalten, Wasser trinken und damit spielen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… inwiefern Wasser lebensspendend und -bedrohend ist. entscheiden und mit-tun
… eine Quelle, einen Bach besuchen.
… Wasser mit Klängen und Tüchern nachspielen.
3 | Lernanlässe
★ Die Taufe eines Kindes
★ Schulausflug zu einem Bach oder See
★ Wasser Erfahrungen, u. a. Trockenheit und Wassernot
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Geschichte „Quelle des Lebens” bringt wie viele Märchen und Mythen das Heilsame des Wassers und seinen religiösen Bezug zum Ausdruck und greift Motive und Teile des chinesischen Märchens
„Die Drosselquelle” auf. Im Originaltext ist von drei Mädchen die Rede … Vieles erinnert an Grimms Märchen „Wasser des Lebens”, in dem der jüngste Sohn schließlich das für den Vater heilende Wasser nach vielen Abenteuern findet. Rund um die Welt werden Geschichen von der besonderen Bedeutung des Wassers erzählt. Der Märchenfachmann und Religionspädagoge Otto Betz verweist aut die „stille” Anwesenheit des Religiösen in den Märchen, wenn er festhält: „Von Gott ist im Märchen selten die Rede. Aber hinter all den Sehnsüchten, von denen die Menschen getrieben werden, lässt sich ein verborgenes Verlangen ablesen, das über alle innerweltlichen Ziele hinausreicht. Von der Unruhe des menschlichen Herzens ist in den Märchen auf jeder Seite die Rede (Betz 1989, S. 30). Solche Märchen und mythischen Geschichten zeigen auch einen wichtigen Weg für die Religionspädagogik: nicht allzu vorschnell und „vorlaut” von Gott zu reden, sondern kommunikativ sich auf das Hintergründige einzulassen und auf das verborgene Wirken zu vertrauen. Das Bild „Baum am Wasser” vom steirischen Künstler Alois Neuhold zeigt einen bunten Baum, der in seinen Farben an den bergenden und schützenden Regenbogen in den Kapitelabschlussseiten erinnert. So verweist er wie auch die lebendige Quelle, an der er wächst, auf den ewigen Bund Gottes mit den Menschen und an die Noach-Erzählung der Bibel, in der Gott verspricht, den Menschen nie mehr wie in der Sintflut in Bedrängnis zu bringen und als Bundeszeichen seinen Bogen in die Wolken setzt (vgl. Gen 9,11b–13). Die drei rot-goldenen Früchte (Äpfel) erinnern an so manche Märchenmotive. Sie erinnern gemeinsam mit dem Wasser aber auch an die Paradiesesströme und an die Fülle des Lebens. Die Zahl drei steht in ihrer Symbolik für die göttliche Vollkommenheit.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Die Geschichte „Quelle des Lebens“ oder „Die Drosselquelle“ vorlesen und besprechen Wasserbild gestalten: Mit Wasserfarben ein Bild gestalten, indem z. B. verschiedene Blautöne ausgewählt werden und mit diesen und recht viel Wasser Linien auf einem A3- Blatt gezogen werden.
Wenn das Bild trocken ist, können Umrisse von Blumen, Menschen usw. auf das Blatt aufgeklebt werden (ggf. auch in einer bauchigen aufgeklebten Vase), oder man legt Figuren auf das Blatt, zeichnet sie ab und schneidet sie aus dem Bild aus.
Bildbetrachtung „Baum am Wasser“: Damit die Schüler*innen beim Betrachten des Bildes nicht abgelenkt werden, kann die S. 99 nach hinten geschlagen werden. Anschließend schauen sie sich das Bild auf S. 98 genau an. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein: Welche Farben sind im Bild zu finden? Welche Formen erkennst du? Was wird dargestellt? Wie unterscheidet sich der untere Teil vom oberen Teil (Farben)? Welche Gedanken könnten die Früchte, die Wurzeln, das Wasser, der Stamm haben? Lied „Wasser, lebendiges Wasser“ singen: Gemeinsam singen und u. a. Geräusche mit einem Regenmacher oder anderen Instrumenten, deren Klang an Wasser oder Regen erinnert, machen. „Wasserorte” besuchen: Ein Ausgang zu einer Quelle, einem Bach, Teich, Biotop etc. ermöglicht, Wasser mit allen Sinnen (sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen) zu erleben und verdeutlicht die Ursprünglichkeit des Wassers in der Natur und dessen Wichtigkeit für eben diese.
6 | … und noch mehr Ideen
Regenmacher basteln: In ein Rohr aus Pappe viele Nägel von den Seiten in die Pappe drücken oder, wenn die Pappe dick ist, hämmern. Das Rohr mit verschiedenen Materialien befüllen (Sand, Reis, Kieselsteine usw.) und dann von beiden Seiten zukleben und von außen gestalten.
Geschichte „Der Sprung in der Schüssel” vorlesen: Nach dem Vorlesen kann mit den Schüler*innen besprochen werden, wie mit dem „Fehler” der einen Schüssel umgegangen wurde. Sie können erzählen, ob sie auch einmal erlebt haben, dass sich ein vermeintlicher Fehler als etwas ganz Besonderes entpuppt hat. Sinnvoll ist auch der Bezug zur lebensspendenden Funktion von Wasser. Wasserblumen gestalten: Die Schüler*innen erhalten eine ausgedruckte Vorlage der Wasserblumen (siehe unten), die mit Farbstiften (Achtung: Filzstifte laufen aus) nach Belieben gestaltet werden. Danach schneiden die Schüler*innen die Blumen aus und schneiden die Blüten bis zum Kreis in der Mitte ein. Die Blütenblätter werden nacheinander eingefaltet. Dann die Blume in eine Schüssel mit Wasser legen und beobachten, wie sich die Blüte mithilfe des Wassers wieder öffnet, was ein Symbol dafür ist, dass Wasser „Leben schenkt”. Wenn die Blume wieder getrocknet ist, kann sie in das Reli-Heft eingeklebt werden.
Bildassoziation „Wasser”: Wasserbilder, in denen verschiedene Dimensionen des Wassers zum Ausdruck kommen, werden aufgelegt. Die Schüler*innen betrachten diese zunächst in Stille (ev. Wassergeräusche). Jedes Kind sucht sich ein Bild aus, das es kurz beschreibt und erzählt, warum es dieses Bild gewählt hat. Wasser erleben: Wasser in einem Krug mitbringen, in eine Schüssel gießen, in Gläser füllen und gemeinsam verkosten und genießen. Verschiedene Sorten Wasser kosten (Leitungswasser, Mineralwässer …): Die Lippen benetzen, im Mund spüren, schlucken und nachspüren.
7 | Kinderbücher
Lefin, P. (2022). Das Wasser gehört allen. Ein Märchen aus Afrika. Don Bosco.
Weniger, B. (2019). Danke, reines Wasser. NordSüd.
8 | Lieder
Alle Knospen springen auf LB Religion Nr. 116
Alle meine Quellen LB „Du mit uns” Nr. 463
In jeder Blume LB Religion Nr. 11
9 | Schnappschüsse













Die Drosselquelle
Die Drosselquelle
Es waren einmal drei Schwestern, die wünschten sich, so schön zu singen, dass alle, die ihnen zuhörten, Kummer und Sorgen vergaßen. Sie gingen von Dorf zu Dorf und sangen, aber sie konnten die Herzen der Menschen nicht rühren, und niemand nahm sich Zeit, ihren Liedern zu lauschen. Da wurden die Mädchen traurig. Sie versteckten sich in einem Bambus-gebüsch, wo niemand sie sehen konnte, und weinten. So viele Tränen flossen aus ihren Augen, dass ein Tränenbach aus dem Bambusgebüsch hervorplätscherte. Und die drei Schwestern weinten, bis aus dem Bach ein großer, breiter Fluss geworden war. Ein Fisch mit goldfunkelnden Flossen kam in dem Fluss geschwommen, streckte den Kopf aus dem Wasser und fragte: „Warum weint ihr, meine hübschen Kinder?" „Wir möchten die Herzen der Menschen mit unserem Gesang rühren und können es nicht", antworteten die drei Schwestern. „Niemand nimmt sich Zeit, unseren Liedern zu lauschen. Die Bauern auf den Reisfeldern arbeiten weiter, bis ihr Rücken krumm wird und schmerzt, die Kaufleute denken nur an die Waren, die sie verkaufen wollen. Keiner vergisst seinen Kummer und seine Sorgen über unserem Gesang.“ „Kennt ihr den weißen Wolkenberg?“, fragte der Fisch mit den goldfunkelnden Flossen. „Auf seinem Gipfel oben entspringt eine Quelle. Diese Quelle heißt die Drosselquelle. Wer aus ihr trinkt, dessen Gesang rührt die Herzen der Menschen. Aber der Weg dorthin ist weit und mühsam.“ „Danke, Fisch mit den goldfunkelnden Flossen", antworteten die Mädchen. „Wir werden zu der Drosselquelle gehen." Die drei Schwestern gingen und gingen und kamen endlich zu dem weißen Wolkenberg. Sie waren sehr müde. Ihre Schuhe waren von den Steinen zerfetzt, ihre Kleider von den Dornen zerrissen. Auf dem halben Weg zum Gipfel setzte die älteste Schwester sich nieder und sagte: „Ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst allein zur Quelle gehen. Trinkt und singt mir dann etwas Hübsches vor, dann werde ich gewiss wieder frisch und munter." Die mittlere und die jüngste Schwester gingen weiter. Sie kamen zu einem Baum. Dort setzte sich die mittlere Schwester nieder. „Ich bin zu müde, liebe Schwester", sagte sie, „geh du nur weiter, trink von der Quelle und sing mir etwas Hübsches vor, dann werde ich gewiss wieder frisch und munter." Die jüngste Schwester ging allein weiter. Auch sie wurde müde, so müde, doch sie dachte: „Ich muss die Quelle fidei uid daraus trinken, damit meine Schwestern wieder frisch und munter werden.“ Endlich war sie oben auf dem Gipfel, und da floss die Quelle aus dem Stein, und ihr Plätschern klang, als sänge sie. Die jüngste Schwester beugte sich nieder und trank. Dann schöpfte sie mit den Händen Wasser, um es ihrer Schwester unter dem Baum zu bringen. Ihr war, als schwebte sie, so leicht fel ihr llttlich eder Schritt. Sie lief zu dem Baum und gab ihrer Schwester zu trinken. Wieder lief sie zur Quelle, schöpfte noch einmal Wasser und lief zu der ältesten Schwester und gab auch ihr zu trinken. Als sie nun alle drei von dem Wasser der Quelle getrunken hatten, wuchsen ihnen Flügel; sie wurden zu Vögeln und schwangen sich hoch in die Luft. Sie flogen in die Dörfer zu den Menschen und sangen. Und da war niemand, der ihnen nicht zuhörte. Und alle, die Kummer und Sorgen hatten, vergaßen über dem Lied der Drosseln ihr Leid.
Die Drosselquelle
aus: Recheis, K., Hofbauer, F. (51987). 333 Märchenminuten. Wien: Verlag Herder.

Der Sprung in der Schüssel
Der Sprung in der Schüssel
Nach einem alten chinesischen Märchen
Nach einem alten chinesischen Märchen
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?“
„Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mi r deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus be reichern.“
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und lohnenswert machen. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie sie ist und das Gute in ihr sehen. Also, an all meine Freunde mit einem Sprung in der Schüssel, habt einen wundervollen Tag und vergesst nicht, den Duft der Blumen auf eurer Seite des Pfades zu genießen
Der Sprung in der Schüssel
Katholische Kirche Kärnten
https://www.kath-kirche- kaernten.at/images/downloads/der- sprung-in-der-schuessel.pdf

Gott schenkt neues Leben: Taufe – Taufsymbole
Seiten 99,100 und 101 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die drei Seiten einladen
Diese Seiten bringen die Taufe ins Bild und Gespräch und wollen zum Zentralen des Sakraments hinführen bzw. helfen, dieses wahrzunehmen. Dies ist in Zeiten des Wandels des Religiösen sicherlich ein schwieriges Unterfangen. Das zentrale Heilszeichen, Sakrament der Initiation und der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kirche, erschließt sich für viele Menschen von heute, die zum Teil nur noch formell zur Kirche gehören, nicht so einfach. Die Kinder bringen vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund vermutlich sehr unterschiedliche Vorerfahrungen mit. Auf der ersten Seite findet sich das Zentrum des Taufritus mit dem deutenden Wort, die Doppelseite bringt wesentliche Einzelheiten der Feier, Symbole und Symbolhandlungen ins Bild bzw. zur Sprache und versucht, diese in kurzen Sätzen zu deuten. „Mit Hilfe von Symbolen … können Kinder für ihre religiösrelevanten Erfahrungen eine Sprache gewinnen und schrittweise in religiöse Ausdrucksfähigkeit verfeinern.“ (Hilger 2006, 212). Symbole müssen erfahrungsnahe, sinnhaft und handlungsorientiert in dieser Altersstufe erschlossen werden, weniger in Erklärungen. Die Kinder sollen dadurch einerseits angeregt werden, sich Erfahrungen wie miterlebte Taufen in Erinnerung zu rufen oder eben sich selbst genauer mit dem eigenen Getauftsein auseinandersetzen. Vielleicht lässt sich so ein wenig das Geheimnis erahnen, wenn Christ*innen von sich sagen: Wir sind Kinder Gottes, Kinder des einen Vaters, hereingerufen in ein neues, erlöstes Leben aus Gnade und Barmherzigkeit, das sich nicht der eigenen Leistung und Anstrengung verdankt, sondern der Liebe, die Gott uns tagtäglich schenkt sowie der Quelle, die sprudelt und nie versiegt. So ermöglicht es ein Leben als neue Menschen, wie Paulus es nennt, in Zuversicht und Vertrauen trotz aller Widrigkeiten, weil wir Christus wie ein Kleid angezogen haben. In erster Linie geht es zunächst wohl um die Wahrnehmungskompetenz, dann auch um erste einfache Deutungen und Ausdrucksmöglichkeiten für das eigene Empfinden und Glauben (gestalten und handeln).
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können… wahrnehmen und beschreiben
… wichtige Gegenstände und Handlungen bei der Taufe. verstehen und deuten
… was Ritus und Symbole der Taufe bedeuten (ansatzhaft).
… ansatzhaft Vertrauen in ein Leben aus der Taufe schöpfen. gestalten und handeln
… Symbolhandlungen: Tauferinnerungen mitbringen, für Taufpat*innen etwas gestalten.
(be-)sprechen und (be-)urteilen
… das eigene Getauftsein und Christ*insein. entscheiden und mit-tun
… Taufe oder Tauferneuerungsfeier erleben.
3 | Lernanlässe
★ Taufe eines Kindes aus der Klasse
★ Kinder mit religiösem Bekenntnis und Kinder ohne Taufe
★ Namen und ihre Bedeutung
★ Kirchenraum: Weihwasser, Taufbecken, Osterkerze
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Foto „Lebendiges Wasser“ zeigt Wasser in Bewegung. Diese Bewegung verweist auf die positive Seite des Wassers, dass es Leben in sich birgt und Leben und Frische spendet. Aber wie jedes Symbol hat Wasser auch eine dunkle, gefährliche und bedrohende Seite. Es kann zerstören und kann den Tod bringen. In der Taufe kommt diese Ambivalenz zum Tragen. Der Täufling wird in der ursprünglichen Taufform im Wasser untergetaucht. Unter Wasser zu sein heißt sterben. Symbolisch wird gezeigt: Wer getauft wird, stirbt mit Jesus, und im Auftauchen wird symbolisiert: der oder die Getaufte steht aber mit Jesus auch wieder auf. Neues Leben ist geschenkt. Es ist in der Arbeit mit den Kindern wichtig, die Ambivalenz des Wassers zur Sprache zu bringen. All die gegensätzlichen Aspekte und Erfahrungen ins Gespräch zu bringen gegen falsche Harmonisierungen, die dem Leben in seiner Fragilität und Gefährdung nicht standhalten können. Die Taufformel wird gesprochen, wenn der Taufspender bei der Taufe dem Täufling das Wasser über den Kopf gießt, oder wenn der Täufling im Wasser untergetaucht wird. Im Namen und auf den Namen des dreifaltigen Gottes wird der Mensch getauft: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist einer, der in sich Beziehung ist. Der oder die Getaufte wird in diese Beziehung mit hineingenommen. Nicht als Nummer, sondern höchst persönlich, beim Namen gerufen. Der Name wird, um es mit einem anderen Bild, das in der christlichen Kunst immer wieder auftaucht, zu sagen, unvergesslich und einzigartig in die Hand Gottes geschrieben.
Im Lied „Wasser, lebendiges Wasser” kommt die religiöse Bedeutung des Wassers zur Sprache. Wasser als Symbol für das lebendige Wasser, das Jesus uns schenkt. Er deutet im Gespräch mit der samaritanischen Frau am Brunnen an, dass er selbst das lebendige Wasser ist bzw. gibt. Das Wasser, das er gibt, wird in den Menschen zur lebendigen Quelle (vgl. Joh 4,13).
Bilder und Elemente zur Verdeutlichung des Taufritus: Taufwasser: Das Wasser ist in vielen Religionen Sinnbild der Reinigung, aber auch Lebensquell, aus dem alles Leben kommt. Im christlichen Sinn ist es auch Bild für das Auftauchen, für Neubeginn und Auferstehung. Paulus schreibt dazu im Römerbrief: Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben (Röm 6,3f).
Taufkerze: Sie wird an der Osterkerze entzündet und verweist so auf die Auferstehung und das ewige Licht, das selbst durch die Finsternis des Todes nicht überwunden werden kann: Selbst in tiefster Nacht leuchtet ein Licht, das seinen Ursprung in Christus selbst hat, von dem im Johannesevangelium gesagt wird: Ich bin das Licht der Welt. Taufkleid: Nach Paulus ziehen die Getauften Christus wie ein Kleid an; es drückt sich darin die Nähe und besondere Beziehung zu Jesus aus. Das Weiß des Kleides erinnert auch an die völlige Reinheit von allem Bösen. Chrisamöl (Tauföl): Die Salbung mit Chrisam erinnert daran, dass alle in hoher Würde zum/zur König*in, Propheten*in,
Priester*in berufen sind und so den „Wohlgeruch Christi” in der Welt verbreiten sollen. Taufname: Der Name steht für die Einzigartigkeit der Person als Individuum – „Ich bin gemeint.” Er steht auch für das Gerufen- und Angerufensein, zugleich meint er auch, dass Gott jeden Menschen beim Namen kennt. Taufpat*in: Sie haben die Aufgabe, die Eltern in der religiösen Erziehung zu unterstützen und das Kind liebevoll zu begleiten. Sie sprechen auch mit den Eltern für das Kind das Glaubensbekenntnis und die Absage an das Böse. Effata-Ritus („Öffne dich”): Der Taufspender berührt die Ohren und den Mund des Täuflings, so wie Jesus es bei der Heilung des Taubstummen gemacht hat. Das Kind möge seine Ohren öffnen für Gottes Wort und den Glauben bekennen bzw. weitersagen mit dem Mund.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Taufelemente kennenlernen: Wörter, Bilder, Utensilien, die zur Taufe gehören, auflegen und besprechen. Arbeitsblatt „Was bei der Taufe wichtig ist“ verbinden: Das Verbinden der Gegenstände ist eine eher einfache Übung. Alternativ können die Bilder und Worte ausgeschnitten und im Heft richtig zugeordnet werden.
Heftarbeit Taufe (Kopiervorlage): Die Schüler*innen zeichnen das, was es für die Taufe braucht, in die Kästchen ein und füllen die Taufformel aus. Anschließend schneiden sie die Kästchen aus und gestalten eine Heftseite.
Namen gestalten: Die Schüler*innen können den Namen, auf den sie getauft wurden, in besonderer Weise gestalten. Dieser kann zum Beispiel für jedes Kind groß ausgedruckt werden, sodass in die Buchstaben eingezeichnet werden kann, was zu mir passt, Lieblingsfarben usw.
Eigene Fotos, Symbole der Taufe mitbringen und anschauen. Wasserritual „Segnen“: Mit Weihwasser einander ein Segenskreuz in die Hand oder auf die Stirn zeichnen. Dabei ist auf Freiwilligkeit zu achten.
6 | … und noch mehr Ideen
Eine Kirche besuchen: das Taufbecken entdecken und besprechen, Taufkerze anzünden, über die Taufe sprechen. Kinder erzählen lassen, wenn sie schon einmal bei einer Taufe dabei waren, was sie dabei erlebt haben. Gemeinsam (das Vaterunser) beten und ein Lied (wie „Jesus ist bei dir“) singen.
Arbeitsblatt „Die Taufe ” ausfüllen: Die Wörter, die zur Taufe gehören, im Suchsel finden und miteinander besprechen, was diese mit der Taufe zu tun haben. Gemeinsam kann man dann auch überlegen, welche Wörter zur Taufe im Suchsel nicht zu finden waren.
7 | Kinderbücher
Brielmaier, B. (2009). Lena wird getauft. Thienemann-Esslinger.
Lühmann, A., Schuld, K. (2016). Erkläre mir die Taufe. Coppenrath.
8 | Lieder
Jesus ist bei dir LB Religion Nr. 264
Ich trage einen Namen T. von R. Krenzer, M. von P. Janssens
Kind Gottes Nr. 8 im HB-Anhang
Wasser, lebendiges Wasser LB „Du mit uns” Nr. 599




Die Taufe
Die Taufe
➜ Finde die versteckten Wörter und male sie in verschiedenen Farben an.
Finde die versteckten Wörter und male sie in verschiedenen Farben an.
Ein gefundenes Wort auswählen und etwas dazu erzählen bzw. erklären.
Diese Wörter sind versteckt: TAUFE WASSER CHRISAMÖL PATIN JESUS TAUFKLEID NAME PATE KERZE
Arbeitsblatt zum Schatzbuch Religion 1

Was bei der Taufe wichtig ist
Was bei der Taufe wichtig ist
➜ Verbinde die Wörter mit den richtigen Gegenständen und male diese an.
Verbinde die Wörter mit den richtigen Gegenständen und male diese an.

Chrisamöl
Chrisamöl
Taufkleid
Taufkleid

Taufbecken
Taufbecken

Taufurkunde
Taufurkunde

Taufkerze
Taufkerze

Religion
Fülle die Schatzkästchen (passend zu deiner Taufe) aus:
➜ Fülle die Schatzkästchen (passend zu deiner Taufe) aus:




Taufkerze Taufkleid Taufpaten




ich taufe dich im Namen des V_ t _ _ s und des S _ h _ _ s und des H _ _ l _ g _ n G _ _ s t _ s . Amen.


Taufpriester Taufformel Chrisamöl






Taufwasser

Taufkind Taufbecken

Mit Jesus verbunden sein
Seiten 102 und 103 im Schulbuch | Kapitel 6
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Durch die Taufe wird der Mensch in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, die als der konkrete Leib Christi in der heutigen Welt die Quelle christlichen Lebens darstellt. Die Aufnahme in die Kirche verdeutlicht auch, dass wir Menschen soziale Wesen sind: als sozial Eingebundene werden wir zu Christ*innen, nicht aus uns selbst heraus. Es ist als Prozess zu verstehen, Christ*in zu werden, tiefer ins Verstehen des Christusgeheimnisses und in die Berufung als Christ*in hineinzuwachsen. Dieser beginnt in der Taufe, überdauert das ganze Leben und ist auf Gemeinschaft angewiesen: alles Leben ist miteinander verbunden und in Beziehung. So bedeutet Kirchesein einerseits Eingebundensein in eine größere Gemeinschaft, Mitgetragenwerden und zugleich Auftrag in dieser Gemeinschaft, die je individuelle Berufung ansatzhaft zu leben. Für Kinder in dieser Altersstufe geht es wohl zunächst um das Aufmerksamwerden auf das Eingebundensein und Dazugehören, Mitgetragenwerden; es ist möglich, schon den eigenen Beitrag als wichtig zu sehen und zu verstehen: mein Dabeisein ist wichtig und bereichert die Gemeinschaft der Kirche, ohne dass ich große „Leistungen“ vollbringen muss. Ich gehöre als wichtiger Teil dazu, als wichtiger Teil zu Christus. Das Wort „Kirche“ kommt vom griechischen Wort „kyriakè“: dem „Kyrios“ (= dem Herrn) gehörig. Es geht also um Aufbau von Beziehung zu Jesus und zueinander, damit Kirche wird, was sie ist: zum Herrn Jesus gehörig.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wie es ist, sich mit jemandem verbunden zu fühlen. verstehen und deuten
… dass Getauftsein Verbundenheit mit Jesus schenkt. gestalten und handeln
… Taufnamen auf ein Verbundenheit-mit-Jesus-Plakat. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was es heißt, mit Jesus verbunden zu leben. entscheiden und mit-tun
… Taufdaten mit den Eltern oder Taufpat*innen eintragen.
3 | Lernanlässe
★ Die Taufe eines Kindes im Umfeld
★ Kinder mit und ohne religiöses Bekenntnis
★ Namen und Namensheilige
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Freundschaftsband „Jesus” verweist auf die Möglichkeit, auch heute noch eine Freundschaft mit Jesus zu pflegen. Durch die Taufe gehören wir zu Jesus – im schulischen Kontext ist oft von „Jesusfreund*innen” die Rede. Durch das Armband zeigt sich, wie
aktuell die Freundschaft zu Jesus sein kann und Jesu Angebot, uns in unserem Leben zu begleiten, wenn wir das möchten.
Der Text vom Raben Felix greift ein Motiv aus der Apostelgeschichte auf: das Leben in der Urgemeinde. Dort wird das Leben der frühen Christ*innen und ihre Glaubensgemeinschaft sehr idealtypisch beschrieben, dass sie eben alles gemeinsam haben, miteinander alles teilen, „ein Herz und eine Seele” sind. Es wird die geheimnisvolle Verbindung von Menschen durch Beziehung, Freundschaft und Liebe angesprochen.
Das Lied „Einander brauchen” bringt das Thema des aufeinander Angewiesenseins und der Freundschaft in das Bild vom bunten Band, das gewebt wird. Mehrere Fäden zusammen ergeben ein buntes Band. Es ist ein Geben und Nehmen, typisch für ein Miteinander. Der QR-Code führt zu einem Lied zum Miteinander. Der Steckbrief zur Taufe lädt ein, dass die Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Taufpat*innen ins Gespräch über ihre Taufe kommen. Fotos und Andenken können angeschaut und die entsprechenden Daten in das Arbeitsblatt im Buch eintragen werden.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Lied „Einander brauchen” singen Taufsteckbrief ausfüllen: Den Taufsteckbrief am besten zu Hause zusammen mit den Eltern oder Taufpat*innen ausfüllen. Wieder in der Schule können die Schüler*innen dann mithilfe vom diesem von ihrer eigenen Taufe erzählen. Schüler*innen, die o. B., also ungetauft sind, können alternativ das Arbeitsblatt „Das bin ich” (siehe unten) ausfüllen.
Freundschaftsarmband basteln: Mit bunten Papierstreifen Freundschaftsarmbänder basteln, beschriften, verzieren. Ggf. kann auch ein Freunschaftsarmband als Zeichen für die eigene Freundschaft zu Jesus gestaltet werden. Die Papierstreifen auf beiden Seiten lochen, damit die Armbänder am Handgelenk befestigt werden können. Alternativ können auch Perlen (u. a. mit Buchstaben) angeboten werden, um Freundschaftsarmbänder mit Namen zu gestalten.
6 | … und noch mehr Ideen
An Tauferneuerungsfeier teilnehmen: Kirche besuchen und evtl. von Personen aus der Pfarre die Utensilien für die Taufe gezeigt bekommen.
Taufbaum befüllen: Die Schüler*innen können z. B. jeweils eine Rebe gestalten, auf diese wird ihr Name und das Datum ihrer Taufe geschrieben. Gemeinsam werden die Reben dann an einen Weinstock, welcher u. a. in der Kirche aufgestellt sein kann, gehängt. Das ist natürlich auch zu anderen Themen möglich, zum Beispiel: Fische im Netz u. v. m.
7 | Kinderbücher
van Hout, M. (2012). Freunde. Aracari.
8 | Lieder
Du bist ein Ton, in Gottes Melodie LB Religion Nr. 67
Ich brauch dich, du brauchst mich Nr. 7 im HB-Anhang
Ich möcht, dass einer mit mir geht LB Religion Nr. 81
Liebt einander, helft einander LB Religion Nr. 71
Mit einem/r Freund/in an der Seite LB Religion Nr. 6
Wo ich gehe oder stehe LB Religion Nr. 250
Wo zwei oder drei LB Religion Nr. 178
9 | Schnappschüsse






Steckbrief: Das bin ich
Steckbrief: Das bin ich
Fülle den Steckbrief aus. Male ein Bild von dir oder klebe ein Foto in das Kästchen.
➜ Fülle den Steckbrief aus. Male ein Bild von dir oder klebe ein Foto in das Kästchen.
Mein Name:
Mein Geburtstag:
Meine Eltern:
Meine Lieblingsspeise:

Meine Lieblingsjahreszeit:
Meine Unterschrift:

Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 104 und 105 im Schulbuch | Kapitel 6
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in Religion beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …), sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Es geht darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken und welche Fragen neu generiert werden.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 106 im Schulbuch | Kapitel 6
Die Schlussseite bildet eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Wie auch im vierten Kapitel, welches sich mit dem Weihnachtsfest auseinandersetzt, ist auch hier die Kapitelschlusseite durch ihre Gestaltung von den anderen sechs Kapiteln abgehoben. Das grafische Element erinnert an die Osterkerze mit Kreuz, den Wundmalen und Alpha und Omega: Christus ist der Anfang und das Ende. Eingebettet in der Mitte die Ostersonne und das österliche Licht wie von bergenden Händen im Blau umgeben. Blau deutet als Farbe einerseits auf das Wasser und die Tiefen des Meeres, aus dem alles Leben kommt, und andererseits verweist es auf die unendliche Weite des Himmels und des Himmlischen.
Die Worte verdeutlichen und interpretieren, worum es geht: um einen Weg aus der Finsternis zum Licht, von der Trauer zur Freude, vom Tod zum Leben. In dieses Geheimnis werden wir in der Taufe hinein verwoben, nicht mehr ich lebe, wie Paulus sagt, sondern Christus lebt in mir.
Literatur zum 6. Kapitel
Betz, O. (1989). Lebensweg und Todesreise. Märchen von der Suche nach dem Geheimnis. Freiburg i. B.: Verlag Herder.
Bowlby, J. (2018). Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Hilger, G./Ritter, W. (2006). Religionsdidaktik Grundschule. Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts. München: Kösel-Verlag.
Höfer, A. (2002). Erlösung will erfahrbar sein. Erlösungsvorstellungen und ihre heilende Wirkung. München: Don Bosco Verlag.
Küng, H. (2012). Jesus. München: Piper Verlag.
Neuhold, H. (2023). Integrative Gestaltpädagogik und biblische Spiritualität. Biblische Gestalten erzählen unser Leben. Gevelsberg: EHP – Verlag Andreas Kohlhage.
Rech, Ph. (1966). Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung, Bd II. Salzburg: Otto Müller Verlag.
Riedel, I. (1994). Hildegard von Bingen. Prophetin der kosmischen Weisheit. Stuttgart: Kreuz-Verlag.
Schweitzer, F. (2012). Elementarisierung im Kontext neuerer Entwicklungen. In: Grümme, B./Lenhard, H./Pirner, M.: Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
Stamer, B. (1994). Quelle/Wasser im Märchen. In: Moltmann-Wendel, E./Schwelien, M./Stamer, B.: Erde – Quelle – Baum. Lebenssymbole in Märchen, Bibel und Kunst. Stuttgart: Kreuz-Verlag.
KAPITEL 7: Einander vertrauen. DIE WELT IST BUNT
Seiten 107 – 116 im Schulbuch
Impuls
Kein Blatt gleicht dem anderen
„Mangaliso, was machst du mit all den Blättern auf dem Boden?“
„Ich vergleiche sie. Ich möchte sehen, ob zwei Blätter genau gleich sind.“
„Was hast du bis jetzt gefunden?“
„Von ferne betrachtet,sind sie alle gleich,aus der Nähe betrachtet, ist jedes anders.“
„Es ist wie bei den Menschen“, sagt Solomon.
„Und wenn ich die Blätter von allen Bäumen des Urwaldes abreißen und sie miteinander vergleichen würde?“
„DasErgebniswäredasselbe.DuwürdestkeingleichesBlattfinden.“
„Warum ist das so?“, will Mangaliso wissen.
„Weil Gott die Fülle ist und dieVielfalt liebt.“, sagt Solomon. Albert Herold
Allgemeine Hinführung
Die Wertschätzung von Vielfalt und Buntheit der Welt wurzelt in einer vertrauensvollen Offenheit der Welt und den Menschen gegenüber. Insofern ist die „Lebenskraft Vertrauen” als Schlüssel für ein gutes Miteinander zu sehen. Sie kann aber nicht gefordert werden – weil Vertrauen letztlich nicht gemacht werden kann, sondern „wie von selbst” entsteht oder nicht entsteht. Sie kann aber sehr wohl gefördert werden; zumindest kann die Sehnsucht nach diesem Vertrauen geweckt werden, selbst in einer misstrauischen Welt. Dazu braucht es Beziehung, Sicherheit und Schutz von Seiten der Lehrperson, damit das Kind sein Herz öffnen kann und sich vertrauensvoll auf das Risiko der Begegnung einlassen kann. Theologisch wurzelt letztlich dieses Vertrauen und erwächst aus dem tiefen Gespür, Wissen und Glauben, dass die ganze Schöpfung, besonders auch alle Menschen als Abbild Gottes aus demselben Geist leben und atmen und daraus das Leben voll Vertrauen miteinander gestalten können. Dazu bedarf es der Resonanz (Hartmut Rosa), bzw. durch dieses Vertrauen und Wertschätzen der Vielfalt entsteht ein Resonanzraum. „Schule kann auf solcheWeise zum Resonanzraum werden – oder sie kann sich in eine Entfremdungszone sondergleichen verwandeln. Resonanz und EntfremdungbeschreibendabeiinsbesonderedieBeziehungsweisen zwischen Stoff,Lehrenden und Lernenden …”(Rosa 2016,408). Der theologische Zugang und auch die Bibelzitate verweisen auf mögliche Querverbindungen zum Thema „Pfingsten” und „Gottes Geist”, der ja auch als Gemeinschaft und Kirche stiftend (Pfingsten: Geburtstag der Kirche) in der Apostelgeschichte erfahren und beschrieben wird. Das Kapitel will insgesamt aus diesem Wissen um den einen Geist Vertrauen stärken, damit Differenz und Vielfalt als wertvoller Schatz wahrgenommen werden können, und will „die angstfreie Bewusstheit von Differenz” (Neuhold 2016) fördern. Die Zusammensetzung
und Vielfalt in der Klasse kann einen Lernanlass bilden, genauer wahrzunehmen und hinzuschauen, wie sich Vielfalt und Heterogenität in der Klassengemeinschaft bzw. Schule abbilden. Mit dem sich mehrfach in der Überschrift wiederholenden Wort „Schatzkiste“ soll deutlich werden, dass Unterschiede wertschätzend als wichtiger Schatz betrachtet werden können. Heterogenität als Konsequenz des Ernstnehmens der Individualität jedes Kindes und religionspädagogischer Subjektorientierung kann heute als eines der pädagogischen Schlüsselwörter gesehen werden. „Offensichtlich gehört Heterogenität zum pädagogischen Feld wesentlich dazu.Wo Pädagogik,dort Vielfalt und Unterschiedlichkeit,aber auch derVersuch,diese HeterogenitätdurchdieFormungvonUnterrichtszielen,vongleichförmigen Methoden oder bereits vereinheitlichenden Wahrnehmungen und Ordnungsgefügen zu bearbeiten.“ (Grümme 2017, 25). Bernhard Grümme fokussiert damit auf die oft unbewussten Ambivalenzen, die heutiger Pädagogik, die sich als eine heterogenitätssensible positionieren will und muss, innewohnen.
Eine zukunftsträchtige Religionspädagogik hat in unserer pluralen Gesellschaft den Nachweis zu erbringen, dass sie pluralitätsfähig ist und Vielfalt wertschätzend ernst nimmt, will sie die Menschen darin noch erreichen. Vielfalt hat im jüdisch-christlichen Kontext ihre Wurzel in der Schöpfungserzählung, Gen 1: Der Mensch als Abbild Gottes geschaffen. Insofern bildet dieses Kapitel die Nagelprobe dafür: Kann es gelingen, eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber der Vielfalt der Menschheit zu entwickeln bzw. zu fördern?
Lehrplanbezüge des 7. Kapitels
Kompetenzbereich | C6 Religiöse und weltanschauliche Vielfalt in Gesellschaft und Kultur
Leitkompetenz | Unterschiedlichen Lebensweisen und Glaubensformen reflexiv begegnen können.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können erkennen, dass Gemeinschaft in Verschiedenheit gelebt wird und können zu einem guten Miteinander beitragen.5
Unterrichtshinweise | Lebenskraft Vertrauen; (Spiel-) Regeln für das Miteinander.
Kompetenzniveau 1 | Die Schüler*innen können ausdrücken, was gebraucht wird, um sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen.
Zuordnung - Zentrale fachliche Konzepte:
Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch Transzendenzbezug.
Freiheit und Offenbarung: Quellen der Offenbarung sind die Bibel und die kirchliche Tradition in ihrer Vielfalt. Auf der darin grundgelegten Freiheit des Menschen basiert die Achtung der Religionsfreiheit jeder Schülerin und jedes Schülers.
Bezüge zu fächerübergreifenden Themen laut Lehrplan
★ 5 Interkulturelle Bildung
Titelseite: Einander vertrauen. Die Welt ist bunt
Seite 107 im Schulbuch | Kapitel 7
Das Titelbild zeigt ein wunderbares, buntes Gewebe von Fäden, die ineinander wie bei einem Teppich verwoben und verflochten sind. Damit wird ein gemeinsames (Muster) sichtbar und zugleich bleibt die jeweilige individuelle Unterschiedlichkeit.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in diesem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Bildarbeit : Das Bild betrachten und zusammen herausfinden, was dargestellt ist: Welche Farben sind zu sehen? Wie hängen die Fäden zusammen? Sind alle Fäden gleich?
Gemeinsam ein Netz aus Wolle spannen : Eine Möglichkeit wäre, im Sesselkreis zu sitzen und ein Kind beginnt und darf eine Sache über sich, von der es denkt, dass es noch niemand weiß, erzählen. Wenn es fertig ist, wirft es das Wollknäuel zum nächsten Kind, welches wiederum erzählen darf. Beim Werfen immer das aktuelle Ende festhalten. So entsteht in der Mitte des Kreises ein Netz. Des Weiteren könnte man auch so anfangen, dass die Lehrperson einem Kind eine Frage stellt und den Wollknäuel zuwirft. Dieses Kind darf nun einem anderen Kind eine Frage stellen und wieder den Wollknäuel zuwerfen, bis alle ein Stück des Wollfadens in der Hand haben und wiederum ein Netz entsteht. Man könnte auch mehrere Durchgänge mit jeweils verschiedenen Wollfarben machen, oder jedes Kind knüpft eine Lieblingswollfarbe an, wenn es dran ist, und wirft diese Farbe weiter. Der entstehende bunte Faden könnte dann z. B. als Spirale auf festes Papier geklebt werden und als ein Klassensymbol auf die Klassenwand aufgehängt werden.

Gemeinsames und Verschiedenes
Seiten 108 und 109 im Schulbuch | Kapitel 7
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Zu Beginn des Kapitels geht es zunächst wiederum um das wertschätzende Wahrnehmen von Vielfalt, das Erinnern und Erzählen in Bezug auf die „Schatzkiste Vielfalt”. Diese Schatzsuche beginnt sinnvollerweise zunächst im eigenen Umfeld der Familie, Klasse und Schule – der Lebenswelt der Kinder. Das kann von den unterschiedlichen Namen, Gesichtern, den möglicherweise unterschiedlichen Herkünften und Muttersprachen, auch im Sinne einer „interkulturellen Bildung”, beginnen. Darauf wollen auch die Bilder verweisen, in denen das Miteinander in den Mittelpunkt gerückt wird, das gemeinsame Tun und Sein trotz aller Verschiedenheit und wünschenswerter Individualität. Die Verschiedenheit und Individualität wird hier bewusst zunächst als Schatz gesehen und beschrieben, obwohl gerade diese Verschiedenheit in Gemeinschaften zu Schwierigkeiten führt und Konflikte bringen kann. Wieviel ICH das WIR verträgt, ist im alltäglichen Zusammensein in der Klasse eine wichtige und berechtigte Frage und pädagogische Herausforderung. Dafür auch gemeinsam Regeln zu entwickeln und einzuüben kann als wichtiger Beitrag zur Schulkultur und Humanisierung der Schule gesehen werden, weil es in ihr immer auch um Herzensbildung und ethische Bildung geht. Zugleich soll auch die Tiefendimension des Verbundenseins, des Gemeinsamen bei aller Vielfalt, bei aller Unterschiedlichkeit, vielleicht auch bei aller Anders- und Fremdheit zur Sprache kommen und als Schatz wahrgenommen werden können, weil wir letztlich alle aus demselben „Atem und Geist Gottes” leben. Dieser Atem und Geist verbindet uns alle und die ganze Menschheit, weil jeder und jede ein von Gott geliebtes und gewolltes Kind und Geschöpf ist, das nach dem Buch Genesis als sein Abbild und Ebenbild in dieser Welt lebt. Die Liebe „als das Band, das alles zusammenhält“ nach dem Kolosserbrief der Bibel wird zur weltweiten Richtschnur für das Zusammenleben über die Religionen hinaus; solche Grundregeln und Grundwerte als wertvoller Schatz finden sich in allen Religionen und Weltanschauungen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Zusammenleben als Vielfalt und Gemeinsamkeit.
… Ebenen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. verstehen und deuten
… Vielfalt (bunte Welt) als etwas Bereicherndes.
… Wertschätzung als Voraussetzung für Frieden. gestalten und handeln
… Buntheit und Vielfalt innerhalb von Gemeinschaften. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Besonderheiten.
… Mitteilen positiver Eigenschaften anderer. entscheiden und mit-tun
… anderen wertschätzend begegnen.
3 | Lernanlässe
★ Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umfeld
★ Konflikte und Streit untereinander
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Bildcollage holt die Lebenswelt der Schüler*innen in das Schulbuch: Zwillinge – gleich und doch verschieden : Eineiige Zwillinge schauen sich oft zum Verwechseln ähnlich. Dennoch sind sie individuelle Wesen. Auf diesem Bild essen die beiden gemeinam eine Wassermelone, sie haben eine ähnliche Frisur, ein sehr ähnliches Aussehen, aber sie blicken in andere Richtungen, vielleicht denken sie gerade an etwas Unterschiedliches, vielleicht, fühlen sie sich unterschiedlich wohl, haben unterschiedliche Wünsche,… Kinder mit bunten Tüchern (Pfingsten): Hier sieht man einen Ausschnitt aus einer gottesdienstlichen Feier, in der gemeinsam gesungen und mit Chiffontüchern getanzt wird. Erstkommunion, aber auch pfingstliche Freude wird sichtbar. Es zeigt sich, dass der Geist Gottes verbindet, Gemeinschaft und Freude schenkt. Würfel mit Begrüßungen in unterschiedlichen Sprachen: Die Sprachen, die hier auf den Würfeln sichtbar werden, sind: Bonjour- französisch, Hello – englisch, Ciao –italienisch, Aloha – hawaianisch, Hallo – deutsch, Hej – schwedisch, Ni Hao – chinesisch, Salut - französisch, Hola – spanisch. Gemeinsames Essen: Ein Tisch voller bunter Speisen, Früchte, Gemüse … verbindet hier unterschiedliche Menschen, die miteinander essen. Gerade das Essen offenbart auf unseren Tischen oft die Zusammengehörigkeit und Vielfalt der ganzen Welt. Gemeinsam essen verbindet. Die bunte Vielfalt regt an nachzudenken, woher die Speisen kommen, welche Menschen hierfür gearbeitet haben usw. Orchester „Verschiedene Instrumente, ein Lied“: Kinder spielen hier mit unterschiedlichen Instrumenten. Jedes klingt anders, doch zusammen ergeben sie einen gemeinsamen und harmonischen Klang. Gerade das Zusammenklingen von unterschiedlichen Instrumenten macht die Musik interessant und schön. So ist es wohl auch in menschlichen Gemeinschaften. Kinderhände: Unterschiedlichste Kinder stehen in einem Kreis zusammen, halten ihre Hände in die Mitte. Sie fühlen sich in ihrer Unterschiedlichkeit als Gemeinschaft, sie feuern sich an und – wie oft vor einem sportlichen Wettkampf sichtbar – verbinden sie sich, um sich zu motivieren, zu stärken und sich selber anzufeuern. Die gemeinsame Mitte verbindet. Das Bild in der Mitte zeigt Menschen aus der Vogelperspektive, die sich in ihrer Buntheit und Unterschiedlichkeit wie in einer Spirale verbinden und miteinander tanzen. Es ist somit ein Hoffnungsbild, das die Menschen der Welt verbindet und – im Gegensatz zu Krieg und Ausgrenzung – in einem friedlichen Miteinander zeigt. Im Schatzkästchen ist Platz für Dinge, die gemeinsam getan werden können, die gerade im gemeinsamen Tun Spaß und Freude machen oder auch schwierig sind. Der Satz „Wir sind geheimnisvoll verbunden …” verweist auf Gemeinsames und Verschiedenes im Zusammenhang mit Pfingsten: Wir sind in unserer Verschiedenheit geheimnisvoll verbunden im Atem und Geist Gottes. Beim Pfingstfest in Jerusalem können sich alle anwesenden Menschen trotz verschiedener Muttersprachen miteinander verständigen. Der Satz verweist auf die Erfahrung vieler Menschen, dass es trotz Unterschiedlichkeit oft ein Verstehen und Verbundensein gibt und deutet auch die Bilder von der linken Buchseite in einem christlichen Kontext: Dort, wo Menschen sich verbinden, wo Unterschiedlichkeit nicht tennt, sondern ein Miteinander gelebt
wird, wird geheimnisvoll der Geist Gottes spürbar und sichtbar. Wesentliche Bilder für den Heligen Geist sind der Atem, der uns belebt, das Feuer, das in uns brennt und Freude und Begeisterung bewirkt, und die wirkmächtige Kraft, die uns antreibt und verändert.
Der QR-Code führt zu einem Pfingstlied
Der Bibeltext „Die Liebe ist …“ nach Kol 3,14 stammt von Paulus aus dem Brief an die Kolosser. „Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält” führt in die religiöse Tiefendimension von Gemeinschaft: die Liebe ist letztlich das verbindende Band, von der es im 1. Johannesbrief heißt: Gott ist die Liebe.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bilder betrachten: Die Schüler*innen betrachten die Bilder und erzählen davon, inwiefern auf den Bildern etwas Gemeinsames, aber auch etwas Verschiedenes zu entdecken ist. Des Weiteren geht es auch darum zu erkennen, dass sich die Unterschiedlichkeit von Menschen nicht nur auf visueller Ebene ergibt und das Verschiedensein als Normalität zu betrachten ist.
Von Verschiedenheit erzählen: Die Schüler*innen können davon erzählen, wo sie selbst Verschiedenheit erleben bzw. inwiefern diese eine Bereicherung oder Herausforderung ist.
„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ singen und gemeinsam musizieren: Um die Botschaft des Liedes noch deutlicher auszudrücken, kann mit den Kindern gemeinsam musiziert werden. Alle Schüler*innen spielen unterschiedliche Orff- und Rhythmusinstrumente und bilden so gemeinsam einen Klangkörper. Jede*r kann sich einzigartig einbringen und mitmachen. Die Erzählungen „Kommt, ich mag es bunt“ und „Komm, nimm meine Hand“ vorlesen und besprechen.
6 | … und noch mehr Ideen
Dance and Draw: Einen langen Papierstreifen auf den Boden oder eine Tischreihe legen. In Abständen Stifte zum Malen bereitlegen. Alle Schüler*innen bewegen sich zur Musik um das Papier herum. Sobald die Musik stoppt, nimmt sich jedes Kind einen naheliegenden Stift und beginnt zu malen. Nach kurzer Zeit des Malens beginnt und pausiert die Musik erneut. So entsteht ein buntes Gemeinschaftsbild. Gemeinschaftsbild gestalten: Aus vielen einzelnen Bildern kann sich ein Gesamtbild ergeben, oder die Schüler*innen gestalten auf einem großen Papier ein gemeinsames Bild zu einem vorgegebenen Thema (z. B. unsere Glücksschule). Eine andere Möglichkeit ist ein

Gemeinschaftsbild z. B. zum Thema „Wir sind ein super Team”. Alle Schüler*innen bekommen hierzu die Vorlage für ein Trikot und dürfen dieses nach ihrem Geschmack gestalten. Aus den einzelnen Trikots entsteht ein Plakat, welches in der Klasse aufgehängt werden kann. Feedback-Hände: Jedes Kind paust auf einem A4-Papier seine beiden Hände ab und schreibt seinen Namen auf das Blatt. Die Blätter mit den Händen und Namen der Kinder werden in der Klasse verteilt. Jetzt gehen die Kinder herum und schreiben oder zeichnen zu einigen oder allen Kindern in die jeweilige Hand: Ich mag an dir …, du kannst gut …, Mir gefällt an dir … usw. Anschließend bekommt jedes Kind sein Blatt zurück und darf sich über die wohltuenden Rückmeldungen der Klassenkolleg*innen freuen.
Strophen erfinden: Für das Lied „Du bist du und ich bin ich” passende Strophen finden, die zu den Schüler*innen der Klasse und zur Melodie des Liedes passen.
7 | Kinderbücher
Brooks, F. (2021). Alle anders, das sind wir. Usborne.
Fromme-Seifert, V., Kamcili-Yildiz, N., Poritzki, S. (2018). Miteinander beten. Die schönsten interreligiösen Gebete. Don Bosco.
John, J., Smith, L. (2019). Roberta und Henry. Carlsen.
Köhnen, M., Hoefs, H. (2017). Ferdinand sucht seinen Ton. Ullmann.
Lionni, L. (2006). Seine eigene Farbe. Julius Beltz.
Lobe, M. (2019). Das kleine Ich bin Ich. Jungbrunnen.
Motschiunig, U. (2020). Wie schön, dass wir uns haben, kleiner Fuchs! G&G.
Murray, M., Kai, H. (2020). Wir sind gleich und doch verschieden. Gabriel.
Weniger, B., Tharlet, E. (2016). Einer für Alle – Alle für Einen! Minedition.
8 | Lieder
Das alles steckt in mir LB Religion Nr. 12
Du bist du und ich bin ich T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Du bist ein Ton in Gottes Melodie LB Religion Nr. 67
Kunterbunt ist Gottes Garten LB Religion Nr. 65
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn LB Religion Nr. 9
9 | Schnappschüsse

In Liebe verbunden ➜ Schreibe die Namen von Menschen, mit denen du in Liebe verbunden bist, in die Herzen oder zeichne sie hinein. Du kannst auch noch weitere Herzen dazuzeichnen oder mehrere Namen in die Herzen schreiben. Gestalte auch das Band, durch das die Herzen verbunden sind.
In Liebe verbunden … Schreibe die Namen von Menschen, mit denen du in Liebe verbunden bist, in die Herzen oder zeichne sie hinein. Du kannst auch noch weitere Herzen dazuzeichnen oder mehrere Namen in die Herzen schreiben . Gestalte auch das Band, durch das die Herzen verbunden sind. „D ie Liebe ist das Band, da s alles zusammenhält.“

Nach Kolosser 3,14
Komm, nimm meine Hand
Komm, nimm meine Hand
In der Schneiderstube liegen zwischen Fingerhüten, Nadeln, Knöpfen und Stoffen Hunderte von bunten Fäden. Dicke, dünne, feine und feste. Rosarote, purpurrote, gelbe, orange, türkise und alle anderen Farben, die man sich denken kann. Einer glänzt sogar wie Silber und ein anderer wie Gold. Nachts fegt manchmal ein Windstoß durch das kaputte Fenster herein. Das ist eine echte Katastrophe. Besonders, wenn man so federleicht ist wie ein Faden. Kreuz und quer wirbelt der Wind sie durch die Stube. Sie haben keinen Halt. „Wäre ich doch so stark wie du!“, sagt ein Wollfaden zur dicken, roten Kordel, „dann hätte ich bestimmt mehr Kraft gegen den Wind.“ „Komm, nimm meine Hand!“, sagt die rote Kordel, „zu zweit sind wir stärker!“ „Oh! Das dürfte ich tatsächlich machen?“, zögert der Wollfaden. „Aber ja!“, sagt die Kordel und streckt ihm gleich eine Hand entgegen. „Das ist ein gutes Gefühl!“, sagt der Wollfaden. „Wenn du mich hältst, bin ich sicher!“ Er hält sich an der Kordel fest. Er will sie gar nicht mehr loslassen und macht mit seinem weichen Händchen einen festen Knoten in die Kordel. Daran hatte bisher noch keiner gedacht! „Super Idee!“, rufen die Fäden und schauen sich gleich neugierig um. Bald hat jeder einen anderen entdeckt, dem er seine Hände reichen will. Ein alter, grauer Wollfaden fragt den gelben: „Kann ich dir meine Hand reichen? Du lässt mich an die Sonne denken!“ „Gerne!“, sagt der gelbe Faden und streckt ihm sein feines Händchen entgegen. „Auch ich mag deine Farbe so sehr!“, sagt dann ein schwarzer zu dem gel ben Faden. „Meine zweite Hand ist noch frei!“, sagt der gelbe. Jetzt leuchtet sein Gelb zwischen dem Grau und dem Schwarz sogar noch besser als vorher. So fügt sich einer zum anderen. Die alte, zerfranste Schnur strahlt zwischen dem goldenen Stück Garn und einem orangen Faden. Die silberne Kordel hat einem grünen und roten Wollfaden ihre Hände gereicht. Der grüne Wollfaden einem türkisen. Und der türkise der himmelblauen Schnur. Und die himmelblaue Schnur… Schließlich haben sich alle zu einer langen Kette zusammengeschlossen. Nein, nicht alle! – die zarten Zwirne sind übrig geblieben. Sie sind so fein und so dünn, dass man sie fast übersieht. Und sie sind so leicht wie die Luft. Kein Wunder, dass sie der Wind besonders schnell fortwirbelt. Kein Wunder, dass die Zwirne so ängstlich sind. „Und was ist mit uns?“, fragt ein Stück Zwirn schüchtern und leise. „Ihr habt eine ganz besondere Aufgabe!“, spricht der türkise Wollfaden. „Ich sage euch, was ihr tun sollt: Die ganze Kette stellt sich jetzt wie eine Spirale auf. Wie ein Schneckenhaus soll es aussehen.“ Alle folgen gehorsam. Sie formen eine wunderschöne, große Fadenspirale. „Jetzt marschieren die Zwirne im Gänsemarsch in die Spirale hinein!“ sagt der Türkise. „Vom Anfang bis zum Ende sollen sich die Zwirne schön gleichmäßig aufstellen. Dann hält sich jeder Zwirn mit beiden Händen links und rechts an der Spirale fest.“ Die Zwirne sind schrecklich aufgeregt. Schnell huschen sie zwischen die Fadenreihen. Genau so, wie der Türkise es gesagt hat. Jeder Zwirn fasst mit beiden Händen einen Faden links und rechts von ihm und hält sich ganz fest. So halten die zarten Zwirne alles und alle zusammen. Am Ende hat jeder seinen Platz. Jeder ist wichtig. Ohne ihn wäre irgendwo ein richtiges Loch. Wenn einer schwach und müde ist, dann spüren es die anderen sofort. Sie ziehen ihn hoch und richten sich auf. Und wenn einer sich freut, spüren es alle. „Wir hängen jetzt alle zusammen!“, ruft der türkise Faden. „Wie ein einziger Körper sind wir.“ Als der Wind das nächste Mal in die Stube hineinhuscht, halten sie sich ganz, ganz fest an den Händen, noch fester als sonst. Sie spannen das Netz und lassen den Wind einfach hindurchsausen.
Komm, nimm meine Hand
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, Heft 01 2018

Kommt, ich mag es bunt
Kommt, ich mag es bunt
Ein kleiner Pinsel freut sich schon sehr darauf, ein buntes Bild zu pinseln. In der Farbschachtel sind aber nur drei Farben. Wie soll er jetzt ein buntes Bild malen? Oder geht es vielleicht doch?
Es ist still im Haus, denn Klara macht zusammen mit ihrer Familie einen Ausflug. Doch in Klaras Zimmer herrscht große Aufregung. „Na, was ist denn jetzt mit euch? Macht doch endlich auf!“ Am Schreibtisch von Klara wackelt der Farbpinsel aufgeregt hin und her. Er hüpft zu den Wasserfarben. „Macht doch endlich auf“, sagt der Pinsel zu den Farben und klopft dabei auf den Schachteldeckel. Doch es kommt keine Antwort. Erneut versucht es der Pinsel und sagt: „Seid doch keine Spielverderber. Ihr habt es mir gestern versprochen.“ Traurig steht er neben den Wasserfarben, als er doch noch eine mürrische Stimme hört. „Na gut, wenn es unbedingt sein muss“, spricht die Stimme in der Farbbox. „Hurra“, denkt sich der Pinsel, „endlich ist es so weit.“ Der Deckel geht auf und voller Neugier schaut der Farbpinsel hinein. Er kann es k aum erwarten. Doch, was sieht er da? „Ihr seid ja nur drei Farben hier in der Schachtel. Wie soll ich denn da ein Bild pinseln? Das ist ja viel zu wenig.“ Enttäuscht dreht sich der Pinsel um. „Na hör mal“, kommt es mürrisch aus der Farbbox zurück. „Jetzt haben wir uns solche Mühe gegeben, den Deckel zu öffnen, und was machst du?“ „Drei Farben sind doch wohl mehr als genug“, sagt die Gelb. „Jawohl“, betont auch die Blau. „Komm her, kleiner Pinsel“, sagt schließlich die Rot. „Du wirst es schon sehen!“ Der kleine Pinsel will eine Wiese malen. Aber wie soll er das ohne grüner Farbe tun? Gelb und Blau beginnen zu lachen. „Komm her!“, sagten sie. „Zuerst hüpfst du in Gelb und dann gleich in Blau.“ Der Pinsel folgt den Anweisungen. Er mischt sich in beide Farben und rührt seine Borsten kräftig hin und her. Dann beginnt er zu malen. „Wie ist das möglich?“, will er wissen. Eine wunderschöne grüne Farbe ist entstanden. Nun kann der Pinsel die Wiese malen. Er möchte auch noch eine violette Blume zeichnen. „Kein Problem“, sagen die Farben. „Hüpf einfach in Rot und Blau!“ Zu guter Letzt mischt der Pinsel noch Gelb und Rot. Dabei entsteht ein schönes Orange und damit malt er noch einen Sonnenuntergang.
Der Pinsel ist sehr zufrieden mit seinem Bild. Trotzdem ist es plötzlich g anz still. „Was ist mit dir los?“, will Rot wissen. „Ich habe gedacht, aus drei Farben kann ich kein Bild malen. Jetzt habe ich gesehen, wenn jede Farbe etwas von sich gibt, kann viel mehr daraus entstehen. Mein Bild ist schön bunt! Nun weiß ich, dass im M iteinander viel Buntheit entstehen kann!“ Die Farben nicken und alle beginnen laut zu lachen!
Kommt, ich mag es bunt
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, Heft 01 2020/21

Was dem Miteinander gut tut –Was Menschen sich wünschen
Seiten 110 und 111 im Schulbuch | Kapitel 7
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Bunt zusammengewürfelt treffen Kinder in der ersten Klasse aufeinander. Daraus soll ein Miteinander entstehen, welches für alle Kinder, Lehrer*innen, Eltern, etc. gut lebbar ist und ein lernfreundliches Klima erzeugt. Im Laufe des ersten Schuljahres wird mit vielen Auf und Abs, großen und kleinen Entwicklungsschritten – unter starker Mithilfe der Lehrperson – einiges an gemeinschaftlichem Erfahrungsraum eröffnet. So kann das Miteinander wachsen und zum sozialen Lernen beitragen. Was zunächst alle vereint, ist der Wunsch, dass das Miteinander-Leben und das Miteinander-Lernen gelingen möge und grundsätzliche Regeln der Achtsamkeit und Wertschätzung eingehalten werden. Intuitiv wird man sich vermutlich im Sinne einer praktischen Ethik an der vielen Religionen gemeinsamen „Goldenen Regel“ orientieren, die auch im Evangelium nach Matthäus zu finden ist: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.” (Mt 7,12). So fasst Matthäus in seinem Evangelium die ganze Ethik zusammen. Der Lehrplan sieht als Unterrichtshinweis vor, dass sich die Kinder mit möglichen und erwünschten Regeln des positiven Zusammenlebens in der Klasse auseinandersetzen und diese erkennen, bestenfalls auch bewusst umsetzen können. So soll das Wir gestärkt werden, was sicherlich nicht für alle Kinder der ersten Schulstufe immer ganz einfach sein wird. Zumindest können die bisherigen positiven und auch negativen Erfahrungen im Zusammenleben in der Klasse reflektiert und die Wünsche der Kinder, was sie brauchen, um sich in der Gemeinschaft wohlzufühlen – wie manche auch in den Sprechblasen der rechten Seite zu finden sind – dazu geäußert und besprochen werden. Allein das Äußernkönnen und Besprechen bestärkt die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen der Kinder.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben … welche Regeln des Zusammenlebens es gibt. … welche Bedürfnisse sie für das Zusammenleben haben. verstehen und deuten … inwiefern und welche Regeln bedeutsam sind. gestalten und handeln
… Klassenregeln erstellen und befolgen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was sie brauchen und was andere brauchen. entscheiden und mit-tun … so verhalten, dass sich andere und man selbst wohlfühlt.
3 | Lernanlässe
★ Atmosphäre in der Klasse (ruhig, unruhig …)
★ Wünsche der Kinder z. B. für die Klasse, Familie usw. ★ Erwartungen die an andere gerichtet sind
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Im Bild „Dynamisches Miteinander“ auf der linken Seite schwirren viele kleine Punkte und Striche herum. Manche vereinzelt, manche verbunden, manche wie in einem Knäuel aneinander gedrängt. Bunt und unterschiedlich vernetzt. Von links nach rechts kommt es zu einem stärkeren Miteinander. So wie wohl auch bei Kindern einer Schulklasse. Es braucht Zeit, bis die bunten einzelnen Kinder Beziehung aufnehmen. Es braucht Zeit, bis eine größere Gemeinschaft entsteht. Aber alles ist und bleibt in Bewegung. Die bunten Punkte und Striche können sich immer wieder neu formieren. Gemeinschaft in Vielfalt ist nichts Statisches, sondern ist dynamisch, und das Miteinander ist ein spannender Prozess.
Das Gedicht „Einander verstehen” zeigt die positive Kraft des Miteinander auf. Wo Menschen nicht nur vereinzelt und einsam, sondern gemeinsam gehen und handeln, können sie die Welt verändern. Wenn Kinder im Lebensraum miteinander lernen, leben, spielen … und gut miteinander umgehen, ist die Welt für sie in Ordnung. Das ist wohl das, was jedes Kind sich in einer Klassengemeinschaft wünscht. Der Junge und die Sprechblasen weisen darauf hin, dass es dem Miteinander in der Schule gut tut, wenn gewisse Umgangsformen und Regeln eingehalten werden. Dabei ist es wichtig zu lernen, seine Bedürfnisse zu nennen, zu sagen, was für eine*n gut oder nicht o.k. ist, gemeinsam zu überlegen, wie alle gut miteinander leben und lernen können. Eine Sprechblase ist leer. Sie ist der Hinweis, in Bezug auf die eigenen Klassensituation weiterzudenken.
Im Schatzkästchen haben Kinder ganz individuell die Möglichkeit, für sich zu überlegen, was sie sich in der konkreten Klassengemeinschaft wünschen bzw. was sie brauchen, damit es ihnen gut geht, was sie nicht wollen, weil es ihr Lernen und ihr Wohlfühlen stört.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Schatzkästchen & Sprechblase befüllen: Selbst einen Satz zur Frage, was dem Miteinander allgemein gut tut, in die Sprechblase schreiben. Durch die bereits befüllten Sprechblasen erhalten die Kinder Ideen, in welche Richtung es gehen könnte. Des Weiteren ist im Schatzkästchen Platz, um auszufüllen, was man sich vom Miteinander wünschen würde bzw. was man braucht, um sich wohlzufühlen. Dabei wird konkret auf das Miteinander in der Klasse eingegangen. Mitteilen, was ich mir wünsche, was ich brauche: Dabei wird darauf geachtet, dass alle einander zuhören, denn Zuhören ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das, was man sich für sich selbst wünscht, auch bei anderen anwendet. Die Wünsche werden nicht an spezielle Kinder (mit Namen) gerichtet, sondern allgemein formuliert. Wünsche und Bedürfnisse können auch auf kleine Zettelchen geschrieben und in der Klasse aufgehängt werden.
Legearbeit „Wir sind verbunden“: Verschiedene Materialien (z. B. Knöpfe, Hölzchen, Stifte und Gegenstände aus der Federschachtel usw.) auflegen und ein Bild entstehen lassen, welches ähnlich dem Bild auf der Doppelseite ist. Jedes Kind kann z. B. einen Knopf und mehrere Hölzchen auswählen. Der Knopf gilt als Symbol für mich und die Hölzchen dienen dazu, mich mit anderen zu verbinden. Dabei reflektieren die Schüler*innen, wie sie in die Klasse eingebunden sind (z. B. nur zu einem anderen Kind oder zu vielen? Wie viele Hölzchen
brauche ich? usw.). Es könnte auch als Einzelarbeit jede Schüler*in versuchen, aus den Materialien der eigenen Federschachtel oder Schultasche das Miteinander in der Klasse aufzulegen. Collage gestalten & besprechen: Was wir an unserem Miteinander positiv erleben, könnte das Thema einer Collage sein, welche auch eine Klassenwand oder eine Heftseite zieren könnte. Gemeinsam kann bei der Betrachtung das Erzählen der positiven Erlebnisse im Vordergrund stehen.
Arbeitsblatt „Regeln für ein gutes Miteinander”: Die Schüler*innen überlegen im ersten Schritt, welche der genannten Regeln in der Schule Sinn ergeben und welche nicht. Anschließend können die Ergebnisse verglichen und besprochen werden. In einem zweiten Schritt können sie noch weitere für sie wichtige Regeln aufschreiben. Gemeinschaftsbild gestalten: Die Schüler*innen in Kleingruppen einteilen und sie dazu anleiten, gemeinsam ein Bild zu malen. Thematisch gesehen könnte man hier etwas vorgeben oder der Fantasie der Kinder freien Lauf lassen. Beipiele für Vorgaben wären: Malt einen Ort, wo ihr gerne gemeinsam wärt, zeichnet eine Glücksschule …
6 | … und noch mehr Ideen
Mit Gott über Wünsche sprechen: Es wird ein gemeinsames Gebet eingeleitet, in dem die Schüler*innen eine stille Zeit haben, in der sie ihre eigenen Wünsche und Bitten an Gott richten können, entweder im Stillen daran denken oder laut sagen. Gemeinsam lässt man das Gebet schließlich enden. Wichtig ist, das Bewusstsein zu transportieren, dass es beim Beten nicht darum geht, etwas zu „bestellen”, sondern vielmehr darum, mit Gott in Kommunikation zu kommen und von ihm gehört, aber nicht zwangsläufig erhört zu werden. Miteinander spielen und sich an Regeln halten: Insbesondere Spiele, die das Teambuilding fördern, können hier gespielt werden, aber auch das freie Spielen untereinander hat einen positiven Einfluss auf die Sozialkompetenzen der Schüler*innen.

Der fliegende Teppich: Alle stehen auf einer Decke, diese soll nun gewendet werden, ohne dass jemand hinuntersteigen darf. Als Variation kann z. B. verboten werden, dass miteinander geredet wird usw. Großes Tuch mit Ball in der Mitte: Alle Kinder halten das Tuch an den Rändern fest – das Tuch muss immer ausreichend gespannt und darf nicht schief gehalten werden, weil der Ball sonst hinunterfällt. Dreibein-Parcours: Jeweils zwei Schüler*innen wird ein Bein zusammengebunden. Sie sollen so miteinander gehen, indem sie sich aufeinander einstellen (Tempo, Schrittgröße etc.). Zuerst einfaches Gehen üben, schließlich können Hindernisse eingebaut werden. Schubkarrenrennen: Jeweils zwei Schüler*innen bilden ein Team. Ein Kind gibt die Hände auf den Boden und geht mit diesen, während das zweite Kind die Beine des Kindes hält und hinter diesem geht. Wenn die Kinder das etwas geübt haben, kann ein Rennen veranstaltet werden: Welches Paar schafft es am schnellsten, am langsamsten, usw.? Kinderbuch „Das kleine WIR“ vorlesen und ein Plakat mit Wünschen und Bedürfnissen der Kinder gestalten
7 | Kinderbücher
Kunkel, D. (2016). Das kleine WIR. Carlsen.
Kuo, J. (2022). Zusammen. Zuckersüß.
Pfister, M. (2012). Der Regenbogenfisch stiftet Frieden. NordSüd.
8 | Lieder
Du bist du und ich bin ich T./M. v. K. Mikula: www.mikula-kurt.net
Kunterbunt ist Gottes Garten LB Religion Nr. 65
Mit einem/r Freund/in an der Seite LB Religion Nr. 66
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn LB Religion Nr. 9
9 | Schnappschüsse

Regeln für ein gutes Miteinander
Regeln für ein gutes Miteinander
➜ Kreuze an, welche Regeln für ein gutes Miteinander in der Schule gelten. Schreibe weitere Regeln, die dir einfallen, auf.
Kreuze an, welche Regeln für ein gutes Miteinander in der Schule gelten sollten.
Wir machen alle, was wir wollen.
Wir teilen miteinander.
Wir arbeiten so laut es geht.
Wir schubsen alle, die uns auf die Nerven gehen.
Wir sind freundlich zu anderen.
Wir grüßen.
Wir sind so leise, dass alle gut arbeiten können.
Wir helfen anderen.
Wir rufen raus, wenn wir etwas brauchen.
Wir laufen in der Klasse.
Wir bitten freundlich um Hilfe.
Wir zeigen auf.
Wir nehmen uns einfach etwas von anderen.
Regeln für ein gutes Miteinander, die dir noch einfallen:
Gehalten werden und sicher sein – Lebenskraft: Vertrauen
Seiten 112 und 113 im Schulbuch | Kapitel 7
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Basis für ein gutes Zusammenleben bildet das Vertrauen zueinander, das Sicherheit gibt und positiv leben lässt. Das wird auf dieser Doppelseite in den Texten und Bildern thematisiert. Diese Doppelseite vertieft damit nochmals die Ansätze in den Seiten davor und kommt ins Zentrum dieses Kapitels: das Vertrauen als Lebenskraft – Vertrauen in die Menschen um mich, Vertrauen in mich selbst, Vertrauen ins Leben und in die „Welt”. Die „Lebenskraft Vertrauen” hat zunächst ihre Wurzel in einer sicheren Bindung am Beginn ihres Lebens, die durch die ersten Bezugspersonen gespiegelt und erfahren wird und so etwas wie ein Urvertrauen ins Leben ermöglicht. (John Bowlby 2018:Bindung als sichere Basis). Im schulischen Kontext wird diese Bindung gestärkt, da das Kind erlebt, welche Sicherheit und welchen Schutz auch die Lehrkraft geben kann, wenn es schwierig wird und Herausforderungen anstehen. Dadurch wird das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die Welt gestärkt. Alles Lernen vom Gehen, Laufen, Radfahren, Klettern – wie in den Bildern angedeutet – hängt eng mit Vertrauen und Zutrauen zusammen, das zunächst darin gründet, dass einen jemand (unter-)stützt, ermutigt, fördert … und das Vertrauen in einen selbst stärkt.
Für religiöse Menschen liegt die tiefste Wurzel des Vertrauens in Gott selbst, den wir nach den Worten Jesu mit „Abba – guter Vater” ansprechen dürfen, was selbst schon ein Ausdruck des Vertrauens ist, weil dieser Lalllaut im Aramäischen, der Sprache Jesu, der Ausdruck dafür ist, wie das kleine Kind seinen Vater anredet: Papa. Schon in den Texten der Psalmen des Alten Testamentes – angedeutet im Gebet – wird die Kraft des Vertrauens besungen: Mit dir Gott überspringe ich Mauern, mit dir wird alles möglich.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wann Vertrauen wichtig ist. … wie sich Vertrauen anfühlt. verstehen und deuten
… was Vertrauen ist, wann es notwendig und hilfreich ist.
… wem Vertrauen geschenkt wird und warum. gestalten und handeln
… Vertrauensübungen machen und reflektieren. (be-)sprechen und (be)urteilen
… was es braucht, damit man vertrauen kann. … wann manchmal auch Misstrauen sinnvoll sein kann. Entscheiden und mit-tun … im Vertrauen (auf andere Menschen und ggf. Gott) leben. … für Vertrauen gemeinsam (singend) beten.
3 | Lernanlässe
★ Vertrauenserlebnisse
★ Vertrauen wird gebrochen
★ Wir lernen uns besser kennen und vertrauen einander
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Der Text vom Raben Felix thematisiert als Lernanlass das Grundbedürfnis, geliebt zu werden und vertrauen zu können. Für Kinder und für Erwachsene gilt gleichermaßen, dass die Erfahrung, geliebt zu werden, Flügel verleiht, dass wir dort, wo wir Vertrauen geschenkt bekommen, über uns selbst hinauswachsen. Der Rabe dreht den Gedanken aber nochmals um: Vertrauen ist nicht nur etwas, das mir möglicherweise und hoffentlich geschenkt wird. Es ist auch ein Segen, wenn ich vertrauen kann. Vertrauen, dass ich gehalten bin und dass letztlich alles gut ist. Trotz der Brüche und Begrenztheiten. Theologisch würde man das Geschenk des Vertrauens als „Gnade” bezeichnen.
Das Schatzkästchen lädt ein, dass die Kinder hineinschreiben oder zeichnen, wem sie vertrauen können. Es ist eine Stärkung der persönlichen Ressourcen, wenn man sich bewusst wird, dass man gehalten und sicher ist, weil es jemanden gibt, der oder dem man vertrauen kann.
Die Fotos zeigen unterschiedliche Beispiele, wo es notwendig ist, dass man vertrauen kann. Seien es Menschen, die Eltern, die Lehrer*innen … sei es das sichere Seil, das hält und auffängt, oder sei es eine Kombination von Können und dem Zusammenspiel mit anderen Menschen.
Das Gebet „Gott, dir …“ nimmt ein Motiv vom Psalm 18 auf und bettet die Bildsprache des Psalms in die Sprache unserer Zeit ein. So wie es hier steht, ist es ein Angebot: Menschen beten, nicht wir alle müssen es beten. Die einzelnen Kinder können vom Beten anderer Menschen lernen, können darüber nachdenken und vielleicht auch selber vertrauensvoll beten.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Gemeinsam Vertrauensspiele spielen: Die essentielle Botschaft dieser Spiele lautet: „Ich kann mir sicher sein, ich darf vertrauen“. Den Kindern genau erklären, welche Verantwortung sie füreinander tragen und dass sie wirklich dafür sorgen sollen, dass sich ihre Partner*innen auf sie verlassen können, indem sie sich an die Regeln halten und auf jeden Fall eingreifen, bevor etwas passiert. Es bietet sich an, die Spiele zuerst an geräumigen Orten (Turnsaal, Aula, Schulhof) zu spielen, wenn die Kinder geübter sind, kann auch in der Klasse oder mit Hindernissen gespielt werden. Auf jeden Fall ist auf Freiwilligkeit zu achten. Zuerst sollten Schüler*innen zusammen spielen, die sich selbst zusammenfinden, dann können auch von der Lehrperson Teams gebildet werden. Mögliche Spiele wären die folgenden: Blinder Parcours: Die Schüler*innen lassen sich blind von einem Kind zu einem Ziel führen. Lauf der Roboter: Ein Paar besteht aus einem Roboter und einem Programmierer. Die Roboter sind blind und werden von dem Programmierer entweder durch Ansagen jedes nächsten Schrittes oder durch berühren der jeweiligen Schulter und z. B. leichtes Klopfen, wie viele Schritte gegangen werden sollen, zu ihrem Ziel geführt.
Vertrauensspiele reflektieren: Wie ist es einem bei den Spielen
ergangen? War es schwierig/leicht anderen zu vertrauen? usw. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Schüler*innen nicht unbedingt Namen nennen oder verallgemeinern und z. B. sagen „X kann ich nicht vertrauen.“
Schatzkästchen befüllen: Kinder zeichnen oder schreiben in das Schatzkästchen, wem sie vertrauen – das können auch Personen außerhalb der Klasse sein.
Arbeitsblatt „Vertrauen“ ausfüllen: Die Schüler*innen beantworten durch das Ausfüllen des Arbeitsblattes für sich persönlich Fragen wie, welche Formen und Farben für sie zum Vertrauen passen bzw. wie Vertrauen für sie ist, wobei sie Analogien finden können, z. B. Vertrauen ist wie eine kuschelige Decke …, Vertrauen schmeckt wie …, Vertrauen riecht wie …, Vertrauen fühlt sich an wie …, Vertrauen klingt wie …, Vertrauen schaut aus wie … Außerdem können sie Menschen aufzählen, denen sie vertrauen. Vertrauenssätze vervollständigen: Ich verlasse mich auf dich, weil …, Ich vertraue dir, weil …, Vertrauen ist für mich wichtig, weil …, Vertrauen ist schwierig, wenn …, u. v. m.
6 | … und noch mehr Ideen
Gemeinsam eine Jause machen und miteinander essen: Eine Jause wird zusammen hergerichtet, z. B. indem miteinander Brote mit Butter beschmiert und darauf Schnittlauch (ggf. aus dem Schulgarten) verteilt werden. Dann kann die Jause bewusst gemeinsam gegessen werden.
Gemeinsam einen tollen Ausflug machen. Gemeinschaft erleben: Einen Ausflug, eine Schnitzeljagd, eine Wanderung … machen, um die Beziehungen unter den Schüler*innen

zu stärken. Dabei könnte es auch verschiedene Herausforderungen zu bewältigen geben, die Zusammenarbeit und Vertrauen erfordern. Auch verschiedene Teambuilding-Spiele eigenen sich hier gut, aber auch das freie Spielen stärkt die Gemeinschaft.
Klassenwand oder Heftseite zur Gemeinschaft gestalten: Mit Bildern der Schüler*innen, ausgedruckten Fotos zu gemeinsamen Erlebnissen und z. B. Vertrauensspielen eine Wand gestalten. Auch Sätze der Schüler*innen über Vertrauen (siehe „Vertrauenssätze vervollständigen”) und Gegenstände, die damit verbunden werden, passen dazu.
7 | Kinderbücher
Melling, D. (2016). Alle lieben Paulchen. Oetinger.
Oziewicz, T. (2023). Vertrauen und Mut kennen sich gut. Knesebeck.
Prasadam-Halls, S. (2023). Ohne dich bin ich nicht ich. Oetinger.
8 | Lieder
Ich möcht, dass einer mit mir geht LB Religion Nr. 81
Mit einem/r Freund/in an der Seite LB Religion Nr. 66
Jesus ist bei dir LB Religion Nr. 264
Mit dir geh ich alle meine Wege LB Gotteslob Nr. 896
Mit meinem Gott, kann ich (Psalm 18) LB Religion Nr. 157
Voll Vertrauen LB „Du mit uns” Nr. 447
9 | Schnappschüsse








Vertrauen

Zeichne in die Felder ein oder schreibe, was für dich zum Vertrauen passt.
Vertrauen:

Diese
mich zum
Formen passen für

Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 114 und 115 im Schulbuch | Kapitel 7
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in diesem Kapitel beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …) sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und Schwierigkeitsgraden angeboten. Das letzte der vier Kästchen bietet Platz, neben dem Gelernten und Besprochenen auch das Persönliche, das individuelle Vertrauen in den Blick zu nehmen. Es geht letztlich darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken, welche Fragen neu generiert werden und auch, wo ihr eigenes Leben berührt ist.
Kapitelabschluss – spirituelle Vertiefung
Seite 118 im Schulbuch | Kapitel 7
Die Schlussseite bildet eine Seite der Vertiefung und des Verweilens. Das Gebet lädt zum Verweilen und zum Beten ein. Mit dem Gott des Lebens, des Aufblühens, der Buntheit können alle – jeweils in ihrer Einzigartigkeit – reden. Gott kennt jede und jeden beim Namen und hört und versteht.
Literatur zum 7. Kapitel
Bowlby, J. (2018). Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt Verlag. Fuchs, E. (2016). Mehrsprachigkeit – vom Sprachenreichtum in Österreichs Klassenzimmern. In: Kronberger, S./Kühberger, Ch./Oberlechner, M. (Hrsg.). Diversitätskategorien in der Lehramtsausbildung. Ein Handbuch, 258–270. Innsbruck: StudienVerlag. Grümme, B. (2017). Heterogenität in der Religionspädagogik. Grundlagen und konkrete Bausteine. Freiburg i. B.: Verlag Herder. Herold, A. (1979). Die Geschichte des Mangaliso. Würzburg: Verlag Echter.
Neuhold, H. (2016). Religiöse Vielfalt als Herausforderung und Chance. Interreligiöses Lernen – die angstfreie Bewusstheit von religiöser Differenz fördern. In: Kronberger, S./Kühberger, Ch./ Oberlechner, M. (Hrsg.). Diversitätskategorien in der Lehramtsausbildung. Ein Handbuch, 281–298. Innsbruck: StudienVerlag. Rosa, H. (2016). Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Verlag Suhrkamp. Schweitzer, F. (2014). Bildung. Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlag. Schweitzer, F. (2014). Interreligiöse Bildung. Religiöse Vielfalt als religionspädagogische Herausforderung und Chance. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen Heft 01 2018/19
Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen Heft 01 2020/21
KAPITEL 8: Sprechen und einander verstehen.
GEMEINSAM UNTERWEGS
Seiten 117 – 129 im Schulbuch
Impuls
Warum sprechen die Menschen verschiedene Sprachen? Warum verstehen die Menschen sich nicht und reden sogar in derselben Sprache aneinander vorbei?
Rainer Oberthür (2010, 22)
Allgemeine Hinführung
Wenn der Lehrplan den Kompetenzbereich A1 für die erste Schulstufe zum Themenbereich „Kommunikation”, der diesem Kapitel zugrunde liegt, dem großen Feld „Menschen und ihre Lebensorientierungen – Beziehungen verantwortungsvoll gestalten“ zuordnet, dann verweist dies darauf, dass es um anthropologisch zentrale Fragen der Kommunikation geht. Kommunikation bedeutet, sich ausdrücken zu können, sich mitteilen und miteinander teilen zu können, in den vielen unterschiedlichen Sprachformen, um sich mit anderen verständigen und verstehen zu können. Das Verstehen wiederum verweist schon auf eine tiefere Dimension, dass es eben dabei um Beziehung geht bzw. gehen kann. Deshalb wird in der Kommunikationspsychologie (Schulz von Thun) zwischen Inhaltsaspekt und Beziehungsaspekt unterschieden, aber auch durch die berühmten „vier Ohren des Hörens”(Schulz v.Thun 2011,49) auf die unterschiedlichen Aspekte und Intentionen der Hörenden eingegangen. So ergeben sich für gelingende Kommunikation Fragen wie: Wie spreche ich? Wie drücke ich mich (Gemeinschaft und Beziehung fördernd) aus? ... aber auch: Wie höre ich? Mit welchem Ohr höre ich? usw. Angestrebt wird durch die Hinweise auf die „Gewaltfreie Kommunikation” (A. Rosenberg 2007) ein Sprechen und Sich-Verständigen, das der Beziehung untereinander und Gemeinschaft dient, denn Sprache ist immer auch ein Beziehungsausdruck.
Theologisch schwingen im Hintergrund zwei Themen mit: einerseits gehören im christlichen Verständnis Beziehung und Kontakt zuinnerst zum Gottesverständnis: vom Anfang der Schöpfung an nimmt Gott Kontakt und Beziehung auf, spricht an, sucht im Menschen ein Gegenüber, schließt mit ihm einen Freundschaftsbund. Dies wird nochmals verdeutlicht im Johannesprolog und auf Jesus übertragen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So wird dann die Dreifaltigkeit Gottes auch Beziehungsgeschehen und als „inneres Gespräch” (Lehre von der Perichorese) beschrieben. Weil der ganze Kosmos von Anfang an von Gottes Atem und Geist durchatmet ist, wird er auch „antwortend” erlebt. „Religion kann dann verstanden werden als die in Riten und Praktiken, in Liedern
und Erzählungen, zum Teil auch in Bauwerken und Kunstwerken erfahrbar gemachte Idee, dass dieses Etwas ein Antwortendes, ein Entgegenkommendes – und ein Verstehendes ist. Gott ist dann die VorstellungeinerantwortendenWelt.”(Rosa2016,435).So schwingt in all dem auch das pfingstliche Thema und Sprachenwunder – die Menschen aus allen Völkern können sich trotz unterschiedlicher Sprachen verstehen – mit.
Lehrplanbezüge des 8. Kapitels
Kompetenzbereich | A1b Menschen und ihre Lebensorientierung Leitkompetenz | Beziehung verantwortungsvoll gestalten können – zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung.
Kompetenzbeschreibung | Die Schüler*innen können verschiedene Ausdrucks- und Kommunikationsformen wahrnehmen und anwenden.10
Unterrichtshinweise | Sprache(n) in ihrer Vielfalt, Körpersprache, unterschiedliche Kommunikationsmittel, gewaltfreie Kommunikation.
Zuordnung – Zentrale fachliche Konzepte:
Lebensrealitäten und Transzendenz: Christlicher Glaube versteht den Menschen in seiner Biografie und in seinen Lebensbezügen als transzendentes Wesen und erschließt Wege der Sinnfindung durch den Transzendenzbezug.
FreiheitundOffenbarung: Quellen der Offenbarung sind die Bibel und die kirchliche Tradition in ihrer Vielfalt. Auf der darin grundgelegten Freiheit des Menschen basiert die Achtung der Religionsfreiheit jeder Schülerin und jeden Schülers.
Zusage und Verantwortung: Ausgehend vom Verdankt-Sein allen Lebens wissen sich Christ*innen beauftragt und befähigt, Verantwortung in der Welt zu übernehmen Dabei leiten sie Hoffnungsperspektiven, die auf biblischen Zusagen aufbauen.
Bezüge zu fächerübergreifenden Themen laut Lehrplan
★ 10 Sprachliche Bildung und Lesen
Titelseite: Sprechen und
einander
verstehen. Gemeinsam unterwegs
Seite 117 im Schulbuch | Kapitel 8
Das Titelbild zeigt zwei Kinder, die gemeinsam unterwegs sind. Sie sind auf einer kleinen Straße im ländlichen Raum unterwegs. Einer legt die Hand um die Schulter des anderen. Entspannt, frei und doch geborgen sind sie unterwegs. Sie tragen die gleiche Kappe, beide haben einen Rucksack. Was sie wohl die ganze Zeit miteinander reden? Worüber sie nachdenken, worüber sie lachen, welche Pläne sie schmieden? Die Körpersprache sagt uns, dass sie sich verstehen und einander vertrauen. Sie sind im Einklang mit sich und mit der Natur, in der sie – einer mit Schuhen, der andere barfuß – unterwegs sind. Sprechen und einander verstehen, so lassen sich (Lebens-) wege gut gehen.
Schätze entdecken zeigt im Sinne eines kompetenzorientierten Lernens auf, wohin die inhaltliche Reise bzw. Schatzsuche in die-
sem Kapitel geht, also in welchen Themenbereichen Kompetenzen erworben werden können. Dabei sollen die Dimension der Mitwelt und die Dimension des Inneren berührt werden.
Möglichkeiten für die Arbeit mit der Titelseite
Bildarbeit: Das Bild anschauen und beschreiben. Den Kindern Stimmen geben und sie miteinander reden lassen. Worüber reden sie? Was erzählen sie sich? Was besprechen sie? Welche Pläne schmieden sie?
Rollenspiel in Partnerarbeit: Das Bild nachspielen, dabei können auch die genannten Fragen von den Schauspieler*innen beantwortet werden.
Bewegungsspiel: Wie kann man Wege gehen? Spazieren, laufen, schlendern, humpeln, hüpfen, schleichen, müde, ungeduldig, in Schlangenlinien … Mit den Kindern überlegen und (im Freien oder im Turnsaal) diese Bewegungsarten nachspielen. Gut eignen sich zum Beispiel Wege in einem der Schule nahegelegenen Park, wo die Kinder auch mit Sichtkontakt ein Stück des Weges alleine gehen können und dann zu zweit und danach darüber berichten, wie es für sie war. Außerdem können sie dort die verschiedenen Geh-Arten ausprobieren.
Überlegen: Wohin man sich in den Ferien auf den Weg machen möchte und wer mit einem unterwegs sein soll.
Foto: Kerstin s eneca Jensen

Verschiedene Sprachen und Zeichen wahrnehmen
Seiten 118 und 119 im Schulbuch | Kapitel 8
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite greift die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Sprachen und Kanäle auf, in denen wir Menschen uns verständigen: Körpersprache, unterschiedliche Kommunikationsmittel, die Sprache der Zeichen und Symbole und vieles mehr. Dies drückt sich auch in den Zeitwörtern auf der linken Seite aus und verweist auf die Ganzheitlichkeit der Kommunikationsvorgänge, die immer mehr als nur Sprechen sind: hören, sehen, fühlen, sprechen. Ein besonderer Aspekt liegt auch nochmals in der Mehrsprachigkeit gesprochener Wörter. Die Überschrift geht von einer positiven Sicht von sprachlicher Vielfalt aus; Mehrsprachigkeit wird als Schatz gesehen, der es ermöglicht, vielfältiger kommunizieren zu können. Fuchs hält fest: „Mehrsprachigkeitist … keineAusnahmeerscheinung – schließlich ist mehr als die Hälfte derWeltbevölkerungmehrsprachig“(Fuchs2016,259). Zugleich aber thematisiert die Doppelseite auch die Frage nach der Bedeutung der Worte, des Gesprächs und der Sprache als Ausdruck von Beziehung. Damit wird auch (unausgesprochen) ein Anlass angeboten, über die Bedeutung der Mehrsprachigkeit und der damit verbundenen Möglichkeiten, aber auch möglichen Verständigungsschwierigkeiten in der Klasse zu sprechen. Über 20 % aller Schüler*innen in Österreich verwenden in ihrem Alltag neben Deutsch eine andere Sprache. An den allgemein bildenden Pflichtschulen beträgt dieser Anteil mehr als 25 %. Gerade für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache und nicht als Muttersprache haben, berührt Sprache auch Fragestellungen wie Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein, Verstehen und Nichtverstehen mit all den damit verbundenen Konsequenzen der Teilhabe und Lernmöglichkeiten bzw. -beeinträchtigungen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… verschiedene Kommunikationsmittel und Sprachen. verstehen und deuten
… eigene Kommunikationsweisen in diversen Kontexten. gestalten und handeln
… Grußworte und -gesten in verschiedenen Sprachen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… unterschiedliche Sprachen und Zeichen. entscheiden und mit-tun
… mit anderen in Kontakt treten und kommunizieren.
3 | Lernanlässe
★ Verschiedene Sprachen im Umfeld
★ Zeichen und Symbole, die Freund*innen verwenden
★ Nonverbale Zeichen (Ruherituale, Daumen hoch usw.)
★ Erwerb der Schriftsprache
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Bildcollage und deren einzelne Bilder bringen verschiedene Zeichen und Sprachen in unserem Alltag zum Ausdruck: Handynachrichten: Auf dem Bild sind viele Menschen auf einem Zebrastreifen unterwegs und es ploppen viele Zeichen der medialen Kommunikation auf. Gerade via Handy wird kaum in ganzen Sätzen kommuniziert. Es werden viele Zeichen benützt, die (meist) von den Empfängern verstanden werden. Ein rasches „Daumen hoch” oder auch Smileys bilden eine eigene Sprache. Daumen hoch: Die Kindergruppe mit den bestätigenden hochgehaltenen Daumen und Händen machen deutlich, dass bei der Kommunikation der ganze Körper mitspielt. Herz am Baum: Ein Herz, gezeichnet auf einen Baum, ist für jeden und jede verständlich. Auch die Hand, die offensichtlich zu einem Menschen gehört, der einen Baum umarmt, spricht eine deutliche Sprache von Zuneigung, von Innigkeit und Dankbarheit. Menschen pflanzen Bäume: Das Bild zeigt eine Aktion, in der Menschen aus unterschiedlichen Ländern auf kargem Land Bäume pflanzen. Auch diese Aktion ist eine Sprache, die davon erzählt, dass unsere Erde schützenswert ist, dass es notwendig ist, etwas für die Zukunft des Planeten zu tun. Bäume pflanzen ist ein Zeichen von Hoffnung und von Zukunft. Nicht zufällig wird oft ein Baum gepflanzt, wenn ein Kind geboren wird oder wenn jemand heiratet oder Geburtstag feiert. Kind mit Buchstaben: Ein Kind hält Buchstaben in die Höhe. Gerade in der 1. Klasse ist das Lernen von Buchstaben zentral, es eröffnet eine neue Welt. Denn wer lesen kann, kann verstehen, kann sich Wissen aneigen, kann Anteil nehmen an der Welt, kann sich auch mit geschriebenen Worten mitteilen. Nicht lesen zu können schließt aus einem großen Teil des gesellschaftlichen Lebens aus. Verschiedene Sprachen und Schriften: Auch das begleitet Menschen im Alltag. Wer mit offenen Ohren durch die eine Stadt geht, hört Menschen in verschiedenen Sprachen sprechen. In anderen Ländern ist man oft damit konfrontiert, dass es andere Schriften gibt. Das Bild zeigt verschiedende Sprachen und Schriften und kann als Suchbild in einer pluralen Schule gemeinsam entdeckt werden. QR-Code „Ella spricht tausend Sprachen” von Madlen Ottenschläger: Die Geschichte erzählt von Ella, einem sprachlich äußerst erfinderischen Mädchen. Sie spricht müdisch und andersrum, reimisch, tierisch und flüsterisch … und noch viele kreativ erfundene Sprachen mehr. Eine fantasievolle Geschichte, die Lust macht, mit Sprache zu experimentieren und Sprachen zu erfinden.
Das Bibelzitat „Jeder hörte …“ Apg 2,6b ist ein Zitat aus der Pfingsterzählung der Apostelgeschichte. Es deutet an, dass es in diesem Themenbereich Anknüpfungspunkte zur Pfingsterzählung bzw. zum Pfingstfest gibt. In dieser Pfingsterzählung wird von mehreren Wirkformen des Heiligen Geistes in bildhafter Sprache erzählt. Der Geist Jesu wirkt zum einen wie Feuer, das in aller Kraft und Dynamik die Menschen für diesen Jesus und seine Botschaft entflammt und begeistert. Zum anderen wirkt er wie ein Sturmwind, der in die Welt und die Menschen hineinfährt und in Bewegung bringt, wie Atem, der in die Menschen eingehaucht wird, um sie lebendig zu machen. Und die dritte Wirkung wird beschrieben, indem es heißt, dass die Menschen verschiedene Sprachen verstehen können, was die Jünger begeistert und von Jesus erzählen lässt. Der Heilige Geist bewirkt Verstehen unter den Menschen. Es ist das Gegenbild zum Turmbau von Babel. Dort werden ob der Hybris der Menschen die Sprachen verwirrt und die Menschen können einander nicht mehr verstehen. Nun, als Wirkung des Geistes Jesu, gibt es ein neues Miteinander, ein Verstehen über alle Grenzen hinweg.
Die Schatzkästchen laden ein, verschiedene Arten von Sprache und Sprechen im eigenen Lebensumfeld zu bedenken. Ich spreche auf unterschiedliche Art und Weise: mit Worten, mit den Händen, mit einer oder mehreren Sprachen, mit Oma rede ich anders als mit der Lehrerin. Kenne ich einen Dialekt? Was kann ich ohne Worte sagen? Was sagt meine Stimme, wenn sie einmal laut und einmal leise spricht? Vieles ist hier möglich zu bedenken und zu beschreiben. Zu Hause sprechen viele Kinder eine andere Sprache als in der Schule. Auch gibt es andere Themen, andere Zeichen und „Codewörter”.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Bilder betrachten: Erzählen, was auf den Bildern zu erkennen ist und inwiefern es sich um verschiedene Zeichen und Sprachen handelt. Schatzkästchenimpulse besprechen: Anhand der Impulse in den Schatzkästchen kann Bezug auf die verschiedenen Sprachen der Schüler*innen genommen werden und es können diverse Kommunikationsmittel und -möglichkeiten gesammelt werden. Kommunikationsmöglichkeiten finden: In Vorausschau auf den Sommer und mögliche Urlaubsreisen, Gäste etc. können verschiedene Worte (z. B.: Grußworte) in unterschiedlichen Sprachen gesammelt werden. Hierbei können Schüler*innen ihre Sprachkenntnisse einbringen. Außerdem können auch verschiedene Zeichen entdeckt oder gefunden werden, mit denen man etwas ausdrücken kann, u. a. wenn es mit Worten nicht möglich ist (z. B.: winken, Hände falten & verbeugen, nicken usw.).
Voneinander (grüßen und danken) lernen: Die Schüler*innen stehen in zwei Kreisen, einem Innenkreis und einem Außenkreis. Wenn die Lehrperson ein Signal gibt, dann begrüßen sie ihr Gegenüber, z. B. in einer anderen Sprache oder mit einer bestimmten Geste, dann gehen sie zum nächsten Kind weiter und so weiter. Als Steigerung können sie jeweils beim nächsten Kind die Worte oder Gesten anwenden, die sie von dem vorherigen Kind gelernt haben. (Gruß-) Memory spielen: Zwei Schüler*innen verlassen die Klasse. Die übrigen Schüler*innen finden sich zu Paaren zusammen und wählen eine Grußgeste oder Grußworte (z. B. in verschiedenen Sprachen). Die Lehrperson überprüft, ob jedes Paar eine eigene Variante gefunden hat. Anschließend kommen die beiden Kinder wieder zurück in die Klasse und spielen Memory. Ein Kind beginnt und nennt zuerst den Namen eines Kindes, dieses macht seine Geste vor oder sagt seine Worte, dann nennt das spielende Kind den Namen eines anderen Kindes. Wenn beide Kinder dieselbe Geste oder dieselben Worte sagen, ist ein Paar gefunden und dieses stellt sich zu dem Kind, welches das Paar gefunden hat. Nachdem zwei Namen genannt wurden, ist das zweite spielende Kind dran. Das spielende Kind, welches die meisten Paare gefunden hat, gewinnt.
„Ella spricht tausend Sprachen” vorlesen oder anhören: Nach dem Hören der Geschichte können die Schüler*innen selber von

Phantasiesprachen erzählen und allein oder gemeinsam lustvoll neue Phantasiesprachen erfinden.
Bibelzitat besprechen und die Pfingsterzählung erzählen oder vorlesen: Die Pfingstgeschichte mit den Schüler*innen besprechen und dabei gemeinsam darüber nachdenken, wie man sich auch ohne gemeinsame Sprache miteinander verständigen kann. Diese Art zu sprechen kann als Sprechen von Herz zu Herz bezeichnet werden. Anschließend können die Schüler*innen eine Heftseite gestalten, indem sie in ein Herz zeichnen, was ihr Herz bewegt, was sie begeistert. Arbeitsblatt „Was mich begeistert, wovon ich gerne spreche” ausfüllen: Das Arbeitsblatt und der darauf enthaltene Bibelspruch werden zuerst gemeinsam angeschaut und besprochen. Dann haben die Schüler*innen Zeit zu überlegen, was sie begeistert bzw. wovon sie gerne sprechen. Setzt man dieses AB in Bezug zur Pfingsterzählung, kann über das Wort „beGEISTert”, in dem eben das Wort „Geist” alias „Heiliger Geist” steckt, die Brücke geschlagen werden. Einige Geschichten von dem, was die Schüler*innen begeistert, können im Plenum oder Partner- bzw. Gruppengespräch miteinander ausgetauscht werden. Dann sollte etwas Passendes in das Herz geschrieben oder gezeichnet werden. Es ist möglich, das Herz auszuschneiden und an den Seiten zu falten, damit man es aufklappen kann. So kann es dann auch gemeinsam mit dem Bibelspruch einen Platz im Heft finden.
6 | … und noch mehr Ideen
Zeichen-Detektiv spielen: Die Schüler*innen machen sich in der Klasse, im Schulhaus, im Schulhof, im Ort, zu Hause … auf die Suche nach Zeichen. Sie zeichnen auf oder bringen ggf. mit, was sie gefunden haben. Alles was gefunden wurde, wird in der Mitte eines Sesselkreises gesammelt und besprochen. Die Schüler*innen sind dazu eingeladen, zu erzählen, wo sie die Zeichen gefunden haben und ihre Bedeutung, wenn sie diese kennen, mitzuteilen bzw. gemeinsam über diese nachdenken. Aus den gefundenen Zeichen kann eine Collage gestaltet oder eine Heftseite befüllt werden. Grußkarten gestalten und verschicken: Die Schüler*innen können Grußkarten gestalten, die z. B. an die Schulanfänger des nächstes Jahres verschickt werden.
7 | Kinderbücher
Ottenschläger, M. (2022). Ella spricht 1000 Sprachen. Esslinger.
8 | Lieder
Feuer und Flamme LB Religion Nr. 122
Zu Pfingsten in Jerusalem LB Religion Nr. 127
9 | Schnappschüsse



Was mich begeistert, wovon ich gerne spreche

Was mich begeistert, wovon ich gerne spreche
➜ Zeichne ein, was dein Herz bewegt, und wovon du gerne erzählst.
Z eichne ein, was dein Herz bewegt und wovon du gerne erzählst.



womit das Herz voll ist, davon geht der Mund über . “
„Denn

Nach Matthäus 12 ,34
Verstehen, nicht verstehen – Sprache kann verbinden und trennen
Seiten 120 und 121 im Schulbuch | Kapitel 8
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite nimmt nach der äußeren Wahrnehmung von Sprache und Verstehen mehr die Innenseite in den Blick. Einander zu verstehen hat viele Ebenen, die hier zur Sprache kommen können und sollen. „Du verstehst mich” meint wesentlich mehr als „Du sprichst die gleiche Sprache wie ich”, wie eben auch „Du verstehst mich nicht!” als Vorwurf in Konfliktsituationen und im Streit. Insofern kann Sprache näherbringen und verbinden, aber eben auch entzweien und trennen. Sie kann zur Quelle von Verstehen und Missverstehen werden. Wirkliches Verstehen ist nicht nur eine Frage des Verstandes, sondern des Einfühlens, der Empathie, der Achtsamkeit, des Sich-Einlassens auf den anderen, von Kontakt und Beziehung. Die Seite lädt ein, sich fragehaltig diesem schwierigen Thema zu nähern, Erfahrungen mit Sprache auszutauschen. Sprache meint immer auch sich selbst mitteilen und miteinander teilen und stiftet Gemeinschaft. Nicht umsonst hängen die Wörter Communio (Gemeinschaft), Kommunion und Kommunikation im Innersten zusammen.
Es werden auch die unterschiedlichen Sprachformen angesprochen (Geschichte vom Raben, Schatzkästchen, Bild), denn „ein Bild sagt mehr als tausend Worte”. Unsere Sprache ist voll von solchen Anklängen, die auf diese Vielfalt aufmerksam machen. Schon die Kinder teilen sich über Smartphone, iPad etc. mit Emoticons, Bildern etc. mit. Zudem drücken wir Menschen unsere Innenwelt, unsere Gefühle, unsere Wünsche und Bedürfnisse körpersprachlich viel früher aus, als wir tatsächlich Sprache beherrschen. Zugleich sollen diese Seiten auch ermutigen, das eigene Repertoire des Sich-Ausdrückens zu erweitern und sich mitteilen zu lernen, damit Verstehen leichter möglich wird. Pfingstlich wird in der Apostelgeschichte des Lukas das Sprachenwunder als Gegensatz zur Sprachenverwirrung und Entzweiung beim Turmbau zu Babel im Buch Genesis als die Erfahrung des „Wunders des Verstehens” – jeder hörte sie in seiner Sprache reden – als Wirken des Gottes Geistes beschrieben und gedeutet. Das Sich-Verständigen und Verstehen erhält eine „göttliche” Dimension. Es ist offensichtlich nicht etwas, was so einfach gemacht werden kann, sondern als besonderes Geschenk erfahren wird. Am Ende der Seite verweist der Bibeltext nochmals darauf, dass Jesus Christus das eigentliche Wort Gottes ist, indem Gott zu uns spricht, sich uns mitteilt. An Jesus und seinem heilsamen Handeln kann abgelesen werden, was Gott uns von sich mitteilen will.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… wie Gesprochenes unterschiedlich wirkt.
verstehen und deuten
… die Bedeutung körpersprachlicher, mimischer, gestischer, symbolischer u. v. m. Zeichen. gestalten und handeln
… sich in unterschiedlichen Sprachen ausdrücken.
… pantomimisches Sprechen anwenden und deuten.
… mit Emoticons umgehen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… was unterschiedliche Sprechweisen bedeuten. entscheiden und mit-tun
… Kommunikation mit Gott: beten, singen, tanzen, sich bewegen.
... verbindende Sprechweisen im Miteinander anwenden.
3 | Lernanlässe
★ Aussagen wie: „Du verstehst mich nicht!”, „Jetzt verstehen wir uns richtig!“
★ Manchmal sagt man nicht das, was man meint
★ Etwas nicht in Worte fassen können
★ Sich mit manchen blind verstehen
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Bild von den Kindern von Stefan Karch zeigt fünf Kinder in unterschiedlichen Haltungen, deren Blick sich konzentriert und doch entspannt auf eine bestimmte „Situation” zu richten scheint. Manche Gesichter wirken nachdenklich, manche eher, als würden sie zuhören, lauschen oder auf etwas reagieren. Auf alle Fälle wirken die Kinder, als wären sie interessiert an dem, worum es geht.
Die Sprechblasen mit Philosophierfragen geben Impulse für philosophierendes Nachdenken und Fragen. Es werden unterschiedliche Themen rund um Sprache und Verstehen bzw. Nicht-Verstehen angeboten. Weitere Fragen können von den Kindern entwickelt werden. Der Text vom Raben Felix erzählt von einer Realität, die viele gerne ausblenden möchten, die aber auch zum Leben gehört. Der Rabe Felix muss erleben, dass ein anderer Rabe ihn ohne irgendwelche erklärenden Worte attackiert und ihm wehtut. Nonverbale Sprache ist nicht immer, aber meist gut zu verstehen. Auch Kinder drücken sich oft nonverbal aus und lernen im Miteinander diese Sprache zu verstehen. Das Bild vom fröhlichen Männchen schaut kommunikativ und fröhlich in die Welt. Die ausgebreiteten Arme und auch die Farbe Gelb lässt uns positive Zuwendung assoziieren.
Das Schatzkästchen lädt dazu ein, sich auf reflexive Weise mit der eigenen Sprach- und Ausdrucksfähigkeit auseinanderzusetzen, indem Sätze mit dem, was für einen selbst zutrifft, vervollständigt werden.
Die Bibelstelle „Vielfältig hat Gott …“ nach dem Hebräerbrief 1,1 macht darauf aufmerksam, dass die Art und Wesie, wie Menschen Gott wahrnehmen, hören etc. sehr vielfältig ist und war. Die Menschen des Alten Testaments haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Gott sprach in Träumen, im Feuer, im leichten Säuseln des Windes, durch andere Menschen (Propheten), u. v. m. Unser Glaube ist, dass Gott schließlich durch Jesus Christus zu den Menschen gesprochen hat und auch heute noch spricht. Jesus als der, der die Botschaft vom neuen Reich Gottes verkündet und gelebt hat. Auch für diese Sprachen Gottes gilt es aufmerksam zu sein. Es braucht ein offenes Ohr, das Gottes Botschaft in den vielfältigen Weisen wahrnimmt und versteht.
Die Bronzeskulptur „Der Hörende” stammt vom deutschen Bild-
hauer Ernst Barlach (1870–1938). Der Blick ist aufmerksam nach oben gerichtet, die Hände sind an die Ohren gelegt, sodass sie die Form eines Herzens bilden. Einerseits verstärken sie die Hörfähigkeit und gleichzeitig erweitern sie das äußere Hören hin auf ein „Hören mit dem Herzen”.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Im Buch suchen: Wo Gott mit Menschen spricht, was Jesus sagt. Zum Beispiel: Doppelseite 16 und 17 im Schulbuch: Jesus erzählt von Gott. Doppelseite 28 und 29 im Schulbuch: Schöpfung. Doppelseite 32 und 33 im Schulbuch: Mose sieht im Feuer: Ich bin der ICH-BINDA. Aber auch viele weitere Seiten laden zum Nachdenken über das Sprechen Gottes ein. Philosophieren und nachdenken: Warum verstehen sich Menschen einmal und dann wieder nicht? In einem philosophischen Gespräch zum Beispiel im Sesselkreis um eine gestaltete Mitte mit den Schüler*innen darüber nachdenken und reden, welche Probleme es in der Kommunikation geben könnte und warum man sich manchmal oder mit manchen Menschen nicht oder nur schwer verständigen kann. Dabei kann Bezug auf Sprachen genommen werden und mitunter auch überlegt werden, wie diese Hürden überwunden werden können. Weitere Fragen über das Verbindende und Trennende von Sprache wären: Wann verbindet uns Sprache? Wann trennt uns Sprache? Können wir uns verstehen, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen? Wie ist es, wenn wir jemanden nicht verstehen, trotz der gleichen Sprache? Schatzkästchen ausfüllen: Die Sätze im Schatzkästchen weiterschreiben. Anschließend miteinander ins Gespräch kommen und die Ergebnisse vergleichen und besprechen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Schüler*innen einander gut zuhören.
6 | … und noch mehr Ideen
Stille Post spielen: Die Schüler*innen sitzen in einem Sesselkreis oder stellen sich in einer Reihe auf und ein Kind darf beginnen,
dem Kind nebenan ein Wort oder (mit gesteigerter Schwierigkeit) einen kurzen Satz ins Ohr zu flüstern, sodass es die anderen nicht hören können. Dann ist dieses Kind dran und flüstert wiederum dem Nachbarskind das gleiche Wort ins Ohr. Das geht so weiter, bis dem letzten Kind das Wort zugeflüstert wurde. Nun soll dieses Kind das Wort laut sagen. Es kann vorkommen, dass am Ende ein ganz anderes Wort oder ein anderer Satz herauskommt, als von dem ersten Kind gesagt. Dann kann darüber gesprochen werden, dass oft etwas anderes ankommt, als es ursprünglich gedacht war. Reli-Activity spielen: Die Schüler*innen können (u. a. in Gruppen) ohne zu sprechen verschiedene Begriffe oder Erzählungen aus dem Religionsunterricht nachstellen, beschreiben, spielen, zeichnen. Die anderen erraten (u. a. auch in Gruppen), welcher Begriff bzw. welche biblische Erzählung dargestellt wurde. Entweder denken sich die Schüler*innen selbst aus, was sie darstellen wollen, oder die Lehrperson gibt bestimmte Begriffe vor (Vorlage siehe unten). Unter Umständen können die Schüler*innen vor der Tür auch gemeinsam ausprobieren, wie sie etwas darstellen könnten (wenn in Gruppen gespielt wird).
7 | Kinderbücher
Ottenschläger, M. (2022). Ella spricht 1000 Sprachen. Esslinger.
8 | Lieder
Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen LB Religion Nr. 9
9 | Schnappschüsse

Reli Activity2/2 ➜ Das Gesuchte beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen.
Activity2/2
R eli
Die Sterndeuter kommen, um das Jesuskind zu sehen
Das Gesuchte beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen. Maria und Josef ziehen nach Betlehem und Jesus wird geboren
Bibel
Hirten und Schafe
Zachäus klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen
Jesus ruft Freundinnen und Freunde
Jesus feiert das letzte Abendmahl mit seinen Freunden
Jesus ist auferstanden
Halleluja
Reli Activity1/2 ➜ Das Gesuchte beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen.
Activity1/2
R eli
Das Gesuchte beschreiben, zeichnen oder pantomimisch darstellen.
Sonne
Noahs Arche
Mirjam singt und tanzt vor Freude
Palmsonntag
Jesus zieht in Jerusalem ein
Jesus stirbt am Kreuz
Erntedankfest
Regenbogen
Mose hört Gottes Stimme am brennenden
Dornbusch
Kirche
Nikolaus
Spuren suchen
Kerze anzünden
Taufe
Engel
Adventkranz
Mit dem Herzen sprechen
Seiten 122 und 123 im Schulbuch | Kapitel 8
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Die Doppelseite lädt dazu ein, die „Gewaltfreie Kommunikation” nach Marshall B. Rosenberg kennen und anwenden zu lernen. Menschen sind sehr unterschiedlich und werden durch ihre individuellen Lebenserfahrungen geprägt. Manchmal ist es sehr schwierig einander zu verstehen. Auch Kinder erleben das in ihrem Alltag. Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein Konzept, das Schüler*innen dabei unterstützen kann, auf ihre Sprache zu achten und respektvoll miteinander umzugehen. Die Gewaltfreie Kommunikation kennt zwei Symboltiere. Die Giraffe und den Wolf. Die Giraffe ist ein ruhiges und entspanntes Tier, das mit allen anderen Tieren friedlich zusammenlebt. Weil sie so groß ist, braucht sie ein großes und v. a. kräftiges Herz. Das große Herz der Giraffe möchte daran erinnern, dass es uns Menschen gut tut, wenn wir mit „Herz” kommunizieren und agieren. Menschen, die ein großes Herz haben, gelten als freundlich und friedlich. Als Gegenspieler tritt der Wolf auf. Das Zähnefletschen, der grobe Umgang miteinander und die geduckte Haltung erinnern eher an eine gewaltvolle Kommunikation. Wichtig dabei ist, dass der Wolf nicht negativ besetzt werden möchte. Der Wolf erinnert uns daran, dass wir nicht immer sachlich und geschickt mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen umgehen können. Die 4 Schritte der Giraffensprache sind: 1) Die Beobachtung (wertfrei, sachlich, ehrlich, unabhängig) 2) Die Gefühle (fröhlich, wütend, traurig, aufgeregt …) 3) Die Bedürfnisse (Sicherheit, Ruhe, Hilfe, Gemeinschaft …) 4) Die Bitte (sachlich, konkret, ergebnisoffen). Hier ist auch nochmals deutlich darauf hinzuweisen, dass es bei der Gewaltfreien Kommunikation um mehr geht als ein „richtig sprechen lernen” als Methode. Es geht um eine innere Haltung der Achtsamkeit mit Sprache, der Beziehung und dem Kontakt, aber auch der Empathie und Rücksichtnahme, damit Beziehung und Gemeinschaft wachsen können. Religiös-spirituell wird man auch hier im Hintergrund durchaus die Goldene Regel der Religionen sehen dürfen, die sich alltagssprachlich im „Was du nicht willst, dass man dir tut, füg auch keinem anderen zu” ausdrückt. Es ist der Versuch einer liebevollen Haltung zueinander, die sich auch im Sprechen ausdrückt.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Aussagen in Wolfs- und Giraffensprache. verstehen und deuten
… Unterschiede zwischen Wolfs- und Giraffensprache. gestalten und handeln
… Beispiele für Wolfs- und Giraffensprache ausprobieren.
…Aussagen dem Wolf und der Giraffe zuordnen. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… wann wir in Wolfs- und in Giraffensprache sprechen.
… was die Wolfs- und die Giraffensprache bewirken. entscheiden und mit-tun
… Giraffensprache anwenden (Gespräche, Konflikte).
3 | Lernanlässe
★ Streit in der Klasse, Schule, Familie
★ Verständigungsprobleme (z. B. in Konflikten)
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Die Übersicht über die Gewaltfreie Kommunikation zeigt die Merkmale der Wolfs- und der Giraffensprache auf. Dabei sind der Wolf und die Giraffe als Symbole sichtbar. Es geht dabei nicht darum, den Wolf, der in Wirklichkeit ein sehr faszinierendes und soziales Tier ist, schlecht dastehen zu lassen. M. Rosenberg greift aber dennoch das Wolfsmotiv aus Märchen auf und verwendet ihn für unsensible Sprache und für groben und aggressiven Umgang miteinander. Es sind einige Beispiele aus dem Alltag angeführt, in denen sich wohl jede*r wieder erkennt. Im Kontext des Kapitels geht es um ein achtsames Wahrnehmen und ein anfanghaftes Einüben, um eine Sprache, die das Miteinander fördert, die Achtung und Wertschätzung auch in belasteten Situationen ausdrückt und hier als „Giraffensprache“ bezeichnet wird. Die Rede von „Wolfssprache“ und „Giraffensprache“ möchte das Bewusstsein vertiefen, dass Sprache verbinden oder auch trennen kann, dass Worte etwas bewirken. Es geht um eine erste Sensibilisierung auf dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes. Weil jeder Mensch einzigartig und ein Ebenbild Gottes ist, ist es gut und notwendig, Aufmerksamkeit und einen achtsamen Umgang miteinander einzuüben.
Der Bibeltext „Freundliche Worte sind …“ nach Spr 16,24 benennt eine Erfahrung, die für alle Menschen und für alle Zeiten gilt: Freundliche Worte tun rundum gut. Das Bild des süßen Honigs verdeutlicht diese Erfahrung. Tatsächlich wurde Honig ja nicht nur zum Essen und Genießen genutzt und als gesund wahrgenommen, sondern auch auf Wunden und Verletzungen gestrichen, sodass sie schneller heilen.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Plakat zur Gewaltfreien Kommunikation erstellen: In der Klasse wird ein Plakat mit kindgerechten Symbolen für die einzelnen Bestandteile der Giraffensprache aufgehängt. Die Inhalte werden immer wieder gemeinsam wiederholt und laut gesprochen: Ich beobachte …, Ich fühle mich …, Ich brauche …, Ich bitte dich … Arbeitsblatt zur „Giraffensprache“ ausfüllen: Beim Ausfüllen des Arbeitsblattes zur Gewaltfreien Kommunikation können die Schüler*innen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit herausfinden, welche Sätze zur Giraffensprache gehören und welche nicht. Wenn im Plenum die Lösung besprochen wird, ist es sinnvoll, auch Alternativen zu suchen, wenn am Arbeitsblatt in Wolfssprache formuliert wurde. Beispielsweise statt „Geh weg!” könnte die Giraffe sagen „Ich beobachte, dass du sehr nahe neben mir stehst, ich fühle mich unwohl, ich brauche etwas mehr Freiraum und bitte dich, ein Stück weiter weg zu gehen.”
6 | … und noch mehr Ideen
Fächerverbindendes Lernen: In Zusammenarbeit mit dem Sachunterricht könnte zum Thema „Giraffe“ oder „Gewaltfreie Kommunikation“ gelernt und in allen Fächern eingeübt werden. Es bietet sich auch Projektarbeit dazu an.
Kinderbücher
Kostyra, K. (2021). Die 50 besten Spiele für Gewaltfreie Kommunikation. Klasse 1-4. Don Bosco.
McKee, D. (2011). Du hast angefangen! Nein, du! Sauerländer.
Wölfel, S. (2020). Unsere Giraffenkartei. Kinder üben selbständig Gewaltfreie Kommunikation mit der Giraffensprache. Verlag an der Ruhr.
8 | Lieder
Einander verstehen LB Religion Nr. 146
Feuer und Flamme LB Religion Nr. 122
Zu Pfingsten in Jerusalem LB Religion Nr. 127
9 | Schnappschüsse



Kapitel_8_Sprechen und einander verstehen.
Was würde die Giraffe sagen?
Was würde die Giraffe sagen?
Male die Sätze der „Giraffensprache“ gelb an.
➜ Male die Sätze der „Giraffensprache“ gelb an.

Ich beobachte genau und bewerte nicht


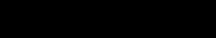



Du bist doof!


Gute Worte hören – Einander gute Worte sagen
Seiten 124 und 125 im Schulbuch | Kapitel 8
1 | Wozu die Doppelseite einlädt
Diese Doppelseite fasst am Ende des Schuljahres wie in einem Brennpunkt wichtige Haltepunkte und Hoffnungsbotschaften zusammen. Im Mittelpunkt steht die Symbolik des Herzens, das einerseits als innerste Mitte des Menschen für Beziehung, Freundschaft und Liebe steht, aber auch für die Verletzlichkeit jedes Menschen: wer sein Herz in Liebe öffnet, macht sich verletzlich. Deshalb steht es immer auch für Jesus selbst, dem die Kinder in diesem Jahr vielleicht mit viel Herz begegnet sind. Das Leben, jeder einzelne Tag ist ein Geschenk, wir dürfen der Kraft der Liebe vertrauen, der Blick auf Jesus während des Schuljahres nährt die Hoffnung, dass das Gute sich letztlich vermehrt – z. B. indem einander gute Worte geschenkt werden. Das Bild von Alois Neuhold auf Seite 126 zeigt, wie sich die Liebe oft in kleinen Dingen realisiert (durch gute Worte, gegenseitiges Vertrauen u. v. m.) und wie sie oft auch unerwartet begegnet. Die Doppelseite lädt ein zurückzuschauen auf das erste Schuljahr. Wahrzunehmen und zu benennen, wo uns vielleicht unerwartet grüne Herzsituationen, Herzbegegnungen … erfreut haben, aber auch das, was nicht schön war, verletzt hat, traurig war und trotzdem zu diesem Jahr dazugehört hat. Und all das Traurige, Unangenehme, Verletzende darf in das große Herz Gottes zurückgelegt werden, der es zu verwandeln vermag, damit alles gut wird. Gott selber ist, wie es auch Jesus zeigt, der große Herzensspender, von ihm kommt all das Gute. Zudem wird mit der Lösung zum Herzrätsel ein Aufruf zum „herzhaft leben” getätigt, um im Bewusstsein der Botschaft des Liedes, dass jeder Tag ein Geschenk ist, sowohl dankbar für das eigene Leben zu sein als auch Gemeinschaft positiv zu erleben und erlebbar zu machen.
2 | Kompetenzen
Die Schüler*innen können: wahrnehmen und beschreiben
… Worte die gut tun. verstehen und deuten
… warum gute Worte kostbar wie ein Schatz sind.
… Notwendigkeit guter Worte, um gut leben zu können. gestalten und handeln
… gute Worte sammeln.
… gute Worte verschenken. (be-)sprechen und (be-)urteilen
… wann wir gute Worte brauchen. entscheiden und mit-tun
… das Lied „Jeder Tag ist ein Geschenk” mitsingen. … im Alltag gute Worte verwenden und empfangen.
3 | Lernanlässe
★ Gute Worte im Umfeld
★ Vorbereitung auf die Ferien
★ Rückschau: Das Schuljahr geht zu Ende
4 | Sehen, lesen, tun und feiern
Das Bild „Herzspender“ von Alois Neuhold zeigt, dass Liebe mehr wird, wenn man sie teilt. Das Gute vermehrt sich und springt über. Dynamisch, mit zwei Beinen in Bewegung. Es ist vielleicht die Liebe und Barmherzigkeit, die Jesus gelebt hat, der in Wort und Tat unter den Menschen wirkte.
Der Text des Raben Felix weist darauf hin, dass gute Worte tatsächlich ein „Lebensmittel” sind, das uns gut tut. Worte, die wir einander sagen und natürlich auch offene Ohren, die zuhören. Gutes Sprechen und Einander-Zuhören – beides brauchen Menschen in ihrem Miteinander.
Das Rätsel „Herzhaft leben“ funktioniert so: Rechts ist in „Herzzeichensprache” eine Geheimbotschaft geschrieben. Diese kann mithilfe der Legende auf der linken Seite entschlüsselt werden. Für jeden Buchstaben gibt es einen Strich auf der Zeile. Werden die Herzen mit den richtigen Buchstaben verbunden, entsteht die Geheimbotschaft: „Herzhaft leben”. Diese ist wie eine Ermutigung für das eigene Leben zu verstehen.
Das Lied „Jeder Tag ist ein Geschenk“ drückt die Dankbarkeit aus, dass es jeden Tag nur einmal gibt und er wertvoll und einzigartig ist. Das Lied lädt ein, in jedem Tag einen positiven Funken zu finden und Gott dafür zu danken.
5 | Möglichkeiten zur Doppelseite
Einander gute Worte schenken und sammeln: Die Schüler*innen sagen gute Worte zueinander. In einem Kreis darf sich immer ein Kind in die Mitte stellen, dann dürfen die anderen etwas Gutes über dieses Kind sagen (die Lehrperson könnte mitschreiben). So lange bis alle, die gerne möchten, dran waren. Die Schüler*innen können einander aber auch Gutes zuflüstern oder aufschreiben. Durch Aufgeschriebenes haben die Kinder die Möglichkeit, die guten Worte zu sammeln, z. B. in einem verzierten Glas, einem Kuvert … und können sich immer wieder daran erfreuen bzw. kann die Sammlung ständig erweitert werden.
Bildbetrachtung: Das Bild „Mit dem Herzen sprechen“ gemeinsam betrachten. Welche Farben siehst du? Welche Formen kannst du erkennen? Was erzählt das Bild? Was erzählen die kleinen Herzen? Was das große Herz?
Herz-Rätsel im Schatzkästchen ausfüllen: Die Herzbotschaft entschlüsseln und darüber ins Gespräch kommen. Was bedeutet es „herzhaft“ zu leben? Was hilft dabei, das Leben positiv anzunehmen? Mögliche Antworten wären: in jedem Menschen etwas Gutes sehen, einander helfen und verzeihen, jemandem eine Freude machen, dankbar sein …
Lied „Jeder Tag ist ein Geschenk“ singen
Arbeitsblatt zum Rückblick auf das Schuljahr ausfüllen und besprechen.
6 | … und noch mehr Ideen
Gute-Worte-Herzen gestalten: Herzen aus Papier basteln und bemalen und ein gutes Wort oder kurze Sätze (Freundschaft, Liebe, Leben, Hoffnung, Schön, dass du da bist, Du bist spitze,…) darauf schreiben. Diese Herzen können dann z. B. an Klassenkolleg*innen, Freund*innen oder auch im privaten Umfeld verschenkt werden. Eine Idee wäre es auch, diese beim Schlussgottesdienst an alle Schüler*innen und Lehrer*innen zu verteilen und so gute Worte mit in die Ferien zu geben.
Gedicht zum Verschenken von Herzen lernen: Das Gedicht (siehe unten) mit den Schüler*innen lernen. Dieses können es dann z. B. aufsagen, wenn sie jemandem ein selbstgebasteltes Herz schenken oder einfach an liebe Menschen in ihrem Umfeld weitergeben. Schulschlussgottesdienst feiern: Gemeinsam einen Gottesdienst
zum Abschluss des Schuljahres feiern. Das Thema könnten auch hierbei „Gute Worte“ sein.
7 | Kinderbücher
Friedl, R. (2021). In deinem Herzen wohnt das Glück. Cbj. Ottenschläger, M. (2022). Ella spricht 1000 Sprachen. Esslinger.
8 | Lieder
Jeder Tag ist ein Geschenk T./M. v. K. Mikula: mikula-kurt.net
Leben lernen T./M. v. K. Mikula: mikula-kurt.net
9 | Schnappschüsse

Herzgedicht
Herzgedicht
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir
Ich schenke dir
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Herzgedicht
Herzgedicht
Zum Auswendiglernen
Zum Auswendiglernen
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir
Ich schenke dir
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Herzgedicht
Herzgedicht
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Herzgedicht
Herzgedicht
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .


Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir
Ich schenke dir
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Herzgedicht
Herzgedicht
Zum Auswendiglernen
Zum Auswendiglernen
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Herzgedicht
Herzgedicht
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich freue mich, wenn ich dich seh‘ .
Ich finde dich so nett.
Ich finde dich so nett.
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!
Ich schenke dir mein H, mein E, mein R und auch mein Z!

Rückblick auf das Schuljahr
Rückblick auf das Schuljahr
Schreibe oder zeichne in die Schatzkästchen.
➜ Schreibe oder zeichne in die Schatzkästchen.



Mein größter Schatz aus dem Religionsunterricht ist …

Das kann ich … das weiß ich …
Seiten 126 und 127 im Schulbuch | Kapitel 8
Diese Doppelseite am Ende des Kapitels dient der Selbstevaluierung der Kinder. Womit habe ich mich in diesem Kapitel beschäftigt? Was kann ich, was weiß ich, was habe ich gelernt, welche Fragen habe ich …
Die Schatzkästchen beinhalten Anregungen zu den am Kapitelanfang beschriebenen „Schätzen”, die in diesem Kapitel zu finden waren. Da die Kinder der ersten Schulstufe sehr heterogen sind, was ihre Interessen und Fähigkeiten anbelangt (Lesen, Feinmotorik, Verständnis, bevorzugte kreative Ausdrucksweisen …), sind hier Arbeitsimpulse mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und Schwierigkeitsgraden angeboten.
Es geht letztlich darum, dass sich die Kinder bewusst werden, welche Schätze sie durch den Religionsunterricht entdecken, was sie im Sinne der Kompetenzorientierung neu wissen und neu können, worüber sie nachdenken, welche Fragen neu generiert werden und auch, wo ihr eigenes Leben berührt ist.
Schulbuchabschluss – spirituelle Vertiefung: Deine Farben sind das Leben
Seite 128 und 129 im Schulbuch | Kapitel 8
Diese Doppelseite thematisiert den Abschluss des Buches, der gemeinsamen Schatzsuche und des gesamten Schuljahres. Der Rabe Felix verabschiedet sich und nimmt noch einmal Bezug auf den Regenbogen, der hier – anders als auf vorherigen Kapitelschlussseiten – weit über den Himmel gespannt ist. Die Regenbogensonne, welche auch bereits von vorhergehenden Kapitelabschlusseiten bekannt ist, befindet sich nun unten in der Mitte, wie eine untergehende Sonne. Genauso wie die Sonne immer wieder aufgeht, wird es auch nach dem Ende dieses Schuljahres wieder weitergehen. Dadurch zeigt sich ein freudiger Ausblick auf die Ferien, aber auch auf das nächste Schuljahr.
Mit dem Text „Freu dich über alles“ wird nochmal Gottes Zuneigung zu den Menschen zum Ausdruck gebracht und den Schüler*innen mit auf ihren Weg gegeben.
Literatur zum 8. Kapitel
Fuchs, E. (2016). Mehrsprachigkeit – vom Sprachenreichtum in Österreichs Klassenzimmern. In: Kronberger, S./Kühberger, Ch./Oberlechner, M. (Hrsg.). Diversitätskategorien in der Lehramtsausbildung. Ein Handbuch, 258–270. Innsbruck: StudienVerlag.
Neuhold, H. (2016). Religiöse Vielfalt als Herausforderung und Chance. Interreligiöses Lernen – die angstfreie Bewusstheit von religiöser Differenz fördern. In: Kronberger, S./Kühberger, Ch./ Oberlechner, M. (Hrsg.). Diversitätskategorien in der Lehramtsausbildung. Ein Handbuch, 281–298. Innsbruck: StudienVerlag. Oberthür, R. (2010). So viele Fragen stellt das Leben. Das Kalenderbuch für alle im Haus. München: Kösel-Verlag.
Rosa, H. (2016). Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Verlag Suhrkamp.
Rosenberg, M.B. (2007). Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Paderborn: Jungfermann Verlag.
Schulz von Thun, F. (2011). Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek bei Hamburg: Rowolth TB Verlag.


1Jesus mein Freund
Text und Musik von Minichmayr
Schatzbuch Religion

2
2

Wunderschön ist diese Erde
Wunderschön ist diese Erde
Schatzbuch Religion
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/


3
3

Wir feiern heut ein Fest
Wir feiern heut ein Fest
Text und Musik von Rolf Krenzer
Text und Musik von Rolf Krenzer
Schatzbuch Religion

4

Wenn unsre Kerze brennt
Text und Musik von Detlev Jöcker
Schatzbuch Religion



5

Macht euch bereit
Schatzbuch Religion
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/

6

Gott macht sich ganz klein
Schatzbuch Religion
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/


7

Ich brauch‘ dich
Text und Musik aus dem Evangelischen Liederheft
Schatzbuch Religion

8 Kind Gottes

Schatzbuch Religion
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/


9

Gottes Wort gibt mir Kraft

Schatzbuch Religion
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/


Hand in Hand mit Jesus gehen
Text und Musik von Stephanie Reitlinger: https://www.musikager.at//de/lieder-demos/

Arbeitsblätter
Das
Gefühle
Erzähltexte
Die Legende von der Vogelpredigt
Durch Jesus scheint das Licht Gottes auf uns Menschen
Ein Licht strahlt auf
Autorinnen und Autoren
Herausgeberinnen:
Prof.in OStRin Mag.a Roswitha Pendl-Todorovic, Hochschulprofessorin, Leiterin des Kompetenzzentrums für Religionspädagogische Schulbuchentwicklung, Private Pädagogische Hochschule Augustinum (Graz)
Prof. Kerstin Seneca Jensen, BEd MEd MA, Religionslehrerin, Private Pädagogische Hochschule Augustinum (Graz)
Unter Mitarbeit von:
Anna Almer, BEd. Religionspädagogin
Mag.a Dipl.-Päd.in Veronika Feiner, Religionspädagogin
Mag. Heinz Finster: Geschäftsführer Sonntagsblatt für Steiermark, Religionspädagoge, finsterverlag.at
Prof. OStR. Hans Neuhold, Religionspädagoge, Autor und Psychotherapeut
Prof.in Mag.a Carmen Stürzenbecher, Religionspädagogin, Private Pädagogische Hochschule Augustinum
Magdalena Wünscher, BEd, MEd, Religionspädagogin, Private Pädagogische Hochschule Augustinum
Die Schätze dieses Handbuches:
Es bietet eine Fülle von Ideen, Materialien und Arbeitsanregungen für den Religionsunterricht
Es begleitet und bereichert die Arbeit mit dem Schulbuch „Schatzbuch Religion“
Es bietet Anregungen, Hintergrundinformationen, methodisch-didaktische Anregungen zu jeder einzelnen Doppelseite des Religionsbuches
Es bietet Verknüpfungen zum Lehrplan, formuliert Lernanlässe und beispielhaft zu erwerbende Kompetenzen
Es zeigt auf, wie die einzelnen Kapitel des Schulbuches den Lehrplan aufgreifen
Es beinhaltet viele Kopiervorlagen und kreative Gestaltungsvorschläge
Es zeigt durch Beispielfotos Blitzlichter aus der konkreten Arbeit mit dem Religionsbuch „Schatzbuch Religion 1“ in der Schule
Es finden sich Lieder, Geschichten, Anregungen zum Philosophieren mit Kindern
FinsterVerlag 2024
