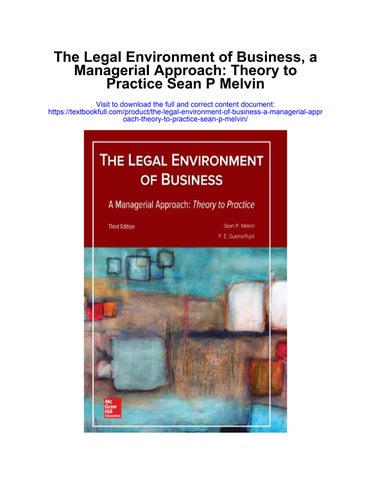changes to this edition
The authors embrace a commitment to continuous improvement of the content, case selection, features, and approach embodied in this textbook. We are privileged to have candid review, suggestions, and guidance from over 100 business law professors from a wide variety of colleges and universities. Much of this third edition is based on specific feedback from our reviewers and students.
■ Full Integration of Strategic Approach: Chapter 1 provides an overview Strategic Legal Solutions: The Big Picture and Legal Strategy 101 is featured at the end of each chapter.
■ New Coverage for Current Controversies in Business Ethics: Includes material on patent trolls, Facebook’s secret psychology experiment, and products liability for gun manufacturers.
■ Streamlined and Updated Contracts Content: Three chapters converted to two chapters with new cases.
■ Expanded Fourth Amendment Material: Warrant requirement and exceptions including “electronic searches.”
■ New Chapter Review Questions: Plus Answers and Explanations at the end of each chapter.
■ New Material: Includes coverage of crowdfunding, peer-to-peer lending, the Affordable Care Act, Deepwater Horizon, Uber’s legal challenges, insider trading, whistleblowers, and the Dodd-Frank Act.
■ Over 50 New Business-Centered Cases that Connect with Students
• EEOC v. Abercrombie (Employee head scarf)
• U.S. v. Ulbricht (Dread Pirate Roberts/Silk Road)
• NFL v. Tom Brady (Effect of binding arbitration)
• Franklin v. Facebook (Forum selection)
• Citizens United v. FEC (First Amendment)
• Yost v. Wabash College and Phi Kappa Psi Fraternity (Liability for hazing)
• O’Bannon v. NCAA (Antitrust and NCAA athletes)
■ Popular Features Expanded and Updated: Three Business Law Simulations (hypothetical disputes) centered on restrictive covenants, trademarks in cyberspace, and ADA liability; Capstone Case Studies (legal and ethical dilemmas faced by actual
companies) from a multidimensional perspective, including an award-winning case: Coffee Wars: Starbucks v. Charbucks; Self-Checks; Key Points; Theory to Practice problems; and Manager’s Challenge.
Chapter 1
■ Streamlined introductory material
■ New 2015 case: U.S. v. Ulbricht (Dread Pirate Roberts/Silk Road)
■ New 2016 case: Specific Performance as a Remedy
■ New Key Terms
■ Replaced Equitable Maxims section with new “Table of Maxims”
■ New section: Strategic Legal Solutions: The Big Picture
Chapter 2
■ New case: Citizens United v. FEC
■ New section: The Fourth Amendment
■ New case: U.S. v. Jones
■ New feature: Chapter Review Questions
■ New feature: Legal Strategy 101 (“The Strategic Legal Battle for Equality”)
Chapter 3
■ Updated table: U.S. Supreme Court Acceptance Rate
■ New case: Goodyear Dunlop Tires Operation v. Brown
■ New figure: Facebook’s Forum Selection Clause
■ New case: Franklin v. Facebook
■ New section: Internet and E-mail Jurisdiction
Chapter 4
■ Updated Litigation section
■ New section on Labor Arbitration
■ New case: NFL v. Brady
■ New Key Points
■ New Critical Thinking case questions
Chapter 5
■ New Legal/Ethical Reflection and Discussion: “The Trolley Problem”
■ New subsections: “Natural Law” and “Contract-Based Approach”
■ Updated Legal/Ethical Reflection and Discussion on “The Penn State Saga”
■ New Ethical Decision-Making Case Study: “Facebook’s Secret Psychology Experiment: The Law & Ethics of A/B Testing”
■ New Critical Thinking case questions
Chapter 6
■ Updated material on Advertisements as Contracts
■ Streamlined chapter by combining Overview and Formation
■ New case: Capacity to Contract
■ New Key Point
■ New summary table
■ New Critical Thinking case questions
Chapter
7
■ Streamlined chapter by combining Enforceability with Performance
■ Updated material on Anticipatory Breach
■ New case: Statute of Frauds
■ New Key Point
■ New Self-Check
■ New Critical Thinking case questions
Chapter
8
■ New Key Points
■ New sample form: Purchase Order
■ New 2016 case: Battle of the Forms
■ New material: Statute of Frauds
■ New material and new case: Risk of Loss
■ New Critical Thinking questions for cases
Chapter
9
■ New 2015 case: Defamation in Employment References
■ New material for Defenses to Defamation
■ New section on Assumption of Duty
■ New 2014 case: Fraternity/College Liability for Hazing
■ Updated Legal Implications in Cyberspace
■ New material for Inadequate Warning
■ New case: Lack of Warning
■ New Legal/Ethical Discussion on Products Liability and Guns
■ New End-of-Chapter case summaries
■ New Critical Thinking case questions
Chapter
10
■ New material on ABC Test for Agency Status
■ New case: Employee vs. Independent Contractor
■ New material on Uber Controversies
■ New Critical Thinking case questions
■ Updated Strategic Legal Solutions
■ New 2014 case: Apparent Authority
■ New material on Going-and-Coming Rule
■ New 2013 case: Employer Liability for Agents
■ New case: Fiduciary Duty of Agents
Chapter
11
■ New case: Implied Employment Contracts
■ New Critical Thinking case questions
■ New material on Whistleblower Statutes
■ New 2014 case: Whistleblower Protection
■ New material: Affordable Care Act
■ New material: Family Medical Leave Act (FMLA)
■ New 2012 case: FMLA Retaliation
Chapter 12
■ New material on Disparate Treatment Theory
■ New 2015 case: EEOC v. Abercrombie (Employee head scarf)
■ Expanded coverage of Sexual Harassment Claims
■ New 2012 case: Hostile Work Environment
■ New Strategic Legal Solutions: Preventing Harassment
■ New flow chart: Title VII Analysis
■ New material on Americans with Disabilities Act (ADA)
■ New 2014 case: Qualified Individuals under ADA
■ New material on Faragher/Ellerth Defense
Chapter 13
■ New 2012 case: Successor Liability of Sole Proprietor
■ New material on Partnership at Will
■ New 2013 case: Wrong Dissociation of a Partner
■ New Critical Thinking case questions
■ New Key Point
Chapter
14
■ Reorganized section on LLCs
■ New 2013 case: Breach of Fiduciary Duty by an LLC Member
■ New Key Point
■ New Critical Thinking case questions
■ Revised Manager’s Challenge
Chapter
15
■ Updated Fiduciary Duties section
■ New material on the Corporate Opportunity Doctrine
■ New Concept Summary
■ New 2012 case: Reasonable Expectations Test
■ New material on Piercing the Corporate Veil
■ New Critical Thinking case questions
Chapter
16
■ Streamlined material on Fundamentals of the Securities Market and Howey Test
■ New material: Crowdfunding
■ New material: Peer-to-Peer Lending
■ New material: Stock Market Games
■ New material: Parties in a Securities Transaction
■ New Concept Summary (Categories of Securities)
■ New material: Process of a Public Offering
■ Streamlined material on Regulation D Exemptions
■ New table: Summary of Exemptions
■ New table: Crowdfunding Regulation
■ New material: Safe Harbors
■ New material: Insider Trading
■ New 2014 case: Tipper-Tippee Liability
■ New material: Personal Benefits Test
■ New 2015 case coverage: U.S. v. Newman
■ New 2013 case: Dodd-Frank Whistleblower
■ New material on Dodd-Frank Act
■ New table: Insider Trading Theories
Chapter
17
■ New Legal Implications in Cyberspace: Net Neutrality
■ New material: Regulatory Flexibility Act
■ New 2012 Case: Regulation of For-Profit Universities
■ New Critical Thinking case questions
■ New 2016 case: VanHollen v. Federal Election Commission (Arb. and Cap. Std.)
■ Updated Manager’s Challenge
■ Added Critical Thinking questions to cases
Chapter 18
■ Updated Strategic Legal Solutions for Managers
■ New material on Deepwater Horizon (BP) Oil Spill
■ New 2014 case: BP Liability for Reckless Conduct
■ Updated Theory to Practice questions
■ Added Critical Thinking questions to cases
Chapter 19
■ New material: Rule of Reason
■ New 2015 case: O’Bannon v. NCAA –Rule of Reason and NCAA Athletes
■ New 2015 case: FTCA–Monopoly Power
■ New Key Points
■ Updated “Search Bias” Investigation against Google
■ New Antitrust and Sports section
■ New Critical Thinking case questions
Chapter 20
■ Updated Bankruptcy Guidelines/Amounts to 2016 Regulations
■ New material on Bad Faith Filings
■ New 2014 case: Power of Trustees
■ New material on the Fraud Exception
■ New 2015 case: Preferential Transfers
■ New Critical Thinking case questions
Chapter 21
■ Increased coverage of Warranties
■ Added section on CFBP and New Rules as a Result of Dodd-Frank
■ Added 2016 case: CFPB v. Pressler (Debt Collection)
■ Updated section on Credit Transactions
■ Added Key Points
■ Added new Self-Check questions
■ Added Critical Thinking questions to cases
Chapter 22
■ New section on the Park Doctrine
■ Increased coverage of the Fourth Amendment and the Impact of Technology on Warrants Requirements
■ New Fourth Amendment summary table
■ New Business Ethics feature: Enforcement of Insider Trading Laws
■ New section on Cardinals Hacking and CFAA
■ Added Critical Thinking questions to cases
Chapter 23
■ New section on Mislaid/Lost/Abandoned Property
■ New case on Treasure Troves
■ New Key Point
■ Updated Landlord/Tenant section
■ Updated Strategic Legal Solutions for Managers
Chapter 24
■ Updated Trade Secret section
■ New section on Strategic Use of Trademark Product Design
■ New USPTO case: In re Hershey Chocolate and Confectionary Corp.
■ New section on Enforcing and Maintaining a Trademark
■ New section on First Amendment Concerns and the “Slants” Test/Washington Redskins Mark Cancellation
■ New section on Patents: Application Process
■ New SCOTUS case: Alice Corporation v. CLS Bank International (Business Method/Software Patents)
■ New Business Ethics feature: Patent Trolls
■ New Key Points
Chapter 25
■ Updated section on Comity
■ New section on “Foreign Official” and the FCPA
■ New 2015 case: Haiti Telco (Bribery)
■ Updated section on World Court and European Court of Justice
UNIT ONE Fundamentals of the Legal Environment of Business 1
Chapter 1 Legal Foundations 2
Appendix to Chapter 1 A Business Student’s Guide to Understanding Cases and Finding the Law 32
Chapter 2 Business and the Constitution 40
Chapter 3 The American Judicial System, Jurisdiction, and Venue 74
Chapter 4 Resolving Disputes: Litigation and Alternative Dispute Resolution 108
Chapter 5 Business, Societal, and Ethical Contexts of Law 138
UNIT TWO Law and Commerce 165
Chapter 6 Overview and Formation of Contracts 166
Chapter 7 Contract Enforceability and Performance 200
Chapter 8 Contracts for the Sale of Goods 238
Chapter 9 Torts and Products Liability 274
Business Law Simulation Exercise 1
UNIT THREE Regulation in the Workplace 317
Chapter 10 Agency 318
Chapter 11 Employment Relationships and Labor Law 354
Chapter 12 Employment Discrimination 396
Business Law Simulation Exercise 2
UNIT FOUR Business Entities, Securities Regulation, and Corporate Governance 441
Chapter 13 Choice of Business Entity, Sole Proprietorships, and Partnerships 442
Chapter 14 Limited Liability Companies and Limited Liability Partnerships 468
Chapter 15 Corporations 486
Chapter 16 Regulation of Securities, Corporate Governance, and Financial Markets 516
UNIT FIVE Regulatory Environment of Business 557
Chapter 17 Administrative Law 558
Chapter 18 Environmental Law 588
Chapter 19 Antitrust and Regulation of Competition 618
Chapter 20 Creditors’ Rights and Bankruptcy 642
Chapter 21 Warranties and Consumer Protection Law 666
Chapter 22 Criminal Law and Procedure in Business 694
Chapter 23 Personal Property, Real Property, and Land Use Law 728
Chapter 24 Intellectual Property 756
Chapter 25 International Law and Global Commerce 794
Business Law Simulation Exercise 3
CAPSTONE CASE STUDIES
1. Coffee Wars: Starbucks v. Charbucks 822
2. The Odwalla Juice Company Crisis 826
3. Fraud under the Arches: The McDonald’s Game Piece Scandal 830
APPENDIX A The Constitution of the United States of America 836
APPENDIX B Excerpts from the Sarbanes-Oxley Act of 2002 846
\\ UNIT ONE Fundamentals of the Legal Environment of Business
CHAPTER 1 Legal Foundations 2
Introduction to Law 3
Purposes of Law 3
Language of the Law 4
Legal Decisions in A Business Environment: Theory to Practice 4
Legal Insight and Business Strategy 5
Role of Counsel 5
Sources and Levels of American Law 7
Constitutional Law 8
Case 1.1 Arizona v. United States, 132 S.Ct. 2492 (2012) 8
Statutory Law 9
Interpreting Statutes 10
Finding Statutory Law 10
Case 1.2 U.S. v. Ulbricht, 31 F. Supp. 3d 540 (S.D.N.Y. 2014) 11
Common Law 12
Stare Decisis and Precedent 13
Stare Decisis and Business 13
Administrative Law 13
Landmark Case 1.3 Flagiello v. Pennsylvania Hospital, 208 A.2d 193 (Pa. 1965) 14
Secondary Sources of Law 15
Uniform Model Laws 15
Restatements of the Law 16
Categories of Law 18
Criminal Law versus Civil Law 18
Substantive Law versus Procedural Law 18
Law versus Equity 19
Case 1.4 Wilcox Investment, L.P. v. Brad Wooley Auctioneers, Inc., et al., 454 S.W.3d 792 (Ct. of Appeals of Arkansas 2015) 19
Public Law versus Private Law 20
Strategic Legal Solutions: The Big Picture 21
Overview 21
Strategy #1—Noncompliance 22
Strategy #2—Avoidance 22
Strategy #3—Prevention 23
Strategy #4—Value Creation (or “Legal
Competitive Advantage”) 23
Summing Up 25
Key Terms 25
Chapter Review Questions 26
Theory to Practice 27
Manager’s Challenge 27
Appendix to Chapter 1: A Business Student’s Guide to Understanding Cases and Finding the Law 32
CHAPTER 2
Business and the Constitution 40
Structure of the Constitution: Federal Powers 41
Structure of the Constitution 41
Amendments 42
Overview of Federal Powers 42
Article I—Congressional Powers 42
Article II—Executive Powers 43
Article III—Judicial Powers 43
Case 2.1 United States v. Alvarez, 132 S.Ct. 2537 (2012) 44
Separation of Powers 45
Applying the Constitution: Standards of Judicial Review 45
Rational Basis Review 45
Intermediate-Level Scrutiny 45
Strict Scrutiny 46
Case 2.2 Brown v. Entertainment Merchants Association, 131 S.Ct. 2729 (2011) 46
The Supremacy Clause and Preemption 47
Commerce Powers 48
Application of Commerce Powers 48
Interstate versus Intrastate Commercial Activity 48
Case 2.3 Gonzalez v. Raich, 545 U.S. 1 (2005) 48
The Commerce Clause and Civil Rights Legislation 49
Noncommercial Activity 50
Constitutional Restrictions on State Regulation of Commerce 51
Tax and Spend Powers 51
Necessary and Proper Clause 52
Constitutional Protections 54
The Bill of Rights and Business 54
The First Amendment 54
Limits on Free Speech 55
Commercial Speech 55
Case 2.4 R.J. Reynolds Tobacco Company v. Food and Drug Administration, 696 F.3d 1205 (D.C. Cir. 2012) 56
Advertising and Obscenity Regulation 56
Political Speech by Corporations 57
Case 2.5 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010) 58
The Fourth Amendment 59
Exceptions 60
Reasonableness Requirement 61
Searches and Seizures 61
Case 2.6 United States v. Jones, 132 S.Ct. 945 (2012) 62
Postscript: The USA Patriot Act 62
Due Process Protections 64
Due Process 64
Equal Protection 64
Postscript: The Right to Privacy 65
Federal Statutes 66
Workplace Privacy 66
Key Terms 66
Chapter Review Questions 67
Theory to Practice 68
Legal Strategy 101 68
Manager’s Challenge 70
CHAPTER 3 The American Judicial System, Jurisdiction, and Venue 74
Role and Structure of the Judiciary 74
State versus Federal Courts 75
State Courts 75
Federal Courts 78
How the Law Develops 80
Jurisdiction and Venue 82
Jurisdiction and Business Strategy 83
Overview of Jurisdiction 83
Two-Part Analysis 83
Subject Matter Jurisdiction:
Authority over the Dispute 84
Original versus Concurrent Jurisdiction 84
Choice of Forum 85
Jurisdiction over Property 86
Personal Jurisdiction 86
In-State Defendants 86
Out-of-State Defendants 87
Case 3.1 Goodyear Dunlop Tires Operation v. Brown, 131 S.Ct. 2846 (2011) 87
Injurious Effect 88
Case 3.2 Clemens v. McNamee, 615 F.3d 374 (5th Cir. 2010) 89
Physical Presence 90
Voluntary 90
Venue 91
Case 3.3 Franklin v. Facebook, No. 1:15-CV-00655 (N.D. Georgia 2015) 92
Internet and E-Mail Jurisdiction 93
How the Law Develops in Real Time 93
International Jurisdiction in the Internet Age 96
Country of Origin Standard 97
Other Theories of Jurisdiction in Electronic
Commerce 97
Key Terms 98
Chapter Review Questions 99
Theory to Practice 100
Legal Strategy 101 100
Manager’s Challenge 101
CHAPTER 4 Resolving Disputes: Litigation and Alternative Dispute Resolution 108
Civil Litigation 109
Dispute Resolution and Business Planning 109
Stages of Litigation 109
Prelawsuit: Demand and Prelitigation
Settlement Negotiations 109
Standing 110
Statute of Limitations 111
Pleadings Stage 111
Complaint and Summons 111
Answer 111
Counterclaim 114
Cross-Claim 114
Motions 114
Discovery Stage 114
Scope, Timing, and Methods of Discovery 115
Case 4.1 20/20 Financial Consulting, Inc. v. John Does 1-5, 2010 U.S. Dist. LEXIS 55343 (D.C. Colo. 2010) 116
Case 4.2 Bridgestone Americas Holding, Inc. v. Mayberry, 854 N.E.2d 355 (Ind. Ct. App. 2006) 118
Pretrial Conference 119
Trial 120
Jury Selection and Opening Statements 120
Testimony and Submission of Evidence 120
Closing Arguments and Charging the Jury 120
Deliberations and Verdict 120
Posttrial Motions and Appeals 121
Collecting the Judgment 121
Alternative Dispute Resolution 122
Informal ADR 122
Formal ADR 123
Arbitration 123
Legally Mandated Arbitration 123
Federal Arbitration Act 124
Case 4.3 American Express v. Italian Colors Restaurant, 133 S.Ct. 2304 (2013) 125
Employment and Labor Arbitration 125
Case 4.4 National Football League Management Council v. Brady, No. 15-2801 (2d Cir. 2016) 126
Mediation 127
Expert Evaluation 127
Other Forms of ADR 128
Key Terms 129
Chapter Review Questions 130
Theory to Practice 131
Legal Strategy 101 131
Manager’s Challenge 132
CHAPTER 5 Business, Societal, and Ethical Contexts of Law 138
What is Ethics? 139
Moral Philosophy and Ethical Decision Making 139
Principles-Based Approach 139
Religion 139
Virtue 139
Natural Law 139
The Categorical Imperative 140
Consequences-Based Approach 140
Contract-Based Approach 141
Business Ethics Defined 142
Primary and Secondary Stakeholders 142
Moral Minimum versus Maximizing Profits 143
Case 5.1 Ypsilanti Township v. General Motors Corporation, 506 N.W.2d 556, 201 Mich. App. 128 (1993) 145
Values Management and Challenges to Business Ethics 146
Common Traits of Effective Values Management 146
Strategic Advantages of Values Management 149
Cultivation of Strong Teamwork and Productivity 149
Clarity in Business Operations 150
Public Image 150
Staying the Ethical Course in Turbulent Times 150
Ethical Decision Making: A Manager’s Paradigm 150
Ethical Decision-Making Case Studies 150
Facebook’s Secret Psychology Experiment:
The Law and Ethics of A/B Testing 151
Public Outcry 152
Ethical Analysis 152
Facebook’s Secret Psychology Experiment: Questions for Discussion 153
AIG Bonusgate: Legal, Managerial, and Ethical
Perspectives 153
Political Reaction 153
Mounting Pressures 154
Cooler Heads 154
AIG Bonusgate: Questions for Discussion 154
Corporate Social Responsibility 155
The Narrow View: “Greed Is Good” 155
The Moderate View: Just Follow the Law 156
The Broad View: Good Corporate Citizenship 156
Landmark Case 5.2 Grimshaw v. Ford Motor Company, 119 Cal. App. 3d 757 (1981) 156
Key Terms 158
Chapter Review Questions 158
Theory to Practice 159
Legal Strategy 101 160
Manager’s Challenge 161
\\ UNIT TWO Law and Commerce
CHAPTER 6 Overview and Formation of Contracts 166
Definition of a Contract 167
Categories of Contracts 167
Written versus Oral Contracts 167
Bilateral versus Unilateral Contracts 167
Case 6.1 Augstein v. Leslie and NextSelection, Inc., 11 Civ. 7512 (HB) (S.D.N.Y. 2012) 168
Express versus Implied versus Quasi-Contracts 169
Other Categories 170
Sources of Contract Law 171
Contract Transactions 172
Contract Formation 173
Offer 173
Advertisements as an Offer 174
Landmark Case 6.2 Lucy v. Zehmer, 84 S.E.2d 516 (Va. 1954) 175
Case 6.3 Leonard v. PepsiCo, Inc., 210 F.3d 88 (2d Cir. 2000) [affirming lower court decision and reasoning in 88 F. Supp. 2d 116 (S.D.N.Y. 1999)] 176
Acceptance 177
Termination of an Offer 177
Termination by Operation of Law 180
When Acceptance Is Effective: The Mailbox Rule 180
Silence as an Acceptance 182
Insufficient Agreement 182
Indefinite Terms 183
Mistake 183
Consideration 184
Legal Detriment 185
Amount and Type of Consideration 185
Preexisting Duty Rule 186
Bargained-for Exchange 186
Past Consideration 187
Promissory Estoppel 187
Capacity 188
Minors 188
Mental Incompetents 189
Case 6.4 Sparrow v. Demonico, Supreme Judicial Court of Massachusetts, 461 Mass. 322 (2012) 189
Legality 190
Key Terms 191
Chapter Review Questions 193
Theory to Practice 193
Legal Strategy 101 194
Manager’s Challenge 195
CHAPTER 7 Contract Enforceability and Performance 200
Enforceability 200
Genuineness of Assent 200
Misrepresentation 201
Fraudulent Misrepresentation 201
Case 7.1 Italian Cowboy Partners, Ltd. v. The Prudential Insurance Company of America, 341 S.W.3d 323 (Tex. Supr. Ct. 2011) 202
Duress 204
Undue Influence 204
Unconscionability 204
Statute of Frauds 205
Case 7.2 Holloway v. Dekkers and Twin Lakes Golf Course, 380 S.W.3d 315 (Tx. Ct. of App. 2012) 206
Interpretation Rules for Written Contracts 207
Nature and Effect of Conditions 209
Categories of Conditions 209
Good Faith Performance and Discharge 211
Substantial Performance 212
Landmark Case 7.3 Jacob and Youngs v. Kent, 129 N.E. 889 (Ct. App. N.Y. 1921) 213
Other Events of Discharge 214
Mutual Consent 214
Operation of Law 216
Impossibility 216
Impracticability 217
Frustration of Purpose 217
Breach of Contract and Anticipatory Repudiation 218
Anticipatory Repudiation 219
Case 7.4 DiFolco v. MSNBC, 622 F.3d 104 (2d Cir. 2010) 219
Remedies at Law 221
Compensatory Damages 221
Consequential Damages 222
Restitution 222
Liquidated Damages 223
Equitable Remedies 223
Specific Performance 223
Injunctive Relief 224
Reformation 224
Avoidance and Mitigation of Damages 224
Clean Hands and Tender of Performance 224
Contracts Involving Rights of a Third Party 225 Assignment 225
Delegation 226
Third-Party Beneficiaries 226
Case 7.5 Emmelyn Logan-Baldwin et al. v. L.S.M.
General Contractors, Inc., et al., 942 N.Y.S.2d 718, 94 A.D.3d 1466 (N.Y. 2012) 227
Key Terms 228
Chapter Review Questions 230
Theory to Practice 231
Legal Strategy 101 231
Manager’s Challenge 232
CHAPTER 8 Contracts for the Sale of Goods 238
Introduction to Article 2 of the UCC 239
UCC Coverage and Definitions 239
Function of the UCC 239
Agreement in a Sales Contract: Offer 240
Offers with Open Terms 241
Quantity 241
Other Open Terms 241
Firm Offers by Merchants 242
Agreement in Sales Contracts: Acceptance 242
Battle of the Forms 242
Nonmerchant Transactions 242
Merchant Transactions 243
Case 8.1 Hebberd-Kulow Enterprises v. Kelomar, No. D066505, Court of Appeals of California (2016) 244
Consideration 245
Statute of Frauds 246
Title and Allocation of Risk 248
Title 248
Risk of Loss 248
Goods Picked Up by the Buyer 249
Performance of Sales Contracts 251
Obligations of All Parties 251
Seller’s Obligations and Rights 251
Perfect Tender 252
Cure 252
Case 8.2 Car Transportation Brokerage Company v. Blue Bird, No. 08-16103 (11th Cir. 2009) 253
Commercial Impracticability 253
Buyer’s Rights and Obligations 255
Buyer’s Right of Inspection: Acceptance or Rejection 255
Special Rules for Installment Contracts 256
Breach and Remedies in Sales Agreements 257
Anticipatory Repudiation in the UCC 257
Remedies Available to the Seller 257
Goods in Hands of Seller 257
Goods in Hands of Buyer 258
Remedies Available to the Buyer 258
Remedies Following Rejection of Goods 258
Cover 258
Lawsuit for Money Damages 259
Specific Performance 259
OF CONTENTS
Remedies Following Acceptance of Nonconforming Goods 259
Revocation of Acceptance 259
Lawsuit for Money Damages 260
Risk of Loss 260
Case 8.3 3L Communications v. Merola d/b/a NY
Telecom Supply, No. M2012-02163-COA-R3-CV, Court of Appeals of Tennessee (2013) 260
Contracts for International Sales of Goods 262
U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods 262
Coverage and Major Provisions of CISG 262
No Writing Required 262
Offer and Acceptance 263
Remedies 263
INCO: International Chamber of Commerce Terms 263
Key Terms 264
Chapter Review Questions 266
Theory to Practice 266
Legal Strategy 101 267
Manager’s Challenge 268
CHAPTER 9 Torts and Products Liability 274
Overview of Tort Law 275
Sources of Law 275
Categories of Torts 275
Intentional Business-Related Torts 276
Defamation 276
Public Figure Standard 276
Defenses to Defamation 277
Truth 277
Privilege Defenses 277
Case 9.1. Nelson v. Tradewind Aviation, No. AC34625, Appellate Court of Connecticut (2015) 278
Trade Libel and Product Disparagement Laws 279
Fraudulent Misrepresentation 279
False Imprisonment 281
Business Competition Torts 283
Tortious Interference with Existing Contractual Relationship 283
Tortious Interference with Prospective Advantage 283
Negligence 285
Elements of Negligence 285 Duty 285
Case 9.2 Yost v. Wabash College, Phi Kappa Psi Fraternity, et al., 969 3 N.E.3d 509 (Indiana 2014) 287
Breach of Duty 288
Cause in Fact 290
Proximate (Legal) Cause 290
Landmark Case 9.3 Palsgraf v. Long Island Railroad Co., 162 N.E. 99 (N.Y. Ct. App. 1928) 291
Actual Damages 292
Defenses to Negligence Claims 293
Comparative Negligence 293
Assumption of the Risk 293
Case 9.4 Zeidman v. Fisher, 980 A. 2d 637 (Pa. Super. Ct. 2009) 294
Strict Liability Torts 295
Abnormally Dangerous Activities 295
Products Liability 296
Negligence 296
Warranty 296
Strict Liability 296
Defining “Defect” 297
Case 9.5 Bunch v. Hoffinger Industries, 20 Cal. Rptr. 3d 780 (Cal. App. 2004) 298
Causation and Damages 301
Seller’s Defenses 301
Key Terms 302
Chapter Review Questions 303
Theory to Practice 304
Legal Strategy 101 305
Manager’s Challenge 305
BUSINESS LAW SIMULATION EXERCISE 1 Restrictive Covenants in Contracts: Neurology Associates, LLP v. Elizabeth Blackwell, M.D. 310
\\ UNIT THREE
Regulation in the Workplace
CHAPTER 10 Agency 318
Definitions and Sources of Agency Law 318
Classification of Agents 319
Employee Agents 319
Employee Agents versus Independent Contractors: Direction and Control 319 State Law 320
Case 10.1 Avanti Press v. Employment Dept. Tax Sec., 274 P. 3d 190, Oregon Court of Appeals (2012) 321
Uber Settlement 322
IRS’s Three-Prong Test 323
Liability for Misclassification 323
Overview of an Agency Transaction 326
Creation of an Agency Relationship 326
Manifestations and Consent 326
Control 326
Formalities 326
Overlay of Agency Law with Other Areas of Law 327
Case 10.2 Bosse v. Brinker Restaurant d/b/a Chili’s Grill and Bar, 2005 Mass. Super. LEXIS 372 327
Liability of the Principal for Acts of the Agent 328
Authority 329
Actual Authority 329
Apparent Authority 329
Ratification 329
Case 10.3 GGNSC Batesville, LLC d/b/a Golden Living Center v. Johnson, 109 So.3d 562 (Miss. Supreme Court 2013) 330
Agent’s Contract Liability to Third Parties 330
Fully Disclosed Agency 331
Partially Disclosed Agency 331
Undisclosed Agency 331
Tort Liability to Third Parties 332
Physical Injury Requirement 332
Scope of Employment 332
Case 10.4 Moradi v. Marsh USA, Inc., 219 Cal.App.4th 886 (California Ct. App. 2013) 333
Intentional Torts 335
Negligent Hiring Doctrine 335 Independent Contractors 335
Duties, Obligations, and Remedies of the Principal and Agent 337
Agent’s Duties to the Principal 337 Loyalty 337 Obedience 337
Case 10.5 SP Midtown, Ltd. v. Urban Storage, LP (Tx. Ct. App, 14th Dist. 2008) 338
Care 338
Disclosure 339
Accounting 339
Principal’s Remedies for Breach 340
Rescission and Disgorgement 340
Unauthorized Acts of Agents 341
Duties and Obligations of the Principal to the Agent 341
Case 10.6 Romanelli v. Citibank, 60 A.D.3d 428 (2009) 341
Agent’s Remedies for Breach 342 Termination of The Agency Relationship 343 Express Acts 343
Operation of Law 344
Key Terms 345
Chapter Review Questions 347
Theory to Practice 347
Legal Strategy 101 348
Manager’s Challenge 349
CHAPTER 11 Employment
Relationships and Labor Law 354
Origins of Employment Regulation and Labor Law 355
Employment-At-Will Doctrine 355 Express Contracts 355
Labor Contracts 356
Implied Contracts 356
Case 11.1 Buttrick v. Intercity Alarms, 2009 Mass. App. Div. 97 (Mass. Dist. Ct. App. 2009) 356
Common Law Exceptions 357
Public Policy Exception 358
Statutory Exceptions 358
State Whistle-Blower Statutes 358
Case 11.2 Wurtz v. Beecher Metro District, 848 NW 2d 121 (Mich. 2014) 359
Federal Whistle-Blower Statutes 360
Employment Regulation 361 Wages and Hours 361
Minimum Wage, Maximum Hours, and Overtime 361
Case 11.3 Integrity Staffing Solutions v. Busk, 135 S.Ct. 513 (2014) 362
40-Hour Workweek 363
Exempt Employees 363
Case 11.4 Madden, et al. v. Lumber One Home Center, 745 F.3d 899 (8th Cir. 2014) 364
Misclassification 366
Child Labor Laws 367
State Wage and Hour Laws 367
Retirement 368
Regulation of Pensions and Retirement Accounts 368
Social Security 368
Health Care 369
Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 and Health Care and Education
Reconciliation Act of 2010 369
Sudden Job Loss 369
Workplace Injuries 370
Defenses to Workers’ Compensation Claims 370
Intentional Actions or Recklessness of the Employer 370
Course of Employment 370
Regulation of Workplace Safety 371
Occupational Safety and Health
Administration 371
Family and Medical Leave Act 372
FMLA Scope and Coverage 372
FMLA Protections 373
Case 11.5 Jaszczyszyn v. Advantage Health Physician Network, 2012 WL 5416616 (6th Cir. 2012) 373
Key Employees 374
Employee Privacy 375
Monitoring of E-Mail and Internet Usage 375
Employer Liability 376
Telephone and Voice Mail 376
Drug and Alcohol Testing 376
Another random document with no related content on Scribd:
zu allen Zeiten zu Wohlhabenheit und zu besonderen Ehren erhoben habe“, läßt uns aber von seinem Geschäftsbetrieb nichts erfahren. Nicht zutreffend ist die Behauptung (28), mit „Koptein“ würden nur die „Konsorten“ angeredet. Dieser Titel kam sämtlichen Teilhabern des Quartiers zu. — Rat Dr. Voigt (Mitt. V. 488 f.) hält es bei Besprechung eines alten Kontraktes für möglich, und Dr. Obst (Hamburger Fremdenblatt 17. Nov. 1905 und „Aus Hamburgs Lehrjahren“ 135 f.) scheint geneigt, sich ihm anzuschließen, daß diese Vereinigungen aus den Knevelkarrenführern hervorgegangen sein könnten. Mir ist dies höchst unwahrscheinlich, denn zum Quartiersmannsberuf eigneten sich nur solche Leute, die mit Behandlung von Waren, Packen usw. Bescheid wußten, also schon auf Speichern gearbeitet hatten. So wenig wie etwa die Ewerführer konnten die Kneveler für solche Beschäftigung gebraucht werden, denn sie hatten nichts weiter gelernt, als ihre Karre zu beladen und zu ziehen. Jünger 12 f. und 22 f. bringt ausführliches über die Quartiersleute.
Ich sagte vorhin, es sei zu bedauern, daß keiner aus der Mitte der Quartiersleute über seinen Stand geschrieben habe. Einer allerdings hat eine Ausnahme gemacht, Herr J. D. J. Pingel senior, der im Jahre 1880 ein hübsches Folioblatt „Hamburger Quartiersleute“ herausgab, das offenbar als Wandschmuck gedacht ist. Er liefert wenigstens einige Andeutungen über ihr Verhältnis zur Kaufmannschaft und die Art ihrer Beschäftigung und zählt zum Schluß etwa 80 Ökelnamen auf, die später von Dr. Borcherdt und anderen wieder abgedruckt wurden. Da die meisten, die in neuerer Zeit über den Gegenstand geschrieben haben, aus diesem Blatte ihre Kenntnisse geschöpft haben dürften (wie ihre Vorgänger aus Morasch und Schütze) und solches außerdem recht selten geworden ist, bringe ich es vollständig am Schluß dieses Heftes.
Um nichts auszulassen von dem, was ich gefunden habe, sei noch erwähnt, daß in zwei Volksstücken der Quartiersmann eine Rolle spielte. In „Hamburger Pillen“ von Schindler und Brünner (1870) trat bei Karl Schultze der 80jährige Quartiersmann Peter Bostelmann auf (Gaedertz II. 173 f.) und auf derselben Bühne im
Jahre 1882 ein Quartiersmann Cords in Schreyer und Hirschels „Hamburg an der Alster“ (Gaedertz II. 262).
Diese Nachrichten sind dürftig. Es mögen noch einige weitere zu finden sein, irgendwie belangreiche aber schwerlich, es sei denn, daß Privataufzeichnungen ans Licht kämen.
Wie und zu welcher Zeit haben wir uns nun das Entstehen des ersten „Quartiers“ zu denken? Nach meiner Ansicht dürfen wir uns das ohne irgendwelche Anknüpfung an eine schon vorhanden gewesene Organisation vorstellen. Wie so manches im kaufmännischen Betriebe sich auf leisen Anstoß entwickelt, wenn die Zeit dafür da ist, so auch hier. Ein paar unternehmende tüchtige Arbeiter haben sich zunächst einmal zusammengetan, um auf Empfehlungen gestützt und auf ihr ehrliches Gesicht hin den Versuch zu machen, solche Kunden zu gewinnen, für die sich die Anstellung eigener Hausküper und Speicherleute nicht lohnte. Als sich gute Erfolge ergaben, haben sie allmählich Nachahmer gefunden. Ähnlich so ging es im sechzehnten Jahrhundert mit der Einführung des Maklergewerbes in Hamburg (Ehrenberg 313, 317) und in neuerer Zeit beim Stande der Warenagenten. In den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts mußte man einen solchen mit der Laterne suchen. Und jetzt? Wie Sand am Meer sind sie zu finden! Abgesehen davon, daß die Umsätze früher weit kleiner waren, besaß jeder Kaufmann für Bezüge von auswärts oder Abladungen dahin seine festen Verbindungen, mit denen auch häufig für gemeinschaftliche Rechnung oder in Form von Aussendung auf eigene Gefahr gearbeitet wurde. Eines Vermittlers bedurfte man also nicht. Als die ersten schüchternen Versuche gemacht wurden, sich solcher zu bedienen, sahen die altbegründeten Firmen das beinahe als unlauteren Wettbewerb an. Ähnlich so werden anfangs die großen Kaufherrn mit eingeübtem Personal sich durchaus nicht angenehm berührt gefunden haben, als kleine neue Häuser in den „Packern“ eine Stütze fanden und ihnen nun oftmals durch Wettbewerb, wie sie ihn früher nicht gekannt hatten, das Leben sauer machten.


Wann aber dürfen wir die Entstehung des ersten Quartiers annehmen? Ich glaube der Antwort ziemlich nahe gekommen zu sein. In den Hamburger Kämmereirechnungen vom Jahre 1508 heißt es (Koppmann V. 66), daß für Erwerb des Bürgerrechts u. a. eingegangen seien 46 6 ß de 39 packers (richtig müßte es lauten: 46 16 ß, da der Satz 1 4 ß der Kopf war). Koppmann vermutet, wohl mit Recht, daß Packer bis dahin überhaupt nicht Bürger zu werden brauchten, aber 1508 sämtlich auf einmal hierzu veranlaßt wurden (VII. S. XLVI.). Da in einem Vertrage von 1693 die Quartiersleute sich als „Compagnions-Packer“ bezeichnen, so ist bestimmt anzunehmen, daß die „Packer“ von 1508 ihre Vorläufer waren. Vielleicht legte man diesen den Zwang des Bürgerwerdens auf, um unliebsame Elemente fernzuhalten, wie aus ähnlichem Grunde die Hausküper und Quartiersleute später darauf bestanden haben, daß die Lüd’ von de Eck Hamburger Bürger sein mußten. Außerdem erfuhr möglicherweise das Institut der Packer grade um jene Zeit eine starke Ausdehnung, da infolge eines Krieges zwischen Lübeck und Dänemark „der Sunt geschlossen und die Ostsehe ganz unsicher war, daz die Hollender, Brabanter und andere nationes mit iren gutern gen Hamburg kamen; und hat auf das mal die stat an kaufmanschaft sich merklich gebessert und vermeret“ (Tratziger 252, vergl auch Lappenberg 294).

Wenn wir annehmen dürfen, die einzelne Genossenschaft der Packer habe schon 1508 aus vier Teilhabern bestanden, so wären damals bereits zehn Quartiere vorhanden gewesen: bei dem Umfange der Unternehmungen immerhin eine stattliche Zahl. Ohne Zweifel sind sie ganz allmählich entstanden. Wir irren vielleicht nicht, wenn wir die erste Gründung in das vierzehnte Jahrhundert setzen, wo infolge der großartig entwickelten Bierausfuhr sich hier in immer steigender Anzahl solche Geschäftsleute eingefunden haben mögen, die mit den rückkehrenden Schiffen Waren aller Art bezogen, deren Vertrieb ihnen die Packer ermöglichten. Die ursprüngliche Zusammensetzung der Quartiere können wir uns dann etwa so denken, daß der „Baas“, der ihnen den Namen gab, auch die Kontrakte entwarf und die Rechnung führte, ein „Scholer“ war, während seine „Konsorten“ sich aus ehemaligen „Knechten“ des Kaufmanns rekrutierten. In späterer Zeit mögen sich häufig Küper zu
ihnen gesellt haben, als dies Gewerbe infolge Sinkens des Brauereibetriebes zurückging.
Übrigens sind auch Träger und Kohlenträger um die Wende des 16. Jahrhunderts veranlaßt worden, sämtlich auf einmal das Bürgerrecht zu erwerben (Koppmann IV. 343, 373), nur daß man diese zu ermäßigtem Satz zuließ. Vermutlich war ihr Verdienst ein weit geringerer als der der Packer (Koppmann VII. S. XLVI.).
In späteren Nachrichten ist, soviel mir bekannt, nichts über die Packer zu finden. Nur werden unter den zwischen 1591 und 1602 in Hamburg eingewanderten niederländischen Reformierten vier Packer, Paqueurs, mit Namen aufgeführt, sowie fünf weitere Paqueurs, die sich gleichzeitig in Stade niederließen (Mitt. 6. Jahrgang 35, 38).
Der älteste Kontrakt der Quartiersleute, der bis jetzt ans Tageslicht gekommen ist, findet sich Mitt. VI. 306 f. vollständig abgedruckt. Datiert vom Jahre 1693, stellt er die gemeinsame Tätigkeit der betreffenden Compagnions-Packer sowie die Tragung der Unkosten und den Anteil am Gewinn zu gleichen Teilen fest und ist sozusagen als auf ewige Zeiten geschlossen gedacht, da genaue Verabredungen getroffen sind, um vorzugsweise immer Familienmitglieder anstelle etwa Ausscheidender aufzunehmen. Ein anderer solcher Vertrag von 1716 ist auszugsweise Mitt. V. 488 f. wiedergegeben, ein dritter, von 1750, vollständig Mitt. XI. 151. Ein vierter endlich, von 1720, wurde im „Hamburgischen Correspondenten“ vom 17. März 1907 veröffentlicht und ist hier im Anhang nach der Urschrift wieder abgedruckt. Ähnliche Verabredungen für die Bedingungen bei Aufnahme neuer Mitglieder usw., wie darin zu finden, enthalten auch die anderen Kontrakte. Aus demjenigen von 1750 interessieren die Bestimmungen, daß einer der vier Maaten, der eine Ware veruntreuen würde, in schwere Strafe verfallen solle, und daß derjenige, der im Fall eines Streites unter den Teilhabern den ersten Schlag tun würde, einen Reichstaler an das Quartier entrichten müsse; verstände er sich hierzu nicht gutwillig, so sei ein Speziesdukaten (9,60 M.) „am Waysenhauß“ zu zahlen. Im Vertrage von 1716 wird für den Fall von Unstimmigkeiten angeordnet, daß notfalls zwei oder drei unparteiische Kaufleute als
Schiedsrichter anzurufen sind, deren Ausspruch bei Vermeidung einer Strafe zu befolgen ist.
Selbst wenn meine Meinung nicht berechtigt wäre, daß wir die „Packer“ des Jahres 1508 als Vorläufer der „Compagnions-Packer“ von 1693 anzusehen haben, darf doch wohl jedenfalls als feststehend betrachtet werden, daß zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts das Institut der Quartiersleute kein neues mehr war.
Auf ein Alter von mindestens dreihundert Jahren kann es also zweifellos zurückblicken. Genaues wird sich nicht ermitteln lassen, sicher ist aber, daß in dieser langen Zeit nirgends eine Andeutung zu finden ist, wonach das Vertrauen zwischen Kaufherr und Packer je gelitten hätte. Dem Bibliothekar unserer Kommerzbibliothek, Herrn Dr. Ernst Baasch, verdanke ich die Mitteilung, er habe bis etwa 1815 bei Durcharbeitung der Akten unserer Kommerzdeputation Überhaupt keinen einzigen Fall entdeckt, wo Streitigkeiten oder Schwierigkeiten zwischen Kaufmann und Quartiersleuten erwähnt würden, während von anderen Hülfsarbeitern des Handels, z. B. den Litzenbrüdern (einer Art Transportvermittler), recht häufig aus solchem Anlaß die Rede sei. Gewiß ein glänzendes Zeugnis für alle Beteiligten. Das angenehme Verhältnis, das stets zwischen Kaufmann und Quartiersmann herrschte, wird übrigens auch dadurch gekennzeichnet, daß die Söhne des letzteren auch bei Firmen allerersten Ranges auf Wunsch sehr gern Stellung als Lehrlinge erhielten. Der junge Mann erwarb sich auf diese Weise manche Kenntnisse, die ihm beim Eintritt ins „Quartier“ seines Vaters später von großem Nutzen sein konnten. Auch dem Kaufmann konnte es im übrigen nur dienlich sein, wenn unter seinen Arbeitsübernehmern sich einer befand, der durch Einblick in den Gang des Geschäfts und die mancherlei Schwierigkeiten, die dabei zu Überwinden waren, die Befähigung erlangt hatte, sich über die peinliche Genauigkeit klar zu werden, die in jeder Hinsicht beobachtet werden mußte.
Der Name Quartiersleute (statt Packer, wie es in dem alten Kontrakte heißt) scheint zuerst im Anfange des 18. Jahrh. in Gebrauch gekommen zu sein. Man findet ihn im „Patriot“ No. 9 vom 2. März 1724 S. 4 und in No. 40 vom 5. Oktober 1724 S. 3. Mit der
Zahl der Teilhaber, wie Schütze meint und andere von ihm abschrieben, hat die Benennung wohl nichts zu tun, denn Quartier bedeutet nicht vier sondern Viertel. Es ist anzunehmen, daß ihr Geschäftslokal („da wir unser Quartier haben“) den ersten Anlaß gegeben hat, nachdem sich hieraus die Bedeutung eines Anteils an ihrer Genossenschaft entwickelt hatte („sein Quartier verkaufen“, „in oder auf das Quartier heiraten“). Man vergleiche den Kontrakt S. 51 f. (Ob man nebenbei an die Zahl vier gedacht hat, mag dahingestellt bleiben. S. auch Goedel, Quickbornbuch 9, S. 68.)
Das Hauptarbeitsgebiet der Quartiersleute lag innerhalb der Speicherräume ihrer Kunden. Nur ausnahmsweise konnte man ihre Leute bei Transporten von Waren in den Straßen antreffen. Für Bestellungen suchte man sie in ihrem Quartier auf. Fand man dessen Tür verschlossen, so sah man auf der schwarzen Tafel, die daneben hing und in einer kleinen Lade Schwamm und Kreide barg, vielleicht die tröstliche Versicherung, „Gleich wieder“ oder „10 Uhr wieder hier“ oder sonst die Angabe der Arbeitsstelle, wo sie beschäftigt waren. (Das hieß dann: „H e h e t s i c k n a s c h r e b e n “). Nicht immer hatte man die Gewißheit, sie dort noch anzufinden. War man nach Jakobsens Speicher, dritter Boden, hinaufgeklettert, so wurde man vielleicht nach dem vierten Boden einer anderen Stelle weiter verwiesen, wenn nicht gar nach der großen Elbstraße in Altona. Hier hatten sie regelmäßig zu tun, weil in den Speichern an der Elbe große Läger, vor allem von Kaffee, zu bearbeiten waren, die sich behufs Ersparung des Hamburger Eingangszolles von ½ v. H. dahin gezogen hatten. Ihre Gerätschaften, besonders Länge und Markputt, bewahrten sie in bestimmten Wirtschaften der Vorstadt St. Pauli und Altonas auf, in denen sie sich dann früh morgens einstellten, um auf einer großen schwarzen Tafel zu verzeichnen, wo sie zunächst bei der Arbeit zu finden sein würden. Verließen sie diese Stelle, so fanden die Fuhrleute der Eisenbahn und die Ewerführer dort neuen Nachweis. Hier besonders gingen sie nur unter ihrem „Ö k e l n a m e n “, die jeder kennen mußte, der nach ihnen herumfragte. Zum ausführlichen Verzeichnis derselben, das ich am Schlusse gebe, bemerke ich, daß diese Beinamen nicht als
Spott aufgefaßt wurden, sondern als gutmütige Scherze, die niemand übelnehmen konnte und die schließlich haften geblieben waren. Ihre Entstehung ist nur in wenigen Fällen nachzuweisen. D e B l a u e n hieß ein Quartier, das viel mit Indigo zu tun hatte.
B ö h n h a s e n sind unzünftige Handwerker oder Leute, die in unberechtigter Weise Geschäfte betreiben (Rüdiger in „Hamburg vor 200 Jahren“ 223 f., Korr. Bl. 23, 88). D a c k l ü ü n k e n war der Spitzname eines Quartiers, das ursprünglich auf dem höchsten Boden eines Speichers gehaust hatte (Lüünk = Sperling). D u n k i s hießen Rabeler u. Kons., weil sie als die ersten den Versuch gemacht hatten, Waren mittels einer Dampfwinde (Donkeymaschine) aus der Schute in die Speicherböden zu heben, E s e l t r e c k e r s ein anderes Quartier, dessen frühere Inhaber vor vielleicht 60 oder 80 Jahren ein störrisches Grautier für die Kinder eines der ihrigen durch ganz Altona bis nach Övelgönne gezerrt hatten. F i n n k i e k e r s sind Untersucher von Schweinen. G n a d d r i g bedeutet verdrießlich. D e K a f f e e b r e n n e r s pflegten gegen Entlohnung für große Krämer wie Conrad Warnke und Adolph Wilmans vor deren Hause in der Steinstraße oder auch bei der nahen Jakobikirche in großen langen Trommeln Kaffee auf Holzkohlenfeuer zu rösten. K r i n d l e r s wurde ein Quartier genannt, weil die Inhaber in ihrer Knabenzeit bei der
Kurrende mitgewirkt hatten, die noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts in unseren Gassen Choräle vortrug; ihre Mitglieder hießen im Volksmunde Krintenjungs oder Krindlers. (Heckscher 32 f.) D e S a c k n e i h e r s wurden auch S a c k j u d e n genannt, da sie mit Jute und Säcken zu tun hatten und nebenbei Sackleihgeschäft betrieben. T ü n b ü d e l ist gleichbedeutend mit Drähnbartel. (Korr. Bl. 28, 73.) Die W u l l k o s a k e n arbeiteten für Kaufleute, die Wolle in großen Ballen aus Mecklenburg erhielten. W o l k e n s c h u b e r s dürfte ähnlich zu deuten sein wie Dacklüünken. Mit W u l l m ü s ’ wurden ursprünglich die Fabrikmädchen bezeichnet, die auf den Speicherböden mit Aussuchen und Reinigen von Waren sich beschäftigten. (Korr Bl. 23, 88.) Ein Klub von Baumwollarbeitern nennt sich „Wullmüs’ von 1910“. Einige weitere Erklärungen findet man in Anl. II. Der Ausdruck Ökelname ist übrigens alt. Er kommt schon im Jahre 1417 vor (Chroniken der niedersächsischen Städte:
Lübeck, herausgegeben von Koppmann, III. 368) und will sagen Beiname, vom altsächs. ôken, ôkian, mehren, vermehren.
Alles was über die Verantwortlichkeit für Leute und Lager, über Behandlung der Waren und Warenkenntnis, über Ausrufe beim Winden, über abendlichen Besuch am Kontor usw. oben vom Hausküper gesagt ist, gilt genau so für die Quartiersleute. Auch sie pflegten eine bestimmte Anzahl von Leuten im festen Wochenlohn zu beschäftigen. Gab es mehr Arbeit, als sie damit bewältigen konnten, so waren sie ebenfalls auf Lüd’ von de Eck angewiesen, die sie dann als „P l o o g “ (Rotte, Schaar) an die betreffende Arbeitsstelle abordneten. Jetzt hat sich dies geändert. Ein regelmäßiger Stamm von Lüd’ von de Eck ist nicht mehr vorhanden, man muß sich an den Hafenbetriebsverein oder an den Arbeitsnachweis der Patriotischen Gesellschaft wenden, wenn Hülfskräfte gebraucht werden.
Die frühere Tracht der Quartiersleute, schwarze Jacke mit Silberknöpfen, Zylinder und Schurzfell, ist längst abgekommen, ebenso wie die Barttracht, die Kinn und Oberlippe frei ließ, „d e K ö h m - u n B e e r g l i t s c h “. Dagegen haben sie die alte Gewohnheit durchweg noch beibehalten, daß nur einer der Teilhaber mit Namen angeführt und für die übrigen die Bezeichnung „und Konsorten“ zugefügt wird. Einzeln hat man allerdings schon eine kaufmännische Firma errichtet. Nach meiner Meinung sollten es die Quartiersleute bei dem alten Brauch lassen, denn sie können mit Recht stolz sein auf eine Art der Bezeichnung, die sich seit Jahrhunderten, vielleicht seit mehr als einem halben Jahrtausend glänzend bewährt hat. „Konsorten“ hat überhaupt gerade so guten Klang wie das andere Fremdwort „Kompagnie“. Wie mir scheinen will, ist diese Anregung der ersten Auflage auf guten Boden gefallen, denn nicht selten findet man jetzt eine Eintragung „N. N. u. Konsorten“ in den Anzeigen des Handelsregisters.
Bei Begründung des Freihafenviertels wurde angeregt, für im Staatsspeicher eingelagerte Waren auf Wunsch der Eigentümer Lagerscheine auszustellen, worauf in Art der englischen dock warrants Vorschüsse erhoben werden könnten. Das führte sich zu allseitiger Zufriedenheit ein. Es zeugt von dem großen Vertrauen,
das man den Quartiersleuten zollt, daß auch viele aus ihrer Mitte dazu übergehen konnten, ihren Kunden solche Lagerscheine auszufertigen, die gleichfalls durch Banken und Bankiers bevorschußt wurden, obwohl keine weitere Garantie vorlag als die Unterschrift einer staatlich nicht bestätigten Verbindung Einzelner. Voraussetzung ist natürlich, daß die Einlagerer über solche Waren, für die sie einen Lagerschein entnommen haben, nur gegen dessen Rücklieferung verfügen können. Vor etwa zehn Jahren erregte der Fall großes Aufsehen, daß ein Quartiersmann sich durch einen langjährigen guten Kunden hatte überreden lassen, von einer Partie Waren Ablieferung vorzunehmen, ohne daß der betreffende Lagerschein bereits zur Stelle war. Der Kaufmann, den er immer als zuverlässig gekannt hatte, war durch Verluste in schlechte Verhältnisse geraten und betrog schließlich den Quartiersmann, der den Wert der anderweitig bevorschußten Ware ersetzen mußte, um sein ganzes Vermögen. Dem Vertrauen, das man den Lagerscheinen der Quartiersleute entgegenbringt, hat dieser Vorfall selbstverständlich keinen Abbruch getan. Es gibt sogar Leute, die sich schon für Ware im Wert von hundert Mark einen Lagerschein ausbitten. Übrigens gewähren einige Quartiersmannsfirmen jetzt selber Vorschüsse, wie denn dieser Geschäftszweig in neuerer Zeit sich Überhaupt mächtig entwickelt hat. Neben Mietsböden und Kontoren für Angestellte im Freihafenbezirk besitzt mancher Quartiersmann seinen eignen Speicher in der Zollstadt, ausgestattet mit elektrischen Anlagen für Warenbewegung, und betreibt ein regelrechtes Lagerungs- und Speditionsgeschäft für seine Kunden. Dazu gesellen sich zuweilen besondere Anstalten. Ich hatte Gelegenheit, bei den Herren Ockelmann und Konsorten die in vollem Betrieb befindlichen, durch vier Lagerböden sich erstreckenden maschinellen Einrichtungen zu besichtigen, die für Reinigung verschiedener Waren, z. B. Entstielung von Rosinen sowie für Enthülsung von solchen Kaffeebohnen bestimmt sind, die aus Mexiko, Guatemala usw mit den Hülsen hier eintreffen, und mußte staunen, in wie sinnreicher Weise alles ineinander griff. Ohne Berührung durch Menschenhand befreiten Trommeln, Siebe, Saugund Blasapparate den Kaffee von Steinen, Hülsen und Häutchen und lieferten ihn schließlich, nach Größe und Form in verschiedene
Sorten getrennt, an die Säcke ab. Nur das Auslesen schlechter Bohnen bleibt noch langen Reihen von Frauen und Mädchen überlassen.
Gleich dem Hausküper wußte der Quartiersmann, so oft es nottat, mit großem Selbstbewußtsein für die Interessen seiner Auftraggeber einzutreten. Allgemein bekannt ist das hübsche Beispiel, das Borcherdt (II. 288 f.) erzählt, wie ein Quartiersmann kurz entschlossen selbst ins Inland reist, um einem Käufer, der eine Partie Kaffee zu Unrecht bemängelt hat, die Übereinstimmung der Ware mit dem Verkaufsmuster zu beweisen. Allerdings fehlt bei Borcherdt der besonders charakteristische Zug, daß der Quartiersmann, vom Inhaber der betreffenden Firma sehr von oben herab nach seinem Namen und seiner Legitimation gefragt, stolz erwidert: „Mein Name? Der hat nichts damit zu tun. Ich stehe hier für Johannes Bahl. Für Sie bin ich Johannes Bahl. — Übrigens heiße ich Timmann. (Die Namen sind fingiert.) Und nun lassen Sie uns mal den Kaffee ansehen.“ Andere kleine Züge sind gut wiedergegeben, besonders die Szene im Eisenbahnschuppen, wo es natürlich an Vorrichtungen fehlt, um die Proben aufzuschütten: Timmann läßt einen Taler springen und sofort ist aus Fässern und Bohlen ein Tisch hergestellt. Als dann alles in Ordnung befunden ist, meint der Kaufmann: „Wie kriegen wir nun die Proben wieder in die Säcke hinein?“ — „Die Proben? Die gehören den Arbeitsleuten!“ ist Timmanns prompte Antwort, wobei er die Bretter umstülpt. (Es war in Hamburg Brauch, daß F e g e l s den Arbeitern zukamen.) Schließlich erfolgt die Zusicherung, der Betrag der Rechnung werde noch heute beglichen werden, worauf Timmann erwidert, für seine Bemühungen und Auslagen möge man gefälligst zweihundert Taler beifügen, was denn auch zum Erstaunen von Johannes Bahl wirklich geschieht. Und so sehr hat Timmann dem Inländer imponiert, daß, als ein anderes Hamburger Haus bei ähnlichem Streitfall meldet, man werde die Sache durch Herrn Timmann untersuchen lassen, umgehend die Nachricht erfolgt, nach nochmaliger genauer Prüfung finde man an der Ware nichts auszusetzen (Vergl. Jünger, 23 f.).
Früher gab es unter einem Teil der Quartiere eine lose Vereinigung, die hauptsächlich bezweckte, in der Form einer
sogenannten „Totenlade“ die Beerdigungskosten verstorbener Mitglieder aufzubringen. Da man aber unterlassen hatte, ein Kapital als Grundstock einzuschießen, so reichte der Taler Sterbegeld schließlich nicht mehr hin und die Sache ging ein. So lange sie noch in vollem Betrieb war, pflegte man sich einmal im Jahre beim Wirte Lautenberg in der Steinstraße, der über einen größeren Saal verfügte, zusammenzufinden, um einen gemütlichen Abend — ohne Damen — zu verleben. Der Gelegenheitsdichter Volgemann lieferte dazu Lieder, in denen die Ökelnamen eine große Rolle spielten. Die Sachen haben natürlich nur einen Augenblickswert gehabt. Mir liegt ein Tafellied zum 31. Januar 1863 vor, worin es nach der Melodie: „Der Papst lebt herrlich in der Welt“ u. a. heißt: „Hier seht nun unsern B o d e n s t e i n , der muß stets Alterspräses sein. Er hat die Sache angeregt, zu diesem Fest den Grund gelegt. — — Un G r o o t k a ß von dat „fiin“ Quarteer, den makt et hüt en Barg Pläseer, denn wenn he recht vergnögt will sien, stellt he sick sicher bi uns in.“ Ebenso geht es hoch- und plattdeutsch durcheinander in einem Liede zum 4. Februar 1865 nach der Melodie: „Ich bin der Doktor Eisenbart“, z. B. „Un P i n g e l unse ohle Fründ is gern wo sien Konsorten sünd. Wer fiif Mal sick een Fro nehm’n kann, dat is förwahr „ein ganzer Mann.“
—
— Auch V o ß und L ö d i n g sind zwei Leut’, sie denken an die Schlafenszeit. Weil wi jem to „de Möden“ tellt, hebbt se denn Slaap hüt afbestellt.“ — In späteren Jahren hören in diesen Tafelliedern die Anspielungen auf Einzelmitglieder und ihre Ökelnamen auf, wie die nachfolgenden Proben aus den Volgemannschen Gelegenheitsgedichten zeigen, die das Hamburger Staatsarchiv in 13 starken Sammelbänden bewahrt und mir freundlichst zur Verfügung stellte.
2. Februar 1878 (Band VIII. 222), Singweise „Wohlauf noch getrunken“ Vers 2 bis 4: „Quartiersleute haben wohl schwierigen Stand, sie müssen empfangen zu Wasser und Land und oft im Geschäft machen bei dem Verkehr den Kopf und die Kräfte die Ablief’rung schwer. Wenn auf dem Komptoir kaum fertig sie sind, die Arbeit am Speicher mit Eifer beginnt. Dort müssen auf’s Winden sie gut sich verstehn und oft dabei selbst sich winden und drehn. Die Führer der Ewer, man weiß ja daß sie absichtlich Streit suchen beim
Arbeiten nie! Trotzdem kann man immer nicht einig sich sein: das liegt im Geschäft so Tag aus und Tag ein.“
11. Januar 1879 (IX. 294) Vers 5: „Der Hamburger Quartiersmannsstand ist rühmlich weit und breit bekannt. Komptoir und Speicher, Quai und Fleth weiß wie er sein Geschäft versteht.“
18. Februar 1882 (IX. 317), Singweise „Was gleicht wohl auf Erden“, Vers 2: „Quartiersmann ist kundig, den Kaufmann zu ehren, zu nützen und schützen zu Wasser und Land; die Speicher zu füllen, die Speicher zu leeren, ist gern er beschäftigt im mühvollen Stand.“
30. Januar 1897 (XIII. 133). Singweise „’Ne ganze kleine Frau“: „Besett mit blanke Knöpen von Sülber mannichfach, darin umher sünst löpen Konsorten Dag för Dag: stolz drog man de bestellten, as wenn’t en Staatskleed wör. Jetzt süht man se man selten un driggt ganz wenig mehr de kotte feine Jack, de kotte feine Jack, de kotte feine, feine, feine ohl Quarteersmannsjack.“
Volgemann selbst nennt sich XIII. 48 „alter Haus- und Hofpoet seit 1848“. Aus den Liedern X. 250 und 251 und XI. 91 scheint hervorzugehen, daß 1864 und 1876 Versuche stattfanden, der ersten Vereinigung von 1848 festere Formen zu geben, während erst weitere zehn Jahre später der noch heute bestehende „Verein Hamburger Quartiersleute von 1886“ endgültig gegründet wurde. Am 30. September 1911 feierte dieser Verein sein 25jähriges Stiftungsfest durch Festtafel und Ball in der „Erholung“. Das Programm, gedruckt bei Carl Griese, enthält unter anderen hübschen Zeichnungen von Johs. Ulfert drei, auf denen Quartiersleute in alter Tracht dargestellt sind.
Zum Schluß muß ich noch der E w e r f ö h r e r gedenken. Es scheint eigentlich sonderbar, daß man den Mann in der Schute Ewerführer und nicht Schutenführer nennt, denn in Hamburg heißt Ewer ein Elbschiff mit Verdeck, Mast und Steuer, während den Schuten dies alles fehlt. Es sind eben ganz offene Fahrzeuge ohne Kiel, die nur hinten einen kleinen verschließbaren Raum haben, d e P l i c h t , worin Arbeitszeug und dergleichen Platz findet, gelegentlich auch vielleicht, was von der Ladung abfällt. Da auch die Ewer
flachen Boden haben (der Kiel wird durch ein „Schwert“ an jeder Seite ersetzt), so läßt sich vielleicht annehmen, daß sie früher nicht allein auf der freien Elbe, sondern auch für Transporte zwischen Speicher und Seeschiff verwendet wurden, und daß man erst allmählich zum offenen Leichter, der Schute, übergegangen ist. Die Bezeichnungen Ewer, Schute und Prahm kommen übrigens bereits im 14. bis 16. Jahrhundert nebeneinander vor (Koppmann I. S. LXXVII. f., VII. S. CXX.). Vom Ewerführer ist im Patriot No. 155 vom 20. Dezember 1726 S. 1 die Rede.
Zum Schutz der Ladung der Schuten gegen Regen dienten P e r s e n n i n g e , breite geteerte Segeltuchstreifen mit Holzrollen an beiden Enden. Doornkaat meint, der Ausdruck könne vom englischen preserving = Schutz stammen (vergl. Korr. Bl. 28 S. 48, 55. 71). Kleinere Schuten werden B o l l e n genannt. Der Eigentümer der Schuten heißt E w e r f ö h r e r b a a s . Baas will sagen „Meister“. Wenn der Lehrling dem Ewerführer eine Bestellung ausrichtete, etwa: „Sie möchten Ihrem Herrn sagen, daß er heute an der Börse vorkommt“, so erhielt er zur Antwort: „H e r r — H e r r ? — I c k b ü n
d o c h k e e n K ö t e r , d e ’ n H e r r n h e t t ! I c k w i l l m i e n ’ n B a a s d a t s e g g n . “ Von den Beinamen der Ewerführerbaase hörte ich nur
B a r o n S a c h s für Hans Sachs, K e e s ’ - D i r c k s für einen Dircks, der für ein Geschäft im Grimm häufig Käse fuhr und S p i n n ’ g r i e p e r d i r c k s für einen Namensvetter. Dessen Nachfolger im Geschäft, Ahrens, hieß J ä g e r a h r e n s .
So lange es sich um den Verkehr zwischen dem alten Binnenhafen und den Fleetspeichern handelte, p e e k t e n die Ewerführer ihr Fahrzeug mittels langer Stangen weiter, indem sie deren eiserne Spitze in den Schlamm stemmten und vom Vorderende der Schute, auf deren breitem Rand, sich langsam, schiebend, nach hinten bewegten. Deshalb ihr Ökelname:
„S l i c k s c h u b e r “. Da sie hierbei die Querleiste des oberen Endes der Stange, die K r ü c k , zwischen Brust und Schulterknochen drückten, hießen sie auch S t a k e n d r ü c k e r . Wenn es gerade so paßte, zogen sie sich auch wohl mit dem neben der Spitze der Stangen befindlichen H a k e n an Ringen der Hausmauern und Schuteneisen der Brückenwiderlager und Kaimauern entlang oder
an Pfählen oder an anderen Schiffen. Da ein Steuer fehlte, wurde die Richtung durch die Art des Schiebens eingehalten, wie man das noch heute in den Fleeten wie auf der Alster gelegentlich beobachten kann. Die Speicherarbeiter pflegten dem Ewerführer wohl scherzend zu bemerken: „D u h e s t d a t g o o d . D u k a n n s t d i ü m m e r s t ü t t e n b i d e A r b e i t U n w e n n d u r ü g g w a r t s g e i s t , k u m m s t d u d o c h v ö r r u u t “ — Daß die Sprache der Wasserkante ausschließlich Plattdeutsch geblieben ist, sei hier beiläufig erwähnt. Im Zusammenhang damit stand es, daß im Verkehr zwischen Arbeitern und Vorgesetzten das trauliche du gegenseitig die Regel bildete. Das hat jetzt allerdings aufgehört. — Auf der Alster benutzt der Ewerführer zuweilen den Wind zur Erleichterung seiner Arbeit, indem er aus einer Stange mit daran befestigter Persenning ein Notsegel herstellt.
Während die älteren Schuten noch aus Holz erbaut sind, ist man jetzt zur Eisenkonstruktion und größerer Tragfähigkeit (300 Tons und mehr) übergegangen, auch sieht man vielfach „Kastenschuten“ mit abnehmbarem Verdeck. Da nun außerdem die Entfernungen wegen der außerordentlichen Ausdehnung unserer Hafenanlagen sehr groß geworden sind, und da infolge der Tiefe der Freihafenfleetzüge die Stangen oft nicht mehr den Grund erreichen würden, so muß der Ewerführer jetzt vielfach Schlepperhülfe in Anspruch nehmen. Einzelne Schuten findet man auch schon mit einem Motor ausgerüstet.
Wenn der Ewerführer am Speicher angelangt war, wo er Waren holen oder abliefern sollte, so rief er den Hausküper oder Quartiersmann an, z. B. „G r o ß m a n n s i e n “ (sollte heißen „Großmann sien Lüd’“). Der Koptein meldete sich dann an der Luke: „W a t s e g g s t d u ? “ und der Ewerführer teilte sein Gewerbe mit, z. B.: „T w i n t i g F a t e n a f l e b e r n “. Bekannt ist der Scherz, daß der Ewerführer hinaufruft: „Te i n K i s t e n R a b a r b e r i n n e h m e n ! “ worauf die Antwort erfolgt: „D e n n g e i s t d u d o d ! “ — Für die kaufmännischen Firmen, mit denen sie zu tun hatten, pflegten die Ewerführer Spitznamen und Verdrehungen anzuwenden. Ich teile hier eine Auswahl mit und füge eine kleine Anzahl bei, die den Betreffenden von anderer Seite angehängt sein mögen, ohne mich
dafür zu verbürgen, daß diese Ökelnamen regelmäßig zur Anwendung gekommen sind. Es soll also geheißen haben: A n d r e e s i e n W i c k e l k i n d für Andree u. Wilkerling, B a a s P ü t t j e r i g für F. R. Scharfe (püttjerig = kleinlich), B i a n k o h n k l e i d i (kratz dich) für Biancone, Klee u. Co., b i l l i g u n s l e c h t für Brock u. Schnars, b i t t e r w e n i g u n s l e c h t für B. Wencke u. Söhne, F i l z l a u s für F. Laeisz, F l o t z u n K l o t z für Blohm u. Voß, I h d e s i e n K n e c h t für Sienknecht u. Ihde, K ö h m u n B e e r für Knöhr u. Burchard oder Kruse u. Bleichwehl, l i n k s u n r e c h t s für Lütgens u. Reimers, M e i e r G e b r ü d e r L u m p e n a n g r o h für Anton Meier, P l ü n n h a u f e n u n S c h u l z e für Lappenberg u. Müller, M u h l a a p für H. L. Muhle u. Co., P ü t t j e r für H. Ahmsetter (Püttjer = Töpfer, Ofensetzer), S e l l e r i e u n P u r r e e für Cellier u. Parrau, t r a n i g u n r a n z i g für Tietgens u. Robertson, w e n i g u n k n a p p oder W i e n u n
K ö h m für Wachsmuth u. Krogmann. Die Kornumstecher Bein u. Kruse hießen A r m u n B e e n . Kornumstecher sind Arbeitsübernehmer für sachgemäße Behandlung von Getreide. Die Leute, die sie anstellen, erhalten nach beendeter Arbeit H o c k e r z e t t e l und das Abholen des betreffenden Akkordlohnes wird H o c k e r n genannt. — Für den Empfangschein, den der Ewerführer erhielt, wenn er Waren an Bord abgeliefert hatte, gibt es die Bezeichnung „R e z i e v “, nach dem ersten Wort der englischen Übernahmezettel: received.
In neuerer Zeit haben einzelne Ewerführerbaase angefangen, neben dem Schutenbetrieb auch Fuhrwerk zu halten. Früher löschten und luden sämtliche Schiffe im Elbstrom, es war also keine Möglichkeit, die Waren anders als zu Wasser zu befördern. Seitdem der größere Teil des Verkehrs sich an den Kais abspielt, ist es in vielen Fällen geratener, den Transport zu Lande vorzunehmen, schon weil die Gefahr einer Havarie dann wegfällt. Außerdem sind zwar die Fleete im Freihafenviertel tief genug gelegt, daß auch bei niedrigstem Wasserstand Schuten dort verkehren können, aber die alten Fleetzüge der inneren Stadt bleiben bei anhaltendem Ostwind oft tage- ja wochenlang leer gelaufen und vielfach finden die Transporte auch nach Stadtgegenden statt, wo es an Fleeten fehlt. — Das vorn beigegebene Bild nach einer Zeichnung von C. Schildt (im Besitz unserer Kunsthalle) die vor 25 Jahren für das Prachtwerk
„An de Woterkant“ hergestellt wurde, gibt einen guten Begriff davon, wie es an einem Hamburger Fleet der Altstadt aussieht. Es ist das D i e k s t r a t e n l o c k , von der Steintwietenbrücke aus gesehen, d. h. das Fleet zwischen Deichstraße (links) und Rödingsmarkt. Eine große Anzahl feiner Beobachtungen sind darauf zu finden: die Speicher mit ihren Luken, den Utleggern und einem außer Betrieb gesetzten Abort, die Ewerführer in ihren Schuten, die J o l l e , die sich durchzwängt, der Schatten, den die hoch gestiegene Sonne auf die Speicher wirft usw.
Seit 1889 besteht ein Verein der Schutenbesitzer, der 1914 sein fünfundzwanzigjähriges Stiftungsfest feierte. Laut „Hamburger Woche“ vom 7. Mai 1914 zählte er 480 Mitglieder mit 1530 Schuten im Wert von sechs Millionen Mark. *