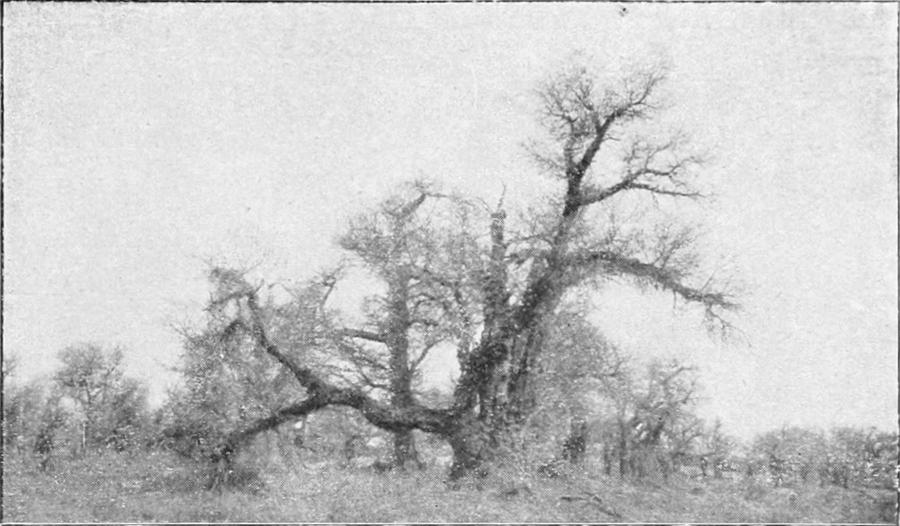The Internet of Toys
Practices, Affordances and the Political Economy of Children’s Smart Play
Edited by Giovanna Mascheroni and Donell Holloway
studies in childhood and youth
Studies in Childhood and Youth
Series Editors
Afua Twum-Danso Imoh
University of Sheffeld Sheffeld, UK
Nigel Thomas
University of Central Lancashire Preston, UK
Spyros Spyrou
European University Cyprus Nicosia, Cyprus
Penny Curtis
University of Sheffeld Sheffeld, UK
Tis well-established series embraces global and multi-disciplinary scholarship on childhood and youth as social, historical, cultural and material phenomena. With the rapid expansion of childhood and youth studies in recent decades, the series encourages diverse and emerging theoretical and methodological approaches. We welcome proposals which explore the diversities and complexities of children’s and young people’s lives and which address gaps in the current literature relating to childhoods and youth in space, place and time.
Studies in Childhood and Youth will be of interest to students and scholars in a range of areas, including Childhood Studies, Youth Studies, Sociology, Anthropology, Geography, Politics, Psychology, Education, Health, Social Work and Social Policy.
More information about this series at http://www.palgrave.com/gp/series/14474
Giovanna Mascheroni · Donell Holloway Editors
The Internet of Toys Practices, Affordances and the Political Economy of Children’s Smart Play
Editors
Giovanna Mascheroni Department of Communication
Catholic University of the Sacred Heart
Milan, Italy
Donell Holloway School of Arts and Humanities
Edith Cowan University
Mount Lawley, WA, Australia
Studies in Childhood and Youth
ISBN 978-3-030-10897-7
ISBN 978-3-030-10898-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-10898-4
Library of Congress Control Number: 2018965777
© Te Editor(s) (if applicable) and Te Author(s) 2019
Tis work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed.
Te use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifc statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use.
Te publisher, the authors, and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. Te publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional afliations.
Cover image: © Ociacia/Getty
Tis Palgrave Macmillan imprint is published by the registered company Springer Nature Switzerland AG
Te registered company address is: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
Preface and Acknowledgements
Tis book brings together diverse contributions on Internet connected toys from leading scholars in the feld of children and media studies. Te Internet of Toys is only the latest technological innovation aimed at children and an emerging application of the Internet of Tings. It embodies a number of technological and sociocultural developments— the robotifcation of childhood, datafcation and dataveillance, and the emergence of connected and hybrid play practices—that render it an excellent point of departure for those interested in understanding, more broadly, how children’s lives, and their futures, are transforming. We are deeply grateful to the authors of the following chapters for providing innovative and thought-provoking research that helps the readers situate the Internet of Toys against the background of such broader sociocultural and media changes. Without their enthusiasm and commitment, this book would have not been possible.
Our interest in how digital media are embedded in children’s everyday lives originated as members of the EU Kids Online network. In over ten years of EU Kids Online research, we became fully committed to going beyond media panics and researching media from the viewpoint of children and their families. While the Internet and digital
media are undoubtedly an integral and pervasive component of children’s everyday lives, we believe in the need for research that accounts for the varied ways in which children and their families face the challenges that digital media pose, and adapt and reinvent technologies so as to ft their everyday lives. A meaningful experience for the both of us was the comparative qualitative research into young (0–8) children’s use of technology at home coordinated by the Joint Research Centre. More recently, the inspiration to direct our attention towards the Internet of Toys and Tings for young children came from our participation in the COST Action IS1410, the digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)—which also supported this publication. Terefore, we are deeply grateful to our EU Kids Online and DigiLitEY colleagues for helpful discussions and inspiration along the way, and especially to Stéphane Chaudron, Ola Erstad, Rosie Flewitt, Lelia Green, Leslie Haddon, Uwe Hasebrink, Claudia Lampert, Sonia Livingstone, Jackie Marsh, Tijana Milosevic, Kjartan Olafsson, Ingrid Paus-Hasebrink, Julian Sefton-Green, David Smahel, Elisabeth Staksrud, Anca Velicu, Dylan Yamada-Rice and Bieke Zaman. A special thank goes also to Nick Couldry and Andreas Hepp who inspired the theoretical backbone of our understanding of IoToys as media.
We are also grateful to the various opportunities we had to present and discuss our ideas, namely the Internet of Toys panel organised at the DigiLitEY meeting in Prague in November 2016; the two sessions we organised with DigiLitEY colleagues at the Cyberspace Conference in Brno in November 2017; and fnally, the panel at the ICA 2018 Conference in Prague.
We are deeply grateful to our partners, Massimiliano Giacomello and David Holloway, for their love, patience and support.
Finally, a particular inspiration for both of us comes from children, frst and foremost those in our families: we want to dedicate this book to Aiden, Angus, Clara and Patrick. We would also like to thank Archie, Laika and Scout, our non-human companions.
Milan, Italy Fremantle, Australia
August 2018
Giovanna Mascheroni Donell Holloway
1 Introducing the Internet of Toys 1 Giovanna Mascheroni and Donell Holloway Part I New Toys, New Play, New Childhood?
2 Asking Today the Crucial Questions of Tomorrow: Social Robots and the Internet of Toys 25 Jochen Peter, Rinaldo Kühne, Alex Barco, Chiara de Jong and Caroline L. van Straten
3 Te Uncanny Valley Revisited: Play with the Internet of Toys 47 Jackie Marsh 4 Toying with the Singularity: AI, Automata and Imagination in Play with Robots and Virtual Pets
Seth Giddings
5 Postdigitality in Children’s Crossmedia Play: A Case Study of Nintendo’s Amiibo Figurines 89 Bjorn Nansen, Benjamin Nicoll and Tomas Apperley
Part II Domesticating the Internet of Toys: Practices and Contexts
6 Te Domestication of Smart Toys: Perceptions and Practices of Young Children and Teir Parents 111 Rita Brito, Patrícia Dias and Gabriela Oliveira
7 An Ecological Exploration of the Internet of Toys in Early Childhood Everyday Life 135
Lorna Arnott, Ioanna Palaiologou and Colette Gray
8 Persuasive Toy Friends and Preschoolers: Playtesting IoToys 159
Katriina Heljakka and Pirita Ihamäki
Part III Design and Research Methodologies
9 Designing the Internet of Toys for and with Children: A Participatory Design Case Study 181
Maarten Van Mechelen, Bieke Zaman, Lizzy Bleumers and Ilse Mariën
10 Including Children in the Design of the Internet of Toys 205 Dylan Yamada-Rice
11 Testing Internet of Toys Designs to Improve Privacy and Security 223
Stéphane Chaudron, Dimitrios Geneiatakis, Ioannis Kounelis and Rosanna Di Gioia
Tomas Enemark Lundtofte and Stine Liv Johansen
Notes on Contributors
Tomas Apperley (Ph.D.) is a researcher and educator that specialises in digital games and other playful technologies. Tom is a University Researcher at the Centre of Excellence in Game Culture Studies at Tampere University.
Lorna Arnott is a Lecturer in the University of Strathclyde, UK. Lorna’s main area of interest is in children’s early experiences with technologies, particularly in relation to social and creative play. She also has a keen interest in research methodologies, with a specialist focus on consulting with children. Lorna is the convener for the Digital Childhoods Special Interest Group as part of the European Early Childhood Educational Research Association and is the Editorial Assistant for the International Journal of Early Years Education.
Alex Barco (Ph.D., 2017, La Salle—Ramon Llull University) is a postdoctoral researcher in the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam. His interests are on how social robots can have an impact in education for children with and without disabilities.
Lizzy Bleumers is a senior researcher at imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel. She has mainly conducted user research related to gaming, play, learning and participatory practice. To do so, she combines human-centred design research methods with living lab testing. Lizzy loves organising events that bring academia closer to the public, like the Ludic City Lectures on gameplay in an urban setting together with DiGRA Flanders and, currently, master classes for city representatives on research and developments in the smart cities domain.
Rita Brito is an Invited Assistant Professor in Lisbon College of Education, Polytechnic Institute of Lisbon, in Early Childhood Education Masters. She holds a degree in Early Childhood Education, a Ph.D. in Educational Technology and a postdoctoral research on the use of technologies by families and children up to 6 years old. Rita is a researcher at UIDEF—Institute of Education, University of Lisbon. Rita’s research focuses on digital educational technology, children under 6 years old, Early Childhood Educators and Primary teachers training. She has published several journal and book articles in international journals and books. Rita is the author of http://www.Familia.com (2017).
Stéphane Chaudron works on research projects dedicated to Empowering Children Rights and Safety in emerging ICT at the Joint Research Centre of the European Commission. Her background is in Social Geography and Science Pedagogy. She has been for years in charge of the coordination of large European Research Networks dedicated to e-safety, New media education, Standardization and Science Teaching Education (UCLouvain, Imperial College London, European Schoolnet). She has been in charge of the coordination of EC’s research project “Young Children (0–8) and Digital Technology” since 2014. Recently she has undertaken research on security and safety considerations of the Internet of Toys and explores the efect of the digital transformation on the concept of Identity, on the way users manage (or not) their personal data.
Chiara de Jong (M.A., 2017, Tilburg University) is a Ph.D. candidate at the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam. She investigates children’s interaction with social robots and in particular children’s acceptance of robots.
Rosanna Di Gioia is a researcher in the JRC Cyber and Digital Citizens’ Security Unit. Her background is in Social Psychology and she has earned a master degree in Cognitive Processes and Technology from International Telematics University Uninettuno with a focus on Media Education, Social Cognition and Cyber-Risk Propensity and Assessment. In the past fve years, she has been involved in projects on cyber-security, cyber-bullying and Empowering Citizens’ Rights in emerging ICT. Her research interests include Privacy and Data Protection practices together with Digital Play. She is currently coordinating the development and dissemination of an edutainment in the format of a storytelling game introducing Data Protection Rights to (young) citizens. Previously, she contributed to development of the Happy Onlife toolkit raising awareness on Internet risks and opportunities. Currently, she is involved in projects exploring the digital transformation impact of the Internet of Toys and the Blockchain technologies in Energy Communities.
Patrícia Dias is Assistant Professor of the Faculty of Human Sciences and researcher at the Research Centre for Communication and Culture Studies at the Catholic University of Portugal. Holding a Ph.D. in Communication Sciences, her research interests are digital media, young children, mobile communication, marketing and public relations. She is author of Living in the Digital Society (2014) and Te Mobile Phone and Daily Life (2008).
Dimitrios Geneiatakis holds a Ph.D. in the feld of Information and Communication Systems Security from the Department of Information and Communications Systems Engineering of the University of Aegean, Greece. He has participated in various research projects in the area of information systems security. His current research interests are in the areas of security mechanisms in Internet telephony, Internet of Tings, intrusion detection systems, network security and lately in software security. He is an author for more than ffty refereed papers in international scientifc journals and conference proceedings. Currently, he is a scientifc project ofcer within Joint Research Centre of European Commission. Previously, he was a lecturer at the Department of Electrical and Computer Engineering of the Aristotle University of Tessaloniki, Greece.
Seth Giddings (Ph.D.) is Associate Professor Digital Culture and Design within Winchester School of Art at the University of Southampton. Seth is a media and cultural theorist, and occasional media artist. Seth has published widely on new media, video games and play culture, and media theory. Recent research has centred on ethologies of the design of playful technologies, from mobile games to robots to playground swings.
Colette Gray is a Principal Lecturer in Early Childhood Studies at Stranmillis University College, Queen’s University Belfast. Editor of the International Journal of Early Years Education, she continues to develop her research interests in the feld of participatory research which children and marginalised groups, the impact of special needs on children’s learning, and the ethical implications of research involving vulnerable groups.
Katriina Heljakka (Doctor of Arts, visual culture, M.A. Art History, M.Sc. Economics) is a toy researcher who holds a postdoctoral position at University of Turku (digital culture studies) and continues her research on toys, toy fandom and the visual, material, digital and social cultures of play in the Academy of Finland project Centre of Excellence in Game Culture Studies. Her current research interests include the emerging toyifcation of contemporary culture, toy design and the hybrid and transgenerational dimensions of ludic practices.
Donell Holloway is a Senior Research Fellow at Edith Cowan University, in Perth, Western Australia. She has authored or co-authored over 50 refereed journal articles, book chapters and conference papers and is in the process of writing a sole-authored book titled Children’s Digital Lives: Te Parent Factor. She is currently a chief investigator on two Australian Research Council grants, Te Internet of Toys: Benefts and risks of connected toys for children, and Toddlers and tablets: exploring the risks and benefts 0–5s face online. As an ethnographic researcher, her work centres on the domestic contexts of children’s media use.
Pirita Ihamäki received her M.A. in digital culture 2006, M.Sc. in marketing 2011 and her Ph.D. in digital culture 2015 from the University of Turku at Pori Unit. She is currently working as a
consultant in the Sustainable Development Industrial Zone Project at Prizztech Ltd. She has also worked as a researcher at diferent universities. Her current research interests are game design, gamifcation, service design, toyifcation, the Internet of Toys and toy tourism.
Stine Liv Johansen (Ph.D.) is Associate Professor at Centre for Children’s Literature and Media, Department of Communication and Culture, Aarhus University. Stine Liv Johansen studies children’s use of and play with media, toys and technology in their everyday life in- and outside of institutional settings. She has written and published studies on for instance football as a mediatised play practice and YouTube as a site for children’s playful practices. She is a member of the Danish Media Council for Children and Young People.
Ana Jorge (Communication Sciences Ph.D., University NOVA of Lisbon) is Assistant Professor at the Catholic University of Portugal and researcher at CECC. She has researched on children and youth as media audiences, as objects of representation in the media and as content producers. Her postdoctoral research focused on children and media education, particularly consumer literacy. She is member of COST DigiLitEY and European Literacy Network; previously, she was member of EU Kids Online and CEDAR networks, and of RadioActive101 project.
Ioannis Kounelis is a scientifc project ofcer at the Joint Research Centre of the European Commission. His research activities focus on blockchain technologies, software security, especially on mobile devices, as well as Internet of Tings security. He holds a M.Sc. and a Ph.D. degree in ICT security from the Royal Institute of Technology (KTH) in 2010 and 2015, respectively, while he received his B.Sc. degree in computer science from the Aristotle University of Tessaloniki in 2007.
Rinaldo Kühne (Ph.D., 2015, University of Zürich) is an Assistant Professor in the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam. His research focuses on media efects on young people, the communication between humans and artifcial agents, cognitive and emotional mechanisms of media uses and efects, and methods in communication research.
Eva Lievens is an Assistant Professor of Law & Technology at Ghent University and a member of the Human Rights Centre and the Crime, Criminology & Criminal Policy Consortium. A recurrent focus in her research relates to human and children’s rights in the digital environment. She is a member of the Flemish Media Regulator’s Chamber for impartiality and the protection of minors, the associate editor of the International Encyclopaedia of Laws—Media Law and a contributor to the European Audiovisual Observatory IRIS newsletter for Belgium.
Vilmantė Liubinienė (Social Sciences, Sociology Ph.D., Kaunas University of Technology) is Professor at Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Lithuania. Her research felds are media linguistics, media literacy, localisation and translation, digital culture and intercultural communication, system of universal values, identity building, etc. She is a member of COST IS1410 Action “Te digital literacy and multimodal practices of young children” and the European Commission’s JRC project “Young Children (0–8) and Digital Technologies”. ECREA Member since 2017.
Tomas Enemark Lundtofte is a Ph.D. fellow in Media Studies at the Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark. Tomas researches how young children, ages 4 to 6 years, play with tablet computers. He has conducted feldwork in the homes of seven Danish children using the POV methodology. His research on young children’s play practices with tablet computers centres on their use of DR Ramasjang—an app provided by the National Danish Broadcasting Company (DR)—which is a common frame of reference within this particular age group in Denmark.
Ilse Mariën is working as a post-doc researcher at imec-SMIT, a research centre attached to the Vrije Universiteit Brussel (VUB) where she is leading several projects related to digital inequalities, e-skills and participation. In 2016, she successfully defended her Ph.D. that entails (1) a more contextualised and comprehensive theoretical framework for digital inequalities; and (2) a concise strategic framework for developing sustainable e-inclusion policies. Over the past 10 years, Ilse has built a great deal of expertise on (1) e-inclusion theories and policies, (2) doing
research with vulnerable groups and groups at risk of digital and social exclusion and (3) innovative, interactive, participatory and actionoriented research methods.
Jackie Marsh is Professor of Education at the University of Shefeld, UK. Jackie has led numerous research projects engaging children, teachers, parents and children’s media industry partners in research on young children’s play and digital literacy practices in homes and schools. Jackie is Chair of COST Action IS1410, DigiLitEY, a European network of 35 countries focusing on research in this area (2015–2019). She is currently leading a 7-country project on makerspaces in the early years, MakEY http://makeyproject.eu (2017–2019) funded by the EU Horizon 2020 programme. Jackie has published widely in the feld and is a co-editor of the Journal of Early Childhood Literacy.
Giovanna Mascheroni (Ph.D.) is a Senior Lecturer of Sociology of Media and Communications in the Department of Communication, Università Cattolica of Milan. She is part of the management team of EU Kids Online and co-chair of WG4 of the COST Action IS1410
DigiLitEY. Her work focuses on the social shaping and the social consequences of the Internet, mobile media and Internet of Toys and Tings among children and young people, including online risks and opportunities, civic/political participation, datafcation and digital citizenship.
Ingrida Milkaite is a doctoral student in the research group Law & Technology at Ghent University in Belgium. She is working on the research project “A children’s rights perspective on privacy and data protection in the digital age: a critical and forward-looking analysis of the General Data Protection Regulation and its implementation with respect to children and youth”. Ingrida takes part in the activities of the Human Rights Centre, is a member of the European Communication Research and Education Association (ECREA) and a contributor to the Strasbourg Observers blog.
Bjorn Nansen is a Senior Lecturer in Media and Communications at the University of Melbourne. His research focuses on emerging and evolving forms of digital media use in everyday and family life, using a mix of ethnographic, participatory and digital methods. His current
research projects explore changing home media infrastructures and environments, children’s mobile media and digital play practices, the digitisation of death and the body, and the datafcation of sleep.
Benjamin Nicoll is a lecturer and researcher based in the School of Culture and Communication at the University of Melbourne, Australia. His research focuses on the history and critical theory of video games and video game platforms, with a particular focus on notions of technological failure and marginality in game history. He is currently developing a research project that examines the use and implementation of “game engines” in Australian game design contexts.
Patricia Núñez (Ph.D.) is Professor of Advertising and Public Relations at the Faculty of Information Sciences, Complutense University, Madrid. She is member of the research group SOCMEDIA: Study of the learning and leisure socio-communicative behaviour and competences developed by children and young people (digital natives) through the use of new media and ICT. Patricia chaired the TWG Advertisement Research of ECREA. She held visiting fellowships in several international universities, including the University of Sao Paulo (Brazil) and Helsinki (Finland).
Gabriela Oliveira holds a Master in Communication Sciences by the Catholic University of Portugal. Her research focuses on consumer behaviour, particularly on children, toys and technologies. Currently, she is research assistant at the Research Centre for Communication and Culture, at the same university.
Ioanna Palaiologou is an Academic Associate of the University College London, Institute of Education, UK and an educational psychologist. She completed her Ph.D. in 2003 and has worked both as a researcher in education and lecturer on Education and Early Childhood Studies in UK universities. She is a member of the executive committee of British Education Studies Association (BESA). She is also the Coordinator of the Special Interest Group (SIG) SIG on Transforming Assessment, Evaluation and Documentation Early Childhood Pedagogy in the European Early Childhood Education Research Association (EECERA).
Esther Martínez Pastor is Assistant Professor in the Faculty of Communication Sciences at the University Rey Juan Carlos de Madrid. She holds a Ph.D. in Communication Sciences and a degree in Advertising and Public Relations (University Complutense de Madrid) and Law (UNED). Her research is focused on advertising, emotions in advertising, kids and regulation. She elaborates an annual Report to evaluate “Self-Regulatory Code for Television spots of toys and Children” for the Spanish Association of Toy. She was involved in the project “the Analysis of the use and consumption of media and social networks on the Internet among Spanish adolescents. Characteristics and high-risk practices (CSO2009-09577)” funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation.
Jochen Peter (Ph.D., 2003, University of Amsterdam) is a Full Professor in the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam. His research deals with young people’s use of new communication technologies and its consequences for their psychosocial development.
Maarten Van Mechelen is a postdoctoral researcher at TU Delft specialised in the domain of Child–Computer Interaction. His current research focuses on early mastering of twenty-frst-century skills through design-based learning. His teaching responsibilities include supervising M.A. and Ph.D. students and teaching a course on designing for and with children. Maarten holds master degrees in Graphic Design and Cultural Studies and a doctoral degree in Design Research (KU Leuven—UHasselt). In addition, he is a member of diferent organising committees including the ACM IDC 2018 conference.
Caroline L. van Straten (M.Sc., 2016, Utrecht University) works as a Ph.D. candidate in the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) at the University of Amsterdam. Her research investigates the psychological mechanisms underlying relationship formation between children and social robots.
Dylan Yamada-Rice is a Senior Tutor in Information Experience Design at the Royal College of Art. She is also a Senior Research Manager for Dubit, a company that specialises in strategy, research and
digital for children’s entertainment brands. Her research focuses on the design of digital storytelling, games and play on a range of platforms such as apps, augmented and virtual reality, as well as new content for television. She specialises in experimental visual and multimodal research methods.
Bieke Zaman is Assistant Professor at Mintlab, part of the Institute of Media Studies at KU Leuven. Her research focuses on digital media, children and interaction design from a communication sciences and Human–Computer Interaction perspective. Bieke is Associate Editor of the International Journal of Child-Computer Interaction and Personal and Ubiquitous Computing. She is Vice-Chair of the ECREA TWG on Children, Youth and Media; member of the EU COST Action IS1410 DigiLitEY, and member of the organising committee of the Interaction Design and Children conference.
List of Figures
Fig. 4.1 Te prototype robot (top) and 3D printed model (below) 71
Fig. 4.2 Children’s robotic imaginary (top), with ‘Sort-of Brian’ (below)
Fig. 4.3 Robot design drawings, with jet packs (top), and sensors (below)
Fig. 7.1 Te social ecologies of play in digital lives
Fig. 7.2 Larry and the learning robot
Fig. 7.3 Engagement with a hybrid toy
Fig. 7.4 Scafolding with a hybrid toy
Fig. 9.1 Storyboard visualizing the third concept, a customizable robot that interacts with other objects, including physical cards
Fig. 9.2 Te fnal prototype that was evaluated by 266 children aged 4–6 years in eight schools
Fig. 10.1 Avakai
Fig. 10.2 Physical making for the Avakai
Fig. 11.1 IoToys data fow
Fig. 11.2 An example of a Man-in-the-Middle attack for capturing/extracting encrypted trafc
Fig. 11.3 Vulnerable points, in dark grey, of IoToys architecture, as identifed by using our test protocol
74
81
141
144
148
151
192
194
210
216
227
232
234
Fig. 12.1 Te POV setup
Fig. 12.2 Interacting with the camera through silly play
Fig. 12.3 Matching picture cards with words
Fig. 12.4 Reaching out to share a successful moment with the researcher and mum
Fig. 12.5 Smelling urinary tracts
List of Tables
Table 6.1 Socio-demographic information about the families which participated in the study
Table 8.1 Play afordances, children’s perceptions of play patterns and design values for IoToys
Table 13.1 Walkthrough analysis of connected toys. Adapted from Light et al. (2018)
Table 15.1 “Hello Barbie Dream House” characteristics
Table 15.2 Child YouTubers who reviewed ‘Hello barbie Dreamhouse’
Table 16.1 Media commentary on IoToys by country, economic and linguistic indicators
118
170
273
314
316
332
Table 16.2 Language of smart toys’ websites by type of producer 334
The Internet of Toys as Media
Our critical analysis of IoToys builds on and adapts Bunz and Meikle’s (2018) media and communications perspective on the Internet of Tings. We make the argument here that we have much to gain from an approach to Internet-connected and sensors-based playthings as media, for this will help us to understand and situate the social consequences of the entanglements of objects, data and communication practices that constitute the IoToys on both the micro-level of everyday life and the macro-level of broader social, political and economic implications. Terefore, before we delve deeper into the world of IoToys and new play practices, we need to theorise how and why we can understand Internet-connected playthings as media.
Te Internet of Toys enables practices of “connected play” (Marsh, 2017), which criss-cross, connect and challenge the boundaries between dichotomised spaces and concepts: online and ofine, digital and non-digital, material and immaterial, but also public and private, global and local. Media scholars, especially within the domestication of technology approach and its notion of double articulation, have long acknowledged the media’s role in the reconfguration of the boundaries between separate social spheres, such as private and public. Media are doubly articulated into private and public social contexts and cultures, for “information and communication technologies, uniquely, are the means (the media) whereby public and private meanings are mutually negotiated; as well as being the products themselves (through consumption) of such negotiations of meaning” (Silverstone, Hirsch, & Morley, 1992, p. 28). In focusing on the process through which media are absorbed into the places and contexts of family life, up to the point that they are taken for granted and normalised, domestication scholars emphasise the double articulation of information communication technologies (ICTs) into everyday life as both “objects and media: ICTs are doubly articulated into everyday life as machines and media of information, pleasure, communication” (Haddon & Silverstone, 2000, p. 251). We propose to extend the concept of double articulation to the study of IoToys, for it acknowledges both the material and
G. Mascheroni and D. Holloway
communication dimensions of Internet-connected toys and the interrelation between the two. IoToys in their capacity as material objects are not dissimilar to other physical toys children are used to playing with. Teir materiality is an important aspect of how children make sense of, normalise and incorporate the new generation of toys into their everyday play practices. However, IoToys are also, fundamentally, media, i.e. a means of communication “mediating between the private world of the household and the public sphere” (Livingstone, 2007, p. 16) or, as is becoming more common under surveillance capitalism, between the household and the commercial sphere (see below). Tey are sensory interfaces that allow children to access media content (be it bedtime stories, educational content or popular culture characters) and to communicate (e.g. they can send messages to their parents’ smartphones through CloudPets or communicate with another VaiKai doll). Teir symbolic value lies in both its content—the software, the media, the conversations—and “its meaning as an object – embedded as it is in the public discourses of modern capitalism” (Silverstone, 1994, p. 123).
However, there have been signifcant changes since the notion of the double articulation of media into everyday life was formulated within the domestication of technology approach. An increasing diversity of media has become integrated into our everyday lives. Digital media have become implicated in all sorts of social practices and processes and have sustained the emergence of a new business logic named “surveillance capitalism” (Zubof, 2015)—we shall return to this later. Te growing complexity of today’s media system, and its increased interdependence, is what media scholars refer to as mediatization. Te notion of mediatization emphasises the interrelation between social and cultural change, on the one hand, and a changing media environment, on the other. While mediatization can be traced back over the past fve to six centuries, we have now entered an age of deep mediatization, in which “the social world is not just mediated but mediatized: that is, changed in its dynamics and structure by the role the media continuously (and recursively) play in its construction” (Couldry & Hepp, 2017, p. 15). By this, we do not argue that each and every social practice is mediated, but that the horizons for practices are represented and processed by a complex social world where digital media are both the resources and reference point for human agency (Couldry & Hepp, 2017).
Te Internet of Tings is part of this growing complexity, in which everyday life is reconfgured through “networks of connected things that create and distribute information” (Bunz & Meikle, 2018, p. 34). IoToys are just another component of the ecology of tracking and measuring that is generated by “sensing networks of connected things” (Bunz & Meikle, 2018, p. 2). While being networked and ftted with sensors, IoToys also combine the play afordances of physical toys (their tactile, functional, narrative and emotional features) with the afordances of the Internet of Tings. Tis recombination adds a further layer of complexity to their double articulation in children’s everyday lives. Not only does the child see, touch, feel, speak to and listen to an Internetconnected toy, the toy as a connected object can also track, see, speak and address them. Te interaction between the child and the toy is, therefore, reconfgured as a bidirectional, multidimensional, multisensory experience that involves auditory, visual, haptic and kinetic communication, and in which the toy is repositioned not only as an interface, but as an actor in the communication process. Te toy itself has gained agency, as it collects, generates, communicates and distributes data.
Te notion of double articulation, then, is complicated by the newly acquired agentic capacities of network things. Te materiality of media as objects, and the materiality of the communication infrastructures to which they are connected, is not a precondition for our communication through and to the connected things, but also for connected things to autonomously engage in communicative practices, confguring what, borrowing from Hartmann’s work (2006), we could describe as triple articulation. We argue, therefore, for an extension to triple articulation, whereby the third dimension refers to the agency of things as producers of (big) data and, ultimately, knowledge (boyd & Crawford, 2012; Couldry & Hepp, 2017). Tat is, triple articulation accounts for the entanglement of media objects with broader processes of social, economic and political change that extend the surveillance business model of social media to playthings.
For these reasons, we believe that the defnition of new media provided by Leah Lievrouw and Sonia Livingstone (2006) can complement and compensate for the challenges that a media- and data-saturated world poses to the concept of double articulation, as originally
6 G. Mascheroni and D. Holloway
developed. Tey understand ICTs and their social contexts as comprising three dimensions:
• the artefacts and devices that enable and extend our ability to communicate;
• the communication activities or practices we engage into develop and use these devices; and,
• the social arrangements or organizations that form around the devices and practices (Lievrouw & Livingstone, 2006, p. 23).
Te contributions collected in this volume variously address IoToys as (a) material artefacts that enable physical as well as connected play practices; (b) a combination of play and communicative practices, as well as the data practices in which the users and IoToys engage; and (c) new organisational forms, namely surveillance culture, datafcation and surveillance capitalism, which reconfgure the meanings and value of play and communication practices, and, ultimately, of such toys as media. We, therefore, begin by exploring IoToys as material artefacts; we then delve into their transformation into robots; and fnally, we look at the organisational practices that have developed around toys as networked, sensing media.
The Internet of Toys as Toys
A toy is a physical object that is used for play. A variety of objects can serve as toys (wooden spoons, cardboard boxes and rulers, to name a few). It is manufactured toys, nonetheless, that now form a substantial part of children’s play culture in developed and developing countries, including connected toys. As a new category of toys, it is the digital connectedness and associated communicative afordances—whether they be benefcial or detrimental—of IoToys that are frequently promoted, critiqued and researched. Early childhood practitioners and early development experts also speculate whether IoToys (as opposed to physical toys) will deprive children of real-life authentic play, restrict children’s socialisation with others and lead to a dominion model
Another random document with no related content on Scribd:
Rücken kräuseln. Der tiefste Teil des Wellentales ist stets der, welcher der Basis der steilen Leeseite zunächst liegt, welches Gesetz auch für die Bajirmulden, die größte Wellentälerform der Wüste, gilt. Der Sand, der von granitharten Bergen stammt, muß treu denselben Gesetzen gehorchen wie das wenig beständige Wasser. Er wälzt sich in Wogen dahin, die denen des aufgeregten Ozeans gleichen; auch die seinen rollen unwiderstehlich vorwärts, nur ist die Bewegung unendlich viel langsamer.
In der Bajir Nr. 33 konnte ich ein gutes Stück vorausreiten. Mich lockte ein schwarzer Gegenstand, der sich höher erhob als das tote, vertrocknete Kamisch. Dieses ist selten mehr als ein paar Dezimeter hoch und sieht aus, als wäre es abgeweidet worden, obwohl es nur verkümmert und abstirbt, sobald seine Wurzeln nicht mehr zum Grundwasser hinabreichen. Der schwarze Gegenstand stellte sich als die erste Tamariske heraus. Noch lebte sie ein schwaches Leben, aber rund umher lagen längst abgestorbene, vertrocknete Zweige, ein willkommener Zuschuß zu unserem Holzvorrat.
Noch eine Stunde konnte ich reiten, ohne diese angenehme Bajir endigen zu sehen. Auch das Kamisch nahm kein Ende. Es lebt, ja besitzt sogar, besonders in der Nähe von Flugsand, vom Sommer her einen Anflug von Grün, ist aber auf ebenem Staubboden abgestorben. Es scheint beinahe, als sei der Sand für sein Gedeihen erforderlich oder trage dazu bei, es am Leben zu erhalten. Weitere Tamarisken sind nicht zu sehen; ich machte daher an einem Punkte Halt, wo das Schilf etwas dichter stand und gegen den Wind schützte; hier band ich das Pferd an und zündete ein kleines Feuer an.
Erst in der Dämmerung kam die Karawane herangezogen. Eines der Kamele, ein prächtiges Männchen, das beste von den fünfzehn Kaschgarern, war seit vier Tagen kränklich und ging daher langsamer als gewöhnlich. Einen Kilometer vom Lager hatten sie es, von der Last befreit, zurückgelassen, und Kurban war bei ihm geblieben. Doch, als es dunkel geworden, kam Kurban uns nach, weil es ihm allein bei dem kranken Tiere zu unheimlich geworden war. Nach dem Abendessen mußten Islam und Turdu Bai mit einer Laterne und einem Beutel voll Häcksel, der eigentlich für das Pferd
bestimmt war, nach jenem Platze zurückkehren. Sie fanden jedoch das Kamel tot; es lag mit offenem Maule und halbgeschlossenen Augen da und war noch warm. Es war rührend, Turdu Bai Tränen vergießen zu sehen; er liebte die Kamele wie ein Vater und er war von allen Männern derjenige, der sich am wenigsten am Feuer sehen ließ, da er sich stets bei den Kamelen zu schaffen machte. Das Tier, welches zuerst auf dieser Reise verendete, erlag weder der Überanstrengung noch dem Mangel wie seine vielen Nachfolger. Die Muselmänner sagten: „Choda kasseli värdi“ (Gott hat ihm eine Krankheit gegeben), und wahrscheinlich würde es ebenso sicher auf den Steppen des Tarim gestorben sein wie hier in der Wüste. Die übrigen sechs Kamele befanden sich vorzüglich. Und doch war es der neunte Tag. In der Takla-makan waren gerade am neunten Tage zwei Männer, vier Kamele und das ganze Gepäck liegen geblieben, damals aber waren wir vor Hitze und Durst verschmachtet, jetzt erstarrten wir fast vor Kälte und hatten Wasser in genügender Menge.
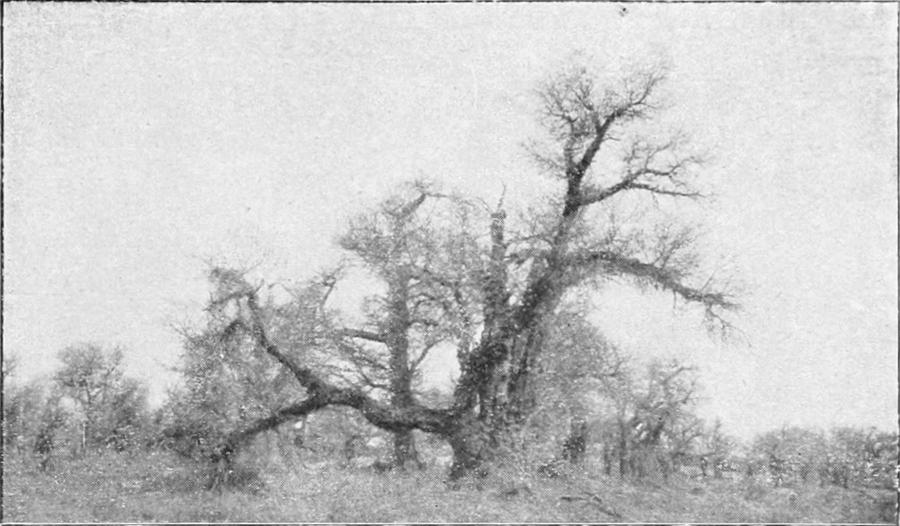
65. Eine alte Tograk am Tschertschen-darja. (S. 182.)
66. Auf dem Eise des Tschertschen-darja. (S. 184.)
67. Am Ufer des Tschertschen-darja. (S. 184.)
68 Sattma in Araltschi (S 187 )
69 Tränken der Pferde an einer Wake (S 189 )
70 Schilfhütten in Scheitlar (S 193 )
Wir hatten jetzt den Abschnitt der Wüstendurchquerung erreicht, in welchem man die großen Schwierigkeiten hinter sich hat und jedes neue Anzeichen von Leben und Wasser mit Spannung und Interesse wahrnimmt. Derartige Zeichen blieben auch heute nicht aus. Wir hatten schon das erste Kamisch und die erste Tamariske passiert. Ich ritt jetzt als Vorhut über die große, lange Bajir Nr. 33, die sich noch immer wie ein ausgetrocknetes Flußbett vor mir hinzog.
Den Boden kreuzten in allen Richtungen Spuren von Hasen, welche Tiere des Wassers gar nicht zu bedürfen scheinen; auch Fuchsfährten waren zu sehen. Dann traten einige Steppenpflanzen, Grasflecke und „Tschigge“, eine am Lop-nor vielfach vorkommende Binsenart, auf. Schließlich zeigten sich wieder Tamarisken, teils frische, geschmeidige, teils abgestorbene, die auf den charakteristischen Kegeln thronen, die ihre längst verdorrten Wurzeln umschließen.
Das Terrain war eben und vorzüglich; wer hätte ahnen können, daß man ein solches im Herzen dieser Sandwüste finden würde! Es wehte jedoch aus Osten so kalt, daß ich bisweilen zu Fuß gehen mußte, um nicht Hände und Füße zu erfrieren.
Diese schöne Bajir endete jedoch in einer Sackgasse, und ein ziemlich hoher Sandpaß war ihr im Süden vorgelagert. Da das Terrain aussah, als könne hier das Grundwasser erreicht werden, beschloß ich, hierzubleiben und zu versuchen, einen Brunnen zu graben.
Islam und Ördek machten sich sogleich ans Brunnengraben, während Turdu Bai die Kamele versorgte und Kurban Holz sammelte. In einer Tiefe von 1,38 Meter stand Wasser. Es war fast ganz süß und hatte +8,2 Grad Temperatur, es quoll aber so langsam aus dem Boden des Brunnens, daß man bei der Verteilung Geduld haben mußte. Abends durften zwei Kamele nach Herzenslust trinken, jedes nämlich sechs Eimer.
Jetzt hatten wir alles, was wir brauchten: Wasser, Brennholz und Weide; es war eine wirkliche Oase in der Tiefe der Wüste. Zwei große Feuer loderten den ganzen Abend in dem intensiven Winde und erhellten mit ihrem rötlichen Scheine die Dünenkämme, von denen Flugsand auf uns herabregnete. Als die Männer meiner Spur folgten, hatten auch sie ein neues, erfreuliches Anzeichen besserer Gegenden erblickt: einen großen, schwarzen Wolf, der über die Dünen im Westen fortgelaufen war.
Dieser Ruhetag war für Menschen und Tiere außerordentlich schön und notwendig. Wir waren meistens zu Fuß gegangen, die Kamele hatten schwere Lasten schleppen müssen, und die Kälte greift den Körper an, wenn man nicht hinreichend Brennholz hat, um sich zu erwärmen.
Wir machten das Lager so gemütlich, wie es die Umstände erlaubten. Der weiße Filzteppich, auf welchem mein Bett ausgebreitet zu werden pflegte, wurde in ein improvisiertes, mit ein paar Tamariskenzweigen gestütztes Zelt verwandelt, das uns Schutz gegen den Sturm gewährte, der den ganzen Tag tobte. Auf der vor dem Winde geschützten Seite hatte ich ein gewaltiges Feuer. Die Leute kampierten auf dieselbe Weise. Während ich den Tag lesend auf meinem sandbedeckten Bette verbrachte, tränkten sie die Kamele, was geraume Zeit in Anspruch nahm.
Das während der Nacht hervorgesickerte Wasser war am Morgen gefroren, und die ausgegrabene Erde war steinhart. Aus den Stangen eines Packsattels wurde eine Leiter gemacht, die bis auf den Boden der Grube reichte, wo Ördek die Eimer mit einer Schale allmählich füllte. Die Kamele tranken nicht weniger als je neun Eimer, zwei von ihnen sogar elf, und man sah sie förmlich anschwellen, während sie sich die Flüssigkeit einverleibten. Ihre Stimmung veränderte sich sichtlich. Sie wurden munter, spielten miteinander, liefen umher und grasten dann tüchtig in dem spärlichen Schilfe.
Der letzte Tag des neunzehnten Jahrhunderts sah am Morgen, als es noch dunkel war, recht vielversprechend aus; ich sah die Sterne auf das Biwak herabfunkeln, wo die Tamarisken sich auf ihren Kegeln gespensterhaft erhoben. Als wir uns aber zum Aufbruch rüsteten, war das Wetter wieder ebenso unfreundlich wie gewöhnlich. Klare, ruhige Nächte und wolkenschwere, windige Tage charakterisieren den Winter und halten die Kälte an der Erdoberfläche fest.
Heute bedeckte sich die Karawane mit Ruhm; sie legte 24,3 Kilometer zurück, die längste Tagereise auf dem ganzen Wüstenzuge.
In den Bajiren Nr. 34, 35 und 36 kam andauernd Vegetation vor, aber die Tamarisken standen dort zerstreuter. Von dem Grenzpasse der letzten Mulde scheint sich eine Bajir nach Südosten zu erstrecken; sie lag aber nicht auf unserem Wege und wurde links liegen gelassen. Ich merkte allerdings, daß es eine Enttäuschung für die Leute war, sie nicht benutzen zu dürfen, sondern nach Südsüdwest abbiegen und einen hohen Paß erklettern zu müssen, doch ihre Überraschung war ebenso groß wie die meine, als wir von der Höhe herab die Bajir Nr 37 erblickten, die groß, breit und offen wie ein Feld war und nicht mehr den Eindruck einer geschlossenen Arena machte. Der sie im Süden begrenzende Paß sah aus wie eine sehr niedrige Schwelle, und hinter ihm erhob sich kein Sand mehr, was ich der bedeutenden Entfernung und der unklaren Luft zuschrieb. Als wir diese Schwelle endlich überschritten hatten, zeigte sich vor uns die Depression Nr. 38 ebenso groß und offen. Es war
herrlich; eine unsichtbare Hand schien eine Riesenfurche durch den Wüstensand gepflügt zu haben, um der Karawane den Weg zu bahnen.
Wir lagerten vorn in der Mulde, wo wir reichlich Brennholz fanden. Islam wollte uns von der letzten Kamellast Holz befreien, aber Turdu Bai, der ein vorsichtiger General war, schlug vor, sie noch eine Tagereise weit mitzunehmen, eine kluge, verständige Rede.
So ließen wir uns denn in dieser wunderbaren Neujahrsnacht in Ruhe und Frieden an zwei großen Feuern nieder in einer Gegend, die so still und ungestört war, daß nicht einmal die Stille eines weit abseits vom Wege liegenden vergessenen Grabes ihr darin gleichkam. Unsere Freunde wußten nicht, wo wir waren, und in Turasallgan-ui waren sie ganz gewiß in Aufregung über unser Schicksal, um so mehr, als ihre Phantasie durch Islams haarsträubende Beschreibungen über unseren früheren Wüstenzug und Parpi Bais Schilderung unserer ersten Wüstentage schon erhitzt worden war. Auch die Kosaken hatten während der Rekognoszierung gesehen, wie es dort aussah, und gestanden nachher, sie hätten gefürchtet, daß der Sand uns auf allen Seiten den Weg versperren werde und wir von unserem eigenen Mute verurteilt seien, vor Durst, Müdigkeit und Kälte umzukommen. Meine vier Begleiter sagten diesen Abend, daß sie erst jetzt, nun wir in sicheres, eine Küste anzeigendes Fahrwasser gekommen, von ihrer Unruhe befreit seien; sie konnten aber nicht begreifen, wie ich die Entfernung nach Tatran mit solcher Sicherheit zu beurteilen imstande war. Sie glaubten entschieden, daß meine Versicherungen und Versprechungen eigentlich nur wohlwollende Versuche seien, sie zu beruhigen.
Und nun ging die Sonne in diesem Jahrhundert zum letztenmal unter — das konnte man nur daran sehen, daß der trübe, neblige Tag in nächtliche Schatten überging, die das erste Morgenrot des zwanzigsten Jahrhunderts verjagen sollte.
Wenn der erste Tag eines neuen Jahres oder noch mehr der eines neuen Jahrhunderts eine Vorbedeutung enthalten oder ein Wahrzeichen zukünftiger Dinge sein soll, so sah die Zukunft an
diesem 1. Januar 1900 für uns in Wahrheit düster aus. Der Himmel war in ein schwarzes Trauergewand gehüllt, und von Morgenrot war nichts zu sehen. Die Temperatur ging um 7 Uhr jedoch bis −15 Grad hinauf, und als ich aufstand und mich ankleidete, befand ich mich dank dem großen Feuer in einem noch gemäßigteren Klima.
Das einzige, was die Neujahrsstimmung hob, war, daß unsere 38. Bajir sich vor uns bis ins Unendliche hinzog, und leichten Schrittes zogen wir in ihrer Mitte dahin. Die Leute hegten sogar die eitle Hoffnung, dies sei der Anfang der Steppen, die sich am Ufer des Tschertschen-darja ausdehnen. Die Vegetation wurde jedoch magerer, nur hie und da ein Grasbüschelchen, einige Schilfstengel oder eine Tamariske, und zwischen kleinen Löchern in dem hier mit Sand untermischten Boden huschten Feldmäuse, von den Muselmännern „Säghisghan“ genannt, hin und her.
Von dominierenden Punkten aus spähten wir vergebens nach der nächsten Bajir, doch diese Bildungen schienen jetzt aufgehört zu haben. Der Blick reichte weit nach Süden: das Sandmeer war wie in der Takla-makan mehr kompakt, die gewaltigen Sandwände, die wir bisher zur Linken gehabt hatten, fehlten, weitere Depressionen waren nicht zu sehen, die ganze Bauart hatte sich mit einem Schlage verändert, aber die Dünen lagen glücklicherweise immer noch im Norden und Süden.
Wir hatten es bisher gut gehabt, wir hatten es gehabt wie ein Schiff, das von der offenen See in Gürtel von Treibeis und Tang hineingekommen ist. Die Wogen gingen haushoch, und wir kamen verzweifelt langsam vorwärts, es ging bergauf und bergab über große Dünen. Die Vegetation hörte beinahe ganz auf. Ich fing wieder an zu vermuten, daß die Oasen, die wir eben durchquert, von den äußersten in die Wüste vorgeschobenen Vorposten des Kara-muran herrührten und daß diese Landstrecke auch wohl bald im Sande begraben sein würde. In diesem Falle konnten wir uns darauf vorbereiten, bis in die Nähe des Tschertschen-darja nur schwieriges Terrain zu finden.
Fern im Osten schien es noch Depressionen zu geben, aber diese lagen außerhalb unseres Weges. Nach Süden hin war alles
gleichmäßig hoher Sand, nur hie und da dominierten pyramidenhohe Dünenkämme, und der Horizont glich einem Sägeblatt mit gezähnter Schneide. Noch tauchte gelegentlich eine verdorrte Tamariske auf ihrem Kegel zwischen den Dünen auf, aber die Entfernungen zwischen diesen abgestorbenen Bäumen wurden immer größer. Als wir nach einer mühsamen Wanderung von nur vierzehn Kilometer wieder eine von etwas Kamisch und trockenen Zweigen umgebene Tamariske trafen, machten wir daher Halt.
2. Januar 1900. Als ich bei Tagesanbruch geweckt wurde, umgab mich eine vollständige Winterlandschaft; es schneite leicht, der Boden war kreideweiß, und die Dünen hätten ebensogut kolossale Schneewehen sein können, denn vom Sand war gar nichts zu sehen. Islam war so vorsichtig gewesen, eine Decke über meine Kiste zu legen, auf deren Deckel Instrumente und Aufzeichnungsbücher nachts gewöhnlich liegen blieben. Es war noch halbdunkel, als das Morgenfeuer vor meinem Bette angezündet wurde, und seine Flammen ließen die feinen Schneekristalle wie Diamanten glitzern und funkeln. Es waren nicht gewöhnliche Schneesternchen, sondern Nadeln, als wenn Reif in außerordentlicher Menge gefallen wäre.
Während der ersten Marschstunden blieb die Landschaft auf allen Seiten blendend weiß; ich hatte noch nie Sanddünen in diesem ungewöhnlichen Gewande gesehen, in diesem weißen Leichentuche, das nur dazu beitrug, ihre totenähnliche Einsamkeit und Nacktheit zu erhöhen. Gegen Mittag verschwand die dünne Decke von allen nach Süden gekehrten Abhängen, und gleich nach Mittag hatten auch die anderen ihren gewöhnlichen gelben Farbenton wieder angenommen; nur hier und dort in Vertiefungen lag noch ein kleiner, weißer Streifen.
Der Sand wurde immer beschwerlicher, und es tauchte keine Bajir mehr auf, die uns einige ermüdende Schritte hätte ersparen können; alles war jetzt Sand. Freilich lagen die steilen Leeabhänge stets nach Süden und Westen, auf zwei ein Netz von Vierecken bildende Dünensysteme deutend, aber alle Depressionen waren hier längst versandet. Augenscheinlich herrschten hier weniger regelmäßige Windverhältnisse als in der nördlichen Hälfte der
Wüste. Es war ein Glück, daß wir den Marsch nicht von Süden her begonnen hatten, denn dies wäre nie gegangen; wir hätten uns zur Umkehr gezwungen gesehen, und auch noch so große Feuer hätten den in diesem Winter herrschenden Nebel auf größere Entfernung hin nicht durchdringen können.
Um 4 Uhr begann es zu schneien, jetzt aber ordentlich. Wir waren nicht verurteilt, an Wassermangel zu sterben. Es herrschte ein regelrechtes Schneetreiben mit Wind aus Südsüdwest. Welch ein Unterschied gegen die Sandstürme in der Takla-makan! Nach einer halben Stunde war die Landschaft wieder kreideweiß, und die Schneedraperien schienen von den Wolken herab auf dem Boden zu schleppen. Die Dämmerung breitete sich über diesem Chaos von Sand und Schnee aus, und wir suchten und spähten nach einem Platze, wo wir die Kamele über Nacht anbinden konnten. Endlich erschien im Süden in einer Entfernung von zwei Kilometer ein schwarzer Punkt; dorthin mußten wir um jeden Preis. Eine gutgemessene Stunde gehörte dazu, und es war pechfinster, als wir bei einer Tamariske anlegten und Brennholz fanden.
Der fallende Schnee zischte nicht einmal im Feuer, er verwandelte sich in Dampf, ehe es dazu kam, aber auf den Blättern meines Tagebuches ließ er sich häuslich nieder. Die freundlichen Oasen hatten gänzlich aufgehört, und um uns herum lag lauter unfruchtbarer Sand. Ein paar Stunden lang waren wir an zwei Fuchsfährten entlang gegangen, einer älteren, nach Norden gehenden, und einer frischen, welche die Rückkehr des Fuchses nach dem Tschertschen-darja anzeigte. Was mochte er in der Wüste gesucht haben? Er mußte doch wohl am Flusse ein viel einträglicheres Jagdrevier haben.
Ich konnte Ördeks Gedankengang verstehen, wenn ihm in dieser Wüste, die gar kein Ende nahm, in der nicht einmal die Sonne schien, und in die wir uns immer tiefer hineinverirrten, unheimlich zumute wurde. Er sprach mit Begeisterung von den Ufern des Tarim, den Seen, den Kähnen und den Fischnetzen wie von einem Paradiese, in das er nie zurückkehren würde. Er sprach von den Schwänen, jenen himmlischen, gefühlvollen Vögeln, welche die Seen zu besuchen pflegen. „Wird das Männchen erschossen,“
erzählte er, „so grämt sich das Weibchen zu Tode und weicht nicht von dem Platze, wo sein Beschützer ermordet worden ist.“ Er habe einmal einen Jäger eine Kugel in eine fliegende Schar hineinschicken sehen, worauf zwei Schwäne herabgestürzt seien. Das Männchen sei tödlich getroffen gewesen, und das Weibchen sei ihm gefolgt, sich in der Verzweiflung mit dem Schnabel die Brust zerfetzend.
Die Kamele waren jetzt so angegriffen, daß wir ihnen einen Ruhetag gönnen mußten. In einer Tiefe von 1,13 Meter fanden wir Wasser mit schwach bitterem Beigeschmack, und Schnee war auch genug da. Der Boden war 33 Zentimeter tief gefroren. Es schneite den ganzen Tag heftig in dichten, großen Flocken. Die Leute machten kleine Entdeckungsreisen in die Nachbarschaft, und in der Dämmerung kam Turdu Bai mit zwei Kamelen zurück, die je eine volle Last trockenen Brennholzes, das er in der Nähe gefunden hatte, trugen. Die Flocken prasselten auf die uralte Zeitung, die ich in der Hand hielt, und glitten an ihr herunter. Oft mußte ich das Blatt schütteln, um die Worte unterscheiden zu können. Auch um die Mittagszeit herrschte Halbdunkel, und Dünen, Erdboden und Himmel verschmolzen zu einem einzigen, weißen, wirbelnden Durcheinander in höchst unangenehmer, matter, ungleichmäßiger Beleuchtung. Noch am späten Abend dauerte das Schneewetter an.
Die Nacht wurde für uns im Freien Liegende recht kalt; das Minimumthermometer zeigte −30,1 Grad, um 7 Uhr −27 Grad und um 8½, als ich aufstand, −24 Grad. Das ist recht kühl für ein Toilettenzimmer, besonders, da ich mich stets entkleidete und im Schlafrocke schlief. Am scheußlichsten ist das Waschen und Anziehen, wenn man auf der Feuerseite +30 Grad und im Rücken −30 Grad hat. Die ganze Nacht schneite es gleich stark, und am Morgen war ich so vollständig im Schnee begraben, daß Islam mich mit Spaten und Kamischbesen aus der Schneehülle befreien mußte. Dafür hatte der Schnee aber dazu beigetragen, mein Nest warm zu halten; ich hatte gar nichts von der nächtlichen Kälte gemerkt. Es ist zu schön, wenn man erst einmal in den Kleidern steckt und mit dem Pelze über den Schultern vor dem Feuer sitzt und seinen Tee trinkt!
Der Schnee fiel den ganzen Tag, und die Temperatur brachte es nur zu −13 Grad, was bitterkalt ist, wenn man den Wind gerade entgegen hat. Das Terrain war nicht unvorteilhaft. Wir konnten oft zwischen den schlimmsten Dünen hindurchkreuzen, und schließlich zeigten sich wieder einige kleine Mulden, die jetzt nach Südsüdost gerichtet und voller Sand waren. In einer solchen, Nr. 43, lagerten wir, obwohl dort keine Spur von Feuerungsmaterial war. Wir besaßen jedoch noch eine halbe Kamellast von unserem ursprünglichen Vorrat; da alle halb erstarrt waren, mußte sie diesen Abend draufgehen, geschehe, was da wolle.
Auf den nach Süden gerichteten steilen Dünenabhängen vermag sich der frischgefallene Schnee nicht lange zu halten. Nur auf den Nordseiten der Dünen bleibt er liegen, und in den Dünentälern ist er mehrere Zentimeter tief. Wirft man einen Blick nach Norden, so sieht man fast nur Sand, nach Süden bloß Schnee.
5. Januar. Endlich hatten die Wolkenmassen, die uns während der ganzen Wüstenreise verfolgt hatten, sich entschlossen, sich von ihrem Inhalte zu trennen, denn der Schnee fuhr die ganze Nacht fort, lautlos wie Watte zu fallen, und am Morgen waren sogar die Stellen, wo unsere Feuer gebrannt hatten, verschneit. Alle unsere Sachen mußten unter dem Schnee hervorgesucht werden. Auch die Kamele lagen überschneit im Kreise da und sahen mit den kleinen Schneewehen auf dem Rücken, Puder in der Perücke und Eiszapfen im Kinnbarte und am Maule ganz barock aus.
Jetzt war nicht einmal ein Streifen gelben Sandes zu sehen. Am Vormittag lagen die steilen, nach Westen gerichteten Abhänge im Schatten und hatten eine prachtvolle Färbung — stahlblau in verschiedener Schattierung, je nach der wechselnden Abschüssigkeit des Hanges, — zu oberst aber wölbten sich die weißen Kuppeln der Dünen, intensiv von der Sonne beleuchtet.
Die hohen Sandprotuberanzen hatten auffallende Ähnlichkeit mit dem in ewigen Schnee gehüllten Kamme einer Bergkette; ich glaubte hier ein Miniaturbild des Transalai mit dem durch eine hohe Dünenpyramide dargestellten Pik Kauffmann wiederzuerkennen. Das blaßblaue Farbenspiel war dasselbe. Es blendete die Augen.
Ich hatte eine doppelte Schneebrille, und alle Männer trugen dunkle Brillen. Doch war die Luft nicht rein, wie sie es im Gebirge an klaren Tagen ist. Die feinen Kristallnadeln erlaubten uns nicht, Umrisse und Formen über eine Entfernung von einem Kilometer hinaus deutlich zu unterscheiden; weiter fort verschwindet alles in undurchdringlichem Schneenebel. Und das war gut, denn das Terrain war nach Süden hin wenig ansprechend. Lauter immer höher werdende Berge von Sand, kein sandfreier Fleck von auch nur einem Quadratmeter Größe, keine Vegetation, weder lebende, noch tote.
Im Laufe des Tagemarsches erlitt die Schneedecke gewisse Veränderungen. Trotz des Schmelzens und der Verdunstung wurde sie um so dicker, je weiter wir nach Süden gelangten, was seinen Grund darin hat, daß die Schneemenge mit der Entfernung von den Bergen, denen wir uns jetzt langsam näherten, abnimmt. Manchmal hatte der Schnee eine harte Kruste, und man hätte lange Strecken auf den Schneeschuhen zurücklegen können. Wer hätte geglaubt, daß dies in einer Sandwüste möglich sein würde!
Im allgemeinen wurde unser Marsch durch den Schnee erleichtert, denn infolge der Regelierung an den Berührungsflächen des Schnees und des Sandes wurde die Tragkraft des Bodens größer. Namentlich waren alle Kämme hart wie Eis, und auf die steilen Abhänge brauchte man nur den Fuß zu setzen, so rutschten schon Schollen von 20 Quadratmeter Größe hinunter. Jetzt hätte nicht einmal der heftigste Buran den Sand aufzuwirbeln vermocht, denn der Schnee wirkte wie Öl auf die Wellen.
Am 6. Januar blieb das Sandmeer sich gleich, ja seine Wogen gingen wenn möglich noch höher. Islam wandert an der Spitze, wird aber müde und besteigt ein unbeladenes Kamel. Turdu Bai ist unermüdlich, er führt die Karawane wie eine Lokomotive ihre Güterwagen. Wenn ich gehe, um mich warm zu halten, darf Kurban auf meinem munteren Pferdchen reiten.
Der Lagerplatz war von allen, die wir bisher gehabt hatten, der schlechteste, eine Grube im Sandmeere, in der nicht einmal ein vom Winde verschlagenes Blatt zu entdecken war. Es ist im Bette, wenn
man sich schlafen legt, beinahe −20 Grad kalt, und man muß sich eine Weile gedulden, ehe die Glieder wieder so elastisch werden, daß man sich der Situation gewachsen fühlt und alle die Diebslöcher, durch welche die Nachtkälte eindringt, zustopfen kann. Diese Nacht ließen die Kälte und der Wind uns kaum schlafen, und am Morgen hatten wir der −24 Grad starken Kälte nur noch ein paar Scheite entgegenzusetzen. Die Leute lagen auf einem Haufen, um sich aneinander zu wärmen, und waren von der Bekanntschaft mit diesem unheimlichen Lande, in das wir uns wie Holzwürmer in eine Planke hineingebohrt hatten, völlig entmutigt.
Am nächsten Morgen waren wir erst um 10 Uhr hinreichend aufgetaut, um unseren Weg fortsetzen zu können. Die Luft war außergewöhnlich klar, und im Süden zeigte sich zum ersten Male die äußerste, Tokkus-dawan genannte Kette des Kwen-lun. Im Norden war der Himmel rein und blau, im Süden aber zogen tiefhängende weiße Wolken, die man oft kaum von den beschneiten Dünen unterscheiden konnte.
71. Meine Kosaken Tschernoff, Sirkin und Schagdur. (S. 195.)
72. Meine burjatischen Kosaken Tscherdon und Schagdur mit tibetischer Jagdbeute. (S. 198.)
73. Basch-tograk. (S. 202.)
74. Tamariskendickicht. (S. 203.)
75 Der Teich bei Kurbantschik (S 204 )
Von dem Gipfel einer Düne aus machte ich eine erfreuliche Entdeckung. Als ich den fernen südlichen Horizont mit dem Fernglase musterte, fiel mir etwas auf, das sich gegen den Schnee
wie schwarze Baumstümpfe abhob und nichts anderes sein konnte als toter Wald. Die Stelle lag etwas aus unserem Wege, gegen Südost, aber ich ließ die Karawane nichtsdestoweniger dorthin ziehen, und wir schlugen am Abend unser Lager unter Massen von abgestorbenen, verdorrten Pappelstämmen auf.
Mit vermehrter Lebenslust und frischem Mute gingen die Leute an die Arbeit. Sie schaufelten den Schnee fort und ließen die Äxte zwischen den Tograkbäumen tanzen, so daß wir bald ganze Stöße von Brennholz hatten. Ein unmittelbar neben dem Lager stehender Stamm war zum Fällen zu dick; er wurde deshalb, so wie er war, in Brand gesteckt und beleuchtete wie eine Riesenfackel das weiße Leichentuch der Wüste. Quer über mein Feuer wurde eine hohle Pappel gelegt, durch welche die Flammen wie durch ein Rohr leckten. Sie glühte, krachte, wurde von innen erleuchtet und glänzte wie Rubine, bis die Rinde platzte und sich wie in Verzweiflung unter der rasenden Gewalt des losgelassenen Elementes wand. Gewaltige Rauchsäulen stiegen zum Monde empor, der jetzt seit langer Zeit zum ersten Male wieder aus seinem Wolkenversteck hervortrat. Meine Leute überlisteten diesen Abend die nächtliche Kälte; sie schaufelten Gruben in den Sand, füllten sie mit glühenden Holzkohlen, schütteten sie wieder zu und legten sich dann darauf nieder. Die Kamele haben seit zwei Tagen kein Futter erhalten, und die Hunde bekommen nur Brot.
Am 8. Januar sollten wir aus der Macht der Wüste befreit werden. Als wir aufbrachen, sagte ich den Leuten, daß sie diese Nacht am Ufer des Tschertschen-darja schlafen würden. Wir nahmen kein Brennholz mit, da wir vor uns überall dürre Stämme sahen, doch sie wurden immer vereinzelter, und bei dem letzten, wo der hohe Sand wieder anfing, beluden wir ein Kamel mit Holz.
Als wir den Gipfelpunkt eines dominierenden Dünenkammes erreicht hatten, zeigte sich im Südosten das erste Anzeichen des ersehnten Zieles: eine dunkle Linie am Horizont, die sich scharf gegen die ewige, weiße Schneedecke abhob. Das mußte der Waldgürtel am Tschertschen-darja sein!
Nachdem wir noch eine Stunde marschiert, gelangten wir an die ersten Tamariskenkegel; ihre Grenze war außerordentlich scharf, kein einziger Strauch überschritt sie, und der Sand, dessen letzte Abhänge langsam nach dem Vegetationsgürtel abfielen, hörte ebenso plötzlich auf. Nun zogen wir in ein vollständiges Labyrinth von Tamarisken hinein; sie standen so dicht, daß zwischen ihnen nur schmale, gewundene Gänge waren; auf diesen zwängten wir uns in unzähligen Zickzackbiegungen durch, wobei die Kamellasten so dicht an den trockenen Zweigen vorbeischrammten, daß diese krachten.
Die Leute wollten gern in einem Haine von uralten Pappeln bleiben, wo alles, dessen wir bedurften, im Überfluß vorhanden war; ich gab ihnen jedoch die Versicherung, daß, wenn sie sich noch eine Weile geduldeten, wir am Flußufer selbst lagern würden. Nach einer Viertelstunde erreichten wir auch den Weg, der von Tschertschen nach dem Lop führt und auf dem wir im Schnee frische Spuren von Kühen und Schafen erblickten. Wir folgten diesem Wege eine Strecke, bis er das Flußufer berührte, und schlugen hier auf einem kleinen Hügel, von dem wir die schneebedeckte, 100 Meter breite, in dem Rahmen der dunkeln Uferwälder kreideweiß erscheinende Eisdecke des Tschertschen-darja überschauen konnten, das Lager auf. Es war sehr angenehm, am Fuße dieser gewaltigen Bäume rasten und die schöne Aussicht genießen zu können. Die Berge zeichneten sich scharf und deutlich ab, und der Schnee glitzerte im Mondschein. Am allerbesten war es jedoch, daß unsere sechs Kamele und das Pferd sich jetzt in die Schilffelder vertiefen konnten, nachdem sie die Probe so rühmlich bestanden hatten. Meine Leute waren verwundert, daß ich die Entfernung fast bis auf eine „gulatsch“ (Klafter) hatte berechnen können, und erklärten, daß sie mir jetzt überallhin folgen würden, ohne sich auch nur einen Moment zu bedenken.
Der Punkt, an dem wir den Fluß erreichten, liegt nach meiner früheren Karte (Petermanns Mitteilungen Ergänzungsheft Nr. 131) 285 Kilometer von dem Punkte entfernt, an dem wir den Tarim beim Tana-bagladi verlassen hatten. Nach dem jetzt aufgenommenen