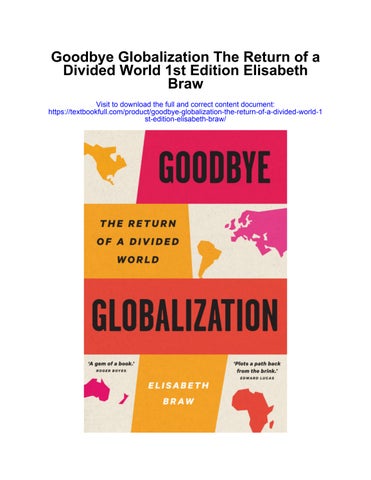1 THE BIG BANG
When Gintarė Skaistė was growing up in the eighties, her world was grey. ‘People like me obviously didn’t know much about the world outside our town or our country,’ she told me. ‘But you could tell when someone had contacts in the outside world. We had relatives in the US and they’d bring gifts for our family. It was always very colourful toys and clothes. You’d never see such colourful clothes in the Soviet Union.’ The outside world was everything outside the Soviet Union, where Skaistė was born in 1981. Her parents insisted that the country the family lived in was called Lithuania, but officially it was the Lithuanian Soviet Socialist Republic, one of the Soviet Union’s fifteen member republics. Skaistė and her parents had visited Lithuania’s neighbours, the Estonian Soviet Socialist Republic and the Latvian Soviet Socialist Republic, and Skaistė’s family had even been to Moscow once. Apart from that, most of the world was closed to her. But thanks to the colourful toys and clothes American relatives brought, young Gintarė knew the world was different outside the Soviet Union.
Across the border, in the Latvian SSR, another girl was growing up in the same ocean of grey. ‘One of my earliest memories is going to a grocery store with my parents and that most of the shelves were empty,’ Ivita Burmistre told me. ‘Every day at a certain time products were delivered to the store, and you had to stand in a very
long queue to try to get them. Sometimes you were successful, but not always.’ Young Ivita’s grandmother, who lived with the family, kept pointing out that Latvia was once the world’s leading exporter of butter and bacon, but such stories seemed to be from a different world.
Ivita couldn’t know that Soviet leader Mikhail Gorbachev was trying to reform his enormous country’s economy. In 1987, the Politburo and the Supreme Soviet passed a new law that allowed international companies to do business in the Soviet Union. Few arrived, which was hardly surprising, since Soviet state enterprises had to be majority-owners and the Soviet bureaucracy seemed insurmountable. But by the summer of 1988, the first private banks were appearing, and by early 1989 the country was home to 150 private banks.1 A few months later, Gorbachev even invited the chairman of the New York Stock Exchange to come to the Soviet Union with a delegation of bankers interested in teaching the Soviets how to establish capital markets.2
Not long afterwards, Gorbachev made another attempt to attract Western firms, this time without the Soviet majority-ownership requirement, and now companies responded in force. On 31 January 1990, McDonald’s triumphantly opened its first restaurant in the Soviet Union. By the beginning of 1991, a staggering 400 foreignowned companies had registered themselves in the small Estonian Soviet Socialist Republic and many others in the Latvian and Lithuanian Soviet Socialist Republics.
In Moscow, a nineteen-year-old mathematics student named Sergei Guriev was plugging away at economic models. After graduating from secondary school in 1988, he’d opted for mathematics, since mathematics students were less at risk of being conscripted for service in Afghanistan.
Guriev needn’t have worried about serving in Afghanistan. When the young Sergei reached conscription age, Gorbachev was beginning to withdraw Soviet forces from that disastrous war, and by the beginning of 1989 there were no Soviet troops left in the country. Gorbachev’s reform of the Soviet Union, though, was not
going according to plan. By the summer of 1990, all three Baltic republics had declared themselves independent. In October 1990, East Germany joined West Germany in the capitalist world. Poland, Czechoslovakia, Hungary and other Warsaw Pact states held democratic elections and began transforming themselves into market economies. By September 1991, the weakened Gorbachev had granted the Baltic states their independence.
Now things began accelerating even faster. By October, more than 1,100 Western companies had, for example, set up operations in Estonia and nearly 200 others were registering in the new republic each month.3 Michael Treschow, a rising executive with the Swedish mining-equipment maker Atlas Copco, was watching closely. ‘There were unlimited countries to expand to,’ he said. ‘If a country was too isolationist, you didn’t need to bother with it because there were so many other ones.’ That December, the Soviet Union itself ceased to exist and Gorbachev’s position with it. Now Russia and its newly elected president, Boris Yeltsin, represented what was left of the superpower.
Across the Baltic Sea, a young executive had just returned from his first overseas posting. Immediately after graduating from Sweden’s Uppsala University in the mid-eighties, Karl-Henrik Sundström had been hired by telecoms giant LM Ericsson. He was swiftly given the chance to work in Australia for a few months, and two years later the firm had dispatched him to Argentina as the chief financial officer at its subsidiary there. ‘There were a lot of us young people who made careers very, very fast,’ Sundström observed. ‘You started as a low-end manager and suddenly you started to rise because we were growing so much. Young people were able to get very good positions very, very fast. I became a director of one of Ericsson’s largest practice areas at age twenty-nine. Today you have to wait until your late forties before you get a position like that. But there was huge demand for managers because companies were growing so quickly.’
When Treschow began his career in the sixties, globalized business mostly meant precisely what Atlas Copco had been doing at
home and in a few countries like the United States: Western companies importing and exporting between each other, including countries like Japan and Australia located outside the geographical West. In his first job, Treschow had been dispatched for a while to France. Internationally ambitious companies like Atlas Copco sometimes went beyond those easily accessible countries, but that usually meant creating a local version of the home company in each country.
Some Western firms even had contracts with Warsaw Pact states. In the 1920s, revolutionary leaders turned national leaders Vladimir Lenin and Leon Trotsky were so enamoured with Ford that they imported Ford engineers and production techniques. The decade after, Ford produced more than a million Ford AA trucks under contract with the Soviet government.4 In the late sixties, Renault began making cars in Romania, and soon thereafter Fiat launched production in Poland and the Soviet Union.5 So excited was Soviet leader Leonid Brezhnev about his country’s massive new commercial arrangement with the Italian automotive giant in the 1960s that he arranged for the town housing Fiat’s new plant to be massively expanded and renamed in honour of the long-time leader of Italy’s Communist Party, Palmiro Togliatti.6 Some years later, PepsiCo struck a pioneering deal allowing the fizzy drink to be manufactured and sold in the Soviet Union; in return, PepsiCo agreed to sell Stolichnaya and other Soviet alcoholic drinks in the West. Around the same time, PepsiCo’s arch-rival Coca-Cola was allowed to launch production and sale in Poland. PepsiCo soon followed.7
But these were not traditional business arrangements: they were arrangements between Western companies and Warsaw Pact governments. By the eighties, a few Warsaw Pact countries were also manufacturing goods for export to the West to earn hard currency. East Germany’s government-owned Deutrans hauling firm brilliantly captured the cargo market for exports going through the Iron Curtain.8 Still, the trade between East and West was modest. ‘If you manufactured anything in those countries, you sold it there,’ Treschow said. ‘We were a global company that operated a number
of islands, you might say. Every now and then you might be allowed to import some components, but that was it.’
But gas seeped through. In the early seventies, West German chancellor Willy Brandt included Soviet gas in his policy of improving relations with the Soviet bloc; indeed, it was part of West Germany’s efforts to create some manner of coexistence with the Soviet Union by trading with it. The Soviets needed pipeline parts while West Germany wanted more gas imports. From 1973, West Germany received Soviet gas even as NATO prepared for war with the Warsaw Pact, and it kept receiving Soviet gas even when the United States placed nuclear weapons on its soil in response to Soviet ones in East Germany.9 In 1981, the Soviet Union signed an agreement to supply gas to West Germany, France, Belgium, Austria, Italy and the Netherlands. West German, French, Italian and Dutch companies were given contracts to build the 3,500-mile pipeline. Ronald Reagan was so furious that he authorized the CIA to sabotage the pipeline.10 Deng Xiaoping, though, had beaten his comrades in Moscow to a strategic decision: to open his country to not just a little bit of licence production but to a market economy.11 In 1979, the chairman of the Chinese Communist Party had sent China’s first-ever delegation to the World Economic Forum in Davos, and a short time later Davos titans arranged for a group of European CEOs to visit China.12 Deng had decided that his country needed economic reform, and he proceeded with small but determined steps. Peasants were given some freedom over their crops and harvests, and a while later Western companies were granted opportunities to invest in Chinese firms. For that, they needed to be able to get to the country. Until 1980, the most convenient way of getting to Beijing involved lengthy flights on Iran Air or Pakistan International Airlines with a corresponding stopover in Iran or Pakistan. That year, Lufthansa, British Airways and Air France launched their first direct flights between Beijing and Frankfurt, Berlin, London and Paris, respectively.13 It was a revolutionary shift for a country that had in the past sealed itself off from capitalism and global markets.
In 1985 Volkswagen began manufacturing in China. Coca-Cola had arrived too, as had IBM and even the French fashion brand Pierre Cardin.14 Treschow was about to launch his company’s firstever operations there. As was the case with every other company setting itself up in China, Atlas Copco’s operations were dictated by the government: ‘Our office was in a hotel, and the manufacturing was done by a local licensee or joint-venture partner,’ Treschow said. ‘We didn’t control our operations there, nor did any other Western companies control theirs.’ But compared with China’s enormous potential for low-cost manufacturing and its massive consumer base, that was a minor headache.
Before China did so in its own way, Japan and South Korea had joined the globalized economy, and they had done so with such phenomenal success that brands from both countries had become household names. That led a Harvard Business School professor to prophesy a global consumer-product era. ‘A powerful force drives the world toward a converging commonality, and that force is technology. It has proletarianized communication, transport, and travel. It has made isolated places and impoverished peoples eager for modernity’s allurements. Almost everyone everywhere wants all the things they have heard about, seen, or experienced via the new technologies. The result is a new commercial reality – the emergence of global markets for standardized consumer products on a previously unimagined scale of magnitude,’ Theodore Levitt – a German Jew whose family had fled to America and settled in the Ohio city of Dayton – wrote. He concluded that ‘the globalization of markets is at hand’. And with that, he popularized the term globalization.15 In the late eighties, consumers in the West loved the fact that all manner of goods were becoming more affordable. And they hadn’t even experienced real globalization yet.
A New York real-estate developer named Donald Trump viewed matters very differently. ‘Japan and other nations have been taking advantage of the United States,’ he complained in open letters addressed ‘To The American People’, which he published in the New York Times, the Washington Post and the Boston Globe in 1987,
adding that ‘the Japanese, unimpeded by the huge costs of defending themselves (as long as the United States will do it for free), have built a strong and vibrant economy with unprecedented surpluses’.16 But many of Trump’s fellow executives, men (and some women) involved in the manufacturing of goods and the generation of new wealth, were now occupying themselves not with competition from Japan but opportunities in China. ‘From the late eighties, things went very quickly in China,’ Treschow said. ‘That’s when Deng Xiaoping’s opening up of the country really took off.’ It did so until June 1989, when the authorities cracked down on student protests in Tiananmen Square with extreme brutality. The United States imposed an unofficial moratorium on investment in China, and other Western governments, too, ensured their companies kept their distance.
The United States, Canada and Western European countries were continuing to let Japanese and South Korean consumer products into their countries, even though this eliminated jobs at home, because they believed in specialization and efficiency. And the more Europe, North America and their Far East friends-cum-rivals demonstrated the benefits of free trade and efficiencies, the more other countries realized that they ought to try too. By the late eighties, many countries that had tried autarky – economic self-sufficiency – had concluded that it was never going to work and that they needed to attract foreign businesses. Mineral-rich African countries led by Ghana opened up their mining to foreign companies,17 and, eventually, by reducing their stakes or selling them altogether, Brazil, Argentina and India became potential locations for serious manufacturing and sales.
That’s why Sundström, who had envisaged a career in Western Europe and North America, had been made chief financial officer of Ericsson’s subsidiary in Argentina. After emerging from a neardecade under military rule, the country had returned to democracy and was trying to reform its economy. That made it one of the countries outside Europe, North America, Japan, South Korea, Australia and New Zealand to which Western companies were able to
expand, albeit in a limited way. ‘These were totally separate operations, self-sufficient and with just a few imported components,’ Treschow said. ‘That way you had a foot in the door in these markets. But these were not completely free markets and such countries also had high tariffs. That meant you had to manufacture as much as possible locally.’ That, though, was a whole lot better than not doing business there at all.
By the late eighties, banking was conquering new markets too. After getting a job with the London office of the Bank of New York in the early eighties, Michael Cole-Fontayn had been looking forward to a career that he thought might take him to New York or perhaps Frankfurt. But now, being a British banker was suddenly becoming extremely attractive. In 1986, Prime Minister Margaret Thatcher had introduced banking reforms so radical that they became known as the Big Bang. Only a short while after being hired as an analyst, Cole-Fontayn was promoted to looking after clients in the telecoms and oil and gas sectors. These were fast-paced days.
The Big Bang generated investment from all over the world, which travelled to London’s energized financial markets. West German banks, US banks, French banks, even some Japanese banks invested in London. And they sent bankers along to learn. ‘In effect, the world capital market, for quite a long period of time, came to London to grow expertise,’ Cole-Fontayn said. Large volumes of capital started flowing, not just into London but out of it too. London bankers, now equipped with consummate expertise in unchained financial markets, began their march to new cities, where they would make even more money for their banks by putting capital to work as countries opened themselves up to all manner of foreign companies, foreign capital and foreign expertise.
Three short years after the Big Bang, citizens behind the Iron Curtain delivered a different Big Bang and brought down their communist rulers. Deng not only managed to avoid such a fate but also delivered a smooth handover to his successor, Jiang Zemin. But China’s opening economy was accelerating quickly without its communist regime being discarded. ‘Among the U.S. companies that have struck deals with China this year are such giants as IBM, Avon,
Coca-Cola, KPMG Peat Marwick and Polaroid. Some, lured by China’s inexpensive labor costs, look to manufacture goods in that country for export elsewhere. Others see major market potential in China’s huge population,’ the Los Angeles Times reported.18 The postTiananmen rift in China’s relations with the West hadn’t lasted long. China’s governing Communist Party had prevailed, while its long-time mentor and rival, the Communist Party of the Soviet Union, had seen its creation pulverized.
As the eventful eighties handed over the baton to the nimble nineties, the political and geopolitical transformations were converging with another revolution: mobile telecommunications. In the late eighties, a group of Western European countries had agreed on a new mobile communications standard, GSM (Global System for Mobile Communications), which allowed mobile telephones to call any other phone inside these countries. It was a massive step up from the first-generation mobile technology that had existed until then. Ericsson and its Finnish rival Nokia were now reaping the benefits of their years of experimental work on mobile telephony.19 The United States was setting up a similar standard, and so were Japan and some other countries – but a mobile phone is of little use if it can’t communicate with phones that use other standards. ‘And with GSM, you got phones down to around $50 to $70 per handset, and then things started to happen,’ Sundström said. In 1991, the world’s first-ever mobile GSM call was made using Nokia equipment. Mobile telephones were on the cusp of becoming a product for ordinary people.
Mo Ibrahim’s expertise was made for this moment. Young Mohamed was born in Anglo-Egyptian Sudan just after World War II. As a young boy, he moved with his family to Egypt, where Mohamed’s father found work with a cotton company. But Mohamed’s mother didn’t want her five sons to work in the cotton industry and pushed them to focus on their studies. Mo earned a degree from Alexandria University’s electrical engineering programme, and he kept going, earning a master’s degree in the subject from Bradford University in Britain, and then, in 1981, a PhD
in mobile communications from the University of Birmingham in the English Midlands. In 1983, he received the best offer an engineer with a PhD in the UK could dream of: an invitation to join the team designing the first cellular network for British Telecom, Britain’s mighty telephony.
By the early nineties, Ibrahim was running his own company, designing mobile networks in European countries, in the United States, in Singapore, even in China. ‘The great manufacturers, Nokia in Finland, Ericsson in Sweden, AT&T in the US, Siemens in Germany: they all worked along the same lines and there was a great sense of global belonging,’ he told me. ‘We thought of ourselves as citizens of the world. We worked in Hong Kong the same way we worked in Singapore, the US, the same technology, same groups of people, full cooperation, publishing papers, sharing information. It was a great time.’
And phone calls from mobile devices heralded the arrival of a new lifestyle.
For mobile-phone companies, the timing was impeccable. GSM and other standards had paved the way for mobile telecommunications in wealthy countries, and now, in the early nineties, lots of new countries decided they wanted to join the trend. ‘We suddenly realized that the communications market would expand into Central and Eastern Europe, and then it went very fast,’ Sundström said. ‘One of the first countries out was Hungary, then came Poland, then other countries. So everybody rushed in and started to sell in these markets.’
The companies now rushing in to sell mobile phones and other consumer products had mishaps too. Some were cheated by dishonest business partners; others just couldn’t figure out how to do business in these wobbly economies, especially in Russia.20
But these were also spectacular times for consumer-product companies. And investment banks. And retail banks. And engineering firms. Even mining companies found new business, despite Russia long having mined its mountains. Treschow was astonished to see the developments around him. ‘Countries of all
kinds were finally realizing that removing trade barriers is a smart thing to do because trade barriers don’t protect your citizens – they force your citizens to pay more for the products they buy,’ he told me. ‘And it wasn’t a process where you thought, “Now the world is about to become global.” You just realized, “Now the world is global.”’ The Atlas Copco subsidiaries he established in the early nineties illustrated the suddenly open doors around the world: Hungary, Ghana, Poland, Slovakia and Thailand.21
In Costa Rica’s capital, San José, a young law student named Kevin Casas-Zamora shared Treschow’s sentiment without having heard of him. In the sixties and seventies, the Central American country of 5 million people had tried to strengthen its economy by becoming more self-reliant. That meant protectionism. The experiment ended badly, with massive debts, currency devaluation, skyrocketing inflation and poverty.22 A new government, elected in 1986 and led by Oscar Arias, a social democrat, set about reforming his country’s bananas-and-coffee-based economy. Despite opposition from within his own party, Arias began opening Costa Rica to trade and even established free-trade zones, designated regions where companies were allowed to operate tax-free as long as their production was solely intended for export.23
The change to ordinary citizens’ lives was dramatic. ‘The availability of goods, the availability of choices, the opportunities to consume goods and services expanded almost overnight,’ CasasZamora recalled. That availability was a trademark study in what happens when a country fully joins the globalized economy: it gets access to all manner of goods and services at low prices, and simply has to accept that this will affect its own companies. But as Costa Rica had discovered, keeping up protectionist walls was simply unsustainable. Arias tackled intractable problems in other areas too: for his successful efforts to help solve the civil wars in El Salvador, Guatemala and Nicaragua, he was awarded the Nobel Peace Prize.
In the early nineties, Casas-Zamora had decided to continue his studies abroad, and he already knew that this opportunity made him one of globalization’s winners. But he did wonder what effect the
emerging economic stratification he was observing would eventually have on his traditionally egalitarian country. Many Hong Kongers were even less sure about the trajectory of their unique city. ‘The city is gloomy about being handed over to Chinese sovereignty,’ the Harvard Business Review reported, and continued, ‘Already, China’s businesspeople are moving in – into business, trade, and politics –and treading so clumsily that the best of the local population are fleeing, distrustful of Beijing’s promises about the autonomous capitalist existence that the colony will supposedly enjoy.’24 But whatever their fears, Hong Kongers didn’t have a voice: Beijing and London had already decided that the British crown colony would be returned to China in 1997.
In the three Baltic republics, meanwhile, not a week went by without a new company announcing its arrival. ‘Suddenly you could go to the shop and you’d see things you’d never seen before,’ Burmistre told me. Young Ivita and her family had already visited the former East Germany, which was now part of reunited Germany and whose shops looked nothing like the ones she was used to. ‘That was the first time I saw that you could have full shelves in the grocery and that people could wear colourful clothes,’ she said. ‘During Soviet times, if you saw a girl in the street wearing a pink dress, you knew that she had relatives in the West.’
That said, it was a shaky ride. In 1992, Latvia’s GDP made a terrifying plunge of nearly one-third.25 By declaring independence, the country had in effect forfeited its massive, previously guaranteed, exports to Russia.26 Around the same time, the three Baltic states were crippled by hyperinflation.27 Despite such misery, and despite the shady dealings some of their compatriots engaged in, Estonians, Latvians and Lithuanians kept supporting their governments’ course of rapid transition.28 ‘We knew that our previous economy didn’t work,’ Burmistre said. ‘If you can’t buy simple things like soap, or if you have to stand in a long queue to buy bread or sausage, something is not right. Even during those really bad months, I felt that whatever is coming is bound to be better than what we had in the Soviet Union.’ At university, she knew
she had a shot at being part of Latvia’s insertion into the big world outside the Soviet Union.
In China, the governments pushed ahead with market reforms without asking people what they wanted. But Chinese citizens certainly seemed to be enjoying the products now available to them. In 1992, Coca-Cola sold 75 million cases – each case containing twenty-four bottles – in the country; between January and September the following year, it sold 100 million cases.29
That year, Deng conducted a tour of Shenzhen, Guangzhou and other southern cities to make the case for his economic reforms. ‘The reason some people hesitate to carry out the reform and the open policy and dare not break new ground is, in essence, that they’re afraid it would mean introducing too many elements of capitalism and, indeed, taking the capitalist road,’ he declared, and continued: ‘Are securities and the stock market good or bad? Do they entail any dangers? Are they peculiar to capitalism? Can socialism make use of them? We allow people to reserve their judgement, but we must try these things out.’30 By now, Chinese officials knew the chairman’s mantra: ‘It doesn’t matter whether a cat is black or white as long as it catches mice.’31
Investment banks realized that they were now welcome in a country they’d been coveting. ‘Deng created a new form of state capitalism where the state had majority control, but foreigners were allowed to purchase stakes in Chinese enterprises through various special classes of share that conferred conditional rights,’ ColeFontayn said. ‘All of this was taking place whilst China was seeking to control its capital accounts. It was not subject to the faults of free markets. This all meant that China could try to control its internal economy whilst enabling it to open up and trade with the rest of the world.’ The Shanghai Stock Exchange – which had been closed after China’s communist takeover – was once again operating and had been joined by the Shenzhen Stock Exchange.
For young university graduates and early-career employees, the opening markets and their need for everything from consumer goods to capital meant unfathomable opportunities. After returning from
Argentina, Sundström opted to stay with Ericsson because he enjoyed working for the company, but he could have had pretty much any job he wanted. ‘Everything was moving so quickly,’ he told me. ‘It was super-easy to get a job. Companies couldn’t find enough people for all the posts they needed to fill as they expanded. If you wanted to work in business, the sky was the limit.’
Countries now turning themselves into market economies needed everything from colourful clothes to retail banks and the rapidly advancing mobile telephony. The World Economic Forum’s annual gatherings in the Swiss skiing resort of Davos evolved from highoctane affairs for the political and business elite from wealthy countries to also include the new elites from countries liberalizing their economies. And who could object to an organization that argues, ‘Progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change’?32 There was an enormous portfolio of issues, ranging from investments to environmental protection, that needed to be discussed.
Western commercial links to newly opening markets offered enormous benefits for the Western countries now exporting their market economies and for the ones adopting them too: new consumers, new markets, new opportunities for economies of scale. But the commercial links now presenting themselves brought the promise of something even better: a world without war. The French economist Frédéric Bastiat is thought to have coined the maxim that ‘when goods don’t cross borders, soldiers will’, and on his own wartorn continent he’d been proven right.33 The European Coal and Steel Community, known during these years as the European Community, now linked former enemies in a commercial embrace that had made them astonishingly prosperous. No country had been a bigger believer in Bastiat’s maxim than West Germany, whose identity rested on economic integration with other countries its identity. Now the rapprochement-cum-trade Bonn had been practising with Moscow was there, ready to be expanded not just within the Soviet Union but with lots of different countries. Suddenly
Another random document with no related content on Scribd:
Draußen bei den Pyramiden steht das Wasser meterhoch auf den Feldern, setzt guten, schwarzen Schlamm ab und spart den Fellachen das Düngen.
Durch die Stadt geht das Herbstfieber, Denga nennen sie es, packt ein paar sommerbleiche Europäer und schüttelt sie, bis sie krebsrot sind, wie vom Sonnenbrand. Morgens und abends ziehen Nebel durch die Straßen, herrisch und drohend, wie die feiernden Soldaten eines Invasionsheeres. Das ist die Zeit, wo die Schiiten zu Ehren ihres Heiligen ihren alljährlichen Umzug halten.
Von einer Moschee hoch oben in der Mouski kommt der Zug und geht durch die Mouski zum Hause eines persischen Notabeln. Es sind fast durchwegs Perser, die mittun.
Die kleinen Krämer zu beiden Seiten der engen Straße stellen Sessel auf den schmalen Bürgersteig vor ihren Läden und vermieten sie zu ein, zwei Piastern. In der Straße drängt sich das Volk. Der Ordnungsdienst ist einfach: Wenn die Schauîsche zu Fuß nicht mehr ausreichen, um die Bahn freizuhalten, dann werden oben irgendwo soviel Berittene nebeneinander gestellt, daß sie die Straße eben ausfüllen. Dann ein letztes, warnendes „Ouaah hazîb — oha, Achtung!“ des Polizeioffiziers, und los, vom Fleck weg im Galopp, die Straße hinunter. Überritten wird fast nie jemand; und wenn schon — die Pferde sind nicht beschlagen. Nur hinter den Reitern ist die Straße dicht bestreut mit großen, gelben Lederpantoffeln, Tarbouschen und Nabbûts, den krummen Bauernstöcken.
So oft auch die Straße unter der Menschenmenge verschwindet, die Reiter fegen sie immer wieder rein, bis auch die Hartnäckigsten es müde werden und sich in die Seitengäßchen verziehen, oder sich in die Lücken der Sesselreihen auf dem Bürgersteig quetschen.
Auf den Sesseln sitzen die Europäer und warten.
Der aufwirbelnde Staub, der schwere Geruch von Hammelfett, von gebackenen, gebratenen, gesottenen Unmöglichkeiten, der Dunst der Menge liegt wie eine wuchtende Plache über der engen Straße, läßt den Schall nicht verflattern, wirft ihn wieder und wieder zurück — Schreie, Flüche, klappernde Hufe, Stimmengesumm.
Endlich — der Zug. Ein letztes Mal fegen die Reiter vorbei; hinter ihnen her schweres Blutlicht, überholt sie, hüllt sie ein. Näher — jetzt — der Zug.
Ein kleiner Eselwagen mit Holzscheiten, Fackelträger zu beiden Seiten. Die Fackeln: an langen Stangen Körbe, aus Eisenbändern geflochten. Darin brennen Holzscheite; will eine verlöschen, so wird aus dem Wagen neu nachgelegt.
Die offen brennenden Scheite geben Glut und Rauch; es ist, als würde aus den Eisenkörben dicker, dunkler Wein hochgeschleudert und flösse an Dingen und Menschen herunter.
Dann ein Pferd, reiterlos, altertümlich reich gezäumt.
Im Sattel stecken ein paar lange Pfeile; früher einmal staken sie im Pferdeleib — jetzt nur im Sattel.
Das Pferd als lebendige Erinnerung an das Schlachtroß des toten Heiligen.
Dann der persische Konsul mit den Notabeln, alle im dunklen Kaftan, und dem dunklen persischen Tarbousch. Stumm, würdig und — ein wenig unbeteiligt schreiten sie vor sich hin.
Ob sie der Glaube treibt, oder die Pflicht? Wir kennen diese Mienen — zu europäisch — weiter!
Die Gläubigen. Die erste Gruppe — zehn, zwölf Leute. Sie haben den Kaftan offen, die linke Brust entblößt, rufen die Heiligen: Hussein! Hassan!
Bei jedem Ruf ein Faustschlag an die Brust.
Die dumpfen Schläge und Rufe durchschüttern das glutige Dämmer wie das Hämmern eines gigantischen Herzens, das Blut
durch die Riesenader dieser Straße triebe.
Ein Abstand — die zweite Gruppe. Leute mit nacktem Oberkörper wieder zehn, zwölf — eine geschlossene, schwere Eisenkette in doppelter Windung um den Hals geschlungen. „Hussein! Hassan!“ bei jedem Ruf ein Riß an der Kette, einmal mit der linken, einmal mit der rechten Hand. Blut rieselt von den wundgerissenen Schultern.
Ein herrischer Geruch drängt sich vor, pocht hart an die Schläfen, macht die Augen glitzern —: Blut!
Kein Laut mehr aus den Reihen der Zuschauer; der Rhythmus hat sie bezwungen, ihre Herzen klopfen hart im Takt mit dem Anruf: „Hussein! Hassan!“
Noch ein Pferd; ein weißes Bündel darauf; eine Puppe — nein ein Kind! Ein dreijähriger Bub in weißem Hemdchen, gestützt und gehalten von dem Mann, der das Pferd führt. Ein blankes Dolchmesser in der Kinderfaust. Auf dem kleinen, glattrasierten Kopf eine Schnittwunde. Das dünne Stimmchen kräht mit, fest im Rhythmus: „Hussein! Hassan!“ Und ein kurzes Schlürfen dazwischen, weil ihm das Blut in dünnem Faden übers Gesicht in den rechten Mundwinkel läuft.
Dringlicher wird der Blutdunst, drückender und aufreizender.
Nun die letzten — die Schwertmänner. Zu beiden Seiten der Straße je ein Dutzend Leute, mit kahlen Köpfen und langen, weißen Gewändern, die vom geronnenen Blut mit schweren, inkrustierten Mustern überdeckt sind und starren, wie Brokat. In den Händen alte Schwerter, haarscharf geschliffen. Alle hundert Schritte bleiben sie stehen, der Straßenmitte zugewandt, fassen die Schwerter mit beiden Händen und — Hussein! Hassan! — bei jedem Ruf ein Schnitt über den Schädel. Im freien Raum zwischen ihnen springt ein Kerl herum, mit einem blutgetränkten Lappen; der wischt über die Gesichter, daß sie nicht geblendet werden vom rieselnden Blut. Und will einer nachlassen, dann springt er vor ihn hin und brüllt ihm ins Gesicht: „Hussein! Hassan!“ bis der wieder das Schwert fester
packt und losschlägt. Der Heilige will keine Schwächlinge unter seinen Dienern.
Die Schwertmänner schreiten weiter; hundert Schritte. Hinter ihnen läßt ein kurzes Grauen noch einen freien Raum, dann schlägt die Menschenflut über der Straße zusammen und verebbt langsam in die Seitengassen.
Der Blutdunst bleibt liegen, wie ein sattes Tier ...
In einem der kleinen Kaufläden drängt sich eine erregte Gruppe. Vielsprachiges Durcheinander: „Wasser! ... Einen Arzt! ... Einen Wagen!“ — Eine Europäerin ist ohnmächtig geworden. Bestrafter Touristenehrgeiz! — Und Fritz will gleichmütig den vorangehenden Fremden folgen. Da sieht er, die Menge der kopflos diensteifrigen Syrianer und Fellachen überragend, ein Mädchen im Hintergrund des Ladens stehen, deren Augen ihn mit ruhiger Bitte rufen. Er steht zögernd, kämpft mit wütender Schüchternheit, mit Mißtrauen, will achselzuckend fort, doch die blauen Augen lassen ihn nicht los. Er drängt sich durch den schmalen Raum, da klingt ihm ein tiefer Alt entgegen: „Sie sind Deutscher — bitte helfen Sie mir — meine Mutter hat den entsetzlichen Dunst nicht vertragen. — Es war so maßlos töricht vom Dragoman, uns herzuführen — wir hatten keine Ahnung ...“ Der feiste Dragoman, in knisternde Rohseide gekleidet, will den Vorwurf wortreich abwehren, beginnt tönende Versicherungen, daß dieses, gerade dieses Schauspiel von den fremden Ladies sehr geliebt sei — und seine breiten Lippen wollen Unrat schmatzen. Fritz sieht das fremde Mädchen peinvoll erröten und fällt dem Schwätzer scharf ins Wort: „Schweige, o Dragoman, und hole einen Wagen, sogleich und schnell!“ Und der Dragoman berührt bei dem arabischen Befehl demütig Brust und Stirne und eilt davon. Fritz wendet sich zu der Schar der schaulustigen Stutzer mit französischer Höflichkeit: „Die Herren haben zweifellos nur die Versicherung abgewartet, daß ihre Dienste von den Damen nicht gewünscht werden, um sich zurückzuziehen!“ Und die Syrianer stolpern mit verlegenem Grinsen hinaus. Nur der Ladeninhaber bleibt. „Durch deine Güte aber, o Hausherr,“ spricht Fritz ihn an, „wird sogleich ein wenig Essigwasser hierher gebracht werden!“ Und wieder klingt der tiefe Alt: „Vielen Dank ... es war nur eine kleine
Schwäche die vielen zudringlichen Leute vor allem Vielen Dank!“ Fritz sieht die weißhaarige alte Dame an, die kraftlos hingesunken in der gepolsterten Eckbank lehnt: Gesicht und Hände wachsfarben, mühsames Atmen weitet zuckend die feinen Nasenflügel. Nun umfaßt ihn prüfend ein müder Blick aus großen, blauen Augen: „Gitta, wer ist der Herr?“ — „Ein Landsmann, Mama, der uns die Gaffer vom Hals geschafft hat!“ Und Fritz verbeugt sich gehemmt, stottert seinen Namen. — „Sie haben wenig Verkehr hier?“ fragt die weiche Stimme, und ein Unterton, wie von leisem Lachen, läßt ihn jäh aufschauen.
Das Mädchen steht frei vor ihm; knapp und klar fließt das weiße Tuchkleid von den kräftigen Schultern, der schmale Kopf sitzt stolz auf edlem Halse. Unter dem kleinen Lederhut quillt straffes, dunkles Haar, starke schwarze Brauen tragen die weiße Stirne, lange schwarze Wimpern säumen das Auge von tiefem Blau. Der Mutter Auge. Von der Mutter auch die feine Nase, den Lippen aber, blutvoll, fest, die sich über starken Zähnen öffnen, fehlt der Mutter kränkliche Weichheit. Darunter, fast zu wuchtig für das Mädchengesicht, ein kantiges Kinn, das keinen Kleinmut kennt. Da deutet nichts auf eine Kindheit voll Gewalt und Lüge — Ruhe und Freiheit liegen auf dem schönen Gesicht, und das Bewußtsein reicher Kraft. In Fritz züngelt trotziger Neid auf, doch der klare Blick entwaffnet ihn schnell. Sie wiederholt ihre Frage, und schickt ihr ein Lächeln nach, das wohl der hartnäckigen Musterung gelten mag: „Sie haben wenig Verkehr hier?“ — „Ich habe einige Kameraden,“ sagt Fritz. Aber es klingt leise und weich, und sollte doch scharfe Abwehr unerwünschten Spottes sein.
Da fährt der Wagen vor Der Dragoman hüpft heraus, gibt, über die Schulter zurück, dem Kutscher laute und überflüssige Weisungen, füllt den Laden mit lärmender Geschäftigkeit. Die alte Dame erhebt sich, auf den Arm der Tochter gestützt. Fritz eilt an ihre andere Seite. Sie dankt mit leisem Kopfneigen und legt federleicht eine schmale Greisenhand auf seinen Arm, wie um seinen Diensteifer nicht zu verletzen. Nun sitzen die Damen im Wagen, der Dragoman schwingt sich auf den Bock, da beugt sich die Tochter vor: „Nochmals schönen Dank — und bitte, besuchen Sie uns doch
— wir wohnen im Ghezireh-Palace — Hostrup, Gitta Hostrup heiße ich. — Ja?“ Die Mutter nickt bekräftigend, und Fritz verbeugt sich tief, unnötig tief, wie er wütend fühlt. Als er verwirrt aufschnellt, springen die Pferde, unter Peitschenknall, eben ins Geschirr, und eine Straßenbiegung schluckt den Wagen. Im letzten Augenblick noch trifft ihn ein Blick aus klaren Mädchenaugen.
Fritz beginnt, wo er steht, gegen sich selbst zu wüten — stampft hart den Fuß aufs Pflaster, krallt sich die Finger der Linken um die Kehle, und die rechte Faust fällt dröhnend auf den Schenkel. „Esel, neunmal verfluchter Esel — benimmt sich wie ein Wildschwein!“ zischt er giftig. Und wie er das Erlebnis überdenkt, wächst seine Wut. Das Zögern erst, bevor er sich zur Hilfe herbeiließ — zur Hilfe! Hilfe!! — Vielsprachige Mätzchen mit dem käuflichen Schwein, dem Dragoman, mit den schmierigen Syrianern! — Dem Dragoman einen Tritt in den speckigen Steiß und den Syrianern jedem eins in die Fresse, das wäre das Richtige gewesen! — Dafür wieder kein Wort zu der alten Dame, keine Frage nach ihrem Befinden, und dort, bei Gott, stand unbenützt die spitzbäuchige Messingkanne mit dem verlangten Essigwasser! Unbenützt! „Möge dein Haus den heutigen Abend nicht überleben, o Sohn zweier Juden!“ krächzt er dem bestürzten Krämer zu. „Warum hast du der kranken Frau das Essigwasser nicht angeboten?“ — „Durfte ich ihr etwas anbieten, o Herr,“ verteidigt sich der Gekränkte, „in ihrer Tochter und deiner Gegenwart? Gott ist gütig!“ — „Verflucht sei dein Vater!“ meint Fritz und wendet sich zum Gehen.
So also — das war die Lebensreise des Weltreisenden! Für die alte Dame keinen Finger gerührt, und der Tochter unverschämt ins Gesicht gestarrt, daß sie ihn zweimal fragen muß, ob er wohl wenig Verkehr hat? Natürlich, mit solchem Benehmen! Tanzstundenbär Bauernlackel! Die ewige Schüchternheit, die ihn zwischen kopflosem Trotz und Lakaiendemut hin und her riß! Wie war es denn mit Komteß Christel — war das gestern oder vor zehn Jahren? — Und er ertappt sich dabei, wie er mit lautem Stöhnen Falko zum Galopp boxt. — Die blauen Augen unter dunklen Brauen! Das schlanke, edle Ebenmaß! — Schmerzgeschüttelt bleibt er stehen, beißt sich die Knöchel blutig, spuckt giftig aus: „Hab’ mich gern, Bestie!“ — Wie ihn
der Blick immer noch durchsengt! O Schöne, Schöne! Und würgende Tränen ...
Dann plötzlich knallt die Frage auf: „Wozu der Jammer? — Ich gehe hin — gehe ins Hotel — mache meinen Besuch Fräulein Gitta Hostrup, Hostrup, jawohl! — und wenn ich Zeit habe, mich vorzubereiten, nicht überrumpelt werde, wie heute, dann benehme ich mich sicher wie ein Herr!“
Ins Hotel — Ghezireh-Palace? — Das ist das ganz feine, unten auf der Nilinsel, wo Fürsten und Millionäre wohnen — drei Portiers und siebentausend verdammte Lakaien — dort Besuch?
Ach ja: Sich peinlich anziehen, im Wagen bis zum Portal fahren, dann die zwanzig Schritte bis zum Hauseingang — dann aufstampfen, ausspucken, und zum Wagen zurück rennen und fluchend heimfahren und sich tagelang elend und verworfen fühlen! Ach ja!
„Nicht mir bist du bestimmt, du Licht aus blauen Augen, Nie werd’ ich, schlanke Hand, dich auf der Stirne fühlen, Euch, roten Lippen, bleibt mein Name ewig fremd!“
„Ein Waschlappen bin ich — daran ändern die schlechtesten Verse nichts!“ Und verbissen in selbstgewollten Schmerz langt er zu Hause an.
Der zweite Kassier ist ein Deutscher, ein blonder, stiller Mensch. Eggert heißt er. An den seltenen Tagen, wo die leidige Expedition früh beendet ist, geht Fritz mit ihm langsam spazieren, um vor dem Abendessen Luft zu schöpfen.
Eines Abends sind sie bis Atabet-el-Khadr hinaufgeschlendert und plaudernd stehengeblieben. Kaum hundert Schritte weiter, am Eingang der Mouski, nur durch die Breite des belebten Platzes getrennt, liegt die Pension, in der Eggert wohnt. Ein flüchtiger Gruß: „Auf morgen!“, dann verschwindet der andere im Gewühl, und Fritz geht langsam nach Hause.
Am nächsten Morgen fehlt Eggert in der Bank. Der Kassier! Aufgeregte Prüfung: Die Kasse stimmt aufs Haar. Die Bücher in Ordnung. Der Kawaß wird in die Wohnung geschickt, bringt den Bescheid: „Herr Eggert ist seit gestern mittag nicht mehr zu Hause gewesen!“ Seit gestern mittag? Was soll das? Wer hat ihn zuletzt gesehen? — Fritz meldet sich, gibt Auskunft, sagt, er habe sich gegen acht Uhr abends in nächster Nähe seiner Pension von Eggert getrennt und keinen Augenblick daran gezweifelt, daß der geradeswegs zum Essen gehe. Das Gespräch? Alltägliche Dinge ein Abendplausch. Eggert war weder aufgeregt, noch traurig hungrig und müde eben, wie man es abends ist.
Das Konsulat wird verständigt, die einheimische Polizei. Eine Durchsuchung des Zimmers gibt keinerlei Aufschluß. Die Pensionsinhaber, ein ältlicher Franzose mit seiner Frau, seit Jahren ansässig, können auf keine Weise verdächtigt werden. — Keine Liebesbriefe, keine irgendwie verdächtigen Schriftstücke. Ein Tagebuch verzeichnet ordentlich und ein wenig trocken die alltäglichen Vorkommnisse; an einem Mittwoch ist Eggert verschwunden; unter dem Dienstag steht noch da: „... In der Bank
nichts Besonderes; sieben Uhr nach Hause. Nach dem Abendessen Café Khédivial, Zeitungen gelesen. Zehn Uhr zu Bett.“ So schreibt kein Mensch, der sich etwa mit Selbstmordgedanken trägt.
Tage vergehen, und Eggert bleibt verschwunden. Das Konsulat verständigt die Eltern; der Vater ist Handwerker, Tischler, in einer deutschen Kleinstadt. Die Antwort kommt, nach Wochen, verzweifelt, ratlos, bringt die gewünschte Photographie, verspricht eine Belohnung von zweihundert Mark für Aufklärung des Falles. Zweihundert Mark! Das sind hier zehn Pfund — soviel wirft ein reicher Syrianer in Weinlaune als Trinkgeld hin ... Und deswegen zwei Wochen kostbare Zeit verloren? Oh deutsche Gründlichkeit! Ein englischer oder französischer Konsul hätte doch wohl mehr Tatkraft entwickelt!
Immerhin: eines Abends leuchten von allen Straßenecken, allen Anschlagsäulen, an Zäunen und Haustüren grellrote Plakate; das Lichtbild des verschwundenen Hans Eggert in der Mitte, ringsum, in vier Sprachen, englisch, französisch, griechisch und arabisch, die Schilderung der Begleitumstände und das Versprechen einer Belohnung von zehn ägyptischen Pfund für nähere Angaben an Konsulat oder Polizei.
Am nächsten Morgen ist aus allen Plakaten das Lichtbild herausgerissen, oft das ganze Plakat zerfetzt.
Fritz geht zum Polizeikommandanten, einem Schweizer Der sitzt, dicknackig, vollblütig, von Sonne und Whisky rot gebrannt, in seinem weiten Amtszimmer. Als er hört, um was es sich handelt, poltert er aufgeregt los: „Was wollen Sie — ich kann gar nichts tun! Gar nichts! Ohne zwingenden Verdachtsgrund kann ich in kein mohammedanisches Privathaus! Die Harîms sind unverletzlich, auch für die Polizei. — Und wären sie das auch nicht — soll ich vielleicht die ganze Stadt umkehren? Fast jedes Haus hat seine eigene Senkgrube, seinen Brunnen, Oublietten, Schlupflöcher was weiß ich — wie sollte man da zurechtkommen? Hier sind schon mehr Leute abhanden gekommen, und gewichtigere als dieser Herr Eggert, glauben Sie mir! Beim Bau der neuen Brücke hat man gemauerte Kammern voll Gerippen aufgedeckt, jedes einzelne ein
Mordfall, meinen Kopf darauf! Aber gehen Sie den Burschen was beweisen! — Ja, früher!“ und er läßt träumerisch die schwarze Nilpferdpeitsche mit Silberknauf durch die fleischigen Finger gleiten, „früher war es leichter. Da durften wir noch Prügelstrafen verhängen. Und wenn man da einen Verdächtigen fest hatte, da war er manchmal doch zum Sprechen zu bringen. Manchmal, nicht immer. Die Burschen haben ein hartes Fell! — Aber jetzt? Wo nur das Verhör nach europäischer Methode zulässig ist? Die verdammten Burschen werden nicht rot, nicht blaß, kennen keine Scham und lügen, lügen grenzenlos! Man könnte in die Luft gehen — aber man kann nichts machen.“
Fritz merkt erstaunt, daß dieses Eingeständnis völliger Ohnmacht unbestimmte Freude in ihm weckt. Er gönnt dem feisten Polizeimenschen den Abbruch an seinem hohlen Europäerdünkel, gönnt dem Sklavenvolk da draußen das schützende Geheimnis. Doch rasch hat wieder der Gedanke an den Kameraden die Oberhand: „Haben Sie keinerlei Vermutung, Herr Major, was überhaupt geschehen sein könnte, und wie?“ Das dicke Gesicht legt sich in kriminalistische Falten: „Vermutungen? Ha, — ich kann es Ihnen fast mit Bestimmtheit sagen, als hätte ich’s selbst mit angesehen! Der junge Mensch geht über den Platz. Er war blond, groß, hübscher Bursch, wie? Nun gut: neben ihm fährt sich im Gedränge plötzlich eine Haremskutsche fest, der Schlag geht wie zufällig auf, eine Dame winkt ihm, einzusteigen, ein Eunuch hilft von draußen nach — das geht eins, zwei und bevor er noch recht zur Besinnung gekommen ist, sitzt er neben einer begehrlichen Schönen im Wagen, der im Galopp davon fährt, freut sich vielleicht des Abenteuers, zu dem er so mühelos gekommen ist ... ja — und dann? Dann kriegt es entweder die Dame mit der Angst, und läßt ihn lautlos und gründlich beseitigen denn er könnte ja plaudern, und sie selbst um den Kopf bringen —, oder er wird erwischt. Das ist dann weniger erfreulich. Die Ehemänner hierzulande rächen sich etwas umständlich. Mir sind da Fälle bekannt ... aber das führt zu weit! Ja, wie gesagt, so etwa denke ich mir den Vorgang. Aber in der Stadt und der nächsten Umgebung gibt es Tausende von Haremskutschen — nun sagen Sie selbst: was kann ich da tun? Gar nichts, gar nichts! — Tut mir ja leid um den armen jungen Menschen, tatsächlich leid ...
aber, wie gesagt ...“ Ein bedauerndes Achselzucken, und die fleischige Hand schiebt sich lässig vor, zu gleichgültigem Abschied.
Nun sind die Schnepfen da, die Wildenten und Kiebitze. Nun gibt es reiche Jagd für jedermann. Mit einem Hochgefühl sondergleichen ersteht Fritz von den Resten des reichlichen Reisegelds ein Gewehr. In finsterer Mitternacht geht es mit ein, zwei Genossen aus der Pension zu Fuß hinaus zu den Pyramiden — die Wagen sind zu teuer, die erste Tram geht viel zu spät — und das erste Dämmern des Sonntagmorgens findet sie weit draußen im Röhricht, das die überschwemmten Felder umsäumt; im offenen Wasser, zehn, zwanzig Meter weit weg, schaukeln die Lockenten. Fremde Vogelstimmen füllen das dämmrige Himmelsgewölbe. Kraniche ziehen, Wildgänse, Störche. Der sausende Flügelschlag klingt gedämpft herab, weckt Sehnsucht nach Höhe. „Schieß, Herr, schieße!“ flüstert der hitzige Fellache. Er weiß natürlich, daß nicht einmal die Kugel die scheuen Flieger erreichen könnte. Aber er liebt wohl den Knall, die gefahrlose und doch mörderische Geste.
Nun kommt Opalschimmer in die leichten Nebel, die ringsum lagern, zarte Farben fließen leise ineinander, vertiefen sich, geben den Dingen langsam feste Gestalt. Da — ein Quaken in der Luft, ein Flattern — die ersten Enten kreisen spähend über den lockend bemalten Puppen, fallen klatschend ein; die letzte stürzt getroffen, die ersten stieben plätschernd wieder hoch, da fällt eine zweite und dritte. Der Fellache heult Jubelrufe, wird mühsam zur Ruhe gezwungen. Andere Enten kommen, lassen sich täuschen, oder streichen ungerührt vorbei. Dann ist es heller Tag und weiteres Warten nutzlos. Die Kleider liegen klamm und dunstig vom Nachtnebel an, in den Schuhen, die zäher Schlamm einhüllt, steckt nasse Kälte. Von der Pyramidenstraße her kommt springend, watend, die blaue Galabieh bis zu den Achseln hochgeschlagen, der Sohn des Trägers, um dem Vater beim Einsammeln des Wildes und beim Rudern zu helfen.
Weit draußen im Überschwemmungsgebiet stehen reglos rosenrote Flamingos; Reiher, Pelikane, in Gruppen streng gesondert, treiben ihr Wesen. Sie scheinen sorglos und leicht zu überlisten, lassen den Schützen auch schleichend, kriechend, bäuchlings in wässerigem Schlamm, bis auf zweihundert Schritte heran; dann aber ein greller Schrei ihrer Wächter, die Schwärme donnern rauschend auf, wirbeln durcheinander, formen sich zu langgezogenen Figuren, Spitzkeilen, Halbkreisen; drei, vier wilde Schwenkungen noch — und die Weite schluckt ihren sausenden Flug.
Die Fellachen rudern das plumpe Boot der Straße zu und singen einander abwechselnd den Takt zu den Schlägen der schweren Einzelruder:
„Oh Gott! — Oh Mohammed!“
Oh Schiffer — oh Meister, Vorwärts! — so ist es!
Mit Kraft! — ja Kraft!
Noch einmal! — und immer!
Mit Kraft! — Vorwärts!
Oh Schiffer! — Oh Meister!
Oh Gott! — oh Mohammed!
Auf den Feldern ist das Leben erwacht. Die Schöpfwerke knarren; Büffel wühlen sich in den Schlamm, fahren beim Nahen des Bootes knallend hoch. Fern klagt ein Esel, auf der hohen Dammstraße antwortet ein anderer, unter schwere Bürde geduckt. Ein nackter Bauer watet hüftenhoch durch den weichen Schlamm eines Feldes, das gestern wohl noch unter Wasser stand, streut mit weitem Arm Samen aus und singt mit näselnder Stimme ein hallendes Lied. Der junge Fellache im Boot läßt sein Ruder fahren, wirft den Kopf verzückt in den Nacken und schmettert tremolierend in den breiten Tag:
„Ich bin der Dampfer, der durchaus schwarze ...“ Sein Vater unterbricht ihn böse: „Willst du nicht arbeiten, oh Hundesohn, oh Kuppler, verflucht sei der Glaube deiner Mutter!“ Dann wendet er
sich mit Vaterstolz zu den Gästen: „Er ist noch jung, aber seine Stimme ist sehr schön!“
Und sie rudern
Fritz bringt von diesen Ausflügen eine schwere Müdigkeit heim, und das Essen will nicht schmecken. Der Tischälteste, seit Jahren im Land, sagt ihm einmal gutmütig warnend: „Passen Sie auf, mein Lieber, Sie holen sich da draußen in der Sumpfluft ein Fieber, das sich gewaschen hat! Lassen Sie die Jägerei lieber sein — das ist was für Europa!“ „Oh, es wird schon nicht so schlimm sein!“ sagt Fritz leichthin und fühlt gehässigen Trotz. — Jagen — in Europa! Als ob es ihm dort nicht verboten gewesen wäre! Nein — die neue Freiheit hier soll ihm kein Warner verkümmern!
Eine Woche drauf packt ihn das Fieber wirklich. Eines Morgens beim Aufstehen fühlt er quälenden Kopfschmerz, ziehende Mattigkeit in allen Gliedern. In der Bank überfällt ihn jäher Schüttelfrost, er taumelt frierend durch die breite Mittagsonne nach Hause, wirft sich ins Bett. Ihm ist, als wäre sein Hirn zur Bleikugel eingeschrumpft, die nun bei der leisesten Regung schmerzhaft an die Schädelwände schlägt. Ruhig liegen, ruhig. — Da kommt ihm ein leises Klingen ins Ohr, das schmutzige, oft geflickte Mückennetz wird zum prunkenden Betthimmel, der dumpfe Straßenlärm fügt sich zu rauschendem Rhythmus und jetzt, hinter geschlossenen Lidern, das Bild, das er so lange nicht mehr gesehen hat: ein weiter, glattgepflasterter Platz, auf den in langen, dichtgedrängten, glasharten Schnüren und Strähnen vielfarbiger Regen niederfällt, in allen Farben, blau, rot, gelb, grün. Regen, Regen ...
Den Poporutscher haben sie wohl ins Nebenzimmer gesteckt aber warum zünden sie die große Lampe nicht an? Felix und Max müssen doch lernen ... Und die Mutter läßt sich nicht blicken ... aha, da kommt sie, bringt Licht ... und der Vater ... Ja, Vater, das hab’ ich mir nun auf der Jagd geholt, ein wenig Fieber, nicht schlimm ... das verfluchte Gerippe hat wieder einmal recht wart’, Hund, ich werf’ dich ab ... Ja, Vater, ich reite jetzt auch viel, fahre oft im Wagen, rauche Zigaretten ... Gott, ja ... man lebt eben ...
Da klingt eine laute, fremde Stimme: „Aspirin — alle Stunden ein Gramm, dreimal! —“ Ein bitterer Geschmack im Munde, Wasser drauf ... Das ist nicht der Vater! Ein fremder Mensch, und die Pensionswirtin ... Dann wieder Halbschlaf und Feuerregen, der langsam blasser wird, farblos — erlischt.
Und ein Auffahren: „Wer steht dort neben der Türe, hoch und schlank, im weißen Kleid? — Gitta — Fräulein Gitta Hostrup gewiß, ich hatte das Vergnügen, neulich in der Mouski oh, bitte, nur ich habe zu danken, nur ich ... Mädel, sag, wo kommst du her? Weißt du denn, wie ich mich nach dir gesehnt habe — nach deinen großen Augen und deiner festen, langen Hand — willst du mir gut sein? Oder kannst du es nicht verzeihen, daß ich durch Sumpf gegangen bin? Sieh doch, ich war blind, ich kannte den Weg nicht ... Steh nicht so steinern dort an der Tür! — komm näher, komm, — verflucht, es ist der Bademantel ... oh, Gitta! — —“
Die starke Aspirindosis hat das Fieber gebrochen. Der nächste Morgen schon findet Fritz fieberfrei, aber lächerlich schwach und zerschlagen. Der Puls ist kaum zu spüren, im Schädel rollt immer noch die verwünschte Bleikugel. — Milch als einzige Nahrung — sie ist lauwarm, schmeckt nach Büffel. — Draußen hat sich eben die Sonne durch die Morgennebel gekämpft, pocht herrisch an die Fensterläden; ein heißer Wind fegt Staub herein — zwei Kakerlaken rennen erschreckt über den Steinfußboden. — Da ist so eine verdammte Mücke im Netz, schwirrt singend herum — bis man die Bestie erwischt, hat sie einen zehnmal gestochen ...
In Weißwasser werden jetzt die Brombeeren reif, die Tage sind still und klar, und die Nächte kalt, mit ersten Frösten ...
Draußen verzittert der Gebetsruf des Muezzin ...
Nach zwei kurzen Rückfällen ist das Fieber überwunden, doch die Genesung geht langsam vor sich. An weite Ritte oder Jagd ist nicht zu denken. Die Pensionsfreunde nehmen keine Rücksicht auf Fritzens geminderte Bewegungsfreiheit. Sie leben ihr Leben weiter.
— Werktags harte Arbeit, abends lärmende Spiele und an den Feiertagen hinaus in die Sümpfe oder in die Wüste. So ist Fritz viel allein, doch die Einsamkeit drückt ihn nicht, denn in ihrer Hut blüht täglich stärker ein Gefühl empor, zu dem er sich in der spottlustigen Runde nie zu bekennen gewagt hätte. Der Gedanke an das fremde Mädchen verläßt ihn keinen Augenblick. Wütend wehrt sich sein Stolz: „Das ist so eine hochnäsige Gans, ein paar Millionen schwer, will bestenfalls Schindluder mit mir treiben — wahrscheinlich hat sie mich aber längst vergessen. — Nicht dran denken — laufen lassen, laufen lassen!“ Doch sein Gedächtnis läßt sich nicht betrügen.
Unverlöschlich haftet das Bild des schlanken jungen Leibes, das ruhige Gesicht mit großen Augen. Und die Stimme — weich, lockend, wie eine Abendglocke hinter Hügeln! Wieviel gütiges
Verstehen lag noch in dem leisen Spott der Frage: „Sie haben wenig Verkehr hier?“ Oh, dieses Mädchen lieben dürfen, sie nur lieben dürfen — das allein könnte wohl den Fluch löschen, der von früher Jugend an auf seinem Leben lag. Noch wagt sein Ehrgeiz sich nicht bis zu der Hoffnung, vielleicht, vielleicht auch geliebt zu w e r d e n . Auch ist ein Wiedersehen so wenig wahrscheinlich — Wochen sind seit dem Abend in der Mouski vergangen. Die dumme Schüchternheit erst, dann die Krankheit — nun, nach so langer Zeit, verbietet sich ein Besuch im Hotel von selbst. Sie ist wohl längst abgereist — sicher längst abgereist — hat ihn vergessen ...
„Oh Gitta, Schöne, Schöne, Schutzengel — ich vergess’ dich nicht!“
Ein stiller Sonntag in der Pension. Sechs von den lauten Genossen sind in die Wüste geritten, kommen wohl abends erst zurück. Nur Herr Lustig ist daheim, weil ihn sein ewiges Magenübel plagt. Und Fritz.
Zum Nachmittagstee findet sich ein deutscher Bekannter ein, Herr Heinze. Der ist, von dem scheinbar hohen Gehalt gelockt, nach Ägypten gekommen, um Ersparnisse machen und eine arme Jugendliebe heiraten zu können. Nun arbeitet er zwei Drittel des Tages in einem Kommissionskontor in einem der verwinkelten, stickigen Seitengäßchen der Mouski, wohnt in einem elenden Mietszimmer und ißt im Gasthause, weil sich dabei leichter sparen läßt als in einer Pension. Kein noch so harmloses Vergnügen gönnt er sich, knickert am Essen und Trinken, an Wäsche und Kleidung, lebt nur für sein kleines Bankguthaben, das langsam, langsam wächst.
Das Bild seiner Braut trägt er ständig bei sich. Fritz hat es einmal zu sehen bekommen: ein leeres, blondes Gesicht, nicht jung, nicht alt, mit kleinlichen Sorgen Vertraut. Wie groß muß die Liebe sein, die solches Leben um solches Ziel erträgt? Fritz fühlt, bei aller Ablehnung der fremden Art, mitleidige Zuneigung zu dem Arbeitstier, das sich eigenwillig die Jugend verkümmert. Und leisen Neid: der blonde Rundschädel mit dicker Brille und schlechten Zähnen — der durfte glücklich lieben, durfte sich geliebt wissen und Besitzerfreuden kosten — und Gitta?
Herr Heinze empfindet das Mitleid nicht — er fühlt sich ja reich und beneidenswert —, setzt vielmehr den Neid als selbstverständlich voraus und nimmt die Zuneigung dankbar an.
Um die Dämmerstunde fahren sie zu den Pyramiden hinaus. Hinter der großen Brücke fügt sich der Wagen in die breite Doppelkette von Gefährten ein, die auf der breiten Straße hingleitet. Was spreizt sich da alles im rotgoldenen Licht des Winternachmittags! Hakennasige Spaniolen mit ihren Weibern, schnaubend im Fett, hilflos in Pariser Moden geklemmt, ewigen, gierigen Haß in den unsteten Jettangen. Syrianische Winkelagenten und Schieber in kostbaren Sportwagen. — Arabische Würdenträger
lassen im Gedränge die reich gekleideten Vorläufer neben den silbergezäumten Hengsten traben. Große Kokotten stellen sich zur Schau, wecken Besitzgier. Da und dort Engländer im Dogcart oder Tilbury, aufdringlich fast in der schmucklosen Gediegenheit von Gespann, Wagen, Insassen.
Die edlen Vollblutpferde vor den kostbaren Gefährten aber geben sich schäumend der Lust an der Weite hin, unbekümmert um die Fracht von Haß, Neid, Gier und Wollust, die sich an ihren stürmenden Lauf geheftet hat.
Die Pyramiden sehen den glitzernden Zug kommen, wenden und eilig zurückfluten nach der gärenden Stadt. Sie ragen unberührt aus dem Sandmeer, das ihre Grundfesten benagt. Verachtung strahlt von ihnen aus, und breiter Hohn:
„Uns haben Menschen erbaut, Menschen mit weiten Götterseelen, die noch für ihre sterblichen Leiber Unvergänglichkeit und unzerstörbare Ruhestätten erzwangen. Wo habt Ihr ihresgleichen? Sie gehorchten niemand, aber sie wußten die Peitsche zu führen. Und zahlloses Sklavengezücht Eures Blutes und Euerer Art mußte fronend verrecken, bis wir standen. Doch künden wir von Schweiß und Tod auch der namenlos Unterlegenen, die Peitsche nur und Stachelstock zu solchem Werke trieb.
Ihr alle, Ihr alle liegt hart unter goldener Geißel! — Wo aber sind Eure Werke, die Jahrtausende überdauern sollen?“
Die Sonne ist versunken, die schlammigen Felder hauchen kühle Dünste aus. Die gleitende Ordnung beginnt sich rasch zu lösen. — Wie der Mietwagen der Freunde stadteinwärts wendet, kommt ihm jäh ein reiches Gespann entgegen, wendet unmittelbar in engstem Zirkel und fegt sausend wieder vor, daß die Langschwänze der Vollblüter fahnengleich wehen. Fritz fährt auf wie gestochen, sinnlos, unbeherrscht —: Das klare Gesicht, das da aus matten Seidenkissen aufgeleuchtet hat, — die wachsblasse alte Dame daneben — und jäh aussetzender Pulsschlag zwingt ihm einen heiseren Jungenschrei ab. Er sieht noch, wie das Mädchen im
Wagen aufspringt, eindringlich zurückwinkt — dann verschwimmt das Bild im Straßenstaub und Abenddunst.
Lustig und Heinze bestürmen ihn mit aufgeregten Fragen: „Was ist ... was soll das ... kannten Sie die Dame?“ — Er findet keine Antwort, nickt gedankenlos, halb unbewußt. — Sie hat ihn erkannt! Hat ihm zugewinkt — w i e zugewinkt! — Schon wollen sich Zweifel melden: War der Gruß nicht allzu formlos, galt er überhaupt ihm? Warum hatte sie den Wagen nicht halten lassen? — Sein Herz aber, bebend noch vor Glück, bringt sie zum Schweigen: „Gitta hat mir zugewinkt, mir ganz auffallend zugewinkt — und also ist es recht so!
— Und den Wagen halten lassen — mitten im Gewühl — angefahren werden vielleicht, und wenn nicht das, so vor Lustig und Heinze Bekanntschaft erneuern? Ach was! Sie ist noch hier, hat mich erkannt — hat mich vielleicht erwartet, die Wochen her? Oh Gitta! —“
Die Freunde machen den Umweg über die Mouski, um Herrn Heinze nach Hause zu bringen. Der Wagen windet sich umständlich durch das dichte Gewimmel der engen Straße, unter endlosem Peitschenknallen und heiserem Gebrüll des Kutschers, der die Fußgänger im Wege nach Geschlecht und Stand warnend anruft: „Ouaah, oh Töchterchen ... ouaah, oh alter Mann ... ouaah, oh Vater, ouaah ... fünfzigmal habe ich’s gesagt, oh Kuppler, ouaah, gib acht zu deiner Rechten, hörst du mich nicht, du Sohn von sechzig Hunden? Ouaah!“ ... Immer wieder werden die Pferdchen hart angehalten, von neuem angetrieben. Erschreckte Flüche klingen auf: „Warum rufst du nicht, oh Vater des Straßenkotes? Willst du mich töten? Dreck auf dein Gesicht!“ Und der Kutscher, empört über die ungerechte Beschuldigung, dreht sich auf dem Bocke um, bellt heiser zurück: „Ich habe gerufen — ich rufe immer — du aber hörst nicht! Bist du ein Mensch oder ein Tier, oh Kuppler mit der gespaltenen Zunge?“ — Unterdessen stoßen die Pferdchen, führerlos, mit nickenden Köpfen eine Gruppe eifriger Plauderer auseinander. Neues Gezeter, neue Flüche. — Welch ein Volk! Wieviel Kraft wird da nutzlos, sinnlos vergeudet an den leeren Augenblick! Und Fritz, immer noch in strahlend hingegebener Stimmung, dem Leben zugewandt, das ihm mit einmal neu und
neuer Zusammenhänge voll sich zu offenbaren scheint, Fritz denkt mit jäher Zärtlichkeit an die Waldbauern in Weißwasser, die auf steile Berglehnen, ungangbar für jedes Zugtier, in Traglasten den mageren Dünger hinaufschleppen, sich mit Frau und Kindern vor Pflug und Egge spannen, hart und schweigsam werden im ewigen Kampf mit dem harten Boden.
Fritz empfindet es erstaunt, wie glühend nahe ihm plötzlich die Heimat ist. — Gitta, Gitta hat ihm den Weg dahin gewiesen! „Ich darf nicht so bettelarm vor sie treten, so unverwurzelt, als irgendwer. Noch habe ich kein zweites Mal mit ihr gesprochen, und sie beschenkt mich schon!“
Der Montagmorgen bringt trübseliges Erwachen, beißende Sehnsucht nach dem Gestern, dem einen Augenblick am Fuße der Pyramiden, um Sonnenuntergang. Eine graue Arbeitswoche dehnt sich öde, ohne Freizeit, ohne Möglichkeit, eine Zufallsbegegnung zu suchen ... und ein Besuch? — Giftige Selbstverspottung hebt an: „Gestern so verdammt siegessicher, Indianergeheul als Gruß — und heute wieder Angst vor dem betreßten Affen am Hotelportal? Oh Held aus Heldensamen und Vater vieler Helden!“
Und doch — da war so vieles ungeklärt! Hatte der Gruß wirklich und wahrhaftig ihm gegolten, ihm, dem sonntäglichen Bankbeamten in dürftiger Mietskutsche? — Recht unwahrscheinlich, im Grunde! Und wenn schon wirklich, dann war es eben ein Jux, den er herausgefordert hatte durch sein vollständig unmögliches Benehmen! In Gegenwart der beiden traurigen Flibustier heulend aufspringen und eine kaum, eigentlich gar nicht bekannte Dame grüßen! Eine andere hätte vielleicht mit stummer Verachtung geantwortet — ein lustiges und selbstsicheres Mädel winkte ebenso ekstatisch zurück — das war eine wohlverdiente Lehre, nichts weiter!
Nein, kein Besuch! Weiter gerackert in der Tretmühle — und kein Gedanke mehr an junge Mädchen, die in seidenen Polstern spazieren fuhren und in fürstlichen Hotels wohnten. Kein Gedanke weiter! — Oh Gitta!