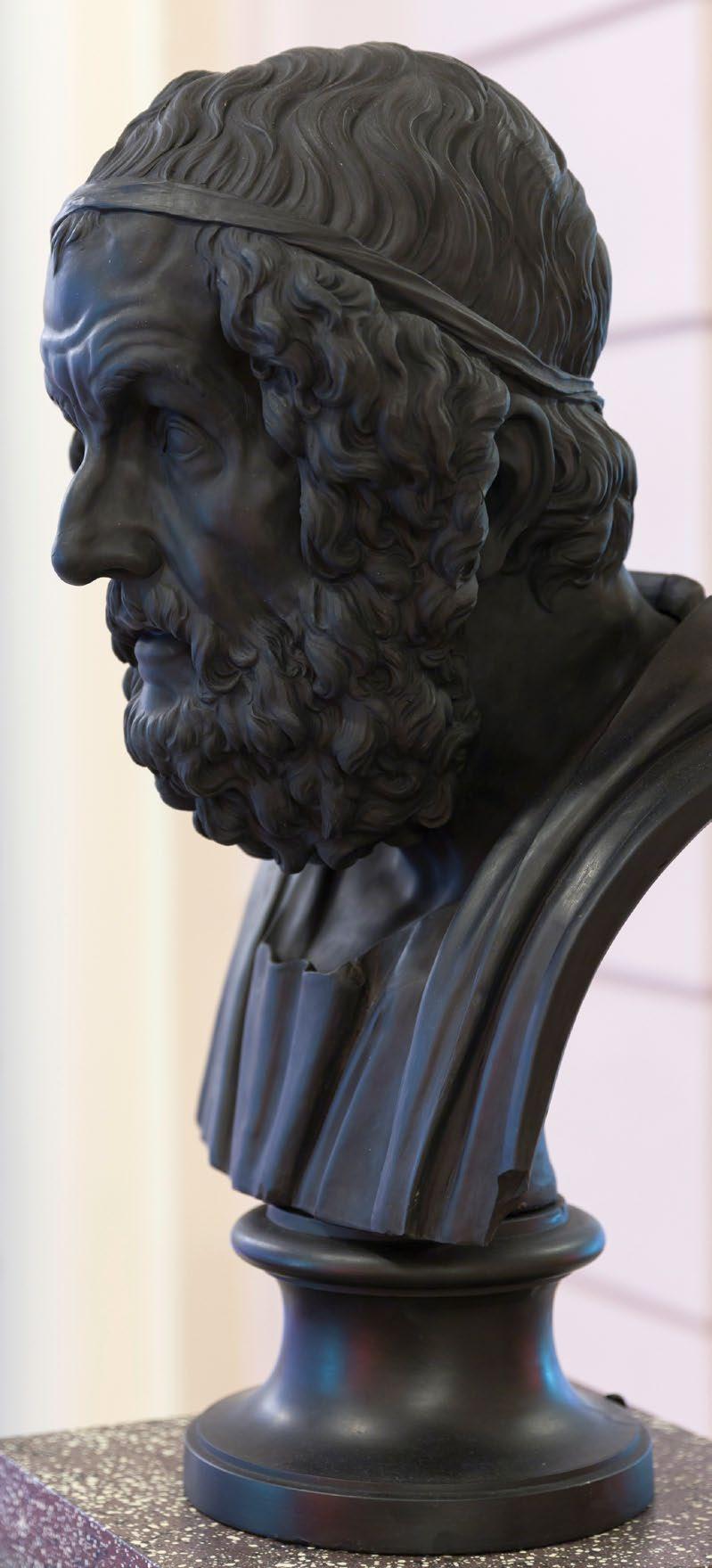MAGAZIN MUSEUM.DE

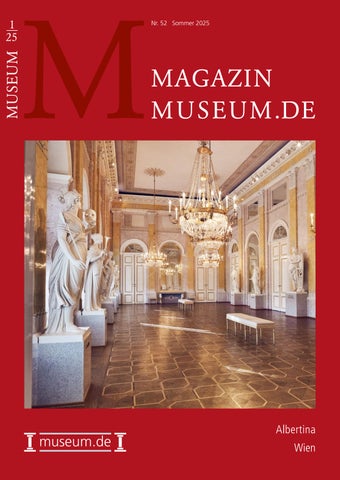







Sammel- & Einzellagerung
VdS-Sicherheitsklasse SG3 & GRASP-Zertifizierung 24/7-Videoüberwachung & Alarmaufschaltung
Zutrittskontrolle & Sicherheitscodes
Geothermie für höchste Energiee zienz
hasenkamp bietet Ihnen über 120.000 qm hochsichere Lagerfläche an erstklassigen Standorten wie Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München sowie international in Amsterdam, Wien und Madrid. Immer mehr unserer Depots werden energiee zient und nachhaltig betrieben – mit Geothermie, Photovoltaik und grünem Strom. Ihre
Objekte finden bei uns einen klimastabilen Lagerplatz (20-22°C bei 50-55% Luftfeuchtigkeit) entweder auf der Sammellagerfläche oder in abschließbaren Einzelboxen.
Unsere zertifizierten Lager entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen. Neben maßgeschneiderten Verpackungslösungen, insbesondere für die Langzeitlagerung, bietet hasenkamp auch spezielle Zollgutlagerung an. Zudem stehen Ihnen Präsentations- und Restaurationsräume zur Verfügung. So verbinden wir modernste Sicherheitsstandards mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise!
Ruhr Museum Essen 4
Das Land der tausend Feuer
Historische Schauweberei Braunsdorf 16
Huis van het Boek 26
Bergbau-Museum Bochum 28
Neue Lichtmarke im Ruhrgebiet
Centre Pompidou 38
Suzanne Valadon
Blog-Beiträge museum.de 46
Das Kunstgewerbemuseum in Prag 54
Museum draussen! 68
Stadt.Land.Kultur – ein Erfahrungsbericht
Zeppelin Museum Friedrichshafen 74
Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus
Die ALBERTINA in Wien 88
Museen sind mehr als Ausstellungsräume –sie sind lebendige Orte der Kultur, die stets im Dialog mit ihrem Umfeld stehen. Aus diesem Verständnis heraus entstand die Idee für eine digitale Kulturkarte: eine Plattform, die historisch bedeutsame Orte in Städten und Gemeinden sichtbar macht – mit Texten und Fotos, direkt auf dem Smartphone abrufbar.
So wird der öffentliche Raum zum Freilichtmuseum – nicht als Konkurrenz zu bestehenden Museen, sondern als sinnvolle Ergänzung. Die Inhalte lassen sich dabei ganz einfach vor Ort über einen QR-Code an den jeweiligen Schildern aufrufen. Geschichte wird dort erfahrbar, wo sie stattfand – im alltäglichen Lebensumfeld der Menschen.
Ende 2023 haben wir über 10.757 Bürgermeister*innen eingeladen, sich an STADT. LAND.KULTUR zu beteiligen. Verbunden war der Aufruf mit der Bitte, den kostenlosen Anmeldelink an die zuständigen Stellen vor Ort
weiterzugeben. Die Resonanz ist groß: Zahlreiche Gemeinden sind bereits aktiv dabei.
Ein besonders gelungenes Beispiel ist Efringen-Kirchen, das wir in dieser Ausgabe auf Seite 68 vorstellen. Unter der Leitung von Frau Dr. Maren Siegmann, der örtlichen Museumsleiterin, wurde dort mit viel Engagement ein digitales Kulturangebot geschaffen. Dabei kamen durch Recherchen im Stadtarchiv sogar bislang unbekannte Fakten ans Licht – ein schönes Beispiel dafür, wie digitale Vermittlung auch neue historische Erkenntnisse fördern kann.
Unter www.museum.de/stadt finden Sie eine Übersicht aller beteiligten Orte. Prüfen Sie gerne, ob Ihre Gemeinde bereits vertreten ist. Lokale Museumsmitarbeitende sind besonders prädestiniert dafür, die Inhalte für ihren Ort zu pflegen. Oftmals lassen sich Verbindungen zu Exponaten im Museum herstellen – so entsteht ein identitätsstiftendes Zusammenspiel von Ort, Geschichte und Sammlung.
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage den individuellen Anmeldelink für Ihre Stadt oder Gemeinde zu – die Teilnahme ist kostenlos. Herzliche Grüße, Uwe Strauch
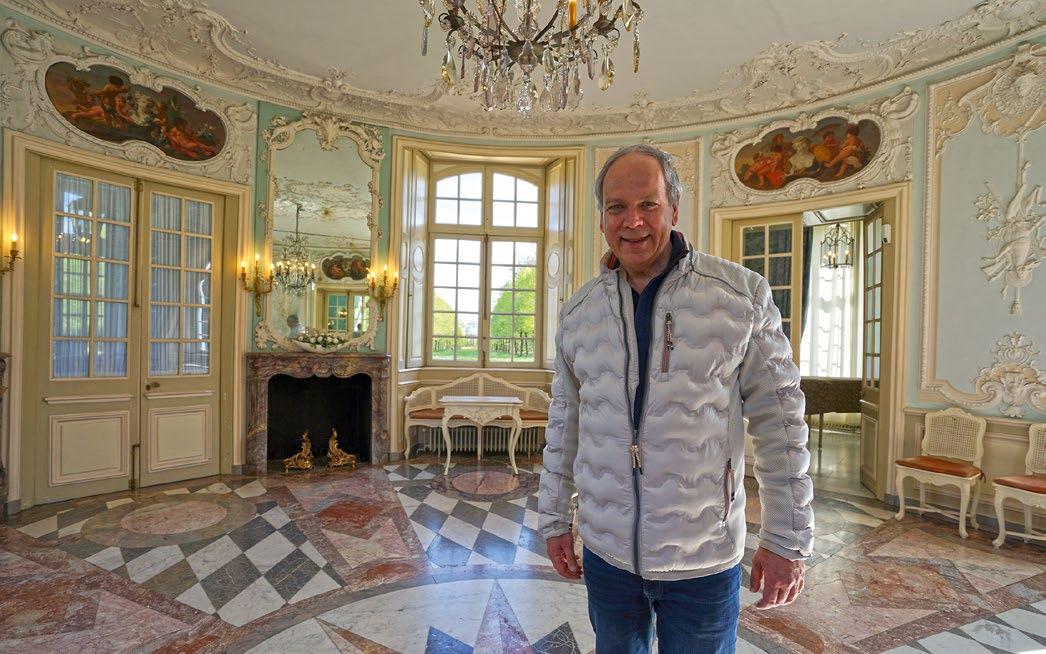

Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld. Ausstellung bis zum 14.2.2026 im Ruhr Museum in der Kohlenwäsche. UNESCO-Welterbe Zollverein

Das Ruhrgebiet ist wie kaum eine andere Region durch die Industrialisierung geprägt. Sie hat es als Einheit und als wirtschaftlich geprägten Bezugsraum überhaupt erst entstehen lassen und aus einer ehemals dünn besiedelten, politisch zerstückelten Agrarlandschaft den bis Mitte des 20. Jahrhunderts größten
industriellen Ballungsraum in Europa gemacht. Die Phase der Industrialisierung hat die Region tiefgreifend und dauerhaft geprägt: Sie formte die Bevölkerung durch Zuwanderung, gestaltete die Region als Zentrum von Kohle und Stahl, förderte weitere Industrien und schuf eine umfassende Infrastruktur.
Obwohl das Industriezeitalter im Ruhrgebiet nach einem jahrzehntelangen Strukturwandel inzwischen der Vergangenheit angehört, sind seine Auswirkungen - wirtschaftlich, ökologisch, gesellschaftlich und kulturell - bis heute spürbar.

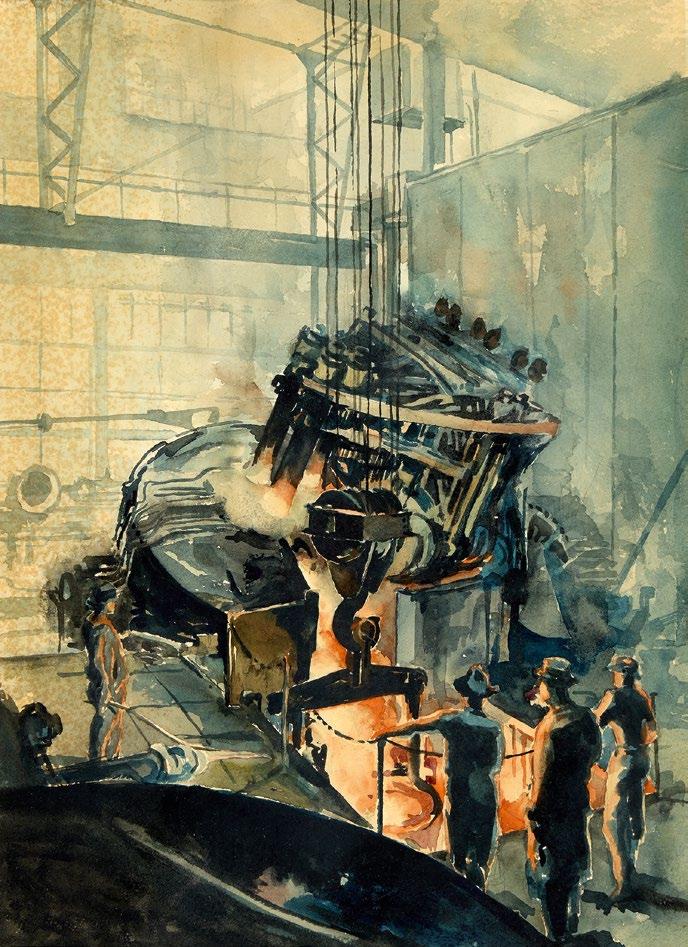
Die Schwerindustrie des Ruhrgebiets übte seit dem späten 19. Jahrhundert eine große Faszination auf Kunstschaffende aus. Die neue Sonderausstellung »Das Land der tausend Feuer. Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld« ist die erste Ausstellung des Ruhr Museums zum Bild des Ruhrgebiets in der Kunst und lädt dazu ein, das Ruhrgebiet durch die Augen von Künstlern und einigen Künstlerinnen zu entdecken, die die massiven Veränderungen der Region zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Stilen dokumentierten.
Linke Seite, oben: Blick in die Ausstellung. © Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar
Unten: Unbekannter Künstler: Elektroofen, Aquarell, 1960/70
Rechte Seite, links:
Oben: Erich Stapel: Hochofenwerk mit Förderturm, Öl auf Hartfaser, um 1960
Mitte: Anton Woelki: Industrielandschaft und Hafen, Öl auf Malkarton, 1959
Unten: Hans Pütter: Korngarben vor Industriegebiet, Öl auf Leinwand, 1951
Rechte Seite, rechts:
Oben: Max Flechsig: Ansicht von Mülheim an der Ruhr, Öl auf Hartfaser, 1958
Mitte: Heinz Eickholt: Zeche Prosper II, Bottrop, Öl auf Leinwand, um 1960 Unten: Unbekannter Künstler: Zeche Heinrich Robert in Hamm, Öl auf Hartfaser, 1953
Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian
Sie ist vom 7. April 2025 bis zum 14. Februar 2026 in den spektakulären Kohlenbunkern auf der 12-Meter-Ebene des Ruhr Museums auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein zu sehen.
Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, erläutert: »Zu den wichtigsten Aufgaben eines Regionalmuseums gehört, die Erinnerung und Wahrnehmung der Menschen zu dokumentieren: Wie haben Zeitzeugen die Industrialisierung erlebt? Wie empfanden sie den Wandel des Reviers, den wirtschaftlichen Aufstieg und den späteren Niedergang? Und welches Bild verbanden sie mit dem einst so lebendigen "Land der tausend Feuer"?«
Die Sonderausstellung mit den Industriebildern aus der Sammlung Ludwig Schönefeld beschäftigt sich mit diesen Fragen. Sie schafft die Verbindung von Kunst und Geschichte und regt zur Reflexion über die sozialen, wirtschaftlichen sowie ökologischen Auswirkungen der Industrialisierung an.
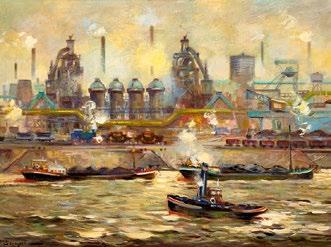

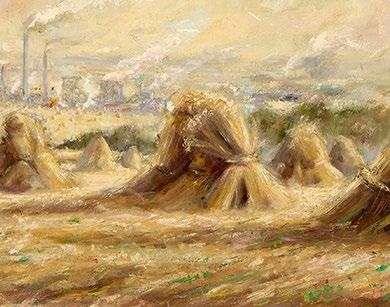
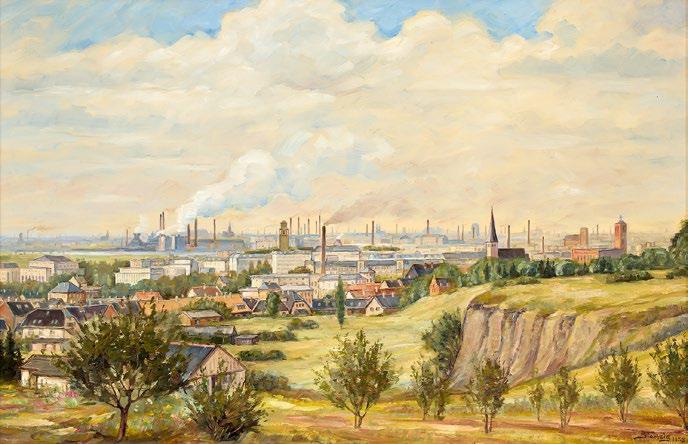
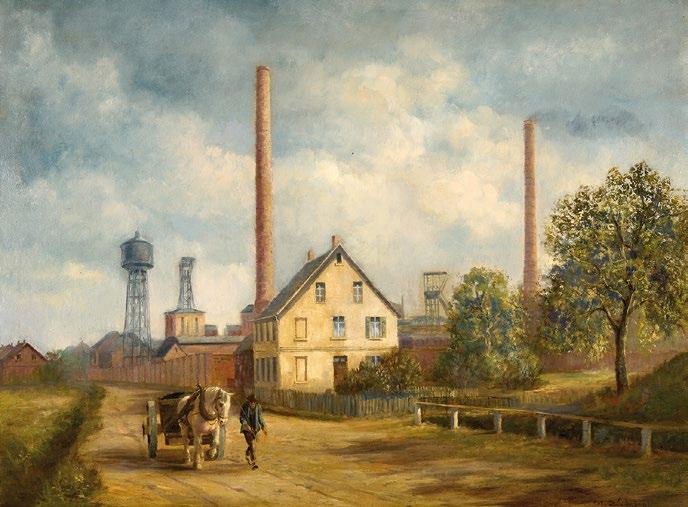
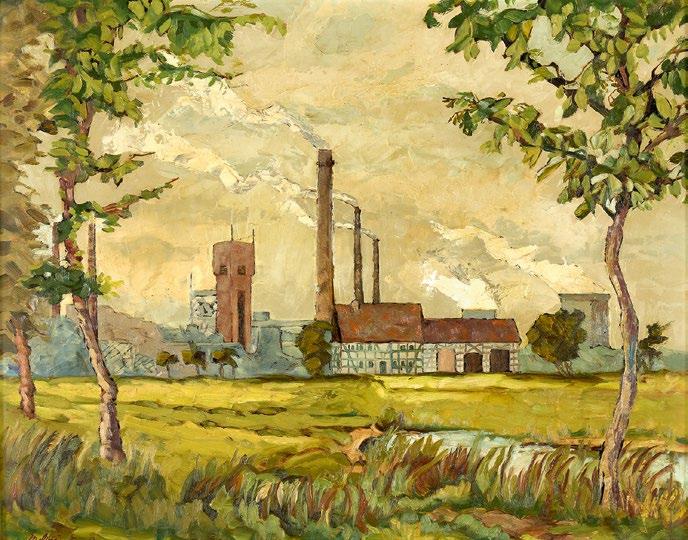
Die 240 ausgewählten Werke zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler subjektiv den Wandel der Region und die damit verbundenen Herausforderungen in ihren Werken eingefangen haben. Die Auswahl zeigt aber auch die Bandbreite der Kunstschaffenden. Der Intention des Sammlers folgend, werden Werke von bekannteren Künstlern, Autodidakten bis hin zu anonymen Urheberinnen und Urhebern gezeigt. Die Ausstellung unterstreicht damit, dass nicht allein der Name und künstlerische Ruf über die Bedeutung eines Industriegemäldes für die Geschichte des Ruhrgebiets entscheiden.
Die Bilder spiegeln eindrucksvoll die euphorischen, aber auch die kritischen, romantischen und ideologischen Einstellungen gegenüber der Industrie. Die zwischen 1890 und 2010 entstandenen Bilder der Ausstellung künden von den Zeiten, in denen Kohleförderung und Stahlerzeugung sowie die schwerindustrielle Massenproduktion, aber auch Arbeitskämpfe, Armut sowie Gesundheits- und Umweltschäden im Ruhrgebiet allgegenwärtig waren.
Oben: Fritz Gärtner: Leuchtende Stunde, Öl auf Leinwand, 1912. © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian
Unten: Blick in die Ausstellung.
© Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar
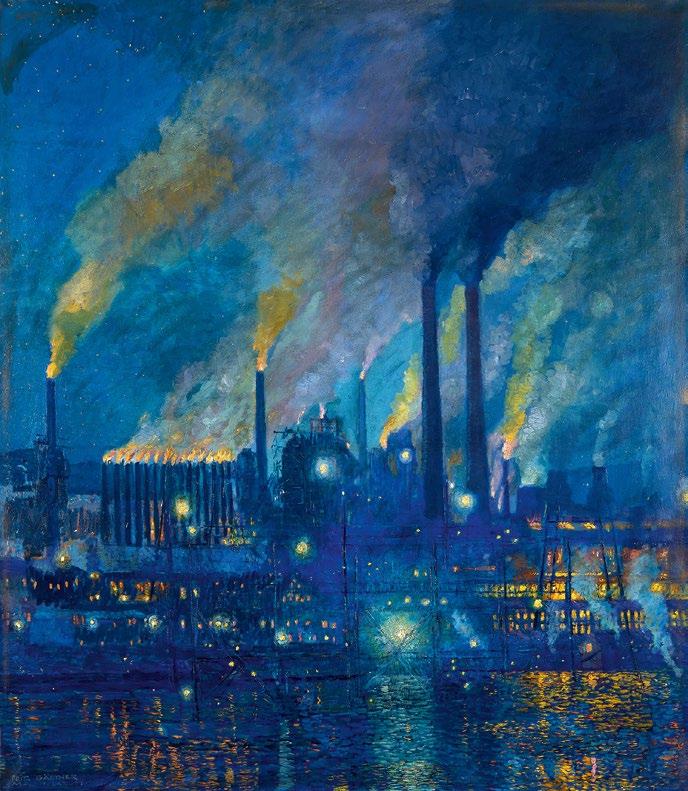


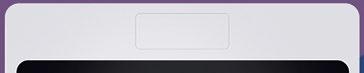






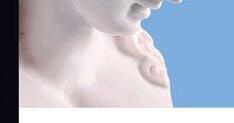






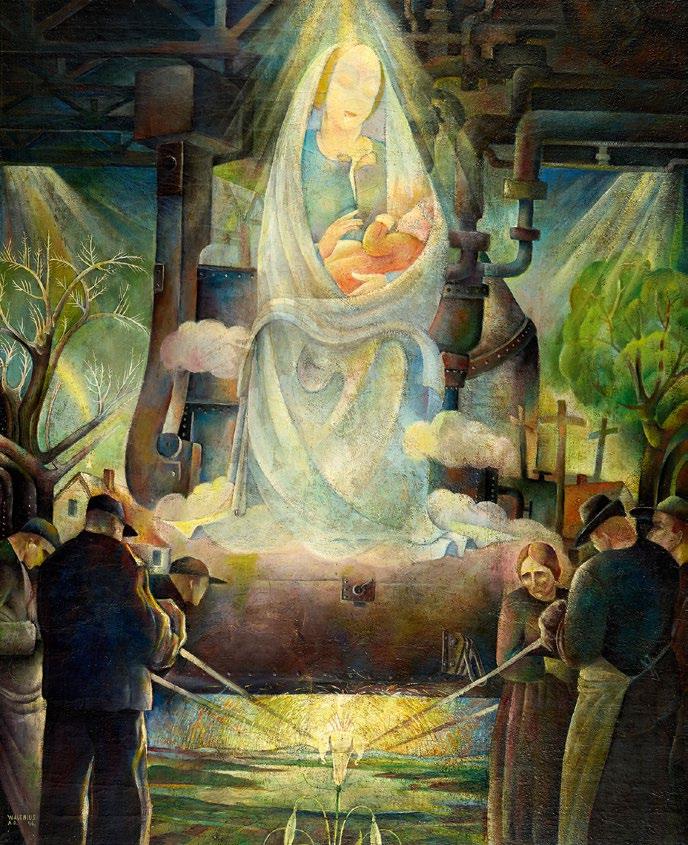
»Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Industrie und den Landschaften des Ruhrgebiets reflektiert nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der Region, sondern auch die jeweilige politische und gesellschaftliche Haltung der Kunstschaffenden gegenüber den industrialisierten Arbeitswelten«, erläutert Projektleiterin und Kuratorin Dr. Reinhild Stephan-Maaser.
»In den Bildern kommen nicht nur die individuellen Beweggründe und Interessen der Künstler und Künstlerinnen zum Ausdruck, sondern auch die jeweils aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurse zur Arbeit wie auch zum Verhältnis des Menschen zu Fortschritt und Technik.«
Die Ausstellung ist nach Bildthemen und Motiven in 18 Kapitel gegliedert. Darunter sind Abteilungen wie zum Beispiel »Zechen und Kokereien«, »Untertage« oder »Industrieromantik«. In den Seitenräumen werden spezielle Themen vertieft und einzelne Persönlichkeiten vorgestellt, die eine besondere Bedeutung in der Kunstszene des Ruhrgebiets einnehmen - darunter Herman Heyenbrock als ältester Künstler [1871-1948] und Alexander Calvelli [*1963] als bekanntester lebender Industriemaler.
Industriemalerei im Ruhrgebiet
Die Industriemalerei entwickelte sich zwischen den akademischen Kunstströmungen und der Fotografie und transportiert die unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Industrie. Tatsächlich erstaunt aus heutiger Perspektive der meist positive Blick, mit dem Zechen, Stahlwerke, Kokereien und Industriehäfen als Arbeitgeber und Stätten technischen Fortschritts dargestellt wurden. Aus den unterschiedlichsten Gründen richteten Künstler und einige wenige Künstlerinnen dieser Zeit ihre Aufmerksamkeit auf die Phänomene der Schwerindustrie - häufig gegen den Trend zur Abstraktion in der Kunst der Avantgarde.
Linke Seite, oben: Richard Gessner: Hafenstadt am Rhein, Öl auf Leinwand, 1920/30
Unten: Hugo Wallenius: Ruhr-Madonna, Öl auf Leinwand, 1946
Rechte Seite, oben links: Unbekannter Künstler: Hochofenanlage, Öl auf Leinwand, 1954
Rechts: Conrad Felixmüller: Bergleute auf der Zeche Schlägel & Eisen, Herten, Holzschnitt, 1974
Mitte: Heinz Schildknecht: Bergleute am Förderturm, Farblinoldruck, 1957
Unten: Otto Honsálek: Stahlarbeiter, Öl auf Leinwand, 1955
Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian

Industriemalerei war an den Akademien nur selten ein Thema. Die Bilder stießen auch beim zahlungskräftigen Publikum kaum auf ein größeres Interesse. Viele Industriegemälde und -grafiken entstanden als Auftragsarbeiten für die Vorstandsetagen und Printmedien der industriellen Betriebe. Die weiteren Beweggründe erschließen sich häufig aus den Biografien der Künstler und Künstlerinnen: Familiäre Prägungen, die Beschäftigung in einer Zeche oder einem Stahlwerk, Heimatliebe, aber auch soziale Fragen oder die künstlerische Herausforderung bei der Darstellung von Atmosphärischem wie Feuer, Rauch und Dampf sowie die Faszination für Produktionsprozesse waren entscheidende Faktoren.
Hochdetaillierte Szenen, zum Beispiel aus der Stahlproduktion, offenbaren den Industriealltag in einer ganz eigenen Ästhetik. In stilistischer Hinsicht ist der Einfluss des Impressionismus in der Darstellung von Lichtund Farbeffekten, etwa bei den Szenen in den Hochöfen und Kokereien, spürbar. Während Gemälde die Industrie oft idealisieren, betonen Werbegrafiken die Größe und Effizienz der Fabriken - Arbeiter wurden dabei oft nur als kleine, anonyme Figuren im Räderwerk der Produktion dargestellt. Diese Bilder prägten das industrielle Selbstverständnis des Ruhrgebiets und machten den technologischen Fortschritt sichtbar.
Die Industriemalerei diente durchaus auch politischen Zwecken. So wurde industrielle Arbeit als Symbol nationaler Stärke verherrlicht. Manche Künstler zeigten die harten Arbeitsbedingungen, andere stilisierten Arbeiter zu heroischen Figuren. Mit dem
Ersten Weltkrieg wurde die Industriemalerei zunehmend patriotisch. Die Gemälde aus dieser Zeit sind oft von einem idealisierten Blick auf die Arbeit und den Fortschritt durchzogen, der die harte Realität des Arbeitsalltags kaum thematisiert. Werke aus der Zeit des Nationalsozialismus glorifizieren die industrielle Leistung als Beitrag zur nationalen Größe, wobei eine enge Verbindung zwischen Arbeit und Patriotismus hergestellt wird. Das Bild des gestählten deutschen Arbeiters als Held war Teil einer breiten nationalsozialistischen Propaganda.
Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet die Industriemalerei unter kritische Beobachtung, insbesondere hinsichtlich der Rolle der Künstler im Nationalsozialismus.
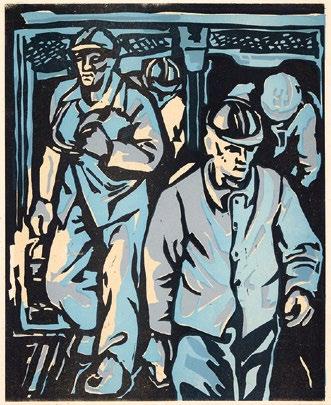
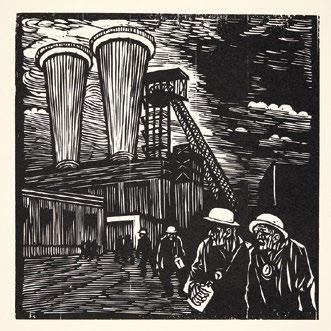
Es herrschte ein pauschaler Verdacht gegenüber den Industriemalern, allzu unkritisch die Politik des Nazi-Regimes unterstützt zu haben. Dies führte einerseits zu einem starken Rückgang der idealisierenden Industriemalerei, zum anderen zu neuen künstlerischen Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel abstrakten Darstellungen, mit dem Thema Industrie. Der Strukturwandel brachte schließlich wieder neue Industriebilder hervor, die verlassene Werke und zunehmende Arbeitslosigkeit dokumentierten.
Die Sammlung Ludwig Schönefeld und ihr Sammler
Die Sammlung Ludwig Schönefeld zählt mit über 1.500 Gemälden, Aquarellen und Grafiken zu den wichtigsten Sammlungen zur Industriemalerei im Ruhrgebiet.
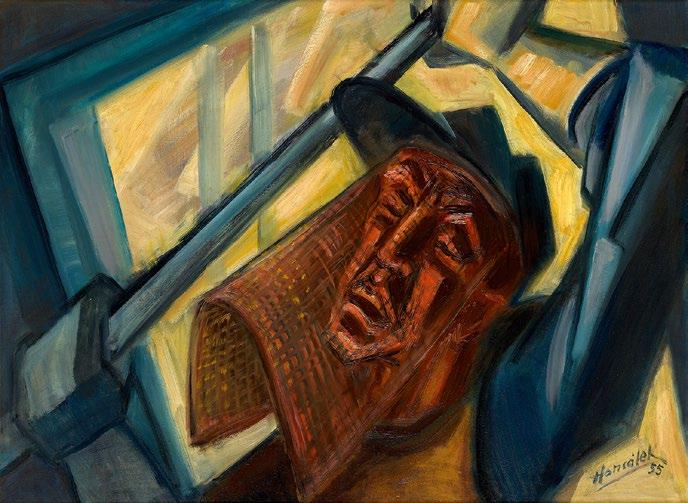

Dementsprechend zeigt die Ausstellung die ganze Breite und Dimension der Industrialisierung der Region - angefangen bei den Zechen und Kokereien, den Hüttenwerken und Hochöfen über die Arbeiter in den Werkshallen und Untertage bis hin zur Infrastruktur, der Industrielandschaft und dem städtischen Leben. Über drei Jahrzehnte lang hat Ludwig Schönefeld Industriedarstellungen zusammengetragen.
lnitialbild seiner Sammlung ist das Gemälde „Hochofenabstich" von Fritz Gärtner, welches er 1986 im Keller eines Verwaltungsgebäudes der Frankfurter Hoechst AG entdeckte. Seitdem erwarb Ludwig Schönefeld aus privater und öffentlicher Hand, auf Online-Plattformen und in Auktionshäusern weitere Industriegemälde und baute im Laufe der letzten Jahrzehnte eine beindruckende Sammlung an Industriebildern auf.
Der Sammler Ludwig Schönefeld erklärt: »Mir ist es wichtig, in der Sammlung die
ganze Bandbreite des künstlerischen Wirkens unabhängig vom Grad der Bekanntheit abzubilden. Industriegemälde haben ganz konkrete historische Bezüge. Sie erzählen die Geschichte der Industrialisierung in unserer Region aus verschiedensten Blickwinkeln. Damit vermitteln sie das Flair einer Zeit, die das Ruhrgebiet und die Menschen im Revier prägte.«
Mit der Ausstellung übergibt Ludwig Schönefeld seine Sammlung in die Obhut des Ruhr Museums. Langfristig wird sie in das Eigentum der Stiftung Ruhr Museum übergehen. Dies bedeutet eine der größten Sammlungserweiterungen in der Geschichte des Museums. Die Sammlung Ludwig Schönefeld ergänzt so zunächst als Dauerleihgabe die umfangreichen Bestände an Realien und Fotografien des Ruhr Museums zur Industrie- und Sozialgeschichte des Ruhrgebiets um den bisher in den Sammlungen nur marginal vertretenen künstlerischen Blick auf die Industriegeschichte.
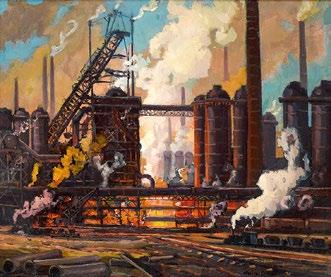
Linke Seite, oben: Paul Ehrenberg: Hochofen Abstich II, Öl auf Leinwand, um 1910
Unt.: Fritz Gärtner: Hochofenabstich, Öl a. Malplatte, 1924
Rechte Seite, oben links: Alexander Calvelli: Abstich, Westfalenhütte, Dortmund, Acryl auf Leinwand, 2009
Oben rechts: Unbekannter Künstler: Industriehalle, Radierung, um 1930
Rechts, Mitte: Hermann Kätelhön: Am Gesenk, Radierung, 1938
Unten: Blick in die Ausstellung. © Ruhr Museum; Foto: Deimel + Wittmar
Alle Objekt-Fotos: © Ruhr Museum / Sammlung Ludwig Schönefeld, Foto: Christoph Sebastian
Ludwig Schönefeld ist ein Kind des Ruhrgebiets: 1964 in Gelsenkirchen geboren, in Wattenscheid aufgewachsen, in Bochum zur Schule gegangen und als Tageszeitungsjournalist in Dortmund ausgebildet. Danach arbeitete der Kommunikationsfachmann und Historiker für verschiedene Unternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit, später in internationalen Managementfunktionen. Schönefeld studierte Sozialwissenschaften, neuere Geschichte und Literaturwissenschaft in Hagen. Zu
seinen frühesten Erinnerungen gehören der Geruch der Kokereien, der nächtliche Lichtschein der Gutehoffnungshütte oder die Geräuschkulisse der Zeche Osterfeld in Oberhausen.
An der Ausstellung „Das Land der tausend Feuer" ist Ludwig Schönefeld als Gastkurator beteiligt und stellt so sein Wissen und seine Recherchen zur Herkunft sowie zum historischen Kontext der Gemälde zur Verfügung.
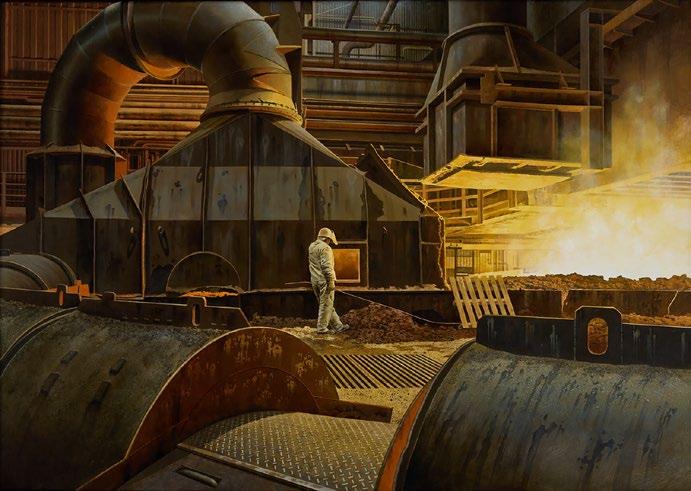
Die Ausstellung wird im großen Sonderausstellungsraum auf der 12-Meter-Ebene der Kohlenwäsche gezeigt. Die einzigartigen Räumlichkeiten mit den rauen Bunkerwänden bieten einen spektakulären Rahmen für die Gemälde und Grafiken.
Zentrales Element der Ausstellungsarchitektur sind vier leuchtend rote Pavillons in der Mittelachse des Raumes.
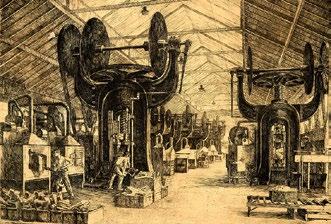



Als wichtige Orientierungsmarker strukturieren sie den Raum und greifen mit ihrer Farbgebung symbolisch den Ausstellungstitel des "Landes der tausend Feuer" auf. Gleichzeitig bilden sie einen starken Kontrast zu den mit Kohlepatina gefärbten Wänden der Bunkerebene.
Das zweite wichtige Gestaltungselement ist das Raster aus von der Decke abgehängten Wänden in den beiden Seitenschiffen. Diese freischwebenden Wände dienen als Präsentationsflächen für Gemälde und Grafiken. Sie sind bewusst massiver gestaltet, als es statisch notwendig wäre, um als eigenstän-
dige Objekte im Raum wahrgenommen zu werden. Ihre helle Graufärbung schafft eine Wechselwirkung mit dem rohen Beton der Ausstellungswände, wodurch sich Alt und Neu harmonisch verbinden. Sie ermöglichen eine flexible Präsentation der Bilder, ohne den Blick auf das Gebäude zu verdecken. Bewusst wurden die meisten Wände und Pfeiler der Bunkerebene sichtbar gelassen, um so den rohen Beton als prägendes Element des Raumes zu erhalten.
Bei der Präsentation der Gemälde und Grafiken wurden die meisten Originalrahmen beibehalten; ungerahmte Werke erhielten schlichte schwarze Rahmen. Alle Ausstellungstexte und Bildbeschreibungen wurden direkt auf die Wände aufgebracht, damit sie das Gesamtbild nicht stören.
Oben: Das Team der Ausstellung "Das Land der tausend Feuer. Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld" (v.l.) Ludwig Schönefeld, Sammler, Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, Dr. Reinhild Stephan-Maaser, Projektleiterin und Kuratorin, Bernhard Denkinger, Ausstellungsgestalter
»Unsere Architektur macht die inhaltliche Gliederung sichtbar und sorgt zugleich für eine einfache Orientierung. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich intuitiv durch den Raum bewegen können, ohne das Gefühl zu haben, sich zu verlieren«, beschreibt der Architekt Bernhard Denkinger das Konzept. Für das Ruhr Museum gestaltete er schon zahlreiche Ausstellungen. Zuletzt schuf er 2017 mit »Der geteilte Himmel. Reformation und religiöse Vielfalt an Rhein und Ruhr« und 2021 mit »Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr« unvergessliche Museumserlebnisse für die Besucherinnen und Besucher.
Ruhr Museum in der Kohlenwäsche UNESCO-Welterbe Zollverein
Gelsenkirchener Str. 181 45309 Essen
Tel. +49 (0)201 24681 444 besucherdienst@ruhrmuseum.de www.ruhrmuseum.de/industriebilder


Dienstleistungen
• Vitrinenwartung
• Dichtigkeitsmessungen
• Emissionsmessungen
• Schadstofffilterung mittels REIER-Filterbox
Vitrinen- und Glasbau
REIER GmbH
J.-S.-Bach-Str. 10 b 02991 Lauta
www.reier.de
info@reier.de
Die Vitrinenmanufaktur


Vitrinenspektrum
• Standardvitrinen
• Spezialvitrinen
• voll- und teilklimatisierte Vitrinen
• Wechselausstellungsvitrinen
• Verleihvitrinen
• Konstruktionslösungen
• Materialauswahl
• Sicherheitstechnik
• Klimatisierung
• Filtertechnik


Autorin: Cornelia Hilsberg, Leiterin des Museums

Foto: © Rolf Tannenhauer
Rechts: Werbetafel
Ist man zu Fuß oder mit dem Rad in Braunsdorf im schönen Zschopautal in der kleinen Gemeinde Niederwiesa in Sachsen unterwegs, wird man überrascht vom Anblick eines unter Denkmalschutz stehenden Kleinodes der Industriegeschichte: der ehemaligen Weberei Kurt Tannenhauer. Wie ein Industrieschloss im Grünen wirkt dieses imposante Gebäude, malerisch auf der kleinen Insel zwischen Zschopau und Mühlgraben gelegen. Es beherbergt heute das Museum „Historische Schauweberei Braunsdorf“. Dort erhält der Besucher in den teils noch original eingerichteten Räumen einen umfassenden Einblick in ein Stück Industrie- und Kulturgeschichte.
Der kleine Ort Braunsdorf ist nicht nur für seine malerische Landschaft bekannt, sondern auch für seine lange Tradition in der Textilproduktion, die tief in der Geschichte des Ortes verwurzelt ist. Das Fabrikgebäude ist mehr als 200 Jahre alt. Es fungierte als Spinnerei, Färberei und Wollfilzproduktion.
Im Jahr 1910 kaufte Martin Tannenhauer das Gebäude mit seiner damals mehr als 100-jährigen Geschichte. Noch heute zeugt der mit Feldsteinen terrassierte Hang hinter dem Mühlgraben davon, dass dort einst die Filze in der Sonne getrocknet wurden. Martin Tannenhauer ließ den Westflügel mit einem neuen Treppenhaus und einem Aufzug errichten. Der Aufzug wurde 1976 erneuert und wird noch heute benutzt. Die Besucher mögen unseren alten Fahrstuhl mit dem grünen Scherengitter sehr gern.
Die Wände und Decken wurden in Betonbauweise ertüchtigt, um dem Gewicht und den Schwingungen der Webstühle standzuhalten. Die Produktion der Stoffe lief an. Alte Musterbücher und –koffer zeugen von der Vielfalt und der Qualität der Ware sowie von der regen Beteiligung an Messen. Unser umfangreiches Musterarchiv mit Entwürfen, Patronen und Webmustern aus rund 100 Jahren hat Seltenheitswert und berichtet eindrücklich vom Ideenreichtum und Können der Musterzeichner, Kartenschläger und Weber von damals.
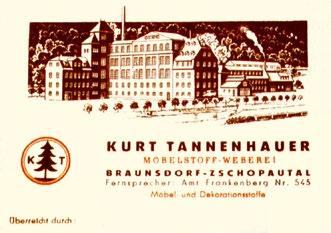

Der Sohn von Martin Tannenhauer, Kurt Tannenhauer, und ab 1971 dessen Sohn Werner Tannenhauer, hatten die in der DDR üblichen Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu überstehen, denen wohl nur die allerwenigsten Betriebe entgehen konnten. 1990 wurde dann von heute auf morgen die Produktion stillgelegt. Von den einschneidenden Erfahrungen dieser Zeit erzählen unsere Zeitzeugen in anschaulichen Videoaufnahmen, welche man in unserem Museum über QR-Code anschauen kann.
Eine Besonderheit der betriebseigenen Musterentwicklung waren Stilstoffe im „Biedermeierdessin“, die in einem aufwändigen Herstellungsprozess produziert wurden. Im In- und Ausland gab es nur wenige darauf
spezialisierte Webereien. In Braunsdorf wurden diese Stoffe nicht nur für Schlösser, Museen und Hotels gewebt, sondern gingen in großen Mengen gegen Devisen ins nichtsozialistische Ausland. Wir produzieren noch heute unsere Biedermeierstoffe auf
den historischen Webstühlen nach originalen Musterkarten. Daraus entstehen kleine Kostbarkeiten mit viel Charme für unseren Museumsshop. Aber wir verkaufen unsere Biedermeierstoffe auch als Meterware in kleinen Chargen.
QR-Code: Film Kindheit Tannenhauer
Oben: Druck aus Besitz M. Tannenhauers, verm. um 1912
Unten: Typenschild Textima
Rechte Seite: Blick in den Websaal
Fotos: © Cornelia Hilsberg
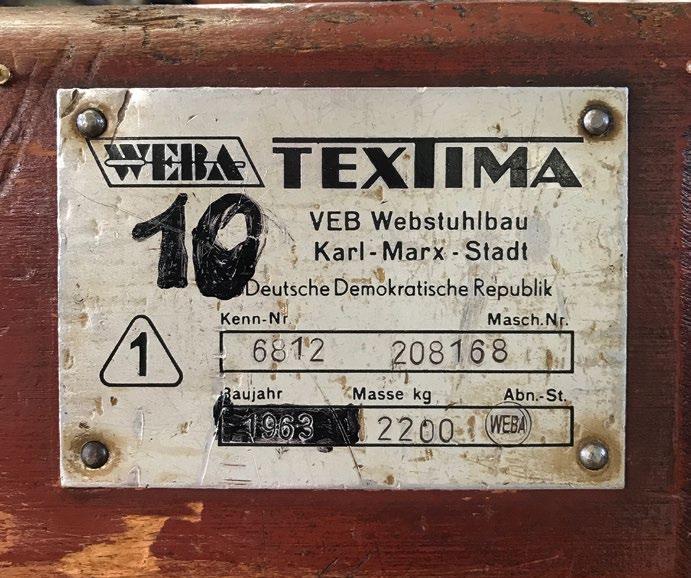



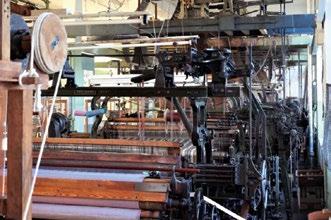


Das heutige Museum beherbergt sowohl Maschinen, die als Schenkung des Industriemuseums Chemnitz in den Museumsbestand eingingen, als auch Maschinen der Weberei Tannenhauer. Das Besondere an unserem Haus: Das Flair der alten Maschinensäle ist noch zu erahnen. Wie oft ist der erste Ausruf der Besucher: „Aaaah, hier sieht es noch aus wie früher! Und wie gut es hier nach Maschinenöl riecht!“
Als einer der wenigen erhaltenen Produktionsstandorte der ehemals bedeutenden sächsischen Textilindustrie vermittelt das heutige Museum „Historische Schauweberei Braunsdorf“ auf lebendige Weise, wie viele Schritte und wieviel Wissen notwendig sind, um einen hochwertigen Möbelstoff herzustellen. Hier kann jeder Besucher er-
leben, wie ohrenbetäubend laut die Webstühle von damals sind, und wie sie den Boden des Websaals zum Beben bringen! Umfassend informiert wird auch zu Leben und Werk des Chemnitzer Ingenieurs und Unternehmers Louis Ferdinand Schönherr, aus dessen Sächsischer Webstuhlfabrik viele der vollfunktionsfähigen Webstühle stammen. Er gilt als Erfinder der mechanischen Tuchweberei in Sachsen und hat maßgeblich zum guten Ruf von Chemnitz als Maschinenbaustandort beigetragen.
Linke Seite: Biedermeier
Foto: © Simone Mende
Oben: Außenansicht
Foto: © Heiko Lorenz
Links, Mitte: DVA Braunsdorfl
Foto: © Simone Mende
Tag des Kunsthandwerks 2023 und Fusseltreff
Fotos: © Cornelia Hilsberg
Das Museum erstreckt sich im Hauptgebäude vom 1. bis zum 3. Obergeschoß. Es verfügt über einen breit aufgestellten Maschinenpark, der nicht nur verschiedene Webstühle, sondern auch Spulmaschinen und Kartenschlagmaschinen zeigt. In der Ausstellung werden traditionelle Webstühle aus verschiedenen Epochen präsentiert, von fast 200 Jahre alten Handwebstühlen bis hin zu den späteren mechanischen Geräten, die die industrielle Produktion prägten. Mit Schautafeln und Modellen zum Ausprobieren kann man nachvollziehen, welch bahnbrechende Erfindung die Entwicklung der Jacquardmaschine als Vorläufer der heutigen Computertechnik war. Joseph-Marie Jacquard ließ seine Erfindung im Jahre 1805 patentieren.

Erkunden Sie die historische Fabrik mit oder ohne Führung, mit unserem Museumsquiz in Heftform oder bei geführten Rundgängen. Digitale oder analoge Medien machen Textil- und Technikgeschichte sowie die Menschen dahinter greifbar. Oder nutzen Sie unsere Kreativangebote nicht nur für Kinder, zum Beispiel Schlüsselbänder oder kleine Bildchen weben (gern nach vorheriger Absprache). Auch als Erwachsene können

Sie im Bilderrahmen weben oder unsere Druckkurse besuchen. Manche der Angebote können Sie auch ohne Voranmeldung nutzen. Wir beraten Sie dazu gern!
Die Historische Schauweberei Braunsdorf ist damit nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Ort der Weiterbildung und des kulturellen Austauschs. Regelmäßig finden Veranstaltungen statt. Ob im DDR-Ambiente unserer Kantine oder zwischen historischen Webstühlen – unsere Konzerte, Vernissagen und Lesungen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung und einen gemütlichen Anlaufpunkt.
Unsere Sonderausstellungen in der ehemaligen Ausnäherei reichen von Malerei über Textilkunst, von Fotografie zu Sammlungen textiler Objekte – sie bedienen ein breites Spektrum und erfreuen sich regen Zulaufes. Unser Musterarchiv machen wir in Teilen unseren Besuchern zugänglich, indem wir wechselnde Ausstellungen nach bestimmten Gesichtspunkten präsentieren.
Die Historische Schauweberei zeigt auf anschauliche Weise, dass das Handwerk in der Region Sachsen, aber auch darüber

hinaus, ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte und des kulturellen Erbes ist. In einer Welt, die zunehmend von modernen Technologien geprägt wird, ist es wichtig, solche Traditionen zu bewahren und weiterzugeben.
Linke Seite: Doppel-Mokettwebstuhl Modell OD von 1925 Foto: © Simone Mende
Rechte Seite, Links: Workshop
Foto: © Cathrin Seifert
Rechts: Museumspädagogik
Foto: © Cornelia Hilsberg





Neben der Erhaltung des Handwerks ist die Schauweberei auch ein Wahrzeichen für die tiefe Verbundenheit der Region mit der Textilindustrie. Für viele ist es eine Erinnerung an die Zeit, als Webereien, Spinnereien und andere Textilbetriebe noch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in Sachsen waren.
Das Museum in Braunsdorf lädt dazu ein, das Wissen und Können in der Textilherstellung, die über Jahrhunderte hinweg in der Region gewachsen sind, nachzuvollziehen. Für alle, die sich für Geschichte, Kultur und Handwerk interessieren, lohnt sich ein Besuch in der Schauweberei. Manch ein Aha-Erlebnis erwartet die Besucher! Unser Museum lässt die Tradition einer vergangenen Epoche wieder aufleben und freut sich auf Sie!
Historische Schauweberei Braunsdorf Inselsteig 1 09577 Niederwiesa OT Braunsdorf Tel. 037206 - 899 800 tourismus-kultur@niederwiesa.de historische-schauweberei-braunsdorf.de
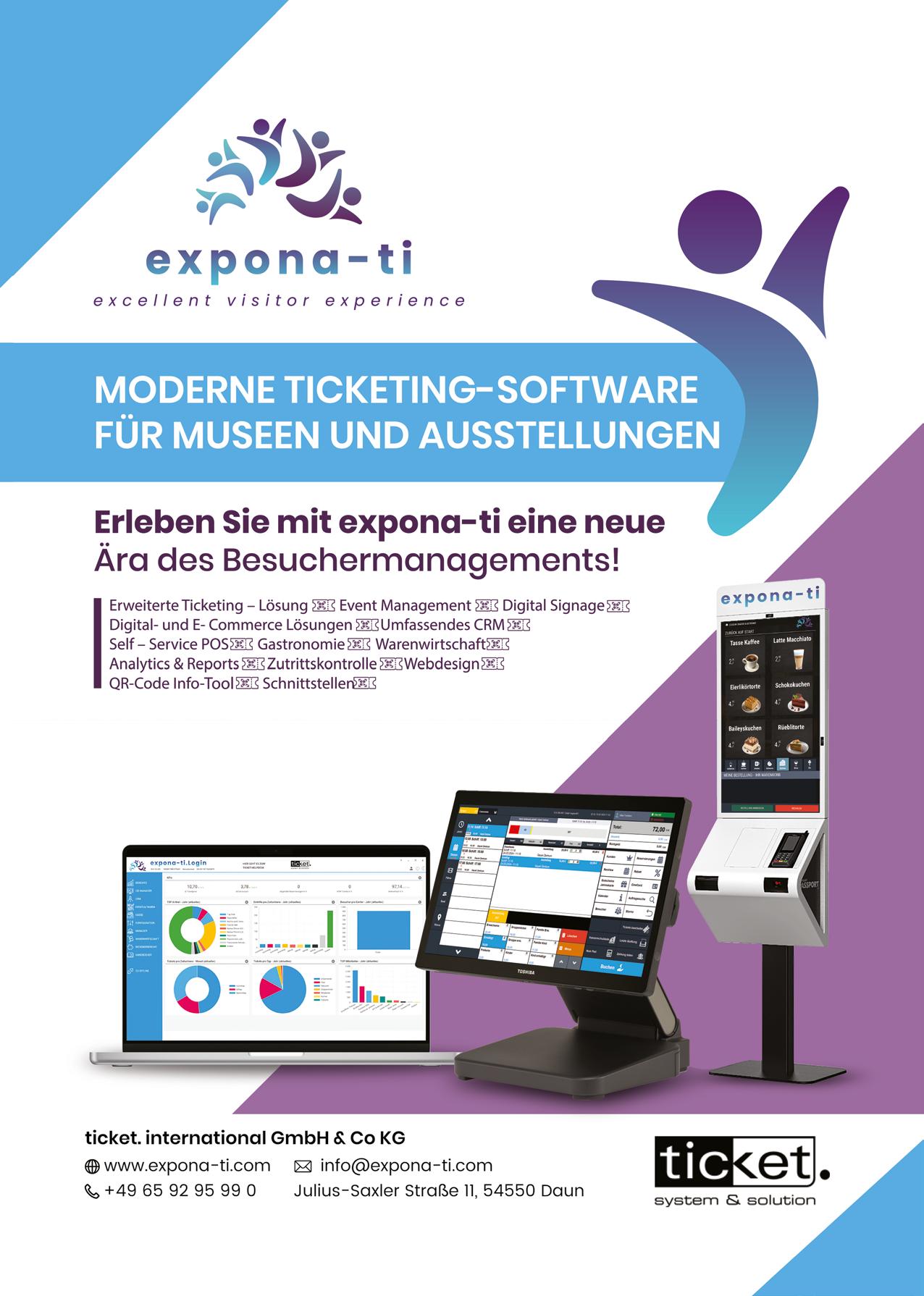
Das Museum Huis van het Boek befindet sich in der ehemaligen Residenz von Baron Van Westreenen van Tiellandt (17831848) und widmet sich der Geschichte des Buches. Neben der Buchgestaltung organisiert das Museum jährlich mehrere Wechselausstellungen. Um wertvolle Bücher zu bewahren, werden sie gereinigt, in säurefreie Hüllen verpackt und bei Bedarf restauriert. Besonders ältere Entwürfe, die mit Kleber und Schere zusammengestellt wurden, benötigen spezielle Konservierungsmaßnahmen.
Um die Archivstücke bestmöglich zu erhalten, wurde die Beleuchtung im hinteren Ausstellungsraum modernisiert.
50LUX Lighting Design and Advice entwickelte in Zusammenarbeit mit Lichtpunt eine maßgeschneiderte Lösung, basierend auf den neuesten Beleuchtungstechnologien. Nach Tests mit verschiedenen Leuchten entschied sich das Museum für CLS Topaz Zoom Leuchten (3000K), gesteuert über Casambi-Bluetooth. Diese Lösung ermöglicht es, das Licht sanft hochzufahren, wenn Besucher den Raum betreten, und es bei Abwesenheit automatisch abzuschalten.
Die CLS Topaz Serie wurde gewählt, da sie eine niedrigere Lichtintensität als die bekannte CLS Jade Serie bietet, was sich besonders vorteilhaft auf die Beleuchtung der Gemälde, Münzen, Bücher und Fossilien auswirkt. Zudem gewährleistet sie hohe Farbtreue und Langlebigkeit.

Ein weiteres Argument für Casambi war die einfache Integration in die bestehende Elektroinstallation. Neben einer verbesserten Energieeffizienz trägt das System zur Schonung der Sammlung bei: LED-Leuchten produzieren weniger Wärme und enthalten kein UV-Licht – eine wesentliche Verbesserung gegenüber den früheren Halogenlampen.
Die Integration der neuen Beleuchtung in das denkmalgeschützte Gebäude war herausfordernd. Die Kassettendecke und vorhandene Stromanschlüsse bestimmten die Platzierung der Schienen. Zudem hängen einige Gemälde sehr hoch, wodurch

Reflexionen vermieden werden mussten. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Team eine reflexionsfreie und optimale Beleuchtung erreichen.
50LUX – über das Projekt
"Es ist ein Raum, in dem eine neue Beleuchtung wirklich einen Unterschied macht. Die Exponate sind endlich wieder perfekt sichtbar, und das moderne System fügt sich harmonisch in das historische Gebäude ein." Das Museum und seine Mitarbeiter sind begeistert vom Ergebnis, und das Projekt zeigt, wie moderne Technik den Denkmalschutz unterstützen kann.
Projekt:
50LUX NL Lighting Design & Advice
Planung: Lichtpunt
Fotos: 50LUX NL – © Jeffrey Steenbergen
www.50lux.nl www.lichtpunt.nl www.cls-led.com
CLS LED B.V. Bijsterhuizen 2523
NL-6604 LM Wijchen
Tel. +31 (0) 26 326 36 76 info@cls-led.com Anzeige
Eine neue Ära beginnt mit der Topaz-Serie



Kunstwerke in Museen entfalten sich erst richtig im richtigen Licht. Angenehme Lichtverhältnisse steigern den Erlebniswert für Besucher erheblich. Bei CLS betrachten wir Beleuchtung als Kunst und gestalten unsere Leuchten entsprechend. Der Erfolg spricht für sich:
CLS Lichttechnik ist in vielen Museen weltweit begehrt. Lichtplaner und Architekten der Museumsbranche schätzen die hervorragende Qualität und innovative Technologie unserer Produkte.
Deshalb innovieren und entwickeln wir ständig weiter, mit der Topaz-Serie als Ergebnis. Diese Serie biet zahlreiche Konfigurationen mit verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, Abstrahlwinkeln und Lichtfarben. Bei häufigem Ausstellungswechsel garantieren die Zoomfunktion und Tunable White höchste Flexibilität. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu unseren erfahrenen deutschen Distributoren, die Sie gerne beraten.
Einige technische Eigenschaften der Topaz-Serie:
> Leistung von max. 15 W.
> CRI bis zu >98 & R9 bis zu 98.
> Horizontale und vertikale Montage und Fixierung möglich.
> Abmaskierung, (Framing) möglich.
> Steuerung über Roto Dim®, Mains Dim, Local Dim, DALI, DMX512, Wireless DMX oder Casambi Bluetooth.
> Zoombereich von 9º bis 58º (je nach Modell).

Huis van het Boek, Den Haag, Niederlande Projekt von: 50LUX
Das Fördergerüst über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum strahlt wieder

333 Tage lang war das Doppelbock-Fördergerüst über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum – Forschungsmuseum für Georessourcen verhüllt. Nach einer umfangreichen Sanierung strahlt das Industriedenkmal und Wahrzeichen Bochums in neuem Germania-Grün-Glanz. Und nicht nur das: Installiert wurde eine dynamische Beleuchtung, die allabendlich die Seilscheiben symbolisch drehen lässt und das Museum und seine Umgebung ereignisbezogen in verschiedene Lichtszenen tauchen kann.

Die Geschichte hinter dem Doppelbock
Ursprünglich befand sich das größte Exponat des Deutschen Bergbau-Museums Bochum an einem ganz anderen Ort: über dem Zentralschacht der Schachtanlage Germania in Dortmund-Marten. Entworfen von den renommierten Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer, wurde das vollwandige Doppelstreben-Fördergerüst 1943/44 errichtet – eine Bauart, die auch als Doppelbock bezeichnet wird. Mit einem Gewicht von 650 Tonnen, einer Höhe von rund 70 Metern und einem Durchmesser der Seilscheiben von rund 8 Metern galt es seinerzeit als weltgrößtes Fördergerüst und war eine der modernsten und auch leistungsstärksten Fördereinrichtungen des deutschen Steinkohlenbergbaus. Nach der Stilllegung der Schachtanlage Germania im Jahr 1971 wurde der Doppelbock in Einzelteile zerlegt und mit Spezialtransportern nach Bochum gebracht. Seit 1976 ist das Fördergerüst das größte Ausstellungsobjekt des Museums und der eingebaute Aufzug ermöglicht eine „Seilfahrt“ zur Aussichtsplattform auf der unteren Seilscheibenbühne sowie runter ins Anschauungsbergwerk
Oben: Wiederaufbau des Doppelbocks über dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 1973 Foto: Montagesituation über dem Museumsgebäude 1973. © Deutsches Bergbau-Museum Bochum/montan.dok, Fotograf unbekannt
Hintergrund: Fördergerüst. Foto: © Hauke Dressler


Industriedenkmal erhalten
Um das Fördergerüst dauerhaft zu erhalten, schützen Farbbeschichtungen die Stahlkonstruktion vor Korrosion. Wind und Wetter setzen der Farbe aber auf Dauer zu, so dass die Beschichtungen etwa alle 25 Jahre erneuert werden. 2024 war es wieder soweit: Im Januar begann das aufwändige Sanierungsprojekt. Vier Monate dauerte zunächst die Einhausung des Industriedenkmals, das vollständig eingerüstet und mit einer Plane staubdicht verhüllt wurde. In mehreren Phasen folgten restauratorische Maßnahmen: Alte Farbschichten wurden entfernt und erforderliche Stahlarbeiten, wie der Austausch von Winkeln und Schrauben, ausgeführt. Im weiteren Verlauf wurde das Fördergerüst neu grundiert, beschichtet und schließlich mit der schon vorher bekannten Farbe Germania-Grün versehen. Die leuchtet nun wieder kräftig und etwas bläulicher als zuvor. Ende Oktober begann der Rückbau des Baugerüsts, bis Anfang 2025 dauerten die abschließenden Arbeiten und die Installation der neuen Lichtinszenierung.
Fakten zur Sanierung
• Gewicht Baugerüst: 760 t
• Einzelbauteile Baugerüst: 76.300 Stück
• Größe der PVC-Plane: 9.980 m2
• Verwendete Farbe: 10.700 kg
• Erneuerte Winkel und Bleche: 2.028 kg
Die Baustelle blieb vollständig im Zeit- und Budgetplan. Gesamtvolumen der Sanierung: 4,5 Mio. Euro.
Der Hauptanteil finanziert sich aus dem Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ (INK2022) der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Weitere Fördermittel stammen vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW), der Stadt Bochum, der DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH (DMT-LB) sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Weitere finanzielle Unterstützung leisten die Vereinigung der Freunde des Deutschen Bergbau-Museums Bochum e.V. in Kooperation mit der NRW-Stiftung.


Oben: Das Fördergerüst wurde für die Sanierung 2024 vollständig verhüllt. Foto: © Dt. Bergbau-Museum Bochum
Unten: Detailaufnahme Fördergerüst.
Foto: © Hauke Dressler


ArchiBALD plant, entwickelt und liefert individuelle Depoteinrichtungen. Ob Regalsysteme für unterschiedlichste Anwendungen, Zugwandsysteme für die Lagerung von Gemälden oder Schränke für Ihr Schaudepot, unser breites Produktportfolio bietet Lösungen für alle Bereiche.
Erfahren Sie mehr: www.archibald-regalanlagen.de


Die neue Lichtinszenierung, gestaltet von westermann kommunikation und LightLife, haucht dem Fördergerüst mit der anbrechenden Dunkelheit neues Leben ein. Die frühere statische Anleuchtung des Gestells wurde ersetzt durch eine dynamische Lichtanlage, die das Deutsche Bergbau-Museum Bochum samt Umfeld in warmweißes und farbiges Licht tauchen kann. Die Installation ist denkmalgerecht montiert, sie ist sparsam, wird energieeffizient mit LED betrieben und kann mit einem Tablet gesteuert werden, so dass unterschiedliche Illuminationen den Turm inszenieren. Auf die Querverstrebung des Gerüsts werden ereignisbezogen Botschaften projiziert, die weithin sichtbar sind. Symbolisch beginnen sich sogar die Seilscheiben des Fördergerüsts wieder zu drehen – und zeigen damit, dass im Museum viel Wissen über die Vergangenheit und die Zukunft des Bergbaus ans Licht gefördert wird. Die Inszenierung kann auch auf Bochumer Ereignisse reagieren, etwa wenn der VfL ein Heimspiel hat. Das Museum zeigt damit: Es ist Teil der Stadtgesellschaft.
Wiedereröffnung
Am 22. Februar feierte das Deutsche Bergbau-Museum Bochum offiziell die Wiedereröffnung des Fördergerüsts und präsentierte gleichzeitig seine vielfältigen Angebote.
Hintergrund/Oben: Fördergerüst.
Fotos: © Hauke Dressler
Unten: Die Sonderausstellung „Doppelbock auf Museum“ läuft noch bis zum 29. Juni.
Foto: © Patrick Lambertus

Bei freiem Eintritt kamen über 10.000 Besuchende und besichtigten die Ausstellungen. Rund 500 Teilnehmende bekamen in spannenden Führungen exklusive Einblicke in die Arbeit des Forschungsmuseums. Im Anschauungsbergwerk unter Tage standen ehemalige Bergleute Rede und Antwort und in Diskussionsrunden debattierten prominente Expert:innen über die Zukunft des Ruhrgebietes, die Industriekultur und welche Rolle die Wissenschaft dabei spielt.
„Doppelbock auf Museum“
Anlässlich der Sanierung wird seit Mai 2024 die Sonderausstellung „Doppelbock auf Museum“ gezeigt. Hier werden in moderner Baustellenoptik spannende Exponate aus verschiedenen Jahrzehnten präsentiert und die Historie des Fördergerüstes an zahlreichen interaktiven Stationen erlebbar gemacht. Die Ausstellung befindet sich im Sonderausstellungsbau (DBM+) des Deutschen Bergbau-Museums Bochum. Aufgrund des großen Erfolgs wird sie bis zum 29. Juni 2025 verlängert.
Die Ausstellung spricht gezielt alle Sinne an. Besuchende erleben Geräusche und Gerüche aus der Arbeitswelt der Bergleute. Ein 270-Grad-Panorama zeigt mit einem Blick vom Fördergerüst das Ruhrgebiet als Region der Industriekultur und in Interviews erklären Materialkundler:innen des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, wie Stahl verrostet und was dagegen bei der Sanierung des Fördergerüsts getan wurde. Zudem nehmen die Heimchen Zirp und Hops in einem für die Ausstellung geschriebenem Comic Kinder mit zurück in die Geschichte des Fördergerüsts.
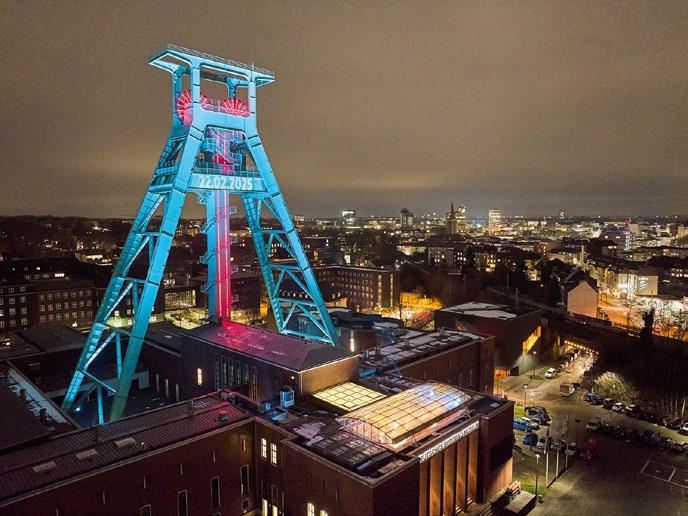


Lebendiges Museum
Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum zeigt, wie facettenreich die Geschichte des Bergbaus als die Urproduktion des Menschen von den Anfängen bis in die Zukunft ist und was Georessourcen für unsere Gesellschaft bedeuten. „Die Welt steht nicht still, wir zeigen ein lebendiges Museum, der Kohlenbergbau im Ruhrgebiet ist zwar vorbei, aber bergbauliche Kompetenzen werden weltweit für die Zukunft gebraucht, auch um die Energiewende zu schaffen. Und dafür ist Bochum ein Hotspot“, schildert die Wissenschaftliche Direktorin Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner die Zukunftsaufgaben, die das Museum als Forschungsmuseum für Georessourcen begleitet. Das Doppelbock-Fördergerüst steht für die Wandlungsfähigkeit des Museums und für Bochum als gewachsenes Kompetenzzentrum bergbaulichen Wissens zusammen mit der Technischen Hochschule Georg Agricola rund um den Europaplatz mitten in der Innenstadt.
Gegründet 1930 ist das Museum eines von acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Zu den forschenden Bereichen
gehören Archäometallurgie, Bergbaugeschichte, Materialkunde, Montanarchäologie sowie das Forschungslabor und das Montanhistorische Dokumentationszentrum (montan.dok). Vier Rundgänge – Steinkohle, Bergbau, Bodenschätze und Kunst – führen über Tage durch das Haus. Mit dem Anschauungsbergwerk werden die Einblicke in die Facetten des Bergbaus auch unter Tage vermittelt. Auf dem gut 1,2 km langen untertägigen Streckennetz erhalten Besuchende Eindrücke vom Alltag unter Tage und von den technikhistorischen Entwicklungen im Bergbau. Und jetzt symbolisiert sogar das Fördergerüst mit der dynamischen Lichtinstallation, dass hier viel Wissen über die Vergangenheit und die Zukunft des Bergbaus ans Licht gefördert wird.
Deutsches Bergbau-Museum Bochum Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen
Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum
Haupteingang: Europaplatz
Tel. +49 (0)234 5877-126
service@bergbaumuseum.de www.bergbaumuseum.de


Oben: Modell einer Tauchpumpe für Grubenwasser im Rundgang Steinkohle Foto: © Helena Grebe
Mitte: Mitte: Besuch im Anschauungsbergwerk
Foto © Helena Grebe
Unten: Walzenschrämlader im Anschauungsbergwerk
Foto: © Karlheinz Jardner




In einer zunehmend dynamischen Geschäftswelt wird es für Museen immer wichtiger, effizient und flexibel zu arbeiten. Eine herkömmliche Kassensoftware reicht oft nicht aus, um den komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Daher wurde von De Haan IT eine umfassende Lösung entwickelt, die weit über die Funktionen traditioneller Kassensysteme hinausgeht. Diese benutzerfreundliche Plattform vereint alle notwendigen Module, die speziell auf die Bedürfnisse von Museen zugeschnitten sind und von IT-Spezialisten im Unternehmen entwickelt.
Ticket- und Onlineticketverkauf im Fokus
Mit dieser innovativen Lösung €lli-Museum können Museen sowohl Tickets vor Ort als auch Online-Tickets verkaufen. Dies erweitert nicht nur die Reichweite, sondern bietet den Besuchern auch ein nahtloses Einkaufserlebnis. Die Integration von OnlineVerkäufen ermöglicht es den Museen, jederzeit und überall auf ihre Verkaufsdaten zuzugreifen. Zudem kooperiert das System mit führenden Drittanbietern, um ein internationales Publikum anzusprechen, das direkt Tickets online, unabhängig von einer eigenen Website erwerben kann.
Effiziente Verwaltung von Führungen und Veranstaltungen
Die Organisation von Führungen und Veranstaltungen stellt oft eine Herausforderung dar. Die neue Software bietet eine umfassende Verwaltungslösung, die alle Aspekte dieser Prozesse abdeckt – von der Planung über die Buchung bis hin zur Nachverfolgung der Teilnehmerzahlen und der Erstellung von Auftragsbestätigungen und Rechnungen.
Dies ermöglicht es den Museen, den Überblick zu behalten und ihre Veranstaltungen optimal zu gestalten. Spezielle Bedürfnisse können in den meisten Fällen durch die Entwickler mühelos ergänzt bzw. verändert werden.
Optimierte Zugangskontrolle
Ein weiterer zentraler Bestandteil des Systems ist die Zugangskontrolle. Diese sorgt für eine reibungslose Einlasskontrolle und
gewährleistet, dass nur berechtigte Personen Zugang zu Veranstaltungen oder Einrichtungen erhalten. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verbessert auch das Besuchererlebnis, da Zeitfenster und Gültigkeitszeiträume flexibel festgelegt werden können.
Selbst an die Abwicklung der Parkplatzgebühren und Übersicht verfügbarer Stellplätze wurde gedacht und ist vollkommen mit in das System integriert. Hier soll jedoch betont sein, dass der Kunde natürlich nur die Module bekommt, die für sein Museum auch ihre Anwendung finden.
Einfache Abwicklung von Jahres- und Monatskarten
Die Verwaltung von Jahres- und Monatskarten wird durch das €lli-Museum erheblich vereinfacht. Museen können Abonnements verwalten, Zahlungen automatisieren und die Gültigkeit der Karten in Echtzeit überprüfen, was einen erstklassigen Service für Stammkunden ermöglicht. Sonderaktionen, wie Rabatte oder ein Bonus-System für Kunden kann ebenfalls realisiert werden und lässt auch in den Reportings für Buchhaltung und Marketing keine Wünsche offen.
Unterstützung bei Shop- und Gastronomieverkäufen
Eine Besonderheit ist besonders hervorzuheben: Das System bietet auch Unterstützung bei der Abwicklung von Shop- und Gastronomieverkäufen. Eine integrierte Bestandsführung sorgt dafür, dass Museen stets den Überblick über ihre Waren haben und Engpässe vermeiden können, was für die Kundenzufriedenheit entscheidend ist. Somit ist keine weitere Software für diese Bausteine nötig, welches für die Mitarbeiter in ihrer Arbeit für eine große Erleichterung sorgt. Auch die Einarbeitung neuer Kollegen ist durch die grundlegend einfache Handhabung innerhalb kürzester Zeit umgesetzt.
Die Anbindung an Buchhaltungssoftware wie DATEV oder andere Plattformen erleichtert die Finanzverwaltung erheblich. Durch die nahtlose Integration können Buchhaltungsdaten automatisch synchronisiert werden, was Zeit spart und Fehler

Foto: © Paleis Het Loo
minimiert. Kombitickets mit unterschiedlichen Steuersätzen können in den Reports individuell aufgeführt werden.
Echtzeit-Statistiken für fundierte Entscheidungen
Daten sind der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Das System ermöglicht die Erstellung individueller Statistiken und Auswertungen in Echtzeit, sodass Museen Trends erkennen, Verkaufsstrategien anpassen und Angebote optimieren können.
Fazit:
Eine integrierte Lösung für Museen
Mit dieser umfassenden Lösung erhalten Museen mehr als nur eine Kassensoftware. Sie profitieren von einer integrierten Plattform, die alle Aspekte des Ticketings und des Veranstaltungsmanagements abdeckt. Durch die Optimierung der Abläufe und die Steigerung der Effizienz können Museen ihren Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bieten – alles aus einer Hand. De Haan IT bietet für Interessierte unverbindliche Präsentationen vor Ort oder per Videokonferenz an.
Ton Cieraad, Geschäftsführer von De Haan IT: „Ein fester persönlicher Ansprechpartner steht den Museen zur Seite, um bei Fragen und Anliegen Unterstützung zu bieten. Dies gewährleistet, dass die spezifischen Bedürfnisse der Museen stets im Fokus stehen und wir schnell die gewünschten Anpassungen umsetzen können.“
De Haan IT Deutschland GmbH Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf Kontakt@dehaanit.com www.elli-museum.de Anzeige



Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten für Ihr Museum mit € lli-Museum
Ticket- und Kassensystem
Online-Ticketshop
einfache, selbsterklärende Bedienung
Zugangskontrolle
Jahres-/Monatskartenverwaltung
Shop- und Gastronomieabwicklung
Schnittstelle Buchhaltung
Reservierungen/Vermietungen
Verwalten von Führungen/Veranstaltungen individuelle Statistiken/Auswertungen
Business Intelligence
fester, persönlicher Ansprechpartner und vieles mehr...

Mit der umfassenden Retrospektive „Suzanne Valadon“ widmet das Centre Pompidou einer der eigenwilligsten und bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Zeit eine längst überfällige Hommage. Kuratiert von Nathalie Ernoult (Musée national d’art moderne), Chiara Parisi (Direktorin des Centre Pompidou-Metz) und Xavier Rey (Direktor des Musée national d’art moderne), beleuchtet die Ausstellung das Leben und Werk einer Künstlerin, die abseits aller dominanten Strömungen ihre ganz eigene Sprache entwickelte – realistisch, körperbetont, ungeschönt.
Suzanne Valadon (1865–1938), einst gefeiertes Modell im Pariser Montmartre, wurde zur kompromisslosen Malerin einer oft übersehenen Moderne. Ihre Karriere verlief quer zu den gängigen Erzählungen: Während sich Kubismus und Abstraktion als neue Avantgarden etablierten, hielt sie mit Nachdruck am Figurativen fest – nicht aus Konservatismus, sondern aus Überzeugung. Für Valadon war die Wirklichkeit ein Terrain, das es unerschrocken zu erkunden galt. Im Zentrum ihres Schaffens: der Akt –weiblich wie männlich, ohne Künstlichkeit, ohne Voyeurismus, frei von Konventionen.
„Ich habe wie verrückt gezeichnet, damit ich, wenn ich keine Augen mehr habe, welche an den Fingerspitzen habe.“
Suzanne Valadon
Ein künstlerisches Porträt in fünf Kapiteln
Die Ausstellung umfasst rund 200 Werke, darunter zahlreiche Gemälde und eine große Auswahl selten gezeigter Zeichnungen. Letztere stehen besonders im Fokus – ein bewusster kuratorischer Zugriff, der Valadons Virtuosität als Grafikerin und ihr beobachtendes, körperlich-analytisches Sehen würdigt.

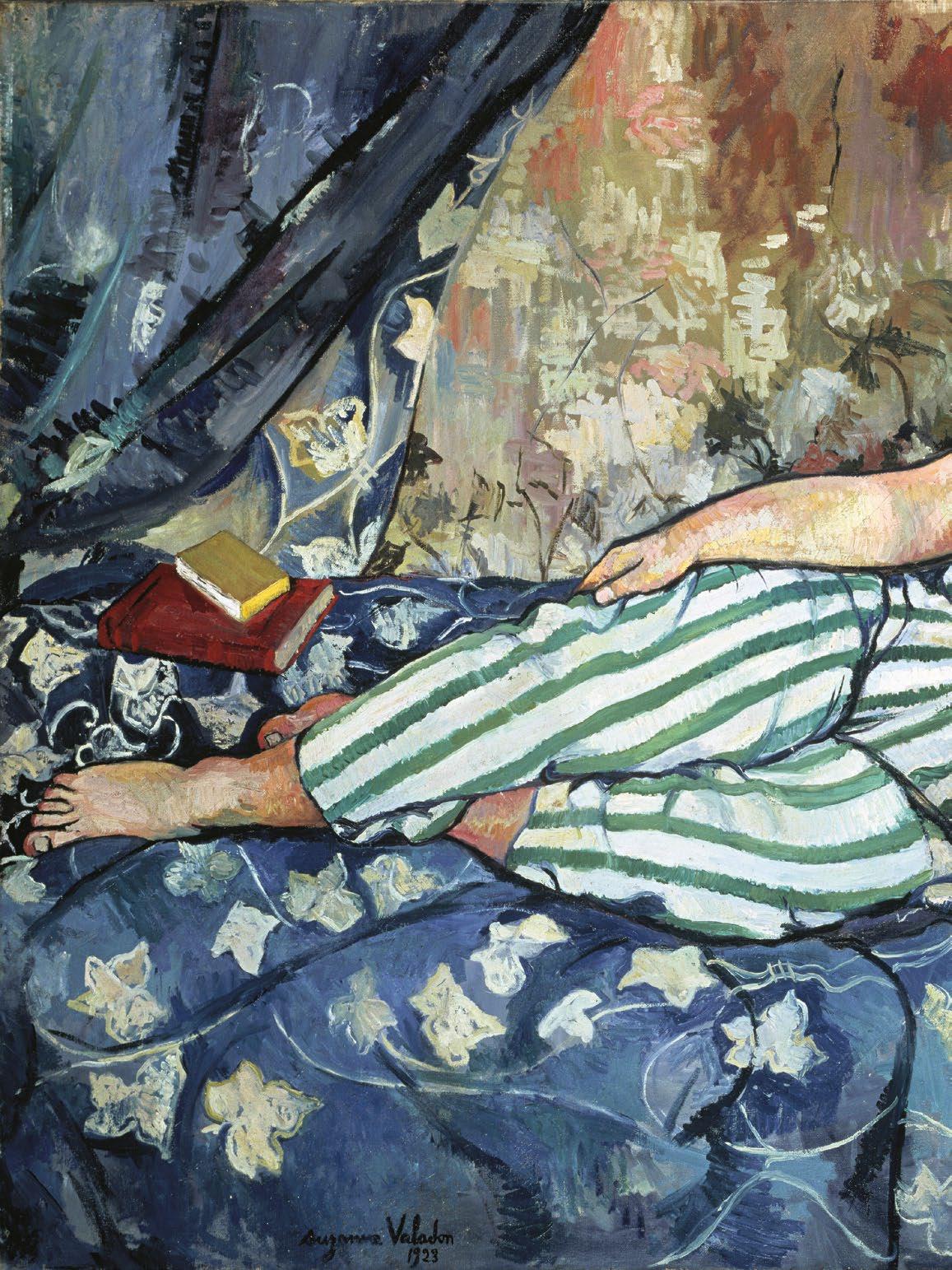

Suzanne Valadon
La Chambre bleue, 1923
Öl auf Leinwand, 90 × 116 cm
Don Joseph Duveen, 1926
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, LUX.1506 P, im Besitz des Musée des Beaux-Arts de Limoges.
Foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Jacqueline Hyde/ Dist. GrandPalaisRmn

Die Ausstellung gliedert sich in fünf Themenbereiche
Lernen durch Beobachtung – ihre autodidaktische Aneignung der Malerei aus der Perspektive des Modells.
Familienporträts – intime, teils konfliktreiche Darstellungen ihres Sohnes Maurice Utrillo und ihrer unmittelbaren Umgebung.
Ich male Menschen, um sie kennenzulernen – der Mensch als Spiegel innerer Zustände.
Die wahre Theorie ist die Natur – ihre Ablehnung des Stilisierens zugunsten einer ungeschminkten Direktheit.
Der Akt: ein weiblicher Blick – darunter der erste männliche Akt in Frontalansicht im Großformat, gemalt von einer Frau.
Diese Konzeption erlaubt es, Valadons Werk nicht nur kunsthistorisch, sondern auch emotional und biografisch zu erfassen – als künstlerischen Ausdruck einer Frau, die sich keiner Bewegung zugehörig fühlte, „außer vielleicht ihrer eigenen“.
Oben: Suzanne Valadon
Familienporträts, 1912
Öl auf Leinwand, 97 × 73 cm
Schenkung an die Nationalmuseen von Herrn Cahen-Salvador zum Andenken an Frau Fontenelle-Pomaret, 1976
Paris, Musée d'Orsay, als Depositum im Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, RF 1976 22
Foto: © Hervé Véronèse
Nächste Doppelseite: Suzanne Valadon
Der Wurf des Netzes, 1914
Öl auf Leinwand, 201 × 301 cm.
Ankauf durch den Staat, 1937
Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Inv. AM 2312 P, als Depositum im Musée des Beaux-Arts de Nancy.
Foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/. Dist. GrandPalaisRmn

Maßgeschneiderte Lösungen für:
· Gemälde-Depotanlagen
· Schaudepots
· Statische Gemäldelagerung

· Transport- und Arbeitshilfen
· Arbeitstische
· Lagertrennwände
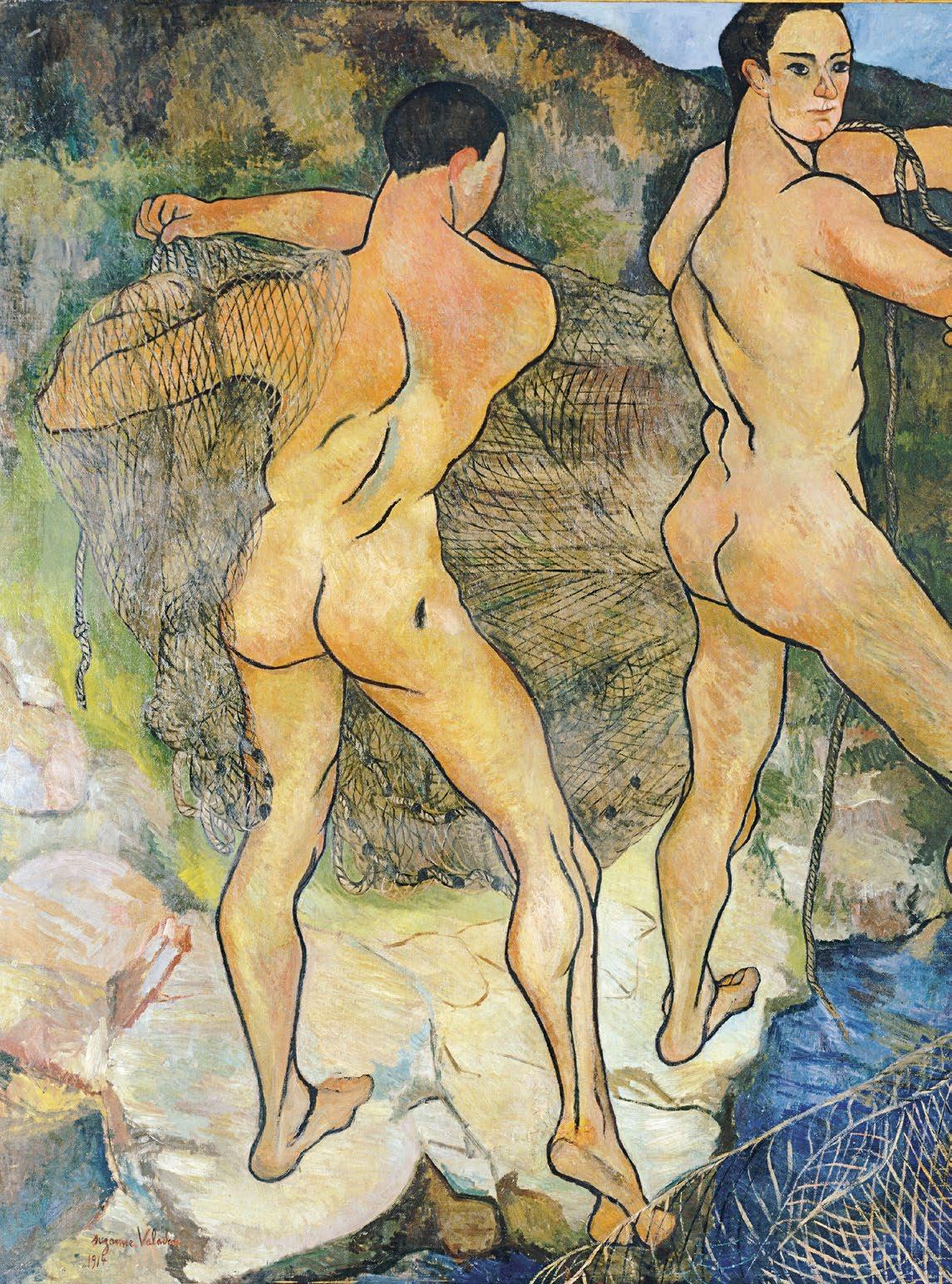
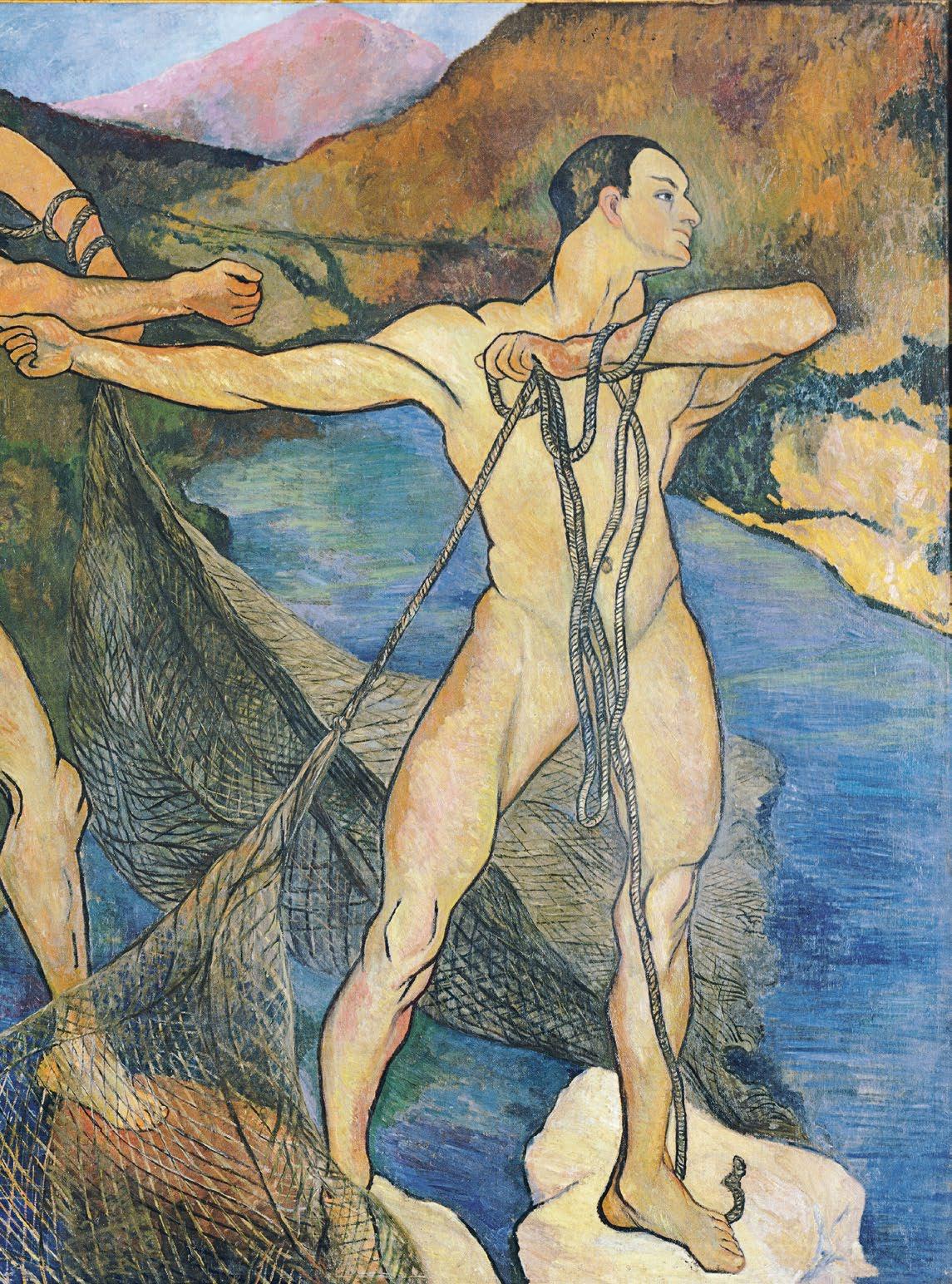
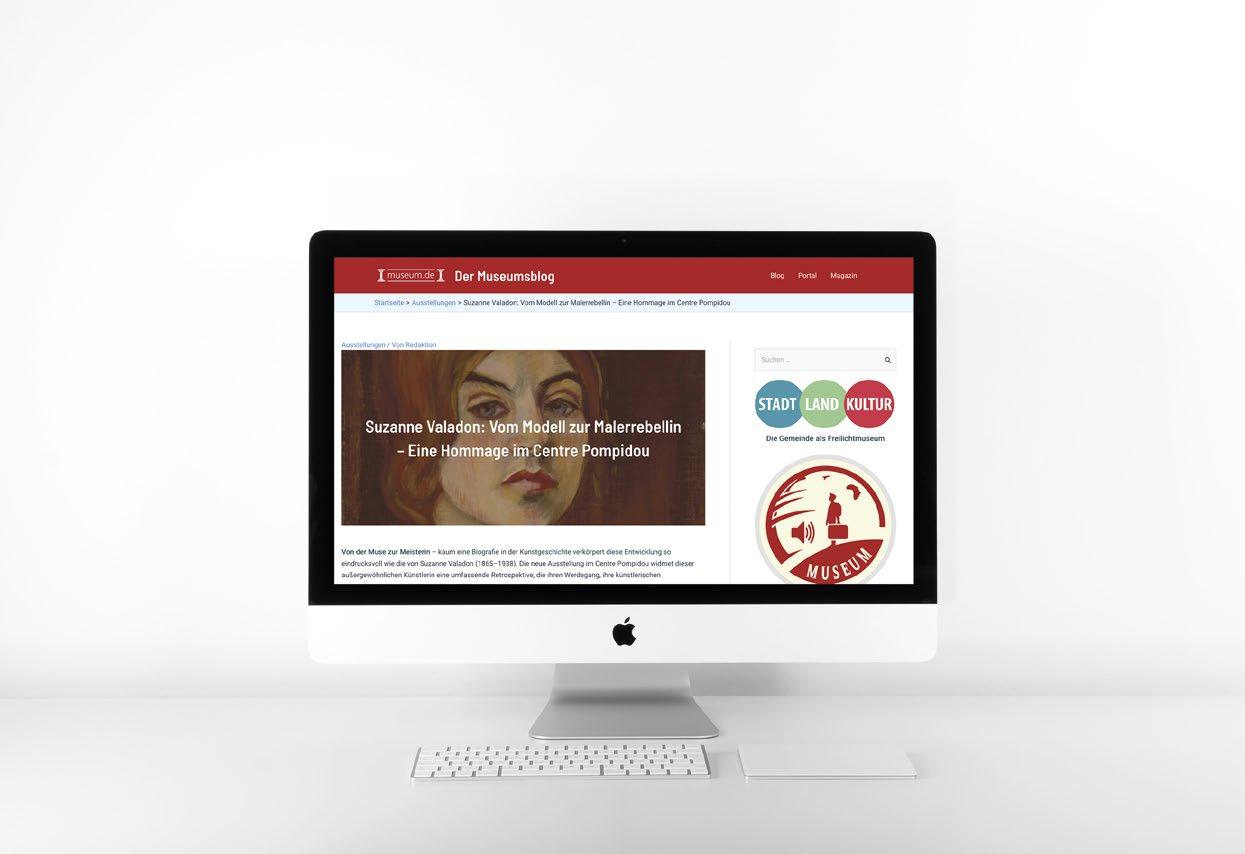
In der heutigen digitalen Landschaft eröffnet sich für Museen eine Vielzahl an Chancen, um ihre Ausstellungen, Sammlungen und Projekte einem breiten, interessierten Publikum zu präsentieren. Insbesondere der Museumsblog von museum.de bietet eine ideale Plattform, um Inhalte authentisch und detailreich zu vermitteln, sodass nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Fachkreise und neue Besuchergruppen angesprochen werden können. Museumskuratoren und -leiter haben somit die Möglichkeit, durch gezielt erstellte Blogartikel eine Reichweite von über 80.000 Besuchern zu erreichen und ihre Institution als innovativen, offenen und modernen Ort der Begegnung zu positionieren. Dabei profitieren Museen von einer emotional aufgeladenen Ansprache, die nicht nur auf wissenschaftliche Expertise basiert, sondern durch erzählerische Elemente auch einen persönlichen Zugang schafft. Ein professionell verfasster Blogbeitrag verwandelt dabei komplexe Zusammenhänge in lebendige Geschichten, die den
Leser in den Bann ziehen und gleichzeitig tiefere Einblicke in die Hintergründe und die Bedeutung der Ausstellungsobjekte geben.
Ein Beispiel
Ein herausragendes Beispiel für einen derartigen redaktionellen Ansatz bildet der Artikel „Suzanne Valadon: Vom Modell zur Malerrebellin – Eine Hommage im Centre Pompidou", veröffentlicht auf museum.de. Anhand dieses Beitrags wird eindrucksvoll sichtbar, wie ein kulturgeschichtlicher Kontext mit emotionaler Ansprache und künstlerischem Hintergrundwissen miteinander verwoben werden kann. Der Artikel erzählt die faszinierende Lebensgeschichte von Suzanne Valadon, die ihren Ursprung als charmantes Modell in den lebhaften Ateliers von Montmartre fand und sich zu einer bahnbrechenden Malerrebellin entwickelte. Dabei wird der Werdegang der Künstlerin nicht nur dokumentiert, sondern auch als Symbol einer kulturellen
Revolution dargestellt, die immer noch die Diskussion um die Rolle der Frau in der Kunst beflügelt. Die gelungene Verbindung aus biografischen Details, analytischem Blick auf Kunsttechniken und der Darstellung gesellschaftlicher Umbrüche zeigt eindrucksvoll, welchen Mehrwert ein gut konzipierter Blogartikel bieten kann.
Redaktionelle Formate
Museen können von einem derartigen redaktionellen Format in mehrfacher Hinsicht profitieren. Zum einen wird eine tiefgreifende inhaltliche Auseinandersetzung mit einem oder mehreren Themen ermöglicht, die über reine Informationsvermittlung hinausgeht. Die narrative Aufarbeitung, wie sie im Beispiel der Suzanne-Valadon-Ausstellung im Centre Pompidou zu finden ist, lädt den Leser ein, nicht nur Fakten zu konsumieren, sondern in die Entstehungsgeschichte, die persönlichen Schicksale und die künstlerischen Herausforderungen einzutauchen.
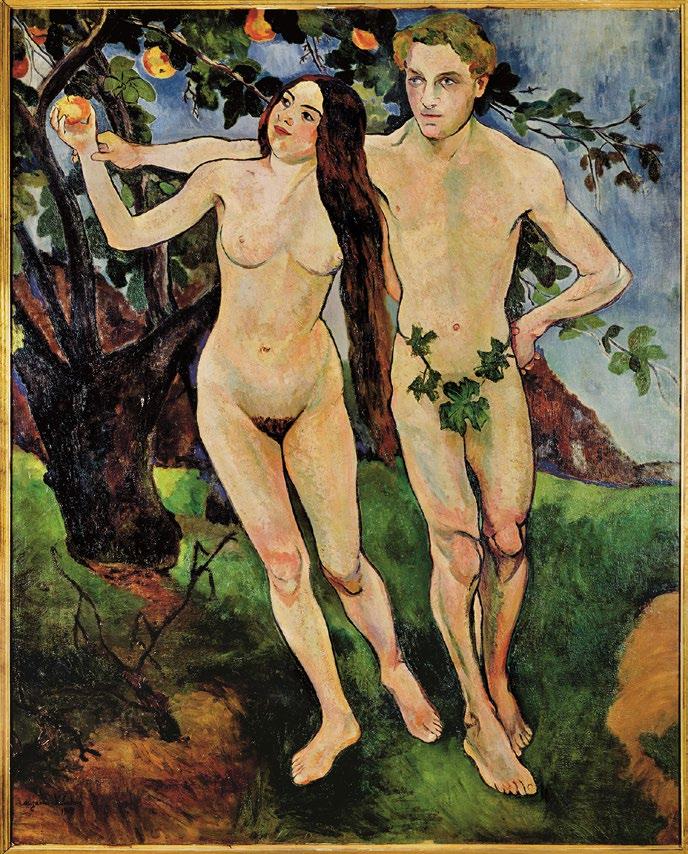
Letztlich steht fest, dass der Museumsblog von museum.de als innovative Plattform einen bedeutenden Beitrag zur Museumskommunikation leisten kann. Er bietet die Chance, wissenschaftliche Expertise in eine fesselnde, verständliche und modern aufbereitete Form zu bringen und dabei eine breite Zielgruppe anzusprechen. Das Beispiel Suzanne Valadon illustriert eindrucksvoll, wie ein liebevoll redaktionell gestalteter Beitrag nicht nur die historische Entwicklung einer Künstlerin dokumentiert, sondern auch den Dialog und die Identifikation zwischen Museum und Publikum nachhaltig stärkt. Museumsleiter und Kuratoren sollten diese Gelegenheit nutzen, um ihr Haus als lebendigen Ort der Begegnung und als Botschafter des kulturellen Gedächtnisses in den digitalen Raum zu führen.
Unser Angebot für Sie: Wir erstellen aus Ihrem Text z.B. einer Pressemitteilung einen aufbereiteten Blogbeitrag auf museum.de mit Backlink und weiteren Infos zu Ihrem Institut und Ausstellung. Angereichert wird der Beitrag mit Bildern von Ihnen und Ihrer Ausstellung.
Dies schafft einen nachhaltigen Lerneffekt und fördert zudem die Identifikation mit der jeweiligen Institution, da der Besucher die Authentizität und Leidenschaft, mit der die Kunst vermittelt wird, hautnah miterlebt.
Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in der Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, sprich Reichwete. Während traditionelle Wissensvermittlung oft durch standardisierte Pressemitteilungen oder wissenschaftliche Publikationen geprägt ist, ermöglicht der Museumsblog von museum.de eine lockere, aber dennoch fachlich fundierte Ansprache. Durch ansprechende narrative Techniken und visuelle Elemente – sei es durch begleitende Fotografien oder digitale Archivmaterialien – wird eine Brücke zwischen der Museumsexpertise und dem breiten Publikum geschlagen. Museen erhalten so die Chance, auch jüngere Zielgruppen sowie international Interessierte zu errei-
chen, die sich aktiv mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Durch eine strategisch kluge Verknüpfung von Storytelling und Fachwissen wird das traditionelle Museumserlebnis erweitert und modernisiert.
Die Erfahrung des Museumsblogs von museum.de zeigt exemplarisch, wie ein anspruchsvoller Blogbeitrag nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Emotionen weckt und den Betrachter auf eine kulturelle Entdeckungsreise mitnimmt. Indem Museen ihr umfangreiches Fachwissen mit einem modernen, kommunikativen Ansatz verbinden, schaffen sie ein authentisches und ansprechendes Medium, das der Institution langfristig neue Impulse verleiht. Vor allem in einer Zeit, in der digitale Präsenz und Interaktion zentrale Bestandteile der Museumsarbeit sind, kann ein derart gestalteter Blogartikel dazu beitragen, das kulturelle Erbe lebendig zu halten und einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.
Linke Seite:Desktop- Ansicht von einem Blog-Beitrag bei museum.de. Den exemplarischen Blogbeitrag findet man als mobile Version über den QR-Code oder hier: museum.de/blog/?s=Suzanne+Valadon. Weitere BlogBeiträge siehe www.museum.de/blog
Rechte Seite: Suzanne Valadon Adam und Eva, 1909. Öl auf Leinwand, 162 × 131 cm Staatsankauf, 1937. Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Inv. AM 2325 P.. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/ Dist. GrandPalaisRmn
Kontaktieren Sie uns gerne zum Thema: museum.de Ostwall 2, 46509 Xanten
Ansprechpartner: Frank Hübsch blog@museum.de

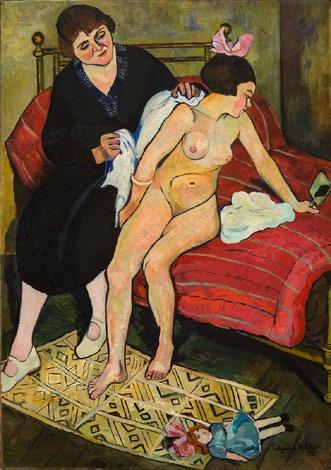
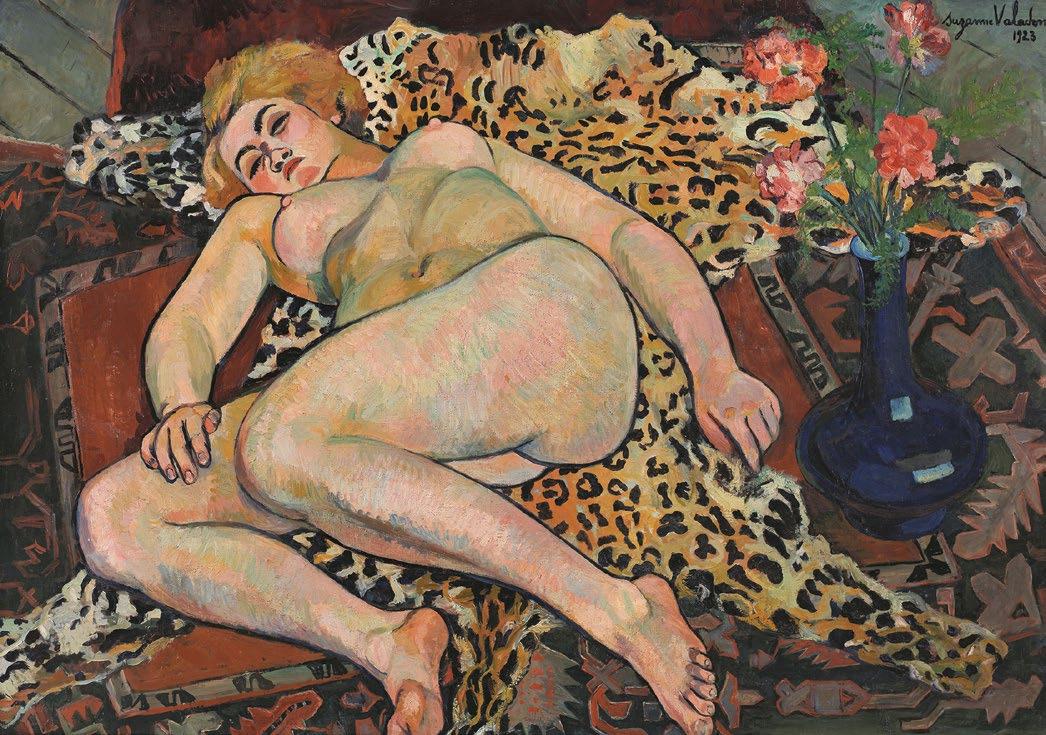
Zwischen den Sammlungen –zwischen den Jahrhunderten
Die Retrospektive macht sichtbar, wie Valadons Werk eine Zwischenposition markiert – zwischen den kunsthistorischen Schwerpunkten der großen Pariser Institutionen: dem Musée d'Orsay, das sich dem 19. Jahr-
hundert widmet, und dem Musée national d’art moderne, das die Moderne des 20. Jahrhunderts abbildet. Valadon ist eine „Passantin zwischen den Jahrhunderten“, deren Schaffen genau diese Übergangsphase
reflektiert – mit einem Stil, der weder rückwärtsgewandt noch avantgardistisch im klassischen Sinne ist, sondern zutiefst eigenständig.

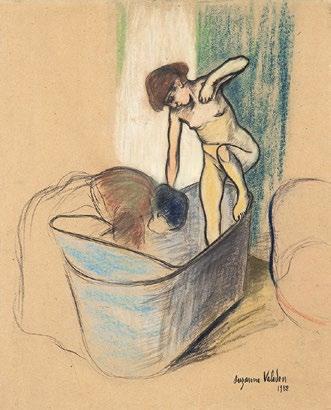
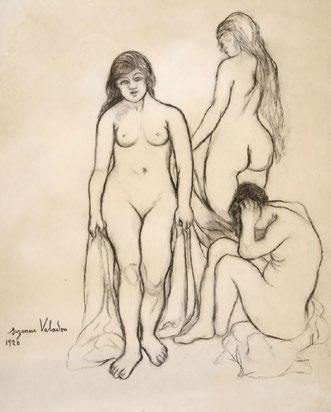
Linke Seite, oben: Blick in die Ausstellung
Foto: © Audrey Laurans
Rechts: Suzanne Valadon
La Poupée Délaissée, 1921
Huile sur toile, 135 x 95 cm
National Museum of Women in the Arts, Washington D.C., Geschenk von Wallace und Wilhelmina Holladay, Inv. 1986.336. Foto: © National Museum of Women in the Arts, Washington, Lee Stalsworth
Unten: Suzanne Valadon
Katharina nackt auf einem Pantherfell liegend, 1923 Öl auf Leinwand, 64,6 × 91,8 cm
Lucien Arkas Collection.
Foto © Hadiye Cangokce
Rechte Seite, , oben: Blick in die Ausstellung
Foto: © Audrey Laurans
Unten, links: Suzanne Valadon
Le Bain, 1908
Kohle und Pastell auf Papier, 60×49cm
Paris, Centre national des arts plastiques
Kauf von der Künstlerin im Jahr 1916
Im Depot des Musée de Grenoble, Nr. DG 1920-9 FNAC 5274.
Foto: © Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix
Rechts: Suzanne Valadon
Drei Akte, unbestimmtes Datum
Fettstift auf Papier, 55 x 44 cm
Sammlung Galerie de la Présidence.
Foto: © Galerie de la Présidence, Paris

Diese Perspektive spiegelt sich auch in der Auswahl der Leihgaben: Neben Schlüsselwerken aus den Beständen des Centre Pompidou – der heute bedeutendsten Sammlung Valadons – und aus den Sammlungen des Musée d’Orsay und der Orangerie, kommen Meisterwerke aus internationalen Häusern wie dem Metropolitan Museum of Art in New York oder der Fondation de l’Hermitage in Lausanne sowie aus renommierten Privatsammlungen hinzu.
Valadon im Kontext mit anderen Künstlerinnen
Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung, Valadons Werk im Kontext anderer Künstlerinnen ihrer Zeit zu zeigen. Werke
von Juliette Roche, Georgette Agutte, Jacqueline Marval, Émilie Charmy und Angèle Delasalle erweitern die Perspektive auf eine ganze Generation weiblicher Kreativer, die sich ebenso von akademischen Regeln wie von avantgardistischen Dogmen lösten –und deren Werke nun langsam den ihnen gebührenden Platz in der Kunstgeschichte einnehmen.
Zeugnisse eines Lebens –
Das Archiv Valadons
Einen wichtigen Bestandteil bildet das umfangreiche Archiv von Dr. Robert Le Masle, Arzt, Sammler und enger Freund Valadons, das seit 1974 im Besitz des Centre Pompidou ist. Manuskripte, Briefe, Fotografien
Suzanne Valadon
Les Deux Sœurs, 1928
Öl auf Leinwand, 72 × 53 cm
Privatbesitz. Foto: © Matthew Hollow
und persönliche Dokumente – heute in der Bibliothèque Kandinsky aufbewahrt – geben Einblicke in die Persönlichkeit Valadons: widersprüchlich, mutig, eigensinnig. Sie zeigen eine Frau, die früh Anerkennung bei Kollegen fand, von Galeristen unterstützt wurde und trotz ihres Erfolgs stets eine Außenseiterin blieb – auch, weil sie sich nie als Frau „in der Kunst“, sondern schlicht als Künstlerin verstand.
Eine Ausstellung in Tradition des Centre Pompidou
Die Ausstellung „Suzanne Valadon“ ist Teil der konsequenten Linie des Centre Pompidou, Künstlerinnen neu zu positionieren und ihre Bedeutung innerhalb der Moderne sichtbar zu machen. Nach den vielbeachteten Ausstellungen zu Alice Neel, Georgia O’Keeffe, Dora Maar und Germaine Richier setzt diese Retrospektive ein weiteres starkes Zeichen – nicht als bloße Rückschau, sondern als bewusste Erweiterung der Sammlungspolitik und Forschungsperspektive.
Und sie markiert ein Ende und einen Neuanfang: Als letzte große Präsentation vor der fünfjährigen Schließung des Centre Pompidou zur umfassenden Renovierung ist sie ein würdiger Schlussakkord – und zugleich ein programmatischer Auftakt für eine offenere, vielfältigere Kunstgeschichte.
Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
www.centrepompidou.fr
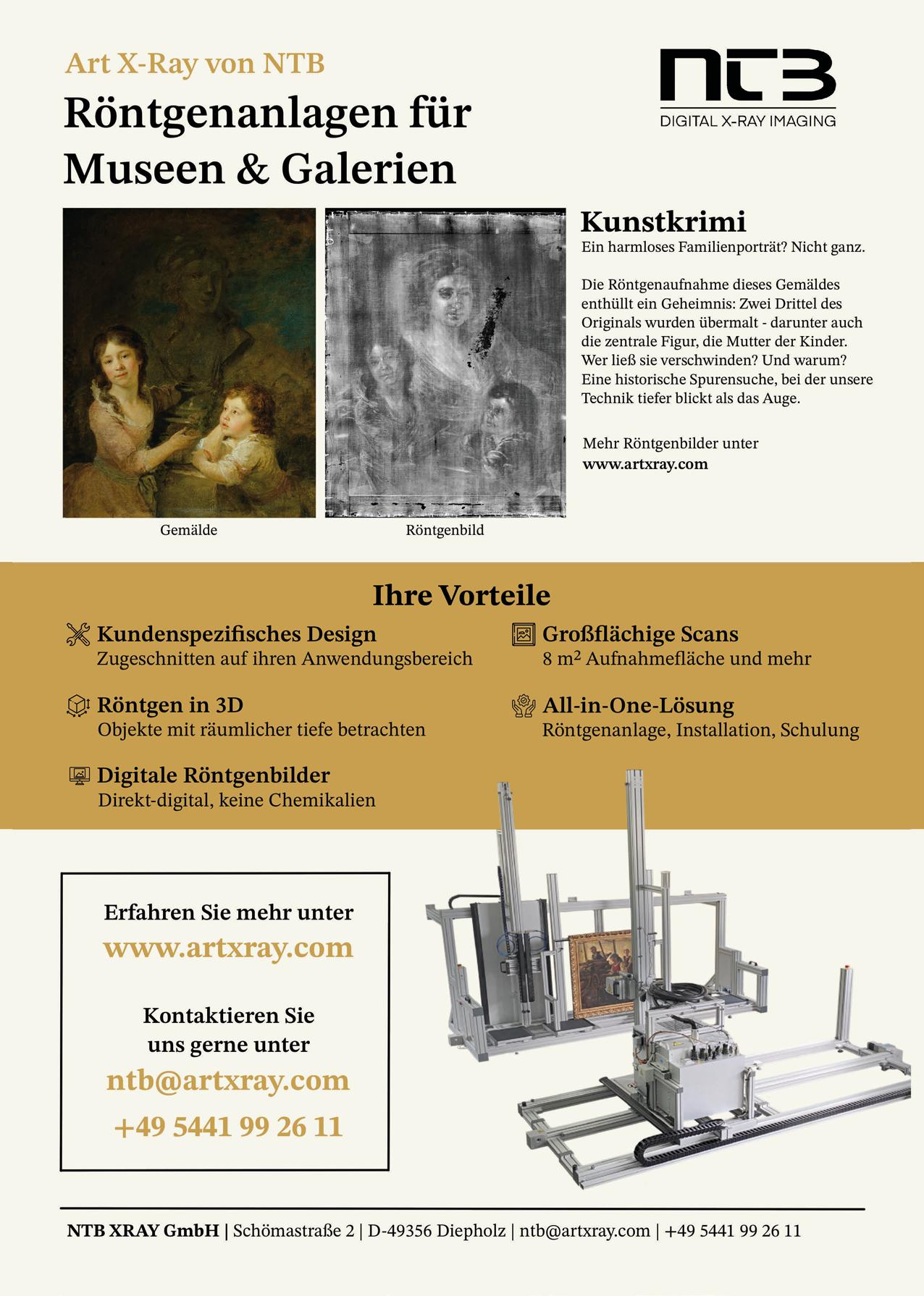

Ein fast leerer Raum. Weiße Wände. Nur wenige Möbel. Eine Besucherin hebt ihr Smartphone – und plötzlich erwacht der ehemalige Festsaal zu neuem Leben. Prächtige Gemälde schmücken die Wände, antike Möbel stehen an ihrem ursprünglichen Platz und der Esstisch ist festlich gedeckt. Dieses beeindruckende Erlebnis bietet die Drostei in Pinneberg, die ihre analogen Ausstellungen mit Augmented Reality (AR) bereichert.
Kultur ohne Grenzen: digital, barrierearm und nachhaltig
Kulturvermittlung endet nicht beim Erlebnis vor Ort. Was Besuchende vor Ort erleben, ist Teil eines größeren Ganzen. Im Mittelpunkt stehen dabei viele strategische Fragen. Wie lässt sich Kultur zielgruppengerecht und langfristig zugänglich machen? Wo stehen wir als Kultureinrichtung heute? Und wo wollen wir gemeinsam hin?
Als öffentlich-rechtliche Institution begleitet Dataport Kultureinrichtungen wie die Drostei langfristig und unabhängig. Gemeinsam entstehen maßgeschneiderte digitale Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse der Einrichtungen zugeschnitten sind. Jedes Angebot ist zielgerichtet, ressourcenschonend und nachhaltig. Einrichtungen in den Trägerländern profitieren dabei von ausschreibungsfreien und umsatzsteuerfreien Auftragsmöglichkeiten. Von Beratungs-
Einer Technologie, die digitale Inhalte in reale Räume einblendet und damit ganz neue Zugänge zu Kultur schafft.
“Mit unserer AR-Anwendung von Dataport bewegen sich unsere Besuchenden zeitgemäß und mit Spaß durch die Jahrhunderte – vom Enkelkind bis zu den Großeltern”, erklärt Stefanie Fricke, künstlerische Leitung der Drostei in Pinneberg.
dKulturAR ist mehr als nur eine digitale Erweiterung für die Drostei. Die Lösung ist Teil einer umfassenden, gemeinsam entwickelten Strategie. Das Ziel? Kulturelle Inhalte zugänglicher und erlebbarer machen. Und sie langfristig bewahren.
Für die Drostei war klar: Es muss mehr sein, als das Erlebnis vor Ort. Die analogen Angebote müssen ergänzt werden. Kultur muss grenzenlos sein. Digital. Barrierearm. Nachhaltig.
Ein Baustein dieser Strategie ist „dVirtuellerRundgang“. Er macht vergangene Ausstellungen auch dann noch erlebbar, wenn die Originale längst abgebaut sind – digital, jederzeit und von überall. So wird das einmal Gezeigte nicht vergessen, sondern bleibt online zugänglich. Für Schulklassen. Für Kulturliebhaber*innen. Für alle, die Kultur flexibel und barrierearm entdecken wollen. Was zählt, ist nicht nur der Moment vor Ort – sondern der dauerhafte Zugang zum kulturellen Erbe.
angeboten über Infrastrukturlösungen und Tools für das digitale Arbeiten bis hin zu vielfältigen Angeboten für Bildung und Vermittlung – die Bandbreite ist groß.
Entdecken Sie, wie Dataport gemeinsam mit Kultureinrichtungen schon heute die Zukunft der Kultur gestaltet. Besuchen Sie uns auf „www.dataport.de/kultur“, erfahren Sie mehr über unsere digitalen Lösungen und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Ideen.
Dataport AöR
Altenholzer Str. 10-14 | D-24161 Altenholz www.dataport.de/kultur kultur@dataport.de

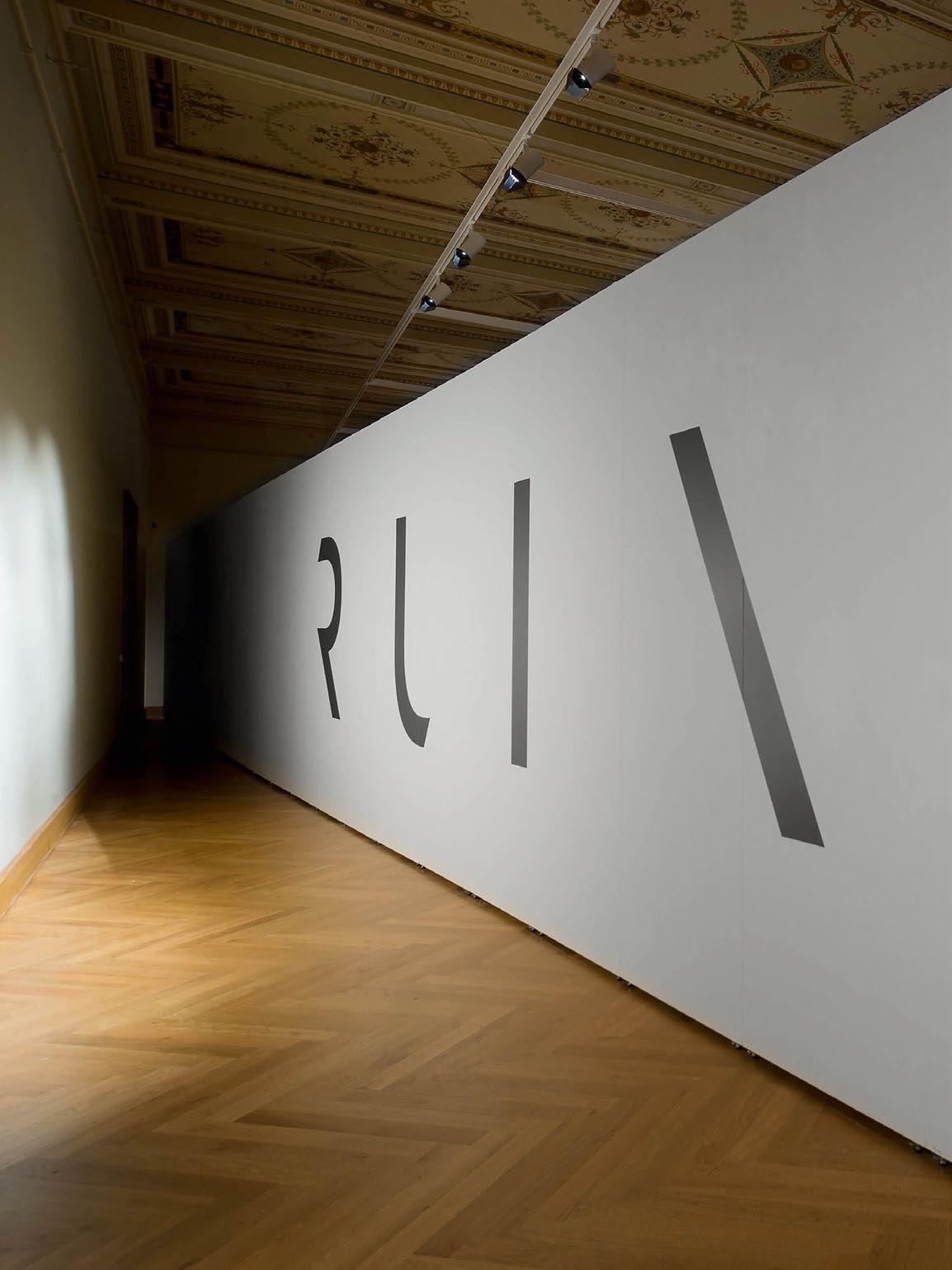
Anzeige


Wer das Kunstgewerbemuseum in Prag betritt, merkt schnell: Hier lebt Geschichte. Gleichzeitig pulsiert im Haus die Gegenwart – und immer auch ein bisschen Zukunft. Seit seiner Gründung sammelt und zeigt das Museum Kostbarkeiten aus Kunsthandwerk und angewandter Kunst. Es schlägt Brücken von den frühen, filigranen Handwerken bis zum modernen Design und verwebt diese eng mit Architektur und bildender Kunst.
© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek
JOSEF KOUDELKA: RUINS
Die Fotografien der neuesten Serie von Josef Koudelka entstanden von 1991 bis 2017 an über 200 archäologischen Stätten im Mittelmeerraum, darunter Albanien, Ägypten, Griechenland, Italien und die Türkei. Einige Bilder der Serie Ruins wurden bereits 2017 in der Ausstellung
Returning im Kunstgewerbemuseum in Prag gezeigt. Die gezeigten Fotografien sind Teil der großzügigen Schenkung von rund 2.500 Werken aus Koudelkas Lebenswerk, die er dem Museum in den letzten Jahren übergeben hat.
Architekt: Jan Roháč
(Redaktion museum.de)
© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek



Das Gebäude selbst ist schon ein Erlebnis. Der Architekt Josef Schulz hat es zwischen 1897 und 1900 im französischen Neorenaissance-Stil errichtet. Die dekorativen Elemente, üppig und detailreich, zeugen
von der Großzügigkeit jener engagierten Unterstützer, ohne die das Museum nicht denkbar wäre. Namen wie Bohumil Bondy, Václav Němec und Josef Wohanka stehen stellvertretend für eine lange Reihe von

Förderern. Herausragend bleibt jedoch Vojtěch (Adalbert) FreiHerr von Lanna, ein leidenschaftlicher Sammler, der dem Haus die Hälfte seiner eigenen Glassammlung überließ – ein Geschenk, das nach wie vor
Besucher staunen lässt und einzigartige Einblicke in die Entwicklung der Glasherstellung von der Antike zur Gegenwart ermöglicht.

Auch die Menschen, die das Museum geleitet haben, zeigen die Lebendigkeit dieses Ortes. Der erste Direktor, Dr. Karel Chytil, brachte sich engagiert in die Denkmalpflege Böhmens ein. Ihm folgten František Adolf Borovský, František Xaver Jiřiík und Karel Herain, unter dessen Leitung das Museum eine wichtige Rolle für tschechoslowakisches Design und angewandte Kunst übernahm. Die Geschichte des Hauses spiegelt auch die Wirren des 20. Jahrhunderts: Während des Zweiten Weltkriegs musste das Museum durch die Übernahme der deutschen Flugzeugfirma Junkers ausgelagert werden, viele Sammlungen fanden Platz in ländlichen Depots und im Nationalmuseum. 1949 wurde das Haus verstaatlicht, war 1959–69 Teil der Nationalgalerie und ist seit 1970 als eigenständige, staatlich gegründete Institution unterwegs. Emanuel Poche, Jiří Šetlík, Dagmar Hejdová, Jaroslav Langer und nach 1989 Helena Koenigsmarková prägten als
Direktoren ebenfalls die Entwicklung. Seit 2024 leitet Radim Vondráček das Haus.
Heute ist das Kunstgewerbemuseum eine wahre Schatzkammer: Über eine halbe Million Objekte lagern im Zentraldepot – Glas, Porzellan, Keramik, Grafik, Fotografie, Textil, Mode, Möbeldesign, Uhren, Metalle, Schmuck, Spielzeug und unzählige Dokumente und Bilder. Jeder, der Sammlungsverwaltung kennt, weiß: Da steckt viel Sorgfalt, Leidenschaft und logistische Meisterleistung dahinter.
Zwischen 2014 und 2017 wurde das geschichtsträchtige Gebäude grundlegend erneuert. 17 Ausstellungssäle, ein großzügiges Vestibül, Shop, Restaurant, Vortragssaal und eine umfangreiche Bibliothek machen das Museum heute zu einem lebendigen Treffpunkt für Kunstbegeisterte aller Generationen. Seit dem Umbau ist das Haus
Schauplatz für ein intensives Ausstellungsprogramm. Highlights sind beispielsweise die Sammlung modernen Glases (2018–20 im dritten Obergeschoss eröffnet) und die neue Dauerausstellung in sieben Sälen des zweiten Obergeschosses, die 2023 ihren Abschluss fand. Flexibilität ist Trumpf: Das Erdgeschoss und das 3. Obergeschoss bleiben wechselnden Projekten und frischen Impulsen aus allen Sammlungsbereichen vorbehalten.


POWER
Das Kunstgewerbemuseum in Prag thematisiert seit vielen Jahren intensiv mit dem Phänomen Spitze – als Ausdrucksform tschechischer angewandter wie bildender Kunst. Zur ICOM-Generalkonferenz 2022 wurde sie daher auf internationaler Bühne präsentiert.
Die Ausstellung verknüpfte drei Perspektiven: Spitze als Kleidungsstück, als bildende Kunst und als Inspirationsquelle zeitgenössischer Künstler.
Insgesamt 23 Objekte wurden in einer raumgreifenden Installation von Pavel Mrkus gezeigt, begleitet von einem Soundtrack von K.L.A.R.A. in Kooperation mit dem Grafikstudio Monsters.
Architekt: Pavel Mrkus
(Redaktion museum.de)
© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos:






MARTIN JANECKÝ: STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS (2022)
Martin Janecký ist eine internationale Ikone der Glaskunst – seine transnationale Ausstrahlung gründet auf der außergewöhnlichen Beherrschung komplexer Heißglastechniken. Sein künstlerischer Ansatz ist dabei so vielseitig wie seine Themenwahl: Von figurativen Skulpturen bis zu großformatigen Köpfen reicht das Spektrum. In der tschechischen Glaslandschaft gilt er als Solitär neuen Typs. Seine außergewöhnliche Entwicklung verdankt sich nicht nur seiner kompromisslosen Konzentration auf die Arbeit, sondern auch dem gesellschaftlichen Wandel der letzten dreißig Jahre, der mit seiner persönlichen Haltung in Einklang stand.
Bereits mit dreizehn Jahren begann Janecký in der Glashütte seines Vaters in Poděbrady. Die offenen Grenzen ab Mitte der 1990er Jahre ermöglichten ihm längere Studienaufenthalte im Ausland – unter anderem in Afrika, Indien, Alaska und besonders in den USA, etwa an der renommierten Pilchuck Glass School bei Seattle oder im Glasmuseum in Corning. Dort vertiefte er seine Kenntnisse und spezialisierte sich auf das sogenannte *Inside Sculpting* – die freie Formung eines Glaskolbens von innen, direkt am Ofen. Diese Technik, die weltweit nur von zwei weiteren Künstlern auf vergleichbarem Niveau beherrscht wird, ist in Tschechien einzigartig. Janecký hat sie an seine künstlerischen Vorstellungen angepasst und dadurch eine ganz eigene Formsprache entwickelt, die ihn international bekannt machte.
Heute reist er um die Welt, gibt Workshops, demonstriert seine Technik und realisiert eigene Werke. Seine Virtuosität, sein Arbeitsethos und seine eindrucksvollen Ergebnisse stoßen im tschechischen Raum auf große Anerkennung – und werfen zugleich Fragen auf: Wie wird sich sein Weg weiterentwickeln?
Eine mögliche Antwort gab Janecký in seiner Ausstellung STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS. Gezeigt wurden dort unter anderem großformatige Köpfe von Sternguckern, die im Studio Zdeněk Lhotský in Pelechov bei Železný Brod aus geschmolzenem Glas gefertigt wurden. Das Kunstgewerbemuseum widmete dem 1980 geborenen Künstler eine umfassende Werkschau und machte damit sein jüngstes Schaffen einem nationalen wie internationalen Publikum zugänglich.
Architekt: Dušan Seidl
(Redaktion museum.de)
© Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek




FASHION IN BLUE. INDIGO IN JAPANESE AND CZECH TEXTILES THEN AND NOW (2021/22)
Kuratiert von Markéta Vinglerová und Setsuko Shibata zeigt das Prager Kunstgewerbemuseum historische und zeitgenössische Textilien aus Tschechien und Japan, die mit der Indigoblau-Färbetechnik (Shibori) hergestellt wurden.
Yukata vom 19. Jahrhundert bis heute, Katagami-Schablonen und Stoffe veranschaulichen, wie diese traditionelle Technik weiterhin in Kunst und Mode Anwendung findet – in Ost und West. Die Ausstellung beleuchtet das „Japan Blue“ als
kulturelles Symbol und stellt ihm lokale Entwicklungen gegenüber: mährische Volkstrachten, Arbeiten von Lib ě na Rochová aus dem Zentrum für Volkskunst (ÚLUV) sowie Mode von Pavel Ivančic, Alice Klouzková u. a. Installationen von Adéla Sou č ková und Petra Gupta Valentová zeigen zeitgenössische künstlerische Perspektiven.
Architektin: Lenka Míková (Redaktion museum.de)
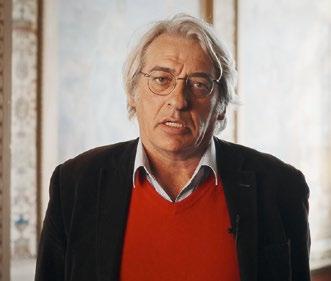
Dipl. Ing. Dušan Seidl
Leiter der Präsentation der Sammlungen
Head of exhibition and publishing department
Herr Seidl ist Autor dieses Artikels und gibt einen Überblick über ausgewählte Ausstellungen der letzten Jahre, bei denen das Mila-wall-System zum Einsatz kam.
Im Rahmen des komplexen Betriebs des historischen Gebäudes steht die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und somit die kurze Aufbauzeit der Ausstellungen sowie deren schnelle Eröffnung im Vordergrund. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein universeller Ausstellungsfundus, den das Museum in den Jahren 2017-19 Schritt für Schritt erwarb. Wir haben uns für das Mila-wall- Stellwandsystem und das LED-Beleuchtungssystem von der Firma Etna entschieden. Beide Systeme haben sich im Ausstellungsbetrieb vielseitig bewährt. Wir verfügen über 700 Wandmodule von verschiedenen Höhen, die meisten 3 und 4 Meter hoch, und Breiten von 1 und 0,5 Metern. Wandmodule von verschiedenen Typen: Standard-, Radien-, Acoustic. Der Lichtpark umfasst 800 Leuchten in vier Grundausführungen, die auf einem festen Schienenraster montiert sind. Dadurch sind wir in der Lage, die komplette Ausstellungsarchitektur inklusive Decken in kurzer Zeit, innerhalb von 2 – 3 Tagen, aufzubauen, zu beleuchten und, nach Beendigung der Ausstellung, innerhalb von 1 – 2 Tagen wieder abzubauen. Aufgrund der Komplexität des Systems kann der Aufbau von Stellwand-Fundus von zwei bis drei Mitarbeitern durchgeführt werden. Die Wandmodule können auch übereinander gebaut werden, um durchgehende Wände mit einer Höhe von bis zu 5 m zu erreichen. Insbesondere dank der robusten Konstruktion und dem umlaufenden Aluminiumrahmen sind die Stellwände nahezu universell einsetzbar.


Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums präsentierte das UPM im Jahr 2020 eine umfassende Ausstellung historischer Hinterglasbilder – fast ausschließlich aus dem eigenen Bestand. Grundlage bildeten jahrelange Forschung und restauratorische Untersuchungen. Gezeigt wurden 135 Werke von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert, darunter Arbeiten von Hans Jakob Sprüngli, dem „Meister VBL“ und Gerhard Janssen. Ein besonderer Fokus lag auf 30 zwischen 2001 und 2017 restaurierten Stücken. Architekt: Dušan Seidl (Redaktion museum.de). © Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek














MAD SILKMAN. ZIKA & LÍDA ASCHER: TEXTILES AND FASHION (2019)
Zika Ascher, geboren 1910 in Prag, war nicht nur ein erfolgreicher Skifahrer, sondern auch Mitbegründer eines Textilunternehmens, das Modegeschichte schrieb. Gemeinsam mit seiner Frau Lida floh er 1939 vor den Nazis nach London. Dort gründeten sie 1942 Ascher (London) Ltd., das bald für innovative Druckstoffe bekannt war. Zika gewann Künstler wie Matisse oder Moore für Entwürfe, die als „Ascher Squares“ weltberühmt wurden. Ihre Stoffe prägten Kollektionen von Dior bis Chanel – ein einzigartiges Zusammenspiel von Kunst und Mode. Architekt: Pavel Mrkus (Redaktion museum.de) Fotos: © Kunstgewerbemuseum in Prag
Die Wände sind leicht zu handhaben und zeichnen sich durch einen einfachen und praktischen Auf- und Abbau aus. Hohe Nachhaltigkeit/Wiederverwendbarkeit, die Wandmodule kommen immer wieder zum Einsatz.
Im Laufe von sieben Jahren haben wir fast fünfzig räumlich sehr unterschiedliche Ausstellungen realisiert. Ich selbst habe beide Systeme, Mila-wall und Beleuchtung, bei über fünfzehn Ausstellungen immer wieder eingesetzt und die Wandmodule dabei oft mit Glaswänden und Vitrinen kombiniert oder daraus Bühnen oder andere Kleinarchitekturen (z. B. Videokabinen für Filmvorführungen von den Acoustic-Modulen) gebaut. Und zwar immer von hohen ästhetischen Qualität.
Davon zeugten Ausstellungen der Hinterglasmalerei, Ausstellungen von Porzellan, historischem Glas, Wandteppichen, Möbeln, Fotografien sowie Ausstellungen zu den Themen Lifestyle, Interieur, Textilien und Mode. Dank des Mila-wall-Systems sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Finanzmittel, die wir für eine herkömmliche Bauweise mit MDF- oder Spanplatten aufwenden müssten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit, Staubfreiheit und einfache Pflege. Immer wieder nutzen wir die Möglichkeit, die Wände mit Farbe zu streichen, um unterschiedliche Oberflächen zu erzielen, jede Ausstellung hat eine andere Farbe.
Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zu den Ausstellungen anzuschauen



KOUDELKA: RETURNING (2018)
Die Ausstellung zeigte eine umfassende Retrospektive zum 80. Geburtstag Josef Koudelkas und würdigte zugleich seine großzügige Schenkung an das Kunstgewerbemuseum in Prag. Architekt: Emil Zavadil (Redaktion museum.de) © Kunstgewerbemuseum in Prag, Fotos: Ondřej Kocourek

Auch bei Messen und Ausstellungsveranstaltungen gewerblicher Art (Designblok) haben wir das Mila-wall-System zur vollen Zufriedenheit eingesetzt. Kompatibel, bei den neuen Entwicklungen, kann die neueste Wandgeneration laufend mit den bereits vorhandenen Wänden kombiniert und der bestehende Fundus ergänzt werden.
Zusammen mit dem universellen Beleuchtungssystem von der Firma Etna, das sich jeder Ausstellung anpasst, trägt das Mila-wall-System maßgeblich zum erfolgreichen und wirtschaftlichen Ausstellungsbetrieb des Kunstgewerbemuseums in Prag bei.
Autor:
Dipl. Ing. Dušan Seidl Leiter der Präsentation der Sammlungen Head of exhibition and publishing department.
MBA-Design & Display Produkt GmbH Siemensstrasse 32 72766 Reutlingen Tel: +49 7121 1606-0 info@mba-worldwide.com www.mila-wall.de
Autorin: Dr. Maren Siegmann. Leiterin Museum in der 'Alten Schule' Efringen-Kirchen
Sie, lieber Leser, haben noch nie von Efringen-Kirchen gehört. Macht nix. Eine kleine Gemeinde (knapp 9.000 Einwohner), ganz im Südwesten Deutschlands, im Kreis Lörrach. So weit im Westen, dass manches deutsche Kartenwerk den Westzipfel der Gemarkung unterschlägt.
Wir sind Naherholungsraum für Basel. Umzingelt von Rhein, Schwarzwald, Vogesen. Ländlich + landwirtschaftlich geprägt, eine Weinbauregion. Südlichstes Ende des Markgräflerlandes. Verkehrsgünstig gelegen, 15 Minuten nach Lörrach, Basel oder Weil am Rhein; 20 Minuten nach Neuenburg am Rhein, 25 nach Müllheim und 40 nach Freiburg im Breisgau. Mit dem PKW, wohlgemerkt, über den ÖPNV decken wir besser das Mäntelchen des Schweigens.
Efringen-Kirchen hat Teilorte: Blansingen, Efringen, Egringen, Huttingen, Istein, Kirchen, Kleinkems, Mappach, Maugenhard,
Welmlingen und Wintersweiler, dazu einige Aussiedlerhöfe und die Engemühle. Efringen und Kirchen bilden zusammen das Ortszentrum.
Alle Ortschaften - auch Efringen und Kirchen - haben ihren dörflichen Charakter bewahrt, jede Ortschaft hat ihren eigenen Charme. Und: jede Ortschaft hat ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Besonderheiten.
Alle Ortschaften zusammen haben ein Museum: das Museum in der 'Alten Schule', untergebracht im Schulhaus von 1912 im OT Efringen. Eröffnet schrittweise ab 1990, ortsgeschichtlicher Schwerpunkt, ein Museum wie viele andere. Notorisch zu wenig Personal, notorisch zu wenig Geld, notorisch zu wenig sonstige Ressourcen. Ein Ort wie viele andere. Aber mordsmäßig viel Geschichte. Gepaart mit Landschaft. Und berühmtem Wein.
Dort, wo es in deutschen Landen am wärmsten ist, mit den meisten Sonnentagen.
Wo sich im Sommer, in den Ferien, am Wochenende massenhaft Leute herumtreiben. Draussen.
Die Museumsleitung (ich) hatte für ein Ausstellungsprojekt 2022/23 ("Rhein spaziert") nach einer Möglichkeit gesucht, Ausstellungsbesucher ins Grüne zu jagen und Leute aus dem Grünen in die Ausstellung zu locken. 2020 noch vergeblich. Aber, mit die Dummen ist Gott, wie es so schön heißt: Ende 2023 kam Stadt.Land.Kultur.
Ich muß in diesem Heft für dieses Projekt keine Werbung machen! Ein virtuelles Freilichtmuseum, die Geschichten am Ort des Geschehens (per Handy und GPS) oder auf dem Sofa (www.museum.de/stadt).
Unten: Blick in die Ausstellung zur Projekt-Ausstellung im örtlichen Rathaus
Rechte Seite: Informationstafeln über das Projekt und beispielhaft zu zwei POI's. © Dr. Maren Siegmann

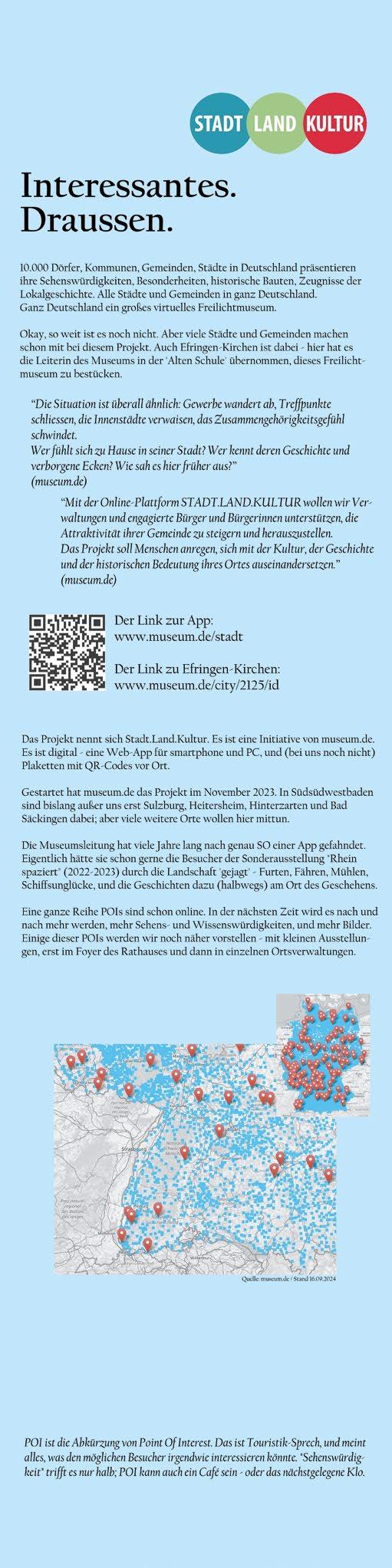
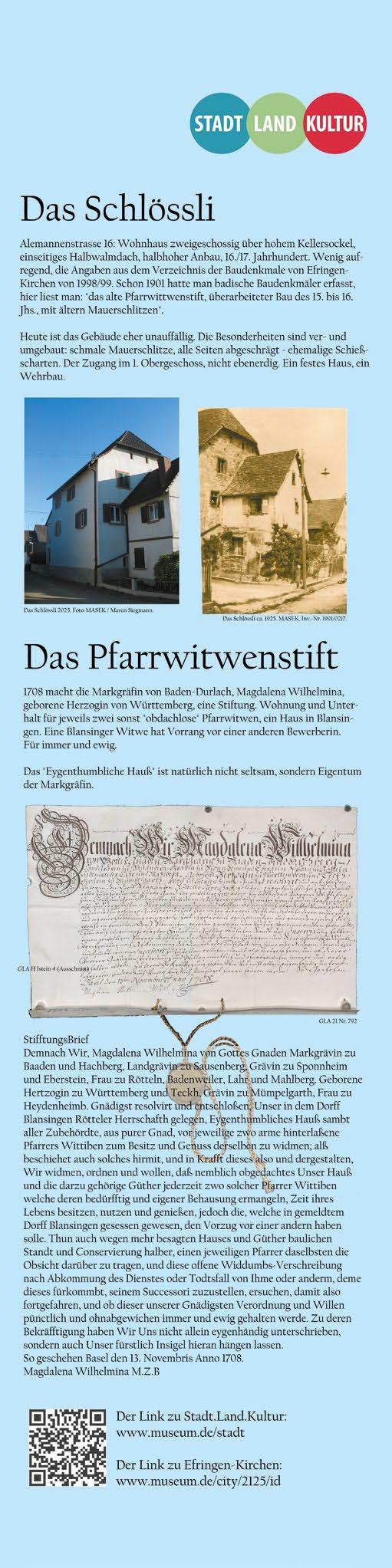
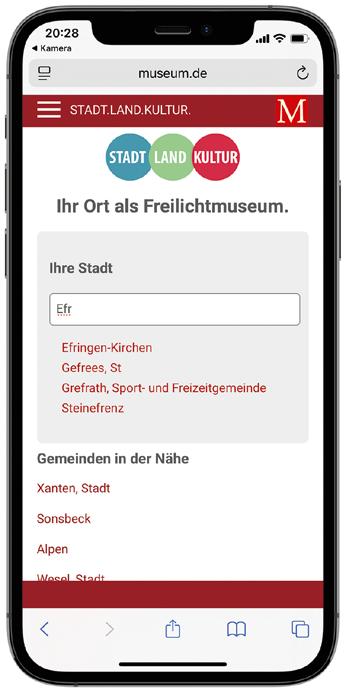
Startseite von STADT.LAND.KULTUR unter www.museum.de/stadt. Hier werden die Orte in der Nähe vom Aufenthaltsort angezeigt. Alternativ dazu kann nach einem Ort gesucht werden.

Exemplarisch: die Startseite von Efringen-Kirchen www.museum.de/city/2125/id Auf der Seite werden die zentralen Adressdaten und ein allgemeiner Text zum Ort angezeigt. Über den blauen Button gelangt man zu den POIs.

Eine Karte und eine Liste mit den POIs darunter geben eine gute Übersicht und Orientierung vor Ort. www.museum.de/p/232
Ein wunderbares Angebot, niedrigschwellig, unkompliziert. Kostenfrei - da fehlen selbst der "kultur-a-phob"sten und geizigsten Gemeindeverwaltung glaubhafte Argumente GEGEN eine Teilnahme am Projekt.
Mit einem Angebot wie Stadt.Land.Kultur. hat man/frau die Chance, eine ganz andere Altersriege zu erreichen, als mit traditionellen Konzepten. Man/frau erreicht auch andere Interessengruppen - Leute, die lieber in der Natur / im Grünen / an der Luft unterwegs sind, anstatt in abgedunkelten Ausstellungsräumen. Stadt.Land.Kultur. ist für Einheimische, Neuzuzügler, Touristen gleichermassen nützlich.
Also, frisch ans Werk gegangen. Die Gemeindeverwaltung dazu gebracht, sich um Zugang zum System und um das Passwort zu kümmern. Grundinformationen zur Gemeinde eintragen. Infos zusammentragen, blauen Himmel für Fotos nutzen, recherchieren, Bilder digitaliseren, Texte schreiben.
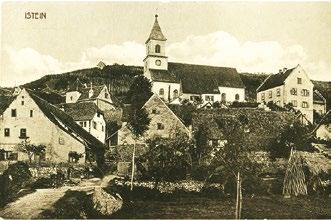
Okay, manche Texte sind etwas lang geraten, aber es MUSS ja niemand alles lesen.
11 Teilorte, davon 10 ehemals selbständig: selbstredend ist frau gut beraten, bei den POIs möglichst paritätisch vorzugehen - Zentralort, jeder Teilort, jede Kirche, jede Kapelle. Auch nach 50 Jahren Zusammen-Gemeindung ist das Eis hier dünn. Jeder Ort soll sich bei Stadt.Land. Kultur. wiederfinden; kein Ort soll den Eindruck haben, unter den Tisch zu fallen (für Maugenhard - gegründet vor 840 und mal Egringen, mal Mappach zugeschlagen - ein
echtes Problem). Ortshistorisch spannendes, unterhaltsames, wichtiges mal hier, mal da, mal dort. Nur wenige Themen habe ich eher en bloc eingetragen: der jüdische Anteil an der Geschichte der Ortschaften Kirchen, Istein und Huttingen gehört dazu.
Andere POIs sind schon lange touristische hotspots. Der Isteiner Klotz, die Isteiner Schwellen sind überregional bekannt und werden auch vom Landkreis und von großen Touristik-Anbietern als Werbe-Lock-Punkte genutzt. Der Isteiner Klotz ist leider auch
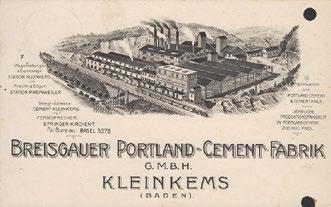

Für jeden POI generiert das System einen QR-Code, den man dazu verwenden kann, vor Ort ein entsprechendes Schild anzubringen. www.museum.de/p/232/104
Historische Postkarten
Mitte: Istein, Unten: Kleinkems-Zement Rechts: Istein Klotzenspitze. © Stadtarchiv
Rechts: Für jeden Ort gibt es eine eigene Homepage sowohl für die Desktop-Ansicht als auch optimiert für die Nutzung mit dem Smartphone. Für Efringen-Kirchen: www.museum.de/city/2125/id
ein Kokolores-hotspot: seit dem frühen 19. Jh. wurde zur Burg Istein, zur Veitskapelle, zum Frauenkloster viel Blödsinn erzählt; ungenügend recherchiert bzw. frei erfunden, immer wieder abgedruckt und nachgeplappert, auf Tafeln gedruckt und in Bronze gegossen.
Überhaupt, Tourismus. Ist bei den Einheimischen eher unerwünscht. Die wirtschaftlichen Effekte sind übersichtlich - weil schon das Ergattern einer Tasse Kaffee am Sonntag nachmittag eine echte Herausforderung sein kann. Viele Gemeindeverwaltungen im
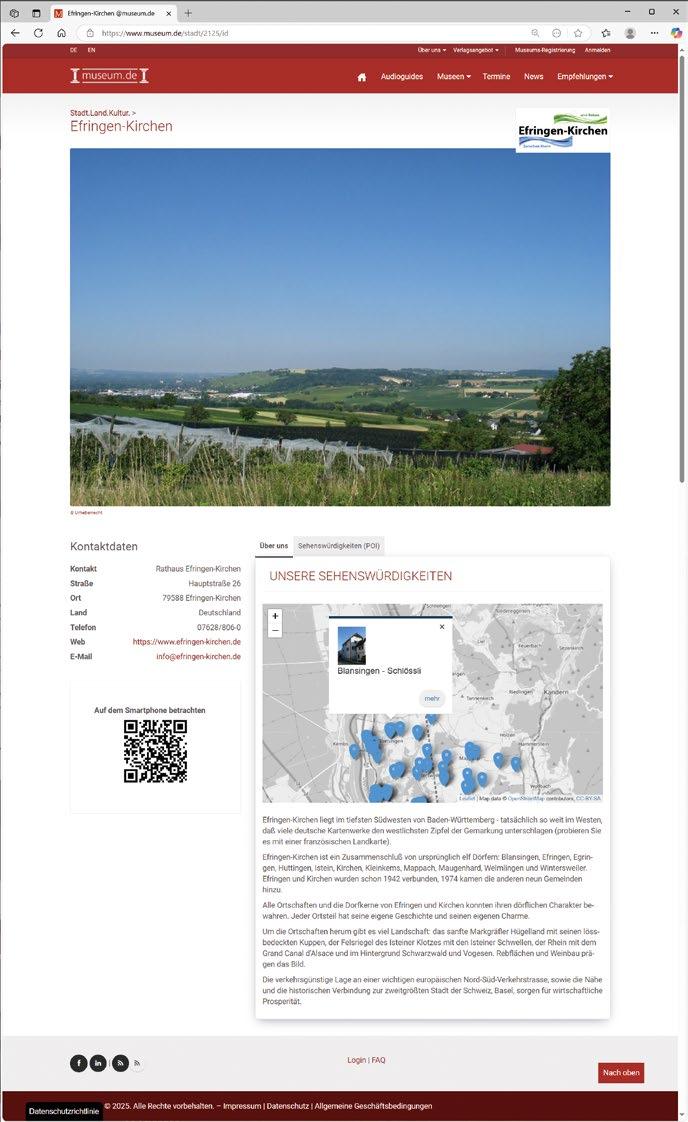
Landkreis und drumherum denken + agieren nur bis an die eigene Gemarkungsgrenze. Ein gemeinsames überregionales Tourismus-Konzept oder gar eine gemeinsame Touristik-Zentrale gibt es nicht. Touristen und solche, die es werden wollen, bleibt www.schwarzwald-tourismus.info. Wir sind aber nicht der Schwarzwald, wir sind das Markgräflerland. Schwarzwald-tourismus. info setzt keinerlei links auf andere Websites und hat z.T. völlig absurde "Infos" zu unseren POIs. Vielleicht ist Besserung in Sicht - der Landkreis Lörrach arbeitet an einem neuen Tourismus-Konzept ...
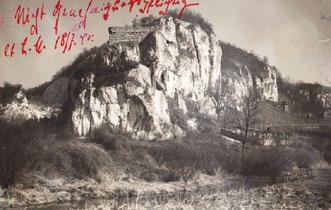
Neuzuzügler! Diese Leute sind meist jung, haben oft Kinder, sind über die Kids oft gut miteinander vernetzt. Viele Neuzuzügler

Historische Postkarte: Pritsche. © Stadtarchiv Efringen-Kirchen
möchten ihre neue Umgebung wirklich kennenlernen. Mit Stadt.Land.Kultur. gibt es eine echte Chance, mit dieser Zielgruppe in Kontakt und ins Gespräch zu kommen.
Das Stadt.Land.Kultur.-Portefolio von Efringen-Kirchen kann sich inzwischen sehen lassen. Begleitend zum Online-Angebot erarbeite ich kleine Sonderausstellungen im Foyer des Rathauses. Die dritte Mini-Ausstellung (Schlössli Blansingen) steht, die nächste ausführlicher vorzustellende Besonderheit soll die Alte Landstrasse von Basel nach Frankfurt am Main sein. Nebenher wollen noch Stapel an Werbe-Postkarten verteilt werden.
Schaut man die Karte der Mitmach-Orte an, ist der Südwesten von Baden-Württemberg deutlich unterrepräsentiert. Nicht täuschen lassen: wir Museumsleute sind hier sehr gut vernetzt - Museumsnetzwerk, Museums-Pass-Musées, Netzwerk der Geschichtsvereine, regelmäßige Treffen der Kollegen aus Museen und Archiven am südlichen Oberrhein. Trinational - deutsche, schweizer, französische Kollegen und Kolleginnen. Die Einladungen zum Projekt Stadt.Land.Kultur. waren an die Stadt-/Gemeindeverwaltungen verschickt worden. Und sind irgendwo im Posteingangs-Umlauf versackt. Und haben die Kollegen, die das Projekt vor Ort mit Leben hätten füllen, nicht erreicht. In einigen Orten wird auch schlicht eine andere Plattform genutzt.
Ich bin jedenfalls sehr froh um Stadt.Land. Kultur. und um die Möglichkeiten, die es bietet. In "meinen" elf Ortschaften stecken noch viele Geschichten drin! Bei uns kreu-
zen sich durch alle Zeiten wichtige NordSüd und Ost-West-Verkehrskorridore. Vom Mittelmeer zur Nordsee, vom Schwarzen Meer an den Atlantik. Flüsse, Straßen, Kanäle, Schleichwege. Ohne Ende Leute von hier nach dort, nette Leute, übles Volk, Soldateska. Durchreisende, Einheimische, Hängengebliebene.
Ich bin ebenfalls sehr froh um die Unterstützung durch die verschiedenen Archivverwaltungen. Besonderer Dank gilt dem Landesarchiv Baden-Württemberg, aber auch das Staatsarchiv Basel-Stadt und das Archiv des ehemaligen Fürstbistums Basel ist hier zu nennen. Karten, Bilder, Archivalien für die jeweiligen POIs nutzen zu können und online stellen zu dürfen ist großartig und keinesfalls selbstverständlich!
In vielen Gemeinden - nicht nur in Efringen-Kirchen - stehen die kleinen Museen auf dem Prüfstand. Reichen die Ressourcen für eine 'anständige' Museumsarbeit nicht aus (wie bei mir), gibt es mit Stadt.Land.Kultur. ein Projekt mit Außenwirkung. Ich hoffe, daß mir Stadt.Land.Kultur. helfen wird, das Museum zu erhalten und zumindest einen Teil der Museums-Sammlung vor der Müllkippe zu retten.
Museum in der 'Alten Schule' Efringen-Kirchen Dr. Maren Siegmann Nikolaus-Däublin-Weg 2 79588 Efringen-Kirchen museum@efringen-kirchen.de 07628/8205 (Mo-Mi 8-12, Mi 14-18 Uhr) Die Dauerausstellung des Museums ist seit 2023 geschlossen.
Einladung museum.de – Ein Freilichtmuseum für jeden Ort in Deutschland
museum.de. Als Initiator des Projektes STADT.LAND.KULTUR möchten wir uns ausdrücklich für den wertvollen Input von Frau Dr. Siegmann aus Efringen-Kirchen bedanken. In akribischer Recherche hat die Museumsleiterin die Lokalgeschichte in Text und Bild zusammengetragen und im Datenpflegebereich von museum.de als digitales Kulturangebot angelegt.
Bereits 2023 hat museum.de die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 10.757 Gemeinden postalisch angeschrieben, um zur kostenlosen Teilnahme einzuladen. In dem Anschreiben enthalten war ein individueller Aktivierungslink für jeden Ort. Viele Bürgermeister sind der Einladung gefolgt und haben dieses Anschreiben an die örtlichen Museen, Heimatvereine und Experten der lokalen Geschichte weitergeleitet. Sie haben das Wissen zu lokalen historischen Bauten und Sehenswürdigkeiten, Zeugnisse der Stadtgeschichte und Traditionen, um sie als POI (Points of Interest) in eine interaktive Karte einzutragen. Im Zusammenspiel mit mit sämtlichen Gemeinden entsteht so eine einzigartige und bundesweite digitale Kulturkarte. Die so eingegebenen Informationen sind jederzeit auch vor Ort per Smartphone abrufbar. Nutzen Sie die Möglichkeit u.a. auch, um zum realen Besuch Ihres Museums einzuladen. Die Startseite zu Ihrem Ort finden Sie unter www.museum.de/stadt.
Alternativ kann die Präsenz auch als Audioguide umgesetzt werden. Hier bieten wir die Möglichkeit, vertonte Sprachbeiträge hochzuladen oder die angelegten Stationstexte diekt über unsere ultrarealistischen KI-Stimmen sehr günstig in verschiedene Sprachen (inklusive Übersetzungen durch DeepL) zu vertonen.
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne ihren lokalen Aktivierungslink zu.
Detaillierte Infos zum Projekt: www.museum.de/stadt-land-kultur
museum.de
Ansprechpartner: Uwe Strauch Ostwall 2, 46509 Xanten
Tel. 02801-9882072, contact@museum.de
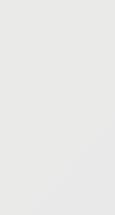
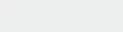
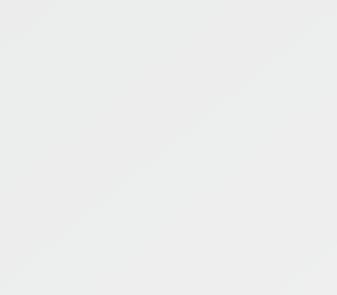












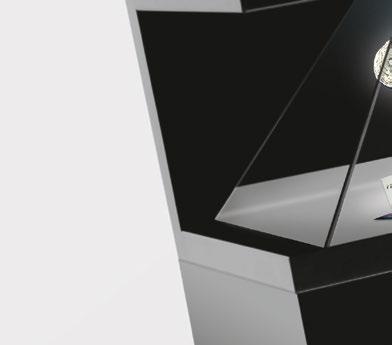













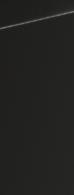
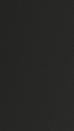












Ausstellung vom 6. Juni 2025 - 12. April 2026 im Zeppelin Museum Friedrichshafen
Wie transportieren Bilder Macht? Wie tragen sie zur Konstruktion von Geschichte bei? Wie manipulieren sie uns?
Die Ausstellung Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus untersucht erstmals umfassend den Zeppelin als Motiv in der Fotografie. Sie setzt damit einen neuen Ausgangspunkt in der Auseinandersetzung mit der visuellen Geschichte des Luftschiffs und zeigt, wie das Bild des Zeppelins im Kaiserreich, der Weimarer Republik und der NS-Diktatur als Werkzeug politischer Propaganda eingesetzt wurde. Als Sinnbild für die Eroberung des Himmels, technologische Überlegenheit, militärische Macht und globale Vernetzung wurde es zum Träger eines imperialen Machtanspruchs. Anhand dieser gezielten medialen Inszenierung stellt das Zeppelin Museum mit Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus die hochaktuelle Frage nach der Macht der Bilder.
Zeitgenössische künstlerische Positionen greifen das historische Bildmaterial auf und arbeiten mit dem Bildarchiv des Museums. Die Künstler*innen Aziza Kadyri, Christelle Oyiri und das Kollektiv Ebb.global & Neïl Beloufa dekonstruieren tradierte Narrative, stellen deren visuelle Sprache infrage und drehen das Archiv im übertragenen Sinne auf links. Sie fordern so den kritischen Umgang mit der Bildgeschichte des Zeppelins, der neue Perspektiven eröffnet.
sucht, wie Bilder des Zeppelins im Laufe des 20. Jahrhunderts dazu verwendet wurden, um ideologische Botschaften zu transportieren und die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Denn zwischen 1900 und 1940 wurde der Zeppelin zum Symbol für die Eroberung des Himmels, militärische Überlegenheit, technische Innovation und globale Vernetzung stilisiert. In allen drei politischen Systemen seiner Zeit - dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und der NS-Diktatur - diente das Bild des Luftschiffs als machtvolles Propagandamittel, das die
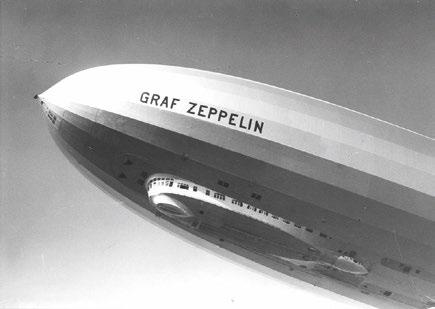
westlichen Blickregimen und entzieht sich der Deutung des Zeppelins als Sinnbilld für Macht, Maskulinität und Fortschritt. Das Kollektiv Ebb.global & Neïl Beloufa widmet sich der Untersuchung propagandistischer Logiken, indem sie den Zeppelin als Propaganda-Maschine entlarven. Ihre Arbeit nutzt KI als Werkzeug, um die Mechanismen der Macht visuell zu übersteigern und satirisch zu hinterfragen. In einer interaktiven Installation wird das Publikum direkt in diese kritische Auseinandersetzung eingebunden. Christelle Oyiri fokussiert sich auf die Inszenierung von Bild- und Medienmacht und untersucht die Reizüberflutung der Rezipient*innen durch visuelle Strategien, die aus der Popkultur stammen. Ihre Arbeit thematisiert auch anhand des Hindenburg-Unglücks die dramatische Wirkung von Bildern, die gleichzeitig in ihrer Ästhetik und ihrer suggestiven Macht überfordernd wirken. Sie stellt so die Frage nach der Verantwortung der Medien und ihrer Bildproduktion.
Darüber hinaus wird der Blick auf Bilder als Informationsträger geschärft. Thematisiert werden deren Wahrheitsgehalt sowie die Methoden und Strategien der Bildmanipulation. Ziel der Vermittlungsarbeit des Museums ist es, die Medienkompetenz der Besucherinnen und Besucher zu fördern und den reflektierten Umgang mit Bildern zu stärken.
Die Ausstellung zeigt den einzigartigen Bestand historischer Fotografien aus dem Archiv des Zeppelin Museums. Sie unter-
politischen Ziele der jeweiligen Regierungen unterstützte und die Bevölkerung für die Vision einer aufstrebenden, machtorientierten Nation zu gewinnen versuchte. Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus legt in Zeiten von Deepfakes und Desinformation die Parallelen dieser systematischen Instrumentalisierung der Bilder offen und zeigt die Kontinuität strategischer Machtvisualisierungen.
Ergänzt wird die Ausstellung durch neue Werke der international tätigen zeitgenössischen Künstlerinnen Aziza Kadyri, Christelle Oyiri und des Kollektivs Ebb.global & Neïl Beloufa. Diese Arbeiten entstehen in Auseinandersetzung mit der einzigartigen Fotosammlung des Zeppelin Museums und eröffnen neue Perspektiven auf sie. Aziza Kadyri deutet den Zeppelin als mythisches Wesen um. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) löst sie sich von
Im Dialog mit den historischen Exponaten dekonstruieren die künstlerischen Positionen visuelle Herrschaftsstrategien, hinterfragen die Bedeutung nationaler Symbole und öffnen das Bildarchiv für marginalisierte Perspektiven. Jede der Arbeiten trägt dazu bei, ein differenziertes Verständnis von Bildproduktion und traditionellen Bildregimen zu entwickeln und regt dazu an, die Bedeutung und Instrumentalisierung von Bildern kritisch zu hinterfragen.
Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus bietet nicht nur einen tiefgehenden Einblick in die Geschichte der Zeppelinfotografie, sondern fordert auch eine Reflexion über die heutige Bildkultur und die Macht visueller Medien. Sie zeigt, wie Bilder seit
Links: Anonym, LZ 127 Graf Zeppelin in Fahrt, 1931
Rechts: Unbekannter Fotograf: Das Luftschiff LZ 130 Graf Zeppelin über der Werft in Friedrichshafen, 1938
Fotos: © Zeppelin Museum Friedrichshafen

jeher als Werkzeuge der Machtausübung dienten – und auch heute noch unsere Wahrnehmung und Interpretation der Welt prägen.
Ausstellungskonzeption
Mit Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus beleuchtet das Zeppelin Museum in sechs Kapiteln verschiedene Facetten der Geschichte des Zeppelins und seiner Inszenierung in der Fotografie: überwältigend, instrumentalisiert, innovativ, verführerisch,

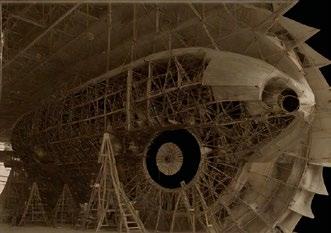

zerstörerisch und erschütternd. Dabei rückt sie sowohl technologische, politische und kulturelle Aspekte in den Fokus, als auch die emotionale Dimension affektbeladener Bilder.
Überwältigend − Der erste Zeppelinaufstieg im Jahr 1900 wurde als symbolischer Beginn einer neuen Ära gefeiert, in der der Zeppelin als Projektionsfläche für Zukunftsträume und technologische Utopien diente. In der Fotografie wurde der Zeppelin nicht nur als technisches Wunder, sondern auch als Symbol für nationale und politische Macht inszeniert. Die Fotografien, oft

gezielt manipuliert, trugen dazu bei, das Bild des Zeppelins als überlegene Technik und unaufhaltsames Zukunftsversprechen zu verbreiten. Die Künstlerin Aziza Kadyri nutzt in heutige Techniken, um diese historischen Darstellungen in neue Bildwelten zu überführen, die oft auch bislang vernachlässigte weibliche Perspektiven der Zeppelin-Geschichte darstellen.
Instrumentalisiert − Ab dem Kaiserreich wurden die Zeppeline gezielt für politische Propaganda genutzt. Sie dienten als Symbole nationaler Identität und wurden im Kaiserreich, der Weimarer Republik und
dem Nationalsozialismus als Ausdruck von Stärke und Machtanspruch verwendet. Insbesondere im Nationalsozialismus wurde der Zeppelin als Teil der Propagandamaschinerie genutzt, um das Bild eines überlegenen und fortschrittlichen Deutschlands zu fördern,
Linke Seite, links und mitte: © Ebb.global & Neïl Beloufa, mock ups of AI generated images based on a dataset of zeppelin images from the Zeppelin Museum, work in progress, 2024.
Unten: Unbekannter Fotograf: Das Gerippe des LZ 6 wird von der festen Halle in die schwimmende Halle in der Manzeller Bucht transportiert, 1909. © Zeppelin Museum Friedrichshafen




Wandsystem stark, für , Showrooms und Büro. In Modulbauweise Exzenterverbindern aufzuWandsys40mm und umlaufend mit Museum, Messe, Galerie und Showrooms.





G40 CLASSIC

Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.


Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

G40 QUICK
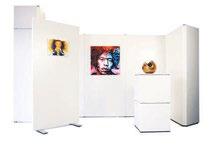







modulares für Büro und Messe. Die einzelnen Moduindividuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug,



Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern . Ideal für Stadthallen, Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabschnell werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.















stabiel auf- und abzubauen mit Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für
G40 CLASSIC
G40 QUICK
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.
Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.


G40 QUICK
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.










Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.
Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.
G19 YOGA
G19 YOGA
RAUMBOX®
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration. RAUMBOX®
Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.

G19 YOGA
G19 EDGE

G19 YOGA
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.




19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.
G40 MÖBEL
G19 EDGE
G40 MÖBEL
G19 EDGE
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.
G40 MÖBEL
G40 MÖBEL
Wandsysteme in Leichtbau ® www.gilnhammer.de
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de
Leichtbau
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de
Wir sind Hersteller von Wandsystemen für MuseMessebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir

während gleichzeitig die Gewaltpolitik des Regimes kaschiert wurde. Wie leicht sich Bilder heute propagandistisch aufladen lassen, zeigt das Kollektiv Ebb.global & Neïl Beloufa in einem KI-Experiment, bei dem Besucher*innen eigene Bilder generieren und als Postkarten verschicken können.
Innovativ − Der Zeppelin entwickelte sich in seiner 40-jährigen Geschichte stetig weiter. Verbesserungen und die Erprobung neuer Technologien wurden durch Fotografien dokumentiert, die den Zeppelin als Symbol für den Fortschritt darstellten. Die Presse nutzte diese Bilder, um den Zeppelin als unverzichtbares Element der Zukunft zu positionieren und den Marktwert des Zeppelin-Konzerns zu steigern.
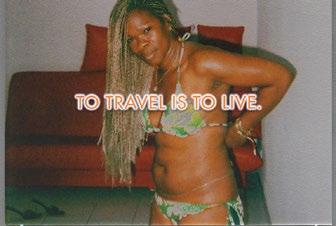

Verführerisch − Die Weltfahrten und Passagierflüge der Zwischenkriegszeit stilisierten den Zeppelin als Vision einer besseren, friedlicheren Zukunft, in der Technologie als Verbindungselement zwischen Nationen fungierte. Gleichzeitig spiegelte seine Darstellung als „Eroberer“ ferner Länder und Kulturen koloniale und eurozentristische Ansprüche wider. Erst jüngere bildwissen-
schaftliche Ansätze erlauben eine kritische Neubewertung solcher Bildpolitiken und die Offenlegung ihrer ideologischen Rahmungen.
Zerstörerisch − Noch vor ihrem realen Kriegseinsatz wurden Zeppeline durch Bilder zu Symbolen technischer und militärischer Überlegenheit. Fotografien in-
szenierten sie als bedrohliche Maschinen zur Einschüchterung der Gegner und zur Mobilisierung der eigenen Bevölkerung. Die wenigen zugänglichen Bilder vermitteln keine Kriegserfahrung, sondern eine Ästhetik der Technik – distanziert, entmenschlicht, ideologisch aufgeladen.


Erschütternd − Der Absturz der Hindenburg 1937 symbolisierte das Ende des Zeppelinzeitalters. Die Bilder der brennenden Hindenburg prägten die globale Erinnerung. Der Unglücksfall wurde zum Sinnbild des Scheiterns von Technologie und Macht. Rückblickend wirkt er auch als Gegenerzählung – als Bild des Kontrollverlusts und dem Zusammenbruch eines vermeintlichen Überlegenheitsanspruchs. Christelle Oyiris Arbeit Sky is the Limit greift den Absturz als Sinnbild eines machtpolitischen Scheiterns auf und untersucht den Wandel technischer Symbole in der kollektiven Wahrnehmung.
Mit der Ausstellung Bild und Macht verfolgt das Zeppelin Museum seinen musealen Bildungsauftrag – und rückt die Förderung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt seiner Vermittlungsarbeit. In einer Zeit, in der Jede*r andauernd Bilder produziert, verbreitet und manipuliert, ist der kritische Umgang mit medialen Inhalten wichtiger denn je. Medienkompetenz bedeutet, Bilder nicht nur lesen, sondern sie auch in ihrem historischen, technologischen und politischen Kontext reflektieren zu können.
In vier Stationen beleuchtet das Museum deswegen zentrale Aspekte der Bildmacht: von der Geschichte fotografischer Manipulation über technische Grundlagen und Bildentwicklung bis hin zu Fragen der Archivierung und Zugänglichkeit. Die Ausstellung vermittelt dabei nicht nur Wissen, sondern auch Handlungskompetenz – etwa das Erkennen von Fakes und Fakenews, interaktiv erfahrbar mit dem „Fakefinder“ des SWR.
Besondere Relevanz erhält das Thema durch die Anbindung an schulische Bildungspläne des Landes Baden-Württemberg und
Linke Seite, oben: LZ 56/LZ 86 am Landeplatz in Königsberg, Winter 1915/1916
Mitte: Filmstill Bild und Macht: Christelle Oyiri
Beide Fotos: © Zeppelin Museum Friedrichshafen
Unten: Christelle Oyiri, VENOM VOYAGE, gta exhibitions, 2023
© Images: Andrea Rossetti
Rechte Seite, oben: Anonym, Aushallen aus der Werfthalle III, ohne Jahr
© Zeppelin Museum Friedrichshafen
Unten: © Ebb.global & Neïl Beloufa, mock ups of AI generated images based on a dataset of zeppelin images from the Zeppelin Museum, work in progress, 2024

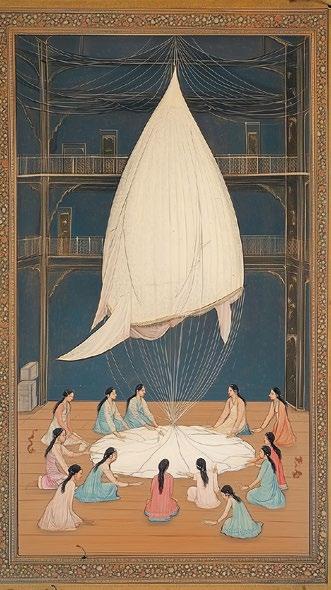

aktuelle gesellschaftliche Diskurse rund um Künstliche Intelligenz. Mit Workshops in der eigenen Dunkelkammer, inklusiven Stationen für Sehbeeinträchtigte und einem erweiterten Vortragsprogramm schafft das Zeppelin Museum Räume für kritischen Dialog – und macht Medien- und Digitalkompetenz zu einem erlebbaren Teil politischer Bildung.
Bild und Macht. Zeppelin-Fotografie im Fokus wird unter anderem von der Baden-Württemberg Stiftung und der ZF Kunststiftung gefördert.
Chronologie: Die Geschichte der Bildmanipulation
Eine dreiteilige Zeitachse führt durch die Geschichte der Fotografie, der Bildmanipulation und der Künstlichen Intelligenz. Die Station zeigt, wie technische Entwicklungen schon immer die Wahrnehmung von Wahrheit beeinflusst haben – von den Anfängen der Fotografie über klassische Bildretuschen bis hin zu heutigen Deepfake-Technologien.

In Anlehnung an Wolfgang Kemps Theorie der Fotografie erzählt die Chronologie die Geschichte der Fotografie als Geschichte ihrer Manipulation.
Werkstatt: Wie Bilder entstehen – und manipuliert werden
Die „Werkstatt“ bietet einen praktischen Zugang zu Fotografie und Bildbearbeitung. Besucher*innen können die Grundlagen fotografischer Techniken kennenlernen –etwa durch das Arbeiten in einer analogen Dunkelkammer, wo schon Bildausschnitt oder Belichtung die Bildwirkung entscheidend beeinflussen. Digitale Anwendungen wie der „Fakefinder“ des SWR erweitern das Angebot um interaktive Elemente. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen hier, manipulierte Bilder zu erkennen und kritisch zu hinterfragen.
Die Macht des Archivs: Wer sammelt, ordnet – und entscheidet?
Ein vertiefender Blick auf das Archiv als Machtinstanz: Jedes Ausstellungskapitel
Links: Mock up of AI generated images based on a dataset of Zeppelin images from the Zeppelin Museum, work in progress, 2024. © Aziza Kadyri
Unten: Rolf Carl: LZ 127 Graf Zeppelin über dem Bürgenstock, im Hintergrund der Pilatus, 1932
Rechts: LZ 56/LZ 86 am Landeplatz in Königsberg, Winter 1915/1916. Fotos: © Zeppelin Museum Friedrichshafenx
wird durch eine reflexive Auseinandersetzung mit dem „Archiv“ ergänzt. Die Stationen zeigen, wie Archive als Orte der Wissensspeicherung und -strukturierung funktionieren – und welche gesellschaftlichen Ausschlüsse sie inhärent reproduzieren. Gleichzeitig wird das Archiv auch als potenzieller Ort des Widerstands sichtbar, an dem alternative Ordnungen und Erzählungen entstehen können. Die kritische Betrachtung des Archivs sensibilisiert für dessen Rolle in der Konstruktion von Geschichte.
Inklusion und Zugang: Medienkompetenz für alle
Barrierefreiheit und Teilhabe stehen im Zentrum dieser Station. Kapitelbilder werden durch Tastbilder für sehbehinderte Menschen zugänglich gemacht, unterfahrbare Stationen erleichtern die körperliche Zugänglichkeit. Ergänzt wird das Angebot durch Audiodeskriptionen in Form des begleitenden Podcasts „Sag mir, was du siehst!“. Medienkompetenz bedeutet für das Zeppelin Museum auch, Zugang zu schaffen – unabhängig von körperlichen Voraussetzungen.
Zeppelin Museum Friedrichshafen
Seestraße 22, 88045 Friedrichshafen Tel. +49 (0) 7541 3801-0 info@zeppelin-museum.de www.zeppelin-museum.de

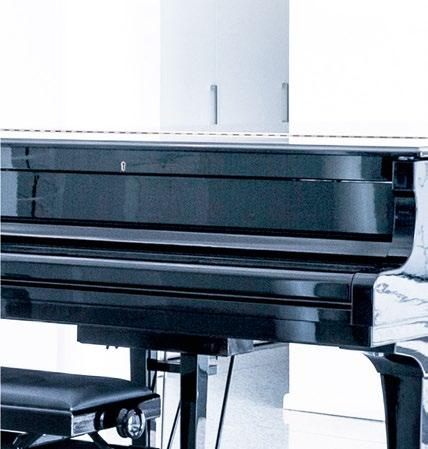


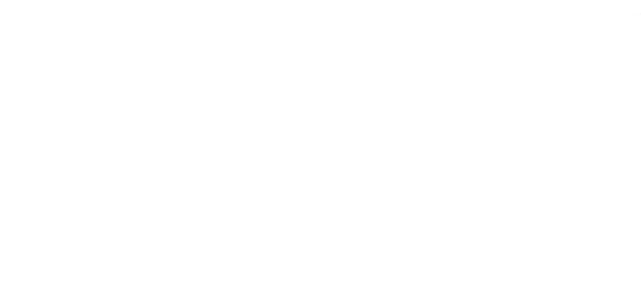




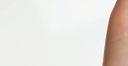









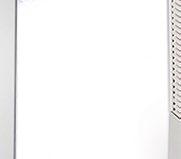


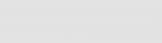























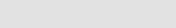
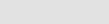


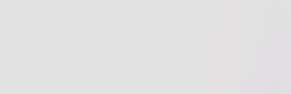








Foto: National History Museum, London. © pixabay.com

Digitale Angebote, die sich zurücknehmen – und gerade dadurch überzeugen
In der musealen Vermittlung erlebt das Digitale derzeit einen Popularitätsschub. Doch mit dem Trend zur Digitalisierung droht auch die Gefahr, dass Technik sich zu sehr in den Vordergrund drängt – und der eigentliche Protagonist in Vergessenheit gerät: das Exponat. Genau hier setzt das Konzept von museum.de an. Ziel ist nicht, den Museumsbesuch mit Technik zu überfrachten, sondern ihn sinnvoll zu unterstützen. Der Audioguide wird zum dezenten Begleiter – nicht zum Hauptdarsteller.
Smartphone ja – aber richtig
Sicherlich kann ein Film auf dem Smartphone eine gotische Kathedrale in einer Animation beeindruckend erklären. Doch während der Gast auf das Display blickt, verliert er den Bezug zum Raum. Der Blick geht ins Gerät – nicht aufs Bauwerk. Deshalb verfolgt museum.de eine klare Philosophie: So wenig Ablenkung wie möglich, so viel Kontext wie nötig.
Das eigene Smartphone dient als technisches Medium – ohne Leihgeräte, ohne App-Installation, ohne Anleitung. Eine einfache browserbasierte Lösung, die auf jedem internetfähigen Endgerät funktioniert, genügt. Das reduziert den technischen Aufwand auf Seiten des Museums auf ein Minimum. Besucherinnen und Besucher hingegen profitieren von einem reibungslosen Zugang. In vielen Fällen informieren sie sich ohnehin im Vorfeld über Öffnungszeiten und Angebote – wenn der Audioguide klar kommuniziert wird, kommen sie vorbereitet und mit geladenem Smartphone.
bereithalten – Smartphones im sogenannten Kiosk-Modus, bei dem die Nutzung auf eine einzige, vorab geöffnete Anwendung beschränkt ist. Auch hierfür bietet museum.de eine passende Lösung.
Das Ende des klassischen Audioguide-Leihsystems
Die herkömmlichen Audioguide-Leihgeräte – jahrelang Standard in Museen – haben sich spätestens seit der Corona-Pandemie als problematisch erwiesen: Hygienevorgaben, regelmäßige Desinfektion, Akkuladung, Reparaturanfälligkeit und hoher personeller Aufwand machen sie zunehmend unattraktiv. Zudem sehen viele Besucher die gemeinsame Nutzung solcher Geräte kritisch – auch wenn sie äußerlich hygienisch einwandfrei erscheinen.
Der Audioguide als Bestandteil vom Gesamtkonzept von museum.de und museum.com

Der Audioguide von museum.de und das neu hinzugekommene internationale Museumsportal unter museum.com steht nicht für sich allein, sondern ist Teil eines kohärenten Gesamtkonzepts. Ursprünglich als Online-Verzeichnis gegründet, ermöglicht museum.de seit fast zwei Jahrzehnten den Museen, ihre Stammdaten, Informationen zur Barrierefreiheit, Serviceangaben, Nachrichten und Veranstaltungen eigenständig und kostenlos zu pflegen. Das System ist so benutzerfreundlich, dass Mitarbeitende in Museen nach einmaliger Einarbeitung effizient alle Inhalte eigenständig verwalten können.

Namen eines Museums googelt, stößt in der Regel auf den direkten Link zur Profilseite bei museum.de – häufig auf der ersten Trefferseite.
Auch das MAGAZIN MUSEUM.DE, das als hochwertige Drucksache und Online kostenlos verbreitet wird, ist Teil dieses Konzepts. Es finanziert das gesamte Projekt mit und stärkt die Sichtbarkeit der teilnehmenden Häuser. So ergibt sich ein Modell, das gleichermaßen die digitale Präsenz wie auch die reale Besuchserfahrung in den Mittelpunkt stellt – mit dem Audioguide als nahtlos eingebundenem Element.
Für Situationen, in denen Besucher kein eigenes Gerät dabei haben, kann das Museum einige wenige, kostengünstige Leihgeräte
Diese langfristige Konsistenz und die permanente Weiterentwicklung haben dazu geführt, dass museum.de bei der Onlinesuche nach Museen eine überdurchschnittliche Sichtbarkeit erreicht: Wer den
Vom App-Modell zum browserbasierten Zugang
Ursprünglich startete museum.de mit einem App-Modell für Audioguides. Doch die Nut-

zererfahrung und die Rückmeldungen aus den Museen führten zu einem klaren Strategiewechsel: Heute setzt man konsequent auf eine browserbasierte Lösung. Der Vorteil liegt auf der Hand: Keine Installation, keine Updates, keine technische Einstiegshürde. Und: keine laufenden Folgekosten, wie sie bei Apps durch Betriebssystem-Updates, Gerätekompatibilitäten oder Sicherheitsanpassungen entstehen können.
Zwar könnten Apps grundsätzlich mehr technische Möglichkeiten bieten – etwa Augmented Reality –, doch bewusst verzichtet museum.de auf solche Features. Die technische Zurückhaltung ist hier keine Einschränkung, sondern eine bewusste Entscheidung zugunsten einer fokussierten Besucherführung. Das Ziel: Der Blick soll auf die Exponate gelenkt werden, nicht auf das Display.
Orte mit digitalem Mehrwert
Ein weiterer zentraler Aspekt: museum.de versteht Museen als reale, gesellschaftlich bedeutsame Orte. Entsprechend werden rein virtuelle Museen im Verzeichnis von museum.de nicht aufgenommen. Denn gemäß ICOM umfassen die Kernaufgaben eines Museums das Forschen, Sammeln, Bewahren und Vermitteln – Aufgaben, die aus heutiger Sicht einen realen Ort erfordern.
Museen sind Räume der Begegnung, der Reflexion, des Austauschs – Orte, an denen Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungshintergrund zusammenkommen können. Der Begriff „Museum“ sollte daher nicht beliebig verwendet werden – etwa für eine private Briefmarkensammlung auf einer Website.
Audioguide als Türöffner zum echten Erlebnis
Digitale Angebote, wie die Audioguides oder virtuelle Rundgänge, können jedoch sehr wohl Interesse wecken und als Entscheidungshilfe dienen – insbesondere für Besucherinnen und Besucher mit weiter Anreise. Ein kluger Einsatz digitaler Medien außerhalb des Museums kann neugierig machen und den Wunsch wecken, die Originale vor Ort zu sehen. So wird der Audioguide von museum.de zum Vermittler zwischen digitalem Erstkontakt und realer Museumserfahrung – niederschwellig, funktional und eingebettet in ein etabliertes Gesamtsystem.
Fotos: National History Museum, London © pixabay.com

Beispiel: Stavenhagen Audioguide und VR-Tour www.museum.de/m/1854
PREMIUM AUDIOGUIDE oder AUDIOGUIDE HOSTING ?
Für Besucher macht es keinen Unterschied: Beide Lösungen ermöglichen den einfachen Zugang zu Ihrem Audioguide – im Museum, draußen oder online über museum.de und museum.com. Die Unterschiede liegen in der Umsetzung.
PREMIUM AUDIOGUIDE –Professionell von A bis Z
Der PREMIUM AUDIOGUIDE ist ein Full-Service-Angebot von museum.de. Alles beginnt mit einem Beratungsgespräch und einem maßgeschneiderten Konzept. Danach folgt ein Vor-Ort-Termin mit unserer Redaktion zur Sichtung von Quellen und Abstimmung der Inhalte. Das komplette Produktionspaket umfasst:
• Redaktionelle Erstellung der Audioskripte
• Übersetzungen durch Muttersprachler
• Tonaufnahmen im Studio mit professionellen Sprecher\*innen
• Technische Abmischung durch erfahrene Toningenieure

Die Audiostationen können per Auswahlliste, einem Grundrissplan, einer Nummernsuche oder über den QR-Code-Scan aufgerufen und gestartet werden

Für virtuelle 3D-Rundgänge können die bereits vertonten Audiofiles an den entsprechenden Stellen im Rundgang eine Wiederverwendung finden
Zum Schluss stellen wir alle Inhalte auf museum.de bereit und liefern für jede Station ein QR-Code-Schild im Postkartenformat – für sofortiges Hören vor Ort.
AUDIOGUIDE HOSTING –Eigenständig und flexibel
Beim AUDIOGUIDE HOSTING verwalten Sie Ihre Audioguides selbst. Ideal für Museen, die bereits über Audioinhalte verfügen oder neue Inhalte eigenständig erstellen möchten. Sie können:
• Eigene Audiofiles hochladen
• Neue Inhalte mit ultrarealistischen KI-Stimmen vertonen lassen (ca. 1,30 € pro Station)
• DeepL-Übersetzungen für mehrsprachige Versionen nutzen
• KI-Vertonungen lokal speichern, bearbeiten und beliebig verwenden
Bis zu drei Audioguides sind im Standardpaket enthalten – z. B. für die Dauerausstellung, einer Sonderausstellung und einer weiteren in Vorbereitung.

Vorteile der KI-Vertonung
• Extrem wirtschaftlich: Geringe Produktionskosten
• Höchste Flexibilität: Inhalte sind in Sekunden vertont
• Einfache Pflege: Inhalte leicht änderbar
Die eigenständige KI-Vertonung hat zudem einen CO2-Fußabdruck, der im Vergleich zu konventionellen Methoden äußerst gering ist.
Welches Modell passt zu Ihrem Haus?
Beide Audioguide-Modelle – PREMIUM AUDIOGUIDE und AUDIOGUIDE HOSTING – bieten Besuchern eine gleichermaßen komfortable Nutzung. Der Unterschied liegt in der Herangehensweise und dem Anspruch an Produktion und Flexibilität.
Der PREMIUM AUDIOGUIDE ist ideal, wenn Sie auf professionelle Begleitung, redaktionelle Qualität und ein hochwertiges Hörerlebnis setzen. Alles wird für Sie übernommen – von der ersten Beratung bis zur fertigen Vertonung durch erfahrene Sprecher im Tonstudio. Dieses Modell eignet sich besonders für Museen, die Wert auf ein konsistentes, kuratiertes und möglicherweise auch hörspielartiges Audiokonzept legen.
Das AUDIOGUIDE HOSTING hingegen richtet sich an Häuser, die ihre Inhalte selbst pflegen möchten und dabei maximale Freiheit schätzen. Es ist besonders wirtschaftlich, da Sie eigene Audiofiles hochladen oder neue Inhalte mithilfe ultrarealistischer KI-Stimmen schnell und kostengünstig vertonen lassen können. Neue Stationen oder zusätzliche Sprachen lassen sich flexibel ergänzen –ideal auch für kleinere Budgets oder schnell wechselnde Ausstellungen.
Kostenlos testen
Im Datenpflegebereich von museum.de haben Sie die Möglichkeit, die KI-Vertonung unverbindlich auszuprobieren. Unter dem Titel „Akustische Reise durch die Museumswelt“ können Sie kostenlos eine Station in Deutsch und Englisch erstellen und sich selbst von der Qualität der synthetischen Stimmen überzeugen.
Reichweite –museum.de und museum.com
Egal, wofür Sie sich entscheiden: Beide Lösungen sind vollständig webbasiert, mobiloptimiert und machen Ihren Audioguide sowohl vor Ort als auch online über museum.de und museum.com sichtbar.
Sämtliche Nutzungsrechte der vertonten Audioskripte sind im Angebot enthalten.
Erweiterung: Virtuelle 3D-Rundgänge
Sie können museum.de auch mit der Erstellung von virtuellen Museumsrundgängen beauftragen. Ein sehr schönes Beispiel befindet sich unter vr.museum.com/de/tour/stavenhagen
Bei diesem Beispiel wurden auch die bereits vertonten Audiofiles wiederverwendet.
Interaktive Museumsquizze: Lernen mit Spiel und Spaß
Eine gelungene Ergänzung zum digitalen Museumsangebot stellen die interaktiven Museumsquizze dar. Sie lassen sich direkt vor Ort auf dem eigenen Smartphone nutzen – ganz einfach im Browser, ohne zusätzliche App-Installation. Spielerisch vermitteln sie Wissenswertes zur Ausstellung und regen Besucher:innen dazu an, sich intensiver mit den Exponaten auseinanderzusetzen. Beispiele und weiterführende Informationen finden Sie unter: www.museum.de/quiz
Kostenlose Datenpflege bei museum.de
Datenpflege allgemein, Bearbeiten von Audioguides als Video-Tutorial und weitere Online-Broschüren: www.museum.de/video-tutorial museum.de
Ansprechpartner: Uwe Strauch Ostwall 2 46509 Xanten Tel. 02801-9882072 contact@museum.de www.museum.de www.museum.com

Die Geschichte der Albertina
Der Name Albertina bezeichnet heute eine der weltberühmtesten Grafiksammlungen. Die Benennung geht auf das Jahr 1870 zurück, als Moriz von Thausing, Galerieinspektor der erzherzöglichen Grafiksammlung, in der „Gazette des BeauArts“ die Sammlung von Herzog Albert von Sachsen-Teschen mit „La Collection Albertina“ bezeichnete. Die Sammlung war damals Teil des „Carl Ludwig’schen Fideikomisses“, der von Erzherzog Carl von Österreich 1826 begründete worden war. Er stellt sicher, dass das erzherzogliche Palais auf der Augustinerbastei und die in ihr verwahrte Sammlung eine unauflösbare, untrennbare und unteilbare Einheit bildeten. Nicht die Sammlung, sondern das Gebäude besaß hier einen höheren Stellenwert. Dies belegen historische Reisehandbücher, die primär das prachtvolle hochherrschaftliche Palais erwähnen, während die Sammlung –wenn überhaupt – nur beiläufig Erwähnung findet. Diese Wertigkeit blieb bis zum Ende des Ersten Weltkrieges erhalten.
Erst mit der Enteignung des letzten habsburgischen Besitzers, Erzherzog Friedrich, im Jahre 1919 änderte sich diese Gewichtung. Für die Republik Österreich symbolisierte das Erscheinungsbild des Palais eindrücklich die Epoche der Donaumonarchie, die es zu beseitigen galt, während die Sammlung keinen objektimmanenten Bezug zur habsburgischen Vergangenheit besaß und damit für die kulturpolitischen Ziele des Staates unvoreingenommen eingesetzt werden konnte.
Dementsprechend filetierten die staatlichen Behörden das Innere des Palais und teilten es auf mehrere bundesstaatliche Institutionen auf, die es nach ihren Bedürfnissen adaptieren durften. Die Einheitlichkeit des Palais in punkto allumfassendes Gestaltungskonzept ging damit unwiederbringlich verloren.
Die „Staatliche Grafische Sammlung Albertina“ verwendete die kostbar dekorierten und prunkvoll gestalteten Repräsentationsräume, die jedoch durch die Mitnahme sämtlicher Möbel und Ausstattungsstücke durch Friedrich ins ungarische Exil zu entseelten Raumhüllen mutiert waren, als Lager- und Archivräume, Büros oder Studiensaal.
Dieser unsachgemäße Umgang mit dem glanzvollen architektonischen Erbe führte naturgemäß zu einer sukzessiven Devastierung des gesamten Palais, doch bestand noch keinesfalls jenen intoleranten Zerstörungswille, mit dem nach dem Zweiten Weltkrieg ein ultimativer Schlussstrich unter die habsburgische Vergangenheit des Palais gezogen werden sollte. Ein kleiner Bombenschaden bot den willkommenen Anlass, die gesamte historische Fassadengliederung abzuschlagen und die habsburgischen Symbole zu demolieren, und die 1919 begonnene Geschichtstilgung zu beenden.
1952 präsentierte sich bei der Wiedereröffnung der „Grafischen Sammlung Albertina“ das vormals hochherrschaftliche Palais als eine seiner Identität beraubte, formal belanglose Raumhülle, deren erfolgreiche Republikanisierung ein überdimensionaler und zudem unproportionaler Adler oberhalb des Haupteinganges an der Augustinerstraße symbolisierte. Dieser demokratische Denkmalsturz tilgte das habsburgische Palais aus dem historischen Bewusstsein ebenso wie aus dem städtischen Erscheinungsbild, wodurch ab diesem Zeitpunkt die Bezeichnung „Albertina“ zum Synonym für die Grafiksammlung wurde. Weil die noble Bezeichnung „Palais Albertina“ in krassem Widerspruch zum unattraktiven Äußerem des Gebäudes stand und auch das innere Erscheinungsbild keinerlei Assoziationen mehr zu Besonderem, Einmaligem oder Glanzvollem weckte, empfand man die Namensgleichheit von Gebäude und Sammlung mehr als zufällig als ursächlich.
Mit der Neupositionierung der Albertina 2000 unter der Direktion von Klaus Albrecht Schröder sollte die untrennbare Verbundenheit zwischen dem prunkvollem Adelspalais und der weltberühmten Sammlung wieder hergestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die historischen Prunkräume umfassend restauriert, das alte prachtvolle Erscheinungsbild wieder hergestellt und der Öffentlichkeit seit 1919 erstmals im vollen Umfang zugänglich gemacht. Die Fassaden erhielten ihr hochherrschaftliche Fassadengestaltung zurück, wodurch das Palais in all seiner historischen Pracht wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit zurückkehrte.

Zeitgleich erfolgte im Jahre 2000 der Beschluss, die prunkvollen Repräsentationsräume des Palais mit originalen Möbeln auszustatten. Alle diese Maßnahmen gingen eine eingehende Befundung sowie umfangreiche wissenschaftliche Recherchen einer im Haus

neu geschaffenen Abteilung voraus. Durch die Einsetzung eines internationalen wissenschaftlichen Beirates soll gewährleistet sein, dass auch zukünftig originale Ausstattung in das Palais zurückkommen.
Damit diese Vision Wirklichkeit werden
konnte, bedurfte es einer großen Anzahl an Sponsoren und Unterstützern. Ihren Zuwendungen ist es zu verdanken, dass die acht Jahrzehnte lange Trennung von Gebäude und Sammlung aufgehoben werden konnte, wodurch im Sinne des 1826
begründeten Fideikomisses eine neuerliche Symbiose zwischen dem historischem Habsburger-Palais und „la Collection Albertina“ geschaffen werden konnte.
Die Renovierung der habsburgischen Prunkräume
Im Frühjahr 1999 begannen die größten Um- und Ausbauarbeiten in der Geschichte der Albertina. Seit den letzten großen Renovierungsmaßnahmen 1897 sind mehr als 100 Jahre vergangen. Durch den unsachgemäßen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die Nutzung der Albertina als Depot hat das äußere Erscheinungsbild des Albertina-Palais stark gelitten.
Die Fassaden von 1865
Die Fassaden des Albertina-Palais aus dem Jahr 1865 wurden im Zuge der Renovierung rekonstruiert. Damit verschwand die stark vereinfachte Betonarchitektur der fünfziger Jahre mit ihren massiven Balkonen, und die ursprüngliche Geschosseinteilung des historischen Albertina-Palais wurde wieder sichtbar gemacht. Der Eingang in das Palais wurde wieder auf die Bastei, in das eigentliche Erdgeschoss, verlegt.
Die Prunkräume von 1822
In den Prunkräumen der Albertina wurden die in den fünfziger Jahren übermalten Dekorationen freigelegt und die kostbaren
Intarsienböden von Joseph Danhauser gesichert. Ebenso wurden die Marmor imitierenden Zinkweißfassungen der Skulpturen des Musen-Zyklus von Joseph Klieber wieder sichtbar gemacht.
Die Stoffe für die Wandbespannungen wurden nach historischen Vorbildern neu gewebt. Die Restaurierung bzw. Rekonstruktion der kostbaren Kristallluster der Prunkräume wurde von der Firma D. Swarovski gesponsert.
In der zweiten Restaurierungsphase konnten die Arbeiten im Spanischen Appartement, dem Ovalzimmer, dem Rokokozimmer und dem Sterbezimmer abgeschlossen werden. Zeitgleich erfolgte die Wiedereinrichtung mit der originalen Ausstattung wie Garnituren, Sitzmöbel, Schränke etc.




schen Prunkräume der Albertina erworben werden. Ergänzt wurden diese Ankäufe durch Leihgaben aus der Möbelsammlung des MAK und aus den Beständen des ehemaligen Hofmobiliendepots. Als Grundlage für die Identifizierung der ursprünglichen Einrichtung des Palais Erzherzog Carl beziehungsweise Erzherzog Friedrich stehen die Entwurfszeichnungen der Danhauser’schen Möbelfabrik aus den Jahren um 1822, die Abbildungen im Mappenwerk „Alte Innenräume österreichischer Paläste und Wohnhäuser“ von Josef Folnesics aus den Jahren um 1905, das Inventar des Palais aus den 1920er Jahren und der Versteigerungskatalog von Einrichtungsgegenständen aus dem Besitz Erzherzog Friedrichs des Wiener Auktionshauses Kende von 1933 zur Verfügung.
Für die Vergolderarbeiten im Goldkabinett und in den Prunkräumen wurde eine eigens für das Palais gemischte, im Ton kühl-elegante Goldlegierung verwendet, die unter dem Namen Albertina- Gold erhältlich ist. Das 24-karätige Albertina-Gold besteht aus 23 Karat reinem Gold und einem Karat Silber und Kupfer.
Neuerwerbungen aus der ehemaligen Einrichtung des Palais Erzherzog Carl und Erzherzog Friedrich
(von Dr. Christian Witt-Dörring) In den letzten Jahren konnte eine Reihe von Möbelstücken, die zur ursprünglichen Einrichtung der Albertina gehörten, am internationalen und nationalen Kunstmarkt sowie aus Privatbesitz für die Wiedereinrichtung der histori-
Linke Seite, oben: Großes spanisches Appartement Unten: Audienzzimmer
Rechte Seite, oben: Rokoko Salon
Unten: Wedgwood Kabinett
Fotos: © Georg Molterer

Bereits 1994 konnten ein noch aus dem Besitz Herzog Alberts von Sachsen-Teschen und Erzherzogin Marie Christines stammendes Tischchen mit klappbarer Platte aus Sèvres-Porzellan (1783) mit Darstellungen aus dem Leben von Rinaldo und Armida nach François Boucher und eine weiß-gold gefasste Wiener Sitzgarnitur aus den 1780er Jahren angekauft werden.
Aus der unter Erzherzog Carl um 1822/23 erfolgten Neuausstattung der Albertina wurde im Laufe der letzten Jahre sukzessive eine Reihe für die Geschichte des Wiener Möbels äußerst wichtiger Objekte erworben. Sie sind alle ausschließlich aus Mahagoni mit vergoldeten Bronzebeschlägen gearbeitet und stammen aus der in der Art eines Einrichtungshauses operierenden Wiener Möbelfabrik des Joseph Danhauser. Dazu zählen zwei so genannte Aufwärter, ein Standleuchter, zwei verspiegelte Kommoden, ein Schreibtisch und zwei Teetische. Ein ebenfalls für die Ausstattung Erzherzog Carls gelieferter achtarmiger Wiener Luster aus vergoldeter Bronze und geschliffenem Glas (um 1820) vervollständigt diese Gruppe von Ankäufen. Aus der unter Erzherzog Friedrich um 1900 erfolgten Umgestaltung und Neueinrichtung der Innenräume der Albertina wurden zwei halbhohe Vitrinenschränke, ein kleiner Tisch und ein Schrank

erstanden. Sie sind formal den Möbeln der Danhauser’schen Möbelfabrik angepasst und von dem Wiener Inneneinrichtungshaus Friedrich Otto Schmidt gefertigt. In Ergänzung der ursprünglichen Einrichtung wurden ein Konsoltisch aus der Danhauser’schen Möbelfabrik (um 1825), ein seltenes Paar Wiener Schreibsekretäre (um 1810) aus ehemalig erzherzoglichem Besitz, sechs Wiener Stühle (um 1825), eine
Wiener Uhr (um 1820/25), zwei Wiener Luster (um 1790/1800) und ein vergoldeter Bronzeluster (um 1820/25) sowie eine Reihe vergoldeter französischer Bronzekandelaber erworben.
Oben: Fürstliches Gold- und Schreibkabinett
Unten: Gelber Salon
Fotos: © Georg Molterer

Seit über 130 Jahren sorgen wir für eine optimale Raumluft. Unsere Klimasysteme befeuchten, entfeuchten, heizen, kühlen und schützen in Museen und Galerien wertvolle Kunstwerke vor irreversiblen Schäden, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft entstehen können.
Welches System bei Ihnen eingesetzt wird, entscheiden Sie nach unserer eingehenden Beratung. Lassen Sie uns genau damit beginnen. Bei Ihnen vor Ort.
Ihr Partner für individuelle Klimatisierungskonzepte Luftbefeuchtung | Luftentfeuchtung | Heizung | Kühlung

Monet bis Picasso –Die Sammlung Batliner
Die ALBERTINA besitzt mit der Sammlung Batliner eine der größten und hochkarätigsten Kollektionen Europas zur Malerei der Klassischen Moderne. 2007 wurde diese Sammlung der ALBERTINA von Rita und
Herbert Batliner übergeben und ein neues Kapitel in der Geschichte des Museums aufgeschlagen.
Vom französischen Impressionismus, Pointillismus und Fauvismus mit Werken von Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Braque und Matisse über Meisterwerke der expressionistischen Künst-
lergruppen Die Brücke und Der Blaue Reiter mit Gemälden von Kirchner, Kandinsky und Nolde bis hin zur russischen Avantgarde und zahlreichen Werken von Pablo Picasso präsentiert die Dauerausstellung alle bahnbrechenden Ideen der Moderne.
Die Entscheidung von Herbert und Rita Batliner 2007, ihre Sammlung der Öffent-
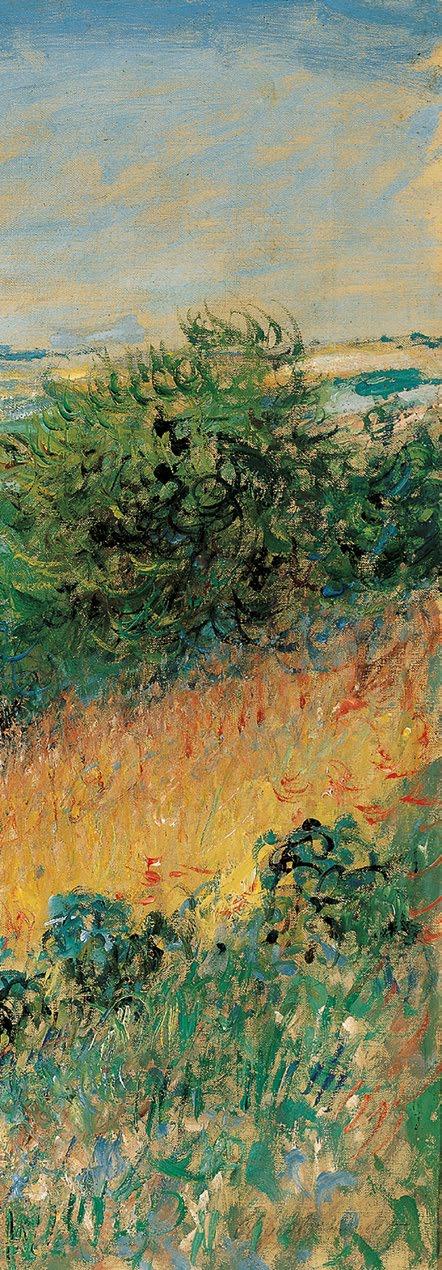
lichkeit zugänglich zu machen und dafür als Partner die ALBERTINA zu wählen, hat die Museumslandschaft auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst bereichert. Denn seit der Jahrtausendwende sammelt das Ehepaar Batliner auch die vielfältige Malerei der Gegenwart: Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Alex Katz, Imi Knoebel und Arnulf Rainer.
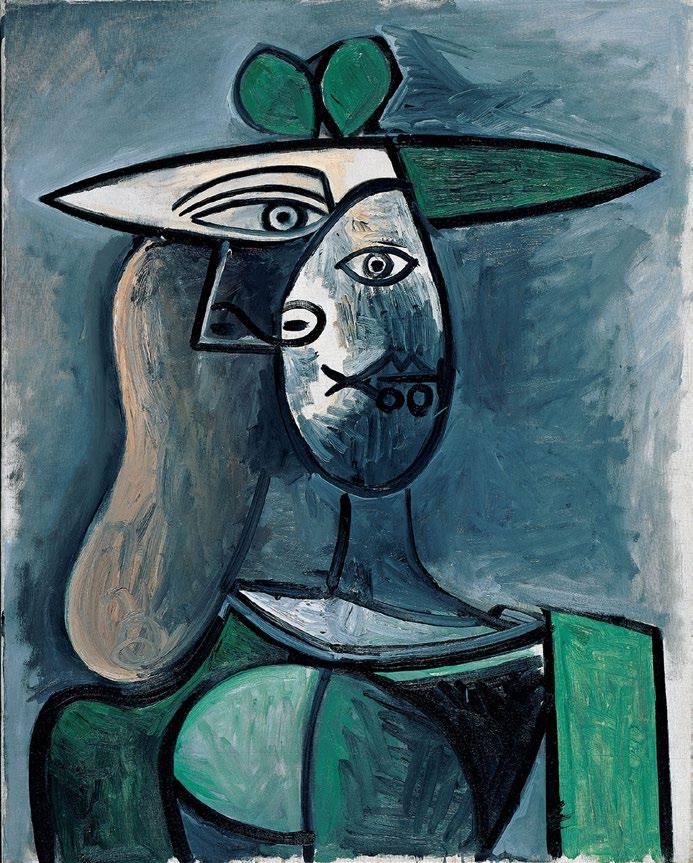
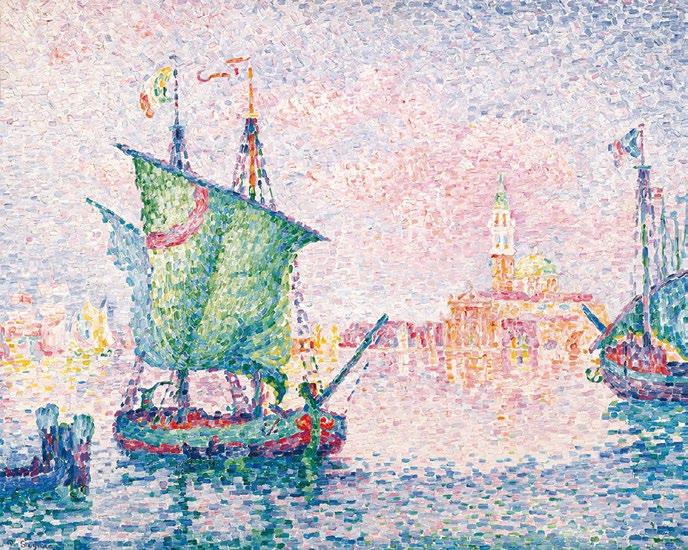
Öl auf Leinwand. ALBERTINA, Wien – Sammlung Batliner © Succession Picasso / Bildrecht, Wien 2024
Rechte Seite, oben: Frau mit grünem Hut, 1947
Unten: Paul Signac. Venedig, die rosa Wolke / Ankerplatz bei der Giudecca, 1909

Mit ihren drei Standorten – der ALBERTINA im historischen Stadtzentrum Wiens, der ALBERTINA MODERN am Karlsplatz und der ALBERTINA Klosterneuburg – zählt die ALBERTINA heute zu den bedeutendsten Kunstinstitutionen Europas. Das Museum vereint imperiale Geschichte, herausragende Sammlungen und zeitgenössische Relevanz in einer Institution, die von der Kunst der Renaissance bis zur Gegenwart reicht.
Die ALBERTINA am Albertinaplatz –das Stammhaus
Das klassizistische Palais am Albertinaplatz 1, direkt neben der Wiener Staatsoper, ist der Ursprung und das historische Herz der ALBERTINA. Gegründet im 18. Jahrhundert von Herzog Albert von Sachsen-Teschen, bildet es bis heute die Heimstätte einer der weltweit bedeutendsten grafischen Samm-
Linke Seite, oben: Außenansicht ALBERTINA MODERN
Mitte: Seitenansicht vom Musikverein aus Unten: ALBERTINA Klosterneuburg. Foto: © Stefan Olah
Rechte Seite, oben: Eingangshalle mit Decke
Unten: Prunkstiege von unten
Fotos: © Robert Bodnar

lungen mit Werken von Dürer, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, Klimt und Schiele.
Die ALBERTINA MODERN – Zentrum für Gegenwartskunst
Seit 2020 ergänzt die ALBERTINA MODERN das Museumsensemble am traditionsreichen Standort des Künstlerhauses am Karlsplatz. Auf mehr als 2.500 m² Ausstellungsfläche werden hier zentrale Werke der Kunst nach 1945 gezeigt. Grundlage dafür bilden die Sammlungen der ALBERTINA sowie die bedeutenden Zugänge der Sammlung Essl und der Sammlung Jablonka.
Mit rund 60.000 Werken von 5.000 Künstler*innen zählt die ALBERTINA MODERN zu den größten Museen für zeitgenössische
Kunst in Europa. Schwerpunkte bilden sowohl österreichische Positionen wie Arnulf Rainer, Maria Lassnig und VALIE EXPORT als auch internationale Werke von Warhol, Sherman, Baselitz oder Longo.
Die ALBERTINA Klosterneuburg – Depot und Forschungszentrum
Die ALBERTINA Klosterneuburg fungiert als wissenschaftliches Zentrum der Institution. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Sammlung Essl untergebracht, bietet der Standort ideale Bedingungen für Konservierung, Restaurierung und Forschung. Damit leistet Klosterneuburg einen unverzichtbaren Beitrag zur professionellen Betreuung der umfangreichen Sammlungen.

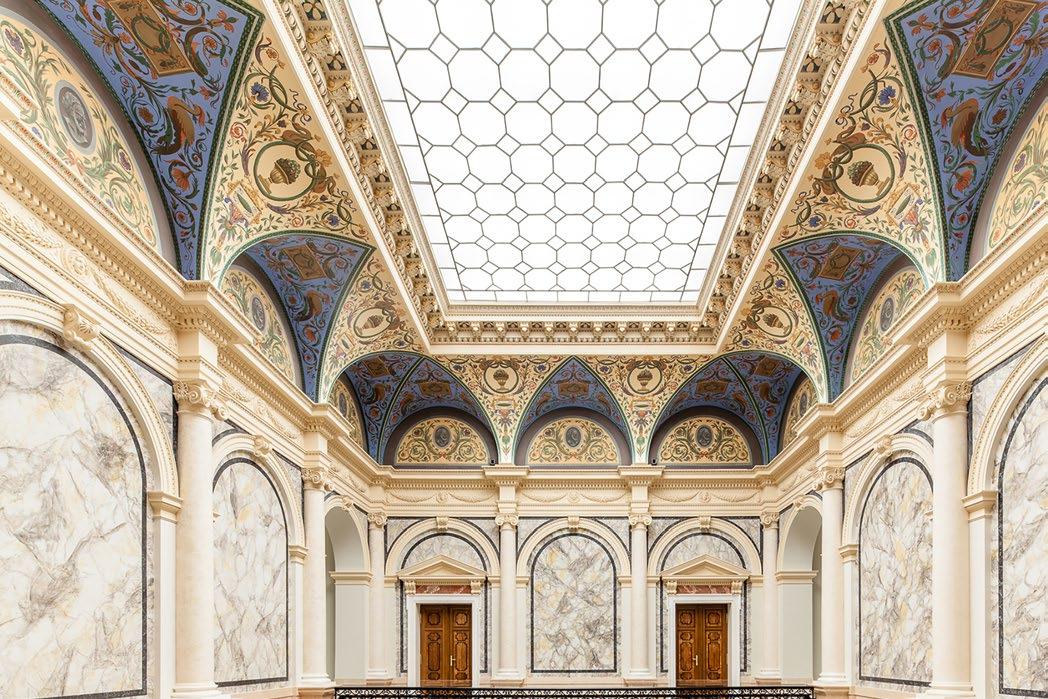
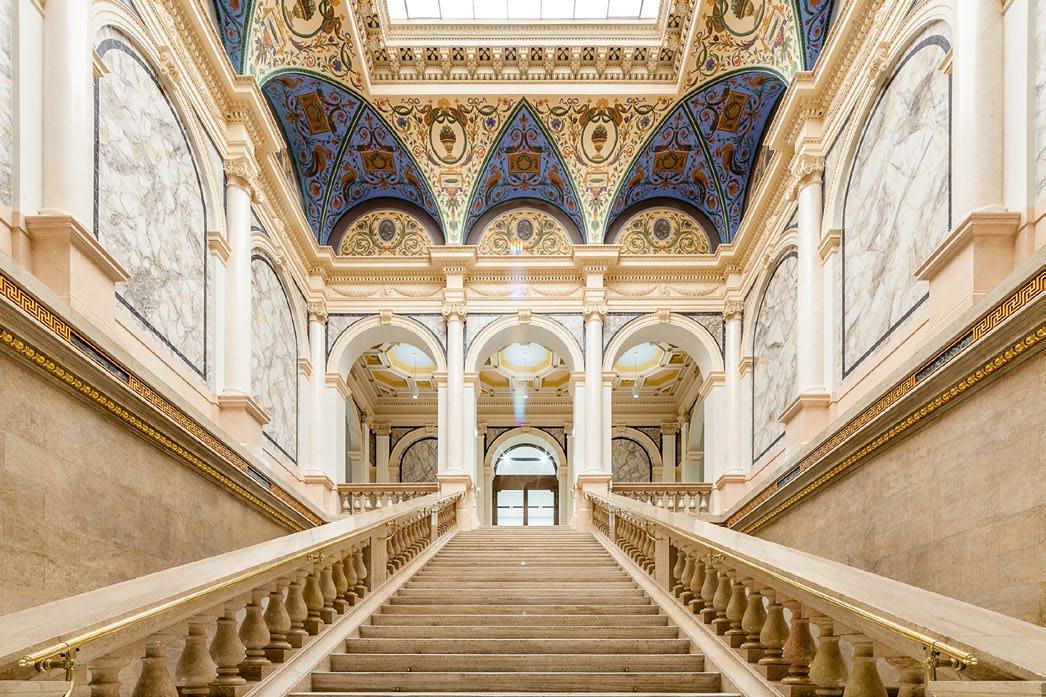
Wedgwood-Basaltbüsten
Bereits zur Zeit von Herzog von Albert von Sachsen-Teschen (1738–1822), dem Begründer der ALBERTINA, waren sie ausgestellt: Antike Feldherren, Politiker und Dichter, Künstler, Philosophen und Wissenschaftler. Der Schwiegersohn Kaiserin Maria Theresias und Statthalter von Ungarn bekrönt damit die Bücherkästen seiner mehr als 25.000 Bände umfassenden Bibliothek.
Neun Büsten von bedeutenden historischen Persönlichkeiten sind erstmals seit der Ausstellung „Die Gründung der ALBERTINA“ (2014) wieder zu sehen und im Säulengang des Palais permanent ausgestellt: Marcus Brutus, Junius Brutus, Aurelius Antonius, Marc Aurel, Pindar, Homer, Cato, Palladio und Inigo Jones. Mit diesen Büsten des Engländers Josiah Wedgwood (1730–1795) ist neben der Grafischen Sammlung, der Architektursammlung und der historischen Ausstattung eine weitere Sammlung von Herzog Albert wieder in der Ausstellung der ALBERTINA vertreten.
Links: Wedgwood-Basaltbüsten im Säulengang der Albertina
Rechts: Detailansicht einer Wedgewood-Basaltbüste Fotos: © Bureau Kies

ALBERTINA
Albertinaplatz 1
1010 Wien
Tel. +43 1 534 83 0 info@albertina.at www.albertina.at