Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin


Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Fräulein Sophies Gespür für Schönheit
Warum Erfolg manchmal nach Fisch riecht
Special: Vorarlbergs beste Marke
Pianist Igor Levit über Improvisation und Freiheit
Bad Ischl oder wie die Kultur Europa salzt

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.
Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.
Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Was wäre wenn und was hätte sein können, wäre man anders „abgebogen“? Vermeintlich kleine Entscheidungen, die auf den ersten Blick oft unbedeutend erscheinen mögen, können das Leben genauso verändern wie große. Karl Troll etwa hat vor über 30 Jahren eine solche Wahl getroffen und damit den Grundstein für ein international erfolgreiches Familienunternehmen gelegt, denn mitunter ringt einem das Leben Mut ab, um Neues zu wagen. Das trifft auf viele verschiedene Bereiche zu: im beruflichen genauso wie im handwerklichen oder künstlerischen Bereich.
Klemens Oezelt hat in einer Zeit, in der nur Wenige von den schöpferischen Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz überzeugt waren, an den Erfolg der neuen Technologie geglaubt und ist heute an verschiedenen Storyboards und Produktionen in Hollywood beteiligt. Oder der Pianist Igor Levit, der nicht nur seiner musikalischen Leidenschaft folgt, sondern sich aus politischer Überzeugung für eine freie, selbstbestimmte Gesellschaft einsetzt. Ob Entscheidungen, die am Ende nicht getroffen wurden und nur im Kopf als Gedankenspiel existieren, dann zum Besseren oder Schlechteren geführt hätten, erfährt man nie – aber so ist es eben, das Leben
Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam
Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com
Redaktion:
Christa Dietrich, Ernest F. Enzelsberger, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Angelika Schwarz
Artdirection:
Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com
Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, patrick.fleisch@russmedia.com Thorben Eichhorn, thorben.eichhorn@russmedia. com Sascha Lukic, sascha.lukic@russmedia.com Gabriel Ramsauer5, gabriel.ramsauer@russmedia.com Roland Rohrer, roland.rohrer@russmedia.com
Druck:
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 4. April 2024; Nächste Ausgabe: 11. Juni 2024




08 66 14 25 74

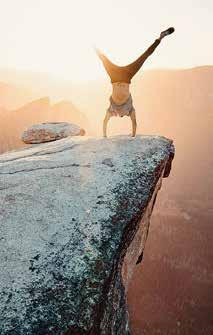
Seite 08 | Troll Cosmetics. Ein Leben für die „Haut“ Couture.
Seite 14 | Claudia Voith. Mit viel Wissen und Ausdauer in der Kultur engagiert.
Seite 19 | Regionales Handwerk. Zwischen Tradition und Innovation.
Seite 25 | Igor Levit. Über das, was im Leben wirklich zählt.
Seite 28 | Künstliche Intelligenz. Wo bitte geht’s nach Hollywood?
Seite 32 | VW Touareg R eHybrid TSI. SUV-Raumschiff mit Adrenalin-Kick.
Seite 34 | Prisma Holding AG. Wieso Bernhard Ölz auf Erfahrung baut?
Seite 41 | Vorarlbergs beste Marke. Über die Bedeutung heimischer Produkte.
Seite 58 | Glashütte Original. Zu Besuch in der deutschen Uhrenmanufaktur.
Seite 62 | Frl. Müller & Söhne. Filmische Leidenschaft und ein rosa Container.
Seite 66 | Marc Lins. Ein Lichtmagier zwischen Kunst und Kamera.
Seite 71 | Ghörig. Vorarlberger Streetfood mit einem kreativen Twist.
Seite 74 | Tristan Horx. Warum plötzlich scheinbar alle verrückt sind?
Seite 79 | Haus des Meeres. Wenn Erfolg manchmal nach Fisch riecht.
Seite 82 | Wien. Zehn unkonventionelle Fakten über Kaffeehaus, Kunst und Kassa.
Seite 87 | Bad Ischl. Unterwegs in der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstadt.
Freude am Fahren



























Stiglingen 75, 6850 Dornbirn
Telefon 05572/23286-0
info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at

Bundesstraße 96, 6710 Nenzing
Telefon 05525/6971-0
info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at

BMW X2: 110 kW (150 PS) bis 221 kW (300 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,8 l bis 8,1 l/100 km, CO 2-Emissionen von 125 g bis 183 g CO2 /km. Angegebene Verbrauchs- und CO 2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.
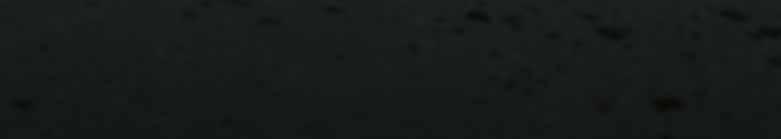
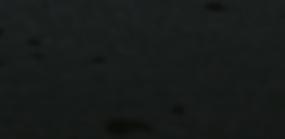
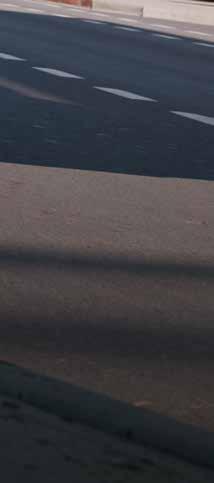


„
Authentisch, offen und herrlich bodenständig –Karl Troll hat drei renommierte Beauty-Marken international erfolgreich lanciert, mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Tochter Barbara Sandner-Troll. Mit Sophie’s Garden setzen die beiden nun neue Maßstäbe. Ein Interview über drei Generationen, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Fräulein Sophie’s Gespür für Schönheit.
Wir treffen Karl Troll und seine Tochter Barbara Sandner-Troll in der Firmenzentrale in Lustenau. Der Vorarlberger Kosmetikhersteller vermarktet von hier aus die international erfolgreichen Pflegemarken Declaré, Juvena und Marlies Möller Beauty Haircare in mehr als 60 Ländern. Zusammen mit seiner Tochter steht er mit über 80 Jahren noch immer an der Spitze des Familienunternehmens, denn „meine Marken sind meine Kinder“, wie er voller Verve unterstreicht. Sophie’s Garden ist der neueste Coup – sozusagen Anti-Aging der dritten Generation, doch erst einmal der Reihe nach...
Wie es der Zufall will. Begonnen hat Karl Trolls berufliche Laufbahn in der Kosmetikbranche beim Sonnenschutz-Pionier Piz Buin, genau genommen im Führungsteam des Unternehmens Greiter. Mit 50 Jahren packt er die Gelegenheit beim Schopf und macht sich selbstständig: Als die neuen amerikanischen Eigentümer Johnson & Johnson die 1978 gegründete Traditionsmarke Declaré aufgeben wollen, weil sie umsatzmäßig hinter den Erwartungen bleibt, erkennt Troll das Potenzial

und übernimmt die speziell für empfindliche Haut konzipierte Kosmetik-Linie: „Ich bin nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau und den Kindern gesagt: ab nächstem Monat sind wir selbstständig“,

Sonnenschutz. Beim Piz Buin
Drachenfliegen-Weltrekordversuch: Gerhard Nenning (li.), Olympiasieger Egon Zimmermann, Karl Troll (re.).
erinnert sich der sechsfache Familienvater mit einem Schmunzeln und legt mit dieser Entscheidung den Grundstein für ein international erfolgreiches, stetig wachsendes Unternehmen: Troll Cosmetics. Maß-
Troll Cosmetics vermarktet von Lustenau aus die international erfolgreichen Pflegemarken Declaré, Juvena und Marlies Möller Beauty Haircare in mehr als 60 Ländern. Der neueste Coup: Sophie’s Garden.

wie etwa bei den Launch Events in China 2012 oder Thailand 2019.
geblich verantwortlich dafür war und ist vor allem seine konsequent visionäre Haltung und Vorreiterrolle in punkto neueste strategisch-technologische Entwicklungen, selbstredend immer verbunden mit höchsten Qualitätsstandards. „Wir setzen auf einen echten Fortschritt in der Forschung und nicht auf marketingbasierte Versprechen und inhaltsleere Schlagwör-
Eingespieltes Team. Karl Troll und seine Tochter Barbara sind weltweit unterwegs

ter“, begründet der leidenschaftliche Unternehmer die Frage, wieso das Wachstum seiner Firma über all die Jahre nur eine Richtung kennt. Kontinuierlich wird daher immer weiter an neuen Produkten und Wirk-Komplexen gearbeitet. Gepaart mit einer unglaublichen persönlichen Qualität, bei strategischen Entscheidungen klar zu wissen, was zu tun ist – letztlich mit gro-
ßer Entschlossenheit und ohne zu zögern. Dieses Herzblut spürt man auch bei seiner Tochter: „Als wir die Firma vor über 30 Jahren gegründet haben, war ich vom ersten Tag an mit dabei, da ging meine jüngste Schwester noch zur Schule. 10 Jahre später hat sie uns dann tatkräftig im Verkauf unterstützt“, erzählt die Mutter von drei Kindern und ihr Vater ergänzt: „Für mich hat das auch immer sehr gut gepasst: Barbara die Ruhige, Strukturierte, Analytische und Verena der umtriebige Wirbelwind.“ Später verlässt die jüngere Schwester die Führungsspitze der Liebe wegen.
Gohla und Garten. Der nächste große Meilenstein erfolgt schließlich im Jahr 2011: Als La Prairie die Anti-Aging-Marke Juvena sowie die Haircare-Brand Marlies Möller verkauft, erweitern Troll und seine Tochter ihre Marken- und Produktpalette: „Wir haben zu diesem Zeitpunkt bereits an einer eigenen Pflege-Serie für die Haa-

re gearbeitet – da hat Marlies Möller perfekt in unser Portfolio gepasst“, so Barbara Sandner-Troll rückblickend.
Mit Sophie’s Garden etablieren die beiden nun eine neue innovative Anti-AgingLinie, die gemeinsam mit dem Schweizer Biotechnologieexperten und Professor Dr. Sven Gohla im Rahmen einer fünfjährigen Forschungstätigkeit entwickelt wurde: „Ich habe Dr. Gohla, der zuvor viele Jahrzehnte lang Forschungsleiter bei Beiersdorf und La Prairie war, zufällig am Flughafen getroffen, wir haben uns kurz ausgetauscht und später die Idee zu einer neuen Linie mit dem Anspruch ‚Skincare of the Next Generation‘ ausgearbeitet“, so die Beauty-Expertin über die zunächst zufällige und doch wegweisende Begegnung. Die Corona-Zeit wurde schließlich intensiv dazu genutzt, um mit einem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen einen weltweit exklusiven Wirkstoff (Funarine) zu entwickeln, der aus den
Interview. Barbara Sandner-Troll im Gespräch mit „kontur“.
Den Funarinen gelingt es, den Informationsfluss in den Zellen wieder zu aktivieren – für eine glatte Haut.


Weiterbildung. Troll Cosmetics verfügt über ein Schulungszentrum auf Mallorca.
Gut vernetzt. Karl Troll mit Kingstar-Chefin Wendy Ngan, Distributeurin für Hongkong.

Stammzellen eines Schweizer HochalpenMooses gewonnen wird und aktiv in den Hautalterungsprozess eingreift. „Die Hautalterung beginnt an den Poren des Zellkerns. Den Funarinen gelingt es, die Poren von Ablagerungen freizuhalten und den Informationsfluss in den Zellen wieder zu aktivieren“, erläutert Sandner-Troll die spezifischen „Kommunikations-Abläufe“ in der Haut.
Mit viel Liebe fürs Detail. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe sowie der Wirk-Komplex sind bei Sophie’s Garden luxuriös und revolutionär – auch die Verpackung ist einzigartig: Der wiederbefüllbare Porzellantiegel wird eigens für Troll Cosmetics in der französischen Porzellanmanufaktur Bernardaud in Limoges gefertigt, das Papier für die Verpackung stammt aus der bekannten deutschen Papiermanufaktur Gmund am Tegernsee, die auch für die renommierten Oscars die Einladungskarten druckt, denn auch hier gingen das perfekt eingespielte Vater-Tochter-Gespann mit viel Liebe fürs Detail und großem Engagement ans Werk: „Uns waren nachhaltiger Luxus sowie ein respektvoller Umgang mit Umwelt und Ressourcen enorm wichtig, so dass wir viele Manufakturen angefragt haben, bis wir die passenden Kooperationspartner
„Ich habe 30 Jahre zu spät angefangen. In dieser Zeit sind die weltweiten Vertriebe auf- und ausgebaut worden. Wäre man da dabei gewesen, wäre es viel einfacher, mit guten Distributoren zu arbeiten.“
fanden. Wir wollten dem Zeitgeist entsprechen und etwas Wunderschönes kreieren, das immer wieder verwendet werden kann“, unterstreichen beide übereinstimmend. Sophie’s Garden – der Garten ist eine Hommage an die Natur – wird in der Schweiz produziert und bereits in 18 Ländern durch exklusive Partner vertrieben.
Die Namenswahl ist naheliegenderweise ebenfalls keine wohlklingende Marketingidee, sondern spannt den Bogen zur dritten Generation von Troll-Cosmetics: Tochter und Enkelin Sophie, eine Molekularbiologin, fungierte für die innovative Anti-Aging-Linie als Patin. Die 30jährige steht somit als nachfolgende Generation in Sachen Schönheit in den Startlöchern und perfektioniert derzeit ihr Wissen bzw. steht bereits beratend zur Seite.
Mission: Schönheit. Ob „Sir“ Troll – dessen vornehme, charmant-ehrliche Art, gepaart mit einem verschmitzten Lächeln ins Auge sticht – rückblickend etwas anders machen würde? „Ich habe 30 Jahre zu spät angefangen. In dieser Zeit sind die ganzen weltweiten Vertriebe auf- und ausgebaut worden. Wäre man da schon
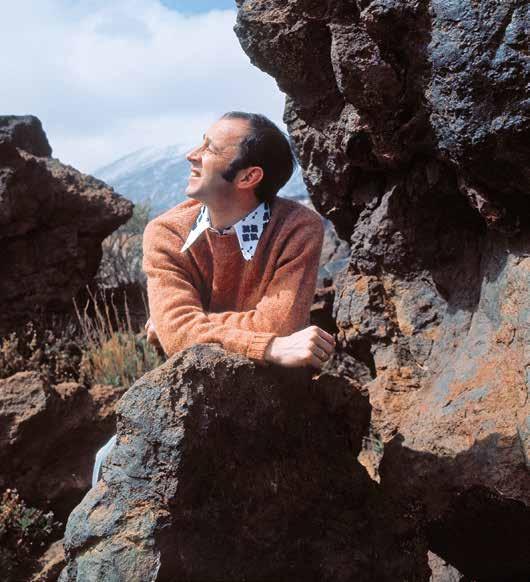

Weitblick. Für revolutionäre technologische Entwicklungen.

dabei gewesen, wäre es viel einfacher, in den aufstrebenden Märkten mit guten Distributoren zu arbeiten“, erklärt der Seniorchef, der sich mit Tennis- und Golfspielen sowie Segeln fit hält und im Rahmen seiner Geschäftsreisen mit Tochter Barbara auf der ganzen Welt herumgekommen ist. Bis heute sind die beiden in der „Mission: Schönheit“ zusammen unterwegs, um neue Vertriebskanäle zu erschließen, Produkte zu launchen oder Geschäftskontakte zu pflegen – selbstverständlich mit einem amüsanten Globetrotter-Wissen im Gepäck wie etwa, warum Kosmetika in Asien unbedingt extra-foliert sein müssen oder man in Kuala Lumpur besser kein Meeresgetier mit Alkohol mischt… doch das ist eine andere Geschichte. Fest steht: Erfolg muss man sich hart erkämpfen, mit globalem Weitblick und strategischem Instinkt. Sophie scheint das Gespür ihres Großvaters und ihrer Mama jedenfalls geerbt zu haben. Christiane Schöhl von Norman





Im neuen Haus von Juwelier Kopf in der Altstadt von Feldkirch finden Sie eine umfangreiche Montblanc-Erlebniswelt, in der Sie eingeladen werden, die wunderbaren Schreibgerate, Lederwaren und Zeitmesser dieser Traditionsmanufaktur in entspannter Atmosphäre zu erleben. Das Team von Juwelier Kopf freut sich, Ihnen die vielen liebevollen Details, die in jedem Produkt von Montblanc versteckt sind, zu erklären.
Die Zahl der Politikerinnen und Politiker, die in den letzten rund 20 Jahren in Vorarlberg das Kulturressort innehatten, ist groß im Vergleich zu den zwei Personen, nämlich Werner Grabher und Winfried Nußbaummüller, die die Kulturabteilung im Amt der Landesregierung leiteten. Claudia Voit übernimmt nun als neue Vorständin dieser Abteilung allerdings einen immensen Aufgabenbereich.
Kein Büro, kein Besprechungszimmer, der Ort unseres Treffens erscheint jedoch nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Abgesehen davon, dass das Ambiente in der ehemaligen Strickereihalle der Johann Hagen KG, diese Präsenz von Erwerbstätigkeit, Kreativität, Industriekultur und -geschichte inspirierend ist, verweist der Raum auch auf eine der bisherigen Tätigkeiten von Claudia Voit. Als ehemalige Kulturamtsleiterin der Marktgemeinde Lustenau war die Kunsthistorikerin unter anderem an der Konzepterstellung und dem Aufbau für das dort in wenigen Monaten zu eröffnende S-MAK zuständig.
Regional und global. Der Name enthält die Begriffe Stickerei, Museum, Archiv und Kommunikation, womit bereits erklärt ist, dass es viel zu erfahren und viel zu erleben gibt. Musterbücher, Publikationen, Fotos, Textilien und Dokumente sind noch in Kisten verwahrt. Vorerst blicke ich auf Stickmaschinen verschiedener Art und auf ein Gerät, auf dem jede Menge Stoffteile in der Größe von Taschentüchern eingespannt sind. Schön versehen mit Blumenmotiven. Enziane sind dabei. Mit dem Alltagsrequisit hat man somit auch gerne auf die eigene Herkunft verwiesen oder auf eine Vorliebe für den alpinen Raum. Inwieweit Lustenau im globalen Handel eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, wird im S-MAK ab Herbst dieses Jahres erzählt.
Stickereiexporte von Lustenau nach Nigeria sind jedenfalls legendär und werden im Vorarlberg Museum in Bregenz thematisiert. Die jahrelang diskutierte Errichtung eines Industriemuseums des Landes liegt allerdings auf Eis. Vielleicht wird Claudia Voit in ihrer neuen Funktion als Vorständin der Kulturabteilung im Amt der Landesregierung damit konfrontiert. Vordergründig wird ein solches Unternehmen wohl kein Thema sein, es gibt somit das
Das DOCK 20 konnte unter Claudia Voit als Raum für zeitgenössische Kunst etabliert werden.

S-MAK und viel zu tun für die Kunsthistorikerin, die nach dem Studium in Wien und Berlin auch zahlreiche Ausstellungen verantwortet hat sowie als Kunsteinkäuferin im Auftrag des Landes tätig war.
Faire Bezahlung. Berührungspunkte mit der von Jänner 2013 bis 2024 von Winfried Nußbaummüller geleiteten Kulturabteilung im Amt der Landesregierung gab es somit bereits viele. Die Chance, sich für die Leitung zu bewerben, gibt es nicht oft, aber die Aufgaben haben sie selbstverständlich auch inhaltlich gereizt. „Ich arbeite gerne in einer Phase, in der man etwas auf den Weg bringt, ich bringe gerne unterschiedliche Akteure zusammen und habe die Ausdauer, langfristige Projekte auf die Schienen zu bringen.“ Diese Fähigkeiten wird sie brauchen. Dass sie sich erst einarbeiten bzw. kundig machen muss, diese Bemerkung, die in Gesprächen mit Menschen in neuer Funktion oft wahrzunehmen ist, hört man von ihr jedenfalls nicht. Einiges ist ihr zudem längst geläufig, denn an dem Strategiepapier, das von den Verantwortlichen in der Kulturabteilung des Landes in Form von drei Büchern jüngst präsentiert wurde, hat sie mitgearbeitet. Der Prozess sei kein linearer gewesen, erklärt sie, man habe formuliert, was einen hohen Stellenwert hat, das aber so offen, dass sich daraus verschiedene Schwerpunkte ableiten lassen. Einfach lässt es sich so erklären, dass sie im Auftrag der Regierung handelt. Wie die im Regierungsprogramm verankerten Aufträge umgesetzt werden, liege dann im Bereich der Verwaltung. In der aktuellen Strategie ist beispielsweise festgelegt, dass Fair Pay umgesetzt werden soll.
Bewertung der Qualität. Es sei an dieser Stelle erläutert, dass die Installierung der Kunstkommissionen in den Sparten Musik, darstellende Kunst, bildende und angewandte Kunst, Film, Literatur, Landeskunde und kulturelles Erbe sowie Kunst und Bau mit von der Regierung bestellten Mitgliedern in Vorarlberg im Kulturförderungsgesetz verankert ist. Die Experten haben die Qualität der in den Anträgen beschriebenen Projekte und Arbeiten zu bewerten und eine Empfehlung abzugeben. Als Vorsitzende selbst auch stimmberechtigt zu sein, erachtet Claudia Voit als angemessen.
Vor knapp einem Jahr wurde die von einer Forschungsgruppe der FH Vorarlberg erstellte Studie über Einkommensverhältnisse Kunstschaffender im Land präsentiert. Sie dokumentiert die Armutsgefährdung von Künstlerinnen und Künstlern in Vorarlberg. Die Gründe sind komplex, liegen definitiv aber auch an zu niedrigen Gagen.
Vielschichtige Thematik. Fair Pay – als Begriff vielbenutzt und zu übersetzen mit gerechter Bezahlung –, müsste sich an sich sofort umsetzen lassen, denn wer will offensichtlich von unfairer Bezahlung profitieren? Um die Frage zu beantworten, verweist Claudia Voit auf die Vielschichtigkeit der Thematik. Denn bei Einzelprojekten ist das Land nie alleiniger Förderungsgeber. Je nachdem, wo das Projekt angesiedelt ist, gehen die Gemeinden und der Bund mit. Eine Förderzusage beziehe sich selten auf einzelne Posten innerhalb des Finanzplanes. Die Kommissionen hätten in den letzten Jahren verstärkt zu empfehlen versucht, wofür der Betrag aufgewendet wird. Beispielsweise für Honorare. Dann könne es aber passieren, dass die Antragstellerin

schloss das Studium der Kommunikationswissenschaften sowie Kunstgeschichte an der Universität Wien ab. Danach absolvierte sie den Master-Studiengang Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie war Assistentin an der Temporären Kunsthalle Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunsthaus Bregenz. Ab März 2016 war sie für das DOCK 20 verantwortlich. Im Jahr 2020 übernahm sie die Leitung der Abteilung Kultur in der Marktgemeinde Lustenau. Nun ist sie Vorständin der Kulturabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung.
Claudia Voit
„Ich arbeite gerne in einer Phase, in der man etwas auf den Weg bringt, ich bringe gerne unterschiedliche Akteure zusammen und habe die Ausdauer, langfristige Projekte auf die Schienen zu bringen.“
oder der Antragsteller auf das eigene Honorar verzichtet und damit etwa den Transport bezahlt, damit das Projekt überhaupt verwirklicht werden kann. Ein Projekt abzulehnen, weil man beim Blick in den Finanzplan sieht, dass die Mitwirkenden nicht fair bezahlt werden können, erachtet Voit für diskutierbar, auch wenn damit die Realisierung behindert bzw. verhindert wird und auch wenn das mitunter schmerzt. Zu den im Gespräch erörterten Fakten zählt es auch, dass Antragstellerinnen und Antragsteller das eigene Honorar mitunter gering ansetzen. Erhellend ist auch der Verweis der Kunsthistorikerin darauf, dass Gagen für Musikerinnen und Musiker eine Selbstverständlichkeit sind, dass sie für Künstlerinnen und Künstler, die an der Gestaltung von Ausstellungen ihrer Werke mitgewirkt haben, aber nicht grundsätzlich üblich waren. „In der Vergangenheit wurde oft damit argumentiert, dass eine Ausstellung in einem renommierten Haus den Marktwert einer Künstlerin oder eines Künstlers erhöht und das sei Honorar genug.“ Angesichts der Sachlage, dass es bildende Kunst gibt, die nicht darauf angelegt ist, verkauft zu werden, stelle sich die Frage, wie die Künstlerinnen und Künstler solcher Werke ihren Lebensunterhalt generieren.
„Es gibt im bildenden Bereich nur eine Handvoll Künstlerinnen und Künstler, die von ihren Arbeiten leben können. Ich sehe einen großen Teil der Verantwortung des Landes auch darin, Bewusstsein für diese Lebensbedingungen zu schaffen.“ Eine wichtige Aufgabe werde es somit sein, sich die erwähnten Förderungskorridore genau anzusehen. Ihre Devise lautet, dass Profis selbstverständlich entsprechend fair zu bezahlen sind und dass es für Aufgaben, die ehrenamtlich übernommen werden können, professionelle Strukturen braucht. So, dass eine ehrenamtliche Aktivität für jene, die sich dafür interessieren, attraktiv sein kann.
Kulturstrategie an der Ziellinie. Die Arbeit von Claudia Voit als Leiterin des Kulturamtes in Lustenau wird berechtigterweise mit dem Programm im DOCK 20 in Verbindung gebracht. Am aus-
gebauten Ort der ehemaligen Galerie Hollenstein wird die Begegnung mit zeitgenössischer bildender Kunst oder interdisziplinär angelegten Formaten möglich gemacht. Die Werke der Malerin Stephanie Hollenstein (1886–1944) lagern in einem Schaudepot, der schriftliche Nachlass ist im Archiv. Sie habe in Lustenau Offenheit erfahren und Freiräume gehabt, erzählt sie. Ihr drittes Projekt neben dem S-MAK und dem DOCK 20 ist die Kulturstrategie in der Marktgemeinde. Sie wird im Sommer finalisiert, Claudia Voit wird sie nicht mehr über die Ziellinie bringen, aber ihre Fähigkeit ist darin dokumentiert. Christa Dietrich

Das S-MAK, geleitet von einem Team mit Daniela Fetz-Mages, wird im Herbst eröffnet.




Über 12.800 Handwerks- und Gewerbebetriebe im Land spielen über das rein Wirtschaftliche hinaus gerade in den Talschaften eine wichtige Rolle.
Damit leisten sie nicht nur einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag, sondern garantieren durch die Weitergabe ihres Wissens den Fortbestand von Tradition, Erfahrung und qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Das Handwerk ist also insgesamt ein entscheidender Faktor für die ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeit. Handwerksbetriebe und die Menschen, die dahinterstehen, beweisen täglich, dass man gerade in Zeiten der
Globalisierung mit Beständigkeit und Mut sehr gut im Wettbewerb bestehen kann. Denn das Handwerk ist in vielen Bereichen auch ein wichtiger Innovationsmotor.
Handwerksbetriebe erfüllen gerade in den ländlichen Strukturen eine wichtige Rolle, weil sie auch für die Vereine und die Dorfgemeinschaft unterstützend wirken. Aber wo liegt die Notwendigkeit und somit auch die Zukunft des Handwerks? Wie gehen Handwerk, Digitalisierung und KI zusammen? Dazu führt Martin Bereuter, Inhaber
einer Tischlerei in Lingenau und Architekt, der sich von 2007 bis 2023 im Vorstand des Werkraum Bregenzerwald, davon neun Jahre als Obmann, engagierte, aus:
„Für mich ist die Frage nach der Notwendigkeit des Handwerks wesentlich. Wesentlicher als die Frage, was denn eigentlich ,echtes‘ Handwerk ist. Die Frage stellt sich für mich aus mehreren Blickwinkeln. Da sind einmal die vielen jungen Menschen, die mit ihrer Entscheidung für einen Beruf nicht nur eine Grundlage für ihr wirtschaftliches

Die Sparte Gewerbe und Handwerk umfasst in Vorarlberg 29 Innungen bzw. Fachgruppen und 246 Berufsgruppen.
• Gewerbe- und Handwerksbetriebe: 12.845
• Beschäftigte: 35.830
• Mit 957 Lehrbetrieben ist die Sparte der größte Lehrlingsausbilder im Land.
• Gesamt (1. bis 4. Lehrjahr) werden 2974 Lehrlinge ausgebildet, damit liegt die Sparte an der Spitze – vor der Industrie mit 1515 und dem Handel mit 780.
• 2023 gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk 810 Lehrabschlüsse, davon 78 mit Auszeichnung und 209 mit gutem Erfolg.
• Insgesamt wählen in Vorarlberg 45 Prozent der Jugendlichen den Weg in eine Lehre. Das ist österreichweit der höchste Wert – der Österreich-Schnitt liegt bei 43 Prozent. Während in Ostösterreich viele Jugendliche keine Lehrstelle bekommen, sind in Westösterreich Lehrlinge eine Mangelware.
Erfahrung. Martin Bereuter ist Geschäftsführer einer Tischlerei, die komplette Innenausstattungen fertigt. Er engagierte sich zudem leitend im Werkraum Bregenzerwald.

Auskommen legen, sondern die auch einen Platz, eine Aufgabe in unserer Gesellschaft einnehmen und diese aktiv mitgestalten wollen. Es ist das Handwerk, das in seiner großen Vielfalt für den Erhalt unserer unmittelbaren, kultivierten Umwelt notwendig ist. Das betrifft die persönliche, gleichermaßen wie die kommunale und somit auch die soziale Umwelt. Hier habe ich den Eindruck, dass wir uns als einzelne ebenso wie als Gesellschaft über die gegenseitigen Wechselwirkungen nicht immer im Klaren sind.“ Martin Bereuter erklärt, dass wir über den internationalen Markt die regionale Versorgung regulieren und neben den Vorzügen eines internationalen Angebots auch den Verlust an regionaler Vielfalt und somit auch regionaltypischen Arbeitsplätzen samt dem dazugehörenden Wissen in Kauf nehmen. „Da das Handwerk oft klein strukturiert und regional verwurzelt ist, ist es von dieser Entwicklung besonders betroffen. Ich sehe Parallelen zwischen den aktuellen Fragen der biologischen Vielfalt und der Frage nach einer kreativen und langfristig stabilen regionalen Wirtschaft. Sind es bei der Natur Freiräume für vielfältiges Leben, sind es in der Wirtschaft die vielfältigen Berufsfelder, die traditionelles Wissen spartenübergreifend in die Gegenwart bringen.“
Da die Neugierde schon immer ein Werkzeug des Handwerks war, sei davon auszugehen, dass das Handwerk neue Tech-
nologien im Sinne einer Verbesserung der Arbeitsergebnisse in sein Selbstverständnis integrieren wird. „Bei der Digitalisierung sind die Möglichkeiten für das Handwerk aus meiner Sicht schon recht klar umrissen, was die KI betrifft, bin ich selbst sehr gespannt, wie sich Handwerk und KI vertragen.“
In Zeiten der Globalisierung scheinen sich die Menschen wieder mehr für HandwerksProdukte begeistern zu können. Dazu Martin Bereuter: „Ich glaube, dass das mit dem grundsätzlichen Bedürfnis zusammenhängt, verstehen zu wollen, wie Dinge gemacht sind und wie sie funktionie-
ren. Denn die digitale Welt ist nicht unmittelbar begreifbar. Der Computer war eine Maschine, in der Hardware und Software Aufgaben erledigten, und somit noch dem Prinzip einer Maschine folgten, wie sie uns aus einer Werkstätte bekannt war. Mit dem Wandel zu Mobilgeräten, die im weltweiten Netzwerk agieren, kam ein lange Zeit vertrautes Verhältnis von Mensch und Maschine abhanden. Wer weiß schon wirklich, wie ein iPhone funktioniert? Aber zu entdecken, wie ein bestimmtes Holz in eine bestimmte Form gebracht wird oder zu verstehen, wie ein Schmied Metall bearbeitet, das ist etwas anderes. Ich denke, das hat mit der natürlichen Neugierde des Menschen zu tun. Die Hände können dazu ein sehr effizientes Werkzeug sein, die Welt selbstwirksam und unmittelbar wahrzunehmen.“
Und Martin Bereuter abschließend auf die Frage nach der Rolle der Tradition im Vorarlberger Handwerk: „Tradition spielt im Handwerk grundsätzlich eine Rolle, keine Frage, bei uns allerdings in geringerem Ausmaß als anderswo – weil wir nicht an den traditionellen Formen festgehalten haben. Ich würde vielmehr sagen, dass wir in Vorarlberg traditionelle Bearbeitungsformen in eine neue Zeit geführt haben und oft Materialien verwenden, die dem heutigen Zeitgeist entsprechen, Holz oder Lehm beispielsweise. Tradiertes wird neu umgesetzt und das ist etwas ganz Wesentliches: Denn während Tradition in anderen Regionen eher einen musealen

Verbesserungen. In seiner Funktion bei der Wirtschaftskammer hat Ing. Bernhard Feigl einen Maßnahmenplan für Handwerksbetriebe mitentwickelt.
Charakter hat, lassen wir Tradition in unser tägliches Wirtschaften einfließen. Wobei man nicht vergessen darf, dass auch ganz viele Gewerke verschwunden sind. Nämlich alle die Tätigkeiten, die mit der Gebrauchsgüter-Produktion zu tun hatten, wie die Korbflechter, Küfer, Kupferschmiede, Keramiker und viele mehr, die dem Weltmarkt zum Opfer gefallen sind.“
Auftrag zur Ausbildung. Der Auftrag zur Ausbildung und Weitergabe von Wissen ist ein Strukturelement des Berufsethos von Handwerkerinnen und Handwerkern. Dabei ist das duale Ausbildungssystem ein ganz wichtiges Kennzeichen des Handwerks in Vorarlberg. Das Ländle gilt daher auf Bundesebene als führender Ausbildungsstandort. Das ist mit ein Grund, warum Vorarlberger Lehrlinge bei nationalen und internationalen Wettbewerben bis hin zu Weltmeisterschaften ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Der Erfolg geht quer durch alle Berufsgruppen und ist in der Langfristbetrachtung sehr konstant. Diese hohe Ausbildungsqualität ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Erzeugnisse der Vorarlberger Handwerksbetriebe auch ein Exportschlager sind und dass das Vorarlberger Handwerk und Gewerbe bundesweit den höchsten Exportanteil hat.
Derzeit läuft nicht alles rund Trotzdem bleibt auch das Gewerbe und Handwerk nicht von den aktuellen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen verschont. Laut Obmann Komm.-Rat Ing. Bernhard Feigl kämpft die Sparte derzeit in vielen Bereichen mit Umsatzrückgängen, fehlenden Aufträgen, hohen Belastungen und zahlreichen freien Stellen. Zwar gibt es in einigen Bereichen wieder Anzeichen für eine positive Entwicklung, aber für viele, vor allem im Investitionsgüterbereich, läuft es noch nicht rund. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat daher einen Plan entwickelt, der u. a. folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorsieht: Verbesserung der flächendeckenden Kinderbetreuung, Steuerbefreiung, Anreize für das Arbeiten über das Regelpensionsalter hinaus und Förderungen für die Qualifizierung im Bereich der Green Skills. Ernest F. Enzelsberger



Weite Reise. Eine Käserei in die Ukraine transportieren? Kein Problem für Vorarlberger Betriebe.
Eine Käserei aus Hittisau für Schischkiwzi in der Ukraine.
Einen besonderen Exportauftrag wickelte die Hittisauer Schlosserei Eberle Metall Exclusiv, die „das gesamte Spektrum des ambitionierten Metallhandwerkes abdeckt“, 2003 in der Westukraine ab. Dabei ging es um die Planung und Errichtung einer Lehrkäserei in dem ukrainischen Ort Schischkiwzi mit 1800 Einwohnern. Das Kolchosendorf liegt 40 Kilometer entfernt von Czernowitz, der historischen Hauptstadt der Bukowina, die Teil der Habsburgermonarchie war.
Die Lehrkäserei zeigt der dortigen Bevölkerung neue Möglichkeiten der Produktion und Vermarktung ihrer Produkte auf und hatte ihren Ursprung in einer Idee von Ing. Anton Hagspiel. Dieser wollte ukrainischen Studenten, die bei ihrem Pflichtpraktikum in Vorarlberg die Vielfalt der Landwirtschaft bei uns kennenlernten, die Möglichkeit geben, ihr Wissen zum Wohle der landwirtschaftlichen Betriebe im eigenen Land umzusetzen. So konnte mit vielen Sponsoren eine Käserei errichtet werden, die Josef
Eberle plante und in Hittisau vorfertigte. Die Bauteile wurden per Auto vom Bregenzerwald in das 2000 Kilometer entfernte Schischkiwzi transportiert, wo von Eberle und einem Mitarbeiter innerhalb einer Woche die Montagearbeiten durchgeführt wurden. „Das Projekt ist sehr erfolgreich und es ergaben sich viele freundschaftliche Kontakte zur ukrainischen Bevölkerung. In der Käserei wird Milch zu Joghurt und Rahm sowie Hart- und Schnittkäse verarbeitet. Das ist gerade in der Kriegszeit von großer Bedeutung“, erläutert Josef Eberle. Für sein Unternehmen spielt die Alpwirtschaft eine große Rolle, denn sie ist neben der Herstellung von Metallmöbeln sein Hauptgeschäft. Der von ihm 1985 übernommene Betrieb, in dem auch Sohn Lukas tätig ist, arbeitet mit modernster CNC-Technik. Die Mannschaft besteht aus drei Meistern, drei Gesellen, zwei Lehrlingen, einem geschützten Arbeitsplatz und einer Bürokraft. Die Ausbildung der Fachkräfte erfolgt in Eigenregie über den Weg einer Lehre.


Möbel und Küchen Block in Meckenbeuren öffnet seine Türen für Designliebhaber und Einrichtungsbegeisterte. Mit Fokus auf modernem Wohnen und einem beeindruckenden Küchenstudio setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Stil und Funktionalität. Vom Minimalistischen bis hin zu Cosy Living bietet das Sortiment für jeden Geschmack das Passende. Alle Möbelstücke wurden sorgfältig ausgewählt, um höchste Qualität und Ästhetik zu gewährleisten. Das Team von Block zeichnet sich durch echte Fachkompetenz und pure Leidenschaft für Inneneinrichtung aus.



Norman und Beryl Huber lancieren ihre erste eigene Schmucklinie mit Glückssymbolen.
Ein Amulett, das Schutz verspricht. Oder ein Talisman als ständiger Glücksbegleiter. Menschen verbinden Glück seit jeher auch mit individuellen Symbolen. «Meine Glückszahl ist zum Beispiel die 13», sagt Norman J. Huber. Der Inhaber des gleichnamigen Uhren- und Schmuckunternehmens in Vaduz hat zusammen mit seiner Tochter Beryl eine eigene Schmucklinie kreiert, die sich dem zeitlosen Thema Glück annimmt.
Die neue Schmuckkollektion „Just Lucky präsentiert eine liebevoll gestaltete Auswahl an Glückssymbolen: Goldfisch, Kleeblatt, Hufeisen, Herz, Glückspilz, individuelle Glückszahl oder ein ganz persönlicher Glücksbringer. Diese lassen sich als Ring, Armband, Anhänger, Halskette und Ohrring kombinieren. Der Schmuck wird in Liechtenstein entworfen und in der Schweiz hergestellt.
Die verschiedenen Glücksbringer der Kollektion sind in zwei Ausführungen und Preiskategorien erhältlich: mit Brillanten und ausgewählten Edelsteinen sowie in verspielter, farbenfroher Keramik. «Da Glück immer eine persönliche Angelegenheit ist, können unsere Kundinnen und Kunden, ihren eigenen Glücksboten nach ihren Wünschen selbst gestalten», erklärt Beryl Huber, Geschäftsführerin des Weissen Würfels von Huber in Vaduz. «Just Lucky» bringt damit auch die Philosophie des Familienunternehmens auf den Punkt – nämlich Menschen mit schönen Dingen eine Freude und damit Glücksmomente zu bereiten.
Wer sich also zusammen mit Huber auf die Spuren des Glücks begeben will, ist herzlich in eines seiner Fachgeschäfte eingeladen. Norman und Beryl Huber mit Team freuen sich, die neue Schmuckkollektion in gemütlicher Atmosphäre zu präsentieren. Positive Vibes sind mit «Just Lucky» von und bei Huber garantiert.

HUBER FINE WATCHES & JEWELLERY
Kirchstraße 1, 6900 Bregenz, Telefon +43 5574 239 32 welcome@huber-juwelier.at, www.huber-juwelier.at

Igor Levit
Der gebürtige Russe (Jahrgang 1987) wuchs in Deutschland auf, wo Klavierexperten seine Hochbegabung früh erkannten. Der erfolgreich tätige Konzertpianist mit umfangreicher Diskographie ist seit dem Jahr 2019 auch Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In Vorarlberg trat er bei der Schubertiade sowie im Rahmen der Bregenzer Meisterkonzerte auf.
Neben ihrem eigentlichen Zweck regen die Plakate mit dem Schriftzug „The People United“ im Stadtbild von Bregenz zum Nachdenken an. Sie verweisen auf ein besonderes Ereignis, nämlich auf die Uraufführung eines einzigartigen Projekts, das der Pianist Igor Levit und der Choreograph Richard Siegal realisieren.
Für viele, die die Aufführung der „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson in der Interpretation von Igor Levit im März 2022 in Bregenz erleben durften, war klar, dass es ein Konzert ist, das lange nachwirkt. Für eine konkrete Folge dieses Ereignisses hat Judith Reichart gesorgt. Die Chefin des Kulturservice in der Vorarlberger Landeshauptstadt und Verantwortliche für die Meisterkonzerte hegte den Wunsch, den prominenten Pianisten Igor Levit auch für das Festival Bregenzer Frühling zu gewinnen. In dieser seit den späten 1980er-Jahren bestehenden Veranstaltungsreihe stehen der zeitgenössische Tanz sowie die Begegnung mit renommierten Gruppierungen aus aller Welt im Fokus. Zahlreiche Österreichpremieren haben stattgefunden, zu denen auch die Choreographie „Fêu“ von Fouad Boussouf zählt, die erst jüngst vom Ensemble Le Phare Centre choréographique national du Havre im Bregenzer Festspielhaus präsentiert wurde. Zuvor ließ Angelin Preljocaj seine Tänzerinnen und Tänzer mit seinem enormen Gespür für die Verbindung von Tradition und Gegenwart sowie brisante Themen wie Unterdrückung und Selbstbestimmung brillieren.
Bedeutend. Nun erwartet das Publikum eine Uraufführung. Der Pianist Igor Levit und der Choreograph Richard Siegal setzen das Werk „The People United Will Never Be Defeated“ von Frederic Rzewski (1938–2021) um. Dass ihm die von Judith Reichart initiierte Zusammenarbeit viel
Die
Uraufführung
des Projekts „The People United Will Never Be Defeated“ von Igor Levit und Richard Siegal mit dem Ballet of Difference findet am 18. Mai im Rahmen des Festivals Bregenzer Frühling statt.
bedeutet, brachte Igor Levit ihr gegenüber mit dem schönen Vermerk „das schenke ich dir zu Weihnachten“ zum Ausdruck. Kenner wissen, dass eine Einspielung von „The People United Will Never Be Defeated“ längst zur umfangreichen Diskographie von Levit zählt und dass er dem Werk eine Folge in seiner Podcast-Reihe widmete.
Die Betrachtung des Themas, das Frederic Rzewski seinen 36 Variationen zugrundelegte, ist aufschlussreich, denn es handelt sich um ein Lied des chilenischen Komponisten Sergio Ortega, mit dem der Protest gegen den Militärputsch von Augusto Pinochet in Chile zum Ausdruck gebracht wurde. Die Uraufführung hatte ebenso
Symbolwert, denn sie fand als kritisches Statement von Künstlern gegenüber der Regierung im Jahr 1976 in Washington im Rahmen der 200-Jahr-Feiern der USA statt. Die Vereinigten Staaten hatten die Pinochet-Diktatur bekanntermaßen unterstützt.
Im Gespräch, das vor wenigen Wochen mit dem Pianisten Igor Levit geführt werden konnte, kommt auch seine intensive Beziehung zu Frederic Rzewski zur Geltung.
Sie haben die Wahl für das Klavierwerk für die Produktion mit Richard Siegal beim Festival Bregenzer Frühling getroffen, und zwar für „The People United Will Never Be Defeated“ von Frederic Rzewksi. Ich nehme an, die Gründe stehen im Zusammenhang mit der Entstehung des Werks. Die Gründe sind vielfältig. Als Richard Siegal und ich uns getroffen hatten, haben wir darüber zu reden begonnen, wie man Musik, sozusagen Musik, wie ich sie spiele, quasi verkörperlichen kann, wie man ihr diese Dimension hinzufügen kann. Es ging darum, mit welcher Art von Musik man das machen kann.
Wir haben uns über verschiedene Stücke unterhalten und wie man diese körperlich erfahrbar machen kann. Ich sagte, wenn es ein Werk gibt, das das Gemeinsame, das Zwischenmenschliche, das Zusammenkommende zum Thema hat, dann sind es die „People United“-Variationen. Ich beziehe mich dabei auf dieses Hymnische in diesem Stück, aber auch auf den permanenten Struggle, auf das Sichbemühen, das permanent Arbeitende und auch das Ankämpfen und das Streiten für etwas und das Zurückkehren auf etwas Gemeinsames. Es war meine Initiative und es hat ihn auch überzeugt. Das Stück bedeutet mir die Welt. Ich habe es mehrere Jahre nicht mehr gespielt. Jetzt darauf zurückzukommen, ist sehr schön.
Der Komponist und Pianist Frederic Rzewski war einer Ihrer Professoren. Welche ganz persönlichen Erinnerungen haben Sie an ihn? Das ist für mich schwer zu beantworten. Es ist sehr ehrlich gemeint, ich habe immer wieder zu einer Freundin gesagt, wie sehr mir Frederic fehlt. Ich kann nicht etwas herauspicken, sa-

Igor Levit hat „The People United Will Never Be Defeated“ auch vor einigen Jahren aufgenommen.
Das Festival wurde heuer mit Choreographien von Angelin Preljocaj eröffnet.

Ich ermutige jeden, für diese freie Gesellschaft einzustehen, aber moralischen Druck aufbauen, das funktioniert auf lange Sicht nicht.
gen, diese Eigenschaft fehlt mir oder jene. Er war ein komplizierter Fall, aber in seiner ganzen Art, in seiner Glaubwürdigkeit, in seiner Ernsthaftigkeit und Unbestechlichkeit, war er eine Bezugsperson. Er hat eine große Rolle gespielt in meiner persönlichen Entwicklung. Mir fehlt unser Austausch, mir fehlen seine langen E-Mails. Wir sind auch ein paar Mal aneinandergeraten, wie das Freunde machen. Er fehlt mir enorm. Er ist immer noch Teil meines Lebens. Wie gesagt, jetzt zu diesem Stück zurückzukommen in dieser Form – das könnte keine größere Bedeutung haben.
Tragen Sie davon etwas in sich, wenn Sie aufs Podium gehen? Ja natürlich, ich habe „The People United Will Never Be Defeated“ aufgenommen und sehr viel gespielt und dann lange nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder zurückkehre, dann denke ich selbstverständlich an Frederic, ich nehme ihn mit. Wie gerne hätte ich, dass der Mann da ist.
Die Uraufführung findet am 18. Mai statt. Das heißt, die Choreographie für diese 36 Variationen steht oder ist auf jeden Fall in Arbeit. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Richard Siegal? Wir sind in Kommunikation, aber diese Kommunikation wird sich noch einmal verstärken, je näher der Abend kommt. Wir haben uns ausführlich darüber unterhalten, aber Siegal ist so ein herausragender Künstler, dass ich – und so ticke ich als Künstler grundsätzlich – vollstes Vertrauen, in das habe, was er tut. Wir treffen uns vor Ort und wir werden gemeinsam arbeiten. Natürlich steht die Choreographie, aber es wird sich alles sowieso noch einmal verändern.
Es gibt Passagen in diesem Werk, in denen auch den Interpreten bzw. Pianistinnen und Pianisten Optionen angeboten werden - etwa pfeifen oder perkussive Aktionen. Wie werden Sie es damit halten? Ich antworte ihnen mit einem Zitat von Rzewski: „Eine Improvisation ist eine Option, du entscheidest in dem Moment, ob du es tust oder nicht, wenn du es im Vorhinein entscheidest, dann ist es keine Improvisation mehr.“ Ich werde exakt in dem Moment die Entscheidung fällen. Ich werde keinen Deut an Gedanken vorher daran verschwenden.
Künstlerinnen und Künstler sollten sich in Zeiten eines Erstarkens des Rechtsextremismus positionieren. Kann so eine



Richard Siegal (im Bild oben mit Kulturservice-Leiterin Judith Reichart) hat mit zahlreichen renommierten Ensembles gearbeitet. Nach Bregenz kommt der Choreograph mit dem Ballet of Difference.
Aufführung auch in diesem Kontext stehen? Ich frage das auch wegen des Themas dieses Werks von Frederic Rzewski nach einem Protestlied des chilenischen Komponisten Sergio Ortega und weil die Uraufführung von „The People United Will Never Be Defeated“ 1976 in Washington zu den 200-Jahr-Feiern der USA stattfand und somit politische Aspekte berührte. Dass die Aufführung für mich in diesem Kontext steht, steht außer Frage, aber Künstlerinnen und Künstler sollen gar nichts. Sie können, sie müssen nichts, das muss kein Mensch, das ist eine freie Entscheidung. Wir sollten Menschen dazu ermutigen, sich zu positionieren, aber ermutigen ist nicht gleich der Zeigefinger. Mit dem Zeigefinger erreicht man relativ wenig. Ich ermutige jeden, für diese freie Gesellschaft einzustehen, aber zwingen, oder moralischen Druck aufbauen, das funktioniert auf lange Sicht, glaube ich, nicht. Christa Dietrich
Jetzt ist er das absolute Top-Modell von VW. Mehr High-Tech und mehr Kraft als dieser neue Spitzen-Touareg bietet kein anderes Erzeugnis aus Wolfsburg. Der Touareg R eHybrid TSI hat überhaupt nur wenige vergleichbare Konkurrenten. Die meisten von denen gehen noch mehr ins Geld.
Unter diesem Gesichtspunkt sollte man die 100.000-EuroMarke, die bei diesem Volkswagen der Extraklasse locker überschritten wird, entspannt betrachten. Wem der neue Touareg nicht genügt, der wird bei der Konkurrenz deutlich mehr hinzulegen haben.
Kein Angeber. So viel zum Thema Preis für einen Top-SUV. Wer sich so ein großes Format zulegt, hat sicher seine Gründe dafür und auch die entsprechenden Mittel. Im Fall des Touareg spielen Show, Sound und Imponiergehabe keine Rolle. Das Design
besticht zwar durch eine geschärfte Optik an der neuen Front- und Heckpartie. Der sportive Auftritt des R-Modells gibt noch eins drauf. Aber ein Angeber, ein auffallender Muskelprotz ist der SpitzenTouareg nicht.
Cooles Raum-Schiff. Eher ein cooles Raum-Schiff. Kaum aus der Ruhe zu bringen. Mit viel Platz für alle. Auch für große Menschen oder mehrere kleine. Nur wenn sehr viel einzuladen ist, fallen auch jene paar Liter ins Gewicht, die die Hochleistungsbatterie und das Ladekabel dem Kofferraum wegnehmen.

So ist das nun einmal in einem Hybrid. Hier fährt neben einem Verbrennungstriebwerk und einem Elektromotor auch eine doch ausladende Batterie mit. Das kostet Platz und erhöht das Gewicht. Bringt aber auch Vorteile, sehr wesentliche Vorteile. Nämlich Unabhängigkeit von Ladestationen, deren Verfügbarkeit und allerlei anderen Unwägbarkeiten der Total-Elektrifizierung.
Was beim Touareg R eHybrid bescheiden als effiziente E-Performance“ bezeichnet wird, ist das clevere Zusammenspiel einer 100 kW (136 PS) starken E-Maschine und eines Dreiliter-V6-Turbobenziners mit
250 kW (340 PS). Mitbeteiligt ist die bereits erwähnte Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie. Daraus resultieren eine stolze Systemleistung von 340 kW (462 PS) und ein maximales Systemdrehmoment von 700 Nm. In 5,1 Sekunden sprintet der große SUV von 0 auf 100. Nicht minder eindrucksvoll: bis zu 3,5 Tonnen schwere Anhänger kann der Power-Cruiser an die Kupplung nehmen. Eine Achtgangautomatik und ein Verteilergetriebe erledigen den Kraftfluss des permanenten Allradantriebs. Über die „Active Control“ und das Infotainmentsystem hat der Fahrer wesentlichen Einfluss auf alles was passiert auf der Straße und
VW Touareg R eHybrid TSI 4MOTION
Antrieb: V6-Turbobenziner, 2995 ccm, 250 kW/340 PS plus E-Motor, 100 kW (136 PS). Systemleistung 340 kW (462 PS)
Kraftübertragung: Achtgangautomatik, Verteilergetriebe
Verbrauch: WLTP-Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,2-2,9 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 23,9-25,1 kWh/100km (Werksangaben). Im Test: 7,0 bis 11,5 Liter.
Preis: 94.890 Euro, Testfahrzeug 110.290 Euro
im Gelände, auch auf den Verbrauch. Ein kreisrunder „Fahrerlebnisschalter“ auf der Konsole wirkt wie ein Relikt aus früheren Zeiten. Alles andere wird über das Infotainmentsystem gesteuert. Man begreift es relativ rasch. Talent fürs Digitale ist jedenfalls von Vorteil. Knöpfe, Schalter und ähnliche „Hardware“ sind diesem Touareg fremd.
Aus eigenem Antrieb. Vieles erledigt er selbsttätig. Beim Start greift der Hybrid stets auf den E-Motor zu, sofern die Batterie ausreichend geladen ist. Im Kurzstreckenbereich will er ja emissionsfrei fahren. Konsequent und mit einer Reichweite von

etwa 50 Kilometern funktioniert das allerdings nur mit einer eigenen Ladestation, daheim oder wo auch immer. Erst bei 135 km/h ist Schluss mit elektrisch. Ob elektrisch oder mittels Sechszylinder, ob Sport, Eco, Normal oder Comfort: Mit seiner Luftfederung und einer Fülle von Annehmlichkeiten hat sich der Touareg zu einem Hightech-Allrounder entwickelt, in dem man wie auf Wolken schwebt. Und nachts einen „Lichtteppich“ (VW über sein hochauflösendes „IQ.Light“) blendfrei vor sich ausbreitet. Natürlich untermalt von selbstgewählter Ambiente-Beleuchtung. So subtil geht SUV heute. Franz Muhr

Künstliche Intelligenz kann schon seit langem Bilder erschaffen und optimieren. Einer der ersten, der sich intensiv mit diesem Thema befasst hat, war Klemens Oezelt – sein Output ist so gut, dass sogar Hollywood und Netflix seinen Support suchen. „kontur“ hat ihn in seinem Loft-Büro in Wien getroffen.
Netflix. Bären, Monster und bizarre Wesen regieren in der neuen Serienwelt.
Klemens Oezelt startete seine Fotografenkarriere ganz klassisch mit einer Knipse-Kamera, gefühlt eine Million Jahre später – was die rasante Evolution seines neuen mächtigen Mediums skizziert – benutzt er eine Technologie, von der manche Leute glauben, sie sei das Tor zum Ende dieser Welt. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen sieht der gebürtige St. Pöltener die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (engl. AI = Artificial Intelligence) rosarot. „Als KI zum ersten Mal auftauchte, kannte sich keiner aus, aber mich hat es von Anfang an fasziniert, weil ich das Potenzial sofort erfasst habe. Obwohl 95% meiner Freunde damals sagten, dass es sinnlos und reine Zeitverschwendung sei, habe ich mich acht bis zehn Stunden am Tag reingekniet.“ Die Vielfalt an Möglichkeiten und die Komplexität des Programms, hauptsächlich Midjourney, wecken seinen Pioniergeist und seine Experimentierfreude: „Es gab keine Anleitung. Jeden Schritt habe ich mir erarbeitet und diese Lernerfolge haben mich immer weiter motiviert.“ So startete er als einer der Ersten im Land irgendwann einen AI-Instagram-Account – mit ungeahnten Folgen.
Eines Tages meldete sich ein Production Designer aus Los Angeles, der schon für Hollywood Filme rund ums DC Universe die surrealen Welten erschuf. „Es gibt Scouts, die weltweit nach AI-Accounts suchen. Irgendwann sind sie auf mich gestoßen und haben gefragt, ob ich nicht bei einer neuen Netflix-Produktion mitarbeiten möchte.“ So erfand er eine eigene Fantasy-Welt, in der Fabeltiere wie Waschbären & Co. in einem Setting á la „Der König von Narnia“ regieren, denn mittlerweile sind auch KI produzierte Filme keine Vision mehr. „Die Art meiner Bilder ist dafür geeignet – man kann ihnen Leben einhauchen.“ Inzwischen hat er an verschiedenen Storyboards zu KI-generierten Serien und Filmen mitgewirkt und eigene Charaktere entwickelt, unter anderem für einen der wohl bekanntesten Köpfe aus Hollywood. Parallel dazu lässt er für eine große Wiener Agentur KI-generierte Werbeträume wahr werden. Doch Klemens Oezelt bleibt bescheiden. Sein Wunsch: „Einfach weiter in das virtuelle Rabbit Hole eintauchen.“
Sprachbezogene konzeptuelle Kunst. Die Schwierigkeit bei der Erstellung eines KI-generierten Bildes ist die sprachliche Kunstfertigkeit, die sich Oezelt in über 20.000 Prompts – also schriftlichen Befehlen für die Erstellung von Fotos – erarbeitet hat. „Durch das intensive Auseinandersetzen mit der Materie habe ich irgendwann herausgefunden, wie man mit dem Tool spricht: Dabei beeinflusst allein die Reihenfolge der Worte am Ende das Ergebnis und auch mein spezifisches Fachwissen aus der Retusche hilft beim Color Grading.“ Sein Know-how aus der Fotografie, Malerei sowie dem Fantasy- und Gamingbereich ist ebenfalls dienlich, etwa beim Setzen der richtigen Lichtpunkte.

Feine Nuancen. Schnurrhaare, Lichtpunkte, Falten – jedes Detail ist akkurat.



Grannies. Auf dem Stahlgerüst oder im Boxring – dank KI.

Visionäre Kunst. Neben den Charakteren erweckt Klemens Oezelt ganze Welten zum Leben.
Weltraum. Storyboard zu einem intergalaktischen Abenteuer.

Mit derzeit maximal 400 Wörtern müssen die Mimik einer Person, ihre Bewegung, Kleidung, Umwelt, Gegenlicht, Tageszeit, etc. so formuliert werden, dass die KI am Ende das gewünschte Ergebnis ausspuckt. „Die Herausforderung besteht nicht darin, irgendein schönes Bild zu erzeugen, sondern ein exakt der Vorstellung entsprechendes und in der Folge ein komplettes Storyboard – also eine ganze Geschichte, mit über 1500 verschiedenen Fotos – in der eine Person aus verschiedensten Perspektiven und in unterschiedlichsten Situationen gezeigt wird und diese immer gleich aussehen muss. Nichts ist zufällig“, erklärt der Experte, der die komplexen Szenarien bereits im Vorfeld in seinem Kopf hat. Im Rahmen des Prompt Engineerings kann eine Darstellung unendlich oft wieder hochge-


laden werden, um sie immer weiter zu verändern oder die Geschichte fortzusetzen, d. h. die Hauptfigur erhält ein Schwert oder es kommen weitere Charaktere hinzu. „Ich schmiede das Bild inhaltsbasiert in die gewünschte Richtung. Mit der Zeit habe ich gelernt, welche Wörter wichtig sind und wie komplizierte Details abstrakt beschrieben werden können – es ist quasi eine eigene Sprache. Alles, was im Prompt nicht erwähnt wird, stellt die KI letztlich zufällig dar. Deswegen reduziert sich meine Eingabe auf das Wesentliche“, so die Essenz seines impliziten Wissens.
Mit diesem Know-how reist er nun virtuell durch die Zeit und erzeugt Bilder vom Bau der Chinesischen Mauer oder erweckt das Buch der fünf Ringe von Miyamoto Musa-
shi, über japanische Kampfkunst, zum Leben. „Wenn ich etwas generiere, habe ich das Gefühl, dass ich in mein Unterbewusstsein eintauche und genau die richtigen Dinge heraushole. Es ist eine Art visionäre Kunst, bei der sich die eigene Individualität und Subjektivität letztlich im Output abbilden und die Grenzen nur mehr im eigenen Verstand liegen“, bringt Klemens Oezelt das unerschöpfliche Potenzial auf den Punkt. Charmante „Makel“ wie Sommersprossen, Narben, Falten, Nasenhaare inklusive, denn diese lassen das Bild letztlich nur noch realer und sympathischer erscheinen.
Wenn Oma in den Boxring steigt. Neben den Storyboards und Agenturaufträgen arbeitet der 38jährige derzeit an der Illustration eines Kinderbuches, an abstrak-
„Wenn ich Bilder oder ganze Storyboards generiere, habe ich das Gefühl, dass ich in mein Unterbewusstsein eintauche. Es ist eine Art visionäre Kunst, bei der die Grenzen nur mehr im eigenen Verstand liegen.“

ten Bildern, die entfernt an die surrealen Szenerien und Gemälde von Salavdor Dali erinnern sowie an unmöglichen Darstellungen, sprich Inhalten, die so in der Realität nicht existieren wie etwa Omas auf einem Jetski, im Boxring oder einem Stahlgerüst eines New Yorker Hochhauses: „Der Aufwand, um eine solche Szenerie tatsächlich zu shooten, wäre enorm, wenn nicht sogar undurchführbar. KI als Hilfsmittel macht alles so viel schneller und einfacher. Man kann die Arbeit zu jeder Zeit durchführen und mit den richtigen Eingaben verbinden sich Realität und Fiktion auf wunderbare Weise. Auch (Werbe-)Konzepte und Ideen können rasch und kostengünstig umgesetzt werden, um Kunden oder Geschäftspartnern einen ersten visuellen Eindruck zu vermitteln“, unterstreicht der KI-Profi die Vorteile.
Lichtgeschwindigkeit. Beeindruckend ist in diesem Zusammenhang tatsächlich die Schwuppdizität, mit der sich die neue Technologie perfektioniert: „Wir hatten noch nie ein Werkzeug, das sich schneller weiterent-
wickelt hat, als wir es tun. Es macht Überstunden, während wir schlafen“, fasst Klemens Oezelt die Evolution des Programms zusammen. Das Tempo der Updates ist rasant und mit jeder Verbesserung ändert sich der Algorithmus, was wiederum die Formulierung der Prompts beeinflusst.
Apropos Wortwahl: Die KI ist auf eine positive Sprachformulierung getrimmt und beim Thema Gewalt und Nacktheit durchaus sensibel, d. h., Worte wie „schießen“, „Schwert“ oder „nackt“ sind geblockt. „Wenn das Storyboard nun aber vorgibt, dass jemand aus der Nase blutet oder ertrinkt, muss es geschickt mit positiv besetzten Begriffen umschrieben werden, etwa mit Marmelade statt Blut oder Ertrinken statt Tauchen – viele geben einfach die falschen Prompts.“ Was uns das sagt? Am Ende ist jede Technologie eben nur so gut, wie der Mensch, der sie bedient… aber wer weiß, vielleicht emanzipiert sich die KI irgendwann, wird empfindungsfähig, und distanziert sich von der natürlichen Intelligenz. Christiane Schöhl von Norman

Gottheit. In dieser Geschichte spielen die Götter des alten Ägyptens die Hauptrolle.

Der Dornbirner Bernhard Ölz entwickelt seit 30 Jahren Quartiere und tüftelt nach zukunftsträchtigen Formen des Zusammenlebens.
Über der Grenze ist Bernhard Ölz Schlossherr. Der dreigeschoßige, nahezu quadratische Barockbau mit Mansarddach und verspielten kleinen Gauben befindet sich in der deutschen Stadt Singen am Hohentwiel, gute eineinhalb Autostunden von der Prisma-Holding in Dornbirn entfernt. „Schlossherr“ und Besitzerfamilie (50% Prisma, 50% Familie Vetter von der Lilie), das Adelsgeschlecht Vetter von der Lilie, wollen der Friedenslinde-Kreuzung ein neues Gesicht geben. 12.503 Quadratmeter Gelände, das entspricht in etwa zwei Fußballfeldern, sollen Quartier werden: Schlossquartier. Was den 60jährigen Prisma-Gründer am meisten freut, ist, dass mit der Neugestaltung der dazugehörige Park erstmals öffentlich zugänglich wird. Eine grüne Oase mit großen, alten Bäumen, Pfingstrosen und historisch angelegtem Stadtgarten aus dem Jahr 1909, umgeben von historischem
geb. 20. April 1963 in Dornbirn, Studium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur, Wien, Studium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Technische Universität Wien, 1989 entec environmental technology, Fußach, 1990 Eintritt in die Zima-Unternehmensgruppe; ‚Aufbau VWP Vorarlberger Wirtschaftspark Götzis, 1994 Gründung der Prisma Holding AG

Ambiente und dynamischer Urbanität. Dazu ergänzt ein adäquater Vorplatz zum Schloss das harmonische Gestaltungskonzept und schließt mit vier zusammenhängenden Baukörpern auf einer zweigeschoßigen Tiefgarage zur Straße hin ab. Nicht zu vergessen die Multifunktionalität aus Wohnen und Arbeiten, Bildung und Coworking-Spaces, Einkaufen und Kinderbetreuung, Kultur und Freizeit sowie Begegnungszonen und gesellschaftliche Integration. Die Zukunft beginnt im Heute. Mit dem geplanten Spatenstich als erster Schritt der baulichen Realisierung des 50-Millionen-Projektes.
Handschlagqualität. Das Schlossquartier ist der insgesamt 93. Standort, den die Prisma-Gruppe von Ölz entwickelt. Der Diplomingenieur baut auf Erfahrung. „Es ist genau 30 Jahre her, dass ich Prisma gegründet habe“, erzählt der Dornbirner. „Damals war ich
Quartiersentwicklung.
Das Schlossquartier in Singen am Hohentwiel ist das 93. Projekt von Prisma.


„Es ist genau 30 Jahre her, dass ich Prisma gegründet habe. Damals war ich allein, hatte mein Büro im Keller des Vorarlberger Wirtschaftsparks und wollte mit meinen Visionen in Sachen Quartiersentwicklung hoch hinaus.“
allein, hatte mein Büro im Keller des Vorarlberger Wirtschaftsparks und wollte mit meinen Visionen hoch hinaus.“ Mit seiner Ehrlichkeit, der konsequenten Art, mit der er seine Visionen verfolgte und mit Entwicklungen, die Hand und Fuß hatten, fand er in Hermann Metzler und Paul Sutterlüty Partner, die ein Expandieren ermöglichten. „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, wo ich heute stehe, ich hätte es niemals glauben können.“ 88 Gebäude an 40 Standorten mit über 1000 Mietern sind im Bestand der Unternehmensgruppe. Projekte wie Acht Zwei Vier in Salzburg, Dichter4 in Ulm und Lustkandlgasse in Wien sind gerade in Umsetzung und haben eine Größenordnung von rund 150 Millionen Euro. Und dass trotz gebeutelten Zeiten mit gestiegenen Material-, Bau und Energiekosten, explodierten Zinsen, Kim-Verordnung, Krisenstimmung und wirtschaftlichen Unsicherheiten. „Das Wachstum ist zwar gebremst, aber wir wachsen“, antwortet Ölz, noch bevor die auf der Zunge liegende Frage ausgesprochen wird. Die Begründung folgt in einem Atemzug: „Wir haben und hatten immer eine sehr konservative Finanzpolitik und halten schon etwas aus.“
Städtisches
Quartier. Schwerpunkt der Zentrumsentwicklung Am Garnmarkt ist die Durchmischung von Einkaufen, Arbeiten und Wohnen.
Ab wann es brenzlig geworden wäre? „Mitte des vergangenen Jahres haben wir Stressszenarien durchgespielt“: „Eine Steigerung von mehreren Prozentpunkten Zinsen wären anstrengend geworden.“ Davon sei man jedoch weit entfernt. Vielmehr ist eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau zu erwarten. Vielleicht eine moderate Senkung. Doch Jammern ist für ihn seit jeher fehl am Platz. Es gab Zeiten in den 1980er- und 90er-Jahren mit Zinsen in Höhe von acht bis neun Prozent und Kontokorrentkrediten mit 13 Prozent. „Wir können damit umgehen“, stellt der Quartiersentwickler klar.
Kleiner Akt, große Zukunft. Lieber greift der gesellige Geschäftsmann nach einem Glas Sekt, um auf die bauliche Halbzeit des Gebäudes Am Garnmarkt 17 in Götzis anzustoßen. Das Fitnessstudio Good Life Sports sowie ein Asia Restaurant und ein Asia Lebensmittelmarkt werden den vorhandenen Branchenmix bereichern. Die Vielfalt ist es nämlich, die den Garnmarkt ausmacht und die dem Projekt den ersten Platz beim Walk-Space Award 2013 und auch beim Shoppingcenter Performance Report 2019 einbrachte. Bei einer Konkurrenz von 130 österreichischen Einkaufszentren ist das beachtlich. Überhaupt ist die Quartiersentwicklung in Götzis ein Vorzeigeprojekt zur Zentrumsgestaltung in Vorarlberg. Auf der ehemaligen Fläche von Huber Tricot sind alle Voraussetzungen erfüllt, was für eine lebendige, lebenswerte und inklusive Gemeinschaft von Bedeutung ist. Urban, umweltverträglich und generationsübergreifend. Komfortabel aufgrund kurzer Wege und fußläufigem Einkaufen im Lebensmittelmarkt und beim Bäcker. Durchmischt von Wohnen und Arbeiten, von Freizeit und Bildung, von Kultur und Gastronomie. Außerdem sehen 21 Wohneinheiten betreubares Wohnen vor. Für Senioren, die noch fit genug sind, sich großteils selbst zu organisieren, aber im Bedarfsfall auf Hilfe zurückgreifen können. „Wir sind ein Unternehmen, das in der Region sehr viel gestalten darf.“ Das gilt nicht nur für das räumliche Gestalten von Quartieren, sondern auch für das gesellschaftliche Leben.
Zukunftsmodell. Das Stadtwerk Salzburg ist ebenfalls ein Leuchtturm-Projekt. Die Entwicklung eines funktionierenden Quartiers anstelle des alten Gaswerkes hätte ihnen keiner zugetraut. Der Salzburger Stadtteil Lehen galt als sozialer Brennpunkt, Betonwüste und Dauerstau-Gebiet. Erfahrung hin oder her. Ölz sah seine Chance, darin das Unmögliche möglich zu machen und ein Zentrum rund ums Lernen, Leben und Arbeiten zu realisieren. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) mit ihren Studiengängen Humanmedizin, Pharmazie und Pflegewissenschaft bildet hunderte Studierende aus und betreibt nebenbei Forschung. Ergänzt durch innovative Unternehmen und Startups, viele ebenfalls aus dem Bereich Gesundheit und Medizin, und durch die Nähe zum Uniklinikum entsteht auch eine inhaltliche Vernetzung. Ergänzend dazu gibt
es weiter Bildungseinrichtungen, wie Volkshochschule, Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung, BiBer Bildungsberatung, Salzburger Bildungswerk und Kulturverein Società Dante Alighieri. Stadtgalerie, Fotohof, Stadtbibliothek und Literaturhaus tragen ebenso zu einem lebendigen Miteinander bei. „Durchmischte soziale Strukturen sollen in einer fruchtbaren Symbiose gelebt und gefördert werden“, erklärt Ölz. Der Chef könnte stundenlang über das Stadtentwicklungsprojekt erzählen. Überhaupt könnte Bernhard Ölz stundenlang erzählen. Das bringt seine Tätigkeit mit, das viele Unterwegssein, das Kennenlernen von interessanten Menschen, die Gespräche. „Friedrichshafen zum Beispiel“. Ölz lehnt sich zurück, verschränkt die Hände. Die Projekte See.Statt Friedrichshafen sowie Competence Park Friedrichshafen gehen auch auf das Konto von Prisma. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technologie und Engineering, Wirtschaftsdienstleistung sowie Aus- und Weiterbildung. Dazu führende Unternehmen wie MTU, ZF, Rolls-Royce Power Systems, Zeppelin Luftfahrttechnik, Liebherr oder der IT-Dienstleister doubleSlash Net-Business. Letzterer hat seinen Standort im „Competence Park Friedrichshafen“ in der Otto-Lilienthal-Straße 16 von der Prisma Unternehmensgruppe als zukünftiges Zentrum des Bodensee-Valleys. In der Zeppelinstadt gibt es außerdem ein Testfeld für automatisiertes Fahren, kurz Alfried genannt. Die 5,5 Kilometer lange Kernstrecke verläuft innerhalb der Stadt und ist an die Bundesstraße B31 angebunden.
Ziel ist die Entwicklung von zukünftigen Mobilitätskonzepten, Erprobung neuartiger Technologien oder branchenübergreifende Kooperationen zu Mobilitätsthemen. Ölz‘ Begeisterung steckt an.
„Mobilität und Quartierentwicklung gehören zusammen.“ Statt Alfried kommt ihm immer wieder Alfredo über die Lippen. So heißt nämlich sein Kater, der ihm morgens beim Frühstück Gesellschaft leistet. Dennoch käme eine Tasse Kaffee jetzt gerade recht. Erst kürzlich erzählte ihm jemand vom Schwarmkonzept mit Individualverkehr-Komponente. „Der Clou dabei sind die Cabs“, berichtet der Mehrheitsaktionär. Sie seien für kurze Strecken ausgelegt und holen die Verkehrsteilnehmer direkt vor der Haustüre ab. „Das ganze steht auch im Kontext mit unserer Zukunftsvision“, sagt Ölz und fügt hinzu: „Unser Beitrag, den wir für die Entwicklung von Regionen beitragen können, ist, dass die Leute gerne dort wohnen und arbeiten.“ Dafür müssen Mosaiksteine gut und sinnvoll zusammengefügt werden. Mobilität ist so ein Mosaikstein, auch wenn das Schwarmkonzept derzeit noch Zukunftsmusik ist. „Aber wir haben es im Hinterkopf“, sagt Ölz. Seine Vision der Zukunft ist nicht mehr das Wachstum, sondern Standorte in die Tiefe weiterzuentwickeln.
Apropos Tiefe. Was vor 30 Jahren im Keller gestartet ist, befindet sich heute im Campus V an der Hintere Achmühlerstraße 1 im fünften Stock. Der Ausblick reicht über den Bodensee hinweg nach Süddeutschland und auf der anderen Seite bis zum Säntis. Weitblick ist eines der Geheimrezepte.
Und weil gute Gespräche verbinden, gibt Bernhard Ölz noch eine kleine Intimität preis. „Im privaten Kreis mache ich gerne den DJ.“ Dann gibt er sich ganz der Musik hin, tankt neue Energie und denkt auch mit 60 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Marion Hofer
„Eine Vision Mobilität ist das Schwarmkonzept mit Individualverkehr-Komponente. Cabs holen auf Abruf die Verkehrsteilnehmer direkt vor der Haustüre ab.“

Erfolgreiche Quartiersentwicklung. In der See.Statt Friedrichshafen haben 18 Firmen aus den Bereichen Technologie und Engineering ihren Sitz. In unmittelbarer Nähe zur Altstadt Salzburgs, liegt das Stadtwerl, ein durchmischter innerstädtischer Arbeits-, Wohn- und Lebensraum.


Büromöbel können dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter(innen) wie zu Hause fühlen und gleichzeitig produktiv sind. Die neuesten
Trends meistern diesen Spagat und vereinen Komfort und Professionalität.
Die Dynamik zwischen Homeoffice und Büropräsenz hat eine vielschichtige Debatte über die Vor- und Nachteile beider Arbeitsmodelle entfacht. Während das Homeoffice durch seine Flexibilität und den Komfort des häuslichen Umfelds besticht, bietet der Büroarbeitsplatz unbestreitbare Vorteile in Bezug auf Ausstattung und die Förderung des direkten Austauschs unter Kolleg(inn) en. Diese Interaktion ist wesentlich für die Entwicklung kreativer Prozesse und die Beschleunigung wichtiger Entscheidungsfindungen, was wiederum den Weg für Innovationen im Arbeitsalltag und in der Wirtschaft ebnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Gestaltung von Büroräumen, die Gemütlichkeit mit Effizienz verbinden, zunehmend an Bedeutung. Ein harmonisch gestaltetes Büro leistet einen entscheidenden Beitrag zum Wohlbefinden und zur Produktivität der Mitarbeitenden. Moderne Büromöbel
spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie die Brücke zwischen dem Komfort des Homeoffice und der Professionalität des Büros schlagen. Ob Lounge-Bereich, Konferenz- oder Zwischenzone: Verschiedene Sofaprogramme und die dazu passenden Tische bringen für jede Situation nicht nur Leichtigkeit und Kreativität in den Büroalltag, sondern auch ein Stück Heimat.
FLEXIBILITÄT UND KOMFORT
„In der modernen Arbeitswelt ist Flexibilität nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Grundvoraussetzung für produktives Arbeiten“, sagt Guntram Paterno, Geschäftsführer der Paterno Bürowelt in Dornbirn. Kleine Tische und vielseitige Ablageflächen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz bieten praktische Lösungen für den flexiblen Austausch und die kurze Kaffeepause zwischendurch.

Ob als Anbau-, Beistell-, Ablage- oder Eckelement, sie bieten ausreichend Platz für die unverzichtbaren Begleiter des Büroalltags wie Smartphones, Laptops oder Tablets. Die Integration von Steckdosen und USB-Anschlüssen in moderne Büromöbel ist ein entscheidender Faktor für einen reibungslosen Arbeitsablauf, da sie es ermöglichen, jederzeit und komfortabel die Geräte zu laden. Diese praktische Lösung, versteckt im Design der Möbel, schafft nicht nur Ordnung im Kabelsalat, sondern fördert auch die Effizienz und Flexibilität im Büroalltag. In diesem Kontext der modernen und funktionalen Bürogestaltung spielt auch die Anordnung der Möbel eine wesentliche Rolle, insbesondere bei der Durchführung von Videokonferenzen. Durch die diagonale Anordnung der Sofaelemente haben sich die Meeting-Teilnehmer(innen) gegenseitig gut im Blick und können gleichzeitig die präsentierten Inhalte sehen. Das unterstützt bei hybriden Besprechungen ein Gefühl von Gleichberechtigung und Gemeinsamkeit, indem sie eine offene und inklusive Kommunikationsatmosphäre schafft. Somit ergänzen sich die durchdachte Integration von Technologie in Büromöbel und die intelligente Raumgestaltung. Sie fördern eine optimale Arbeitsumgebung, die sowohl die praktischen Bedürfnisse des modernen Arbeitslebens als auch den menschlichen Aspekt der Zusammenarbeit berücksichtigt.
Die Individualisierung der Büroeinrichtung spielt eine zentrale Rolle, um den unterschiedlichen Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu werden. Die Auswahl reicht von Einzelsofas bis hin zu Insel-Konstellationen, von einfarbigen bis zweifarbigen Designs, von Stoff bis Leder. Die Vielfalt der Optionen und Kombinationen
ermöglicht es, ein einzigartiges und einladendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Grenzen zwischen Büro und Zuhause verschwimmen lässt. Die klare Linie und Form der Büromöbel lassen sie für jede Gelegenheit und Situation solide und dennoch harmoinisch wirken. Büropflanzen ergänzen dieses Bild, indem sie für eine ausgeglichene und entspannte Atmosphäre sorgen und so einen wertvollen Beitrag zum Stressabbau leisten. Zudem steigern sie die Luftqualität und machen Arbeitsräume lebendiger und einladender. In einem solchen Umfeld fällt es leicht, sich wohlzufühlen und produktiv zu sein.
In der Zusammenführung dieser Elemente – von der funktionalen Ausstattung über flexible Möbellösungen bis hin zur persönlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes – offenbart sich die Vision des modernen Büros. Es ist ein Ort, der sowohl die professionellen Anforderungen erfüllt als auch ein Gefühl von Zuhause vermittelt. Guntram Paterno fasst es treffend zusammen: „Moderne wohnliche Büromöbel sind weit mehr als bloße Einrichtungsgegenstände; Sie sind Bausteine, die das Beste aus dem Wohnbereich und dem Büro vereinen.“ Diese harmonische Verbindung schafft eine Atmosphäre, in der sich jede(r) willkommen und wertgeschätzt fühlt.

se:living
Der Büroalltag mit seinen täglichen To-dos und Meetings erfordert gute Planung, Kommunikation und volle Aufmerksamkeit. Leichter wird’s, wenn dabei eine angenehme und produktive Atmosphäre herrscht. Das Sofa se:living und die dazu passenden Tische machen genau das: Sie sorgen für Leichtigkeit sowie Kreativität und bringen Wohnlichkeit in den Arbeitskontext. Die bequeme Polsterung verspricht Komfort in jeder Situation.


Alles für das moderne Büro.
Paterno Bürowelt
Forachstr. 39 | A-6850 Dornbirn Tel. +43 (5572) 3747
info@paterno-buerowelt.at www.paterno-buerowelt.at
Paterno Bürowelt GmbH & Co KG
A-6850 Dornbirn | Forachstr. 39|+43 (5572) 3747 | Messepark | +43 (5572) 949799
info@paterno-buerowelt.at|www.paterno-buerowelt.at
DYNAMISCHFirmament ist ein Raum für Ideen, Kreativität und Wachstum. In den vielseitigen Seminarräumlichkeiten ist jedes Business-Event von Erfolg gekrönt.
Jedes Unternehmen, egal ob lokal agierendes KMU oder multinationaler Konzern, strebt nach kontinuierlicher Entwicklung und dem Setzen neuer Impulse. Dies erfordert Raum für Kreativität, Möglichkeiten für Wachstum und Teambuilding. Firmament schafft Erlebnisse, die noch lange im Gedächtnis der Mitarbeiter bleiben. In einer Location, die so vielfältig ist, wie die Ideen selbst.
IDEENREICH
Nicht nur ein Name, sondern ein Erlebnis. Unser neu gestaltetes 77 m2 großes IdeenReich im Obergeschoß des Firmament ist ein einladender und inspirierender Raum für persönliches und berufliches Wachstum. Mit hochwertigen Loungemöbeln gestaltet und modernster Präsentationstechnik ausgestattet, schafft das IdeenReich ein ideales Umfeld für kreative Prozesse. Großzügige Fensterfronten mit Blick auf die Berglandschaft und die gegenüberliegende Glaswand durchfluten den Raum mit natürlichem Licht. Bei Bedarf sorgt ein Vorhang für zusätzlichen Sichtschutz. Für kreative Sessions sind darüber hinaus viele großzügige BreakOut Möglichkeiten geeignet. Zusätzlich bieten – dem individuellen

Unvergessliche Sommer-Events sind garantiert.
Firmament greift mit Ihnen nach den Sternen und schafft ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.
Event entsprechend – vier weitere einladende Seminarräumlichkeiten, die großzügige Empore oder Eventhalle genug Raum für Entfaltung und vielseitige Veranstaltungsmöglichkeiten. Wir laden ein zum Eintauchen in eine Welt voller Ideen und Innovationen.
VORFREUDE SOMMER
Bei uns ist Innovation Programm, und das wissen unsere Kunden nur allzu gut. Die warme Jahreszeit lädt zum Feiern ein, und wir haben ein weiteres aufregendes Konzept entwickelt, um die kulinarischen Freuden ins Freie zu bringen: Das Firmament-Sommerfest Streetfood-Special verspricht eine Weltreise der Geschmäcker, die Menschen zusammenbringt. Unsere kreativen Gerichte werden an eigenen Seidl Catering Marktständen in Form eines Buffets präsentiert. Ein besonderes Highlight ist unser "Beerdorado": internationale Flaschenbiere auf Eis, frei zugänglich für die Gäste über das Gelände verteilt. Altbewährtes trifft auf Kreatives: Das Firmament verwandelt jede Kulisse – sei es die Terras-

Im IdeenReich wird kreatives Arbeiten zum Kinderspiel.
se, der Grillgarten oder der einladende Vorplatz – in die perfekte Location für jeden Anlass. Ob Grillfest, Firmenfeier mit Hüpfburg, Markt oder Open-Air-Festival – indoor sowie outdoor, hier wird jedes Event unvergesslich.
GENUSS VERBINDET
Das haben Events bei Firmament und mit Seidl Catering gemeinsam: Die kulinarische Erfahrung geht über den reinen Genuss hinaus. Durch die Verwendung von regionalen und nachhaltigen Produkten betont Firmament sein Engagement für Qualität und Umweltschutz. Unter der Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Ernst Seidl wird jedes Event, egal ob Seminar oder Sommerfest, zu einer Gelegenheit für gemeinsame Erlebnisse und offenen Austausch, bei dem die Verbindung zwischen den Gästen gestärkt und die Sinne verwöhnt werden.
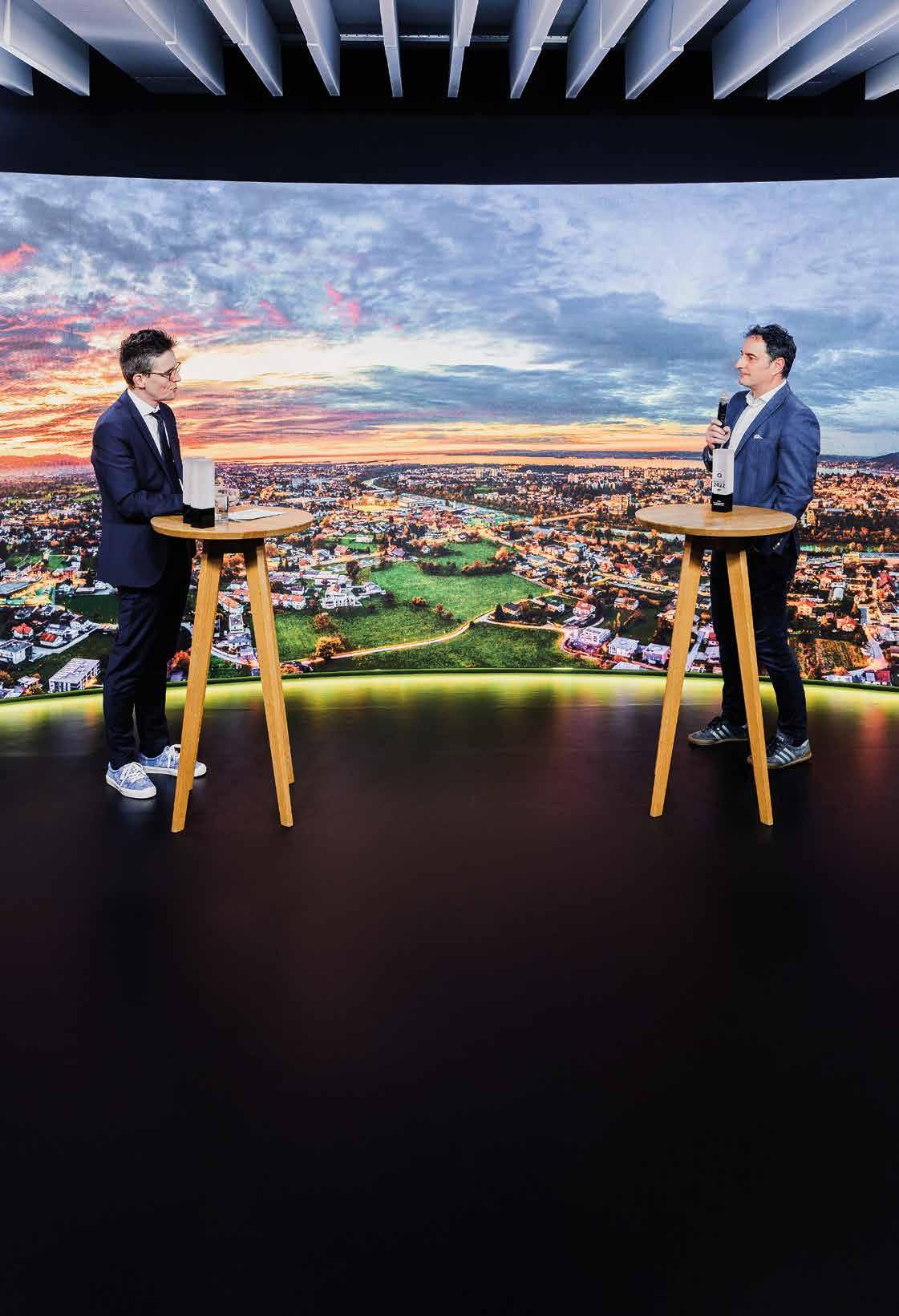
Die heimischen Konsument(inn)en vertrauen beim Kauf auf ihre regionalen Traditionsmarken. Eine hohe Qualität, ehrliche Kommunikation und überdurchschnittliche Servicequalität bilden die Grundlage für diese Kundentreue –und das trotz eines immer intensiver werdenden Wettbewerbs. Auch die Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle.
Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben eine innige Beziehung zu regionalen Marken und sind auf diese sehr stolz. Das untermauern auch die hohen Weiterempfehlungsraten.

Marken sind wichtig, weil sie in den Köpfen der Kundinnen und Kunden Vorstellungsbilder erzeugen und einen Vertrauensanker bilden. „kontur“ hat Dr. Wolfram Auer, Institut für Management & Marketing, getroffen und ihn auf Basis einer jährlich durchgeführten Studie zur Bindungsqualität der heimischen Bevölkerung an regionale Marken befragt.
Worauf basiert diese starke Markenbindung? Vertrauen in eine Marke ist der Treibstoff für die Loyalität zum Produkt. Die Befragten entscheiden sich immer für Marken, denen sie vertrauen und nicht für jene, über die sie nichts wissen. Gerade bei uns wird sehr stark auf die Produktqualität geachtet. Es herrscht grundsätzlich ein sehr großes Vertrauen in die heimischen Produkte und Marken, da sich die Befragten sicher sind, dass die Qualität gleichbleibend hoch ist.
Was ist die Zielsetzungen der Analyse? Wir möchten mit den Untersuchungen aufzeigen, welchen Stellenwert die Vorarlberger Marken bei der heimischen Bevölkerung
haben und diese dadurch zusätzlich stärken. Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurden zwei neue Kategorien für die Evaluierung mitaufgenommen, welche eher nicht erwartete Ergebnisse lieferten. Die neuen Messfaktoren betreffen die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz im Rahmen der regionalen Produkterstellung.
Was hat sich geändert? Sie führen die Untersuchung seit 2018 jährlich durch . . . Als weitere kaufentscheidende Faktoren sind in der Analyse gegenüber den Vorjahren, die Ehrlichkeit und Offenheit der heimischen Produzenten sowie der Kundenservice in den Vordergrund gerückt und noch wichtiger geworden. Gleichzeitig wurde aber auch beanstandet, dass die regionalen Produkte, durch den Einfluss der Inflation, außergewöhnlich teuer geworden sind und deshalb weniger gekauft werden.
Daten und Fakten zur Umfrage:
Im Auftrag von VOL.AT führte das Institut für Management & Marketing (Lustenau), in den Monaten November und Dezem-
ber des vergangenen Jahres, eine Studie zum Thema „Vorarlberger Marken“, bei der heimischen Bevölkerung, durch. Die Datenerhebung wurde mittels einer „OnlineBefragung“ abgewickelt und dabei insgesamt 497 Fragebogen in die Auswertung aufgenommen.

„Erstmals wurde heuer den Proband(inn)en die Möglichkeit gegeben, auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.”
Dr. Wolfram Auer, Institut für Management & Marketing

Zu Beginn wurde die ungestützte Bekanntheit von Vorarlberger Marken und/oder Produkten evaluiert und wie diese von den Befragten weiterempfohlen werden. Zusätzlich konnten die Proband(inn)en die Gründe angeben, wieso sie diese Marken und/oder Produkte kaufen beziehungsweise nicht kaufen. Erstmals wurde heuer den Proband(inn)en die Möglichkeit geboten, Vorarlberger Unternehmen zu nennen, die bei der Herstellung ihrer Produkte, besonders auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit achten.
Ein weiterer Fragenblock hatte zum Ziel, die ungestützte Bekanntheit von Arbeitgebermarken aus dem Bundesland Vorarlberg und deren Weiterempfehlung zu messen. Zusätzlich konnten die Befragten drei heimische Lieblingsmarken, auf welche sie nicht verzichten möchten, in offener Form nennen und Aussagen darüber machen, wie sich das persönliche Einkaufsverhalten in Zukunft verändern wird. Spitzenwerte erzielten die Mohrenbrauerei, Sutterlüty und Vorarlberg Milch. Ernest F. Enzelsberger
Bekanntheit generell
1. Mohrenbrauerei
2. Vorarlberg Milch
3. Brauerei Frastanz
Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte
1. Vorarlberg Mehl
2. Mohrenbrauerei
3. Vo üs Vorarlberger Limo
Bekanntheit Nachhaltigkeit
1. Sutterlüty
2. Vorarlberg Milch
3. Alpla
Bekanntheit Klimaschutz
1. Sutterlüty
2. Blum
3. illwerke vkw
Bekanntheit Arbeitgeber
1. Blum
2. Sutterlüty
3. Rauch Fruchtsäfte
Weiterempfehlung als Arbeitgeber
1. Vorarlberg Milch
2. Sutterlüty
3. Rudolf Ölz Meisterbäcker
Unverzichtbarste Vorarlberger Marke
1. Mohrenbrauerei
2. Vorarlberg Milch
3. Brauerei Frastanz
Beste Marke 2023
1. Mohrenbrauerei und Sutterlüty
2. Vorarlberg Milch
3. Vorarlberg Mehl
Quelle: Studie zum Thema „Vorarlberger Marken“, Durchführung: November bis Dezember 2023, Datenerhebung mittels Online-Befragung, Auswertung von 497 Fragebogen.
Blum setzt auf Bedürfnisforschung, Innovation und Teamwork in internationalem Umfeld, um sich den kommenden Herausforderungen zu stellen.

Unauffällige und platzsparende
Beschläge: AVENTOS HKi, perfekt integriert in der Korpusseitenwand.
Bei seinen Beschlagslösungen strebt Blum immer nach der perfekten Bewegung. Um dies zu erreichen, bedarf es konsequenter Entwicklungsarbeit und großer Innovationskraft.
Warum ist es für einen Beschlägehersteller so wichtig, Bedürfnisforschung zu betreiben? Ganz einfach: Weil es bei Blum um noch so viel mehr geht, als darum: Schranktüren zu öffnen und zu schließen. Das Unternehmen aus Höchst beschäftigt sich mit vielen Fragen – zum Beispiel: welche Trends werden unsere Wohnungen und Häuser in den kommenden Jahren verändern? Wie muss der Stauraum angeordnet sein, um die Wege in einer Küche möglichst kurz zu halten? Und wie kann der Bewegungskomfort auch in allen anderen Wohnbereichen erhöht werden? Antworten darauf sucht und findet die Abteilung Forschung und Entwicklung bei Blum im engen Austausch mit Kunden und Partnern in der Möbelbranche. Zum Einsatz kommen dabei auch Hilfsmittel wie eine vollausgestattete Laborküche oder der Alterssimulationsanzug AgeExplorer©.
INNOVATIONEN.
Eines zieht sich dabei durch alle Überlegungen: Bei seinen Beschlagslösungen strebt Blum immer nach der perfekten Bewegung. Um dies zu erreichen, bedarf es konsequenter Entwicklungsarbeit und großer Innovationskraft. Rund 2100 weltweit erteilte Schutzrechte und die alljährliche „Top Ten“-Platzierung beim Ranking des Österreichischen Patentamts belegen dies

Mit AMPEROS sind Licht, Ladefunktion und die Verwendung von elektrischen Geräten in und auf beweglichen Möbelteilen möglich. Fotos: Julius Blum GmbH,
Offene, unkomplizierte Zusammenarbeit und Dinge gemeinsam vorantreiben – das zeichnet Arbeiten bei Blum aus.
eindrücklich. Bestes Beispiel für eine der aktuellsten Innovationen des Unternehmens ist der vollintegrierte Hochklappenbeschlag AVENTOS HKi: Bei der Entwicklung stand der Trend zu immer kleineren Beschlägen im Mittelpunkt. AVENTOS HKi ist besonders unauffällig und platzsparend. Die technische Meisterleistung lässt sich durch die schmale Bauweise von nur 12 mm perfekt in der Korpusseitenwand integrieren und verschmilzt so mit dem Möbel. Ein weiteres Beispiel ist AMPEROS, die einfache und sichere Blum-Lösung zur Elektrifizierung von Möbeln: Strom wird sicher und ohne freihängende oder sichtbare Kabel in Schubkästen oder auf Tablarauszüge geführt. Somit sind Licht, Ladefunktion und die Verwendung von elektrischen Geräten in und auf beweglichen Möbelteilen möglich. Verarbeitung, Montage und Inbetriebnahme sind einfach gestaltet und erfordern keine Expertise in Elektrik. All das entwickelt Blum in Höchst und produziert es für die ganze Welt.
INTERNATIONAL UND FAMILIÄR.
Blum ist regional in Vorarlberg verwurzelt, gleichzeitig aber mit mehr als 30 Tochterunternehmen in 120 Ländern vertreten. Weltweit beschäftigt Blum 9300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allein davon 7000 am Hauptsitz in Vorarlberg. Offen und unkom-


pliziert zusammenarbeiten, gemeinsam und abteilungsübergreifend Dinge vorantreiben, das zeichnet das Arbeiten bei Blum aus. Beim Beschlägehersteller warten unzählige spannende Aufgaben und alle Mitarbeitenden tragen ihren Teil dazu bei, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Arbeitskolleginnen und -kollegen arbeiten Hand in Hand in einem Familienunternehmen mit gelebten Werten und langfristigen Partnerschaften. Als Teamplayer zum Erfolg einer weltweiten Marke beizutragen und gleichzeitig persönliche Entwicklungsmöglichkeiten zu haben, ist zudem eine reizvolle Chance.
Die Jobmöglichkeiten bei Blum sind so vielfältig wie die Menschen: von der modernen High-Tech-Fertigung über das Qualitätsmanagement bis hin zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung, der IT oder Verwaltung. Auch in die Ausbildung von neu-

en Fachkräften investiert Blum – und das schon seit Jahren. Bereits in den 60ern hat der Beschlägehersteller mit der Ausbildung von Lehrlingen im eigenen Haus begonnen. Diese langjährige Erfahrung fließt in die tägliche Arbeit mit ein. Die Jugendlichen arbeiten früh in den Fachabteilungen aller Werke und lernen direkt von Expertinnen und Experten. Für die optimale Betreuung und einen individuellen Lerneffekt sind die Lehrlinge in kleinen Teams im Einsatz. Die individuelle Förderung steht dabei im Vordergrund und eröffnet vielseitige Perspektiven. So setzt Blum den Grundstein für eine gesunde Weiterentwicklung des Unternehmens gleich in mehreren Bereichen: Durch zukunftsorientierte, aus der Bedürfnisforschung gewachsene Innovationen, durch die Schaffung von guten Arbeitsbedingungen für internationale Teamplayer und durch die Förderung des FachkräfteNachwuchses.
JULIUS BLUM GMBH Industriestraße 1 6973 Höchst www.blum.com
Gemeinsam eigenständig und regional – Die Genossenschaftsbrauerei aus Frastanz ist tief mit der gesamten Region verwurzelt.

Gemeinsam und konzernunabhängig wirtschaften. Mit dieser Mission wurde die Brauerei Frastanz 1902 unter der Führung von Martin Reisch gegründet. An diesem Gründungsgedanken hat sich bis heute nichts geändert, ist aber aktueller denn je.
„VOLKSBRAUEREI“ FRASTANZ
Die Vorarlberger Brauereigenossenschaft ist seit jeher ein eigenständiges und tief mit der Region verwurzeltes Unternehmen, welches im Besitz von rund 3400 Genossenschaftsmitgliedern ist. Und laufend werden es mehr. „Als Mitglied ist man echte(r) Miteigentümer(in) einer echten Brauerei.“
Qualität – und nicht die Quantität – steht im Vordergrund. Gebraut wird am offenen Sudkessel im denkmalgeschützten Sud-

„In einer Reihe mit den Top-Marken Vorarlbergs zu sein, ehrt uns sehr und macht uns stolz –Vielen Dank.“
Kurt Michelini, MSc.Geschäftsführer
haus. Eine offene Gärung, die naturnahen Zutaten aus der Bodenseeregion, viel Zeit und die abschließende Kaltabfüllung ergeben das echte, ursprüngliche Bieraroma; Für natürlichen und vollmundigen Biergenuss.
Mit den ersten gebrauten BIO-Bieren in Vorarlberg hat die Brauerei Frastanz vor rund 14 Jahren eine bierige Marktnische gefunden – mit stark wachsendem Erfolg. Was vor einigen Jahren mit dem BIO-Kellerbier begann, weitet sich mehr und mehr auf das gesamte Biersortiment aus. Mittlerweile gehören 10 Biere der BIO-Linie an. Im Mai werden zwei weitere Sorten dazustoßen. Die Brauerei Frastanz gehört somit zu einer der größten BIO-Brauereien in Österreich.
Erfolge werden gemeinsam mit der frastanzer-Crew erreicht und auch natürlich gemeinsam gefeiert.
Trotz aller Tradition ist die Brauerei Frastanz stark zukunftsorientiert und modern. In den letzten Jahren wurde kräftig in die Infrastruktur investiert. Lagerkapazitäten wurden erweitert, um eine längere Reifung bzw. Lagerung und damit immer gleichbleibende Qualität der Biere zu garantieren.
Vergangenes Jahr wurden die Bauarbeiten für das Modernisierungs-Projekt, welches die gesamte Produktion nach dem Sudhaus an einem Ort beheimatet, fertiggestellt und feierlich eröffnet. Erhalten geblieben ist natürlich der Blick auf die traditionelle offene Biergärung in der neuen Gärlounge.
Mit diesem Neubau mit neuester Technik, kombiniert mit dem ehrwürdigen, denkmalgeschützten und vor allem intakten Sudhaus mit traditioneller Brauweise steht in Frastanz nun eine der schönsten und modernsten Brauereien Österreichs. Und davon kann man sich ab sofort auch wieder selbst überzeugen. Denn Brauereibesichtigungen sind ab sofort wieder regulär möglich – perfekt für Vereinsausflüge!


Ein alljährliches Highlight ist sicher das frastanzer Bockbierfest, welches mit rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern das stärkste Bierfestival in Vorarlberg ist. Im Jahr 2024 öffnet die Brauerei Frastanz vom 12. bis 15. September seine Pforten für das diesjährige Bockbierfest und bietet ein bieriges Festprogramm für Jung und Alt.
Direkt damit verbunden ist das alljährliche Bierzahl!-Gewinnspiel, das zu einem der größten Gewinnspiele in Vorarlberg zählt. Man darf gespannt sein, wer am Finaltag den Hauptpreis mit nach Hause nehmen darf. Was es wird, bleibt bis in den Sommer ein gut gehütetes Geheimnis.
#SKLENNEGOHTIMMER
In den sozialen Medien ist die Brauerei Frastanz direkt mit den frastanzer-Fans in Kontakt. Regelmäßig gibt es spannende News aus der Brauerei. Dabei nimmt man sich aber nicht immer allzu ernst und immer gilt der Leitsatz: „s’klenne goht immer!“. Mit diesem Hashtag #sklennegohtimmer teilen Bierfans aus der Region ihre Biermomente

mit der Community. Somit sorgt die Brauerei Frastanz auch digital für echte Bierkultur, die die Menschen verbindet.
Nachhaltiges Wirtschaften, beliebte, regionale Produkte, sowie die Verbundenheit mit den Mitgliedern haben frastanzer zu einer der Top-Marken in Vorarlberg gemacht. „Dass die Brauerei Frastanz gemeinsam mit starken, internationalen Marken genannt wird, macht uns sehr stolz! Wir bedanken uns bei allen, die die Brauerei Frastanz durch den Genuss unserer Produkte unterstützen“, so Brauereidirektor Kurt Michelini.
Die Brauerei Frastanz ist seit jeher eine regionale Genossenschaft. 60 Mitarbeiter(innen) stehen gemeinsam mit rund 3400 Genossenschaftsmitgliedern aus der Region für echte Bierkultur, die verbindet, und für echte und starke Partnerschaften.
Gegründet im Jahr 1902
• Jährlicher Bierausstoß von 50.000 hl
• 60 Mitarbeiter(innen) 3400 Mitglieder/Miteigentümer
• Vorarlbergs erstes BIO-Bier, mittlerweile über 10 Sorten in BIO-Qualität. Mitbegründer und Produktionsstandort der VO ÜS-Limowerke
• Besichtigungen wieder möglich
BRAUEREI FRASTANZ eGen Bahnhofstraße 22 6830 Frastanz www.frastanzer.at
Regionalität ist mehr als eine gute Idee, sie zeigt sich im Tun! Tagtäglich im Kleinen genauso wie bei großen Projekten

Bertram Martin und Jürgen Sutterlüty freuen sich über die Auszeichnung mit dem Regional Star Award 2022 für ihr gemeinsames Projekt „Vorarlberger Urdinkelprodukte“
Tolle Leistungen wie die gefeierten Ländlemärkte in Dornbirn-Schwefel und Rankweil Passage 22 schlagen natürlich hohe Wellen. Seit der Neuinszenierung dieser ehemaligen BillaPlus-Filialen finden Genussmenschen hier ein wahres Eldorado mit unzähligen regionalen Produkten, einer hauseigenen Marktkonditorei, großer Frischetheke, riesiger Weinabteilung, reichhaltiges Glutenfrei- und Vegansortiment, Sushi, und, und, und. Doch dahinter steht, was wirklich zählt: Bei Sutterlüty wollen wir das Handwerk der Bauern und Produktionsbetriebe in Vorarlberg fördern und nachhaltig weiterentwickeln. So arbeiten alle Sutterlüty Teammitglieder daran, aus der regionalen Idee unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.
… lautet diese einfache Unternehmensphilosophie, die auch in zahlreichen Marktstudien bekräftigt wird – Sutterlüty ist auf Erfolgskurs. Statt als Unternehmen maßlos zu expandieren, hat Eigentümer und Geschäftsführer Jürgen Sutterlüty die Weichen für gesundes Wachstum bei gleichbleibendem Raumangebot gesetzt. Das bedeutet in erster Linie ein verantwortungsvoller Wandel durch die Modernisierung von alten Märkten, damit keine „grüne Wiese“ verbaut werden muss. Stattdessen entstehen an Standorten wie in Dornbirn oder Rankweil wahre Spielwiesen für alle Stärken, die der Ländlemarkt zu bieten hat: Regionalität, Nachhaltigkeit und b’sundrige Genusskultur. Hier – mitten im
Die Familie Fink ist einer unserer 1500 Ländlepartnerbetriebe.

Langjährige Partnerschaften und die Wertschätzung für Produkte aus dem Ländle machen
Sutterlüty b'sundrig.

Maria vom Sutterlütymarkt DornbirnSchwefel liebt es die Kunden zu beraten.

Im Sutterlütymarkt Rankweil Passage 22 kann man den Konditoren bei der Arbeit über die Schulter schauen.
Markttreiben, in unserer Kernkompetenz, bei erlesenen Lebensmitteln – wollen wir die Menschen im Ländle von unserer Vision überzeugen und ihnen die großartigen Produkte aus unserer Region näherbringen.
B’sundrig werden diese Produkte aber erst durch die Menschen. Damit sind nicht nur unsere langjährigen Partner gemeint, sondern vor allem die Teams in den Märkten, die unsere Philosophie stolz nach außen tragen. Diese positive Einstellung für unser Ländle haben auch sämtliche Mitarbeiter(innen) in den neuen Märkten gleich übernommen. Zum Beispiel Renate, die nun gerne für ein Vorarlberger Familienunternehmen tätig ist. Auch die Kund(inn) en seien von der regionalen Schiene be-
geistert, schwärmt sie. Genauso passen die Werte von Sutterlüty zu Maria. „Wir wohnen in Vorarlberg und daher sollten wir das Ländle unterstützen und regionale Produkte kaufen“, sagt die gelernte Köchin und freut sich, jetzt als Teil der SutterlütyFamilie in der Feinkost die besten Zubereitungstipps für Delikatessen aus der Region parat zu haben.
SONNIGE AUSSICHTEN
Als Familie sehen wir unsere großen und kleinen Erfolge als unterschiedliche Ausdrucksformen für eine umfassende Idee, nämlich unserer Wertschätzung fürs Ländle Ausdruck zu verleihen. Für das passionierte Team, für die Wünsche unserer Kund(inn)en, für langjährige Partnerschaften auf Augenhöhe. „So kommt unser
Mehr als 150 Sutterlüty’s Spezialitäten sind mittlerweile exklusiv in den 30 Ländlemärkten erhältlich.


Yasemin und Ayse sind stolz auf das Regionalsortiment bei Sutterlüty.
Engagement für heimische Lebensmittel, Qualität, Frische und exzellenten Kundenservice zur Geltung“, meint Geschäftsführer Florian Sutterlüty stolz und kann es kaum erwarten, bis die regionale Idee mit dem nächsten b’sundrigen Ländlemarkt in Altach noch höhere Wellen schlägt.
SUTTERLÜTY HANDELS GMBH
Mühle 534
6863 Egg www.sutterluety.at
Bald
vier Jahre gibt es jetzt regionalen Limonade-Genuss VO ÜS. Darauf
eine Zirbe-Zitrone! Oder eine Orange! Oder

Die „VO ÜS Vorarlberger Limo Werk GmbH“ gehört zu je 50% der Mohrenbrauerei in Dornbirn und der Brauerei Frastanz. Beim Bier Mitbewerber, arbeiten beide Brauereien bei der Limonade sehr eng zusammen.
• Erste Abfüllung war am 5. Mai 2020
• 4 Mitarbeiter
• 20 Sorten in sieben verschiedenen Gebinden
• Nachhaltige Glasflaschen, die in Dornbirn und Frastanz für Vorarlberg abgefüllt werden.
• Kurze Wege von den Brauereien zu den Vorarlberger Kunden.
Oder eine der 18 weiteren Geschmacksrichtungen, die VO ÜS in Vorarlberg abfüllt. Am 5. Mai 2020 ist in der Brauerei Frastanz die erste Mehrweg-Glasflasche abgefüllt worden. Der Zirbe-Zitrone von damals sind inzwischen viele tausend weitere Flaschen in Frastanz und in der Dornbirner Mohrenbrauerei gefolgt.
Trotz des jungen Alters ist VO ÜS tief in Vorarlberg verwurzelt. Nicht zuletzt wegen der beiden Brauereien, die eine lange Tradition haben. Die Dornbirner Mohrenbrauerei gibt es seit 1763, die Brauerei Frastanz seit 1902. Dagegen ist VO ÜS mit seinen bald 4 Jahren ein absoluter „Jungspund“ der aber auf die Erfahrung, die Geschichte und das Know-how der Brauereien zurückgreifen kann. Natürlich macht es einen Unterschied aus, ob Bier oder Limonade abgefüllt wird, aber die beiden Brauerei-Teams pushen sich gegenseitig noch immer jeden Tag. Ein „Gehtnicht“ hat es nie gegeben und gibt es auch heute nicht.
NACHHALTIG
Mit der Erfahrung, die beide Brauereien im Bereich Mehrweg-Glas haben war auch klar, dass es VO ÜS im gleichen Gebinde geben wird. Dabei war es am Anfang gar nicht so einfach, gegen die PET-Flaschen der Mitbewerber zu bestehen. In-

VO ÜS spiegelt das Beste von Vorarlberg wieder: echte Kooperation über Grenzen hinweg für nachhaltigen Genuss.
zwischen ist die Rückkehr zur Akzeptanz von Glasflaschen deutlich spürbar, wobei der Wunsch nach Glas VO ÜS immer häufiger explizit geäußert wird. Und es macht das junge Team stolz, dass es große Veranstaltungen wie die SCHAU, die Herbstmesse, das HYPO-Meeting in Götzis oder den Drei-Länder-Marathon in vielen Bereichen schon von Plastik- auf Glasflaschen umstellen konnte. VO ÜS wird in Vorarlberg für Vorarlberg produziert und mit den Bier-LKW der Brauereien ausgeliefert. Damit ist auch kein zusätzlicher LKW unterwegs. Und weil durch die lokale

„Bei VO ÜS bringen wir Vorarlberger Brautradition und moderne Werte zusammen, um mit lokaler Limonade die Region zu stärken.“Philipp
Wüstner,Leiter Marketing/Vertrieb


Abfüllung zudem die Wege kurz sind, trägt VO ÜS zur Nachhaltigkeit bei.
Aber das regionalste und nachhaltigste Produkt verkauft sich nicht, wenn es nicht schmeckt. Mit 20 unterschiedlichen Sorten kann VO ÜS die Freunde von Klassikern wie Cola, Orange oder Zitrone genauso bedienen wie Nostalgiker, die gerne einen „gespritzten Holundersaft wie bei Oma“ trinken. Und für alle Neugierigen gibt es Einzigartiges wie Zirbe-Zitrone oder Vogelbeer-Kirsch. Dazu wird auf die Herkunft der Rohstoffe Wert gelegt. Auch wenn es in Österreich keine Cola-Nuss oder genug Orangen und Zitronen gibt, so kommen sie doch zumindest aus der EU. Je näher die Rohstoffe an Vorarlberg angebaut werden, umso besser. 2022 gab es die limitierte Sondersorte „Birne-Honig“. Der dafür verwendete Bio-Honig ist zu 100 Prozent aus dem Bregenzerwald gekommen.

Einzigartig im deutschsprachigen Raum ist, dass die „VO ÜS Vorarlberger Limo Werk GmbH“ zwei am Biermarkt im Wettbewerb stehenden Brauereien gehört. Und während es beim Bier um jeden zusätzlichen Liter geht, wird bei der Limonade gemeinsame Sache gemacht. Beide Brauerei-Geschäftsführer leiten gleichzeitig und gemeinsam auch das Limo Werk. Für Thomas Pachole (Mohrenbrauerei) und Kurt Michelini (Brauerei Frastanz) war dabei von Anfang an klar, dass auf den eigenen Anlagen abgefüllt und der eigene Fuhrpark verwendet wird. Und dass die Sache nur funktionieren kann, wenn sie beide die Gmeinsamkeit vorleben. Und dabei ist etwas entstanden, das bei VO ÜS gerne auch als „Vorarlberger Weg“ bezeichnet wird. Zwei Mitbewerber, die sich auf Augenhöhe begegnen, eine Chance sehen und die Synergien in beiden Betrieben nutzen, um etwas Großartiges zu produzieren.
VO ÜS VORARLBERGER
LIMO WERK GMBH Dr.-Waibel-Straße 4 6850 Dornbirn www.voues.at
Die illwerke vkw feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 100 Jahren wurden die Vorarlberger Illwerke gegründet.
Insbesondere die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges hatten den Vorarlberger Landtag dazu veranlasst, sich mit der Frage einer sicheren Stromversorgung zu beschäftigen. Im Jahr 1917 wurde Dekan Barnabas Fink aus Hittisau zum „Referenten für den Ausbau der Wasserkräfte“ ernannt. Er tauschte sich mit diversen Sachverständigen aus, darunter der Münchner Zivilingenieur Johann Hallinger. Dieser äußerte die Empfehlung, ein großes Kraftwerk mit einem Speicher zu errichten. Um die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, wurde im Jahr 1922 eine Gesellschaft gegründet. Am 5. November 1924 wurde der Gesellschaftervertrag unterzeichnet und damit die Gründung der Vorarlberger Illwerke GmbH besiegelt.
TECHNOLOGISCHE MEILENSTEINE
In den darauffolgenden Jahren wurden zahlreiche Kraftwerksprojekte umgesetzt: So ging 1930 das seinerzeit größte Kraftwerk Österreichs in Betrieb – das Vermuntwerk in Partenen. Zeitgleich wurde
die erste Großraum-Energieübertragung Europas realisiert. Die Leitung von Vorarlberg bis ins Ruhrgebiet war nahezu 800 Kilometer lang. Hinzu kamen im Jahr 1943 das Rodund- und Obervermuntwerk, 1950 das Latschauwerk und nur acht Jahre später das Lünerseewerk, um nur einige historische Meilensteine zu nennen. Im November 2000 hat der Vorarlberger Landtag die unentgeltliche Einbringung der VKW-Aktien des Landes in die Vorarlberger Illwerke AG beschlossen. Nach einem langjährigen Prozess sind Illwerke und VKW schließlich im Jahr 2019 gesellschaftsrechtlich zur illwerke vkw AG zusammengewachsen.
Ein Blick in die Geschichte der illwerke vkw zeigt deutlich: Die Grundlage für die Entscheidungen von damals waren visionäre Ideen der Pionierinnen/Pioniere, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Heute steht unser Energiesystem wieder vor einer großen Transformation. Damals wie heute braucht es Visionärinnen/Visionäre, die wegweisen-

Oben: Arbeiter auf der Baustelle des Gampadelswerks (1925). Rechts: Blick in das Vermuntwerk (1929).
de Projekte für die Energiezukunft umsetzen. So laufen derzeit die Planungen für das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs: Das Lünerseewerk II basiert auf Überlegungen aus den 1920er-Jahren. Die Nutzung des Wassers aus dem Lünersee durch ein Kraftwerk in Bürs wurde schon damals angedacht. Nach mehr als 100 Jahren soll die Idee nun Wirklichkeit werden.
Alle Infos zum Jubiläumsprogramm und einen historischen Rückblick finden Sie unter www.energieausvorarlberg.at
ILLWERKE VKW AG Weidachstraße 6 6900 Bregenz +43 5574 601-0 www.illwerkevkw.at
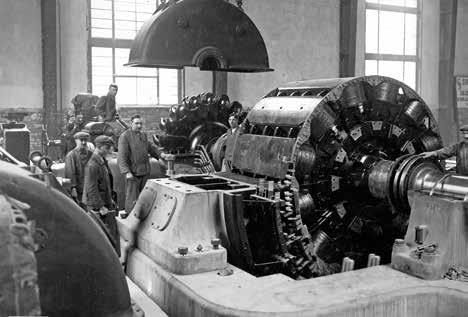
Hier bist du der SPAR.

Nutze die Möglichkeiten!
spar.at / karriere
Bei Vorarlberg Milch vereint sich die heimische Landwirtschaft mit den Werten der Region und der Vision einer nachhaltigen Zukunft.
Die Geschichte der Vorarlberg Milch ist das Ergebnis landwirtschaftlicher Bestrebungen, gemeinsam wirtschaftlicher produzieren und vermarkten zu können. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen ist zu 100 Prozent im Eigentum von über 440 Vorarlberger Bäuerinnen und Bauern. Sie sind es auch, die das Naturprodukt und den wertvollen Rohstoff Milch liefern. Daraus entstehen bereit seit 1993 hochwertige Molkereiprodukte – und das ausschließlich mit Milch aus Vorarlberg.
Die hohe Qualität der Produkte von Vorarlberg Milch wird auch auf internationaler Bühne anerkannt. 2023 hat die AMA die hohe Käsekompetenz der Vorarlberg Milch

„Der Anspruch an Spitzenqualität und das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist unser Rezept für die Zukunft.“
Mag. Raimund Wachter Geschäftsführer Vorarlberg Milch
mit der Verleihung eines Käsekaisers für den Ländle Klostertaler extra-reif erneut gewürdigt. „Ein Käsekaiser ist immer die größte Anerkennung und Motivation zugleich. Die Vorarlberg Milch ist stolz, den Kund(inn)en nur beste Käsequalität bieten zu können“, so Geschäftsführer Raimund Wachter. Zudem belegt die Vorarlberg Milch mit zahlreichen Auszeichnungen bei den World Cheese Awards 2023/24, darunter „Supergold“ für den Ländle Bioberger, die hohen Qualitätsansprüche, die das Unternehmen an sich selbst stellt.
MEHR PROTEIN, MEHR POWER
Mit dem Ländle Bifidus Joghurt eröffnet die Vorarlberg Milch ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte innovativer
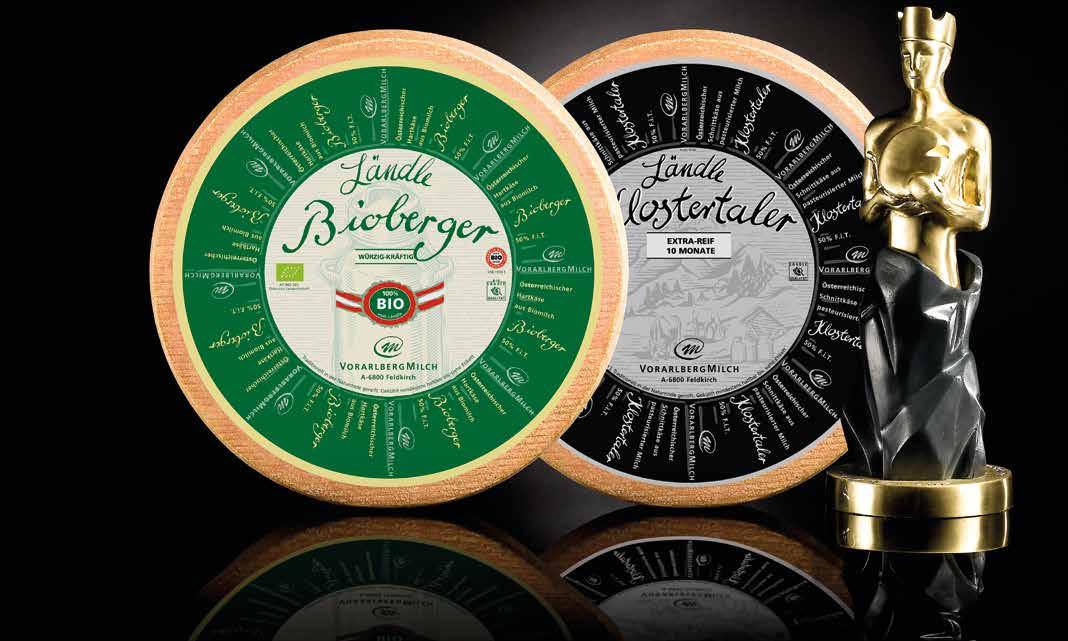
Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die hohe Produktqualität.

Produktentwicklungen. Das proteinreiche Naturjoghurt wird aus feinster Ländle Heumilch hergestellt und mit dem Bakterienstamm Bifidobacterium lactis angereichert. Klingt kompliziert, macht das Joghurt aber besonders bekömmlich und sorgt für eine Extraportion Wohlbefinden. „Besonders für ernährungsbewusste Menschen ist es kombiniert mit Früchten und Müsli der perfekte ‚Power-Shot‘ für einen aktiven Tag“, empfiehlt Raimund Wachter.
Auch die Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit können als echter „PowerShot“ bezeichnet werden. Mit der Wärmeschaukel besteht bereits seit dem Jahr 1997 ein immer wieder erweitertes Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Feldkirch. Mit der Abwärme von verschiedenen Produktionsanlagen der Vorarlberg Milch werden das Waldbad Feldkirch, das Schulzentrum Oberau und die Sanitäranlagen des Waldstadions Feldkirch mit Energie versorgt. 2022 wurden der Stadt Feldkirch so rund 850.000 Kilowattstunden Wärme zur Verfügung gestellt. „Dank dieser Initiative können wir nicht nur unseren CO2Fußabdruck reduzieren, sondern auch aktiv zur Lebensqualität in unserer Gemeinschaft beitragen“, unterstreicht Wachter die Bedeutung dieser Zusammenarbeit.
Genossenschaftliche Organisation und starke Partnerschaften – so bekennt sich Vorarlberg Milch zur Region.

STROM FÜR DEN EIGENGEBRAUCH
In der Stromproduktion stellte das Jahr 2023 einen Meilenstein dar. Mit der Erweiterung der bereits bestehenden Fotovoltaikanlage auf sämtliche Dachflächen wurde ein signifikanter Schritt in Richtung Energieautonomie und Nachhaltigkeit gesetzt. „Unsere Fotovoltaikanlage ermöglicht es uns, etwa zehn Prozent unseres Energiebedarfs selbst zu decken. Somit können wir jährlich rund 484.000 Kilowattstunden Strom sparen, was ei-

ner Reduktion von über 227 Tonnen CO2 entspricht“, führt Vorarlberg Milch Technischer Leiter Johannes Wehinger aus.
Die Vorarlberg Milch steht somit nicht nur für Spitzenprodukte aus dem Herzen Vorarlbergs, sondern auch für eine Zukunft, in der Wirtschaft und Ökologie Hand in Hand gehen. Mit nachhaltigen Initiativen beweist das Unternehmen, dass sie mehr als ein Lebensmittelproduzent ist – sie sind ein Wegbereiter für eine nachhaltige Zukunft.
Nofler Straße 62 6800 Feldkirch www.vmilch.at
Die Vorarlberger Mühlen punkten mit Mehlspezialitäten für die regionale und internationale Küche
Wer von Norden her nach Feldkirch kommt, dem fällt sofort das schöne alte Mühlengebäude ins Auge. Von außen nicht sichtbar ist allerdings das Herzstück des Gebäudes – die moderne Mahltechnologie, die sich hinter den historischen Mauern verbirgt. Sie ist es, die regionale Mehle von allerhöchster Qualität entstehen lässt.
Rund 20.000 Tonnen Getreide werden jährlich in den Vorarlberger Mühlen gemahlen. Für Vorarlberg ist das viel, im europäischen Vergleich handelt es sich jedoch um eine kleine Mühle. Umso mehr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert, beste Produkte herzustellen, die es den Kund(inn)en ermöglichen, das perfekte Brot zu backen oder ausgezeichne-

„Wir sind stolz darauf, den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern ein regionales Haushaltmehl von höchster Qualität anzubieten.”
Felix A. Rhomberg Vorarlberger Mehl
te Spätzle zu machen. Tag für Tag sorgen die motivierten Mitarbeiter(innen) mit ihrem profunden „Mahl-Know-how“ sowie einer äußerst sorgfältigen Qualitätskontrolle für eine konstant erstklassige Mehlqualität.
MODERNSTE TECHNOLOGIE
Das gereinigte und mikrobiologisch einwandfreie Getreide wird auf modernsten Müllereimaschinen schonend zu Qualitätsmehlen vermahlen. Im hauseigenen, bestens ausgestatteten Labor untersuchen die Mitarbeiter(innen) das Getreide bereits vor der Verarbeitung genaustens. Auch während des Produktionsvorgangs werden die hohen Qualitätsstandards laufend überprüft, um den Vorarlberger(innen) beste Mehle zu bieten.

Die Vorarlberger Mühlen sind nach IFS (International Food Standard) auf höchstem Niveau zertifiziert. Um das Zeritifikat auf diesem Niveau zu erhalten, müssen mindestens 95 Prozent der Punkte erreicht werden. Somit können sich die Verbraucher(innen), Bäcker(innen) und Teigwarenhersteller(innen) sicher sein, dass beim Endprodukt die höchstmögliche Produktsicherheit garantiert ist.
NACHHALTIG DURCH UND DURCH
Ein eigener Bahnanschluss sorgt dafür, dass das Getreide aus Niederösterreich und dem Burgenland umweltfreundlich per Waggon angeliefert werden kann. Aus Vorarlberg und dem Bodenseeraum ist die Anlieferung per Lkw möglich. Diese um-



weltbewusste Beschaffung spiegelt die tiefe Verwurzelung in der regionalen Wertschöpfungskette wider. Ähnlich verhält es sich mit dem Engagement für den lokalen Getreideanbau. Vorarlberger Bäuerinnen und Bauern bauen die Urgetreidesorten Dinkel und Emmer an. Im ersten Schritt liefern sie das Getreide an den Sennhof nach Rankweil, wo es entspelzt wird. Zum Vermahlen geht es dann weiter zu den Vorarlberger Mühlen. Unter der Marke „urig und vo do“ gelangen die Mehle aus den Urgetreidesorten in die Regale der Vorarlberger Supermarktketten. Durch diese regionale Partnerschaft unterstützen die Vorarlberger Mühlen nicht nur die heimische Landwirtschaft, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Regionalität bedeutet für die Vorarlberger Mühlen mehr als nur den Getreideeinkauf in Österreich und der Bodenseeregion. Auch heimische, traditionelle Spezialitäten sollen nicht in Vergessenheit geraten und auch in Zukunft mit besten Zutaten zubereitet werden. Speziell dafür entwickelte anwendungsfreundliche Spezialmehle wie das Vorarlberger Spätzlemehl, der Vorarlberger Riebelgrieß, das Vor-
arlberger Kuchenmehl oder das Vorarlberger Zopfmehl sorgen für perfekte Ergebnisse in den heimischen Bäckereien und Haushalten.
Die Qualität und das Engagement der Vorarlberger Mühle bleiben nicht unbemerkt und finden Anerkennung. Die Auszeichnung als „Beste Marke Vorarlbergs“ für Weiterempfehlung im Jahr 2020, der Gewinn des KMU-Preises 2023 sowie weitere Ehrungen zeigen deutlich, dass Kunden und Verbraucher den hohen Qualitätsanspruch der Vorarlberger Mühlen wertschätzen und bestärken.
VORARLBERGER MÜHLEN UND MISCHFUTTERWERKE GMBH
Reichsstraße 139 6800 Feldkirch www.vorarlbergermehl.at
Die Uhrenindustrie mit ihren erlesensten Manufakturen ist fest in Schweizer Hand? Die exklusivsten Marken? Nein! In einer sächsischen Kleinstadt namens Glashütte in Deutschland sind Manufaktur-Mitarbeiter(innen) mit Herzblut und Leidenschaft darum bemüht, einzigartige Zeitmesser zu fertigen – und das mit einer nonchalanten Unaufgeregtheit, die beeindruckt.
Während andere Marken mit pompösen PR-Events und Werbestrategien aufwarten sowie ihre Manufakturen zu Museen ausbauen, besinnt man sich bei Glashütte Original auf das, worauf es den Menschen schon immer ankam, seit sich 1845 dort die ersten Uhrmacher niederließen: die Herstellung von Uhren – und zwar von erstklassigen, versteht sich. Am Anfang jedes genialen Zeitmessers steht aber erst einmal die Idee und die nimmt in der Designabteilung ihren Anfang. Hier ist man für den visuellen Mehrwert, aber auch die kreativen Entwicklungsaspekte zuständig. Soll heißen: Neue Zeitmesser verlan-
gen auch im Innenleben nach innovativen Komplikationen, Werken und Modifikationen. Bei Glashütte Original ist man stets darauf bedacht, den Stil des eigenen Hauses zu bewahren und dennoch zeitgemäß zu bleiben: „Die Herausforderung besteht darin, unsere Traditionen, unser Erbe zu pflegen, aber gleichzeitig zeitgenössische Elemente wie moderne Abmessungen, Proportionen, Materialien und Techniken zu integrieren“, so Roland von Keith, CEO Glashütte Original. Das symbolisiert auch das gespiegelte Doppel-G auf dem Rotor eines Automatikwerks oder der Schließe: Der linke Buchstabe richtet den Blick in die Vergangenheit, der rechte in die Zukunft.

Es hängt davon ab . . . Der Schaffensprozess beginnt teilweise ganz unprätentiös: „Die besten Ideen entstehen manchmal als Skizze auf einer Papierserviette“, erzählt von Keith mit einem Schmunzeln. Darauf folgen Diskussionen innerhalb des Teams. Immer wieder trifft man sich, bespricht Ideen, Entwürfe und Skizzen – bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Das kann manchmal sehr schnell gehen, aber auch lange dauern. „In der Regel benötigen wir neun bis zwölf Monate für die Designphase eines Produkts inklusive Modell und Prototypen.“ Zuerst ist der Körper, das Volumen wichtig. Hinzu kommen das Zifferblatt mit Zeigern, Bandanstöße, Krone und schließlich das Wichtigste – das Werk. Bis all diese Details erdacht, durchdacht und festgehalten sind, kann es dauern. Bei Glashütte Original würde man eher sagen: Es hängt davon ab… und zwar von den Menschen, die dort arbeiten, denn Kreativität und echte Handwerkskunst sind ein schwer vorhersehbarer Prozess. „Manchmal hat man schnell eine Idee, manchmal zerbricht man sich wochenlang den Kopf, bis die ideale Lösung gefunden ist. Wenn man sich intensiv damit beschäftigt, ist es wirklich unglaublich, wie viele verschiedene Formen, Farben und Varianten es gibt“, unterstreicht der gelernte Uhrmacher die schier unerschöpflichen Möglichkeiten. Der neueste Coup ist der Senator Chronometer Tourbil-

Neben dem hohen technischen Anspruch ist es Teil der Markenidentität, Zeitmesser auf authentische Weise herzustellen – von der ersten Skizze bis zum Finish fußt alles auf dem Know-how der Mitarbeiter.



Meisterleistung. Glashütte Original Senator Chronometer Tourbillon.

Die Marke fertigt bis zu 95% aller Teile seiner Uhrwerke sowie die filigranen Zifferblätter selbst und verkörpert deutsche Uhrmacherkunst auf höchstem Niveau – eben Made in Germany.
lon mit patentierter Flyback-Funktion, der eben lanciert wurde: Eine Vertikalkupplung hält beim Ziehen der Krone die Unruh an und arretiert den Tourbillonkäfig in seiner aktuellen Position. Wird die Krone auf ihre nächste Position gezogen und dort gehalten, schwingt der Tourbillonkäfig in einer geschmeidigen Bewegung aufwärts, bis der Sekundenzeiger an der Spitze des Käfigs auf der Null stehen bleibt – uhrmacherisch eine absolute Meisterleistung.
Individuelle Handschrift. Von der ersten Idee bis zum Finish sind zahlreiche Köpfe und Hände an der Entstehung der mechanischen Werke beteiligt. Der Gang durch die Manufaktur ist beeindruckend, denn er offenbart die Leidenschaft, mit der die Menschen die verschiedenen Arbeitsschritte verrichten. „Es hängt davon ab…“, ist also nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern zeigt, dass dort Männer und Frauen mit Akribie und ruhiger Hand Schönheit und Perfektion aufbieten, um winzigste Komponenten sowie Dekorteile von Hand
zu fertigen und zu verzieren – wie lange das dauert, hängt eben auch von der persönlichen Tagesform ab. So werden kleinste Messingelemente etwa nicht ausgestanzt, sondern filigran und genaustens mittels elektrischer Impulse mit einem feinen Draht herausgeschnitten (sogenannte Drahterosion). Danach durchlaufen die Kloben, Schrauben und Schwanenhalsfedern verschiedenste Abteilungen wie Galvanik, Härterei, Verzahnerei, Politur, Dekoration etc. und finden schließlich in der finalen Montage unter dem fachkundigen Augenpaar von einem Uhrmacher(in) ihren richtigen Platz im Werk. „Diese individuelle Handschrift von jedem einzelnen unserer Mitarbeiter(innen) machen die Zeitmesser zu einem Unikat und somit zu einem Original“, unterstreicht Roland von Keith und führt weiter aus: „Es ist unsere DNA, nahezu alle Komponenten im eigenen Haus zu produzieren. Diese hohe Wertschöpfung gewährleistet die volle Kontrolle über ein hohes Qualitätsniveau und verleiht uns Flexibilität. Gerade die Covid-Pandemie
hat gezeigt, wie schnell Lieferketten unterbrochen werden und wie wichtig es ist, möglichst unabhängig zu agieren. Wir sind stolz, dass wir nicht nur unsere Spezialwerkzeuge, sondern nahezu alle Komponenten selbst konstruieren und produzieren. Neben dem technischen Aspekt ist es auch Teil unserer Markenidentität, Zeitmesser auf authentische Weise herzustellen – von der ersten Skizze bis zum Finish ist alles von unseren Mitarbeitern.“
So trägt jede Uhr die unsichtbare Handschrift der Menschen, die im Großen oder Kleinen an ihrer Herstellung beteiligt waren, so dass diese dort mit Fug und Recht stolz darauf sein können, dass sie in dem malerischen Örtchen mit den grünen Hügeln und schnuckeligen Giebelhäuschen, im Osten des Erzgebirges, spektakuläre Zeitmesser fertigen, die sich mit den besten dieser Welt messen können – alles ganz ohne großes Tamtam, sondern herrlich unaufgeregt, den Blick auf das Wesentliche fokussiert. Christiane Schöhl von Norman
DER NEUE PANAMERA.

Porsche Zentrum
Vorarlberg – Rudi Lins
Bundesstraße 26d
6830 Rankweil
Telefon +43 5522 77911
info@porschezentrumvorarlberg.at www.porschezentrumvorarlberg.at
Porsche Service Zentrum Dornbirn
Schwefel 77
6850 Dornbirn Telefon +43 5572 25310
www.autohaus-lins.at
Panamera Turbo E-Hybrid – Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,2 - 1,7 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 26 - 28 g/km; Stromverbrauch kombiniert: 27,5 - 29,9 kWh/km. Stand 03/2024. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der jeweils gültigen Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

„Unser Wissen vermehrt sich, wenn wir es untereinander teilen und neu verknüpfen. Unsere Fähigkeiten wachsen, wenn wir sie in immer wieder neuen Zusammenhängen anwenden. Und eigentlich ist es genau das, was wir 20 Jahre lang gemacht haben: Wir haben als Team unsere Kompetenzen immer wieder geteilt, neu kombiniert und sind damit gewachsen.“
Heute zählt die Dornbirner Filmproduktionsfirma „Frl. Müller & Söhne“ zu den renommiertesten Vertretern ihrer Branche im Land. Offiziell unterstrichen hat das zuletzt der „Staatspreis Wirtschaftsfilm“, mit dem das Unternehmen Ende 2023 ausgezeichnet worden ist. Von Beginn an haben die beiden Firmengründer Martin Mühlburger und Thomas Fenkart auf ihre Fähigkeiten vertraut und die Talente des jeweils anderen als kongeniale Ergänzung hochleben lassen. Mit ihren mittlerweile 14 Mitarbeiter(inne)n haben sie diesen Ansatz weiter verfeinert: „Filmemachen ist generell keine One-Man-Show“, verdeutlicht Martin Mühlburger. „Es lebt vielmehr davon, unterschiedliche Talente für ein gemeinsames Ziel zu begeistern, für ein Ziel, das der jeweilige Kunde vorgibt. Als Geschäftsführer bemühen wir uns darum, unseren Mitarbeiter(inne)n die Möglichkeiten bereitzustellen, ihre jeweiligen Talente voll auszuschöpfen und gemeinsam etwas Neues zu erschaffen.“ Dieser Ansatz hat das Unternehmen weit getragen und es so flexibel gemacht, dass es sich auch in diesem sich extrem rasant wandelnden Metier immer wieder neu zu orientieren vermag.
Sich beim Nachdenken zuhören. „Synergieeffekte“, fassen sie es rückblickend zusammen, „das war auch der Grund, wieso wir uns 2006 zusammengetan haben“. Vor ihrer Firmengründung waren beide getrennt voneinander bereits ein knappes Jahrzehnt selbstständig. Gekannt haben sie sich da aber schon längst und waren ständig im Austausch: „Und das vor allem nächtelang“, lacht Thomas. „Das waren interessante Stunden am Telefon, in denen wir uns gegenseitig einfach zugehört haben.“ Und Martin ergänzt: „Eigentlich haben wir uns nicht nur beim Reden zugehört, sondern auch beim Nachdenken.“ Es war und ist bis heute ein ständiger Austausch auf Augenhöhe mit einem Gegenüber, das jeweils völlig andere Talente, eine andere Expertise hat. Deshalb war auch die inhaltliche Aufteilung ihrer Geschäfts-



führung von vornherein klar: Thomas Fenkart, verantwortlich für den Bereich „Postproduktion“, ist der Visionär, der zukünftige Technologien regelrecht „erschnuppern“ kann: „Er hat die Hartnäckigkeit, sich in ein Thema einzulesen und immer tiefer zu gehen, bis er irgendwann ein Niveau erreicht hat, in das wir ihm alle nicht mehr folgen können. Oft klingt es so, als spräche er von einer anderen Welt“, erzählt sein Geschäftspartner bewundernd. „Aktuell ist KI so eine Welt. Thomas hat außerdem das Talent, in emotionalen Situationen gerade und ehrlich zu bleiben. Er ist
Planung bis ins Detail. Sorgfältige Recherche gepaart mit modernstem Produktionsequipment.
der Ruhepol. Dass er dazu noch ein Zahlentalent hat, hat sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert.“ Martin Mühlburger, Geschäftsführer für den Bereich „Kreation“, nimmt den kreativen Part ein: „Er hat diese Fähigkeit, Neues zu erschaffen. Manchmal ist es schwierig, mit seinen Gedanken Schritt zu halten. Aber damit schafft er es, dass aus einer Geschichte, die zuerst gar keine ist, eine wird. Und das ist eine unglaublich wichtige Gabe in unserem Job. Die haben nur sehr, sehr wenige Menschen, die ich kenne, in dieser Ausprägung. Außerdem ist Martin sehr
feinfühlig, was dabei hilft, Stimmungen aufzunehmen. Das hilft uns nicht nur im Job, das macht ihn vor allem zu einem wunderbaren Menschen.“
Dass diese Partnerschaft bis heute so gut funktioniert, führen die beiden nicht nur auf die gegenseitige Wertschätzung zurück, sondern auch darauf, dass sie einander eine ehrliche Reflexionsund Projektionsfläche geblieben sind: „Und es kommt auch heute noch vor, dass wir um 3.00 Uhr nachts miteinander telefonieren, wenn einer das Gefühl hat, dass er dringend gehört werden muss.“ Dass diese Art des Arbeitslebens ohne Familienrückhalt nicht möglich wäre, dessen sind sich die beiden Familienväter bewusst: „Wir hätten weder den Kopf frei, noch Zeit dafür. Unsere Familien wissen das, Sie sind mit uns mitgewachsen, haben von Beginn an Freude und Schmerz mit uns geteilt. Die Frage, ob sie mitgemacht hätten, wenn sie wüssten, wie es wird, stellen wir lieber nicht... Wir sind einfach dankbar.“
Neue Ideen in altehrwürdigem Tarnkleid. Der Firmenname stammt noch aus Martins Studentenzeiten auf der Filmakademie: „Da las ich auf einem Container Frau Meier und Sohn. Das hat mir gefallen, weil der Container rosarot war – für eine Erdbewegungsfirma eine markante Farbe und Stoff für Geschichten“, schmunzelt er. Auch Frl. Müller und Söhne lässt viel Spielraum für Fantasie, was gerade in den Anfangsjahren gute Dienste geleistet hat: „Viele Kunden haben in den Namen eine lange Familiengeschichte interpretiert. Sie sind davon ausgegangenen, Frl. Müller wäre die betagte Geschäftsführerin, deren Söhne übernommen hätten. Es klang wie etwas Junges und gleichzeitig Altehrwürdiges. Etwas Modernes auf Basis von Tradition.“
Diese Kombination spiegelt sich im heutigen Firmensitz wider: In einer der – tatsächlich! – altehrwürdigen Hallen des einstigen Fabrikgeländes Dornbirn-Steinebach sind „Frl. Müller & Söhne“ zu Hause. Die liebevoll adaptierten Räumlichkeiten aus dem 19. Jahrhundert beherbergen modernstes Schnitt- und Produktionsequipment. Überhaupt nähert sich die damals noch fiktive Geschichte aus Tradition und Neuem der Realität an: Das Team ist auf soliden Beinen gewachsen, hat sich selbst eine Vergangenheit erschaffen und dabei viele, auch technische Neuerungen nicht nur miterlebt, sondern teils selbst weiterentwickelt.


Design-Thinking.
„Frl. Müller & Söhne” gestalten die Zukunft ihrer Branche selbst mit.
Branche der Mutmaßungen. „Frl. Müller & Söhne“ ist kein klassischer Dienstleister im ausschließlich technisch-handwerklichen Bereich. Das wäre im Filmsektor generell, und im Metier „Wirtschaftsfilm“ im Speziellen, zu wenig weit gedacht. Die Kunst ist es, die Auftraggeber abzuholen und gemeinsam aus vagen Vorstellungen eine konkrete Botschaft via Film zu kreieren. Da ist Hintergrundwissen gefragt, umfangreiche Vorgespräche, sorgfältige Recherche, die in die Tiefe geht: „Wenn man nur an der Oberfläche kratzt, geht das nicht“, betont Martin Mühlburger.
Das Team arbeite in einer „Branche der Mutmaßungen“, wie die beiden Geschäftsführer es nennen: „Wie ein fertiger Film schlussendlich funktioniert und beim Publikum ankommt, liegt nicht zu 100 Prozent in unserer Hand.“ Aber gute Vorarbeit, Erfahrung und Gespür für den jeweiligen Zeitgeist lassen zumindest realistische Prognosen zu. „Ständige Neugier ist daher eine Grundvoraussetzung, um am Markt bestehen zu können. Und die ist bis heute nicht abgeflaut.“ Daher haben sie auch keine Angst vor neuen Entwicklungen, auch wenn sie mitunter sehr schnell passieren. Im Gegenteil. 2016 hat sich ein weiteres Firmenstandbein entwickelt: Die Crew besteht nicht nur aus Filmemacher(inne)n, sondern auch aus Spezialist(inn)en im Bereich Software und Design-Thinking. In der rasanten Weiterentwicklung von KI sieht das Team eine spannende Herausforderung mit viel Potenzial.
Gespür für Zeitgeist.
„Frl. Müller & Söhne” entwickeln gemeinsam mit „Mäser Digital Media“ das Pixel Tube LED Studio.
„Das Schlimmste in unserer Branche ist, wenn man nicht mit der Zeit geht, wenn man nicht rundum schaut, ständig wie eine Eule um 180 Grad den Kopf drehen kann. Man muss die Zukunft selbst mitgestalten. Schlecht ist es, wenn die Zukunft dich gestaltet“, ist Thomas Fenkart überzeugt. Und Martin Mühlburger ergänzt: „Es gibt dabei natürlich nicht nur richtige, sondern auch falsche Wege. Wir wissen es im Vorhinein nicht. Vielleicht müssen wir hin und wieder auch umdrehen, ein kurzes Stück zurücklaufen. Aber stehenzubleiben, das war für uns nie eine Option.“ Angelika Schwarz
Fotos: Frl. Müller & Söhne
EIN WHISKY FÜR JOHN WICK
Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves hegt seit vielen Jahren eine Leidenschaft für die japanische Kultur und ist bekennender Liebhaber des „flüssigen Goldes“ aus einer der ältesten Destillerien des Landes. Zum 100. Jubiläum des House of Suntory hat er gemeinsam mit Regisseurin Sofia Coppola eine Kurzfilmreihe gedreht. „Es sind die hohe japanische Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die Suntory Whisky so besonders machen. Als Schauspieler, der sein eigenes Handwerk verfeinert und perfektioniert, finde ich es aufregend, diesen Prozess in einer Dokuserie zu teilen“, so der John Wick Darsteller. •
house.suntory.com

AUF DEN SPUREN VON APOLLO 8
Im Jahr 1968 wurde Geschichte geschrieben: Apollo 8 gelang die erste bemannte Mondumrundung. An Bord dieser Mission war jeder Astronaut mit einer Omega Speedmaster ausgerüstet – ein Instrument, auf das man während des gesamten NASA-Mondprogramms vertraute. In diesem Jahr würdigt die Marke das Vermächtnis mit einer neuen Speedmaster Dark Side of the Moon, die mit modernsten Technologien gefertigt wurde. So zeigt die Zifferblattseite die Ansicht des Mondes von der Erde aus, während die Rückseite die dunkle Seite offenbart, die nur Astronauten zu sehen bekommen. • www.omegawatches.com
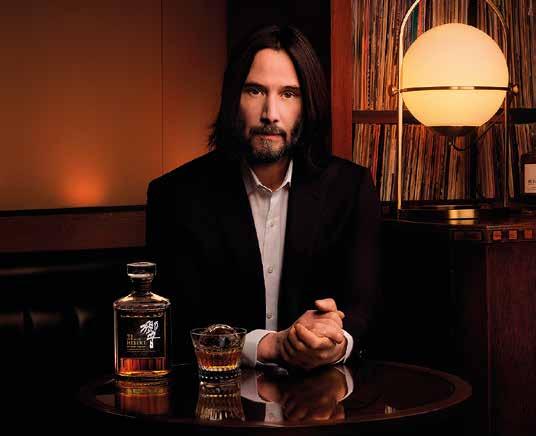
DA GLÄNZT DIE ALU-HAUT
Freiheit, Unabhängigkeit, Extravaganz – Für alle, die das Gefühl vom Reisen auch noch mit ins Bett nehmen möchten, hat das Hotel Daniel direkt neben dem Schloss Belvedere in Wien einen Trailer im Garten geparkt. Der Airstream-Wohnwagen (Anmerkung für Kenner: 22 ft Silver Streak Clipper, Baujahr 1952) mit einer Wohnfläche von 16 m2 bietet Vintage-Charme mit modernem Luxus – sogar eine freistehende Badewanne mit Aussicht ist integriert. Ausgestattet ist er wie ein Hotelzimmer: Queensize Bett, WC, Flachbild-TV, WLAN, Klimaanlage und Heizung. Außerdem ist er schallisoliert und wärmegedämmt. • hoteldaniel.com/de/wien/zimmer/trailer

Vater Textilmanager. Mutter Model und Malerin. Der Blick fürs Schöne hat im Elternhaus von Marc Lins (49) die Allgegenwart der Schwerkraft.
Der Schüler Marc Lins ist unauffällig. Am Fuße des Walserkamms liegt auf einer Höhe von 496 Meter über dem Meer die Gemeinde Satteins. Dort besucht Marc Lins die Volks- und Hauptschule. Von der HAK in Feldkirch wechselt er in die HTL nach Dornbirn. Die dreijährige Ausbildung als Wirker & Stricker schließt er erfolgreich ab. Danach verlässt er die textilen Fußstapfen des Vaters und heuert als Lehrling im Fotostudio Rhomberg an. „Das visuelle Verständnis flammte plötzlich auf.“
Der Lehrling. 1993 beginnt Marc Lins mit der Ausbildung zum Fotografen. Auf die abgeschlossene Lehre folgen ab 1996 Praxisjahre im europäischen Ausland. Den Fokus richtet der Schöngeist auf Mode und Fotografie. Prägende Erfahrung sammelt er als Assistent einschlägiger Fotografen, etwa in Mailand, Florenz, München und Hamburg. Dann lockt New York.
Der Freiberufler. Als Marc Lins am 21. Juni 1999 in New York ankommt, will er es wissen: Stimmt das, was Frank Sinatra seit 20 Jahren im legendären Song „New York, New York“ behauptet? „If I can make it there, I´ll make it anywhere.“ Zuerst dockt der Satteinser im Big Apple bei Österreichern an. Davon gibt es einige in New York in der Mode-, Kunst- und Medienbranche. Mit Philipp Hämmerle aus Lustenau entwickelt er zum Beispiel Set Designs. Er jobt als Assistent von Mode- und Architekturfotografen, bevor er eigene Strecken für Magazine und Images für Kunden aus den Bereichen Architektur und Kunst fotografiert. Parallel zur Fotografie richtet er einen Fokus auf Underground Musik. In dieser Szene tritt er gemeinsam mit Bruder Oliver als Eventveranstalter, Raumgestalter, Projektions- und Lichtmagier auf. Ohne geballte Energie für eine breit gefächerte Umtriebigkeit ist das Überleben für Newcomer in New York schwer. „Der Druck, sich in eine aussichtsreiche Stellung für Aufträge und Jobs zu bringen, ist Teil dieser Stadt. Wenn man etwas erreichen will, muss man zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, den Schalter umzulegen und zu funktionieren.“ Bis 2012/13 hat Marc Lins seinen Hauptwohnsitz in New York.
Der Europäer. In den New Yorker-Jahren stellt Marc Lins fest, dass er Europäer geblieben und kein Amerikaner geworden ist. In der Zeitspanne von rund zwölf Jahren zügelt er aus dem East Village von Manhattan ins multikulturelle Williamsburg in Brooklyn. Dort wohnt er zeitweise auch in Bedford-Stuyvesant und Clinton Hill. In der Freizeit arbeitet er an eigenen Kunstobjekten, macht mit dem Fahrrad Erkundigungen in allen Vierteln von New York, sammelt Impressionen in einer Stadt, die bekanntlich nie schläft. Der Europäer Marc Lins freut sich darauf, wieder ruhiger zu schlafen. Seine Homebase wird die Ostschweiz. Beruflich bleibt er mit New York verbunden. Ab 2019 wird Barcelona ein weiterer Aktionsplatz.
Der Bildhauer. 2007 beginnt Marc Lins in New York mit der Entwicklung seiner „Frame Sculptures“. Die bildhauerischen Mittel sind Garne, Aluminium und Stahl. Die geeigneten Garne für lineare Verspannungen findet er im Repertoire der Sticker. Stickergarne bieten die größte Farbauswahl. Sein skulpturales Gerüst sind Buchstaben aus dem Alphabet. Er beginnt diese Serie mit dem Z. 2020 kommt das X dazu. B ist in Arbeit.
Der Portraitist. Kurz nach der Rückkehr aus New York erscheint 2013 ein Bildband mit 100 Farbportraits von Feldkircherinnen und Feldkirchern. „Mensch Feldkirch“. Marc Lins fotografiert Menschen in ihrem alltäglichen beruflichen Umfeld. In der Apotheke, auf einer Baustelle, im Geschäft, . . in Kirche und Kloster. Seit einigen Jahren arbeitet er an einem weiteren Bildband, in dem er die Menschen in ihrer Freizeit am Neusiedlersee und „das Meer der
Seine Fotos sprechen Klartext. Menschen wie Architekturen sind authentisch, ungekünstelt, ungeschönt.

„Mensch Feldkirch“. Buchprojekt, 100 Porträts einer typischen Kleinstadt, 2013.
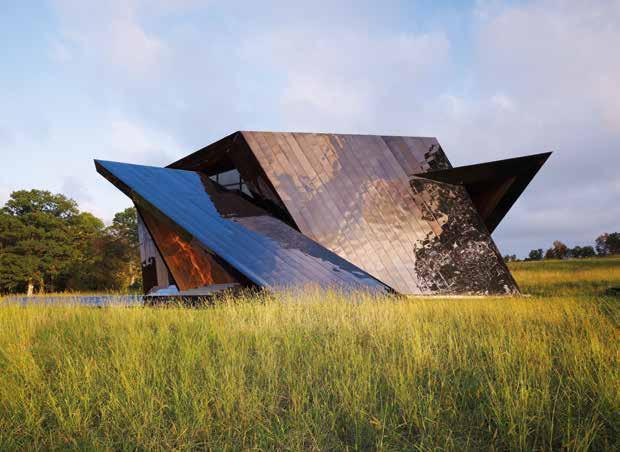
Private Residence 18.36.54. Studio Daniel Libeskind –Kent, Connecticut, USA.

Mountain Cabin. Marte Marte Architekten – Laterns, Österreich.
Alpe Furx. Baumschlager Eberle Architects –Furx, Österreich.


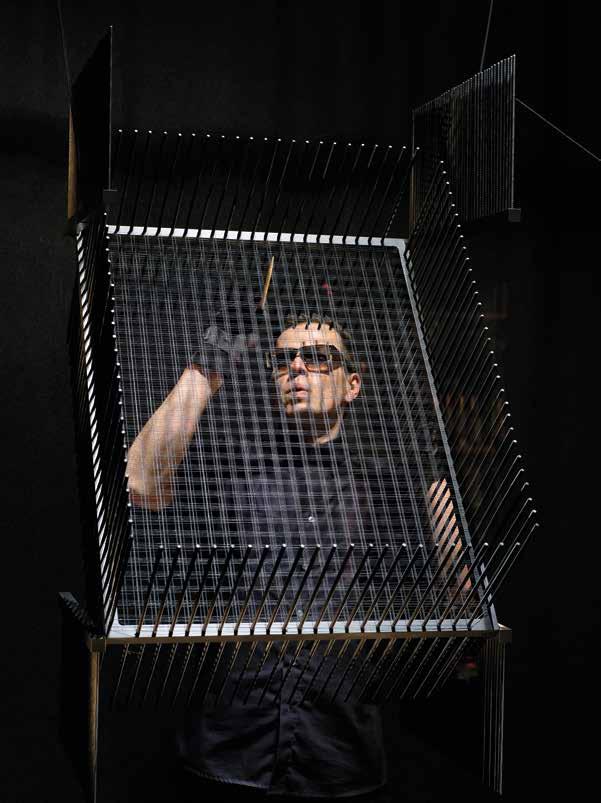
Wiener“ zu allen seinen Jahres-, Trocken- wie Sturmzeiten porträtiert. Die schicksalhafte Wechselbeziehung von Mensch und Natur verspricht ein spannendes Dokument von künstlerischer Ästhetik.
Der Architekturfotograf. Seine Bilder von Architekturen in Stadt und Land, in den Bergen wie auf Wiesen bestätigen das Gefühl des Fotografen für grafische Klarheit, unabhängige Authentizität, stille Poesie. Der Schöngeist mit der Kamera bildet private wie profane Bauten als unverwechselbare, selbstbewusste Skulpturen ab, die in ihrem Umfeld als Solitäre positioniert sind.
Der Editor. Mit der Edition „Flying Sails“ betritt Marc Lins den Kunstmarkt mit Acrylglasdrucken. Legendäre Sujets bietet die Regatta „Les Voiles de Saint-Tropez“ mit über 300 der schönsten Luxusyachten im Hafen von Saint-Tropez. In der digitalen Bearbeitung entstehen illusionäre Bilder, in denen die von Schiffsrumpf, Masten und Takelagen befreiten Segel übers Meer fliegen und in den azurblauen Himmel abheben. „Invisible Pole“ ist eine weitere Editionsserie und als Work in Progress angelegt. Marc Lins befreit Arme, Beine, Köpfe der Artisten an der Pole Stange von ihren Körpern. Das Ergebnis ist ein neues Vokabular der Sportart Pole Dance, das schwerelos im Raum schwebt und gleich einem Puzzle zusammengefügt werden kann.
Der Teamplayer. Vor 25 Jahren gründen seine beiden älteren Brüder Oliver und Alexander die Agentur Olex Design. Zum Full Service-Konzept gehören u. a. Webdesign und Entwicklung, E-Commerce, Grafik, Branding, Corporate Design. Marc Lins ist zusammen mit Sarah Aberer im Team dieser Designagentur, die in Europa wie in Amerika aktiv ist. Aktuell pendelt Junggeselle Marc Lins zwischen Zürich–Barcelona–Vorarlberg–Wien . to make it anywhere. Elisabeth Längle
Mit Garnen ist Marc Lins seit Kindertagen vertraut. Seine Skulpturen „Frame Sculptures“ sind Verspannungen aus Stickergarnen in einem Alurahmen. Je nach Lichteinfall ist in dem magischen Garnlabyrinth ein Buchstabe zu erkennen, der das gedankliche Gerüst des Bildhauers bildet.

Seit 1956 verkauft, vermietet und serviciert Huppenkothen Mini- und Kompaktbagger sowie ein breites Spektrum an Baumaschinen. Mit unserem flächendeckenden Filial- und Händlernetz sind wir immer direkt beim Kunden. Das macht uns zu einem europaweit führenden Anbieter.

Das komplette Huppenkothen Produkt- und Serviceangebot
ZENTRALE ÖSTERREICH / Huppenkothen GmbH
Bundesstraße 117 6923 Lauterach / Österreich T +43 50 663 400 info@huppenkothen.com

ZUM VERLIEBEN
Die bezaubernde Keep My Heart Handtasche ist aus glänzendem Monogramm-Vernis-Leder gefertigt. Sie besitzt eine abnehmbare, goldfarbene Tragekette mit LV Circle Signatur-Anhänger. Perfekt, um darin kleine Schätze wie Schlüssel und Kopfhörer aufzubewahren.
www.louisvuitton.com

TÄUSCHEND ECHT
Kaiser Franz Joseph I. hatte eine besondere Vorliebe für resche Handsemmeln. Als Dekoration wurden für die kaiserliche Tafel auch Gebäckstücke aus Porzellan gestaltet. Augarten hat diese Tradition wieder aufleben lassen und die täuschend echte Kaisersemmel kreiert.
www.lobmeyr.at

HOCHKARÄTIGER BEGLEITER
Die Geschichte beginnt in den 60ern in einem Friseursalon nahe der Ponte-Vecchio-Brücke in Florenz: Ugo Cala wollte das Geschäft seines Vaters nicht weiterzuführen, sondern Goldschmied werden, mit Erfolg, wie der Benvenuto Armreif aus Weißgold und Diamanten beweist.
www.pontevecchiogioielli.it

AB IN DEN SÜDEN
Der Frühling steht in den Startlöchern! Die perfekte Zeit, um sich mit der diesjährigen Reiseplanung sowie einer angemessenen Ausstattung zu beschäftigen. Die US-amerikanische Brand Tumi hat das passende „Gepäck“ für jeden Trip.
www.tumi.com
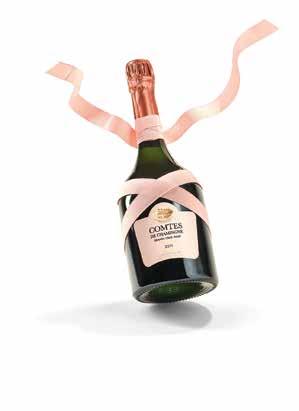
JAHRGANGS-CHAMPAGNER
Taittinger ist eines der wenigen Champagnerhäuser, die nach wie vor im Familieneigentum stehen und einen richtig guten Tropfen mit ausgeprägtem Charakter produzieren wie den Comtes de Champagne Grands Crus Rosé 2011 aus Chardonnay- und Pinot-Noir-Trauben.
www.taittinger.com

WIRKLICH ANHÄNGLICH
Die Shades von Gucci mit verspielten, abnehmbaren Ananas-Anhängern, goldigem Metallgestell und Grün getönten Gläsern wecken die Sehnsucht nach exotischen Urlaubsdestinationen und bringen auch in heimischen Gefilden Abwechslung in den Alltag.
www.gucci.com
Während hierzulande die Temperaturen steigen, locken südlichere Gefilde bereits mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichem Flair – voilà, unsere Must-haves für einen glamourösen Auftritt von Antibes bis Zagreb.
Was passiert, wenn in der Bundeshauptstadt zwei Exil-Vorarlberger kulinarisches „Heimweh“ bekommen? Sie wirbeln die Wiener Streetfood-Szene ghörig durcheinander – ein Interview über Herzlichkeit, atmosphärische Coolness und ganz viel Apfelmus.
Jeremy Auer und Alexander Pezold setzen in ihrem Lokal am Hernalser Gürtel mit ihren experimentellen Dishes ein kulinarisches Statement, kombiniert mit dem Geschmack der Kindheit, einer Brise Heimatgefühl und knusprigen Röstzwiebeln.
Wie kam es zu der Idee, in Wien einen Imbiss mit Vorarlberger Spezialitäten zu eröffnen? Wir haben das Vorarlberger Essen vermisst, vor allem aber gute Käsknöpfle. Diese Sehnsucht teilen wir wahrscheinlich mit vielen Exil-Vorarlbergern – und so entstand die Idee, in Wien einen Imbiss mit heimischen Spezialitäten zu eröffnen.
Ihr betreibt zusammen das Ghörig. Wie habt ihr euch gefunden? Wir haben beide die Tourismusschule in Bludenz besucht und uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Uns hat immer schon die Leidenschaft fürs Essen verbunden, und wir ergänzen uns auf allen Ebenen perfekt. Nachdem wir beide nach Wien gezogen sind, entstand während der Corona-Phase die Idee für das Ghörig.
Wie kommt man auf so ausgefallene Kombinationen wie panierte Käsknöpfle-Kugeln mit Apfelmus? Selbst experimentiert? Die Idee zu ausgefallenen Kombinationen entstand tatsächlich durch experimentelles Kochen und die Suche nach neuen, überraschenden Geschmackserlebnissen. In der klassischen Wiener Küche wird alles paniert, von Rindfleisch bis zu Schnecken oder Champignons. Wir wollten zunächst einen Burger machen, aber die Kombination mit Fleisch war uns zu deftig. Auf einem Italienurlaub haben wir die Arancini (panierte Risotto-Kugeln) kennengelernt und daraus entstand dann die runde Form der Ghörig Balls.
Was ist eure Food-Mission? Unsere Mission ist es, sowohl den Wienern die Vorarlberger Spezialitäten näherzubringen, als auch den Vorarlbergern in der Hauptstadt ein Stück Heimat zu vermitteln. Nicht nur Wiener, sondern auch Touristen aus der ganzen Welt freuen sich über originale Vorarlberger Käsknöpfle. Unser Ziel ist es, durch

Streetfood. Kulinarische „Auffangstation“ für hungrige Nachtschwärmer.

unsere Gerichte eine Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen zu schlagen und die kulinarische Vielfalt Österreichs zu zelebrieren.
Was muss man unbedingt essen, wenn man zu euch kommt?
Auf jeden Fall die Ghörig Balls – die sind unser Signature Dish. Für die Traditionalisten empfehlen wir die klassischen Käsknöpfle. Wir haben versucht, den Geschmack unserer Kindheit von Zeltfesten, Fasching und Fußballspielen modern zu interpretieren und einen kreativen Twist einzubringen.
Was ist eure Imbiss-Philosophie? Sie basiert darauf, unseren Gästen ein Stück Heimat in Wien zu bieten, indem wir per „du“ sind und im Dialekt reden. Wir möchten, dass sich jeder bei uns wie zu Hause fühlt. Daher legen wir besonderen Wert darauf, dass sich unsere Gäste nicht nur kulinarisch verwöhnt fühlen, sondern auch eine vertraute und herzliche Atmosphäre erleben. Diese Verbundenheit zu unserer Heimat spiegelt sich auch in der Auswahl unserer Zutaten wider: Wir verwenden hochwertige regionale Produkte, beziehen unser Gemüse direkt aus der Umgebung und unser Brot kommt frisch vom örtlichen Bäcker. Durch diesen Ansatz möchten wir sicherstellen, dass unsere Gerichte nicht nur gut, sondern auch authentisch und von höchster Qualität sind.
Das Geheimnis guter Käsknöpfle? Es liegt neben der Qualität der Zutaten vor allem in der richtigen Zubereitung und der Liebe zum Detail. Wir verwenden vier verschiedene hochwertige Käsesorten für unsere Käsemischung, bereiten die Spätzle nach traditionellem Rezept frisch zu und stellen täglich auch knusprige Röstzwiebeln frisch her.
Was ist das Besondere an der Streetfood-Kultur? Warum ist Essen „to go“ weltweit so beliebt? Sie zeichnet sich durch ihre Vielfalt, Kreativität und Zugänglichkeit aus. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, unterschiedliche Geschmacksrichtungen und kulinarische Traditionen kennenzulernen und schnell zu genießen, ohne auf Qualität zu verzichten. Wir punkten auf jeden Fall mit Schnelligkeit, denn wir möchten unseren Gästen ein rasches und dennoch genussvolles kulinarisches Erlebnis bieten, das perfekt in den hektischen Alltag der Stadt passt.

Signature Dish. Frittierte Käsknöpfle mit PreiselbeerDip, Salat und Apfelmus.
Essen die Leute aus Lust oder Notwendigkeit schnell zwischendurch? Beides. Streetfood bietet eine praktische Möglichkeit, hochwertiges Essen unterwegs zu genießen, aber gleichzeitig auch eine Gelegenheit, neue Geschmackserlebnisse zu entdecken. Gerne können die Gäste auch länger bei uns verweilen oder wir stellen den hinteren Raum für Veranstaltungen zur Verfügung.
Braucht Streetfood eine bestimmte coole Umgebung, um gut rüberzukommen? Streetfood kann überall gut rüberkommen, solange die Atmosphäre einladend und entspannt ist. Eine coole Umgebung kann sicherlich dazu beitragen, das Erlebnis zu verbessern, aber letztendlich kommt es vor allem auf die Qualität der Speisen und die Freundlichkeit des Teams an Christiane Schöhl von Norman

Jeremy Auer (l.): geboren in Dornbirn, gelernter Touristikkaufmann, isst am liebsten Käsknöpfle.
Alexander Pezold (r.): geboren in Schlieren (bei Zürich, Schweiz), gelernter Landschaftsgärtner, trinkt am liebsten Mohrenbräu.
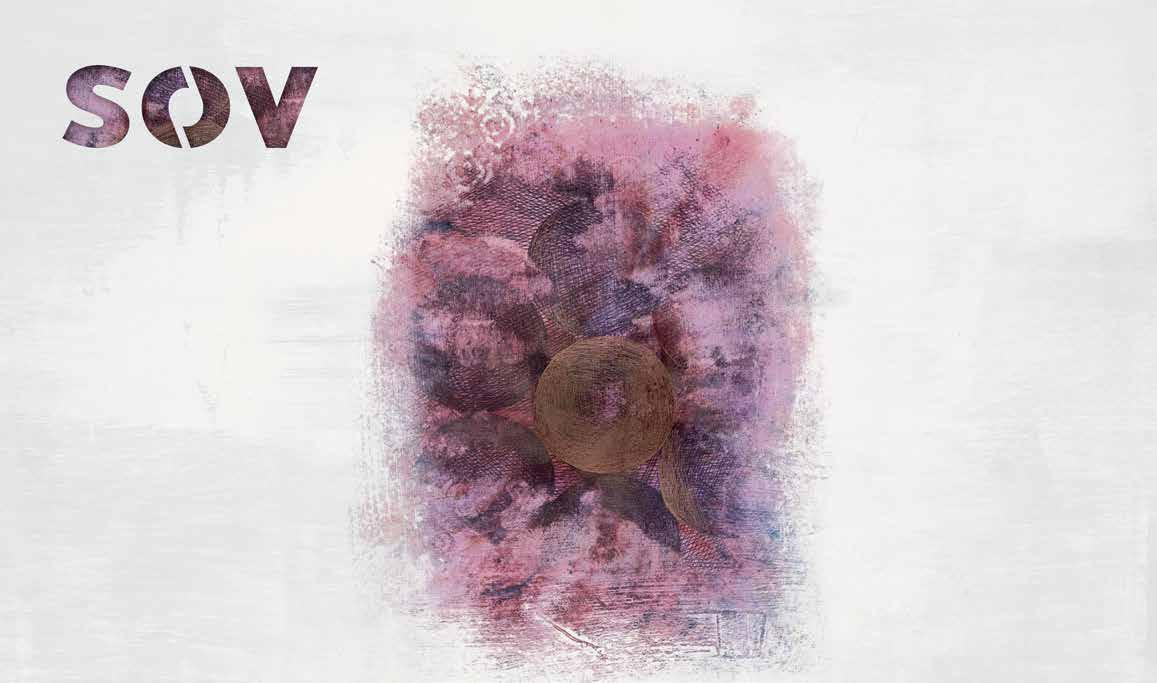


Verrückte waren früher verschämt in Behandlung, heute sind sie scheinbar weit verbreitet. Crazy sein ist absolut en vogue und gleichbedeutend dem Statement: „Hey Leute, schaut her, ich bin nicht langweilig!“. Doch wie aufregend und anders ist man überhaupt noch, wenn plötzlich alle „verrückt“ sind? „kontur“ hat Trendforscher Tristan Horx zu diesem Phänomen befragt.
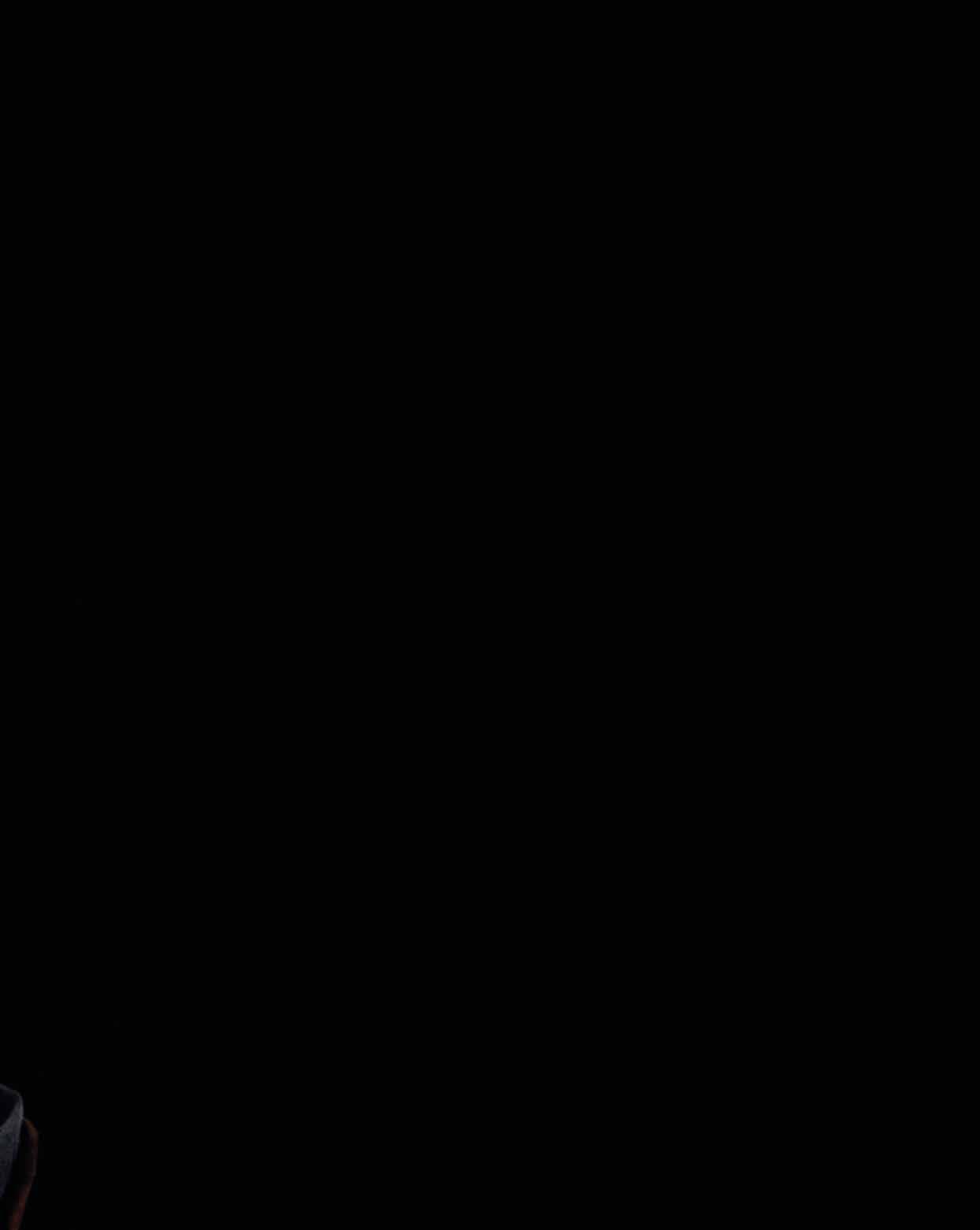
Heute muss man sich schon in jungen Jahren überlegen, wie man sich in der digitalen Welt inszeniert – das ist ein Seiteneffekt vom Weltschmerz, mit dem man über die Digitalisierung in Berührung kommt.
Ein Blick auf Instagram offenbart: 47 Millionen Posts, die den Hashtag #crazy beinhalten. Zu sehen bekommt man Menschen auf Jetskis, Skate-Boards, Luxusschlitten, mit Tattoos an allen erdenklichen Körperteilen, posierend mit verschiedensten Lebensmitteln oder Tieren, singend und tanzend auf dem 10-Meter-Sprungbrett oder bei skurrilen Mutproben, wie dem Trinken aus Bidets. Verrückt ist offenbar das neue „normal“, wobei dem Ganzen eine positive Konnotation im Sinne von ausgeflippt, rebellisch und aufregend anhaftet. Jeder möchte speziell und besonders sein und präsentiert sich auf diversen Social Media Plattformen, denn das Crazy-Phänomen zeigt sich auch auf TikTok & Co. und trägt einem Zeitgeist Rechnung, in dem alle ganz besonders und individuell sein wollen.
Weltschmerz der Digitalisierung. „Die Frage ist: Ist es der Versuch, sich in eine Mehrheitsgesellschaft einzugliedern, weil die Welt um einen herum verrückt geworden ist – sprich zeigt sich normatives Verhalten – oder sind wir bei der Generation Z, diese These vertrete ich, an der Spitze der Individualisierung angekommen? Ein Herausstechen aus der Masse durch verrückte, also von der Norm abweichende, Verhaltensweisen“, erklärt Tristan Horx und führt weiter aus: „Es ist eine Form von Selbstoptimierung, crazy zu sein, denn echte Verrückte, sprich Leute mit psychiatrischem Befund, bezeichnen das nie als solches, weil sie denken, dass sie normal sind. Man muss es sich eben auch leisten können, crazy zu sein.“
Der Begriff ist somit ambivalent: „Der/Die ist verrückt“ kann ein Kompliment aber auch üble Nachrede sein, das lässt sich sehr gut an Liebesbeziehungen illustrieren, beispielsweise am Song von Beyonce „Crazy in Love“, dessen Inhalt frei übersetzt lautet: „Schau mich doch mal an. Ich sehe doch völlig verrückt aus und du bist schuld dar-
an. Deine Berührungen, deine Küsse, deine Liebe haben aus mir eine Verrückte gemacht“ – hier sind wir also noch in der Phase „rosarote Brille“. Das Ganze kippt, wenn aus dieser verrückten Verliebtheit irgendwann Besessenheit wird. Stichwort: Narzissmus – Massive Abwertungen, die den anderen in den Wahnsinn treiben, während die eigenen Eskapaden vertuscht werden und ihr/ihm am Ende psychische Probleme unterstellt werden. Der Trend zur anfangs beschriebenen gemeinschaftlichen Social Media Crazyness hat mit solchen soziopathischen Störungen allerdings wenig zu tun, sondern vielmehr mit veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bedingt durch den Einfluss und die Nutzung der Medien: „Heute muss man sich schon in jungen Jahren überlegen, wie man sich als Individuum im Netz und den sozialen Medien inszeniert, stylt und individualisiert – das ist ein Seiteneffekt vom Weltschmerz, mit dem junge Menschen schon sehr früh über die Digitalisierung in Berührung kommen: Sie konsumieren heutzutage ab etwa 10 bis 12 Jahren verschiedenste Inhalte aus dem Netz und werden dadurch sehr früh mit dem konfrontiert, was die Welt an Positivem wie Negativem zu bieten hat. Durch diese Einflüsse kann man es nicht wirklich schlechtreden, dass die Jugendlichen am Ende denken, die Welt sei verrückt geworden“, so der Trendforscher, der selbst der Generation Y angehört.
Welt ist einfach „Mist“. Die Weltordnung ist also durch den medialen Blick, pointiert ausgedrückt, irgendwie „Mist“ und deswegen suchen sich junge Leute eine bewusste Alternative zu den Werten und Normen der dominierenden, anonymen Kultur, die von Kriegen, Klimakatastrophen & Co. bestimmt wird – wie etwa durch Subkulturen. „Diese sind heute viel stärker fragmentiert: Früher gab es immer eine Mehrheitsbzw. Antisubkultur wie die Hippies oder Punks. Heute existieren unglaublich winzige Formen, die sehr oft mit „core“ enden,

Zeitgeist. Trendund Zukunftsforscher Tristan Horx gehört der Generation Y an.
beispielsweise die Goblincore. Das sind Leute, die von der Ästhetik der Goblins inspiriert sind und sich wie diese Waldwesen anziehen oder die Clowncore, die sich an der Jokerwelt orientieren. Diese starke Zersplitterung führt dazu, dass man immer noch einen draufsetzen muss, um als Individuum wahrgenommen zu werden“. Alles bunt, laut und ein bisschen chaotisch. Übrigens der Hashtag Clowncore hat auf TikTok über 200 Millionen Aufrufe. „Die Aufmerksamkeitsökonomie belohnt crazy sein. Hinzu kommt bei den Jüngeren, dass sie in einer wichtigen Entwicklungsphase ihres Lebens – in der man normalerweise aus den familiären Hierarchien und von zu Hause ausbricht, um mit Freunden auszugehen und sich in der Gesellschaft draußen zu individualisieren – in Zeiten des Lockdowns lange eingesperrt waren. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass sich durch den Wegfall dieser Entwicklungsphase ihr Verlangen nach Aufmerksamkeit noch vergrößert bzw. der Drang individueller und verrückter zu sein“, zieht der Zukunftsforscher Bilanz.
Gender-Gap. Auf die Spitze getrieben wird das Ganze durch das Schießen von Fotos an besonders gefährlichen Orten, um möglichst viel Aufmerksamkeit, Likes und Abonnements auf Social Media einzuheimsen. Hochhäuser, gefährliche Klippen, reißende Flüsse – weltweit gibt es immer mehr Todesfälle durch sogenannte Killfies. „Das ist die Spitze des aufmerksamkeitsökonomischen Eisbergs“, bringt es Horx auf den Punkt. Apropos: warum sterben eigentlich deutlich mehr Männer durch Killfies? „Männer sind risikoaffiner, weil Mut und Risiko mit Aufmerksamkeit beim anderen Geschlecht belohnt werden – das ist evolutionär nicht so überraschend.“
Hat das Ganze vielleicht auch mit Rebellion zu tun? Bei diesem Stichwort winkt Horx ab: „Momentan ist es unglaublich schwierig aufzubegehren. Die Elterngeneration, die Boomer, finden Rebellion selbst ganz cool. Das ist das Schlimmste für die Jungen. Man kann heute eigentlich nur noch rebellieren, indem man spießig wird und sich im Dreiteiler zum Abendessen mit den Eltern setzt. Die Rebellion ist ziemlich gekappt.“ Aber auch aus diesem Umstand heraus identifiziert Tristan Horx in der Generation Z einen neuen überraschenden Gegentrend: „Die jungen Männer agieren im Vergleich zu den Frauen extrem konservativ, während diese immer liberaler werden. Diese Entwicklung
beim männlichen Geschlecht ist der Versuch, normativ zu sein und sich in die Hegemonie einzuordnen. Mich würde es nicht überraschen, wenn bei den Männern z. B. auch die Risikobereitschaft wieder abnehmen würde. Frauen sind dagegen in ihrer Essenz nicht so risikobereit, weil sie es glücklicherweise auch nicht sein müssen.“ Die Geschlechter driften also auseinander – u. a. auch, weil Frauen und Männer in der digitalen Welt tendenziell in unterschiedlichen (Pop- und Sub-)Kulturen leben und sich somit mit unterschiedlichem Content versorgen. Ob dies mit der #MeToo-Bewegung zu tun hat oder der Tatsache geschuldet ist, dass Demokratie und Emanzipation
global gesehen auf dem Rückzug sind (in unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan und den USA haben Frauen und Mädchen heute teilweise weniger Rechte als ihre Mütter und Großmütter) oder Männer sich von der Gesellschaft bestraft fühlen, wenn sie sich einfach mal wie Männer verhalten, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. Fest steht: Wir leben trotz so mancher feministischer Lichtblicke tendenziell immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft – das ist nach all den Jahren weiblicher Emanzipation, mühevoller Protestbewegungen und furioser Anstrengungen gesellschaftspolitisch gesehen ziemlich crazy. Christiane Schöhl von Norman
Alles bunt, laut, chaotisch – Die starke Zersplitterung führt dazu, dass man immer noch einen draufsetzen muss, um als Individuum wahrgenommen zu werden.

Risiko. Fotos an gefährlichen Orten –für mehr Aufmerksamkeit, Likes und Abonnements im Netz.


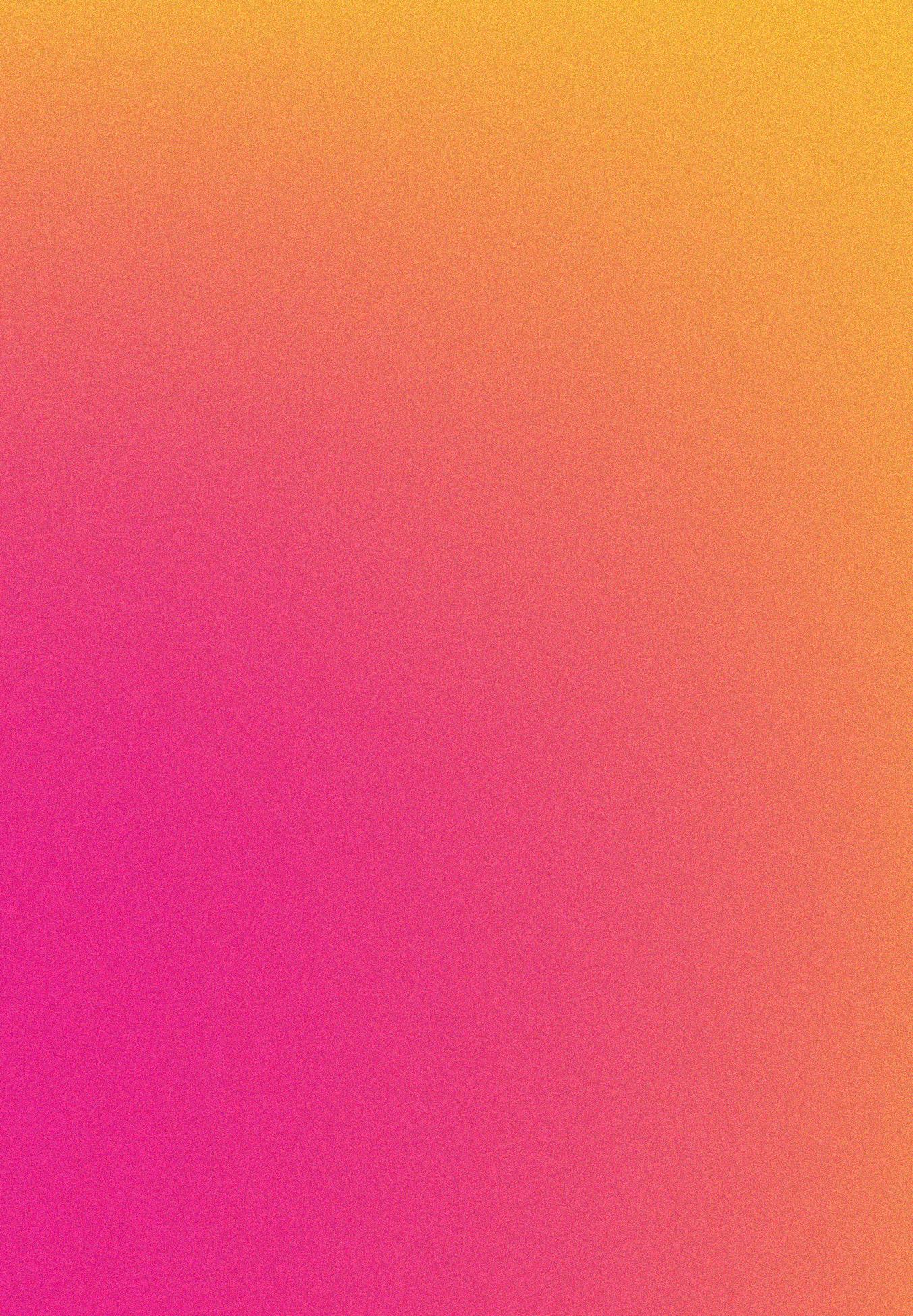




Die Interactive West ist eine EVENTSERIE, die als Plattform für Austausch und Innovation dient, und sich über das Jahr in einzigartige Veranstaltungen aufteilt. Es gibt zwei Hauptstränge: Interactive West_tech konzentriert sich auf technologische Innovationen und künstliche Intelligenz, während Interactive West_xyz sich auf Personal- und Führungsentwicklung fokussiert. Beide fördern die intensive Interaktion von Ideen, Best Practices und den neuesten Trends in ihren Bereichen.
Eine Veranstaltung von



Im Herzen von Feldkirch hat sich mit der Eröffnung des zweiten Kopf-Standorts ein neues Kapitel aufgeschlagen. Doch dies ist keine gewöhnliche Eröffnung –es ist die Verwirklichung einer Vision, die tief im Herzen der Familie verwurzelt ist.
Auf 450 qm Fläche und drei Etagen präsentiert sich ein Juweliergeschäft, das seinesgleichen sucht. Hier ist ein modernes Gebäude entstanden, das seine Besucher(innen) einlädt zu verweilen, zu erleben und zu genießen. „Die Kunden sind bereits verzaubert von den hellen, offenen Räumen, der freundlichen Atmosphäre und der einladenden Bar, wo künftig private und öffentliche Veranstaltungen stattfinden werden“, erzählt Andreas Kopf. Doch was den Standort wirklich auszeichnet, ist seine einzigartige Kombination aus Handwerk, Kunst und Erlebnis. Schon beim Betreten eröffnet sich ein großzügiger Eingangsbereich mit gemütlicher Sitzgruppe, der sich in den Charme einer edlen Barlounge hüllt. „Hier können unsere Gäste erst einmal ankommen“, sagt Andreas Kopf. Die Augen sehen sich um, die Sinne tauchen ein. Die Entdeckungsreise beginnt.
ERLEBEN. STAUNEN. GENIESSEN.
Im Erdgeschoß warten Schmuckkollektionen, Uhren sowie der eigens entworfene Breitling Shop auf. „Diesen haben wir gemeinsam und nach dem Designkonzept von Breitling gestaltet“, erklärt Andreas Kopf. „Besonders einmalig ist diese Ecke dank des Graffitis eines Vorarlberger Künstlers.“ In der ersten Etage finden auf 100 qm eine Trauringlounge, das öffentliche Diamantlabor, das Uhrmacheratelier sowie ein separater Mont Blanc Corner ihren Platz. Das Highlight des neuen Juweliergeschäfts befindet sich jedoch im Untergeschoß: Eine moderne Eventlocation mit Bar. Bei einem gekühlten Glas Champagner oder einem edlen Rum verschmelzen Shopping und Kulinarik zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. „Wir bieten unseren Kunden ein spektakuläres Erlebnis, das über einen Besuch in einem ‚normalen Juweliergeschäft‘ hinausgeht“, betont Andreas Kopf. Deshalb setzt der zweite Kopf-Standort neue Maßstäbe in der Welt des Luxus und der Feinheit.
EIN ZUHAUSE FÜR ALLE
Bei uns ist jeder willkommen, auch wenn man sich nur mal umsehen möchte.

Trotz der Exklusivität bleibt der Kern der Kopf-Botschaft klar: „Gleich, ob man auf der Suche nach einer Taufkette oder einem elitären Schmuckstück ist – bei uns ist jeder willkommen.“ Es ist diese Balance aus Exzellenz und Zugänglichkeit, die den neuen Kopf-Standort in Feldkirch nicht nur zu einem Geschäft, sondern zu einem Zuhause für alle macht, die das Besondere suchen. Willkommen in einem Geschäft, das es so kein zweites Mal auf der Welt gibt – willkommen bei Familie Kopf.
Die Vorarlbergerin Kadisha Belfiore ist Zoologin, Pädagogin und Kinderbuchautorin. Gemeinsam mit ihrer Kollegin und Freundin Isabella Rummel entstand „Der Streifentüpfelhai“.

Schnappschuss. Isabella Rummel (l.) und Kadisha Belfiore vor dem neuen 360°-HaiAquarium im Haus des Meeres in Wien. Zebrahai Chanti schwamm just in diesem Moment vorbei, als der Fotograf den Auslöser drückte.
Als der Zebrahai vorbeischwamm, fiel es den beiden wie Schuppen von den Augen. Eine Frage stellen alle Kinder, die vor dem Haiaquarium stehen: Warum hat Chanti Punkte und keine Streifen?



Als die Naturwissenschaften laut wurden, verstummten die Geisteswissenschaften. Aber warum eigentlich? Es sind doch die Gegensätze, die sich anziehen und die zu spannenden Verbindungen verschmelzen. Erdbeeren mit Eis, Balsamessig und roter Pfeffer wären da so ein Beispiel. Oder Schokolade mit gebratenem Frühstücksspeck. Doch nicht nur beim Essen kann der Kontrast die Geschmacksexplosion auf der Zunge sein. Auch in der Wahl der Studiengänge beflügeln ungewöhnliche Kombinationen die Karriere. Kadisha Belfiore aus Lustenau, die an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, kurz BafEP genannt, maturierte, sah zuerst im Bachelorstudium Sprachkunst ihre Zukunft. Doch da war auch die große Liebe zu Tieren, der Wissensdurst um das Erforschen von Leben und das Engagement für die Hamsterhilfe und den Tierschutz. Soll das nur Hobby bleiben? Nein, dachte sich die junge Vorarl-

bergerin und begann mit den Naturwissenschaften zu liebäugeln. Biologie mit Schwerpunkt Zoologie war dann das Studium ihrer Wahl, das Belfiore mit dem Master in Verhaltens-, Neuro- und Kognitionsbiologie abschloss. Dass für ihren Traumjob ein „Sowohl-als-auch“ statt eines „Entweder-oder“ die perfekte Voraussetzung ist, ahnte die talentierte 32jährige damals noch nicht.
Über 10.000 Tiere. Auch nicht, als Kadisha Belfiore sich im Haus des Meeres in Wien auf eine Stellenausschreibung bewarb: Guide für die zoopädagogische Abteilung gesucht. „Ausbildung im biologischen Bereich, Erfahrung in der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene, Begeisterungsfähigkeit und, und, und . .“ Dazu das Umfeld, ein Aqua Terra Zoo mit über 10.000 Tieren, die jährlich von 900.000 wissbegierigen Besuchern beobachtet und bestaunt werden.

Buchmesse. Kadisha Belfiore und Isabella Rummel lasen auf Österreichs größter Buchmesse, der Buch Wien.
Zebrahai mit Punkten. Noch dazu stand ein großes Ereignis bevor. Das Haus des Meeres feierte seinen 65. Geburtstag. Dafür wollte sich Belfiore gemeinsam mit ihrer Kollegin und Freundin Isabella Rummel etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Etwas Ähnliches wie das japanische Kamishibai könnte es werden, doch eine große Frage war noch offen: welche Geschichte wollen wir erzählen. Sie soll zu den Tieren passen und das gewisse Etwas haben. Eine eifrige Suche begann. Die beiden durchforsteten Buchhandlungen und Bibliotheken, aber etwas Adäquates fanden sie nicht. Bis sie vor dem 360°-Hai-Aquarium im siebten Stock brainstormten. „Genau in diesem Moment schwamm Chanti, unser Zebrahai-Mädchen vorbei“, erzählt Belfiore schmunzelnd. Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. „Die Kinder wollen doch immer wissen, warum sie Zebrahai heißt, wenn sie keine Streifen, sondern Punkte hat!“
Gelungene Inszenierung. Da war sie nun, die Idee für das Erzähltheater. Ein kleiner gestreifter Hai, gerade erst aus einem Ei geschlüpft, macht sich auf die Suche nach seiner Identität.
Können ihm die anderen Meeresbewohner, wie Anemonenfische, Rotfeuerfische, Meeresschildkröten weiterhelfen? Zumal sich im Laufe seiner Reise auch noch das Aussehen verändert, denn aus den Streifen werden Punkte. Kann es sein, dass er ein „Streifentüpfelhai“ ist?
Aufgeschrieben von Kadisha Belfiore und illustriert von Isabella Rummel, entstand für den großen Tag eine Geschichte, die die kleinen wie auch großen Besucher begeisterte. „Wir gestalteten eine Klanggeschichte als Bilderbuchkino und bauten Orff-Instrumenten mit ein“, erzählt Belfiore. Erst da kam die Idee, Kontakt mit einem Verlag aufzunehmen. So erschien im Herbst 2023 das Bilderbuch „Der Streifentüpfelhai“, das die beiden Biologinnen, Pädagoginnen und Kunstschaffenden stolz auf der Buch Wien im November präsentierten. Mit einem Mal reichen sich Naturund Geisteswissenschaften die Hand. Gegensätze haben Flügel verliehen und die Vielseitigkeit zum Erfolgsgeheimnis erhoben. Könnte wie Rollmops mit Marshmallows schmecken. Is(s)t aber viel, viel besser. Marion Hofer

Tauchgang. Das 360°-HaiAquarium ist eine Nachbildung eines indopazifischen Korallenriffes und Lebensraum für viele Fischarten. Sie zu beobachten, ist wie ein Tauchgang beispielsweise auf den Malediven.
Kennen Sie den Canaletto-Blick oder wissen, warum es unter dem Stephansplatz manchmal unangenehm riecht? Zehn unkonventionelle „Insider-Facts“, die so garantiert in keinem Reiseführer der Welt stehen.

Lebenswerteste Stadt der Welt (der britische Economist reihte Wien im letzten Jahr in punkto Lebensqualität wieder auf den ersten Platz), Tiergarten Schönbrunn ältester Zoo der Welt, innerstädtisches Weinbaugebiet (mit über 600 Hektar besitzt Wien die größte Weinanbaufläche sämtlicher Hauptstädte der Welt) oder Hochquellenwasserleitung aus der Kaiserzeit – diese Schlagworte finden sich in zahlreichen Publikationen. „kontur“ hat versucht, die Seele von „Wean“ mit einem Augenzwinkern in seiner vollen Tiefe zu erfassen.
# 1. Uhrzeit. „Viertel Fünf“ – Die Wiener haben ihre eigene Zeitrechnung und die ist für „Zuagraste“ am Anfang verwirrend, denn es stellt sich die Frage: ist damit 16.45 Uhr gemeint oder 16.15 Uhr? Überlegt man genauer, macht es dann doch Sinn: Ein Viertel der fünften Stunde, sprich 16.15 Uhr oder Viertel Fünf.
# 2. „G‘spritzter“. Das Nationalgetränk der Wiener ist der „G´spritzte“, ein Gemisch von Weißwein mit Mineral- oder Sodawasser im Verhältnis 1:1. Für hohe Temperaturen und den ganz großen

Canaletto-Blick reloaded. „Erhebende“ Sicht vom Belvedere in Richtung Innenstadt.
Gesamtes Spektrum an Gefühlsregungen – von Oida, des is leiwand bis Gusch, du Oasch!
Durst gibt es noch den Sommerspritzer, bei dem sich das Mischverhältnis auf 1:2 ändert. Politisch geprägt ist das „Gesöff“ spätestens seit dem vielzitierten Sager des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, der literarisch ironisch fabulierte: „Man bringe den Spritzwein“. Es gibt auch ausgefallene Kreationen wie etwa den Kaiserspritzer mit einem Schuss Hollunder-Sirup.
# 3. Essen nach Mitternacht. Hungrig und durstig muss auch zu später Stunde in Wien niemand nach Hause gehen: Zahlreiche Restaurants, Lokale und Würstelstände haben bis in die frühen Morgenstunden geöffnet wie etwa das Café Europa (Zollergasse, 7. Bezirk) oder das In-Lokal Motto, das zum 50jährigen Jubiläum Anfang 2023 in Thell umbenannt wurde (Schönbrunner Straße, 5. Bezirk). Selbstredend, dass es dort auch nach Mitternacht noch etwas zu essen gibt.
# 4. Gemütlichkeit. Stichwort: Kaffeehaus – in Wien eine Institution, vor allem weil zu jeder Getränkevariation der braunen Bohne immer ganz selbstverständlich ein Glas Leitungswasser serviert wird und es vollkommen in Ordnung ist, wenn man so lange sitzen bleibt, wie man möchte, um Zeitung zu lesen, über die Welt zu sinnieren oder soziale Kontakte zu pflegen. Manch alteingesessener Wiener würde einschränkend hinzufügen: Der Verbleib über einen längeren Zeitraum ist gestattet, solange die Oberhoheit der Kellner akzeptiert wird.
# 5. Zweite Kassa. Diese vielbeschworene Gelassenheit findet im Supermarkt ein jähes Ende – und zwar, wenn aus der Warteschlange ein lautes, nachdrückliches „Zweite Kassa“ ertönt, das einen zusammenzucken lässt! In anderen Breitengraden völlig undenkbar, ist diese forsche Forderung in der ostösterreichischen DNA tief verwurzelt. Tipp: Obst unbedingt vorher abwiegen, um aggressive „Kassa“-Schreie zu vermeiden.
# 6. Grant versus Charme. Das besondere an Wien sind seine Bewohner: ihr Charme, ihr Grant, begleitet von einem melodischen Dialekt. Die Bandbreite umfasst dabei das gesamte Spektrum an Gefühlsregungen – von „Oida, des is leiwand“ bis „Gusch, du Oasch“. Es ist eine Zwiespältigkeit: Einerseits die lebenswerteste und gleichzeitig die unfreundlichste Stadt der Welt (siehe Expat-City-Ranking 2022), d. h. im Klartext: zum Leben ist es schön, nur freundlich sind die Bewohner eben halt nicht immer. So kann man schon mal auf Parksheriffs treffen, die wegen Falschparkens zwar keinen Strafzettel ausstellen, sondern einen mit dem rustikalen Hinweis „Fahr‘ dein Dreckskarrn da weg, du Oaschloch!“ zur schnellen Platzräumung auffordern. Tipp: Einfach auf sich wirken lassen und im Falle der Fälle mit Humor nehmen.
# 7. 13 A. Das öffentliche Verkehrsnetz ist bestens ausgebaut und doch muss an dieser Stelle die Autobuslinie 13 A erwähnt werden, die den Hauptbahnhof mit der Alserstraße/Skodagasse verbin-

„Wurscht“. Ob zu Mittag oder Mitternacht –der nächste Würstelstand ist nicht weit.
det. Da sie mehrere Bezirke (vom 10. über den 4. bis 9. Bezirk) durchkreuzt, ist sie eine der meistfrequentierten und notorisch überfüllten Wiener Öffi-Linien. Der Umstieg auf größere Gelenkbusse vor einigen Jahre schaffte eine gewisse Abhilfe, dennoch ist in Stoßzeiten bis heute das panikartige „Steigen Sie aus?“ zu hören, um einer anderen Person schon Minuten vor dem Erreichen der gewünschten Ausstiegsstelle mitzuteilen, dass man große Angst hat, nicht zur offenen Tür zu kommen. Falls man den Ausstieg tatsächlich verpasst, wird das „tröstend“ mit folgenden Worten quittiert: „A Spaziergang is eh g‘sund.“
# 8. Windiger Winter. Wer in Wien lebt, weiß, wie der Wind weht: er fegt wild und furios durch die Gassen! Während er an der einen Stelle noch gemächlich durch die eine Straße kriecht, erschreckt er einen – bedingt durch die jeweilige Richtung, aus der er bläst – beim Abbiegen um eine Hausecke plötzlich mit seinem unerbittlich nasskalten Griff, der einem die Ohren einfrieren lässt. Einheimische und Touristen sind so in der kalten Jahreszeit teilweise ganz leicht durch ihre Kopfbedeckung beziehungsweise durch deren Fehlen sowie an frostig roten Gesichtern und Ohren zu erkennen. Für dieses Phänomen gibt es eine eigene Begrifflichkeit: den Wind-Chill-Faktor. Laut dieser Kennzahl fühlen sich zum Beispiel 0 Grad Außentemperatur bei 20 km/h Windgeschwindigkeit an wie minus 6 Grad. Im weltweiten Vergleich ist Wien eine windige Großstadt. Statistisch gesehen gibt es nur an wenigen Tagen im Jahr Flaute. Tipp: Mütze auf, sich eine sturmfeste Frisur oder viel Haarspray zulegen und auf das Positive fokussieren. Wegen des Windes herrscht eine für Großstädte ganz gute Luftqualität. Der Teint bleibt somit frisch.
# 9. U-Bahn-Station Stephansplatz. Auf den Bahnsteigen der U1/Station Stephansplatz dringt Wartenden manchmal ein unangenehmer Geruch in die Nase. Der Grund: Beim Bau der Station wurde ein Verfestigungsmittel auf organischer Basis in den Boden
gespritzt. So sollte verhindert werden, dass der Boden nachgibt und der Stephansdom sich senkt. Diese Materialien dringen nun mit dem Grundwasser kleinweise durch den Tunnel ein und riechen nach Erbrochenem. Tipp: Möglichst lange die Luft anhalten oder alternativ durch den Mund atmen
# 10. Hochhäuser. Die hohen Türme erhitzen seit Jahren die Gemüter: Vor allem Bewohner ärgern sich, weil die Sicht versperrt und die Sonne weg ist oder die Bauten einfach nur „schiach“ sind und das Stadtbild verschandeln. Dennoch wird seit den 90er-Jahren munter in die Höhe gebaut wie etwa beim Millennium Tower am Handelskai, der eigentlich nur 140 Meter hoch werden sollte. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 1999 maß er mit Antenne 202 Meter. Kurzerhand wurde der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im Nachhinein angepasst – wohl eine prägende Erfahrung für die Stadtpolitik, denn in der Folgezeit blieben die städtebaulichen Leitlinien vage und wurden bei Bedarf angeglichen wie etwa beim DC Tower 1. Auch hier war die Höhe von 220 Metern nicht ganz so vorgesehen. Das Hochhausprojekt am Heumarkt mit einer geplanten Bauhöhe von 66 Metern katapultierte das historische Zentrum schließlich auf die Rote Liste der bedrohten UNESCO-Weltkulturerbestätten. „Canaletto-Blick reloaded“: sprich Bernardo Bellottos berühmtes Gemälde, seit Jahrhunderten eine Art Aushängeschild für die Stadt, das den Blick von Schloss Bellvedere in Richtung Innenstadt auf Stephansdom und Kuppelkirchen richtet, visuell beeinträchtig durch Hochhäuser? – eine Vorstellung, die alteingesessenen Wienern die Zornesröte ins Gesicht treibt.
Das Original-Canaletto-Bild ist übrigens im Kunsthistorischen Museum in Wien zu bestaunen – ohne Hochhäuser. Fazit: #We love Vienna, Oida! Bussi, Baba! Christiane Schöhl von Norman

Kultstatus. Cafés sind eine Oase der Gemütlichkeit.

Verboten. Dieser Wirt kommuniziert klar seine Regeln.
Ja, wir drucken klimaneutral.
Wir setzen auf Wärmepumpen statt fossile Brennstoffe, produzieren grüne Energie mit unserer PhotovoltaikAnlage, drucken mit Farben auf Pflanzenölbasis und leben ganz nach dem Motto «vermeiden – reduzieren – kompensieren».



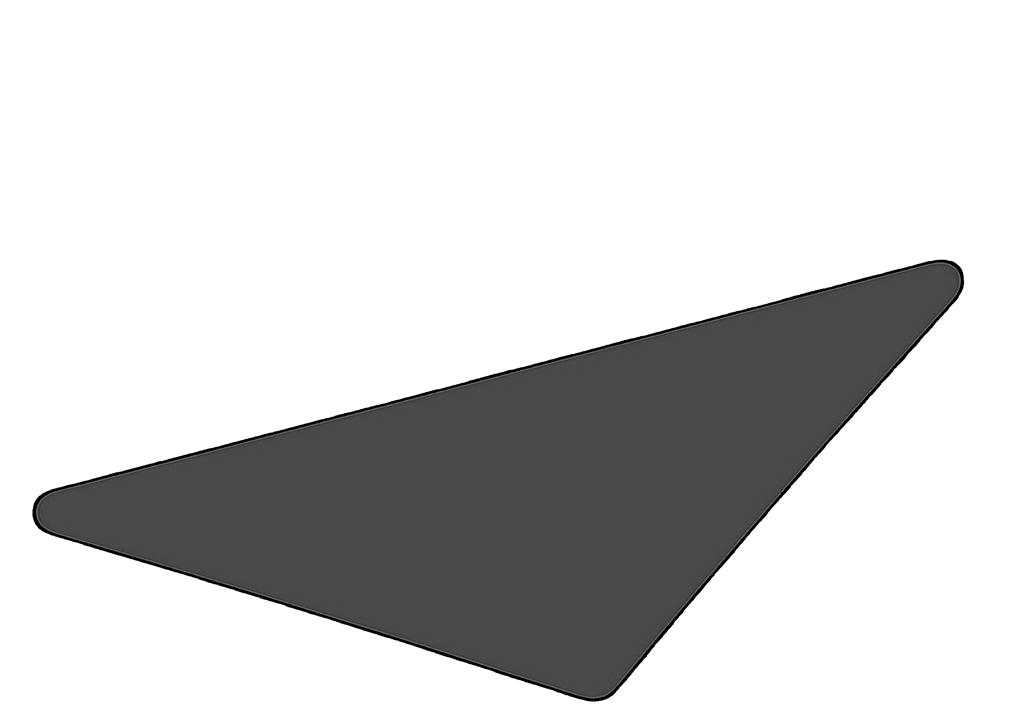
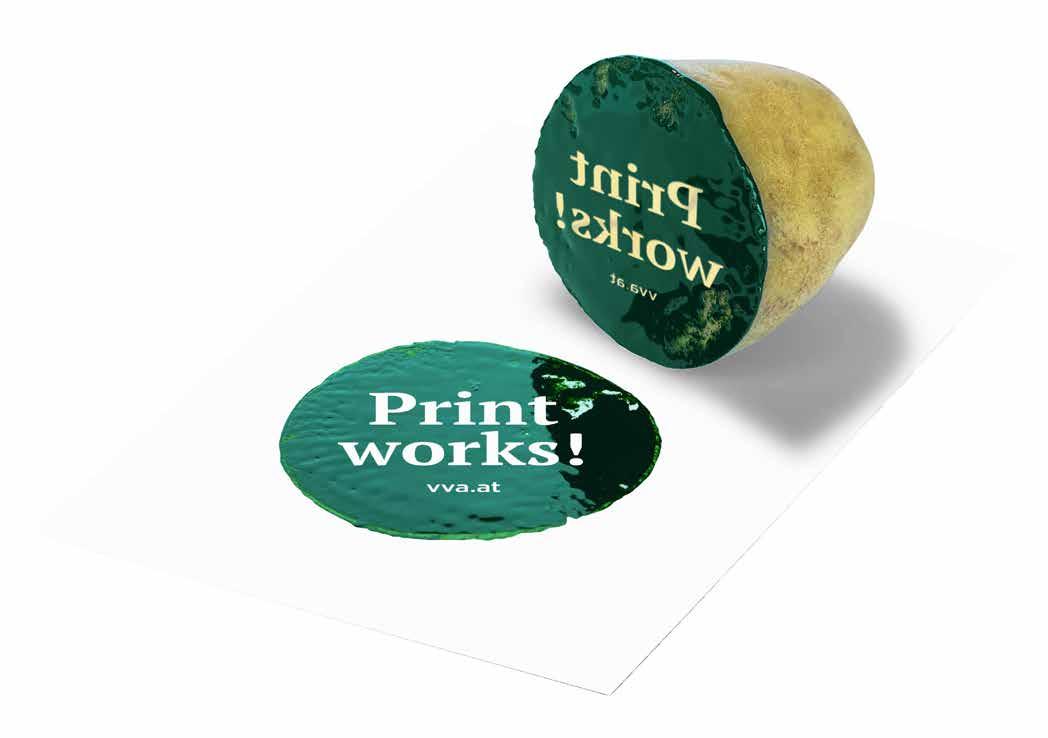

VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE
Seit dem Jahr 2019 ist das erste Elektroauto von Porsche, der Taycan, auf dem Markt. Nun bekommt das Modell eine Frischzellenkur verpasst, die sich in Form von mehr Leistung, einer höheren Reichweite, verbesserten Beschleunigungsphase sowie kürzeren Ladezeit niederschlägt. An DC-Ladsäulen mit 800 Volt kann der neue Taycan beispielsweise mit bis zu 320 kW geladen werden – das sind 50 kW mehr als bisher. Darüber hinaus wurde das Design modifiziert sowie die Turbo-Modelle mit einem eigenständigeren Auftritt noch stärker differenziert – auch der fahrzeugeigene Sound ist speziell. •
www.porsche.at

DIE SACHE HAT EINEN HAKEN
Wenn jemand etwas von richtig gutem Sound versteht, dann wohl Pharrell Williams. Der Sänger, Rapper, Songwriter und Musikproduzent ist seit 2023 Kreativchef der Männerlinie des französischen Modeunternehmens Louis Vuitton. In dieser Funktion hat er nun eine limitierte Damo-flage-Edition eines High-End-Lautsprechers entworfen: Der LV Nanogram Speaker bietet einen satten Klang mit einer maximalen Lautstärke von 84 dB sowie einer Betriebsdauer von bis zu 17 Stunden. Inspiriert von der ikonischen Toupie-Tasche präsentiert er sich mit zahlreichen Koffer-Details wie Lederschlaufe, Stahlnieten und Gürtelhaken. •
www.louisvuitton.com

IMMER DER NASE NACH
Parfums haben die Kraft, die unterschiedlichsten Assoziationen und Emotionen zu wecken. Die Edition Noir ist eine charismatische und moderne Neuauflage des Originaldufts von Pasha de Cartier. Sie kombiniert eine von Zitrusnoten geprägte Frische mit der Tiefe von Ambra und Zedern –das Ergebnis: geheimnisvoll, gewagt und ausdrucksstark. Auch das Design des Flakons wurde überarbeitet, die Menge des verwendeten Plastiks reduziert sowie nachhaltige Materialien bevorzugt. Der blaue Cabochon, oben auf dem Deckel des Flakons, spannt übrigens den Bogen zur Uhrmacherkunst der Maison. •
www.cartier.com
„Kultur salzt Europa“ heißt es nun in Bad Ischl. Wer länger sucht, entdeckt in der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstadt neben den vielen MonarchieDevotionalien einiges, das diesem Slogan entspricht.
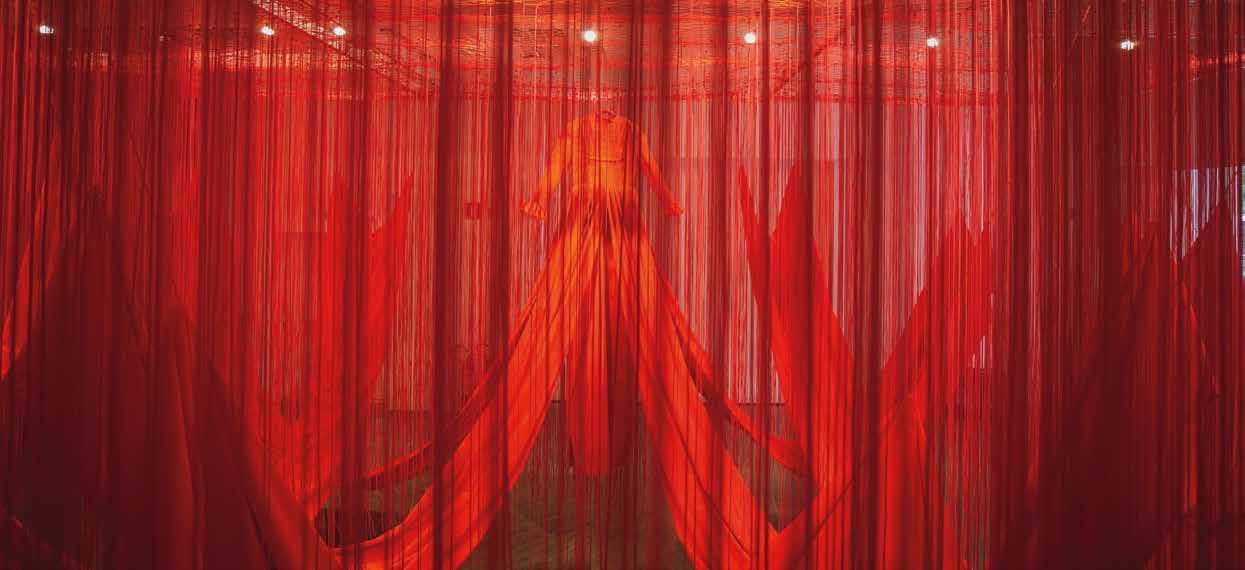
Gedenkkultur. Chiharu Shiota erarbeitet eine Installation für den KZGedenkstollen in Ebensee.
Sie ist keine Abonnentin einer regionalen Tageszeitung und hat auch sonst keinerlei Mitgliedschaft vorzuweisen, die ihr laut Kassier eine Ermäßigung einbringen würde. Die ältere Dame legt den vergleichsweise stattlichen Eintrittspreis von 15 Euro auf den Tresen und leistet sich – mit zeitgenössischer Kunst absolut nicht vertraut, wie sie gesteht – für fünf Euro noch ein Zusatzticket für die bald beginnende Führung. Mit dem Zug sei sie eigens angereist und jetzt wolle sie einfach einmal schauen, was hier so läuft in der Kulturhauptstadt. Diese Szene war nicht etwa in einem schönen großen Muse-
um zu beobachten, sie spielte sich jüngst im ehemaligen Sudhaus des oberösterreichischen Salzkammergutortes Bad Ischl ab.
Zu bewältigen. Das Ambiente ist grindig, Sole wird hier zwar keine mehr verarbeitet, aber von architektonischer Adaptierung kann nicht die Rede sein. Eine schwierige Voraussetzung für die Präsentation von Kunst, aber zu bewältigen, wie sich bald herausstellt. Wie ihr die Ausstellung gefallen hat, kann ich die erwähnte Dame nicht mehr fragen, ihr Interesse hat mich jedoch beeindruckt, berührt. Sollte sie das Ballet Mécanique, eine Klanginstallation von
Winfried Ritsch, an diesem Tag noch auf ihrem Plan gehabt haben, hatte sie Pech gehabt wie ich. „Heute leider wegen Krankheit geschlossen“ steht auf einem Zettel, der an die Tür zum Lehár-Theater geklebt wurde. Die Sanierung des lange als Kino genutzten Hauses mit nostalgisch anmutender „Filmtheater“-Fassade ging sich für 2024 nicht mehr aus, soll aber stattfinden. „Die Avantgarde wird auf unbestimmte Zeit verlängert“, steht auf dem Giebel. Vor dem Eingang gibt es noch einen Hinweis darauf, dass die Autorin und Rapperin Mieze Medusa in Bad Ischl zur Stadtschreiberin ernannt wurde.
Neben dem entsprechenden Poster befindet sich die Büste vom Schauspieler Helmut Berger. Er hatte nicht in Bad Ischl gekurt – wie viele der derart präsenten Personen –, sondern wurde hier im Mai 1944 geboren. „Internationaler Schauspieler als Ludwig II.“ steht auf dem Sockel. Dachte ich es mir, seine Ludwig-Darstellung wird als einzige seiner vielen Rollen hervorgehoben. Ludwig, der König, der Träumer und der Cousin von Kaiserin Elisabeth. Da ist nichts zu machen, Sisi bleibt omnipräsent an diesem Ort. Während man lange nach einem Kulturhauptstadt-Plakat suchen muss und den offiziellen Schriftzug „Kultur salzt Europa“ dann zumindest bei der ehemaligen Trinkhalle, dem Tourismusbüro, findet, wird alle paar Meter, in Schaufenstern oder auf Fassaden, mit dem Kaiserinnen-Porträt für irgendetwas geworben, wird damit irgendetwas verkauft. Meistens ist es etwas Süßes, wobei auch der Kaiser für allerlei Werbezwecke herhalten muss. Kleine Fruchtküchlein als „Habsburger“ zu 3,30 Euro pro Stück in eine Auslage zu stellen, hat dabei zumindest einigen Witz. Eine Besichtigung der Kaiservilla reizt uns als Kulturhauptstadtbesucher
Treffend. Schriftzug von Katharina Cibulka auf dem Postamt von Bad Ischl.
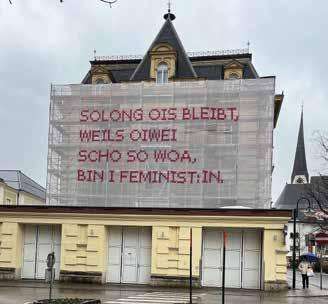
trotzdem nicht. Aber immerhin präsentiert man dort nicht nur Monarchie-Devotionalien, in der Auflistung der Bad Ischler Sehenswürdigkeiten ist mittlerweile zu lesen, dass Kaiser Franz Josef am 28. Juli 1914 hier in seiner Villa die Kriegserklärung gegen Serbien unterschrieben hat, die den Ersten Weltkrieg auslöste.
Menschenrechte. Die ab Juni geplante Intervention des chinesischen Künstlers Ai Weiwei im Kaiserpark führt weiter zurück in die Geschichte. Seine Auseinandersetzung mit Relikten früher chinesischer Dynastien in Form von Gefäßen ist von einigen Retrospektiven bekannt, die etwa im Gropius-Bau in Berlin oder in der Albertina in Wien zu sehen waren. In Bad Ischl werden seinen Arbeiten Funde aus der Hallstatt-Zeit gegenübergestellt. Die Werke der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota sind nicht nur Biennale-Besuchern in Venedig in Erinnerung, sie realisierte im letzten Sommer im Kunstraum Dornbirn eine Installation aus Schläuchen mit roter Flüssigkeit, mit der sie die Verflechtung der eigenen physischen Existenz mit der Umwelt thematisierte. Für den KZ-Gedenkstollen in
Mit Bad Ischl und weiteren 22 Salzkammergutgemeinden ging der Titel Europäische Kulturhauptstadt zum dritten Mal nach Österreich.
Ebensee hat sie eine Arbeit aus Kleidungsstücken und von Menschen benutzten Gegenständen konzipiert, die von April bis September dort zu sehen ist. Die Lichtinstallation „Flood“ von Ruth Schnell ist nicht mehr da, aber es ist gut zu wissen, dass die aus Vorarlberg stammende Medienkünstlerin und Hochschulprofessorin hier mit einer ihrer neueren Arbeiten prominent vertreten war. Projektionsmapping nennt sich das Verfahren, mit dem sie die 30 Artikel sowie Zusatzartikel der Menschenrechtserklärung von 1948 auf dem Gebäude der Johann-Nestroy-Mittelschule von Bad Ischl sichtbar machte.
Wasser und Salz. Bad Ischl ist von zwei Flüssen, der Traun und der Ischl, umgeben. Im 16. Jahrhundert wurde dort der erste Salzstollen angeschlagen.

Monarchie.
Dass Bad Ischl die Sommerresidenz des Habsburg-Kaiserhauses war, ist auch im Straßenbild ersichtlich.


Operette. Das einstige, nach dem Komponisten benannte LehárTheater wurde lange als Kino genutzt.
Menschenrechte.
Ein Werk der Vorarlberger Künstlerin Ruth Schnell war bei der Eröffnung vertreten.


Im Kulturhauptstadtjahr sind in Bad Ischl sowie in den teilnehmenden Salzkammergutorten in Oberösterreich und in der Steiermark rund 300 Projekte geplant. Sie sollen auch den Übertourismus in der Region thematisieren.
Postämter, die in Österreich gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, gleichen einander. Das beste Beispiel dafür liefern das markante Gebäude am Bregenzer Seeufer sowie der monarchiegelbe Klotz in der diesjährigen Kulturhauptstadt. Schön, dass das Werk der Tiroler Künstlerin Katharina Cibulka gleich über mehrere Wochen eine Seite dieses Hauses abdeckt. Ein Baustellennetz ist mit einem passenden Spruch bestickt: „Solong ois bleibt, weils oiwei scho so woa, bin i Feministin“. Auch das


erinnert übrigens an Bregenz, wo vor zwei Jahren das Rathaus mit einer Arbeit von Cibulka verkleidet war. „Solange Gleichstellung nicht deine Lieblingsstellung ist, bin ich Feministin“, war zu lesen.
Partizipativ. Gendergerechtigkeit und auch vieles, das schief läuft, ärgerlich oder schlicht als skandalös aufzuzeigen ist, kommt in einer Produktion zum Ausdruck, die im großen Kulturhauptstadtprogramm nicht untergehen darf und den partizipativen Charakter, der überall wichtig wäre, im Konzept hat. „Kannst gerne auch ein bischen weiter nach vorne kommen, dann siehst du alles besser“, sagt mir einer der engagierten Mitwirkenden. Im Festsaal von Bad Goisern steht die Produktion „Das große Welttheater“ kurz vor der Premiere. Ich darf kiebitzen. Das von Reinhold Tritscher geleitete Salzburger Theater ecce entspricht dem Begriff inklusiv und nimmt das Angebot zur Teilhabe nicht nur ernst, sondern thematisiert es gleich in seiner Adaptierung des „Großen Welttheaters“ von Calderón de la Barca. Die Zuweisung der Rollen im barock aufgefassten Schöpfungsprogramm wird in der Gegenwart zu einem Casting mit Bewerbern, die jeweils gesellschaftspolitische Themen repräsentieren. Das sind die Unterbezahlten in der
Erhellend. Das inklusive Ensemble ecce beeindruckte mit seinem „Großen Welttheater“.
Pflege- und Expeditbranche, das sind reiche Erben, das sind die Weisungsgebundenen, Aussteigerwilligen oder leicht Manipulierbaren, aber auch die Bombenbauer und Empathielosen. Die Zuspitzungen im Text verschiedener Autorinnen und Autoren sowie in der Darstellung sind mitunter kurios, die Härte des Überlebenskampfes bleibt sichtbar wie die politischen Mechanismen inklusive Populismus auf der Gemeinde- und Bundesebene.
Wer sich mit dem gesamten Kulturhauptstadtprogramm auseinandersetzt, kommt zum Schluss, dass es bei einem Budget von rund 30 Millionen Euro mehr Einbindung regionaler Gruppierungen geben müsste. Mit der Teilnahme von 23 Salzkammergutgemeinden in Oberösterreich und der Steiermark wird geworben. Bei Gesprächen in Geschäften im zentralen Ort Bad Ischl wird mir Erwartungshaltung signalisiert: „Noch merken wir nichts von der Kulturhauptstadt, aber das wird sich schon noch ändern.“
Nahrungsmittel. Besucher, die nicht nach Zauner-Kipferln und einer Zuckerguss-Sisi trachten, gibt es, wie die ältere Dame im Sudhaus beweist. Die bis in den Herbst geöffnete Ausstellung „Kunst mit Salz & Wasser“ besticht in der komple-
xen Auseinandersetzung mit dem was uns am Leben erhält, erzählt von Sesshaftwerdung, Industrieprozessen, Wachstum etc. Norbert W. Hinterberger lässt uns – um einige Beispiele zu erwähnen – über Nahrungsmittel und Ressourcen nachdenken, wenn er ein Schiff aus Brot auf einen See aus Salzsteinen setzt, die Fragilität des Erinnerns thematisiert Motoi Yamamoto mit einem Labyrinth aus reinem, weißen Salz. Im Video von Sigalit Landau schmelzen Schuhe aus Salzkristallen ein Loch in die Eisdecke eines Sees, in dem sie schließlich
Sudhaus. Installation von Norbert W. Hinterberger im Sudhaus, wo die zentrale 2024-Ausstellung bis Oktober zu sehen ist.

Poetisch. Videoarbeit von Sigalit Landau mit Salzund Eiskristallen.
Gedenkprojekt. In Bad Ischl wird endlich auch auf die Verbrechen in der NS-Zeit aufmerksam gemacht.
verschwinden. Eva Schlegel konkretisiert mit Augmented Reality Raumerfahrungen. Caterina Gobbi arbeitet mit Geräuschen, die beim Schmelzen von Gletschern entstehen. Die handelsübliche Verpackung des Bad Ischler Salzes erfährt in den Collagen von Marion Eichmann aufschlussreiche Verwendung.
Raubkunst. Mit Bad Ischl und den Salzkammergutgemeinden ging der Titel Europäische Kulturhauptstadt zum dritten Mal nach Österreich. Im Jahr 2003 erhielt ihn

„Reise der Bilder“ heißt eine Ausstellung im Linzer Lentos mit Werken, die in der NSZeit in Salzkammergutstollen gelagert waren.


Graz, das damals sein Kunsthaus eröffnete und wo ein Kulturhauptstadt-Projekt verblieb, nämlich die nach Plänen von Vito Acconci errichtete Murinsel. 2009 trug Linz den Titel. Im dortigen Museum Lentos konfrontiert nun eine in Kooperation mit der Kulturhauptstadt 2024 konzipierte Ausstellung mit NS-Raubkunst sowie Werken, die während der Kriegsjahre im Salzkammergut, unter anderem auch in Bergwerksstollen in Lauffen gelagert wurden. Werke von Tizian, Tiepolo und Van Dyck sind dabei, aber auch wesentliche europäische Themen wie die Provenienzforschung und Rückgabeforderungen sind somit im Kulturhauptstadtprogramm enthalten. Übrigens: Es ist gut, auf die etwa ein Meter hohen Stecknadeln im Stadtraum von Bad Ischl zu achten. Wer die roten Köpfe aufklappt, dem wird die Geschichte von Vertreibung, Ermordung und von Zwangsenteignungen des Besitzes und der Betriebe von Jüdinnen und Juden ab 1938 erzählt. Christa Dietrich
Die komplexe Thematik von Kunsthandel, Raubkunst und Beschlagnahmung in der Region behandelt die Ausstellung über Wolfgang Gurlitt bis Oktober im Kammerhofmuseum Bad Aussee.



WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Sie haben die Strategien und Ideen für nachhaltiges Wachstum. Wir unterstützen Sie zuverlässig bei der Umsetzung und finden gemeinsam Lösungen, die Ihr Unternehmen weiterbringen.
Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels, Salzburg und St. Gallen (CH). www.hypovbg.at