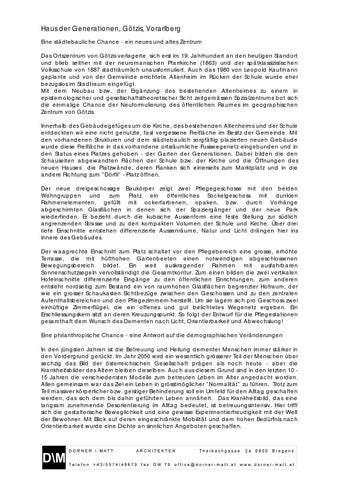Haus der Generationen, Götzis, Vorarlberg Eine städtebauliche Chance - ein neues und altes Zentrum Das Ortszentrum von Götzis verlagerte sich erst im 19. Jahrhundert an den heutigen Standort und blieb seither mit der neuromanischen Pfarrkirche (1863) und der spätklassizistischen Volksschule von 1887 stadträumlich unausformuliert. Auch das 1980 von Leopold Kaufmann geplante und von der Gemeinde errichtete Altenheim im Rücken der Schule wurde eher bezugslos im Stadtraum eingefügt. Mit dem Neubau bzw. der Ergänzung des bestehenden Altenheimes zu einem in epistemologischer und gesellschaftstheoretischer Sicht zeitgemässen Sozialzentrums bot sich die einmalige Chance der Neuformulierung des öffentlichen Raumes im geographischen Zentrum von Götzis. Innerhalb des Gebäudegefüges um die Kirche, des bestehenden Altenheims und der Schule entdeckten wir eine nicht genutzte, fast vergessene Freifläche im Besitz der Gemeinde. Mit den vorhandenen Strukturen und dem städtebaulich sorgfältig plazierten neuen Gebäude wurde diese Freifläche in das vorhandene ortsräumliche Fusswegenetz eingebunden und in den Status eines Platzes gehoben - der Garten der Generationen. Dabei bilden die den Schauseiten abgewandten Flächen der Schule bzw. der Kirche und die Öffnungen des neuen Hauses die Platzwände, deren Flanken sich einerseits zum Marktplatz und in die andere Richtung zum ”Dörfli” - Platz öffnen. Der neue dreigeschossige Baukörper zeigt zwei Pflegegeschosse mit den beiden Wohngruppen und zum Platz ein öffentliches Sockelgeschoss mit dunklen Rahmenelementen, gefüllt mit ockerfarbenen, opaken, bzw. durch Vorhänge abgeschirmten Glasflächen in denen sich der Spaziergänger und der neue Park wiederfinden. Er bezieht durch die kubische Aussenform eine feste Stellung zur südlich angrenzenden Strasse und zu den kompakten Volumen der Schule und Kirche. Über drei tiefe Einschnitte entstehen differenzierte Aussenräume, Natur und Licht drängen hier ins Innere des Gebäudes. Der waagrechte Einschnitt zum Platz schaltet vor den Pflegebereich eine grosse, erhöhte Terrasse, die mit hüfthohen Gartenbeeten einen notwendigen abgeschlossenen Bewegungsbereich bildet. Ein weit auskragender Rahmen mit ausfahrbaren Sonnenschutzsegeln vervollständigt die Gesamtkontur. Zum einen bilden die zwei vertikalen Hofeinschnitte differenzierte Eingänge zu den öffentlichen Einrichtungen, zum anderen entsteht nordseitig zum Bestand ein von raumhohen Glasflächen begrenzter Hofraum, der wie ein grosser Schaukasten Sichtbezüge zwischen den Geschossen und zu den zentralen Aufenthaltsbereichen und den Pflegezimmern herstellt. Um sie lagern sich pro Geschoss zwei einhüftige Zimmerflügel, die ein offenes und gut belichtetes Wegenetz ergeben. Ein Erschliessungskern sitzt an deren Kreuzungspunkt. So folgt der Entwurf für die Pflegestationen gesamthaft dem Wunsch des Dementen nach Licht, Orientierbarkeit und Abwechslung! Eine philanthropische Chance - eine Antwort auf die demographischen Veränderungen In den jüngsten Jahren ist die Betreuung und Heilung dementer Menschen immer stärker in den Vordergrund gerückt. Im Jahr 2050 wird ein wesentlich grösserer Teil der Menschen über sechzig das Bild der österreichischen Gesellschaft prägen als noch heute - aber die Krankheitsbilder des Altern bleiben dieselben. Auch aus diesem Grund sind in den letzten 10 15 Jahren die verschiedensten Modelle zum betreuten Leben im Alter angedacht worden. Allen gemeinsam war das Ziel ein Leben in grösstmöglicher ”Normalität” zu führen. Trotz zum Teil massiver körperlicher bzw. geistiger Behinderung soll ein Umfeld für den Alltag geschaffen werden, das sich dem bis dahin geführten Leben annähert. Das Krankheitsbild, das eine langsam zunehmende Desorientierung im Alltag bedeutet, ist betreuungsintensiv. Hier trifft sich die gestalterische Beweglichkeit und eine gewisse Experimentierfreudigkeit mit der Welt der Bewohner. Mit Blick auf deren eingeschränkte Mobilität und dem hohen Bedürfnis nach Orientierbarkeit wurde eine Dichte an sinnlichen Angeboten geschaffen.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.