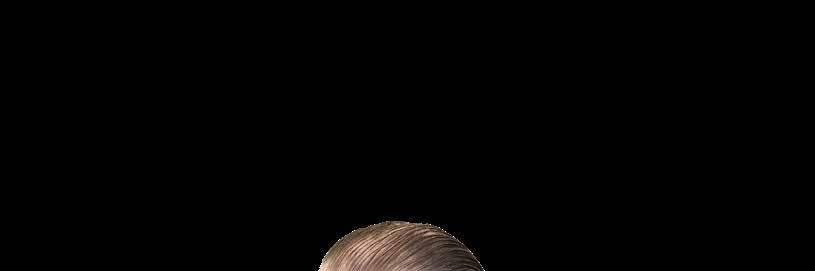
Minister für Gesellschaft und Justiz

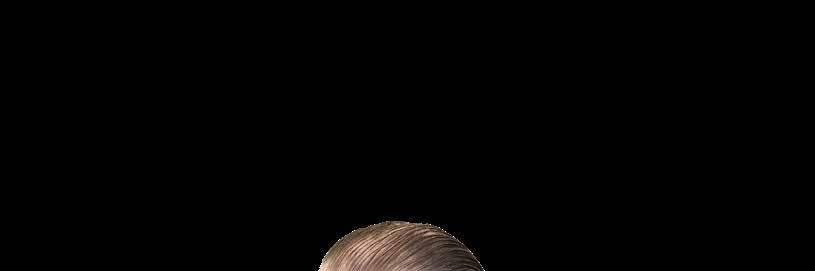
Minister für Gesellschaft und Justiz
ab Seite 6


Hagenhaus Lie-Zeit 206x265 Sep.qxp_Layout 1 25.08.2025. 08:12 Page 1

4. Sep
Donnerstag im Hagenhaus Weltstars
Tschaikowski Wettbewerb Gewinner
Alexandre Kantorow, Klavier 65 CHF – 19 Uhr
9. Sep
Kammermusikkonzert Streichquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
10. Sep
Resonanzen Violoncellokunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
11. Sep

Donnerstag im Hagenhaus Operalia
Modern Musical Classics
Frank Nimsgern, Klavier
Aino Laos, Musicalstar
Chris Murray, Musicalstar 45 CHF – 19 Uhr
16. Sep
Kammermusikkonzert
Klavierquartette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
17. Sep
Resonanzen Violinklänge freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
Konzerte der Musikakademie Donnerstag im Hagenhaus
Erleben Sie die Weltelite von heute und morgen bei über 100 Veranstaltungen im exklusiven Ambiente des Hagenhaus in Nendeln Tickets und/oder obligatorische Reservierung unter: T +423 262 63 52 oder hagenhaus@ticketing.li • Max. 100 Plätze bei freier Platzwahl • Feldkircherstrasse 18, FL-9485 Nendeln


18. Sep
Donnerstag im Hagenhaus
Tanzabend mit der Band Rowsekit 30 CHF – 19 Uhr
25. Sep
Donnerstag im Hagenhaus
Einführungen zur Musik im Zeichen der Frau: Prof. Dr. Eva Rieger; Marianne Böttcher, Violine; Tatiana Chernichka, Klavier freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
30. Sep
Kammermusikkonzert
Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
1. Okt
Resonanzen Tastenvirtuosi freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
7. Okt
Kammermusikkonzert
Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
8. Okt
Resonanzen Klavierkunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit Gesellschafts- und Justizminister Emanuel Schädler schliessen wir die Reihe der Vorstellung der Liechtensteiner Regierungsmitglieder und deren Aufgaben ab. Unser Mitarbeiter Heribert Beck hat mit Regierungsrat Schädler über seinen Arbeitsprozess gesprochen.
Der Landtag ist die zentrale Säule der Demokratie, da er die Interessen des Volkes auf nationaler Ebene vertritt. Philipp Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut, ist Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechten-
steins». Er beschreibt die Aufgaben des Landtags.
Rolf Pfeiffer ist seit rund zweieinhalb Jahren Stadtpräsident von Buchs. Er ist Buchser durch und durch und brennt für die Anliegen seiner Stadt, die er mit seinem Einsatz voranbringen möchte. Gleichzeitig denkt er aber auch sehr regional und plädiert dafür, Kräfte zu bündeln. Wir haben mit ihm über seine aufstrebende Stadt gesprochen.
Im Sportteil widmet sich unser Mitarbeiter Chrisi Kindle dem Liechtenstein Olympic Commitee (LOC), dessen Präsident Stefan Marxer im Interview ausführlich Stellung zur aktuellen
Situation des Sports in Liechtenstein bezieht.
Auf seinen mehr als 100 Auslandsreisen besuchte Papst Johannes Paul II. am 8. September 1985 auch Liechtenstein, das ihm einen grossen Empfang bereitete. Unser Mitarbeiter Günther Meier blickt auf diesen Besuch zurück.
In diesem Sinne wünsche ich euch sonnige Herbsttage, weiterhin alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der lie:zeit.
Herbert Oehri, Redaktionsleiter
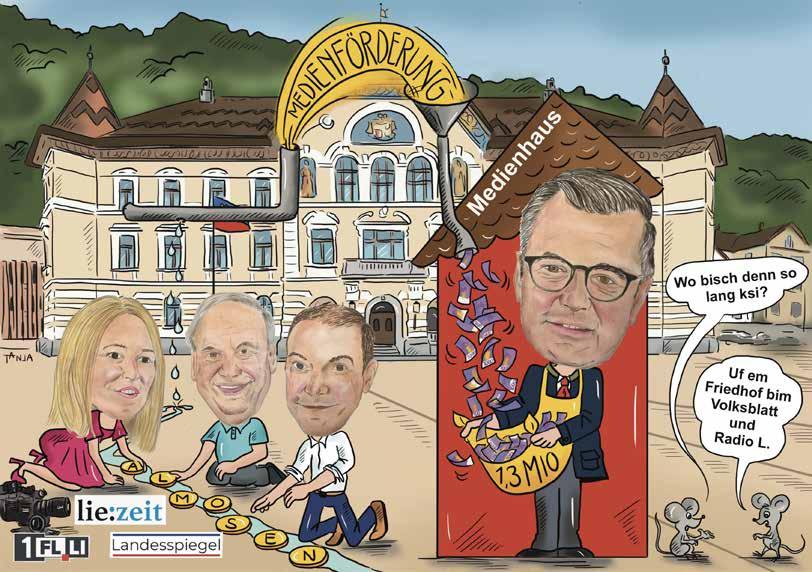

Handbuch «Das politische System Liechtensteins»

Buch im:fokus
«Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein»
Buchvorstellung


jugend:zeit mit Giulio Vogt
Impressum
Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Regierungsrat Emanuel Schädler, Jörg Paetzold, Michael Benvenuti, Philippe Rochat, Stadtpräsident Rolf Pfeiffer, Giulio Vogt, Emil Jäger, Carlo Klösch, David Näscher, Fabian Öhri, Günter Grabher, Schöb AG, Christoph Kindle, Philipp Meier, Günther Meier, Klaus Biedermann · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Daniela Büchel, Stephanie Lampert · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: Jürgen Posch, Michael Zanghellini, Liechtensteinisches Landesarchiv, Adobe, ZVG ·
Urheberschutz: Die Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden. · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Somedia Partner AG, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 06. September 2025 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 03 (Vera Oehri), Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 04. Oktober 2025
Interview mit Stefan Marxer, Präsident des Liechtenstein Olympic Commitee
«Der Weg zu internationalen Medaillen ist lang und steinig»


Papstbesuch vor 40 Jahren
Freie Fahrt für alle – bringt
Gratis-ÖV wirklich die Wende? 10
Menschen in der FBP: Franziska Hoop 11
Zahltag bei Günter Grabher, Hilcona AG 44
Projektpräsentation «Toggenburg» 52

Ist der FC Vaduz ein Aufstiegskandidat? 57
«Erster Saisonsieg fühlt sich an wie eine Befreiung» 60
Balzers will Herausforderungen annehmen 62
Hintersassen in Triesenberg: Dörfliche Unterschicht ohne landwirtschaftliche Nutzungsrechte 76

Montag, 8. September 2025, 18.00 Uhr
Bis 17.00 Uhr können Fundgegenstände abgeholt und Kastenschlüssel abgegeben werden. Nach diesem Datum verfällt die Depotgebühr zu Gunsten des Schwimmbades.
Titelstory
«Ich
Mit dem Gesellschaftsministerium hat Regierungsrat Emanuel Schädler eine Reihe grosser Ausgaben übernommen. Im Interview berichtet er, wie er die Corona-Zeit aufarbeiten möchte, wie das Kostenwachstum im Gesundheitswesen eingedämmt werden könnte, warum die AHV jetzt ohne Not auf langfristig gesunde Beine gestellt werden kann und wie er das Projekt Landesspital nach Jahren der Planungen nun voranbringen möchte.
Interview:
Heribert Beck
Herr Regierungsrat, wie haben Sie sich in den vergangenen knapp fünf Monaten in Ihre neuen Aufgaben eingelebt und was waren die grössten Herausforderungen?
Regierungsrat Emanuel Schädler: Eine grosse, aber auch spannende Aufgabe war es für mich, mir erst einmal einen Überblick über den grossen Bereich Gesellschaft und Justiz zu verschaffen. Es ist in diesen Themen in den vergangenen Jahren viel passiert und wir haben eine breite Palette an Anspruchsgruppen, die ich erst einmal persönlich kennenlernen wollte. Daneben läuft das Tagesgeschäft weiter. Es gibt akute und dringende Entscheidungen, die sich nicht aufschieben lassen. Auch haben wir einige Projekte der Vorgänger geerbt, die wir weitertreiben. Zum Glück kann ich mich auf mein Team im Ministerium verlassen, denn nur Teamwork macht es möglich, diese ganze Fülle an Themen und Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.
Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie in diesen ersten Monaten gesetzt?
Was uns natürlich permanent beschäftigt ist das Landesspital. Wir müssen mit den Verantwortlichen nun endlich jene Klarheiten und Voraussetzungen schaffen, die wir brauchen, um mit dem Bau in geordneten und sicheren Bahnen voranzukommen. Leider haben unsere Überprüfungen ergeben, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. Wir arbeiten aber vertrauensvoll mit dem Stiftungsrat zusammen, und wir alle wollen, dass es zügig weitergeht. Weitere grosse Themen waren die langfristige Sicherung der AHV und natürlich der Budgetprozess für das Jahr 2026. Die Aufbruchsstimmung im Ministerium und den Ämtern mit einer gewissen haushälterischen
Vorsicht zu paaren, ist eine Herausforderung. Aber es ist nötig, um das Grosse und Ganze des Landes und der Landesverwaltung auch künftighin auf tragfähige finanzielle Beine stellen zu können.
Mit dem angesprochenen Neubau des Landesspitals haben Sie keine einfache, vielleicht sogar eine undankbare Aufgabe übernommen. Wie zuversichtlich sind Sie, das Projekt nach all den Verzögerungen und Schwierigkeiten der vergangenen Jahre zu einem guten Abschluss zu bringen?
Das Projekt wurde ganz schwierig aufgegleist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir – hätte die erste Abstimmung gereicht – in den nächsten Monaten wohl Eröffnung hätten feiern können, sagt das schon alles. Am Ende wird es gut kommen, aber bis dahin wird es noch Geduld und Schweiss kosten.
Wie möchten Sie Ruhe in das Projekt bringen und mit welchem Zeithorizont rechnen Sie derzeit bis zur Eröffnung des neuen Landesspitals?
Wir – und damit meine ich alle Akteure, die in irgendeiner Form beteiligt sind – müssen jetzt schauen, dass Dokumentation und Organisation auf den neusten Stand gebracht werden und zweckgemäss sind. Wir brauchen mehr Bauwissen im Projekt. Der Steuerungsausschuss muss mit jenen Leuten besetzt werden, deren Institutionen dieses Wissen haben. Ich denke dabei insbesondere an die Stabsstelle für staatliche Liegenschaften. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, weil dieser Ansatz von allen Seiten bisher positiv aufgenommen wurde und unterstützt wird. Es wird halt nicht so schnell gehen, wie wir uns das alle erhofft hätten. Aber am Ende zählt, dass wir ein

Justizminister Emanuel Schädler zusammen mit Manuel Walser (links), Präsident der Rechtsanwaltskammer, und Hilmar Hoch (rechts), Präsident des Staatsgerichtshofs, bei der Verleihung der Rechtsanwaltsdiplome im vergangenen Juni.
zweckmässiges Spital haben, das sich unsere Bevölkerung mit zwei Abstimmungen gewünscht hat. Derweil müssen wir darauf bedacht sein, das Landesspital am alten Standort so auszustatten, dass dort das qualitativ hochwertige Arbeiten für die Angestellten weiterhin möglich ist. Das geht angesichts der Neubau-Diskussionen leider manchmal fast unter, ist im Moment aber wohl das Wichtigste: die Grundversorgung!
Erbprinz Alois hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er den Eindruck habe, die neue Regierung, «insbesondere der neue Gesellschaftsminister», wolle sich dem Thema Corona-Aufarbeitung nochmals widmen. Welche Schritte planen Sie diesbezüglich?
Es steht ausser Frage, dass noch ein Kapitel im Corona-Buch fehlt. Wir haben nicht wenige Menschen im Land, die persönlich und politisch von dieser Zeit traumatisiert sind, auch wenn wir verglichen mit anderen Ländern vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Es gibt Menschen, die das Vertrauen verloren haben. Und diesen Menschen müssen wir ein vernünftiges Angebot machen, damit sie wieder bereit sind, unserem Staat zu vertrauen. Wir müssen dabei unterscheiden zwischen jenen, die wirklich Probleme mit diesem Teil der jüngeren Geschichte haben, und jenen, welche diese Gefühle bei den Menschen zu ihrem politischen Vorteil instrumentalisieren wollen. Ich hatte zu diesem Thema sehr viele gute Gespräche und ich habe mir vorgenommen, dass wir in dieser Legislatur noch einmal einen Schritt aufeinander zu machen. Ob mir das gelingt, hängt davon ab, wie stark es von allen Seiten gewollt ist.
Ein anderes Gesundheitsthema: In wenigen Wochen werden die
OKP-Prämien für das Jahr 2026 bekanntgegeben. Rechnen Sie nach wie vor mit einer moderaten Steigerung oder eher doch wieder mit dem oft bemühten «Prämienschock»?
Wie jedes Jahr haben die Kassen die Prämien auf Ende August eingereicht. Die Aufsichtsbehörde hat nun die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, sodass die Bekanntgabe der Prämien wie üblich Anfang Oktober erfolgen kann. Jüngste Kostendaten lassen einen Prämienanstieg erwarten. Mit einem Prämienschock rechne ich nicht. Aber ich möchte hier keine falschen Versprechungen machen. Wir haben in diesem Themenfeld halt das folgende Dilemma: Wir alle wollen die beste medizinische Versorgung, aber sie muss auch möglichst günstig sein. Ich denke, ein grosser Teil der Bevölkerung weiss, dass das so nicht geht. Qualität hat ihren Preis. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, an dem grosse Teile das Solidaritätsprinzip der OKP infrage stellen, dann sind wir zum Handeln verpflichtet. Wenn beispielsweise Umfragen in der Schweiz sagen, dass 80 Prozent für eine Einheitskrankenkasse sind, der man dann notabene auf Gedeih und Verderb alternativlos ausgeliefert ist, und ein Drittel sich sogar vorstellen kann, das Obligatorium ganz abzuschaffen, dann hat das System ein massives Vertrauensproblem. Und daran müssen wir arbeiten. Das kann man aber nicht, indem man allen Akteuren sagt, dass sie Teil des Problems sind. Wir müssen eine Kultur erreichen, in der alle Akteure Teil der Lösung sein wollen.
Wie möchten Sie das stetige Prämienwachstum künftig eindämmen?
Wichtig ist, dass wir keine Prämienexplosionen haben. Dort müssen wir ansetzen, ausser, wir wollen riskieren, dass wir eine Zweiklassenmedizin
Titelstory
schaffen. Ein Gedankenspiel: Dann würden wir die Selbstbehalte so hoch ansetzen, dass sich nur noch die Reichen Behandlungen leisten könnten. Dann könnten wir vielleicht die Prämien senken, der Zugang zu Leistungen würde aber eingeschränkt. Im Sinne der Solidarität wäre das jedenfalls nicht. Wir müssen sicher Entscheidungen treffen – und das ziemlich bald. In der Schweiz sind Bestrebungen da, der gesellschaftliche Druck wächst und auch die Einführung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, kurz EFAS, in der Schweiz eröffnet auch bei uns Diskussionsspielräume, die ich in den nächsten Jahren nutzen möchte, um das Gesundheitswesen fit zu machen. Damit es qualitativ hochwertig, aber auch bezahlbar bleibt.
Ein anderes grosses Thema ist derzeit europaweit die Sicherung der Renten. Wie steht es aktuell um die Liechtensteiner AHV? Wie viele Jahresausgaben sind ungefähr in Reserve?
Wir haben ungefähr elf Jahresausgaben in Reserve. Gemäss den aktuellen Modellrechnungen haben wir auch in knapp 20 Jahren noch rund vier bis fünf Jahresausgaben auf der hohen Kante. Das ist komfortabel. In der Schweiz und Österreich und ganz sicher auch in Deutschland beneidet man uns darum. Aber nun sagt uns das Gesetz, dass wir handeln müssen, weil wir eben in 20 Jahren nicht mehr ganz fünf Jahresausgaben im Fonds hätten. Und diese fünf Jahresausgaben Reserven wären für die meisten Rentenkassen in Europa ein Traum, wohlgemerkt! Wir brauchen kein Paket, weil wir ein Problem haben. Wir brauchen ein Paket, um die gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen, bevor wir ein Problem bekommen. Das sind Welten!
Welche Massnahmen könnten Sie persönlich, das Einverständnis des Landtags und allenfalls des Volks vorausgesetzt, sich vorstellen, um die im Vergleich mit anderen Staaten überaus komfortable Situation der AHV langfristig sicherzustellen?
Alle! Wir haben im Koalitionsvertrag schwarz auf weiss, dass das Lösungspaket eine Mischung aller möglichen Massnahmen sein muss, damit die Lasten auf die verschiedenen Schultern verteilt werden. Somit ist grundsätzlich keine Massnahme undenkbar. Ich gehe aber davon aus, dass ein Grossteil der Menschen in unserem Land nicht am gut funktionierenden System an sich rütteln will.
Neben dem Gesellschaftswesen geht der Geschäftsbereich Justiz in der öffentlichen Wahrnehmung fast unter. Was beschäftigt Sie dort im Moment und in näherer Zukunft?
Wir sind mitten in der Umsetzung der beschlossenen Justizreform, für die meine Vorgängerin Graziella Marok-Wachter die politischen und der Landtag die gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat. Jetzt müssen wir das Ganze theoretische Gebilde mit Leben füllen. Es gibt viel Bewegung im Justizapparat, weil nun neue Richter zu bestellen sind und sich neue Chancen bieten. Zudem prüfen wir laufend die Instanzenzüge und nehmen die Reform auch zum Anlass, das System weiter zu optimieren. Zudem haben wir mit der ersten Lesung der Optimierung des Trustrechts einen weiteren Teil der Reform angestossen, den man damals aus dem Paket herausgenommen hatte.

Diesbezüglich finden wir auch für die zweite Lesung noch die richtige Dynamik für einen Erfolg. Und dann waren da noch die medialen Berichterstattungen über die sogenannten verwaisten Strukturen – verkürzt gesagt Stiftungen, die aufgrund von Sanktionierung oder Sanktionierungsgefahr von ihren Organen verlassen wurden. In diesem Zusammenhang zeigen unsere Arbeiten bisher, dass das Problemvolumen zum Glück kleiner ist, als es gewisse finanzplatzkritische Journalisten gerne gesehen hätten. Auch dabei sind wir auf gutem Weg hin zu Lösungen.
Die Sommerferien liegen erst wenige Wochen zurück. Daher abschliessend die Frage: Wie hat Emanuel Schädler in seinem ersten Sommer als Gesellschafts- und Justizminister abgeschaltet?
Um Kraft für die anstehenden Aufgaben zu tanken, habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter ein paar erholsame Tage in den Tiroler Bergen und ein paar sonnige Tage an einem griechischen Strand verbracht.
Ein kostenloser öffentlicher Verkehr gilt vielen als Wundermittel der Mobilitätswende. Doch hält die Realität, was die Vision verspricht? Ein Blick nach Deutschland und in andere Länder zeigt ein gemischtes Bild – und liefert spannende Hinweise für Liechtenstein.
Text: Jörg Paetzold, Ökonom am Liechtenstein-Institut
Das 9-Euro-Ticket als Testfall Im Sommer 2022 sorgte das 9-Euro-Ticket in Deutschland für Schlagzeilen: Drei Monate lang konnte die Bevölkerung den gesamten Regionalund Nahverkehr für nur 9 Euro im Monat nutzen. Eines der Hauptziele war, Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen.
Eine Forschungsstudie, an der das Liechtenstein-Institut auch beteiligt war, wertete dafür Verkehrskameras und Mobilfunkdaten mit ökonometrischen Methoden aus. Das Ergebnis: Die Bahn verzeichnete einen regelrechten Boom mit rund 35 Prozent mehr Fahrgästen. Der Autoverkehr jedoch sank nur um etwa 5 Prozent. Auffällig war ausserdem, dass der Anstieg vor allem an Wochenenden und in der Freizeit stattfand – zu den klassischen Pendelzeiten blieb die Wirkung gering.
Was lässt sich auf Liechtenstein übertragen?
Natürlich ist Deutschland nicht direkt mit Liechtenstein vergleichbar. Dennoch können Landkreise mit ähnlicher Siedlungsstruktur, Einkommen oder Pkw-Dichte – etwa der Bodenseekreis oder das Unterallgäu – als Referenz dienen. Auch dort bestätigen die Daten: mehr Bahnfahrten ja, deutliche Reduktion des Autoverkehrs eher nein.
Erfahrungen anderer Länder und Städte Luxemburg führte 2020 als erstes Land weltweit einen dauerhaft kostenlosen Nahverkehr ein. Doch die Corona-Pandemie, die nahezu zeitgleich begann, erschwert eine klare Bewertung. Auch in Städten wie Aubagne und Dünkirchen
(Frankreich) oder Tallinn (Estland) zeigt sich ein gemischtes Bild: teils grosse Effekte, teils kaum Veränderungen.
Ein Problem: Oft fehlt eine solide wissenschaftliche Begleitung. Viele Städte verlassen sich auf Fahrgastbefragungen. Diese geben zwar Hinweise auf Zufriedenheit und Einstellungen, erfassen aber nicht zuverlässig, ob tatsächlich weniger Auto gefahren wird. Entscheidend sind objektive Daten wie Fahrgastzählungen oder Verkehrsmessungen und dass äussere Umstände – wie Temperatur etc. – statistisch ebenfalls in der Bewertung berücksichtigt werden.
Lehren für Liechtenstein
Liechtenstein selbst wagte bereits 1988 ein einjähriges Gratis-ÖV-Experiment. Mangels Daten blieb die Wirkung jedoch unklar, und man musste sich in der Bewertung auf Befragungen verlassen, welche vor allem auf einen Anstieg der Freizeitfahrten hinwiesen. Heute sind die Voraussetzungen besser: Das Land verfügt über ein dichtes Netz an Verkehrszählstellen, die Autound Radverkehr systematisch erfassen. Ergänzt durch Fahrgastbefragungen liesse sich erstmals eine umfassende, evidenzbasierte Bewertung vornehmen.
Fazit
Kostenloser ÖV kann Menschen zum Umsteigen bewegen – vor allem in der Freizeit. Wie stark dieser Effekt ist und in welchem Umfang auch Arbeitspendelnde erreicht werden können, bleibt jedoch unklar. Auch spielen neben dem Preis die ÖV-Qualität und -Frequenz eine entscheidende Rolle, damit der Arbeitswegumstieg vom Auto auf den ÖV attraktiv ist und nicht durch mehr

Bereits 1988 hatte Liechtensteins Bevölkerung die Möglichkeit, ein Jahr lang gratis Bus zu fahren.
Quelle: Plakat. Liechtensteinisches Landesarchiv, BS 061/010.
Freizeitreisende erschwert wird. Sollte Liechtenstein den Schritt erneut wagen, könnte es dank moderner Datenbasis wertvolle Erkenntnisse liefern – nicht nur für sich selbst, sondern auch als Modellregion in Europa.
Auswirkungen des 9-Euro-Tickets auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. ifo Schnelldienst 8/2024. www.ifo.de.
Sozial engagiert, dialogbereit, mit Blick für das Ganze.
Text: Michael Benvenuti

Franziska Hoop zählt zu den prägenden Persönlichkeiten einer neuen Generation in der liechtensteinischen Politik. Geboren 1990 in Vaduz und aufgewachsen in Ruggell, hat sie sich früh für gesellschaftliche Themen interessiert – und diesen Weg konsequent verfolgt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und dem Studium der Sozialpädagogik an der Fachhochschule St. Gallen sammelte sie Berufserfahrung im Bereich Kinder- und Jugendschutz. Seit 2025 steht sie an der Spitze der Special Olympics Liechtenstein Stiftung, bei der sie sich für Inklusion und Teilhabe starkmacht.
Privat ist Franziska Hoop naturverbunden und sportlich aktiv. Als langjährige Skitrainerin bei Special Olympics Liechtenstein bringt sie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen und fördert Teamgeist und Lebensfreude. Die Familie – sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter – ist ihr Rückhalt und Kraftquelle. Freundschaften und der Austausch mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen sind für sie Inspiration und Ansporn zugleich.
Politisch engagiert sich Hoop seit mehreren
Jahren für die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP). Ihr Weg führte sie vom Vorstand der FBP-Frauen direkt in den Landtag, dem sie seit 2021 angehört. Dort übernahm sie rasch Verantwortung, etwa als Delegationsleiterin bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Strassburg. 2025 wurde sie zur Vizepräsidentin des Landtags gewählt und ist seither auch in der Aussenpolitischen Kommission sowie der EWR/Schengen-Kommission aktiv. Ihr politischer Stil ist geprägt von Offenheit, Dialogbereitschaft und dem Willen, gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam anzugehen.
Ein zentrales Anliegen ist ihr der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Sie setzt sich für bessere Präventions- und Unterstützungsangebote ein und möchte, dass niemand im System verloren geht – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Beeinträchtigung. Besonders am Herzen liegt ihr die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung, sowohl im Bildungsbereich als auch im gesellschaftlichen Leben. Ebenso engagiert sie sich für die Förderung von Chancengleichheit und die Stärkung der Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht
sie dabei als eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart: Sie macht sich für flexible Strukturen und mehr Unterstützung für Familien stark, damit Eltern – und insbesondere Mütter – ihre beruflichen und familiären Aufgaben besser miteinander verbinden können. «Vielfalt ist eine Stärke, die wir nutzen sollten – gerade in der Politik», sagt sie. Ihr Engagement ist geprägt von Empathie, aber auch von klaren Positionen.
Die Bestätigung bei der Landtagswahl 2025 und die Wahl zur Vizepräsidentin sieht sie als Auftrag, weiterhin Brücken zu bauen und neue Impulse zu setzen. Für Franziska Hoop ist Politik kein Selbstzweck, sondern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und das Land aktiv mitzugestalten. Sie steht für eine Politik, die zuhört, Lösungen sucht und auch Antworten auf unbequeme Fragen nicht scheut.
Mit ihrer Mischung aus sozialem Engagement, politischer Erfahrung und persönlicher Nahbarkeit bringt Franziska Hoop frischen Wind in die liechtensteinische Politik. Ihr Weg zeigt: Veränderung beginnt dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und neue Perspektiven einzubringen.

Landtagsgebäude in Vaduz
Der Landtag ist das Parlament des Fürstentums Liechtenstein. Er ist eine zentrale Säule der Demokratie, da er die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf nationaler Ebene vertritt. Neben dieser fundamentalen Repräsentationsfunktion hat der Liechtensteiner Landtag spezifische, durch die Verfassung und die Gesetze festgelegte Aufgaben (sogenannte Funktionen) zu erfüllen. Hierzu werden ihm entsprechende Kompetenzen, Organe und Strukturen zugewiesen.
Text: Philippe Rochat
Struktur und Organisation des Landtags
Die vergleichende Parlamentsforschung unterscheidet drei Arbeitsebenen von Parlamenten. Auf der höchsten Ebene ist das Gesamtparlament angesiedelt. Mit 25 Abgeordneten ist der Landtag eines der kleinsten Parlamente weltweit. Gemäss Daten
der Inter-Parliamentary Union (IPU) haben nur elf der gezählten 187 Staaten ein kleineres nationales Parlament. Setzt man die Anzahl der Abgeordneten jedoch in Relation zur Bevölkerungszahl, erscheint der Landtag eher gross. Im europäischen Vergleich hat gemäss IPU nur San Marino weniger Einwohnerinnen und Einwohner pro Parlamentsmitglied.
Auf der tiefsten Arbeitsebene finden sich die einzelnen Parlamentsmitglieder. Sie werden alle vier Jahre in demokratischen Wahlen bestimmt und nehmen ihr Amt als Milizparlamentarierinnen und -parlamentarier wahr. In ihrer Rolle als Repräsentanten vertreten sie verschiedene Interessen im Parlamentsbetrieb. Dabei sind sie in ihrer Willensbildung und

Dr. Philippe Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut, Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechtensteins»
Entscheidungsfindung frei und unterliegen keinen Weisungen («freies Mandat»). Zusätzlich zu den 25 Parlamentsmitgliedern gibt es derzeit neun stellvertretende Abgeordnete. Sie kommen zum Zug, wenn ein Parlamentsmitglied nicht an einer Parlamentssitzung teilnehmen kann.
Zwischen dem Gesamtparlament und den individuellen Abgeordneten gibt es verschiedene lang- und kurzfristige Zusammenschlüsse von Parlamentsmitgliedern. Dazu zählen Fraktionen, Kommissionen und Delegationen. Eine Fraktion besteht aus mindestens drei Abgeordneten einer Partei. Sie hat ein Vorschlags- und Antragsrecht sowie Anspruch auf Vertretung in parlamentarischen Kommissionen. Auch Kommissionen sind Zusammenschlüsse von Abgeordneten. Sie konstituieren sich jedoch nicht entlang der Parteizugehörigkeit, sondern fachlicher Schwerpunkte. Kommissionen beraten und bereiten die Beschlüsse des Plenums vor. Es gibt ständige (Finanz-, Geschäftsprüfungsund Aussenpolitische Kommission) und nichtständige Kommissionen. Delegationen wiederum vertreten den Landtag in internationalen parlamentarischen Versammlungen und Organisationen wie beispielsweise dem Europarat oder der OSZE und dienen der Pflege von Beziehungen zu Parlamenten anderer Staaten. Delegationen bestehen häufig aus zwei Landtagsabgeordneten und zwei Ersatzmitgliedern.
Parlamentsfunktionen
Eine Hauptfunktion des Landtags ist die Gesetzgebungsfunktion. In Liechtenstein darf kein Gesetz ohne Mitwirkung des Landtags erlassen oder abgeändert werden. Er kann von sich aus Gesetzesvorschläge einbringen und die Gesetzesvorlagen der Regierung annehmen, ändern, ablehnen oder Anregungen einbringen. Eine zentrale Rolle spielen dabei verschiedene parlamentarische Instrumente.
Der Fürst als zweiter Souverän neben dem Volk im Staat besitzt die verfassungsmässig garantierten Rechte, die vom Landtag beschlossenen Gesetze zu sanktionieren und im Krisenfall den Landtag sogar aufzulösen. Letzteres ist aber selten und war zuletzt 1993 nach der Absetzung des Regierungschefs Markus Büchel der Fall, als die Auflösung des Landtags gegen dessen Willen erfolgte.
Neben der Gesetzgebung gehört die Kontrolle der Regierung und der Verwaltung zu den Hauptaufgaben des Landtags. Er kann im Rahmen von Interpellationen und Kleinen Anfragen Informationen und Klarstellungen zu allen Bereichen der Landesverwaltung verlangen. Von besonderer Bedeutung sind ferner die Geschäftsprüfungskommission, die Abnahme von Rechenschaftsberichten und der Landesrechnung sowie Untersuchungskommissionen. Schliesslich verfügt er auch noch über die Instrumente der Ministeranklage und des Misstrauensvotums gegen die Regierung oder einzelne Mitglieder.
Wahlen gehören ebenfalls zu den Hauptaufgaben des Landtags. Die Abgeordneten werden vom Volk gewählt, führen aber auch selbst Wahlen durch. Einerseits wählen sie verschiedene Funktionsträgerinnen und -träger des Parlaments wie beispielsweise die Mitglieder der Kommissionen und Delegationen sowie den Landtagspräsidenten. Andererseits wählen sie Personen für nichtparlamentarische Positionen. Der Landtag schlägt unter anderem die Mitglieder der Regierung vor, die anschliessend vom Landesfürsten ernannt werden, und wirkt bei der Wahl von Richterinnen und Richtern mit.

Die aktuelle Sitzverteilung im Liechtensteiner Landtag, Legislaturperiode 2025–2029.
Das politische System Liechtensteins
Handbuch für Wissenschaft und Praxis Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, 1. Baden-Baden: Nomos, 2024. Herausgegeben von Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat.
Das Handbuch enthält in 23 Kapiteln Informationen zu Themen wie Souveränität, Regierung, Landtag, Parteien, Medien, Wahlen und Wahlsystem, Politische Kultur u. v. a.
Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel erhältlich. Das ePDF kann kostenlos von der Website des Liechtenstein-Instituts oder des Nomos-Verlags heruntergeladen werden.

Mit dieser Beitragsreihe möchte das Liechtenstein-Institut das Handbuch «Das politische System Liechtensteins» näher vorstellen.
Heute zum Thema: «Landtag»
Der Beitrag zum Landtag von Philippe Rochat im Handbuch «Das politische System Liechtensteins» gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die Einbettung der repräsentativen Demokratie zwischen Monarchie und direkter Demokratie. Er beleuchtet die Struktur und Organisation des Landtags, seine Aufgaben und Kompetenzen und präsentiert empirische Daten zur Arbeitsweise des Landtags. Abgerundet wird der Beitrag durch einen internationalen Vergleich, eine umfangreiche Literaturliste und Internetlinks zu relevanten Websites.
Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.

www.liechtenstein-institut.li
Der Sommer 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass auch in Liechtenstein über längere Zeit hohe Temperaturen herrschen können. Die FBP hat daher eine Motion zum sinnvollen Umgang mit Klimageräten eingereicht, die der Landtag diese Woche behandelt hat.
Wie stehen Sie zu dieser Thematik? Soll es in Liechtenstein künftig einfacher möglich sein, Kühlsysteme in Privat und Geschäftsgebäude einzubauen?

Angesichts steigender Temperaturen ist das Anliegen nachvollziehbar – wir alle spüren, dass Hitzeschutz wichtiger wird. Ich unterstütze das Ziel, die Bewilligungspraxis zu überprüfen, frage mich jedoch, warum kein Postulat eingereicht wurde. Ein Postulat hätte der Regierung mehr Freiheit gegeben, verschiedene Lösungen zu prüfen – etwa strengere Effizienzstandards, nachhaltige Bauweisen oder alternative Kühltechnologien. Ein offener Ansatz wäre hilfreich gewesen, um die Thematik breiter und umfassender zu erarbeiten.
Mir ist wichtig, dass wir eine ausgewogene Lösung finden, die kurzfristige Bedürfnisse und langfristige Entwicklungen berücksichtigt. Klimageräte können in bestimmten Fällen sinnvoll sein, dürfen aber nicht zur alleinigen Antwort werden. Entscheidend ist, dass wir die langfristigen Folgen im Blick behalten: Mehr Geräte bedeuten mehr Energieverbrauch und höhere Kosten. Daher sollten wir parallel prüfen, wie wir durch bessere Bauweisen, Verschattung und andere Massnahmen eine dauerhaft tragfähige Strategie für unser Land entwickeln können. Nur so schaffen wir eine Lösung, die heute hilft und morgen Bestand hat.

Ja, das schlägt die FBP-Fraktion vor. Bisher hat man sich bei der Gebäudetechnik auf das Heizen im Winter konzentriert. In Zukunft wird uns aber vermehrt die Hitze im Sommer zu schaffen machen. Darunter leiden das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass effiziente Kühlsysteme auch in Liechtenstein einfach und unbürokratisch zugelassen werden.
Es ist wichtig, dass bei Neubauten – egal ob Pflegeheim, Schule, Bürogebäude oder Wohnhaus – die Gebäudekühlung von Anfang an mitgedacht wird. So verhindern wir, dass ineffiziente, kleine und mobile Geräte zum Einsatz kommen, die mehr Energie verbrauchen und einen Wildwuchs im Ortsbild verursachen. Auch bei Altbauten ist ein spontaner Kauf einer Klimaanlage nicht die beste Lösung.
Eine wichtige Entwicklung: Um auch im Winter genügend eigene Energie zu haben, werden immer mehr PV-Anlagen installiert. An heissen Sommertagen entsteht dadurch ein Stromüberschuss, der sinnvollerweise für die Kühlung genutzt werden kann.
Unsere Motion gibt der Regierung einen klaren Auftrag: Bürokratie abbauen, praxistaugliche Kriterien schaffen und die Zulassung effizienter Kühlsysteme ermöglichen. Gleichzeitig fordern wir eine Sensibilisierung für umweltfreundliche Kühlmethoden und erwarten, dass der Staat bei öffentlichen Bauten mit gutem Beispiel vorangeht. Auch die laufenden Entwicklungen in der Gebäudetechnik sollen berücksichtigt werden.
Wir sind überzeugt: Ein moderner und nachhaltiger Umgang mit Gebäudekühlung ist ein weiterer notwendiger Schritt für die gute Lebensqualität in Liechtenstein.


Fakt ist: In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Alpenraum etwa doppelt so stark erwärmt wie der globale Durchschnitt. Hitzeperioden sind längst keine Ausnahmeerscheinungen mehr, und sie werden in den kommenden Jahren zunehmen – mit Folgen für Gesundheit und Lebensqualität, besonders für ältere Menschen, Kinder und Vorerkrankte. Kühlung ist daher kein Luxus, sondern Gesundheitsschutz. Gleichzeitig greift eine rein technokratische Antwort aber zu kurz: Die blosse Liberalisierung von Bewilligungsverfahren löst das Problem nicht, wenn sie weder soziale Fragen noch Energie- und Raumplanung mitdenkt. Vielmehr sollten wir eine gesamtgesellschaftliche, sozial gerechte Kühlstrategie anstreben, die passiven Hitzeschutz, städtebauliche Massnahmen und technische Lösungen klug verbindet. Zur Frage, ob der Einbau von Kühlsystemen einfacher werden soll: Ja. Aber nur so, dass Klimaschutz gestärkt und soziale Gerechtigkeit gesichert werden. Unkoordinierter Gerätewildwuchs produziert Stromspitzen, gefährdet die Energiewende und löst das Problem von überhitzten Wohnungen nicht nachhaltig. Deshalb braucht es klare Leitplanken mit Vorrang für passive Hitzeschutzmassnahmen, verbindlichen Effizienz- und Qualitätsstandards sowie intelligenter Steuerung statt bloss mehr Technik. So schützen wir Klima, Netzstabilität und Haushaltsbudgets zugleich. Ebenso müssen wir die rechtliche Asymmetrie zwischen Heizen und Kühlen überwinden: Während Mindesttemperaturen fürs Heizen geregelt sind, fehlt beim Kühlen ein vergleichbarer Rahmen. Es braucht Regeln, ab wann Überhitzung ein Mangel ist, damit Mieterinnen und Mieter bei dauerhaft überhitzten Wohnungen nicht schutzlos bleiben. Und wir sollten Kühlung städtebaulich denken: Begrünung, Entsiegelung, Erhalt von Kaltluftströmen – das entlastet Menschen und Stromnetze. Anstelle eines pauschalen Freipasses braucht es einen präzisen Regierungsauftrag: eine umfassende Auslegeordnung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen, raumplanerischen Instrumenten, technischen Standards und energetischen Auswirkungen. Nur so schaffen wir eine Kühlstrategie, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbringt.


Ja, eine erleichterte Möglichkeit zum Einbau von Kühlsystemen ist grundsätzlich zu begrüssen – allerdings nur unter klar definierten Voraussetzungen. Die von der FBP eingereichte Motion bleibt jedoch sehr allgemein, liefert weder Daten noch Fakten und wirkt daher wie ein Schnellschuss.
Gerade an heissen Sommertagen steht ohnehin überschüssiger Solarstrom zur Verfügung, sodass der Betrieb von Klimaanlagen das Stromnetz sogar stabilisieren kann. Positiv hervorzuheben ist der Vorschlag eines Anzeigeverfahrens, da dieses unnötige Bürokratie reduziert. Wichtig ist zudem, dass ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren nicht nur für Klimageräte, sondern auch für Wärmepumpen gilt, da diese technisch sehr ähnlich funktionieren. Die Motion kann somit ein Schritt in die richtige Richtung sein – vorausgesetzt, die Regierung legt verbindliche Richtlinien fest und bezieht Wärmepumpen gleichermassen mit ein.


Wir stehen der Thematik grundsätzlich offen und positiv gegenüber, Kühlsysteme in privaten Wohn- und Geschäftsgebäuden in Liechtenstein künftig einfacher zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass die Ausgestaltung und Planung solcher Heiz-, Kühl- und Haustechnikanlagen in der Verantwortung kompetenter Fachpersonen aus Planung und Ingenieurwesen liegt, die über das notwendige Know-how verfügen, um innovative und nachhaltige Lösungen umzusetzen.
Moderne Technologien erlauben vielfältige, sich ergänzende Ansätze, wie zum Beispiel die Speicherung der durch Kühlung entstehenden Abwärme im Erdreich mittels Erdsonden oder Energiepfählen oder die Nutzung überschüssiger Solarenergie für Kühlzwecke. Diese technischen Möglichkeiten zeigen, dass ökologische und energieeffiziente Konzepte im Gebäudebereich immer stärker in den Vordergrund rücken.
Aus unserer Sicht sollte die politische Rolle darin bestehen, einen möglichst breiten Spielraum für Fachleute zu schaffen, damit diese ihre Kompetenz bestmöglich einsetzen können. Dabei sind unnötige Regulierungen möglichst zu vermeiden, um Innovationen nicht zu behindern und eine flexible sowie individuelle Umsetzung zu gewährleisten. Dieses Prinzip sollte für alle Bereiche der Bau- und Haustechnik gelten, um nachhaltige und effiziente Gebäudetechnologien in Liechtenstein zu fördern.
Der Gemeinnützige Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren ist am 18. Mai 2004 gegründet worden. Er hat sich im Lauf der vergangenen 20 Jahre durch die Produktion und Veröffentlichung von mehreren Büchern und Zeitschriften einen Namen geschaffen.
Zu seinen grössten Werken zählt die fünfteilige Buchreihe «Menschen, Bilder & Geschichten, Mauren von 1800 bis heute».
Diese Buchreihe umfasst insgesamt mehr als 2500 bebilderte Seiten, die alle Maurer und Schaanwälder Familienstämme vereint. Es ist ein willkommenes Nachschlagwerk, das seit der Publikation des letzten Bandes im Jahr 2010 vergriffen ist. Zudem sind zahlreiche Geschichten aus den vergangenen 200 Jahren aufgezeichnet, die sich mit den Familienverbänden der Gemeinde und darüber hinaus befassen.
Daraus ist auch der Wunsch entstanden, die politischen Mandatsträgerinnen und -träger von Mauren (Gemeindevorsteher, Landtagsabgeordnete und Regierungsmitglieder seit 1862 respektive1864) einem grösseren Publikum in einem gesammelten Werk vorzustellen. Es handelt sich um insgesamt 22 Gemeindevorsteher, 40 ordentliche bzw. stellvertretende Landtagsabgeordnete und 16 ordentliche bzw. stellvertretende Regierungsmitglieder, von denen die aktuelle Regierungschefin Brigitte Haas und ihre Stellvertreterin Sabine Monauni ebenfalls als Bürgerinnen der Gemeinde Mauren vorgestellt sind.
Das Buch beginnt mit der Präsentation der
Text: Herbert Oehri
Vorsteher und der Landtagsabgeordneten im Zeitraum von 1862 respektive 1864 bis heute. Auf Landesebene war mit der Verfassung von 1862 erstmals ein weitgehend demokratisch gewählter Landtag ermöglicht worden. Das 1864 erlassene Gemeindegesetz schuf und definierte die Gemeindebehörden im heutigen Sinn, folglich auch das Amt des Gemeindevorstehers.
Am Anfang der Präsentation der Regierungmitglieder steht das Jahr 1921. Eine Regierung in Vaduz amtierte zwar bereits ab 1862 als Nachfolgerin von Oberamt und Regierungsamt. Dieser Regierung stand bis 1921 ein Landesverweser vor, der vom Fürsten im Prinzip auf Lebenszeit eingesetzt wurde und der die Regierung faktisch dominierte.
Neben dem Fokus auf die Mandatsträger und Mandatsträgerinnen werden auch zwei wichtige Persönlichkeiten aus Mauren ins Rampenlicht gerückt: Peter Kaiser und Franz-Josef Oehri (beide 1793 geboren und 1864 gestorben), die zu den bedeutendsten Erscheinungen in der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein zählen. Beide hatten grossen Einfluss auf die Entstehung
und Durchsetzung der neuen Verfassung im Jahr 1862. Im Ganzen tendierte der Jurist Oehri mehr hin zu einer effizienten, politisch zweckmässigen Verfassung, während Kaiser stärker auf die Erringung ausgedehnter Volksrechte und Freiheiten abzielte. Aus Oehris Entwurf ist vieles in den endgültigen Verfassungsentwurf übernommen worden, zum Teil wörtlich.
Buch kann bestellt werden
Das Buch ist Ende August in einer begrenzten Auflage herausgegeben worden. Schnell Entschlossene können dieses einmalige Polit-Buch für 28 Franken kaufen. Der Herausgeber des Werks ist der Ahnenforschungsverein Mauren, der seit mehr als 20 Jahren besteht und von DDr. Herbert Batliner, Gerold Matt, Adolf Marxer («Thedoras»), Adolf Marxer («Dökterle»), Doris Bösch-Ritter, Waltraud Matt, Rita Meier, Johannes Kaiser und Herbert Oehri (Präsident) gegründet wurde.
Der Verein bedankt sich bei den Unterstützern dieses Werkes und bei den Käufern des Buches herzlich.
AB SOFORT ERHÄLTLICH
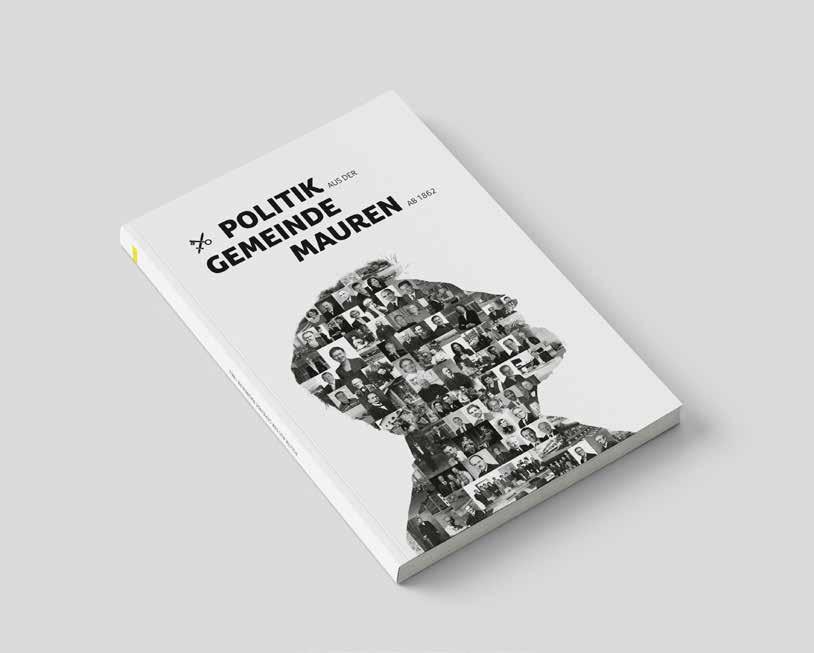

Gemeinnütziger Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren
POLITIK AUS DER GEMEINDE MAUREN AB 1862
Vertrieb:
Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen
Bestellung bei:
Brigitte Hasler, Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen
Tel. :+423 375 90 08
E-Mail: brigitte.hasler@medienbuero.li
Das Buch kann abgeholt oder zugeschickt werden.
Das Buch kann auch bei der Maurer Post bezogen werden.
Preis: CHF 28.– (plus Versandkosten CHF 6.–)

«Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein»
Seit rund zweieinhalb Jahren ist Rolf Pfeiffer Stadtpräsident von Buchs. Er ist Buchser durch und durch und brennt für die Anliegen seiner Stadt, die er mit seinem Einsatz weiter voranbringen möchte. Gleichzeitig denkt er aber auch sehr regional und plädiert dafür, Kräfte zu bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Interview: Heribert Beck
Buchs ist bei der Liechtensteiner Bevölkerung seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für das Einkaufen wie für Freizeitaktivitäten und vermutlich dennoch in vielem der wenig bekannte Nachbar. Wie schildern Sie, Herr Stadtpräsident, einem Liechtensteiner oder einer Liechtensteinerin in einigen Sätzen, was Buchs ausmacht?
Stadtpräsident Rolf Pfeiffer: Buchs machen
Offenheit, Willkommensmentalität, Bodenständigkeit und der Sinn für die Region aus. Wir wissen, was wir können, und das wird hüben wie drüben, also auf beiden Seiten des Rheins, geschätzt, wie ich immer wieder erfahren darf.
Auch als Wohnort ist Buchs beliebt, wie die stetig steigenden Einwohnerzahlen zeigen. Auf welchen Vorzügen gründet diese Attraktivität?
Ein entscheidender Punkt ist die geografische Lage gegenüber Liechtenstein mit seinen mehr als 40'000 Arbeitsplätzen. Hinzu kommt die Grösse von Buchs. Wer in einer Stadt aufgewachsen ist, möchte oft nicht in einem Dorf wohnen, sondern sucht sich einen Wohnort mit einer gewissen Grösse – und in unmittelbarer Nähe zu Liechtenstein hat nur Buchs diese Grösse. Ausserdem beheimatet Buchs attraktive Bildungseinrichtungen wie die International School Rheintal, hat kulturell einiges

Das Buchserfest ist jedes Jahr Ende August ein Publikumsmagnet und ein Treffpunkt für Menschen von beiden Seiten des Rheins.
zu bieten, Stichwort Fabriggli, die Gastronomie ist vielfältig und bietet alles von lokalen und internationalen Speisen bis hin zum Feierabendfeeling. Weiter haben wir über 120 Vereine. All dies wirkt als Magnet für neue Einwohnerinnen und Einwohner.
Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Buchs und die Arbeitsplatzzahlen?
Wir haben mit der Hilti AG und der Merck Arbeitgeber, die bei der Rekrutierung einen riesigen Rayon bedienen und Arbeitnehmende von weit her anziehen. Das schlägt sich auch wieder beim Angebot nieder und fördert das heimische Gewerbe. Neue Einwohner bedeuten in vielen Fällen auch Familien und damit mehr Kinder, was wiederum mehr Stellen für Lehrkräfte bedingt, sowohl in der schon erwähnten International School als auch in der Schule Buchs, die inzwischen ebenfalls ein grosser Arbeitgeber ist. Insgesamt haben rund 8500 Personen ihren Arbeitsplatz in der Stadt.
Welche Anstrengungen unternimmt die politische Gemeinde Buchs, um den Wirtschaftsstandort weiter zu fördern?
Wir achten auf bestmögliche Rahmenbedingungen. Dazu arbeiten wir zum Beispiel eng
mit dem grössten Grundstücksbesitzer in Buchs zusammen, der Ortsgemeinde. Gemeinsam stellen wir Flächen für Unternehmensansiedlungen zur Verfügung, für Wohnraum und für das öffentlichen Leben, aber natürlich auch für die Bildung.
14'000 Einwohner und 8500 Arbeitsplätze bringen sicher auch ihre Herausforderungen mit sich. Welches sind die drängendsten? Neben dem Verkehr ist es vor allem die gesellschaftspolitische Integration, die uns fordert. Die Buchser Bevölkerung setzt sich derzeit aus 101 Nationalitäten zusammen. Folglich ist die halbe Welt in Buchs zu Hause (schmunzelt). Das bringt Herausforderungen beim Zusammenleben der verschiedensten Religionsgemeinschaften mit sich, die alle ihre eigenen Bedürfnisse haben, aber auch im schulischen Bereich, wo es häufig Sprachbarrieren zu überwinden gilt. All diese Herausforderungen gehen wir gerne an. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir unsere Traditionen und Grundsätze erhalten und schützen, also das, was unsere Vorfahren erschaffen haben.
Eine Herausforderung, die Sie angesprochen haben, besteht auf beiden Seiten des Rheins in besonderem Mass: der Verkehr. Wie geht Buchs diese Aufgabe an?

Rolf Pfeiffer, Stadtpräsident von Buchs
Über die Region Werdenberg konnten wir kürzlich beispielsweise den Anstoss dazu geben, dass die Stelle eines Kümmerers geschaffen wird, der sich ganz mit der Verkehrsproblematik beschäftigt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist – in enger Abstimmung mit dem Kanton St. Gallen – die Optimierung aller fünf Rheinübergänge zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Das ist eine langfristige Aufgabe, denn einerseits steht eine neue Brücke nicht innerhalb von ein paar Tagen, andererseits geht es auch um die Zubringer. Ich habe dem Kümmerer aber auch ans Herz gelegt, dass er um Massnahmen besorgt sein muss, die kurzfristig, also innerhalb eines Jahres, Erleichterungen bringen. Das sind dann naturgemäss nicht die grossen Würfe, aber jede Erleichterung ist von Bedeutung, damit die Situation erträglich bleibt. Ein Beispiel für solche Massnahmen ist die direkte Busverbindung vom Bahnhof Buchs zur Presta in Eschen. Generell ist der ÖV für mich ein wichtiger Teil der Lösung des Verkehrsproblems. Aber derzeit steht der Bus eben auch im Stau, und mehr Platz können wir nicht so einfach schaffen. Daher müssen wir an verschiedenen Schrauben drehen. Flexiblere Arbeitszeitmodelle wären eine mögliche Lösung. Aber dafür müssen die Arbeitsplätze auch früh am Morgen schon gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein.

Die im Jahr 2009 eröffnete Energiebrücke ist eine von vielen Verbindungen zwischen Buchs und Liechtenstein.
Dass grenzüberschreitende Lösungen nötig sind, haben Werdenberg und Liechtenstein bereits vor Jahrzehnten erkannt. Die Projekte aus den Agglomerationsprogrammen sind ein Ergebnis dieser Erkenntnis. Wie ist diesbezüglich der aktuelle Stand und bei welchen Projekten kann Buchs, kann die Region mittelfristig von Bundesgeldern profitieren?
Wir haben unsere Vorstellung für die fünfte Generation des Agglomerationsprogramms kürzlich eingereicht. Derzeit wird in Bern geprüft, was förderungswürdig ist, und wir nehmen zu Rückfragen Stellung. Gleichzeitig läuft die Umsetzung von Projekten aus früheren Generationen des Agglomerationsprogramms. Denn auch dabei handelt es sich um langfristige Massnahmen, die vorausschauend angegangen worden sind. Bereits sichtbare Auswirkungen sind zum Beispiel der Bushof am Bahnhof Buchs oder die Langsamverkehrsbrücke zwischen Buchs und Vaduz, die von Arbeitspendlern in der wärmeren Jahreszeit rege genutzt wird.
Wie gestaltet sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit generell – sowohl mit dem Land Liechtenstein als auch mit den Liechtensteiner Gemeinden?
Sehr gut! Auf Ebene der Gemeinden ist der Austausch eng, und die Kontakte werden gepflegt. Mit der Gemeinde Schaan beispielsweise haben wir einen jährlichen, sehr angenehmen Austausch. Hinzu kommen die alle zwei Jahre stattfindenden Ratstreffen, einmal in Buchs, dann wieder in Schaan. Auch mit den neuen Mitgliedern der Liechtensteiner Regierung hatte ich bereits einige Treffen. Auf beiden Ebenen, Gemeinden und Land, spüre ich immer wieder, dass Buchs und die Region Werdenberg mit ihrem Angebot sehr geschätzt werden.
Vom Grenzüberschreitenden zum Buchs-Spezifischen: Vor einem knappen Jahr haben Erneuerungswahlen des Stadtrats stattgefunden. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Mandataren und Parteien?
Wir haben vier neue Ratsmitglieder erhalten. Sie haben sich bereits in ihre Aufgaben und Ressorts eingearbeitet. Wir sind ein junges Team und als Stadtrat insgesamt auf einem guten Weg. Dabei herrscht Einigkeit, dass wir Buchs nicht neu erfinden wollen, sondern auch den Visionen Gewicht geben müssen, die unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gehabt und auf den Weg gebracht haben. Im Austausch
zwischen den Ratsmitgliedern und auch zwischen den Parteien steht als zentraler Punkt immer Buchs im Fokus. Alle sind bemüht, dass es Buchs gut geht. Das freut mich sehr und stimmt mich zuversichtlich, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
Und wie steht es um den Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern? Bei einer Bevölkerung von 14'000 Personen dürfte dies eine Herausforderung sein.
Der Kontakt ist vielseitig. Ich habe unter anderem das Modell Sprechstunde eingeführt. Zu festgelegten Zeiten können die Einwohnerinnen und Einwohner ohne Termin zu mir in den Rathaussaal kommen und mir ihre Anliegen mitteilen. Das wird unterschiedlich stark genutzt. Aber ich bin natürlich auch froh, dass keine Heerscharen kommen. Denn sonst liefe etwas falsch (lacht). Jedenfalls bekomme ich immer wieder Anregungen, die oft in Richtungen gehen, die wir bereits eingeschlagen haben und mir bestätigen, dass wir als Stadtrat mit unseren Einschätzungen nicht ganz falsch liegen. Ein weiteres neues Dialogformat nennt sich «Äs isch no ötschis». Im Gegensatz zu den Bürgerversammlungen richtet es sich an die gesamte Einwohnerschaft, nicht nur an die Stimmberechtigten. Alle werden dort

über aktuelle Entwicklungen informiert und können Anregungen anbringen. Den direkten Austausch mit der Bevölkerung schätze ich aber auch im Privaten sehr. Ich werde beim Einkaufen, auf dem Fussballplatz oder an Anlässen wie dem Buchserfest oft angesprochen und bekomme Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Das ist mir sehr wichtig, da ich nicht den Anspruch an mich stelle, allwissend zu sein. Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben gute Ideen und sind bemüht um Buchs. Solche Gedanken nehme ich gerne mit und reflektiere sie im Büro, bespreche sie mit dem Rat und den Fachleuten in der Verwaltung. Natürlich lässt sich nicht jeder Wunsch erfüllen, aber aus manchem entsteht dann eben doch etwas sehr Gutes.
Welche Anliegen teilen Ihnen die Nutzer der Sprechstunden oder diejenigen, die sie in der Freizeit ansprechen, mit?
Es geht in der Regel um Themen, die wir auch auf dem Radar haben, zum Beispiel den Verkehr, das Littering, die gesellschaftliche Entwicklung oder das Freizeitangebot. Erfreulich ist, dass diese Begegnungen immer mit viel Anstand und Respekt ablaufen.
Themen aus dem Hoch- und Tiefbau kom-
men sicher auch zur Sprache. Gerade im Hochbau läuft in Buchs mit Grossprojekten wie «Chez Fritz», «Rhii City» oder «Hilti Tower» einiges. Inwiefern profitieren die Stadt und die Bevölkerung davon?
Jedes dieser drei Gebäude ist für sich speziell und einzigartig. Im «Rhii City» entstehen 220 Wohnungen, was wiederum viele Familien mit Kindern nach Buchs bringen wird und für uns bedeutet, dass wir die Schulraumsituation gut im Auge behalten müssen. Der «Hilti Tower» ist ein starkes Bekenntnis der Hilti AG zum Standort Buchs. Von bisher 250 Mitarbeitenden wächst deren Zahl auf 400. Soviel ich weiss, hat das Gebäude keine Kantine, wovon die Gastronomie stark profitieren wird. Das «Chez Fritz» wiederum hat eine sehr lange Geschichte. Wenn es fertig ist, wird es mit seiner Höhe von 65 Metern ein Leuchtturm für die Region. Das Gebäude wird ein wichtiges Zeichen setzen, dass wir in Buchs, in Werdenberg, im Rheintal offen für Neues sind.
Ein weiteres klassisches Aufgabengebiet der Politik liegt in der Bewältigung der Herausforderungen der demografischen Entwicklung. Wie geht Buchs das Thema an?
Wir konnten in den vergangenen Jahren ohne
Zeitdruck das Projekt VitaBuchs auf die Beine stellen. Es handelt sich um ein Angebot der ambulanten wie auch temporären oder dauerhaften stationären Pflege, das seit dem 1. Januar 2025 operativ tätig ist und mit grösseren Bauprojekten verbunden war. Wir haben damit ein Gesundheitsangebot geschaffen, das sich nicht allein auf die Alterspflege konzentriert, aber einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Menschen länger zu Hause bleiben können. Eine Herausforderung war dabei selbstverständlich auch die finanzielle Tragbarkeit. Die vielen interessierten Anfragen von anderen Städten und Gemeinden zu VitaBuchs sind nun aber ein Beweis dafür, dass wir auch diesbezüglich den richtigen Weg beschritten haben.
In Sachen Natur hat sich Buchs in den vergangenen Jahren ebenfalls einen Namen gemacht. Der revitalisierte Werdenberger Binnenkanal zieht beispielsweise auch viele Spaziergänger aus Liechtenstein an. Welche weiteren Projekte aus diesem Bereich können Sie nennen und was waren die Hintergründe, sie anzugehen und umzusetzen?
Der Werdenberger Binnenkanal ist ein grossartiges Projekt. Aber in unserer Vision 2040 ist die auch die Schwammstadt ein wichtiges
Buchs im fokus

In den vergangenen Jahren hat Buchs der Natur an einigen besonders schönen Orten einen Platz zur Entfaltung zurückgegeben.
Schlagwort. Wichtig ist uns, dass wir im Zentrum ebenfalls naturnah und umweltfreundlich unterwegs sind. Aktuell testen wir beispielsweise einen Strassenbelag, der beim Abfluss von Regenwasser, beim Lärm und bei der Erhitzung Erleichterungen mit sich bringen soll. Daneben wirken wir dem Klimawandel mit vielen kleinen Massnahmen entgegen, wo immer wir können. Und viele kleine Beiträge ergeben in der Summe bekanntlich auch wieder etwas Grosses. Ein weiteres Projekt haben wir im Gebiet Rietli auf einer alten Deponie umgesetzt. Wir haben das Feuchtgebiet fachgerecht wiederhergestellt und der Natur eine Ecke zurückgegeben, die als Oase der Ruhe und Erholung sehr geschätzt wird. Wichtig ist mir, Visionen zu haben, diese anzugehen, aber auch Verständnis dafür zu schaffen, dass sich nicht alles auf einmal umsetzen lässt.
Dies alles klingt schon bei den übergeordneten Themen nach ausgefüllten Arbeitstagen. Welche weiteren Aufgaben und Herausforderungen bringt das Tagesgeschäft an Arbeit in Gremien und Kommission für Sie mit sich?
Eine der grössten Herausforderungen ist es, dass man nie weiss, was das Tagesgeschäft mit sich bringt. Dramatische Themen können
plötzlich akut werden. Dann kann ich mich glücklicherweise auf viele Fachleute in der Verwaltung stützen. Gleichzeitig habe ich gelernt, mir bewusst zu machen, dass ich nicht jedes Problem lösen kann und vor allem nicht an jedem schuld bin. Diese Distanz muss man in der Politik meines Erachtens aufbauen. Ich führe mir dann immer vor Augen, dass ich mit meinen Handlungen und Entscheidungen das Bestmögliche für Buchs erreichen muss. Dann habe ich schon viel erreicht. Was die Gremien und Kommissionen betrifft, ist es tatsächlich so, dass ich manchmal sechs Sitzungen mit unterschiedlichsten Themen an einem Tag habe. Das macht mir aber auch grossen Spass, und es zeigt sich immer wieder, wie sich ganz verschiedene Sitzungsgegenstände verknüpfen lassen. Das ist ein besonderer Reiz der Aufgabe. Mit der Begeisterung, die ich verspüre, vergeht die Zeit wie im Flug, und ich nehme die Arbeitsbelastung gar nicht als solche wahr.
In Liechtenstein waren Sie vor Ihrer Amtsübernahme nicht zuletzt für Ihre Tätigkeit im Pontonierverein bekannt. Bleibt Ihnen noch Zeit für dieses Hobby?
Ich finde tatsächlich noch die Zeit, wenn auch beschränkt. Das Hobby hat seinen ganz besonderen Reiz. Der Rhein ist natürlich eine
Grenze und als solche ein trennendes Element. Er verbindet die beiden Seiten aber auch auf vielfältige Weise. Das Rudern auf dem Rhein gibt mir so viel zurück wie anderen das Biken oder Skifahren. Schön ist auch, dass ich in einem Land starten und in einem anderen ankommen kann. Dort treffe ich dann oft gute Bekannte. Die enge Verbindung zwischen Buchs und Liechtenstein wird mir in solchen Momenten immer sehr bewusst – und beide Seiten profitieren von ihr. Nach meiner Wahl zum Stadtpräsidenten habe ich zum Beispiel unglaublich viele Glückwünsche aus Liechtenstein bekommen, obwohl sie das Land ja kaum betroffen hat. Auf der persönlichen Ebene sind solche Kontakte sehr wertvoll. Denn ich weiss bei vielen Themen, wen ich in Liechtenstein um Rat fragen kann, und erhalte auch immer gute Hinweise. Diese Freundschaften, dieses Netzwerk, diese kurzen Wege tragen dazu bei, dass unsere Kleinheit dies- und jenseits des Rheins zu etwas Gemeinsamem wird, das wieder Grosses auslösen kann. Zusammen kommen wir vorwärts, wofür ich mich bei all meinen persönlichen Kontakten in Liechtenstein und der Schweiz herzlich bedanke. Gemeinsam sind wir erfolgreich und werden es weiter sein.


Das Gartenzimmer im Gasthaus Traube –offen, herzlich und voller Genuss Mitten in Buchs, eingebettet im charmanten Gasthaus Traube, bietet das Gartenzimmer ein Ort der Wärme, Genuss und Begegnung vereint. Hier verschmilzt das Gefühl von Zuhause mit der Inspiration einer lebendigen Stadtoase.
Das Gartenzimmer ist nicht nur ein Restaurant, sondern das Wohnzimmer von Buchs: offen, herzlich und voller Leben. Mit Blick auf den angrenzenden Truuba Garten, eine grüne Oase, die zum Durchatmen, Entschleunigen und Verweilen einlädt. Ein Platz, an dem Menschen zusammenkommen – Gäste, Einheimische und Besucher der Region.
Weinerlebnis Wachau 28. September 2025 11.00 – 15.30 Uhr im Eiskeller
Wir tauchen ein in die Welt des Grünen Veltliners und Rieslings – zwei Rebsorten, die in der Wachau eine unverwechselbare Stimme gefunden haben.
Genussmomente von früh bis spät Vom reichhaltigen Truuba-Zmorga, erfrischenden Lunch über den entspannten Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen bis hin zum geselligen Apéritif – das Gartenzimmer begleitet seine Gäste durch den ganzen Tag. Unter der Leitung von Küchenchef Jonas Grundner präsentiert das Gartenzimmer eine leichte, international inspirierte Bistroküche. Überraschend, unkompliziert und voller Raffinesse.
Das Gartenzimmer, dass sagt fühl dich willkommen, so wie du bist. Täglich geöffnet von sieben bis sieben.
Der Treffpunkt für Genuss, Begegnung und eine Auszeit vom Alltag.
Preis CHF 205.-- pro Person inkl. Apéro, Weinverkostung, 5-Gang-Menü Reservation
081 750 55 22 oder info@gasthaus-traube.ch weitere Matinées 19. Oktober: Champagne 23. November: Burgenland
St.Gallerstrasse 7, CH-9470 Buchs www.gasthaus-traube.ch/weinerlebnis

Giulio Vogt aus Schellenberg ist 19 Jahre jung und kam durch seine Qualifikation an schweizerischen und internationalen Chemie-Olympiaden an verschiedene Orte der Welt, so letztes Jahr nach Riad und dieses Jahr nach Dubai. Mitte September startet Giulio sein Studium an der ETH in Zürich. Das Jugend-Interview mit Giulio könnte spannender nicht sein.
Interview: Johannes Kaiser

Giulio, wie entdeckt man die Leidenschaft für Chemie? Für viele ist dieses Fach während der obligatorischen Schulkarriere eine Odyssee.
Giulio Vogt: Die Chemie ist deswegen faszinierend, weil sie einen Ansatz bietet, komplexe Begebenheiten der Natur, die auch in ganz alltäglichen Situationen von Bedeutung sein können, zu begreifen. Das Tolle ist, dass man das, was man theoretisch lernt und sich überlegt, auch im Experiment so umzusetzen versuchen kann, dass man auch tatsächlich sieht, was passiert. Die Erkenntnis, dass die Chemie ein sehr interessantes Gebiet ist, habe ich vor allem der Chance zu verdanken, im Zuge der letztjährigen und diesjährigen Teilnahme an der Olympiade mehr über sie zu lernen und den Freiwilligen, die diese Disziplin so zugänglich gemacht haben.
Vom 5. bis zum 14. Juli fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten die 57. Internationale Chemie-Olympiade statt. Du warst schon letztes Jahr ein Olympiade-Teilnehmer in Riad. Wie kamst du auf die Idee, an diesem weltweiten Wettbewerb teilzunehmen?
Generell beginnen alle Schweizer Olympiaden, an denen auch wir Liechtensteiner teilnehmen dürfen, mit einer ersten Qualifizierungsrunde, die online stattfindet. Da wir in der Schule einige solcher ersten Runden absolviert hatten, habe ich mich letztes Jahr spontan dazu entschieden, bei der ersten Runde der SChO, wie die Schweizer Chemie Olympiade abgekürzt heisst, mitzumachen. Insgesamt folgen nach dieser Onlineprüfung zwei weitere Prüfungsrunden und zahlreiche Vorbereitungsveranstaltungen an einer Vielzahl von Schweizer Universitäten, deren Absolvierung mich letztes Jahr nach Riad in Saudi-Arabien und dieses Jahr nach Dubai geführt hat. Einfach probieren kann in so einem Fall also nicht schaden.
Kannst du die Disziplin oder Disziplinen an dieser Chemie-Olympiade genauer beschreiben?
Die IChO und auch die SChO prüft ihre Teilnehmer mit zwei verschiedenen Prüfungen. Eine davon ist praktisch und die andere theoretisch, wobei es in der Chemie drei grosse thematische Bereiche gibt, die Inhalt der jeweiligen Prüfung sein können. Diese drei Gebiete umfassen die physikalische Chemie, sie beschäftigt sich mit den physikalischen Grundlagen von chemischen Prozessen und Substanzen, die organische Chemie, beschäftigt sich, mit einigen Ausnahmen, mit Verbindungen, die auf dem chemischen Element Kohlenstoff basieren, und die anorganische Chemie, welche die Chemie aller chemischen Elemente behandelt, ausser die von Kohlenstoff – wiederum mit einigen Ausnahmen.
Wie gross ist das Teilnehmerfeld und aus wie vielen Ländern kommen die Teilnehmer?
Die diesjährige IChO war mit 354 Teilnehmenden aus 91 verschiedenen Ländern die bisher grösste Chemieolympiade überhaupt, und erstmals war auch Liechtenstein mit einem vollen Team, also vier Personen, vertreten. Diese Vielzahl an Teilnehmenden aus der ganzen Welt ist auch eine der hervorragendsten Qualitäten von Anlässen dieser Art. So ist es möglich, über die verschiedensten Kulturen der Welt, deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu lernen.
Wie sahen die Prüfungstage aus? Was hat dich zu deiner hervorragenden Leistung geputscht?
Bei der praktischen Prüfung sind Aufgaben typisch, bei denen es beispielsweise darum geht, ein Produkt aus gegebenen Ausgangsstoffen herzustellen, beziehungsweise zu synthetisieren und zu analysieren oder

die Zusammensetzung gewisser Chemikalien oder Mixturen mittels verschiedener Methoden zu ermitteln. Die Theorieprüfung besteht dabei aus verschiedenen Aufgaben, die auch themenübergreifend den zuvor genannten Gebieten der Chemie zugeordnet werden können. Dieses Jahr lag beispielsweise ein grosser Fokus auf verschiedenen Modellen, welche die räumliche Anordnung der Atome eines Moleküls aufgrund von verschiedensten Faktoren bei deren Herstellung vorhersagen können. An der letztjährigen IChO in Riad lag ein Fokus zum Beispiel auf katalysierten Reaktionen. Beide Prüfungen haben bei dem internationalen Wettbewerb jeweils fünf Stunden in Anspruch genommen.
Zum einen konnte ich mich dadurch motivieren, mich vorzubereiten, da ich diese Inhalte an einem gewissen Punkt im Studium benötigen werde und die Inhalte sehr interessant sind. Zum anderen hatten wir sehr tolle Mentoren und Mentorinnen, die bei allen möglichen Fragen stets zur Stelle waren. Für uns war es ein grosses Privileg, dass wir uns gemeinsam mit den Schweizern vorbereiten durften. Einer der Vorbereitungsanlässe hat sogar im Gymnasium in Vaduz stattgefunden.
Da kommt ein Chemie-Talent aus Schellenberg – aus einem 1000-Seelen-Dorf – in die Arabischen Emirate mit 10,8 Millionen Einwohnern … - welche Eindrücke prasselten auf dich ein?
Die beiden arabischen Städte Riad und Dubai könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie waren beide auf ihre eigene Weise sehr eindrücklich für mich. Riad zeugt von arabischer und orientalischer Geschichte, Religion und Kultur. Wir durften dort ein breites Rahmenprogramm geniessen und bekamen einiges von der historischen Stadt und von deren Umgebung zu sehen. Meistens fanden diese Ausflüge am Abend statt, als die Temperatur mit trockenen 38 Grad gut erträglich war. Dubai als Teil der Vereinigten Arabischen Emirate ist deutlich jünger und
blickt auf eine Geschichte von nur zirka 60 Jahren zurück. Die Stadt ist dabei ein wenig mehr auf den internationalen Tourismus ausgelegt und an ihn angepasst, sodass auch in Dubai ein eindrückliches Rahmenprogramm an den Abenden stattfand. Beide Städte hinterliessen umfangreiche Eindrücke, wenn auch stark unterschiedliche.
Du beginnst nun dein Studium an der ETH in Zürich. Was ist dein Ziel?
Zunächst ist es mein Ziel, gut in mein Studium zu starten, meine Interessen weiterzuverfolgen und irgendwann in diesem oder einem verwandten Gebiet tätig zu sein. Grundsätzlich möchte ich in der Forschung arbeiten. Ich freue mich nun sehr auf die Zeit an der ETH und kann es eigentlich kaum erwarten, am 15. September in Zürich zu starten. Bis dahin darf ich in Buchs bei der Merck ein vierwöchiges Praktikum absolvieren, was für mich eine grossartige Chance ist, weiter in die Welt der Chemie hineinzublicken und vieles auszuprobieren.
Was machst du in der Freizeit – welches sind deine Hobbys?
In meiner Freizeit versuche ich mich an neuen Kochrezepten, treibe Sport, bin Pfadfinder und spiele im Musikverein Cecilia Schellenberg Waldhorn. Wenn es die Zeit zulässt, besuche ich gerne Konzerte und treffe mich mit meinen Freunden. Grundsätzlich bereitet es mir auch in meiner Freizeit grosse Freude, mich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Neuerungen in der heutzutage doch sehr stark dynamischen Geopolitik zu beschäftigen und über diese Thematiken zu debattieren.
Danke, Giulio, für dieses höchst interessante, spannende und sehr sympathische Gespräch.




Was Ihre Anlagen bewirken, ist uns wichtig
Der Erfolg einer Anlage wird durch das optimale Verhältnis von Risiko und Rendite bestimmt, der Sinn einer Anlage durch ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Uns ist Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Papier wichtig. lgt.com/li






























In Zusammenarbeit mit PUMA hat balleristo die beiden Sneaker-Modelle Smash v2 Leather und Basket Classic XXI umfassend auf Druckqualität, Haftfestigkeit und Materialverträglichkeit getestet. Ziel war es, personalisierte Designs mit hoher Farbbrillanz und Langlebigkeit auf Leder zu realisieren – ohne Kompromisse bei Komfort oder Stil.




Modelle direkt im Konfigurator mit 3D-Vorschau gestalten und bestellen. Zum Start der Produktlinie steht pro Schuh eine Druckfläche von 5 cm Länge × 1.5 cm Höhe auf dem Aussenrist zur Verfügung – ideal für Initialen, Teamlogos oder Firmenkennzeichen.
Die speziell entwickelten Druckverfahren von balleristo harmonieren optimal mit den Lederoberflächen der Sneaker – Farben bleiben dauerhaft brillant und die Drucke sind widerstandsfähig im täglichen Einsatz.
Auf Basis dieser erfolgreichen Testphase hat sich balleristo entschieden, den PUMA Smash v2 Leather und den PUMA Basket Classic XXI ins Sortiment aufzunehmen – als erste veredelbare Ledersneaker in der balleristo-Kollektion. Wie von balleristo gewohnt, lassen sich beide

Sowohl der Puma Smash v2 als auch der Puma Basket Classic überzeugen durch eine komfortable Passform, ein weiches Innenfutter und eine gedämpfte Gummisohle. Die Sneaker passen sich nach kurzer Eintragzeit optimal dem Fuss an – ideal für das Tragen im Alltag, bei Events oder im Teamkontext.
Direkt ausprobieren!
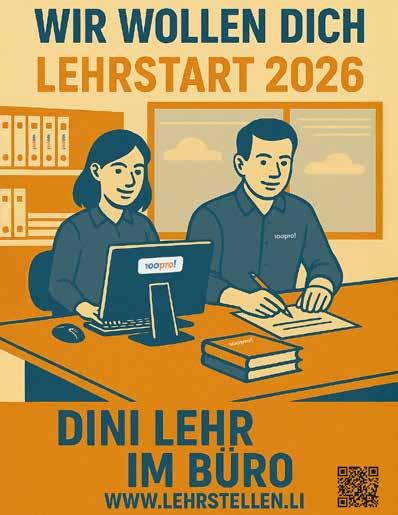


Lehre mit Zukunft im team von altherr OFFENE LEHRSTELLEN 2026

Automobil-Mechatroniker/-in EFZ Nutzfahrzeuge
Automobil-Fachmann/-frau EFZ Nutzfahrzeuge
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ Automobil After-Sales
STANDORTE: SCHAAN | Nesslau | BIlten
JETZT BEWERBEN: info@altherr.ch
www.agil.li


Starte durch in einem der führenden Lehrbetriebe Liechtensteins und wähle aus einer Vielzahl von rund 20 Lehrberufen.
Die Industrie-Lehrbetriebe in Liechtenstein bieten zahlreiche spannende Lehrstellen an: Angefangen bei Automatikerin über Lebensmitteltechnologe bis Physiklaborantin oder Logistiker und noch viele mehr.
In den Lehrbetrieben der ArbeitsGruppe IndustrieLehre AGIL (siehe Kasten) können abwechslungsreiche praxisorientierte Ausbildungen in rund 20 verschiedenen Berufen mit modernsten Arbeitsplätzen und neusten Technologien absolviert werden. Erfahrene Berufsbildnerinnen und Berufsbildner begleiten ihre Lernenden durch die Ausbildungszeit und unterstützen sie auf dem Weg zu einem erfolgreichen Lehrabschluss. Eine Lehre in der Industrie hat Zukunft. Denn gerade in technischen Berufen sind gut ausgebildete, motivierte junge Leute sehr gefragt.
5 AGIL-Tipps für die Berufswahlvorbereitung
• Am besten informieren sich junge Leute mit ihren Eltern frühzeitig über alle Berufe, die sie interessieren.
• Unter www.agil.li finden sich z.B. rund 20 kurze Berufsbeschriebe von Lehrberufen in der Industrie.
• Alle weiteren Berufe, die im Land ausgebildet werden, sind unter www.next-step.li aufgeführt.
• Noch keine Ahnung, was für ein Beruf gelernt werden soll? Keine Bange. Die Berufsberatung in Schaan hilft gerne weiter.
• Am besten werden Infotage von Lehrbetrieben genutzt, um in verschiedene Berufsfelder reinzuschauen, damit man sich dann für Schnupperlehren in Berufen entscheiden kann, die einen näher interessieren.
In diesem Sinne: Allen viel Erfolg bei der Berufswahl!
AGIL, die ArbeitsGruppe IndustrieLehre der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), setzt sich aktiv für die Förderung des Lehrlingswesens in der Region ein. Mit dabei sind die Hilcona AG, Hilti Aktiengesellschaft, Hoval Aktiengesellschaft, Ivoclar Vivadent AG, Liechtensteinische Kraftwerke, Oerlikon Balzers, Herbert Ospelt Anstalt und thyssenkrupp Presta AG.
Industrielehre ist Zukunft
Besuche uns bei den Berufs- und Bildungstagen NEXT-STEP am 26. und 27. September 2025 im SAL in Schaan
Industrielehre ist Zukunft.


Deine Zukunft: agil.li




Freie Lehrstellen und Studienplätze für 2026
Fachperson Gesundheit FZ
Fachperson Hauswirtschaft FZ
Koch/Köchin FZ
Dipl. Pflegefachperson HF



Eine Firma, ver schie dene Berufe und viel Per spek tive. Mach auch du deine Lehre bei Frickbau und werde jetzt Teil unseres Teams.
Unsere Lehrberufe
• Maurer/-in FZ
• Maurer/-in BA
• Strassenbauer/-in FZ
• Strassenbaupraktiker/-in FZ
• Kaufmann/-frau FZ

Für unseren Landwirtschaftsbetrieb schreiben wir folgende Stelle und Karriere aus:
Der Biohof Verein ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich dafür ein, dass es in Liechtenstein wieder mehr Obstbäume gibt. Dazu studieren wir die Obstsorten Europas und der Welt hinsichtlich ihrer Eignung für unsere klimatischen Bedingungen und Böden und verbreiten das gewonnene Wissen.
Der Biohof Verein bewirtschaftet auch Grundstücke von privaten Eigentümern, pflanzt und pflegt Obstgärten sowie Kastanien- und Nussbäume. Zudem setzt sich der Verein dafür ein, dass es in Liechtenstein in Zukunft einen botanischen Garten geben wird und hat ein entsprechendes Projekt gestartet.
Es besteht die Möglichkeit und unser Wunsch, nach erfolgreichem Lehrabschluss die Betriebsleitung unseres Landwirtschaftsbetriebs zu übernehmen.
Folgendes wirst du unter anderem lernen: Pflanzenanbau, Tierhaltung, Umgang mit Traktoren, Maschinen, Pflanzen, Tieren, Menschen und Naturkräften.
Biohof Verein, Noflerstrasse 31, 9491 Ruggell

Neben der Arbeit mit den Pflanzen und Tieren sind auch die administrativen Tätigkeiten ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehören unter anderem:
• Kontakt mit Behörden
• Führung der Betriebsbuchhaltung
• Studium der sich laufend ändernden Gesetze und Verordnungen
• Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Vereinsversammlungen
• Mithilfe bei der Gründung, dem Aufbau und Betrieb des Botanischen Gartens in Liechtenstein (Sortengarten alpenländischer Nutzpflanzen)
• Mitarbeit bei weiteren Projekten, zum Beispiel «Verwertung von Schafwolle»
• Mitarbeit in verschiedenen Verbänden und Interessensgemeinschaften
Deine Kreativität und Ideen sind sehr gefragt. Wir suchen eine zuverlässige und fleissige Person, die in Liechtenstein verwurzelt ist und interessiert ist, nach dem Lehrabschluss als Betriebsleiter:in die Verantwortung für den Landwirtschaftsbetrieb des Biohof Vereins zu übernehmen.
Schicke deine Bewerbung bitte bis zum 20. September 2025 per E-Mail an: info@biohof.li
Wir danken allen, die uns mit einer Spende unterstützen: Liechtensteinische Landesbank IBAN LI69 0880 1086 1200 3
Lehrstellen mit Zukunft. Jetzt abchecken!
Gipser/in, Baupraktiker/in, Maurer/in, Strassenbaupraktiker/in, Strassenbauer/in, Pflästerer/in und Schreiner/in

www.biohof.li www.sortengarten.li
Jetzt bewerben: hiltibau.li/ueber-uns/lernende Wir freuen uns auf dich!
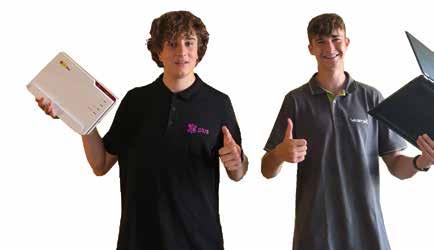
Die globale Unsicherheit wirkt sich zunehmend auch auf die regionale Arbeitswelt aus. Für Mitarbeitende heisst dies höhere Erwartungen an die Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft für Weiterbildung oder in manchen Fällen eine berufliche Neuorientierung. Dabei kommen Fragen auf: Wo stehe ich beruflich? Passen meine Fähigkeiten noch? Wohin möchte ich mich beruflich weiter entwickeln? Was erfüllt mich in der Arbeit und was fehlt mir? Die Laufbahnberatung kann in der Entwicklung von Laufbahnzielen, in
der Erkundung von persönlichen Ressourcen sowie bei der Entwicklung von Handlungsplänen Unterstützung bieten. Dabei gilt es, die berufliche Laufbahn nicht nur an äussere Anforderungen anzugleichen, sondern im Einklang mit den persönlichen Werten und Lebenszielen zu gestalten.
Einen kostenlosen Beratungstermin können Sie beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) unter +423 236 72 00 vereinbaren.

Eine Laufbahnberatung bietet Ihnen:
• Standortbestimmung der beruflichen Situation, Motivation, Fähigkeiten Blick auf den Arbeitsmarkt und dessen Entwicklung
• Berücksichtigung der beruflichen und persönlichen Rahmenbedingungen
• Zielgerichte Gestaltung und Entwicklung neuer Perspektiven

Kostenlos, vertraulich, praxisnah
Infos unter: abb.llv.li
Abb in die Zukunft.
Bildung & Jugend
Emil Jäger macht seine Lehre bei der Franz Hasler AG in Gamprin und befindet sich im zweiten Lehrjahr als Zimmermann FZ. Er gibt einen kleinen Einblick in seine spannende und interessante Tätigkeit.
Interview: Vera Oehri-Kindle
Warum hast du dich für den Beruf des Zimmermanns entschieden?
Emil Jäger: Ich bin mit Holz aufgewachsen, und Holz hat mich immer schon interessiert. Daher war es naheliegend, diesen Beruf zu erlernen.
Was gefällt dir an deinem Beruf und deinem Ausbildungsbetrieb?
Das Arbeiten im Team macht mir grossen Spass. Wenn ich am Abend sehe, was ich geschafft habe, ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich fühle mich wohl, weil alles organisiert abläuft und alle sehr gut miteinander auskommen.
Welche Voraussetzungen sollte man für
deinen Beruf mitbringen?
Man sollte gerne im Freien und auch im Team arbeiten. Handwerkliches Geschick ist ebenfalls von Vorteil.
Wer unterstützt dich in deiner Ausbildung und welche Unterstützung erhältst du konkret?
Wenn ich eine Frage habe, kann ich auf jeden im Betrieb zählen. Es werden mir alle meine Fragen anhand praktischer und theoretischer Besipiele beantwortet.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus und was sind deine Hauptaufgaben?
Am Morgen richten wir das Material her, das wir auf der Baustelle benötigen. Danach


gehen wir auf die Baustelle. Dort sind die Arbeiten unterschiedlich. Zum Beispiel richten wir Elementhäuser auf, erstellen eine Holzfassade und natürlich noch vieles mehr.
Wie schaltest du nach einem langen Tag nach getaner Arbeit am besten ab?
Ich gehe nach Hause und arbeite im Familirnbetrieb weiter. Ab und zu gehe ich auch ins Fitnessstudio.
Welche Ziele hast du nach der Lehre?
Ich möchte noch einige Jahre als Zimmermann arbeiten und bei der Firma bleiben. Später würde ich gerne bei meiner Mutter in der Röckle AG einsteigen.


Optimierung von Unternehmensprozessen. Für Unternehmer:innen, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen, die Geschäftsprozesse gestalten, steuern oder optimieren.
Der Lehrgang vermittelt praxisnah die Grundlagen, Methoden und Werkzeuge des Prozessmanagements. Ziel ist es, Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, zu lenken und kontinuierlich zu verbessern – mit Fokus auf Kundenorientierung, Kooperation und messbare Ergebnisse.
Inhalte
Die 3 Module:
1. BASIC–Prozesse verstehen (Grundlagen, Kundenorientierung, Process-Life-Cycle, IST-Analyse, Soll-Prozesse),
2. INTERMEDIATE–Prozesse lenken (Projekte, Prozessketten, Veränderungsprozesse, Rollen & Teams, Software, Dokumentation),
3. EXCELLENCE–Prozesse managen (Unternehmenssteuerung, Kennzahlen, Prozessoptimierung, Methoden, Bewertungsmodelle, Projektarbeit).
Prüfung
Multiple-Choice, Praxisbeispiel und mündliche Projektpräsentation; erfolgreicher Abschluss berechtigt zur Zusatzqualifikation «Senior Process Manager:in» (EN ISO/IEC 17024).
Ein Lehrgang mit Zukunft.
Für HTL-, FH-, TU-Absolvent:innen sowie Personen aus Technik, Dokumentation oder Kommunikation, die sich für einen Beruf im Spannungsfeld von Entwicklung und Nutzer:innen interessieren.
Die Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern klare technische Kommunikation. Technische Redakteur:innen erstellen verständliche, rechtssichere Informationen für Produkte und Software. Der Lehrgang vermittelt praxisnahes Wissen – von Informationsentwicklung bis zum Einsatz von KI.
Zielgruppe
Mitarbeiter:innen/Manager:innen im Bereich Umwelt, Energie, Qualität, Gesundheitsschutz, Facility Services, Marketing und Kommunikation sowie Führungskräfte, die am Thema Nachhaltigkeit interessiert sind und eine solide Grundlage erhalten wollen.
Inhalte
Die 8 Module: 1. Rechtliche und normative Grundlagen, 2. Informationsentwicklung & Zielgruppenanalyse, 3. Technisches Schreiben & Layout, 4. Visualisierung & Illustrationen, 5. Strukturierung & Content Management, 6. Redaktionssysteme & XML, 7. Projekt- und Prozessmanagement, 8. KI-gestützte Redaktionsprozesse (NEU).
Prüfung
Schriftliche Arbeit, Fachgespräch und Abschlussprüfung; erfolgreicher Abschluss berechtigt zur Zusatzqualifikation «Zertifizierte:r Technische:r Redakteur:in» (EN ISO/ IEC 17024).

Trainer:innen procon Unternehmensberatung GmbH
Trainingseinheiten: 88 Stunden
Beitrag: € 2.950,zuzüglich € 510,- Prüfungsgebühr
Ort: WIFI Dornbirn
Start: 14.01.2026
Kursnummer: 62961
Persönliche Beratung Tanja Kathan T 05572/3894-469
E kathan.tanja@vlbg.wifi.at
Mehr Infos zum Kurs

Lehrgangsleiter
IIng. Curt Schmidt, Geschäftsführer technics4users-TB
Trainingseinheiten: 252 Stunden
Beitrag: € 4.770,zuzüglich € 510,- Prüfungsgebühr
Ort: WIFI Dornbirn
Start: 21.11.2025
Kursnummer: 62831
Persönliche Beratung
Tanja Kathan T 05572/3894-469
E kathan.tanja@vlbg.wifi.at
Mehr Infos zum Kurs
Bildung & Jugend
Carlo Klösch hat seine dreijährige Lehre als Maurer FZ bei der Bühler
Bauunternehmung AG in Triesenberg im Juli 2025 erfolgreich abgeschlossen und gewährt einen kleinen Einblick in seine Tätigkeit, die gerade die Baustelle auf der Schlossstrasse betrifft.
Interview: Vera Oehri-Kindle
Was hat dich dazu bewogen, dich als Maurer ausbilden zu lassen?
Carlo Klösch: Für mich kam immer schon ein handwerklicher Beruf infrage. Ich arbeite sehr gerne im Freien und mag, wenn man am Abend sieht, was man geleistet hat.
Was macht für dich ein gutes Team aus?
Zusammenhalt, gute Kommunikation, Vertrauen, Verlässlichkeit und Spass an der Arbeit sind für mich in einem Team sehr wichtig. Es ist wichtig, zusammen etwas zu bewegen.
Welche Werkzeuge und Geräte musst du im Maurerhandwerk beherrschen?
Die Werkzeugvielfalt ist gross. Angefangen von der Kelle und der Wasserwaage bis zum Kompressor, zur Spitzmaschine, zum Laser und zu vielem mehr.
Wie gehst du mit Kritik um?
Ich schätze konstruktive Kritik sehr, da diese jeweils auch einen sehr grossen Lerneffekt für mich mit sich bringt.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten interessieren dich?
Vorarbeiter beziehungsweise Polier.
Was sind deine Pläne für die nächsten fünf Jahre?

Ich möchte Erfahrungen als Maurer sammeln, um irgendwann eine eigene Baustelle zu führen.
Wie gehst du mit den verschiedenen Wetterbedingungen auf der Baustelle um?
Die Hitze und die Kälte machen es einem die Arbeit nicht immer leicht. Aber das gehört zum Beruf dazu. Es gibt gute Kleidung. Ich bin auch im Privatleben sehr häufig bei jeder Witterung in der Natur, deshalb kann ich recht gut damit umgehen. Manchmal kann man die Arbeit auch der Witterung anpassen.
Langversion ab 6. September 2025 online www.lie-zeit.li
Erfahrung ist unser Fundament Tr iesenberg · Tr iesen
Dann starte deine Zukunft bei der Kaiser Partner Privatbank AG!
Wir bieten motivierten jungen Talenten eine spannende und vielseitige Banklehre an. Du erhältst Einblicke in unterschiedliche Bereiche unserer Privatbank, arbeitest aktiv mit und entwickelst dich fachlich wie persönlich weiter. Dabei begleiten und unterstützen wir dich individuell und legen gemeinsam den Grundstein für deine Karriere.
Bewirb dich jetzt als Bankkauffrau / Bankkaufmann und werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf dich!
Lass dich inspirieren:
kaiserpartner.bank/lehre kaiserpartnernextgen



Freie Lehrstellen ab Sommer 2026
Elektroinstallateur/in EFZ
Montage-Elektriker/in
Die Zukunft liegt in deiner Hand, komm in unser Team und werde Teil einer starken Gemeinschaft!
Kolb Elektro SBW AG Industriestrasse 24 9487 Gamprin-Bendern www.kolbelektro.li


Werde auch du ein Teil unserer Hoval Familie hoval.com/berufsbildung-liechtenstein



Bildung & Jugend
David Näscher absoviert bei der Frickbau AG in Schaan sein zweites Lehrjahr als Maurer und ist mit seiner Berufswahl sehr glücklich. Er gibt einen kleinen Einblick in seine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Interview: Vera Oehri-Kindle
Warum hast du dich für den Beruf des Maurers entschieden?
David Näscher: Während meiner Orientierungsphase habe ich Einblicke in verschiedene Berufe gewonnen und konnte dadurch unterschiedliche Tätigkeiten kennenlernen. Besonders der Beruf des Maurers hat mich überzeugt, da er sowohl handwerkliches Geschick als auch Präzision und Ausdauer erfordert. Es gefällt mir, dass man am Ende des Tages sieht, was man mit den eigenen Händen geschaffen hat, und dass man ein sichtbares Ergebnis hinterlässt. Die Mischung aus körperlicher Arbeit, technischer Genauigkeit und der Möglichkeit, beim Bau von etwas Dauerhaftem mitzuwirken, hat mich dazu motiviert, diesen Beruf zu wählen.
Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr, hast also schon gewisse Erfahrung. Bist du rückblickend zufrieden mit deiner Berufsentscheidung?
Ja, mit meiner Berufswahl bin ich sehr zufrieden. Durch die Ausbildung habe ich bereits viele praktische Erfahrungen gesammelt und konnte mein handwerkliches Geschick stetig weiterentwickeln. Besonders gefällt mir, dass die Arbeit abwechslungsreich ist und man immer wieder neue Herausforderungen meistert.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Beruf?
Dass er sehr vielseitig ist. Jeder Tag bringt neue Aufgaben mit sich, sodass die Arbeit nie

eintönig wird. Als Maurer braucht man nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch technisches Verständnis. Ausserdem schätze ich die Teamarbeit sehr. Gemeinsam mit den Kollegen an einem Bauwerk zu arbeiten und Schritt für Schritt zu sehen, wie etwas Neues entsteht, ist für mich besonders motivierend.
Welche Arbeiten führst du bereits eigenverantwortlich aus?
Inzwischen darf ich bereits verschiedene Tätigkeiten selbstständig übernehmen. Dazu gehören unter anderem das Mauern, das Schalen und das Verputzen.
Langversion ab 6. September 2025 online www.lie-zeit.li
Noch auf der Suche nach einer Lehrstelle?
Ausbildungen bei Frickbau


Freie Lehrstellen 2026:
Kauffrau/Kaufmann
Elektroinstallateur/in
Montageelektriker/in
Netzelektriker/in (Energie)
Solarinstallateur/in
Jetzt bewerben: berufsbildung@lkw.li
Martin Berchtel
Weitere Infos

Leiter Berufsbildung T +423 236 01 20

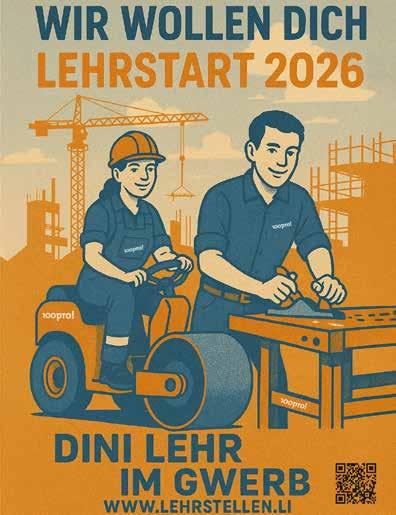


Aus bildung
Bereit für den nächs ten S chrit t ? Dann bewerbe dich jetz t ramona ackermann@neuebank li
Weitere Informationen unter neuebank .li/ausbildung


Fabian Öhri absolviert bei der LGT die dreijährige KV-Lehre. Das erste Lehrjahr hat er bereits erfolgreich bewältigt. Im Interview spricht er über seine ersten Erfahrungen als Lernender und worauf er sich bei der LGT noch besonders freut.
Fabian, warum hast du dich für eine KV-Lehre entschieden?
Fabian Öhri: Ich finde es spannend, was an den Finanzmärkten passiert und habe als Schüler schon zweimal am European Money Quiz teilgenommen. Ausserdem arbeiten zwei meiner Verwandten bei der LGT. Zur KV-Lehre entschlossen habe ich mich aber, nachdem ich bei drei Banken zum Schnuppertag war.
Und warum wurde es dann die LGT, bei der du dich beworben hast?
Von der LGT hatte ich viel Gutes gehört, nicht nur in der Familie. Wichtig war für mich aber auch der gute Eindruck beim Schnuppertag. Da habe ich viele verschiedene Bereiche gesehen und konnte mich mit Mitarbeitenden und
Lernenden unterhalten. Was auch für die LGT spricht: Sie ist so gross, dass man vielleicht auch mal die Chance hat, im Ausland zu arbeiten.
Es heisst, dass man in der Lehre verschiedene Unternehmensbereiche kennenlernt?
Das ist richtig, in den drei Jahren werde ich in sechs Abteilungen mitarbeiten. Gerade bin ich im Fondshandel. Meine erste Abteilung war beim Einkauf im Supply Management, dann war ich im Zahlungsverkehr.
Was für einen Eindruck hast du bei deinen ersten Stationen von der LGT gewonnen?
Mir gefällt es sehr gut. Man arbeitet von An-
fang an mit und man lernt jeden Tag was Neues dazu.
Auf welche Abteilung bist du besonders gespannt?
Auf den Handel habe ich mich schon von Anfang an sehr gefreut. Ganz allgemein finde ich Aktienfonds, Wertschriften und wie das alles gehandelt wird sehr spannend. Das hat mir auch schon am Schnuppertag gefallen, wo wir mal in die Abteilungen reinschauen konnten.
Weitere Informationen zur KV-Lehre: www.lgt.com/lehre

Die Hilcona AG bietet eine Vielzahl interessanter Lehrberufe an. Günter Grabher ist Koordinator für Berufsbildung und die erste Anlaufstelle bei der Bewerbung sowie allen weiteren Fragen rund um die Berufslehre. Er sagt: «Oberstes Ziel der Hilcona AG ist es, dass unsere Lernenden nicht nur die Lehre erfolgreich absolvieren, sondern auch auf lange Sicht Teil unseres Teams bleiben wollen und sich für eine Karriere bei uns entscheiden.»
Interview & Fotos: Vera Oehri-Kindle
Wie viele Lehrlinge
bildest du zurzeit aus?
33
Wie viele Teamanlässe führst
du mit den Lehrlingen durchschnittlich pro Jahr durch? 10

Günter Grabher bildet zurzeit 33 Lehrlinge aus.
Wie viele Lehrlinge hast du in deiner Karriere bereits ausgebildet?
150
Welches war die Höchstnote beim Lehrlingsabschluss von einem deiner Lehrlinge?
5,5
In wie vielen Berufszweigen bildet Hilcona aus?
6

Günter Grabher präsentiert einen kleinen Teil des bereiten Produktsortiments.
Wie viele unterschiedliche Produkte bietet Hilcona an?
2589
In welchem Jahr wurde die Hilcona gegründet? 1935

In welchem Jahr hast du deine Lehre beendet? 1980
Wie viele Wochen Ferien erhält ein Lehrling pro Jahr?
6
An wie vielen Standorten ist Hilcona vertreten?
5
Wie alt war dein ältester Lehrling?
35
Seit 60 Jahren steht die Kibernetik AG für Innovation – ein Versprechen an die nächste Generation. 1965 begann alles mit dem einzigartigen micro-cube-Eis, das den Weg zu Wärmepumpen, Klima- und Photovoltaik-Lösungen ebnete. Diese Mischung aus Pioniergeist und Praxisnähe prägt auch die Kibernetik Academy und die Ausbildung der Fachkräfte von morgen.
Unsere Ausbildungsberufe
Kaufmann/-frau EFZ

3 Jahre
Unsere Benefits – was dich stärker macht
Eigene Lehrwerkstatt für dich und die anderen Lernenden
Kibernetik AG
Prämie für überdurchschnittliche schulische Leistungen und bestandener QV
Mindestlohn nach erfolgreichem Lehrabschluss CHF 4’600.–
Langäulistrasse 62 | CH-9470 Buchs SG +41 81 750 52 00 | academy@kibernetik.ch
Kältesystem-Monteur/-in EFZ

4 Jahre oder 2 Jahre Zusatzausbildung
Schnuppertage? Jederzeit.
Wer wissen will, wie sich der Berufsalltag anfühlt, kommt zum Schnuppern vorbei – unkompliziert und direkt ins Team-Gefühl. Nach der Schnupperlehre geht es bei Interesse rasch weiter: Bewerbung senden, Gespräch führen, Vertrag unterschreiben –und der neue Abschnitt kann starten.
Zertifiziert zur Stufe 3 –die höchste Auszeichnung
Persönliche Begleitung durch erfahrene Berufsbildner, praxisnahes Lernen vom ersten Tag an und eine eigene Lehrlingswerkstatt, die echtes Arbeiten ermöglicht.
kibernetikag
Kibernetik AG
Hier erfährst du mehr
kibernetik.ch/academy

Die Energiewende verändert nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch die Art, wie wir Strom nutzen. Immer mehr Haushalte investieren in Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Elektromobilität. Doch erst das Zusammenspiel dieser Technologien macht eine wirklich effiziente Nutzung möglich. Hier kommt die Eigenverbrauchsoptimierung ins Spiel.
Photovoltaik als Basis
Eine PV-Anlage bildet die Grundlage für die Eigenversorgung mit Strom. Je nach Ausrichtung und Grösse liefert sie über das Jahr hinweg erhebliche Mengen an Energie. Ohne zusätzliche Massnahmen wird jedoch ein grosser Teil dieser Energie ins öffentliche Netz eingespeist – oft genau dann, wenn der eigene Verbrauch gering ist.
Stromspeicher als Bindeglied
Ein moderner Batteriespeicher sorgt dafür, dass überschüssiger Solarstrom nicht verloren geht, sondern für später verfügbar bleibt. Abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, kann so gespeicherte Energie genutzt werden – anstatt Strom teuer einzukaufen.
Intelligentes Energiemanagement
Die eigentliche Optimierung geschieht durch ein Energiemanagementsystem. Dieses steuert, wann Strom in den Speicher geladen wird, wann Verbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox aktiviert werden und wie Lastspitzen vermieden werden können. So wird der Eigenverbrauch auf intelligente Weise maximiert.
Wärmepumpe und Elektromobilität Besonders interessant wird es, wenn auch Heizung und Mobilität in das System eingebunden sind. Eine Wärmepumpe kann mit Solarstrom betrieben werden und so nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich arbeiten. Elektrofahrzeuge lassen sich in Zeiten hoher PV-Leistung laden und fungieren perspektivisch sogar als mobile Speicher.
Ganzheitlicher Ansatz
Statt einzelne Komponenten isoliert zu betrachten, ist es entscheidend, alle Sektoren zu einem stimmigen Gesamtkonzept zu verbinden. Genau hier liegt der Mehrwert: Durch die Auswahl perfekt abgestimmter Systeme entsteht ein effizientes Energiemanagement, das den Eigenverbrauch maximiert, die Stromkosten senkt und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

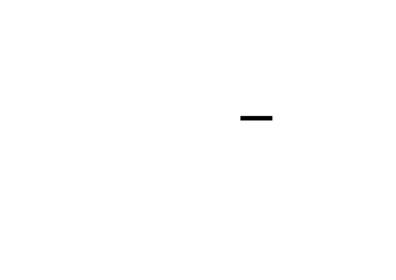


Die Herausforderung liegt in der reibungslosen Kommunikation der Systeme untereinander. Fachbetriebe, die auf eine enge Zusammenarbeit mit Herstellern und Lieferanten setzen, können ihren Kunden eine umfassende Lösung bieten – von der Planung bis zur Umsetzung. So entsteht ein zukunftsfähiges Energiesystem, das auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist und alle Sektoren intelligent miteinander verbindet.

Hasler Solar AG
Ober Au 28, FL-9487 Bendern +423 373 41 31, info@haslersolar.li www.halsersolar.li


Die Baubewachung von ARGUS bietet Sicherheit und Schutz rund um die Baustelle.
Mehr Informationen unter: www.argus.li
sicherheit@argus.li +423 377 40 40



„Verwittertes Pflaster?!
Alternative zur Neuverlegung.“
Die Steinpfleger Schweiz-Ost, das Team im Interview:
Eine kurze Einleitung bitte. Was genau bieten Die Steinpfleger an?
Wir haben uns darauf spezialisiert, Oberflächen im Außenbereich aufzubereiten und diese nachhaltig zu schützen. Im Grunde vergleichbar mit der Pflege eines Autos. Richtig geschützt hat man auch hier deutlich länger Freude daran und erhält zeitgleich den Wert.
Kurz zum Ablauf, wie kann man sich einen Steinpflegerbesuch vorstellen?
Zunächst schaut sich ein Mitarbeiter die Flächen an, legt eine Probereinigung, bspw. In einer Ecke an, und erstellt dann ein Aufmaßblatt inkl. Fotos. Dieses wird noch vor Ort an unser Büro versendet. Direkt im Anschluss erhält der Kunde ein schriftliches Angebot. Das Besondere bei uns: Bis hierhin ist alles kostenfrei und völlig unverbindlich. Für uns sind die Angebote verbindlich, es wird kein Cent mehr abgerechnet als vereinbart, auch wenn wir länger bleiben müssen.
Und wie läuft so eine Aufbereitung, bspw. die eines Pflasters ab?
Reinigung mit bis zu 100° C heißem Wasser (350 BAR Druck)
Gleichzeitige Absaugung von Fugenmaterial und Schmutzwasser
Wir reinigen mit bis zu 100°C heißem Wasser und einem angepassten Druck von bis zu 350 bar. Dabei saugen wir gleichzeitig das entstehende Schmutzwasser sowie das Fugenmaterial ab. Im Anschluss wird die Fläche einer umweltverträglichen Art der Desinfektion unterzogen. Damit entfernen wir selbst die kleinsten Rückstände und Sporen. Damit es aussieht wie neu verlegt und die Flächen ihre Stabilität behalten, werden diese neu verfugt. Im Anschluss imprägnieren wir die Flächen und schützen diese so langfristig.
Warum sollte man die Steinpfleger beauftragen?
Zum einen natürlich der Faktor Zeit. Ich denke, ein Garten ist in erster Linie ein Ort der Ruhe und Erholung. Wer möchte schon die wenigen Sonnenstunden damit verbringen, zu reinigen und Sachen von A nach B zu schleppen. Außerdem ist ja zu beachten, reinigt man selbst, ist das i. d. R. alle 3-4 Monate nötig. Dabei wird viel Dreck an Fenstern und Türen verursacht, teilweise werden die Fugen ausgespült, Pfützen entstehen und natürlich wird jedes Mal das Pflaster weiter angeraut. Dadurch ist das Pflaster im neuen Jahr noch schmutzanfälliger. Wenn wir da waren, bieten wir mit STEINPFLEGER Protect 4 Jahre Garantie, auch gewerblich! Und dank unserer hauseigenen festen

Neuverfugung mit unkrauthemmendem Fugenmaterial
Langzeitschutz dank Steinpfleger-Protect-Imprägnierung




Systemfuge ist auch eine nachhaltige chemiefreie Unkrauthemmung möglich.
Man hört und liest ja immer wieder von Drückerkolonnen, welche vor Ort direkt abkassieren und mit dubiosen Mitteln nachhelfen. Was unterscheidet Sie davon?
Einfach alles! Das beginnt schon damit, dass wir Angebote ausschließlich schriftlich versenden, geht über unsere Auftragsbestätigungen bis hin zu einer ordnungsgemäßen Rechnung, welche auch zum Teil steuerlich geltend gemacht werden kann. Nicht zuletzt sind wir einfach vor Ort und mit offenem Visier am Kunden. Das gibt Sicherheit. Garantiert haben wir auch in Ihrer Nähe Referenzen zu bieten.
Ein letztes Statement an alle Unentschlossenen, und wie man Sie erreichen kann!
Testen Sie uns. Bis zu Ihrem „Go“ zur Durchführung der Arbeiten ist es kostenfrei und unverbindlich, Sie können nur gewinnen!
Auf www.die-steinpfleger.ch haben wir ein informatives Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung, telefonisch sind wir unter +41 71 510 06 40 erreichbar.
Fair und seriös - schriftliche Angebote und Topbewertungen
ca. 75 % günstiger als eine Neuverlegung




Projektpräsentation «Toggenburg»
Ein Ferienhaus in der dritten Generation bedeutet stets mehr als nur Mauern und Räume – es ist ein Stück Familiengeschichte. Emotional verabschiedete sich ein Geschwisterpaar nun vom bisherigen Bestand, der seit den 1950er-Jahren als Ferienhaus mit zwei Wohnungen diente.
Text: Schöb AG
Eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Bausubstanz hatte ergeben, dass eine Erhaltung nicht zielführend wäre: Eine schlechte Fundation, geringe Raumhöhen, ungünstige Raumanordnungen und eine energetisch veraltete Bauweise hätten Investitionen ohne nachhaltigen Wert bedeutet – ein Fass ohne Boden.
Die Entscheidung für einen Neubau war somit nicht nur eine Frage der Zukunftsfähigkeit, sondern auch eine Investition in die Weiterführung der Familiengeschichte. Entstanden ist ein modernes Ferienhaus mit zwei fast identischen 3,5-Zimmer-Wohnungen mit 67 und 69 Quadratmetern Wohnfläche.
Wohnen mit Weitblick
Beide Wohnungen überzeugen mit grosszügigen Terrassen sowie einem Gartensitzplatz im Erdgeschoss. Ein besonderes Highlight: Die unvergleichliche Aussicht auf die Churfirsten, die nicht nur im Freien, sondern auch gemütlich vom Sitzfenster aus genossen werden kann. Die Nutzung bleibt der Familientradition treu – die Wohnungen stehen weiterhin der Familie und Freunden als Ferienort zur Verfügung. Praktische Ergänzungen wie ein Carport für zwei Autos sowie ein Abstellraum für Skier, Fahrräder und Sportgeräte runden das Konzept ab.
Architektur und Materialisierung
Der Neubau vereint eine klare Architektursprache mit hochwertigen, langlebigen Materialien, die Funktionalität und Ästhetik gleichermassen betonen. Die architektonische Gestaltung wurde hausintern von Architektin Christa Mosimann entwickelt. Mit viel Gespür für Raum, Material und den familiären Hintergrund hat sie ein Ferienhaus geschaffen, das Moderne und Tradition in einer selbstverständlichen Harmonie vereint.
Grosszügige Kunststofffenster mit Rafflamellenstoren sorgen für helle Innenräume und einen flexiblen Sonnenschutz. Im Inneren setzen hochwertige Türen mit Futter und Verkleidung dezente Akzente und unterstreichen die sorgfältige Ausführung. Als Bodenbelag prägen Landhausdielen aus rustikaler, gebürsteter und natürlich geölter Eiche den Wohnbereich – sie verleihen den Räumen Wärme und Authentizität. In den Nasszellen sorgen elegante Feinsteinzeugplatten für eine robuste und pflegeleichte Oberfläche.
Die Fassade wird durch eine horizontale, vorvergraute Holzschalung strukturiert, die das Gebäude harmonisch in seine alpine Umgebung einbettet. Im Innern spannen sich Holz-Betonverbunddecken in Fichte natur sowie eine Dachuntersicht in Dreischichtplatte Fichte natur und schaffen eine Atmosphäre, die von Natürlichkeit und handwerklicher Präzision lebt. Das Dach ist mit klassischen Dachziegeln gedeckt und gleichzeitig technisch auf dem neuesten Stand: Eine Photovoltaikanlage mit 11,04 Kilowatt Peak liefert erneuerbare Energie. Für ein nachhaltiges Raumklima sorgt die energieeffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe, die ihre Wärme über eine komfortable Bodenheizung verteilt.
So entsteht ein Ferienhaus, das Tradition und Moderne verbindet – geprägt von natürlichen Materialien, zeitloser Gestaltung und zukunftsweisender Haustechnik. Mit diesem Neubau setzen die Bauherren nicht nur ein starkes Zeichen für die Zukunft, sondern auch ein sichtbares Bekenntnis zur Weiterführung einer Familientradition – modern, nachhaltig und mit einem Panorama, das seinesgleichen sucht.

Projektpräsentation «Toggenburg»



Panoramablick in die Bergwelt
Das Panoramafenster bildet den zentralen Blickfang des Wohnraums. Mit seiner rahmenreduzierten Konstruktion öffnet es den Innenraum grosszügig zur Landschaft und macht die Aussicht auf die Churfirsten zum integralen Bestandteil der Architektur. Eine integrierte Sitzbank erweitert das Fenster zu einem bewohnbaren Möbel: Die Frontflächen in weiss beschichtetem Kunstharz treten zurückhaltend in den Hintergrund, während die Sitzfläche aus rustikaler, geölter Eiche einen warmen, haptischen Akzent setzt. Dezente Muschelgriffe unterstreichen die reduzierte, klare Gestaltung. Im Dialog mit diesem Element steht die Küche, die durch ihre Material- und Farbwahl eine ruhige, aber kraftvolle Präsenz im Raum entfaltet. Die Fronten sind in seidenmatter Kunstharzoberfläche in Lavaschwarz ausgeführt und werden durch bügelartige Edelstahlgriffe akzentuiert. Die Arbeitsfläche aus Neolith Pietra di Luna bildet mit ihrer steinernen Haptik den robusten Rahmen für den täglichen Gebrauch. Spülbecken und Glaskeramik sind flächenbündig integriert, was die horizontale Wirkung der Platte betont und die Eleganz der Linienführung verstärkt. Die Küchenrückwand aus einer Argolite Verbundwerkstoffplatte in Grauweiss mit schwarzem Kern setzt einen subtilen Kontrast zu den dunklen Fronten. Ergänzt wird die hochwertige Ausstattung durch aktuelle Küchengeräte sowie ein Spülbecken und eine Armatur in mattem Edelstahl.
Gemeinsam erzeugen Panoramafenster und Küche ein Zusammenspiel aus Offenheit und Geborgenheit. Die warme Natürlichkeit von Holz trifft auf die Klarheit moderner Oberflächen und die Funktionalität zeitgemässer Küchentechnik. Die Architektur schafft damit einen Ort, an dem Alltag und Aussicht zu einem atmosphärischen Ganzen verschmelzen.



Schreinerarbeiten und Innenausbau
Die Schreinerarbeiten fügen sich als massgefertigte Einbauten harmonisch in das architektonische Gesamtkonzept ein und verbinden Funktionalität mit handwerklicher Präzision. Die Garderobe überzeugt durch eine klare, zurückhaltende Frontausführung in weiss beschichtetem Kunstharz. Als wohnliches Detail setzt eine Sitzbank aus rustikaler, geölter Eiche einen warmen Akzent. Dezente Muschelgriffe sorgen für eine funktionale, zugleich elegante Bedienung und greifen die Gestaltung des Panoramafensters auf, wodurch ein durchgängiges architektonisches Motiv entsteht.
Im Bereich der Bäder prägen Einbauten aus Eiche rustikal, furniert und matt lackiert, das Erscheinungsbild. Die natürliche Maserung des Holzes verleiht den Möbeln einen warmen, authentischen Charakter, während die matte Oberfläche eine dezente Eleganz ausstrahlt. So wird die handwerkliche Qualität der Schreinerarbeiten sichtbar, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Schöb AG
Haagerstrasse 80 9473 Gams
info@schoeb-ag.ch www.schoeb-ag.ch
LANGZEITPARTNER FÜR IHRE SCHALUNG

Die alkus® Schalungsplatte. Mehr als 1.500 Einsätze. Ein ausdauernder Begleiter für Ihre Bauvorhaben.
Langlebig und preiswert. Entdecken Sie, was alkus® so besonders macht: www.alkus.com
3 1 2
FUSSBALL IST TEAMGEIST.
MBPI. In Liechtenstein. Für Liechtenstein.

Landstrasse 105, Postfach 130, 9495 Triesen
Telefon + 423 399 75 00, info @ mbpi.li, www.mbpi.li


Der FC Vaduz ist nach sechs Runden in der Challenge League noch ungeschlagen und liegt mit 14 Punkten auf Tabellenrang 2. So gut sind die Liechtensteiner schon lange nicht mehr in eine Saison gestartet. Nicht nur die Punkteausbeute überzeugt, auch die Spielweise der neuformierten Mannschaft gefällt, das belegen unter anderem die bereits 15 erzielten Treffer. In dieser Verfassung darf der FC Vaduz als ernsthafter Kandidat für die Aufstiegsplätze in Betracht gezogen werden.
Text: Christoph Kindle
Noch sind zwar 30 Runden zu spielen, ein wenig kristallisieren sich aber bereits die (allgemein erwarteten) Favoriten in dieser Challenge League-Saison heraus. Der FC Aarau, vergangene Saison in der Barrage an GC gescheitert, hat seine ersten sechs Partien alle-
samt gewonnen und führt die Tabelle mit dem Punktemaximum an. Auch Super League-Absteiger Yverdon kommt nach der Auftakt-Niederlage in Vaduz langsam in Fahrt und liegt einen Zähler hinter dem FCV auf dem 3. Rang. Diese drei Teams haben sich vom Rest des Feldes bereits ein wenig abgesetzt.
Der FC Vaduz bislang eine Heimmacht
Schon in der vergangenen Saison präsentierten sich die Vaduzer zu Hause deutlich stärker als auf fremden Terrains. Dieser Trend scheint sich, zumindest bis jetzt, in der neuen Spielzeit fortzusetzen. Viermal durfte die Elf von Trainer Marc


Besuche 18 Heimspiele, davon 7 gratis, mit kostenloser Hin- und Rückfahrt im gesamten LIEmobil-Liniennetz
Erhältlich auf fcvaduz.li oder auf der Geschäftsstelle.
Schneider im heimischen Rheinparkstadion antreten, und sämtliche zwölf Punkte blieben in der Liechtensteiner Residenz. Bei den letzten drei Heimspielen gegen Stade Nyonnais, Bellinzona und Wil war auffallend, dass die Vaduzer schon frühzeitig für klare Verhältnisse sorgten. Gegen Nyon stand es nach 18 Minuten bereits 2:0, gegen Bellinzona führte der FCV nach 16 Minuten schon 3:0, und zuletzt im Ostderby gegen den FC Wil kaufte der Favorit dem Gegner mit zwei Toren in den ersten elf Minuten den Schneid ab.
In allen diesen Spielen überzeugte die Schneider-Elf mit schnellem und variantenreichem Angriffsspiel. Diesbezüglich hat die Mannschaft im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich zu-
gelegt. Im Mittelfeld sorgt der neue Sechser, der Deutsche Luca Mack (wechselte von Stuttgart II zu Vaduz), für Stabilität, die offensiven Impulse kommen in erster Linie von Stephan Seiler (kam vom FC Schaffhausen) und Luzern-Leihgabe Ronaldo Dantas Fernandes. Generell wirkt die Mannschaft geschlossen, der breite und ausgeglichene Kader bietet dem Trainer einiges an Möglichkeiten. Mit dem 25-jährigen Kanadier Ayo Akinola verpflichtete der FC Vaduz in den letzten Wochen noch einen zusätzlichen Stürmer.
Spitzenkampf in Aarau wartet Wenn der FCV in dieser Saison tatsächlich um den Aufstieg mitspielen will, dann reichen starke Heimauftritte allein aber nicht. Vergangene

Saison war die Auswärtsschwäche eklatant. Diesbezüglich ist eine klare Steigerung gefordert. In den beiden bisherigen Partien in der Fremde gab es zwei Unentschieden gegen Etoile Carouge und Xamax. Am kommenden Samstag folgt nun die ultimative Standortbestimmung beim noch verlustpunktlosen Leader FC Aarau im Brügglifeld. In diesen Begegnungen steckte in den vergangenen Jahren stets viel Brisanz. Die Bilanz ist recht ausgeglichen, wobei die Vaduzer in den letzten vier Vergleichen nicht reüssieren konnten. Den letzten FCV-Erfolg im Brügglifeld gab es am 1. April 2023. Damals gewann Vaduz unter Neo-Cheftrainer Martin Stocklasa dank Toren von Fehr und Rastoder mit 2:0.
Nach sechs Runden liegt der FCV mit 14 Punkten auf dem zweiten Rang, man kann wohl sagen, der Start in die Saison ist gelungen?
Marc Schneider: Sicher. Wir sind zufrieden, auch mit den Auftritten in der Conference League. Trotzdem dürfen wir uns keinesfalls zurücklehnen. Wir müssen weiter hungrig bleiben.
In den vergangenen Jahren war es meistens so, dass sich der FC Vaduz durch die Mehrbelastung im Europacup zu Beginn einer Saison schwer getan hat. In diesem Jahr scheint es eher so zu sein, dass man durch die zusätzlichen Ernstkämpfe besser in den Rhythmus gekommen ist. Wie siehst du das?
Ja, durchaus, wir hatten die Möglichkeit, viele 1:1-Wechsel vorzunehmen, das war sicher ein Vorteil. Da kommt uns die Qualität im Kader zugute. Wir sind praktisch auf allen Positionen doppelt gut besetzt.
Vier Heimspiele, vier Siege: Der FC Vaduz ist zumindest bis jetzt eine Macht im Rheinparkstadion.
Bislang funktioniert das bestens zu Hause. Wir spielen sehr gerne im Rheinparkstadion,
aber jetzt müssen wir schauen, dass wir auch auswärts die Punkte einfahren können. Aber wenn man zu Hause so erfolgreich auftreten kann wie wir zurzeit, dann ist das zweifellos ein grosses Plus.
Nach sechs Runden gibt es mit Aarau, Vaduz und Yverdon eine Dreierspitze in der Challenge League, denkst du, dass diese
drei Teams am Ende auch die beiden ersten Plätze unter sich ausmachen werden?
Man kann davon ausgehen, dass diese drei Mannschaften vorne sein werden, aber es gibt noch das eine oder andere Team, das ebenfalls mitmischen kann. Wir sind froh, wenn wir so lange wie möglich zu diesen Spitzenfeld gehören. Dafür arbeiten wir jeden Tag.



Die USV-Fans mussten vier Wochen auf den ersten Saisonsieg des 1.Liga-Teams warten. Dieser stellte sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den FC Kosova Zürich mit einem 2:0-Erfolg ein. Und die Freude im USV-Lager war gross. Doch Trainer Michele Polverino bremst die Euphorie etwas und bemängelt die sieben Gegentore in drei Spielen. Gegen den FC Kosova hat er die Defensive etwas umgestellt, sodass die Gegentore ausgeblieben sind. Er freut sich auf die kommenden Partien und sieht den Spielen mit viel Selbstvertrauen entgegen.
Interview: Herbert Oehri
Michele, wie bist du mit dem Auftakt in die neue 1.Liga-Meisterschaft zufrieden?
Michele Polverino: Es gibt zwei unterschiedliche Aspekte, die man betrachten muss. Die Art und Weise, wie wir
gespielt haben, stimmt mich sehr positiv und hat mir gut gefallen. In den ersten drei Spielen haben wir 23 Torchancen herausgespielt – eine wirklich starke Zahl. Negativ fällt jedoch ins Gewicht, dass wir bereits sieben Gegentore kassiert haben und aus diesen Partien lediglich zwei Punkte mitnehmen konn-
ten. Mit dem Sieg am letzten Spieltag gegen Kosova können wir nun aber zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Gegen St. Gallen und Winterthur gab es je ein 3:3. In beiden Spielen lag ein Sieg drin, weil der FC USV insgesamt besser

war. In einem Spiel lag deine Mannschaft 2:0 vorne, im anderen 0:2 zurück. Liegen die Schwächen allein in der Abwehr?
Nein, die Schwächen liegen nicht allein in der Abwehr. Natürlich haben wir in beiden Spielen Tore zu einfach zugelassen, aber Fußball ist immer ein Zusammenspiel aller Mannschaftsteile. Wir müssen sowohl im Verteidigen nach vorne als auch in der Absicherung nach Ballverlust konsequenter sein. Dazu gehört auch, dass wir unsere Chancen noch effizienter nutzen, um enge Spiele frühzeitig zu entscheiden. Positiv ist, dass wir uns gegen starke Gegner wie St. Gallen und Winterthur viele Möglichkeiten herausgespielt haben – das zeigt die Qualität der Mannschaft. Jetzt geht es darum, die Balance zwischen Offensive und Defensive noch besser zu finden, was uns gegen Kosova gut gelungen ist. Beim 2:0-Sieg zeigten wir in der ersten Halbzeit ein fast perfektes Spiel. Leider haben wir das dritte Tor nicht nachgelegt. Aber der erste Erfolg in der neuen Saison fühlt sich an wie eine Befreiung. Ich hoffe, dass wir nun so viel Selbstvertrauen getankt haben, dass wir in den nächsten Spielen so weitermachen können.
Was wirst du unternehmen, damit es besser wird?
Wir werden in erster Linie an unserer defensiven Stabilität arbeiten. Das bedeutet, dass wir kompakter verteidigen, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen verringern und in entscheidenden Momenten konsequenter handeln müssen. Gleichzeitig wollen wir unsere Effizienz vor dem Tor steigern, damit wir enge Spiele früher für uns entscheiden können. Insgesamt geht es darum, die gute spielerische Linie beizubehalten, aber mit mehr Konsequenz in beiden Strafräumen aufzutreten.
Braucht der USV Verstärkungen auf den Abwehr-Aussenbahnen?
Im Moment vertraue ich den Spielern, die wir auf den Aussenbahnen haben. Sie bringen die Qualität mit, die wir brauchen, müssen aber, wie die gesamte Mannschaft, noch konstanter in ihren Aktionen werden. Natürlich schauen wir uns den Markt immer an, aber akuter Handlungsbedarf besteht derzeit nicht. Wichtiger ist, dass wir die vorhandenen Spieler weiterentwickeln und ihnen Vertrauen schenken.

Derzeit sind erst drei Runden in der 2. Liga Interregional gespielt und die «Resultate sind noch etwas wild», sagt Marco Wolfinger vom FC Balzers zur gegenwärtigen Tabellenlage, die noch nicht viel aussagt. Wichtig sei es, Ruhe zu bwahren und die wenigen Trainingseinheit bestmöglich nutzen, um sich als Team stetig zu verbessern. Marco Wolfinger bezeichnet die Gruppe als ausgeglichen. Jeder könne jeden schlagen.
Interview: Herbert Oehri
Marco, wie bist du mit dem Start der 1. Mannschaft zufrieden?
Marco Wolfinger: Leider konnten wir aus den ersten drei Meisterschaftsspielen nur einmal als Sieger hervorgehen und
wollen daher auch nicht von Zufriedenheit sprechen. Die Resultate sind noch etwas wild. Wir konnten in den ersten Punktespielen jedoch auch sehr viele positive Eindrücke gewinnen, auf denen es nun aufzubauen gilt. Dabei ist wichtig, dass wir Ruhe bewahren und die wenigen Trainingseinheiten, die wir zusammen haben, bestmöglich nutzen, um als Team gewisse Abläufe zu verinnerlichen, die uns helfen, die positiven Eindrücke in positive Resultaten umzuwandeln.
In der vergangenen Saison sind die Balzner insgesamt gut in die Meisterschaft gestartet.
Was fehlt derzeit noch, um ganz vorne mitzumischen?
Es war eine 1:3 Niederlage, mit der wir in die letztjährige Saison gestartet sind und mit lediglich drei Punkten mehr aus den ersten drei Spielen. Allgemein, denke ich, bringt uns ein saisonübergreifender Quervergleich nicht wirklich weiter oder brauchbare Erkenntnisse, weshalb wir uns voll und ganz auf die aktuelle Situation konzentrieren. Aus Niederlagen –deren zwei haben wir jetzt eingefahren – kann man sehr viel lernen und Schlüsse ziehen. Diese gilt es nun zusammen aufzuarbeiten und gleichzeitig schnellstmöglich nach vorne zu schauen auf unsere nächsten Herausforderungen. Nach drei Spieltagen wäre es sehr gewagt in dieser ausgeglichenen Gruppe zu prognostizieren, wer vorne mitmischen wird. Ich denke, dass sich eine Tendenz im weiteren Verlauf der Vorrunde zeigt. Aktuell fehlen Punkte. Um konstant Punkte einfahren zu können, bedarf es einer Konstanz im Abrufen unserer besten Teamleistung. Diese Konstanz wiederum erarbeitet man sich über Wiederholungen in Training und Spiel.
FCB-Trainer Gerardo Clemente sprach von einer nicht idealen Vorbereitung. Auf was führst du das zurück?
Wie oben beschrieben, ist die Anzahl der Wiederholungen von Abläufen als Team in Trainingseinheiten und Trainingsspielen die Basis für Konstanz im Meisterschaftsbetrieb. Dies gilt grundsätzlich für jedes Team, wird jedoch nochmals wichtiger im Zusammenhang mit einem neuen Trainerteam und einer grossen Zahl an Neuzugängen im Kader. Aufgrund der sehr vielen und langen Ferienabsenzen, die teilweise bis in den laufenden Meisterschaftsbetrieb andauerten, konnte bis vor kurzem nicht mit dem kompletten Kader trainiert werden, und von einer gezielten Vorbereitung kann erst ab der zweiten August-Woche die Rede sein. Mit Ferienabsenzen kämpften diesen Sommer bekanntermassen aber auch viele andere Teams. Daher darf dies durchaus Erwähnung finden, uns jedoch nicht weiter beschäftigen. Wir schauen nach vorne, wollen die Länderspielpause nutzen, um mit den Spielern, die nicht im LFV-Aufgebot stehen, an Fitness und Themen im Einzelspielerbereich zu arbeiten und freuen uns darauf, nach den Länderspielen mit dem ganzen Kader weiter an den Teamabläufen zu feilen.
Der FCB verfügt über eines der schlagkräftigsten Teams in der 2. Liga Interregional, Gruppe 5. Mit dieser Mannschaft kann das Saisonziel nur der Aufstieg sein. Bist du auch dieser Meinung?
Die Frage nach der Zielsetzung für diese Saison wurde im Interview Anfang August bereits beantwortet. Ich wüsste nicht, was uns zu einer abgeänderten Formulierung unserer Zielsetzung bewegt haben sollte, daher kann ich mich nur wiederholen. Wie beschrieben, gehen wir mit relativ vielen Veränderungen in diese Saison und wollen daher an jeder neuen Herausforderung wachsen, in der Entwicklung der mannschaftlichen Geschlossenheit und unseren Spielprinzipien Fortschritte machen und dabei immer auch die individuelle Entwicklung aller Kaderspieler im Auge behalten. Sollte uns dies gut gelingen und wir von grösseren Verletzungsausfällen verschont bleiben, ist mit unserem Kader einiges möglich. In dieser ausgeglichenen Gruppe wird jedoch zwangsläufig immer wieder auch die Tagesform der jeweiligen Teams entscheidend sein. Wir schauen mit viel Vorfreude auf die kommenden Wochen und die Herausforderungen, auf die wir uns bestmöglich vorbereiten werden.



Stefan Marxer anlässlich der LOC-Delegiertenversammlung 2025 in Nendeln.
Liechtenstein ist in früheren Jahren bezüglich Erfolge auf internationalem Parkett verwöhnt worden. Medaillen und Triumphe bei Grossanlässen, vor allem im alpinen Skisport, waren fast an der Tagesordnung. Seit einiger Zeit aber müssen die Liechtensteiner Athletinnen und Athleten kleinere Brötchen backen, Topergebnisse auf höchstem Niveau bleiben praktisch aus. Woran liegt das? Fehlt es an den Talenten oder darf man aufgrund der Kleinheit des Landes nicht zu viel erwarten?
Interview: Christoph Kindle
Der Präsident des Liechtenstein Olympic Commitee (LOC), Stefan Marxer, nimmt im Interview ausführlich Stellung zur aktuellen Situation des Sports in Liechtenstein.
18 Medaillen zuletzt an den Kleinstaatenspielen in Andorra sind zweifellos erfreulich, doch bei internationalen Grossan-
lässen kann Liechtenstein nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Wo siehst du die Gründe dafür?
Stefan Marxer: 18 Medaillen an den Kleinstaatenspielen sind ein schöner Erfolg, vor allem weil fast jeder dritte Athlet eine Medaille gewinnen konnte. Das zeigt, dass wir in unserem Umfeld konkurrenzfähig sind. Gleich-
zeitig müssen wir realistisch bleiben: Auf der internationalen Bühne können wir derzeit nicht mehr an die grossen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Ein zentraler Grund ist die demografische Realität. Mit rund 30'000 Staatsangehörigen ergibt sich rein rechnerisch eine sehr kleine Basis für potenzielle Spitzensportlerinnen und -sportler. Pro Jahrgang sind das maximal neun Talente, die theoretisch das
Potenzial für internationale Spitzenleistungen mitbringen. Vor diesem Hintergrund ist jeder internationale Erfolg eine Sensation. Dass wir trotzdem Erfolge feiern können – wie die Qualifikation unseres Artistic Swimming Duetts für die Olympischen Spiele, Julia Hasslers starken zwölften Platz in Tokyo oder die EM-Medaillen und Weltcup-Siege der Kickboxer – ist beachtlich, aber nicht selbstverständlich.
An der finanziellen Förderung dürfte es nicht fehlen. Das LOC wird vom Staat grosszügig unterstützt. Fehlt es momentan an herausragenden Talenten oder sind die Athletinnen und Athleten zu schnell zufrieden?
Den Vorwurf, unsere Athleten seien zu schnell zufrieden, weise ich entschieden zurück. Wer sich ansieht, welche Opfer diejenigen, die es
Jeder internationale Erfolg eine Sensation
Hinzu kommt: Die internationale Sportwelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark professionalisiert. Während andere Länder ihre Fördersysteme massiv ausgebaut haben, kämpfen wir als Kleinstaat mit den natürlichen Grenzen. Mit der Anpassung der Sportschule, Teilanstellungen für Athletinnen und Athleten sowie besserer medizinischer Betreuung sind wichtige Fortschritte gemacht worden – aber sie bedeuten lediglich das Aufholen von Standards, die anderswo längst etabliert sind. Wir haben in den vergangenen Jahren gezielt daran gearbeitet, strukturelle Lücken zu schliessen. Aber wenn wir nicht weiter Gas geben, werden wir künftig noch weniger Chancen haben, uns international durchzusetzen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir noch Erfolge feiern können, sondern wie wir sie ermöglichen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik und der Verbände. Es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft. Leistungssport ist kein Selbstläufer. Er erfordert langfristige Investitionen, professionelle Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Verständnis dafür, dass hinter jeder Medaille jahrelange Arbeit steckt –von Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern sowie vielen Menschen im Hintergrund. Leistungssport ist heute kein ambitioniertes Hobby mehr, sondern ein knallharter Job, der einem körperlich, mental und organisatorisch alles abverlangt. Wer international mithalten will, braucht nicht nur Talent, sondern ein Umfeld, das Höchstleistung ermöglicht. Wir sind auf einem guten Weg, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
wirklich ernst meinen, erbringen – Lebenspläne, die sie dem Sport unterordnen, Ausbildungen, die sie verschieben, finanzielle Unsicherheiten, die sie in Kauf nehmen –, der weiss: Es geht um alles andere als Zufriedenheit. Unsere Sportlerinnen und Sportler kämpfen jeden Tag um jeden Zentimeter, jede Sekunde, jeden Punkt. Dass sie das tun, verdient höchsten Respekt.
Auch am Talent liegt es nicht. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, sie geduldig und professionell auf ihrem Weg in die Weltspitze zu begleiten. Dafür braucht es auch das Kom-
menden Jahren entfalten wird. Was darüber hinaus notwendig ist, sind bessere infrastrukturelle Rahmenbedingungen sowie internationale Trainingsmöglichkeiten – etwa Sparring mit Weltklasse-Athletinnen und -Athleten, um sich zu messen und daran zu wachsen. Diese Massnahmen sind jedoch mit höheren Kosten für Verbände und Athleten verbunden. Gleichzeitig dürfen wir uns nichts vormachen: Die Konkurrenz ist heute grösser denn je. Während wir in Liechtenstein mit einer Handvoll potenzieller Spitzenathleten pro Jahrgang arbeiten, verfügen andere Länder nicht nur über mehr Talente, sondern auch über deutlich mehr Ressourcen, um sie zu fördern. Die Leistungsdichte im internationalen Sport ist enorm – wer dort mithalten will, braucht nicht nur Talent und Einsatz, sondern auch ein System, das alle verfügbaren Ressourcen nutzt. Dass der Staat und die Gemeinden den Sport grosszügig unterstützen, ist richtig und wichtig. Dennoch müssen wir ehrlich sein: Im Vergleich zu anderen Ländern, die ihre Athleten mit Millionenbudgets, hochprofessionellen Strukturen und Infrastrukturen sowie langfristigen Karriereplänen ausstatten, hinken wir in einigen Bereichen noch hinterher. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Fachhochschule Graubünden eine Studie in Auftrag gegeben, die unser gesamtes Leistungssportsystem – inklusive der finanziellen Förderung – kritisch analysiert. Ziel ist es, objektiv zu erkennen, wo wir nachbessern müssen, um keine Chance ungenutzt zu lassen.
Spitzensport als Beruf anerkennen
mittent des ganzen Landes. Spitzensport sollte als Beruf anerkannt werden, nicht als ambitioniertes Hobby, sondern als das, was er heute ist: ein knall harter Job, der körperlich, mental und organisatorisch alles abverlangt.
Die Investitionen in Strukturen wie die Sportschule, medizinische Abteilungen, Leistungsdiagnostik und Athletiktraining sind wichtige Schritte, deren Wirkung sich erst in den kom-
Das LOC bietet Liechtensteiner Sportlerinnen und Sportlern Anstellungsverträge mit einem entsprechenden Einkommen an. Hat sich dieser Schritt schon bewährt?
Die Zukunft des liechtensteinischen Sports ist meines Erachtens vielversprechend. Allein der aktuelle Bewerbungsprozess für die Athletenanstellungen beim LOC zeigt, wie viel Potenzial vorhanden ist: 25 junge Talente aus 13
verschiedenen Sportarten haben sich beworben – mit einem Durchschnittsalter von nur 22,1 Jahren. Das ist ein starkes Zeichen für die gute Arbeit unserer Verbände und für die Motivation der Athletinnen und Athleten, den Schritt in den professionellen Leistungssport zu wagen.
Diese jungen Menschen verzichten auf vieles –auf Freizeit, auf finanzielleSicherheit, auf klassische Lebenswege –, um sich ganz ihrem Sport zu widmen. Umso entscheidender ist es, jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu bieten, damit sie sich ohne Existenzängste auf ihre Entwicklungkonzentrieren können.
Besonders ermutigend ist die Vielfalt der Sportarten, die vertreten sind. Ob im Skisport, Mountainbike, Tennis, Schwimmen, Judo, in der Leichtathletik oder anderen Disziplinen: Überall gibt es junge Menschen, die mit Leidenschaft und Professionalität an ihre Grenzen gehen. Der Weg zu internationalen Medaillen ist lang und hart, und die Konkurrenz schläft nicht. Genau diese Breite und dieser Elan sind
Unser Anstellungsprogramm für Leistungssportler ist ein zentraler Baustein der Förderung, und es basiert auf einem klar strukturierten, transparenten und fairen Auswahlverfahren. Um sicherzustellen, dass die besten Talente mit den aussichtsreichsten Perspektiven unterstützt werden, haben wir ein breit aufgestelltes Gremium eingerichtet: Athletenvertreter, Vertreter der Sportverbände, der staatlichen Sportförderung und des LOC bewerten gemeinsam alle Bewerbungen. Diese Vielfalt an Perspektiven garantiert, dass die Entscheidungen nicht nur sportlich fundiert, sondern auch nachvollziehbar und gerecht sind.
Das Verfahren ist professionell organisiert. Nach der Einreichung der Bewerbungsdossiers werden die vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten in mehreren Runden ausgewählt. Dabei achten wir besonders auf ein stabiles, professionelles Umfeld von der Trainingsbetreuung bis zur medizinischen Unterstützung. Es handelt sich um ein langfristiges Kommittent für den Spitzensport im Sinne des Potenzials für internationale Erfol-
Die Ausgangslage ist so gut wie lange nicht mehr.
die beste Voraussetzung für Erfolge in den kommenden Jahren.
Dabei sollten wir nicht vergessen: Für einen Kleinstaat wie Liechtenstein ist bereits die Qualifikation für Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften ein grosser Erfolg und ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit der richtigen Förderung, der gezielten Unterstützung und dem unermüdlichen Einsatz unserer Athletinnen und Athleten bin ich überzeugt, dass wir bald wieder internationale Erfolge feiern können. Die Ausgangslage ist so gut wie lange nicht mehr. Jetzt geht es darum, dieses Potenzial gemeinsam zu nutzen und weiter auszubauen.
Wie läuft dieses Auswahlverfahren und wer entscheidet letztlich?
ge, sei es bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder anderen Titelkämpfen. Es ist uns dabei wichtig, dass die Ausgewählten nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und beruflich nachhaltig begleitet werden. Am Ende steht eine Entscheidung, die nicht nur dem LOC, sondern dem gesamten liechtensteinischen Sport zugutekommt. Denn jedes Talent, das wir fördern, ist eine Investition in die Zukunft und eine Chance, unser Land wieder auf die internationale Bühne zu bringen.
Ein Kritikpunkt, der oft zu hören ist: Es fehlt beim LOC an einer gewissen Selbstreflexion, es ist kaum ein kritisches Wort zu hören. Sie stehst du dazu?
Selbstreflexion und kritische Auseinandersetzung sind für uns keine Fremdwörter, im
Gegenteil: Sie sind zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Intern analysieren wir regelmässig unsere Förderprogramme, die Zusammenarbeit mit den Verbänden und die Leistungen unserer Athleten. Dieser Prozess ist essenziell, um Schwächen zu identifizieren und kontinuierlich besser zu werden.
Darüber hinaus pflegen wir einen sehr engen und regelmässigen Austausch mit anderen Nationen, etwa mit der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und weiteren. Dieser Prozess ist entscheidend, um Schwächen zu erkennen, internationale Best Practices aufzunehmen und das Sportsystem Liechtensteins kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein konkretes Ergebnis dieser Auseinandersetzung mit den Verbänden ist das Projekt Sportschule Liechtenstein 2.0. Ab dem Schuljahr 2026/27 führen wir neben dem bewährten Verbandsprofil einen neuen Zweig ein, der gezielt auf die polysportive und athletische Ausbildung von Nachwuchstalenten setzt. Diese Anpassung erfolgte in enger Abstimmung mit den Verbänden und Coaches, die uns klar signalisiert haben, dass dieser Bereich in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Der neue Zweig schafft nicht nur bessere Entwicklungsmöglichkeiten für die Talente, sondern öffnet die Sportschule auch für Verbände, die bisher kein eigenes Programm anbieten konnten.
Ein weiteres Beispiel ist die Auseinandersetzung und Diskussion mit den Leistungssportverantwortlichen der Verbände über die strategische Ausrichtung der Athletenförderung. Gemeinsam haben wir die Frage erörtert, wie Liechtenstein mehr Athletinnen und Athleten für Olympische Spiele und andere Grossanlässe qualifizieren kann. Ein Lösungsansatz war die Fokussierung in der Förderung auf weniger Athletinnen beziehungsweise Athleten. Sozusagen ein Ausdünnen der Förderpyramide. Die Arbeiten daran haben wir bereits begonnen, und wir werden dies in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Verbänden umsetzen.
Wir sind überzeugt, dass eine offene, konstruktive Diskussion im internen Rahmen den grössten Mehrwert für die Verbände, die Athleten und letztlich für den Sport in Liechtenstein bringt. Unser Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der sich alle Beteiligten auf ihre sportliche Entwicklung konzentrieren können. Öffentliche Kritik kann schnell

demotivierend wirken oder den Fokus von der eigentlichen Arbeit ablenken. Deshalb setzen wir auf einen lösungsorientierten Dialog hinter den Kulissen, der Raum für ehrliches Feedback und gezielte Massnahmen lässt. Gleichzeitig sind wir immer offen für den Austausch mit Medien und der Öffentlichkeit, um Transparenz zu schaffen und gemeinsam den liechtensteinischen Sport voranzubringen.
Ganz grundsätzlich: Wo steht der Sport in Liechtenstein derzeit im Vergleich zu früheren Jahren und wo steht er deiner Ansicht nach in etwa zehn Jahren?
Der liechtensteinische Sport steht heute vor einer klaren Realität. Wir können aktuell
Konkurrenz und der natürlichen Schwankung zwischen sportlichen Hochphasen und Baisse-Zyklen. Doch diese Realität hat uns nicht gelähmt, sondern zum Handeln motiviert. In den vergangenen Jahren haben wir gezielt Förderstrukturen ausgebaut, Lücken zu anderen Nationen geschlossen und ein Umfeld geschaffen, das jungen Athleten den Schritt in den Profisport ermöglicht. Die Sportschule Liechtenstein 2.0, die Teilanstellungen für Spitzenathleten und die medizinische sowie finanzielle Unterstützung sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Gleichzeitig zeigt die hohe Zahl an Bewerbungen für unsere Förderprogramme, dass eine neue Generation bereit ist, den Weg in den internationalen Leistungssport zu gehen.
nicht an die Medaillenerfolge vergangener Jahrzehnte anknüpfen – insbesondere nicht an die goldenen Zeiten des alpinen Skisports oder die zeitweiligen Spitzenleistungen in anderen Disziplinen. Das liegt nicht an mangelndem Engagement oder Talent, sondern an den strukturellen Herausforderungen eines Kleinstaates: einer begrenzten Talentrekrutierung, einer global immer professioneller werdenden
Liechtenstein war nie ein Land mit konstanter internationaler Dominanz – mit einer Ausnahme: dem Skisport. Doch selbst dort gab es nach jeder Erfolgsphase eine Durststrecke. Heute sehen wir jedoch, dass sich durch die vielseitige Förderung in verschiedenen Sportarten neue Chancen eröffnen. Wenn wir diese Opportunitäten konsequent nutzen, können wir in zehn Jahren wieder breiter aufgestellt
sein – nicht nur im Skisport, sondern auch in Disziplinen wie Schwimmen, Mountainbike, Leichtathletik oder Radsport.
Der Schlüssel dazu liegt in vier Punkten:
• Kontinuität: Wir müssen die begonnenen Massnahmen weiterführen und die Förderstrukturen stetig anpassen.
• Internationale Kooperationen: Wir brauchen die richtige Infrastruktur, um auch ausländische Athletinnen, Athleten und Coaches in Liechtenstein willkommen zu heissen. Unsere zentrale Lage in Europa bietet dafür ideale Voraussetzungen und stärkt gleichzeitig unsere eigenen Strukturen.
• Geduld: Erfolg im Spitzensport braucht Zeit, besonders in einem Land mit der Grösse Liechtensteins.
• Zusammenarbeit: Nur wenn Politik, Verbände, Athleten und die Gesellschaft an einem Strang ziehen, können wir nachhaltige Erfolge erzielen.
Liechtenstein hat bewiesen, dass es Spitzenleistungen hervorbringen kann. Die Frage ist nicht, ob wir wieder international erfolgreich sein werden, sondern wann – und in welcher Sportart wir als Nächstes überraschen. Die Weichen dafür sind gestellt.

Anzeige


Beide Teams des FC USV Eschen/Mauren spielen in der 4. Liga in unterschiedlichen Gruppen. Mit Michael Marxer (USV 2) und Sebastian Längle (USV 3) konnten zudem erfahrene und kompetente Trainer verpflichtet werden.
Text: Philipp Meier
Wir wünschen eine gute und verletzungsfreie Saison und bedanken uns bei den Sponsoren für die Trikots, das Trainingsoutfit und die Auswärtstrainer.







Papstbesuch vor 40 Jahren
Über 100 Auslandreisen absolvierte Papst Johannes Paul II. während seiner Zeit als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Eine davon führte ihn am 8. September 1985 nach Liechtenstein. Die Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Vatikan verstärkten sich unter Johannes Paul II. mit der Akkreditierung eines liechtensteinischen Botschafters beim Heiligen Stuhl. Die Errichtung des Erzbistums Liechtenstein im Jahr 1997 fällt ebenfalls in sein Pontifikat.
Text: Günther Meier
Über 30'000 Gläubige warteten beim Sportpark Eschen-Mauren auf Papst Johannes Paul II. Fast auf die Minute genau um 10 Uhr landete der Helikopter mit dem Heiligen Vater an Bord am Rande der Sportanlage. Wie üblich bei seinen Auslandreisen stieg der Papst aus dem Helikopter, kniete nieder und küsste den Boden. Das Fürstentum Liechtenstein war das 45. Land, das vom kirchlichen
Oberhaupt im Rahmen einer Pastoralreise besucht wurde. «Eure Heiligkeit! Ihr Besuch ist der bedeutendste, den Kirche und Land von Liechtenstein je erleben durfte», sagte Fürst Franz Josef II. bei seiner Begrüssung. Nach der päpstlichen und liechtensteinischen Hymne, gespielt von den Musikvereinen von Eschen und Mauren, fuhr der Heilige Vater mit dem «Papamobil» durch die Menschenmenge zum Altar, wo er zusammen mit Bischof Johannes Vonderach und Vertretern des liechtensteinischen Klerus die Messe zelebrierte.
Mahnende Worte des Papstes gegen egoistische Bedürfnisse
Bei der Begrüssungszeremonie hatte Papst Johannes Paul II. in einer Ansprache daran erinnert, weshalb er jeweils den Boden küsse bei seiner Ankunft . Wie bei anderen Pastoralreisen in die verschiedenen Kontinente habe er vorhin auch den Heimatboden der Liechtensteiner geküsst und so seine Wertschätzung gegenüber diesem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern zum Ausdruck gebracht: «Diese Geste der Zuneigung verstehe ich als
Zeichen meiner Achtung vor der von Gott geschaffenen Welt und meiner Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer selbst, dem wir Menschen unsere Existenz und alles, was diese enthält, verdanken.» Der Heilige Vater lobte Liechtenstein, dem er nun erstmals einen Besuch abstattete und betonte: «Die Geschichte und das Brauchtum Ihres Landes sind geprägt vom Geist des Christentums und geben dem Fürstentum Liechtenstein durch die Ehrbarkeit und den Fleiss seiner Bürger einen ehrenvollen Platz in der Gemeinschaft der Völker.»
Der Heilige Vater hatte aber auch mahnende Worte bereit, als er den materiellen Wohlstand Liechtensteins lobte. Der hohe Lebensstandard zeuge von der Tüchtigkeit der Bürgerinnen und Bürger, verlange jedoch zugleich eine hohe sittliche Reife und Verantwortung. Sonst verleite er nur allzu leicht zu Bequemlichkeit, zur Befriedigung egoistischer Bedürfnisse und zur Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen. «Wenn ihr wirklich zum Leben in Christus aufbrechen wollt, müsst ihr ausbrechen aus der selbstsüchtigen Welt von Habgier

und blossem Geniessen und euch auf jenen schmalen, aber verheissungsvollen Weg begeben, der zum eigentlichen Gipfel des Lebens führt – zur Vollendung in Gottes Ewigkeit», betonte Johannes Paul II. mit Anspielung auf die für 1985 beschlossene Volksmission unter dem Motto «Aufbruch zum Leben».
Fürst Franz Josef II. würdigte den Papst als Mahner für den Frieden Fürst Franz Josef II. bedankte sich in seiner Begrüssungsansprache beim Papst, die Einladung nach Liechtenstein angenommen zu haben. Der Fürst hatte den Heiligen Vater anlässlich der Landeswallfahrt nach Rom, die 1983 aus Anlass des Heiligen Jahres durchgeführt worden war, zu einem Besuch in Liechtenstein eingeladen. Dem Papstbesuch aber komme nicht nur aus pastoraler Sicht eine besondere Bedeutung zu, betonte der Fürst, Liechtenstein empfange auch das Oberhaupt der weltumspannenden römisch-katholischen Kirche. Als Mahner für den Frieden und Verteidiger der Menschenrechte habe der Papst in der ganzen Welt Unterstützung gefunden, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Ähnlich wie der Papst bei seiner Begrüssung ging der Fürst auf den Spannungsbogen von Christentum und Wohlstand ein: «Die Betonung des materiellen Wohlstandes, die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten unserer Zeit können mit anderen Faktoren dazu führen, dass wir unser menschliches Glück ohne Gott zu erreichen vermeinen und damit auch unseren Mitmenschen und seine Bedürfnisse nach unseren persönlichen Massstäben und nicht nach einem durch Gott vorgegebenen Ideal beurteilen.» Die Meinungsvielfalt drohe damit zur Orientierungslosigkeit zu werden, mahnte der Landesfürst, und der Sinn des Lebens bleibe unbeantwortet.
Grosses Lob für die christliche Tradition in Liechtenstein Auf Schloss Vaduz richtete Papst Johannes Paul II. einige Worte an die beim Empfang anwesenden Politiker aus Regierung und Landtag. Einleitend wies er auf eine Enzyklika hin, die sein Vorgänger Leo XIII. im Jahr 1885 über die christliche Staatsordnung veröffentlicht hatte. Dieser habe die Staatsmänner ermahnt, vor allem auf Gott und seinen Willen zu blicken, auf den höchsten Herrscher der Welt. Johannes Paul II. äusserte Verständnis für die komplexen Probleme, die von den Politikern zu lösen seien. Dennoch dürften
sie bei ihrem Handeln ein solides Werte- und Verantwortungsbewusstsein nicht vermissen lassen: «Gerade bei der heutigen Vielfalt der Ansichten und Absichten ist vom gläubigen Christen, der in einer gesellschaftlichen Führungsposition steht, ein klarer Standpunkt gefordert.» Der Papst lobte die christliche Tradition des Fürstentums Liechtenstein und äusserte seine Hoffnung, dass Liechtenstein auf «diesem kostbaren und kraftvollen Erbe» auch in Zukunft weiterbaue. Er erinnerte an die grosszügigen Hilfeleistungen für Flüchtlinge und Verwundete des Zweiten Weltkriegs und die bereitwillige Aufnahme von Verfolgten. «Dieses gereicht dem Fürstentum Liechtenstein zur bleibenden Ehre», betonte der Papst und unterstrich seine damit verbundene Hoffnung: «Möge dieser mutige Einsatz für die Würde und die Rechte des Menschen von gestern das Volk, besonders die Verantwortlichen in diesem Staat, auch heute und morgen als Vorbild und Auftrag in ihren Entscheidungen leiten und verpflichten.»
Organisch gewachsene Beziehungen zwischen Kirche und Staat Regierungschef Hans Brunhart erinnerte in seiner Rede auf Schloss Vaduz an Dekan Franz Näscher, der in seiner Predigt zum Staatsfeiertag 1980 festgestellt habe, die Kirche sei in Liechtenstein nie eine Macht gewesen, sicher jedoch eine Kraft, die in verschiedenen Bereichen gewirkt habe. Ein Blick in die Geschichte des Landes zeige die organisch gewachsenen Beziehungen zwischen Kirche und Staat, sagte Brunhart weiter. Die christliche Tradition des Landes drücke sich auch in der jedes Jahr am Staatsfeiertag erneuerten Losung «Für Gott, Fürst und Vaterland» aus. Auf das Motto des Papstbesuchs «Aufbruch zum Leben» hinweisend, leitete der Regierungschef auf die Aussenpolitik über: «Liechtenstein bemüht sich, im Verband der auf Freiheit, Solidarität, Frieden und Gerechtigkeit gegründeten Staaten Europas und der Welt, den ihm gebührenden Platz einzunehmen.» Liechtenstein als auf den christlichen Grundsätzen aufbauender Staat fühle sich in besonderer Weise mit dem Heiligen Stuhl und den Bemühungen um mehr Frieden und mehr Freiheit unter den Völkern verbunden. Den Papst selbst bezeichnete Brunhart als einen unermüdlichen Mahner für Menschenrechte, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Die von Johannes Paul II. repräsentierte Kirche könne durch die Betonung dieser christlichen
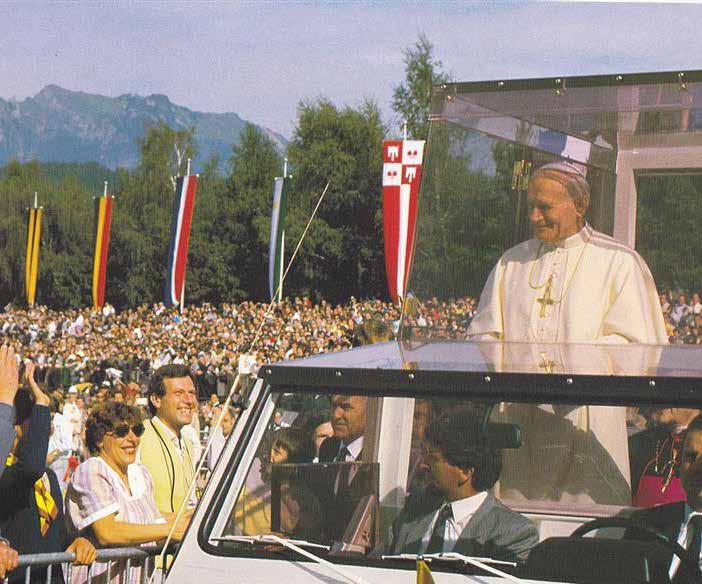
Grundsätze zu einem Abbild des Friedens für die Staatenwelt werden: «Toleranz aber nicht im Sinne von Meinungslosigkeit oder von Schwäche, sondern im Sinne von Verständnis und gegenseitiger Achtung.» Gerade in einem Kleinstaat wie Liechtenstein spüre man besonders, sagte der Regierungschef, wie notwendig die von der Kirche geforderte Gemeinsamkeit und die gegenseitige Achtung seien.
Der Papstbesuch – ein eindrückliches Fest des Glaubens Für Liechtensteins aktive Katholiken war die Zeit um den Papstbesuch ein bewegter Zeitabschnitt. Aus Anlass des Heiligen Jahres wurde 1983 eine Landeswallfahrt nach Rom organisiert, an der knapp 800 Personen teilnahmen, unter ihnen Fürst Franz Josef II. mit weiteren Angehörigen der Fürstlichen Familie, Bischof Johannes Vonderach, Mitglieder der Regierung und des Landtags, Gemeindevorsteher und Seelsorger.
Im Mittelpunkt der Pilgerreise stand eine Sonderaudienz bei Papst Johannes Paul II. Fürst Franz Josef II. überbrachte dem Heiligen Vater bei dieser Gelegenheit die Einladung zu einem Pastoralbesuch in Liechtenstein, der schon 1985 Wirklichkeit werden sollte. Er fand unter dem Motto «Aufbruch
zum Leben» statt, ein Motto, das gleichzeitig auch für die im gleichen Jahr anberaumte Volksmission galt.
Der grosse Volksaufmarsch zur heiligen Messe mit Papst Johannes Paul II. beim Sportpark Eschen-Mauren wurde von vielen als beindruckend empfunden, als ein gutes Zeichen für die römisch-katholische Kirche in Liechtenstein. Allerdings gab es auch Kritik wegen der Dimension der Organisation und der Ausklammerung kritischer Meinungen. Der damalige Dekan Franz Näscher schrieb im Jahresbericht 1985 des Dekanats, der Erfolg des Papstbesuchs lasse sich weder statistisch festhalten noch im religiösen, seelsorglichen Bereich. Aber: «Das eindrückliche Fest des Glaubens zusammen mit dem Papst hat sicher vielen Mut und Zuversicht gegeben. Es wurde eine so grosse Gemeinschaft Gleichgesinnter erlebt, wie es in unserem Land sonst gar nicht möglich ist!»
Treffen mit den Jugendlichen Einen wesentlichen Programmpunkt im dichtgedrängten Besuchsprogramm von Papst Johannes Paul II. in Liechtenstein bildete ein Treffen mit Jugendlichen. Papst und Jugend trafen sich auf Dux, oberhalb von Schaan, wo der Heilige Vater das Volk, das Land und das Fürstenhaus der Gottesmutter Maria weihte.

«Hoi
Papst» – «Hoi zemma!»
Ein wesentlicher Programmpunkt im dichtgedrängten Besuchsprogramm von Papst Johannes Paul II. in Liechtenstein bildete ein Treffen mit Jugendlichen. Papst und Jugend trafen sich auf Dux, oberhalb von Schaan, wo der Heilige Vater das Volk, das Land und das Fürstenhaus der Gottesmutter Maria weihte.
Text: Günther Meier

Eine grosse Zahl von Jugendlichen hatte sich zum Abschluss des Papstbesuchs auf Dux versammelt, um mit dem Heiligen Vater zu beten, zu feiern und in die Zukunft zu blicken. Nach Schätzungen hatten sich etwa 3000 Jugendliche dort eingefunden, wo schon Fürst Franz Josef II. im Zweiten Weltkrieg den Schutz der Mutter Gottes für Land und Volk erbeten hatte. Die Jugendlichen waren offensichtlich in einer Art von positiver Aufbruchstimmung, wollten nicht nur feiern, sondern mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche auch kritische Fragen diskutieren. Dazu kam es aber nicht, denn der offiziellen liechtensteinischen Kirche erschienen die Anliegen einer progressiven Gruppe von Jugendlichen als zu provokativ, weshalb diese Fragen im Vorprogramm der Jugendveranstaltung artikuliert wurden.
Als Papst Johannes Paul II. auf Dux eintraf, wurde das Oberhaupt der Kirche von einer jungen Frau mit dem typisch liechtensteinischen Gruss «Hoi Papst» begrüsst. Sie bedankte sich, dass sich der Heilige Vater speziell Zeit für eine Begegnung mit der Jugend nehme und wies auf das Symbol der Jugendlichen für diese Begegnung hin, einen Erdball: «Dieser Erdball hat uns in der Vorbereitungszeit begleitet. Er ist für uns zu einem starken Zeichen der Solidarität und Mitverantwortung geworden. Unser Land und seine Bewohner bilden in der grossen Völkerfamilie einen winzig kleinen Teil, aber doch gross
genug, im Geist der Solidarität Mitverantwortung zu tragen. Die grosse, weite Welt wartet auch auf unser Miteinander und Füreinander.»
Der Papst nahm den eher ungewöhnlichen Willkommgruss «Hoi Papst» auf und rief den Jugendlichen «Hoi zemma!» zu. Nach dem Willen der Veranstalter sollte auch die Begegnung mit den Jugendlichen nicht durch Misstöne getrübt werden. Deshalb ging der Papst in seiner Ansprache nicht auf die Probleme der Weltkirche und der Armut in vielen Teilen der Welt ein, sondern hob die Verehrung der Mutter Gottes hervor.
Aber der Papst brachte auch Verständnis auf für die Anliegen der Jugend, besonders für die Kritik an der offiziellen Kirche. Es gebe manches zu kritisieren, es gebe immer wieder Ärgerliches und Schmerzliches, denn die Kirche sei eine Gemeinschaft von irrenden und sündigen Menschen. Dennoch rief Johannes Paul II. die Jugendlichen zu Verständnis für die Kirche auf: «Liebt eure Kirche!» Eingehend auf die Situation der Jugend in Liechtenstein, erklärte der Papst: «Liebe junge Freunde! Ihr lebt in einem wohlhabenden Land. Freut euch darüber, und nutzt die euch dadurch gebotenen Chancen. Seid euch jedoch zugleich der Verantwortung bewusst, die sich für euch daraus ergibt.» Materieller Reichtum sei an sich etwas Gutes, sagte der Papst weiter, solange wir nicht den Hunger der Seele in ihm ersticken. Weil man aber immer wieder
in Gefahr sei, abhängig zu werden von dem, was man besitze, müsse man ganz bewusst das Verzichten üben. Sein Appell, regelmässig zur Beichte zu gehen und sich in Verzicht zu üben, ganz besonders was die Sexualität betreffe, fiel wahrscheinlich nicht bei allen Jugendlichen auf Zustimmung. Nicht alle waren zufrieden, dass es keine Diskussion über kritische Fragen gab, dennoch glich die Begegnung zwischen Papst und Jugendlichen einer fröhlichen Feier mit Musik, Gesängen und modernen Rhythmen.
Bei seiner Ankunft hatte der Heilige Vater eine Halsschleife mit einer Aufschrift erhalten, die sowohl gelten sollte für diese Begegnung als auch Motto war für die Volksmission 1985 der liechtensteinischen Kirche: «Aufbruch zum Leben». Dieses Motto bedeute, erklärte dazu ein Jugendlicher, zu Christus, dem wahren Leben, zu den anderen und zur Gemeinschaft aller aufzubrechen: «Wir wollen bei diesem Aufbruch im Glauben wachsen.»
Ein grosser Erdball, der über die Köpfe der Jugendlichen bewegt wurde, sollte ein Symbol sein für die Verantwortung der Menschheit für die ganze Welt. Was dem Papst verborgen blieb, weil in das Vorprogramm verwiesen, war eine «Reise» um die Welt, die in der Arktis begann. Die kälteste Zone der Erde war als Start ausgewählt worden, weil viele der Jugendliche eine bestimmte Wärme in der katholischen Kirche vermissten. «Wir sehnen uns danach», lautete die Botschaft dazu, «das Packeis zu durchstossen.» Erstarrte Mauern und Gesichter, eingefrorene Gedanken seien nicht die richtige Atmosphäre, um Hoffnung zu schöpfen und um Gemeinschaft zu erleben. In Erinnerung geblieben von der Begegnung des Papstes mit den Jugendlichen sind weniger diese kritischen Gedanken als die fröhliche Stimmung, die an ein Volksfest erinnerte.
Kurz vor 20 Uhr hob ein Helikopter mit dem Heiligen Vater an Bord von Dux ab, laut verabschiedet von den Jugendlichen, die ihm mit ihren Schleifen zuwinkten und gute Reise zurück in den Vatikan wünschten. Zuvor hatte der heutige Fürst Hans-Adam II., damals noch Erbprinz Hans-Adam, dem Papst mit herzlichen Worten für seinen Besuch in Liechtenstein gedankt. Für Liechtenstein sei dieser Pastoralbesuch ein «historisches Ereignis». Eine Mehrheit anerkenne auch, mit Johannes Paul II. eine «historische Persönlichkeit» getroffen zu haben. Eingehend auf die Rolle des Heiligen Vaters als
kirchliches Oberhaupt in einer zunehmend individualisierten Welt, betonte Hans-Adam, bei seinen Auslandsreisen und Ansprachen habe Johannes Paul II. Aussagen gemacht, die oft unpopulär waren oder nicht dem Zeitgeist entsprachen. Und doch hätten viele Millionen in aller Welt zugehört. «Auch viele, die Sie nicht überzeugen konnten», wandte er sich direkt an den Papst, «haben Sie nähergebracht an den Glauben zu Gott.» In seinen weiteren Ausführungen ging Erbprinz Hans-Adam auf die Situation in der Welt ein und erklärte, die Menschheit lebe heute in einer Zeit des tiefen Wandels. Ideologien, die der Menschheit das Paradies auf Erden und eine absolute Gerechtigkeit versprochen hätten, erwiesen sich als gefährliche Illusionen. Deshalb könne man nur hoffen, dass es dem Heiligen Vater gelinge, mit seiner Botschaft möglichst viele Menschen anzusprechen und zu überzeugen.


Bei seinem Pastoralbesuch absolvierte Papst Johannes Paul II. ein dicht gedrängtes Programm. Nach der Fahrt mit dem «Papamobil» vom Helikopterlandeplatz durch die Menge der Gläubigen zelebrierte er zusammen mit Bischof Johannes Vonderach und Priestern aus Liechtenstein eine Messe.
Nach der Eucharistiefeier folgte in seiner Residenz, dem Pfarrhof in Bendern, ein Mittagessen mit dem liechtensteinischen Klerus.
Am Nachmittag begab sich der Papst mit Gefolge zum Schloss Vaduz, wo er mit dem Fürsten, dem Erbprinzen und weiteren Mitgliedern der fürstlichen Familien zusammentraf. Mit dabei auf Schloss Vaduz waren auch Vertreter von Regierung und Landtag.
Kurz vor 17 Uhr begab sich der Papst zur Pfarrkirche Vaduz, wo im Beisein von Kranken, Betagten und Behinderten ein Wortgottesdienst stattfand.
Um 18 Uhr erfolgte bei der Dux-Kirche in Schaan eine Begegnung mit der Jugend. Danach verabschiedetErbprinz Hans-Adam den Heiligen Vater. Der Helikopters zum Flughafen Zürich startete um 19.40 Uhr.
Der nachfolgende Beitrag von Klaus Biedermann erschien erstmals im Winter 2016 im Triesenberger Dorfspiegel. Für die Veröffentlichung in der «lie:zeit» hat der Autor seinen Beitrag aufgrund neuerer Forschungsergebnisse überarbeitet und aktualisiert.
Text: Klaus Biedermann
Als «Hintersassen» bezeichnete man Personen und Familien, die in einer Gemeinde heimatberechtigt waren, jedoch nicht –oder nur eingeschränkt – über den Bürgernutzen verfügten. Sie gehörten zur dörflichen Unterschicht. Ohne landwirtschaftliche Nutzungsrechte mussten Hintersassen ihre Heimatgemeinde zeitweise verlassen, um zu überleben.
Weshalb liessen sich Hintersassen trotz schwieriger Perspektiven auch in Triesenberg nieder? Für eine Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick sowohl auf die Gemeinde als auch auf nicht-sesshafte Familien. Gerade in ländlichen Gebieten waren Sesshafte und Herumziehende aufeinander angewiesen. Nicht-sesshafte Handwerker und Händler boten in den Dörfern ihre Dienstleistungen und Waren an. Für Triesenberg, erst ab 1868 durch eine befahrbare Strasse erschlossen, war dies besonders wichtig. Manche nicht-sesshafte Personen erhielten
dort, dank längeren oder wiederkehrenden Aufenthalts ein Heimatrecht zugesprochen. In diesem Beitrag werden Angehörige der Familien Kung, Knobel und Wagner vorgestellt. Diese Familiennamen sind in Triesenberg ausgestorben.
Aufnahme von Johann Jakob Kung als Hintersasse
Der Fall des Johann Jakob Kung (auch «Kumm» geschrieben) ist ein Musterbeispiel einer geregelten Hintersassen-Aufnahme. Johann Jakob Kung bat am 7. August 1791 das Oberamt in Vaduz um Aufnahme in den liechtensteinischen Untertanenverband: Er sei in Sagogn (Graubünden) geboren, sein aus Savoyen stammender Vater starb, als er (Kung) zwölf Jahre alt gewesen sei. Kung habe bei Landammann Johann Wachter in Vaduz als Knecht gedient, zudem sei er an verschiedenen Orten als Zimmermann und Schreiner tätig gewesen. Seit vier Jahren sei er mit der Triesenbergerin Katharina Sele verheiratet.

Korbflechterin Wilhelmina Wagner (1874–1943), heimatberechtigt in Triesenberg; unbekannter Fotograf. Quelle: Privat Klaus Biedermann, Vaduz.
Die Gemeinde Triesenberg unterstützte am 16. August 1791 das Anliegen des Bittstellers mit einem positiven Leumundszeugnis. Landvogt Franz Xaver Menzinger schickte am 21. August 1791 Kungs Gesuch mit Beilagen nach Wien, der Fürst stimmte am 20. September 1791 dem Gesuch zu. Kung wurde nun Liechtensteiner Untertan (Staatsangehöriger) und zugleich Hintersasse in Triesenberg. Johann Jakob Kungs Einkauf in den Staatsverband kostete ihn 25 Gulden Reichswährung. Dies entsprach etwa dem Wert von 125 Hühnern.
Familien Knobel und Wagner
Erleichterte die Heirat mit einer Triesenbergerin die Aufnahme von Johann Jakob Kung als Hintersasse, so war dies bei den Familien Knobel und Wagner schwieriger. Der 1757 in Tisis geborene Johann Georg Knobel ist bloss vorübergehend zwischen 1805 und 1811 als Hintersasse in Triesenberg nachweisbar. Knobel entstammte einer grösseren, unter anderem in Vorarlberg auftau-
chenden, über mehrere Generationen nicht-sesshaften Sippschaft.
Sein Sohn Josef Anton Knobel (1787–1853) heiratete am 6. Juli 1815 in San Vittore (Graubünden) die in Vorarlberg geborene heimatlose Magdalena Item. Die Frau war hochschwanger. Ihr Sohn Josef kam am 14. August 1815 in Fellengatter bei Frastanz zur Welt. Weitere Kinder wurden an verschiedenen Orten geboren: die Töchter Anna Maria Afra 1817 in Schnifis und Catharina 1821 nahe bei Bendern, der Sohn Johann Jakob 1823 in Satteins und die Töchter Crescentia 1832 und Magdalena 1840 in Triesenberg.
Das Oberamt in Vaduz diffamierte den als Kesselflicker tätigen Josef Anton Knobel im Jahr 1843. Er sei ein «dem Land in früheren Jahren zugewachsener Vagant, der auch die Legitimität seiner Ehe nicht gehörig auszuweisen im Falle ist». Tatsächlich war Knobel – wie erwähnt – mit seiner Frau 1815 nach San Vittore im Misox gewandert, um
dort zu heiraten. Der dortige Pfarrer Francesco Toschini vermählte Paare, die andernorts keine Ehebewilligung bekamen. Das hatte sich herumgesprochen, blieb indes höchst umstritten. Die Churer Bistumsleitung rügte Pfarrer Toschini und setzte ihn schliesslich ab. Doch bald ist zu lesen, dass Crescentia Knobel aus Triesenberg später gar beim Heiligen Stuhl in Rom heiratete.
Als sich Magdalena Item und Josef Anton Knobel meist in Triesenberg aufhielten, wurden sie 1842 zu Heimatberechtigten dieser Gemeinde, mit Einschluss der dort getauften Töchter Crescentia und Magdalena. Grundlage dafür war Paragraf 60 des Gemeindegesetzes von 1842: «Die dem Lande zugewachsenen fremden Leute, welche nicht mehr entfernt werden können, und die in früheren Zeiten aufgenommenen sogenannten Staatsbürger, welche nicht ausdrücklich einer bestimmten Gemeinde zugewiesen worden sind, werden als Hintersassen jener Gemeinde erklärt, in welcher jene bei Erscheinung dieses Gesetzes ihren ordentlichen Wohnsitz genommen hatten.»
Bereits ab 1817 waren Angehörige der Familie Wagner als Hintersassen in Triesenberg. Die Sie kamen wohl aus Oberschwaben. Der als Korbflechter, Schreiner und Seiltänzer tätige Johann Wagner (1812–1897) heiratete 1864 Agatha Bauer aus Lustenau. Diese Vorarlberger Gemeinde hatte zuvor der Gemeindekasse von Triesenberg 110 Gulden bezahlt, als Vorbedingung für Agatha Bauers Einbürgerung in Triesenberg. Diese Zahlung ermöglichte dem mittellosen Paar die Heirat. Agatha Bauer und Johann Wagner hatten sechs Kinder, darunter die Tochter Wilhelmina Wagner (1874–1943). Diese lernte – wie ihr Vater – die Korbflechterei, blieb aber von der kommunalen Unterstützung abhängig. Sie war nie wirklich akzeptiert in Triesenberg.
Man rief ihr Schimpfnamen nach, so auch «Schlegalbättleri», weil ihre Grosseltern unter dem Gemeindevorsteher Franz Josef Schlegel ein Heimatrecht in Triesenberg erhalten hatten.
Staatliches Heiratsverbot für Mittellose
Die Ausführungen zu den Familien Knobel und Wagner zeigen, dass Land und Gemeinden ärmeren Paaren ungern eine Heiratsbewilligung erteilten. Bereits 1804 legte Fürst Alois I. fest, dass für jede Eheschliessung eine Zustimmung der politischen Behörden nötig war. Der Staat konnte so mittellosen Paaren das Heiraten verbieten. In Zukunft musste jedes heiratswillige Paar ein gewisses Vermögen vorweisen. Mit dieser Anordnung wollte man verhindern, dass sich arme Leute unkontrolliert vermehrten und damit der Armenfürsorge zur Last fielen. Unverheiratete Paare, die Kinder zeugten, gab es trotzdem. Und diese Paare bemühten sich, wie angedeutet, nötigenfalls um eine Heiratsbewilligung im Ausland, denn die Folgen eines Konkubinats waren meist nur schwer erträglich.
Anna Maria Kirschbaumer, 1810 in Untervaz getauft und 1882 in Tisis verstorben, lebte von zirka 1830 bis 1846 im Konkubinat mit dem Triesenberger Hintersassen Josef Bauer. Das Paar hatte mehrere gemeinsame Kinder, so den Sohn Josef Kirschbaumer (1831–1897). Von ihm wird noch die Rede sein. Die Gemeinde Triesenberg weigerte sich, für diese mittellose Familie aufzukommen. Die lokalen Behörden drängten auf eine Abschiebung. Die Kirschbaumer waren spätestens ab 1842 als heimatberechtigte Hintersassen in Mauren anerkannt. Josef Bauer stellte fest: «Allein in meiner Gemeinde Triesenberg protestirte man gegen die Kirschbaumerin, die nach Mauren gehört, und die Maurer wollten wieder mich nicht.» Letztlich führte diese ausweglose Situation zur Trennung des Paares.

Heiratsurkunde aus Rom für Crescentia Knobel und Josef Bauer aus Triesenberg, datiert vom 23. Januar 1852, mit Nachtrag vom 24. Januar 1852. Quelle: Amt für Kultur, Liechtensteinisches Landesarchiv Vaduz, Signatur J 003/S 1854/26.
Eine Triesenbergerin heiratet in Rom
Der Vaduzer Landvogt Peter Pokorny hatte bereits 1828 beklagt, «liederliches Gesindel» fände «zu allen Zeiten sichere Zuflucht in Rom», um dort zu heiraten. Tatsächlich kümmerte sich die oberste Leitung der katholischen Kirche wenig um staatliche Eheverbote. Auf lokaler Ebene sah die Situation wiederum anders aus. Gemeinden und Pfarreien wehrten sich gegen Eheschliessungen von mittellosen Paaren. Sie wollten so darauf hinwirken, dass die Zahl der ihnen in Zukunft zur Last fallenden Fürsorgefälle möglichst klein bleibt.
Der erwähnte Josef Bauer – getrennt
von seiner Konkubine, jedoch mit Kindern – wollte im Jahr 1850 Crescentia Knobel heiraten. Diese war, wie erwähnt, eine Tochter von Magdalena Item und Josef Anton Knobel. Josef Bauer und Crescentia Knobel zogen nach Rom, wo sie 1852 im Petersdom kirchlich getraut wurden. Das Paar kam zurück mit einer auf Lateinisch geschriebenen Hochzeitsurkunde. Crescentia Knobel und Josef Bauer legten diese Urkunde sogleich dem Triesenberger Pfarrer vor. Das führte zu ihrer Verhaftung. Ihnen wurde die verbotene Eheschliessung im Ausland zur Last gelegt.
Weshalb nahm das Paar diese strapaziöse «Hochzeitsreise» auf sich,

um nach der Rückkehr gerichtlich belangt zu werden? Besonders nicht-sesshafte ledige Frauen wurden diffamiert, oft mit Prostituierten gleichgesetzt. Konnte eine solche Frau einen Trauschein vorlegen, so zeigte sie damit, dass sie in geordneten Verhältnissen lebte. Das war ein Vorteil im Verkehr mit den Behörden. Aufgrund eines guten Leumunds waren die Gefängnisstrafen für das erwähnte Paar eher mild: dreieinhalb Monate Arrest für den Schleifer Josef Bauer, drei Monate für seine Frau. Die als Besenbinderin tätige Crescentia Knobel wollte zudem die Kinder ihres Mannes unterstützen, doch wurde ihre Hilfe von diesen offenbar ausgenützt.
Die Ehe zwischen Crescentia Knobel und Josef Bauer selbst blieb kinderlos. Nach dem Tod Bauers 1861 wollte sein unehelicher Sohn Josef Kirschbaumer die verwitwete Crescentia Knobel heiraten. Die-
se war gleichaltrig, doch zugleich seine Stiefmutter. Die Behörden verboten Josef Kirschbaumer diese Eheschliessung. Crescentia Knobel selbst starb 1908 im Armenhaus in Triesen.
Noch im Tod ungleich
Der Triesenberger Pfarrer Matthäus Müller meldete am 10. Februar 1897 den Tod von Josef Kirschbaumer. Dieser hatte sich 30 Jahre zumeist in Triesenberg aufgehalten, er starb auf Fromahus. Der Triesenberger Gemeindevorsteher meldete tags darauf der Gemeinde Mauren, der Leichnam Kirschbaumers werde mittels Fuhrwerks in das dortige Armenhaus überführt.
Die Regierung in Vaduz fragte am 14. Februar 1897 die Verantwortlichen in Triesenberg, weshalb diese den Verstorbenen nicht an seinem Wohnort bestattet hätten. Gemäss einer Regierungsverordnung von
1873 seien die Gemeinden darüber hinaus verpflichtet, auf ihrem Gebiet Verstorbene auf dem eigenen Friedhof zu bestatten. Der Triesenberger Vorsteher erwiderte am 16. Februar 1897, man habe bereits zuvor die Gemeinde Mauren kontaktiert und diese über das vermutete baldige Ableben ihres Bürgers Kirschbaumer informiert. Die Unterländer Gemeinde habe darauf nicht geantwortet.
Pfarrer Matthäus Müller schrieb der Regierung am 20. Februar 1897: «Es stand zu befürchten (…), dass die kirchliche Beerdigung des verstorbenen Schleifers Joseph Kirschbaumer, dessen keineswegs gut katholische Lebensweise allgemein bekannt war, sehr viel Aufsehen und übles Gerede verursachen werde; wogegen in Mauren, wo der Lebenswandel des Verstorbenen weniger bekannt, solches nicht zu befürchten war.» An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Josef Kirschbaumer ein uneheliches Kind war. Unehelich Geborene wurden noch bis weit ins 20. Jahrhundert stigmatisiert und ausgegrenzt. Zudem war ihm, wie erwähnt, das Heiraten verboten worden.
Die Behörden in Mauren freuten sich nicht über die Ankunft von Kirschbaumers Leichnam. Der Triesenberger Vorsteher erwähnte in seinem Brief vom 16. Februar 1897 an die Regierung, die Gemeinde Mauren habe jetzt sehr gehässig reagiert, und er resümiert: «Der Stoff zum Schimpfen ist daher nicht ausgeblieben, und wird hier vielfach gejubelt, jetzt werden Pfarrer und Vorsteher [von Triesenberg] bestraft.»
Laut Rechnung vom 26. Dezember 1897 hatte die Gemeinde Triesenberg folgende Auslagen für Kirschbaumer gehabt: je fünf Gulden für Unterstützung während dessen Krankheit sowie für den Leichentransport, dazu fünfeinhalb Gulden für den von Schreiner Josef Beck angefertigten Sarg. Die Regierung
nahm eine vermittelnde Position ein. Sie verpflichtete mit Schreiben vom 27. Dezember 1897 die Gemeinde Mauren, die Kosten für Unterstützung und Sarg zu übernehmen. Für den Leichentransport würde die Gemeinde Triesenberg aufkommen.
Offizielle Aufhebung des Hintersassen-Status 1864
Mit dem Gemeindegesetz von 1864 war der Hintersassen-Status offiziell aufgehoben worden. Alle bisherigen Hintersassen erhielten die Option, sich in die Nutzungsrechte ihrer Heimatgemeinde einzukaufen. Dadurch hätten sie das volle Gemeindebürgerrecht erlangt, mit Anrecht auf landwirtschaftlichen Boden und auf Holz. Den meisten (ehemaligen) Hintersassen fehlte dafür das nötige Geld. So blieben sie Bürger zweiter Klasse in Liechtenstein. Ohne Gemeindenutzen blieben ihnen folgende Optionen: Weiterführen des traditionellen Handwerks (was zunehmend schwieriger wurde), Arbeit in der Textilindustrie, Dienst als Tagelöhner, Mägde und Knechte sowie die Auswanderung.
Literatur: Klaus Biedermann: «Aus Überzeugung, dass er der Gemeinde von grossem Nutzen seyn werde». Einbürgerungen in Liechtenstein im Spannungsfeld von Staat und Gemeinden 1809–1918. Vaduz, Zürich, 2012; derselbe: Die Folgen staatlicher Eheverbote für Betroffene in Liechtenstein. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, Band 121. Vaduz, 2022, S. 67–96.
Quellen: Amt für Kultur, Liechtensteinisches Landesarchiv, Vaduz; sowie Gemeindearchiv Triesenberg; diverse Akten; Johann Beck, Rütelti 370, November 1984: D‘ Wagneri (Wilhelmina Wagner), in: Heimelige Zeiten (t. T. auch harte Zeiten), 3. Teil. Red. Engelbert Bucher, Triesenberg, S. 34–36 (im Triesenberger Dialekt geschrieben). zudem: Tauf-, Heirats- und Sterbebücher aus Liechtenstein, Graubünden und Vorarlberg


Interkulturelles Fest
Samstag, 20. September 2025, ab 12 Uhr
Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen.
Ab 12 Uhr: Beste hausgemachte Speisen aus aller Welt
Ab 13 Uhr: Tanz und Musik auf der überdachten Bühne
Ab 14 Uhr: Ausstellung im Gasometer geöffnet
Das beliebte Fest der Kulturen im Innenhof der alten Fabrik beim Gasometer in Triesen bietet feinstes Essen und Getränke aus vielen Ländern, Musik, Tanz und Kunst auf der Bühne und im Gasometer!
Gasometer - Dorfstrasse 24 FL 9495 Triesen Tel +423 392 50 80
Alle Informationen: www.gasometer.li
Seit über 50 Jahren Erfahrung in:
• Allgemeine Malerarbeiten bei Alt- und Neubauten
• Individuelle Wandgestaltungen
• Fassadenrenovationen
• Risssanierung

ZAUBERSHOW «ABNORMAL» MIT DANINI
Freitag, 26. September 2025, 20.00 Uhr
Reservation www.kulturhaus.li

Ihr kreativer Maler für ihre speziellen Wünsche –für Innen- und Aussenbereich.






Jetzt nur
Da ist mehr drin! Mit der FL1 Superkombi bekommen Sie Mobile, Internet und Fernsehen aus einer Hand aus Liechtenstein - und das jetzt schon ab CHF 49.90 pro Monat!
Sie haben bereits Internet und TV von uns, aber noch kein Mobile-Abo? Dann wechseln
Sie jetzt zu FL1 und sichern Sie sich zusätzlich bis zu CHF 200.– Gutschrift, wenn Sie Ihre bestehende Liechtensteiner (+423) oder Schweizer (+41) Mobilnummer mitnehmen.
Mehr Infos erhalten Sie unter +423 237 74 00 oder direkt im neuen FL1 Shop in Vaduz, Schaanerstrasse 1.