
9 minute read
Der Chef auf dem Platz
«Wir Schiris sind komische Vögel»
Als junger Profischiedsrichter im Fussball darf Sandro Schärer seine Autorität von niemandem untergraben lassen. Neben dem Platz musste er jedoch lernen, Schwäche zuzulassen.
Text: Dario Aeberli Bilder: Benjamin Soland
Was machen Sie als Letztes, bevor Sie aufs Spielfeld gehen? Ich schaue kurz in den Spiegel. Kontrolliere, ob alles in Ordnung ist, mein Trikot sitzt. Warum ist Ihnen das wichtig? Ich muss selbstbewusst sein auf dem Platz. Ich habe eine klare Routine vor dem Match, damit ich erfolgreich arbeiten kann. Was beinhaltet diese Routine? Das fängt beim Kofferpacken an: Zuerst mein Schiritrikot rechts, links Stulpen und Hosen, dann der Pullover darüber und zuletzt die Schuhe. Im Stadion ziehe ich immer zuerst den rechten Stulpen an. Wenn ich fürs Aufwärmen auf den Platz gehe, schaue ich zuerst das rechte und dann das linke Tor an. Automatisch. Was machen Sie in der Kabine vor dem Spiel? Da bin ich mit meinen Assistenten zusammen. Wir reden nicht viel. Der eine hört Musik, mit anderen tschüttele ich ein bisschen. Dann macht ein Mitarbeiter des Verbands einen Countdown, klopft an die Tür; noch fünf Minuten, noch eine, jetzt geht es los. Bevor wir rausgehen, umarme ich jeden Kollegen. Ich will sie spüren, wissen, wie es ihnen geht. Sagen Sie etwas zu ihnen? Ja, ich bitte sie darum, mich zu beschützen. Sie sind mein Team, meine Familie auf dem Platz, und können mich retten, falls ich mal versagen sollte.
Rennen sie auf den Platz, wenn Sie bedrängt werden? Sehr selten. Viel wichtiger ist die Kommunikation, die mentale Unterstützung. Meldungen wie «Es ist alles okay, bleib ruhig.» helfen mir. Sie hören über das Mikrofon und den Knopf im Ohr, wenn ich vor mich hinfluche. Manchmal sagen sie auch, ich soll mich zusammenreissen. Wie beruhigen Sie Spieler? Ich muss einschätzen: Wie funktioniert mein Gegenüber? Und

Gehört zu den 30 besten Schiedsrichtern der Welt: Sandro Schärer im Zürcher Letzigrund-Stadion
«Manchmal reicht ein böser Blick oder ein Witz, um den Spieler zu beruhigen.»
dann muss mir sehr bewusst sein, wie ich gerade wirke. Verbal, nonverbal, mit Gestik, Mimik. Manchmal reicht ein Augenzwinkern, manchmal ein böser Blick oder ein Witz. Ich muss eine breite Klaviatur von Emotionen erkennen und bespielen können. Diskutieren Sie gern mit Spielern? Nein. Ich habe früher viel erklärt, doch das bringt nichts. Es zieht nur weitere Diskussionen nach sich. Heute rede ich nur noch, wenn es mir einen Vorteil bringt, der Spieler sich beispielsweise beruhigt. Ansonsten schiebe ich einen Riegel und sage, er soll nach dem Spiel zu mir kommen. Möchten Sie von Spielern und Trainern gemocht werden? Nein. Meine Aufgabe ist es, Entscheide zu treffen. Was finden Sie auf dem Spielfeld das Schlimmste? Rudelbildungen, wenn sich alle anpöbeln und schubsen. Die Auswirkung solcher Szenen auf den Junioren- und Amateurfussball ist nicht zu unterschätzen. Viele Kinder sehen das am TV und benehmen sich auf dem Platz dann genauso. Wann zücken Sie die gelbe Karte fürs Reklamieren? Sobald es ansteckend ist für die Zuschauer oder andere Spieler. Wenn einer nach einem Entscheid grosse Gesten macht oder rumschreit und damit meine Autorität untergräbt, hat das Konsequenzen. Sonst beschweren sich plötzlich alle. Einer Ihrer Schiedsrichterkollegen hat mal gesagt: «Schiedsrichter sind schlechte Fussballer, die sich weitergebildet haben.» Trifft das auf Sie zu? Meine Freunde werden lachen, wenn sie das lesen: Aber ich finde, ich kann relativ gut Fussball spielen. Waren Sie für den Schiri ein mühsamer Spieler? Absolut, ich habe viel gemotzt und war ein sehr unangenehmer Spieler. Eigentlich bin ich das heute noch, weil ich immer gewinnen will – auch, wenn ich Pingpong spiele oder jasse. Stimmt es, dass Sie Schiedsrichter wurden, weil Ihr Vater sagte «Du motzt so viel, zeige, dass du es besser kannst!»? Ja. Mein Nachbar war Schiedsrichter, und sein Sohn, ein Freund von mir, wollte sich für einen Schirikurs anmelden. Mein Vater und mein Nachbar sagten, ich soll mitgehen. Eigentlich wollte ich nicht, ich war erst 15 und dachte, Schiris seien komische Vögel. Gut, sind wir auch. Man braucht ein spezielles Gen, ein Talent, um Schiri zu sein. Die meisten hören entweder nach einem Jahr auf oder sind es ein Leben lang. Schon mit 16 pfiffen Sie Spiele von Erwachsenen. Woher nahmen Sie den Mut dafür? Das frage ich mich heute selbst. Bei meinem allerersten Spiel als Schiri war ich gleich alt wie die Spieler – aber zwei Köpfe kleiner. Als Landei aus Buttikon war ich plötzlich allein in der Zürcher Agglo. Ich war nie mehr so nervös wie vor diesem Spiel. Ich dachte: Die fressen mich auf. Doch das Spiel lief super, ich habe mein Ding durchgezogen. Die 15-Jährigen waren sonst Schiris gewohnt, die nicht besonders engagiert sind, sich wenig bewegen. Als ich dann über den Platz sprintete und gestikulierte, hatten die einen Riesenplausch. Sie sahen, dass ich mir Mühe gab, und verziehen mir Fehler. Ich glaube, ich bin mehr gerannt als die Spieler. Wie weit rennen Sie denn während eines Spiels? Etwa 11,5 Kilometer. Wann war Ihnen klar, dass Sie Profi-Schiri werden wollten? Schon nach meinem ersten Spiel rief ich einen Freund an und sagte: Ich will Profischiedsrichter werden – und werde das
ins Bundeshaus.

Ich bin dabei.




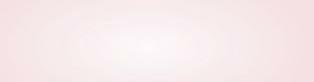

auch schaffen. Ich spürte: Da liegt etwas drin, ich habe Talent dafür, dazu bin ich berufen. Im Moment geniesse ich das Privileg, Geld mit dem zu verdienen, was mir Spass macht. Schiedsrichter ist mein Traumjob. Auch wenn Sie deutlich weniger verdienen als die Spieler? Ja. Ich kenne meine Rolle. Als Schiri habe ich kein Merchandising, keine Sponsoren. Letztlich locken die Spieler die Menschen vor den TV und bringen das Geld. Zudem sind in der Schweiz die wenigsten Spieler Millionäre. In Spanien oder Deutschland ist das anders. Dort verdienen auch Schiedsrichter bis zu 5000 Franken pro Spiel, in der Schweiz bekommen wir 1250 plus Reisespesen. Sie haben früher als Lehrer gearbeitet. Kehren Sie dereinst ins Klassenzimmer zurück? Vielleicht. Mir war es wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Im Moment arbeite ich am dritten. Ich würde gern junge Sportler coachen. Ich war zu Beginn meiner Karriere oft orientierungslos und hätte jemanden gebraucht, der mir beratend zur Seite steht. Sie pfeifen alle drei Tage ein Spiel. Laugt Sie das nicht aus? Obwohl bereits die neue Saison begonnen hat, habe ich die alte noch nicht verarbeitet. Manchmal ist es wie in einem Hamsterrad. Während des ersten Lockdowns ging ich in den Bergen wandern, und plötzlich schossen mir die atemberaubenden Bilder aus dem Old Trafford in Manchester durch den Kopf, diesem Riesenstadion. Ich hoffe, dass ich im Winter einige dieser Bilder bei mir ablegen, einordnen kann. Sonst holt mich das irgendwann ein, auf eine unangenehme Art. Haben Sie Angst, auszubrennen? Dieses Gefühl kenne ich. Immer wenn ich das letzte Mal pfeife, die Saison fertig ist, ich heimkomme und die Spannung von mir abfällt, habe ich ein Tief. Mental und emotional. Wie schaffen Sie es aus diesem Tief wieder heraus? Ich musste lernen, dass diese Tiefs normal sind. In der Sommerpause hatte ich null Bock auf Fussball. Ich bin erschrocken und dachte: Das darf nicht sein, das ist mein Job. Es brauchte Zeit, bis ich mir sagen konnte: Du warst gerade vier Monate lang jede Woche in einer anderen Stadt, hast sehr anspruchsvolle Spiele geleitet, hart trainiert. Jetzt ist es okay, dass du drei Tage auf dem Sofa liegst und keine Lust hast.
Sandro Schärer ist mit 34 Jahren bereits der beste Fussballschiedsrichter der Schweiz. Seit er 25 Jahre alt ist, pfeift er in der höchsten Liga des Landes. Seit 2022 gehört er zu den 30 besten Unparteiischen der Welt – für die Weltmeisterschaft in Katar musste er aber zehn Europäern mit mehr Erfahrung den Vortritt lassen.
Hätten Sie sich das früher auch zugestanden? Mit 25 Jahren konnte es mir nicht schnell genug gehen. Ich wollte immer weiter aufsteigen. Als ich dann in der höchsten Liga angekommen war, hatte ich einen Durchhänger, ging nicht mehr mit der richtigen Einstellung auf den Platz. Darunter litten meine Leistungen. Haben Sie Menschen, die Ihnen aus solchen Tiefs heraushelfen? Ja, meine Schiedsrichterassistenten. Mit ihnen kann ich in den Pausen Dampf ablassen. Dafür habe ich noch keine Routine, das ist meine grosse Schwäche. Ich denke immer gleich an den folgenden Match, statt mir einfach mal einen Coupe Dänemark zu gönnen. Vor einem Jahr erzählte der ehemalige deutsche Schiedsrichter Babak Rafati, dass er wegen des ständigen Drucks in eine Depression rutschte und versuchte, sich das Leben zu nehmen. Ist das ein Thema unter Unparteiischen? Ich glaube, die mentale Gesundheit ist nicht nur bei Schiris, sondern in der ganzen Gesellschaft ein Thema, das vernachlässigt wird. Als das mit Rafati geschah, war ich Mitte 20 und konnte mir nicht vorstellen, wie er an diesen Punkt gekommen war. Heute verstehe ich besser, dass der Druck, Leserkommentare oder Kritik in den Medien einen krank machen können. Wie gehen Sie damit um? Ich lasse das nicht an mich heran. Wenn ich wollte, könnte ich über Social Media eine Flut an Feedback erhalten – in meinem Fall wohl grösstenteils negatives. Ich habe darum keine SocialMedia-Konten. Sonst würde auf mich eingeprügelt, es gäbe einen Shitstorm nach dem anderen. Als Schiri habe ich ohnehin keine Fans – abgesehen von meinem engen Umfeld, natürlich. Wessen Feedback ist Ihnen wichtig? Ich habe einen Coach im Stadion, einen vor dem TV und mein Team auf dem Feld. Sie alle sind vom Fach und geben mir konstruktive Kritik. Obwohl Sie aktuell der beste Schweizer Schiedsrichter
«Schiedsrichter zu sein, ist mein Traumjob.»
sind, wurden Sie für die WM in Katar nicht aufgeboten. Wieso nicht? Ich bin noch zu jung, zu wenig erfahren. Die Schiedsrichter, die es an die WM geschafft haben, haben ihre Sporen schon lange abverdient. Deshalb habe ich auch nicht mit einer Nomination gerechnet. Werden Sie die WM schauen? Klar. Ich schaue auch während der Saison so viele Spiele wie möglich. Zur Unterhaltung? Nein, als Weiterbildung. Ich habe mal gelesen: Um in irgendwas Profi zu werden, muss man 12000 Stunden dafür investieren. So viele Stunden zu pfeifen, schaffe ich in diesem Leben nicht. Wenn es am TV eine heikle Szene gibt, überlege ich, wie ich entschieden hätte, und versuche, das abzuspeichern. Wenn ich selbst im Einsatz bin, muss ich dann weniger überlegen. Die WM in Katar ist wegen des dortigen rigiden Regimes sehr umstritten. Schauen Sie das Turnier mit einem schlechten Gewissen? Nein, ich differenziere da zwischen Sport und Politik. Ich bin viel herumgekommen, und mit den Gesellschaftsformen, die wir hier leben – mit Gleichstellung von Mann und Frau, Menschenrechten – sind wir auf der Welt noch in der Minderheit. Wir können nicht verlangen, dass es beispielsweise in Katar von heute auf morgen auch so sein wird. Das ist ein Prozess. In SaudiArabien habe ich schon mehrmals gepfiffen. Heute fahren Frauen dort Auto, sitzen im Stadion. Das klingt für uns unspektakulär, ist aber trotzdem ein Fortschritt. Und Fortschritt erhoffe ich mir auch in Katar – darum schaue ich diese WM auf jeden Fall. Um dann bei der nächsten 2026 in Kanada, USA und Mexiko selbst dabei sein zu können? Ja, das ist mein grosses Ziel. MM








