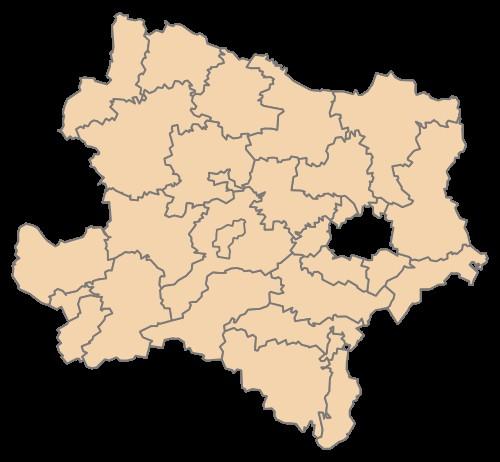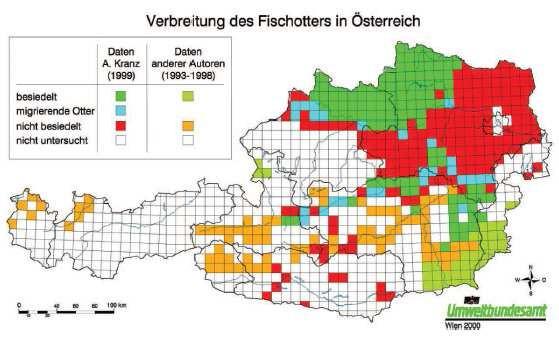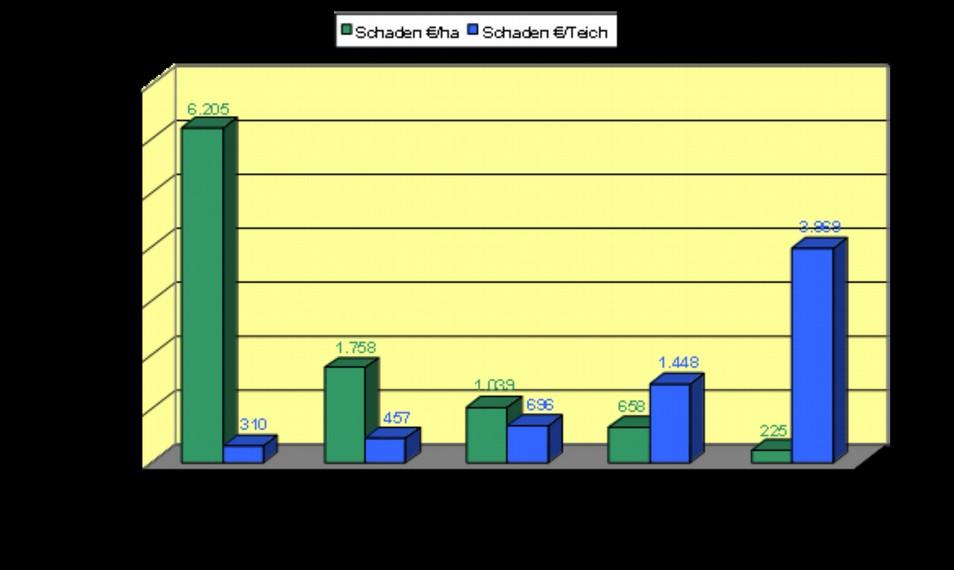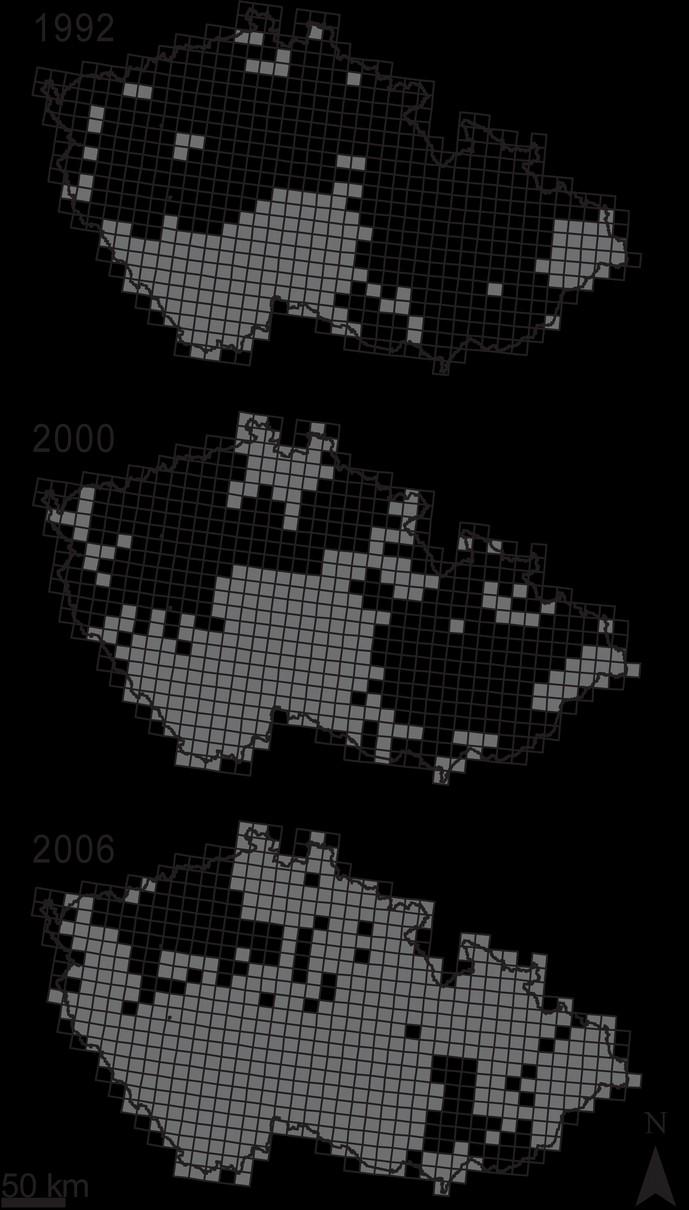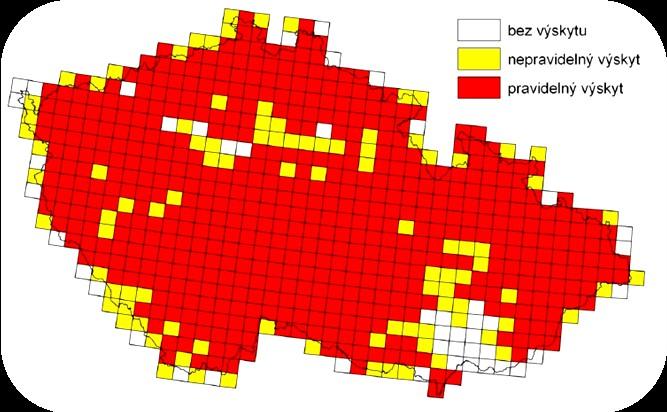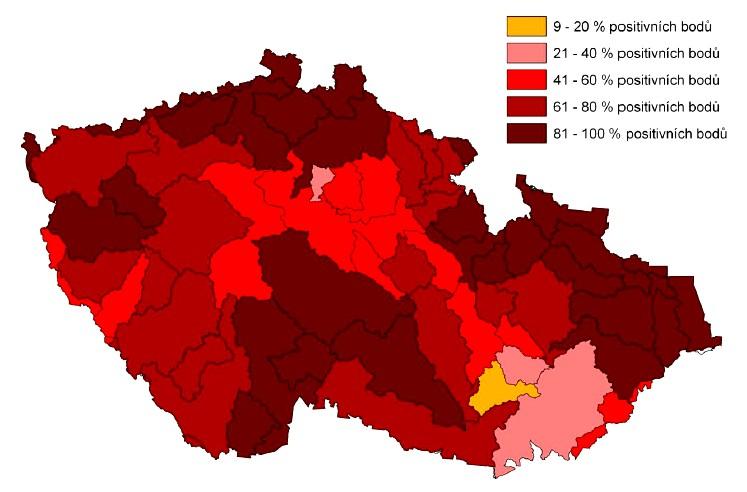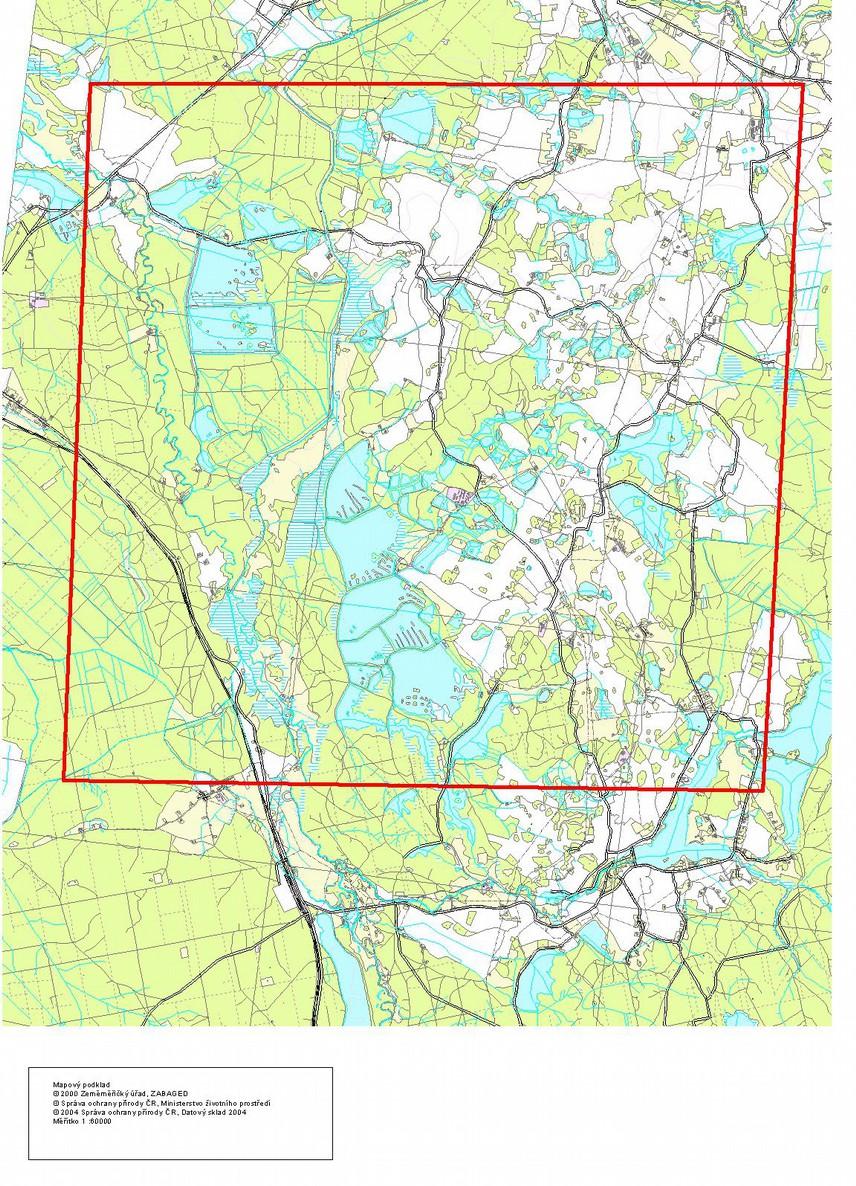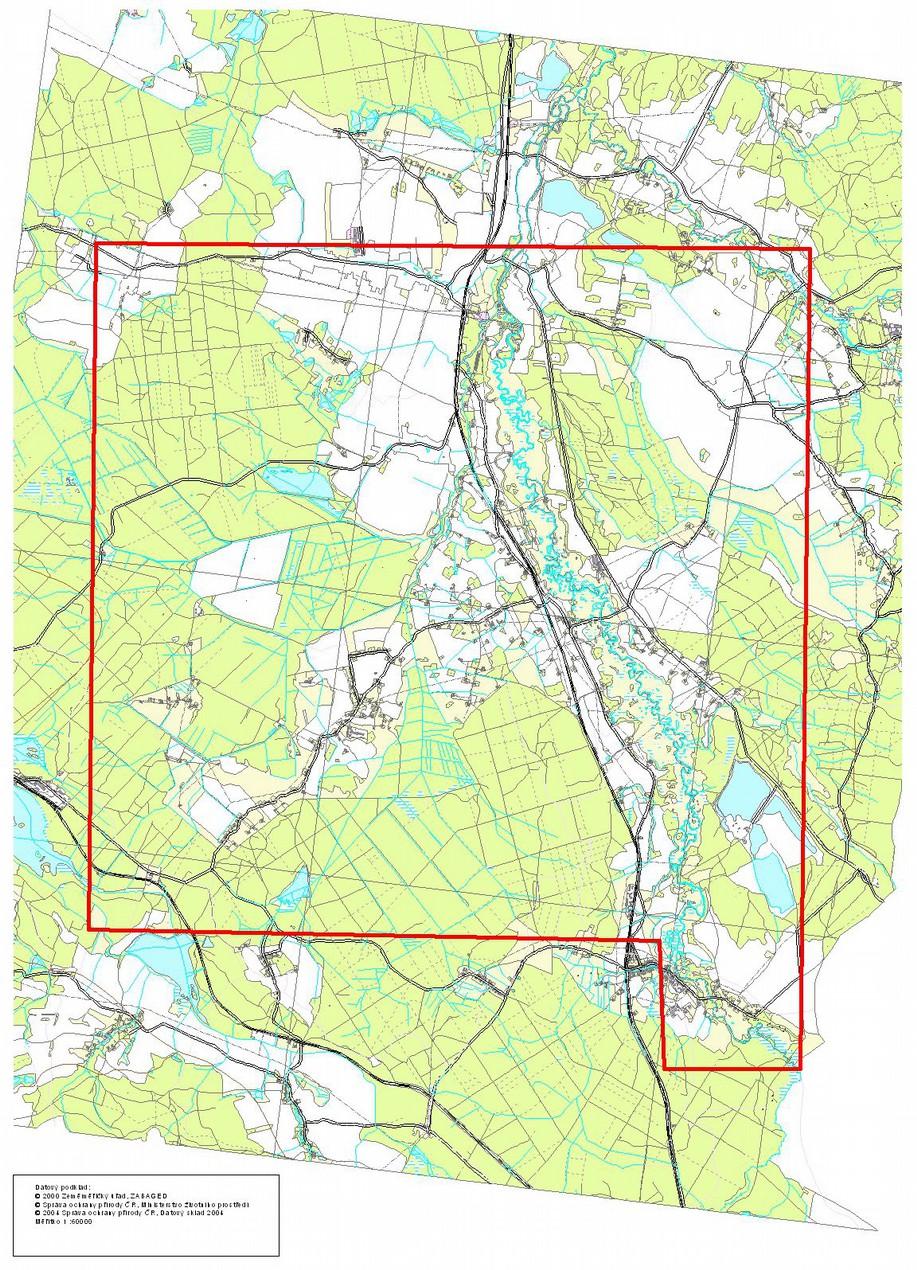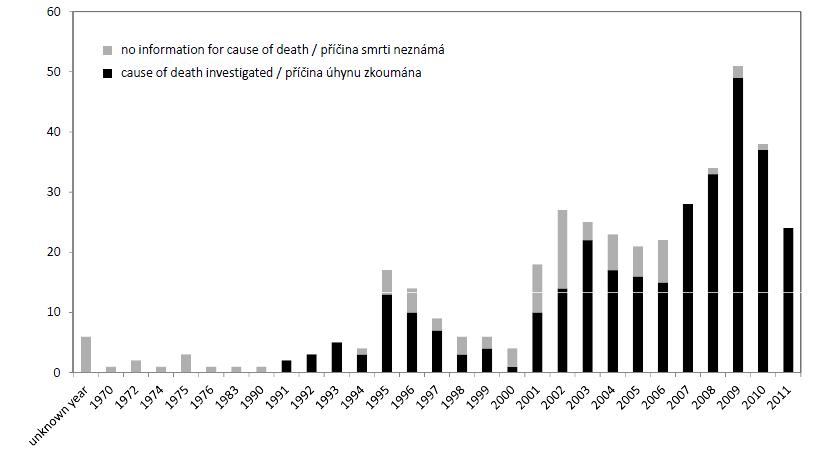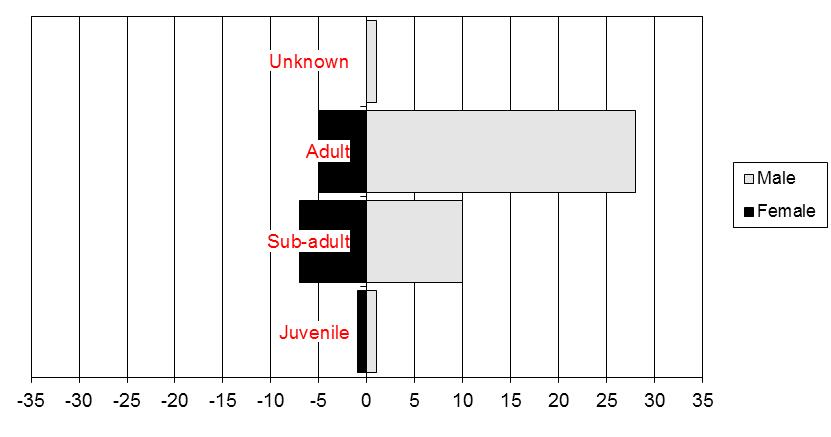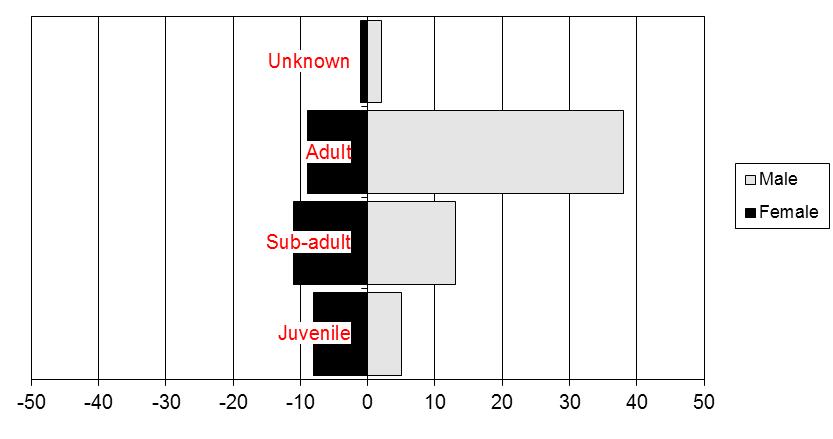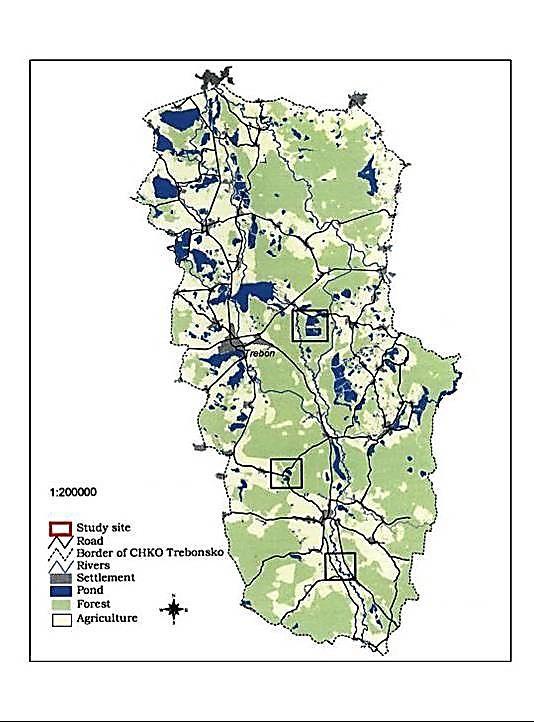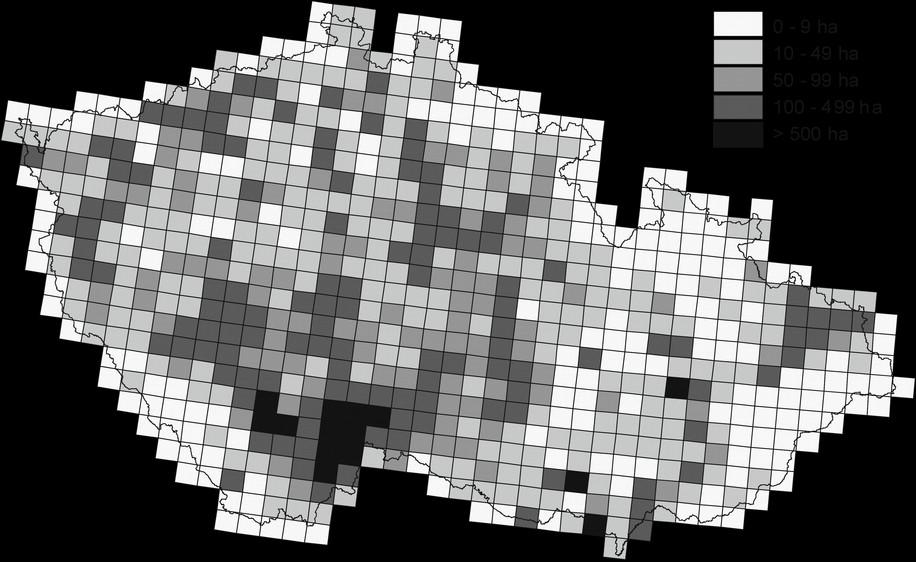Synopse Fischotter
Teil III
Südböhmen und Böhmisch-Mährisches Hochland
Kevin Roche
Übersetzung aus dem Englischen: Christian Bauer, Markus Böhm
39
Gesetzlicher Schutz
Auf Grund von wachsenden Hinweisen auf ein Schrumpfen der Population wurde der Fischotter seit 1956 in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik unter Schutz gestellt (primär durch Beschränkungen der Jagd). Nach den politischen Umwälzungen 1989 wurde dem Fischotter weiterer Schutz zuteil, vor allem nach der Entstehung der Tschechischen Republik und dem Beitritt zur Europäischen Union.
Nach dem Dekret 395/1992, welches das tschechische Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft (114/1992) umsetzt, gilt der Europäische Otter (Lutra lutra) in der Tschechischen Republik als stark bedrohte Art. Mit dem Rechtsakt 114/1992 übernimmt die Tschechische Republik die Anforderungen der Berner Konvention und der EU Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (RL 92/43/EWG) in nationales Recht. Das Gesetz verbietet den Fang, das Töten und/oder das Stören der gelisteten Arten (der Otter findet sich im Anhang 2), sowie die Zerstörung oder Störung ihres Lebensraumes. Der Otter ist darüber hinaus in der (IUCN) Tschechischen Roten Liste als gefährdete (vulnerable) Art gelistet (Anděra & Červený, 2005)
Der Otter wird im nationalen tschechischen Jagdgesetz als geschützte , ganzjährig geschonte Art geführt. Obwohl nicht explizit ausgeführt impliziert das, dass Otter als Fallwild der lokalen Jagdgesellschaft gehören.
Im Prinzip ist es möglich den strikten Schutzstatus des Otters zu ändern (temporär oder permanent) unter der Voraussetzung, dass es keine befriedigende Alternative gibt und es nicht nachteilig für die Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes im natürlichen Verbreitungsgebiet ist. Im Falle von kritisch oder stark bedrohten Arten (wie dem Otter) könnten Ausnahmen vom Tschechischen Umweltministerium oder regionalen Verwaltungsbehörden, mit Zuständigkeiten für bedrohte Arten, erlassen werden. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder diesbezüglich Anträge gegeben hat, wurden bis heute keine Ausnahmeregelungen erlassen. Entschädigungen für Schäden, die von geschützten Arten, einschließlich Otter, verursacht werden, sind im Gesetz 115/2000 geregelt (zuletzt geändert 2001, 2002 und 2006).
Ökologie Verteilung und Anzahl der Otter
Die Tschechische Republik ist eines der wenigen europäischen Länder, das mehrere nationale Untersuchungen der Anwesenheit von Ottern, basierend auf der standardisierten Technik, welche
40
von der IUCN Otter Specialist Group (Reuter et al. 2000) empfohlen wird. Ungefähr alle fünf Jahre werden Untersuchungen zum Fischotterbestand durchgeführt. Dabei werden von Experten oder geschultem Personal vier bis sechs Stellen (Brücken, Teiche, Flussmündungen,...) innerhalb eines 11,2 x 12 km Planquadrates des tschechischen nationalen Kartenrasters S-JTSK untersucht, an denen Zeichen von Ottern (Fährten, Losungen) erwartet werden können. Es wird bis zu 300 m entlang des Ufers von Flüssen/Bächen bzw. Teichen nach Spuren gesucht. Werden nach dieser Distanz keine Spuren gefunden, so wird die Stelle als negativ (kein Nachweis des Fischotters) markiert. Dies ermöglicht nicht nur den Nachweis vonAnwesenheit oder Fehlen des Otters, sondern auch einen groben Hinweis auf die Otterdichte. In den letzten Jahren haben sich die Untersuchungen auf Gebiete konzentriert, die bisher spärlich besiedelt oder gänzlich frei von Ottern waren. Kerngebiete werden als kontinuierlich besiedelt angesehen (Poledník et al. 2007b).
Nach historischen Jagdberichten, waren Fischotter noch im 19. Jh. in der ganzen Tschechischen Republik präsent. Anzeichen für ein Schrumpfen der Population gab es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Trotzdem wurden die Otter intensiv bejagt. Diese Zeit brachte zudem einen Niedergang der Teiche und die Fließgewässer wurden erstmals in großem Stil bewirtschaftet (Anděra & Kokeš, 1994). Die große Anzahl an getöteten Ottern vermittelte aber den Eindruck, dass Fischotter zu dieser Zeit noch zahlreich und weit verbreitet waren (Baruš & Zejda, 1981).
Zunehmende Hinweise für einen Rückgang der Population führten zum gesetzlichen Schutz. Trotzdem gingen die Zahlen weiter zurück, dieses mal auf Grund der zunehmenden Zerstörung und Verschmutzung der Habitate und Lebensräume. In den späten 70er Jahren war die Population in zwei Sub-Populationen aufgetrennt. Ein Schwerpunkt lag im Bereich der Südböhmischen Teiche und im dortigen Grenzgebiet bis nach Österreich. Kleinere Populationen fanden sich im Grenzgebiet Tschechien/Slowakei/Polen (Hájková et al., 2007) und im Norden an der Grenze zu Deutschland. Im Jahr 1992 wurde, als Basis für zukünftige Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen, eine erste große, auf Spuren im Freiland basierende, Untersuchung durchgeführt.
Die Schätzungen über die Anzahl der Fischotter in der Tschechischen Republik schwanken beträchtlich, abhängig davon wen man fragt. Im Jahr 1998 setzte die staatliche Naturschutz Agentur die Zahl der Otter mit 600 – 700 Exemplaren an, während die Union der Angler von 1.380, die Fischzüchter Vereinigung gar von 1.710 Tieren ausging (Adámek et al. 1999). Zum Vergleich: Die Anzahl der Otter wurde vor 1978, basierend auf einer Umfrage, auf nur 174 Individuen geschätzt, mit einer deutlichen Konzentration in Südböhmen, auf Grund der vielen Fischteiche, nicht verschmutzten Flüsse und der guten Nahrungsversorgung (Baruš & Zejda, 1981). Im Jahr 1980, wurde die Zahl mit 330-350 Tieren geschätzt, wiederum mit einer Konzentration in Südböhmen
41
(Kučera, 1980).
Gleichzeitig mit der Zunahme der Otterpopulationen in ganz Europa, erholten sich auch die Bestände in der Tschechischen Republik ab den beginnenden 90er Jahren. Die nationale Untersuchung für das Jahr 2000 ergab eine deutliche Ausbreitung, wobei sich die Quadrate mit Nachweisen zwischen 1992 und 2003 nahezu verdoppelten (Roche et al., 2004, Abb. 1). Die größte Expansion schien in nord-östlicher Richtung, quer durch das Land ins Böhmisch-Mährische Hochland, stattgefunden zu haben (Abb. 1). Die Gründe für die Erholung sind: verbesserter gesetzlicher Schutz, Lebensraumverbesserung, Reduzierung der Verschmutzung und eine Zunahme der Teichwirtschaft, vor allem Hobbyteichwirtschaften im Böhmisch-Mährischen Hochland. Zur selben Zeit dürften Fischotter über die polnische Grenze zugewandert sein (Abb. 1). In einem Versuch, die Wiederbesiedelung zu unterstützen, wurde eine kleine Anzahl von gesund gepflegten verletzten Ottern sowie in Gefangenschaft aufgezogene Tiere ausgewildert. Diese Maßnahmen im Nordosten des Landes wurden von der staatlichen Agentur für Natur- und Landschaftsschutz (AOPK ČR) durchgeführt (Hlavac et al. 1998).
Basierend auf der Untersuchung von 2000 und mit dem Wissen bezüglich der Otterdichten in verschiedenen Habitattypen in Südböhmen, welche mittels snow-tracking (Spurensuche im Schnee) (Kučerova und Roche, 1999) und genetischen Analysen von Losungen (Hájková et al., 2009) gewonnen wurde, kann die Anzahl der Fischotter mit Ende der 90er Jahre auf 800 – 1.100 Individuen geschätzt werden. Die höchste Dichte wurde im Bereich der einmaligen Konzentration von großen Teichen im Südböhmischen Biosphärenreservat von Třeboň gefunden. Die Otterdichte nimmt signifikant mit der Entfernung zu diesem Gebiet ab.
Unabhängig davon, berechneten Poledník et al. (2005) die Anzahl der Fischotter für die Erhebung aus 2000 nach ihrer eigenen Methode (Abschätzen der Anzahl mittels snow-tracking in sieben 10 x 10 km großen Quadraten in verschiedenen Teilen des Landes, allerdings nicht in der Südböhmischen Teichregion!). Die Anzahl der Tiere schwankte zwischen 1 und 28 Individuen pro Quadrat. Anschließend verglichen sie diese Zahlen statistisch mit einer Anzahl von Faktoren und entschieden sich dafür, dass die Länge an Teichufern in jedem Quadrat die Variation der Daten am besten beschreibt. Nach der Aufstellung einer Korrelation der Anzahl an Fischottern in einem Quadrat gegen die Länge der Teichufer im selben Quadrat, berechneten die Autoren die Anzahl der Fischotter im Land an Hand der Teichuferlänge in jedem besiedelten Quadrat, das die Untersuchung von 2000 auswies (Poledníková et al. 2006). Mit dieser Methode berechnet sich die Otterpopulation für 2000 mit 1.600 – 2.000 Tieren. Das ist deutlich höher als die Zahlen von Kučerova et al. (2001) und auch höher als die Daten der Tschechischen Otter Foundation für 2005 (1.200 – 1.500; siehe
42
auch Kortan et al. 2007). Darüber hinaus schlagen die Autoren vor, dass die carrying capacity (Tragfähigkeit des Lebensraumes) für den Fischotter in vielen Teilen des Landes erreicht ist. Diese Korrelation wurde auch für die aktuelle Methode zur Abschätzung der Schäden verwendet (siehe weiter unten) und auch für die Bestandsaufnahme der Fischotterpopulation in 2006.
Die Fischotterbestandsaufnahme von 2006 zeigt eine deutliche Expansion in viele Richtungen, so dass alle, ursprünglich getrennten, Meta-Populationen nun wieder verbunden sein dürften. Zeichen von Fischottern wurden in 75 % der Kartenquadrate nachgewiesen, wobei in 60 % eine permanente und in 15 % zumindest eine zeitweilige Anwesenheit nachgewiesen wurde (Poledínk et al. 2006).
Die letzte Bestandsaufnahme von 2011 zeigt einen Nachweis in 92 % der Quadrate, 63 % mit ständigem und 32 % mit zeitweiligem Vorkommen (Abb. 2). Trotz des sich ausbreitenden Vorkommens, der Kern der Population mit hohen Dichten ist nach wie vor das Südböhmische Teichgebiet und die Grenzregionen zu Deutschland und Polen. An den Rändern dieser Zonen und dazwischen sind die Individuendichten deutlich geringer (Abb. 3). Obwohl für die Bestandsaufnahmen von 2006 und 2011 keine Schätzungen über die Individuenzahlen vorliegen, ist es wahrscheinlich, dass die Anzahl der Tiere zwischen 2000 – 2006 nicht wesentlich zugenommen haben dürfte. Neu besiedelte Lebensräume außerhalb der Kernzonen sind oft weniger optimal (z.B. geringer Nahrungsverfügbarkeit) und können daher vergleichsweise wenige Tiere beherbergen.
Eine aktuelle statistische Analyse der wesentlichen Änderungen in der Landnutzung, die die Expansion der Fischotterpopulation fördert ergab, dass ein starker Zusammenhang zwischen der positiven Entwicklung der Fischotterverbreitung und zwei wesentlichen Änderungen in der Umwelt Tschechiens seit den 1990er Jahren besteht (Marcelli et al. 2012). Diese Veränderungen sind:
a) Die Reduktion der intensiven Landwirtschaft und die damit einhergehende diffuse Verschmutzung der Fließgewässerökosysteme.
b) Die Reduktion der punktuellen Verschmutzung durch Industrie und urbane Gebiete.
Das begünstigte eine breite Wiederbesiedlung urbaner Landschaft durch den Fischotter. Die Beständigkeit des Vorkommens und die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung war in der Landschaft stark mit der Anzahl der Süßwasserhabitate und damit letztlich mit dem Nahrungsangebot verknüpft. Generell war der Einfluss der landwirtschaftlichen Nutzung auf die Fischotterpopulationen beständiger und höher als jener von Industrie und urbanen Gebieten. Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass sich der Fischotterschutz in großem Maßstab auf die Sanierung und Renaturierung von Gewässerlebensräumen, vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, konzentrieren soll.
43
Zusammenfassung
• Die minimale Anzahl an Fischotter in der Tschechischen Republik vor 1978 wurde mit nur 174 Individuen angegeben, wobei der Schwerpunkt in Südböhmen lag. Im Jahr 1980 wurden die Zahl der Fischotter mit 330 – 350 Tieren geschätzt. Im Jahr 1992 bildeten die Fischotter drei Meta-Populationen, mit der stärksten in der südböhmischen (österreichischen) Teichregion.
• In der Tschechischen Republik wurden vier nationale Bestandsaufnahmen (1992, 2000, 2006, 2011) mit einer standardisierten Methode durchgeführt. Wie im restlichen Europa, erholten sich die Fischotterbestände in der Tschechischen Republik seit den 1990er Jahren.
• Heute deckt die Fischotterpopulation 92 % des Landes ab. In großen Gebieten gibt es allerdings nur sporadische Vorkommen und die Dichten sind viel geringer als in den Gebieten der ursprünglichen drei Meta-Populationen.
• Die Erholung der Bestände hat ihre Ursachen im erhöhten gesetzlichen Schutz, in der Verbesserung der Lebensräume, der Reduktion der Verschmutzung und einer Zunahme der Verfügbarkeit von Fischen.
Der Aktionsraum bzw. die Reviergröße
Das Wissen über die Anzahl, Dichte und die Reichweite einer Spezies ist essentiell für Schutz und Management von Wildtierpopulationen. Auf Grund seiner scheuen Natur, seiner einzelgängerischen Lebensweise, des großen Aktionsraumes und der Nachtaktivität in weiten Teilen seines Vorkommens, sind diese Daten besonders für den Fischotter schwer zu erheben. Daher setzten Forscher häufig auf indirekte Methoden (z.B. Spuren in Schnee oder Schlamm und neuerdings genetische Untersuchungen von Losungen) oder mehr invasive Techniken (z.B. Radiotelemetrie), um Daten zum Verhalten des Fischotters zu gewinnen. Für einen Vergleich der Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden siehe Anhang 1.
Seit 1994 wurden zahlreiche Untersuchungen (Spurensuche im Schnee und Schlamm, Radiotelemetrie, direkte Beobachtungen) im Biosphäre Reservat und Landschaftsschutzgebiet von Třeboň durchgeführt, um die Anzahl der Fischotter im Gebiet zu ermitteln und verschiedene Aspekte des Verhaltens von Fischottern zu untersuchen (z.B. Roche & Roche 2004). Das 700 km² große Reservat umfasst einen langsam fließenden Tieflandfluss (Lainsitz) und eine hohe Konzentration (ca. 500) von, meist großen (50 ha im Mittel, max. 490 ha), eutrophen Fischteichen. Das Ergebnis einer mehr als 700 jährigen Wasser- und Teichwirtschaft ist ein kompliziertes
44
Netzwerk von Teichen, Zu- und Abflusskanälen, Flüssen, Bächen, Feuchtwiesen, Mooren, Sumpfflächen, dass sich zu einer einmaligen Landschaft entwickelt hat (Kučerova & Roche 1999, Roche 2001, Roche & Roche 2004), welche dem Fischotter geeignete und weniger geeignete Lebensräume und Nahrungsmöglichkeiten bietet.
In den Jahren 2001 und 2003 wurden zwei 10 x 10 km große Quadrate für ein groß angelegtes Snow-tracking im Biosphärenreservat ausgewählt. Ziel war, die Anzahl der Fischotter im Reservat abzuschätzen (Roche & Roche 2004, Abb. 5 & 6). Die zwei Quadrate repräsentieren die zwei wichtigsten Lebensraumtypen im Biosphärenreservat: Konzentrationen von mittleren und großen Teichen mit einem komplexen Netzwerk von Flüssen, Kanälen, Bächen und Feuchtgebieten (Kernzone; 2003) und einen Tieflandfluss in landwirtschaftlich genutztem Gebiet mit verstreuten kleinen (< 50 ha) Teichen (Flusszone; 2001). Während die Struktur der Kernzone einmalig in Tschechien ist, ist die Flusszone relativ typisch für die umgebende Landschaft außerhalb des Biosphärenreservats, bis ins Böhmisch-Mährische Hochland.
Die Untersuchung wurde am Morgen nach frischem Schneefall durchgeführt, sodass nur die Spuren der vergangenen Nacht aufgenommen wurden. Bis zu 15 geschulte Mitarbeiter waren an der Untersuchung beteiligt, wobei jedem ein bestimmtes Untersuchungsgebiet zugewiesen wurde, sodass alle Gewässer im Quadrat am selben Tag untersucht werden konnten. Die Mitarbeiter folgten den frischen Spuren, führten Größenmessungen durch und notierten die Bewegungsrichtung. Die Daten wurden in Karten des Untersuchungsgebietes eingetragen, kombiniert und hinsichtlich der Anzahl und Reichweite der einzelnen Fischotter ausgewertet. In vielen Fällen war es auch möglich an Hand der Größe der Fährten, Geschlecht (z.B. Fähe mit Welpen) und Altersklasse (adult, subadult, juvenil) zu bestimmen. Mehr Details zur Methode und den Ergebnissen findet sich in Roche & Roche 2004.
Die abschließenden Schätzungen zeigten, dass 3,4 mal soviel Fischotter in der Kernzone als in der Flusszone (38 und 11 Individuen) und 4 mal soviel Welpen in der Kernzone zu finden waren. 11 Rüden, 10 Fähen, 8 Welpen und 9 unidentifizierte Einzelindividuen wurden für die Kernzone berechnet, 2 Rüden, 3 Fähen, 4 Welpen und 2 unidentifizierte Einzeltiere für die Flusszone. Die unidentifizierten Einzeltiere wurden als sub-adulte Tiere ohne eigenes Revier bzw. als Durchzügler gerechnet. Diese Einzeltiere hielten sich im Bereich von kleinen einzeln liegenden Teichen auf. Die nächtlichen Bewegungen waren gering, was auf die Vermeidung von Begegnungen mit anderen Fischottern hindeutet (Abb. 5).
In der Flusszone (Abb. 6) zeigten die Spuren lineare Reichweiten mit einem Fischotter auf 2 – 30 km Flusslänge, was typisch ist für Fischotter in anderen Teilen des Landes (siehe weiter unten) und
45
in Europa (z.B. Kruuk 1995). Die in der Nacht zurückgelegten Strecken variieren zwischen 1 und 5 km, wobei angenommen wird, dass Rüden längere Strecken zurücklegen. Grundsätzlich scheinen sich die Bereiche der einzelnen Fischotter nicht zu überlappen. Die Tiere machen kehrt, wenn sie auf Zeichen von Artgenossen stoßen. Eine Ausnahme bildete ein unidentifiziertes Einzeltier (wahrscheinlich männlich) und eine Fähe mit zwei Welpen. Bemerkenswert ist, dass bei den Fischottern der Flussregion regelmäßig Karpfen als Nahrung nachgewiesen werden konnten. Das lässt den Schluss zu, dass die Fischotter der Flussregion die verstreuten Teiche der Region zur Futtersuche aufsuchten und sich diese Nahrungsquelle möglicherweise mit anderen Fischottern, wenn auch nicht zur selben Zeit, teilten. Eine radiotelemetrische Studie im böhmisch-mährischen Hochland zeigte, dass die Teiche sehr unterschiedlich von Fischottern aufgesucht werden, manche weit öfter als andere (Poledniková et al. 2006). Im Mittel lag die Besuchsrate bei 20 – 21 % oder ein Besuch alle 5 Tage. Ein Fischotter hatte 18 kleine Teiche in seinem Revier und besuchte pro Nacht drei Teiche (Poledník 2005). Darüber hinaus haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass die Besuchsrate saisonal variiert. Die meisten Besuche finden im Sommer statt (alle Teiche besetzt), während sich die Fischotter im Winter, auf Grund von Eis und, nach der Ernte, leeren Teichen, auf Fließgewässer und wenige offene, besetzte Teiche konzentrieren.
Eine Anzahl von ähnlichen 10 x 10 km Untersuchungen im Schnee haben auch in anderen Teilen des Landes stattgefunden. Poledník (2012) untersuchte beispielsweise zwischen 2008 und 2012 12 10 x 10 km Quadrate in verschiedenen Teilen des Landes. Die Anzahl der identifizierten Individuen schwankte zwischen 1 und 29 (deutlicher Schwerpunkt bei den niedrigen Zahlen), wobei die niedrigsten zahlen im Bergland und dem mährischen Hochland, die höchsten Zahlen in Quadraten mit vielen Fischteichen in Südböhmen zu finden waren. Noch von der Mutter abhängige Welpen machten 36 % der Population aus.
Die Reviere der Fischotter in der Kernzone zeichnen sich durch ein komplexes Mosaik von nichtlinearen, überlappenden Aktivitätsbereichen aus. Die nächtlich zurückgelegten Strecken reichen von 0,5 – 4 km, wobei die Strecken der Rüden ausnahmslos größer waren. Die Aktivitätsbereiche waren selten linear, da die Fischotter wiederholt Teiche überquerten oder zwischen bzw. sich entlang von Teichen, Flüssen und Kanälen bewegten. Grundsätzlich zeigten die nächtlichen Bewegungen von Einzeltieren abermals, dass Fischotter ihre Artgenossen meiden und sich zurückziehen, wenn sie auf Zeichen eines anderen treffen. Die Reviere von Rüden überlappten sich ausnahmslos mit denen von 1 – 2 Fähen. Die nächtlichen Bewegungsmuster decken sich manchmal vollständig mit denen von Fähen (Dulfer et al. 1996, Roche 1997).
Die maximalen nächtlichen Strecken waren sowohl in der Kernzone als auch in der Flusszone
46
niedrig im Vergleich zu Untersuchungen in anderen Teilen Europas. In Schweden beispielsweise legen Fischotter im Durchschnitt maximale nächtliche Strecken von 16 km zurück, während in Schottland 5 – 16 km für Rüden und 4 – 9 km für Fähen normal sind (zitiert in Chanin 1988).
Rüden haben ausnahmslos einen größeren Aktivitätsradius und überlappen oder beinhalten die Aktivitätsbereiche von ein, zwei oder mehr Fähen.
In der Kernzone umfassen die Reviere der Fähen tendenziell Habitate mit optimalen Bedingungen (vermutlich in Zusammenhang mit einer ganzjährigen Futterverfügbarkeit und geeigneten Unterständen), während jene der Rüden auch viele sub-optimale Habitate umfassen. Allgemein hielten sich Fähen tendenziell in der Umgebung von Teichkomplexen auf, die Rüden hingegen im Bereich von Flüssen und Kanälen. Ausgeprägte geschlechtsspezifische Unterschiede in der Größe und Qualität der Reviere bzw. Aktionsbereiche wurden regelmäßig für den eurasischen Otter nachgewiesen und können als typisch für die Spezies gelten (Kruuk 1995).
Die Reviere von Fähen überlappen oder decken sich mit bis zu 4 weiteren Fähen. Innerhalb jedes Reviers konzentrieren die Fähen ihre täglichen Aktivitäten auf bevorzugte Bereiche (vielleicht 20 % des Gesamtreviers). Obwohl sich die Reviere oft vollständig überlappen, treffen sich die Fischotter selten oder nutzen gar den selben Ort zur selben Zeit. In nahezu allen Fällen mieden Fischotter Bereiche, wo ein anderer Otter kürzlich aktiv war (vermutlich auf Grund frischer Spuren oder Losung). Man muss aber anmerken, dass in strengen Wintern (die Eisdecke kann die Nahrungsverfügbarkeit erheblich einschränken) zahlreiche Fischotter, meist Fähen mit Welpen, beobachtet wurden, wie sie die besten Futterplätze (ein tiefer Flusskolk) in der Kernzone mit bis zu 11 andern Fischottern (bis zu 5 zur selben Zeit) während einer kurzen Periode teilten (Förster 1996). Dieses Verhalten ist außergewöhnlich und wurde nur im einmaligen Lebensraum von Třeboň und auch nicht in „normalen“ Wintern beobachtet.
Eine relativ neue nicht-invasive und potentiell sehr wertvolle Methode zur Erhebung von Individuenzahlen des Fischotters, nutzt die genetische Analyse von Losungen. Für die detaillierte Beschreibung und Diskussion der Methodik der genetischen Analyse siehe Hájková et al. 2009, 2001. In den Wintern 2003 und 2004 führten Hájková et al. (2009) zwei genetische Untersuchungen in 10 x 10 km Quadraten durch, in denen zuvor ein snow-tracking stattfand. Die erste Untersuchung fand in einem Fließgewässerhabitat in der Slowakei statt, die zweite, welche 5 Tage dauerte, wurde in einem Quadrat der Kernzone, wie oben beschrieben, durchgeführt.
Für das Fließgewässerhabitat brachten beide Methoden sehr ähnliche Ergebnisse (snow-tracking: 10 Individuen, DNA-Analyse: 12 Individuen). Im Bereich der Fischteiche in der Kernzone ergaben die DNA-Analysen der Losungen erheblich höhere Individuenzahlen als mittels snow-tracking (snow-
47
tracking: 38 Individuen, DNA-Analyse: 50 Individuen, 29 Rüden, 21 Fähen). Diese Differenz ist wahrscheinlich auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Beispielsweise sind Untersuchungen durch snow-tracking subjektiv und basieren auf der Erfahrung der ausführenden Personen. Zudem zeigen sie nur die Aktivität einer Nacht und nur im Winter, was von der Aktivität zu anderen Tagesund Jahreszeiten abweichen kann. Fischotter können beispielsweise weniger aktiv sein, ja sogar für einige Tage im Unterstand bleiben (Kranz & Knollseisen 1998) oder die Aktivität spielt sich unter dem Eis ab und kann auf bestimmte Hauptfutterplätze beschränkt sein. Auf der anderen Seite kann die genetische Untersuchung auch Tiere auf der Durchreise erfassen oder solche, deren Revier nur sporadisch das Untersuchungsquadrat umfasst. Darüber hinaus werden die Daten von mehr als einer Nacht erfasst (vielleicht von Wochen) und sie ist nicht subjektiv, d.h. unterliegt nicht der Erfahrung des Untersuchers, wie sie bei der Unterscheidung von ähnlichen Spuren notwendig ist. Zu beachten ist auch, dass gute Futterplätze im Winter zudem auch von Fischottern von „außerhalb“ genutzt werden können, die darüber hinaus nur minimale Aktivität im Untersuchungsquadrat zeigen.
Generell kann festgestellt werden, das Untersuchungen mittels snow-tracking eine adäquate Abschätzung der Individuenzahlen und Aktivitätsbereiche von Fischottern in einfachen, linearen Fließgewässerhabitaten ermöglichen. In komplexen Teichhabitaten mit hoher Fischotterdichte benötigt man eine Kombination aus snow-tracking und genetischer Losungsanalyse für die genaue Abschätzung. Snow-tracking ist einfacher und billiger, unterliegt aber den Wetterbedingungen und der Erfahrung der durchführenden Person. Die genetische Analyse ist noch teuer und zeitaufwändig, bringt dafür aber verlässliche Zahlen, in Kombination mit anderen Daten.
Zusammenfassung
• Zahlreiche Untersuchungen mittels snow-tracking wurden in der Tschechischen Republik durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen zwei Haupthabitate für Fischotter, a) große Konzentrationen von mittleren und großen Teichen mit einem komplexen Netzwerk von Flüssen, Kanälen, Bächen und Feuchtgebieten (seltene Habitate) und b) lineare Fließgewässerhabitate, meist in landwirtschaftlich genutztem Gebiet mit verstreuten kleinen Fischteichen (häufigste Habitate).
• Komplexe Teichhabitate ermöglichen hohe Fischotterdichten (bis zu 50 auf 100 km²). Diese Habitate sind selten. Die Aktivitätsradien von Fähen sind klein, umfassen die besten Habitate und überlappen sich. Die Aktionsgebiete der Rüden sind größer, meist auf schlechtere Habitate zentriert und überlappen mit jenen von ein bis zwei Fähen. Fischotter meiden ihreArtgenossen generell. Die nächtlich zurückgelegten Strecken sind relativ gering.
48
• Fließgewässerhabitate ermöglichen viel geringere Fischotterdichten (typischerweise 1- 12 auf 100 km²). Diese Habitate sind am häufigsten. Die größeren Aktionsbereiche der Rüden überlappen ebenfalls mit jenen von zwei oder mehr Fähen. Die Aktivitätsbereiche umfassen eine Anzahl von kleinen Teichen. Die in der Nacht zurückgelegten Strecken sind relativ lang und mehr als ein kleiner Teich kann in einer Nacht besucht werden.
• Im Winter konzentriert sich die Aktivität auf die besten Futterplätze (oft Fließgewässer, aber auch offene Teiche). In sehr strengen Wintern sind Fischotter gezwungen in andere Gegenden zu wandern, um Nahrung zu finden. Bessern sich die Bedingungen jedoch, kehren sie in ihr angestammtes Aktivitätsgebiet zurück.
Fortpflanzung
Während Fischotter prinzipiell in der Lage sind das ganze Jahr über Welpen auszutragen, zeigen direkte Beobachtungen und Untersuchungen mittels snow-tracking in der südböhmischen Teichregion, dass die meisten Welpen Mitte des Sommers geboren werden (Roche & Roche 2004).
Zu dieser Zeit halten sich die Fähren nahe des oder im Bau auf und nur während dieser kurzen Zeit hält sich auch der Rüde in der Nähe der Fähe auf. Kurz nach der Geburt wird der Rüde und etwaige Jungtiere aus dem letzten Jahr von der Fähe vertrieben und die alten Reviere werden wieder errichtet bzw. neue gefunden.
Dieser sommerliche Höhepunkt in der Fortpflanzung scheint so gewählt, dass die Zeit mit dem höchsten Energiebedarf der Fähe (Füttern und Beschützen der Jungen) mit jener der größten Nahrungsverfügbarkeit und den geringsten Energiekosten zusammenfällt. Für gewöhnlich führt eine Fähe nur ein Junges, zwei Welpen sind seltener. Diese Zahlen decken sich mit den Beobachtungen in Gegenden mit ganzjähriger hoher Futterverfügbarkeit, wie Küstengebieten (Kruuk 1995). In Fließgewässerhabitaten mit geringerer Futterverfügbarkeit kann die Größe des Wurfes höher sein (z.B. Mason & MacDonald 1986), was einen Zusammenhang zwischen der Wurfgröße und der erwarteten Überlebensrate der Welpen vermuten lässt.
Im Winter kann die Population zu mehr als 30 % aus Jungtieren bestehen (Zahlen basierend auf Daten aus dem snow-tracking; Poledínk et al. 2012). Diese Zahl sinkt aber übers Jahr auf Grund von Mortalität und Abwanderung. Ansorge et al. 1997 weist eine typische Mortalitätsrate für Welpen im Osten von Deutschland von bis zu 90 % aus.
49
Mortalitätsfaktoren
Die Todesursachen für Totfunde von Fischottern in der Tschechischen Republik wird seit 1990 untersucht (Abb. 7; Tab. 1), mit 316 Kadavern zwischen 1990 und 2011 (Zusammenfassung der Daten in Poledník et al. 2011b). Bevor 2008 wurden die meisten Kadaver vom Tschechischen Otter Foundation Fonds, mit dem Sitz im Biosphärenreservat von Třeboň in Südböhmen, gesammelt und untersucht (Roche 2004b). Seither werden die Kadaver von Alka Wildlife s.r.o. bearbeitet. Die Kadaver werden entweder währen der Feldarbeit, der oben genannten NGOs gefunden oder von Bürgern, Naturschutzorganisationen, der Verwaltung von Naturschutzgebieten, der Tierschutzorganisationen, der Böhmisch-Mährischen Union der Jäger oder der Union der Böhmischen bzw. Mährischen Fischer gemeldet bzw. abgegeben. Die gesammelten Kadaver werden untersucht, vermessen, gewogen, einer Autopsie unterzogen (meist erst nach 2008) und der Konditionsfaktor wird berechnet (bezüglich Methoden siehe Roche 2004b, Poledník et al. 2011b).
Die Anzahl der gesammelten Fischotter hat über die Jahre zugenommen (Tab. 1), was das gestiegene Interesse am Fischotter (und dem Naturschutz allgemein), das wachsende Wissen über die Arbeit von NGOs, die sich mit dieser Spezies beschäftigen (und der Bereitschaft ihnen Kadaver zu überlassen) und zuvorderst die steigenden Fischotterzahlen und die Ausbreitung seit 1990 (Abb. 1 & 2) widerspiegelt.
Die allgemeinen Ergebnisse legen nahe, dass die meisten Todesfälle vom Straßenverkehr verursacht werden (75,6 %), 7,9 % auf illegale Tötungen und 3,5 % auf natürliche Todesursachen zurückzuführen sind (für 13 % konnte die Todesursache nicht zuverlässig identifiziert werden).
Der Konditionsfaktor wurde für 56 Tiere berechnet. Die Werte schwanken zwischen 0,642 und 1,557 (im Mittel 1,087 ±0,0279). Allgemein zeichnet sich kein klares Muster für die Todesfälle im Straßenverkehr ab, obwohl die meisten Tiere einen höheren Konditionsfaktor aufwiesen. Auf der anderen Seite wiesen verlassene Welpen, durch Bisse verletzte und illegal getötete Tiere einen niedrigen Konditionsfaktor auf (in erster Linie in Zusammenhang mit Hunger und Entkräftung). Vergiftete Tiere waren dagegen in guter Kondition (Roche 2004b, Poledník et al. 2011).
Fehlerursachen
Die Wahrscheinlichkeit, einen Fischotterkadaver zu finden, hängt stark von der Todesursache ab. So ist zum Beispiel die Chance, einen im Straßenverkehr verunfallten Fischotter zu finden, sehr hoch, weil der Kadaver allgemein sichtbar ist. Zusätzlich ist im tschechischen Jagdgesetz (Gesetz No. 449/2001) geregelt, dass alles Fallwild (einschließlich Fischotter) der örtlichen Jagdgesellschaft
50
gemeldet werden müssen, unabhängig von der Todesursache. Im Gegensatz dazu werden Fischotter, die eines natürlichen Todes (Krankheiten, Alter) gestorben sind, höchstens zufällig gefunden und auch illegal getötete Tiere werden selten gefunden. Ein Beispiel, Poledník et al. (2011b) berichten von 5 mit Radiosendern versehenen Fischottern, die bis zu ihrem bestätigten Tod radiotelemetrisch beobachtet werden konnten. Von diesen 5 verendete einer an einer Krankheit, einer wurde von einem Auto überfahren, und drei wurden illegal getötet. Obwohl es sich nur um wenige Fälle handelt, drängt sich der Verdacht auf, dass menschlich induzierte Mortalität weit höher ist, als die vorhandenen Daten vermuten lassen.
Regionale und zeitliche Faktoren wie die Geomorphologie (Berge, Ebene), das Wetter (Überflutungen, winterliche Temperaturen), die menschliche Besiedlungsdichte, die öffentliche Aufmerksamkeit, etc. können signifikante Auswirkungen auf die Anzahl der gefundenen bzw. abgegebenen Kadaver haben. Aus diesem Grund können die verschiedenen Kategorien von Todesursachen nicht direkt verglichen werden und man muss sehr vorsichtig sein, die Kategorien von Jahr zu Jahr zu vergleichen.
Mortalität im Straßenverkehr
Obwohl die Daten gewissen Fehlern unterliegen können (siehe oben), gibt es Hinweise, dass der Anteil der im Straßenverkehr getöteten Fischotter im Laufe der Zeit zugenommen hat (z.B. von 57 % auf 78 %; Poledník et al. 2011b). Das hat wahrscheinlich zwei Hauptursachen, a) zunehmender Verkehr und Straßenbau seit 1990 und b) zunehmende Ausbreitung und Anzahl der Fischotter in der selben Periode.
Im großen und ganzen kann festgestellt werden, dass die Todesfälle mit dem steigenden Straßenverkehr zunehmen. Je nach Rang der Straßen verteilen sich 45 % der Todesfälle auf Straßen 1. Ordnung (Bundesstraßen), 23 % auf Straßen 2. Ordnung (Landstraßen), 17 % auf Straßen 3. Ordnung und 9 % auf lokale Verbindungsstraßen, zusätzlich 6 % auf Autobahnen. Man muss bedenken, dass der Verkehr auf Autobahnen nicht anhält. Daher werden die Zahlen für Autobahnen wahrscheinlich unterschätzt.
In 56 % der Fälle kamen die Fischotter in der Nähe von Gewässern im Straßenverkehr um (30 % in unmittelbarer Nähe eines Gewässers, 26 % in Verbindung mit Dämmen zwischen Teichen oder Stauanlagen). In 44 % der Fälle war allerdings kein Gewässer in unmittelbarer Nähe, was deutlich macht, dass Fischotter auch quer durchs Land ziehen können um einzelne Abschnitte ihres Areals zu erreichen. Während Fischotter durchaus Brücken und Unterführungen benutzen können, um Straßen zu unterqueren – vor allem wenn ein Fluss durchfließt, nehmen sie in vielen Fällen den
51
direkten Weg zwischen zwei Gewässern, was oft das Überqueren einer Straße notwendig macht.
Der Blick auf die gesamten Daten zeigt, dass ungefähr doppelt so viele Rüden wie Fähen im Straßenverkehr umkommen, mit einer Rate von 2:1 (138 Rüden, 67 Fähen). Bei allen anderen Todesursachen hingegen liegt die Rate bei 1:1 (31 Rüden, 30 Fähen). Zusammengenommen rühren 82 % aller aufgezeichneten Todesfälle bei Rüden und 69 % bei Fähen vom Straßenverkehr (Poledník et al. 2011b).
Daten, ausschließlich aus dem Gebiet von Třeboň (101 Kadaver davon 58 bei Verkehrsunfällen, Roche 2004b), legen eine Verhältnis von getöteten Rüden zu Fähen von 3:1 nahe, wobei ausgewachsene Rüden am häufigsten verunfallen, gefolgt von sub-adulten Rüden, sub-adulten Fähen, adulten Fähen und sehr wenige Welpen beiden Geschlechts (Abb. 8). Ausnahmsweise alle Tiere waren in guter Verfassung, vor allem im Sommer. Ein Vergleich von Todesfällen im Straßenverkehr mit dem Verkehrsaufkommen übers Jahr und den Spitzenzeiten von Straßenüberquerungen an Brücken zeigte, dass die Häufigkeit von Todesfällen nicht so sehr mit dem Verkehrsaufkommen, als mit der Häufigkeit mit der Fischotter Straßen überquerten, zusammenhing. Das heißt, die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen hängt mit Verhaltensänderungen der Fischotter zusammen und nicht mit dem Verkehrsaufkommen. Die meisten Unfälle ereignen sich im Spätsommer und Herbst und am wenigsten im Winter, mit einer kleinen Spitze im Frühling. Andere Todesursachen von Fischottern häufen sich im Winter und sind seltener im Sommer (Roche 2004b).
Rüden habe größer Reviere und Aktivitätsbereiche als Fähen und legen daher weitere Strecken zurück, sowohl wenn sie an den Grenzen ihres Reviers patrouillieren, als auch wenn sie auf Futtersuche sind. Das trifft zu einem geringeren Teil auch auf sub-adulte Individuen zu, die sich erst ein eigenes Revier suchen müssen. Rüden überqueren daher häufiger Straßen als die „sesshafteren“ Fähen. Zudem ist der Herbst und, in weit geringerem Maße, auch der Frühling die Saison der Karpfenernte. Viele Teiche sind leer oder doch teilweise leer, wobei die letzteren gute Futterquellen darstellen, wenn die dicht stehenden Fische im seichten Wasser relativ leicht zu fangen sind. Zu dieser Zeit dehnen Fischotter ihre Streifgebiete aus und suchen gute Futterplätze häufiger auf, was insgesamt zu häufigeren Straßenquerungen führen kann.
Illegale Tötungen
Es gibt viele Hinweise (besenderte Individuen, persönliche Berichte), dass die Anzahl der Fischotter, die illegal getötet werden, viel höher ist als die Zahl der Kadaver die gefunden werden es vermuten lässt. Zusammen mit den Todesfällen im Straßenverkehr scheinen illegale Tötungen die
52
wichtigsten Faktoren für die Regulierung der Populationen in der Tschechischen Republik zu sein. Die derzeitigen Auswirkungen dieser illegalen Tötungen ist schwer zu bestimmen, da die Populationen über den Beobachtungszeitraum gewachsen ist und sich ausgebreitet hat und die illegalen Tötungen zudem zeitlich und regional variieren. Wobei das zunehmende Wissen über Naturschutzbelange und die, von der Regierung seit 2000, geleisteten Kompensationszahlungen für Fischotterschäden in Fischteichen, eine Rolle spielen mögen, da vor allem letztere zum Abbau von Spannungen beigetragen können. Auf der anderen Seite expandierte der Fischotter in neue Gebiete, wo zuvor für viele Jahre Schäden unbekannt waren.
Im Verhältnis zum Fallenfang, Erschießen und Erschlagen, dürften Fälle von Vergiftung in den letzten Jahren, mit 15 bestätigten Fällen seit 2006 (Poledník et al. 2011b), zugenommen haben. In 14 Fällen war das, nunmehr illegale, Pestizid Carbofuran die Vergiftungsursache. Einen detaillierten Überblick über die Vergiftungen durch Carbofuran gibt Poledníková et al. 2010. In diesen Fällen wird das Gift für gewöhnlich mittels eines Köders, z.B. einem toten Fisch, angeboten. Allerdings gehen Fischotter sehr selten an tote Fische/Aas und wenn, dann meist im Winter (Roche 2001). In allen Fällen war der Konditionsfaktor sehr gut, was auf gesunde Tiere (z.B. nicht hungernd) hinweist. Zudem wurden in einigen Fällen mehrfach vergiftete Fischotter an der selben Stelle gefunden (Poledník et al. 2011b). Während vergiftete Köder Verwendung finden können (wie auch bei anderen vergifteten Arten, Poledniková et al. 2010), ist es zudem möglich, dass andere, bisher unbekannte, Methoden verwendet werden bzw. dass die Fischotter auf andere Art und Weise dem Gift ausgesetzt werden. Diese Möglichkeit ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen.
Während die tschechische Polizei mehrere Fälle von Wildtiervergiftungen mit Carbofuran untersucht hat, wurde bisher niemand verurteilt.
Andere Todesursachen
Im Vergleich mit andern Länder (z.B. Kruuk 2006) wurde nur von wenigen Fällen einer Krankheit bei Kadavern von tschechischen Fischottern berichtet. Toman (1995) berichtet von einem bestätigten Fall von Staupe bei einem juvenilen Tier und von einem Darmgeschwür bei einem anderen. Krankheiten sind aber möglicherweise im Datenmaterial sehr unterrepräsentiert, da die Wahrscheinlichkeit ein verendetes Tier zu finden sehr gering ist und es zudem an ausreichend tiefgehenden Autopsien mangelt. Überhaupt ist wenig über die Prävalenzen von Krankheiten Europäischer Fischotter bekannt.
Verlassene Welpen als Gruppe, umfassen Tiere unter einem Jahr (Fischotterwelpen bleiben in der Regel mindestens ein Jahr bei der Fähe) die tot gefunden wurden oder kurz nach dem Fund
53
verendeten (lebende Findlinge, die in Gefangenschaft aufgezogen und später wieder ausgewildert wurden, sind nicht inkludiert). Viele dieser Tiere wiesen einen schlechten Konditionsfaktor auf, der auf Unterernährung hinweist. In einigen Fällen wurden Welpen nach starken Hochwasserereignissen gefunden (Roche 2004b). Das legt nahe, dass die Welpen in der starken Strömung nicht schwimmen konnten und ertranken. In anderen Fällen kann man nur spekulieren, dass die Fähe getötet wurde oder die Welpen absichtlich verlassen wurden, was ausnahmsweise andernorts beobachtet wurde (Kruuk 2006).
Von den 7 Fällen von tödlichen Bissverletzungen, stammten 6 von Hunden und eine von einem anderen Fischotter. Zwei Tiere waren adult (1 Fähe, 1 Rüde) und fünf waren Welpen. Mit einer Ausnahme (Wundinfektion) waren die Bisse die unmittelbare Todesursache. In allen Fällen war der körperliche Zustand schlecht, was bedeuten könnte, dass der Hunger die Otter veranlasste die Nähe menschlicher Siedlungen oder geschützter Teiche mehr als sonst zu suchen. Alternativ können frei laufende Hunde (mit oder ohne Wissen der Halter) Fischotter attackiert oder Baue ausgegraben haben.
Ausgewachsene Fischotter haben keine Feinde (Menschen ausgenommen) in der Tschechischen Republik. Zwei Fälle sind allerdings bekannt (Toman 1995), wobei einer in Tabelle 1 inkludiert ist. In beiden Fällen handelte es sich um Welpen, eines wurde von einem Fuchs und eines von einem Uhu gerissen.
Weitere Diskussion
Speziell der Winter scheint eine belastende Zeit für Fischotter zu sein, in der viele Tiere in schlechter Kondition sind, mit geringem Gewicht und/oder krank. Vor allem betrifft das subdominante Fischotter in suboptimalen Gebieten mit schlechter Nahrungsverfügbarkeit, sei es durch geringe Biomasse, leere Teiche oder Eisbedeckung. Im Winter sind die Energiekosten für Fischotter viel höher, daher müssen sie mehr Zeit für die Futtersuche aufwenden und sind oft tagaktiv. Sie verbringen nicht nur mehr Zeit mit der Nahrungssuche an einem bestimmten Teich, sondern sind auch leichter zu bejagen. Darüber hinaus zwingt sie der Futtermangel zu höheren Risiken, z.B. Eindringen in geschützte Anlagen, wo Hunde freilaufen und eine Flucht nicht einfach ist.
Fähen besetzten tendenziell kleiner Reviere in den besten Habitaten, z.B. Plätze die eine gute Futterversorgung über das ganze Jahr gewährleisten (oft rund um Gruppen von Teichen). Ausgewachsene Fähen sind daher weniger von winterlichem Futterstress betroffen, genau so wie ihre Welpen, die nahe bei der Fähe bleiben. Subadulte Fähen können länger bei der Mutter bleiben als subadulte Rüden. Jedoch können subadulte Rüden eine Zeit lang in ihrem Geburtsgebiet von
54
Futterstelle zu Futterstelle umherstreifen, wobei sie aber den Kontakt zu anderen Fischottern vermeiden. Rüden haben größere Reviere, die in dicht besiedelten Gebieten mit jenen anderer Rüden überlappen. Die Häufigkeit von Revierpatrouillien kann in diesen Gebieten höher sein, ebenso wie die innerartliche Aggression zu Zeiten von Futterstress. Das kann zusätzlich durch temporäre Einwanderer aus nahrungsärmeren Gegenden verstärkt werden (Förster 1996).
Nahrungsspektrum des Fischotters und Jagdverhalten
Untersuchungsgebiete
Das Nahrungsspektrum von Fischottern ist weltweit relativ gut erforscht. Der Fischotter ist ein Fischspezialist und es ist daher nicht überraschend, dass diese Nahrung im gesamten Verbreitungsgebiet mit einem Anteil von bis zu 70 – 90 % dominiert. Zusätzlich frisst der Fischotter Insekten, Vögel, Reptilien, Amphibien und kleine Säugetiere. Der Anteil, den verschiedene Arten am Nahrungsspektrum haben, variiert stark, sowohl räumlich als auch zeitlich.
Zwischen August 1994 und Juli 1996 wurden im Biospähren Reservat und Landschaftsschutzgebiet von Třeboň in Südböhmen, Nahrungsanalysen beim Fischotter durchgeführt (Roche 2001). Innerhalb dieses Gebietes wurden drei Habitattypen ausgewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Lebensräumen und Nahrungsquellen abzudecken (Abb. 9). Zudem repräsentieren die ausgewählten Habitattypen die drei Hauptlebensräume für Fischotter in der Tschechischen Republik. Die Habitate waren:
• Teich/Fluss – zwei große Teiche (Novy Vdovec und Ženich, jeder ca. 85 ha groß) sowie die Verbindungskanäle von den Teichen zur Lainsitz, ca. 0,5 km Distanz. Diese Teiche werden vorwiegend mit K1 und K2 (in der Studie wurde ein Verhältnis von 1:2 angenommen), mit einigen K0, sowie einer Bandbreite von Nebenfischen z.B. Zander (Sander lucioperca), Hecht (Esox lucius), Rotauge (Rutilus rutilus) besetzt.
• Teich – ein mittlerer 50 ha großer Teich (Novy u Cepu) und ein in unmittelbarer Nähe gelegener Brut- bzw. Brutstreckteich (< 0,5 ha). Der Teich wird hauptsächlich mit K1 besetzt (für die Studie wurden 100 % angenommen). Die Teiche bekommen ihr Wasser aus dem näheren Einzugsgebiet und die Hauptentwässerungskanäle sind die meiste Zeit des Jahres leer. Diese Probenstelle liegt relativ weit (für Třeboňer Verhältnisse) vom nächsten Gewässer entfernt (> 4 km).
• Fluss – das westliche Ufer der Lainsitz, 3 km flussabwärts der Ortschaft Suchdol nad Lužnice und die umliegenden Altarme und Tümpel in den Überflutungsgebieten. Diese
55
Probenstelle ist relativ weit von den kommerziell bewirtschafteten Teichen entfernt (> 4 km) und wird im Herbst und Frühjahr regelmäßig überflutet. Flussaufwärts der Teiche gelegen, ist dieser Abschnitt von der Teichbewirtschaftung unbeeinflusst und weist eine relativ geringe Fischbiomasse auf (Jurajda & Roche 1994). Kleine Weiler und Dörfer in der Nähe verfügen über kleine „Hobbyteiche“, die im Schnitt 2 ha groß sind. Diese Teiche werden für gewöhnlich mit K1 und K2 in einem Verhältnis von 80:20 besetzt.
Methoden
Sammeln von Losungen undAnalyse
Zwischen August 1994 und Juli 1996 wurden an allen drei Probenstellen frische Losungen (Kot) in ähnlicher Distanz zum Ufer gesammelt. Die Losungen wurden für 24 Stunden in einer Lösung mit Spülmittel eingeweicht, durch ein 0,5mm Sieb gefiltert und unter einem x10 – x25 Binokular untersucht. Um die gefressenen Fische zu bestimmen, wurden für die Diagnostik nützliche Knochen wie Prämaxillare, Dentale, Schlundzähne, Wirbelsäule und Operculum, Bestimmungsschlüssel (Libois et al. 1987, Libois & Hallet-Libois 1988, Knollseisen 1996) und eine private Referenzsammlung von Skeletten, Zähnen und Schuppen verwendet. Rechte und linke Knochen wurden nach Möglichkeit paarweise angeordnet, um eine Mindestanzahl an gefressenen Fischen abschätzen zu können. Diese Methode unterschätzt manchmal größere Fische, da die Knochen dieser Fische nicht mit gefressen werden. Es wurde daher besonders sorgsam auf Schuppen oder Knochenfragmente, die auf große Fische wie Karpfen hinweisen, geachtet. Andere Beutetiere wurden als „nicht-Fisch Beute“ klassifiziert und in Säugetiere, Amphibien, Vögel, Reptilien, Mollusken oder Insekten eingeteilt. Der Diversitätsindex nach Simpson wurde verwendet, um die Vielfalt der saisonal gefressenen Beutetiere zu ermitteln bzw. darzustellen. Die Ernährungsdaten sind als relative Häufigkeit des Vorkommens und relative Biomasse dargestellt. (Für weitere Informationen zu den Methoden siehe Roche 2001)
Abschätzung von Fischlänge und Biomasse
Die Länge und Biomasse der gefressenen Fische wurde durch Regressionen, basierend auf der Länge der Schädelknochen, Wirbelsäule und Schuppen, berechnet. Die Regressionen für die meisten dieser Knochen wurden aus der Literatur bezogen (Libois et al. 1987, Libois & HalletLibois 1988, Knollseisen 1996); andere, für die im Biospärenreservat dominanten Arten, wurden vom Autor erstellt. Wenn Messungen unmöglich waren, obwohl die Art identifiziert werden konnte (z.B. bei Knochenfragmenten von großen Karpfen), wurden die Altersklasse und das Gewicht durch Vergleich mit der Referenzsammlung geschätzt. Es wurde angenommen, dass der Otter maximal
56
500g eines Beutetiers, mit einem ermittelten Gewicht über 500g, frisst (Libois et al. 1991). Für Beutetiere, die keine Fische waren, wurde das Gewicht aus der Literatur ermittelt (Hrabes et al. 1973, Andera & Horacek 1982, Libois et al. 1991). (Für weitere Informationen zu den verwendeten Regressionen siehe Roche 2001)
Schätzung des Fischbestands in der Umgebung
An den Standorten mit Kanälen oder Flussabschnitten wurden die Fische, so zeitnah wie möglich zur Losungsaufsammlung, durch Elektrobefischung gefangen. Ein Flussabschnitt mit einer Standardlänge von üblicherweise 100 m x 1 m wurde flussaufwärts mit einem batterie- oder generatorbetriebenen Gerät (1000 W, 220-240 V, 1,5-2,5 A pulsierender Gleichstrom mit 60-100 Hz Frequenz) befischt. An allen Probenstellen wurden die betäubten Fische in Aufbewahrungsbottiche transferiert, die Art bestimmt, gemessen, gewogen, repräsentative Schuppen entnommen und wieder ins Wasser zurückgesetzt. Bei der Probenstelle Teich/Fluss wurde zusätzlich ein 75 m2 großes Altwasser der Lainsitz (Lužnice), weniger als 0,5 km entfernt, mit einer Punktprobe befischt. Die Probenstelle Fluss wurde wenn möglich, elektrobefischt. Allerdings war das durch häufige Hochwässer und Überschwemmungen oft nicht, oder nur vom Ufer aus möglich.
Bei den Teichen war es nicht möglich, eine Elektrobefischung durchzuführen und genaue Daten zum Besatz waren auf Grund der semi-intensiven Bewirtschaftung und den langen Produktionszyklen nicht verfügbar. Der Besatz der Teiche (85 ha, 50 ha und 2 ha) wurde daher anhand von Daten der Třeboň Fisheries Ltd. und durch die Teilnahme an Abfischungen geschätzt. Für den Winter wurde angenommen, dass die Zahlen an allen Probenstellen nur die Hälfte der Werte der anderen Jahreszeiten betragen, da Fische durch leere Teiche oder die Eisdecke weniger verfügbar sind. Obwohl nicht erwartet werden kann, dass die geschätzten Zahlen genau sind, ist die Rangfolge der mittleren relativen Häufigkeit vermutlich nahe an der Realität. Die Längenverteilung und das Gesamtgewicht der Nebenfische in den Teichen (z.B. nicht kommerzielle Karpfenartige wie das Rotauge) wurden anhand von Proben die während des Abfischens genommen wurden geschätzt. (Für weitere Details siehe Roche 2001).
Beutediversität
Fünfundzwanzig Arten wurden als Bestandteil der Otternahrung identifiziert; 19 Fischarten und sechs andere Kategorien, Säugetiere, Amphibien, Vögel, Reptilien, Mollusken und Insekten (Tabelle 2a). Am vielfältigsten war das Nahrungsspektrum an der komplexen Probenstelle Teich/Fluss, am geringsten divers bei der Probenstelle Fluss. Die meisten Kategorien von nichtFisch Beutetieren wurde an der Probenstelle Teich gefunden, die wenigsten beim Fluss. Das könnte
57
jedoch auch auf die geringere Menge an gesammelten Losungen bei der Probenstelle Fluss zurückzuführen sein. Simpsons Diversitätsindex (D) zeigt, dass die Probenstelle Fluss die am wenigsten spezialisierte Beutezusammensetzung aufweist, verschiedene Beutetierarten wurden in etwa zu gleichen Teilen gefressen. Der niedrige D-Wert bei der Probenstelle Teich/Fluss weist hingegen auf eine hohe Spezialisierung auf wenige Beutearten hin (Tabelle 2a).
Saisonal gesehen zeigten die an Flüssen gelegenen Probenstellen eine höhere Spezialisierung im Herbst und Winter, und ein vielfältigeres Beuteschema im Frühling (Fluss) und Sommer (Teich/Fluss). Bei der Probenstelle Teich wurde nur eine geringe Variation zwischen den Jahreszeiten, ein leicht geringerer Wert im Winter und ein leicht höhere Wert im Herbst, beobachtet. Generell gab es daher einen Trend zu einer eher spezialisierten Ernährung in den kalten Jahreszeiten und zu einer mehr diversen Ernährung in den warmen Jahreszeiten.
Bei der Probenstelle Teich/Fluss und bei der Probenstelle Teich dominierten drei Arten (Rotauge, Karpfen und Flussbarsch) das Nahrungsspektrum tendenziell das ganze Jahr über, sowohl hinsichtlich der Häufigkeit, wie auch bei der Biomasse. Alle „anderen Fischarten“ zusammen erreichten kaum die Häufigkeit oder Biomasse dieser drei Arten (Abb. 10).
Rotaugen waren immer die häufigste Beuteart bei der Teich/Fluss Probenstelle, mit Ausnahme des Sommers, wo sie auf dem letzten Platz rangierten.
Bei der Probenstelle Teich waren die Karpfen für gewöhnlich häufiger Beute als die Rotaugen, nur im Herbst fielen sie hinter diese zurück. Karpfen wurden bei der Teich/Fluss Probenstelle am häufigsten im Sommer erbeutet und am wenigsten im Winter, wohingegen sie bei der Teich Probenstelle am häufigsten im Winter und am seltensten im Sommer erbeutet wurden. Bei beiden Probenstellen waren Karpfen jedoch immer der bedeutendste Anteil an der Biomasse.
Flussbarsche wurden ganzjährig nur in geringen Mengen erbeutet, am häufigsten im Sommer bei beiden Probenstellen (Teich und Teich/Fluss).
Andere Fischarten, als die genannten, waren bei beiden Probenstellen relativ unbedeutend, wurden aber bei der Teich/Fluss Probenstelle im Sommer in relativ hohen Zahlen erbeutet.
Karpfen und „andere“ Fische dominierten die Ernährung bei der Fluss Probenstelle das ganze Jahr über. Rotauge und Barsch spielten, bis auf den Herbst, nur eine geringe Rolle (Abb. 10). Karpfen wurden am häufigsten im Winter und am seltensten im Sommer gefangen. „Andere“ Fische wurden hingegen häufiger im Sommer als im Winter erbeutet, was einen Wechsel der Hauptbeutetiere nahelegt. Der Wechsel von hoher relativer Häufigkeit und niedriger Biomasse von „anderen“ Fischen im Winter, zu niedriger relativer Häufigkeit und hoher Biomasse im Sommer legt den
58
Schluss nahe, dass sich die Größe der erbeuteten Fische drastisch verändert. Das war auch bei anderen Probenpunkten mehr oder weniger zu beobachten, z.B. bei Barschen an der Teich/Fluss Probenstelle. Veränderungen in den erbeuteten Arten und der Größe der Beute können auf bestimmte Vorlieben, basierend auf der Häufigkeit oder Verfügbarkeit der Beute, hinweisen. Der Otter könnte seine Nahrungssuche zur Erhöhung der Energieaufnahme anpassen.
Nicht-Fisch Beute wurde an allen drei Probenpunkten am meisten im Sommer und am wenigsten im Winter erbeutet. Weiters war die Spannweite der Beutekategorien im Sommer weiter (siehe Roche 2001). Die Biomasse der Nicht-Fisch Beute war für die Teich/Fluss Probenstelle nur im Herbst bemerkenswert, für die Fluss Probenstelle nur im Frühling und Sommer. Bei der Probenstelle Teich war die Biomasse immer relativ hoch, besonders im Sommer und Herbst. Insekten wurden bei allen Probenstellen erbeutet, waren aber in puncto Biomassen nicht von Bedeutung. Nur Säugetiere (Herbst und Winter bei der Teich/Fluss Probenstelle; Frühling bei der Fluss Probenstelle) und Vögel (Sommer und Herbst bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle, Sommer bei der Fluss Probenstelle) leisteten einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtbiomasse.
Vergleich des Nahrugsspektrums des Otters mit der Fischverfügbarkeit
Für die Probenstellen Teich und Teich/Fluss waren hohe Zahlen von Rotaugen charakteristisch, entweder als Futterfische für kommerziell wichtige Raubfische besetzt werden, oder natürlich in den umgebenden Bächen und Flüssen (Teich/Fluss Probenstelle) vorkommen. Andere Fischarten wurden häufiger bei der Fluss Probenstelle als bei den Probenstellen Teich und Teich/Fluss gefunden, was die höhere Vielfalt an verfügbaren Fischarten im Fluss und die Distanz zu den Teichen unterstreicht (Abbildung 10). Überraschenderweise machten aber Karpfen (aus den Dorfteichen) einen höheren Teil der verfügbaren Nahrung aus, womöglich wegen der niedrigen Dichte von Beutetieren im Fluss. Barsche waren bei allen Probenstellen in geringen Anteilen vorhanden, trotzdem machten sie oft einen bedeutenden Anteil der Ernährung aus.
Insgesamt wurden Rotaugen bei der Teich/Fluss und Fluss Probenstelle etwa in Relation zu ihrem Vorkommen erbeutet. Bei der Teich Probenstelle wurden Rotaugen hingegen in geringeren Mengen gefressen, als zu erwarten gewesen wäre. Tatsächlich wurden sie an dieser Stelle das ganze Jahr über gemieden. Saisonal zeigten die Teich/Fluss und Fluss Probenstelle im Sommer und Frühling ein ähnliches Muster, eine negative Präferenz für Rotaugen im Sommer und keine Präferenz im Frühling. Im Winter und Herbst hingegen waren die Vorlieben gegensätzlich. Rotaugen wurden im Winter an der Teich/Fluss Probenstelle bevorzugt und bei der Fluss Probenstelle gemieden. Im Herbst hingegen bei der Teich/Fluss Probenstelle gemieden und bei der Fluss Probenstelle bevorzugt gefressen.
59
Karpfen wurden bei der Fluss/Teich und der Teich Probenstelle ganzjährig bevorzugt erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle wurden sie nur im Winter bevorzugt, im Frühling und Sommer wurden sie gemieden und im Herbst gab es keine Präferenz.
Barsche wurden an allen Probenstellen bevorzugt gefangen.
„Andere“ Fischarten wurden im Sommer und Winter an allen Probenstellen tendenziell gemieden, etwas geringer bei der Teich/Fluss Probenstelle und verstärkt an der Fluss Probenstelle. Im Frühling wurden „andere“ Fische an der Fluss Probenstelle allerdings eher bevorzugt, während sie an den anderen Probenstellen gemieden wurden. Im Sommer wurden sie an der Fluss und Teich/Fluss Probenstelle eher bevorzugt erbeutet.
Relative Häufigkeit der Fisch Größenklassen in der Nahrung und Umwelt
Die gesamten Ergebnisse (alle Arten zusammen) deuten darauf hin, dass an allen Probenstellen dieselben Größenklassen (von unter 5 cm bis über 25 cm) verfügbar waren (Abb. 11). Bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle waren kleine Fische in der Nahrung jedoch dominant (< 5 cm bei der Teich/Fluss Probenstelle und 5 – 10 cm bei der Teich Probenstelle). Große Fische hatten in allen Fällen eine geringe relative Häufigkeit.
Bei der Fluss Probenstelle waren die Größenklassen tendenziell normalverteilt, mit 10 – 15 cm als dominanter Größenklasse und 15 – 20 cm auf Platz zwei. Saisonal gesehen war die relative Häufigkeit der Größenklassen an allen Probenstellen relative konstant, mit geringem Anstieg der Häufigkeit großer Fische im Frühling und/oder Sommer.
Bei der Teich/Fluss und der Teich Probenstelle wies die relative Häufigkeit der Größenklassen in der Nahrung eine starke Schiefe in Richtung kleiner Fische auf. Kleinere Fische wurden an diesen Probenstellen das ganze Jahr über bevorzugt gefangen. An beiden Probenstellen gab es allerdings eine Tendenz zur Erbeutung höherer Anzahlen der größeren Größenklassen im Frühling und Sommer (Abb. 11), während diese im Winter und Herbst gemieden wurden.
Bei der Fluss Probenstelle orientierte sich die Ernährung an der Verfügbarkeit der Beute. Die Größenklasse 15 – 20 cm war im ganzen Jahr dominant und wurde bevorzugt erbeutet. Die Häufigkeit der kleinen Fische stieg eher im Frühling, wohingegen die Häufigkeit größerer Fisch im Sommer stieg. Kleine Fische wurden bevorzugt im Winter und Frühling gejagt, größerer Fische im Sommer und Herbst.
Zusammengefasst: An allen Probenstellen gemeinsam wurden kleinere Fische daher ganzjährig bevorzugt und größere Mengen an größeren Fischen wurden in den warmen Jahreszeiten erbeutet.
60
Rotaugen zeigten an allen Probenstellen eine ähnliche Verteilung der Größenklassen und relativen Häufigkeiten (für die Probenstelle Teich liegen nur Schätzungen vor). Die Größenklasse 15 – 20 cm war immer dominant gefolgt von den Größenklassen 10 – 15 und 5 – 10 cm. Größere Fische wurden nur sehr wenig gefangen. Die Größenklasse < 5cm wurde nur bei der Teich/Fluss Probenstelle im Sommer gefunden. Generell veränderte sich die relative Häufigkeit der Größenklassen das ganze Jahr über nur sehr gering. Bei der Teich/Fluss und der Teich Probenstelle dominierten die kleinsten Größenklassen in der Nahrung, auch wenn diese im Gewässer nicht gefunden wurden. Nur im Sommer wurde eine höhere Anzahl von größeren Rotaugen erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle stimmte die dominante Größenklasse bei den Rotaugen immer mit jener der Lebensraum überein. Die Ausnahme bildet der Frühling, wo große Zahlen sehr kleiner Fische erbeutet wurden (< 5cm Größenklasse). An allen drei Probenstellen wurden bei Rotaugen kleinere Größenklassen bevorzugt erbeutet.
Die in der Nahrung vorgefunden Karpfen stimmten mit dem Vorkommen überein, das im Lebensraum vermutet wurde. In allen Fällen scheint eine Vorliebe für die kleineren verfügbaren Größenklassen zu bestehen. Saisonal war bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle eine Tendenz zu kleineren Karpfen im Herbst und Winter (< 5cm) und größeren Karpfen im Frühling und Sommer festzustellen. Bei der Flussprobenstelle bestand das Nahrungsspektrum bei Karpfen nahezu ausschließlich aus den kleinen, aber häufigen Größenklassen (< 5cm). Nur im Frühling wurden Karpfen aus der Größenklasse 5 – 10 cm gefunden. Generell wurden kleinere Größenklassen bevorzugt, wenn vorhanden. Größere Karpfen wurden bei der Teich/Fluss und Teich Probenstelle eher in den wärmeren Jahreszeiten gefangen, und im Winter und Frühling bei der Fluss Probenstelle (aber in geringer Zahl).
Die Verfügbarkeit von Flussbarsch war bei den drei Probenstellen unterschiedlich. Drei Größenklassen, von 5 – 10 bis 15 – 20 cm waren bei der Teich/Fluss Probenstelle immer verfügbar. Größere Fische (über 25 cm) waren hauptsächlich im Frühling aber auch im Sommer und Herbst verfügbar. Während die 10 – 15cm Größenklasse dazu tendierte das ganze Jahr über zu dominieren, gab es einen Anstieg der Verfügbarkeit größerer Fische im Frühling und einen Anstieg kleinerer Fische im Herbst. In der Nahrung dominierte hingegen die 5 – 10 cm Größenklasse das ganze Jahr über und die saisonale Variation war gering. Bei der Teich Probenstelle wurde angenommen, dass eine Größenklasse vorhanden ist (15 – 20 cm). Allerdings wurden tatsächlich nur die drei kleinsten Größenklassen gefressen. Bei der Probenstelle Fluss waren dieselben drei Größenklassen vorhanden wie bei der Teich/Fluss Probenstelle. Im Winter wurden aber nur kleine Fische gefunden und im Frühling nur die größeren. Im Sommer und Herbst waren alle drei Klassen verfügbar, wobei
61
die 15 – 20 cm Größenklasse vorherrschte. An allen drei Probenstellen dominierten kleinere Fische die Nahrung, am häufigsten wurde die 5 – 10 cm Größenklasse erbeutet. Obwohl es kein klares Muster gab, wurden größere Fische eher im Sommer erbeutet. Die kleineren Größenklassen wurden an allen drei Probenstellen bevorzugt erbeutet, wenn die Nahrung mit der Verfügbarkeit übereinstimmte.
Die Verfügbarkeit „anderer Fischarten“ war je nach Probenstelle unterschiedlich. Bei der Teich/Fluss Probenstelle waren vier Größenklassen das ganze Jahr verfügbar, wobei die 5 – 10 und die 15 – 20 cm Größenklassen dominierten. Während des Sommers waren große Mengen an Fischen > 25 cm verfügbar. Die Ernährung konzentrierte sich jedoch ganzjährig auf kleinere Fische. Die meisten Fische < 5 cm wurden im Winter und Sommer erbeutet, 5 – 10cm im Herbst und Frühling. Bei der Teich Probenstelle wurde angenommen, dass drei Größenklassen verfügbar sind, mit einem leichten Anstieg größerer Fische im Frühling. Die gefressenen Fische waren fast alle aus den kleineren Größenklassen, jedoch mit einem Trend zu größeren Fischen im Frühling und Sommer. Fische über 25 cm Länge wurden nur im Sommer erbeutet. Bei der Fluss Probenstelle waren alle Größenklassen verfügbar, die mittleren und größeren Größenklassen waren gleich häufig. Generell hielt sich dieses Muster das ganze Jahr über, jedoch mit einer leichten Verschiebung zu einer höheren Verfügbarkeit an größeren Fischen im Frühling und Sommer.
Im Frühling und Sommer spiegelte die Zusammensetzung der Nahrung generell die Verfügbarkeit wieder. Im Sommer und Herbst hingegen gab es einen auffälligen Wechsel zu größeren Fischen, im Herbst wurden nur Fischer über 25 cm erbeutet. Generell wurden kleinere Größenklassen immer bevorzugt gefangen. Bei der Fluss Probenstelle wurden im Winter und Fluss hingegen fast alle Größenklassen ohne Unterschied gefangen, es wurde also jeder Fisch, der gefunden werden konnte, erbeutet. Ein generelles Prinzip war, dass kleine Größenklassen bei allen Beutearten präferiert und bevorzugt gejagt wurden. Im Frühling und speziell im Sommer fand eine Verschiebung in Richtung größerer Fische statt. Nur bei der Probenstelle Fluss wurden alle Größenklassen von anderen Fischen ohne Unterschied fast das gesamte Jahr gejagt.
Jagdverhalten
Das Nahrungsspektrum des Fischotters enthielt immer ein Spektrum kommerziell bedeutender Teichfische (Karpfen) und kommerziell unbedeutender Fische, auch wenn die Probenstelle weit entfernt von einem Teich oder Fluss lag. Das streicht die Vorliebe des Fischotters für eine Reihe von verschiedenen Futterplätzen in seinem Revier hervor. Das schafft Sicherheit in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit (z.B. während des Abfischens) und erlaubt es dem Otter auch von Überflüssen (z.B.: Überwinterungsteiche oder Laichschwärme) zu profitieren. Es stellt auch sicher,
62
dass der Fischotter die einzelnen Futterplätze nicht ausbeutet.
Die Angreifbarkeit eines Fisches hängt davon ab, ob er nacht- bzw. tagaktiv ist, sich im Freiwasser oder in Deckung befindet (Carss 1995). Adulte Fische sind oft verwundbarer wenn sie gerade aktiv werden und junge Fische wenn sie für die Nacht Schutz suchen (Copp & Jurajda 1993).
Die Bedeutung junger Rotaugen bei der Probenstelle Teich/Fluss im Spätsommer und Frühherbst, wenn im Zuge der Abfischung große Mengen in den Ablaufgräben auftreten, erklärt sich dadurch, dass diese Fische in den engen Gräben zwar einen gewissen Schutz vor räuberischen Fischen finden, in diesem beengten Raum aber zu einer leichten und attraktiven Beute für den Fischotter werden. Tatsächlich legte diese Studie dar, dass kleine Fische generell ein bevorzugtes Beuteobjekt des Fischotters sind, besonders bei der Probenstelle Teich/Fluss. Während Flussbarsche bei allen Probenstellen nur in geringen relativen Zahlen vorkommen, stellten sie trotzdem einen bedeutenden Anteil der Nahrung dar, was frühere Studien bestätigen. Raubfische werden generell im Morgengrauen und der Abenddämmerung aktiv, wenn Beutefische schlechter sehen können. Das ist auch die Zeit in der der Fischotter bevorzugt jagt. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Barsche, die eine für den Otter ideale Größe haben, gerade zu dieser Zeit für ihn am meisten verfügbar werden. Aus diesem Grund können Flussbarsche auch bei einer Elektrobefischung während des Tages unterschätzt werden.
Es besteht im Allgemeinen die Annahme, dass Fischotter Fische zwischen 10 und 20 cm bevorzugen und Fische in Relation zu deren Vorkommen im Lebensraum erbeuten (siehe Chanin 1988). In der gegenständlichen Studie hingegen wurden kleine Fische immer häufiger gefangen (Teich/Fluss < 5 cm; Teich = 5 – 10 cm), außer im Sommer wo eine Verschiebung zu größeren Fischen stattfand (aber die 5 – 10 cm Größenklasse blieb vorherrschend). Nur an der Probenstelle Fluss stimmten die bejagten Größenklassen mit den im Lebensraum vorhandenen ungefähr überein. Die bevorzugt erbeutete Größenklasse war 15 – 20 cm. Auch wenn zwei Größenklassen von Karpfen vorhanden waren, wurde die kleinere bevorzugt gefangen. Bei Studien in kleineren Fischteichen im Böhmisch-Mährischen Hochland und Österreich fanden Knollseisen (1955) und Polednik et al. (2007a), dass Otter dazu tendieren Fische unter 10 cm zu fangen und obwohl grundsätzlich Karpfen jeder Größe erbeutet werden, werden kleinere Karpfen am häufigsten gefangen. Allerdings weist Adámek et al. (2003) darauf hin, dass große Karpfen bei der Losungsanalyse unterschätzt werden. Die Kadaver werden gelegentlich am Ufer zurückgelassen und nur teilweise gefressen (oft werden keine harten Bestandteile gefressen). In einer Studie über die Ernährung im Herbst in kleinen Bächen Südböhmens, bemerkte auch Jurajda et al. (1996), dass
a) die meisten gefressenen Fische < 20 cm waren;
b) „nicht-Fisch“ Beute, besonders kleine Säuger
63
und Vögel, bis zu 38 % der Beute ausmachen kann; und c) erbeutete Arten und Größen den im Lebensraum vorhandenen ähneln, so wie bei der Probenstelle Fluss in der Třeboň Studie.
Bei bestimmten Fischarten ändert sich die Aktivität saisonal, entweder zum Laichen oder Überwintern. Viele Süßwasserarten (z.B.: Rotaugen) versammeln sich im späten Frühling bis Frühsommer in großer Zahl, um in seichten Uferzonen abzulaichen. Aufgrund ihrer hohen Anzahl und schlechten Kondition nach dem Ablaichen, können solche Fische eine bevorzugte Beute des Otters werden, dadurch kann möglicherweise auch die Zunahme größerer Arten im Nahrungsspektrum im Frühjahr und Sommer erklärt werden. Wenn die Temperaturen fallen, werden viele Arten umgekehrt inaktiv und bilden große Schwärme in Becken und Buchten. Manche, wie der Karpfen, ruhen am Grund des Teichs in einer Art Halb-Winterschlaf. Dadurch werden diese Arten zu einer einfachen Nahrungsquelle für den Fischotter, zu einer Zeit wenn Beute generell rar ist.
Um dem Absinken des Sauerstoffgehalts unter der Eisdecke im Winter entgegen zu wirken, schneidet die Třeboň Fisheries Ltd. große Löcher in das Eis. In milden Wintern mit geringem Schneefall dürfen viele Teiche, bis auf jene mit den empfindlichsten Fischen, hingegen zufrieren. Das dürfte eine wichtige Futterquelle für den Otter zunichte machen, besonders wenn sein Revier um solche Teiche herum angelegt ist und das Habitat andere große Beutequellen vermissen lässt. Die Flussabschnitte an der Teich/Fluss und Fluss Probenstelle hingegen beinhalten schnell fließende Abschnitte und es stehen daher den ganzen Winter offene Wasserflächen zur Verfügung. Bei der Teich und Fluss Probenstelle, wo Futter im Winter beschränkt verfügbar ist, stieg die Jagd auf Karpfen auf den höchsten Wert. Bei der Teich/Fluss Probenstelle hingegen, wo Nahrung auch im Winter immer verfügbar war, sank die Jagd auf Karpfen auf den niedrigsten Wert. Umgekehrt stieg der Anteil der Rotaugen an der Nahrung, an dieser Probenstelle, im Winter auf den höchsten Wert. Das würde nahelegen, dass Fischotter an der Teich/Fluss Probenstelle ihre Hauptjagdgründe in stehende Gewässer und Nebenarme verlegten und im Winter bevorzugt überwinternde Rotaugen erbeuteten. Beobachtungen von Föerster (1996) bestätigen das. Er fand heraus, dass der Jagderfolg des Otters höher ist, wenn er den Winter in stehenden Gewässern und Nebenarmen der Flüsse, als im Teich verbringt.
Die Nahrungssuche im kalten Wasser bringt für den Otter einen erheblichen Energieaufwand mit sich. Unter bestimmten Umständen können Otter daher nahrungslimitiert und anfällig für Schwankungen in der Nahrungsverfügbarkeit sein. Das heißt, dass bestimmte Jagdgebiete in Zeiten niedriger Beuteverfügbarkeit oder niedriger Wassertemperaturen unrentabel werden können, besonders im Hochland. In diesen Zeiten müssen Otter ihre Streifzüge ausweiten, in anderen
64
Habitaten jagen oder auf andere, weniger bevorzugte, Beute umstellen (Roche 1997). Föerster (1996) schätzte, dass während der Untersuchungen alle Otter im Umkreis von 16 km die Stillwasserzonen von Gewässern zu einer gewissen Zeit im Winter besuchten um zu fressen, besonders in den kältesten Monaten, Jänner und Februar. Zumindest elf verschiedene Otter benutzten die Stelle, zumeist Weibchen mit Jungen (Föerster 1996). Heggegberget (1994) fand heraus, dass weibliche Otter kleinere Fische fraßen als die die sie für ihre Jungen fingen. Da große Fische zuerst zum Ufer gebracht werden müssen, um sie zu überwältigen und zu fressen und kleine Fische üblicherweise im Wasser gefressen werden (Kruuk 1995), senkt dies den Energieaufwand des Weibchens beträchtlich, weil die Zeit effektiver genutzt werden kann. Dieses Verhalten spiegelt den erhöhten Energiebedarf des Weibchens im Winter wieder, wenn die Jungen noch unerfahrene Jäger sind. Wenn die Temperaturen fallen, steigt der Energiebedarf der Otter beträchtlich (Kruuk & Carss 1996) und da geschätzt wird, dass Otter ungefähr 12 – 15% ihres Körpergewichts (im Winter vermutlich noch mehr) dazu benötigen, um ihre Körpermasse zu erhalten (Carss et al. 1990, Chanin 1988, Kruuk et al. 1993), kann erwartet werden, dass sie die effizientesten Jagdmethoden verwenden. Es erscheint so, dass in diesem Fall die extrem hohe Konzentration von leicht zu fangendem Fisch, die Stillwasserzonen zu einem so profitablen Jagdgebiet macht. In harten Wintern fressen nicht nur lokale Otter fast ausschließlich an diesen Stellen, sondern diese tolerieren auch die Anwesenheit andere Otter, zumindest bis sich die Verhältnisse wieder bessern. Die auf Besuch befindlichen Otter können dadurch, zu einer Zeit in der Nahrung in ihren eigenen Revieren knapp ist, nicht nur sich selbst sondern auch ihre Jungen ernähren. Nicht alle Otter im Gebiet nutzten die Bucht als ihre Hauptnahrungsquelle, aber es ist möglich, dass jene die dies nicht taten, von der Abwesenheit anderer Otter, durch zeitlich erweiterte Reviere und verfügbarer Nahrung in Teichen, profitiert haben. Dieses Verhalten konnte nur in sehr harten Wintern beobachtet werden, niemals in „normalen“ Wintern.
Um in einem zugefrorenen Teich im Winter zu jagen, muss der Otter unter dem Eis schwimmen bevor er einen Fisch fängt und danach zu seinem Einstiegspunkt zurückkehren. Das ist klarerweise ein aufwendiger Prozess, der Energie kostet. Zudem steigen die Energiekosten im Winter zusätzlich mit der Notwendigkeit die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Man würde daher erwarten, dass der Otter, falls keine profitableren Jagdgebiete (Stillwasserzonen) vorhanden sind, die zu dieser Zeit profitabelsten Fische im Teich (oder Fluss) jagt. Tatsächlich stieg die Jagd auf Karpfen im Winter bei ertragsarmen Stellen im Biosphärenreservat stark an (z.B.: die Teich und Fluss Probenstelle).
Obwohl die Otter der Fluss Probenstelle gewisse Distanzen überwinden mussten, um ihre Jagd auf Karpfen im Winter auszuweiten, kehrten sie gewöhnlich zur Kernregion ihrer Reviere zurück und
65
fingen zahlreiche, in Stillwasserzonen und Kolken überwinternde, Cypriniden. Dieses „Central Place Foraging“ (Begon & Mortimer 1986) setzt relativ kleine Reviere voraus und ist nur möglich, wenn die Beute in hoher Stückzahl verfügbar und zerstreut in der Landschaft verteilt ist. Um solche profitablen Futterstellen zu nutzen, muss der Otter seine, in Flusslandschaften für gewöhnlich linienförmigen Jagdgründe (Roche et al. 1995), bedeutend vergrößern, oder ganzjährig ein größeres Revier unterhalten und bestimmte Regionen (profitable Futterstellen) im Winter öfter als gewöhnlich aufsuchen. Bei einer heterogenen Landschaft kann das zu einer temporären Ansammlung von Ottern an solchen profitablen Futterstellen führen, wie dies an der Teich/Fluss
Probenstelle beobachtet werden konnte.
Kruuk (1995) behauptete, dass in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit weniger beliebte Beutetiere (alles außer Fisch) öfter in der Nahrung zu finden sind, im Zuge der Untersuchungen im Biosphärenreservat war solche Beute im Winter allerdings fast nie in der Nahrung zu finden. Obwohl Fische saisonal in manchen Gegenden des Biosphärenreservats manchmal weniger häufig (oder verfügbar) waren, schienen sie niemals limitierend zu sein.
Bei seiner Studie der Ernährung von Ottern in kleinen Teichen entlang der österreichischtschechischen Grenze, bemerkte Polednik et al. (2007a) eine hohe Variation (10 – 90%, im Mittel 35 %) im Anteil kommerzieller Fische in der Nahrung der Otter. „Nicht-Fisch“ Beute wie Amphibien (Frösche – Maximum 49%) und Krebse (maximal 40%) waren oft die größte Gruppe alternativer Beutetiere. Die Autoren kommen nicht nur zum Schluss, dass eine hohe Häufigkeit von Ottersichtungen an einem Teich und eine hohe Anzahl von Otterspuren nicht unbedingt auf einen hohen Schaden bei kommerziellen Fischen schließen lassen, sondern auch dass, wie in dieser Studie, die Jagd auf kommerzielle Fische durch die gute Verfügbarkeit alternativer Nahrung verringert werden kann.
Otter scheinen in Südböhmen in einer optimalen Weise zu jagen. Sie wechseln Beute und Jagdgebiet in Reaktion auf Veränderungen in der Rentabilität. Otter verwenden jene Jagdgründe, die sowohl räumlich als auch zeitlich (innerhalb des Reviers, innerhalb der Futterstellen und/oder saisonal) die profitabelste Beute bieten und maximieren dadurch ihre Nettoenergieaufnahmerate.
Hauptaussagen
• Fische waren die Hauptbeute bei allen Probenstellen, mit einem Anteil von immer über 85% in der Nahrung. Der Fischotter hatte immer eine Reihe an kommerziellen Teichfischen (Karpfen) und nicht kommerziellen Arten im Nahrungsspektrum, auch wenn der Aufsammlungsort weit von einem Fischteich oder Fluss entfernt lag. Daszeigt die Vorliebe
66
des Otters für eine Reihe unterschiedlicher Futterplätzen in seinem Revier. Das schafft Sicherheit in Zeiten geringer Nahrungsverfügbarkeit (z.B. während des Abfischens) und erlaubt es dem Otter auch von Überflüssen (z.B.: Überwinterung oder Laichschwärme) zu profitieren. Zudem beutet der Otter aif diese Weise seine Nahrungsgrundlage nicht zu stark aus.
• In den kälteren Jahreszeiten tendierten Otter an der Teich/Fluss und Teich Probenstelle dazu eine größere Artenvielfalt an Fischen ins Nahrungsspktrum aufzunehmen. Bei der Fluss Probenstelle fing der Otter weniger Arten und spezialisierte sich mehr. Obwohl Rotaugen tendenziell die am häufigsten gefangen Fische war, trugen Karpfen (insgesamt und saisonal) am meisten zur Biomasse bei (Teich/Fluss und Teich Probenstelle). Bei der Fluss Probenstelle stellten andere Fische allerdings den größten Anteil an der Biomasse insgesamt.
• „Nicht-Fisch“ Beute wurde an allen Probenstellen in niedriger relativer Häufigkeit gefangen, außer im Sommer. Insekten waren an allen Probenstellen die am häufigsten gefressene Beuteklasse in den warmen Jahreszeiten, im Bezug auf die Biomasse aber vernachlässigbar. In den warmen Jahreszeiten war die „nicht-Fisch“ Biomasse relativ hoch, Vögel und Säuger machten davon den Großteil aus.
• An allen Probenstellen wurden Fische jeder Größe gefangen (< 5 cm bis > 25 cm). Bei der Teich/Fluss Probenstelle und Teich Probenstelle wurden kleine Fische jedoch am häufigsten gefangen. Im Frühling/Sommer gab es eine Verschiebung zu größeren Fischen (aber die 5 –10cm Größenklasse blieb dominant). Nur an der Fluss Probenstelle entsprachen die gejagten Größenklassen in etwa jenen im Lebensraum Die dominante Beuteklasse war 15 – 20 cm. Kleine Fische wurden bevorzugt im Winter gefangen, wenn vorhanden, da die „Bearbeitungszeit“ pro Fisch gering ist und dadurch der Energieverbrauch niedrig gehalten werden kann. In warmen Monaten ist der Energiebedarf generell niedriger und große Fische wurden häufiger gefangen.
• Bei der Teich und der Fluss Probenstelle, wo Nahrung im Winter limitiert sein kann, stieg die Jagd auf Karpfen im Winter an, wohingegen bei der Teich/Fluss Probenstelle, wo Nahrung im Winter immer verfügbar ist, die Jagd auf Karpfen auf das niedrigste Niveau sank.
• Wenn Teiche mit einem Fluss oder Gerinne verbunden sind, kann der Zeitpunkt der Abfischung einen starken Einfluss auf die Verfügbarkeit von Fischbiomasse rund um den Teich im Herbst und Winter haben. Eine große Zahl an kleinen Fischen stellt ein attraktives
67
Nahrungsangebot für den Otter dar und reduziert die Anzahl an gefressenen wirtschaftlich bedeutenden Fischen. Tatsächlich werden kleine nichtkommerzielle Arten vom Otter immer erbeutet wenn sie verfügbar sind und senken nachweislich die Jagd auf größere kommerzielle Arten.
• Otter reagieren auf Änderungen der Rentabilität von Futterplätzen oder Beutearten. Sie nutzen die Futterplätze, die die profitabelste Beute bieten, sowohl räumlich als auch zeitlich gesehen (innerhalb des Reviers, innerhalb der Futterstellen und/oder saisonal). In anderen Worten maximieren sie ihre Nettoenergieaufnahmerate über die Zeit, in dem sie Futterplätze oder Beutetypen wechseln.
Die Fischzucht in der Tschechischen Republik
Die Teichwirtschaft hat in der Tschechischen Republik eine lange Tradition, die bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Zurzeit gibt es im Land etwa 50.000 Teiche mit einer Gesamtfläche von ca. 520 km2. Generell gibt es zwei unterschiedliche Arten der Teichbewirtschaftung, die sich, vor allem durch die Größe der Teiche und die Produktivität der Teiche, unterscheiden. Der größte Teil der produktiven Karpfenteiche liegt entlang des Tieflandflusses Lainsitz (Lužnice) in Südböhmen, während die höher gelegenen Teiche im böhmisch-mährischen Hochland und an den Rändern
Südböhmens eher klein, verstreut und von niedriger Produktivität sind, ähnlich zu den Teichen in Österreich (Abb. 11).
In Südböhmen hat sich, während mehr als sieben Jahrhunderten der Bewirtschaftung, ein komplexes Netzwerk von verbundenen Teichen, Zu- und Ableitungskanälen, Bächen, Marschen, Mooren und Feuchtwiesen zu einem einzigartigen und höchst produktiven künstlichen Feuchtgebietslebensraum entwickelt. Die 460 künstlichen Teiche im Třeboň Biosphären Reservat und Landschaftsschutzgebiet (Třeboň BR & PLA), reichen zum Beispiel von 0,1 bis 450 ha und bedecken insgesamt über 7.000 ha, das sind ungefähr 10 % der Fläche der Třeboň BR & PLA. Die Teiche sowie die umliegenden Kanäle, Flüsse und Kleingewässer sind hochproduktiv und beinhalten eine dichte Populationen an Fischen, Amphibien und Vögeln. Ungefähr 84 % dieser Teiche (6.289 ha) werden von einem Unternehmen der Třeboň Fisheries Ltd verwaltet. Die meisten Teiche haben naturnahe Ufer, umgeben von Wald und Sträuchern, die eine wichtige Barriere gegen Einträge aus der Landwirtschaft darstellen und den optischen Anreiz erhöhen, sowie mit einer hohen Biodiversität der Feuchtgebiete und Lebensräume einen bedeutenden Wert für die Umwelt darstellen. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Teil des traditionellen, kulturellen und landschaftlichen Erbes der Region. Auf der einen Seite die Balance der hohen natürlichen
68
Biodiversität und wertvolle natürliche Lebensräume zu bewahren und auf der anderen Seite einen profitablen Wirtschaftszweig zu entwickeln, hat zu unvermeidlichen Konflikten geführt (Roche 2001, 2004).
Fischzucht in höher gelegenen Teichen ist weit weniger produktiv und die Teiche sind aufgrund geomorphologischer und klimatischer Randbedingungen über eine große Fläche verteilt. Die Teiche sind viel kleiner (typischerweise 0,1 – 1 ha), haben kahle Ufer und sind gewöhnlich ausschließlich mit Karpfen besetzt, allerdings können auch geringe Mengen von Schleie, Hecht und Zander besetzt werden. Die Teiche werden normalerweise nach einer längeren Zeit (2 – 3 Jahre und mehr) als die Tieflandteiche abgefischt. In den letzten drei Jahrzehnten wurden in dieser Region viele neue Teiche angelegt, da der gesteigerte Wohlstand zu einer größeren Zahl an „Hobby“-Teichwirten geführt hat.
Teichwirtschaft im Flachland umfasst generell drei Schritte in der Teichbewirtschaftung, welche seit ihrer Entwicklung im 14. Jahrhundert weitgehend unverändert geblieben sind. Karpfen werden nacheinander in drei Gruppen von Teichen aufgezogen, die entweder jährlich oder alle zwei Jahre abgefischt werden. Aufzuchtteiche sind bis zu 1 ha groß und 0,5 m tief (und werden später im Jahr oft als Überwinterungsteiche, mit höherer Wassertiefe, genutzt) und produzieren die Fische des ersten Jahres. Teiche zum Übersommern sind bis zu 10 ha groß, dort werden die 2-jährigen Karpfen aufgezogen. Abwachsteiche mit zumindest 50 – 100 ha Fläche und 2 m Tiefe werden mit 2-jährigen Fischen besetzt, die zu 3-4 jährigen Fischen mit einem Verkaufsgewicht von 1,5-3 kg heranwachsen (Edwards 2007, Roche 2004a).
Die typische Polykultur wird dominiert vom Karpfen (50 – 90 %), gefolgt von asiatischen Karpfen (Marmorkarpfen (Hypophthalmichthys nobilis), Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), und Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix)) mit 10 – 30 %, einigen wenigen Prozenten an Raubfischen (Hecht, Zander und europäischen Wels) und anderen Arten wie Schleien. Weißfische wie Rotaugen und Güster werden häufig als Beutefische für die Raubfische besetzt.
Um die 70 – 75 % der Nahrung für die Fische stammt von proteinreicher Naturnahrung (Plankton, Benthos) und 25 – 30 % von Zufütterung mit energiereichem Getreide (Gerste, Mais, Weizen).
Gewöhnlich wird Rindermist verwendet um die Teiche zu düngen, auch Schweine- und Geflügelmist kann in Gebieten verwendet werden, wo das Vieh in Bodenhaltung aufgezogen wird.
Auf manchen der größeren Teiche wurde sehr intensive Entenzucht betrieben, aber Krankheitsausbrüche in der Vergangenheit haben diese Praxis wieder vermindert. Die meisten Enten werden aufgezogen um spezielle Teiche für Jäger zu besetzten. (Roche 2001, 2004).
Fische werden im Frühjahr, Sommer und (hauptsächlich) im Herbst mit Wadennetzen gefangen. Bei
69
der letzten Ernte zum Ende des Jahres, wird der Wasserstand des Teiches abgesenkt und die Fische sind dazu gezwungen in die Fischgrube zu schwimmen. Die Erträge sind relativ gering, sie reichen von 600 – 1.500 kg/ha in großen Teichsystemen bis zu 300 – 600 kg/ha in kleineren Teichen (Edwards 2007). Während des Winters bleiben etwa 23 % der Teiche leer, um den Boden regenerieren zu lassen und Parasiten abzutöten. Die größte Menge der Karpfenproduktion wird zu Weihnachten, für das traditionelle Weihnachtsabendessen, lebend verkauft. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage im Land jedoch nachgelassen, da sich die Geschmäcker verändern. Der Großteil der Karpfen wird nun exportiert. Die veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten der Karpfenteichwirtschaft hat einige Teichbesitzer auch dazu bewogen, auf neue Produktionsbereich umzustellen. Manche Teiche werden zu Angelteichen gemacht, speziell für das immer beliebtere Sportfischen auf Karpfen.
Schäden am Fischbestand
Interessenvertreter
Es gibt eine ganze Reihe an Interessensgruppen wenn von Otterschäden an Fischteichen die Rede ist. Jede davon hat eine andere Ansicht dazu wie a) Schäden beurteilt, vermieden und/oder kompensiert werden und zu b) Otterschutz und Schutzmaßnahmen generell.
Hauptberufliche Teichwirte, die ihr Geld primär mit Aquakultur (Karpfen) verdienen, sind eher im Flachland von Südböhmen angesiedelt. Die meisten sind Mitglieder von Firmen oder Organisationen und die Teiche sind meist mittel bis groß und in verbundenen Teichsystemen konzentriert. Teilzeit oder „Hobby“-Teichwirte besitzen meist nur ein paar kleine Teiche, die über ein ganzes Flusssystem verteilt sind. Moravcová (2002) bemerkte dass 93 % der kleinen Teiche < 5 ha, und 65 % davon weniger als 1 ha groß sind. Die Mehrheit davon liegt in höher gelegenen landoder forstwirtschaftlichen Landstrichen, die verglichen mit dem Flachland, weniger gute Bedingungen bieten. Obwohl der tschechische Teichwirteverband für alle offen steht, sind seine Mitglieder vor allem professionelle Teichwirte mit großen oder mittleren Teichen.
Die tschechische und mährische Fischerunion zusammen vertreten mehr als 300.000 Angler. Die Vereine sind in lokalen und regionalen Gruppen organisiert die von einer Zentralstelle koordiniert werden. Fischerei findet in fast allen Fließgewässern und ausgewählten Stauseen und Teichen statt. Zusätzlich Angelfischerei, besitzen oder pachten viele Ortsgruppen Teiche zur Produktion von Karpfen oder andere Arten, die dem Besatz von leergefischten Gewässern oder dem Verkauf dienen (Poledníková et al. 2006).
70
Staatliche Organisationen, einschließlich des Umweltministeriums, die für die Umsetzung und Adaptierung von Gesetzen (einschließlich das Hinzufügen von Ausnahmen), die die Natur betreffen (inkl. Otter) zuständig sind, das Landwirtschaftsministerium, dass Förderungen an die Teichwirte vergibt und landwirtschaftliche Belange betreut, lokale und regionale Behörden, die die Kompensationsgesetze vor Ort umsetzen und die Agentur für Natur- und Landschaftsschutz, das ausführende Organ des Umweltministeriums, die den Schutzstatus einer Spezies festlegt, erstellen Managementpläne (in Kooperation mit NGOs und Wissenschaftlern), etc. Im Jahr 1988 gründete die Agentur eine Station für Tierschutz für die Aufzucht und Wiedereingliederung von verlassenen und verletzten Tieren (besonders Otter), Naturschutzforschung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Station wird zurzeit privatwirtschaftlich betrieben.
Zwei bedeutende NGOs waren in viele Aspekte des Otterschutzes und der Teichwirtschaft involviert, der „Czech Otter Foundation Fund“ (gegründet 1993) und „Alka Wildlife o.p.s.“ (gegründet 2007). Die „Foundation“ ist zur Zeit vor allem in der Ausbildung, bei Veröffentlichung, im Monitoring und bei der Bereitstellung von Expertengutachten zu Schadensansprüchen tätig, während „Alka“ die meisten wissenschaftlichen Aktivitäten und die Erstellung der Ottermanagementpläne übernommen hat.
Einige höhere Bildungs- und Forschungsanstalten waren auch involviert, entweder alleine oder in Kooperation mit den oben genannten Organisationen. Von diesen verdienen folgende eine lobende Erwähnung: Die Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, die Fakultät für Fischerei und Gewässerschutz (Vodňany), die Berufsfischerschule in Třeboň, und verschiedene Universitäten (z.B.: Masaryk (Brünn), Palacký (Olmütz), und die Universität von Südböhmen, Budweis.
Sichtweisen der Interessenvertreter
Für eine erfolgreiche Anwendung und zukünftige Verbesserung von Ausgleichsmaßnahmen, die sich auf Konflikte zwischen geschützten Arten und menschlicher (wirtschaftlicher) Aktivität konzentrieren, ist es unumgänglich, die Einstellung der Interessenvertreter zu Schutzstrategien und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu verstehen. Um sich mit diesem Problem zu befassen, wurde in der Tschechischen Republik eine Reihe von großen Fragebogen/Interview-basierten Studien durchgeführt, welche die Meinungen, Vorstellungen und den Wissensumfang der Teichwirte, Angler und Schutzorgane in Bezug auf das Jagdverhalten des Otters erheben sollten (Novotná 1998, Moravcová 2002, Spurný et al. 2003, Václavíková et al. 2011; siehe auch Poledníková et al. 2006 für eine weiterführende Diskussion). Allgemein sind die Ergebnisse dieser
71
Studien alle sehr ähnlich, deshalb sind nur die Hauptpunkte nachfolgend zusammengefasst (mit Schwerpunkt auf der letzten Umfrage).
• Die Mehrheit der Fischer glauben, dass die Fischverluste in den letzten Jahre kontinuierlich angestiegen sind. Viele glauben, dass es zu viele Fischräuber gibt, diese sollen nicht länger gesetzlich geschützt und aktiv unter Kontrolle gehalten werden, entweder durch Erlegen oder Umsiedlung. Otterschützer sind damit aus einer Reihe an Gründen nicht einverstanden. Erstens, Otter bevorzugen Orte mit den besten Habitaten und Jagdgebieten, wenn Otter von guten Habitaten entfernt werden, übernehmen bald andere Tiere ihren Platz. Wiederholte „Entfernung“ würde bald ernsthafte Auswirkungen auf die Population haben. Außerdem können weibliche Otter das ganze Jahr über Nachwuchs bekommen, in vielen Bereichen ihres Territoriums ist die Population noch immer nicht stark genug, um sowohl illegale, als auch legale Tötungen zu verkraften und Umsiedlungen verschieben das „Problem“ nur in eine andere Region.
• Die am meisten beschuldigten Fischräuber sind der Kormoran (Phalacrocorax carbo), der Graureiher (Ardea cinerea) und der Otter. Beachtenswert ist, dass in früheren Umfragen der Otter noch vor dem Reiher und Kormoran lag. Andere Faktoren die gelegentlich ernsthafte Bedeutung erreichten, waren Krankheiten und Wilderei. Manche, besonders die Angler, weisen auf die geringen Fischpopulationen in Fließgewässern, aufgrund verarmter Habitate (z.B. Begradigung) hin, welche die Fischerei sowohl in Flüssen, als auch in Fischteichen beeinflusst. Laut den privaten Eigentümern verursacht der Otter die größten Schäden, gefolgt von der natürlichen Sterblichkeit. Wilderei und der Reiher verursachten in etwa denselben Schaden, während Kormorane und andere Faktoren nicht bedeutend zum Schaden beitrugen. Große Teichwirtschaften betrachteten den Otter nicht als das größte Problem, sondern waren weitaus stärker vom Kormoran betroffen.
• Der durchschnittliche Anteil des Schadens der durch den Otter verursacht wurde, variierte in den unterschiedlichen Fischergruppen zwischen 7 und 17 %, wobei Otter selten für > 50 % des Gesamtschadens verantwortlich waren. 35 % der Fischer erlitten keine Verluste durch den Otter. Entweder weil Otter nur selten vorbeikommen, Vorsorgemaßnahmen ergriffen wurden oder der Schaden durch den Otter im Vergleich zu anderen Räubern vernachlässigbar gering war. (Alle Daten von Václavíková et al. 2011)
• Die Sichtweise der Otterschäden durch Berufs- und „Hobby“-Teichwirte wird von drei Hauptfaktoren beeinflusst: a) die relative Menge der Schäden im Verhältnis zu anderen
72
Räubern, b) Grad der persönlichen Beteiligung („Hobby“-Teichwirte sind emotional viel stärker mit dem Ergebnis der Teichwirtschaft verbunden und betreiben die Teichwirtschaft weniger aus finanziellem Interesse, als aus persönlicher Befriedigung) und c) die Größe und der wirtschaftliche Hintergrund des Unternehmens (dieselbe Schadenssumme kann für große professionelle Teichwirtschaften nur einen kleinen Profitverlust darstellen, für kleine Teichwirte allerdings einen Totalausfall des Profits bedeuten).
• Viele Teichwirte (hauptsächlich Hobbyteichwirte) sehen den Otter nur als „Killer“, der einen ganzen Teich in kurzer Zeit leer fressen kann. Der Otter wird oft beschuldigt, Fische nur aus Lust am Töten und nicht zum Überleben zu fangen. Weniger radikale Teichwirte, speziell jene die zu großen Fischereibetrieben gehören, akzeptieren die Anwesenheit des Otters als Teil der Umwelt und als einheimische Tierart, fordern aber dennoch eine Regulation der Population.
• Die Einstellung der Teichwirte zu nicht-tödlichen Präventivmaßnahmen (z.B. Elektro- oder Fixzäune, Vergrämungsmaßnahmen, Ablenkteiche, etc.) ist generell negativ, nur 25 % der Teichwirte, deren Teiche regelmäßig von Ottern besucht werden haben präventive Maßnahmen ergriffen. Tschechische Teichwirte erhalten keine finanzielle Unterstützung für Präventivmaßnahmen. Generell empfinden die Teichwirte die Kosten für Präventivmaßnahmen als zu hoch und die Methoden als komplett ineffektiv. Wo solchen Maßnahmen allerdings an kleinen Teichen getestet wurden, haben sie sich als hoch effektiv erwiesen (z.B. 100 % Effektivität bei Elektrozäunen (wenn adäquat gewartet) und ein Wechsel der Futterstelle und der bevorzugten Beute, wenn Ablenkteiche, besetzt mit kleineren nicht-kommerziellen Fischarten, zur Verfügung gestellt wurden; Bodner 1995). Es gibt zwar die Möglichkeit einer Finanzierung durch die EU, die bürokratischen Hürden sind aber für den durchschnittlichen Teichwirt zu hoch.
• Die Bekanntheit des Gesetzes zur Schadenskompensation war unter den Teichbesitzern relativ hoch. Bei denen, die tatsächlich um Kompensation ansuchen, gibt es große Unterschiede zwischen Hobby- und Berufsteichwirten. Von den kleinen Teichwirten suchen nur 10 % um Kompensation an. Im Vergleich dazu bemühen sich 75 % der kommerziellen Unternehmen um eine Kompensationszahlung. Kleine Teichwirte beschweren sich über unnötige Bürokratie und sind nicht immer sicher, wie sie Kompensationen beanspruchen oder Schäden nachweisen können („Hobby“-Teichwirte haben oft keine Belege über den Fischbesatz in den Teichen). Die meisten Privatbesitzer beschweren sich, dass das Gesetz nur den momentanen Schaden berücksichtigt und nicht den potentiellen Profit, z. B. den
73
Wert der Fische bei Verkaufsgröße. Es gibt ein generelles Misstrauen gegenüber Naturschutzverantwortlichen.
• Teichbesitzer betonen häufig, dass die Teiche vordergründig als wirtschaftliche Betriebe, mit Zusatznutzen für die Umwelt, existieren, während Naturschützer den Wert der Teiche für die Umwelt betonen, ohne an wirtschaftliche Aspekte zu denken. Umweltaspekte werden weiters als der Allgemeinheit gehörend gesehen, während Teichwirte betonen, dass die Teiche und der Besatz ihr Eigentum sind.
• Lokale Regierungen, Fischer und Naturschützer stimmen darüber überein, dass es einen Wechsel von Kompensation zu Präventivmaßnahmen geben muss. Naturschützer schlagen ein Subventionssystem, um technische Präventivmaßnahmen (z.B. Einzäunungen) zu finanzieren, in Verbindung mit einem verstärkten Wechsel zu weniger intensiven Bewirtschaftungsformen (z.B. niedriger Besatz, gemischter Besatz) und einer stärkeren Verteilung von Informationen über vorhandene Möglichkeiten (speziell an „Hobby“- und Kleinteichwirten) vor.
• Naturschützer schlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Anlage neuer Teiche vor. Diese Vorgangsweise wird in der Tschechischen Republik zurzeit kaum angewandt. Sind in der beabsichtigten Errichtungsregion Fischräuber vorhanden, müssen Präventivmaßnahmen automatisch imAntrag enthalten sein.
• Generell gibt es einen Mangel an Wissen über und Anwendung der vorhandenen Präventivmaßnahmen, Kompensationsschemata. Der amerikanischer Mink (Mustela vison) wird manchmal mit dem Otter verwechselt. Darüber hinaus gibt es ungenaue Kenntnisse über die Nahrung der Otter und der geborenen Jungen (siehe Novotná 1998, Moravcová 2002)) vor allem bei Kleinteichwirten. Es gibt auch einen Mangel an Kommunikation zwischen Teichwirten, Naturschützern und zuständigen Behörden. Viele Konflikte die wegen der Otterschäden entstehen, könnten, mit Kompromissen auf beiden Seiten, durch bessere Kooperation, Kommunikation und Informationsaustausch vermindert werden.
Quantifizierung der Verluste und Schadenskompensation
Kompensationen von Schäden, die durch geschützte Tiere verursachte werden, das inkludiert den Otter, wird durch das Gesetz Nr. 115/2000 (novelliert 2001, 2002 und 2006) geregelt. Kompensationen können, gemäß diesem Gesetz, für, durch den Otter verursachte, wirtschaftliche
74
Schäden an Brutanstalten und Aufzuchtanlagen, Hälterteichen, Abwachsteichen, Käfigen und Forellenzuchten und auch an Wasserläufen gezahlt werden. Schadenskompensation bei Fischen aus Fischbrutanstalten (keine Teiche) ist nur möglich, wenn die Einrichtungen eingezäunt und am Einund Auslauf mit Gittern ausgestattet waren, als der Schaden entstand. Das Gesetzt legt das Recht auf Kompensation fest und theoretisch gibt es, was die Höhe der ausgezahlten Entschädigungen angeht, kein Limit nach oben.
Vor 2000 gab es keinen Entschädigungsanspruch und Otter wurden, obwohl sie unter Schutz stehen, in steigendem Maße verfolgt. Zum Beispiel wurde geschätzt, dass in der Region Südböhmen alleine jährlich zumindest 100 Otter illegal getötet wurden (Kranz et al. 1998, Kucerova & Roche 1999, Roche 2001). Angesichts der steigenden Forderung nach einer offiziellen Eindämmung der Otterzahlen, entschied die tschechische Regierung, einen Kompensationsplan für, durch den Otter (und andere Arten) verursachte, Schäden einzuführen. Die Agentur für Natur- und Landschaftsschutz in der Tschechischen Republik (SOPK ČR) wurde damit betraut, ein Schema zur Berechnung der Schadenskompensation zu erstellen. Das geschah unter Mithilfe von externen Experten (in diesem Fall Mitglieder des Tschechischen Ottergesellschafts Fonds (www.vydry.org)) und einer NGO-finanzierten Studie über Otter in Südböhmen und anderer Landesteile (siehe Roche und Toman 2003). Anträge von Anglern über Schäden am Fischbestand in Fließgewässern wurden ursprünglich nicht berücksichtigt, da a) Flüsse als natürlicher Lebensraum des Otters angesehen wurden und b) die Maßnahme übermäßig teuer geworden wäre. Eine Änderung des Gesetzes im Jahr 2006 erlaubt nun aber Anträge für besetzte Fische in Angelgewässern. Eine Teilnahme an dem Schema war nicht verpflichtend. Die Methode war, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens bis 2009 wirksam, dann wurde von Alka Wildlife s.r.o. (www.alkawildlife.eu), der AOPK ČR, der Tschechischen Ottergesellschaft und anderen ein neues Schema als Teil eines Managementplans für den Otter (Poledník et al. 2009) vorgeschlagen. Das neue Schema wurde aufgrund der beonachteten Unstimmigkeiten in der Art, wie das alte Schema umgesetzt wurde vorgeschlagen (siehe Poledníková et al. 2006).
Kompensationsmethode vor 2009
Die ursprüngliche Vorgangsweise für Schadenskompensationen war relativ einfach gestaltet und dadurch einfach anwendbar. Trotzdem war sie genau genug, um verschiedene Teichgrößen und die veränderbare Nutzungsintensität eines Gewässers durch den Otter zu berücksichtigen.
Antragssteller waren verpflichtet, jeden Schaden innerhalb von 48 Stunden den lokalen Behörden zu melden. Die Behörde, oder deren ernannter Vertreter, inspizieren dann den Fischteich und bestätigen die Anwesenheit des Otters durch Spuren, z.B. Fährten oder Losungen, überprüfen die
75
Eigentumsverhältnisse und den Verlust. Ein Gutachten, dass das Ausmaß des Schadens erhebt, war auch ein verpflichtender Bestandteil des Berichts. Die Experten wurden davor durch Gerichtsbeschluss ernannt. Im Fall des Otters wurden Mitglieder der Tschechischen Ottergesellschaft und der Otterstation der AOPK ČR als in Otterökologie ausreichend qualifiziert betrachtet und benötigten keine Ernennung durch das Gericht. Zusätzlich wurden Personen (für gewöhnlich Mitarbeiter der lokalen AOPK ČR Dienststellen), die durch Mitarbeiter dieser Organisationen geschult wurden, ebenfalls als Experten für den Zweck der Schadenskompensation anerkannt. Ein vollständiger Schadensantrag wurde dann bis zu 10 Tage nachdem der Schaden erfasst wurde, oder spätestens sechs Monate nachdem der Schaden auftrat, an die zuständige regionale Behörde geschickt.
Das Verfahren zur Schadensprüfung basierte entweder auf einer detaillierten oder vereinfachten Prüfung. Zwei Verfahren wurden ursprünglich vorgeschlagen, eine genaue Prüfung für große Teichwirtschaften und eine vereinfachte Kalkulation für die große Zahl an Teichwirten, die nur ein paar kleinere Teiche besitzen. Bei der detaillierten Prüfung wurde ein regelmäßiges Monitoring der Wasserqualität, Vorkommen von Fischkrankheiten und anderen Fischräubern wie dem Kormoran, verlangt. Als „einmalige“ Maßnahme gedacht, war die detailierte Überprüfung speziell auf schwierige Fälle zugeschnitten oder wenn Teichbesitzer mit der ursprünglichen Bewertung nicht einverstanden waren. Die genauere Methode verursacht aber hohe Kosten, obwohl viele der verlangten Daten von den großen Fischereibetrieben ohnehin gesammelt werden. Die vereinfachte Prüfung ist schneller und einfacher in der Anwendung. In die Bewertung gehen ein: die Otterspuren, die Teichgröße und Besatzdichte, die berechnete Fraßrate von kommerziellen Fischen/Jahr und der Marktpreis der Fische im Schadensjahr. Alle vom Besitzer bereits ergriffenen Maßnahmen zur Begrenzung des Schadens (z.B. Zäune) konnten auch berücksichtigt werden.
Die Höhe der Kompensation wurde dann anhand der folgenden Gleichungen berechnet:
Z = C x P x D x V xAnzahl der Otter
Wobi:
• Z = Geschätzter Verlust (Schaden) in CZK
• C = Durchschnittlicher Preis der Karpfen pro kg in CZK
• P = Futterkoeffizient (0,5 kg oder 0,75 kg)
o Es wurde berechnet, dass ein Otter zwischen 0,5 und 0.75 kg kommerzielle Fische
76
pro Tag verspeist.
• D = Koeffizient der Otteraktivität (1-180 Tage)
• V = Koeffizient für die Größe des Fischteiches
o Da der gesamte Schaden in kleinen Teichen höher angenommen wird, wird der geschätzte Schaden in Teichen < 2 ha um 20% erhöht, und in Teichen > 5 ha um 2050% verringert, daher:
o Teich < 2 ha: V = 1,2
o Teich 2-5 ha: V = 1,0
o Teich > 5 ha: V = 0,8
• Zahl der Otter (Weibchen + 1 Jungtier = 1,5)
o Basierend auf einer Experteneinschätzung der Otterspuren, z.B. Fährten, Losungen, Futterreste und den Angaben des Antragsstellers
o Im Fall von Teichketten basierte die Schätzung der Otterzahl auf Schneespuren
o Im Fall von einzelnen Teichen oder kleinen Teichkomplexen basierte die Schätzung der Otterzahl auf der Teichfläche.
Es wurde behauptet, dass eine einzelne Begehung nicht ausreicht, um die Häufigkeit von Otterbesuchen festzustellen und dass Expertenmeinungen oft subjektiv sind, was zu potentiellen Unterschieden zwischen Experten und innerhalb einer Region führen kann (Poledníková 2006).
Weiters deckt der Schadensbericht nur vom Otter tatsächlich gefressene Fische ab und kann nicht die sogenannten „sekundären Schäden“ (Verletzungen oder Stress) berücksichtigen, die das Potential für Wachstum und den Verkaufswert reduzieren. Außerdem berücksichtigt die Methode gelegentlich gefangene „übergroße“ Fische nicht, die bei den Anglern sehr begehrt sind. Aus einer ganzen Anzahl an Gründen werden nicht alle Anträge von den regionalen Behörden als berechtigt anerkannt.
Obwohl die Methode in der Praxis ganz gut funktioniert hat und die Zahl der Anträge jährlich zugenommen hat (Tabelle 3a), ist die Anzahl der Teichbesitzer oder Unternehmen, die solche Anträge stellen, immer noch relativ gering (z.B. 220 im Jahr 2007; Tabelle 3b). Die insgesamt größte Gruppe die Anträge stellt, sind die „Hobby“-Teichwirte (60 % der Anträge), gefolgt von professionellen Fischereibetrieben (20 %), Fischereigemeinschaften (10 %) und anderen Organisationen (10 %), für die die Fischzucht nicht die Haupteinnahmequelle ist, so wie
77
Jagdgemeinschaften und Landwirte (Poledníková et al. 2006). Die meisten Anträge kamen aus der Region Südböhmen, was vielleicht auf die Präsenz des Tschechischen Otter-Fonds und dessen Rolle als Quelle für Informationen und als Expertenstützpunkt zurückzuführen ist. Manche meinen (Poledníková et al. 2006), dass die, nach dieser Methode ausbezahlten Beträg,e zu hoch sind, da die Bewertungsmethode den verursachten Schaden überschätzt. Für eine Zusammenfassung der bewilligten Anträge und der zwischen 2000 und 2006 gezahlten Kompensationen, siehe Abb. 13.
Kompensationsmethode nach 2009
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Problemen sind einige andere Probleme bei der Berechnung des Schadens durch Räuber bemerkt worden. Diese beinhalten:
• Die Verluste werden in Fischereibetrieben für gewöhnlich nach der Ernte berechnet. Diese Verluste beinhalten allerdings den summierten Verlust der ganzen Saison, dadurch kann die spezifische Verlustursache nicht mehr genau festgestellt werden. Verluste können zum Beispiel auch durch andere Fischfresser, Krankheiten, Wilderei oder natürliche Mortalität auftreten. Die meisten Besitzer erwarten generell Verluste um 10 % durch natürliche Mortalität.
• Die Verbindung zwischen dem Nachweis des Otters durch Spuren und dem Verlust von Fischen ist oftmals von untergeordneter Bedeutung. Das Vorhandensein von Spuren impliziert nicht automatisch auch die Jagd durch den Otter. Auf der anderen Seite muss auch ein Fehlen von Otterspuren nicht heißen, dass der Jagddruck durch den Otter in der Vergangenheit gering war.
• Studien über die Ernährung des Otters zeigen eine hohe Variation in der Menge der kommerziellen Fische in der Nahrung, abhängig von der Menge der verfügbaren alternativen, kleineren Fische oder der Teichgröße (siehe Kapitel über die Ernährung). Eine hohe Visitationsrate bedeutet daher nicht unbedingt auch hohen Schaden und umkehrt garantiert eine niedrige Visitationsrate auch nicht geringen Schaden.
• Die Häufigkeit der Anwesenheit des Otters kann nicht nur zwischen verschiedenen Teichen, sondern auch saisonal verschieden sein. Währen im Sommer zum Beispiel alle Teiche besetzt und offen sind, können im Winter eine große Zahl der Teiche eisbedeckt oder leer sein. Otter konzentrieren dann ihre Aktivität/Nahrungssuche auf produktive Flussabschnitte oder Teiche, die zugänglich sind Es kann zum Beispiel mehr als ein Otter im Winter an einem bestimmten Teich jagen.
Im Bestreben die Herangehensweise der verschiedenen regionalen Experten, die in die
78
Schadensberechnung eingebunden sind, zu vereinheitlichen wurde 2006 ein neuer, standardisierter Ansatz, basierend auf einer verstärkten statistischen Herangehensweise, präsentiert (Poledníková 2006). Seit 2009 kommt diese neue Methode zur Anwendung. Die neue Methode berücksichtigt, wie zuvor, die Verweildauer des Otters am Teich und den Anteil der kommerziellen Fische in der Nahrung und beinhaltet zusätzlich einen Faktor für sekundäre Schäden. Diese Zahlen basieren auf neuen Studien und einer Literaturstudie früherer Ergebnisse (siehe Poledník et al. 2013).
Die Methodik besteht erneut aus zwei Berechnungsmethoden. Eine für einzelne Fischteiche, die andere für Teichgruppen. Die Wahl der Methode basiert auf der Fläche und dem Anteil der Teichanlage des Antragstellers, in Bezug auf die Fläche des Rechtecks, einer GIS (Geographisches Informationssystem) basierenden Karte, das über seine Teiche gelegt werden kann.
• Wenn die Fläche des Rechtecks < 25 km2 ODER der Anteil der Teiche < 10 % ist, wird die Methode für einzelne Teiche verwendet.
• Wenn die Fläche des Rechtecks zwischen 25 und 100 km2 UND der Anteil der Teiche > 10 % ist, wird die Methode von einem berufenen Schadenserhebungsexperten ausgewählt.
• Wenn die Fläche des Rechtecks > 100 km2 UND der Anteil der Teiche > 10% ist, wird die Methode für Teichgruppen verwendet.
• Eine Kombination aus beiden Methoden kann verwendet werden, wenn die meisten Teiche des Antragstellers die Kriterien für Teichgruppen erfüllen, aber ein oder mehrere Teiche >10 km außerhalb des Rechtecks gelegen sind.
Der Schaden wird, basieren auf der Anzahl der gefunden Losungen, bei zwei Begehungen zur Kontrolle von Spuren bei den Teichen geschätzt. Zwei Begehungen innerhalb von 6 Monaten werden als geringst mögliche Zahl angesehen, um eine aussagekräftige Korrelation zwischen Otterbesuchen und Losungen herzustellen, wobei die Kosten möglichst gering gehalten werden sollen (Poledník et al. 2013). Der tatsächliche Schaden wird dann mit ähnlichen Formeln berechnet wie bei der alten Methode:
Für einzelne Teiche wird der Schaden folgendermaßen berechnet:
Z = C x P x KP x D x R
79
Wobei:
• Z = Geschätzter Verlust (Schaden) in CZK
• C = Durchschnittlicher Preis der Karpfen pro kg in CZK
o Basierend auf den Preisen des Antragsstellers oder den lokalen Preisen zur Zeit der Antragsstellung
• P = Futterkoeffizient (Anteil der Besetzten Fische in der Otternahrung)
• KP = Koeffizient für die Größe des Fischteiches
• D = Anzahl der Tage
• R = Visitationsrate
• P = Anteil der besetzten Fische in der Otternahrung
o 0,5 kg – 0,7 kg, basierend auf Studien aus dem Böhmisch-Mährischen Hochland (Poledník et al. 2007a). Wo 80 % der besetzten Fische > 1,5 kg sind, wird eine Ausnahme gemacht und P als 1,0 angenommen.
• März – Oktober
o KP = 1,0
• November – Februar
o < 0,5 ha KP = 1,3
o > 0,5 ha KP = 1,0
• D = Anzahl der Tagen an denen der Teich mit Fischen besetzt ist.
• R = Visitationsrate
o Schätzung wie oft ein Otter einen Teich besucht
o Die Visitationsrate wird durch Zählen der Otterlosungen bei zwei, im Abstand von mindestens einem Monat durchgeführten Begehungen, in dem Zeitraum wo der Schaden vermutlich auftritt festgestellt.
Anzahl der Losungen = T:T = t1m1 + t2m2, wo m =
Dezember, Jänner, Februar = 0,7 80
März, April = 1,0
Mai, Juni, Juli, August, September = 1,5 (z.B. Mutter und Junges)
Oktober, November = 0,8
o T wird mit Hilfe eines „Losungsindex“-Koeffizienten zu R umgeformt. Dieser basiert auf einer, durch Monitoring von zufällig ausgewählten Fischteichen im Böhmisch-Mährischen Hochland, berechneten Korrelation und einem Vergleich von geschätzten Visitationsraten und gefundenen Losungen.
Für Teichgruppen wird der Schaden aufgrund der Otterdichte und dem Anteil der Fischteiche des Antragsstellers in der Region nach folgender Formel berechnet:
Z = c x p x d x n x Rn x N/4
Wobei:
• c = Durchschnittlicher Preis der Karpfen pro kg in CZK
o Basierend auf den Preisen des Antragsstellers oder den lokalen Preisen zur Zeit der Antragsstellung
o Für gemischten Besatz – Preis wird nach dem Gewichtsanteil der besetzten kommerziellen Fische berechnet (gewichteter Mittelwert)
• p = Anteil der kommerziellen Fisch ein der Nahrung (konstant)
o P = 0,7 basierend auf Studien aus dem Böhmisch-Mährischen Hochland (Poledník et al. 2007a)
• d = Anzahl der Tage des Forderungszeitraums
• n = Otterdichte in der Region des Antragsstellers
o Gewichteter Mittelwert der Dichten im individuellen GIS-Raster Kästchen im zugehörigen kleinsten Rechteck.
o Gewichtung verschiedener GIS-Raster Kästchen basierend auf der Anzahl der Teiche pro Kästchen die demAntragssteller gehören.
o Dichte erwachsener Otter pro GIS-Raster Kästchen, jährlich aktualisiert basierend
81
auf Schneespuren Daten und Korrelation zwischen Anzahl der Otter und Zahl der Teiche in der unmittelbaren Umgebung (www.ochranaprirody.cz)
o N = (Anteil der Teiche des Antragsstellers im Kästchen 1 x Anzahl der Otter die im Kästchen 1 vermutet werden + Anteil der Teiche des Antragsstellers im Kästchen 2 + Anzahl der Otter die im Kästchen 2 vermutet werden, … etc.) x Gesamtzahl der Fischteich für die ein Antrag gestellt wird.
• R = Anteil der Fischteiche die dem Antragssteller gehören
• N/4 = betroffenes Areal
Zusätzlich zu der neuen Methode schlugen die Autoren auch eine Reihe von Maßnahmen vor, um die Effizienz von Schadensanträgen zu steigern, die Kosten zu senken, Bürokratie einzudämmen und den spürbaren Konflikt zwischen Teichwirten und Naturschützern zu reduzieren. Diese Vorschläge beinhalten die Zahlung einer „Pauschale“ an Teichbesitzer bei denen die Anwesenheit des Otters schon vor der Abfischung bekannt ist (möglicherweise durch die EU finanziert) und die Dezentralisierung solcher Zahlungen d.h., die Entscheidung über solche Zahlungen soll von lokalen oder regionalen Behörden gefällt werden (Poledníková et al. 2006). In diesem Fall würde die Beweislast eines Schadens dem Teichwirt erlassen. Es gäbe keine Verpflichtung Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen (z.B. Zäune, Mischbesatz) und die relative Schadensmenge und relative Otterdichte würde ignoriert. Diese Vorschläge wurden noch nicht in die Praxis umgesetzt.
Generell hatten die Entschädigungszahlungen seit 2000 weitreichende positive Auswirkungen auf die Spannungen zwischen Teichwirten und Naturschützern, speziell auf die großen professionellen Teichwirtschaftsbetriebe. Diese haben Schäden durch den Otter gemeinhin immer als relativ kleines Problem gesehen (Poledníková et al. 2006, Moravcová 2002). Die Entschädigungszahlungen reichen allerdings nicht, um vielen der kleinen „Hobby“-Teichwirte ihren Verlust vollständig zu erstatten (siehe oben). Obwohl bei der neuen Methode einige Probleme, die an der alten Methode kritisiert wurden berücksichtigt wurden, hat sie sich als teuer, zeitaufwändig und für die meisten Fischer als zu kompliziert und technisch erwiesen. Darüber hinaus ergeben die beiden Methoden ähnliche Ergebnisse. In der Praxis wird die neue Methode daher tendenziell eher von den großen Betrieben angewandt, während die alte Methode weiterhin für Klein- und „Hobby“-Teichwirte verwendet wird (M. Brůčkova, ehemaliger Direktor des Tschechischen Otter-Fonds, persönliches Gespräch). Die Vorschläge zur Reduzierung der Bürokratie machen anfällig für Missbrauch und könnten sich, falls jemals beschlossen, als viel teurer als die bisherige Praxis erweisen.
82
Sekundärschaden
Viele Teichwirte beschweren sich, dass neben dem, durch Räuber wie den Otter, verursachten „primären Schaden“ (z.B. direktes fressen oder töten), wirtschaftlicher Schaden auch durch „sekundären Schaden“ entsteht. „Sekundäre Schaden“ ist z.B. physischer Schaden, der nicht unbedingt gleich zum Tod führt oder Stress, besonders im Winter, der zu reduziertem Wachstum und verminderter Körpermasse führt. Physischer Schaden kann zu vermehrtem Parasitenbefall oder Krankheiten führen, die den Fisch auf lange Sicht töten oder am freien Markt unverkäuflich machen (Adámek et al. 2003).
Resultate von Experimenten sind hingegen zweideutig. Experimente von Poledník et al. (2008), in denen Blutproben vom Karpfen, nach vorsätzlichem Kontakt mit einem Otter in einem Hälterungsbecken, auf Stresshormone untersucht wurden zeigten deutlich, dass obwohl Stresshormone im Blut temporär erhöht waren, keine ökonomischen Auswirkung festzustellen waren, da keine Beeinträchtigung des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit festgestellt werden konnte. In weiteren Experimenten, in denen Stresshormone und Wachstum bei freilebenden Karpfen gemessen wurden, die verschieden starken Störungen durch den Otter ausgesetzt waren, kamen die Autoren´zu dem Schluss, dass nach der Überwinterung die Wachstumsrate und die Kondition von Karpfen in Teichen, mit höherer Störungshäufigkeit, geringer war (Poledník et al. 2012a). Diese Autoren berichten allerdings nichts über etwaige andere Stressfaktoren in diesen Teichen. Was auch immer die „Wahrheit“ über den Einfluss „sekundärer Schäden“ ist, solche Schäden sind, wegen der vielen möglichen Ursachen und Faktoren, die alle miteinander interagieren und/oder von Teich zu Teich und Jahr zu Jahr variieren können, beinahe unmöglich zu berechnen.
Obwohl Fischotter Fische verletzten können und das auch tun, übersteigen Schäden durch den Kormoran (siehe Adámek et al. 2007) bei weitem jene, die durch den Otter verursacht werden (wie auch die ausgezahlten Kompensationszahlungen). Daher werden Kormorane mittlerweile auch als weit größeres Problem gesehen als der Otter. Zum Beispiel fand Kortan et al. (2008), dass bis zu 47% der zweijährigen Spiegelkarpfen (Gesamtlänge 200 – 300 mm, Gewicht 200 – 300g)
Verletzungen von bis zu 10% der Körperoberfläche aufwiesen, die durch Kormorane verursacht wurden. Als Reaktion auf die wachsende Zahl von Kormoranen wurde ihr Status als gefährdete Art mit 1.April 2013 aufgehoben. Während er von europäischen Gesetzen noch immer geschützt ist, können limitierte Abschüsse mit einer Lizenz erfolgen (MZP 2012).
83
Literaturverzeichnis
Adámek, Z., Kučerova, M., Roche, K. 1999. The role of common carp (Cyprinus carpio) in the diet of pisciverous predators – cormorants (Phalacrocorax carbo) and otter (Lutra lutra). Bull. VÚRH Vodňany 4. 185-193
Adámek, Z., Kortan, D., Lepič, P., Andreji, J. 2003. Impacts of otter (Lutra lutra L.) predation on fishponds: A study at ponds in the Czech Republic. Aquaculture International. 11. 389-396
Adámek, Z., Kortan, J., Flajshans, M. 2007. Computer assisted image analysis in the evaluation of fish wounding by cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis (L.)) attacks. Aquaculture International. 15. 211-216
Anděra, M., Horáček, I. 1982. Poznáváme naše savce (Determination of our mammals). Mladá Fronta Press. Prague. (In Czech)
Andĕra, M., Kokeš, O. 1994. Poznámky k historii výskytu vydry řični (Lutra lutra) v českých zemich (Historical review of otter (Lutra lutra) distribution in the Czech dominions). Bulletin Vydra 4, 6-23 (In Czech)
Anděra M., Červený J. 2005. Červený seznam savců České republiky (Red List of mammals in the Czech Republic). Příroda, 23. Prague.
Ansorge, H., Schipke, R., Zinke, O. 1997. Population structure of the otter, Lutra lutra: Parameters and model for a Central European region. Z. Säugetierk 62. 3. 143-151
Baruš, V., Zejda, J. 1981. The European otter (Lutra lutra) in the Czech Socialist Republic. Acta Sc. Nat. Brno. 15, 1-41
Begon, M. & Mortimer, M. 1986. Population Ecology: A unified study of Animals and Plants (2nd ed.). Blackwell Scientific Publications. Oxford. pp. 103-152.
Bodner, M. 1995. Otters and fish farming: preliminary experiences of a WWF project in Austria. Hystrix. 7. 223-228
Carss, D.N. 1995. Foraging behaviour and feeding ecology of the otter Lutra lutra: A selective review. Hystrix (n.s.) 7 (1 – 2), 179-194.
Carss, D.N., Kruuk, H., Conroy, J.W.H. 1990. Predation on Atlantic salmon, Salmo salar L., by otters, Lutra lutra (L.), within the River Dee system, Aberdeenshire, Scotland. J. Fish Biol. 37, 935944.
Chanin, P. 1988. The natural history of otters. Croom Helm. London. 179 pp
84
Copp, G.H., Jurajda, J. 1993. Do small fish move inshore at night? J. Fish. Biol. 43 (Suppl. A), 229241.
Dulfer, R., Föerster, K, Roche, K. 1996. Habitat, home range and behaviour. In: Dulfer. R, Roche. K. (eds) First phase management plan for otters in the Třeboň Biosphere Reserve. Nature and Environment 93. Council of Europe Publishing. 1998. 24-33
Edwards, P. 2007. Rural Aquaculture: Pilgrimage to traditional carp pond culture in Central Europe. In: Aquaculture Asia Magazine. Oct-Dec. 28-34
Föerster, K. 1996. Spatial organisation and hunting behaviour of otters Lutra lutra in a freshwater habitat in Central Europe. University of Agricultural Sciences, Vienna. Diploma Thesis. 34 pp (In German)
Hájková, P., Pertoldi, C., Zemanivá, B., Roche, K., Hájek, B., Brja, J., Zima, J. 2007. Genetic structure and evidence for recent population decline in Eurasian otter populations in the Czech and Slovak Republics: implications for conservation. Journal of Zoology. 272. 1-9
Hájková, P., Zemanová, B., Roche, K., Hájek, B. 2009. An evaluation of field and non invasive genetic methods for estimating Eurasian otter population size. Conservation Genetics. 10. 16671681
Hájková, P., Zemanová, B., Roche, K., Hájek, B. 2011. Conservation genetics and non-invasive genetic sampling of Eurasian otters (Lutra lutra) in the Czech and Slovak Republics. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. 28(4). 127-138
Heggberget, T.M. 1994. Prey selection in coastal Eurasian otters Lutra lutra. Ecography. 17. 331338.
Hlaváč, V., Toman, A., Bodešínsky, M. 1998. Experimentální reintrodukce vydry v Jesenikách (Experimental reintroduction of otters in the Jeseniky region). Bulletin Vydra. 8. 37-39 (In Czech)
Hraběs, S., Oliva, O. Opatrný, E. 1973. Klič našich ryb, ubojživelníků a plazu (A key to our fish, amphibians and reptiles). Statni pedagogické na kladatelství, Prague. (in Czech)
Jurajda, P. Roche, K. 1994. The fish community of water bodies within the Třeboň Biosphere Reserve. Annual report to the Třeboň Otter Foundation.
Jurajda, P., Prasek, V., Roche, K. 1996. The autumnal diet of otter (Lutra lutra) inhabiting four streams in the Czech Republic. Folia Zoologica. 45(1). 9-16
Kadlečíková, Z. 2009. Old methodology for quantification of damages caused by Eurasian otter in
85
fishponds in the Czech Republic. Czech Otter Foundation Fund, Třeboň. PowerPoint presentation at “Otter & fishery – special seminar”. 25-26.6.2009. Mitwitz, Germany.
Knollseisen, M. 1995. Aspects of the feeding ecology of the Eurasian otter Lutra lutra L. in a fish pond area in Central Europe (Austria and Czech Republic). Unpublished Diplomarbeit. Agricultural University of Vienna,Austria.
Kortan, J., Adámek, Z., Poláková, S. 2007. Winter predation by otter, Lutra lutra on carp pond systems in South Bohemia (Czech Republic). Folia Zoologica. 56(4). 416-428
Kortan, J., Adámek, Z., Flajshans, M., Piackova, V. 2008. Indirect manifestation of cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis (L.)) predation on pond fish stock. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 2008. 1.
Kranz, A., Toman, A., Roche, K. 1998. Otters and fisheries in Central Europe: what is the problem?
BOKU Rep. Wildl. Res. Game Manag. 14: 142–144
Kranz, J., Knollseisen, M. 1998. How many otters live ‘here’? A discussion about counting otters.
BOKU Rep. Wildl. Res. Game Manag. 14: 120–125
Kruuk, H. 1995. Wild otters: Predation and Populations. Oxford University Press. Oxford.
Kruuk, H. 2006. Otters: Ecology, Behaviour and Conservation. Oxford University Press. London. pp 265
Kruuk, H., Carss, D.N., Conroy, J.W.H., Durbin, L. 1993. Otter (Lutra lutra L.) numbers and fish productivity in rivers in north-east Scotland. Symp. Zool. Soc. Lond. 65, 171-191.
Kruuk, H., Carss, D.N. 1996. Costs and benefits of fishing by a semi-aquatic carnivore, the otter Lutra lutra. pp 10-16 In: S.P.R. Greenstreet & L.T. Tasker (eds.). Aquatic predators and their prey. Fishing News Books, Blackwell Scientific Publications. Oxford. 191 pp.
Kučera, L. 1980. Bestandesentwicklung des Fischotters in Böhmen und Mähren (ČSSR). In: Reuter, C., Festetics, A. (eds) Der Fischotter in Europa. Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. Selbstverlag der Aktion Fischotterschutz. e.V. 199-204
Kučerová, M., Roche, K. 1999. Otter conservation in the Třeboň Biosphere Reserve and Protected Landscape Area: scientific background and management recommendations. Internal document of the council of Europe. T-PVS (2000) 20, Strasbourg, 2000, pp 103
Kučerová, M., Roche, K., Toman, A. 2001. Rozšířeni vydry říční (Lutra lutra) v Česke republice. Bulletin Vydra. 11: 37-39
86
Libois, R.M., Hallet-Libois, C. Rosoux, R. 1987. Éléments pour l'identification des restes craniens des poissons dulcaquicoles de Belgique et du nord de la France. In: Fiches d'ostéologie animale pour l'archéologie, Série A, No. 3, Centre de Recherches Archéologiques du CNRS, Belgium. (In French)
Libois, R.M., Hallet-Libois, C. 1988. Éléments pour l'identification des restes craniens des poissons dulcaquicoles de Belgique et du nord de la France. In: Fiches d'ostéologie animale pour l'archéologie, Série A, No. 4, Centre de Recherches Archéologiques du CNRS, Belgium. (In French)
Libois, R.M., Rosoux, R. Delooz, E. 1991. Ecologie de la loutre (Lutra lutra) dans le Marais
Poitevin. III. Variations du régime et tactiique allimentaire. Cahiers d'Ethologie, 11 (1): 31 – 50. (In French)
Mason, C.F., Macdonald., S.M. 1986. Otters: ecology and conservation. Cambridge University Press, Cambridge. 236 pp.
Marcelli, M., Poledník, L., Poledníková, K., Fusillo, R. 2012. Land use drivers of species expansion: inferring colonization dynamics in Eurasian otters. Diversity and Distributions. 18, 1001-1012
MZP – Ministry of Environment of the Czech Republic. Press release: 21.11.2012: The Great Cormorant removed from the list of specially protected species. http://www.mzp.cz/en/news_121121_the_great_cormorant. Last accessed on 14.06.2013
Moravcová, J. 2002. Biologie a ekologie vydry říční (Lutra lutra): Výchova a vzdĕlávání k jeji ochranĕ (Biology and ecology of the European otter (Lutra lutra): Improving its protection through education) MSc. Thesis. Charles University. Prague. 118 pp (In Czech)
Novotná, E. 1998. Lidé a vydra, závĕrečná zpráva sociologického průzkumu. Jiho-česká sociologická agentura. Zahrádky. pp 24 (In Czech)
Poledník, L. 2005. Otters (Lutra lutra L.) and fishponds in the Czech Republic: interactions and consequences. Unpublished PhD thesis. Palacky University Olomouc. pp 109
Poledník, L., Poledníková, K., Roche, M., Hájková, P., Toman, A., Culková, M., Hlaváč, V., Beran, V., Nová, P., Marhoul, P. 2005. Záchranný program – program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v Ceske republice v letech 2006-2015 (Rescue programme – Management programme for the common otter (Lutra lutra) in the Czech Republic for 2006-2015). AOPK ČR. Praha (in Czech)
Poledník, L., Poledníková, K., Hlaváč, V. 2006. Rozšířeni vydry říčni (Lutra lutra) v České republice v roce 2006 (Distribution of the common otter (Lutra lutra) in the Czech Republic in
87
2006). Bulletin Vydra 14. 4-6 (In Czech)
Poledník, L., Poledníková, K., Kranz, A., Toman, A. 2007a. Variability in the diet of the Eurasian otter (Lutra lutra) at fisponds in Česko-moravská vrchovina (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic). Lynx n.s. (Prague). 38. 31-46
Poledník, L., Poledníková, K., Hlaváč, V. 2007b. Program péče o vydru říční a výsledky monitoringu vydry v roce 2006 (Management plan for the common otter and results of otter monitoring in 2006). Ochrana přírody. 62(3). 6-8 (In Czech)
Poledník, L., Poledníková, K., Roche, M., Hájková, P., Toman, A., Václavíková, M., Hlaváč, V., Beran, V., Nová, P., Marhoul, P., Pacovská, M., Růžičková, O., Mináriková, T., Větrovcová, J. 2009. Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009-2018 (Management plan for the common otter (Lutra lutra) in the Czech Republic in 2009-2018). AOPK ČR. pp 84 (in Czech)
Poledník, L., Poledníková, K., Kadlečíková, Z. 2011a. Damages caused by the Eurasian otter in fishponds and impact of otter disturbance on condition and growth rate of common carps in fishponds. XIth International Otter Colloquium, Hystrix. Italian Journal of Mammology (n.s.) supp. p 84
Poledník, L., Poledníková, K., Větrovcová, J., Hlaváč, V., Beran, V. 2011b. Causes of death of Lutra lutra in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae). Lynx. n.s. (Prague) 42. 145-157
Poledník, L., Poledníková, K., Hlaváč, V. 2012. Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas of the Czech Republic in years 2008-2012. Bulletin Vydra. 15. 29-38 (In Czech)
Poledníková, K., Větrovcová, J., Poledník, L., Hlaváč, V. 2010. Carbofuran – a new and effective method of illegal killing of otters (Lutra lutra) in the Czech Republic. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. 27(3). 137-146
Poledníková, K., Kranz, A., Poledník, L., Myšiak, J. (eds). 2006. Otters causing conflicts: the fish farming case of the Czech Republic. WP 11 – Generic framework for reconciliation action plans and dissemination. Reconciliation action plans for targeted conflicts. Public Deliverable 21 – 3rd Report. Part A. 2006. pp. 22.
Reuther, C., Dolch, D., Green, R., Jahrl, J., Jefferies, D., Krekemeyer, A., Kucerova, M., Madsen, A.B., Romanowski, J., Roche, K., Ruiz-Olmo, J., Teubner, J., Trindade, A. 2000. Surveying and Monitoring Distribution and Population Trends of the Eurasian Otter (Lutra lutra). Habitat 12, 152pp.
88
Roche. K., 1997. The influence of diet and habitat structure on the home range activity of otters (Lutra lutra) within the Třeboň Biosphere Reserve. In: Proceedings of the 14th European Mustelid Conference. Kouty. Czech Republic. pp. 51-56
Roche, K. 2001. Sprainting behaviour, diet and foraging strategy of otters (Lutra lutra) in the Třeboňsko protected landscape area and biosphere reserve. PhD thesis, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp 135.
Roche, K. (ed.) 2004a. Scientific report of the Czech Otter Project 1998-2004. Czech Otter Foundation Fund, Třeboň. 14-29
Roche, K. 2004b. Otter (Lutra lutra) mortality and its causes in the Třeboň Biosphere Reserve, with emphasis on road kills. pp 30-47. In: Roche, K. (ed) Scientific report of the Czech Otter Foundation Fund 1998-2004. Czech Otter Foundation Fund, Třeboň. pp 166
Roche, K. Roche, M. 2004. Calculating otter (lutra lutra) numbers in the Třeboň Biosphere Reserve using snow survey data. In: Roche, K. (ed) Scientific report of the Czech Otter Project 1998-2004. Czech Otter Foundation Fund, Třeboň. pp 166
Roche, K., Toman, A., Susta, F. 2004. National otter (Lutra lutra) survey of the Czech Republic 1997-2002(3). In: Roche, K. (ed) Scientific report of the Czech Otter Project 1998-2004. Czech Otter Foundation Fund, Třeboň. 14-29
Roche, M., Toman, A. 2003. Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru říční (Method for determining damages for the otter). Report for Ministry of Environment of the Czech Republic. Czech Otter foundation fund and Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Třeboň, pp 5 (In Czech)
Spurneý, P., Mareš, J., Kopp, R., Fiala, J. 2003. Socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice. Český rybářský svaz. Brno. pp 24 (In Czech)
Toman, A. 1992. První Výsledky Akce Vydry (First Otter Monitoring Event). Bulletin Vydra. 3. 3-8 (In Czech)
Toman, A. 1995. Mortalita vydry říčni v České republice (Mortality of the Eurasian otter in the Czech Republic). Bulletin Vydra. 6. 17-22 (In Czech)
Tomášková, L, 2009, Zákon č, 115/2000 Sb, – nástroj k odstraňování konfliktů mezi ochranou přírody a hospodařícími subjekty (Law No, 115/2000 Sb, – A tool for removing the conflict between nature conservation and private subjects), Ochrana přirody – Péče o přírodu a krajinu, December 2009 (6) (In Czech)
89
Václavíková, M., Václavíik, T., Kostkan, V. 2011. Otters vs. fishermen: Stakeholders perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation. 19. 95-102
90
Anhang I
Vier Methoden, jede mit Vor- und Nachteilen, stehen zum Monitoring von Fischotterpopulationen zur Verfügung (z.B. direkte Beobachtung, Schneestudien (snow-tracking), Radiotelemetrie, genetische Analyse der Losungen). Schneestudien sind in Ländern mit häufigem Schneefall am geläufigsten, unter Umständen ergänzt durch Radiotelemetrie oder genetische Analysen, wo das finanziell möglich ist oder mehr Informationen gesammelt werden sollen.
Methode Vorteile Nachteile
Direkte Beobachtung Stellt detaillierte Informationen über das Verhalten bereit (an der Beobachtungsstelle). Gute Informationen über die saisonale Nutzung des Verbreitungsgebiets, wenn viele Personen über eine lange Zeit involviert sind.
Schneestudien* Die Methode ist billig, einfach und erlaubt eine relativ gute Abschätzung der Otterzahl (inkl. Geschlecht undAlter) in einem relativ großen Gebiet. Teiche sind im Winter gefroren, Fährten können daher auch über Wasserkörper verfolgt werden. Nicht-invasiv.
Es können immer nur wenige Tiere beobachtet werden.
Nimmt an, dass Tiere jedes Mal sicher identifiziert werden können.
Invasiv – Störung kann das Verhalten beeinflussen.
Braucht frischen Schnee. Benötigt Bearbeiter die Erfahrung im Spurenlesen und imAbleiten des Verhaltens aus den Spuren haben. Ergibt nur Daten über die Bewegungen der letzten Nacht und des Morgens –ergibt nicht den gesamten Aktionsradius. Aktionsradius undAnzahl kann zwischen Sommer und Winter unterschiedlich sein.
Auch erfahrene Gutachter können nur aufgrund der Spuren nicht sicher das Geschlecht oderAlter bestimmen.
Radiotelemetrie Der Otter kann während seiner aktiven Phase, oder über die Lage von Einständen verfolgt werden. Relativ genaue
DieAusrüstung ist teuer.
Es können nur relativ wenige Otter zu einem Zeitpunkt beobachtet werden. Hochinvasiv – erfordert Fang und
91
Informationen über den Aktionsradius über relativ lange
chirurgische Einpflanzung eines Transmitters.
Das Verhalten könnte durch den Transmitter beeinflusst werden. Genetische Analyse der Losungen** DieAnzahl der Individuen eines Gebietes wird genau erhoben, wie auch das Geschlecht, Verwandtschaft und Trächtigkeit. Losungen sind leicht verfügbar und können das ganze Jahr über gesammelt werden, was einen Vergleich der Aktionsradien über die Zeit erlaubt. Nicht-invasiv.
Zeiträume (z.B. Monate) können gesammelt werden.
Mit derzeitigen Methoden ist die Erfolgsrate relativ gering, daher muss eine hohe Zahl von Losungen gesammelt werden.
Analyse ist noch immer relativ teuer und zeitintensiv.
* Für eine vollständige Beschreibung der Methodik der Schneestudien siehe Roche & Roche 2004.
** Für eine vollständige Beschreibung der genetischen Methoden und einem Vergleich mit anderen Methoden, siehe Hájková et al. 2009, 2011.
92
Anhang II
Abbildung 1. Verbreitung des Eurasischen Otters (Lutra lutra) in der Tschechischen Republik, basierend auf den Daten der nationalen Bestandsaufnahme von 1992, 2000 und 2006. Die Daten basieren auf dem 11,2 x 12 km großen tschechischen Rastersystem (S-JTS). Graue Kästchen = Otter wurde zumindest in einer von vier Untersuchungsstellen gefunden, leere Zellen = Otter abwesend (Abbildung nach Marcelli et al. 2012).
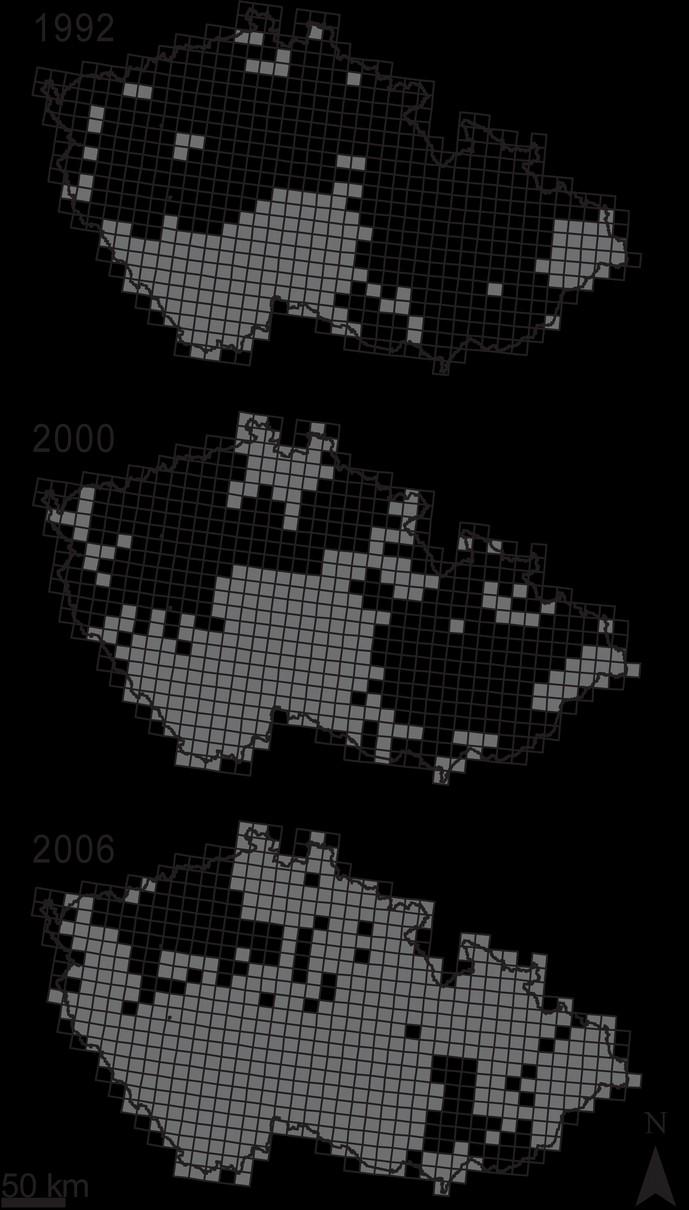
93
Abbildung 2. Verbreitung des Eurasischen Otters (Lutra lutra) in der Tschechischen Republik, basierend auf den Daten der nationalen Bestandsaufnahme von 2011. Die Daten basieren auf dem 11,2 x 12 km großen tschechischen Rastersystem (S-JTS). Rote Kästchen = regelmäßiges Vorkommen, Gelbe Kästchen = unregelmäßiges Vorkommen, leere Kästchen = Otter abwesend (Abbildung nach Poledník et al. 2012.
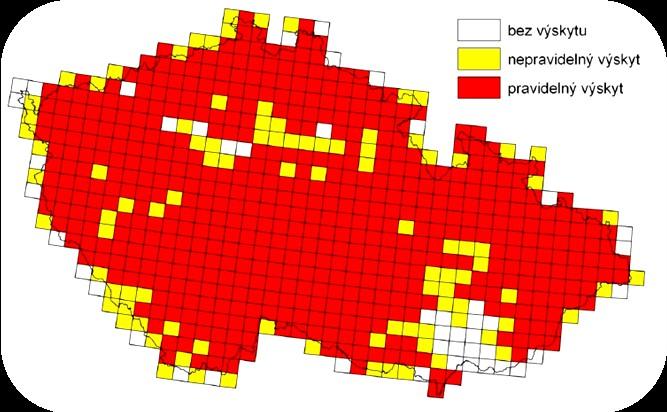
Abbildung 3. Otterdichte in der Tschechischen Republik, basierend auf den Daten der nationalen Bestandsaufnahme von 2000. Die Daten basieren auf dem 11,2 x 12 km großen tschechischen Rastersystem (S-JTS). Die Dichte wurde aufgrund der Daten von Schneespuren in siebe Quadraten und einem angenommenen Verhältnis zwischen Otterzahl und Länge der Teichufer berechnet (Abbildung nach Poledníková et al. 2006).

94
Abbildung 4. Prozentsatz der Probenstellen mit Ottervorkommen pro Flusseinzugsgebiet, basierend auf den Daten der nationalen Bestandsaufnahme von 2011 (Abbildung nach Poledník et al. 2012).
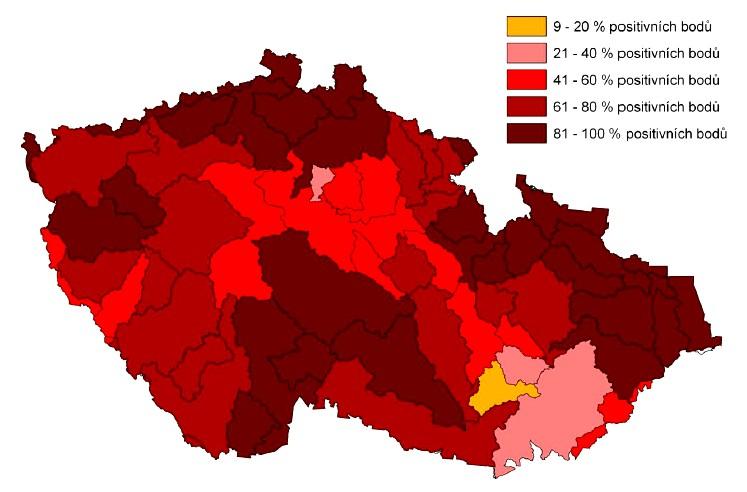
95
Abbildung 5. Die detaillierte Ansicht des Untersuchungsgebiets in der Kernzone zeigt die komplexe Anordnung von großen und kleinen Teichen, Kanälen, Feuchtgebieten und Flüssen in einer land- bzw. Forstwirtschaftlich genutzten Landschaft. Zahl = unidentifizierte Individuen, M = männlich, F = weiblich, X = kein Nachweis, strichlierte Linien markieren die maximale Reichweite der nächtlichen Aktivität der identifizierten Individuen oder Gruppen (Abbildung nach Roche 2004a).
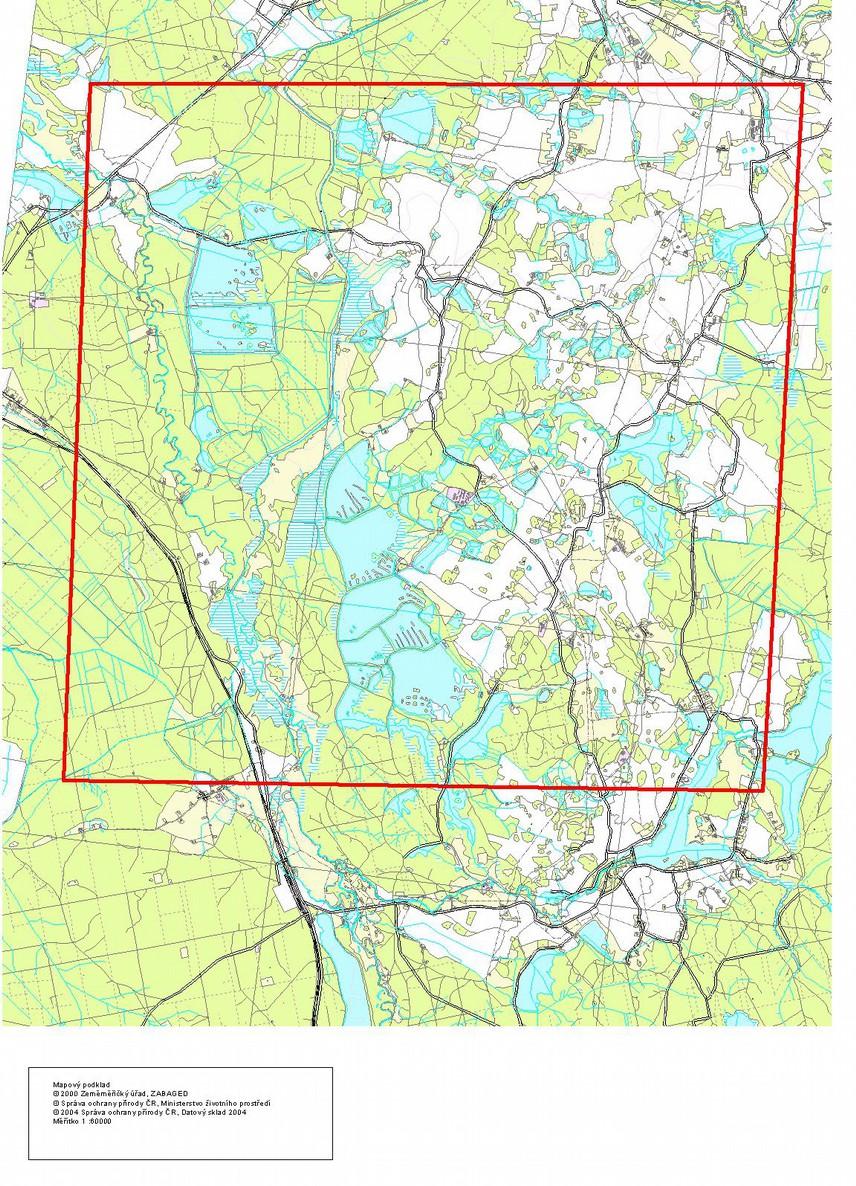
96 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 M M M M M M M M M M M F + 1 F + 1 F + 1 F + 1 F + 1 2 (F +1?) 2 (F + 1?) F F + 2 F F F + 1 M
Abbildung 6. Die detaillierte Ansicht der Fluss Probenstelle zeigt den Fluss Lainsitz (Lužnice) und seine Aue mit weit verstreuten kleinen Teichen, in einer vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Landschaft. Zahl = unidentifiziert Individuen, M = männlich, F = weiblich, X = kein Nachweis, strichlierte Linien markieren die maximale Reichweite der nächtlichen Aktivität der identifizierten Individuen oder Gruppen (Abbildung nach Roche 2004a).
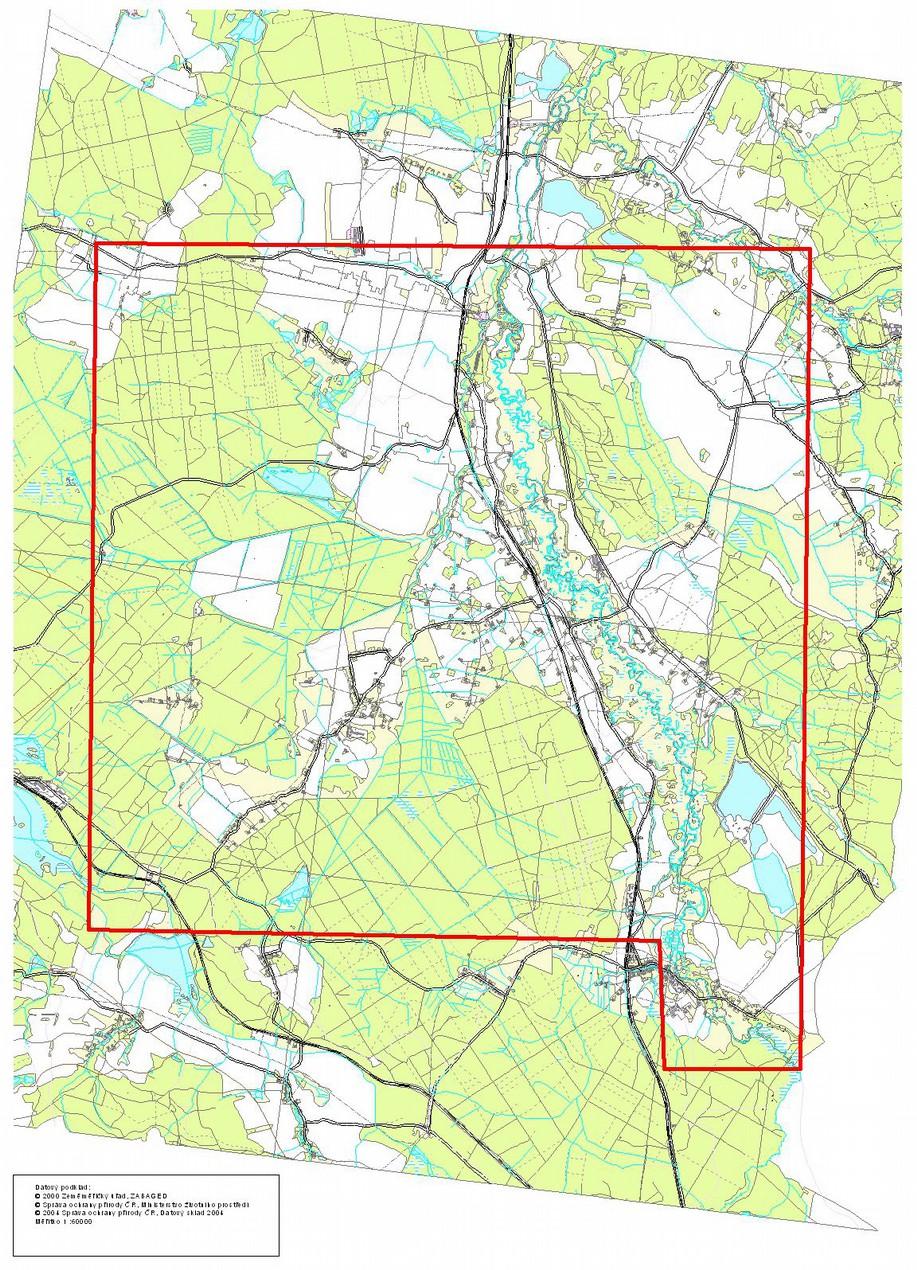
97
1 1
2 (F + 1?)
F + 2
1 (M?)
1 (M?)
2 (F + 1?)
X X
Abbildung 7. Anzahl der Otterkadaver, die in der Tschechischen Republik zur Untersuchung eingereicht wurden (Abbildung nach Poledník et al. 2011b).
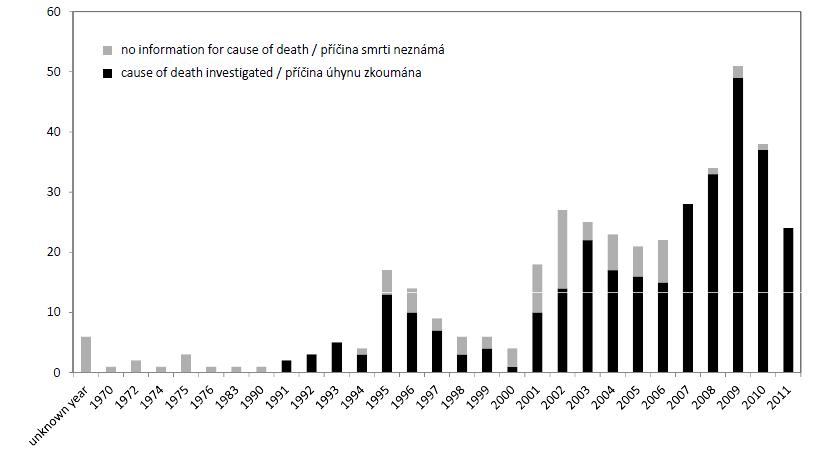
98
Abbildung 8. Anzahl der männlichen und weiblichen Otter jeder Altersstufe bei a) allen Kadavern (n = 101), b) nur Opfer des Straßenverkehrs (n = 58) und c) andere Ursachen (n= 43).

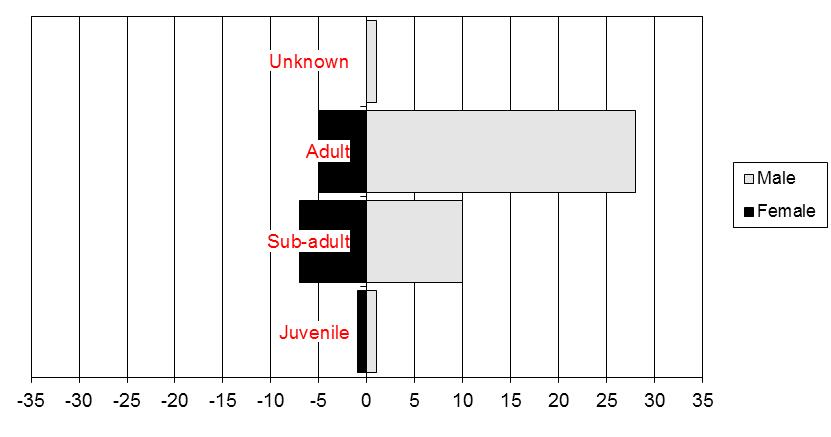
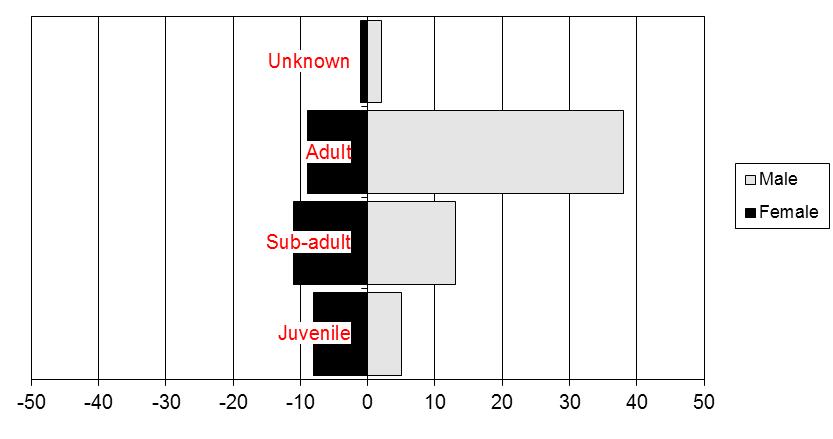
99
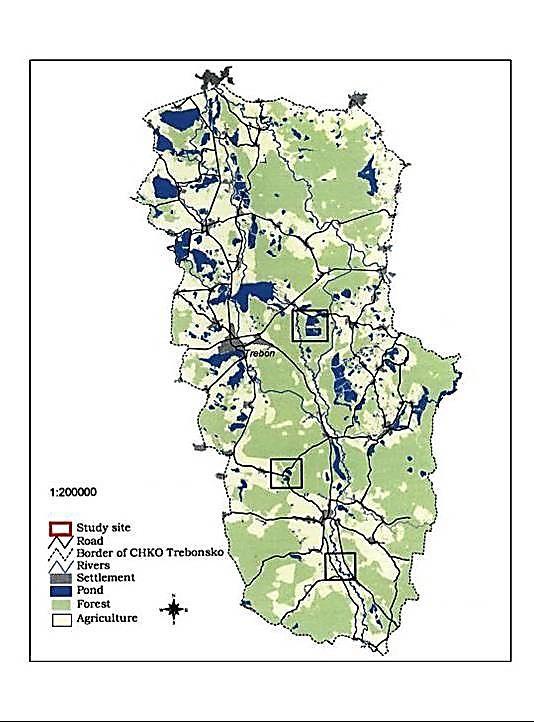
100
Abbildung 9. Das Třeboň Biosphären Reservat und Landschaftsschutzgebiet, eingezeichnet die drei Untersuchungsstellen (von oben nach unten – Teich/Fluss, Teich, Fluss [siehe auch Abbildungen 6&7]).
Abbildung 10. Jährliche und saisonale relative Häufigkeit von Beutetieren in der Nahrung des Otters und in der Umgebung der drei Probenstellen. Rr = Rotauge, Cy = Karpfen, Pf = Barsch.
101 Rr Cy Pf Other Rr Cy Pf Other Rr Cy Pf Other Rr Cy Pf Other Rr Cy Pf Other Rr Cy Pf Other 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% Diet Environment Pond/River Pond River Annual Winter Spring Summer Autumn Species
Abbildung 11. Jährliche und saisonale relative Häufigkeit der Fischgrößenklassen in der Nahrung des Otters und in der Umgebung der drei Probenstellen.
102 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% Diet Environment Pond/River Pond River Annual Winter Spring Summer Autumn 5 10 15 20 25 >25 5 10 15 20 25 >25 5 10 15 20 25 >25 5 10 15 20 25 >25 5 10 15 20 25 >25 5 10 15 20 25 >25 Size class (cm)
Abbildung 12. Fischteiche in der Tschechischen Republik, wiedergegeben als Fläche (ha) pro 11,9 x 12km (ca. 143 km2) tschechischer Standard-Kartenraster (wiedergegeben nach Poledníková et al. 2006).
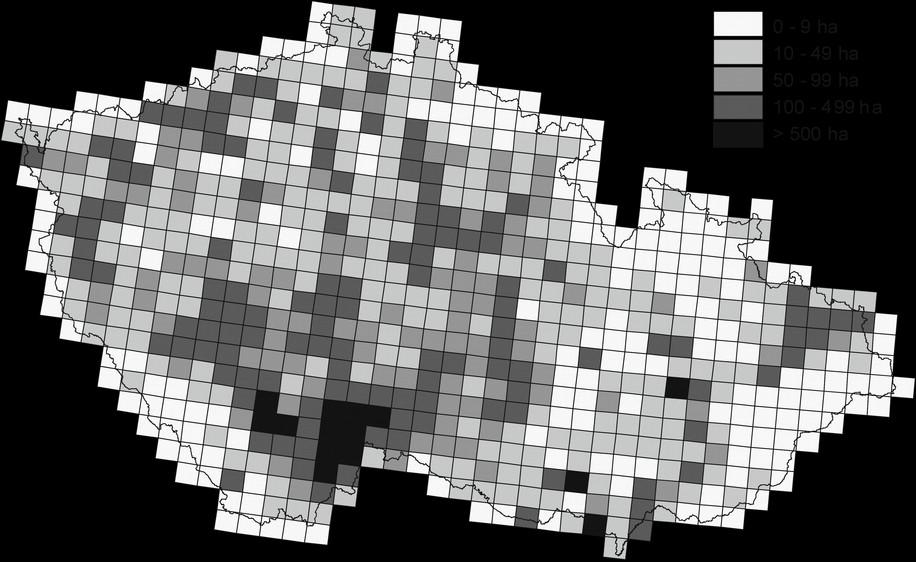
103
Abbildung 13. Vom Otter besiedelte Flächen und von den einzelnen Regionen in der Tschechischen Republik beanspruchte Entschädigung: (a) relative Fläche mit Ottervorkommen; (b) Gesamtzahl bewilligter Anträge zwischen 2000 und 2006; und (c) Gesamtsumme der ausgezahlten Entschädigungszahlungen zwischen 2000 und 2006 (nach Václavíková et al. 2001).

104
Anhang III
Tabelle 1. Todesursachen von, in der Tschechischen Republik, gefundenen Otter zwischen 1990 und 2011 (Tabelle nach Poledník et al. 2011b).
Tabelle 2. A) Gesamtzahl der Arten (inkl. Nicht-Beutetier Kategorien), die vom Otter bei den drei Probenstellen gefangen wurden und B) Simpsons Diversitätsindex (D) für gefangene Fischarten an jeder Probenstelle zu jeder Jahreszeit.
A) Teich/Fluss Teich Fluss Kombination Gesamt Fische + nichtFische 22 19 15 25 Fischarten gesamt 17 13 11 19 Nicht – Fische gesamt cat. 5 6 4 6 D = 1.81 3.37 7.77 2.55 B) Winter Frühling Sommer Herbst Kombination 2.33 2.83 3.44 1.78 Teich/Fluss 1.47 2.04 4.27 1.49 Teich 2.37 2.33 2.63 2.94 Fluss 4.04 8.00 6.18 3.50 105 Todesursache 1990-2000 2001-2005 2006-2011 Total Verkehr Straße 28 63 144 235 Eisenbahn 1 0 2 3 Mensch Vergiftung 0 0 15 15 Erschießen 1 0 2 3 Erschlagen 0 1 2 3 Fangeisen 0 1 3 4 andere 1 0 0 1 Natürliche Ursachen Krankheit 0 2 0 2 schlechter Allgemeinzustand 2 2 0 4 Alter 1 1 1 3 verlorene/verlassene Welpen 0 3 10 13 unbekannt 1 0 0 1 Gewaltsamer Tod/Verletzung Räuber 1 0 0 1 Fischotterbisse 1 0 0 1 Hundebisse 3 1 1 5 unbekannte Bissspuren 1 0 0 1 Andere Ursache unklar/unbekannt 10 5 6 21 Gesamt 51 79 186 316
Tabelle 3. A)Schäden durch geschützte Tiere (in Millionen CZK) nach Gesetzt 115/2000 Sb zwischen 2000 und 2008 (nach Tomásková 2009), B) Anzahl der Anträge für Otterschäden zwischen 2000 und 2007 mit ungefähren Äquivalenten in Millionen EUR (nach einer PowerPoint Präsentation von Kadlecíková 2009)
Jahr Otter (Lutra lutra) Kormoran (Phalacrocora x carbo) Biber (Castor fiber) Elch (Alces alces) Wolf (Canis lupus) Bär (Ursus arctos) Luchs (Lynx lynx) Gesamt 2000 0 0 0 0 0 0,193 0,005 0,198 2001 2,350 1,710 0,009 0 0 0,044 0,005 4,122 2002 3,150 3,130 0 0,016 0,009 0 0,006 6,310 2003 4,600 8,660 0 0,002 0,048 0,005 0,093 13,414 2004 7,050 23,460 2,429 0,063 0,203 0 0,049 33,255 2005 7,930 21,330 4,187 0,064 0,045 0 0,047 33,599 2006 5,810 23,630 6,865 0,006 0,015 0 0,012 36,335 2007 6,420 26,490 5,104 0,052 0,035 0 0,068 38,162 2008 8,350 35,960 6,672 0,054 0,063 0 0,023 51,123 Total 45,66 144,37 25,27 0,26 0,42 0,24 0,31 216,52 B) Jahr Anträge/Jahr Entschädigung (EUR) 2000 0 0 2001 28 87,652 2002 65 121,951 2003 85 170,998 2004 137 189,291 2005 142 234,992 2006 208 291,480 2007 220 244,872 106
A)