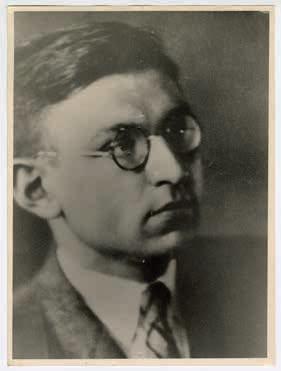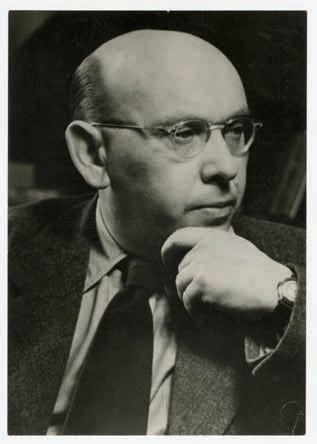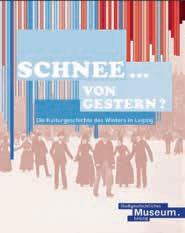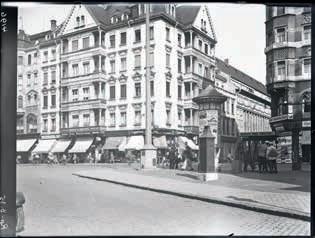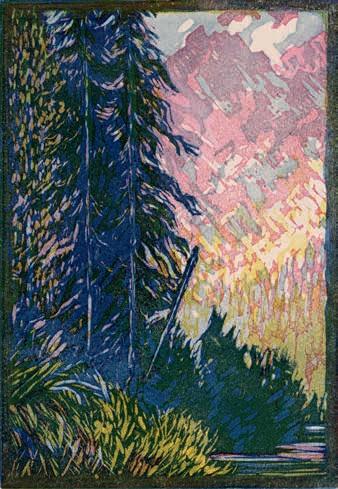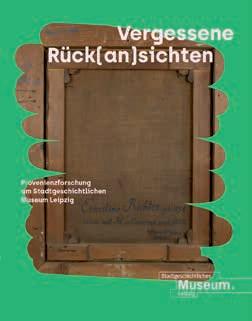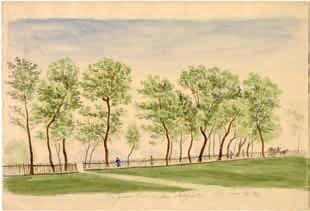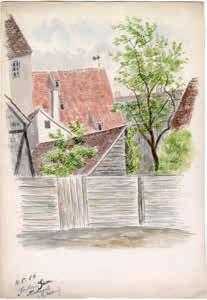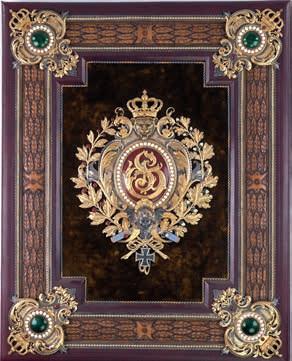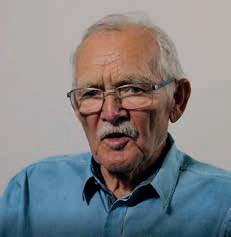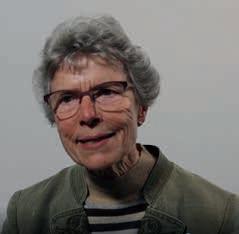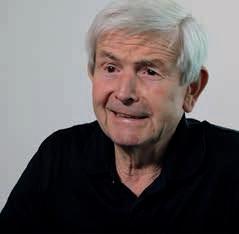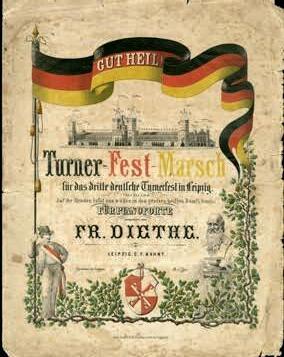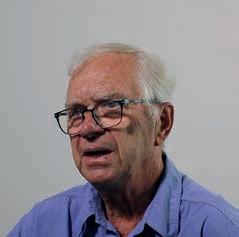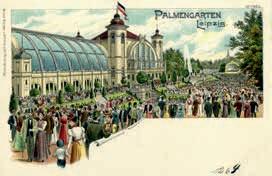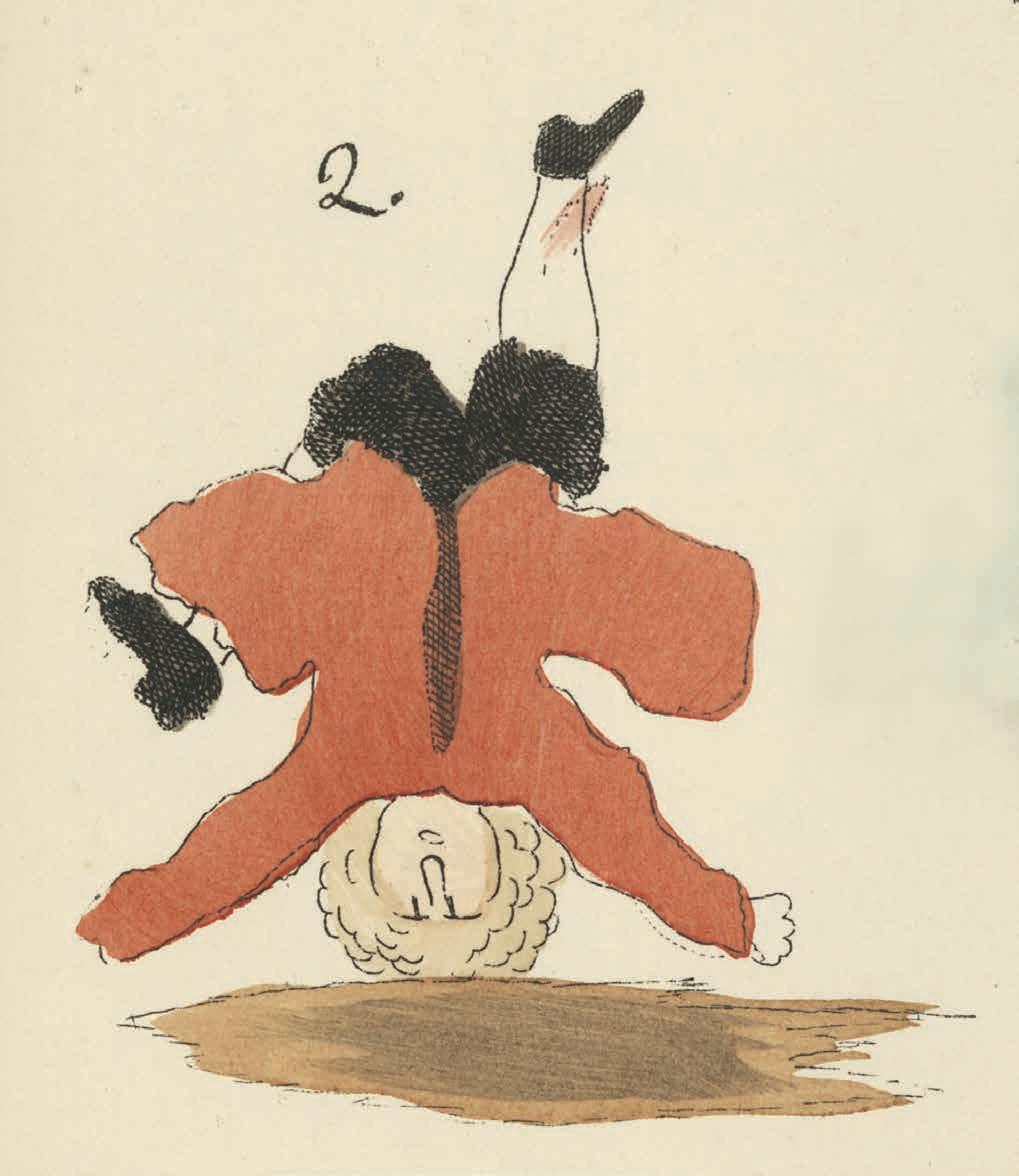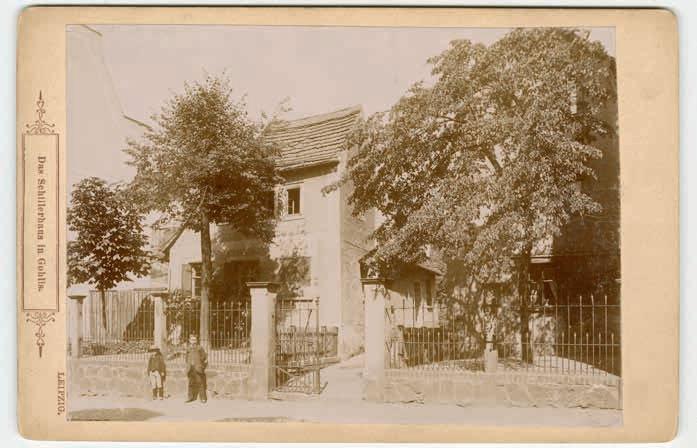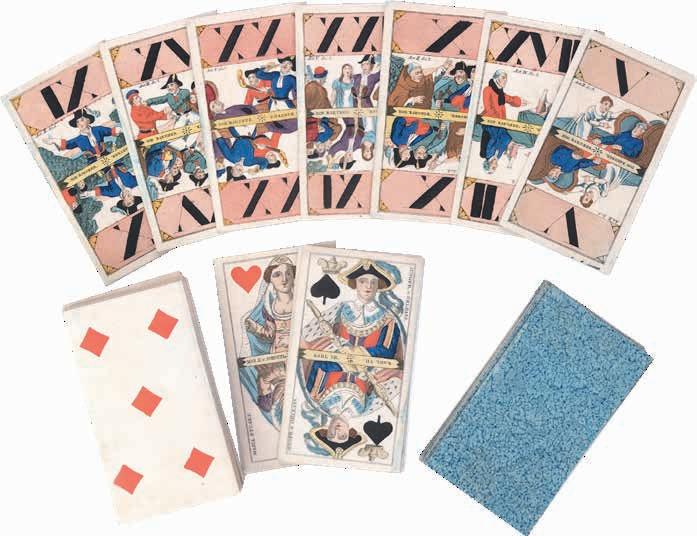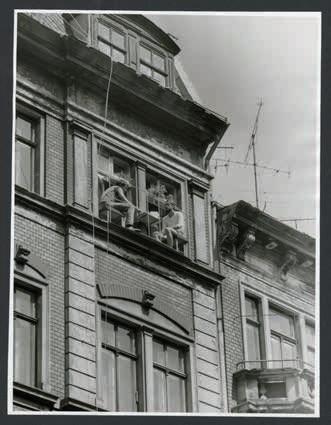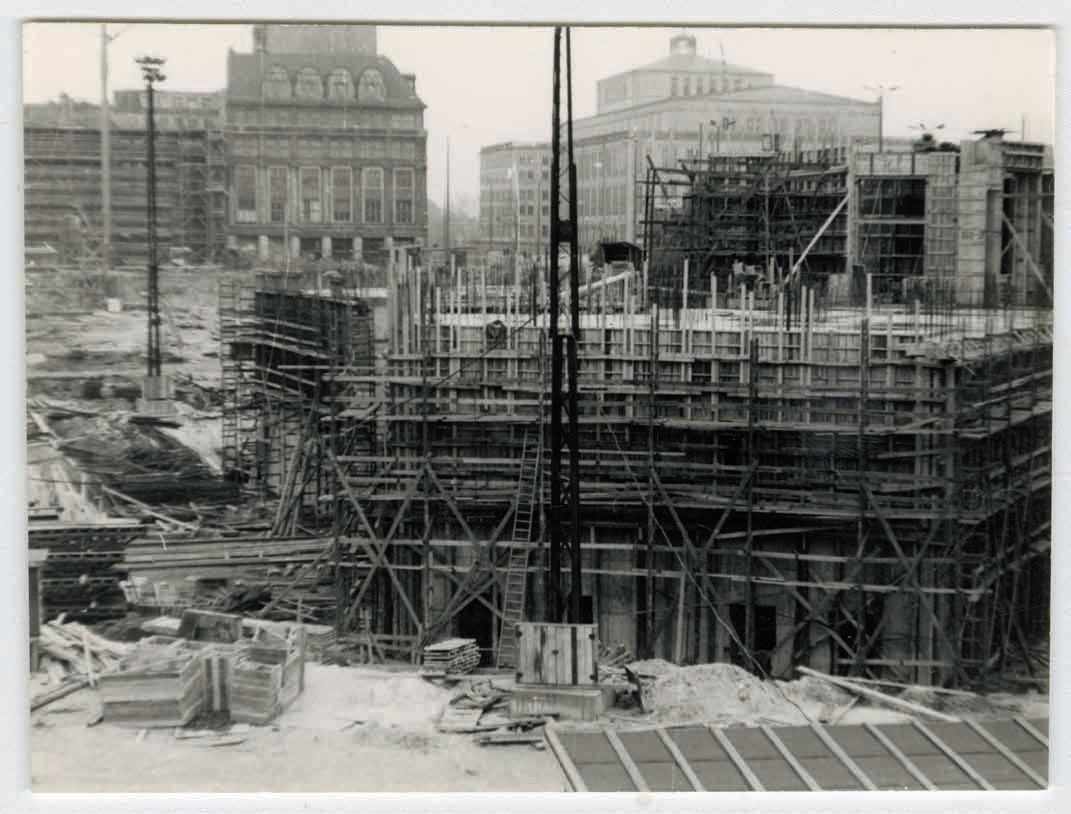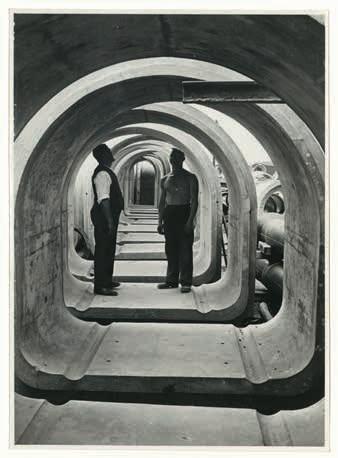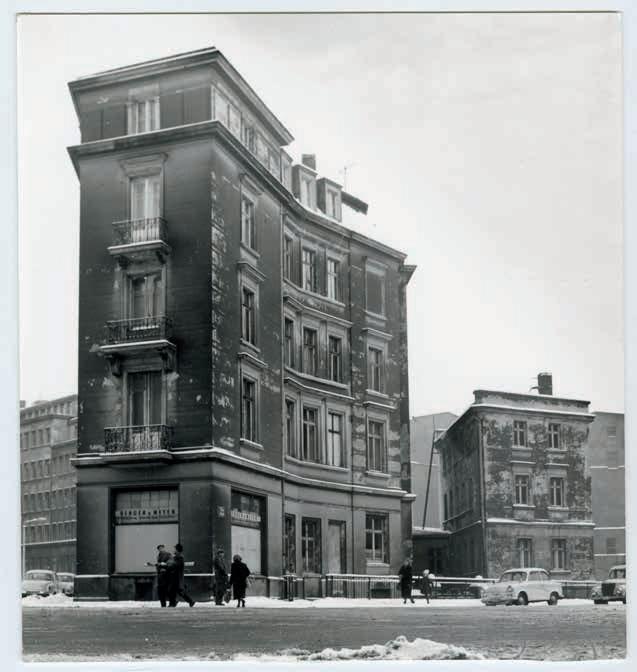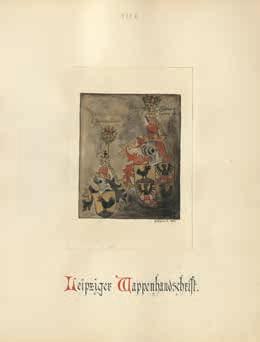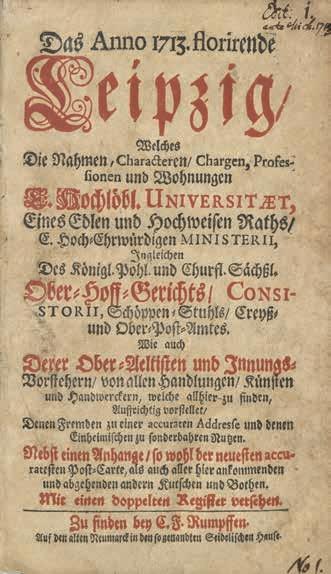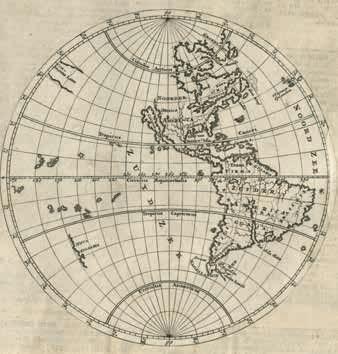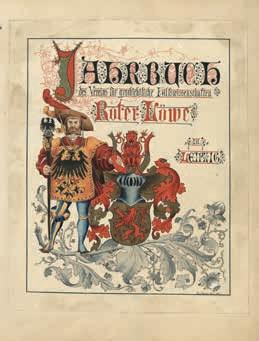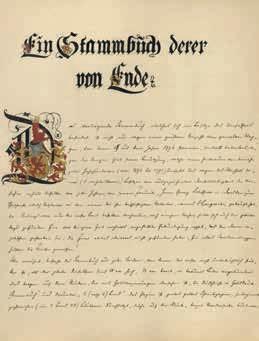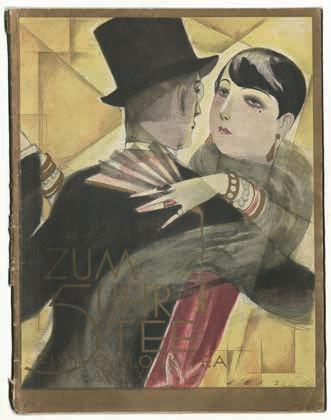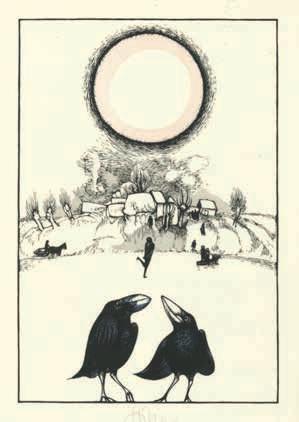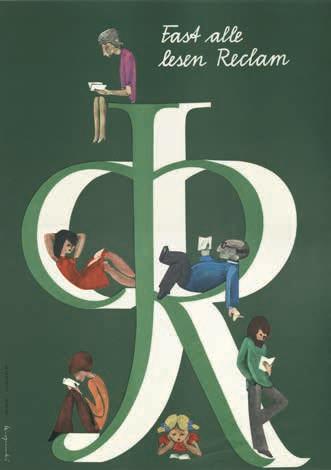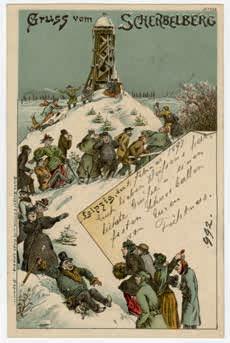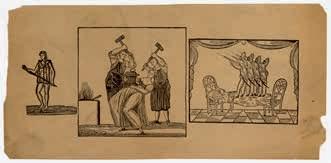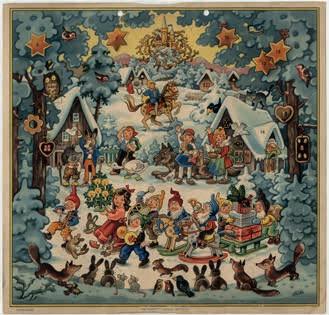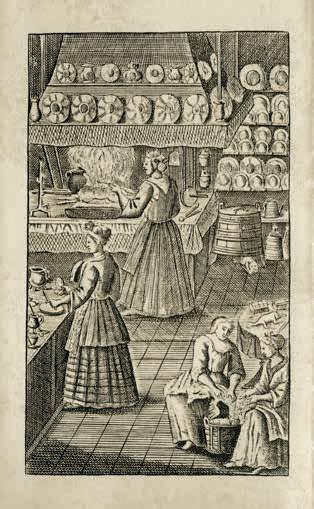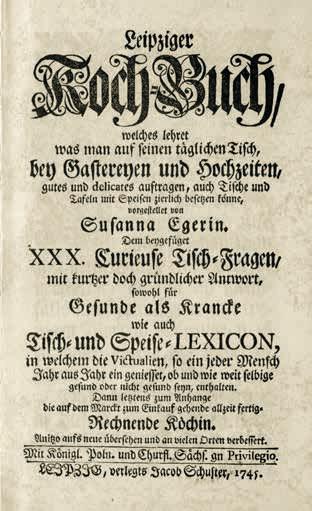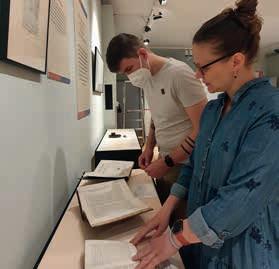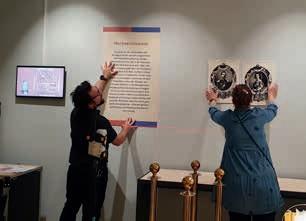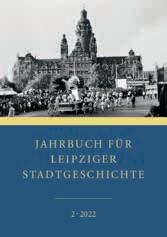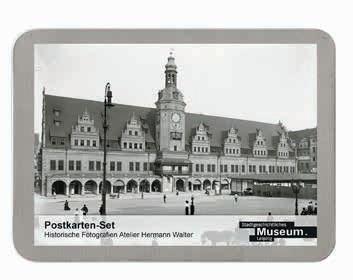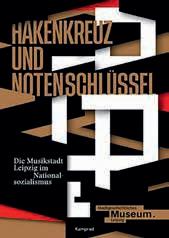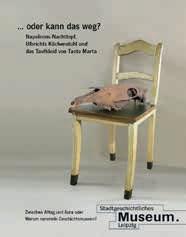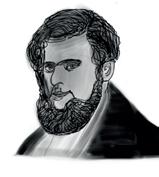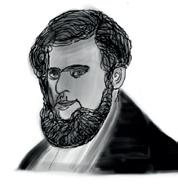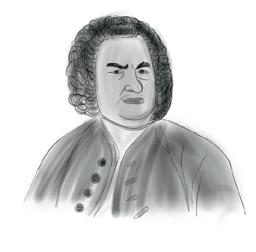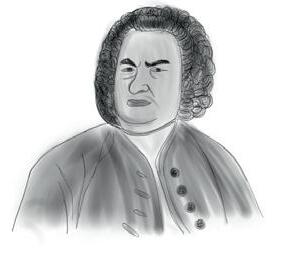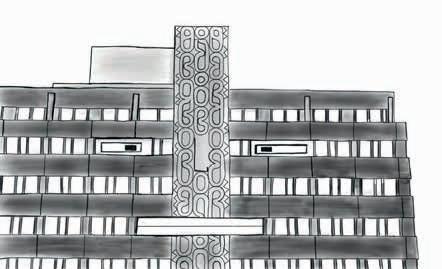MuZe
Zeitung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig
+++ VON GLEICHKLANG
ZU PAUKENSCHLAG +++
Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus, S. 3
+++ VERGESSENE
RÜCK(AN)SICHTEN +++ Zu den Provenienzen der Objekte, S. 7
+++ MAL OHNE
LOBEERKRANZ +++ Schillerhaus auf Anfang, S. 13
3. Ausgabe 2023 | stadtmuseum-leipzig.de
Achtung, Baustelle!
Ein Museum in dauernder Transformation
Achtung, Baustelle! So möchten wohl die meisten bei uns ausrufen, wenn wieder einmal umgeplant werden muss, Besucherinnen und Besucher nach der Öffnung geschlossener Häuser fragen, das Zwischendepot überquillt oder Schleifmaschinenlärm durch das Treppenhaus dringt. Ja, wir sind als Museum in einem anhaltenden Umbauzyklus begriffen, der uns menschlich und budgetär alles abverlangt:

Nach der Festsaaletage im Alten Rathaus stehen jetzt die noch geschlossenen Naschmarkträume sowie der verwaiste Museumsshop und irgendwann das historische Kellerverlies auf der Tagesordnung. Gerade haben wir das runderneuerte Schillerhaus bezogen, da steht die Wiedereinrichtung des sanierten Museums zum Arabischen Coffe Baum vor der Tür. Im Haus Böttchergäßchen haben wir quasi »nebenher« 550 Quadratmeter Parkett saniert und eine Menge neuer Infrastruktur verbaut, für das seit Jahrzehnten heimatlose Sportmuseum sind wir in intensiven Bauvorplanungen, und was am Völkerschlachtdenkmal Jahr für Jahr bewegt wird, kann man bei 91 Metern Höhe kaum übersehen. Historische Gebäude machen neben den alten und neuen Sammlungen den Kern
unserer Museumsschätze aus — sie sind aber eben auch begehbare Alpträume in puncto Bauerhalt, Inklusion und Energiekosten. Einen umfänglichen Bestandsumzug als Vorgriff auf ein noch zu entwickelndes Zentraldepot aller städtischen Museen haben wir für 2025/26 auch noch auf der Agenda …
Historische Gebäude machen neben den alten und neuen
Sammlungen den Kern unserer Museumsschätze aus
Doch ist auch das in seiner Ursprungsidee dem bürgerlichen
19. Jh. entstammende Museum als Konzept und bei laufendem Betrieb mitten im Umbau begriffen. Dass wir unsere zahlreichen OutreachAngebote im Stadtraum jetzt konsequent als eigenständige Säule der Museumsarbeit behandeln, ist da nur ein Teil der nötigen Neubestimmung. Ein aktualisiertes Leitbild und die ab 2024 geltende Eintrittsfreiheit für Dauerausstellungen profilieren uns noch stärker als Partner einer diverser werdenden Stadtgesellschaft und »dritten Ort« der Begegnung und des Ringens um

+++ GESCHICHTE(N)
HINTER GLAS +++ Objekte zu Exponaten gemacht, S. 17
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit. Wir laden Sie zum Stöbern ein, was die Arbeit des Museums im vergangenen Jahr ausmachte. Nehmen Sie sich im Wirbel der Zeit einen Moment und tauchen Sie lesend, lachend oder zuweilen auch (mit-)leidend in die großen und kleinen Geschichten aus unserem Haus ein.
Geschichte befragen. Gegenwart begreifen. Zukunft gestalten. Dies haben wir im Rahmen unseres neuen Leitbildes als übergreifenden Anspruch formuliert und sehen es als Chance und Verständigungsgrundlage sowohl für das Team als auch für Sie.

Zusammenhalt und Demokratie. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sich im Zeitalter der Fake News und Triggerwarnungen über historische Akteurinnen und Akteure sowie aktuelle Bewegungen sprechen lässt, was nachhaltiger Tourismus und ressourcenschonende Arbeitsorganisation künftig bedeuten, wie wir die neuen Daueraufgaben Digitalisierung und Provenienzforschung meistern wollen und uns angesichts ausufernder Verwaltungsregularien reaktionsschnell Freiräume der Eigenverantwortung und Kreativität bewahren.
Denn auch die Gesellschaft insgesamt befindet sich in beschleunigter Transformation. Klimakrise, Krieg, Teuerungswelle und Fachkräftenotstand, aber auch die Erfordernisse einer neuen Mobilität sowie einer Stadt und Land verbindenden Erneuerung nach Corona sind Themen, die uns alle unter heftigen Anpassungsschmerzen verändern. Für ein Leipzig-Museum in der Stadt des weltorientierten friedlichen Wandels stellen diese herausfordernden Paradigmenwechsel jedoch selbst spannende Themen dar, denen wir uns in Ausstellungen wie aktuell zur Musikstadt im Nationalsozialismus oder künftig zur Umbruchzeit der 1990er
Jahre und den Spuren des Braunkohlezeitalters engagiert widmen.
Achtung, Baustelle — Betreten, Beraten, Beteiligen erwünscht!
Genau deshalb zeigt dieses Fotos einen Baustromverteiler, den ich als Sinnbild des immensen Energiestroms sehe, der aus der unversiegbaren Motivation und Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen schöpft. Die Begegnung mit Ihnen allen als unseren Museumsfreundinnen und -freunden, Kooperationspartnerinnen und -partnern, Trägern und interessierten Besucherkreisen lädt diese unsere Batterie immer wieder auf und verleiht uns so die Kraft, durch allen Umbaustress hindurch eine in Relevanz und Herausforderung beglückende Zukunft zu sehen.
Deshalb kann die Devise für das kommende Jahr nur lauten: Achtung, Baustelle — Betreten, Beraten, Beteiligen erwünscht!
Unsere Häuser und Ausstellungen verstehen sich als offene Räume, die dazu einladen, sich anhand von Objekten und Geschichten mit Leipzig auseinanderzusetzen. Ausgehend von aktuellen Fragestellungen beschäftigen wir uns mit der Stadtgeschichte und stellen Bezüge zur Gegenwart und Zukunft her. Wir sammeln und dokumentieren dazu Alltagsdinge, Kunstwerke, Dokumente und immaterielle Zeugnisse zur Stadt und Region in ihren weltweiten Verflechtungen. Dieses dingliche Gedächtnis der Stadtgesellschaft für künftige Generationen zu erhalten und beständig neu zu erschließen, ist zentrale Aufgabe. So die hehre Theorie — wie aber setzt man dies im Alltag eines im ständigen Umbau begriffenen Museums praktisch um, und auf welchen plangeraden Alleen oder auch lehrreichen Umwegen sind wir diesen Zielen zumindest nähergekommen? Schließlich geht es uns darum, die Vielfalt der Stadt, ihrer Menschen und ihres kulturellen Erbes konkret erlebbar zu machen. Dazu nutzen wir in Ausstellungen und Programmen nicht nur Formate der anschaulichen Wissensvermittlung und des lebendigen Austauschs, sondern gerade auch diese Zeitung als vergnügliches Dialogangebot.
Also, checken Sie beim Lesen und teilen Sie uns mit, ob und wie wir den im Leitbild definierten Arbeitsfeldern »Erhaltung und zeitgemäße Erschließung von Sammlungen und Baudenkmälern«, »Erwerb und Bereitstellung von Wissen über Sammlungen«, »Raum für Reflexion und kritischen Austausch«, »Museumsgeschichte und Unrechtskontexte aufarbeiten«, »Vermittlung und Kommunikation als Querschnittsaufgaben«, »Demokratische Vielfalt und Teilhabe«, »Nachhaltigkeit und Ressourcenbewusstsein« und »Arbeitskultur, Service-Orientierung und ethische Standards« gerecht geworden sind.
Und wenn nicht, freuen wir uns, von Ihnen zu hören, was Sie thematisch vermissen und wo wir uns gemeinsam noch verbessern können.
Baustelle durch Parkettsanierung im HAUS BÖTTCHERGÄßCHEN 2022
AUTOR Dr. Anselm Hartinger Direktor Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
Eine naheliegende Alternative war die Mitwirkung im Publikumsbeirat, der im Herbst 2020 als Pilotprojekt startete. Zunächst für ein Jahr geplant, wurde der Zeitraum wegen Corona mehrfach verlängert und im Oktober 2022 dann schließlich mit einer Bestandsaufnahme beendet.
Ziel war es, den Anliegen der Museumsbesucherinnen und -besucher sowie den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft an das Museum ein Forum zu geben und in einen regelmäßigen Dialog zu treten. Obwohl der gewünschte Austausch durchaus zustande kam und das Museum viel hilfreiches Feedback und inhaltliche Anregungen erhielt, fiel die Bilanz der Mitwirkenden doch gemischt aus.
Mitmachen, Mitbestimmen, Mitgestalten
Neue Wege für das freiwillige Engagement
Aktuelle Fragen an die Leipziger Stadtgeschichte aufgreifen und die gegenwärtige Stadtentwicklung für kommende Generationen dokumentieren, um die Vielfalt der Stadt, ihrer Menschen und ihres kulturellen Erbes auf attraktive und zeitgemäße Weise erfahrbar zu machen — diesen Anspruch formuliert das Museumsteam in seinem neuen Leitbild als ein zentrales »Mission Statement«.
Dazu wollen wir als Museum auch zukünftig mit Neugier hinaus in den Stadtraum wirken und unsere Räume für mehr bürgerschaftliches Engagement öffnen. Voraussetzung dafür sind zielgruppengerechte Angebote


für Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen. Bürgerschaftliches Engagement stand freilich bereits am Anfang des Stadtgeschichtlichen Museums: Es entstand aus einer Initiative im Umfeld des 1867 gegründeten Leipziger Geschichtsvereins. Seine Sammlungsbestände gehen in nicht unerheblichem Maße auf die Schenkungen Leipziger Bürgerinnen und Bürger zurück.
In der Gegenwart wird freiwilliges Engagement am Museum zuerst mit dem klassischen Ehrenamt verbunden. Meist von Menschen nach ihrer beruflichen Aktivphase ausgeübt, handelt es sich dabei um eine auf Langfristigkeit angelegte regelmä-
Stadt, Erinnerungskultur und Museum
Drei Fragen an Dr. Ansgar Scholz vom Kulturamt der Stadt Leipzig
Sie sind seit 20 Jahren Sachgebietsleiter »Bauinvestitionen/ Kunst im öffentlichen Raum«. Was sind Ihre Aufgaben und in welcher Weise sind Sie mit dem Stadtgeschichtlichen Museum verbunden?
Das Kulturamt entwickelt Zielstellungen für das Kulturleben der Stadt und unterstützt es mit Förderverfahren. Freie Kunst und Kultur leben nicht zuletzt von ihrer gebäudeseitigen Verortung, wofür unser Sachgebiet die Bauherrenaufgabe wahrnimmt. Für diese etwa 40 Liegenschaften (zu denen weitbekannte Einrichtungen wie z. B. das Werk 2 und die Russische Gedächtniskirche zählen) gilt es die permanente Pflege und Entwicklung zu gewähr-
leisten und dabei auch Objekte, die sich am Stadtrand befinden, nicht aus dem Blick zu verlieren. Dazu kommen neue Herausforderungen wie der Umbau des ehemaligen Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz. Als Bauherr gilt es, gemeinsam mit den Nutzern Aufgabenstellungen zu formulieren, für deren Umsetzung alle zu Beteiligenden zusammen zu bringen und natürlich die Finanzierung mit einer möglichst hohen Förderquote abzusichern.
Aufgrund dieses Aufgabenspektrum bin ich dem Museum seit Jahren vielfältig verbunden — etwa durch die Sanierung des Alten Rathauses.
Ein spannendes Aufgabengebiet umfasst das weite Feld der Kunst im öffentlichen Raum. Auch hier gilt es,
ßige Mitarbeit auf Grundlage eines Vertrags. Die Ehrenamtlichen bringen in der Regel besondere Kenntnisse oder Erfahrungen mit, die sie in die Erschließung etwa der Bildbestände in unserer Fotothek einbringen. Aus organisatorischen Gründen ist die Zahl der Plätze allerdings sehr begrenzt, so dass neue Bewerberinnen und Bewerber erst nach dem Ausscheiden der bisherigen Ehrenamtlichen und einem individuellen Eignungsgespräch zum Zuge kommen können. Interessierte mussten daher oft auf unbestimmte Zeit vertröstet werden, ohne dass ihnen zeitnah eine Möglichkeit zum praktischen Mitarbeiten angeboten werden konnte.
Die Vielfalt der besprochenen Themen und Fragen wurde zwar überwiegend positiv gesehen, doch einige äußerten den Wunsch nach mehr Gelegenheiten zum ganz ›praktischen‹ Mitmachen und zur inhaltlichen Mitarbeit, z. B. bei Ausstellungen.
Da schnell klar war, dass das den Rahmen des Publikumsbeirats übersteigen würde, nutzten wir den jährlichen Ehrenamtstag für einen Workshop zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements.

Mit einer Gruppe Freiwilliger beschäftigten wir uns schwerpunktmäßig mit den folgenden Fragen: Wie kann freiwilliges Engagement die Angebote des Museums ergänzen? Wo kann es neue Aufgaben übernehmen, um das Museum attraktiver zu machen? Welche innovativen Ideen gibt es dafür? Das Ergebnis zeigte: Es gibt viele Möglichkeiten, besonderes Potenzial wird aber im zwischenmenschlichen Bereich gesehen. Hier können Engagierte eine ganz besondere Rolle spielen, um das Museum als attraktiven sozialen Ort mitzugestalten, etwa indem sie Besuchende im Eingangsbereich begrüßen und mit hilfreichen Tipps versorgen oder unverbindliche Erklär- und Gesprächsangebote in den Ausstellun-

gen machen. So können sie punktuell Rollen übernehmen, die durch das Aufsichts- und Service-Personal, das Vermittlungsteam wie auch Kuratorinnen und Kuratoren im Normalbetrieb nicht abgedeckt werden.
Ausgehend von den Erfahrungen des letzten Jahres und den Ergebnissen des Workshops soll noch in diesem Jahr eine neue Engagementstrategie umgesetzt werden, die unter den drei Leitbegriffen »Mitmachen — Mitbestimmen — Mitgestalten« neue Wege eröffnet. Neben das klassische Ehrenamt und den stärker auf seine beratende Kernaufgabe fokussierten Publikumsbeirat mit einjähriger Laufzeit sollen niedrigschwellige Angebote treten, z. B. die praktische Mitarbeit im Helferinnen- und Helfer-Team oder in der Betreuung von Besucherinnen und Besuchern. Insbesondere auch den vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Möglichkeit zur inhaltlichen Mitwirkung möchten wir aufgreifen, indem wir größeren Ausstellungsvorhaben zu Themen mit Gegenwartsbezug frühzeitig bürgerschaftliche Projektgruppen an die Seite stellen.
MITGESTALTEN ERWÜNSCHT!
90er Jahre in Leipzig: Möchten Sie Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen führen? Recherchieren Sie gern Medien oder Objekte und möchten daraus Präsentationsideen entwickeln? Dann ist die Projektgruppe zur Geschichte der Nachwendezeit und Transformationserfahrungen der 90er Jahre in Leipzig genau die richtige. Aktiv werden Sie von September bis Dezember 2023, ggf. mit Fortsetzung in 2024. Hier geht es zum Anmelde-Webformular: https://formulare.leipzig. de/frontend-server/form/ provide/2228/
uns Anvertrautes wie das von Mendelssohn gestiftete Denkmal für Johann Sebastian Bach und Neugeschaffenes wie der Erinnerungsort für die Große Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße zu pflegen. Wir beraten maßgeblich andere Bauherrenämter bei der Umsetzung von Kunst am Bau und loben selbst Wettbewerbe aus — so in Kürze für das Museumskarree beim Haus Böttchergäßchen. Und bei der Umsetzung des Gedenktafelprogramms der Stadt sind wir für den konstruktiven Austausch mit dem Museums-Fachteam sehr dankbar.
Was sind die Besonderheiten des Bauens und Sanierens in historischen Liegenschaften und Denkmälern?
Um die Gebäude dauerhaft zu erhalten, müssen sie genutzt werden. Den Nutzungen und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen muss jedoch in einer Weise Rechnung getragen werden, die den Häusern nicht ihre Seele raubt und somit den Menschen weiterhin Halt
und Orientierung gibt. Wir müssen darauf achten, dass Gebäude bei umfassenden Instandsetzungen bauhistorische Nutzungsschichten behalten, mit denen ihre Geschichte erzählt werden kann. Das gilt umso mehr bei den Museen, die selbst facettenreiche Exponate und Wissensspeicher unserer Stadtgeschichte sind. Was sich in Zukunft als wertvolle bauhistorische Quelle entpuppen wird, kann man heute noch gar nicht abschätzen. Auch daher ist es zunehmend wichtig, Nutzungsspuren der DDR-Zeit nicht vollständig zu tilgen.
Zu unseren aktuellen Gemeinschaftsprojekten gehören die Sanierung des Museums zum Arabischen Coffe Baum, das neue Sportmuseum sowie die Depotplanungen auf der Alten Messe. Wie ist dort der Stand, was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre?
Der »Coffebaum« ist eine große Herausforderung. Die Kleinteiligkeit des innerstädtisch gelegenen Gebäudes, die große Nachfrage nach Handwer-
kern sowie Materialengpässe führten leider dazu, dass weder der Zeitnoch der Kostenplan eingehalten werden konnten. Wir hoffen, dass das bei Einheimischen und Besuchern beliebte Haus im Sommer 2024 wieder öffnen wird.
Die schon lange gehegten Pläne, die Nordtribüne des ehemaligen Schwimmstadions in ein zeitgemäßes Sportmuseum umzubauen, erhalten gerade Rückenwind durch die Entwicklung der angrenzenden Freifläche als Schulstandort. Sofern der Stadtrat zustimmt, könnte noch 2023 ein gemeinsamer Architekturwettbewerb ausgelobt werden.
Die in Halle 12 ab 2025 zur Verfügung stehenden Depotflächen entspannen vorerst die ausgeschöpften Kapazitäten einiger Museen. Langfristig steht die Aufgabe an, ein Depot für alle kommunalen Museen der Stadt Leipzig zu schaffen. Erfahrungen anderer Städte zeigen, dass da ein Weg von mindestens 10 Jahren vor uns liegt. Die Liste anspruchsvoller Aufgaben wird also nicht kürzer.
2 3 2 1 ZUKUNFT MUSEUM CHANCEN & HERAUSFORDERUNGEN
AUTOR Carl Philipp Nies | Referent für Museumsentwicklung und bürgerschaftliche Beteiligung
Gemeinsam kreative Ideen entwickeln beim Workshoptag des freiwilligen Engagements im November 2022, Foto: Mahmoud Dabdoub
Zwischen Gleichklang und Paukenschlag
Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus
Am 21. Januar 1942 wurden mit dem ersten Transport sächsischer Jüdinnen und Juden 785 Menschen von Leipzig und Dresden nach Riga deportiert. Einer von ihnen war Erich LiebermannRoßwiese, auf der Transportliste hat er die Nummer 258. Es herrschten minus 15 Grad. Erich LiebermannRoßwiese war 55 Jahre alt und herzkrank. Seinem Ziehsohn Wolfgang Michael hatte er in einem Abschiedsbrief geschrieben: »Mein Junge, wenn du diesen Brief erhältst, befinde ich mich auf der Fahrt gen Osten. Es musste kommen. Ziel unbekannt … Laß mich in dieser Abschiedsstunde Dir für alle Liebe und Freundschaft danken.«
Vor 1933, in seinem früheren Leben, war Liebermann-Roßwiese (ein Verwandter des Malers Max Liebermann)
Pianist, Komponist und Rundfunkmensch. Hier im jungen Rundfunk der Messestadt Leipzig machte er Karriere, war Schallplattenredakteur, später Chef der Musikabteilung.
Für die MIRAG, die Mitteldeutsche Rundfunk AG, gestaltete er Sendungen, komponierte Musik und schrieb Texte für die Rundfunkzeitschrift. Er war evangelisch getauft, doch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten galt er als Jude. Im Frühjahr 1933 wurde er entlassen. Neun demütigende Jahre lang versuchte er, außerhalb von Deutschland eine Anstellung zu finden, in Wien, in der Türkei, in den Niederlanden. Er bat
Hanns Eisler in Leipzig
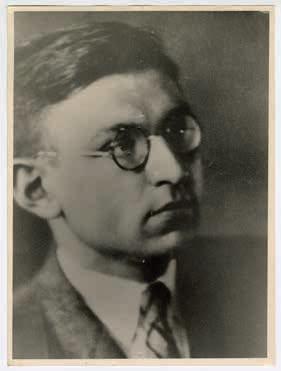

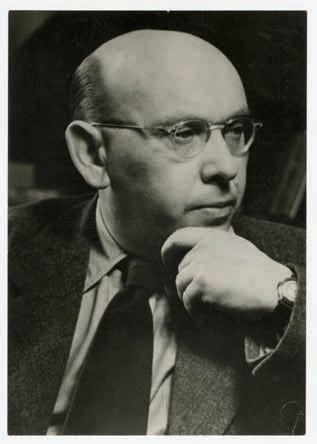
Sein Leben zeichnet die Spuren des 20. Jahrhunderts
»Wer war Hanns Eisler« — titelte 1983 ein Buch. Dieser Frage geht auch die Ausstellung anlässlich seines 125. Geburtstag in seiner Geburtsstadt Leipzig nach.
Wer war dieser Künstler, der sich so um die Politik kümmerte, dass man ihn in der DDR zu einer Politgröße machte? Was ist heute, über 60 Jahre nach seinem Tod, in der Öffentlichkeit überhaupt noch bekannt über ihn? Und vor allem: Wie klingt seine Musik? Sein Leben zeichnet die Spuren des 20. Jh. — politischer Widerstand, Verfolgung als Jude und Kom-
»Wir sind dicht vorm Zielbahnhof. Von dort aus soll es unmittelbar in die Gräben gehen, wo hartnäckige Abwehrkämpfe stattfinden. Ich sehe also mit Fassung auch dem Tod auf dem Schlachtfeld ins Auge, dem Schicksal, das uns so hart erscheinen will und dem wir auch nicht entrinnen können, wenn es uns vorbestimmt ist.«
Bräutigam war erst 27 Jahre alt, als ihn wenige Tage später eine Kugel traf, in der Nähe von Weliki Nowgorod in der damaligen Sowjetunion. Er war Student des Leipziger Konservatoriums und musikalisch hochbegabt. Viele seiner Kompositionen, vor allem Lieder, wurden bereits zu Lebzeiten gedruckt. Er engagierte sich im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und wurde 1937 NSDAP-Mitglied. Verblendet von der menschenverachtenden NS-Ideologie beeinflusste er am Landeskonservatorium die Erziehungsarbeit, bevor er 1939 in die Wehrmacht eingezogen und zwei Jahre später an die Ostfront versetzt wurde.
die NS-Zeit eine wichtige Rolle. Nun also »Hakenkreuz und Notenschlüssel« — das böse NS-Regime und die gute, unschuldige Musikstadt? Natürlich nicht. Beide sind eng miteinander verwoben.
prominente Menschen um Hilfe, darunter Alma Mahler-Werfel. Alle Versuche zu emigrieren scheiterten. 1938 ließen er und seine nichtjüdische Ehefrau sich scheiden, vermutlich, um die minderjährigen Kinder aus erster, »arischer« Ehe zu schützen. Er musste in eines der Leipziger »Judenhäuser« umziehen; die Lortzingstraße 14 war die letzte Adresse vor der Deportation. Wie lange Liebermann-Roßwiese in Riga überlebt hat, ist unklar, vermutlich starb er noch 1942.
Die erschütternden Zeugnisse von Liebermann-Roßwiese und seiner Familie während der jahrelangen Suche nach Auswegen sind erst vor wenigen Jahren an das Stadtarchiv Leipzig übergeben worden. Dr. Allmuth Behrendt hat sie gesichtet und uns davon berichtet, ihr verdanken wir den Hinweis auf dieses Schicksal.
Auch Helmut Bräutigam schrieb im Januar 1942 einen Abschiedsbrief. Er war an seine Eltern gerichtet:
Erich Liebermann-Roßwiese und Helmut Bräutigam sind zwei von neun Biografien, die in der Ausstellung und dem gleichnamigen Buch »Hakenkreuz und Notenschlüssel.
Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus« näher vorgestellt werden. Sie sind mit den neun Hauptthemen verwoben. Seit der von Dr. Thomas Schinköth herausgegebenen Publikation über die »Musikstadt Leipzig im NS-Staat« von 1997 gab es Überlegungen, dieses Thema auch im Stadtgeschichtlichen Museum zu präsentieren. Das ist eine Weile her. In der Zwischenzeit hatten wir MusikAusstellungen zu Jubiläen: Mendelssohn, Thomanerchor, Wagner. In all diesen Ausstellungen spielte auch
Unsere neun Hauptthemen stehen unter musikalischen Oberbegriffen: Vorspiel, Gleichklang, Trommelwirbel, Paukenschlag, Musikdrama, Kirchentöne, Abschiedslied, Akzent und Nachspiel. Sie liefern die Struktur, um die bekannten Institutionen der Musikstadt und Geschehnisse jener Zeit zuzuordnen. Thematisiert werden die Gleichschaltung an Gewandhaus und Konservatorium, das Anlaufen der Propagandamaschinerie und das Nähren des Mythos von der »Musikstadt Leipzig« (die aber ohne Mendelssohn auszukommen hatte). Es geht um den ungleichen Umgang mit den Denkmälern für Mendelssohn und Wagner, das sich ändernde Repertoire an der Oper, die Instrumentalisierung der Bachschen Werke als Beispiel »kultureller deutscher Überlegenheit«, die komplette Auslöschung des jüdischen Musiklebens nach 1938 und um die von den Nationalsozialisten beargwöhnte junge Jazz- und Swingszene. Auch in die Zeit vor 1933 wird geschaut und auf die ersten musikalischen Jahre nach 1945 — und darauf, wie Karrieren weitergingen.
Zu unserer Auswahl von neun Biografien gehören außer den beiden bereits genannten der Arbeiterchordirigent Barnet Licht, der NS-Kulturfunktionär Friedrich August Hauptmann, die spätere Jazzpianistin Jutta Hipp, Opernchef Paul Schmitz, Thomaskantor Günther Ramin und Gewandhauskapellmeister Hermann Abendroth — die drei letztgenannten standen allesamt auf der berühmtberüchtigten »GottbegnadetenListe« von Hitler und Goebbels, dank der sie als »unersetzliche Künstler« eingestuft und somit vor dem Wehrdienst bewahrt wurden. Auch die Liedsängerin Elena Gerhardt wird vorgestellt, die aus Solidarität zu ihrem 1933 aus politischen Gründen verhafteten Mann sofort die Emigration plant und entschlossen durchzieht. Leipzig verliert nicht nur einen Gesangsstar mit internationalem Renommee, sondern auch eine prominente Lehrerin am Konservatorium.
SCHON GEWUSST

munist, Verfemung seiner Musik als »entartet«, Exil, Ausweisung aus den USA, Rückkehr in die Heimat. Doch was war überhaupt Heimat für Eisler, den Österreicher, der in Leipzig geboren wurde, der dann in Wien aufwuchs und später »öfter als die Schuhe die Länder wechselte«? Wieviel Leipzig steckt in Eisler – und wieviel Eisler heute in Leipzig?
Seine innere und die äußere Welt klingen in seinem umfangreichen Werk. Es umfasst Chor- und Orchesterwerke, Ensemblemusik, Lieder, Songs, Balladen, Bühnen- und Filmmusik. Er ver-
tonte Bertolt Brecht kongenial und komponierte die Nationalhymne der DDR. Er war einer der bedeutenden Komponisten des 20. Jh.
Die Ausstellung vom 7. Juli bis 15. Oktober 2023 ist eine Kooperation der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft e. V., Berlin, mit dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Gastkuratorin ist Bettina Weil. Begleitet wird die Schau von den EislerTagen der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft vom 6. bis 9. Juli 2023 in Leipzig.


Vor 300 Jahren kam Johann Sebastian Bach nach Leipzig. Er wurde neuer Thomaskantor. Musikalisch brach damit eine neue Zeit an: Bach komponierte Meisterwerke im Wochentakt. Begonnen hatte alles mit seiner Unterschrift im Alten Rathaus …
Die 300-jährige Wiederkehr des Amtsantrittes von Bach nehmen wir zum Anlass, das Alte Rathaus als authentische Bachstätte neu zu profilieren. Ab Sommer wird es ein digitales Angebot dazu geben, einen neu konzipierten »BachParcours«.
Die Intervention entsteht im Rahmen des städtischen Themenjahres 2023 »Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne« in Kooperation mit dem Bacharchiv Leipzig.
3 MUSIK & THEATER ZWISCHEN NOTENSPUREN UND BÜHNENBILDERN AUTORIN Kerstin Sieblist | Kuratorin Musik und Theatersammlung
Hanns Eisler, Inv.-Nr.: H 165
Erich Liebermann Roßwiese, Abb. aus Die Mirag, Mitteldeutsche Rundfunkzeitung, Nr. 49, Leipzig, 5. Dezember 1931, Abb. Deutsche Nationalbibliothek Leipzig
Helmut Bräutigam, um 1938, Inv.-Nr. Jost 73
Die Ausstellung ist noch bis zum 20. August 2023 im HAUS BÖTTCHERGÄßCHEN zu sehen. Weitere Infos:
GESCHICHTE BIS 1800
Von wegen »Schnee von gestern«
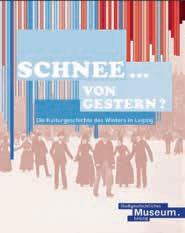
Never ending story oder Bauvorhaben mit Happy End?
Das Ende eines Kraftaktes
Der WINTER, geliebt und gehasst, ersehnt und gefürchtet, keine Jahreszeit polarisiert so sehr wie diese. Leipzig gilt bis heute weder als Stadt schneereicher Winter noch des ambitionierten Wintersports. Der Rhythmus städtischen Lebens ist auch von dieser Jahreszeit geprägt, stellt sie doch Herausforderung an jeden Einzelnen wie die städtische Daseinsvorsorge insgesamt dar. Doch hat diese zunächst harsch erscheinende Jahreszeit eine verletzliche Seite. Ihre Zukunft ist eng mit der Klimaentwicklung verbunden. Die Debatten hierzu sind aktueller denn je.


Mit einer Fülle unterschiedlicher Objekte, Bilder und Medien sowie mit Mitmachstationen für Groß und Klein zeigten wir bei der Ausstellung »Schnee von gestern« die schönen und die schauerlichen Seiten des Winters, bei denen die musikalischen und kulinarischen Genussmomente der Weihnachtszeit nicht vergessen wurden. Und was bleibt? In der begleitenden Publikation können Sie die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig jederzeit zu Hause vertiefen.
Das Buch ist für 12,50 Euro im Museum und unter petra.schuerer@ leipzig.de erhältlich.
Wir schreiben Freitag, den 29. April 2022, eigentlich kein besonderer Feiertag, aber für uns als Museumsteam ein besonderer Festtag. Es ist vollbracht! Restlos erschöpft und unheimlich stolz auf das Geleistete gaben wir als Museumsteam die erste Etage des Alten Rathauses an den Hausherrn, den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, und 200 geladene Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft zurück. Am Sonntag, dem 1. Mai 2022, folgten über 3.000 Gäste der Einladung zum »Tag der offenen Tür«.

Hinter uns lagen sechszehn Monate elektrotechnischer Ertüchtigung. Das Öffnen und Schließen von historischen Decken, Wänden und Fußböden mit allen Konsequenzen, das Verlegen von zweieinhalb Kilometer Elektro- und anderthalb Kilometer Datenkabel sowie die Einrichtung verschiedener WLAN-Netze unterschiedlicher Sicherheitsstufen war eigentlich schon sportlich genug.
Fenster und Fensterrahmen wurden in Abstimmung mit dem Wetter! ertüchtigt. Es galt, die Hürden neuer Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit zu meistern. Bis hier fragt sich der geneigte Leser, was das denn mit Museum zu tun hat, sind das doch Aufgaben des städtischen Amtes für Gebäudemanagement und der beauftragten Gewerke. Der erste Eindruck beim Betreten des Festsaales scheint dies noch zu verstärken. »Viel hat sich ja nicht verändert«, so eine dann und wann leise, aber hörbare Bemerkung. Weit gefehlt! Das war die große Kunst, dass die Wunden des Baugeschehens rückstandlos verheilen. Es ist Zeit für eine kurze
Hat er oder hat er nicht?
Gregor Anesorges Tischlerarbeiten in der Ratsstube
Zu den schönen kuratorischen Pflichten gehört das Erforschen: Objekte und ihre Geschichte sowie deren Einordnung in das Große und Ganze der Geschichte. Anlass zum Arbeiten in Bibliothek und Archiv gab der Ratsschrank, DAS Kleinod in der Ratsstube des Alten Rathauses.
30 Monate war er in der Werkstatt von Matthias Krahnstöver und kam gerade rechtzeitig vor der Wiedereröffnung zurück. Mehr als 1.300 Arbeitsstunden hatte er dem Restaurator abverlangt, um gesichert, ergänzt und aufgehellt zu werden. Aber im
Bilanz. Wir waren alles andere als tatenlos:
Wir veränderten unter dem wachsamen Auge des Denkmalschutzes mit Gestaltern die Willkommensgeste im Festsaal des Rathauses indem wir Garderobe und Tresen verjüngten. Ein neues Besucherleitsystem vermittelt auf moderne Weise die nötigen Informationen. Mit dezenten Schienen und Leuchten wird der Festsaal in ein warmes und intensiveres Licht gesetzt. Das bewirkt nicht nur eine andere Raumatmosphäre, in den Gemälden und Architekturteilen an der Decke werden zudem neue Akzente sichtbar, die dem Auge bisher verborgen blieben.

Ganz »nebenbei« bauten wir Zwischendepots auf und wieder ab, verschoben die Kunst, wenn sie der Baustelle Platz machen musste, und richteten ihr ein neues temporäres Zuhause ein. Die komplette Auslagerung des Kunstgutes in Depots außerhalb hätte eines mittleren sechsstelligen Betrages bedurft.
In der Ratsgarderobe, so ihr endgültiger gendergerechter Name, entstand ein neuer Blickfang mit nachgefertigten historischen Ratskostümen. Mit Spannung begleiteten wir die bauhistorischen Untersuchungen, die vor allem in zwei Fensterlaibungen viel Hoffnung auf neue Erkenntnisse schürten. Mit dem Mut zum Neubeginn trennten wir uns von schweren Pultvitrinen und schufen Raum für neue Inszenierungen in den Fensternischen. Drei beherbergen bereits Großobjekte der Sammlung, wie die Sänfte, der Apoll und eine Einbaumtruhe. Die anderen werden thema-

tisch neu ausgestaltet und bieten bisher Platz, um dem Museum Zum Arabischen Coffe Baum und seiner Geschichte eine kleine Reminiszenz während seiner Schließzeit zu setzen.
In einigen Ausstellungsräumen wurde die Erzählung verändert oder ergänzt, wie z. B. in der Nuntiatur, dem Raum, der Festsaal und Ratsstube trennt. Hier zeigt sich die Baugeschichte des Alten Rathauses jetzt viel eindringlicher, und wir konnten Hieronymus Lotter als Bauherrn und der Lotter-Gesellschaft als großartigen Projektunterstützern einen würdigen Rahmen setzen. Für die Naschmarkträume begann die Neuplanung zur Geschichte der Messe in Leipzig und zur Ära Leipzigs im 18. Jh.
Summa summarum: Eine stets lebendige Baustelle. Zehn unterschiedliche Fachplaner und mehr als 20 Gewerke waren am Umbau beteiligt. Teilweise arbeiteten vier Gewerke gleichzeitig, um den Zeitplan trotz Corona und Lieferverzögerungen halten zu können. Die Herausforderung lag weniger in der Menge der Aufgaben als vielmehr in der Verzahnung ihrer Umsetzung. Nicht alle Wünsche wurden wahr. Die Erneuerung der Heizkörper im Festsaal steht immer noch aus.
Die Bauabläufe verzögerten sich, aber Ende 2021 mussten wir einen klaren Eröffnungstermin bestimmen, an dem nicht mehr gerüttelt werden
durfte. Von fehlerfreier Funktion von Licht und Lichtsteuerung, Steckdosen, Schalter und Verteilerkästen waren wir zu diesem Zeitpunkt meilenweit entfernt, das Verteilen von Stirnlampen an die Eröffnungsgäste aber keine Option. Nicht nur deswegen war die Wiedereinrichtung der ersten Etage als Museum ein harter Kraftakt und ein Prüfstein unserer Flexibilität und des Improvisationstalents. Die Tinte auf dem Papier war noch gar nicht richtig trocken, da waren Zeitpläne manchmal schon nicht mehr gültig. Wir waren die ersten, die fertig sein mussten, bevor die Bauvorhaben begannen und die letzten, die ihre Arbeiten zu Ende bringen konnten. Museale Objekte und Baustelle gehören einfach nicht zusammen, müssen zeitlich wie örtlich voneinander getrennt sein. Dennoch sollten ca. 1.000 Objekte rechtzeitig an ihren alten oder neuen Platz zurück. Wir haben die Prüfung bestanden und konnten Ende April 2022 die erste Etage an die Öffentlichkeit zurückgeben. Die vierstelligen Besucherzahlen am Tag der offenen Tür und zur Museumsnacht, die außerordentlich positiven Reaktionen auf das Ergebnis sind ein schöner Lohn für unsere Mühen. Der Festsaal ist nun für Konzerte, Lesungen, Empfänge, Vorträge oder einfach nur den ganz normalen Museumsalltag bestens ausgestattet.
Vielen lieben Dank an ALLE, die am Ergebnis beteiligt waren!
April 2022 war es soweit. Wir setzten den Schrank auf einen Sockel, um ihn besser vor Besen und Wischmopp zu schützen. Das Prunkstück der deutschen Tischlerkunst des ausgehenden 16. Jh. steht nun wieder im Ensemble des historischen Mobiliars.
Nach den Rechnungsbüchern der Stadt Leipzig fertigte ihn der Tischlermeister Gregor Anesorge für 62 Gulden und 18 Groschen. Das entsprach weit mehr als dem Jahreslohn eines Handwerkers.
Bei Außenmaßen von 2,42 Meter Höhe, 2,69 Meter Breite und 60 Zentimetern Tiefe sind hier etwa zwei Kubikmeter Aktenablage möglich. Galt damals schon die heute von Architekten und Gestaltern gern genutzte Formel »form follows function«, war er weniger Aktenschrank als vielmehr Repräsentationsmöbel anspruchsvoller Bürgermeister in einer prächtigen Amtsstube.
Gregor Anesorge war von 1592 bis 1607 in Leipzig tätig. Seinem Wirken werden der Ratsschrank, der sog. Bürgermeisterstuhl mit dem Leipziger Stadtwappen aus dem Jahre 1607 und der Tisch von 1592 zugeschrieben, der bis ins 20. Jh. als Beratungstisch diente. Diese Arbeiten sind in der Ratsstube versammelt. Aber stammen Tisch und Stuhl wirklich aus der Werkstatt dieses Meisters? Der
Tisch wurde im April 1592 bezahlt. Jedoch steht in der Rechnung nicht, an wen. Unser Tischler, Gregor Anesorge, taucht zuerst in der Rechnung für den Ratsschrank auf, die am 1. Juli 1592 Eingang in die städtischen Bücher fand. Dann hätte Anesorge drei Monate nach dem Tisch den Ratsschrank abgeliefert. Das ist selbst bei gutem Zeit- und Projektmanagement mehr als sportlich.
Beim sogenannten Bürgermeisterstuhl wird es noch nebulöser. Die Datierung dieser Arbeit fußt nicht auf einer Rechnung, sondern auf der Jahreszahl 1607 in der Stuhllehne. Zudem muss bezweifelt werden, ob die einzelnen Teile in ihrer ursprünglichen Verwendung als Stuhl gedacht waren. Die Lehne ist zu steil, der Stuhl bietet keinerlei Sitzqualität, und die Stuhlbeine könnten wesentlich jünger sein als Lehne und Sitzpolster. Der Stuhl ist aber zweifelsfrei der unbequemste am Tisch.
Nach den Rechnungsbüchern der Stadt haben an der Ausgestaltung des Festsaales und der Ratsstube viele Tischler über Jahrzehnte gearbeitet, darunter Gregor Anesorge. Ob er drei oder doch nur ein Möbelstück für den Leipziger Rat fertigte, bleibt ein Geheimnis — vorerst. Unzweifelhaft aber laden Schrank und Ratsstube zum Staunen und Entdecken ein.
4 AUTORIN Dr. Maike Günther | Kuratorin Stadt und Landesgeschichte
1800
bis
VON FRÜHEN KULTUREN BIS ZUR VORMODERNE
Blick in Ratsstube in der ersten Etage des Alten Rathaus Leipzig
Blick in Festsaal mit den neugestalteten Servicebereichen in der ersten Etage des Alten Rathaus Leipzig.
Blick auf Thomaskirche, Aquarell Robert Wehle, um 1850, Inv.-Nr.: 2780 b
Einmaliges Zeugnis jüdischen Lebens gerettet

»Bomben auf Leipzig«
Eindrucksvolle FilmTonInstallation zur Zerstörung Leipzigs im Zweiten Weltkrieg

Geschäftshaus mit Atelier A. Mittelmann.
Foto: Hermann Walter, 1932. Inv.-Nr.: F/6902/2005
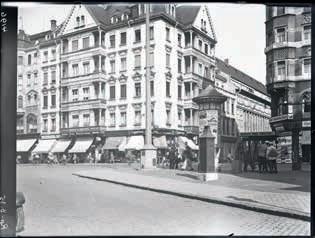
Zwischen 1906 und 1938 betrieb der jüdische Fotograf Abram Mittelmann am Peterssteinweg 15 ein Fotoatelier. Dort versteckte die Familie wohl Ende 1938 mehr als 2.000 FotoGlasplatten, meist Por träts, vor ihrer erzwungenen Flucht. Abram, seine Frau Selma und Tochter Nadjeschda Mittelmann wurden Opfer der Shoah. Nur die beiden Söhne überlebten in Frankreich. 2022 konnte der Bestand an die Erbin Nadia Vergne zurückgegeben werden. Seitdem bemüht sich das Stadtgeschichtliche Museum zusammen mit ihr, dem Archiv Bürgerbewegung und der Israelitischen Religionsgemeinde um die langfristige Sicherung, Erforschung und Veröffentlichung der Fotos in Leipzig. Geschichte und Perspektiven des einmaligen Bestands zum jüdischen Leben zeigt eine Ausstellung vom 28. Juni bis 26. August 2023 im Ägyptischen Museum der Universität Leipzig.
Ab dem Herbst 1943 kehrte der von Deutschland entfesselte Krieg nach Leipzig zurück. Bis kurz vor Kriegsende 1945 erlebte Leipzig schwere Luftangriffe, denen mehr als 5.000 Menschen zum Opfer fielen. Ein großer Teil der Innenstadt wurde zerstört. Dimensionen und Schrecken dieses wie jedes Kriegsgeschehens sind kaum in Worte zu fassen — die neugestaltete Installation unter dem Dachstuhl des Alten Rathauses verzichtet fast völlig darauf. Hörbar, sichtbar und körperlich spürbar wird der Krieg an diesem historischen Ort. Er wird so zu einem Ort des Nachdenkens und der Mahnung.
Turmhaube stammte von der Radrennbahn am Cottaweg, das Kupfer aus Schrottspenden.
Daran erinnert die Medieninstallation aus einer Film-Ton-Collage von Bombenabwürfen und Fotos zerstörter Gebäude. Sie ist in die historische Dachkonstruktion der Nachkriegszeit eingepasst. Beim Betreten dieses riesigen, dunklen Raums, der sich über die gesamte Fläche des Rathauses zieht, werden nicht nur der Dachstuhl, Leitungen und Rohre sichtbar. Auf eine große Leinwand projiziert ein Beamer Ausschnitte eines Dokumentarfilms der Royal Air Force über Lufteinsätze aus dem Zweiten Weltkrieg und privates Filmmaterial. Mal fern, mal nah erscheinen die Detonationen. Radiodurchsagen, Sirenen und Einschläge intonieren es, Erschütterungen lassen die Wucht spüren.

In der Nacht des 3. zum 4. Dezember 1943 trafen Brandbomben der Royal Air Force das Alte Rathaus. Museumsgäste, die sich vorher in der Dauerausstellung anhand von historischen Exponaten über den Verlauf des Krieges informieren konnten, erhalten hier einen tieferen Eindruck von diesem Grauen.


Achim
Es war der schwerste Luftangriff auf Leipzig. Sie zerstörten den Turm und von da aus den Dachstuhl und das zweite Obergeschoss, die völlig ausbrannten. Wegen Wassermangels konnten keine Löscharbeiten erfolgen. Eine Stahlbetondecke zwischen erstem und zweitem Obergeschoss verhinderte die vollständige Zerstörung des Gebäudes. Jahrelang blieben die stählernen Dachstreben als gleichsam mahnendes Zeichen des Krieges offen. 1946 begann unter widrigsten Umständen die Wiederherstellung. Das Holz für die barocke
Die — gerade in der aktuellen europäischen Kriegssituation wieder besonders relevante — Medieninstallation konnte 2022 in der Corona-Pandemie
technisch modernisiert und besser inszeniert werden und kann so auch ein jüngeres Publikum erreichen. Durch die Corona-Pandemie hat die Mediennutzung und Medienkompetenz einen besonderen Schub erhalten, der sich auch auf die Erwartungshaltung unseres Publikums in Bezug auf die mediale Aufbereitung von Inhalten und die dafür zur Verfügung stehende technische Ausstattung auswirkt. »Bomben auf Leipzig« wurde bisher unter Nutzung mehrerer analoger Röhrenfernseher gezeigt, die nicht mehr gewartet werden konnten. Nur mit der technischen, auch stromsparenden Modernisierung wird die nachgefragte Installation wieder erlebbar.
Sie ist wegen der weitläufigen und gut durchlüfteten Räumlichkeit auf dem historischen Dachboden gerade unter pandemischen Bedingungen sehr gut für Besucherinnen und Besucher geeignet, da sie nicht künstlich belüftet werden muss. Allerdings stellt die »natürliche« Raumsituation hohe Anforderungen an die Robustheit der Technik. Die Inhalte der Medieninstallation wurden für die höher auflösende Technik formal und dramaturgisch angepasst. Die Investition erlaubte auch in der Pandemie die konstante Arbeit an der Neugestaltung der Dauerausstellung. Sie wurde mit 24.480 Euro von der Sächsischen Aufbaubank im Rahmen des Projekts »Kultur Erhalt« 2022 gefördert.

Der erste Job in einem neuen Leben

Was ein Lieferrucksack erzählt
Corona hat in Deutschland viel verändert. Statt einzukaufen oder Essen zu gehen, boomten seit 2020 die Lieferdienste. Ein freundlicher Fahrradbote bringt bei Wind und Wetter frisches Essen. Doch wer ist dieser Mensch und welches Schicksal hat er? Das bleibt meist verborgen. Sayed Ahmad Shah Sadaat war bis vor kurzem einer von ihnen. 2020 floh er vor der zunehmenden Bedrohung durch die Taliban aus Afghanistan. Er kam nach Leipzig.
In seiner Heimat war er Experte für Telekommunikation und zwei Jahre lang Minister. Er hatte sich in Afghanistan um den Aufbau von Internet und Telefon-Netz gekümmert. Doch in Deutschland erging es ihm wie vielen: Während er erst die Sprache lernte, fand er keine gut bezahlte Stelle. Also wurde er Pizzabote. Die Leipziger Volkszeitung brachte die Geschichte. Im Internet ging sie viral. Zeitungen und TV-Sender berichteten auf der ganzen Welt.
Ein Abstieg, eine Schande? Sayed Sadaat sagt: Nein. Er tut das gleiche wie die meisten Migrantinnen und Migranten: Hart arbeiten, um sich ein neues Leben aufzubauen. Und in der neuen Heimat ankommen. Seit 2022 kann er wieder in seinem Beruf arbeiten. Dafür ist er aus Leipzig nach Bayern gezogen. Seine Uniform hat er dem Museum überlassen. Hier erzählt sie jetzt seine Geschichte vom Ankommen. Es ist die Geschichte vieler Geflüchteter.
5 GESCHICHTE AB 1800 VON DER INDUSTRIALISIERUNG BIS ZUR GEGENWART AUTORIN
Dr. Johanna Sänger | Kuratorin Stadt und Landesgeschichte ab 1800
Beier (Archiv Bürgerbewegung), Küf Kaufmann (Israelitische Gemeinde), Nadia Vergne (Tochter von Siegfried Mittelmann, Uwe Schwabe (Archiv Bürgerbewegung) und Dr. Anselm Hartinger (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig) im November 2022.
Foto: Anja Lippe
Blick auf den Markt mit zerstörtem Rathaus.
Foto: Johannes Widmann, nach 1943, Inv.-Nr.: F/1492/2004
Screenshot des Videos
Abb. oben: Video über Sayed Sadaat bei France24, youtube, 2021 Abb. u. l.: Herr Sadaat übergibt seine Kleidung dem Museum, 2022 Abb. u. r.: Museumsmitarbeiterin Ines Seefeld richtet die Präsentation für »Neu im Museum« im Alten Rathaus aus.
Alter Fürst in neuem Glanz
Ein vergessener Leipziger Expressionist und viele Überraschungen
Neuerwerbungen 2022
Das vergangene Jahr brachte dem Museum erneut eine große Schenkung des Leipziger Sammlers und Kunstliebhabers Falk A. Hüchelheim, dessen Vorlass in der Sammlung inzwischen auf rund 2.000 Inventareinträge angewachsen ist. Es handelt sich zum großen Teil um Zeichnungen und Druckgraphiken, aber auch Gemälde, Dokumente und Korrespondenz namhafter Leipziger Künstlerinnen und Künstler sind darunter. Drei besonders interessante Beispiele aus dem Neuzugang seien hier vorgestellt:

1
Landschaft, Aquarell, um 1920/1930

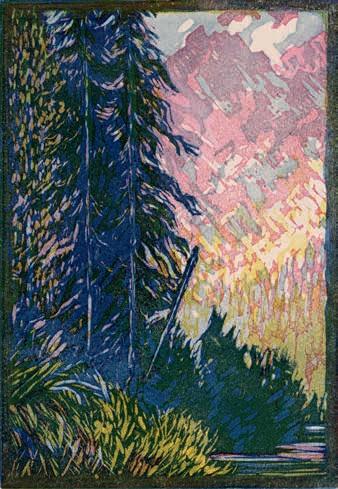
Mit der Schenkung kam u. a. eine wunderbare Landschaftsstudie von Fritz Zalisz ins Museum, in der wo-
gende Felder, ein gewundener Weg und ein bewegter Himmel ineinanderfließen. Fritz Zalisz gehört zur »Verschollenen Generation« aus dem Umfeld der Leipziger Expressionisten, die heute zu Unrecht weitgehend vergessen ist. Der 1893 in Gera geborene Zalisz studierte in Jena bei Ernst Haeckel (Zoologie), in München bei Adolf von Hildebrand (Bildhauerei) und in Leipzig bei Alois Kolb und Otto Richard Bossert (Graik) und Adolf Lehnert (Bildhauerei). 1937 wurden sieben seiner Werke als »entartet« beschlagnahmt, davon sechs aus dem Museum der Bildenden Künste Leipzig. Von 1940 bis zu seinem Tod 1971 lebte Zalisz in Holzhausen bei Leipzig. Er schuf zahlreiche Denkmäler für den Leipziger Südfriedhof, erhalten ist auch die Gedenktafel für

Wagners Geburtshaus am Brühl, heute Höfe am Brühl. 2022/23 widmete ihm seine Heimatstadt Gera eine größere Ausstellung.
2 Alter Fischer, Öl auf Leinwand
Ebenso kam das eindrucksvolle Porträt eines alten Fischers von Oskar Zwintscher ins Museum. Zwintscher, 1870 in Leipzig in eine Pianistenfamilie geboren, studierte in Leipzig und Dresden. Er vereinte viele, teils widersprüchliche Einflüsse der Zeit um 1900 in seinem Werk: Jugendstil, Symbolismus, auch Neue Sachlichkeit. Er hatte zu Lebzeiten große Erfolge, war aber auch umstritten. Im Herbst und Winter 2022/23 ehrte ihn das Dresdner Albertinum mit einer großen Ausstellung, basierend auf einem größeren Forschungsprojekt zu seinem Lebenswerk.
3 Zeichnung von Heinrich Alfred Kaiser
Zuletzt sei Heinrich Alfred Kaiser erwähnt, der mit einer farbigen Zeichnung vertreten ist, die eine beklemmende Situation mit Verletzten in einem Bunker des Zweiten Weltkriegs einfängt. Der 1883 geborene Remscheider verbrachte einen Teil

Die Suche nach dem Künstler im Heuhaufen
Wie ein unbekannter Holzschnitt einen Namen erhält
Während des praktischen Studiensemesters im Museum wurde mir die Aufgabe zuteil, die Schenkung von 63 Objekten des passionierten Sammlers Falk A. Hüchelheim zu bearbeiten. Er trägt vor allem Werke von regionalen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und übergab dem Museum schon in den vergangenen Jahren immer wieder umfangreiche Konvolute.
Nun galt es, die Kunstwerke zu sichten und in der Sammlungsdatenbank zu erfassen. Hierbei kam es auf Genauigkeit an: Signaturen mussten entziffert, wenn nicht vorhanden der Titel gefunden und schließlich eine sorgfältige Inventarisierung durchgeführt werden. Bei einigen Grafiken war es schwer, einen Anhaltspunkt

für den Künstler oder Titel des Werkes zu finden.
Besonders ein Holzschnitt stellte mich vor Probleme, da dieser weder Signatur noch Vermerke auf der Grafik hatte. Durch eine Suche via Google Lens konnte das Bild erschlossen werden. Google Lens bietet die Möglichkeit, das Internet auf Grundlage eines selbst geschossenen Fotos zu durchsuchen. Hierbei »fahndet« der Algorithmus in den Web-Tiefen nach vergleichbaren Bildern. Auf Seite zwei dann der Treffer: Dieselbe Grafik, signiert und nummeriert. Nun war klar, worum es sich handelt: Einen Holzschnitt von Leopold Wächtler, entstanden um 1950, mit dem Titel »Am Obersee«, der durch kontrastreiche Farben und genaue Schnitte besticht
Seit jeher werden die Gäste des Alten Rathauses von 27 lebensgroßen Fürstenporträts in Festsaal und Ratsstube begrüßt. Sie gehören wie selbstverständlich hierher. Nach der Wiedereröffnung im Mai 2022 klaffte jedoch zunächst eine Lücke: Johann Georg I., sächsischer Kurfürst von 1611 bis 1656, gemalt von Johann Gerhardt 1611, befand sich in Restaurierung. Nicht nur Johann Georg I., beinahe alle Fürstenporträts sind restaurierungsbedürftig. Während es bei vielen vorrangig der Schmutz von Jahrzehnten sowie stark vergilbte Firnisse sind, die die einstige Pracht verdunkeln, war das Porträt Johann Georgs I. darüber hinaus durch aufgesprungene Farbschollen akut gefährdet und darum als erstes an der Reihe. Die Restauratorin Paula Sowa sicherte die Farbschichten und festigte die Aufspannung des Gemäldes. Der Firnis musste großflächig abgenommen und erneuert werden. Auch am Rahmen waren viele Fehlstellen zu beseitigen. Nun erstrahlt das Gemälde an seinem alten Platz und zieht besonders durch die prachtvoll funkelnden Schmuckstücke des Fürsten die Blicke auf sich, z. B. das Medaillon an der Doppelkette, der reichverzierte Gürtel oder die Edelstein-Agraffe am Hut.
seines Berufslebens in Berlin und war dort als erfolgreicher Architekt tätig. Er hatte aber ebenso einen Namen als professioneller Tänzer und Tanzlehrer. Später lebte er in Dresden. Über seine beiden Brüder stand Heinrich Alfred Kaiser in Kontakt mit den Verschwörern des 20. Juli 1944, sein Bruder Hermann wurde als führendes Mitglied des Widerstands hingerichtet, er selbst war zeitweise inhaftiert und starb 1946.
Wir danken ganz herzlich Falk A. Hüchelheim für seine unermüdliche Unterstützung und große Bereicherung der Sammlungen.

und so ein grandioses Gesamtbild des Obersees in Bayern zeigt.
Leopold Wächtler wurde 1896 in Penig geboren und studierte an der »Leipziger Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe« Leipzig, danach war er als freier Grafiker tätig. Bekannt ist er vor allem für seine Holz- und Scherenschnitte. Sein Können unterstreichen die Porträt-Holzschnitte von Persönlichkeiten wie z. B. Wolfgang Amadeus Mozart und Marie Curie, die ebenfalls über Falk A. Hüchelheim in die Sammlung gelangten.

Schlussendlich konnte ich also doch meine Suche im Heuhaufen erfolgreich beenden und die Schenkung erschlossen werden.
Der Ursprung der Fürstengalerie im Alten Rathaus geht bis 1553 zurück. In diesem Jahr bezahlte der Rat der Stadt dem Maler Hans Krell »etliche« Porträts für das in Planung befindliche Rathaus. Neben den sächsischen Herrschern malte Krell auch einige römisch-deutsche Kaiser, hessische und thüringische Fürsten. Später beauftragte der Rat unterschiedliche Künstler mit Porträtgemälden der jeweils regierenden sächsischen Kurfürsten und Könige. 1905 wurde die Tradition aufgegeben, als der Stadtrat ins Neue Rathaus umzog. Die Galerie hat u. a. mit der Funktion des Rathauses als bedeutendem Gerichtsort Sachsens zu tun: Die Herrscher waren als höchste Instanz im Bild bei Gericht anwesend. Die Porträts »thronen« quasi über der Galerie der Stadtrichter und manifestieren, wer hier letztendlich das Sagen hatte.
Die Restaurierung wurde durch die bewährte Unterstützung der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft ermöglicht, allen Spendern sei herzlich gedankt!
6
KUNST GEMÄLDE | SKULPTUR | GRAFIK | KUNSTHANDWERK
AUTORIN Ulrike Dura | Kuratorin Kunstgeschichte, Stellvertretende Direktorin
AUTOR Julius Brandt Praktikant
Johann Gerhardt (tätig um 1610); Kurfürst Johann Georg I., Öl auf Leinwand, 1611, Inv.-Nr.: Fürstenbild Nr. 17
Leopold Wächtler (1896—1988), »Am Obersee«, um 1950, Inv.-Nr.: K/2022/197
Oskar Zwintscher (1870–1916), Alter Fischer, Öl auf Leinwand, um 1910, Inv.-Nr.: K/2022/110
Abb. links: Fritz Zalisz (1893—1971), Landschaft, Aquarell, um 1920/1930, Inv.-Nr.: K/2022/117. Abb. oben: Heinrich Alfred Kaiser (1883—1946), ohne Titel, Zeichnung, 1945, Inv.-Nr.: K/2022/195
Grün, grün, grün sind alle meine … Provenienzen?!
Abschließende Bewertung der untersuchten Kunstwerke
Die untersuchten Erwerbungen offenbarten, dass das Museum kaum im Kunsthandel Kunstwerke erwarb. Es wurden lediglich sieben Käufe bei lokalen Kunsthändlern wie Curt Naubert, Johannes Windsch, Erich Bretschneider, dem Versteigerungshaus Hans Klemm und dem Frankfurter Kunsthändler Albert Glücksmann getätigt. Vorrangig erwarb das Museum von Leipziger Privatpersonen Kunstwerke, die diese bevorzugt schenkten. Die Überprüfung der Einlieferungen stellte sich als besonders aufwendig heraus, weil zunächst kaum noch brauchbare Quellen aufzufinden waren, insofern sie nicht direkt bei der Erwerbung im Museum hinterlegt wurden. Zeitaufwendige Archivrecherchen schlossen sich daher an.




Für die »sehr bedenkliche« Erwerbung von fünf Kunstwerken und zwei Fotografien 1941 beim Versteigerungshaus Klemm konnten bisher die finalen Schritte zu einer möglichen Restitution oder einer fairen und gerechten Lösung im Sinne der Washingtoner Prinzipien nicht eingeleitet werden. Das Museum hat die sieben Objekte zwar als Fundmeldungen in der Lost Art-Datenbank gemeldet, dennoch gestaltet sich die Suche nach möglichen anspruchsberechtigten Personen sehr schwierig. Es gibt erste Anhaltspunkte, doch es sind weitere Nachforschungen notwendig, die bis zum Abschluss des Projektes nicht geleistet werden konnten.
Die vier bedenklichen Kunstwerke werden zeitnah als Fundmeldungen in der Lost Art-Datenbank gemeldet.
weislich beim Versteigerungshaus Hans Klemm einkaufte, der für den Verkauf ehemaligen jüdischen Eigentums zuständig war, sodass es sich hierbei um Werke aus ehemaligem jüdischen Eigentum handeln könnte. Diese Privatperson wird in einem neuen Provenienzforschungsprojekt am Museum näher untersucht.
Es geht in die nächste Runde Erfreulicherweise konnten wir im Dezember 2022 mit einem weiteren Provenienzforschungsprojekt starten, das ebenso vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird.
Gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, wurde im August des vergangenen Jahres das erste Projekt »Provenienzrecherchen im Sammlungsbereich Kunst und Kunsthandwerk des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig für die Erwerbungen zwischen 1933 und 1945« beendet. Dabei hat die Prüfung von 323 Provenienzen dem Museum verdeutlicht, wie umfänglich die Recherchen und die abschließende Bestimmung eines Provenienzstatus sein können.

Durch die Untersuchungen wurde bestätigt, dass eine Erwerbung (zwei Fotografien, sieben Grafiken), die ursprünglich auch den Anlass zur Einreichung des Projektantrags gab, als »sehr bedenklich« eingestuft werden
Vergessene Rück(an)sichten
Publikation zur Provenienzforschung
Zum Abschluss des Forschungsprojektes veröffentlichten wir 2022 die Publikation »Vergessene Rück(an) sichten«, die einst übersehene Kunstwerke ins Blickfeld rückt.
Die Vorstellung der Museumsgeschichte und der Überblick von Ausstellungen zwischen 1933 und 1940 bilden zunächst den Einstieg. Ein Teil




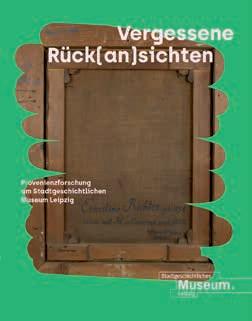
muss. Zwei Aquarelle und zwei Gemälde wurden als »bedenklich« kategorisiert, da es Hinweise auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug gibt. Die 64 »offenen« Provenienzen gilt es in Zukunft im Blick zu behalten, um mögliche neue Erkenntnisse zur Schließung von Provenienzlücken zu berücksichtigen. Wie sich in diesem Forschungsprojekt erfreulicherweise herausstellte, vereinen im Hinblick auf die Erwerbungsjahre zwischen 1933 und 1945 unbedenkliche Provenienzen den mit Abstand größten Anteil auf sich.

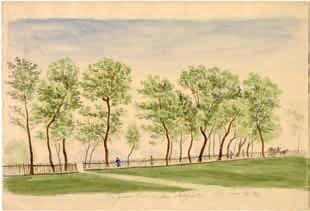
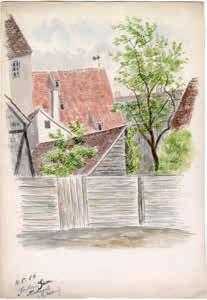
Die 323 untersuchten Provenienzen aus den Erwerbungsjahren zwischen 1933 und 1945 wurden mithilfe der Provenienzampel kategorisiert (siehe Abb. rechts).
der Erwerbungen und ausgewählte Forschungsaspekte werden dargestellt, darunter u. a. die Aufklärung einer Irreführung im Falle des Künstlers Emil Büchner und seiner angeheirateten Familie Polich. Die Vorstellung der Kunsthandlung Curt Naubert und C. G. Boerner stehen stellvertretend für den damaligen Leipziger Kunsthandel. Weitere Beiträge setzen sich darüber hinaus mit der Sammelleidenschaft von Privatpersonen auseinander, richten den Blick auf frühere Ausstellungen als wertvolle Quelle der Provenienzforschung oder widmen sich der Aufklärung einer bedenklichen Provenienz in der Museumsbibliothek. Exempla-
Das Museum wird transparent mit diesen Fällen umgehen, um hoffentlich weitere Hinweise zur Klärung der Provenienzen zu erhalten. Die vier Werke sind im Rahmen von drei Einlieferungen ins Museum gelangt. Zwei Aquarelle sind von einer Privatperson eingeliefert worden, die nach-
Das Museum wird transparent mit diesen Fällen umgehen
Eines der »bedenklichen« Gemälde ist über die Kunsthandlung Curt Naubert erworben worden. Doch die durchgeführten Recherchen im Rahmen dieses Projektes konnten nicht abschließend nachweisen, dass es verfolgungsbedingt entzogen wurde. Dennoch muss bei einem Ankauf von einer Kunsthandlung in den Erwerbungsjahren von 1933 bis 1945 von einem Entzugskontext ausgegangen werden. Das zweite bedenkliche Gemälde kam durch eine Zuweisung ins Museum: Während des Nationalsozialismus wurden der Verband Deutscher Kriegsveteranen und die dazugehörige Ortsgruppe Leipzig im Zusammenhang mit der Eingliederung von Militärvereinen in den Deutschen Reichskriegerbund (Kyffhäuserbund) höchstwahrscheinlich dazu gedrängt, darüber nachzudenken, den Verband, auch aufgrund der Überalterung der Mitglieder, aufzulösen oder sich dem Verbund anzuschließen. Der Verband entschied sich gegen die Eingliederung und löste diesen daher gänzlich auf. Höchstwahrscheinlich war die Geheime Staatspolizei für die Auflösung, Abwicklung und Übergabe der Sammlungsgegenstände aus der Sammlung des Verbandes zuständig. In diesem Fall ist bislang noch keine Vorgehensweise seitens des Museums abgestimmt worden.
Im vorausgegangenen Projekt rückten Erwerbungen ins Blickfeld, die eindeutige Verdachtsmomente im Zusammenhang mit einem NS-verfolgungsbedingten Kulturgutentzug aufweisen. Zu den Neuzugängen zählen Kulturgüter von Einlieferern, die beim Versteigerungshaus Klemm einkauften und diese später selbst weiterveräußerten. Zudem sind Kunstwerke des jüdischen Künstlers Eduard Einschlag, Einlieferungen des Fürsorgeamtes der Stadt Leipzig oder der Nachlass von Felix Mendelssohn Bartholdy vorgesehen. So werden Einzelpersonen, Unternehmen und städtische Ämter gleichsam näher betrachtet.
43 Erwerbungen bestehend aus 146 Kunstwerken und kunsthandwerklichen Gegenständen, 42 Objekten aus dem Sammlungsbereich »Alltagskultur und Volkskunde«, zwei Autographen, 11 Büchern und 4.001 Fotografien werden somit in den nächsten zwei Jahren umfänglich erforscht.
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
Provenienzampel: grün = unbedenkliche Provenienz, gelb = offene Provenienz, orange = bedenkliche Provenienz, rot = sehr bedenkliche Provenienz
risch wird zudem eine bereits erfolgte Restitution der Sammlung von Karl Rudolf Bromme, darunter Abzeichen, Bücher, Spiele und Gegenstände der Alltagskultur, aus dem Jahr 2006 vorgestellt. Details zu ihrer Arbeit stellt die Restauratorin Franziska Lipp, die das Projekt bei der Untersuchung der Kunstwerke maßgeblich unterstützt hat, in einem Interview vor. Zudem werden die Intention und Konzeption eines pädagogischen Angebotes für Jugendliche beschrieben, das im Frühjahr 2022 realisiert wurde. Ein Glossar erläutert abschließend die Fachbegriffe der Provenienzforschung und ermöglicht somit auch Laien einen
voraussetzungslosen Zugang zur Thematik.
Das Buch ist für 8,50 Euro im Museum und unter petra.schuerer@ leipzig.de erhältlich.
Im neuen Forschungsprojekt wird es u. a. um die Firmengeschichte des ehemaligen Versteigerungshauses Klemm gehen, das seine Räumlichkeiten in der Großen Fleischergasse 19 hatte. Es ist bisher unklar, was aus den Eigentümern Hans und Karl Klemm wurde und wie die Bestände nach der Liquidation in der Nachfolgeinstitution »Versteigerungs- und Gebrauchtwarenhaus VEB« fortbestanden. Es gibt zwar erste Anhaltspunkte, doch es bedarf noch weiterer, genauerer Informationen über jenes berühmt-berüchtigten Auktionshaus.
Falls Sie mit uns Ihre Erinnerungen, Fotos, Filme und vielleicht sogar Objekte aus einer Ersteigerung oder Ankauf teilen möchten, würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung
Kontakt: lina.frubrich2@leipzig.de oder Tel. 0341/9651342

7 AUTORIN Lina Frubrich Provenienzforschung PROVENIENZFORSCHUNG ZUR HERKUNFTSGESCHICHTE DER OBJEKTE
freuen!
Gebäude in der Großen Fleischergasse 19 in dem Hans Klemm später das Versteigerungshaus eröffnete. Hermann Walter, Große Fleischergasse 17—23, nach 1900, Inv.-Nr.: F/8503/2005
gelb orange rot Anzahl der Werke Aquarelle 60 16 2 2 80 Zeichnungen 93 32 0 0 125 Druckgrafik 40 0 0 3 43 Fotografie 2 0 0 2 4 Sonstiges 5 0 0 0 5 Gemälde 33 6 2 0 41 Plastiken 15 10 0 0 25 Anzahl d. Werke 248 64 4 7 323
grün
Mandarine, bärtige Kerle und der Pirat der Königin
Neues aus der Numismatik

Im 19. Jh. begann nahezu jeder bürgerliche Altertumsverein seine Tätigkeit mit dem Anlegen einer numismatischen Collection. Oft genug wurde nicht nur ortsgeschichtlich Relevantes zusammengetragen. So findet sich in den numismatischen Sammlungen vieler Stadtmuseen, die oft diese Vereine beerbten, heute so manches Stück, das wegen seiner Ferne zur Stadthistorie kaum in Ausstellungen zu sehen ist. Unter den mehr als 12.000 Objekten unserer Sammlung ist das nicht viel anders. Hier bietet sich die Gelegenheit, einige wenige Stücke einmal näher in den Blick zu nehmen.

gantische Kriegsflotte, die Armada. Im Kanal stieß sie auf die englische Flotte, die unter anderem von dem bekannten Kaperkapitän Francis Drake kommandiert wurde. Im Verlauf der Kämpfe erlitten die Spanier schwere Verluste. Ebenso desaströs waren die Verwüstungen, die mehrere Stürme unter den Spaniern anrichteten. Ihre Invasionspläne scheiterten. Von den 130 Schiffen, die gen England aufgebrochen waren, kehrten nur 68 zum Teil schwer beschädigt nach Spanien zurück, der Rest lag auf dem Meeresgrund.
Beide Seiten machten für dieses Ergebnis das widrige Wetter als Haupt-
tere Geistliche mit verbundenen Augen auf einem mit scharfen Spitzen versehenen Boden, rückseitig ist die zerschellende spanische Flotte dargestellt. Auch die lateinischen Inschriften interpretieren das Scheitern des Invasionsunternehmens als Gotteswerk, das von den blinden Befürwortern nicht erkannt wird.
Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht.*
Das war streng genommen nicht so ganz legal, erfüllte aber seinen Zweck. Einen bitteren Beigeschmack hat die Münze freilich. Ausgerecht die großen Verlierer des Goldrauschs, die amerikanischen Ureinwohner, verewigte man im Bild auf ihr. Von der Gier nach Gold getrieben, brachten die einfallenden Glückritter binnen zweier Jahrzehnte nach dem ersten Goldfund rund achtzig Prozent von ihnen um.
Was macht man, wenn der Staat nicht genug Kleingeld zur Verfügung stellen kann, die Währung aber auf dem Goldstandart basiert? Man macht sein Kleingeld eben selbst.
1588 erreichte ein Konflikt zwischen England und Spanien seinen vorläufigen Höhepunkt. England war mit seinen zunehmend vom Bürgertum bestimmten wirtschaftlichen Interessen mit dem absolutistischen Machtanspruch Spaniens kollidiert. Für Philipp II. von Spanien gab es nur eine Lösung: das protestantische Inselreich musste wieder zur alten Ordnung zurückgezwungen werden. Durchsetzen sollte das 1588 eine gi-

schuldigen aus. Die einen, weil man gegen Stürme keinen Krieg führen könne, die anderen, weil offensichtlich auch der Allmächtige auf Seiten der Engländer gestritten habe.

In den protestantischen Niederlanden schuf Gerard van Bylaer eine vielfigurige silberne Medaille auf den Untergang der Armada. Auf ihr sitzen der spanische König, der Kaiser, einige Kurfürsten, der Papst und wei-
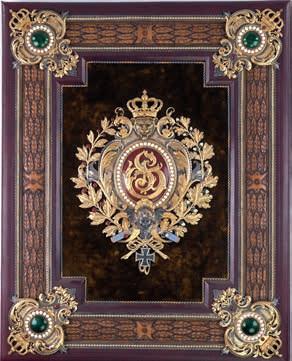


Austeilen und Einstecken
Aus der Militariasammlung

Nur wenige Prozent seiner gesammelten Objekte stellt ein Museum in der Regel aus. Eigentlich schade und darum seien hier einmal zwei von ihnen vorgestellt.
Bei einem Objekt der ganz besonderen Art verbindet sich Militärgeschichtliches sehr eindrucksvoll mit Leipziger Buchkunst. Im Juni 1896 trug der Sächsische Militärverein des 7. Infanterie-Regiment Prinz Georg
Nr. 106 König Albert von Sachsen die Ehrenmitgliedschaft an. Das Ganze geschah mit einer zeittypisch gestalteten Lithographie. Soweit, so gut, so unspektakulär. Was besonders hervorsticht, ist, wie so oft, die Verpackung. Die Urkunde wurde dem König in einer prachtvollen Ledermappe überreicht. Der stark reliefierte
Deckel strotzt nur so von vergoldeten und versilberten Metallbeschlägen und farbigen Glassteinen. Ein vergoldeter Lorbeerkranz mit roten und silbernen Beeren, weiße Perlen
Was macht man, wenn der Staat nicht genug Kleingeld zur Verfügung stellen kann, die Währung aber auf dem Goldstandard basiert? Man macht sein Kleingeld eben selbst. Nicht von ungefähr wird der amerikanischen Bundesstaat Kalifornien »Golden State« genannt, weil er seit den reichen Goldfunden um die Mitte des 19. Jh. in dem Edelmetall zu schwimmen schien. Vor allem Juweliere nahmen eine Menge an Gold, dessen Verkaufswert einem halben oder einem Vierteldollar entsprach und prägten ihm diesen Wert auf.
Ein Silberbarren mit chinesischen Schriftzeichen entführt uns in die fantastische Welt der Seidenstraße. Die Verwaltung in der chinesischen Provinz Guangxi hat ihn zwischen 1850 und 1911 als Zahlungsmittel herausgegeben und entsprechend gestempelt. Auch hier also musste Geld nicht unbedingt rund sein. Fisch und Reis für das Mittagessen hat man damit allerdings nicht eingekauft. Dafür gab es Münzen aus unedlem Metall, ein Charakteristikum der chinesischen Geldgeschichte, in der fast 2.000 Jahre kein aus Edelmetallen gefertigtes Geld existierte. Silberbarren fanden im Großhandel und zur Begleichung von Steuern und Abgaben Verwendung und wurden immer wieder eingeschmolzen. Entsprechend selten ist dieses Exemplar.
Haben alle drei Objekte eher weniger mit der Leipziger Stadtgeschichte zu tun, sind sie doch schöne Beispiele emsigen Sammeleifers einiger Leipziger, die mit einem englischen Piraten, einem amerikanischen Abenteurer und dem chinesischen Kaiserreich die Welt an die Pleiße holten.
Ein stadthistorisches Museum beschäftigt sich hauptsächlich mit Menschen und ihrem Tun. Wir widmen uns Kindheiten, Karrieren, Triumphen und Niederlagen, gelungenen Lebensentwürfen und gescheiterten Existenzen. Nur von dem, was uns allen unausweichlich begegnen wird, sprechen wir nicht. Ab März 2024 werden wir es tun: wir reden in einer großen Ausstellung vom Tod in Leipzig.
Heute wird der Tod eher als Zumutung empfunden, dem man durch hartnäckiges Ignorieren vielleicht doch entgehen könnte. Über Jahrtausende hinweg aber, galt Sterben als selbstverständlicher Teil des Lebens. Man bereitete sich bewusst darauf vor, umgab es mit eigenen Ritualen, begleitete Sterbende und hielt auch nach ihrem Tode ein unsichtbares Band der Zusammengehörigkeit aufrecht.
Die Ausstellung wird sich etlichen Aspekten rund um das heikle Thema zuwenden. Wir werden Bürger, Vereine und Institutionen, die sich in Vergangenheit und Gegenwart der rechten Art, den letzten Gang anzutreten, verschrieben haben, kennenlernen und erfahren, wo und wie die uns vorangegangenen Generationen die letzte Ruhe fanden. Kommen Sie mit uns auf diese Entdeckungsreise, die nicht nur Todtrauriges präsentiert. Hilft doch gerade im größten Schrecken der Humor, Unerträgliches erträglicher zu machen.

* so umschrieb der griechische Philosoph Epikur den Tod
und ein rotes Medaillon im Zentrum, plastische Maskarons, blau emaillierte Geschützrohre und ein mit Glasfluss belegtes Eisernes Kreuz machen die lederne Hülle zum wohl aufwendigsten Beispiel Leipziger Buchbinderkunst, die das Museum zu bieten hat. Kein Wunder, hat sie doch die renommierte Großbuchbinderei von Heinrich Sperling gefertigt, dessen Firma damals nicht nur Deutschlands größte Buchbinderei, sondern auch für ihre künstlerischen Handeinbände berühmt war.
Albert hat aber nicht nur eingesteckt, er konnte auch austeilen. Beispielsweise anlässlich seines 73. Geburtstags 1901. Selbst passionierter Jäger, verlieh er einigen ausgewählten Förstern und Waid-

genossen einen aufwendig verzierten Hirschfänger, die typische Blankwaffe des Jägers. Dessen kostbare Damastklinge trägt in Gold das Datum des königlichen Geburtstages, der Bronzegriff ist ebenso wie die Lederscheide mit jagdlichen Symbolen und dem sächsischen Wappen geschmückt und mit Perlmutt eingelegt. Auch das zugehörige Beimesser und die lederne Schutzhülle für das Ensemble haben sich makellos erhalten. Die noblen Geschenke tragen den Namen des Empfängers, in un-
serem Falle ist das ein Heinrich Schumann. Die Jagdwaffe hat 1946 der damalige Leipziger Superintendent, Thomaspfarrer Heinrich Eduard Schumann, dem Museum geschenkt. Dessen Vater war Oberförster im königlichen Forst Spechthausen bei Tharandt und Adressat der königlichen Gabe. Eigentlich schade, dass sich die Sitte, des Verteilens von Geschenken durch den Jubilar nicht erhalten hat, heutzutage bewegen sich Präsente ja meist in umgekehrter Richtung.
8
MILITARIA & NUMISMATIK ALLES MÜNZEN & UNIFORMEN?! AUTOR
Kalifornien (USA), Token 1/4 Dollar, 1871, Inv.-Nr.: MS/545/2004
Steffen Poser | Leiter Völkerschlachtdenkmal / FORUM 1813, Kurator Militaria und Numismatik
Medaille auf die Niederlage der Spanischen Armada, Gerard van Bylaer 1588, Inv.-Nr.: MS/2019/3
China, Silberbarren des Si en Fu/Guangxi Provinz, Ende des Qing Dynastie (1850—1911), Inv.-Nr.: L/875/2006
Ehrenhirschfänger mit Beimesser und Scheide, Sachsen 1901, Inv.-Nr.: W/S
63
Ledermappe für eine Ehrenurkunde, Leipzig Großbuchbinderei Heinrich Sperling 1896, Inv.-Nr.: MI/4/2004
Grabstätte von Johanne Elisa Friderike Westphal auf dem Alten Johannisfriedhof, Fotografie um 1890, Inv.-Nr.: F/127/2003
Leipzig – Hochburg des Radsports
Am 6. Mai 2022 wurde die 5. Station der Sportroute vor dem Haupteingang des Leipziger Zoos eingeweiht. Enthüllt wurde die Tafel gemeinsam mit der Kulturbürgermeisterin

Dr. Skadi Jennicke und Johannes Becker, Leiter für Bau und Betriebsunterhalt sowie Prokurist im Zoo Leipzig. Auch prominente Gäste wie Olympiasieger und Bahnradweltmeister Jens Lehmann sowie WolfDietrich Rost, Mitglied im Sächsischen Landtag mit besonderem Engagement für das Sportland Sachsen, zählten zu den Gästen.

Eure Geschichten, Eure Schenkungen, Euer Sportmuseum
Über Geschenke an das Museum und wie sie dort einen Ehrenplatz erlangen
Wolf-Dietrich Rost und Jens Lehmann zu Gast bei der Einweihung der Sportroute Nr. 5.


Das darauffolgende Wochenende wurde der Ort, wo einst Ernst Pinkert im Jahr 1882 das erste Radrennen in Mitteldeutschland ermöglichte um 140 Jahre zurückversetzt. Ein historisches Straßenkünstlerspektakel versetzte die über 17.000 Gäste zurück in die Zeit des Velocipeds, des Hochrades. Das Rennen wurde an historischem Ort sogar von Hochradfahrern nachgestellt und ein Kinderradrennen veranstaltet, welches zeigte, dass dieser Sport in Leipzig auch eine Zukunft hat.

Jakob Grimm widmete eine seiner berühmten »Reden in der Akademie« dem Schenken. Aus sprachgeschichtlicher Sicht bedeutet »schenken« so viel wie »schief halten, eingießen«. Grimm schloss daraus, »daß unsere gastfreien vorfahren aus dem darreichen des trunks den abstracten begriff des gebens überhaupt ableiteten.« Georg Simmel erhob 1958 das Schenken gar zur Grundlage menschlicher Vergesellschaftung überhaupt: »Ohne dass in der Gesellschaft dauernd gegeben und genommen wird — auch außerhalb des Tausches — würde überhaupt keine Gesellschaft zustande kommen.« Das Schenken als Sonderform des Tausches definieren Soziologen wie Frank Adloff heute als »Geben und Nehmen als soziales Handeln jenseits rein ökonomischer Interessen«. Dieser nüchternen Definition steht allerdings eine Aussage des Ethnologen Claude Levi-Strauss entgegen, »man könne das Gesetz des Tausches« nicht »überlisten« oder, anders gesagt: Das Geschenk impliziert immer auch eine — gleichwohl immaterielle — Gegenleistung und sei es nur Dankbarkeit. Diese stelle sich aber, wie Sebastian Brant schon 1494 feststellte, nicht immer sofort ein, sondern könne auf sich warten lassen. Diesen Dank sprach das Sportmuseum mit der Sonderausstellung »EHRENPLATZ«
(21.9.2022 26.2.2023) denjenigen Menschen aus, die in der Vergangenheit dem Sportmuseum Objekte für die Sammlung geschenkt hatten, und warf damit auch einen Blick auf
Goldmedaille, Fantrikot & Co.

Neuerwerbungen
Auch im Jahr 2022 wuchsen die Sammlungen des Sportmuseums und konnten mit zahlreichen, teilweise einmaligen Objekten ergänzt und erweitert werden. Es fanden 41 Erwerbsvorgänge statt, diese enthielten insgesamt 335 Objekte, fast alle wurden als Schenkung übergeben.

Darunter befanden sich umfangreiche Konvolute, wie bspw. Teile des künstlerischen Nachlasses der Leipziger Turnerin Erika Zuchold. Neben Fotografien von der XIV. Schacholympiade 1960 in Leipzig konnten auch seltene Original-Unterrichtsfilme zum Schulsport aus dem Zeitraum 1937 bis 1943, ein Wildwasser-Einer-Kanadier vom DDR-Leistungssport aus der Zeit um 1955 sowie Objekte mit Bezug zum DFB-Pokalfinale 2022, das RB Leipzig gewann, übernommen

werden. Erfolgreiche Sportkarrieren belegen Dokumente und Fotografien des in den 1930er Jahren aktiven ehemaligen rumänischen Berufsringers Vasile Colev, der später in Leipzig lebte. Der bekannte Leipziger Triathlet Martin Schulze, u. a. Welt- und Europameister und zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, übergab seinen Wettkampfanzug sowie seine Laufschuhe, die er bei seinem paralympischen Triathlon-
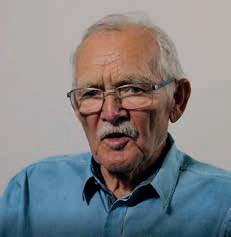
Höhepunkte der geplanten neuen Dauerausstellung am Sportforum.
Für viele Museen haben Geschenke eine ganz besondere Bedeutung, die nachgerade essenziell für den Fortbestand des Museums als sammelnde Institution sein kann. Denn neue Objekte für die Sammlung aus dem Antiquitätenhandel, aus anderen Sammlungen oder Auktionshäusern zu erwerben, ist selten möglich. Dies gelingt oft nur über finanzielle Zuwendungen, etwa aus Museumsfördervereinen oder durch Fördermittel.
Schenkungen helfen Museen, diese Lücke zu schließen. So eröffnete das Sportmuseum Leipzig 1977 bereits mit einer Reihe von zeitlich begrenzten Leihgaben aus Privatbesitz. Viele davon konnten später dauerhaft als Schenkung in der Sammlung verbleiben — und so manche dieser Schenkungen wird künftig im neuen Sportmuseum wieder ihren Platz finden. Aus dem »Geschenk« wird übrigens genau dann eine »Schenkung«, wenn mit der Übergabe ein Rechtsakt verbunden ist. Denn erst durch die Schenkungsurkunde, die zu jedem Objekt ausgestellt wird, gelangt es rechtlich in den Besitz des Museums.

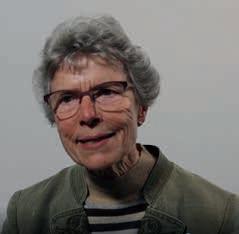
Das Sportmuseum erhält jedes Jahr etwa 300 bis 500 Schenkungen. Manche Dinge sind zufällige Flohmarkt- oder Dachbodenfunde, andere wiederum lange gehütete persönliche Schätze. Sportlerinnen und
Sportler sowie deren Verwandte, sportlich Interessierte und nicht zuletzt Menschen, die beruflich mit Sport zu tun haben, tragen so dazu bei, dass die Sammlungen des Sportmuseums Leipzig unaufhörlich spannende Neuzugänge verzeichnen können. Viele Schenkende wünschen sich einen »Ehrenplatz« für ihr Objekt in der Ausstellung des Museums, der deshalb auch Pate für den Ausstellungstitel war.



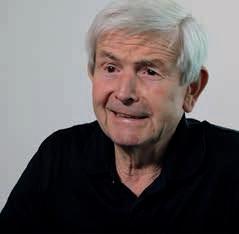
Von der Autogrammkarte bis zur Weltrekordurkunde und von der Torwartmaske bis zum Wanderpokal: Die Ausstellung machte die — nicht selten verblüffenden, ja verrückten — persönlichen Geschichten hinter den Objekten und ihren Schenkungen lebendig. Auch wenn die Ausstellung abgebaut ist, kommen die Menschen weiterhin zu Wort, die von ihrer Schenkung an das Museum erzählen, wie es dazu kam und was sie sich davon erhofften.
ehemaligen Leipziger Topathleten Carl Ludwig »Luz« Long ergänzt werden. Es handelt sich um eine Goldmedaille von der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft 1933 in Köln, bei der Long mit 7,65 Meter im Weitsprung siegte und zugleich Deutscher Meister wurde. Die Medaille gehörte zu einer umfangreichen Kollektion mit Long-Memorabilien, die seine Nachfahren im Herbst 2022 über ein Auktionshaus in den USA versteigern ließen.

sieg 2021 in Tokio trug. Weitere Neuzugänge sind ein Notenblattdruck des Turner-Fest-Marsches zum Deutschen Turnfest Leipzig 1863, ebenso wurden textile Mattensegmente übergeben, die ein Chemnitzer Unternehmen seit 2008 als Wintersport-
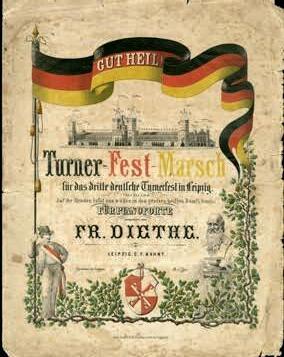
Bodenbeläge in schneeloser Zeit
anbietet. Allen Schenkerinnen und Schenkern sei an dieser Stelle herzlich für ihre Unterstützung gedankt.



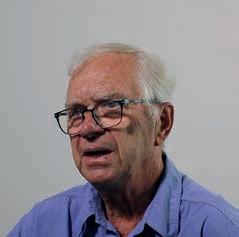


Durch einen bemerkenswerten Ankauf konnte auch der Bestand zum

9 AUTOR Aiko Wulff Leiter Sportmuseum SPORT 500 JAHRE BEWEGUNGSKULTUR IN LEIPZIG AUTOR Wolfgang Metz
Sportmuseum
Schachwettkampf Florencio CampomanesMichael Tal,XIV. Schacholympiade Leipzig 1960, Inv.-Nr.: SM/2022/664
DFB-Pokalfinale 2022, Trikot zur Siegerfeier von RB Leipzig, Inv.-Nr.: SM/2022/632
Notenblatt Turner-Fest-Marsch für das dritte deutsche Turnfest in Leipzig, 1863, Inv.-Nr.: SM/2022/256
Goldmedaille Deutsche Leichtathletikmeisterschaften Köln, 12.-13.8.1933, für Luz Long, 1. Platz Weitsprung, Inv.-Nr.: SM/2023/4
AUTOR
Radrennen für Kinder und mit historischen (Hoch-)Rädern im Zoo Leipzig.
Dietmar Schulze Sportmuseum
Die Interviewbeiträge und der Film sind auf unserem Museums-Youtube-Kanal weiterhin sichtbar.
SCHON GEWUSST
Umweltschäden, Kriegszerstörungen, planwirtschaftliche Mängel sowie Generationen von Besucherinnen und Besucher hatten dem 1913 eingeweihten Denkmal mächtig zugesetzt. In den 1990er Jahren wurde darum ernstlich erwogen, das Denkmal »kontrolliert verfallen« zu lassen. Am 9. Oktober 1998 gründeten deshalb 29 Leipziger Bürgerinnen und

Dr. Anselm Hartinger: Die Rettung und Sanierung des Denkmals ist eine Generationsleistung, die ganz zentral mit dem Verein verbunden ist. Wie aber hat alles angefangen, vor 25 Jahren? Was hat euch bewogen, diese 300.000 Tonnen schwere Herkulesaufgabe anzugehen?
KlausMichael Rohrwacher: In den 1990er Jahren war das Denkmal schwarz, rissig, Beton und Natursteine voller Wasser. In der Stadt kam die Meinung auf, eine Sanierung wäre zu teuer, man solle es kontrolliert verfallen lassen. Das Geld brauche man an anderen Stellen. Aber das Denkmal ist wichtigstes Wahrzeichen von Leipzig, das größte in Europa und weltbekannt. So ein Symbol muss erhalten und saniert werden, sagten 29 Leipzigerinnen und Leipziger und gründeten im Oktober 1998 unseren Förderverein. Den Anstoß dafür gaben Mitglieder des ATV 1845 e. V., vor allen Dr. Jürgen Fechner, Gerhard Langner und Walter Christian Steinbach.
A. H.: Gab es in den vielen Jahren der aufreibenden Denkmalssanierung besondere Meilensteine, Schlüsselmomente und menschliche Begegnungen, die Dir in Erinnerung geblieben sind? Wann wurde Dir klar, dass es gelingen kann?
K. R.: Den ersten Meilenstein setzte die Stadt Leipzig. Im Stadtratsbeschluss vom Juli 1999 bekannte sie sich zu ihrem Denkmal und beschloss die Sanierung, stellte finanzielle und technische Mittel bereit. Den zweiten Schritt tat der Freistaat Sachsen. Er bewilligte im Jahr 2000 eine Unterstützung von 15 Millionen DM, um das Denkmal zu erhalten. Besondere menschliche Begegnungen gab es damals mit Prof. Dr. Kurt Biedenkopf und Dr. Rolf Jähnichen, die sich aktiv für die Zuwendung einsetzten. Stephan Seeger und Wolfgang Tiefensee waren dann diejenigen, die initiativ Aufbau und Arbeit des Vereins begleiteten.


Diese Konstellation war beeindruckend: Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen und Leipziger Bürger im schnell wachsenden Förderverein vereint — solch ein Zusammenschluss, das war eigentlich ein Garant für den Erfolg. Da wusste ich es. Die letzte Bestätigung dieser Gewissheit brachten die Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht und zum 100. Jahrestag der Einweihung des Denkmals im Jahr 2013.
A. H.: Der von Dir geleitete Förderverein hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Hunderttausend Euro mobilisiert und immer wieder neue Unterstützerinnen und Unterstüt
Bürger den Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V. Satzungsgemäßer Zweck des Vereins ist die Erhaltung und umfassende Sanierung des Völkerschlachtdenkmals. Der Verein hat fast 300 Mitglieder: Bürger, Unternehmen, Institutionen, Verbände. Sie setzen sich — wie einst der den Bau initiierende Patriotenbund — mit bürgerschaftlichem Enga-
zer für das Denkmal geworben. Wie macht man das, was ist das Erfolgsrezept dafür?
K. R.: Der benannte Zusammenschluss ist entscheidend. Je mehr Leute mit Überzeugung und Begeisterung für ein gemeinsames Ziel arbeiten, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Wir haben es verstanden, mit unserem Vorbild, unseren Aktio-
gement für die Sanierung des Denkmals ein. Betrachten sie dieses doch nicht nur als Stätte des Gedenkens an die Toten der Völkerschlacht, sondern auch als Mahnmal für Frieden, Freiheit, Völkerverständigung und europäische Einheit. Klaus-Michael Rohrwacher trat dem Verein Anfang 1999 bei, seit 2002 ist er sein Erster Vorsitzender.


nannt: im ledernen Ehrenbuch, auf Spendertafeln vor der Krypta, in der Vereinszeitung, im Internet. Jeder, der einen Stifterbrief erwirbt, dessen Name wird in Bronze gegossen. Schwere Bronzeplatten, die auf den Postamenten der Haupttreppe vom Wasserbecken zum Eingangsplateau tief verankert sind, tragen die Namen eines jeden Stifters. Alle Menschen, die das Völkerschlachtdenkmal besu-
A. H.: Der erfolgreiche Abschluss des grundhaften Sanierungszyklus steht in wenigen Jahren bevor. Wie soll es dann mit dem Denkmal und Verein weitergehen, worin siehst Du die großen Herausforderungen der Zukunft?
K. R.: Eine große Herausforderung muss für das Denkmal die immerwährende Idee von Frieden und Freiheit sein. Es sollte sich auch in Zukunft zu einem europäischen Standort für vor allem jugendliche Menschen entwickeln. Dafür muss sich auch der Verein weiterentwickeln, weg von der reinen Bauunterstützung, hin zu einem Unterstützer von neuen Visionen. Ein wichtiger Meilenstein wird sein, wie wir uns im Verein selbst weiterentwickeln und verjüngen.
Als Aufgaben am Denkmal stehen für uns 2023 neben der Bauerhaltung wichtige Maßnahmen zur nachhalti-
des Klimawandels sowie explodierender Energiekosten ressourcenschonender betreibbar werden, was die Fragen erneuerbarer Energiequellen sowie des nachhaltigen Tourismus dringlich macht. Für all dies brauchen wir weiterhin tatkräftige Unterstützer, die uns bei neuen strategischen Investitionen eben unterstützen wie beim Bauerhalt und im ehrenamtlichen Engagement. Dass Du und der Förderverein im Moment des Zurückblickens auf ein Vierteljahrhundert Erfolgsgeschichte energisch auf Verjüngung und Zukunftsorientierung dringen, finde ich sehr ermutigend und visionär.
A. H.: Ein riesiges Dankeschön von mir und dem Team für die letzten 25 Jahre. Ich denke, dass wir das nächste Vierteljahrhundert trotz aller Krisen mit Zuversicht angehen können. Was erwartet Mitglieder und Interessierte in diesem Jubiläumsjahr?
K. R.: Wir haben diese Zuversicht und wir wollen sie weitertragen. Dazu sollen die Veranstaltungen und Projekte beitragen. Wir möchten allen Interessierten ganzjährig die Möglichkeit geben, das Denkmal kennenzulernen. Deshalb bieten wir sowohl für Schulklassen als auch für alle Bürgerinnen und Bürger Führungen an.
Im Februar 2023 setzen wir große Hoffnungen auf die Sitzung unseres hochkarätigen Kuratoriums, geleitet von seinem Ersten Vorsitzenden, Staatsminister Sebastian Gemkow. Ganz sicher werden hier einige neue Ideen für die weitere Entwicklung der Projekte und des Vereins geboren.
Im März dann findet unsere Mitgliederversammlung statt. Wir sind überzeugt, hier wichtige Anregungen und Vorschläge für zusätzliche Aktionen von unseren Mitgliedern zu bekommen.
Im September werden wir zum 30. Mal mit OBM Burkhard Jung Stifterbriefe an neue Erwerber übergeben. Wer dafür noch einen Stifterbrief erwerben möchte, sollte sich bis Ende Juni in der Geschäftsstelle melden.
nen und unserem Einsatz die Leipziger und überregionale Bevölkerung zu Einigkeit und Engagement für eine gute Sache, zu gewinnen. Dazu gehören engagierte Vereinsmitglieder, ein Vorstand, der sich zu 100 Prozent einbringt, Mitarbeiter der Planungs-und Ingenieurbüros, ebenso der Stadtverwaltung, das Team des Denkmals mit Steffen Poser und der Stiftung und nicht zuletzt das Team der Vereinsgeschäftsstelle. Außerdem konnten wir uns immer der Unterstützung von OBM Burkhard Jung, nicht nur bei den Stifterbrief-Übergaben, sicher sein. Über 3 Millionen Euro Zuwendungen und Spenden hat der Verein bereits eingeworben und wir sind sicher, dass es gemeinsam so weitergeht.
Das wichtigste Instrument dafür ist unser Stifterbrief. Es gibt ihn seit 2009 in Gold, Silber oder Bronze, initiiert von unserem Gustav A. Steinert. Es ist eine persönliche, handsignierte Urkunde, die feierlich übergeben wird. Alle unsere Helfer werden an mehreren Stellen be-
chen, können die Namen lesen — für immer. Und unsere Großspender stehen auf einer Messingtafel im historischen Stifterzimmer. Wir vergessen niemanden. Die Nachwelt wird wissen, wer die Sanierung des Denkmals vollbrachte.
A. H.: Du bist selbst Steinmetz und in der Denkmalpflege tätiger Unternehmer gewesen. Wie wichtig ist Dir diese handwerkliche Dimension des Denkmals?
K. R.: Der Bau des Denkmals um 1900 war eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Das begann schon mit der Bauplanung, der Konstruktion, setzte sich fort bei der Auswahl und dem Heranschaffen der Baumaterialien, in dem Einsatz der Stampfbeton-Technik und gipfelte in den bildhauerischen Arbeiten der Steinmetze. Diese Dimension war damals der Wahnsinn, vor allem die handwerkliche Genauigkeit in Beton und Stein. Das ist auch heute noch bewunderungswürdig.

gen Neuausrichtung und zur energetischen Modernisierung der Denkmalinfrastruktur an.
K. R.: Apropos Herausforderungen: Mit welchen hat das Museum bzw. die Stiftung eigentlich zurzeit zu kämpfen und was können wir dabei tun?
A. H.: Zunächst gilt es, die Sanierung abzuschließen und gemeinsam mit der Stadt und weiteren Förderern dem Denkmal eine langfristige Erhaltungsperspektive zu sichern. Wir müssen dabei mit neuen Formaten noch stärker machen, dass das Denkmal die junge Generation Europas im Zeichen des Friedens verbinden kann — Geschichtsinteresse, Handwerkstradition, Bürgernähe, kulturelles Engagement mit unserem Botschafter Denkmalschor sowie Friedensarbeit gehören dabei zusammen. Wir wollen auch die Auseinandersetzung mit der Völkerschlacht als dem neben 1989 wichtigsten Ereignis der Leipziger Geschichte ausbauen und sinnlicher gestalten. Zugleich muss das Denkmal im Zeichen
Zur Feier unseres 25. Geburtstages organisieren wir eine Festveranstaltung. Diese findet für geladene Gäste am 27.10.2023 statt. Wir beginnen im Alten Rathaus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird ein Grußwort halten, ebenso Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Die Festrede hat Prof. Dr. Johannes Beermann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, zugesagt. Im Anschluss planen wir eine Podiumsdiskussion. Der Chor des Völkerschlachtdenkmals wird sich beteiligen, ebenso die Traditionsvereine. Danach geht es in die Alte Handelsbörse. Zur Veranstaltung bereiten wir eine Festschrift vor, als Beilage der traditionsreichen »Leipziger Blätter«.
DENK-MAL MIT!
Möchten Sie selbst aktiv werden und mitmachen?
Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V. Magazingasse 4 | 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9618538
Fax: 0341/9618540 kontakt@voelkerschlachtdenkmal.de
Ansprechpartnerin: Dr. Irina Poldrack
10
LEIPZIGER BÜRGERGEIST SEIT 25 JAHREN
DANK DENKMAL
AUTOR Dr. Anselm Hartinger Direktor Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Geschäftsführer Stiftung Völkerschlachtdenkmal
AUTOR Klaus-Michael Rohrwacher Erster Vorsitzender des Vorstandes des Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.
Wasserbeckenbefüllung 2017, Sommerfest 2016, Übergabe des Stifterzimmers 2014, Bürgerfest 2013, Fotos: Armin Kühne
ZUM 18. OKTOBER 2022

Wie in jedem Jahr gedachten wir auch 2022 des historischen Geschehens der Völkerschlacht von 1813 in Leipzigs größtem Denkmalsbauwerk. Aus aktuellem Anlass drucken wir die in diesem Jahr dabei gesprochenen Worte hier ab. Sie geben vieles von dem wieder, was uns alle seit Monaten bestürzt und bewegt.
»Unter Beschuss ist es nicht leicht, das Leben zu sortieren. Du horchst dich in alle Geräusche hinein und unterteilst sie in fröhliche und schauerliche. … Und dann noch der Klang der vertrauten Stimmen am Telefon. Es ist so wichtig zu fragen: ›Wie geht es dir?‹ Eine meiner Bekannten antwortet immer: ›Wie der ganzen Stadt‹. Eine Freundin … teilt mit, dass sie gerade im Flur sitzt, um den Beschuss zu überstehen. Ich werde ruhiger, weil ich auch im Flur sitze, und es fühlt sich an, als würden wir zusammen da sitzen.«
»Gegen 10 Uhr Vormittags geschahen zwei Kanonenschüsse … In dieser großen Noth wussten wir nicht, wohin wir uns wenden sollten, um Schutz zu finden … und eine große Zahl der hiesigen Einwohner flüchtete sich in die Kirche, weil sie sich da wegen des starken Mauerwerks vor den Kugeln gesichert hielten; … heftig war der Angriff … auf unseren Ort … Herzerreißend war das Jammern und Wehklagen in der Kirche, besonders da die Kirchenthüren aufgesprengt wurden und die Kugeln durch die Fenster in die Kirche fielen … Noch mehr aber steigerte sich unser Jammer, als einige Männer … gewahr wurden, wie der größte Theil der Häuser in der Windmühlengasse in Feuer aufging.«
»Als die Essensvorräte alle waren, haben die Ärzte den Patientinnen ihre Rationen gegeben. Der Chefarzt brachte Wurst und Käse. Weil es kein Brot gab. Nirgends gab es welches zu kaufen. Es gab überhaupt nichts zu kaufen. Zuerst blieben die Geschäfte zu, dann wurden sie geplündert.«
»Als Erstes kommen die Töne. Widerliche, metallische Töne, als würde jemand einen gigantischen Zirkel ansetzen, um die Entfernung bis zu deinem Bunker zu vermessen. … Dann fliegt ein Geschoss. Du hörst, wie ein riesiger Hammer auf das Metalldach schlägt, und dann kommt dieses schreckliche Knirschen, als würde man mit einem gigantischen Messer die Erde aufschlitzen ...«
»In dem Augenblicke kamen mehrere in die Stube und nahmen Alles vom Tische weg, was darauf stand. Ja, sie gingen weiter, suchten in allen Stuben und Kammern, in Keller, Küche und auf dem Boden und wo sie nur glaubten etwas zu finden, nahmen, was da war und schlugen Hühner, Gänse und Schweine todt.
»Gegen Mittag schlug die erste Granate durch unser Dach; im Laufe des Nachmittages folgten ihr noch zwei …. Aus einigen anderen Stadttheilen … sahen wir Rauchsäulen aufsteigen. Die nach dem Park zu gelegenen Zimmer, … betraten wir gar nicht mehr. … Nachdem es dunkel geworden war …, stieg ich mit dem Vater … noch einmal auf den oberen Dachboden, von wo aus wir denn …, nichts als unzählige Wachtfeuer, dazu aber mehrere brennende Dörfer sahen. Der Vater sagte seufzend: »Und morgen wird die Stadt in Flammen aufgehen!«
»Der zweite Aufgang brennt oberhalb des zweiten Stocks, ringsum nichts als Asche, Glas und Tüten aus den Müllcontainern, die schon seit mehr als zwei Wochen nicht mehr geleert werden. Ach, scheiß doch auf diese Müllcontainer. Die Leichen deiner Nachbarn und Bekannten räumt auch keiner weg. Die Getöteten liegen in Hauseingängen, auf Balkons, in Innenhöfen.«
»Vor lauter Angst habe ich meinen rothaarigen Kater Josik verraten. Ich habe ihn zurückgelassen. Ich habe es nicht geschafft, ihn mitzunehmen. Ich hatte Angst, nach oben in die Wohnung zu gehen. Ich habe meinen sanften und lieben Kater in der Hölle zurückgelassen. Weil ich selbst zerbrochen bin.«
»Überall stieß man auf Todte. Besonders groß war die Anzahl der Pferde. Die Leichen lagen am dichtesten, je mehr man sich dem Ranstädter Thore näherte. … Dort sah man überall Menschen und Pferde, die ins Wasser gedrängt, darinnen ihr Grab gefunden hatten, und in scheußlichen Gruppen hervorragten.«
»Unsere Hülfsquellen sind erschöpft, und wir haben jetzt eine ungeheure Menge Kranker und Verwundeter ... zu versorgen. ... Wir sehen vor unsern Augen viele Tausend Bewohner der umliegenden Flecken und Dörfer, …welche … nun, ohne Obdach, All des Ihrigen beraubt, mit ihren Familien fast Hungers sterben. … Alles um uns her ist eine große Wüste. Die zahlreichen Dörfer und Flecken liegen fast alle ganz oder zum Theil in Asche; die noch stehenden Gebäude sind von Kugeln durchlöchert, dem Einsturz nahe und gänzlich ausgeplündert; …, die Vorräthe jeder Art hinweggeführt; Alles, was zur Wirthschaft gehört, …; die Pferde und alles Vieh wurde fortgeschleppt und viele, viele Familien betrauern den Verlust geliebter Verwandter ...«

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit mehr als einem Jahrhundert versammeln sich um den 18. Oktober jeden Jahres in diesem Gebäude Menschen zum Gedenken einer Schlacht, die bis zum Beginn des 20. Jh. die größte und schlimmste der Menschheitsgeschichte war. Seit über dreißig Jahren stehe ich selbst hier an dieser Stelle und versuche, unsere Gedanken für einige Augenblicke auf jenes Geschehen des Jahres 1813 zu lenken. Mit dem Abstand von 200 Jahren wissen wir, dass herzlich wenig von dem einst triumphal Gewonnenen und sieglos Verlorenen wirklich Bestand hatte. Wofür damals 90.000 Menschen ihr Leben verlorenen haben, es hat für uns heute kaum eine Bedeutung. Warum also überhaupt daran erinnern? Weil so eine Stunde des Innehaltens, des Überdenkens, des Abwägens vielleicht
helfen kann, unser Handeln in der Gegenwart zu beeinflussen? Weil wir vielleicht gar etwas aus der Vergangenheit lernen könnten? Wir als Menschheit können oder wollen es offensichtlich nicht.
Vor genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, es scheine kompliziert, aus einer so lange zurückliegenden Schlacht etwas für unser Tun in der Gegenwart abzuleiten. Die Umstände sind immer andere und die Perspektiven, aus denen wir auf ein historisches Geschehen schauen, seien immer von Überlegungen der Gegenwart gelenkt. Dennoch bestätige auch eine 200 Jahre alte Schlacht, welch ein Irrsinn Krieg immer schon gewesen sei. Und man müsse genau das tun, vielleicht als das einzig Mögliche, Sinnvolle. Es klingt nach nicht viel
Augenzeugenberichte vom Krieg. Von jenem vor mehr als 200 Jahren, mitten im Herzen unserer Stadt und von dem in Mariupol im März 2022, der immer noch tobt, vor unserer Haustür.
und doch könnte es eine ganze Welt verändern. Krieg ist nicht romantisch, Krieg ist nicht ehrenvoll, er ist nicht zwangsläufig und er ist nicht akzeptabel. Er ist ein Desaster, ein grauenhaftes Verhängnis und man muss diesen Irrsinn eine Verirrung und eine Beleidigung des Menschen nennen, wo immer man auf ihn trifft, sei es in der Vergangenheit oder sei es heute, sei es vor unserer Haustür oder sei es irgendwo sonst auf der Welt, laut und deutlich beim Namen nennen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit — Irrsinn, Verbrechen, diabolische Abscheulichkeit. Das war und das ist der Krieg. Vor 200 Jahren genauso wie heute. Homo sapiens — der verstehende Mensch. Es wird Zeit, dass er damit beginnt.
11 AUTOR Steffen Poser | Leiter Völkerschlachtdenkmal / FORUM 1813, Kurator Militaria und Numismatik
KRIEG & FRIEDEN VÖLKERSCHLACHTDENKMAL / FORUM 1813
DENK-MAL
2022 1813
Die
Augenzeugenberichte
Völkerschlacht sind Veröffentlichungen
Vereins zur Feier des 19. October, Ludwig Hußels und Maximilian Poppes entnommen. Die Auszüge aus dem Tagebuch der ukrainischen Journalistin Nadezhda Sukhorukova auf Facebook erschienen in einem Abdruck in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 27. März 2022. Laserprojektion auf das Völkerschlachtdenkmal anlässlich des Angriffs auf die Ukraine, 9. März 2022
historischen
zur
des
02
JANUAR
01.01.1890: Beginn der ersten großen Eingemeindungswelle Leipzigs

Ab etwa 1850 wuchsen die Dörfer rund um Leipzig in ihrer Größe durch Zuzüge, bessere Verkehrsanbindungen und Industrieniederlassungen rasant an. In den 1880er Jahren wurde festgelegt, dass alle Dörfer innerhalb eines 5 km Umkreises der Stadt ausgehend vom Markt der Stadt angeschlossen und eingemeindet werden sollen. 1889 wurden zunächst zwei Ortschaften eingegliedert, die eigentliche erste große Eingemeindungswelle begann mit dem 1. Januar 1890, hier wurden acht Dörfer eingemeindet, darunter Eutritzsch und Gohlis. Während dieser Phase, die bis 1892 anhielt, vergrößerte sich Leipzig flächenmäßig etwa um das Dreifache, die Bevölkerung stieg von etwa 200.000 auf fast 400.000 an.
FEBRUAR
08.02.1917: Zerstörung der Luftschiffhalle in Mockau
Am 22. Juni 1913 wurde der Mockauer Luftschiffhafen feierlich eingeweiht, und mit ihm eine gigantische Halle, in der zwei Großluftschiffe Platz finden konnten. Der Stahlbau hatte 193 x 77 x 32 Meter Außenmaße und eine Nutzfläche von 17.665 Quadratmetern. In den folgenden Jahren gab es dort unzählige Besucher und zahlreiche Luftschiffaufstiege. Vermutlich war die schiere Größe der Grund, dass die damals weltgrößte Luftschiffhalle nach nicht einmal vier Jahren am 8. Februar 1917 unter hoher Eis- und Schneelast in sich zusammenbrach und nach einer daraus folgenden Explosion durch austretende Wasserstoffgase völlig zerstört wurde. Der Luftschiffhafen wurde als solcher noch bis 1938 genutzt.
Pläne von Leipzig. 1888 und 1895, Inv.-Nr.: L/211 A2 und S/10/2005 Luftschiff-Halle auf dem Flugplatz Leipzig. Postkarte, um 1915, Inv.-Nr.: PK 4314/5

JULI
11.07.1888: Eröffnung des städtischen Viehund Schlachthofes in der Südvorstadt
Mehr als elf Mal so groß wie der Leipziger Markt, eröffnete am 11. Juli 1888 der städtische Vieh- und Schlachthof an der heutigen Richard-LehmannStraße, eines der größten städtischen Bauprojekte des 19. Jahrhunderts. Schnell erwies er sich als nicht ausreichend, um die Fleischversorgung Leipzigs zu gewährleisten, da die Bevölkerungszahl der Stadt damals rasant anstieg. Es kam immer wieder zu Erweiterungen, die Quadratmeterzahl der überdachten Fläche war 1913 mehr als doppelt so groß wie zu Anfangszeiten. Am 4. Dezember 1943 wurde auch der Schlachthof teilweise zerstört, zu DDRZeiten entwickelte er sich zu einem der größten Schlachthöfe des Landes. Heute hat der MDR dort seinen Sitz.
AUGUST
06.08.1543: Kauf des Georgenklosters durch die Stadt
Im Zuge der Reformation erwarb Leipzig am 6. August 1543 vom sächsischen Herzog Moritz die aufgelösten Klöster in und um Leipzig, darunter auch das Georgenkloster der Zisterzienserinnen. Das einzige hiesige Frauenkloster wurde um 1230 von Kitzen nach Leipzig verlegt und befand sich vor den Toren der Stadt, in der Petersvorstadt gegenüber der Pleißenburg. Die heutige Nonnenmühlgasse erinnert an die ungefähre Lage. Das Kloster selbst wurde kurze Zeit später abgebrochen, von den Besitztümern des Stifts am eigentlichen Standort überdauerte nur die Nonnenmühle die Jahrhunderte. Die mehrfach umgebaute Mühle wurde 1890 abgerissen, um Platz für die heutige KarlTauchnitz-Brücke zu schaffen.

MÄRZ
19.03.1893: Einweihung der Lukaskirche in Volkmarsdorf

Eine Kirchgemeinde bestand in Volkmarsdorf erst seit 1891, nachdem ein Jahr zuvor das Dorf und Rittergut eingemeindet wurden. Im gleichen Jahr wurde mit dem Bau einer Kirche mit 911 festen Sitzplätzen begonnen. Als Architekt zeichnete sich der auf diesem Gebiet bewanderte Julius Zeißig aus. Die Einweihung des Sakralbaus mit einem 71 Meter hohen und weithin sichtbaren Kirchturm erfolgte am 19. März 1893. Zu diesem Zeitpunkt hatte die evangelischlutherische Kirchgemeinde im arbeitergeprägten Volkmarsdorf etwa 18.000 Mitglieder. 1985 wurde Christoph Wonneberger, der die DDR-Opposition unterstützte und später die Friedensgebete in der Nikolaikirche organisierte, in der Kirche Pfarrer.
APRIL
29.04.1899: Eröffnung des Palmengartens in Lindenau
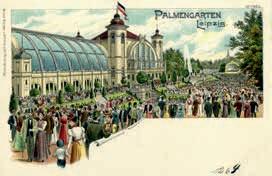
Nachdem 1893 auf den Ratswiesen in Lindenau im Rahmen einer Gartenbauausstellung eine Parkanlage angelegt wurde, erweiterte man diese zu einem großen Landschaftsgarten. Am 29. April 1899 erfolgte die Eröffnung. Hauptattraktion der 225.000 Quadratmeter großen Anlage waren das großflächig mit Glas ausgestattete Gesellschaftshaus mit großem Festsaal und Hauptrestaurant sowie das daran angrenzende Palmenhaus mit tropischen Pflanzen. 1940 sollte u. a. im Park die letztlich nicht stattgefundene »Gutenberg-Reichsausstellung« gezeigt werden. In Vorbereitung darauf wurde am 10. Januar 1939 das Gesellschafts- und das Palmenhaus gesprengt. Heute ist das Gelände Teil des Clara-Zetkin-Parks.

MAI
02.05.1842: Eröffnung des Ball und Konzerthauses »Tivoli« in der Petersvorstadt


Am 2. Mai 1842 wurde an der heutigen und damals nahezu unbebauten Karl-LiebknechtStraße 30–32 das Ball- und Konzerthaus »Tivoli« mit Ausflugslokal eröffnet. Das Gebäude war zwei Stockwerke hoch und fast 40 Meter breit. Im Inneren fand man einen imposanten Tanzsaal mit Restauration vor, der die gesamte Hausbreite einnahm. Von einem rückseitig gelegenen Treppenausgang gelangte man in einen großen Garten mit Springbrunnen, der links und rechts von Kolonnaden gesäumt war. 1905/06 wurde dem beliebten Vergnügungsetablissement das Volkshaus »vorgesetzt«. Anfangs noch Teil des Konzertparks hinter dem Volkshaus, verlieren sich die Spuren des »Tivoli« spätestens in den 1920er Jahren.
24.06.1782: Eröffnung der »Eisbude« im Rosental
Am 24. Juni 1782 wurde am Eingang des erst kurz zuvor angelegten Rosentals eine kleine Konditorei eröffnet. Da dort hauptsächlich Eis verkauft wurde, nannte man sie im Volksmund »Eisbude« oder »Kalte Madame«. Eis bestand damals meist aus Schnee, vermischt mit Zucker, Zitronensaft oder verschiedenen Früchten. Auf den Erfolg der Eisbude aufbauend, errichtete der Gastronom Otto Bonorand 1841 an gleicher Stelle ein Café, welches bei der Leipziger Bevölkerung sehr beliebt war. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sogar ein großer Saal angebaut. In dem Café mit Garten fanden bis zu dessen Schließung im Jahr 1935 große Festivitäten und Konzerte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich statt.

Innenraum der Lukaskirche. Fotografie, Hermann Walter, um 1900, Inv.-Nr.: F/268/2010
09 SEPTEMBER
30.09.1846: Erste Beisetzung auf dem Neuen Johannisfriedhof
Der 42-jährige Maurergeselle Johann Karl Gehlicke war die erste Person, die am 30. September 1846 auf dem Neuen Johannisfriedhof beigesetzt wurde. Zwei Tage zuvor wurde der nordwestlich von Thonberg gelegene Friedhof eingeweiht. Die Errichtung war notwendig geworden, nachdem der Alte Johannisfriedhof — seit 1536 mehr als drei Jahrhunderte lang die einzige Begräbnisstätte für die Toten der Stadt Leipzig — allmählich zu klein geworden war. Nach mehreren Erweiterungen hatte er zum Schluss 19 Hektar Fläche. Die letzte Beisetzung fand dort 1950 statt. 1970 wurde der Friedhof endgültig geschlossen und säkularisiert, heute befindet sich auf dem Areal der 1983 eröffnete Friedenspark.
Palmengarten Leipzig. Postkarte, Bruno Bürger & Ottilie, um 1900, Inv.-Nr.: PK 3980a/1264
10 OKTOBER
23.10.1859: Ankündigung der Anlegung des Johannaparks

Am 23. Oktober 1859 teilte der Bankier Wilhelm Seyfferth der Stadt in einem Brief mit, dass er auf einer von ihm ein Jahr zuvor erworbenen Wiese in der Westvorstadt nah der Pleißenburg einen Park errichten wolle. Die 1863 fertiggestellte Anlage erhielt den Namen Johannapark, benannt nach der 1858 jung und der Legende nach an Liebeskummer verstorbenen Tochter des Bankiers. Nach dem Tod Seyfferth wurde der bei den Einheimischen sehr beliebte Johannapark testamentarisch an die Stadt Leipzig gestiftet, einhergehend mit der Auflage, dass das Areal niemals anderweitig bebaut werden darf. Zeitweise Teil des ClaraZetkin-Parks trägt die Anlage seit 2011 wieder ihren ursprünglichen Namen.

Tivoli. Fotografie, Inv.-Nr.: 5868
11 NOVEMBER
09.11.1859: Illumination des Dorfes Gohlis

Vom 9. bis 11. November 1859 fand in Leipzig ein großes Fest zu Ehren des 100. Geburtstags von Friedrich Schiller statt. Ein Augenzeuge schätzte, dass daran mehr als 50.000 Menschen teilnahmen. Es gab Veranstaltungen und Feierakte u. a. in Schulen, an der Universität, im Gewandhaus und im Stadttheater. Mehrere Festzüge mit unzähligen Teilnehmern zogen durch die Straßen. Den ersten führte Carl Friedrich Zöllner mit mehreren Chören am Abend des 9. Novembers mit bunten Laternen, Musik und Gesang nach Gohlis vor das Schillerhaus, in dem Schiller 1785 für einige Monate wohnte. Für den Festzug wurde Gohlis illuminiert, alle Häuser wurden angeleuchtet und mit Emblemen und Transparenten versehen.
Eis-Bude im Rosenthal. Kupferstich, Ernst Wilhelm Straßberger, um 1825, Inv.-Nr.: 9906 a
12 DEZEMBER
23.12.1974: Straßenbahnlinie 16 fährt erstmals nach Lößnig
1971/1975 entstand in Lößnig ein Neubaugebiet mit mehr als 3.000 Wohnungen. Den Stadtplanern war klar, dass dieses eine StraßenbahnAnbindung bekommen sollte. Bis dahin konnte man nur bis zur Märchenwiese nach Marienbrunn fahren. Am 23. Dezember 1974 wurde die etwa 1,2 km lange Strecke zwischen Märchenwiese und Lößnig eingeweiht. Die erste Tatra-Bahn der Linie 16 wurde im Neubaugebiet mit viel Begeisterung empfangen. Aber nicht nur die »Neu«-Lößniger hatten etwas davon: Die Strecke führte weiter bis zum »Rundling«. Und so bekamen nun auch die Bewohner dieser ringförmigen Wohnsiedlung aus den Jahren 1929/30 einen bis dahin kaum für möglich gehaltenen direkten Straßenbahnanschluss.

Der neue Vieh- und Schlachthof in Leipzig. Originalzeichnung von B. Straßberger. In: Illustrierte Zeitung 91 (1888), Nr. 2351, S. 74,
147/2351
Nonnenmühle und Areal des ehemaligen Georgenklosters. Stadtansicht (Ausschnitt), Conrad Knobloch, 1595, Inv.-Nr.: K/145/2010

Eingang des Neuen Johannisfriedhofs. Fotografie, Hermann Walter, nach 1883, Inv.-Nr.: F/8531/2005
Johannapark. Zeichnung, Karl Enderlein, um 1900, Inv.-Nr.: K II/144
Schillerhaus. Gemälde, L. Schulze, 1859, Inv.-Nr.: SV 25
Empfang der Linie 16 in Lößnig. Fotografie, Wolfgang Bahnert, 1974, Inv.-Nr.: F/2020/152
12 AUTOR Marko Kuhn Bibliothek
ZWÖLFMAL STADTTEILE UND VORORTE 01
KALENDERBLATT
07
08
03
04
05
06
JUNI
Sign.: III Q
Mal ohne Lorbeerkranz
Schiller und Leipzig
»Wir stehen an einer Stätte, die ein großer und edler Mann betrat … Unser großer Schiller, … er steht uns in heiliger und unnahbarer Ferne; … Aber an dieser Stelle …, die alle an das gewöhnliche Leben erinnern, fühlen wir es lebhafter als je: daß auch Schiller Mensch war; wie wir; … hier ist er ausund eingewandert, hier hat er sich erfreut …, in diesen freundlichen Räumen hat er dieselbe Luft geathmet, die uns erquickt, in unserm traulichen Rosenthale haben ihn dieselben Schattengänge gekühlt, die uns erfreuen.«
Treffender, als es Robert Blum anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel an Schillers kurzzeitigem Quartier in Gohlis im November 1841 tat, kann man kaum zusammenfassen, warum auch heute noch im mittlerweile Schillerhaus geheißenen alten Bauernhaus in der Menckestraße Gebäude und Ausstellung an den Sommeraufenthalt des Dichters im Jahre 1785 erinnern.
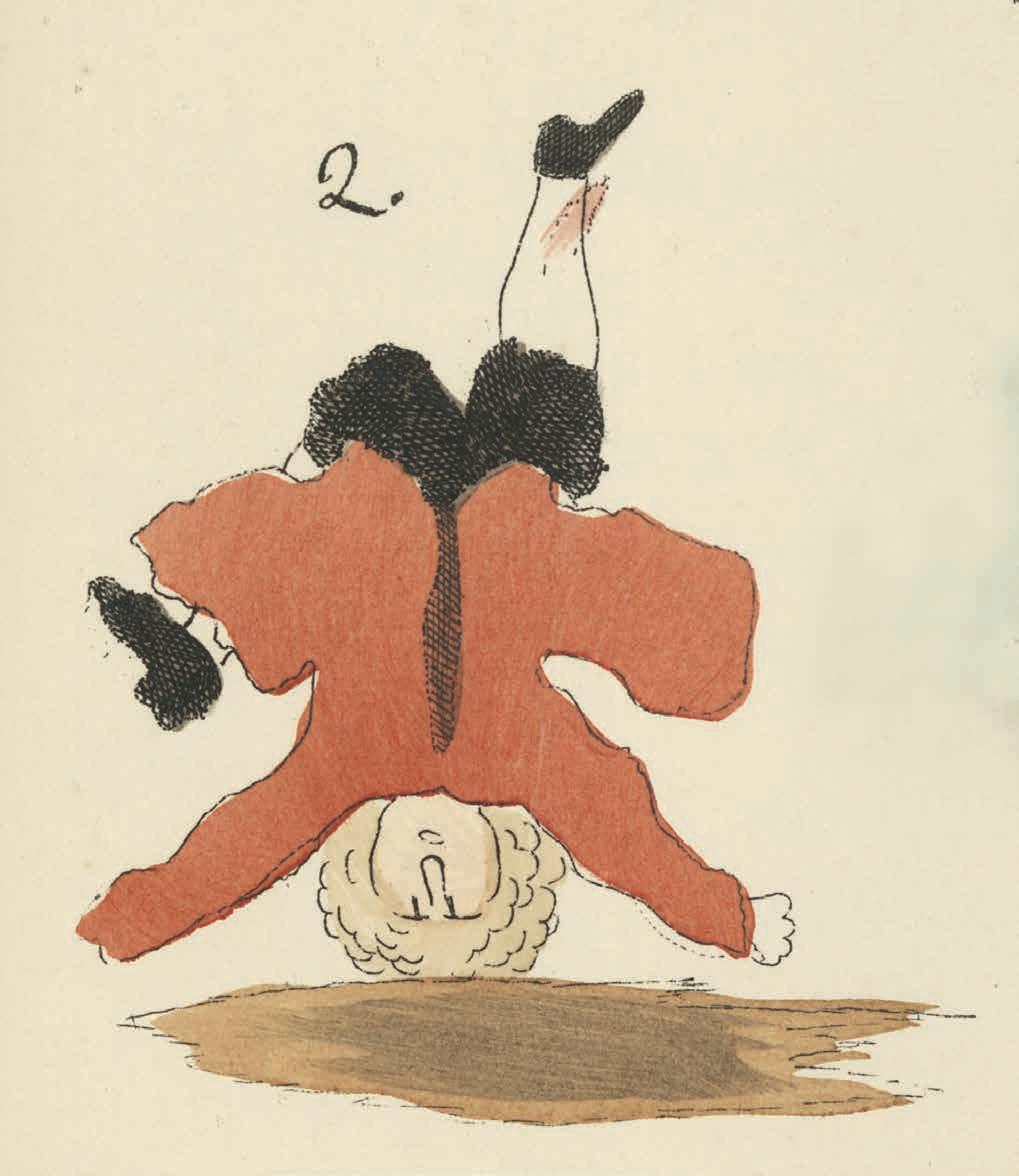
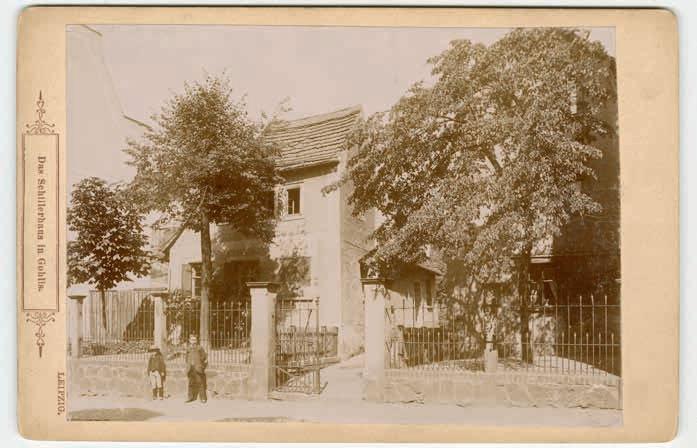
Dieses Jahr hatte für den späteren Dichterfürsten genauso bedrückend begonnen, wie das alte geendet hatte. Aus dem Job als Militärarzt, den er hasste, hatte er sich davongeschlichen, aus dem nächsten, den
überraschende Einladung von zwei ihm bis dahin vollkommen unbekannten Pärchen an, die ihn, voll der Bewunderung für seine ersten schriftstellerischen Erfolge nach Leipzig baten. 1785 zog er für einige Wochen im Haus des Bauern Schneider als Sommergast ein. Dort erlebte er beglückende Nähe, bedingungslose Freundschaft und ehrliche Bewunderung, im nahen großstädtischen Leipzig eine verheißungsvolle Ahnung der weiten Welt. Hier sah er sein eigenes Stück im Theater, machte die Bekanntschaft zahlreicher Künstler, gewann neue Zuversicht und verlor seine Schulden. Plötzlich schien alles eitel Sonnenschein und im Hochgefühl des Glücks wuchsen in ihm Verse, die einmal seine bekanntesten sein sollten — das Lied »An die Freude«.

Rund 50 Jahre später ist es der Leipziger Theatersekretär und Homo Politicus Robert Blum, der Schillers einstige Sommerfrische zu wenig beachtet findet. Blum nimmt den »kräftigste(n) Kämpfer für … Wahrheit, Recht und Freiheit« beim Wort und setzt ihn als subversive Waffe gegen politische Bevormundung, Despotie und Zensur ein. Man beschäftigt sich im Kreise Gleichgesinnter mit dem Werk eines der größten deutschen

trotzigen Applaus nach Posas Gedankenfreiheits-Forderung bei einer Aufführung des Don Karlos erlebte, weiß, was gemeint ist. Man macht einen über siebzigjährigen Gohliser ausfindig, der des Dichters einstige Sommerwohnung identifiziert, die man 1841 mit einer für das schmalbrüstige Häuschen etwas überdimensionierten Ehrenpforte samt Eisengusstafel schmückt. Die erklärt, er habe hier nicht nur gewohnt, nein, sein populärstes Werk, das Lied sei hier entstanden. Später disputiert man darüber. Hat er es hier nur im Herzen getragen, allenfalls knapp skizziert, vielleicht zunächst im Freundeskreis im sommerlichen Schatten alter Linden nur einzelne Verse gesungen und das Ganze erst jenseits Gohlis‘ vollendet? Heute Nebensächlichkeit, damals an diesem Ort unverzichtbar für die Identifikation mit Mann und Werk.
rung 1998 sichern kann. Nachvollziehbar, dass sich im Laufe von mehr als anderthalb Jahrhunderten Gedenkstättenexistenz auch mehrfach die Art und Weise wandelt, mit der Friedrich Schiller an diesem Ort dem Publikum begegnen soll. Vom Freiheitskämpfer, über den entrückten
Dichterfürsten zum Revolutionär ist da Vieles dabei. Vielleicht ist es heute an der rechten Zeit am rechten Ort, in der neuen Ausstellung den Wortgewaltigen als Menschen kennenzulernen, ehe er vollständig zu Marmor erstarrt.
er wirklich mochte, war er rausgeflogen. Die Behörden waren ihm wegen Fahnenflucht auf den Fersen, der Geldbeutel war flach und zu allem Überfluss plagte er sich mit einer Malariaerkrankung. Kurzum, die Welt war schlecht und das Leben, kaum dass es richtig begonnen hatte, schien aschgrau.
Und dann, von jetzt auf gleich, änderte sich alles. Schiller nahm eine
Dichter und ruft doch mit dessen Worten von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit laut in den abgestandenen Mief der deutschen Kleinstaaten nach dem Öffnen der Fenster.
Schiller und sein Werk trifft auch nach Jahrzehnten noch den Nerv der Zeit bei jenen, die am politischen Prozess teilhaben wollen. Man zitiert den Dichter und münzt ihn auf die Gegenwart. Wer je in der DDR den
Von nun an gibt es alljährlich Schillerfeste, Wettbewerbe für Schüler und Ausstellungen von »Schiller-Reliquien«. 20 Taler lässt sich der Schillerverein die Miete für die beiden windschiefen Stuben kosten, in denen der Verehrte einst logierte und als 1856 der Abbruch des ganzen Hauses droht, erwirbt er kurzerhand Haus und Grundstück und setzt es instand. Fast einhundert Jahre später wird der Schillerverein aufgelöst und die Stadt übernimmt das Gebäude. Unsachgemäßer Umgang mit der Bausubstanz und verwalteter Mangel in der DDR lassen Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts erneut um den Fortbestand des Hauses fürchten, den eine grundhafte Sanie-
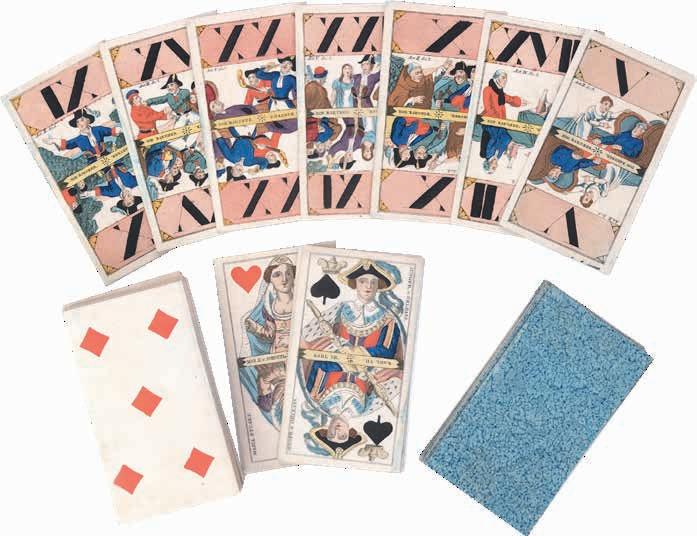
13 SCHILLERHAUS LEIPZIG GÖTTERFUNKEN AUTOR Steffen Poser | Leiter Völkerschlachtdenkmal / FORUM 1813, Kurator Militaria und Numismatik
Das Schillerhaus in Leipzig-Gohlis, Fotografie, um 1880, Inv.-Nr.: G.Sch.H. 40c Werbeannoncen in der Leipziger Zeitung für Produkte zur Feier von Schillers 100. Geburtstag 1859
Selbstkarikatur
2.
Tarock-Karten mit Darstellung von Szenen aus Theaterstücken von Friedrich Schiller, um 1820, Inv.-Nr.: V/2973/2007
Schillers vom
Juli 1786, Sign. I N 5580
Eine Baustelle, die sich als Stadt tarnt …
Zwei Fotoankäufe zeigen städtischen Wandel ab den 1960er Jahren
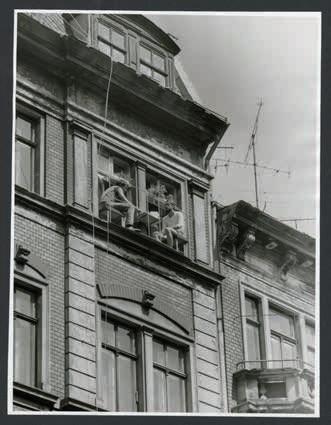
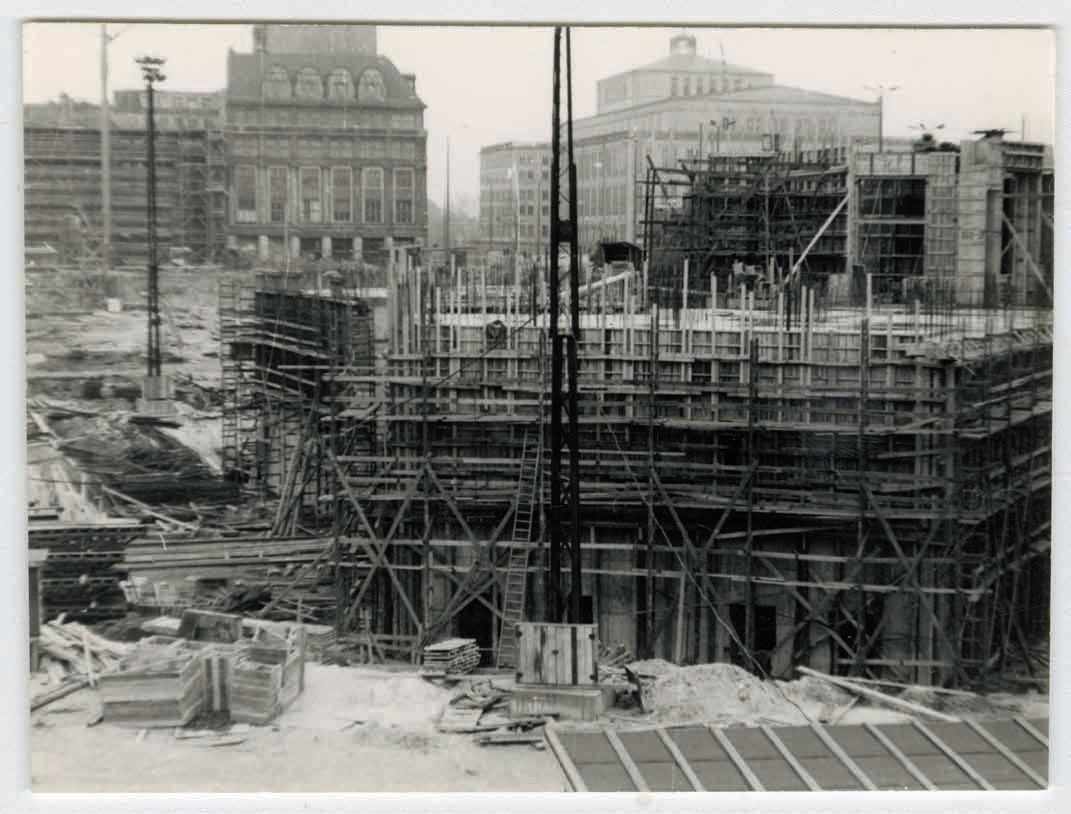
In den 1960er und frühen 1970er Jahren lebten in Leipzig mit etwa 590.000 Einwohnern so viele Menschen wie derzeit. Als Referenz kann die Einwohnerzahl aber mitnichten einfach herbeigenommen werden, da die Stadtfläche heute vor allem durch die Eingemeindungen Ende der 1990er Jahre etwa doppelt so groß ist wie damals.
Wenn wir heute auf große Bauprojekte in Leipzig schauen, kommt es uns bisweilen vor, als sei die Stadt nur so von Bauflächen, -zäunen und Kränen durchzogen. Dieser Blick lässt sich relativieren und schärfen, schaut man auf Fotografien aus der benannten Zeitspanne. Denn in dieser Zeit wurden heute ortsbildprägende Großprojekte wie das Univer-
Fotothek verpflichtet
Georg Zschäpitz: Licht und Schatten über Leipzig
Im Jahr 2019 gelang es dem damaligen Fototheksleiter, Christoph Kaufmann, den Teilnachlass des Fotografen Georg Zschäpitz für die Sammlung anzukaufen. Bei über 3.000 Fotos eine gigantische Erschließungsaufgabe, der er sich nun als Ehrenamtler überaus engagiert widmet und hier über den Fotografen berichtet:
Friedrich Wilhelm Georg Zschäpitz wurde am 3. September 1879 in Leipzig-Volkmarsdorf geboren und ließ sich 1914 als Fotograf nieder. Seine Tätigkeit wurde durch die Einberu-
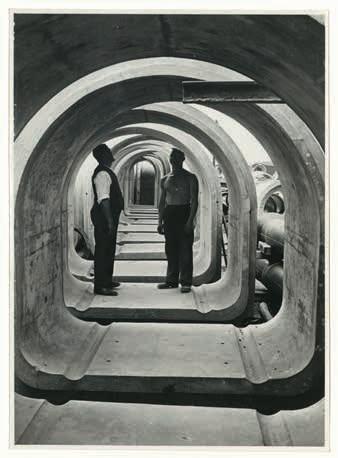
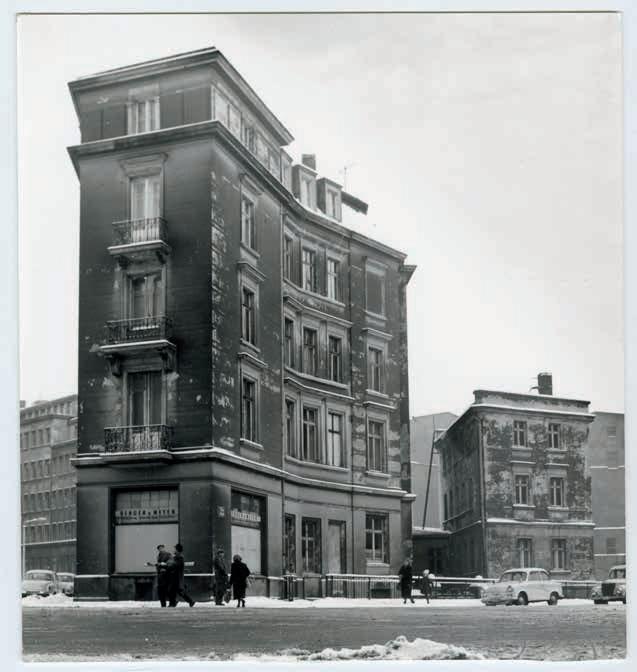
fung als Soldat im Ersten Weltkrieg unterbrochen. In seinem Nachlass finden sich daher auch Bilder vom Feldzug gegen Frankreich; darunter einige Luftbilder und Fotos der dabei eingesetzten Kameratechnik. Nach dem Krieg fand man ihn in LeipzigConnewitz, wo er als Inhaber des Fotoateliers »Am Kreuz« in der Bornaischen Straße 3 registriert war. Aus dieser Anfangszeit sind mutmaßlich keine Aufnahmen erhalten. Ab 1924 sind Reportageaufnahmen von ihm nachweisbar, ab 1929 firmierte er, nun mit Atelier in der Kochstraße, als »Fotograf für Presse und Sportaufnahmen«. Augenfällig sind dabei zwei Betätigungsfelder: Es gibt unzählige Pferdeaufnahmen von Rennen, Kutschfahrten und Tierporträts, die ihn als ausgesprochenen Pferdenarr ausweisen. Zum anderen war die Hinwendung zu »patriotischen« Veranstaltungen in Leipzig ein Schwerpunkt seines fotografischen
sitätshochhaus und das Wintergartenhochhaus realisiert — Mittendrin in der flächenmäßig noch deutlich kleineren und »volleren« Stadt.
Eine großzügige Schenkung künstlerischer Fotografie
Im Jahr 2022 kam Amateurfotograf und Zeitzeuge Hans Anders auf uns zu und bot seine Fotografien der Baustellen dieser »Modernisierungsjahre« an, es folgte ein Ankauf von etwa 300 Fotos, v. a. Kleinbildnegativen aus jener bewegten Zeit.
Eine großzügige Schenkung künstlerischer Fotografie, die ebenfalls den Wandel der Stadt in der DDR-Zeit do-

Schaffens. Schon vor 1933 fotografierte er zahlreiche nationalistische Aufmärsche und militärische Übungen. Nach der Machtergreifung stellte er seine Arbeit zweifellos in


kumentiert, erreichte uns 2022 von Diplom-Fotografin und GEDOK-Mitglied Sigrid Schmid: 68 von der Fotografin selbst abgezogene Originale fanden dank unserem FototheksEhrenamtler Reinhard Krabbes ihren

Weg über die händische Inventarisierung, die Digitalisierung und schließlich als recherchierbare Objekte in unsere Sammlungsdatenbank. Sie zeigen, wie das hier ausgewählte Motiv der Schloßgasse, im Stadtbild Verschwundenes ebenso wie Altbauten, die die Zeit zwar überdauert haben, aber dem Verfall preisgegeben wurden. Dennoch ist Sigrid Schmidts fotografischer Blick auf Leipzig ein versöhnlicher: Zeigt sie doch, wie die Menschen sich die Stadt trotz ihrer Widrigkeiten stets kreativ zu eigen machten.
den Dienst des nationalsozialistischen Regimes und wurde somit zum Chronisten der NS-Zeit in Leipzig. Da aus dieser bislang relativ wenige Fotos in den Archiven und Sammlungen der Stadt überliefert sind, schließen Zschäpitz‘ Fotografien eine wichtige Lücke im Bildgedächtnis Leipzigs. Zugleich werden damit Fehlstellen bei der Dokumentation wichtiger Infrastrukturmaßnahmen wie Kanalund Hafenbau geschlossen. Was Georg Zschäpitz im Zweiten Weltkrieg tat, ist kaum belegt. Zahlreiche Trümmerfotos sind sowohl im Stadtarchiv Leipzig als auch im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig überliefert. Nach 1945 gibt es noch vereinzelte Fotografien von Sportereignissen. Am 12. Februar 1950 verstarb der Fotograf im Alter von 70 Jahren. Er schuf hervorragende Genreaufnahmen, aber seine ideologische Nähe zum Regime im Nationalsozialismus ist unverkennbar.
Stadtwandel reloaded
Um Leipzig und seinen Wandel ab 1990 wird es ab Herbst 2023 in der Sonderausstellung »Tiefen/Lichter. Bildgedächtnis einer Stadt. 30 + 3 Jahre Leipziger Fotoagentur punctum« gehen. Zusammen mit der Leipziger Fotografenagentur Punctum wird auf 33 Jahre Leipzig, seine Menschen und Bauten, zurückgeblickt.

RATEN SIE MAL!
Wo in Leipzig bin ich? Das Postamt gibt es, wenn auch etwas weniger schmuckvoll, noch. Man muss nur für einen kurzen Schwenk die große Magistrale im Leipziger Norden verlassen …
14
FOTOTHEK DAS FOTOGRAFISCHE GEDÄCHTNIS DER STADT LEIPZIG AUTORIN Friederike Degner Fotothek
Abb. oben: Zwei im Zweiten Weltkrieg erhalten gebliebene Gebäude, die später abgerissen wurden. Am linken Bildrand ist das Merkurhaus (Schloßgasse) angeschnitten. Beide Häuser standen am hier noch nicht verfüllten Burggraben; der Burgplatz ist durch ein Schutzgeländer abgegrenzt. Fotografie von Sigrid Schmidt, 1957, Inv.-Nr.: F/2022/100
Abb. links: Blick auf die Baustelle des Universitätshochhauses. Im Hintergrund rechts der Königsbau und das Krochhochhaus. Fotografie von Hans Anders, 1970, Inv.-Nr.: F/2022/353
Ein illegaler Balkon zwischen den Fenstern zweier Wohnhäuser im Waldstraßenviertel. Fotografie von Sigrid Schmidt, 1984, Inv.-Nr.: F/2022/80
Betonelemente (Autobahn-Durchlässe), die gleichzeitig als Elemente für Luftschutzbunker genutzt werden konnten. Fotografie von Georg Zschäpitz, nach 1933, Inv.-Nr.: F/2022/451
Fotografie vom Atelier Hermann Walter, um 1925, Inv.-Nr.: F/5289/2005
Der Hauptbahnhof im Umbau, Punctum/Bertram Kober, 1995.
Von Stammbäumen, nackten Füßen und der Insel Kalifornien
Historische Sammlung komplett erschlossen
Die historischen Bestände der Bibliothek werden seit Jahren auch retrospektiv elektronisch erschlossen. Ein bedeutendes Hilfsmittel dafür bildet ein bis 2004 geführter Zettelkatalog, in dem eine eigentlich sehr wichtige Sachgruppe allerdings gar nicht vorkam. Nun ist dieser Bestand komplett online recherchierbar.
Nach und nach werden auch die »alten« Bücher in unsere Sammlungsdatenbank eingepflegt. Der sogenannte Standortkatalog hilft dabei ungemein. In diesem internen alten Zettelkatalog findet man alle Sach-
gruppen der Bibliotheksbestände aufsteigend nach den Signaturen –angefangen mit den ältesten Erwerbungen des Leipziger Geschichtsvereins ab Ende der 1860er Jahre. Nur die alten Schriften der sogenannten Historischen Hilfswissenschaften fehlten darin unverständlicherweise völlig. Zu diesen Grundwissenschaften für Historikerzunft gehören u. a. die Ahnen- und Familienforschung (Genealogie), die Wappenkunde (Heraldik) oder die Münzkunde (Numismatik). Mehr als 200 Titel später ist der Altbestand aus dieser Sachgruppe nun online recherchierbar. Die älteste Schrift stammt aus
Sebastian Jacob Jungendres: Einleitung zur Heraldic. Für die Jugend in Frag und Antwort gestellet. Für Erwachsene aber mit Anmerkungen erläutert […]. Nürnberg 1729, Sign.: II O 176
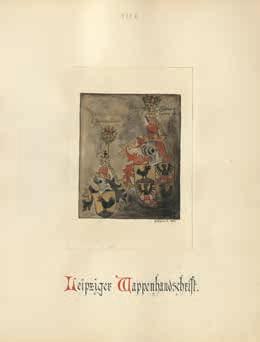

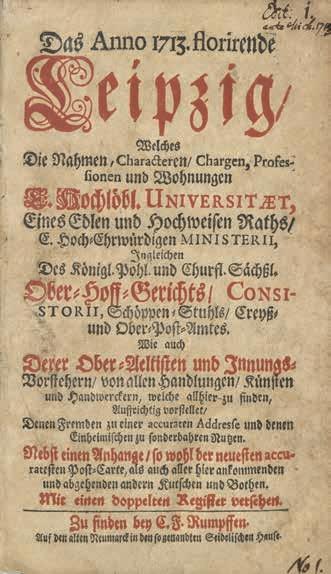
dem Jahr 1586, das größte Buch ist ein 37 cm großer Foliant mit Holz-/ Ledereinband aus dem 17. Jh.
Wichtige Forschungsquelle und skurrile Details
Nun denkt man vielleicht: Historische Hilfswissenschaften? Laangweilig … Dem ist aber bei weitem nicht so! Leipzig-Bezug haben bei uns hier tatsächlich nur recht wenige Bücher, trotzdem ist die Sammlung eine wichtige Quelle für alle Geschichtsinteressierten. Ob man hier die frühesten bildlichen Wappen-Darstellungen von Adelsgeschlechtern, Familien oder Orten findet, ob man zu Ritua-
Adressbücher als Nachschlagewerke
In Leipzig wurde 1701 mit »Das ietzlebende Leipzig« nach Pariser und Londoner Vorbild das erste deutschsprachige Adressbuch gedruckt. In den ersten Jahrgängen waren das eher kleine Heftchen mit den Standespersonen der wichtigsten Institutionen der Stadt (Universität, Gerichtbarkeit, Rat der Stadt, Kirchen, Schulen usw.). Aber noch im gleichen Jh. entwickelten sich die Bände zu vollständigen Einwohnerverzeichnissen der Stadt plus fremdem Handelsstand, allerdings damals noch thematisch geordnet mit Personen- und Berufsregister. Zeitweise gab es sogar zwei unterschiedliche Adressbücher verschiedener Verlage in einem Jahr.
Abb. links: Wappenauswahl.
Aus: Johann Siebmacher: New Wapenbuch. Nürnberg 1605, Sign.: II O 189 Abb. rechts: Amerika-Karte.
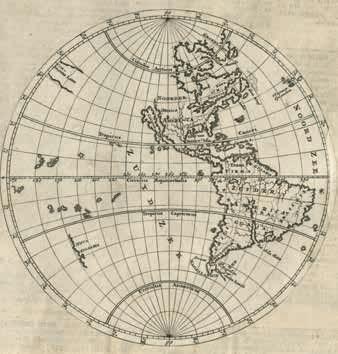
Aus: Johann Ludwig Levin Gebhardi: Der Mohamedanischund Heydnischen Hohen Häuser Historische und Genealogische Erläuterung. Dritter Theil. Lüneburg 1731, S. 117, Sign.: II E 192

Der »Rote Löwe« und sein Schatz

len bei Beerdigungen aus der Vergangenheit forscht, ob man in den Büchern mit etwas Glück alte Münzen aus dem Familienbesitz identifiziert, oder wenn man wissen möchte, wer zu einer bestimmten Zeit was am sächsischen Königshof gemacht hat: Hier wird man oft fündig.
Hinzu kommen noch einige Skurrilitäten, wie z. B. ein riesiger Band aus dem 18. Jh. mit Stammbäumen von Königs- und Regentenhäusern auf allen Kontinenten. Hier sind wie bei einer Collage verschiedene andere Sachen eingeklebt, u. a. eine kleine alte Weltkarte, auf der entsprechend des damaligen durch Seereisen erlangten Forschungsstandes Nordamerika noch unvollständig und die Halbinsel Baja California noch als Insel Kalifornien eingezeichnet war. Auch die Bücher mit den Wappendarstellungen sind teilweise aus heutiger Sicht amüsant anzusehen: Männer mit Eselsohren, Schildkröten, gehörnte Fische, nackte Füße, einzelne Arme in Rüstungen mit Blumenstrauß in der Hand oder sogar Leichenaufbahrungen sind dabei zu entdecken.
Eine studentische Verbindung, die auch forschte — einmalige Quelle in der Bibliothek
Im Rahmen der Erschließung der historischen Literatur zur Genealogie und Heraldik wurden auch aus anderen Sachgruppen Schriften zu diesen Themen in die Sammlungsdatenbank mit aufgenommen. Dazu gehört auch ein im wahrsten Sinne des Wortes einmaliges vierbändiges handschriftliches Werk, welches lange Zeit als zerstört galt.
Abb. links: Jahrbuch des Vereins für geschichtliche Hilfswissenschaften Roter Löwe.
Leipzig 1885, Sign.: I M 443/4
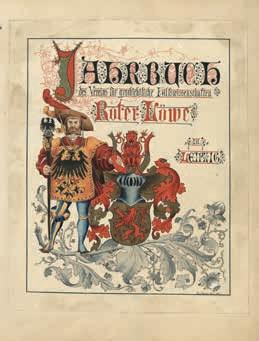
Abb. Mitte: Ein Stammbuch derer von Ende. In: Jahrbuch des Vereins für geschichtliche
Hilfswissenschaften Roter
Löwe. Leipzig 1885, S. 97,
Sign.: I M 443/4
Abb. rechts: Leipziger Wappenhandschrift. In: Jahrbuch des Vereins für geschichtliche
Hilfswissenschaften Roter
Löwe. Leipzig 1885, S. 182d, Sign.: I M 443/4
Im Dezember 1875 wurde in Zwickau durch einige Gymnasiasten ein Verein gegründet, der sich zunächst mit Wappenkunde beschäftigte. Da eine Mehrzahl der Mitglieder nach Leipzig zum Studium ging, wurde der Vereinssitz 1880 in die Messestadt gelegt. Man erweiterte die Inhalte und benannte sich 1886 in »Verein für Geschichte und historische Hülfswissenschaften Roter Löwe an der Universität Leipzig« um. Aus der nun
studentischen Verbindung wurde 1926 eine freie Burschenschaft.
Im Dritten Reich verschwanden die letzten Überbleibsel im Rahmen der Gleichschaltung, im Zweiten Weltkrieg wurden bei Bombenangriffen auf Leipzig die Archivalien des Vereins weitestgehend zerstört.
Vom 1877 bis 1885 führte der Verein ein Jahrbuch, in den ersten Jahren handschriftlich, später in größerer
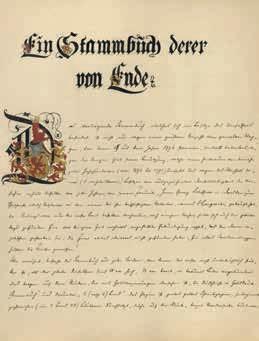
Auflage gedruckt. Anfang 1969 kaufte das Stadtgeschichtliche Museum vom Zentralantiquariat der DDR ein großes Konvolut an, darunter für den Teilbetrag von 800 Euro vier große grünliche Bücher in goldgeprägten Ledereinbänden. Tatsächlich waren das der erste Jahrgang sowie die Ausgaben 1879/80, 1881 und 1885 des Jahrbuchs. In den Bänden sind neben den Geschäftsberichten Aufsätze zur Wappen- und Münzkunde, zur Leipziger und sächsischen Geschichte sowie familiengeschichtliche Abhandlungen zu finden. Aufwendig handschriftlich gestaltet sowie mit kunstvollen und teilweise farbigen Initialen und Zeichnungen versehen, erregten die Jahrbücher damals solches Aufsehen, dass sogar namhafte Heraldiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum dem Verein beitraten. Lange verloren geglaubt, sind die Bände bei uns einsehbar.
1863 kam noch eine weitere Abteilung dazu, und zwar die der Straßen bzw. der Straßennummern. So konnte man nachlesen, wer Besitzer und Bewohner welchen Hauses in Leipzig war. Ende des 19. Jh. wurden auch die Vororte mit aufgenommen, zahlreiche Firmenwerbung und z. B. Übersichtspläne der Zuschauerbereiche der städtischen Opern- und Theaterbauten waren dem eigentlichen Adressbuchteil vorangestellt. Anfang des 20. Jh. wurden noch große Stadtpläne eingelegt.
Das Anno 1713. florierende Leipzig. Leipzig 1713, Sign.: I H 1/1713
Die Adressbücher gab es mit kurzen Unterbrechungen bis 1949. Bis heute sind sie eine unverzichtbare Quelle für stadtgeschichtliche Forschungen jeder Art, ob es nun um Personen, Gebäude, Berufsstände oder Institutionen geht.
SCHON GEWUSST
Für den hochwertigen Scan einer DIN-A2-großen Vorlage (z. B. ein Plakat von etwa 60 x 40 cm) in Druckqualität benötigt unser Buchscanner, der sich unter optimalen Lichtbedingungen im Bibliotheksmagazin befindet, etwas mehr als 9 Sekunden. Ein großer Flachbettscanner würde für ein vergleichbares Resultat mehrere Minuten beschäftigt sein.
15 BIBLIOTHEK NICHT NUR SCHWARZ AUF WEISS AUTOR Marko Kuhn Bibliothek
SammlungsHoroskop
Mit unseren Objekten in Ihre Sterne geschaut
Wassermann
20. Januar — 18. Februar
Beschwingt ins neu Jahr gekommen?
Besuchen Sie unsere Sonderausstellung »HAKENKREUZ UND NOTENSCHLÜSSEL« und lernen Sie mehr über die Leipziger Swing-Szene in der »Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus«.
Fische
19. Februar 20. März
Im Frühjahr mag man ja so manches Mal die Nase lieber in ein Buch als vor die Tür stecken. Machen Sie doch beides; wir zeigen die Studioausstellung »LESELAND DDR« (bis 18. Juni) für alle Lesebegeisterten.
Widder
21. März — 20. April
Dynamisch starten Sie in den Frühling, wir haben einen neuen »Götterfunken« für Sie im Schillerhaus: »Wir betreten feuertrunken/ Himmlische, dein Heiligthum.« Seit dem 1. April erstrahlt das Gohliser Kleinod in neuem Glanz, der Schillerhausgarten lädt zum Verweilen ein.
SCHON GEWUSST
Stier
21. April — 21. Mai
Die Nacht steht Ihnen offen: Am 6. Mai laden wieder alle Leipziger Museen zur Museumsnacht ein. Bei uns erwarten Sie spannende Führungen und ein beswingtes musikalisches Programm.

In der Museumssammlungsdatenbank www.stadtmuseum. leipzig.de sind über 400.000 unserer mittlerweile 600.000 Objekte fassenden Sammlung digital abrufbar. Jeder, also auch Sie, kann diese nutzen und nach Dingen der Alltagskultur, Kunst, Büchern, Karten, Fotografien, Stadt- und Landesgeschichte, Persönlichkeiten und und und suchen. In den meisten Fällen und mit etwas Geduld und Mühe bei der Stichwortsuche werden Sie auch etwas finden; manchmal auch Unerwartetes und seltene Fundstücke.
Farblithographie
Haus in Gohlis von Carl Heyn, Druck von J. G. Fritzsche, um 1800, Inv.-Nr.: K/548/2006

Unsere Sammlung, das historische Gedächtnis der Stadt Leipzig, umfasst Objekte aus dem 10. Jh. bis ins Jahr 2023. In unserem Horoskop lesen wir Ihnen diesmal die Zukunft aus Illustrationen, Plakaten, Schaustellerzetteln und Adventskalendern aus dem 19. bis ins 20. Jh.. Wir laden Sie ein, mit uns das »LESELAND DDR« zu bereisen, Schiller »Götterfunken« zu suchen und die Nacht zu erkunden. Bunt wird es allemal.

Notenheft »Zum 5 Uhr Tee Band XI« mit aktuellen Schlager von Grafiker Herzig im Musikverlag Anton J. Benjamin, 1928, Inv.-Nr.: MT/2021/44
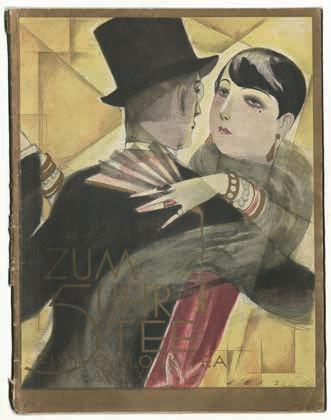
Zwillinge
22. Mai — 21. Juni
»Die Welt ist schwarz«, schrieb Erich Kästner in einem seiner »13 Monate«, die der Leipziger Illustrator und HGBProfessor Karl-Georg Hirsch 1972 illustrierte. Dass Schwarz elegant kleidet, wissen nicht nur diese beiden Raben. Wir heißen alle Besucherinnen und Besucher des WGT herzlich willkommen in Leipzig.
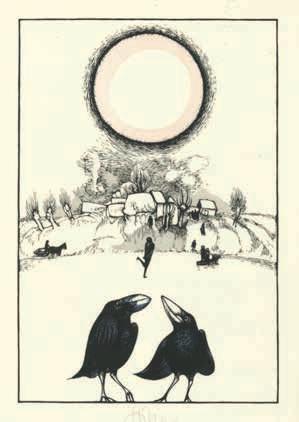
Plakat »Fast alle lesen Reclam« von Grafiker Karpinski, 1977, Inv.-Nr.: PL 77/100
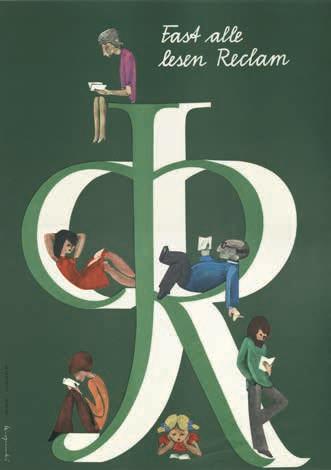
Krebs
22. Juni — 22. Juli
Der Krebs versteckt sich an den überraschendsten Orten in unseren Sammlungen. Dem Sternzeichen nach übrigens auch ein Krebs, ist der in Leipzig
geborene Komponist Hanns Eisler, dem wir ab dem 7. Juli eine Studioausstellung im HAUS BÖTTCHERGÄßCHEN widmen.
Adventskalender Sternwarte von Grafiker G. Hain im Verlag VEB Bild und Heimat, Reichenbach i. V., 1961, Inv.-Nr.: V/2015/41
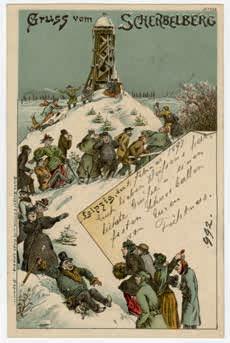
Löwe
23. Juli — 22. August

Unter den Löwen findet man treue Gefährten. Das Kuscheln mit wilden Großkatzen können wir dennoch nicht empfehlen.
Schaustellerzettel »Die große Menagerie der C. S. v. Aken«, 1836, Inv.-Nr.: VI/50



Holzstich zu »Der Januar« aus Erich Kästners
»Die dreizehn Monate« von Grafiker KarlGeorg Hirsch im Verlag Karl Quarch, 1972, Inv.-Nr.: Schütte 8
Jungfrau
23. August — 22. September
Wundersames vermögen die Jungfrauen. Auf diesem Schaustellerzettel sehen wir sie gar vier Soldaten oder einen Amboss beim Schmieden halten — stark und anpassungsfähig in vielen Situationen.

»Der Krebsreiter«, Grafik zur Völkerschlacht, 1813, Inv.-Nr.: VS 1872
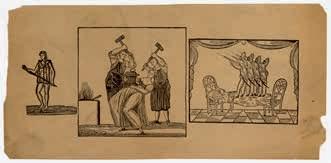
Waage
23. September — 22. Oktober
Wie wichtig Gleichgewicht ist, wussten man schon 1555 beim Bau der Alten Waage auf dem Leipziger Marktplatz. In unserer Sonderausstellung mit der Leipziger Foto-Agentur punctum halten sich kunstvoll »Tiefen/Lichter«
(13.9.2023 25.2.2024) die Waage.
Skorpion
23. Oktober — 22. November
Wenn Sie gelegentlich Ihren metaphorischen Stachel ausfahren wollen, halten Sie inne. Womöglich liegt es an der dunklen Jahreszeit. Nicht verzagen, holen Sie sich die Farben des Herbstes ins Haus.
Schütze
23. November — 20. Dezember
Wenn der Advent einzieht, wird es auch bei uns bunt: Ab dem 28. November schmücken Krakauer Krippen, die zum immaterielles Kulturerbe der Menschheit zählen, den Festsaal des Alten Rathauses und erzählen farbenfrohe Geschichten aus unserer polnischen Partnerstadt.
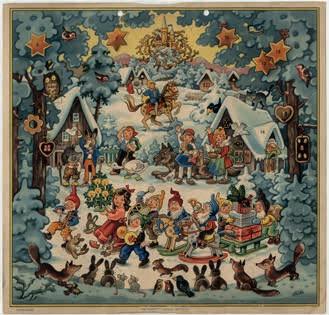
Steinbock
21. Dezember — 19. Januar
Ob es sich wohl dieses Jahr lohnt Leipzigs Berge für eine Schlittenpartie zu besteigen? So oder so: Blicken Sie zuversichtlich und mit Freude ins neue Jahr, wir freuen uns auf vielfältige neue Ausstellungen 2024 und natürlich Ihren Besuch.
16 AUTORIN Ida Mahlburg Volontärin Presse und Öffentlichkeitsarbeit HOROSKOP BLICK IN DIE SAMMLUNG
Schiller’s
Schaustellerzettel mit drei Illustrationen aus einem Circus oder dem Schaustellermilieu, 1800/1900, Inv.-Nr.: A/348/2003 »Die alte Waage« von Zeichner Friedrich Wilhelm Heine, (vor) 1861, Inv.-Nr.: H 400 Zeichnung
Adventskalender »Märchenland« von Grafiker K. L. im VEB Postkartenverlag Berlin, 1960, Inv.-Nr.: V/2015/40 Postkarte »Gruss vom Scherbelberg« aus dem Verlag Bruno Bürger & Ottillie, 1897, Inv.-Nr.: PK3979/992
»Blumenvase mit Hagebutten und weiteren Beeren« von Richard Siegert, 1847,
Inv.-Nr.: K/2015/233
Geschichte(n) hinter Glas
Die Exponate kehren wieder zurück

Nach der sanierungsbedingten Schließung der ersten Etage des Alten Rathauses erfolgte Ende Januar 2022 der Startschuss zur Wiedereinrichtung der renovierten Museumsräume. Nach der Entnahme von fast 1.000 Exponaten vor Beginn der Baumaßnahme ein Jahr zuvor sollte nun das Gros der Objekte wieder zurück an seinen angestammten Platz, ebenso wie die vielen gestalterischen Hilfsmittel, Halterungen und Texttafeln.
Als eine bevorzugte Form zur sicheren Präsentation von musealen Exponaten kommt in Ausstellungen die Vitrine zur Anwendung. Vom lateinischen »vitrum« abgeleitet, beschreibt der Begriff Vitrine einen Schaukasten, bei dem eine oder mehreren Seiten aus Glas bestehen.
Unser Museum nutzt diese Präsentationsform selbstverständlich ebenfalls in all seinen Ausstellungen. Wie sich zeigen sollte, spielten ausgerechnet diese Vitrinen im Prozess der Objekteinrichtung eine besondere Rolle.
Die Endreinigung der Baustelle war bereits erfolgt, allerdings gab es in Teilbereichen witterungsbedingt immer noch Restarbeiten, die für erneuten Schmutzeintrag sorgten.
Zudem kam hinzu, dass auch ein Teil von 247.000 Tonnen des jährlich in Deutschland anfallenden Staubes immer wieder seinen Weg in das Alte Rathaus fand. Deshalb stellte neben der sorgfältigen Entnahme der Objekte aus den Transportverpackungen, der vorsichtigen Handhabung und Einrichtung der Musealien die
Reinigung der Präsentationsoberflächen eine große, vor allem aber zeitaufwändige Herausforderung für das Einrichtungsteam dar.
Kulinarisches
Es hieß also putzen, putzen, putzen … und nach dem die temporäre Arbeitsbeleuchtung der Lichtinszenierung der Ausstellungsräume wich, sah die Situation schon wieder etwas anders aus, so dass teilweise erneut nachgereinigt werden musste. Bis zur Wiedereröffnung Ende April war diese Prozedur in allen Ausstellungsbereichen mehrfach notwendig.
Am Ende herrschte bei allen Beteiligten ein tolles Gefühl, endlich wie-
der einzigartige historische Objekte, die Leipziger Geschichte erzählen, der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ob das bekannte Gemälde von Johann Sebastian Bach, die schmuckvoll gearbeitete Amtskette vom Oberbürgermeister oder die beiden repräsentativen Standuhren aus der Ratsstube, sie alle kehrten wieder zurück in die Beletage des Alten Rathauses.
Nebenbei bemerkt sind sämtliche Exponate unversehrt geblieben. Hier geht ein besonderer Dank an die Firma Museal, die das anspruchsvolle Gemäldehandling hervorragend meisterte sowie an alle Mitwirkenden des Museumsteams. Eine solch große Herausforderung gehört nicht oft zu unserer alltäglichen Arbeitsroutine … und den Spaß dabei gab es inklusive.



Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was früher so auf den Tisch kam? Ob man das heute noch kochen bzw. backen könnte? In unserer Bibliothek befinden sich auch alte Kochbücher, das Älteste ist aus dem Jahr 1745 von Susanna Eger. Rezepte können eine spannende Lektüre sein, auch wenn man einiges heute wohl eher nicht mehr kochen würde, wie z. B. Ochsen-Gehirn, Schafs-Magen oder »Kälber-Füsse«. Einige der verwendeten Begriffe sind uns nicht mehr geläufig, im Kontext kann man sie sich jedoch erschließen oder mit ein wenig Recherche herausfinden was gemeint ist. Mit dem Wort »mandeln« ist nichts Anderes als »ausrollen« gemeint.
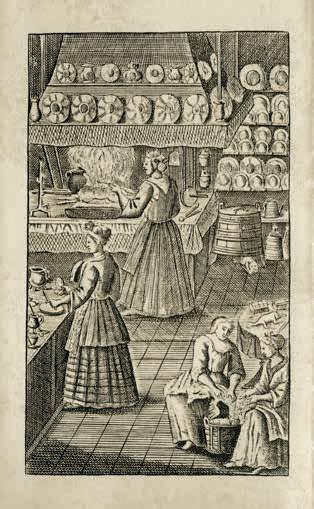
Lust bekommen, mal ein altes Rezept nach zu kochen? Wie wäre es mit Käsekrapfen aus dem Kochbuch von Susanna Eger?!
Abb. o. l.: Reinigung der »Amtsketten-Vitrine« in der Ratsstube
Abb. o. M.: Ausrichten des Bach-Porträts
Abb. r.: Wiedereinrichtung der kirchlichen Kunst in der sog. Kapelle

Abb. u.: Drapieren einer Militärfahne aus der Zeit Johann Georg des I.
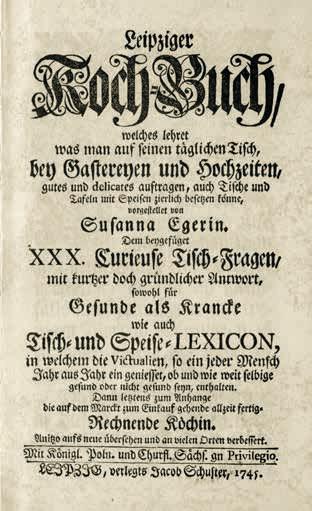
Museumsarbeit (krisenbedingt) einmal anders
Unterstützung im Ankommenszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine
Im Oktober 2022 habe ich die Sammlungsdatenbank gegen die PIKStation getauscht.
Wie viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wurde auch das Museum um Unterstützung bei der Ukraine-Hilfe gebeten. So weit, so gut — aber was bedeutet das für eine gelernte Museologin genau?
An zwei Tagen in der Woche war ich statt in der Dokumentation des Museums im Ankommenszentrum im Technischen Rathaus tätig. Der erste
Tag startete gleich mit einer Teamberatung und vielen neuen Fachbegriffen, wie Fiktionsbescheinigung, AZR oder PIK-Station*. Nach der Beratung ging es dann an die PIK-Station. Zunächst einmal habe ich die hiesige Kollegin begleitet und versucht, mir gleich die vielen Einzelschritte von der Anmeldung in den verschiedenen Systemen bis hin zum Starten der Aufrufanlage zu merken.
Mit dem Aufruf der ersten »Ticketnummer« ging es dann richtig los: Den Namen der Person im System suchen, Daten öffnen, ein Passbild
* Fiktionsbescheinigung: vorläufiges Aufenthaltsrecht, während der Antrag noch geprüft wird AZR: Ausländerzentralregister, PIK-Station: Personalisierungsinfrastrukturkomponente
machen und die Fingerabdrücke nehmen … und da die Technik beim Fotografieren und Handabdruckscanner manchmal nicht so wollte wie wir, gab es mehrere Versuche bis es klappte. Bei einer Erstregistrierung wurde zudem noch ein weiterer Datensatz in einem anderen System angelegt. Nach Abschluss dieses Vorgangs wurde die Ticketinhaberin oder -inhaber dann an die nächste Stelle gebeten. Mit dem Aufrufen der nächsten Nummer ging der Vorgang von vorne los: Namen im System suchen, Daten öffnen oder neu eingeben, Fingerabdrücke
nehmen, Foto machen. Die nächste Hürde war die sprachliche. Meistens klappte es mit Englisch oder mit »Händen und Füßen« und einem Lächeln. Wenn die Kommunikation einmal so gar nicht klappen wollte, standen uns jederzeit versierte Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Seite. Alles in allem war es sehr interessant, einen, wenn auch nur kleinen, Einblick in die tägliche Arbeit dort zu erhalten und mit zu bekommen, was hier geleistet wird. Und das Gefühl Menschen geholfen zu haben, ist auch ein gutes.

»Nimm guten geriebenen Käse, und halb so viel Mehl, Eyer, so viel nöthig, mache einen Teig an, daß er sich mandeln lasse. Thue auch Muscatenblumen und ein wenig Salz darein. Mandele ihn auf einem Brete, daß er schön weiß werde, formiere ihn krumm, wie einen kleinen halben Mond, oder was du vor eine Forme daraus zu machen verlangest, backe es in geschmelzter Butter fein gelbe ab.«
Als Käsesorte wird Parmesan oder Rahmkäse empfohlen. Die Muskatblume kann durch geriebene Muskatnuss ersetzt werden.
Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!
17 AUTOR
DOKUMENTATION SAMMLUNG BACKSTAGE
Michael Stephan Leiter Zentrale Dokumentation
AUTORIN Sabrina Linnemann Dokumentation
Leipziger Koch-Buch, Susanna Eger, 1745, Sign: I O 547 Leipziger Koch-Buch, Susanna Eger, 1745, Sign: I O 547
Es hieß also putzen, putzen, putzen (…)
OBJEKTE UNTERWEGS
AUSSTELLUNGSSEKRETARIAT | LEIHVERKEHR

Aus und in aller Welt
Wie jährlich knapp 1.000 Objekte in Ausstellungen kommen
Was verbirgt sich wohl hinter einem Ausstellungssekretariat? Wird ein Sekretariat ausgestellt? Gibt es ein Sekretariat in der Ausstellung?

Weder … noch. In einigen Museen wird der Arbeitsbereich auch durch das englische Wort »Registrar« bezeichnet. Unabhängig vom Namen verbirgt sich dahinter die Betreuung des ein und ausgehenden Leihverkehrs.
Bei großen Namen der Kunstgeschichte, man denke da z. B. an Albrecht Dürer, Pablo Picasso oder Neo Rauch, kann sich jeder vorstellen, wie schwierig, aufwendig, teuer und teilweise auch unmöglich es ist, Leihgaben aus den Museen für eine Sonderausstellung zu erhalten. Aber auch abseits der großen Namen ist der Leihverkehr zwischen Museen, Sammlungen und Privatpersonen unverzichtbarer wie auch arbeits- und kostenintensiver Teil der musealen Arbeit.
Auch wenn sich die Abläufe bei allen Ausstellungen sehr ähneln, stellt uns jedes Projekt wieder vor neue Herausforderungen — sowohl inhaltlich als auch operativ, wie die besonderen Anforderungen der Objekte an Klima, Licht und Präsentation, ebenso die Transporte. Zugleich werden die museumseigenen Sammlungsobjekte auf ihre Ausstellungsfähigkeit geprüft, nach Bedarf gereinigt, kleinere und

größere Schäden behoben und schlussendlich in die Ausstellung eingebracht. Das ist immer eine Leistung des gesamten Ausstellungsteams!
Für mich ist das jedes Mal wieder ein spannender Prozess, bei dem ich am Ende stolz bin, ein kleines Stück zum Gelingen einer jeden Ausstellung beitragen zu können.
Die zweite große Säule meiner Tätigkeit ist die Steuerung des Leihverkehrs von Sammlungsobjekten aus unserem Bestand an andere Museen, Sammlungen und Institutionen. Insgesamt verzeichneten wir im Jahr 2022 weniger Anfragen als in den Vorjahren. Dies führen wir auf eine veränderte Ausstellungsplanung in Folge der Corona-Pandemie zurück.

Dennoch sind die Anfragen so unterschiedlich wie unsere Sammlungen selbst: Sie reichen von einer Porzellantasse über ein Plakat bis hin zu Gemälden oder einer Fotoserie. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass wir uns in Zeiten geringerer Ausleihen verstärkt um die eigene Sammlung kümmern (können). So wurden drei Porträtbüsten, die Gewandhausstühle und auch drei Gemälde zur Restaurierung gegeben. Auch die Digitalisierung der Bestände treiben wir stetig voran — es wurden fast 300 großformatige Stadtansichten an einen Dienstleister, der diese scannen kann, verliehen.
Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel
Die Welt mit Würfelaugen sehen! Gezeigt wurden etwa 300 Objekte der über 10.000 der Leipziger Privatsammlung von Jakob Gloger — eine reine Leihgabenaus-
stellung. Der kleinste Würfel hatte die Kantenlänge von fünf Millimetern und war aus Elfenbein, der größte war begehbar und vier Meter hoch.
POKALSIEG
AUSGESTELLT UND ANGESTAUNT.
Menschen, Technik, Traditionen auf der STIGA 1897
Die Intervention »störte« in der Ständigen Ausstellung »Moderne Zeiten« im Alten Rathaus und entstand in Kooperation mit der Projektgruppe zur DOAA Leipzig im


Rahmen des Themenjahres »STIGA 1897«. Bilder und Objekte suchten Kontraste zu den bekannten Stadtansichten.
Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg. Wagner und Mendelssohn in Leipzig. Eine Ausstellung mit dem Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig und Unterstützung des Richard-Wagner-Verband Leipzig e. V.: Die Studierenden setzten die Ergebnisse und Ideen aus einem vorrausgegangenem Seminar gemeinsam mit dem Museumsteam um und sammelten so beim Ausstellungsbau ganz praktische Erfahrungen. Daher
war die Einrichtung der Ausstellung auch etwas komplexer als gewöhnlich, da die Studierenden selbst gestalterisch tätig waren und Verschiedenes ausprobieren wollten. Im Ergebnis präsentierte sich eine wirklich gelungene Ausstellung mit rund 50 Exponaten zum Leben und Wirken der beiden großen Komponisten in der Stadt Leipzig.

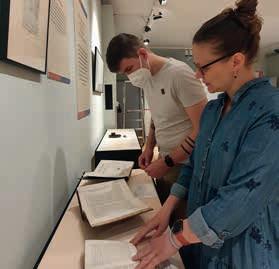
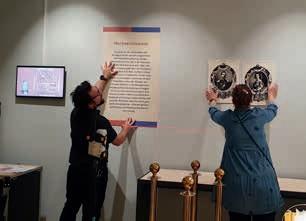

Am 5. Oktober 2022 erhielten wir für einen Tag die Siegertrophäe des DFB Pokals und damit goldenen Glanz in der Ehrenplatz-Ausstellung. Sonst meist nur aus der Ferne auf dem Bildschirm zu sehen, konnten die eingravierten Namen der Siegermannschaften im Fuße des Pokals in der Vitrine aus nächster Nähe bestaunt werden. Gewinner der 79. Auflage des Turniers und damit derzeitiger Inhaber des Wanderpokals ist RB Leipzig, der den goldenen Pokal für diesen einen Tag als Leihgabe an das Museum übergab.


Liebknecht
Marianne und Maja Liebknecht, die Enkelinnen von Karl Liebknecht, waren im September 2022 zum zweiten Mal zu Gast bei uns im Alten Rathaus. 2018 erhielten wir bereits ein Porträt, gemalt von Vater Robert Liebknecht als Leihgabe. Zwischenzeitlich konnte das Gemälde vom Museum angekauft werden und wurde aus diesem Anlass in der ständigen Ausstellung »Moderne Zeiten« im Alten Rathaus im Ausstellungsteil »Novemberrevolution« präsentiert. Das Gemälde ergänzt nun den vorhandenen »Liebknecht-Bestand«, bestehend aus einem Gehrock, einer Weste und einer Brille.

EHRENPLATZ. Eure Geschichten — Eure Schenkungen — Euer Sportmuseum!
Alle 70 Objekte der Ausstellung galt es zunächst aus dem Depot des Sportmuseums ins Haus Böttchergäßchen zu transportieren. Hier wurden sie vom Team Dokumentation fachmännisch auf der hauseigenen Fotostation fotografiert, auch eine wichtige Voraussetzung für die Begleitpublikation. Viele Sportarten werden durch unterschiedliches Objekt repräsentiert: Das schwerste war ein Fahrradergometer, das kleinste eine Anstecknadel vom Bundeskegeln 1929. Die umfang-

reichste Schenkung ist die Sammlung von knapp 9.000 Autogrammkarten. Die jüngsten Objekte waren zum einen Teil der Hygiene-Ausstattung bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo/Japan. Zum anderen handelt es sich um den Schläger des Ping Pong Weltmeisters 2021 Alexander »Flash« Flemming. Das vielleicht kurioseste Objekt ist das Paar Eislauf-Schlittschuhe, das vermutlich als Pfand in der Kneipe abgegeben wurde und nie wieder ausgelöst wurde.
SCHON GEWUSST
Leihgaben 2022
22 Verträge mit 585 Objekten an andere Museen, Institutionen bzw. zur wissenschaftlichen Bearbeitung oder Restaurierung und Digitalisierung
Leihnahmen 2022
16 Verträge mit 342 Objekten von anderen Museen, Institutionen oder Privatpersonen

18
AUTORIN Cathrin Orzschig Ausstellungssekretariat
Schicken Sie das historische Leipzig in die Welt! PostkartenBox Hermann Walter und sein Atelier gelten als wichtigste Bildchronisten der Stadt Leipzig im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. Wir besitzen mit etwa 5.500 Fotografien einen Großteil des Bildvermächtnisses – und hüten damit einen einzigartigen Schatz. In der Postkarten-Box befinden sich zehn einmalige schwarz/weiß-Ansichten von Leipziger Plätzen oder Gebäuden zwischen 1900 und 1934.
HEUTE SCHON GESHOPPT?
Ja ist denn schon Weihnachten?
Adventskalender
Traditionell festlich zelebriert, gehören Advent und Weihnachten zu Leipzig wie Bach, der Buchdruck und der Ballsport. In unserer Sammlung finden sich zahlreiche Ansichten der winterlichen Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zwischen Kälte, Kerzenschein, Eislauf und Markttreiben. Lassen Sie sich verzaubern von unseren alten und neuen Motiven und entdecken Sie hinter der Kulisse des Alten Rathauses täglich eine kleine Welt liebevoller Einblicke und Überraschungen!
MUSEUM IN BETRIEB
Ausstellungsfläche gesamt 4.100 m2 davon
> Altes Rathaus 2.800 m2
> Haus Böttchergäßchen 600 m2
> FORUM 1813 250 m2
> Museum zum Arabischen Coffe Baum 200 m2
> Schillerhaus 150 m2
> Kindermuseum 100 m2
www.stadtmuseum.leipzig.de
APSDatensätze gesamt
> Sammlungsdatenbank gesamt 401.031
> davon Objektdatenbank 342.287
> davon Literaturdatenbank 53.131
> davon Leipziger Opfer der Shoah 5.613
> Bilddatenbank Cumulus (Sammlungskatalog) 116.089
Museumsverbände & Mitgliedschaften
ICOM Deutschland, Deutscher Museumsbund, Sächsische
Landesstelle für Museumswesen, Sächsischer Museumsbund e. V., Bundesverband Museumspädagogik e. V., Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e. V.
FAKTEN & ZAHLEN
Bibliothek Bibliotheksbestand (digitalisiert) 53.131
Fotothek
Fototheksbestand (digitalisiert) 86.306
Personalstellen
Mitarbeitende 36
davon
> 31 festangestellte Mitarbeiter/-innen
> 3 Volontäre/-innen
> 2 Bundesfreiwilligendienstler
NETZWERK
men, Notenspur Leipzig e. V., Richard-Wagner-Verband Leipzig e. V., SACHSEN.DIGITAL — Geschäftsstelle Digitale Bibliothek der SLUB Dresden, Schaubühne Lindenfels gAG, Schillerverein Leipzig e. V., Schillerhaus Rudolstadt, Theater der Jungen Welt, Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813 e. V.
13,50 €, im Alten Rathaus Leipzig erhältlich
9,50 €, im Alten Rathaus Leipzig erhältlich
BÜCHER LESEN LOHNT
Leipzig in Schwarz Lang ersehnt und heiß erwartet! Das 2016 anlässlich des 25. WGT-Jubiläums herausgegebene Buch, damals nach wenigen Tagen vergriffen, ist nun wieder mit erweiterten Texten und ergänzten Bildern erhältlich. Im Buch werden nicht nur die Hoch- und Tiefphasen des WaveGotik-Treffen beleuchtet, sondern auch szenerelevante Randbereiche unter die
HAKENKREUZ UND NOTENSCHLÜSSEL. Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus
ISBN 978-3-98753-004-3 14,80 €
ProgrammTipps
Lupe genommen. Zahlreiche Interviews, mannigfaltige Fotos, Comics oder auch ein Styleguide geben Einblicke in die doch so bunte Welt der »schwarzen
Szene«.
Leipzig in Schwarz | 19,95 €
Tipp: Lesung & Podiumsgespräch, So. 28. Mai, 14 Uhr, Alte Börse, 2 €
… oder kann das weg? Napoleons
Nachttopf, Ulbrichts Küchenstuhl und das Taufkleid von Tante Marta: Zwischen Alltag und Aura oder Warum sammeln Geschichtsmuseen?
ISBN 978-3-910034-86-0 | 8,50 €
KLANGPAUSE — Mittagskonzert freitags, 12.30 Uhr, Altes Rathaus, 3,50 € Anmeldung stadtmuseum@leipzig.de
VOM MUSEUMSDIREKTOR GEFÜHRT
Jeden 1. Mittwoch im Monat, Altes Rathaus Kostenfreier Eintritt und Führung, Anmeldung stadtmuseum@leipzig.de
REVOLUTIONÄRER STADTRUNDGANG.
Rebellen und Reformer. Menschen und Meinungen 1848
Fr 17.3. 16 Uhr, Do 11.5. 16 Uhr, Do 1.6. 16 Uhr,
So 25.6. 11 Uhr, Treff Altes Rathaus 1. OG, 2 € zzgl. Eintritt Anmeldung stadtmuseum@leipzig.de
Ausstellungen
HAKENKREUZ UND NOTENSCHLÜSSEL. Die Musikstadt Leipzig im National
sozialismus
27.1.2023 20.8.2023
Leseland DDR
15.3. 18.6.2023 | Studioausstellung in Koop. Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur
BACHPARCOURS
Sommer 2023 | Intervention in der ständigen Ausstellung im Alten Rathaus Leipzig
Im Rahmen des Themenjahres 2023
Jahrbuch für Leipziger Stadtgeschichte. 2. Band. Leipzig 2022.
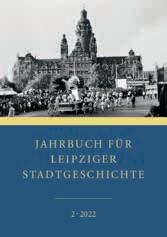
ISBN: 978-3-96023-505-7 30,00€
AUSBLICK
»Leipzig — Die ganze Stadt als Bühne« in Kooperation mit dem Bacharchiv Leipzig.
»Anmut sparet nicht noch Mühe« Der Komponist Hanns Eisler
7.7. 15.10.2023 | Studioausstellung in Koop. mit der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft e. V., Berlin
Tiefen/Lichter. Bildgedächtnis einer Stadt. 30+3 Jahre Leipziger Fotoagentur
punctum
13.9.2023 25.2.2024
FARBENFROHE WEIHNACHTSFREU(N)DE.
Krakauer Krippen zu Besuch in Leipzig
28.11.2023 Februar 2024 | Ausstellung im Festsaal Altes Rathaus | Im Rahmen von 50 Jahre Städtepartnerschaft LeipzigKrakau in Koop. mit dem Historischen Museum Krakau und Referat Internationales der Stadt Leipzig
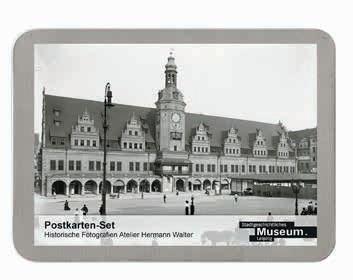
Publikationen
»HAKENKREUZ UND NOTENSCHLÜSSEL.
Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus«, »Tiefen/Lichter. Bildgedächtnis einer Stadt. 30+3 Jahre Leipziger Fotoagentur punctum«, Leipzig in Schwarz, Jahrbuch für Leipziger Stadtgeschichte (in Koop. Geschichtsverein Leipzig e. V. und Stadtarchiv Leipzig)
Fördervereine & Freundeskreise
Hieronymus-Lotter-Gesellschaft, Förderverein des Völkerschlachtdenkmals, Förderverein Sächsisches
Sportmuseum
Kooperationen, Partnerschaften und Projekte
Ahoi — Das Stadtmagazin für Leipzig und Region, Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V., Ariowitschhaus e. V., Blinden und Sehbehinderten Verband Sachsen e. V. Kreisorganisation Leipzig-Stadt (BSVS e. V.), BSG Chemie
Leipzig e. V., Bürgerverein Gohlis e. V., Büro für Leichte Sprache Lebenshilfe Sachsen e. V., Deutsche SchillerGesellschaft, Gedok Mitteldeutschland e. V., Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung (SbR), Gedenkstätte Zwangsarbeit in Leipzig, Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig (HMT), Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Hochschule für Grafik & Buchkunst Leipzig (HGB), Historisches Museum der Stadt Krakau, Institut für Musikwissenschaft
— Universität Leipzig, Kulturstiftung Leipzig, LeibnizInstitut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) e. V., Leipziger Capa-Haus, Leipziger Geschichtsverein e. V., Mühlstraße 14 e. V. // Unterwegs & angekom-
Drittmittel & Förderer
Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Holger KoppeStiftung, Kulturstiftung der Länder, Sächsische Aufbaubank (SAB), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, Stadt Leipzig
Arbeitskreise & Fachgruppen
AK Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Museumsbundes, AK Provenienzforschung e. V., AG Provenienzforschung in Sachsen, AG Gedenktage Stadt Leipzig, AK Volontariat Mitteldeutschland, AG Tag der Stadtgeschichte, Mitglied im Beirat »Leipziger Blätter«, AG »Kulturelle Bildung« Stadt Leipzig, FriedrichGustav-Klemm-Gesellschaft für Kulturgeschichte und Freilichtmuseen e. V., AG Jüdische Wochen Leipzig, AG Gohliser Schlösschen, AG Museumsnacht Halle/Leipzig, FG Geschichtsmuseen im Deutschen Museumsbund AK Ausstellungen im Deutschen Museumsbund
Bürgerschaftliche Beteiligung
Publikumsbeirat am Stadtgeschichtlichen Museum (Pilotphase von von November 2020 bis Oktober 2022, Wiederaufnahme geplant für März/April 2023)
Publikationen
»Die Welt als Würfel – 5000 Jahre Glück im Spiel«, »Vergessene Rück(an)sichten. Provenienzforschung am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig«, Jahrbuch für Stadtgeschichte (in Koop. Geschichtsverein Leipzig e. V. und Stadtarchiv Leipzig)
Sammlungsneuzugänge
> 1.186 Objekte, darunter 129 Schenkungen und 30 Ankäufe
Dokumentation
> APS-Datenbank-Zugriffe 2.774.040 von 11.666 Usern
> Benutzeranfragen 1.735
> Gäste Bibliothek 273
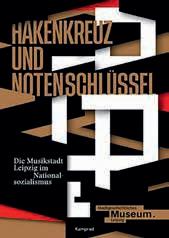
»museum on tour«
Ausstellungen
HELD ODER HASSFIGUR? Der Leipziger Liebknecht
Bis 30.1.2022 | Studioausstellung im Rahmen des Themenjahres 2021 »Leipzig — Stadt der sozialen Bewegungen«
Schnee von gestern? Die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig | Bis 27.2.2022
»Nie bring’ dich der Verdienst um das Verdienst«.
Die Leipziger Familie Küstner
23.2. 29.5.2022 | Studioausstellung
Die Welt als Würfel — 5000 Jahre Glück im Spiel
13.4. 23.10.2022
Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg.
Wagner und Mendelssohn in Leipzig

15.6. 4.9.2022 | Studioausstellung in Kooperation mit der Universität Leipzig, Musikwissenschaft
AUSGESTELLT UND ANGESTAUNT.
Menschen, Technik, Traditionen auf der STIGA 1897
6.7. 31.10.2022 | Intervention ALTES RATHAUS
EHRENPLATZ. Eure Geschichten — Eure Schenkungen —
Euer Sportmuseum! | 21.9.2022 — 26.2.2023
Studioausstellung des Sportmuseums Leipzig
> 56 Teilnahmen bei Stadt(teil)festen, Stadtrundgängen, Radtouren & Begegnungen außerhalb der Museumsräume mit insgesamt 7.385 Gästen.
Bildung & Vermittlung
> 360 (Ferien-)Programme, öffentliche & gebuchte Führungen, Workshops Haus Böttchergäßchen, Rathaus, Schillerhaus mit insgesamt 5.830 Gästen
Begleitprogramme & Veranstaltungen
> 97 u. a. Ausstellungseröffnungen, Vorträge, Lesungen, Podiumsgespräche, Museumsnacht & Schillerhaus Programm mit 9.735 Gästen
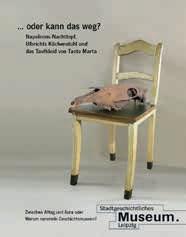
Dank
Für die Verstärkung des MuseumsTeams bis und in 2022:
Volontariat: Nadine Gerth (Öffentlichkeitsarbeit), Sebastian Krötzsch (Dokumentation) | Bundesfreiwilligendienst: Janne Duda (Bibliothek/Fotothek), Clara Wübbeke (Bildung & Vermittlung) | Projektunterstützung: Jan Sadler (MXM Museum Ex Machina), Till Umbach (Barnet Licht) | Praktikum: Anton Boxhammer, Frank Damm, Antonia Gerber, Jessica Kottas, Friederike Klose, Alexander Ling, Lena Antonia Müller, Lenka Nenke, Celina Papendorf, Sarah Reinhardt, Jasper Zunkel


19 AUTORIN Katja Etzold | Presse und Öffentlichkeitsarbeit
SHOP | ZAHLEN & FAKTEN | NETZWERK | RÜCKBLICK | AUSBLICK
RÜCKBLICK
Besuchszahlen 2022 2021 SGM gesamt 419.511 216.545 davon Altes Rathaus 34.979 6.248 Haus Böttchergäßchen 17.146 8.107 Völkerschlachtdenkmal 253.876 144.623 FORUM 1813 88.769 47.735 Schillerhaus 3.756 2.978 Sportmuseum 2 27 Alte Börse 18.598 6.802 Museum zum Arabischen 0 25 Coffe Baum Outreach 7.385 0
AUTORIN Ann-Kathrin Reichenbach Marketing
In english please — Gamification geht weiter



Alte Räume, neue Gäste
Vermittlung in der ständigen Ausstellung im Alten Rathaus, Kindermuseum und Schillerhaus
Die MXM-App (Museum Ex Machina), dank der sich die Ausstellung »Moderne Zeiten« im Alten Rathaus per Augmented Reality spielerisch erkunden lässt, hat eine kleine aber entscheidende Erweiterung erhalten: Auch englischsprachige Gäste begegnen nun Robert Blum, Julie Bebel oder Bruno Vogel digital! Das macht die App passend zu ihrem technischen Innovationsanspruch ein kleines Stück internationaler; weitere Sprachen nicht ausgeschlossen … Wir danken dem gesamten Projektteam für die gelungene Umsetzung!



PS: Gratulation! 2022 gab es für die MXM-App den #GIAS22 Games Innovation Award Saxony 2022 in der Kategorie »Beste Gamification« für die Macher rund um OVRLAB, VR-Bits, Miracode & Co.
NACHGESCHAUT
mxm-leipzig.de
Lieber Anders — Sub und Jugendkulturen in DDR und Wende

Im brandneuen Vermittlungsangebot »Lieber Anders« (nicht nur) für Schulklassen, werden unterschiedliche Jugend- und Subkulturen in der DDR behandelt. Im Fokus des in der Dauerausstellung »Moderne Zeiten« stattfindenden zweistündigen Programms steht das Kennenlernen der Jugendpolitik, der Repressionsorgane und der Opposition in der DDR durch den Blickwinkel von Gruftis, Punks, Skinheads, Kundinnen und Kunden und der HomosexuellenCommunity. Das Herzstück sind hierbei aussagekräftige Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Leipzig.
Das Jahr 2022 stand bei uns ganz im Zeichen unserer »guten Stube«: nach einer langen Renovierungsphase erstrahlen die historischen Räume des Alten Rathauses endlich in neuem Glanz und wurden eifrig von uns und Ihnen, den Gästen, erkundet.
Neben den klassischen Führungen für Jung und Alt wurden beispielsweise kunstvolle Fächer von den Gästen des Wave-Gotik-Treffen (WGT) gestaltet. Besonderer Beliebtheit erfreute sich auch unsere Weihnachtsführung, bei der die Gäste nicht nur spannende Anekdoten rund um das beliebte Fest und seine Leipziger Traditionen erfuhren, sondern auch den Weihnachtsmarkt vom Rathausbalkon bestaunen konnten. Auch in Zukunft bleiben die prächtigen Räume eine unserer Hauptspielstätten — vor allem für Familien haben wir spannende Veranstaltungen in petto.
An geflüchtete Familien aus der Ukraine richtete sich unser Angebot »Meet and Play«. Damit konnten wir Menschen, die vor dem Angriffskrieg in der Ukraine geflohen waren, einen Ort für Muße, insbesondere aber auch gegenseitiges Kennenlernen, ermöglichen. In einem offenen und kostenfreien Angebot probierten die
Kinder verschiedene Bastel- und Gestaltungsaktionen im Kindermuseum aus. Eine junge, selbst geflüchtete Ukrainerin unterstützte uns auf Honorarbasis bei zwei Terminen und übersetzte zudem Thementexte der Sonderausstellung »Die Welt als Würfel«.
Aktuelle politische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft agil und flexibel in die Arbeit zu integrieren ist und bleibt für unsere Abteilung eine der wichtigsten Aufgaben.
Aus diesem Grund ist das Thema Postkolonialismus ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda. Die Frage nach den Ursprüngen und Auswirkungen kolonialistischer Praktiken ist nicht nur eines der brennendsten
Zwischen »Hakenkreuz und Notenschlüssel«
Vermittlungsprogramm zur Sonderausstellung

Mit der »Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus« beleuchten wir bis zum 20. August 2023 ein eher fachspezifisches Thema, das jedoch große Relevanz für uns alle besitzt.
Themen im aktuellen musealen Fachdiskurs, sondern beschäftigt zunehmend auch die breitere Stadtgesellschaft. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Migrantenbeirats der Stadt Leipzig werfen wir kritische Blicke auf unsere Ausstellungen, um Schritt für Schritt notwendige Perspektivwechsel einzubinden. Nach ersten konkreten Maßnahmen im Kindermuseum wird diese Zusammenarbeit auch 2023 fortgeführt und innerhalb des Museums bildet sich eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe für diese umfangreiche Aufgabe.

Um einen Perspektivwechsel geht es auch in einem für 2023 neu geplanten Format. In Willkommensführungen für Menschen, die neu in Leipzig angekommen sind, werden die Stadt und ihre Geschichte leicht zugänglich in verschiedenen Sprachen vorgestellt.
Das Thema Sprache beschäftigte uns 2022 in besonderem Maße. Gefördert
durch die Sächsische Landesstelle für Museumswesen konnten wir das Büro für Leichte Sprache — Lebenshilfe Sachsen e. V. als kompetente Partner für die Umsetzung eines Projektes gewinnen. In einem mehrstufigen Prozess bildeten wir uns intern zum Thema »Einfache Sprache« weiter und entwickelten in enger Zusammenarbeit mit Testgruppen Führungen zu den wichtigsten Themen im Alten Rathaus: Festsaal und Ratsstube im Überblick, Mittelalter, NSZeit und DDR-Zeit. Diese können ab sofort gebucht werden.


Ebenfalls neu im Programm sind Führungen zum Thema »Leipzig im Mittelalter« und den sozialen Bewegungen des 19. und frühen 20. Jh. Gruseln geht immer — der neu aufgelegte Führungs-Klassiker »Leipzig von unten« erfreute sich so großer Beliebtheit, dass wir die enorme Nachfrage nicht vollständig bedienen konnten. Immerhin mehr als 400 Kinder und Erwachsene erkundeten mit uns die unterirdischen Geheimnisse der Stadt und trauten sich in die Kellerräume des Alten und Neuen Rathaus. Eine Fortsetzung des beliebten Ferienangebots ist für Sommer 2023 geplant.
Erkunden Sie mit uns die Geschichte(n) der Stadt!
Als Zuwachs im Museum konnten wir im Sommer 2022 wieder einen engagierten jungen Abiturienten als Bundesfreiwilligen willkommen heißen. Bereits nach kurzer Zeit erweist sich Nathan Wild als große Bereicherung für unser kleines Team. Eines seiner Hauptprojekte bildet die Unterstützung bei der Konzeption neuer Vermittlungsangebote im Schillerhaus. Mit Blick auf die neugestaltete Dauerausstellung unterziehen wir auch hier die Schulprogramme einer Neukonzeption und werden Schiller stärker in die Lebenswelt von Jugendlichen holen. Dazu gehört beispielsweise eine digitale Stadtteilrallye durch das alte Gohlis.
Ob analog oder digital — lassen Sie uns also in Kontakt bleiben!
Für Fragen und Buchungen: vermittlung.stadtmuseum@leipzig.de
Um möglichst vielen Gästen einen Zugang zur Ausstellung zu ermöglichen, steht Ihnen ein breit gefächertes Vermittlungsprogramm zur Verfügung. Mit Stadtspaziergängen und Radtouren gehen wir auch außerhalb unserer »vier Wände« auf Spurensuche im Stadtraum. Zudem bietet eine Kombi-Führung mit dem
Musikinstrumentenmuseum Leipzig die Gelegenheit, einen Blick in beide Ausstellungen zu werfen. Für Schulklassen ab der Oberstufe gibt es ebenfalls speziell konzipierte Angebote.
ANGEBOT IM ÜBERBLICK & BUCHUNGEN
vermittlung.stadtmuseum@leipzig.de
20
PÄDAGOGIK & KULTURELLE BILDUNG AUTORIN Annemarie Riemer Bildung & Vermittlung AUTORIN Eva Lusch Bildung & Vermittlung
VERMITTLUNG
Projektgruppe und Vermittlungsangebot »Einfache Sprache« im Alten Rathaus
Mit Augmented Reality Vergangenheit im Hier und Jetzt erleben
Kunden und Kundinnen am Leipziger Hauptbahnhof auf dem Weg zu einer Blues-Fete im Umland, Oktober 1973, Schenkung Reinhard »Willi« Wild.
»Meet & Play« im Kindermuseum
Vermittlungsangebote zu verschiedensten Themen der Stadtgeschichte und für unterschiedliche Altersgruppen, hier im Alten Rathaus
Besuch und Gespräch in der Sonderausstellung »Hakenkreuz und Notenschlüssel« (bis 20.8.2023)
SCHON GEWUSST
Schon zu Friedrich Schillers Zeiten waren Fächer ein beliebtes Mode- und Flirt-Accessoire bürgerlicher Damen, wie das ausgestellte Exemplar im Schillerhaus zeigt. Dieser stammt aus dem Besitz von Rahel Johanna Erckel, einer Cousine Christian Gottfried Körners. Die Rückseite nutzte sie als Stammbuch, in dem sich
Gefächert
… sieben feine Unterschiede
Dieser Fächer im japanischen Stil aus dem Jahr 1888 stammt aus unserer Sammlung. Er wurde anlässlich der Hochzeit von Clothilde Limburger und Hermann Tauchnitz bedruckt. Auf der einen Seite mit Naturmotiv, auf der anderen Seite mit einem sechsstrophigen TafelLied zu Ehren des Brautpaars. Vermutlich erhielt jeder Gast einen solchen Fächer als »give-away« zum Mitsingen. Fächer sind in Zeiten heißer werdender Sommer ein Accessoire mit großem ComebackPotential.


Götterfunken
… für zündende Antworten!
Hochzeitsfächer, Papier mit Bambusgerüst, 1888, Inv.-Nr.: V/773/2002
SCHILLERGARTEN VORGEMERKT!
Di 9.5., 14 Uhr
Schiller zum Gedenken — Spaziergang zu SchillerOrten in Gohlis | Anlässlich Schillers Todestag. Treffpunkt am Schillerhaus. Dauer 1,5 h Führung 2 € zzgl. Eintritt
Fr 2.6., 18 Uhr

Heinrich Heine: Atta Troll Papiertheater und Lieder zur Hakenharfe mit Ulrike Richter
Eintritt 10 €, ermäßigt 8 €
Fr 23.6., 19 Uhr
Improvisationstheater mit »Uschis Erben« | Unterhaltsamen Theaterabend ohne Drehbuch.
Eintritt 10 €, ermäßigt 8 €
Anmeldung erforderlich Tel. 0341/5662170 Email schillerhaus-leipzig@leipzig.de
Sa 8.7., 18 Uhr
SCHILLER. Der Dichtung muntre Schattenwelt Gedichte und Auszüge aus Schillers Dramen und Briefen vorgetragen von Cora Chilcott. Eintritt 10 €, ermäßigt 8 €
So 9.7., 16 Uhr
»Dieses Glas dem guten Geist« Kurzweilige Führung und Weinprobe mit Museumsdirektor Dr. Anselm Hartinger und Franziska Jenrich-Tran.
Eintritt 15 € (inkl. Verkostung), Anmeldung erbeten bis 3.7.
Sa 16.9., 16.30 Uhr und 19 Uhr Wilhelm Jacoby und Carl Laufs: »Pension Schöller« | Freilufttheater mit dem TheaterPACK Eintritt 20 €, ermäßigt 15 €
① Welcher Park befand sich früher zwischen der Stadt Leipzig und dem Dorf Gohlis?
② In welchem Leipziger Schloss soll Schiller Gast gewesen sein?
③ Wie hieß Schillers Freund und Gönner Körner mit zweitem Namen?
④ Welcher Verein initiierte die ersten Schiller-Feiern in Leipzig?
⑤ Wie lautet der Titel der neuen Dauerausstellung im Schillerhaus?

⑥ Welche Person war maßgeblich an der Erhaltung des Schiller-
hauses als Literaturgedenkstätte beteiligt?
⑦ Als was diente das Schillerhaus vor seiner Funktion als Literaturgedenkstätte?
⑧ Wie heißt Schillers viertes Drama, das teilweise in Gohlis entstand?

⑨ Die Steinfigur welcher Muse zierte einst den Schillerhain, der in unmittelbarer Nähe zum Schillerhaus liegt?
Wie war der Nachname des Bauern, bei dem Schiller wohnte?
Wie war der Nachname des Mitbewohners Schillers?
Welchen Gegenstand musste ein Bauernjunge Schiller bei seinen frühmorgendlichen Ausflügen hinterhertragen?
21 UNTERHALTUNG MUSEUM MACHT SPASS AUTOR Nathan Wild Bundesfreiwilligendienst Bildung & Vermittlung AUTORIN
▼8 ▼12 3 5 11 ►2 ►10 6 9 7 1 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 14 13 7 11 5 12 10 6 8 4 1
Franziska Jenrich-Tran Bildung & Vermittlung Koordination Schillerhaus
Faltfächer, um 1790, Inv.-Nr.: XXVII/32
29. Apr.: Neuer Glanz für alte Gemäuer – Die »gute Stube« der Stadt wird wiedereröffnet: Dr. Skadi Jennicke (Kulturbürgermeisterin), Dr. Anselm Hartinger, Burkhard Jung (Oberbürgermeister der Stadt Leipzig), Ulrike Dura und Dr. Maike Günther (Museum) sowie Dr. Ansgar Scholz (Kulturamt der Stadt Leipzig) (v. l.).


1. Mai: Unbedingt mit Trompeten … auf historischen Instrumenten vom Balkon des Alten Rathaus! Wiedereröffnung der historischen Etage mit dem Trompetenduo Jürgen Hartmann.

IMPRESSUM
Herausgegeben und Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RSTV: Stadt Leipzig, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser endvertreten durch den Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, Dr. Anselm Hartinger
12. Dez.: EHRENPLATZ! Zweifacher Paralympics-Sieger Martin Schulz im Paratriathlon nimmt im Alten Rathaus Leipzig seine Schenkung unter die Lupe.
14. Juni: Open Air und sehr gesellig — und im Zeichen von Wagner & Mendelssohn – war auch die Eröffnung der Ausstellung »Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg«.
12. Juli: Dobry dzien! Besuch in der Partnerstadt und unserem Partnermuseum Krakau — da wurde am runden Tisch mit Direktor Michal Niezabitowski per Handschlag das ein oder andere gemeinsame Ausstellungsvorhaben beschlossen.


12. Apr.: Da ging der Punk ab — Die Eröffnungs»party« der Würfelausstellung im Museums-Carré war durch die Band SPIELO ein wirklicher Kracher.
3. Mai: 16 Plakate gegen den Krieg präsentierte plakat-sozial e. V. nach langer Vorbereitung und Überwindung einiger bürokratischer Hindernisse an der Fassade des ehemaligen Leipziger Schwimmstadions.
18. Sept.: And the ›oscar‹ goes to ... Die Gewinnerin der Deutschen Kniffel-Meisterschaft 2022 kommt aus Erfurt. Tina Göltzner (Mitte) holte sich den Titel. Das freute ebenso Schmidt Spiele GmbH, den Würfelsammler Jakob Gloger und natürlich das Museum.

2. Apr.: Wasser marsch! Trinkwasser per Knopfdruck gibt es jetzt kostenfrei dank der Unterstützung der Leipziger Wasserwerke; hier mit Mario Hoff (Leiter des Unternehmensbereichs Markt) am »Völki«.
17. Juni: Wichtige Memorabilien für sporthistorische Sammlung erhalten!

RB Leipzig Vorstandsmitglied Ulrich

Wolter übergibt uns ein von der Mannschaft unterschriebenes Fan-Shirt anlässlich des DFB Pokalsiegs 2022.
Autoren & Mitwirkende: Dr. Anselm Hartinger (Direktor) Juri Bergmann (Volontär Dokumentation), Julius Brandt (Praktikant Dokumentation), Robert Brückner (Technischer Dienst), Friederike Degner (Fotothek), Ulrike Dura (Kuratorin Kunstgeschichte, Stellvertretende Direktorin), Katja Etzold (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Lina Frubrich (Provenienzforschung), Andre Gloger (Technischer Dienst), Ulrike Gühne (Sekretariat), Dr. Maike Günther (Kuratorin Stadt- und Landesgeschichte bis 1800), Steffi Heiland-Steinbrecher (Verwaltung), Robert Heinzig (Vermietung und Veranstaltungsmanagement), Franziska JenrichTran (Bildung und Vermittlung/Koordination Schillerhaus), Marko Kuhn (Leiter Bibliothek), Sabrina Linnemann (Zentrale Dokumentation), Eva Lusch (Bildung und Vermittlung), Ida Mahlburg (Volontärin Öffentlichkeitsarbeit), Wolfgang Metz (Sportmuseum), Carl Philipp Nies (Referent für Museumsentwicklung und bürgerschaftliche Beteiligung), Jana Nietzschmann (Leiterin Verwaltung), Cathrin Orzschig (Ausstellungssekretariat), Steffen Poser (Leiter Völkerschlachtdenkmal/FORUM 1813, Kurator Militaria und Numismatik), Andreas Presch (Leiter Technischer Dienst), Ann-Kathrin Reichenbach (Marketing), Annemarie Riemer (Bildung und Vermittlung), Tim Rood (Wissenschaftlicher Volontär Direktion & Vermittlung), Dr. Johanna Sänger (Kuratorin Stadt- und Landesgeschichte ab 1800), Petra Schürer (Verwaltung), Dietmar Schulze (Sportmuseum), Ines Seefeld (Papierwerkstatt), Kerstin Sieblist (Kuratorin Musik- und Theatergeschichte), Michael Stephan (Leiter Zentrale Dokumentation), Thomas Teichmann (Technischer Dienst), Nathan Wild (Bundesfreiwilligendienst Bildung und Vermittlung), Aiko Wulff (Leiter Sportmuseum)
Redaktion: Katja Etzold Text und Bildredaktion & Lektorat: Katja Etzold, Ann-Kathrin Reichenbach
Layout & Satz: makena plangrafik, Leipzig
Druck: Presse-Druck- und Verlagshaus-GmbH pd, Augsburg
Erscheint 1 x im Jahr, 5.000 Auflage
Fotonachweis:

Wenn nicht anders angegeben © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
Kontakt:
Capa-Haus: In Gedenken an den tragischen Tod des US-Soldaten Raymond J. Bowman am 18. April 1945, der von Robert Capa in seinen weltberühmten Fotos festgehalten wurde.
24. Feb.: Vorm Alten Rathaus — Mehr als 5.000 Menschen haben ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Viele Menschen hielten Lichter oder Schilder hoch, auf denen unter anderem »Hände weg von der Ukraine« und »Putin endlich Grenzen setzen« stand.


7. Sept.: Alle Jahre wieder … kommt der schöne »Historische Leipzig-Kalender« der LTM, hier mit Marit Schulz, mit Fotografien aus unserer Sammlung – dieses Mal aus den 1960er und 1970er Jahren, v. a. aus dem Bestand PGH Fotostudio Leipzig.
22. Okt.: Wir sind uns der angespannten Energielage bewusst und haben dafür intelligente und sogar zum Mittun einladende Lösungen gefunden … Um ein Zeichen für Frieden in der Welt zu setzen versammelten sich mehrere tausend Gäste. Eine Aktion des OUTSIDE-Festivals gemeinsam mit der Stiftung Völkerschlachtdenkmal.
Das MXM-Team sorgt mit Augmented Reality für »Moderne Zeiten« im Alten Rathaus: Jennifer Krebs, René Reinhardt und Clémentine Harpagès (Schaubühne Lindenfels), Frank Just (miracode), Nicole Laux (OVRLAB), Jan Sadler (Projektorganisation), Carl Philipp Nies und Eva Lusch (Stadtgeschichtliches Museum) (v. l.).


Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Einrichtung der Stadt Leipzig Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig
Folgen Sie uns: www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/blog www.facebook.com/stadtgeschichtlichesmuseumleipzig

Service: Tel.: 0341/9651340
Fax: 0341/9651352 stadtmuseum@leipzig.de
Redaktion:
Katja Etzold Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0341/9651320 katja.etzold@leipzig.de
»LPZ-GAST-WEB« kostenfreies WLAN
9. Mai: Man muss nicht immer Erster sein! Wir freuten uns überaus, den 3. Platz beim Tourismuspreis 2021, hier mit Volker Bremer (Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH), zu erhalten. Foto: Alexander Schmidt.


2. Jul.: Lasst die Spiele beginnen! Ostdeutsche Mensch ärgere dich nicht-Meisterschaft mit Forum-Spiel und Schmidt Spiele GmbH im Museums-Carré; Gewinner Vitaliy Ponomarenko mit seinen Kindern bei der Preisübergabe (rechts).

5. Feb.: Andenken in Ehren: Markus Wildhagen (Bares für Rares) bringt zusammen mit Unterstützung des Leipzigers Jörg Schwerdtner das Lebenswerk des Olympia-Sportlers Günther Meinel ins Museum. Foto: Dirk Dießel

6. Dez.: Sehr gefreut! Nach einer PopUp-Audio-Ausstellung »Leipzig, hör zu!« des Mühlstraße 14 e. V. übergab uns das Projektteam für unsere Sammlung die Objekte, in dem Fall 35 Audiointerviews mit Leipzigerinnen und Leipzigern zu ihren Lieblingsorten.
Wir sind am Netz: Im Alten Rathaus, der Alten Börse, im Haus Böttchergäßchen sowie im Schillerhaus können Gäste, also auch Sie, die digitalen Angebote des Museums jetzt auch mit dem kostenfreien »LPZ-Gast-Web« beim Besuch nutzen.

MUSEUMSARBEIT UNTERSTÜTZEN
Förderverein Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e. V.
Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig
Tel.: 0341/4969360 info@lotter-gesellschaft.de lotter-gesellschaft.de

Förderverein Sächsisches Sportmuseum Leipzig e. V.
Am Sportforum 3 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341/99991089
Fax: 0341/99995175 foerderverein@sportmuseum-leipzig.de foerderverein.sportmuseum-leipzig.de
Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V.
29. Nov.: Ein Dank an Dr. Michael Jaenisch (Mitte) — für einen neuen Baum (Dr. Volker Rodekamp gewidmet) in der Lindenallee am Völkerschlachtdenkmal; hier mit der »Projektgruppe Völki« Sven Baum, Dr. Volker Rodekamp, Andreas Fröhlich, Steffen Poser, Dr. Anselm Hartinger, Klaus-Michael Rohrwacher, Katrin Nobis & Karl Hartl (v. l.).




22. Feb.: Eine Ausstellung zur eigenen Familiengeschichte – »Nie bring‘ Dich der Verdienst um das Verdienst«, hier mit Maik & Julia Opallach sowie Petra & Hans Küstner (v. l.), machte dies möglich.
Magazingasse 4 | 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9618538
Fax: 0341/9618540 kontakt@voelkerschlachtdenkmal.de voelkerschlachtdenkmal.de
22
AUTORIN Katja Etzold | Presse und Öffentlichkeitsarbeit BOULEVARD ÜBER KLEINE UND GRO ß E EREIGNISSE
22. Juni: Vor dem Start oder bereits am Ziel? Wir versuchen immer eine gute Figur (beim Sport) zu machen; hier die Aktiven beim Firmenlauf.
Via Vergangenheit im Gespräch mit der Zukunft
MuZe machts’ möglich!
Mit längst verstorbenen Geistesgrößen ins Gespräch kommen oder verstaubte Steinwüsten zum Sprechen bringen? Was in zweihundert Jahren Museumspraxis (fast) nie möglich wurde, ist nun Dr. M, dem investigativen Chefreporter der MuZe gelungen. Überwinden Sie mit uns
die Grenzen von Zeit und Raum und lesen Sie das exklusive unzensierte Interview mit Johann Sebastian Bach, Robert Blum und dem Matthäikirchhof über historische Erblasten, museale Aufgaben und Leipziger Zukunftsthemen der nächsten Zeit!
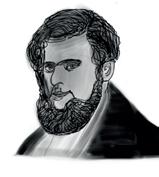
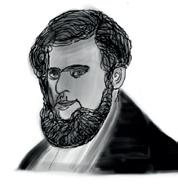
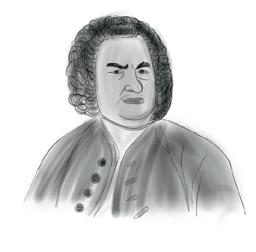
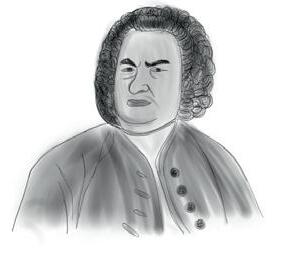
los ist hier ja grade nicht, oder?
Matthäikirchhof: Nein, immer noch tote Hose – ich hab aber auch schon eine Menge einstecken müssen. Der schreckliche Krieg und die Bomben, dann die Amis mit ihren Panzern und die Russen mit dem Panjewagen – und dann erst noch diese Typen mit Kunstlederjacke und Aktentasche. Welch ein Abstieg, nach den charismatischen Mönchen mit ihren schicken Kutten … Aber jetzt geht’s hier langsam los, jede Woche kommt jemand vorbei, und plant irgendwas …
5 Dr. M: Der Kirchhof war schon immer hier, oder?
Matthäikirchhof: Also, ich bin sicher der älteste hier (lacht) Oder sagt man jetzt – die älteste? Ich bin ja geschlechterübergreifend, mit meinen diversen Geschichten … Na, jedenfalls hat hier alles angefangen, als der zauselige Bischof nebenan in der Burg gestorben ist. Hätt ich mir nicht träumen lassen, was da mal draus wird. Der Küas hat ja jeden Stein hier umgedreht, in den 50ern und mir die ganzen
Scherben und Profile aus dem Bauch gegraben. Ein ganzer Museumskeller soll noch voll mit den Kisten sein – dabei hat man das Zeugs vorher extra weggeworfen. Aber jetzt soll es ja ein Schaufenster Stadtwerdung geben, und sogar ein Forum, wie bei den römischen Kaisern. Dem Bach seine Familie hat übrigens bei mir gewohnt, nachdem sie ihn auf den Acker geschafft und vergessen haben.
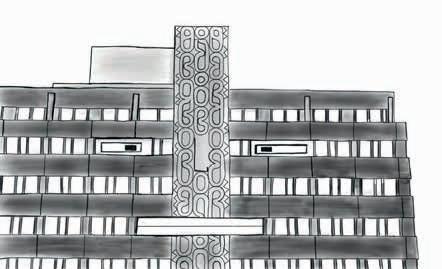

6 Dr. M: Herr Bach, Sie sind heute in Leipzig musikalisch omnipräsent, und Herr Blum, nach Ihnen soll kommendes Jahr sogar ein Preis benannt werden! Wie empfinden Sie das?
Blum: Völlig verdient, sage ich mal, nach allem, was ich gerade für das Schillerhaus getan habe. War doch völlig runter, diese Gohliser Gartenlaube – und jetzt steht eine Ehrenpforte davor und der imposerante Götterfunken hält Einzug … Ich finds aber gut, dass dieser Preis mit Demokratie, Kultur und politischem Engagement zu tun hat. War echt viel Arbeit damals für mich, ich saß ja Abend für Abend noch an der Theaterkasse, und hab für den Intendanten die Schreiberei gemacht. Und dann die Familie, und trotzdem wollte ich was verändern und für die Freiheit einstehen. Das dürfen sie mir gern nachmachen, die Künstler und Gelehrten von heute.
Gibt noch viel zu tun, die Reaktion schläft ja nicht.
Bach: Für mich gibt es sogar ein eigenes Festival! Kaum zu glauben, diese Leipziger – machen mir erst das Leben schwer, und heute werben sie weltweit mit meinem Namen. Ich habs aber gern, dort unter meiner Grabplatte, wenn die
1 Dr. M: Herr Bach, wie darf ich Sie eigentlich anreden?
Bach: Natürlich mit »Herr Hofkapellmeister«, ist doch klar!
In Leipzig bin ich ja offiziell nur Musiklehrer an dieser Thomasschule – dass ich mal zum Kantor absteige, hätte ich nie gedacht. Na, ich muss mich mal umschauen, was so an Grafen und Herzögen bei unserer Messe vorbeischaut. Zuhause bei mir in Thüringen gabs an jeder Ecke einen … Vielleicht krieg ich irgendwann einen Titel vom König …
2 Dr. M: Herr Blum, wie ist das bei Ihnen?
Blum: Also, ich bin ja »abgeordnet«, gewissermaßen »Vertreter«, weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennt – wir machen das ja auch zum ersten Mal, hier in der Paulskirche, mit diesem Parlament und den ganzen Debatten. Da wird ordentlich ausgeteilt, vorne am Pult und nachher im Fraktionsclub. Was die Wähler wirklich wollen, wissen sie allerdings manchmal selber nicht so genau. Aber eigentlich bin ich ja längst tot, »erschossen wie Robert Blum«, wie man so sagt (lacht)
Bach: Na, ich war ja vorher in Köthen. Schon mal da gewesen? Praktisch ein Dorf, mit einem Schloss, einer Kirche, drei Kneipen und lauter Kuhweiden drumrum … Na, Ochsen gibts auch im Stadtrat hier. Jedenfalls viel los an der Pleiße, gut zu tun und eine renommierte Uni für meine Jungs zum Studieren. Aber teuer ist es hier, vor allem zur Messe! Und wenn es weiter so warm und trocken bleibt, sterben zu wenige Leute und ich verdiene nix an den musikalischen Leichen. Vielleicht sollte ich lieber nach Berlin wechseln …
Blum: Ich komme ja us Kölle am Ring, aber wenigstens nich us Deutz, vun dä scheele Sick, wie nachher der Bebel … Ja, Leipzig hat was zu bieten, mit seinem Orchester, und dem Theater und der ganzen Szene. Solche Leute wie den Mendelssohn, oder den Lortzing, die gibt’s nich überall …
Bloß deinen Kram auf der Bühne machen, das geht hier aber nicht. Jeder muss mitmachen, in dieser Stadt. Manchmal werden die Leute dann aber rammdösig und mucken richtig auf – dann muss mer se wieder beruhigen, damits keene Toten gibt. Puh, hab ich mir den Mund fusslig geredet deshalb, auf diesem wackligen Rathausbalkon. Gerechtigkeit und Frieden gehören eben zusammen, wie das Amen zur Kirche – aber nicht zu der mit den Kardinälen und dem ganzen Mummenschanz. Ich hab gleich meine eigene gegründet, die Deutschkatholischen, da waren wir alle Brüder und Schwestern. Ja, auch die Frauen konnten mitreden –sonst hätte mir meine Freundin Louise was gehustet! War auch eine Tapfere, hat nachher den Revoluzzer Peters geheiratet. Da saß er noch im Zuchthaus … Chapeau!
Kapellen und Chöre aus aller Welt kommen, und meine Kantaten spielen. Sogar Türken, Papisten und Reformierte sind mittlerweile dabei … Die können sich heute aber auch auf ein Instrument spezialisieren – kein Wunder, dass es besser klingt als bei Gotti Reiches ollen Stadtpfeifern … Am meisten freuts mich, wenn meine wunderlichen Spezialfreunde von der Obrigkeit im Alten Rathaus meine Musik anhören müssen. Der Stieglitz schielt sich vor Ärger fast zu Tode, dort an seiner Bilderwand … Und jetzt bekomme ich noch einen eigenen Rundgang, einen »Bach-Parcours«, mit Lutherbibel und allen Schikanen. Sogar der Tisch ist dabei, an dem ich damals diesen vermaledeiten Vertrag unterschrieben habe. Dafür haben sie mein Porträt in Gold gerahmt und hinter Panzerglas gebracht. Da kann sich das ganze Konsistorium dran festkleben, bis es schwarz wird …

Bach: Also über mich hat die Lokalpresse in meiner Zeit nie berichtet … Nicht mal im Kulturteil! Da bin ich echt froh, dass sich mal jemand meldet! Dass die Thomaner und das Orchester meine Musik jetzt so langsam draufhaben, freut mich ebenfalls. Wenn man fleißig ist und sich richtig anstrengt, kann man alles möglich machen – hab ich immer gesagt. Ich wollte immer das Höchste in meiner Kunst erreichen, und scheinbar sind die Leipziger endlich auch so weit, da hat das Soli Meo Gloria doch gefruchtet! Also, mit mir könnt ihr rechnen, auch wenn ich mich schon wundere, dass ihr diesem Wagner einen Museumsraum direkt neben mir eingerichtet habt.
Ein Musiker, der nicht Clavier spielen kann? Na, den hätte ich aber zum Tristan gejagt … Blum: Zeitungen und Pressefreiheit finde ich immer gut – also traut euch was und langweilt die Leute nicht! Aber was ihr im Museum alles von mir rumliegen habt … Flugblätter, Gedichte, sogar Kaffeetassen mit meinem Rauschebart drauf – komisch, dass die Leute immer erst hinterher merken, mit wem sie es
zu tun hatten. Schade, dass ich nichts mehr davon habe, meine Jenny hätte das Geld nötig gehabt. Aber vielleicht komme ich vorbei und halte ne zündende Rede, wenn der Bundespräsident nächstes Jahr zu Besuch kommt. Vielleicht lässt mich auch der Christian Wolff mal auf seiner nächsten Demo auftreten? In Leipzig bin ich ja zuhause und noch immer gut vernetzt … Matthäikirchhof: Ach, Papiere brauche ich keine mehr, wird Zeit, dass mal die Bagger anrollen. Ich will wieder richtig durchatmen können, und diese hässlichen Steinklötze liegen mir so was von auf der Brust. Bin echt gespannt, was aus den ganzen Plänen wird – Wohnungen, Archivräume, Gewerbeflächen, Kultur, Musik, Bildung … Im Grunde alles, was es in tausend Jahren mal gab, jetzt auf einem Bierdeckel zusammengedrängt – die Menschen wollen heute wirklich alles auf einmal! Aber allemal besser als der Parkplatz und die Mülltonnen … Bischof Eid hat anno dazumal auch nicht in der Garage übernachtet … Macht einfach was draus, ja? Amen!
24 AUTOR Dr. M | der Redaktion bekannt ZEICHNUNGEN Nathan Wild | Bundesfreiwilligendienst Bildung und Vermittlung
3 Dr. M: Lieber Matthäikirchhof, viel
4 Dr. M: Herr Hofkapellmeister, Herr Abgeordneter. Sie kamen beide von auswärts nach Leipzig. Wie war denn ihr Eindruck von der Stadt?
7 Dr. M: Herr Bach, Herr Blum, lieber Kirchhof, was wünschen Sie dieser Stadt, dem Museum und seiner Zeitung?