

RENOUVEAU DES VILLAGES DE MONTAGNE

FOKUS FOCUS VERBANDSNACHRICHTEN VIE ASSOCIATIVE

6 LEBENDIGE RANDREGION
PÉRIPHÉRIE VIVANTE 38 IN DER WAGGONWERKSTATT
2 In aller Kürze
Fokus
BEGEGNUNGEN RENDEZ-VOUS


VOM FRIEDHOF ZUM STADTPARK
CIMETIÈRE AU PARC URBAIN
6 Lebendige Randregion
11 Poschiavo in Bewegung
12 «Altes beleben, Neues bewirken»
17 Dort, wo der Stein wieder spricht
20 Das Goms lädt zum Dialog
24 Hoch hinaus für gute Ideen
Verbandsnachrichten
26 Vom Friedhof zum Stadtpark
31 Für Natur und Heimat
32 Unterwegs in den Gassen
34 Zwei neue Ferienangebote
Begegnungen
38 In der Waggonwerkstatt
42 Verbindende Freiräume 44 Unterwegs mit Lucienne
46 Wir empfehlen
48 Schlusspunkt
Titelseite: Blick auf Grengiols (VS) Page de couverture: Vue de Grengiols (VS)
2 En bref
Focus
6 Une périphérie vivante 11 Poschiavo en mouvement 12 «Faire revivre l’ancien, inventer le nouveau»
17 Là où la pierre reprend voix
20 Goms invite au dialogue
24 Les idées prennent de la hauteur
Vie associative
cimetière au parc urbain
la nature et le patrimoine
Deux nouvelles offres
«Habiter l’imprévu»
Rendez-vous
Dans l’atelier des wagons
Des espaces qui créent du lien
Chemin faisant avec Lucienne 46 Coups de cœur
Point final
Christian Beutler/Keystone
Historische
BERGWÄRTS! SOULEVONS DES MONTAGNES!
Unser diesjähriger Wakkerpreis an Poschiavo gibt Anlass, den Blick auf die Berggebiete zu richten: Was hält die Gemeinden zusammen? Wo liegen Chancen, wo die Herausforderungen? Mit welchen Strategien begegnen sie der Abwanderung?
Das Valposchiavo hat sich vom vermeintlich «verlorenen Tal» zum Modell für regionale Eigenständigkeit entwickelt. Die Berggemeinde zeigt beispielhaft, wie der Zusammenhalt und die Nutzung lokaler Stärken Lebensqualität schaffen können.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgte im Tessin das Kollektiv Squadra, das in Mosogno di Sotto ein Umbauprojekt zur «Res publica» erhob. Nicht nur das Resultat zählt, sondern vor allem der Weg dorthin: gemeinschaftlich, zuhörend, lernend.
Dieser Austausch auf Augenhöhe wird im Goms in Form von Dorfgesprächen zur Methode. Dabei geht es nicht um schnelle Lösungen, sondern um die Anerkennung und Diskussion unterschiedlicher Perspektiven als Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben.
Was all diese Beispiele eint, ist eine entscheidende Erkenntnis: Es stehen nicht Bauten, sondern Beziehungen im Vordergrund. Dieser Fokus schafft aussergewöhnliche und tragfähige Lösungen, die beweisen: Die Stärke der Berggemeinden liegt im Miteinander.
Im Miteinander liegt auch die Stärke des Schweizer Heimatschutzes. Der Jahresbericht, der dieser Ausgabe beiliegt, zeigt, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit Ihnen – als Mitglied, Gönnerin oder Partner – erreichen konnten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
La remise du Prix Wakker 2025 à Poschiavo offre l’occasion de se tourner vers les régions de montagne: qu’estce qui unit les communes? Où résident les opportunités, où se situent les défis? Avec quelles stratégies combattentelles l’émigration?
Autrefois perçu comme une «vallée oubliée», le Valposchiavo est devenu un modèle d’autonomie régionale. Cette commune de montagne montre de manière exemplaire comment la cohésion et l’exploitation responsable des forces locales peuvent générer une réelle qualité de vie.
Au Tessin, le collectif Squadra a poursuivi une approche similaire en faisant d’un projet de transformation à Mosogno di Sotto une cause publique. Ce qui importe, ce n’est pas seulement le résultat, mais surtout le chemin pour y parvenir: un parcours collectif, attentif et ouvert à l’apprentissage.
À Goms, ces échanges d’égal à égal prennent la forme d’ateliers village. Il ne s’agit pas d’y trouver des solutions rapides, mais de reconnaître et de débattre de perspectives différentes, une condition nécessaire à une cohabitation harmonieuse.
Tous ces exemples ont en commun un constat décisif: ce ne sont pas les bâtiments qui priment, mais les relations humaines. Cette perspective aboutit à des solutions hors du commun et durables qui font leurs preuves: la force des régions de montagne réside dans la communauté.
Cette conclusion s’applique aussi à Patrimoine suisse. Le rapport annuel qui est annexé à ce numéro présente ce que nous avons accompli avec vous, nos membres, nos donateurs, nos partenaires. Un grand merci pour votre soutien!
Natalie Schärer und Peter Egli, Redaktion

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE
ACTUALISATION DE L’ISOS POUR FRIBOURG ET LES GRISONS
En mars 2025, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle mise à jour de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Après l’actualisation de l’inventaire dans le district de la Broye (2024), les travaux se sont concentrés sur les districts de la Glâne et de la Gruyère. Ne présentant plus les qualités requises, Chavannes-les-Forts, Mézières, Promasens, Rueyres/Treyfayes et Villars-sousMont (Bas-Intyamon) sont ôtés de la liste des sites d’importance nationale.
Dans les Grisons, la mise à jour concerne les régions de Moesa, Prättigau/Davos et Surselva. Le village de Siat entre à l’inventaire fédéral, les sites de Grono con Pont del Ram e San Clemente, Grüsch/Schmitten, Küblis, Luven, Sagogn et Sumvitg en sortent.
Les nouveaux relevés de sites (9 pour Fribourg, 17 pour les Grisons) seront disponibles dès le 1er mai 2025 sous forme de géodonnées et de PDF sur les géoportails de la Confédération et de l’ISOS.
L’ISOS apporte une contribution essentielle à une culture du bâti de qualité. Il fait partie des inventaires d’objets d’importance nationale établis par la Confédération sur la base de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
Nouveaux relevés de sites ISOS map.geo.admin.ch, gisos.bak.admin.ch
MITMACHEN
EINSATZ IN LIONZA
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten am «Heidehüs» (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 3/2024) nimmt die Stiftung Baustelle Denkmal mit der «Casa Fiscalini» ein neues Projekt in Angriff. Das Wohnhaus liegt im historischen Dorfkern von Lionza (TI), eingebettet in die reiche Kulturlandschaft des oberen Centovalli. Das ortsbildprägende Gebäude mit weitgehend erhaltener Originalsubstanz und reichen Schablonenmalereien steht seit Jahrzehnten leer und verfällt zunehmend. Nun soll es unter grösstmöglicher Substanzerhaltung instandgestellt werden – wiederum unter der Anleitung einer Fachperson und mithilfe von Freiwilligen und Zivildienstleistenden. Für diesen Einsatz sucht die Stiftung noch helfende Hände, die im Sommer 2025 tatkräftig mit anpacken!
Informationen und Anmeldung baustelle-denkmal.ch/einsatz-in-lionza
SONDERANGEBOT
BURGENKARTE DER SCHWEIZ
Die Schweiz gehört zu den burgenreichsten Landschaften Europas. In den beiden Karten werden über 4 000 Objekte von der prähistorischen Zeit bis zur Frühen Neuzeit kartografisch in 23 verschiedenen Objektklassen dargestellt. Eine Begleitbroschüre enthält Detailkarten, Kurzbeschreibungen und Ortsangaben sämtlicher Objekte und erleichtert damit das Auffinden. Die Karte bildet mit den Erläuterungen eine ausgezeichnete Grundlage für Fachleute und alle, die an Kultur und Geschichte interessiert sind. Die Karte im Massstab 1 : 200 000 wurde von Swisstopo und dem Schweizerischen Burgenverein herausgegeben. Da Swisstopo nun den Bestand liquidiert, werden beide Blätter als Sonderangebot zum Preis von CHF 20.– (ursprünglich CHF 89.–) angeboten.
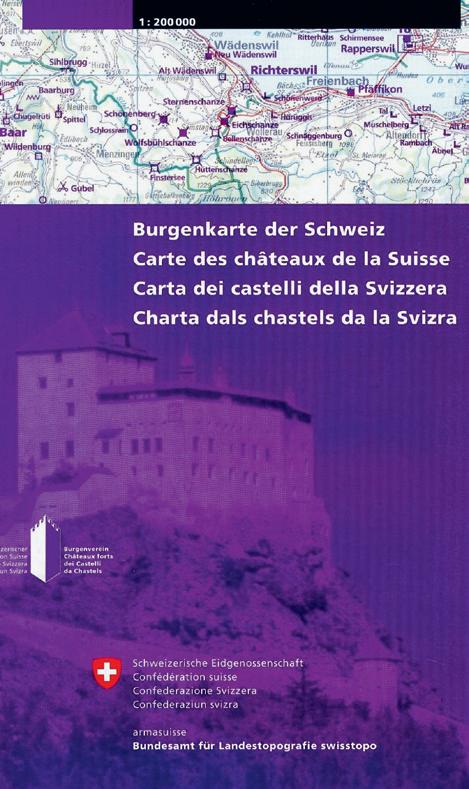
Zu bestellen beim Schweizerischen Burgenverein: info@burgenverein.ch, burgenverein.ch

AUSSTELLUNG
WAS WAR WERDEN KÖNNTE
Während früher der Neubau im Vordergrund stand, gelten heute der Erhalt und die Pflege des Gebäudebestandes als die Zukunft der Disziplin. Vor diesem Hintergrund erhält die Denkmalpflege eine neue Dringlichkeit. Sie sieht den Bestand als eine wertvolle Ressource und hat verschiedene Methoden und Ansätze entwickelt, um das Vorhandene behutsam und sinnvoll in die Zukunft zu überführen. Was lässt sich daraus lernen, und welche neuen Impulse können aus einem vertieften Dialog zwischen Denkmalpflege und Architektur entstehen? Die aktuelle Ausstellung im SAM «Was War Werden Könnte» wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege (Prof. Dr. Silke Langenberg) der ETH Zürich entwickelt. Sie nimmt das 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 zum Anlass, einen Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Denkmalpflege zu werfen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Architektur auszuloten.
Was War Werden Könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur Schweizerisches Architekturmuseum, 5. April bis 14. September 2025
«La tâche que doit diriger la cellule de crise spécialement instituée après la catastrophe est titanesque. Dans le haut du village, aucune maison n’a été épargnée par le torrent en furie. Pourtant, la commune tient à conserver l’âme de son centre historique. Elle décide donc d’établir un plan d’aménagement prévoyant la restauration des bâtiments endommagés dans le respect de critères architecturaux et historiques précis et en profite pour moderniser son infrastructure. Aujourd’hui, ces travaux sont achevés et les craintes de la population se sont très vite dissipées. [...]
À Poschiavo, l’homme et la nature se sont réconciliés.»
«Un bilan, pas trop désastreux?»
À propos des inondations du 18 juillet 1987 à Poschiavo Marco Badilatti, Heimatschutz/Sauvegarde 4/1999
Gay Menzel / Emmanuel Dorsaz


JUBILÄUM
AUSSTELLUNG
VERS UNE ARCHITECTURE: REFLEXIONEN
Nach der Winterpause öffnet der Pavillon am Ufer des Zürichsees mit einer neuen Ausstellung seine Türen. Hauptexponat ist und bleibt das einzige von Le Corbusier entworfene Haus in Zürich. Sein letztes Haus bildet den Rahmen, um die 100-jährige Schrift Vers une architecture zu verhandeln. Acht heterogene Gastbeiträge bespielen den Pavillon und nehmen mehr oder weniger Bezug zu Le Corbusiers Buch, das als Manifest und Grundstein der Moderne gilt. Der in die Zukunft weisende Titel animierte die ausstellenden Studios dazu, zukünftige Perspektiven einzunehmen. So analysieren beispielsweise Grillo Vasiu zusammen mit Christine Gertsch die Struktur und Sprache der Publikation neu, und zeigen Textmuster auf, die auf einem grossen Screen über einer Charlotte-Perriand-Liege projiziert werden, während im ersten Stockwerk Bauruinen und architektonische Fantasien einer KI über Bildschirme flimmern. Platz für Vertiefung bleibt dabei wenig, die Ausstellung muss sich hinter dem Haus und dem grossen Meister, so scheint es, bescheiden zurücknehmen.
Vers une architecture: Reflexionen
Pavillon Le Corbusier, 25. April bis 23. November 2025
Die Stiftung Ferien im Baudenkmal des Schweizer Heimatschutzes feiert 2025 ihr 20jähriges Bestehen. Noch bis im November finden in ausgewählten Baudenkmälern «Tage der offenen Tür» statt. Sie sind herzlich eingeladen, in die Geschichte der Häuser einzutauchen und mitzufeiern.
Jubiläumsprogramm und Angebote der Stiftung Ferien im Baudenkmal ferienimbaudenkmal.ch/20-jahre
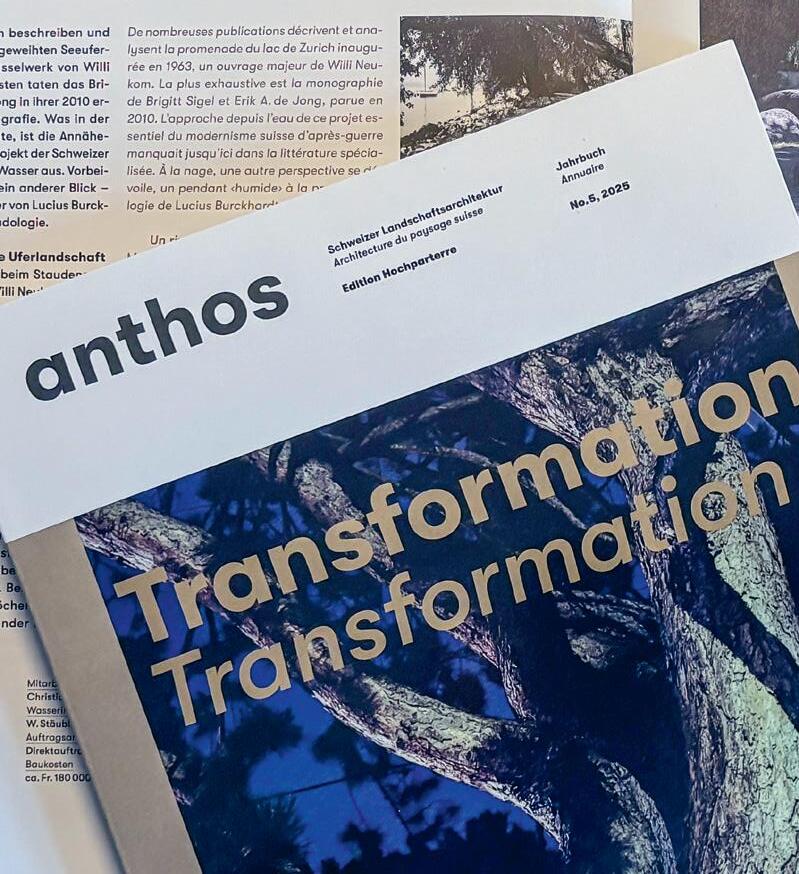
DISTINCTION
PAYSAGE
JUBILÄUM
100 JAHRE BSLA
Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) feiert sein 100-jähriges Bestehen. 1925 als Bund Schweizer Gartengestalter gegründet, ist der BSLA heute eine einflussreiche Organisation mit 800 Mitgliedern und 250 Büros in allen Landesteilen. Das Jubiläum steht unter dem Motto «Transformation» und wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Zum Jubiläum erscheint das Jahrbuch Anthos. Transformation, das die Entwicklung der Landschaftsarchitektur in der Schweiz reflektiert und einen Blick in die Zukunft der Disziplin wagt. Die Publikation versammelt Beiträge von Fachpersonen und dokumentiert 15 Projekte aus 100 Jahren, die auch auf der Plattform bsla100.ch präsentiert werden.
La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (SL-FP) a décerné le prix du «Paysage de l’année» 2025 au Val Bavona (TI). Les lauréates sont la Fondazione Valle Bavona et la commune de Cevio qui sont récompensées pour le soin apporté depuis de nombreuses années au paysage culturel traditionnel de cette vallée, mais aussi pour l’action scrupuleuse et solidaire de la fondation et de la commune après les terribles intempéries de juin 2024. Plutôt que de rétablir l’état antérieur dans la précipitation, elles ont lancé un processus participatif afin de traiter le paysage d’une manière nouvelle et durable en concertation avec la population. Le projet prévoit de conserver une trace des évènements, de prendre en considération les dangers naturels et de maintenir la qualité de l’entretien du paysage.
Le prix rend également hommage au réseau de bénévoles et de donateurs de la Fondazione Valle Bavona. Par l’attribution de ce «Paysage de l’année», la SL-FP met en relief les acteurs d’utilité publique et les actions solidaires dans le domaine de la préservation du paysage.
Val Bavona (TI)
Paysage de l’année 2025
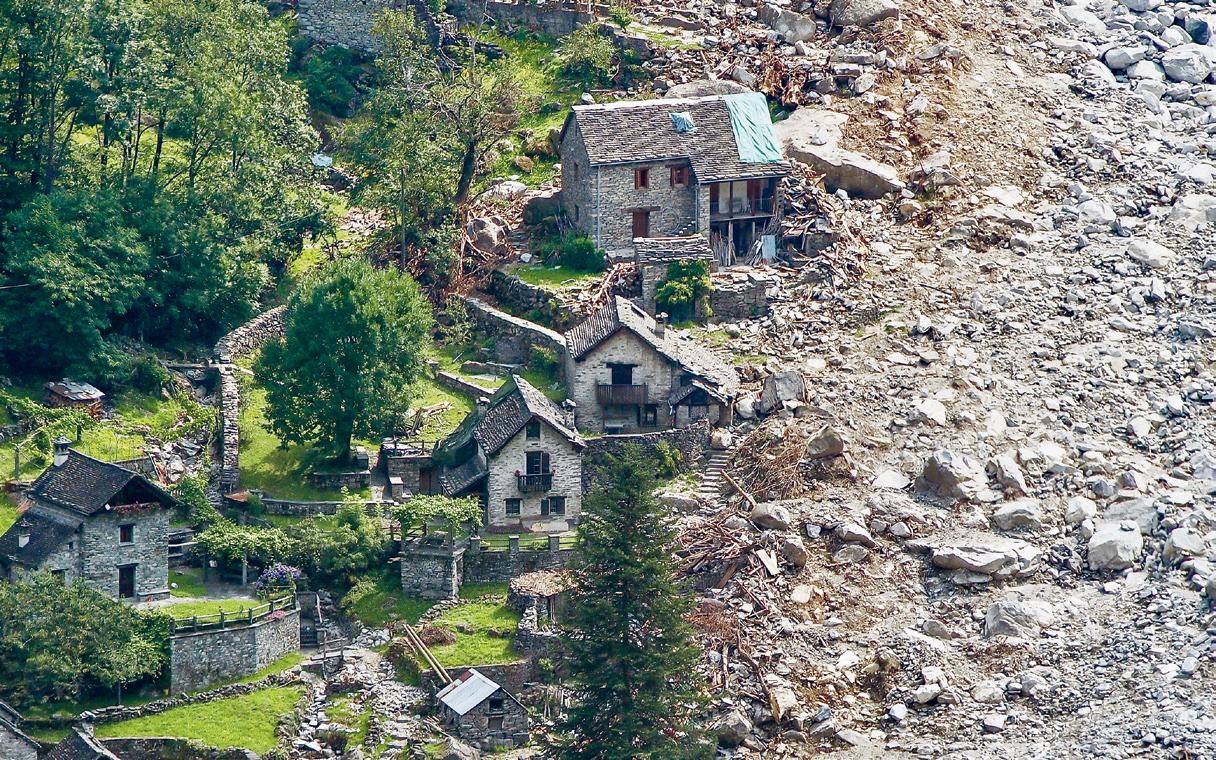
bsla100.ch
UNTERSTÜTZEN
BUCHPROJEKT
GEORG RAUH

Ein neues Buchprojekt würdigt das Werk des wenig bekannten Architekten Georg Rauh (1906–1965). Rauh brachte in den 1930er-Jahren die Ideen des Bauhauses in die Ostschweiz und passte sie dem dortigen Kontext an. Seine architektonische Handschrift zeigt sich im Detail und nicht in der grossen Geste. Zudem baute er oft für ein kleines Budget.
In der geplanten Publikation arbeiten die Herausgeberinnen Christine Egli und Dorothy Holt Wacker den Nachlass von Georg Rauh auf. Fotografien von Ladina Bischof sowie Essays von Ita HeinzeGreenberg, Gregory Grämiger und Patrick Schoeck-Ritschard verleihen dem Buch inhaltliche Tiefe. Die Buchvernissage findet am 13. September in St. Gallen statt. Unterstützen Sie die letzte Meile des Projekts mit einer Spende!
wemakeit.com/projects/ buchprojekt-georg-rauh
IBAN: CH62 0690 0062 6117 1000 8, Notiz: Buchprojekt Georg Rauh

LEBENDIGE RANDREGION UNE PÉRIPHÉRIE VIVANTE
Daniele
Papacella, Journalist
Nach Jahrzehnten der Rezession hat Valposchiavo neues Selbstvertrauen gewonnen. Geschickt nutzt das Tal regionale Ressourcen und gestaltet seine Zukunft im Dialog mit der Welt.
Après des décennies de récession, le Valposchiavo avance aujourd’hui avec une confiance retrouvée. Il mise habilement sur ses ressources régionales et façonne son avenir dans un dialogue ouvert avec le monde.
Die periphere Lage als Chance sehen: Poschiavo, ausgezeichnet mit dem Wakkerpreis 2025 des Schweizer Heimatschutzes, ist ein Vorbild für weitere Berggemeinden. Faire d’une situation périphérique une opportunité: Poschiavo, lauréate du Prix Wakker 2025 décerné par Patrimoine suisse, est un exemple pour d’autres communes de montagne. Foto: Christian Beutler/Keystone

Der 2327 Meter hohe Berninapass verbindet das Engadin mit dem italienischsprachigen Valposchiavo. Auch im Winter bleibt er dank Strasse und Berninabahn eine bedeutende Verkehrsverbindung über die Alpen.
Le col de la Bernina, haut de 2327 mètres, relie l’Engadine à la région italophone du Valposchiavo. Même en hiver, il reste un axe alpin important grâce à la route et au chemin de fer.
1957 beschrieben Riccardo Tognina und Romerio Zala das Tal als «das verlorene Tal», eine abgelegene und beinahe vergessene Region. Die schwierige Lage war vor allem der geografischen Abgeschiedenheit geschuldet, aber nicht nur. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte der Bau der Berninabahn und der Wasserkraftwerke Modernität ins Tal. Doch in der wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit blieb Valposchiavo weitgehend aussen vor. Fehlende Perspektiven führten zu einer massiven Abwanderung, wie in vielen peripheren Regionen. Zwischen 1950 und 2000 verlor das Tal ein Fünftel seiner Bevölkerung und zählte nur noch 4427 Einwohnerinnen und Einwohner.
Doch in jüngster Zeit kam es zu einer Kehrtwende. Erste Anzeichen dafür zeigten sich Mitte der 1980er-Jahre, als einige Landwirte begannen, Heilkräuter anzubauen – ein innovatives Produkt, das den Weg für weitere Entwicklungen ebnete.
Aufschwung nach Katastrophe
Im Sommer 1987 brachte ein dramatisches Ereignis eine unerwartete Wende. Nach anhaltenden Regenfällen traten die Bäche über die Ufer. Eine gewaltige Schlammlawine aus dem Val Varuna überschwemmte den Hauptort Poschiavo. Auch in anderen Dörfern entstanden schwere Schäden. Das Unglück erregte grosse mediale Aufmerksamkeit, und aus der gesamten Schweiz strömte Solidarität ins Tal. Jahrelang arbeiteten die Bewohnerinnen und Bewohner an der Wiederherstellung der Häuser und der Sicherung des Gebiets. Der Ortskern von Poschiavo, den einst ausgewanderte Konditoren prachtvoll gestaltet hatten, erstrahlte erneut in altem Glanz. Gleichzeitig erlebte der Tourismus einen neuen Aufschwung.
En 1957, Riccardo Tognina et Romerio Zala décrivaient le Valposchiavo comme la «vallée perdue», une région lointaine et presque oubliée. Sa situation précaire était due avant tout à sa position géographique, mais pas seulement. Au début du XXe siècle, la construction de la ligne de la Bernina et des centrales hydroélectriques avait fait souffler un air de modernité. Mais le Valposchiavo demeura largement en marge du boom économique de l’après-guerre. Le manque de perspectives provoqua, comme dans de nombreuses régions périphériques, une hémorragie démographique massive. Entre 1995 et 2000, la vallée perdit un cinquième de sa population, qui n’atteignait plus que 4427 habitants.
Mais un virage est intervenu récemment. Les signes avant-coureurs sont apparus au milieu des années 1980 quand quelques agriculteurs ont commencé à cultiver des plantes médicinales – une production innovante annonciatrice d’autres évolutions.
Rebondir après une catastrophe
Mais un évènement entraîna à l’été 1987 un tournant inattendu. Après des jours de déluge, les torrents sortirent de leur lit. Une énorme masse de boue provenant du Val Varuna submergea Poschiavo, le chef-lieu, et les autres villages subirent aussi d’énormes dégâts. La catastrophe souleva l’attention des médias et des élans de solidarité affluèrent de toute la Suisse. Durant des années, on travailla à la reconstruction des maisons et à la sécurisation du territoire. Le centre de Poschiavo, autrefois aménagé avec faste par des pâtissiers émigrés, retrouva toute sa splendeur. Dans le même temps, le tourisme connut un nouvel essor.

Poschiavo erzählt bis heute die Geschichte eines einst florierenden Handelsorts zwischen Graubünden und Italien. Neue Bauten orientieren sich an traditionellen Grundsätzen, um das Ortsbild zu erhalten.
Poschiavo raconte aujourd’hui encore l’histoire d’un ancien centre commercial florissant entre les Grisons et l’Italie. Les nouvelles constructions s’inspirent de principes traditionnels pour préserver l’image du village.
Regionale Stärken nutzen
Ein Jahrzehnt später führte die periphere Lage zu einem weiteren unerwarteten Vorteil. Swisscom wählte Valposchiavo als Testregion für neue digitale Technologien aus. Das Interesse war gross, und im Jahr 2000 hatte das Tal die höchste Internetdichte der Schweiz. Vor Ort wurde der technologische Wandel aktiv begleitet. 2002 entstand das Polo Poschiavo, ein Weiterbildungszentrum für Erwachsene in Valposchiavo und Bregaglia. Die Hoffnung auf eine breite Nutzung von Telearbeit erfüllte sich zwar nicht, doch das Projekt förderte die Entstehung von Unternehmen im IT- und Dienstleistungssektor. Dadurch gewann die lokale Wirtschaft an Stabilität.
Parallel dazu führte die Liberalisierung des Energiemarkts zu einer weiteren positiven Entwicklung. Der Kanton Graubünden forcierte die Fusion mehrerer Wasserkraftunternehmen. Die ehemaligen Forze Motrici Brusio wurden dabei zum stärksten Partner in der neuen Unternehmensstruktur. So wurde Poschiavo zum Hauptsitz von Repower, was zusätzliche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Ressourcen ins Tal brachte. Auch die Landwirtschaft entwickelte sich weiter und fand mit der Bioproduktion eine zukunftsweisende Nische. Besonders innovativ war ein Projekt, das 2007 mit der Restaurierung der alten Mühle von Aino begann. Eigentlich als kulturelles Vorhaben gestartet, entwickelte sich daraus eine Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben zum Anbau von Buchweizen und Roggen.
Dieses kleine Projekt war der Ausgangspunkt für eine grössere Initiative: 100% Valposchiavo. Die Idee war, Landwirtschaft, Tourismus und kulinarisches Erbe unter einer gemeinsamen Marke zu vereinen. Regionale Produkte wurden
Miser sur les forces régionales Une décennie plus tard, la situation périphérique de la vallée amène Swisscom à la choisir pour tester sa nouvelle technologie numérique. L’essai soulève un grand intérêt et, en 2000, le Valposchiavo dispose de la plus grande densité de connexions Internet en Suisse. De vastes projets sont lancés: en 2002 est créé le Polo Poschiavo, un centre de formation continue pour les adultes dans le Valposchiavo et le Val Bregaglia. Mais la promesse des nouveaux modèles de télétravail reste vaine. Cependant, le projet favorise l’apparition de sociétés actives dans les secteurs de l’informatique et des services. Les compétences acquises renforcent le tissu économique. En parallèle, la libéralisation du marché de l’énergie offre une nouvelle opportunité. Le canton des Grisons encourage la fusion de plusieurs entreprises hydroélectriques. Les anciennes Forze Motrici Brusio deviennent le partenaire le plus puissant dans la nouvelle entité et Poschiavo accueille le siège de Repower. Ce regroupement crée des ressources économiques et des places de travail supplémentaires. De son côté, l’agriculture n’est pas en reste et a trouvé un débouché d’avenir dans les produits bio. Un projet particulièrement innovant a été développé dès 2007 avec la restauration de l’ancien moulin d’Aino. À vocation culturelle au départ, cette initiative a débouché sur une collaboration avec des exploitations agricoles pour la culture de sarrasin et de seigle. Ce projet modeste a donné le coup d’envoi à une aventure à plus large échelle, couronnée de succès et qui va bien audelà du monde paysan: 100% Valposchiavo. L’idée était de réunir sous une même marque la promotion touristique, l’agriculture et l’héritage culinaire – les produits régionaux

100% Valposchiavo: Die Mulino Aino mahlt den gesamten Buchweizenertrag des Tals, das gewonnene Mehl wird lokal weiterverarbeitet.
100% Valposchiavo: le Mulino Aino moud toute la récolte de sarrasin de la vallée. La farine entre dans la fabrication de produits locaux.
zu Botschaftern des Tals. Durch den Fokus auf Qualität und Tradition erlebte der Tourismus einen regelrechten Boom und erreichte Jahr für Jahr neue Rekorde.
Die Kraft der Gemeinschaft
Ein entscheidender Erfolgsfaktor war das soziale Gefüge. In Valposchiavo kennt man sich, und viele Ideen entstehen durch den direkten Austausch der Menschen. Ebenso wichtig war der Kontakt zur Aussenwelt. Fast alle Jugendlichen verlassen das Tal für ihre Ausbildung in der restlichen Schweiz. Doch viele kehren zurück – mit neuen Erfahrungen und wertvollen Kompetenzen.
Trotz seiner Abgeschiedenheit ist dieser Mikrokosmos immer im Dialog mit der Welt. Doch das wahre Erfolgsgeheimnis liegt in der sozialen Kohäsion. Mit fast 80 Vereinen und Organisationen – von Fussball über Museen bis hin zu Tanz und Philatelie – bietet das Tal ein aussergewöhnlich reiches gesellschaftliches Leben.
In Valposchiavo, einer peripheren Region der Schweiz mit einer sprachlichen Minderheit, wissen alle: Lebensqualität und Erfolg hängen direkt von der gemeinsamen Initiative ab. Dieses Bewusstsein hat die wirtschaftliche, kulturelle und demografische Wiederbelebung ermöglicht.
Die Übergabe des Wakkerpreises an Poschiavo findet am 23. August 2025 im Rahmen einer öffentlichen Feier statt. Eine Publikation zum Wakkerpreis 2025 mit Beiträgen in deutscher und französischer Sprache erscheint demnächst. heimatschutz.ch/wakkerpreis
étant devenus les ambassadeurs de la vallée. En se concentrant sur la qualité et la tradition, le tourisme a enregistré de nouveaux records d’année en année.
La force de la communauté
Le tissu social a joué un rôle déterminant dans ce succès. Dans le Valposchiavo, les gens se connaissent et beaucoup d’idées naissent de ces échanges directs. Mais les contacts avec l’extérieur ont été importants également: presque tous les jeunes partent se former dans le reste du pays et nombre d’entre eux reviennent, avec des expériences nouvelles et de précieuses compétences.
En dépit de son isolement, ce microcosme est en dialogue permanent avec le monde extérieur. Mais le vrai secret de la réussite réside dans la cohésion sociale. Avec plus de 80 sociétés et organisations, du football à la danse en passant par la philatélie et les musées, la vallée propose une vie associative d’une rare richesse.
Dans le Valposchiavo, une région périphérique peuplée d’une minorité linguistique, on a pleinement conscience que la qualité de vie et le succès dépendent directement de l’action commune. C’est ce sentiment qui a permis sa renaissance économique, culturelle et démographique.
La remise du Prix Wakker à Poschiavo aura lieu le 23 août 2025 dans le cadre d’une fête publique. Une publication consacrée au Prix Wakker 2025, avec des articles en allemand et en français, paraîtra prochainement. patrimoinesuisse.ch/wakker
Christian Beutler/Keystone
POSCHIAVO IN BEWEGUNG POSCHIAVO EN MOUVEMENT
Ein Streifzug durch die Archive von SRF, RTS und RTR zeigt Poschiavo im Wandel: mal gefordert, mal hoffnungsvoll, mal stolz. Archivbilder aus fünf Jahrzehnten dokumentieren, wie sich die Gemeinde den Herausforderungen gestellt und neue Perspektiven geschaffen hat.
Une plongée dans les archives de la SRF, de la RTS et de la RTR montre la mutation de Poschiavo – tantôt mise à rude épreuve, tantôt traversée par de grands espoirs ou emplie de fierté. Sur cinq décennies, les images montrent comment la commune a affronté les défis et s’est créé de nouvelles perspectives.

1971
Vom stockenden Ausbau der Berninastrasse bis zu leer stehenden Wohnungen infolge des Bevölkerungsrückgangs: Das Porträt von 1971 zeigt ein Poschiavo im Kampf gegen die Abwanderung, zugleich reich an Kultur, Rohstoffen und Handwerkskunst.

2016
100 % Valposchiavo: eine Initiative mit dem Ziel, die ganze Wertschöpfungskette in der Region zu halten. Gästen und Einheimischen soll eine Vielfalt an regionalen Produkten angeboten werden. Die Initiative stärkt die lokale Wirtschaft und den Tourismus.

1977
Deux habitants du Valposchiavo racontent leur région pour les caméras de la télévision romande. Partis pour gagner leur vie loin des Grisons, ils évoquent l’immigration, le retour au pays et surtout leur attachement à leur vallée.

2025
Poschiavo reçoit le Prix Wakker décerné par Patrimoine suisse. L’émission présente la commune de montagne et donne un reflet de ses accomplissements: un cinéma dans une ancienne grange, le «Centro di conservazione dei beni culturali» ou le développement de la production locale.

1981 Begrenzte Ausbildungsmöglichkeiten und fehlende Arbeitsplätze zwingen viele Puschlaverinnen und Puschlaver zur Abwanderung. Vor allem Jugendliche sehen im Tal kaum Perspektiven. Arbeitsmöglichkeiten gibt es fast nur in der Marmor- und Holzverarbeitung, in der Landwirtschaft, in Elektrizitätswerken und bei der Bahn. In diesem Beitrag erzählen junge Erwachsene von den Hürden bei der Arbeitssuche, ihren Ideen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und ihrer Hoffnung, eines Tages zurückkehren zu können. Trotz der Herausforderungen bleibt die Verbundenheit mit dem Tal spürbar.
Videos anschauen: Eine Zusammenstellung der Videoausschnitte finden Sie unter heimatschutz.ch/ videoarchiv.
Regarder les vidéos: vous trouverez les extraits vidéo sous patrimoinesuisse.ch/ archives-video.
zVg
GESPRÄCH MIT BEAT RITZ
ENTRETIEN AVEC BEAT RITZ
«ALTES BELEBEN, NEUES BEWIRKEN» «FAIRE REVIVRE L’ANCIEN, INVENTER LE NOUVEAU»
Marco Guetg, Journalist Marion Nitsch, Fotografin
Sorgenkind Dorfkern. Während man hier wie dort noch nach Lösungen sucht, hat die Walliser Gemeinde Grengiols für sich eine gefunden: mit dem dezentralen Hotel POORT A POORT. Was dahinter steckt? Mitinitiant und Stiftungsratspräsident Beat Ritz gibt Auskunft.
Drehen wir die Zeit zurück in die Jahre vor der Jahrtausendwende und werfen wir einen Blick auf Grengiols. Welches Bild zeigt sich uns?
Am Dorfrand stehen zahlreiche Neubauten, erstellt von Einheimischen, die eine Familie gegründet und sich ausserhalb des Dorfzentrums ein neues Heim errichtet haben. Wir sehen aber auch die Folge davon: Alte Häuser im Dorfkern wurden weniger bewohnt und stehen leer.
Ich habe gelesen, dass damals auch Gefahr bestand, dass in Grengiols plötzlich keine Beiz mehr vorhanden sein könnte und Sie diese Perspektive aufgescheucht hat. Ja, das war im vergangenen Jahrzehnt. Grengiols hatte im Dorf drei Beizen: Insider nannten sie «Oberschta», «Mittleschta» und «Unnerschta». Als die langjährige Wirtin des Restaurants Bettlihorn 2014 verkündete, im Frühjahr 2015 aufzuhören, läuteten bei mir die Alarmglocken. Mit Jahrgang 1949
Les centres historiques sont un cassetête dans de nombreuses communes. Mais le village valaisan de Grengiols a trouvé une solution avec l’hôtel décentralisé POORT A POORT. Beat Ritz, qui a contribué à lancer cet établissement et préside le conseil d’administration, explique ce concept.
war sie die jüngste der drei Wirtinnen am Ort. Somit bestand die Gefahr, dass in Grengiols die zwei anderen Restaurants auch schliessen und wir ein Dorf ohne Beiz wären. Also meldete ich mich beim Gemeindepräsidenten und beim Landschaftspark Binntal (LP Binntal). Dort rannte ich offene Türen ein, da man bereits beschlossen hatte, das früher angestossene Projekt «Dorfkernerneuerung» zu aktivieren.
Und dieses Projekt führte in Grengiols schliesslich zum dezentralen Hotel POORT A POORT?
Tatsächlich wurde im LP Binntal bereits ab 2005 über ein dezentrales Hotel nachgedacht, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Es ging vor allem um die Bewirtschaftung der Ferienwohnungen. Diese Idee fing jedoch nie richtig Feuer. Einen neuen Anlauf starteten wir 2011/12. Nach einem Gang durchs Dorf hockten wir an einen runden Tisch, breiteten unsere Ideen aus, setzten einen kreativen Prozess in
Si nous remontons le temps, comment se présente Grengiols au tournant du siècle?
De nombreux bâtiments modernes s’élèvent à la périphérie du village. Ils appartiennent à des gens de la région qui ont fondé une famille et construit hors du centre. Avec pour conséquence que les maisons anciennes du centre sont désertées et restent vides.
J’ai lu que l’on redoutait alors qu’il n’y ait plus de bistrot au village et que cette perspective vous avait effrayé ... Oui, c’est ce que l’on craignait il y a une décennie. Grengiols avait trois cafés: les habitants les nommaient «Oberschta», «Mittleschta» et «Unnerschta». J’ai entendu le signal d’alarme lorsque la gérante du restaurant Bettlihorn a annoncé en 2014 qu’elle arrêterait son activité au printemps 2015. Née en 1949, elle était la plus jeune parmi les trois tenancières! On voyait soudain se profiler la fermeture des deux autres bistrots et le village aurait été privé de

Beat Ritz vor dem ehemaligen Restaurant Bettlihorn im Zentrum von Grengiols, der Auftakt zum dezentralen Dorfhotel POORT A POORT. Beat Ritz devant l’ancien Restaurant Bettlihorn au centre de Grengiols, le point de départ de l’hôtel décentralisé POORT A POORT.
Gang und stellten fest, wie der Gedanke eines dezentralen Hotels immer wieder ein Thema wurde.
Was Sie weiter verfolgt und schliesslich mit dem Hotel POORT A POORT auch realisiert haben. Wie sind Sie konkret vorgegangen?
In den Jahren 2010 und 2011 haben wir den Bestand im Dorfkern inventarisiert, dabei den Typ der Wohnungen festgehalten und in welchem Zustand sie sind. Geklärt wurde auch die Frage der Nutzung und der Eigentümerschaft und was diese mit den leer stehenden Wohnungen vorhat.
Wie aber brachten Sie die Eigentümerschaft dazu, das Restaurant Bettlihorn samt Wohnung im oberen Stock der Stiftung Dorf am Bettlihorn zu verkaufen?
Die Eigentümer verfolgten unsere Arbeit mit Interesse und sahen, dass wir mit dem Projekt POORT A POORT am gleichen Ort ihren geliebten Gastbetrieb weiterführen wollen. Sie waren begeistert. Etwas mehr Überzeugungskraft war beim Erwerb der einstigen Wirtewohnung im oberen Stock nötig, die bisher von einem Sohn der Erbengemeinschaft als Ferienwohnung genutzt wurde. 2022 war es dann so weit.
Ideen entwickeln ist das eine, sie umzusetzen, das andere. Wie sind Sie in Grengiols vorgegangen?
Um eine juristische Person als Ansprechpartner zu haben, gründeten wir zuerst einen Verein mit dem Zweck
tout établissement public. J’ai contacté le président de la commune et la direction du Parc naturel de la vallée de Binn (LP Binntal) et j’ai constaté que je prêchais des convertis car ils avaient déjà décidé de relancer le projet «Renouveau du centre historique».
Et ce projet a abouti au concept d’hôtel décentralisé POORT A POORT? Une réflexion avait déjà été engagée dès 2005 au sein du LP Binntal autour d’un hôtel décentralisé, avec une autre priorité. Il s’agissait avant tout d’exploiter des logements de vacances. Mais l’idée n’a jamais vraiment pris. Nous l’avons relancée vers 2011–2012. Après une visite du village, nous nous sommes réunis autour d’une table, avons échangé nos réflexions, lancé une démarche créative et constaté qu’on en revenait toujours au concept d’un hôtel décentralisé.
Une idée que vous avez approfondie et finalement réalisée avec l’hôtel POORT A POORT ... Comment avezvous procédé concrètement? En 2010 et 2011, nous avons effectué un inventaire des bâtiments au centre, en relevant le type et l’état des logements. Les questions de l’utilisation et de la propriété avaient aussi été abordées, ainsi que les intentions des propriétaires concernant les logements vacants.
Comment avezvous convaincu les propriétaires de vendre le restaurant Bettlihorn, avec l’appartement à l’étage, à la fondation Dorf am Bettlihorn?
Les propriétaires suivaient notre travail avec intérêt et ont constaté que le projet POORT A POORT permettrait de poursuivre l’exploitation de leur cher restaurant au même endroit – bref, ils étaient enthousiastes. Il a fallu davantage d’efforts pour acquérir l’ancien appartement du cafetier à l’étage, qui était alors utilisé comme résidence secondaire par un des fils de la communauté d’héritiers. On y est parvenu en 2022.
Développer des idées est une chose et les réaliser en est une autre. Comment avezvous procédé à Grengiols?
Afin d’agir en tant que personne morale, nous avons d’abord créé une association dédiée à la «rénovation et à l’animation du centre historique». Elle se concentre sur les manifestations: on peut citer la fête du village en 2019 durant laquelle nous avons présenté une chambre témoin et lancé le financement participatif pour l’hôtel. En avril 2019, la société POORT A POORT Dorfhotel AG a été fondée et en décembre la fondation Dorf am Bettlihorn. D’emblée, il était important que le projet soit porté par une fondation, pour réunir les moyens financiers et pour assurer la séparation du patrimoine de la fondation. Le prêtre
Eduard Imhof, récemment décédé, a été notre premier gros donateur.
C’est lui qui a trouvé le nom POORT A POORT ...
Eduard Imhof était un homme plein de fantaisie, qui connaissait la langue et les coutumes du village. Il nous a sou-
Meine Vision: Dass in möglichst vielen Wohnungen abends ein Licht brennt – als Zeichen dafür, dass hier gelebt wird. Ma vision est de voir une lumière allumée
le soir dans un grand nombre de logements, montrant ainsi que l’on y habite.
Er hat dem Hotel auch den Namen POORT A POORT gegeben. Pfarrer Imhof war ein fantasievoller und mit der Sprache und den Gepflogenheiten des Dorfes vertrauter Geist. Er hatte uns eine Liste mit rund 30 Namen zur Auswahl vorgelegt. Das Walliserdeutsche POORT A POORT hat uns für unser Projekt mit den damit verbundenen Zielen am besten gefallen.
Das Projekt stand, der Name auch. Nebst der Frage, wie die Erneuerung des Dorfkerns gestalterisch umgesetzt werden kann, beschäftigte wohl auch die Frage der Finanzierung? Mit der Inventarisierung hatten wir uns schon ein gutes Bild über die infrage stehenden Objekte machen können. 2017 hatten wir – Monika Holzegger, die das Projekt Dorfkernerneuerung beim LP Binntal geleitet hat, Architekt David Ritz und ich – bereits sehr konkrete Vorstellungen und wünschten, unsere Vision am Ort des einstigen Restaurants Bettlihorn realisieren zu können. Und ja, die Finanzierung dafür war eine Knacknuss. Immerhin mussten rund zwei Millionen Franken aufgetrieben werden. Ein Meilenstein war im März 2022 die Zusage einer grossen Spende. Jetzt wussten wir, dass wir wichtige Schritte wagen können: den Kauf und den Umbau des Restaurants Bettlihorn samt darüber liegender Wohnung.
Welche gestalterischen Prämissen bestimmten den Umbau?
Unser Slogan «Altes beleben, Neues bewirken» bringt diese Prämissen gut zum Ausdruck. Unser Ziel war, so viel wie möglich zu erhalten und nur das zu ändern, was für die Realisierung

Mit dem dezentralen Dorfhotel soll Leben
L’hôtel décentralisé doit redonner vie au village.
nötig und sinnvoll ist. So wurden die Aussenmauern im Erdgeschoss Ost fachmännisch bearbeitet und an zwei Ecken mit Verzierungen versehen, wie sie in anderen Gebäuden im Dorfkern vorhanden sind. Die Fenster wurden erneuert, aber nicht ersetzt. Im Innern der Zimmer blieb vieles beim Alten. Die Tragbalken samt Inschriften machen die Geschichte des Hauses lesbar. Grössere Eingriffe erfolgten im Restaurant, das über die Jahre immer wieder umgebaut worden war. Neu präsentiert es sich als grossen Raum mit passender Holzmöblierung. Im Raum stehen geblieben ist ein Giltsteinofen von 1896, den wir sanieren liessen.
Hotel wie Restaurant wurden im September 2024 eröffnet. Was bietet das Dorfhotel POORT A POORT rein räumlich an?
Das Dorfhotel umfasst aktuell das Restaurant im Erdgeschoss und darüber drei Zimmer mit eigenen Nasszellen sowie einzelne Nebenräume. 2023 hat die Stiftung eine weitere Wohnung oberhalb des Restaurants Grängierstuba gekauft, das von einem Wirtepaar betrieben wird. Mit ihnen haben wir uns betrieblich so arrangiert, dass in Grengiols immer eine Beiz offen ist.
Wenn Sie als Präsident der Stiftung Dorf am Bettlihorn nicht an Finanzen denken müssten: Was wäre in Grengiols noch wünschenswert?
mis une liste d’une trentaine de noms. L’expression haut-valaisanne POORT A POORT nous a plu et nous a paru la plus en phase avec nos objectifs.
Le projet a été lancé, et le nom trouvé. Au delà de la renaissance du centre se pose aussi la question du financement?
Lors de l’inventaire, nous avons déjà pu nous faire une idée des objets qui entraient en ligne de compte. En 2017, Monika Holzegger, qui a dirigé le projet «Renouveau du centre historique» au sein du LP Binntal, l’architecte David Ritz et moi-même avions déjà des vues très concrètes et nous entendions réaliser notre projet sur le site de l’ancien restaurant Bettlihorn. Mais oui, le financement était un casse-tête: il fallait réunir quelque 2 millions de francs. Une étape a été franchie en mars 2022 avec la promesse d’un don important. Dès lors, nous savions que nous pouvions avancer avec l’achat et la transformation du restaurant et de l’appartement.
Quelles étaient les conditions formelles régissant la transformation? Notre slogan «Faire revivre l’ancien, inventer le nouveau» illustre bien ces conditions. Notre objectif était de préserver autant que possible et de ne changer que ce qui était nécessaire et judicieux pour la réalisation. À l’est, le mur extérieur au rez-de-chaussée a été rénové par des professionnels et «Erneuerung und Belebung des Dorfkerns». Dieser Verein fokussiert sich in erster Linie auf Veranstaltungen. Eine war das Dorffest von 2019, an dem wir einerseits Musterzimmer präsentierten, andererseits das Crowdfunding für das Dorfhotel lancierten. Im April 2019 wurde die POORT A POORT Dorfhotel AG gegründet, im Dezember desselben Jahres die Stiftung Dorf am Bettlihorn. Dass das Projekt von einer Stiftung getragen wird, war von Anfang an wichtig, allein schon wegen der Mittelbeschaffung und zur personellen Entflechtung des Stiftungsvermögens. Mit dem kürzlich verstorbenen Dorfpfarrer Eduard Imhof hatten wir den ersten Hauptstifter.
ins Dorfzentrum zurückkehren.
Nach der Inventarisierung haben wir uns beim Dorfhotel zuerst auf vier Objekte festgelegt: Das Restaurant POORT A POORT mit drei Hotelzimmern ist realisiert. Die Baubewilligung liegt vor, um auch die 2023 erworbene Wohnung oberhalb der «Grängierstuba» umbauen zu dürfen. Es sind aber noch ein paar Sachen zu klären und die nötigen Geldmittel zu beschaffen. Aktuell suchen wir noch einen Raum, um dort die hoteleigene «Waschküche» unterbringen zu können. Ein Objekt, das wir in der Inventarisierung erfasst hatten, wurde von privater Seite erworben und umgebaut. Das ist gut so und passt durchaus zu den Zielen der Belebung und Erneuerung des Dorfkerns. Wir schätzen selbstredend auch entsprechende private Initiativen. Was wir uns später einmal – die personellen Kapazitäten vorausgesetzt – durchaus vorstellen könnten, sind Dienstleistungen für Wohnungsbesitzer bei der Vermietung von Ferienwohnungen.
Bei der Eröffnung von POORT A POORT sprachen Sie von einem «Puzzle im Gesamtkonzept». Wie sieht das Bild aus, wenn das letzte Puzzleteil gesetzt ist?
Ich wünsche mir die Zusammenarbeit von allen im Dorf, damit die Wohnungen im Dorf möglichst zeitgemäss umgebaut und neu genutzt werden und damit das Dorf wieder mehr belebt wird. Meine Vision: Dass in möglichst vielen Wohnungen abends ein Licht brennt – als Zeichen dafür, dass hier gelebt wird.
Sie wurden für Ihr Engagement mit Auszeichnungen geehrt. Denken Sie, dass Grengiols für andere Gemeinden Modell stehen könnte?
Durchaus. Während unseres Findungsprozesses habe ich Gemeinden mit ähnlichen Problemen und Aktivitäten besucht. Ich war in Vnà im Unterengadin; mit dem Projektteam haben wir das Albergo diffuso in Corippo (TI) angeschaut und uns im bündnerischen Valendas schlau gemacht. Wir haben die nationale Dorfkerntagung 2019 erstmals hier in Grengiols (mit)organisiert und dabei unser Konzept vorgestellt; andere Orte präsentierten ihre Visionen und Lösungen. Klar, jeder Ort hat seine spezifischen Probleme, doch ich bin überzeugt, dass das, was wir hier entwickelt haben, durchaus Modellcharakter haben kann.
pourvu de décorations comme on en voit sur d’autres bâtiments dans le village. Les fenêtres ont été rénovées, mais pas remplacées. Les éléments anciens ont été largement conservés dans les pièces. Avec leurs inscriptions, les poutres racontent l’histoire du bâtiment. Le restaurant, qui avait déjà été largement modifié au fil des ans, a été l’objet d’interventions plus étendues. Il comporte maintenant un grand espace ouvert, aménagé avec des meubles en bois choisis avec soin et un poêle en pierre ollaire de 1896 que nous avons fait restaurer.
L’hôtel et le restaurant ont été ouverts en septembre 2024. Comment se présente aujourd’hui l’offre de l’hôtel POORT A POORT?
L’hôtel villageois se compose actuellement du restaurant au rez et à l’étage de trois chambres équipées de salles de bains ainsi que de locaux annexes. En 2023, la fondation a acquis un autre appartement au-dessus du restaurant «Grängierstuba» qui est exploité par un couple. Nous nous sommes arrangés avec eux de manière qu’il y ait toujours un café ouvert à Grengiols.
Si vous faites abstraction des aspects financiers, qu’est ce que vous considérez comme souhaitable pour le village en tant que président de la fondation Dorf am Bettlihorn?
Après l’inventaire, nous nous sommes investis en premier lieu pour l’hôtel villageois et pour quatre autres objets. Le restaurant POORT A POORT avec ses trois chambres est réalisé. Nous disposons du permis de construire pour transformer l’appartement acquis en 2023 au-dessus du café «Grängierstuba» – il y faut encore clarifier quelques aspects et réunir le financement. Actuellement, nous sommes encore à la recherche d’un local afin
d’y installer la buanderie de l’hôtel. Un objet que nous avions inscrit sur notre inventaire a été acquis et rénové par un particulier. C’est bien ainsi et ça correspond en gros à nos objectifs d’animation et de réhabilitation du centre. Bien entendu, nous ne pouvons qu’approuver de telles initiatives privées. Pour ce qui nous concerne et dans la mesure des capacités en personnel, nous pouvons tout à fait imaginer fournir des services aux propriétaires qui louent des appartements de vacances.
Lors de l’ouverture de POORT A POORT, vous aviez parlé d’un «puzzle dans un concept global». Que représentera le puzzle lorsque la dernière pièce aura été posée?
Je souhaite que tout le monde collabore dans le village pour que les appartements soient rénovés et occupés, afin que le village soit plus vivant. Ma vision est de voir une lumière allumée le soir dans un grand nombre de logements, montrant ainsi que l’on y habite.
Vous avez été récompensés pour votre engagement. Pensezvous que Grengiols puisse servir d’exemple pour d’autres communes?
Sans aucun doute. Durant la procédure de recherche, j’ai visité des communes qui se heurtaient aux mêmes problèmes et menaient les mêmes actions. Je suis allé à Vnà, en Basse-Engadine, nous avons rencontré l’équipe de l’Albergo diffuso à Corippo (TI) et nous nous sommes inspirés de Valendas (GR). En 2019, nous avons coorganisé pour la première fois la journée nationale «Cœur de village» et présenté notre projet aux côtés d’autres localités. Naturellement, chaque site est confronté à des difficultés spécifiques mais je suis convaincu que ce que nous avons développé ici revêt un caractère exemplaire.
Mehr erfahren: Unter heimatschutz.ch/interview findet sich eine ausführliche Version des Gesprächs. Darin verrät Beat Ritz zum Beispiel, wie die Dorfgemeinschaft auf das Projekt reagiert hat oder wie der Betrieb im letzten Herbst angelaufen ist.
Pour en savoir plus: sous patrimoinesuisse.ch/interview, l’entretien est à disposition en intégralité. Beat Ritz y révèle par exemple comment la communauté villageoise a réagi au projet. Il tire aussi un premier bilan de l’exploitation durant l’automne dernier.
LÀ OÙ LA PIERRE REPREND VOIX
DORT,
WO DER STEIN WIEDER SPRICHT
Au fond de la vallée tessinoise d’Onsernone, là où le silence se mêle aux façades de pierre, Mosogno di Sotto veille. Sept âmes y vivent à l’année, gardiens d’un passé que l’oubli menace. Mais aujourd’hui, patiemment, des mains reconstruisent et redonnent souffle à ces murs qui racontent une histoire ancienne.
Mosogno di Sotto compte plus de maisons que d’habitants. C’est dans ce petit hameau suspendu au relief escarpé que certains membres du collectif Squadra ont pris part à la restauration de deux maisons du village, en collaboration avec leurs propriétaires et une communauté élargie d’artisans et d’amis. Pas en bâtisseurs conquérants, mais en alliés du lieu, en médiateurs entre l’architecture et le territoire. Leur ap -

Am Ende des Tessiner Onsernonetals, wo Stille die Steinfassaden umgibt, liegt Mosogno di Sotto. Sieben Seelen leben dort das ganze Jahr über, Hüterinnen einer vom Vergessen bedrohten Vergangenheit. Heute bauen geduldige Hände verlassene Mauern wieder auf und hauchen ihnen neues Leben ein.
In Mosogno di Sotto gibt es mehr Häuser als Einwohnerinnen und Einwohner. In diesem Weiler, der an einem steilen Berghang klebt, haben einige Mitglieder des Kollektivs Squadra zusammen mit Eigentümerinnen, Handwerkern und Freundinnen zwei Häuser restauriert. Nicht als erobernde Baumeister, sondern als Verbündete des Ortes, als Vermittlerinnen zwischen Architektur und Territorium. Ihr Ansatz? Eine partizipative Architektur, bei der die Baustelle zu einem Ort des Lernens und der Weitergabe wird, wo jeder gesetzte Stein das Ergebnis eines Dialogs zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist. In Mosogno di Sotto haben diese Eingriffe es ermöglicht, vernachlässigte Räume wiederzubeleben und eine fragile, aber lebendige Verbindung zwischen dem Wissen von gestern und den Gewohnheiten von morgen herzustellen.
Bauen im Dialog mit der Vergangenheit
Der Bau der Casa Giuseppina in Zusammenarbeit mit Isabel Lehn-Blazejczak und Florian Stieger war eine Gratwanderung zwischen Erhalt und Anpassung. Die jahrhundertealten, vom Zahn der Zeit gezeichneten Steinmauern wurden verstärkt, ohne in eine sterile Musealisierung zu verfallen. Der historische Terrazzo, der Tadelakt im Badezimmer, Holz und Granit aus der Region zeugen von einem tiefen Respekt vor der Identität des Ortes. Hier zielt jeder Eingriff in erster Linie darauf ab, das Bestehende zu erhalten und bewohnbar zu machen, im ständigen Dialog mit dem Gebäude und seinen ursprünglichen Materialien.
Aber nicht nur die architektonische Qualität macht dieses Projekt zu einem Erfolg. Es ist auch die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde: eine offene Baustelle, auf der lokale Handwerker, Studentinnen und Freunde gemeinsam dazu beigetragen haben, den verlassenen Häusern neues Leben einzuhauchen. «Man musste immer auf das Vorhandene reagieren, sich dem Unerwarteten anpassen», sagt Alessio Gottardi, einer der Architekten des Kollektivs.
Weit entfernt von einem starren Ansatz nahm Squadra jede Entdeckung – ein versteckter Sturz, eine vergessene Steinstruktur – zum Anlass, das Projekt zu überdenken. Diese Flexibilität spiegelte sich auch im wirtschaftlichen Modell der Baustelle wider: Ohne eine fest vorgegebene Planung entwickelte sich der Auftrag im Laufe der Zeit, in einem Gleichgewicht zwischen Notwendigkeit und Intuition. Squadra konnte auf eine Bauherrschaft zählen, die ihnen vertraute
Stefania Boggian, architecte EPFL, Patrimoine suisse
À Mosogno di Sotto, le collectif Squadra a restauré deux maisons et recherché le dialogue avec les habitants. In Mosogno di Sotto hat das Kollektiv Squadra zwei Häuser restauriert und den Dialog mit den Einheimischen gesucht.
Dario
Bosio

Entre préservation et transformation, les interventions apportées à la Casa Giuseppina respectent la substance bâtie et la font évoluer en douceur. Zwischen Erhalt und Weiterentwicklung: Die Eingriffe in der Casa Giuseppina respektieren den Bestand und führen ihn behutsam weiter.
proche? Une architecture participative, où le chantier devient un espace d’apprentissage et de transmission, où chaque pierre posée est le fruit d’un dialogue entre le passé et le présent. À Mosogno di Sotto, ces restaurations ont permis de raviver des espaces délaissés, tissant un lien, fragile mais vivant, entre les savoir-faire d’hier et les usages de demain.
Construire en dialogue avec le passé
La construction de la Casa Giuseppina, en collaboration avec Isabel Lehn-Blazejczak et Florian Stieger, a été un exercice d’équilibre entre conservation et adaptation. Les murs de pierre centenaires, fatigués par le temps, ont été consolidés sans les figer dans une muséification stérile. Le terrazzo historique au sol, le tadelakt dans la salle d’eau, le bois et le granit local témoignent d’un respect profond pour l’identité du lieu. Ici, chaque intervention vise avant tout à préserver l’existant et à le rendre habitable, en dialogue constant avec le bâti et ses matériaux d’origine.
und eine organische Entwicklung akzeptierte, bei der die Entscheidungen sowohl von den materiellen Gegebenheiten als auch von den Möglichkeiten des Ortes bestimmt wurden. Durch die Beschränkung der Eingriffe auf das Notwendigste und die Einbindung des lokalen Know-hows ist es gelungen, die Seele des Ortes zu bewahren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Jede Baustelle ist mehr als nur eine Frage der Effizienz, sie wird zu einem Lernraum, in dem das Experiment und die Weitergabe eine zentrale Rolle spielen.
Architektur als soziale Strategie
Die Frage nach der Zukunft der abgelegenen Dörfer beschränkt sich nicht auf die bauliche Instandsetzung. Im Tessin wie anderswo verändert das Phänomen der Zweitwohnungen das soziale Gefüge grundlegend. Viele Weiler verlieren nach und nach ihre ständige Bewohnerschaft und machen Platz für Ferienhäuser, die die meiste Zeit des Jahres unbewohnt sind. Squadra versucht auf diese Herausforderung zu
Pierre Marmy
Mais ce qui fait de ce projet une réussite, ce n’est pas seulement la justesse architecturale. C’est aussi la manière dont il a été mené: un chantier ouvert, où artisans locaux, étudiants et amis ont contribué ensemble à redonner vie à ces maisons abandonnées. «Il fallait toujours réagir à la substance préexistante, s’adapter à l’inattendu», confie Alessio Gottardi, l’un des architectes du collectif.
Loin d’une approche figée, Squadra a privilégié un processus évolutif, où chaque découverte – un linteau caché, une texture de pierre oubliée – devenait une opportunité de repenser le projet. Cette souplesse s’est aussi reflétée dans le modèle économique du chantier: sans planification immuable, l’intervention s’est construite au fil du temps, dans un équilibre entre nécessité et intuition. Squadra a pu compter sur des maîtres d’ouvrage prêts à leur faire confiance, acceptant une progression organique où les décisions étaient guidées autant par les contraintes matérielles que par les potentialités révélées par le site lui-même. En limitant les interventions au strict essentiel et en s’appuyant sur les savoir-faire locaux, ils ont su préserver l’âme du lieu tout en maîtrisant les coûts. Plus qu’une simple question d’efficacité, chaque chantier devient un espace d’apprentissage, où l’expérimentation et la transmission jouent un rôle central.
L’architecture comme stratégie sociale
La question de l’avenir des villages reculés ne se limite pas à leur restauration physique. Au Tessin, comme ailleurs, le phénomène des résidences secondaires transforme profondément le tissu social. De nombreux hameaux se vident peu à peu de leurs habitants permanents, laissant place à des maisons saisonnières inhabitées une grande partie de l’année. Squadra cherche à répondre à ce défi en intégrant une communauté élargie dans le processus, en favorisant une réappropriation collective des lieux, en redonnant une vocation vivante et partagée à ces espaces. Leur approche ne vise pas à faire revivre un village comme une carte postale figée, mais à l’ancrer dans une dynamique contemporaine, où l’architecture devient aussi un outil de lien social et pas seulement un moyen de préservation.
Et après?
L’histoire de Mosogno di Sotto ne s’arrête pas là. D’autres maisons abandonnées attendent leur tour, et avec elles, la question du futur de ces villages reculés. Peut-on leur insuffler une nouvelle vie sans les transformer en simples résidences secondaires? Peut-on recréer une dynamique communautaire, un espace où habiter ne serait pas seulement un acte privé, mais un engagement envers un territoire?
Pour Squadra, l’enjeu dépasse le simple cadre de la rénovation architecturale. C’est une réflexion sur la manière dont nous habitons le monde, dont nous prenons soin des lieux et des mémoires qu’ils portent. À Mosogno di Sotto, ils ont esquissé une réponse: en construisant ensemble, en respectant les rythmes du lieu, en laissant la pierre respirer. En faisant de l’architecture aussi un acte d’écoute, et pas seulement de transformation.
Squadra est un collectif d’architectes indépendants installés à Bellinzone, Barcelone, Bâle et Zurich, qui met l’accent sur la collaboration, le partage de connaissances et les processus participatifs. L’objectif consiste à rapprocher la planification et la réalisation, afin de faciliter le dialogue entre les intervenants et d’aboutir à un processus créatif plus libre.
reagieren, indem es einen gemeinsamen Prozess anstrebt, eine kollektive Wiederaneignung der Orte fördert und diesen Räumen eine lebendige und gemeinsame Bestimmung zurückgibt. Ihr Ansatz zielt nicht darauf ab, ein Dorf wie eine erstarrte Postkarte wiederzubeleben, sondern es in einer zeitgenössischen Dynamik zu verorten, in der die Architektur auch zu einem Instrument zur sozialen Bindung wird und nicht nur ein Mittel zur Erhaltung bleibt.
Wie geht es weiter?
Die Geschichte von Mosogno di Sotto ist nicht zu Ende. Weitere verlassene Häuser warten auf ihre Nutzung und mit ihnen die Frage nach der Zukunft dieser abgelegenen Dörfer. Kann man ihnen neues Leben einhauchen, ohne sie zu reinen Zweitwohnsitzen zu machen? Kann man eine gemeinschaftliche Dynamik wiederherstellen, einen Raum, in dem das Wohnen nicht nur eine private Angelegenheit ist, sondern eine Verpflichtung gegenüber dem Ort?
Für Squadra geht es um mehr als den rein baulichen Eingriff. Es geht um die Art und Weise, wie wir die Welt bewohnen, wie wir mit den Orten und den Erinnerungen, die sie in sich tragen, umgehen. In Mosogno di Sotto haben sie eine Antwort skizziert: indem sie gemeinsam bauen, die Rhythmen des Ortes aufnehmen und den Stein atmen lassen. Indem sie Architektur auch zu einem Akt des Zuhörens und nicht nur der Transformation machen.
Squadra ist ein Kollektiv freischaffender Architektinnen und Architekten in Bellinzona, Barcelona, Basel und Zürich. Sie setzen auf kollaboratives Arbeiten, Wissensaustausch und partizipative Prozesse. Ihr Ziel ist es, die Planung und Umsetzung näher zusammenzubringen, um die Kommunikationswege zu verkürzen und eine freiere Gestaltung zu ermöglichen.

La «chambre d’été», sous le toit, est à nouveau habitable grâce à Squadra. Das «Sommerzimmer» ist dank des Einsatzes von Squadra wieder bewohnbar.
Pierre Marmy
DAS GOMS LÄDT ZUM DIALOG
GOMS INVITE AU DIALOGUE
Norbert Russi, Architekt und Raumplaner, Siedlungsberatung EspaceSuisse
Der Andrang war gross, als die Walliser Gemeinde Goms ihre Zweitwohnungsbesitzerinnen und besitzer letzten Sommer zu einem Dorfgespräch einlud. Der Anlass zeigte, dass die Zweitheimischen nicht nur konsumieren und fordern, sondern auch mittun, mithelfen und mitdenken – und vor allem gut informiert sein wollen.
Es ist voll, laut und die Stimmung gesprächig an diesem Samstagmorgen in der Mehrzweckhalle von Münster, dem grössten Dorf der Oberwalliser Gemeinde Goms. Bei einem Glas Wein und einem Imbiss sitzen Vertreter der Gemeinde und sowie Besitzerinnen und Besitzer von Zweitwohnungen zusammen und lassen den Vormittag Revue passieren. Die Gemeinde hat zum Dorfgespräch eingeladen. Dieses niederschwellige Beratungsangebot des Raumplanungsverbands EspaceSuisse fand bereits mehrmals erfolgreich in verschiedenen Gemeinden der Schweiz statt – jeweils begleitet und moderiert vom Team Siedlungsberatung von EspaceSuisse. Die Geschichte beginnt allerdings ein bisschen früher: Fünf Gemeinden haben sich 2017 zur Gemeinde Goms zusammengeschlossen. Gesamthaft besteht die Gemeinde heute aus 13 Dörfern und Kleinsiedlungen. Gemäss Gemeindepräsident Gerhard Kiechler hat die Bevölkerung der einzelnen Ortschaften die Fusion gut «verdaut». Dennoch war es ihm ein Anliegen, den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung die Gelegenheit für einen offenen Austausch zu bieten. Und so konnte EspaceSuisse
DAS DORFGESPRÄCH
Das Beratungsinstrument von EspaceSuisse bietet Gemeindebehörden ein Gefäss, um mit der Bevölkerung einen Dialog über die Zukunft ihres Dorfes zu führen. Teilnehmende diskutieren an einem öffentlichen, unabhängig moderierten Anlass in Gruppen und im Plenum über verschiedene aktuelle Themen und mögliche Entwicklungsstrategien. Die Aussensicht und die externe Moderation helfen mit, zu neuen Ideen, Anregungen und Einschätzungen zu gelangen. Zur Vorbereitung des Gesprächs gehört ein intensiver Austausch mit den Verantwortlichen der Gemeinde zur Ist-Situation – meist in Verbindung mit einer ganztägigen Begehung vor Ort. Das Dorfgespräch erfordert Mut: In der Regel erfolgt die Wahl der Inhalte und Themen durch die Expertinnen und Experten von EspaceSuisse. Nur in Ausnahmefällen lassen sie sich in die Karten schauen. Bisher hat es laut EspaceSuisse noch keine Gemeinde bereut.
espacesuisse.ch
La salle était pleine à craquer lorsque la commune valaisanne de Goms a invité l’été dernier les propriétaires de résidence secondaire à participer à un atelier village. La manifestation a montré que les hôtes réguliers de la commune ne se contentent pas de consommer et d’exiger, mais qu’ils participent, aident et réfléchissent, et surtout qu’ils veulent être bien informés.
En ce samedi matin d’août 2024, la salle polyvalente de Münster, le plus grand village de la commune haut-valaisanne de Goms (aussi appelée Conches en français), est pleine à craquer et les discussions sont animées. Réunis autour d’un apéritif, les représentants de la commune et les propriétaires de résidence secondaire passent en revue la matinée. La commune a organisé un atelier village. L’équipe du conseil en aménagement d’EspaceSuisse a déjà conduit de nombreuses fois cette forme de conseil, destinée à faciliter la participation de la population, avec succès dans plusieurs communes suisses.
L’histoire commence quelques années plus tôt. En 2017, cinq communes haut-valaisannes ont fusionné pour former la commune de Goms. Aujourd’hui, la nouvelle entité communale compte 13 villages et petites entités urbanisées. De l’avis de son président, Gerhard Kiechler, la population des différentes localités a bien «digéré» la fusion. Il souhaitait cependant donner aux habitantes et habitants de la commune l’occasion d’un échange de vues ouvert, lors d’une manifestation publique. EspaceSuisse a donc pu organiser un premier atelier village au début de l’été 2023. Les discussions ont montré que la sécurité, la circulation, le vivre-ensemble et l’avenir de la commune en tant que destination touristique étaient les thèmes brûlants aux yeux de la population locale.
Seulement pour la population locale … L’exécutif avait à dessein invité seulement la population locale à ce premier atelier village. Il voulait entendre les voix de celles et ceux qui habitent et travaillent toute l’année dans la commune. Depuis la fusion, il y a sept ans, les représentants de la commune doivent en effet mener de front une double tâche d’intégration: améliorer la confiance et favoriser la cohésion de la population dans les différentes localités, d’une part, et coordonner le vivre-ensemble entre la population locale, les propriétaires de résidence secondaire et les hôtes de Goms, d’autre part. La commune a un taux de résidences secondaires supérieur à 75 % (état en 2023; en 2011, le taux était encore de 57 %), ce qui n’est pas sans conséquences: la population locale et les propriétaires de résidence secondaire n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes préoccupations, ce qui crée inévitablement des tensions.

im Frühsommer 2023 ein erstes Dorfgespräch durchführen. Es zeigte sich, dass der einheimischen Bevölkerung die Themen Sicherheit, Verkehr, Zusammenleben im Goms und die Zukunft ihrer Gemeinde als Tourismusdestination am stärksten unter den Nägeln brennen.
Nur für Einheimische … Zu diesem ersten Dorfgespräch hatte die Gemeinde bewusst nur die einheimische Bevölkerung eingeladen. Sie wollte die Stimmen derer hören, die das ganze Jahr über in der Gemeinde leben und arbeiten. Seit der Fusion vor sieben Jahren hat die Gemeinde eine doppelte Integrationsleistung zu bewältigen: das Vertrauen und den Zusammenhalt der Bevölkerung
… et pour les propriétaires de résidence secondaire
Encouragé par les réactions positives au premier atelier village, le conseil municipal de Goms décida d’organiser une deuxième manifestation avec EspaceSuisse, cette fois pour les propriétaires de résidence secondaire. L’invitation suscita un tel écho qu’il fallut chercher une plus grande salle. Le nombre des participants a finalement été limité à 160 personnes. En amont de l’atelier village, les propriétaires de résidence secondaire ont pu répondre à un questionnaire qui portait sur la vie en commun, la communication, la participation et les problèmes qui les préoccupaient. Le questionnaire a été envoyé à 2130 personnes, et 245 y ont répondu. Les attentes des participants à l’égard de l’atelier village étaient donc grandes.
Das schmucke Reckingen ist eines der 13 Dörfer und Kleinsiedlungen der Walliser Gemeinde Goms. Reckingen, et son cadre pittoresque, est l’un des 13 villages et petites entités urbanisées de la commune valaisanne de Goms.
Florian Inneman, EspaceSuisse
in den verschiedenen Siedlungen fördern sowie das Zusammenleben der Einheimischen mit Zweitheimischen und Gästen im Goms koordinieren. Die Gemeinde weist einen Zweitwohnungsanteil von über 75 Prozent auf (Stand 2023; 2011 waren es noch 57 %). Dies hat Konsequenzen: Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer haben nicht dieselben Bedürfnisse und Anliegen, was unweigerlich zu Spannungen führt.
… und für Zweitheimische
Die positiven Reaktionen auf das erste Dorfgespräch haben den Gemeinderat von Goms ermutigt, zusammen mit EspaceSuisse einen zweiten Anlass für die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer zu organisieren. Das Echo auf diese Einladung war so gross, dass ein grösserer Versammlungsraum gesucht werden musste. Die Teilnehmerzahl wurde schliesslich auf 160 Personen beschränkt.
Im Vorfeld des Dorfgesprächs konnten die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer eine Online-Umfrage zum Zusammenleben, zur Kommunikation, zur Mitwirkung sowie zu Problemen, die sie beschäftigen, ausfüllen. 2130 Personen wurden angeschrieben, 245 haben die Umfrage ausgefüllt. Und so kamen die Teilnehmenden mit hohen Erwartungen zum Austausch.
Tâter le terrain
Revenons maintenant à ce samedi matin d’août 2024, au cours duquel les personnes présentes ont pu poser leurs questions et exprimer leurs points de vue en plénum et dans des petits groupes. La situation était inhabituelle pour beaucoup d’entre elles, et il était donc important de bien préparer l’animation et le déroulement des discussions pour que la manifestation soit structurée et constructive.
L’atelier village n’a pas vocation de résoudre des problèmes à court terme.
Lors d’un atelier village, le regard extérieur amené par EspaceSuisse peut parfois prendre la forme de postulats provocateurs et impertinents. Dans le cas de Goms, l’exécutif communal a été courageux, car il ne savait pas sur quels sujets les deux experts proposeraient de discuter. Et en effet, après une

Die Bevölkerung tauschte sich in den Dorfgesprächen über die Zukunft der Gemeinde Goms aus. EspaceSuisse schafft damit einen niederschwelligen Dialog auf Augenhöhe, der neue Formen des Miteinanders hervorbringt. La population a échangé sur l’avenir de la commune de Goms dans le cadre des ateliers village. EspaceSuisse instaure ainsi un dialogue accessible et sur un pied d’égalité, propice à l’émergence de nouvelles formes de cohabitation.
Auf den Busch geklopft
Zurück also zu diesem Vormittag im August 2024: Die Anwesenden hatten Gelegenheit, im Plenum oder in Kleingruppen Fragen und Anliegen vorzubringen. Dieses Setting war für viele ungewohnt. Gerade deshalb sind eine gut vorbereitete Moderation und eine Strukturierung des Ablaufs entscheidend, um die Veranstaltung in geordnete Bahnen zu lenken. EspaceSuisse bringt beim Dorfgespräch eine Aussensicht in Form von manchmal provokativen und zugespitzten Thesen ein. Im Fall von Goms bewies die Gemeindeexekutive viel Mut: Sie wusste nicht, welche Themen die beiden Experten zur Diskussion stellen würden. Und tatsächlich starteten diese nach einem kurzen Einstieg mit zwei «heissen Eisen» rund um die Zweitwohnungen: dem Zusammenleben und dem zunehmend knapper werdenden Wohnraum für die Einheimischen. Weitere Themen waren der Verkehr sowie die Rolle der Landschaft.
Probleme identifizieren
Das Format hat diejenigen enttäuscht, die schnelle Lösungen für ihre Fragen erwartet hatten. Das Dorfgespräch löst kurzfristig keine Probleme – dafür ist es nicht gedacht. Vielmehr hilft es, Berührungsängste abzubauen, Anliegen und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu identifizieren, Probleme anzusprechen und Lösungsansätze zu diskutieren.
Das
Dorfgespräch löst kurzfristig keine
Probleme – dafür ist es nicht gedacht.
So zeigte sich ein grosser Wunsch der Zweitheimischen der Gemeinde Goms: Sie wollen besser informiert sein und die Fragen und Herausforderungen, die sich der Gemeinde stellen, besser verstehen (auch die politischen). Neben den bestehenden Informationskanälen (touristische Angebote, Gemeinde-App) sollen neue Formen des Austauschs gesucht und angeboten werden. Die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer wünschen sich mehr Gelegenheiten, mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Viele sind auch bereit, sich aktiv in der Gemeinde zu engagieren. Ein diskutierter Vorschlag: ein «Gommertag», der von Ein- und Zweitheimischen gemeinsam organisiert wird.
Nachbearbeitung darf nicht fehlen
Wie weiter? Neben der Auswertung und dem Bericht zum Dorfgespräch gibt das Team Siedlungsberatung Empfehlungen an die Gemeinde ab. So kann das Dorfgespräch als Katalysator für Massnahmen wirken und Prozesse auslösen, die sowohl die ständige Bevölkerung als auch die Gäste mittragen. Eine erfreuliche Weiterführung wäre natürlich eine weitere Einladung der Gemeinde Goms zu einem dritten Anlass –an dem Ein- und Zweitheimische gemeinsam am Apéro anstossen könnten.
Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2024 im Inforaum – Magazin für Raumentwicklung von EspaceSuisse.
brève introduction, les experts ouvrirent la discussion sur deux sujets brûlants en rapport avec les résidences secondaires: le vivre-ensemble et le manque croissant de logements pour la population locale. Les autres thèmes abordés furent la circulation et le rôle du paysage.
Identifier les problèmes
Les personnes qui attendaient des solutions rapides en réponse à leurs questions ont peut-être été déçues par le format. L’atelier village n’a pas vocation de résoudre des problèmes à court terme. Il aide plutôt à aborder des sujets délicats, à identifier les préoccupations et les besoins des participantes et participants, à évoquer des problèmes et à discuter des pistes de solution.
Il est ainsi ressorti qu’un souhait majeur des propriétaires de résidence secondaire est d’être mieux informés et de mieux comprendre les questions et les enjeux (aussi politiques) que la commune doit traiter. À cet effet, de nouvelles formes d’échange devraient être étudiées et proposées en plus des canaux d’information existants (offres touristiques, application numérique communale). Les propriétaires de résidence secondaire souhaitent avoir davantage d’occasions de rencontrer la population locale. Beaucoup sont aussi prêts à s’investir activement dans la commune. Parmi les propositions discutées, on peut mentionner une «Journée de Goms», qui serait organisée conjointement par la population locale et les propriétaires de résidence secondaire.
Analyse et synthèse nécessaires
Et après? En plus de l’analyse des résultats et d’un rapport final sur l’atelier village, le team conseil en aménagement fournit des recommandations à la commune pour les étapes suivantes. L’atelier village peut donc avoir un rôle catalyseur pour des mesures et initier des processus qui seront alors soutenus aussi bien par la population locale que par les hôtes. Pour la suite, il serait évidemment réjouissant que la commune de Goms propose une nouvelle manifestation où la population locale et les propriétaires de résidence secondaire pourraient partager un verre à l’apéritif.
Cet article est paru en décembre 2024 dans Inforum – Le périodique du développement territorial suisse d’EspaceSuisse.
L’ATELIER VILLAGE
Ce conseil d’EspaceSuisse offre un cadre aux autorités communales pour débattre de l’avenir du village avec la population. À l’occasion d’une manifestation publique, les habitantes et habitants discutent en petits groupes, puis en plénum, sur des thèmes actuels du village et sur les stratégies de développement possibles. La vision extérieure et l’animation par des personnes externes à la commune sont propices aux idées nouvelles, aux suggestions et aux évaluations. La préparation d’un atelier village nécessite un échange intense avec les responsables communaux sur la situation actuelle. Cet échange est combiné avec une visite d’une journée sur place. L’atelier village demande du courage: ce sont en effet les expertes et experts d’EspaceSuisse qui choisissent les contenus et les thèmes, et il est rare qu’ils ou elles dévoilent leurs cartes à l’avance. Selon EspaceSuisse, aucune commune ne l’a jusqu’ici regretté.
espacesuisse.ch
HOCH HINAUS FÜR GUTE IDEEN LES IDÉES PRENNENT DE LA HAUTEUR
71 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz sind Berggebiete (blau eingefärbt). In den 814 Berggemeinden lebt ein Viertel der ständigen Wohnbevölkerung. Die Siedlungen, Dörfer und Kleinstädte stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Abwanderung, Überalterung, Energieversorgung oder leer stehende Bauten. Doch innovative Konzepte und lokales Engagement bringen viele neue Ideen hervor. Sechs Beispiele aus den Bergen.
Les zones de montagne occupent 71 % de la surface totale de la Suisse (en bleu). Un quart de la population résidente vit dans ces 814 communes.
Les hameaux, les villages et les petites villes affrontent des défis semblables: exode, vieillissement de la population, approvisionnement énergétique et bâtiments inoccupés. Mais des concepts innovants et des initiatives locales génèrent de nouvelles idées. Six exemples en altitude.
1
LA MARCHANDE, SAIGNELÉGIER (JU)

Initiative contre la mort des petits magasins 985 m.
La Marchande, à Saignelégier, est une épicerie en vrac qui propose avant tout des produits locaux et de saison. L’idée revient à trois personnes qui voulaient rétablir la proximité entre les producteurs et la clientèle. Dans une commune de montagne victime de la disparition des petits commerces, ce concept contribue à l’activité locale et offre une alternative aux grands distributeurs. Les clients peuvent acheter exactement la quantité nécessaire – un avantage pour les plus âgés. Ce modèle innovant soude la communauté et permet de réduire les déchets.
SENIORS ET PAYSAGES, CHÂTEAU-D’OEX (VD)

Des paysages pour les seniors 959 m.
Un quart de la population de Château-d’Oex a plus de 65 ans, ce qui est nettement supérieur à la moyenne suisse. Et la topographie montagneuse des lieux constitue un défi pour ces résidents. Le projet «Seniors Paysages» devait rendre le paysage environnant plus accessible aux seniors grâce à l’installation, par exemple, de bancs, de rampes et de poubelles. Des ateliers et des forums ont permis d’impliquer activement les seniors dans la planification. En 2024 est née l’association «Seniors et Paysages», qui réunit les personnes intéressées grâce à des activités et des manifestations. 4
VEREIN KRONE TROGEN, TROGEN (AR)

Rettung und Revitalisierung der «Krone» 897 m ü. M.
Das 1727 erbaute Gasthaus Krone in Trogen ist das zweitälteste erhaltene Haus der Zellweger-Dynastie am Landsgemeindeplatz. Nach Jahren des Leerstands und der Spekulation von Immobilienhändlern rettete es die eigens gegründete Stiftung Krone Trogen im Jahr 2023 unter grossem Zeitdruck. Was einst der gesellschaftliche Mittelpunkt des Dorfes war, lebt heute als Bistro, Kulturort und Gästehaus wieder auf. Über 175 Freiwillige engagieren sich für diesen Wandel. Die Krone ist mehr als ein gerettetes Gebäude – sie steht für den Zusammenhalt eines Dorfes und den Mut, alte Mauern mit viel Herzblut mit neuem Leben zu füllen.
FERNWÄRMEANLAGE, ALT ST. JOHANN (SG)

Fernwärme mit lokalen Holzschnitzeln 894 m ü. M.
Das obere Toggenburg gehört zu den Pionieren in Sachen Fernwärme. Bereits 1995, bevor Energiekrise und Ressourcenknappheit zu allgegenwärtigen Begriffen wurden, entstand hier eines der ersten Holzfernwärmewerke der Region – mit gerade mal neun Anschlüssen. Heute versorgt das Netz rund 85 Haushalte mit nachhaltiger Energie aus Holzschnitzeln aus den umliegenden Wäldern. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, entsteht nun eine neue, zentrale Heizzentrale für Alt St. Johann und Unterwasser. Damit werden lokale Ressourcen genutzt, CO2-Emissionen reduziert und die regionale Wertschöpfung gestärkt.
WG MISCHER, SAANEN (BE)

Wohnung für junge Menschen in Ausbildung 1036 m ü. M.
Mitten in der alpinen Landschaft des Saanenlands liegt die WG Mischer: eine Wohngemeinschaft für junge Menschen in Ausbildung. Das innovative Wohnprojekt, das im Jahr 2021 gegründet wurde, bietet einerseits bezahlbaren Wohnraum und ermöglicht es den Bewohnerinnen und Bewohnern andererseits, ihre Selbstständigkeit und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken. Eine Fachperson begleitet das Zusammenleben und vermittelt bei Konflikten. Mit diesem Modell hat die WG Mischer 2023 den Innovationspreis Berner Oberland gewonnen und zeigt, wie kreative Lösungen die regionale Ausbildungslandschaft stärken können.
TRANSFORMATION DE MONTE, MONTE (TI)

Pour favoriser les rencontres dans le village 680 m.
À Monte, un petit village de la Valle di Muggio, le bureau d’architectes studioser a procédé à des interventions dans l’espace public afin d’améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants âgés. Après une analyse approfondie et des entretiens avec la population, sept mesures ont été identifiées, prenant la forme de sièges, de fontaines, de mains courantes ou encore d’une armoire à pain devant la Butega (épicerie) … Chaque action est en lien avec l’histoire du lieu, améliore l’accessibilité, ménage des possibilités de rencontres intergénérationnelles et renforce la cohésion sociale.

VOM FRIEDHOF ZUM STADTPARK DU CIMETIÈRE AU PARC URBAIN
Johannes Stoffler, Landschaftsarchitekt
Der Kannenfeldpark in Basel ist eine Erfolgsgeschichte. Sie erzählt von einer gelungenen Umnutzung, die Erinnerung und soziale Teilhabe miteinander verbindet. Das unkonventionelle Projekt von Stadtgärtner Richard Arioli (1905–1994) bleibt bis heute lebendig. Es ist längst ein Denkmal und erfindet sich doch immer wieder neu – ausgezeichnet mit dem Schulthess Gartenpreis 2025 des Schweizer Heimatschutzes.
Le Kannenfeldpark à Bâle est une success story. Il témoigne d’une transformation réussie, qui fait la part belle à la mémoire et à la participation sociale. Le projet non conventionnel du paysagiste municipal Richard Arioli (1905–1994) reste bien vivant aujourd’hui. Considéré depuis longtemps comme un monument historique, il ne cesse pourtant de se réinventer –une reconnaissance confirmée par le Prix Schulthess des jardins 2025 de Patrimoine suisse.
Lebendiges Gartendenkmal: Der Kannenfeldpark zählt heute zu den beliebtesten Grünanlagen in Basel. Un jardin historique vivant: le Kannenfeldpark compte aujourd’hui parmi les espaces verts préférés de Bâle.
Mancher sieht den Park vor lauter Bäumen nicht. Nicht so Stadtgärtner Richard Arioli, als er im Herbst 1951 damit begann, den ehemaligen Gottesacker im Kannenfeld umzubauen. Wo hochfliegende Projekte für ein Schwimmbad oder einen botanischen Garten gescheitert waren, besann sich Arioli auf das, was eigentlich schon da war: den Park und die Menschen. Sie galt es, zusammenzubringen. Durch kluge Interventionen entstand so aus einem alten Friedhof mit eindrücklichem Gehölzbestand ein pulsierender Stadtpark. So geht ressourcenschonendes Bauen! Bis heute hat der Kannenfeldpark nichts von seiner lebendigen Anziehungskraft verloren. Und bis heute bleibt seine Herkunft als Friedhof erfahrbar.
Der Gottesacker Kannenfeld
Im Jahr 1866 entschied sich der Stadtrat für den Bau zweier Grossbasler Friedhöfe weit ausserhalb des Siedlungsgebiets der Stadt. Der Gottesacker auf dem Wolf im Osten und jener auf dem Kannenfeld im Westen wurden als Zentralfriedhöfe für das wachsende Basel geplant. Mit der Konzeption des Gottesackers im Kannenfeld wurde Basels erster Bauinspektor, Amadeus Merian (1808–1884), beauftragt. Die Bepflanzung der Anlage wurde dem Stadtgärtner Georg Lorch (1829–1870) übertragen. Bereits 1868 wurde der neue Friedhof eröffnet. Bis auf das Leichenhaus waren die Architekturen zwar dem Rotstift zum Opfer gefallen, doch das Gelände war nochmals vergrössert worden. Weitläufige Alleen unterschiedlicher Baumarten gliederten die Grabfelder. Ihr Raster wurde von einer umlaufenden ovalen Promenade zusammengehalten. «Landschaftliche» Strauchpflanzungen rahmten die Familiengräber entlang der Wege ein, monumentale Portale und Einfriedungen definierten die Grenzen des Friedhofs.

Die skulpturalen «Kinderspiel-Formsteine» haben bis heute überdauert. Les sculptures à vocation ludique sont toujours en place aujourd’hui.
Beaucoup ne voient pas le parc tant il y a d’arbres. Ce n’était pas le cas de Richard Arioli à l’automne 1951 lorsqu’il a lancé la transformation de l’ancien cimetière du Kannenfeld. Là où des projets ambitieux de piscine ou de jardin botanique avaient échoué, le jardinier municipal a orienté ses réflexions sur ce qui était déjà présent: le parc et la population. Mais il convenait désormais de les réunir. Par des interventions inspirées, un ancien cimetière bien arborisé est devenu un parc urbain animé. Un bel exemple de préservation des ressources dans la construction! Jusqu’à aujourd’hui, le Kannenfeldpark n’a rien perdu de son attractivité, et sa vocation première est toujours visible.
Le cimetière du Kannenfeld En 1866, les autorités bâloises décidèrent de construire deux cimetières loin du périmètre urbain. L’un sur le Wolf, à l’est, et l’autre sur le Kannenfeld, à l’ouest, devaient devenir les lieux d’inhumation pour une population croissante. La conception du Kannenfeld fut confiée au premier inspecteur des constructions de Bâle, Amadeus Merian (1808–1884). Le jardinier de la ville Georg Lorch (1829–1870) se chargea de l’arborisation. Le nouveau cimetière fut inauguré en 1868. À l’exception de la morgue, les constructions projetées avaient été abandonnées. En revanche, la surface avait été agrandie. De longues allées d’arbres de diverses essences structuraient le terrain. Leur trame était ceinte d’une promenade ovale. Des plantations «paysagères» d’arbustes encadraient les caveaux familiaux le long des chemins, tandis que des portails monumentaux et des clôtures délimitaient le cimetière.
Une politique verte Avec l’ouverture du nouveau cimetière central «am Hörnli» en 1932, les inhumations au Kannenfeld devinrent toujours plus rares et celui-ci fut totalement fermé en 1951. Entre-temps, les ormes de l’allée périphérique avaient succombé à la graphiose mais ce lieu de mémoire était resté un composant essentiel de l’identité bâloise. Nombre d’habitants furent choqués quand le Département des constructions projeta d’y aménager une piscine. Et lorsque la ville commença à débarrasser sans ménagement les pierres tombales pour les réutiliser dans le port de Bâle, une tempête d’indignation se leva. Dans un délai record, l’initiative «pour la préservation du Kannenfeldpark» recueillit 7000 signatures. Appuyée par une pétition de 5000 paraphes supplémentaires, elle réclamait que la beauté unique du parc soit préservée et que celui-ci soit transformé en un havre de paix qui pourrait devenir un jardin botanique. Il n’en fallut pas plus pour que l’idée de la piscine soit abandonnée. Et, lorsque la direction du Jardin botanique se retira du projet, celui-ci échoua également.
Un parc social et moderne Après cette impasse urbanistique, le paysagiste de la ville Richard Arioli prit résolument les choses en mains. Dès que les premières réparations et de nouvelles plantations furent réalisées, l’ancien cimetière fut rouvert en mai 1952 déjà comme parc municipal et embelli durant les années suivantes conformément aux idées du paysagiste. L’ancien découpage fut conservé, en particulier les allées, les portails, les murs et quelques pierres tombales. Il en est allé de même pour de nombreux arbustes à feuillage persistant plantés aux abords des anciennes tombes, qui vinrent désormais structurer les nouvelles surfaces gazonnées. Dans le même temps, les utilisations du parc ont été étendues de manière ciblée et sa «fonction sociale» (selon Arioli) développée. Le long d’une allée transver-

Unter Stadtgärtner Richard Arioli wurde ab den 1950er-Jahren die Funktion des Parks erweitert, zum Beispiel mit der grünen Freilichtbühne.
Sous la direction du jardinier municipal Richard Arioli, la fonction du parc a été élargie à partir des années 1950, avec par exemple la création du théâtre de verdure.
Ein grünes Politikum
Als 1932 der neue Zentralfriedhof am Hörnli eröffnete, wurden Bestattungen auf dem Kannenfeld zur Ausnahme und der Friedhof 1951 ganz stillgelegt. Die umlaufende Allee war inzwischen dem Ulmensterben zum Opfer gefallen, doch als stimmungsvoller Erinnerungsort blieb der Friedhof fester Bestandteil der Basler Identität. Dass nach den Plänen des Baudepartements ausgerechnet ein Freibad an seiner Stelle entstehen sollte, empfanden viele als pietätlos. Und als die Stadt unzimperlich begann, die Grabsteine abzuräumen und im Rheinhafen zu verbauen, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. In kurzer Zeit hatte die «Initiative zur Erhaltung des Kannenfeldparks» rund 7000 Unterschriften gesammelt. Gemeinsam mit einer Petition von weiteren 5000 Baslerinnen und Baslern forderte sie den Schutz der «einmaligen Parkschönheit» und einen stillen Park, der als botanischer Garten entwickelt werden sollte. Damit war die Idee des Freibads vom Tisch. Als sich aber die Leitung des Botanischen Gartens aus dem Projekt zurückzog, war dieses ebenfalls geplatzt.
Sozialer Park der Moderne
In dieser Pattsituation ergriff Stadtgärtner Arioli entschlossen die Initiative. Nach ersten Reparaturen und «handstreichartigen» Neupflanzungen der Stadtgärtnerei wurde der ehemalige Friedhof bereits im Mai 1952 als Stadtpark eröffnet und in den folgenden Jahren nach Ariolis Vorstellungen weiterentwickelt. Das alte Gefüge des Gottesackers blieb erhalten, insbesondere seine Alleen, seine Portale, seine Einfriedungen und einige Grabmale. Erhalten blieben auch zahlreiche immergrüne Gehölze der ehemaligen Grabbepflanzungen, die nunmehr die neuen Rasenflächen abwechslungsreich kammerten. Gleichzei-
sale de vieux châtaigniers, un axe dédié aux loisirs a été créé avec des bassins pour les enfants et des jeux. Commandées dans le cadre d’un concours lancé par le Crédit bâlois pour l’art, des sculptures à vocation ludique y ont trouvé place. Dans les bords plus tranquilles, un jardin de lecture avec pergola, un kiosque élégant avec des cabinets conçu par le directeur cantonal des constructions Julius Maurizio ainsi qu’un théâtre de verdure. Les nouvelles installations et leur réalisation s’orientaient sur le répertoire formel du jardin résidentiel moderne et restaient sobres et modestes. Des buissons fleuris et des plantes exotiques enrichissaient la flore du parc et enchantaient ceux qui regrettaient encore un peu le projet de jardin botanique.
Poursuivre l’aménagement
Les orientations posées par Richard Arioli perdurèrent après son départ à la retraite en 1970. Elles se révélèrent d’emblée solides: les structures marquantes de l’ancien cimetière offraient un cadre durable pour des constructions et des utilisations repensées périodiquement. À l’occasion de l’exposition Grün 80, une roseraie remplaça le jardin de lecture. Son aménagement fut réalisé par le paysagiste de Riehen Paul Schönholzer. Mais avec le départ de son maître d’œuvre, le parc perdit peu à peu de sa cohérence. Une certaine forme de bricolage s’installa au fil des ans, alors que les anciennes et les nouvelles plantations envahissaient toujours plus les surfaces gazonnées. Il n’y avait plus de concept d’entretien et de développement. Une première étape fut franchie en 2005 avec le «principe directeur Kannenfeldpark». Ce document-cadre servit de base, en particulier pour l’aménagement de cinq îlots de jeux conçus par le bureau d’architecte-paysagiste Fontana pour remplacer les constructions ludiques des années 1950. De nouvelles collec-
tig wurde das Nutzungsangebot des Parks zielstrebig erweitert, die «soziale Funktion des Parks» (Arioli) ausgebaut. Entlang einer alten, querlaufenden Kastanienallee entstand so nach und nach eine Spielachse mit Planschbecken und Spielgeräten. Skulpturale «Kinderspiel-Formsteine», die im Rahmen eines Wettbewerbs des Basler Kunstkredits entstanden, fanden dort ebenfalls Platz. An den ruhigen Rändern fanden sich ein Lesegarten mit Pergola, ein eleganter Kiosk mit Abort von Kantonsbaumeister Julius Maurizio sowie eine grüne Freilichtbühne. Die neuen Einbauten und ihre Materialisierung orientierten sich am gestalterischen Repertoire des Wohngartens der Moderne und blieben sparsam und zurückhaltend. Blütensträucher und Exoten bereicherten die Flora des Parks und beglückten jene, die dem botanischen Garten immer noch ein wenig nachtrauerten.
Weitergestalten
Ariolis Weichenstellungen blieben auch nach seiner Pensionierung 1970 bestehen. Sie erwiesen sich zunächst als robust: Die markanten Strukturen des alten Friedhofs boten einen beständigen Rahmen für sich zyklisch erneuernde Einbauten und Nutzungen. Die Grün 80 bescherte dem Park anstelle des Lesegartens einen neuen Rosengarten, für den der Riehener Gartengestalter Paul Schönholzer verantwortlich zeichnete. Gleichwohl war dem Park sein Meister abhandengekommen, und es entstand über die Jahre eine Bricolage der Einbauten, während alte und neue Pflanzungen auf den Rasenflächen beständig mehr Raum einnahmen. Ein Pflege- und Entwicklungskonzept fehlte. 2005 wurde als erster Beitrag dazu das «Leitbild Kannenfeldpark» erarbeitet. Es bildete die Grundlage insbesondere für den Neubau von fünf Spielinseln, die 2010 bis 2018 von Fontana Landschaftsarchitektur erstellt wurden und die Einbauten der Spielachse der 1950er-Jahre ersetzten. Neue Gehölzsammlungen griffen die Idee des botanischen Gartens auf. 2017 folgte die Umgestaltung des Rosengartens zur Staudenanlage.
Lebendiges Gartendenkmal
Der Kannenfeldpark zählt heute zu den beliebtesten Grünanlagen in Basel. Seine «Rettung» ist den Baslerinnen und Baslern und ihrem Stadtgärtner Richard Arioli zu verdanken. Hier verbindet sich auf zeugnishafte Weise die Geschichte des alten Gottesackers mit Ariolis innovativem Konzept eines sozialen Parks der Moderne – ein Konzept, das bis heute Spielräume für neue Nutzungen eröffnet. Aufgrund seiner grossen kulturgeschichtlichen Bedeutung ist der Kannenfeldpark in mehreren Denkmalinventaren eingetragen. Um Planung und Unterhalt ein verlässliches Instrument für eine denkmalgerechte Pflege und Entwicklung zur Verfügung zu stellen, wurde 2021 im Auftrag der Stadtgärtnerei durch den Verfasser dieses Beitrags ein Parkpflegewerk erarbeitet. Darin werden verschiedene Massnahmenbereiche zur Pflege, Restaurierung und Entwicklung der Anlage definiert. Diese betreffen neben Vegetation oder Ausstattung auch Anregungen zur Parkgastronomie oder zur ökologischen Aufwertung. Erhaltung, sanfte Nutzungsanpassung und beständige Aufenthaltsqualität sind hier das Ziel. Oder um es mit den Worten Ariolis zu sagen: «Man darf die Grünflächen nicht nur für die Augen herstellen. Man muss sie in erster Linie für den tatsächlichen Gebrauch einrichten.»
Die Übergabe des Schulthess Gartenpreises findet am 28. Juni 2025 im Rahmen einer öffentlichen Feier statt. heimatschutz.ch/gartenpreis
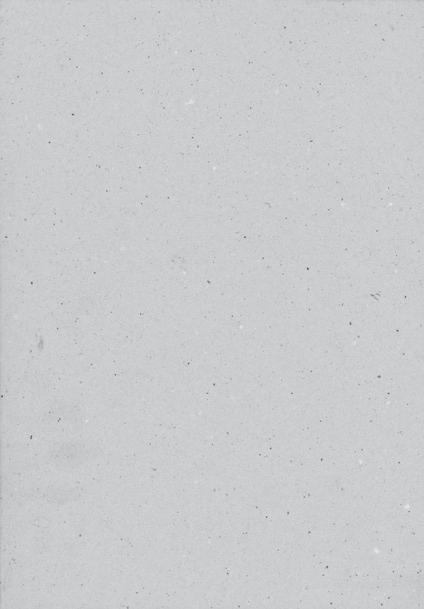


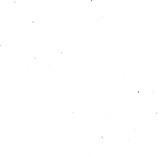

KANNEN FELD

PARK BASEL





Schulthess Gartenpreis 2025 –Kannenfeldpark Basel
Dieser (leicht gekürzte) Text stammt aus unserer soeben erschienenen Broschüre.
CHF 10.– / für Heimatschutzmitglieder: CHF 5.–
heimatschutz.ch/shop
Prix Schulthess des jardins 2025 –Kannenfeldpark Basel
Ce texte (légèrement abrégé) est tiré de notre brochure qui vient de paraître:
CHF 10.– / membres de Patrimoine suisse: CHF 5.–
patrimoinesuisse.ch/boutique
tions de plantes ligneuses renouèrent avec l’idée du jardin botanique. Et en 2017, la roseraie fut transformée en massifs de plantes vivaces.
Un jardin historique vivant
Le Kannenfeldpark compte aujourd’hui parmi les espaces verts préférés des Bâlois. Son «sauvetage» doit être mis au crédit de la population et du jardinier de la ville Richard Arioli. Il combine de manière exemplaire l’histoire de l’ancien cimetière et le concept d’un jardin social et moderne voulu par Richard Arioli – un concept qui, jusqu’à aujourd’hui, a ménagé suffisamment de latitude pour de nouvelles utilisations. En raison de sa grande importance patrimoniale, le Kannenfeldpark est inscrit dans plusieurs inventaires. Afin de disposer d’un instrument fiable pour un entretien et un développement du site dans le respect de son caractère patrimonial, un guide a été rédigé par l’auteur de cette contribution sur mandat du Service des jardins de la ville. Ce document définit différents domaines d’intervention pour l’entretien, la restauration et l’évolution du parc. Il aborde non seulement la végétation et les équipements, mais formule aussi des suggestions en termes de gastronomie ou de valorisation écologique. L’objectif est de favoriser la conservation, l’adaptation douce aux usages et une qualité de vie durable. Ou pour le dire avec les mots de Richard Arioli: «Il ne faut pas créer des espaces verts seulement pour les yeux. Il faut avant tout les aménager pour leur usage effectif.»
La cérémonie de remise du Prix Schulthess des jardins aura lieu le 28 juin 2025 dans le cadre d’une fête publique. patrimoinesuisse.ch/jardins
FÜR NATUR UND HEIMAT
POUR LA NATURE ET LE PATRIMOINE
Böden sind voller Leben. Sie beherbergen zwei Drittel der weltweiten Artenvielfalt. Der Schoggitaler wirbt 2025 deshalb für einen sorgfältigen Umgang mit unserer wortwörtlichen Lebensgrundlage.
Böden sind voller Leben. Sie beherbergen zwei Drittel der weltweiten Artenvielfalt. Ob Garten, Feld oder Wald: Lebendige Böden sind unsere Lebensgrundlage und regulieren das Klima. Bei Regen speichern sie Wasser, bei Trockenheit geben sie es wieder ab. So verhindern sie Überschwemmungen und kühlen die Luft. Regenwürmer, Pilze, Bakterien und andere Lebewesen bereiten Nährstoffe für die Pflanzen auf. Wo wir auf Asphalt, Beton und Pestizide verzichten, schonen wir den Boden. Mit dem Schoggitaler helfen Sie uns, lebendige Böden zu erhalten. Zudem unterstützen Sie zahlreiche Tätigkeiten von Pro Natura und dem Schweizer Heimatschutz.
Schulkinder profitieren
Die Schoggitaler-Aktion dient nicht allein den Anliegen des Natur- und Heimatschutzes in der Schweiz. Auch die teilnehmenden Schulklassen profitieren: Einerseits erhalten sie didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien zum Thema, aus denen sie Spannendes lernen. Andererseits fliessen pro verkauftem Taler 50 Rappen in die Klassenkasse.
Verkauf im September
Der Verkauf der traditionsreichen Schoggitaler aus Schweizer Biovollmilch und Kakao aus fairem Handel startet Ende August. Schulkinder werden die süssen Taler vom 25. August bis 22. September 2025 verkaufen (im Tessin ab 1. September). Ab Mitte September sind die Schoggitaler für den guten Zweck zudem schweizweit in den Verkaufsstellen der Post erhältlich.
Les sols sont pleins de vie. Ils abritent les deux tiers de la biodiversité mondiale. C’est pourquoi l’Écu d’or 2025 plaide en faveur d’une utilisation soigneuse de notre base vitale.

Der Talerverkauf für den guten Zweck beginnt am 25. August. La vente de l’Écu d’or pour la bonne cause démarre le 25 août.
Les sols sont pleins de vie. Ils hébergent deux tiers de la biodiversité mondiale. Jardin, champ ou forêt: des sols vivants constituent notre base vitale et régulent le climat. Ils stockent l’eau de pluie et la restituent en cas de sécheresse. Ils empêchent ainsi les inondations et refroidissent l’air. Vers de terre, champignons, bactéries et autres organismes libèrent des nutriments pour les plantes. En renonçant à l’asphalte, au béton et aux pesticides, nous prenons soin du sol. Avec l’Écu d’or, vous nous aidez à conserver des sols vivants et soutenez le travail de Pro Natura et de Patrimoine suisse.
Der Schoggitaler ist eine geschützte und zertifizierte Marke für Natur- und Heimatschutzprojekte. Seit 1946 setzen sich Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz mit dem Talerverkauf gemeinsam für die Erhaltung unseres Naturund Kulturerbes ein. Die beiden Trägerorganisationen sind Nichtregierungsorganisationen und handeln nicht gewinnorientiert zugunsten der Allgemeinheit.
L’Écu d’or est une marque protégée pour des projets de protection de la nature et du patrimoine. Depuis 1946, Pro Natura et Patrimoine suisse unissent leurs efforts au travers de la vente de l’Écu d’or pour préserver notre patrimoine naturel et culturel. Les deux associations sont des organisations non gouvernementales, sans but lucratif et d’utilité publique.
schoggitaler.ch ecudor.ch
Les élèves en bénéficient aussi
L’action de l’Écu d’or n’est pas seulement utile à la protection de la nature et du patrimoine. Les classes participantes en profitent également. Elles reçoivent du matériel pédagogique qui leur propose des informations pédagogiques. En outre, 50 centimes vont à la caisse de classe pour chaque Écu d’or vendu.
La vente aura lieu en septembre
La traditionnelle vente des Écus d’or produits avec du lait suisse bio et du cacao issu du commerce équitable démarre fin août. Les élèves les vendront entre le 25 août et le 22 septembre (au Tessin dès le 1er septembre). À partir de mi-septembre les Écus d’or pourront également être achetés, dans toute la Suisse, pour cette bonne cause, aux guichets de la Poste.
Schoggitaler
UNTERWEGS IN DEN GASSEN AU FIL DES RUELLES
Seit dem 22. Mai dreht sich im Heimatschutzzentrum alles um den «Kosmos Altstadt». Die neue Ausstellung wurde mit Menschen aus über 20 Schweizer Altstädten entwickelt und zeigt Herausforderungen und Visionen im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz, Klimapolitik, Wohnraum, Tourismus und Eigentum.
Flanieren Sie durch die «Grüne Gasse», machen Sie Halt auf dem «Marktplatz» oder beim «Spielsträsschen»: In der Ausstellung erkunden Besucherinnen und Besucher die Altstädte und ihre Geschichten in neun Gassen und Plätzen. Sie treffen auf Personen, die in historischen Stadtkernen leben, wirken, arbeiten oder dazu forschen. Daraus ergibt sich ein vielstimmiges und dichtes Geflecht von Perspektiven, das die Altstadt als besonderen städtebaulichen und sozialen Raum erfahrbar macht.
Entwicklung im Kollektiv
Im letzten Sommer startete das Heimatschutzzentrum einen Aufruf, in dem es Geschichten aus Schweizer Altstädten suchte. Über 40 Personen haben sich gemeldet, und ein Teil davon nahm an einem Workshop in der Villa Patumbah teil. Von den Mitwirkenden wollte das Ausstellungsteam hören, mit welchen Fragen und Herausforderungen sie in ihren Altstädten konfrontiert sind. Gemeinsam wurden Themenfelder für die Ausstellung definiert und mögliche Umsetzungen skizziert. Diese partizipative Herangehensweise machte es möglich, diverse Sichtweisen in die Ausstellung einzubinden und sichtbar zu machen.
Von Genf bis Ilanz
Wir erfahren, wie eine umgebaute Garage in der Genfer Altstadt zum lebendigen Quartiertreffpunkt wird, weshalb sich in Bern die grünste Gasse der Schweiz befindet und wie verschiedene Akteurinnen versuchen, die Ilanzer Altstadt zu beleben. Die Ausstellung will die Altstadt den Besuchern als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum (wieder) näherbringen und regt dazu an, über mögliche Entwicklungen nachzudenken –zum Beispiel in der «Zukunftsgasse».
Aus dem Veranstaltungsprogramm:
Samstag, 21. Juni, 9.30 Uhr Die Farben der Zürcher Altstadt Interaktive Führung mit Schwester Veronika Ebnöther, Synästhetikerin
Samstag, 6. September, 18–1 Uhr Die Lange Nacht der Zürcher Museen Spezialprogramm zur Ausstellung, Barbetrieb und Musik
Depuis le 22 mai, la Maison du patrimoine invite à explorer les multiples facettes de la vie dans un centre ancien. L’exposition «Vieilles Villes. Tout un monde» conçue avec des personnes issues de plus de 20 vieilles villes en Suisse met en lumière les visions d’avenir et les enjeux de ces espaces, entre protection du patrimoine, politique climatique, logement, tourisme et propriété.
Flâner le long du «Chemin vert», s’arrêter sur la «Place du marché» ou emprunter la «Ruelle du jeu»: à travers neuf ruelles et places thématiques, l’exposition invite les visiteuses et visiteurs à explorer les vieilles villes et les histoires qu’elles abritent. Ils y croiseront des personnes qui vivent, travaillent, s’engagent ou mènent des recherches dans ces centres anciens. De ces rencontres naît un réseau dense et pluriel de voix, qui révèle la vieille ville comme un espace social et urbain particulier.
Donnerstag, 25. September, 17.30 Uhr
Denkmal oder Sanierungsfall? Die Zürcher Altstadt im 20. Jahrhundert
Stadtführung mit Melchior F. Fischli, Architekturhistoriker
Sonntag, 26. Oktober, 15 Uhr
Mit dem Expertenblick durch die Ausstellung
Rundgang mit Paul D. Hasler, Ingenieur und Mitgründer
«Netzwerk Altstadt»
Für Schulklassen
Workshops «Altstadt: Viel los auf wenig Raum» ab September 2025
Details unter heimatschutzzentrum.ch/schulen
Mittagsführung durch Villa und Ausstellung
Jeden Donnerstag um 12.30 Uhr
Sonntagsführung durch Villa und Ausstellung
Jeweils am letzten Sonntag des Monats um 14 Uhr
«Kosmos Altstadt» bis Anfang 2027
Zweisprachig (DE/FR), englische Texte via QR-Code heimatschutzzentrum.ch
Heimat verbindet
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein
Legat – legt den Grundstein für die Zukunft.
Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, diese für kommende Generationen zu bewahren.
Bestellen Sie unsere Unterlagen oder kontaktieren Sie unseren
Geschäftsführer David Vuillaume. Er berät Sie gerne persönlich: T 044 254 57 00.

Une démarche collective
L’été dernier, la Maison du patrimoine a lancé un appel à témoignages autour des vieilles villes de Suisse. Plus de quarante personnes y ont répondu, et une partie a participé à un atelier organisé à la Villa Patumbah. L’équipe de conception de l’exposition souhaitait entendre leurs interrogations et les défis auxquels elles font face dans leurs vieilles villes. Ensemble, ils ont défini les grands axes thématiques de l’exposition et esquissé des pistes de mise en œuvre. Cette approche participative a permis d’intégrer une diversité de points de vue et de les rendre visibles au cœur de l’exposition.
De Genève à Ilanz
On découvre comment un ancien garage transformé, au cœur de la vieille ville de Genève, est devenu un lieu de rencontre animé pour le quartier, pourquoi la ruelle la plus verte de Suisse se trouve à Berne, et comment différents acteurs s’engagent pour redynamiser la vieille ville d’Ilanz. L’exposition invite à redécouvrir la vieille ville comme un espace de vie, de travail et d’habitat, et incite à réfléchir aux évolutions possibles.
«Vieilles Villes. Tout un monde», visible jusqu’à début 2027 Bilingue (DE/FR), textes en anglais via un code QR maisondupatrimoine.ch


heimatschutz.ch/nachlass
ZWEI NEUE FERIENANGEBOTE DEUX NOUVELLES OFFRES
Mit dem herrschaftlichen Patrizierhaus «Haus zur Beuge» in Näfels eröffnet die Stiftung Ferien im Baudenkmal ihr zweites Objekt im Kanton Glarus. Die «Casa Mix» mitten im historischen Dorfkern von Meride, erweitert das Angebot im Tessin.
Der Kern des «Hauses zur Beuge» in Näfels (GL) geht auf zwei Wehrtürme aus dem Jahr 1415 zurück, die im Laufe der Zeit zu zwei separaten Wohnhäusern ausgebaut und im 17. Jahrhundert zu einem herrschaftlichen Patrizierhaus erweitert wurden. Nach langem Leerstand sollte das baufällig gewordene Haus im Ortskern abgerissen werden und einer modernen Wohnbebauung weichen. Die Genossenschaft Alterswohnungen Linth (GAW Linth) erkannte das Potenzial der Liegenschaft und konnte 2020 mit dem Architekten Volker Marterer die Sanierung starten. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und der Glarner Sektion des Schweizer Heimatschutzes gelang es, die über 600-jährige Baugeschichte des «Hauses zur Beuge» wieder erlebbar zu machen. Mit seinen zwölf Alterswohnungen und einem gemütlichen Café im Erdgeschoss trägt das Projekt auch zur Belebung und Aufwertung des Dorfkerns bei. Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal ermöglicht die Genossenschaft nun auch Feriengästen, in die Geschichte des Hauses und der Region einzutauchen.
Mitten im historischen Dorfkern von Meride (TI), am Hang des Monte San Giorgio, liegt die «Casa Mix». Das Haus aus dem 17. Jahrhundert ist geprägt durch den zentralen Innenhof, den lombardischen Einfluss der Wanderhandwerker und die Geschichte der Journalistin und Schriftstellerin Mix Weiss – ihre Bibliothek sowie die beiden von ihr verfassten Romane befinden sich im Wohnzimmer. Die «Casa Mix» steht seit April für Feriengäste aus nah und fern zur Verfügung.
ferienimbaudenkmal.ch

Avec la résidence patricienne «Haus zur Beuge», la fondation Vacances au cœur du Patrimoine enrichit son offre dans le canton de Glaris. La «Casa Mix», située au cœur du village historique de Meride, élargit l’offre dans le Tessin.
Les fondations de la «Haus zur Beuge» à Näfels remontent à 1415 avec la construction de deux tours de défense qui, au cours du temps, sont transformées en demeures d’habitation avant d’être réunies au XVIIe siècle pour former une élégante résidence patricienne. Après une longue période d’abandon, le bâtiment, délabré, menace d’être démoli pour laisser place à une construction moderne. Percevant le potentiel du site, la coopérative de logements pour seniors Linth (GAW Linth) lance sa restauration en 2020 avec l’architecte Volker Marterer. Grâce à une collaboration étroite avec les services cantonaux des monuments historiques et la section glaronnaise de Patrimoine suisse, la restauration a permis de sauvegarder et de valoriser les plus de 600 ans d’histoire de la «Haus zur Beuge». En accueillant douze logements pour seniors et un café convivial au rez-de-chaussée, la maison participe activement à la redynamisation du centre du village. Grâce à sa collaboration avec la fondation Vacances au cœur du Patrimoine, la coopérative permet désormais aux visiteurs de se plonger dans l’histoire de cet édifice et de sa région.
La «Casa Mix» se situe au cœur du centre historique de Meride, à flanc du Monte San Giorgio. Cette maison du XVIIe siècle se distingue par sa cour intérieure centrale, par l’influence lombarde transmise par les artisans itinérants, et par la mémoire de l’écrivaine et journaliste Mix Weiss. Dans le salon se trouvent sa bibliothèque ainsi que les deux romans qu’elle a écrits. Depuis avril, la «Casa Mix» accueille des hôtes venus de près ou de loin.
vacancesaucoeurdupatrimoine.ch

«Haus zur Beuge», Näfels (GL)
«Casa Mix», Meride (TI)
Hans Bühler
Gataric Fotografie

La Maison de l’Ancre depuis la rue de Lausanne
Die Maison de l’Ancre von der Rue de Lausanne

Le restaurant après sa rénovation
Das Restaurant nach der Renovation
«HABITER
L’IMPRÉVU»
Patrimoine suisse Genève s’est lancée en 2024 dans une nouvelle aventure avec la création du Prix Patrimoine suisse Genève. Pour cette première édition, le thème «Habiter l’imprévu» a été retenu. Le prix a été décerné au projet de rénovation de la Maison de l’Ancre, construite entre 1957 et 1960 par Georges Addor.
Tous les bâtiments connaissent plusieurs vies. Les plus anciens ont souvent changé d’affectation et le mouvement se poursuit au gré des changements d’époque et de société: une ferme agricole qui devient musée, un hôpital qui devient palais de justice, un arsenal qui devient hôtel des archives, une église qui se transforme en salle d’escalade et bien sûr la transformation en logement. C’est cette dernière mutation, sans doute la plus fréquente, que Patrimoine suisse Genève a souhaité mettre en lumière pour cette première édition du Prix. La forte demande actuelle en logements – et le fait que la LAT donne un cadre de non-mitage du territoire – accroît considérablement cette tendance et le patrimoine bâti en a souvent pâti. Pourtant de très bons exemples prouvent qu’il est possible de créer du logement de qualité au sein de bâtiments non prévus pour cette fonction au départ. Comment transformer les bâtiments anciens sans détruire leur substance, autrement dit comment densifier le patrimoine, pour habiter l’imprévu?
Parmi les dossiers déposés, cinq projets de qualité ont été retenus pour cette première édition, et c’est à l’unanimité que le jury a choisi le projet de rénovation du bâtiment de la Maison de l’Ancre, construite entre 1957 et 1960 par Georges Addor. Cette dernière est située à l’angle de la rue de Lausanne et de la rue de la Navigation.
Affecté depuis sa construction à l’hôtellerie sociale, le bâtiment reflète à l’origine une séparation en deux entités programmatiques distinctes à travers ses façades et sa volumétrie. La rénovation de cet emblème du modernisme, menée entre 2019 et 2023 par le bureau dmarchitectes, souligne les défis complexes de la conservation du patrimoine de l’aprèsguerre. Cette intervention majeure commandée par la Fondation pour le Développement des Établissements Publics pour l’Intégration (FONDEPI) visait à concilier la préservation patrimoniale avec la nouvelle vocation d’accueil pour personnes en situation de handicap psychique.
1re édition du Prix Patrimoine suisse Genève 2025
La remise du Prix a eu lieu le 11 avril 2025 dans le bâtiment de la Maison de l’Ancre à Genève. patrimoinegeneve.ch
GENÈVE

AUSFLUG ZUR PANTENBRÜCKE
Die Pantenbrücke wird in der Publikation Die schönsten Aussichten des Schweizer Heimatschutzes gewürdigt. Sie ist Teil eines regional bedeutenden Passüberganges. Seit dem 15. Jahrhundert verbindet der Kistenpass Linthal (GL) mit Brigels (GR). Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Brücke mit der Linthschlucht als Motiv in der Reiseliteratur und Landschaftsmalerei europaweit bekannt. Der Glarner Heimatschutz bietet zusammen mit der Pantenbrugg-Stiftung und der VISIT Glarnerland AG am 4. Juli eine Wanderung zu der 200 Meter über der Linthschlucht gelegenen Doppelbrücke an.
glarnerheimatschutz.ch

GRAUBÜNDEN
SERTIG DÖRFLI – BEWAHREN ODER VERSCHANDELN?
Im kleinen Weiler Sertig Dörfli, der seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert keine wesentliche Erweiterung mehr erfahren hat, wird die Vereinbarkeit von Weiterentwicklung und Ortsbildschutz gerade auf eine harte Probe gestellt. Der Bündner Heimatschutz engagiert sich seit Längerem für die Bewahrung dieses besonderen Ortes. Nun erhalten die Bemühungen durch eine Bürgerinitiative neuen Schub.
Hintergründe und Petition heimatschutz-gr.ch
ZUG
KEIN NEUER KANTONSRATSSAAL AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ
Der Zuger Regierungsrat will auf dem Landsgemeindeplatz in Zug als Erweiterungsbau zum Regierungsgebäude einen neuen Kantonsratssaal erstellen. Der Platz gehört zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Deshalb wäre der Neubau ein schwerer Eingriff und damit aus Sicht des Zuger Heimatschutzes nicht zulässig. Die letzten Freiräume beim Landsgemeindeplatz und am See in der Zuger Altstadt müssen erhalten bleiben und dürfen nicht verbaut werden.
Ende März forderte der Zuger Heimatschutz die kantonalen Behörden auf, der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege den Auftrag zu erteilen, in einem Gutachten zu prüfen, ob der geplante Ratssaal mit dem ISOS vereinbar ist.

Medienmitteilung vom 25. März 2025 zugerheimatschutz.ch
OBERWALLIS
ZWEI ATELIERS
Atelier «Ischi Junge uf Entdeckig»: Der Oberwalliser Heimatschutz lädt zusammen mit ArtPraxis zu einem Kindernachmittag ein, der ganz im Zeichen von Naturerlebnissen und kreativem Entdecken steht. Dieser bietet Kindern und Familien die Möglichkeit, spielerisch und aktiv die Natur und die gebaute Umgebung zu erforschen und die heimische Pflanzen- und Tierwelt besser kennenzulernen. Das Atelier findet am 6. September im Stockalpergarten in Brig statt, dessen beeindruckende Umgebung Raum für Entdeckungen, Spiele und kreative Aktivitäten bietet.
Atelier «I(n)schi Sunne ufem Dach»: Am 4. September ist ein Abend der Integration von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden gewidmet: In welchem Masse darf moderne Solartechnik das Erscheinungsbild eines denkmalgeschützten Gebäudes verändern? Wo liegen die Grenzen zwischen Fortschritt und dem Erhalt historischer Substanz?
oberwalliserheimatschutz.ch
Kanton
Zug
VAUD
DOMAINE DE LA DOGES
Le 11 avril, la section vaudoise de Patrimoine suisse a inauguré le salon d’été, le vestibule et la salle de bain historique de La Doges, qui viennent d’être soigneusement restaurés. Ce chantier ambitieux, soutenu par des donateurs privés et institutionnels, marque une nouvelle étape-clé dans la préservation et la mise en valeur de cette maison de maître du XVIIe siècle. En redonnant vie à ces espaces, cette restauration ne se limite pas à une conservation matérielle: elle s’inscrit dans une dynamique culturelle et historique, garantissant leur transmission aux générations futures.
Les travaux, réalisés d’août à décembre 2024 par les ateliers Meta, Sinopie et kalk architecture, ont révélé et sublimé des décors d’exception tout en assurant leur pérennité.
Inauguration des espaces restaurés – Domaine de La Doges patrimoinesuisse-vd.ch

ZÜRICH
GEGEN DEN ABBRUCH DES «KINO REX» IN PFÄFFIKON
Das ehemalige «Kino Rex» in Pfäffikon ist das älteste noch authentisch erhaltene Zeugnis der vergangenen Kinokultur im Zürcher Oberland. Das bedeutende kulturhistorische Baudenkmal bildet zudem einen prägnanten Merkpunkt für den dortigen Ortsbildteil. Der Zürcher und der Schweizer Heimatschutz haben im März gegen den Baurechtsentscheid, wonach das Haus abgebrochen werden soll, Rekurs eingelegt und verlangen eine denkmalpflegerische Abklärung. Das «Kino Rex» ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz verzeichnet. Mit dem Verzicht auf die Aufnahme des Gebäudes in das kommunale Inventar verletzte die Gemeinde Pfäffikon das Zürcher Planungs- und Baugesetz (PBG).
Medienmitteilung vom 18. März 2025 heimatschutz-zh.ch

MONTHEY ANNÉES 1980
La section Valais romand présente une nouvelle promenade en ligne dédiée à la culture du bâti à Monthey. Celle-ci invite à découvrir les transformations majeures de la ville entre 1975 et 2000 à travers neuf réalisations emblématiques: théâtre, médiathèque, logements résidentiels ou encore interventions urbaines.
Ce projet s’inscrit dans la campagne «Culture du bâti 1975–2000» de Patrimoine suisse. Il a pour ambition de mieux faire connaître les architectures de la fin du XXe siècle, souvent encore méconnues ou controversées, mais qui structurent durablement notre cadre de vie. Photo: Théâtre du Crochetan (Jean-Luc Grobéty, Raoul Andrey, André Schenker, 1989)

Promenade 1975–2000 sur la plateforme de Patrimoine suisse patrimoinesuisse.ch/valais/monthey
VALAIS ROMAND
Pierre Marmy
Liubov Krivenkova

IN DER WAGGONWERKSTATT DANS L’ATELIER DES WAGONS
Marco Guetg, Journalist
Thomas Pulfer war KV-Stift, und Martin Gysin ging noch zur Schule, als sie 1985 den Verein Historische Eisenbahn Gesellschaft gründeten. Sein Zweck: die Restaurierung alter Eisenbahnwagen. Seit 1991 geschieht dies in der Rotonde in Delémont, wo derzeit eine Preziose aus dem Jahr 1902 ihren letzten Schliff erhält: ein Personenwagen vom Typ B 3505.
Thomas Pulfer était apprenti de commerce et Martin Gysin allait encore à l’école lorsqu’ils ont fondé en 1985 l’association Historische Eisenbahn Gesellschaft afin de restaurer d’anciens wagons de chemin de fer. Depuis 1991, les travaux se déroulent dans la rotonde de Delémont où un bijou de 1902 – une voiture de voyageurs du type B 3505 – est en cours de finition.
Seit 40 Jahren restauriert Thomas Pulfer mit unermüdlicher Leidenschaft historische Eisenbahnwagen. Depuis 40 ans, Thomas Pulfer restaure avec une passion inépuisable des wagons historiques. Foto: Marco Guetg
Auf dem Areal der Rotonde in Delémont, knapp zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt, lagert hinter verputztem Mauerwerk, was jedes Bähnlerherz höherschlagen lässt. Zwei fahrtüchtige Dampflokomotiven zum Beispiel, die «Zephir», Baujahr 1874, und die SBB-Dampflok 8485, Baujahr 1907. Doch solche publikumswirksamen Maschinen, die durch die Landschaft fauchen, stehen nicht im Fokus der Historischen Eisenbahn Gesellschaft (HEG). Die Vereinsmitglieder haben sich vor allem der Restaurierung historischer Bahnwaggons verschrieben. «Dieser Personenwagen des Typs C, Baujahr 1897», verrät Präsident Thomas Pulfer bei einem Besuch, «war das erste Projekt des noch jungen Vereins.» 1985 erworben, wurde der Wagen von der HEG in den folgenden 15 Jahren originalgetreu restauriert und wieder betriebsfähig gemacht.
B 3505: Rückkehr eines Originals
Das «Gesellenstück» der HEG und der Stolz der Macher steht jedoch in einem Nebenraum: ein Personenwagen vom Typ B 3505, ein 16 Tonnen schweres Fahrzeug mit 40 Sitzplätzen aus dem Jahr 1902. Bis 1958 war er im Einsatz, wurde dann als Bremsversuchswagen zweckentfremdet, 1976 endgültig ausrangiert und einem Schrotthändler zur Verwertung übergeben. Doch der liess sich Zeit. «Das war unser Glück»,

ROTONDE DELÉMONT
Die Rotonde Delémont ist ein ringförmiger Schuppen mit einer Fahrzeughalle und einer kleinen Werkstatt um eine zentrale Drehscheibe. Sie wurde 1889/90 von der Jura-Simplon-Bahn erbaut und diente dieser ab 1890 als Depot für Dampflokomotiven, später der SBB als Reparaturwerkstatt. 1991 genehmigte die SBB der Historischen Eisenbahn Gesellschaft (HEG) eine Teilnutzung, 1997 wurde die inzwischen zum Kulturgut von nationaler Bedeutung erhobene Anlage renoviert. Seither steht ein grosser Teil der Halle der HEG und der Stiftung SBB Historic als Aufbewahrungsort für historisches Bahnmaterial sowie als Depotmuseum zur Verfügung.
La rotonde de Delémont est une halle circulaire autour d’une plaque tournante. Elle comprend une remise à locomotives et un petit atelier. Elle a été construite entre 1889 et 1890 par le chemin de fer du Jura-Simplon pour servir de dépôt de locomotives. Par la suite, les CFF l’ont utilisée comme atelier de réparation. En 1991, l’association Historische Eisenbahn Gesellschaft (HEG) a obtenu des CFF le droit de l’occuper en partie. En 1997, cette infrastructure, promue monument d’importance nationale, a été rénovée. Dès lors, une grande partie de la halle est à la disposition de la HEG et de la fondation CFF Historic comme dépôt-musée et lieu d’entreposage de véhicules anciens.
Sur le site de la rotonde de Delémont, à dix minutes à pied de la gare, des trésors chers à tous les amoureux du rail sont garés derrière les murs crépis. Par exemple, deux locomotives à vapeur en état de marche, la «Zephir», de 1874, et la «8485», construite en 1907 pour les CFF. Mais ces machines, si chères au public lorsqu’elles halètent dans les campagnes, ne sont pas la priorité de la Historische Eisenbahn Gesellschaft (HEG). Les membres de cette association se consacrent avant tout à la restauration de wagons historiques. «Cette voiture de type C, construite en 1897, a été le premier projet mené à bien par la HEG», explique le président Thomas Pulfer, lors d’une visite. Acquise en 1985, elle a été remise dans son état d’origine au cours des 15 années suivantes et est désormais apte au service.
Remise en l’état d’origine de la B 3505
Mais le «chef-d’œuvre de compagnonnage» de la HEG et la fierté des membres actifs se trouve dans une annexe: un wagon de voyageurs de type B 3505, pesant 16 tonnes, offrant 40 places assises et datant de 1902. En service jusqu’en 1958, il a été ensuite utilisé comme véhicule d’essai de freins. Désaffecté en 1976, il a été cédé à un ferrailleur. Mais celui-ci n’était pas pressé de le démanteler. «Une chance pour nous», reconnaît Thomas Pulfer. En 1989, l’association a repris le véhicule qui avait été vidé de ses aménagements intérieurs. Depuis, on martèle, on recrée, on visse et on vernit. Des milliers d’opérations ont été nécessaires afin de rétablir peu à peu l’état d’origine, mais le but est proche désormais.
Le président se tient devant la voiture à la livrée verte flambant neuve. Il se lance dans un exposé d’histoire ferroviaire: l’évolution des systèmes d’éclairage, les inscriptions avec la typographique propre aux CFF ... Ce courtier en assurances, avec sa passion et sa connaissance du rail, pourrait donner le vertige à son interlocuteur. Mais il est indulgent et se limite à l’essentiel.
Ça sent le neuf à l’intérieur du vénérable wagon. Les pièces en laiton sont polies, quelques porte-bagages sont déjà montés. Les sièges ont été fabriqués sur le modèle de deux bancs originaux, de même que le tissu. Les teintes et les veines du bois doivent être conformes, les panneaux émaillés doivent être placés comme autrefois. Le résultat doit être aussi authentique que possible. «Je considère que nous avons rétabli l’état d’origine à 90%», indique Thomas Pulfer. Reste encore à monter les derniers porte-bagages, à enlever les protections du sol en linoleum, à poser le rembourrage des sièges et à effectuer quelques retouches çà et là ...
Labeur et plaisir de rouler
Un vrai travail de détective se cache derrière la rénovation fidèle du wagon de voyageurs. Les membres ont compulsé des photos et des livres, étudié des plans, feuilleté des magazines, exploré le Web. «Martin Gysin est notre historien», explique le président qui a fondé avec lui l’association qui compte aujourd’hui une centaine de membres. Cinq à six d’entre eux tentent de matérialiser à petits pas le rêve que caressaient les deux jeunes passionnés un certain mois de juin 1985. Cet été, ces passionnés pourront poser fièrement devant un véhicule qui sera dans le même état qu’à sa sortie de fabrique il y a plus de 100 ans. Ils auront aussi derrière eux sept ans de labeur et un investissement conséquent. Le projet B 3505 aura coûté 600 000 francs, un montant rassemblé au fil des années au travers de donations, de soutiens par des sociétés, de fonds de loterie et de fondations ainsi que d’autres
sagt Pulfer. 1989 übernahm die HEG den ausgeweideten Wagen. Seither wird gehämmert, gegossen, geschraubt und gepinselt. Tausend Dinge sind nötig, um den Originalzustand nach und nach wiederherzustellen, doch bald sind sie am Ziel. Pulfer steht vor dem glänzenden, grün lackierten Wagen. Es folgt ein eisenbahnhistorischer Abriss: Er erklärt die Entwicklung des Beleuchtungssystems, weist auf die Beschriftung mit der SBB-spezifischen Typographie hin … Der Versicherungstreuhänder mit eisenbahntechnischem Flair und Wissen könnte den Besucher mühelos schwindelig reden. Er ist jedoch nachsichtig und beschränkt sich auf das Wesentliche. Im Inneren des alten Wagens riecht es neu. Die Messingteile sind poliert, einzelne Gepäckablagen bereits montiert. Die Sitze wurden «nach dem Vorbild zweier noch vorhandener Originalsitze» wiederhergestellt, der Stoff nach einem originalen Muster gewoben. Farbe und Holzmaserung müssen stimmen, die Emailleschilder sollen möglichst an der ursprünglichen Stelle angebracht werden. Was entsteht, soll so authentisch wie möglich sein. «Ich behaupte», sagt Thomas Pulfer, «dass wir bei diesem Wagen den Originalzustand zu 90 Prozent erreicht haben.» Was noch ansteht: Gepäckträger montieren, Linoleumböden freilegen, Sitzpolster platzieren, hier und da eine Retusche anbringen
Durch Fronarbeit zur Fahrfreude
Hinter der originalgetreuen Restauration des Personenwagens steckt Detektivarbeit. Fotos und Bildbände werden gewälzt, Pläne studiert, in Publikationen geblättert, das Internet durchforstet. «Martin Gysin ist unser Historiker», sagt Pulfer. Mit ihm hat er den Verein gegründet. Mittlerweile zählt er rund 100 Mitglieder. Fünf bis sechs von ihnen versuchen, in kleinen Schritten das zu verwirklichen, wovon die beiden jungen Enthusiasten in jenem Juni 1985 träumten.
Im Sommer werden sich die Macher an einem Wagen erfreuen, der vor über 100 Jahren in dieser Ausstattung über die Schienen rollte. Sie blicken aber auch auf sieben Jahre Fronarbeit und ein stattliches Budget zurück. 600 000 Franken hat das Projekt B 3505 gekostet, ein Betrag, der über die Jahre durch Spenden, Firmensponsoring, Lotteriefonds, Stiftungen und weitere Zuwendungen zusammengekommen ist. Im September lädt die HEG zur Jungfernfahrt mit dem neu-alten B 3505, dem einzigen betriebsfähigen Personenwagen der Schweiz, mit dem Reisen in der «Polsterklasse» wie vor 120 Jahren erlebt werden kann.
Damit erreicht die HEG ein wichtiges Ziel: Sie will der Öffentlichkeit zeigen, was in den Hallen entstanden ist. «Wir restaurieren unsere Wagen nicht nur fürs Museum», erklärt Pulfer, «wir wollen sie erlebbar machen.» Dahinter steckt durchaus eine kulturpolitische Absicht. «Wir finden», fährt er fort, «dass die Eisenbahn als mobiles Kulturgut – analog zur Baukultur oder zur Landschaft – ein schützenswertes Kulturerbe ist.» Er skizziert dem Besucher eine Vision: Wie die HEG eines Tages eine kleine historische Komposition durch die Landschaft dampfen lässt, mit Lokomotive, 1.- und 2.-Klasse-Wagen, einem reinen 2.-Klasse-Wagen, einem 3.-Klasse-Wagen und einem Gepäckwagen, «wie vor 150 Jahren».
Die HEG rettet und restauriert technisches Eisenbahnkulturgut seit 1985 und betreibt zusammen mit SBB Historic das Depotmuseum Rotonde in Delémont.
contributions. En septembre, la HEG organisera le voyage inaugural de la B 3505, la seule voiture de Suisse en état de marche qui permet de goûter au confort de la «classe fauteuil» d’il y 120 ans.
L’association atteint ainsi un objectif important: elle entend montrer au public que ce qui est réalisé dans ses ateliers revêt aussi une dimension historique et culturelle. «Nous restaurons nos voitures pas seulement pour les présenter dans un musée, souligne Thomas Pulfer, mais aussi pour les faire vivre. Nous considérons qu’en sa qualité de bien culturel mobile – analogue au patrimoine construit ou au paysage – le chemin de fer est un héritage culturel digne de protection.» Le président partage enfin son rêve avec le visiteur: un jour, la HEG sera en mesure de faire circuler par monts et par vaux un petit train historique composé d’une locomotive à vapeur, d’une voiture de 1re et 2e classes, d’une voiture de 2e et d’une voiture de 3e ainsi que d’un fourgon à bagages, «comme il y a 150 ans».
La HEG sauve et restaure des biens culturels ferroviaires techniques depuis 1985 et exploite, en collaboration avec CFF Historic, le musée Rotonde à Delémont.
volldampf.ch/fr
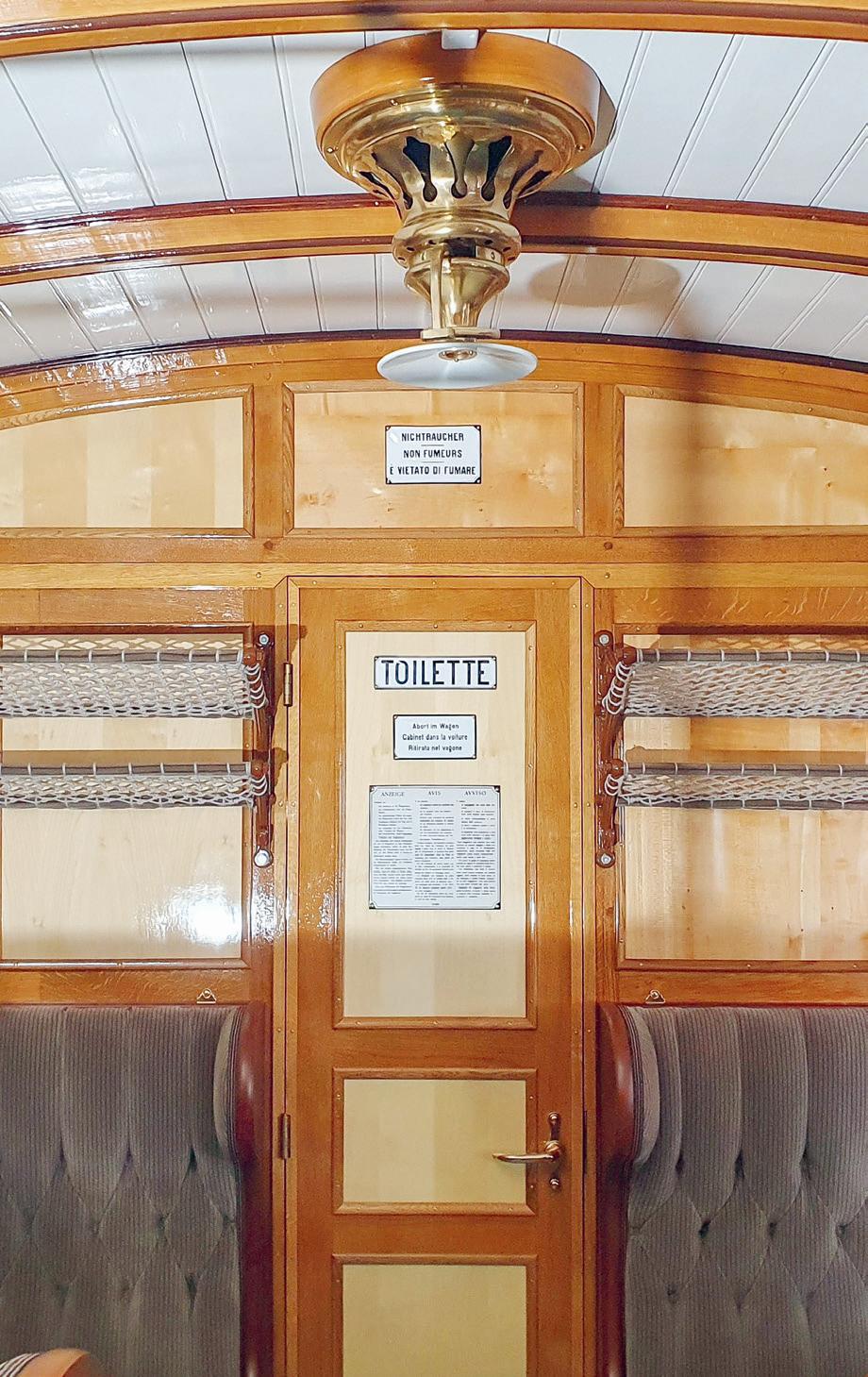
volldampf.ch
Der restaurierte Personenwagen B 3505 soll im September 2025 seine Jungfernfahrt antreten. Le wagon restauré B 3505 entreprendra son voyage inaugural en septembre 2025.
Historische

Landschaftsarchitektin Brigitte Nyffenegger auf der Baustelle der Siedlung Grabenacker: Was an historischen Baumaterialien erhalten werden kann, wird zwischengelagert.
L’architecte Brigitte Nyffenegger sur le chantier du lotissement Grabenacker: les matériaux historiques qui peuvent être réutilisés sont mis de côté.
VERBINDENDE FREIRÄUME
DES ESPACES QUI CRÉENT DU LIEN
Patrick Schoeck, Geschäftsführer BSLA
Erhalten und Weiterbauen: Beides findet in der Siedlung Grabenacker in Oberwinterthur gleichzeitig statt. Brigitte Nyffenegger begleitet als Landschaftsarchitektin diesen Prozess der Veränderung seit vielen Jahren.
Im Zweiten Weltkrieg hatte sich die Wohnungsnot in der Schweiz breitgemacht. Wer wollte in Immobilien investieren, während in Europa die Bomben vom Himmel fielen? In der unsicheren Zeit griffen Bund, Kantone und Städte ab 1942 beherzt in den Markt ein und lancierten ein gross angelegtes System der Wohnbausubventionierung.
Die damaligen Vorgaben zur Subvention lassen sich an der Siedlung Grabenacker der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) ablesen: Im «Landi-Stil» entstanden von 1945 bis 1947 bescheidene Reihenhäuser in kostengünstiger und materialsparender Bauweise. Die Gärten vor den Häusern dienten zur Selbstversorgung der mehrköpfigen Familien.
Préserver et construire: ces deux activités sont menées de front dans le lotissement Grabenacker à Oberwinterthour.
Architecte paysagiste, Brigitte Nyffenegger accompagne cette mutation depuis de nombreuses années.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a souffert d’une pénurie marquée de logements. Qui aurait été assez fou pour investir dans l’immobilier alors que les bombes pleuvaient sur toute l’Europe? En ces temps incertains, la Confédération, les cantons et les villes ont pris le taureau par les cornes et lancé un programme de subventionnement à large échelle.
Le lotissement Grabenacker de la Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) est très représentatif des critères posés à l’époque pour ce financement: ses sobres maisons mitoyennes, dans le style «Landi», ont été construites entre 1945 et 1947 avec des méthodes bon marché et économes en matériaux. Les jardins devaient servir à l’autosuffisance des familles nombreuses.
Sophie Stieger
Die Siedlung hat sich über Jahrzehnte hinweg als lebenswertes Wohnumfeld bewährt. Die gesellschaftlichen Veränderungen haben sich zugleich in die Nutzung eingeschrieben. Gerade an den Gärten sind diese Veränderungen ablesbar, hält die Landschaftsarchitektin Brigitte Nyffenegger fest: «Die Gemüsebeete wurden zu Rasen, die Sitzplätze dehnten sich mehr und mehr aus. Obstbäume und Sträucher verschwanden, und Thujahecken markierten das Private des Gartens.»
Die HGW beschloss vor rund zehn Jahren, die Siedlung mit ihren 144 Reihen- und 4 Mehrfamilienhäusern substanziell zu erneuern. Die Aufgabe war herausfordernd: Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen die Wohnumgebung und die moderaten Mietzinse. Gleichzeitig gab es im Grabenacker-Quartier einen steigenden Bedarf an kleineren Wohnungen. Und zugleich hatte der Kanton Zürich den Denkmalwert des Ensembles in seinem Inventar festgehalten.
Um die Möglichkeiten der Erneuerung im Bestand auszuloten, wurden ein Partizipationsprozess und danach eine Testplanung durchgeführt. «Die Eigentümerin hatte früh erkannt, dass der Freiraum ein prägendes Element der Siedlung ist, und hat die Landschaftsarchitektur von Beginn weg beigezogen», erklärt Brigitte Nyffenegger. Es sei ein Glücksfall, dass dasselbe Planungsteam über alle Phasen von der Testplanung bis zur Umsetzung zusammenarbeiten konnte: «Bauen im Bestand ist aufwendig und verlangt ein grosses gemeinsames Verständnis von den Aufgaben und Zielen.»
Die Reihenhäuser werden als Baudenkmäler integral erhalten. Was sich weiternutzen lässt, bleibt bestehen. Dies gilt auch für die Freiräume: «Was wir an Treppen, Mäuerchen oder Platten finden, wird zwischengelagert und später wieder eingesetzt. Wir wollen auch die Rasenflächen so unberührt wie möglich lassen. Der Tiefbauer musste erst lernen, dass man nicht überall Material ablagern darf.» Der Denkmalwert der Freiräume umfasst die Konzeption, die Raumqualität, die Gliederung und den Anteil an Grünflächen. Mit der Instandstellung soll das zeittypische «fliessende Grün» wieder erkennbar werden.
Ersetzt werden hingegen die Mehrfamilienhäuser der Siedlung. Das Ziel ist, mehr Wohnungsgrundrisse für unterschiedliche Lebensphasen anbieten zu können. Für Brigitte Nyffenegger steht fest: «Der Freiraum nimmt dabei eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Alt und Neu ein und stärkt den Charakter als Ensemble.»
Le quartier a fait ses preuves au fil des décennies comme un cadre de vie de qualité. Les changements sociétaux ont aussi laissé des traces, dans les jardins en particulier, constate Brigitte Nyffenegger. «Les carreaux de légumes deviennent des pelouses, les terrasses s’étendent, les arbres fruitiers et les buissons disparaissent alors que les haies de thuyas garantissent l’intimité des habitants.»
Il y a une dizaine d’années, la HGW a décidé de renouveler substantiellement son lotissement, composé de 144 maisons en rangée et de quatre immeubles locatifs. L’objectif était ambitieux: les habitants étaient attachés à leur cadre de vie et aux loyers modérés. Parallèlement, le quartier du Grabenacker faisait face à une demande croissante pour des logements de plus petite taille. Enfin, le canton de Zurich a inscrit l’ensemble à son inventaire des monuments.
Afin d’évaluer les possibilités de rénovation de ce parc immobilier, un processus participatif, suivi d’une planification test ont été menés. «La propriétaire a reconnu rapidement que les espaces verts constituaient un élément caractéristique du lotissement et a pris en compte dès le début l’architecture paysagère», explique Brigitte Nyffenegger. Par chance, la même équipe a pu collaborer durant toutes les étapes, de la planification test jusqu’à la réalisation. «Intervenir sur la substance existante est compliqué et exige une compréhension commune et approfondie des moyens et des objectifs.»
Vu leur intérêt historique, les maisons en ordre contigu ont été entièrement préservées. Ce qui était encore utilisable est conservé. Ce principe a été aussi appliqué aux espaces extérieurs: «Les escaliers, les murets ou les dalles que nous avons retrouvés sont mis de côté et réutilisés. Dans la mesure du possible, nous voulons aussi laisser telles quelles les pelouses. L’entreprise de génie civil a d’ailleurs dû apprendre qu’on ne peut pas entreposer du matériel n’importe où. La valeur patrimoniale comprend aussi la conception spatiale, le découpage et la proportion de surfaces vertes. La remise en état doit faire ressortir le style «coulée verte» typique de l’époque.
Les immeubles locatifs vont disparaître, en revanche. L’objectif est de proposer des types d’appartements différenciés et plus adaptés aux diverses phases de la vie. Selon Brigitte Nyffenegger, les espaces libres jouent ici un rôle charnière entre l’ancien et le nouveau, et renforcent le caractère d’ensemble du site.

Die Landschaftsarchitektur wurde von Anfang an in die Planung einbezogen. L’architecture paysagère a été intégrée dès le début dans la planification.
Sophie Stieger
CHEMIN FAISANT AVEC LUCIENNE UNTERWEGS MIT LUCIENNE
Amanda Addo, Patrimoine suisse
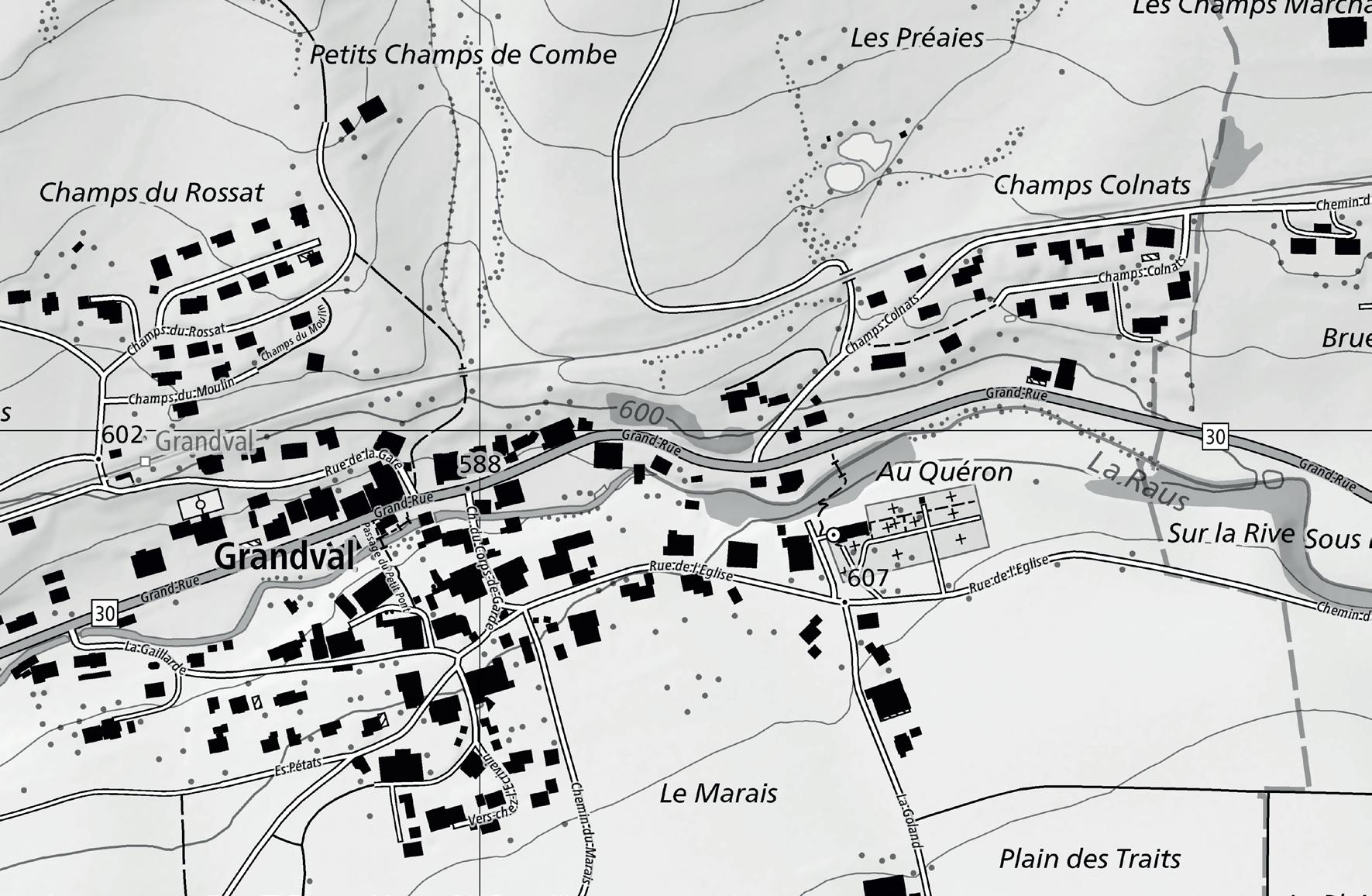

rénove, transmet — et, avec chaleur, fait vivre les pierres. Lucienne Lanaz lebt seit gut 50 Jahren in Grandval (BE). Mit viel Herzblut hat sie hier gefilmt, dokumentiert, renoviert und ihr Wissen weitergegeben.
Lucienne Lanaz a posé ses valises à Grandval (BE) en 1974. Réalisatrice et productrice indépendante, elle a consacré une partie de sa carrière à documenter la vie et le patrimoine du Jura bernois. Elle continue aujourd’hui de faire vivre les lieux, les histoires et les gestes d’un territoire qu’elle s’est attachée à transmettre.
C’est un nuage de fumée flottante qui me guide, avant même d’avoir trouvé la maison de Lucienne. Je longe une rue de Grandval, et remarque qu’elle me mène naturellement à la «Maison du Banneret Wisard», imposante, pyramidale. Est-ce normal? Les passants que je croise n’ont pas l’air de s’en inquiéter. Et moi, pour l’heure, c’est chez Lucienne que je suis attendue. Je la retrouve chez elle 1 , vive, curieuse, un panettone sur la table et un café prêt.
Sa propre maison, achetée en 1974, était en ruine. L’eau courante venait de la fontaine du village. Mais dans cet intérieur aujourd’hui foisonnant, à la fois habité et muséal, des milliers de livres et d’objets cohabitent. Sous la charpente, un enchevêtrement de poutres noircies par les fumées anciennes se déploie, habilement assemblées sans un seul clou. La fumée s’échappant librement de la cuisine à l’époque, elle imprégnait le bois d’une teinte profonde.
Lucienne Lanaz liess sich 1974 in Grandval (BE) nieder. Die selbstständige Regisseurin und Produzentin widmete einen Teil ihrer Karriere der Dokumentation des Lebens und des kulturellen Erbes im Berner Jura. Bis heute hält sie die Orte, Geschichten und Traditionen einer Region lebendig, die ihr am Herzen liegt.
Rauchschwaden führen mich, noch bevor ich zu Luciennes Haus finde. Ich gehe eine Strasse in Grandval entlang und bemerke, dass es mich ganz natürlich zur imposanten «Maison du Banneret Wisard» zieht. Ist das normal? Die Menschen, denen ich begegne, scheinen sich darüber keine Gedanken zu machen. Nun werde ich aber bei Lucienne erwartet. Ich finde sie zu Hause 1 vor, aufgeweckt, neugierig, mit Panettone und fertigem Kaffee auf dem Tisch.
Das Haus, das sie 1974 gekauft hatte, war baufällig. Das Wasser kam aus dem Dorfbrunnen. Doch in diesem heute üppig gefüllten, bewohnten und zugleich museal wirkenden Innenraum stehen Tausende von Büchern und Gegenständen. Unter dem Dachstuhl spannt sich ein Geflecht aus rauchgeschwärzten Balken, das ganz ohne Nägel auskommt. Der Rauch, der damals ungehindert aus der Küche entweichen konnte, hat dem Holz seine dunkle Farbe verliehen.
Quelques pas seulement séparent la maison de Lucienne de celle du Banneret Wisard 2 . Nous nous y rendons, la fumée s’étant enfin dissipée. Car la saison de fumage bat son plein: dans la cuisine voûtée, des saucisses pendent en rangs serrés. La fumée de l’âtre longe la voûte, puis s’échappe dans la charpente. En se diffusant ainsi sous le toit, elle protège le bois des insectes et contribue à la remarquable conservation de la structure, explique Lucienne. Avant que la fondation actuelle n’en assure la gestion, elle a été l’une des personnes-clés dans la transition, en facilitant le lien entre son dernier habitant, Fritz Marti, et les soutiens institutionnels. Elle y a notamment tourné deux films, «Feu, fumée, saucisses» en 1976, puis «Une maison pas comme les autres» en 2007, et a participé à l’obtention de financements. La conservation de la charpente massive, les poutres placées organiquement et noircies par le fumage, ainsi que la remise en place de bardeaux pour restituer l’aspect d’origine de la «Maison du Banneret Wisard» témoignent de la volonté de respecter l’authenticité du lieu, dont l’origine remonte à 1535.
De l’autre côté de la ruelle, nous visitons la maison habitée par Jacqueline, voisine et amie. La «Maison de la dîme» 3 , comme on l’appelle parfois, aurait servi à stocker les impôts en nature, comme des sacs de céréales, destinés au prince-évêque de Bâle. Parmi les pièces voûtées du premier étage, celle aux murs noircis de suie aurait également servi de fumoir. La maison est à peine plus récente que la précédente, probablement construite vers la fin du XVIe siècle.
Nous poursuivons notre chemin plus loin vers la réserve naturelle des Préaies 4 , un écrin de biodiversité créé et géré par le club d’ornithologie de Moutier: des étangs sur deux niveaux, une cabane d’observation sombre et discrète, quelques chèvres chargées d’entretenir le paysage. À la belle saison, libellules, oiseaux, grenouilles et salamandres animent le site. Un lieu aménagé avec attention, comme les maisons que Lucienne fait vivre à sa façon.
Où habitez-vous? Voulez-vous nous présenter un lieu particulier près de chez vous? Écrivez-nous un e-mail à redaktion@heimatschutz.ch et accompagnez Amanda Addo dans votre univers.

Nur wenige Schritte trennen Luciennes Haus von der «Maison du Banneret Wisard». 2 Wir gehen dorthin, nachdem sich der Rauch verzogen hat. Die Räuchersaison ist in vollem Gange: In der gewölbten Küche hängen Würste dicht an dicht. Der Rauch aus der Feuerstelle strömt am Gewölbe entlang und entweicht in den Dachstuhl. Dort schützt er das Holz auch vor Insekten und trägt zum Erhalt der Struktur bei, erklärt Lucienne. Bevor die heutige Stiftung die Verwaltung übernahm, war sie eine der Schlüsselpersonen im Übergangsprozess und vermittelte zwischen dem letzten Bewohner, Fritz Marti, und den institutionellen Trägern. Sie drehte dort die beiden Filme «Feu, fumée, saucisses» (1976) und «Une maison pas comme les autres» (2007) und war an der Mittelbeschaffung beteiligt. Der Dachstuhl und die organisch angeordneten, rauchgeschwärzten Balken blieben erhalten, und auch die Schindeln wurden wieder angebracht. So erhielt die «Maison du Banneret Wisard» ihr ursprüngliches Erscheinungsbild zurück, und das Ensemble, dessen Ursprünge auf das Jahr 1535 zurückgehen, konnte bewahrt werden.
Auf der anderen Strassenseite steht das Haus von Jacqueline, einer Nachbarin und Freundin. Das «Zehntenhaus» 3 , wie es manchmal genannt wird, diente vermutlich als Lager von Naturalsteuern wie Getreidesäcken, die für den Fürstbischof von Basel bestimmt waren. Unter den gewölbten Räumen im ersten Stock diente ein russgeschwärztes Zimmer vermutlich als Räucherkammer. Das Haus ist kaum jünger als das vorherige und wurde vermutlich Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Wir gehen weiter zum Naturschutzgebiet Préaies 4 , einer Oase der Artenvielfalt, die vom Vogelschutzverein Moutier angelegt wurde und gepflegt wird: Teiche auf zwei Ebenen, eine unscheinbare Beobachtungshütte, einige Ziegen, die das Gras abweiden. In den warmen Monaten beleben Libellen, Vögel, Frösche und Salamander das Areal. Ein Ort, der mit viel Liebe gestaltet wurde – genau wie die Häuser, die Lucienne auf ihre Weise mit Leben erfüllt.
Wo leben Sie? Welchen speziellen Ort in Ihrem Umfeld möchten Sie uns zeigen? Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@heimatschutz.ch, und begleiten Sie Amanda Addo auf einer Tour durch Ihre Umgebung.

Saison de fumage à Grandval: suie sur les murs, saucisses au plafond Räuchersaison in Grandval: Russ an den Wänden und Würste an der Decke
Lucienne et Jacqueline devant la «Maison de la dîme» Lucienne und Jacqueline vor dem «Zehntenhaus»
ZUG ENTDECKEN
Zu ihrem 150-jährigen Bestehen hat die Bürgergemeinde der Stadt Zug einen Stadtführer herausgegeben. Das Besondere daran: Das Buch versammelt nicht nur materielles Kulturerbe wie bedeutende Gebäude, Plätze oder Kunstwerke – immaterielles Kulturgut wie Brauchtum oder handwerkliche Traditionen ergänzen es zu einer kulturgeschichtlichen Gesamtsicht. So haben neben dem Rathaus mit Treppengiebel oder dem Landsgemeindeplatz auch die Zuger Fasnacht und der «Chriesisturm» ihren Platz. Nach einem einleitenden historischen Überblick ist die ansprechend gestaltete Publikation in acht abwechslungsreiche Rundgänge gegliedert. Sie führen durch die verschiedenen Stadtquartiere, aber auch auf den Zugerberg. Fahren Sie wieder einmal nach Zug, es gibt viel zu entdecken! Regula Steinmann
Beiträge von Brigitte Moser, Thomas Glauser, Peter Hoppe, Michael van Orsouw, Michael Hanak, Flavia Müller, Carl Bossard, Elisabeth Feiler-Sturm und Daniel Schläppi Fotoessay von Alexandra Wey
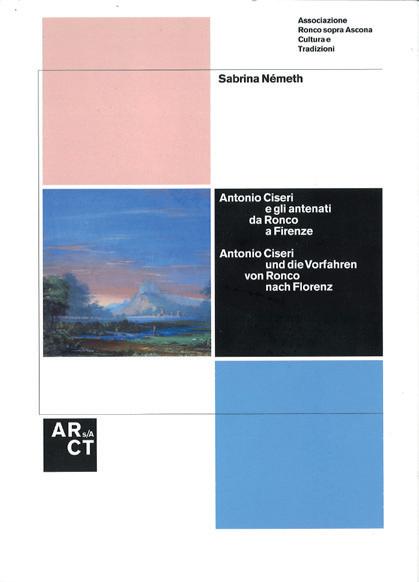
Sabrina Németh: Antonio Ciseri und die Vorfahren von Ronco nach Florenz. Associazione Ronco sopra Ascona. Cultura e Tradizioni 2024, 64 Seiten, CHF 20.–
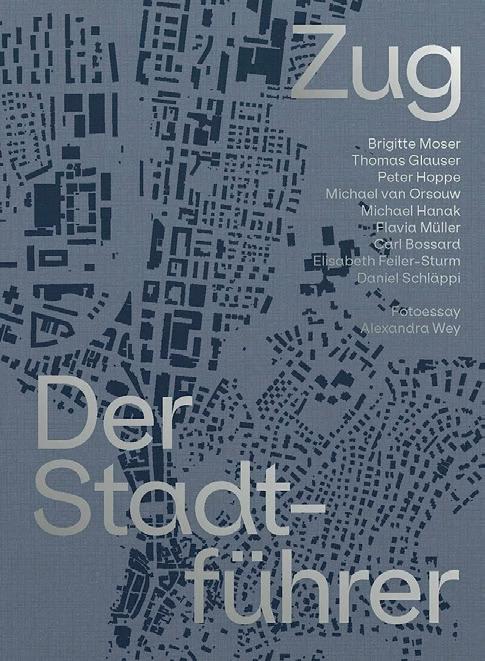
Bürgergemeinde der Stadt Zug (Hg.): Zug. Der Stadtführer.
Kalt Medien 2024, 228 Seiten, CHF 39.–
VON RONCO NACH FLORENZ
Im Rahmen der Ausstellung «Antonio Ciseri und die Vorfahren von Ronco nach Florenz» in der Casa Ciseri in Ronco sopra Ascona (TI) entstand diese Publikation des lokalen Kulturvereins, der sich seit 1999 der Erhaltung und Aufwertung des künstlerischen Erbes, der Baukultur und des Brauchtums des Ortes widmet. Sie zeichnet die Biografie und das künstlerische Schaffen von Antonio Ciseri (1821–1891) nach und stellt sein Werk in den familiären Kontext seiner Vorfahren, die aus beruflichen Gründen vorübergehend oder dauerhaft in die Toskana ausgewandert waren. Von Ronco nach Florenz: Die Publikation ermöglicht es, Ronco anhand dreier architektonischer Juwelen – Casa Ciseri, Casa Suter und Ca’ di Pitur – neu zu entdecken, aber auch in die faszinierende Welt des architektonischen Illusionismus des Florentiner Barock einzutauchen, dank des berühmtesten Vorfahren von Antonio Ciseri, Andrea II (1612 bis ca. 1678). Peter Egli
INGENIEURBAUTEN DER RHÄTISCHEN
BAHN
Wer regelmässig mit dem Zug ins Bündnerland fährt, kennt sie nur zu gut: die imposanten Eisenbahnbrücken und Viadukte in der Berglandschaft. Sie verwandeln manche Zugfahrt zu einem faszinierenden baukulturellen Ereignis. Gut 600 Brückenbauwerke sind seit dem späten 19. Jahrhundert auf den verschiedenen Linien der Rhätischen Bahn (RhB) entstanden. Die Publikation widmet sich den denkmalpflegerischen und technischen Herausforderungen, die sich beim Umgang mit den teilweise über 100-jährigen Bauwerken stellen. Reich bebildert gibt die umfangreiche Denkschrift einen Einblick in gestalterische Überlegungen und betriebliche Rahmenbedingungen und zeigt Verfahren der Instandhaltung auf. Mit der Auswahl der Autorinnen und Autoren tragen die Herausgebenden unterschiedliche Perspektiven, so etwa jene der Bauherrschaft, der Architektur, der Landschaftsplanung oder von Expertinnen und Experten, zusammen und schaffen so einen vielfältigen Blick auf die Ingenieurbauten der RhB. Rebekka Ray
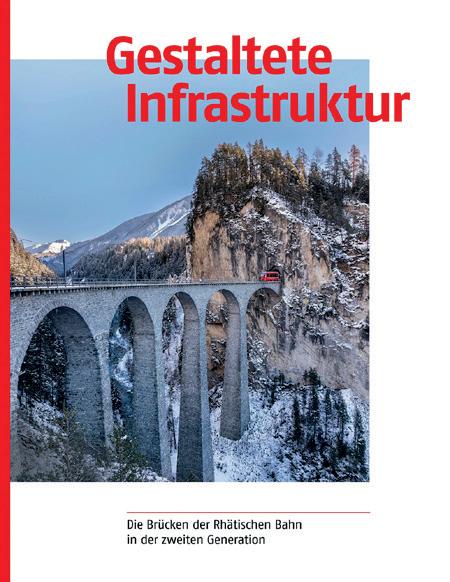
Scheidegger & Spiess 2024, 272 Seiten, CHF 69.–
Karl Baumann, Clementine Hegner-van Rooden (Hg.): Gestaltete Infrastruktur. Die Brücken der Rhätischen Bahn in der zweiten Generation.
IDEEN FÜR EIN NEUES ERNÄHRUNGSSYSTEM
Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) stellt das Masterstudium der Architektur unter ein jeweiliges Jahresthema von gesamtgesellschaftlicher Tragweite. Mit Feed the City spricht das Institut für Architektur die Transformation des weltweiten Ernährungssystems an, das nicht nur für 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, sondern auch wesentlich zum Verlust an Biodiversität, zu Abholzung und Erosion beiträgt, wie Axel Humpert und Tim Seidel in der Einleitung zum Reader schreiben. Dieser beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Architektur und einem nachhaltigen Ernährungssystem. Wenn es kleinteiliger, regionaler und ökologischer wird, hat das auch Einfluss auf Architektur und Raumplanung, wie Beiträge von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten zeigen. Randabfallende Bilder illustrieren thematische Schwerpunkte wie «Logistik / Lagerung», «Verarbeitung / Konsum» oder «Entsorgung / Weiterverarbeitung» und machen das Buch zu einem Zeitdokument des Lebensmittelkreislaufs in der Stadt Basel und ihrer trinationalen Agglomeration. Jenny Keller
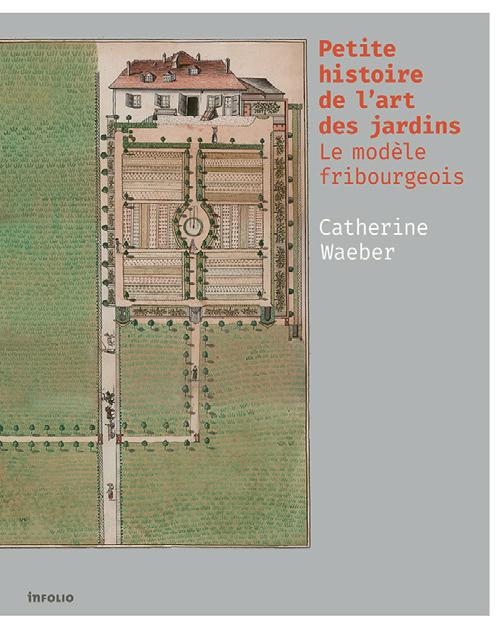
Catherine Waeber: Petite histoire de l’art des jardins. Le modèle fribourgeois. Infolio 2025, 152 pages, CHF 35.–
DIE WELT DES
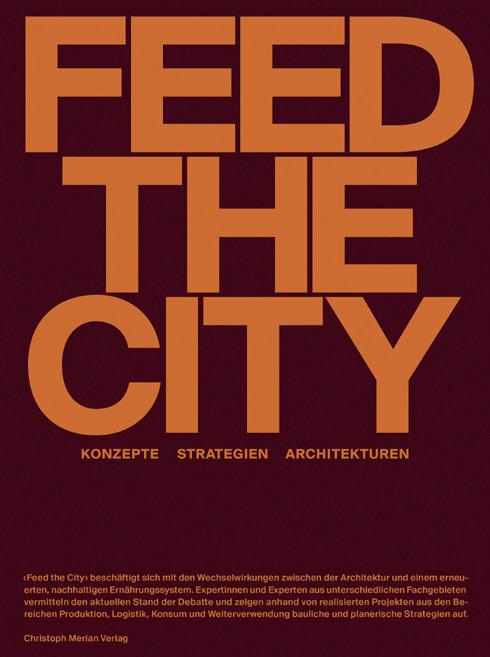
FHNW Institut Architektur, Axel Humpert, Barbara Lenherr, Tim Seidel
UNE HISTOIRE DES JARDINS FRIBOURGEOIS
Dans sa «Petite histoire de l’art des jardins», l’historienne de l’art Catherine Waeber met en lumière la beauté des jardins historiques fribourgeois. Elle s’intéresse principalement aux jardins des châteaux et manoirs de la région, en les replaçant dans le contexte plus large de l’histoire européenne des jardins. Bien que nombre de ces aménagements, créés entre le XVIe et le XVIIIe siècle, aient aujourd’hui disparu, ils sont décrits avec richesse et force d’image grâce à des trésors archivistiques: plans historiques, dessins et peintures permettent d’en restituer l’importance et l’esthétique. Quant aux jardins créés aux XIXe et XXe siècles, souvent encore bien conservés, leurs descriptions sont complétées par des photographies actuelles, qui illustrent leur évolution au fil des dernières décennies. Peter Egli
OFENBAUS
Hafner Walter Higy öffnet mit diesem umfangreichen Werk ein Fenster in die Welt der Kachelöfen. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung dokumentiert er nicht nur die technische und gestalterische Vielfalt dieser Objekte, sondern auch ihre kulturelle und soziale Bedeutung über vier Jahrhunderte hinweg. Rund 320 Abbildungen zeigen die beeindruckende Handwerkskunst und die Vielfalt der Öfen. Dem Autor gelingt es, technische Details verständlich zu erklären und gleichzeitig die Geschichten hinter den Ofenbauten lebendig werden zu lassen. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in einen oft übersehenen, aber prägenden Teil unseres gebauten Kulturerbes. Es ist eine wertvolle Ressource für Fachleute und Laien gleichermassen, die sich für die Arbeit des Ofensetzens interessieren. Natalie Schärer
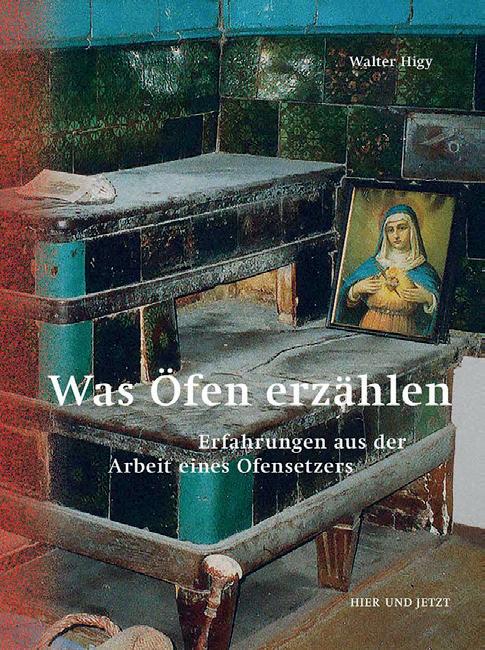
Walter Higy: Was Öfen erzählen. Erfahrungen aus der Arbeit eines Ofensetzers. Hier und Jetzt 2024, 480 Seiten, CHF 79.–
(Hg.): Feed the City. Konzepte, Strategien, Architekturen. Christoph Merian Verlag 2024, 284 Seiten, CHF 39.–
DER HEIMATSCHUTZ HILFT, GÜNSTIGE ALTBAUWOHNUNGEN ZU RETTEN PATRIMOINE SUISSE AIDE À PRÉSERVER DES LOGEMENTS ANCIENS BON MARCHÉ
Wir leben in einer Zeit beispielloser Zerstörung unserer überlieferten Baukultur. Viele Dörfer im Mittelland haben innert weniger Jahre ihr gewohntes Aussehen verloren. Nach den Agglomerationsgemeinden um die grösseren Städte sind jetzt die Dörfer in abgelegeneren Gebieten an der Reihe, so etwa im Aargau, wo Dörfer wie Villmergen, Wohlen und viele andere innert kurzer Zeit zu Wüsten der heute üblichen Trivialarchitektur werden. Was aber tut die Politik? Dort hört man vor allem Gejammer über die stetigen Verhinderungen durch Einsprachen. Es heisst (je nach Quelle), 80 oder gar 90 Prozent der Einsprachen seien «missbräuchlich». Dabei bezieht man sich auf Zahlen aus dem Kanton Zürich, wo – wie in den Jahresberichten der Gerichte nachzulesen ist – über 20 Prozent der Baurekurse gutgeheissen, ungefähr gleich viele abgewiesen und der grosse Rest von gegen 60 Prozent mit einem Vergleich enden. Geschätzt 30 bis 40 Prozent der Rechtsmittel von Nachbarn sind damit erfolgreich, beim Heimatschutz sind es rund zwei Drittel oder mehr. Diese Realitäten werden in den Medien totgeschwiegen, was parlamentarische Vorstösse provoziert, die die Rechtsmittel für Private und Verbände einschränken möchten. Es soll sich möglichst niemand mehr gegen Abbrüche wehren dürfen.

Nous vivons dans une période de destruction sans précédent de la culture du bâti qui nous a été transmise. De nombreuses localités du Plateau ont perdu leur aspect familier en l’espace de quelques années. Après les communes des agglomérations, les villages des régions périphériques, comme les communes argoviennes de Villmergen ou Wohlen, pour n’en citer que quelquesunes, sont victimes de cette architecture banale qui est de mise aujourd’hui. Mais que font les responsables politiques? Ils se plaignent avant tout des obstacles résultant des oppositions. Selon les sources, 80 à 90% de ces procédures seraient «abusives». Si l’on se réfère aux rapports annuels des tribunaux du canton de Zurich, plus de 20% des recours en matière de construction sont admis, environ autant sont rejetés et plus de la moitié aboutissent à une conciliation. On peut ainsi estimer que 30 à 40% des procédures judiciaires menées par les voisins aboutissent –avec un taux de réussite des deux tiers, voire plus, dans le cas de Patrimoine suisse. Cette réalité est tue dans les médias, ce qui entraîne des interventions parlementaires visant à restreindre le droit d’opposition des particuliers et des organisations. Dans ce meilleur des mondes, plus personne ne devrait pouvoir combattre les démolitions.
Denn alle wollen mehr Wohnungen – subito! Bei einer Bevölkerung, die ungebremst in einem historisch einmaligen Tempo wächst, ist dieser Mangel sehr wohl real. Das Problem ist nur, dass die neuen Wohnungen meistens auf Bauland entstehen, wo zuvor billige Altbauwohnungen standen, und dass die neuen ausnahmslos um ein Vielfaches teurer sind als die alten. Wohnungsnot kennen gutverdienende Menschen kaum, wohl aber diejenigen, die einen «normalen» Lohn nach Hause bringen. Ihre Wohnungsnot wird durch die Bautätigkeit verschärft und nicht etwa vermindert. Selbstverständlich betreibt der Heimatschutz nicht Wohnungspolitik, sondern verteidigt den Denkmal- und Ortsbildschutz. Wenn jedoch bei jeder Gelegenheit betont wird, wie sehr der Schutz der Baukultur den Bau «zeitgemässer» Wohnungen verhindere, dann darf man auch einmal sagen, wie sehr dies in vielen Fällen mit der Rettung günstiger Altbauwohnungen einhergeht. Auf das Preisproblem hat die Politik bisher überhaupt keine Antworten. Und die Verdichtung? Auch hier hapert es gewaltig, denn sehr oft werden kleinere Wohnungen durch grosse Apartments ersetzt, die mehr Profit versprechen, aber am Ende überhaupt nicht für mehr Menschen Platz bieten.
Car tout le monde veut plus de logements – et tout de suite! Alors que la population croît à un rythme historiquement inégalé, la pénurie est certes réelle. Le problème est que les nouveaux bâtiments sont construits en général sur des terrains qui étaient occupés par de l’habitat ancien et bon marché, et que ces nouveaux appartements sont sans exception beaucoup plus chers que ceux qu’ils remplacent. Les personnes bien nanties ne souffrent guère de la pénurie de logements mais il en va tout autrement de celles qui doivent se contenter d’un salaire «normal». Au lieu d’être réduites, leurs difficultés à se loger sont aggravées par le boom de la construction. Bien entendu, Patrimoine suisse ne fait pas de politique du logement, mais de la préservation des monuments et des sites. Cependant, lorsqu’on entend à tout bout de champ que la protection de la culture du bâti entrave la construction de logements «modernes», on peut aussi rappeler qu’elle contribue dans de nombreux cas à la sauvegarde d’un habitat ancien et bon marché. Or les milieux politiques n’apportent aucune réponse à la problématique des prix. Et qu’en est-il de la densification? Là aussi, on nage en pleine contradiction, car très souvent les petits logements sont remplacés par de vastes appartements, qui rapportent plus mais qui, à l’arrivée, n’accueillent pas davantage d’occupants.
Prof. Dr. Martin Killias
Präsident Schweizer Heimatschutz
Jutta Vogel
GESCHÄFTSSTELLE/SECRÉTARIAT
Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse
Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich T 044 254 57 00, info@heimatschutz.ch, heimatschutz.ch info@patrimoinesuisse.ch, patrimoinesuisse.ch
Geschäftsführer/Secrétaire général: David Vuillaume
VORSTAND/COMITÉ
Präsident/Président:
Prof. Dr. Martin Killias
Vizepräsident/Vice-président: Beat Schwabe
Übrige Mitglieder/Autres membres: Benedetto Antonini, Christof TscharlandBrunner, Claire Delaloye Morgado, Monika Imhof-Dorn, Caroline Zumsteg
SEKTIONEN/SECTIONS
Aargauer Heimatschutz
Präsident: Christoph Brun Gehrig
Geschäftsstelle: Lucienne A. Köpfli heimatschutz-ag.ch
Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden
Präsidentin: Irene Hochreutener heimatschutz-ar.ch
Baselbieter Heimatschutz
Präsident: Angelo Tomaselli
Geschäftsstelle: Nadine Caflisch heimatschutz-bl.ch
Heimatschutz Basel
Präsident: Marc Keller
Geschäftsstelle: Andreas Häner heimatschutz-bs.ch
Berner Heimatschutz
Präsident: Luc Mentha
Geschäftsstelle: Andrea Schommer-Keller bernerheimatschutz.ch
Pro Fribourg
Présidence: vacante
Secrétariat général: Sylvie Genoud Jungo pro-fribourg.ch
Patrimoine Gruyère-Veveyse
Président ad interim: Serge Castella monpatrimoine.ch
Patrimoine suisse Genève
Coprésidence: Pauline Nerfin, Lionel Spicher
Secrétariat: Sara Hesse patrimoinegeneve.ch
Glarner Heimatschutz
Präsident ad interim: Marc Schneiter
Geschäftsstelle: Sarah Maria Lechner glarnerheimatschutz.ch
Bündner Heimatschutz
Präsident: Patrick Gartmann
Geschäftsstelle: Ludmila Seifert heimatschutz-gr.ch
Protecziun da la patria Grischun dal Süd
Präsidentin: Patrizia Guggenheim heimatschutz-engadin.ch
Innerschweizer Heimatschutz
Präsident: Dr. Remo Reginold
Geschäftsstelle: Marco Füchslin innerschweizer-heimatschutz.ch
Patrimoine suisse, section Jura
Président ad interim: Toufiq Ismail-Meyer
Secrétariat: Gabriel Jeannerat patrimoinesuisse.ch/jura
Patrimoine suisse, section neuchâteloise
Président: Denis Clerc patrimoinesuisse.ch/neuchatel
Heimatschutz St. Gallen / Appenzell I.-Rh.
Präsident: Jakob Ruckstuhl
Geschäftsstelle: Annina Sproll heimatschutz-sgai.ch
Schaffhauser Heimatschutz
Präsidentin: Katharina E. Müller
heimatschutz-sh.ch
Schwyzer Heimatschutz
Präsidentin: Isabelle Schwander heimatschutz-sz.ch
Solothurner Heimatschutz
Präsident: Daniele Grambone
Geschäftsstelle: Michael Rothen heimatschutz-so.ch
Thurgauer Heimatschutz
Präsident: Kurt Egger
Geschäftsstelle: Gianni Christen heimatschutz.ch/thurgau
Società ticinese per l’arte e la natura (STAN)
Presidente: Tiziano Fontana stan-ticino.ch
Patrimoine suisse Vaud
Présidente: Muriel Thalmann
Secrétariat: Sophie Cramatte patrimoinesuisse-vd.ch
Oberwalliser Heimatschutz
Präsidentin: Valeria Triulzi oberwalliserheimatschutz.ch
Patrimoine suisse, section Valais romand
Président: Léonard Bender patrimoinesuisse.ch/valais
Zuger Heimatschutz
Co-Präsidium: Paul Baumgartner, Thomas Christmann
Geschäftsstelle: Regula Waller zugerheimatschutz.ch
Zürcher Heimatschutz
Präsident: Prof. Dr. Martin Killias
Geschäftsstelle: Bianca Theus, Christine Daucourt heimatschutz-zh.ch
FACHVERTRETER/INNEN/REPRÉSENTANT-E-S DES MILIEUX SPÉCIALISÉS
Ursula Boos, Lucie Hubleur, Damian Jerjen, Dr. phil. Friederike Mehlau Wiebking, Dr. Raimund Rodewald, Christoph Schläppi
STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL/ FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE
Geschäftsführerin/Directrice: Christine Matthey ferienimbaudenkmal.ch vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
SCHOGGITALER/ÉCU D’OR
Geschäftsleiterin/Direction: Loredana Ventre schoggitaler.ch, ecudor.ch
EHRENMITGLIEDER/MEMBRES D’HONNEUR
Marco Badilatti, Philippe Biéler, Denis Buchs, Dr. Caspar Hürlimann, Dr. Andrea Schuler
WERDEN SIE TEIL UNSERER GEMEINSCHAFT/REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ: heimatschutz.ch/newsletter patrimoinesuisse.ch/infolettre



IMPRESSUM/IMPRESSUM 2/2025
120. Jahrgang/120e année
Herausgebe/Éditeur:
Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse
Redaktion/Rédaction: Natalie Schärer, Peter Egli (Leitung) Marlyse et Laurent Aubert (traductions) Irene Bisang (Übersetzungen)
Redaktionskommission/Commission de rédaction: Lucia Gratz (Vorsitz), Architektin TU / MAS ETH
Hans-Ruedi Beck, MSE Raumentwicklung/ Landschaftsarchitektur
Christian Bischoff, architecte EPFZ Karoline Wirth, Journalistin, Videobiografin David Vuillaume, Geschäftsführer Peter Egli, Architekt FH/MAS Denkmalpflege und Umnutzung
Druck/Impression: Stämpfli Kommunikation, Bern
Gestaltungskonzept/Maquette: Stillhart Konzept und Gestaltung, Zürich
Erscheint/Parution: vierteljährlich/trimestrielle
Auflage/Tirage: 18 000 Ex.
Adresse:
Redaktion Heimatschutz/Patrimoine, Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich, T 044 254 57 00, redaktion@heimatschutz.ch, redaction@patrimoinesuisse.ch ISSN 0017-9817
Die Zeitschrift als Online-Ausgabe: heimatschutz.ch/zeitschrift Revue disponible en ligne: patrimoinesuisse.ch/revue
Ausgabe 3/2025 erscheint am 25. August 2025 Le numéro 3/2025 paraîtra le 25 août 2025
Adressänderungen: heimatschutz.ch/adressaenderung Changement d’adresse: patrimoinesuisse.ch/changement-d-adresse
Datenschutz: heimatschutz.ch/datenschutz Protection des données: patrimoinesuisse.ch/protection-des-donnees

Ich bestelle/Je commande Die schönsten Aussichten Les plus beaux points de vue Die schönsten Bauten 1975–2000 Les plus beaux bâtiments 1975–2000
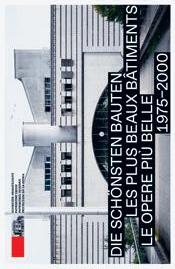







Name, Vorname/Nom, prénom
Strasse, Nr./Rue, n o PLZ, Ort/NPA, lieu Telefon, E-Mail/Téléphone, e-mail Datum, Unterschrift/Date, signature
Ich werde Freundin oder Freund der Villa Patumbah. Bitte schicken Sie mir mehr Informationen zum Heimatschutzzentrum.
Die schönsten Hotels der Schweiz Les plus beaux hôtels de Suisse CHF 18.–(CHF 10.–für Heimatschutzmitglieder, exkl. Porto) CHF 1 8.–(CHF 1 0.–pour les membres de Patrimoine suisse, port exclu)
I ch bin bereits Mitglied beim Schweizer Heimatschutz.
Je suis déjà membre de Patrimoine suisse. Ich werde Mitglied beim Schweizer Heimatschutz (CHF 70.–pro Jahr*) und profitiere von Sonderkonditionen.
Je deviens membre de Patrimoine suisse (CHF 70.–par an*) et je profite de conditions préférentielles.
* Kantonale Abweichungen möglich: heimatschutz.ch/mitglied * Les tarifs peuvent différer selon la section: patrimoinesuisse.ch/membre heimatschutz.ch/datenschutz patrimoinesuisse.ch/protection-des-donnees
Name, Vorname Strasse, Nr. PLZ, Ort Telefon, E-Mail Beruf, Geburtsjahr Datum, Unterschrift

GUTE BAUKULTUR BRAUCHT BILDUNG UND VERMITTLUNG
Unser Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah in Zürich schärft den Blick für die Baukultur und spricht mit Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen ein breites Publikum an. Als Freundin oder Freund der Villa Patumbah helfen Sie, den Betrieb des Heimatschutzzentrums langfristig zu sichern, und unterstützen dabei unser vielfältiges Engagement in der Vermittlung von Baukultur. Herzlichen Dank! Unterstützen Sie uns! We rden Sie Freundin oder Freund der Villa Patumbah ab CHF 1000.–pro Jahr. Ihre Vorteile
Freier Eintritt ins Heimatschutzzentrum
Gratismitgliedschaft beim Schweizer Heimatschutz
Persönliche Einladung zu unseren Ausstellungen und Veranstaltungen, Spezialführungen u.v.m.
heimatschutzzentrum.ch/unterstützen
Jede Spende zählt! I BA N: CH69 0483 5169 8616 9100 0 Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich heimatschutz.ch/datenschutz














Die schönsten




Aussichten
Der Schweizer Heimatschutz begeht mit der Publikation Die schönsten Aussichten neue Wege abseits altbekannter Tourismuspfade–für alle, die unsere Begeisterung für Kulturlandschaften und Baukultur teilen und die Schweiz aus einer neuen Perspektive erleben möchten. Lassen Sie sich inspirieren, und erfahren Sie Wissenswertes über 50 aussergewöhnliche Aussichtspunkte und die Ausblicke, die sie bieten.
Preis: CHF 18.–für Heimatschutz-Mitglieder: CHF 10.–
Zu bestellen mit portofreier Karte auf der Rückseite oder unter heimatschutz.ch/shop

Jetzt bestellen Commander maintenant

Les plus beaux points de vue
Avec Les plus beaux points de vue, Patrimoine suisse emprunte des chemins inexplorés qui s’écartent des sentiers touristiques battus et rebattus, pour tous ceux qui partagent notre attachement aux paysages cultivés et à la culture du bâti, et qui souhaitent changer de perspective pour découvrir la Suisse. Laissezvous inspirer et apprenez des choses captivantes sur 50 points de vue qui sortent de l’ordinaire, et sur les horizons qu’ils nous ouvrent.
Prix: CHF 18.–pour les membres: CHF 10.–
À commander avec le talon-réponse en dernière page ou sur patrimoinesuisse.ch/boutique

