

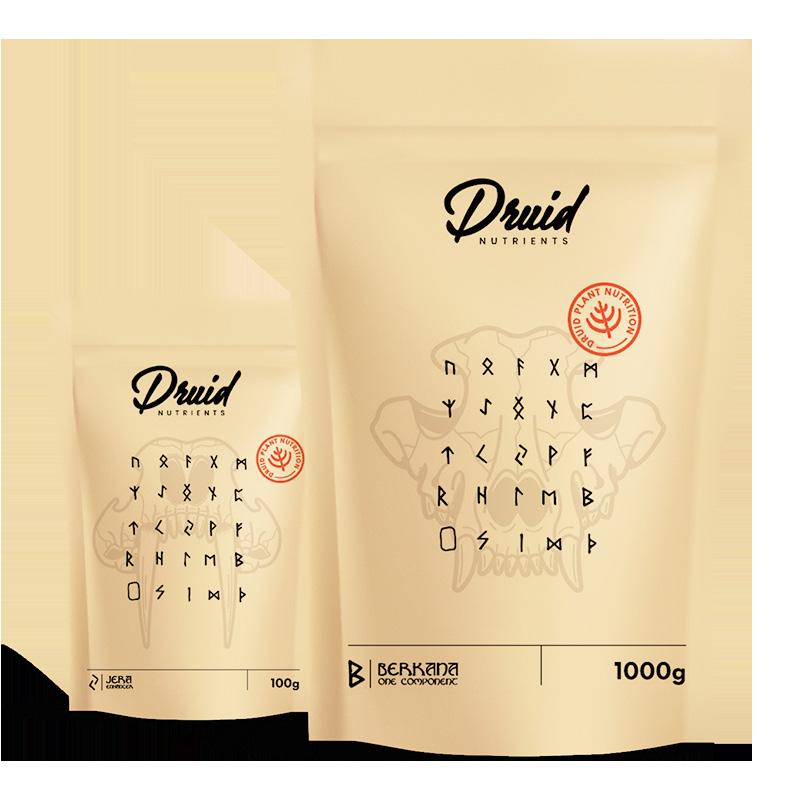










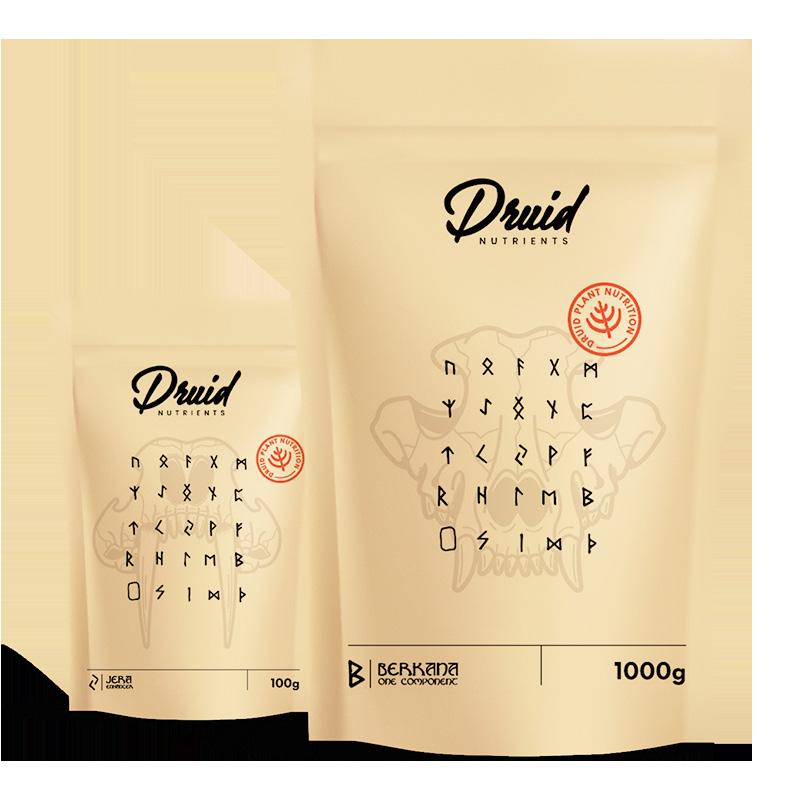







Bereits jetzt, gerade mal ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des neuen Cannabisgesetzes CanG, offenbaren sich die inhaltlichen Schwachstellen in den Details des zu bürokratischen und zu komplexen Regelwerks. Von allen Seiten hagelt es Kritik, dem einen zu liberal, dem nächsten zu restriktiv, so richtig zufrieden will mit der neuen Lage niemand sein.
Vor allem die für die gemeinschaftliche Versorgung gedachten Anbauclubs kommen in vielen Regionen Deutschlands nicht richtig aus den Startlöchern. In einigen Fällen zeigten sich schon Schwierigkeiten bei der Klärung der Zuständigkeiten für Antragsbearbeitung, Lizenzvergabe und Überprüfung der Cannabisclubs. Nun, da die Ampelkoalition eine sagenhafte Bruchlandung hinlegt, stellt sich ohne-
hin die Frage, was uns mit einer kommenden Regierung, mutmaßlich mit Unionsbeteiligung, in Sachen Cannabisgesetzgebung erwartet.
Dennoch können Zweifel und Kleinigkeiten bei vielen die Freude nicht trüben, die nun ihren ersten Festivalsommer ohne Cannabis-Repressalien verbringen durften, Autofahrer leider ausgenommen. Wer ohne Teilnahme am Straßenverkehr Musik, Fest und Cannabis genossen hat, für den war der letzte Sommer vielleicht wirklich ein wahr gewordener Traum. Und mal ehrlich, neben einiger Kritikpunkte lässt es sich dann schon ganz gut leben mit der neuen Freiheit.







TEXT PETER LEIS
Die Erzählung von der gar nicht so harmlosen Einstiegsdroge „Marihuana und Haschisch“ war eine Kernaussage aus den „Keine Macht den Drogen“-Broschüren in den 1990er Jahren.
Cannabis, so hieß es darin, werde zwar als weiche Droge und natürliches Betäubungsmittel bezeichnet, doch das für den „Rausch“ verantwortliche Tetrahydrocannabinol (THC) stelle vor allem für junge Konsumenten eine Gefahr dar und führe oft zu härteren Suchtmitteln. Eine Drogenkarriere mit immer schädlicheren Rauschgiften sei vorprogrammiert, und ein Abwärtsstrudel aus Kontrollverlust, Sucht, Beschaffungskriminalität − und manchmal sogar Prostitution − folge zwangsläufig. Was mit einem Zug an einer seltsam riechenden Zigarette beginnt, endet schließlich mit einer Spritze im Arm und extremen Konsequenzen für die eigene Gesundheit und das soziale Umfeld.
Bei der landesweiten Anti-Drogen-Kampagne für Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen ging es vor allem um Abschreckung und das Schüren von Ängsten – wissenschaftliche Daten oder Begriffe wie „Harm Reduction“ spielten dabei keine Rolle. Cannabis wurde mit anderen illegalen Drogen wie LSD, Kokain und Heroin gleichgesetzt, während die legalen Drogen Tabak und Alkohol kaum Beachtung fanden. In Kombination mit den
bebilderten Horrorgeschichten aus den staatlichen Drogenpräventionsheftchen wurde häufig der eindrucksvolle Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ gezeigt, um einen maximalen Schockeffekt zu erzielen. Mit diesen „Aufklärungsmaterialien“ wurde auch ich von 1994 bis 1998, im Alter von 12 bis 16 Jahren, in der Unter- und Mittelstufe eines Gymnasiums in BadenWürttemberg ständig konfrontiert. Im Gegensatz zu dem ebenfalls aus der Zeit gefallenen, aber zumindest voyeuristisch informativen Dokufilm über heroinabhängige Kinder aus dem geteilten Westberlin, waren die „Keine Macht den Drogen“-Pamphlete nicht einmal unterhaltsam. Leider. Nicht umsonst galt es bei Lehrern aller Fachrichtungen als beliebte Strafarbeit, renitente oder im Unterricht „schwätzende“ Schüler die offensichtlich sehr einseitigen Texte aus den Präventionsheftchen mit der abgestürzten Marionette auf dem Cover abschreiben zu lassen.
Bei den älteren Mitschülern in der Raucherecke fiel jedoch auf, dass die dort kiffenden Oberstufler keinen abgewrackten Eindruck à la Christiane F. machten. Zwar rochen ihre selbst gedrehten Lungentorpedos seltsam und ihre Frisuren waren ungewöhnlich, aber die häufig kichernden Haschbrüder und Grasschwestern mit ihren Gesprächen über Musik, Politik und Geschichte waren mir definitiv näher als die saufenden Neo-Nazis aus der Region mit ihren stumpfen Parolen und den mit
Asbach-Cola gefüllten Gießkannen. Über den vergleichsweise „kulturnahen“ Alkoholismus der halbstarken Skinheads gab es aber natürlich keine bunten Präventionsheftchen.
Vielleicht wegen dieser eindeutigen Asymmetrie verfehlte die einseitig auf Abschreckung setzende Drogenprävention bei mir völlig ihr Ziel. Nach vier Jahren der Gehirnwäsche begann ich mit 17 Jahren „Marihuana und Haschisch“ zu rauchen, und Cannabis erwies sich auch bei mir als Einstiegsdroge – allerdings nicht in Richtung Ecstasy, LSD, Kokain oder gar Heroin, wie in den Broschüren prophezeit, sondern überraschenderweise hin zu einer legalen Droge, von der dort kaum die Rede war: Tabak.
Da Cannabis üblicherweise mit industriell produziertem Zigarettentabak gemischt geraucht wird, entwickelte sich bei mir fast unbemerkt eine hartnäckige Nikotinsucht, und ich blieb über zwei Jahrzehnte Zigarettenraucher.
Dieses Problem ist auch 25 Jahre später noch hochaktuell. Rauchen bleibt die beliebteste Konsumform von Cannabis, und über 80 % der geschätzt 4,5 Millionen erwachsenen Cannabisnutzer in Deutschland mischen ihr Cannabis vor dem Inhalieren mit Tabak – meist Tabak, dem suchtverstärkende Substanzen wie Ammonium oder Zucker zugesetzt sind.
Immerhin gibt es mit der Verdampfungstechnologie mittlerweile eine inhalative



Alternative, bei der Cannabis pur konsumiert und verdampft, statt verbrannt wird. Die vergleichsweise lungenschonende Anwendung wurde Anfang der 2000er Jahre in Baden-Württemberg serienreif entwickelt. Nachdem die als Vaporizer, Vaporisatoren oder Verdampfer bekannten Medizintechnikgeräte seit den 2010er Jahren zunächst vor allem in den USA heiß begehrt waren, sind sie seit dem Gesetz „Cannabis als Medizin“ vom März 2017 auch im Mutterland des „Haschöfele“ nicht mehr wegzudenken. Die Geräte aus dem Schwarzwald sind zudem die einzigen Inhalatoren ihrer Art, deren Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, zumal sie auch von stark mobilitätseingeschränkten Patienten genutzt werden können.
Die
moderne Suchtprävention –
zwischen
Die These von Cannabis als einer Einstiegsdroge in Richtung harter Drogen wird von Prohibitionsbefürwortern zwar nach wie vor bemüht, ist aber wissenschaftlich längst widerlegt. Moderne Suchtprävention hat sich seit dem Launch der „Keine Macht den Drogen“-Kampagne unter dem ewigen Helmut Kohl vor fast 35 Jahren deutlich verändert und basiert heute auf modernen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und der Soziologie. Während früher − auch aus Mangel an entsprechenden Daten − stark auf Abschreckung gesetzt wurde, liegt der Fokus mittlerweile auf Aufklärung, Schadensminimierung und wissenschaftlich fundierten Ansätzen. Moderne Präventionsprogramme sind auf das Indi-
viduum zugeschnitten, versuchen die Ursachen hinter einem bestimmten Verhalten zu verstehen und berücksichtigen deshalb soziale, psychische und familiäre Faktoren. Dabei geht es nicht nur darum, den Konsum an sich zu verhindern, sondern auch den Schaden für Konsumenten zu minimieren – etwa durch die Verbreitung von Informationen über sichere Konsumpraktiken und die Risiken des Mischkonsums. Beim Thema Cannabis geht es in diesem Zusammenhang unter anderem um die Schädlichkeit des Rauchens und die Gefahr der Nikotinabhängigkeit. Diese vor allem in Europa weitverbreitete Suchtproblematik im Zusammenhang mit der weltweit am häufigsten konsumierten illegalen Droge wird auch in meinem voraussichtlich im Frühjahr 2025 erscheinenden Tatsachenroman “HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien” thematisiert. In der Dokufiktion geht es aber generell um die positiven und negativen Potenziale von Cannabis. Die Ambivalenz des Cannabiskonsums in Bezug auf die individuelle Lebensqualität wird vor allem am Feldweg von Carmen deutlich.
In HIGH auf Rezept wird im Detail seziert, wie die junge Frau in ihrer Jugend durch den Mischkonsum von Cannabis, Tabak, Alkohol und Ecstasy eine Suchtstörung entwickelt und diese dann An-
fang der 2000er Jahre mit therapeutischer Unterstützung überwindet. Fast 15 Jahre später profitiert Carmen vor dem Hintergrund einer Krebserkrankung von THC-dominantem Cannabis als einer hochwirksamen und verhältnismäßig nebenwirkungsarmen Schmerzmedizin, die ihr auch in spiritueller Hinsicht beim Umgang mit ihrer schwerwiegenden Erkrankung hilft.
Sucht als Bewältigungsstrategie
HIGH auf Rezept transportiert die komplexen, unkonventionellen und tiefgründigen Ansichten zum Thema Sucht des ungarisch-kanadischen Arztes Gabor Maté. Die Thesen in den Büchern der Koryphäe der Suchtforschung basieren auf seiner umfangreichen Erfahrung in der Arbeit mit Süchtigen sowie auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie. Maté betrachtet Sucht nicht als eine Krankheit im traditionellen Sinne, sondern als eine Bewältigungsstrategie für tieferliegende emotionale Schmerzen und Traumata. Danach greifen Menschen zu Suchtmitteln, um mit unerträglichen Gefühlen oder unerfüllten emotionalen Bedürfnissen umzugehen. Eine zentrale These Matés ist, dass die Wurzel aller Sucht in frühkindlichen Traumata liegt.
Diese Traumata, die oft in Form von Vernachlässigung, Missbrauch oder emotionaler Abwesenheit der Eltern auftreten, hinterlassen tiefe Spuren im Gehirn und in der emotionalen Entwicklung eines Kindes.
Suchtforscher Maté betont die Rolle des Gehirns bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtkrankheiten. Traumatische Erlebnisse können die Entwicklung des Gehirns beeinflussen, insbesondere die Bereiche, die für Stressbewältigung, Selbstkontrolle und Belohnung zuständig sind. Dies kann die Anfälligkeit für Sucht erhöhen. Neben individuellen Traumata sieht Maté auch gesellschaftliche Faktoren als wesentliche Einflüsse auf Suchtverhalten. Er argumentiert, dass eine ungesunde Gesellschaft, die auf Wettbewerb, Isolation und Materialismus basiert, zur Verbreitung von Sucht beiträgt. Maté plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz in der Suchtbehandlung, der über die reine Abstinenz hinausgeht. Er betont die Notwendigkeit, die zugrunde liegenden emotionalen und psychologischen Probleme anzugehen, und spricht sich für Ansätze aus, die Körper, Geist und Seele einbeziehen. Ein weiteres zentrales Element in Matés Ansatz ist die Bedeutung von Verbindung und Mitgefühl. Er glaubt, dass Heilung nur in einem Umfeld geschehen kann, das von Empathie und authentischen menschlichen Beziehungen geprägt ist. Süchtige benötigen
Unterstützung und Verständnis, keine Verurteilung oder Strafe.
In seinen Büchern zum Thema Abhängigkeit verbindet Maté wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Geschichten und klinischen Erfahrungen, um seine Sichtweise auf Sucht und Heilung zu veranschaulichen. Der Philosoph und Cannabisforscher Dr. Sebastian Marincolo schlägt in dieselbe Kerbe. So argumentiert der Cannabispionier aus dem Schwabenland, dass Cannabis, wenn es bewusst und gezielt eingesetzt wird, das Bewusstsein erweitern und positive kognitive Effekte haben kann, beispielsweise durch eine verbesserte Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit, eine intensivierte Fähigkeit zur Imagination und Mustererkennung und die Bereicherung von kreativen Denkprozessen.
In seinen Büchern und Essays befasst sich der Bewusstseinsforscher Dr. Sebastian Marincolo hauptsächlich mit der Idee, dass Cannabis weit mehr als nur eine Freizeitdroge ist. Der promovierte Philosoph setzt sich für eine differenzierte, wissenschaftlich fundierte Betrachtung des Cannabishighs ein. Marincolo interessiert sich besonders für die positiv nutzbaren Wirkungen von Cannabis auf
das Bewusstsein.
Das Konzept vom multidimensionalen High beschreibt die Vielfalt der Bewusstseinsveränderungen, die durch den Konsum von THC-haltigem Cannabis ausgelöst werden. Marincolos Modell bezieht sich darauf, dass das High nicht nur eine einzige Wirkung hat, sondern durch ein breites Spektrum an Effekten auf verschiedene Aspekte des Bewusstseins charakterisiert ist. Dazu zählt der Bewusstseinsforscher unter anderem:
1. Veränderung der Aufmerksamkeit: Cannabis kann die Fähigkeit verstärken, sich auf bestimmte Reize zu konzentrieren, während andere ausgeblendet werden.
2. Intensivierung der Sinneswahrnehmung: Sinneseindrücke, wie Geschmack, Geruch und Berührungen, werden oft intensiver und detaillierter erlebt.
3. Verbesserung der episodischen Erinnerung: Menschen erleben oft lebhafte Erinnerungen an vergangene Erlebnisse und können diese detailliert durchleben.
4. verbesserte Mustererkennung: Nutzer erleben oft, dass sie Verhaltensmuster an sich oder an anderen besser wahrnehmen.
5. verbesserte Imagination: Während eines Highs scheinen Nutzer sich oft besser verschiedene Situationen vorstellen zu können.
6. Veränderung der Zeitwahrnehmung: Nutzer berichten häufig, dass die Zeit bei einem High langsamer oder schneller vergeht.
7. Bereicherung der Kreativität: Das High kann spontane kreative Ideen und Einsichten fördern sowie assoziative Gedankengänge beschleunigen.
8. Modulation der Stimmung: Neben einer stimmungsaufhellenden oder entspannenden Wirkung, kann es bei einer falschen Dosis auch zu Angstzuständen kommen.
9. Eine Verbesserung des empathischen Verstehens: Gesunde Nutzer erleben während eines Highs oft empathische Einsichten, und auch viele Menschen im autistischen Spektrum scheinen in einem solchen Bewusstseinszustand zu einer verbesserten sozialen Kognition fähig zu sein.
Das multidimensionale High umfasst also eine Vielzahl an möglichen kognitiven, emotionalen und sensorischen Veränderungen, die individuell unterschiedlich ausfallen können. Wenn wir diese besser verstehen, so lernen wir auch mehr darüber, warum manche Menschen eine problematische Beziehung zu Cannabis entwickeln − und können diesen dann gezielter mit therapeutischen Ansätzen helfen. Damit liefert Marincolo


einen konkreten Ansatz für eine moderne Suchtprävention, die auch den Umgang mit dem Cannabishigh berücksichtigt und der Schadensminderung auf diese Weise eine neue Dimension gibt.
Mit dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) wurde in diesem Jahr der gemeinschaftliche, nicht gewerbliche Eigenanbau von Cannabis für Erwachsene in Cannabisanbauvereinigungen (CAV) gesetzlich geregelt. Laut § 23 Abs. 4 KCanG sind diese Anbaugenossenschaften verpflichtet, zu einem umfassenden Jugendschutz beizutragen und ihre Mitglieder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis anzuhalten.
Die Notwendigkeit der Benennung eines Präventionsbeauftragten wird hoffentlich zu einer wissenschaftlich fundierten Cannabisprävention 2.0 à la Gabor Maté und Sebastián Marincolo führen. In jedem Fall muss jeder Ansatz dadurch gekennzeichnet sein, dass das nach wie vor tabuisierte Thema Sucht endlich vom Stigma der Schwäche befreit wird. Die Betroffenen sind keine wertlosen „Junkies“, sondern Teil dieser Gesellschaft und mitten unter uns, auch wenn sie im Gegensatz zu den Drogenkranken im Frankfurter Bahnhofsviertel oft unsichtbar sind.

PR-MANAGER, FRANKFURT A. M.
Mit über fünf Jahren Erfahrung als Kommunikationsprofi zählt der gebürtige Heidelberger zu den Pionieren der jungen Cannabisindustrie in Deutschland. Als am Main.
Als Autor des voraussichtlich Anfang 2025 erscheinenden Tatsachenromans HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien thematisiert er seine 25-jährige Reise mit der polarisierenden Hanfpflanze, sowohl innerhalb als auch außerhalb der medizinischen Cannabiswirtschaft. Das Erkenntnisinteresse des 1982 geborenen Absolventen der Politischen Wissenschaft, Psychologie und Rechtswissenschaften gilt generell dem positiven und negativen Potenzial von Cannabis.

Erkundigt man sich online nach Cannabis als Medizin, kann man leicht feststellen, dass der Zugang zu diesem natürlichen Medikament in Deutschland wohl noch nie so gut war wie heute.
Gerade die CanG-Reform, die am 1. April 2024 in Kraft trat, hat die Verschreibung von Cannabis für Ärzte enorm erleichtert. Da die Entstigmatisierung angesichts der erst wenigen Jahre legaler cannabismedizinischer Praxis noch längst nicht vollständig gelungen ist, wird dies teilweise noch skeptisch betrachtet, doch die Akzeptanz wächst und das Verständnis für die Vorteile der guten Verfügbarkeit von Cannabismedikamenten ebenso.
Telemedizin ermöglicht die Versorgung von Cannabispatienten in ländlichen Regionen
Auch wenn die mediale Berichterstattung manchem den Eindruck vermitteln mag, dass man bei jedem Arzt eine Cannabis-Verordnung erhalten kann, ist das mitnichten der Fall. Der Erfolg von Cannabis als Medizin in Deutschland ruht auf den Schultern einer Minderheit von liberalen Me-

dizinern, die sich mit der Pflanze und ihren Heilwirkungen beschäftigen und ihren Patienten diese als Medizin zur Verfügung stellen wollen. Vor allem in konservativ geprägten, häufig ländlichen Regionen sind solche verschreibungswilligen Ärzte schwer zu finden. Die Telemedizin ermöglicht eine flächendeckende Patientenversorgung mit Medizinalcannabis in Deutschland, da dort spezialisierte Mediziner zusammenfinden, für die Cannabis als Medizin oft den Schwerpunkt ihres Behandlungsangebots bildet. Das bietet den Patienten große Vorteile, die der Managing Director der tetrapy GmbH, Alex Gutjahr, wie folgt zusammenfasst: “Die Telemedizin ermöglicht einen hochwertigen Zugang zu Cannabis-Therapien, auch für Patienten in abgelegenen Regionen, und bietet durch individuelle Betreuung eine ebenso effektive Behandlung wie der direkte Praxisbesuch.”
Nicht nur für Patienten, die auf dem Land wohnen und keinen Praxisarzt für eine Cannabistherapie finden können, ist die Nutzung von Online-Verschreibungen eine der wenigen Möglichkeiten, Cannabis als Medizin zu erhalten. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird der Zugang durch Telemedizin massiv erleichtert. Wie man also sieht, für zahlreiche



Patienten in der Bundesrepublik ist eine Behandlung mit Cannabismedikamenten durch die Nutzung von TelemedizinDienstleistungen überhaupt erst möglich. Die Plattform tetrapy ist auf die verantwortungsbewusste Cannabistherapie spezialisiert und kann hier auf langjährige Erfahrung bei der cannabismedizinischen Begleitung von Patienten aus dem kanadischen Militär- und Rettungsdienst zurückblicken.
Ist es positiv, dass Cannabis als Medizin so leicht verfügbar ist?
Selbstverständlich ist der verantwortungsbewusste Umgang mit Cannabis, ob als Medizin oder Genussmittel, enorm wichtig. Plattformen wie tetrapy eröffnen interessierten Medizinern die Möglichkeit, sich in einem spezialisierten Umfeld der Behandlung von Patienten mit Cannabismedikamenten zu widmen und da-

bei von der Expertise zu profitieren, die sich die dort tätigen Ärzte durch Erfahrung und Weiterbildung aneignen konnten. Auch die Ärztin Dr. med. Teresa Thalmaier ist spezialisiert auf Cannabis als Medizin und betont: "Cannabis ist nicht für jeden Patienten geeignet, kann jedoch bei fachgerechter Dosierung und individueller Sortenauswahl ein großes therapeutisches Potenzial entfalten. Eine sorgfältige Anpassung und regelmäßige Evaluation der Therapie sind entscheidend für den Behandlungserfolg.”
Mit der Cannabis-Entkriminalisierung hat der Gesetzgeber für Freizeitkonsumenten zwei Möglichkeiten geschaffen, sich mit Cannabis zu versorgen: den Eigenanbau und den Bezug über eine Anbauvereinigung. Dieser Zugang zu Cannabis als Genussmittel ist mit viel größeren Hürden verbunden als eine ärztliche Verordnung. Der Eigenanbau erfordert einige Mühen und vor allem Geduld, bis man die erste Ernte einfahren kann. Anbauclubs hingegen sind in Deutschland noch längst nicht omnipräsent. Viele davon haben noch keine Betriebserlaubnis oder zumindest noch kein Cannabis an ihre Mitglieder abgeben können.
Cannabis aus der Apotheke ist in ausreichenden Mengen verfügbar, und vor allem kann man es unmittelbar beziehen, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dass die Anzahl der Patienten, die eine Behandlung mit Cannabis erhalten, mit dem CanG schnell ansteigen würde, war also eigentlich nicht überraschend, und diese Entwicklung ist auch keineswegs als etwas Negatives zu verurteilen. Dass Cannabis nicht mehr auf dem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden muss, eröffnet auch die Behandlung von Erkrankungen,





die nicht als schwerwiegend gelten, bevor sämtliche Standardtherapien ausgeschöpft sind. Da die herkömmlichen medikamentösen Alternativen oft selbst gesundheitliche Risiken durch Neben- und Wechselwirkungen bergen, ist das auch völlig in Ordnung.
Die gute Verfügbarkeit von Medizinalcannabis auch in Zukunft zu gewährleisten, ist unter anderem Aufgabe der tetrapy GmbH, die ausschließlich mit spezialisierten Ärzten mit Sitz in Deutschland
zusammenarbeitet, welche sich regelmäßig fachspezifisch weiterbilden.
Schon allein die Tatsache, dass Menschen über Apotheken Zugang zu sauberem Cannabis erhalten, ist zu begrüßen, denn das Rezept als Zugang zu sicherem, qualität sgeprüftem Cannabis bedeutet einen großen Schritt für den Gesundheitsschutz in Deutschland. Vor allem aber bedeutet Telemedizin für Patienten in Regionen ohne verschreibungswillige Praxisärzt, oder auch für all diejenigen mit Mobilitätseinschränkungen, eine praktikable Möglichkeit, eine Behandlung mit Cannabis als Medizin in Anspruch zu nehmen.


TEXT DAVID GLASER

Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Aufschwungs. Die Industrialisierung setzte ein. Wichtige grundlegende medizinische Entdeckungen stammen aus dieser Zeit. Besonders erwähnenswert ist, dass Hanf in diesem Jahrhundert eine zentrale Rolle spielte. Die weltweite medizinische Verwendung von Hanf erreichte damals ihren Höhepunkt. Gleichzeitig wurde aber auch das Ende seiner Ära eingeläutet, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann ein förmlicher Feldzug gegen die Hanfpflanze. Aus rein ideologisch und politisch motivierten Hintergründen wurde die Pflanze verdrängt und verteufelt.
Über ein gesamtes Jahrhundert hinweg saß die durch Medien indoktrinierte Gehirnwäsche in der breiten Bevölkerung so tief, dass diese selbst heute nur sehr mühsam mit objektiven Fakten rückgängig gemacht werden kann. Im 19. Jahrhundert war Hanf eine vollkommen normale

Kulturpflanze, die in vielen Bereichen des Lebens und der Industrie zum Alltag gehörte. Es war das Jahrhundert vor dem Verbot. Nun befinden wir uns langsam aber sicher im Jahrhundert nach dem Verbot, wobei sich manche Vorurteile bis heute absolut hartnäckig halten.
Im 19. Jahrhundert waren Zubereitungen aus Hanf eines der am häufigsten eingesetzten Heilmittel bei vielen zur damaligen Zeit verbreiteten Erkrankungen. Zwar geht die medizinische Verwendung von Hanf bereits über Jahrtausende bis ins alte China zurück, erlebte aber besonders in Europa im 19. Jahrhundert noch einmal einen Höhepunkt. Einer der wichtigsten Pioniere zu dieser Zeit war der irische Arzt William Brooke O’Shaughnessy. Er ging 1833 nach Indien und befasste sich dort eingehend mit der traditionellen Volksmedizin. In diesem Zusammenhang lernte er natürlich auch Hanf kennen, da dies einer der zentralen Bestandteile der indischen Naturmedizin war. Er brachte seine Erkenntnisse über Hanf mit nach Europa und setzte ihn gegen eine Vielzahl von Leiden ein. Unter anderem behandelte er damit Epilepsie, rheumatische Erkrankungen und Cholera. Auch


als krampflösendes Mittel bei Tollwut und Tetanus wurde Hanf von ihm erfolgreich eingesetzt.
Brooke O’Shaughnessy veröffentlichte mehrere Werke über die medizinische Verwendung von Hanf, die auf breiten Anklang stießen.
Auch der britische Neurologe John Russell Reynolds empfahl Hanf gegen eine Reihe von Krankheiten. Als Leibarzt von Königin Victoria verschrieb er Hanf unter anderem gegen Menstruationsbeschwerden. Der französische Psychiater JacquesJoseph Moreau studierte die Wirkung von Hanf auf den Geist und versuchte daraus potenzielle Behandlungsmöglichkeiten abzuleiten. Seiner Ansicht nach war es möglich, durch den starken Perspektivenwechsel, der durch die Wirkung von Cannabis erzeugt wird, Depressive von ihren gedanklichen Sackgassen abzulenken und auf diese Weise zu heilen. Zusätzlich versuchte er unter der bewusstseinserweiternden Rauschwirkung, die Gedankengänge von Geisteskrankheiten nachvollziehen zu können und auf diese Weise Ideen für die Behandlung zu bekommen. 1845 veröffentlichte er seine
Erkenntnisse in einem über 400 Seiten dicken Buch, mit dem Namen „Haschisch und Geisteskrankheiten“.
Vor allem in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts war Hanf eine der am häufigsten verschriebenen Arzneien überhaupt. Man kann sich das analog etwa so vorstellen, wie Aspirin in der heutigen Gesellschaft. Ein Medikament gegen Alltagsleiden, das praktisch jeder zu Hause hat. Es gab keinerlei gesetzliche Beschränkungen im Besitz und niemand wäre auf die Idee gekommen, Patienten zu kriminalisieren. Dies sollte sich jedoch im darauffolgenden Jahrhundert drastisch ändern. Wenige Jahrzehnte vor dem Verbot kam eine Expertenkommission des britischen Unterhauses in Indien noch zu dem Schluss, dass ein Verbot nicht gerechtfertigt ist. In den Jahren 1893 – 1894 verfassten 1200 Fachleute ein über 3200 Seiten langes Dokument, den sogenannten Indian Hemp Report. Es ging darum, herauszufinden, welche negativen Auswirkungen der weitverbreitete
Gebrauch von Hanf in der Bevölkerung von Britisch-Indien hat. Man folgerte, dass ein modera-


ter Konsum weder gesellschaftliche noch gesundheitliche negative Auswirkungen hat und daher ein Verbot nicht gerechtfertigt ist. Im Gegenteil - es wurde festgestellt, dass der gelegentliche Konsum von Hanf gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann.
Besonders beliebt war dort Dawamesk. Dabei handelt es sich um eine orientalische Süßspeise, die aus Hanf hergestellt wird. Auch in der breiten Bevölkerung war das Rauchen von Hanf zu dieser Zeit weitverbreitet. Deswegen wurde es auch in Comics aufgegriffen. Es gibt die berühmte Bildergeschichte „Krischan mit der Piepe“ von Wilhelm Busch aus dem Jahr 1864, die davon erzählt, wie ein Junge heimlich die Hanfpfeife seines Vaters raucht.
In der Industrie spielte Hanf primär in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Europaweit war zu dieser Zeit Hanf neben Flachs und Wolle der wichtigste Ausgangsstoff für die Textilindustrie. In den USA erlebte der Anbau von Nutzhanf zu dieser Zeit einen Höhepunkt, während er gegen Ende des Jahrhunderts zunehmend von Baumwolle ver-
Natürlich war auch der berauschende Effekt unter Künstlern bestens bekannt und geschätzt. Jeder, der schon einmal in den Genuss von THC gekommen ist, wird die stark inspirierenden, tiefgründigen und teils nicht mit Worten beschreibbaren Gedankengänge kennen. Typischerweise sind diese oft von einer Flut neuartiger Ideen und Einsichten geprägt. Genau diesen Effekt machten sich zur damaligen Zeit auch Künstler und Schriftsteller zunutze, um neue Inspirationen zu erlangen. Der französische Schriftsteller Charles Baudelaire war bekannt für seinen Konsum von Haschisch. Auch der US-amerikanische Schriftsteller Fitz Hugh Ludlow nutzte die psychedelische Wirkung von Hanf. Sein Buch „Der Haschischesser“ kann als eine Art Tripbericht verstanden werden, in welchem er versuchte, die psychedelische Wirkung von Haschisch in Worte zu fassen. Die wahrscheinlich bekannteste Gruppe von Künstlern, die sich mit der psychoaktiven Wirkung von Hanf beschäftigten, war der Club der Haschischesser. Der Club wurde 1844 in Paris vom französischen Psychiater Jacques-Joseph Moreau gegründet. Einmal im Monat traf sich dort eine aus 14 Personen bestehende literarische und künstlerische Elite von Paris, um die Wirkung und den Nutzen von Haschisch zu studieren.



Kosten: Pro Dreh zahlst du nur symbolische 5 € und die Versandkosten. Diese variieren je nach Land – fair und transparent. Garantierter Wert: Jedes Paket hat einen Mindestwert von 25 €. Kein Risiko, nur Belohnung!




PREIS: 5€ PRO


drängt wurde. Der Anbau von Nutzhanf konzentrierte sich hauptsächlich auf die Staaten Kentucky, Missouri und Tennessee. Die geernteten Stängel wurden aufbereitet, bis man die eigentlichen Fasern mittels Wälzen vom äußeren Bereich des Stängels trennen konnte. In der Aufbereitungsphase unterscheidet man zwischen einer Feldröste und einer Wasserröste. Bei der Feldröste lässt man die Stängel einige Wochen am Feld liegen, bis sich durch die Feuchtigkeit die Fasern leichter ablösen lassen, während bei der Wasserröste dies durch Einlegen in Flussufer und Teiche geschah. Das Grundprinzip ist auch heute noch im Wesentlichen identisch, allerdings stark
automatisiert. Fasern händisch zu gewinnen war relativ aufwendig, weshalb die einfacher zu erntende Baumwolle Hanf zunehmend verdrängte. Nicht zuletzt standen jedoch auch wirtschaftliche und ideologische Interessen hinter diesem Wandel. Ein großer Vorteil der Hanffaser ist allerdings ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit, weshalb sie über Jahrhunderte als Ausgangsstoff für Schiffssegel diente. Im 19. Jahrhundert wurden Schiffe weitgehend auf Dampfkraft umgestellt, weshalb Segel ihre Bedeutung verloren.
Die Widerstandsfähigkeit von Textilien, die aus Hanf hergestellt werden, war auch für die Kleidungsindustrie lange

von Bedeutung, bis diese von Baumwolle abgelöst wurden. In der Papierindustrie spielte Hanf in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch eine zentrale Rolle. Fast das gesamte Papier wurde aus Hanf hergestellt. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann jedoch die Herstellung von Papier aus Holz zunehmend an Bedeutung und löste Hanf fast gänzlich ab. Obwohl der Zellulosegehalt in Hanf höher ist als in Holz, setzte sich letztlich die Papierherstellung aus Holz durch. Zu erwähnen ist jedoch die Langlebigkeit von Hanfpapier. Aufgrund seiner starken Widerstandsfähigkeit wurde Hanfpapier unter anderem zur Herstellung von Geldscheinen benutzt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bis vor dem Verbotswahn nach der darauffolgenden Jahrhundertwende Hanf eine der wichtigsten Nutzpflanzen überhaupt war. Die Wichtigkeit des Hanfanbaus auf den Feldern lässt sich bis zum heutigen Tag sogar an der Namensgebung mancher Ortschaften herleiten. Der Ort Hanfthal in Niederösterreich war über Jahrhunderte für den Hanfanbau bekannt. Urkundlich wurde der Ort im Mittelalter erstmals unter dem Namen Hanifthal erwähnt, was sich vom altdeutschen Wort für Hanf ableitet.

TEXT DIETER KLAUS GLASMANN
Das Auge isst mit. Das ist weit mehr als nur eine bedeutungslose Floskel, denn es stimmt. Ein schön angerichteter Teller ist unserem Appetit weit förderlicher als die Pappschachtel, in der wir eine Pizza geliefert bekommen, und eine frische gelbe Banane wirkt für die meisten appetitlicher als eine matschig-braune. Was für die Nahrungsaufnahme gilt, trifft auch beim Konsum von Cannabis zu, egal ob medizinisch oder in der Freizeit.
Vaporizer gibt es in unzähligen Formen, Farben und Designs, und wenn man sein Gerät auch gern überallhin mitnehmen möchte, legt man neben der Funktionalität auch Wert auf eine schöne Optik. Der Hizen Stilus Pro Max macht hier in jeder Hinsicht eine gute Figur. In einer Limited Edition gibt es diesen großartigen Vaporizer nun auch in Forest Green.
Mit 12 × 14,8 Millimeter verfügt der Hizen Stilus Pro Max über eine wirklich große Kräuterkammer. Etwa ein halbes Gramm Kräuter findet darin problemlos Platz, sodass man den Vaporizer in ausgedehnten Sessions genießen kann, ohne ständig nachladen zu müssen. Da das Gerät mit Konvektion heizt, ist es im Gegensatz zu Konduktionsverdampfern nicht zwingend nötig, die Kräuterkammer immer ganz vollzumachen. Sie kann auch mit weniger Pflanzenmaterial geladen werden. Das KonvektionsHeizsystem sorgt auch für ein klares
und unverfälschtes, aromatisches Erlebnis.
Der Hizen Stilus Pro Max bringt die Aromen deiner Kräuter zur vollen Entfaltung, ohne Spuren der Verbrennung. Durch den großen Temperaturbereich, der von 80 bis 220 Grad Celsius reicht, kann der Vaporizer mit einem breiten Spektrum von Kräutern verwendet werden, Lavendel, Kamille, Cannabis und vieles mehr. Dabei holt der Stilus Pro immer das Beste aus den Wirkstoffen der Pflanze.
Die Bedienung des Hizen Stilus Pro Max ist intuitiv und einfach. Mit einem übersichtlichen Display und drei Knöpfen hast du alles unter Kontrolle und kannst auf die durchdachten Modi und Funktionen des Vaporizers zugreifen, endless Timer, normal oder Time Mode, Vibrationsalarm und haptisches Feedback, Temperaturregulierung und andere Einstellungen. Die Temperatur kann beim Hizen Stilus Pro Max stufenlos reguliert werden, sodass jeder seinen individuellen Sweetspot findet, sein optimales Dampferlebnis in Wirkung und Geschmack.
Der 18650 LG Akku kann selbstverständlich über den USB-CAnschluss am Gerät geladen werden, muss er aber nicht. Das ist ein Feature, das in der ganzen Vaporizer-Landschaft enorm selten ist, dabei ist es gleichermaßen einfach und genial: Der Akku ist austauschbar. Diese Tatsache bringt einige tolle Vorteile mit sich. Die Möglichkeit, den Akku zu wechseln, ist nicht nur nachhaltig, sondern auch praktisch, denn mit einem Zweitakku kann man den Vaporizer verwenden, während der zweite Akku extern aufgeladen werden kann. Auch für die Langlebigkeit des Geräts an sich ist das Austauschen des Akkus spitze, denn sollte die Ladekapazität durch häufigen Gebrauch irgendwann einmal nachlassen, kann mit einem neuen Akku die volle Leistung einfach wieder abgerufen werden.
Neben dem Dampf auch ein optischer Hochgenuss
Nachdem all die Funktionen und technischen Daten bereits klarstellen, dass der Hizen Sti-




lus Pro Max ein Statement für Technik und Qualität bei Vaporizern setzt, darf abschließend dann auch ein Blick auf das Erscheinungsbild geworfen werden. Ein schlankes Design verbindet sich hier mit einer erstklassigen Handlage und hochwertigen Materialien wie Metall und Glas, für den echten, vollen Kräutergeschmack. Das Glasmundstück ist austauschbar und man kann es zum Beispiel durch einen separat erhältlichen Bubbler ersetzen, der den Dampf noch besser kühlt und dadurch besonders mild macht.
Mit dem Stilus Pro Max hat Hizen einen Vaporizer geschaffen, der nicht nur Funktionalität und Qualität vereint, sondern der auch durch ein tolles Äußeres besticht. In der Limited Edition erstrahlt der Stilus Pro in einem satten Forest Green, während das klassische Modell in einem edlen Schwarz schimmert. Ob man den Vaporizer also dezent mag oder das Gleiche in Grün, optisch ist der Stilus Pro Max in jeder Variante ein Hingucker und in jedem Fall ist er der TopBegleiter für dein bestes Dampferlebnis, überall.
TEXT ANDRÉ SCHNEIDER
Seit der Entkriminalisierung von Cannabis in Deutschland und der wachsenden globalen Akzeptanz hält die Cannabispflanze zunehmend Einzug in private Haushalte. Damit stellt sich für viele die Frage: Wie lässt sich eine selbst angebaute Pflanze auf konventionelle Weise am besten nutzen?
Allgemein bekannt ist vorwiegend der Konsum der Blüten in gerauchter Form oder die Verarbeitung zu sogenannten HaschKeksen. Auch grundlegende Informationen aus dem Superfood-Bereich sind vielen Cannabis-Interessierten vertraut: Produkte wie Hanfproteinpulver, Hanfmehl oder das aus Hanfsamen gewonnene Öl sind für ihre positiven Wirkungen auf den menschlichen Organismus weithin geschätzt.


Wer jedoch eine eigene Pflanze zu Hause kultiviert, stellt schnell fest, dass genau diese Produkte nicht so einfach aus der heimischen Ernte zu gewinnen sind – der potenzielle gesundheitliche Nutzen der Pflanze bleibt dadurch häufig ungenutzt. Zwar lässt sich eine ertragreiche Samenproduktion recht unkompliziert erzielen, doch sie ist im privaten Anbau meist gar nicht erwünscht.
Doch abseits der bekannten Produkte und Konsumformen gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, eine Cannabispflanze umfassend zu nutzen –auch im kulinarischen Bereich. Einige der gängigen Methoden zur Verarbeitung der Ernte setzen auf Extraktionsverfahren, deren Komplexität jedoch ein eigenes, vertiefendes Thema darstellt. Ein kurzer Einblick in diesen Bereich wird dennoch gegeben.
In diesem Fall möchten wir jedoch ganz unten ansetzen –bei der Wurzel. Denn sie eignet sich hervorragend, um auf einige bemerkenswerte Aspekte aufmerksam zu machen.
Dem organisch arbeitenden Cannabis-Anbauer stehen in der Regel nur selten Wurzeln zur Verfügung, die sich vollständig von Erd- und Substratresten befreien lassen. Dennoch gibt es praktikable Möglichkeiten, diese im Haushalt sinnvoll zu nutzen.
Die wohl einfachste Methode, sich die positiven Eigenschaften der Cannabis-Wurzel körperlich zunutze zu machen, ist ein Alkohol-Ansatz – also die Herstellung eines sogenannten „medizinischen Schnapses“. Schon in früheren Jahrhunderten war die Cannabis-Wurzel, insbesondere bei spezifischen
Gerade in Zeiten eines steigenden Gesundheitsbewusstseins und dem Wunsch, unerwünschte Substanzen im Körper möglichst zu vermeiden, sollte auch beim Verzehr von Cannabis auf Qualität geachtet werden. Deshalb empfehlen wir, nur Pflanzen zu konsumieren, die möglichst organisch angebaut wurden. Wie bei allen Lebensmitteln können auch im Cannabisanbau eingesetzte Düngemittel und Pestizide erhebliche gesundheitliche Risiken bergen. Und damit zurück zur Wurzel –im wahrsten Sinne. Schon im Altertum wurden der Wurzel der Cannabispflanze medizinische Wirkungen nachgesagt.






Frauenleiden, eine gefragte Zutat in der Volksmedizin. Seit jeher werden Wurzeln, Kräuter und Rinden in Alkohol eingelegt, um ihre ätherischen Öle zu lösen und in trinkbarer Form dem Körper zugänglich zu machen. Nach einer gründlichen Filtration spielen eventuelle geringe Rückstände von organisch gedüngter Erde in der Regel keine Rolle mehr.
Eine weitere Möglichkeit der Nutzung: die kulinarische Verarbeitung. Mit sauber vorbereiteten Wurzeln lassen sich kreative Speisen zubereiten – etwa ein Selleriepüree mit einem Schuss Hanfwurzel für eine besondere Note?
RAUCH-AROMA:
KULINARISCHE
EXPERIMENTE MIT
CHARAKTER
Was oft achtlos entsorgt wird, birgt ebenfalls verstecktes Potenzial: Stamm und Äste der Cannabispflanze gelten gemeinhin als unbrauchbar – dabei enthalten sie noch wertvolle Pflanzenstoffe wie Terpene, Flavonoide und sogar Cannabinoide. Auch hier bietet sich ein alkoholischer Auszug in Form einer Tinktur an. Je nach Ver-
hältnis von Pflanze zu Alkohol lässt sich so eine potente Basislösung herstellen. Diese kann anschließend beispielsweise für die Herstellung von infundiertem Zucker oder aromatisiertem Salz verwendet werden – eine elegante Möglichkeit, auch den vermeintlichen „Resten“ noch einen Nutzen zu geben.
Ein oft übersehener Weg, das Stamm- und Astwerk einer Cannabispflanze kulinarisch zu nutzen, führt über das Aroma. Beim Verglimmen entwickeln die Hölzer der Cannabispflanze ein ganz eigenes Duft- und Geschmacksprofil – vergleichbar, aber deutlich differenzierter als bei klassischen Räucherhölzern wie Rosmarin, Birke oder Buche. Naheliegend ist daher, dieses spezifische Aroma in die Zubereitung von Räucherwaren zu integrieren – sei es zur Gänze oder als akzentuierende Beigabe. Dabei gelten die gleichen Grundregeln wie bei anderen Räuchermaterialien: Überdosierung kann zu Bitterkeit führen.
Eine weitere kreative Möglichkeit: die Verwendung von Ästen als Spieße. Ähnlich wie Rosmarinzweige oder Zitronengras geben auch Cannabis-Äste bei Erhitzung Aromastoffe an das Gargut ab – ein
sensorisch spannender Ansatz für experimentierfreudige Köche.
DAS BLATTWERK –VIELSEITIG, ABER NICHT
GLEICHWERTIG
Cannabisblätter lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Blätter aus der Wachstumsphase (Vegetation) und Blätter aus der Blütephase. Beide Typen lassen sich nochmals nach Größe differenzieren – wobei insbesondere die größeren „Sonnensegel“ aufgrund ihrer faserigen Struktur eher ungeeignet für den Rohverzehr sind. Doch selbst diese groben Blätter lassen sich sinnvoll nutzen: als Aromaträger in Kräuterhüllen, Gemüsebetten oder als getrocknetes, fein vermahlenes Gewürzpulver.
Feinere Blätter hingegen – speziell junge Blätter aus der oberen Pflanzenstruktur – sind hervorragend für den Rohverzehr geeignet. Mit einem leichten Dressing verfeinert, bringen sie grüne Frische in jeden Salat. In gebratener Form lassen sich kleinere und mittlere Blätter –ebenso wie Blüten – zu spannenden Beilagen oder sogar Hauptgerichten verarbeiten. In etwas Fett und Knoblauch sautiert, entfalten sie ein nussiges, erdiges Aroma. Dabei ist zu beachten: Auch nicht decarboxylierte Blätter entwickeln durch Erhitzen eine gewisse psy-
choaktive Wirkung – ein Aspekt, den insbesondere Neulinge nicht unterschätzen sollten.
Die Blüte ist unbestritten das Herzstück jeder Cannabispflanze – und das nicht nur wegen ihrer Potenz. Auch kulinarisch bieten die Blüten überraschend vielfältige Möglichkeiten. Entscheidend ist dabei die Frage: Geht es um die psychoaktive Wirkung – oder um Aromen und Terpenprofil?
Wer sich auf den berauschenden Effekt konzentriert, muss decarboxylieren. Nur durch dieses Verfahren wird THCA in THC umgewandelt und damit überhaupt wirksam. In der Küche gilt daher: „Wer sein Cannabis essen will, muss es decarboxylieren.“ Wer jedoch als echter Kulinar auf Geschmack setzt, sollte auf die Decarboxylierung verzichten. Denn selbst bei vorsichtiger Durchführung gehen wertvolle Terpene und Flavonoide verloren. Als Würzkraut entfalten zerkleinerte, rohe Blüten eine außergewöhnliche Aromatik – ob in herzhaften oder süßen Speisen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ob als Akzent in Soßen, als Würze im Teig oder als Bestandteil komplexer Aromakompositionen – stets


gilt: Qualität, Potenz und Dosierung mit Bedacht wählen.
Die kulinarische Verwertung der Cannabispflanze ist ein faszinierendes Feld voller Möglichkeiten – weit über Blüten und Edibles hinaus. Vom Wurzelextrakt bis zum Rauchholz, vom Gewürzblatt
bis zur Terpenbombe: Wer sich traut zu experimentieren, wird mit neuen Geschmackserlebnissen belohnt. Die Küche der Zukunft ist grün – und sie duftet nach mehr als nur Kräutern.
TEXT DIETER KLAUS GLASMANN
Menschen, die an einer Multiplen Sklerose leiden, kämpfen mit dem eigenen Körper. Die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems greift das körpereigene Immunsystem und Teile des Gehirns und Rückenmarks an, wodurch Nervenimpulse nicht mehr korrekt weitergeleitet werden. Dies führt mitunter zu schmerzhaften Muskelverkrampfungen, zu Seh- und Koordinationsstörungen. Ebenfalls können Schlaf- und Sprachstörungen auftreten sowie ein Zittern bestimmter Körperteile. Insgesamt kann davon gesprochen werden, dass MS-Patienten ein stark eingeschränktes Leben führen, das auch oft mit Depressionen verbun-
den ist. Während die Medizin bei einer solchen Erkrankung regulär auf Muskelrelaxantien und Antiepileptika sowie verschiedene andere Medikamente aus dem Arzneimittelschrank setzt, die oft mit starken Nebenwirkungen besetzt sind, hat sich in gewisser Weise nun auch Cannabis bei MS etabliert. Da manch Patient auf den Einsatz der natürlichen Medizin schwört und viel bessere Ergebnisse als mit regulären Medikamenten erzielen kann, hat auch die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft inzwischen keine Ängste mehr, über den Einsatz des einst noch sehr verpönten Krautes zu informieren. Sogar die Folgen der Teillegalisierung stehen dort


jetzt im Interesse, was dazu führte, dass man eine Frage- und Antwortrunde mit Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl und der Vorsitzenden des DMSGBundesverbandes, Frau Prof. Dr. Judith Haas, stattfinden ließ. Bei dem jetzt veröffentlichten Videovortrag wurde dazu auch ein grober Überblick
über das gesamte Themengebiet geboten.
Prof. Dr. Kirsten MüllerVahl, Neurologin und Psychiaterin von der Medizinischen Fachhochschule Hannover, gilt als Expertin bezüglich Cannabis in
der Medizin. Schon in den frühen Neunzigerjahren nutzte sie die Naturarznei bei Menschen mit einer Tick-Krankheit, hat aber auch viel Erfahrung bei dem Einsatz von Cannabis und Cannabinoiden bei MS. In dem auf Vimeo veröffentlichten Video gibt sie einen Überblick über die Geschichte des Endocannabinoidsystem des Menschen, klärt über cannabisbasierte Medikamente auf und spricht die aktuelle Gesetzeslage an. Dazu wird genauer auf erhältliche Medikamente auf Cannabisbasis im Kontext der Multiplen Sklerose eingegangen und was das Cannabisgesetz (CannG) für Patienten und Ärzte bedeutet. So wird erläutert, dass Cannabis nahezu in allen Kulturen zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wurde und das teils bereits vor tausenden Jahren. Dabei wird auch die deutsche Benediktinerin Hildegard von Bingen erwähnt, die Cannabis in ihrem Kräutergarten züchtete und es als schmerzstillendes, verdauungsförderndes Heilkraut erkannte oder

es auch bei rheumatischen und bronchialen Erkrankungen einsetzte. Dass Cannabis in Apotheken vor circa 200 Jahren dann gleich zum Standardrepertoire zählte, wurde Prof. Dr. MüllerVahl bei einem Besuch im historischen Juliusspital in Würzburg bewiesen. Doch zum Beginn des 20.
Jahrhunderts wurde ein Niedergang der Cannabismedizin in die Wege geleitet, da synthetisch hergestellte Arzneimittel der Vorrang gewährt wurde. Eine fehlende Standardisierung, Dosierungsprobleme und dass die chemische Struktur von Cannabis nicht ermittelt werden konnte, tat
seinen Teil dazu. Die Prohibition von Cannabis in den USA führte dann zu dem Teil der Geschichte, der das natürliche Arzneimittel für viele Jahrzehnte unter das strenge Verbot stellte.

1964 schaffte es dann der israelische Hochschullehrer Dr. Raphael Mechoulam das Blatt zu wenden, da er als erster den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) aus Cannabis isolieren konnte. Auch fand er etwa zwanzig Jahre später heraus, dass alle Säuge- und Wirbeltiere ein körpereigenes Endocannabinoidsystem besitzen, was die Erkenntnisse über die Wirkungsweisen weit voranbrachte. Erklärt wird in dem Vortrag, dass das auf Botenstoffe reagierende System auch durch von außen zugeführten Cannabinoiden stimuliert werden kann, was den Nutzen und das Interesse an Cannabisarzneimitteln erklärt.
So fand man im Laufe der Zeit auch heraus, dass über 500 Inhaltsstoffe in der Pflanze vorkommen. Man hat mehr als 115 verschiedene Cannabinoide sowie viele weitere Bestandteile entdeckt. Prof. Dr. Müller-Vahl gibt auch einen Überblick über die erhältlichen und bekanntesten Arzneimittel auf Cannabisbasis, die sich aktuell auf dem Markt etabliert haben. Dass bislang THC und das unter der Abkürzung CBD bekannte Cannabidiol im größten Interesse der Medizin stehen, wird im Detail und unter genauerer Erklärung wiedergegeben.
So gibt es beispielsweise für eine therapieresistente Spastik bei Multipler Sklerose in Deutschland ausschließlich das Medikament
Sativex, das für diese spezielle Form der Erkrankung eine dafür nötige Zulassung erhalten hat. Hier darf das Medikament via regulären Rezepten verschrieben werden und die Krankenkasse hat die Kosten zu übernehmen. Zwar wirkt Sativex auch bei Schmerzen, hier muss aber ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt werden. So verhält es sich auch bei Rezepturarzneimitteln wie Cannabisblüten, die zwar theoretisch bei jeglicher Form verschrieben werden dürften, jedoch bezüglich der Kostenübernahme mit der Krankenkasse stets im Vorfeld abgesprochen werden sollten.
Um die jüngste Geschichte von Cannabismedizin in Deutschland aufzudecken, erklärt Prof. Dr. Müller-Vahl, dass die Legalisierung von Medizinalhanf auch hierzulande nicht durch ein Vorhaben der Politik, sondern aufgrund von Gerichtsentscheidungen stattfand. Wie auch in anderen Teilen der Erde klagten Patienten bis vor die höchsten Gerichte, damit sie ihre Leiden mit Cannabis behandeln durften. Erst nach Urteilen der Richter zogen die Politiker nach. So geschehen ebenfalls in Deutschland, wo ein MS-Patient das Recht erhielt, selbst Cannabis zur Behandlung seiner Krankheit
anbauen zu dürfen. Da dies der damaligen CDU-geführten Regierung ein Dorn im Auge war, entwickelte man 2017 eine Strategie und erlaubte Cannabis als Medizin über den gewöhnlichen Weg zur Apotheke. Damit war das errungene Recht auf Eigenanbau nicht mehr durchsetzbar, weil eine Versorgung unter den passenden Voraussetzungen nun regulär gewährleistet wurde. Zu diesen Voraussetzungen zählte neben der schwerwiegenden Erkrankung aber auch, dass andere Therapieformen ausgeschöpft wurden und eine „nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome“ besteht. Dennoch stets mit Anträgen betreffend der Kostenübernahme der Medikamente bei den Krankenkassen verbunden.
Bei Multipler Sklerose macht Sativex zwar einen gewissen Teil der Behandlungen aus, doch im großen Ganzen wird bei dieser Krankheit auf Cannabisblüten und Extrakte der Cannabispflanze gesetzt. Um herauszufinden, inwieweit der Einsatz positive Ergebnisse erzielt, hat
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Begleiterhebung durchgeführt und die Erfahrungen von Ärzten mit Cannabis in der Therapie gesammelt. Dabei wurden die Fälle insgesamt sowie die jeweiligen Arzneimittel gelistet. Von Cannabisblüten über Cannabisextrakte hin zu Sativex und Dronabinol.
Auffällig wurde dabei, dass es eine hohe Anwendungsquote von Cannabisblüten bei Multipler Sklerose und Spastiken gab. 45,5 Prozent der von diesen Symptomen Betroffenen wurden demnach vor dem Gebrauch von Blüten mit Sativex behandelt, was darauf hindeutet, dass Cannabisblüten einen besseren Behandlungserfolg mit sich brachten. Auch nach Umfragen gab es das Ergebnis, dass der Gebrauch von Cannabis bei den verschiedensten Leiden der Patienten als vorteilhaft wahrgenommen wurde.
Eine weitere Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab dazu, dass die häufigste Krankheit, bei der die Kosten für das benötigte Cannabis von den Krankenkassen übernommen werden, Multiple Sklerose ist. Auch ist MS eine der am weitesten untersuchten Erkrankungen, bei denen Cannabis hilfreich zum Einsatz kommt, wobei die Wirksamkeit gegen Spastiken und Schmer-




zen im Allgemeinen als eher moderat eingestuft wird. Als sinnvoll wurde es in anderen Studien erkannt, wenn ein Cannabismedikament gemeinsam mit anderen Arzneimitteln genutzt wird.
Im Allgemeinen gelten Cannabismedikamente als gut verträglich, doch auch diese können unerwünschte Nebenwirkungen für die Patienten haben, die aber als vorübergehend und nicht schwerwiegend eingestuft worden sind. Nach einer Auswertung von 25 Studien kam man zu dem Ergebnis, dass die auftretenden Nebenwirkungen sich nicht sonderlich von denen unterscheiden, die bei Placebomedikamenten auftreten. Die Verträglichkeit wird daher insgesamt als gut bewertet.
Die häufigsten Nebenwirkungen sind laut Beipackzettel des Medikaments Sativex unter anderem Müdigkeit und Schwindel, was aber bei allen Cannabismedikamenten, die THC enthalten, empfunden werden könnte. Abhängig ist das Auftreten der Nebenwirkungen nach Forschungsergebnissen jedoch, dass auch die Dosierung eine Rolle spielt. Man soll daher langsam und mit wenig Wirkstoff die Therapie beginnen und auf diesem Wege eine Toleranz entwickeln, um später die Dosis erhöhen zu können, falls nötig. 2,5 Milligramm THC stellen daher einen guten Wert zum Beginn einer Therapie dar, den man nach zwei bis drei Tagen um wieder 2,5 Milligramm erhöhen kann.
Die Maximaldosis wird zwar als individuell angegeben, doch es gibt einen Richtwert zwischen 10 und 20 Milligramm. Bezüglich Kontraindikationen werden von Experten besonders zwei Dinge genannt: Zum einen eine Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der jeweiligen Präparate und zum anderen, wenn ein Patient unter einer akuten Psychose leiden sollte. In beiden Fällen wird dann von einem Gebrauch abgeraten.
Seit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes zu Konsumzwecken hat sich der Status von Medizinalhanf auch geändert. Nun werden Cannabismedikamente nicht länger als Betäubungsmittel eingestuft, sodass die Arzneimittel über ganz normale Rezepte von Ärzten verschrieben werden können. Somit ist das Ausstellen einer Verordnung für Mediziner sichtlich erleichtert worden, Apotheker haben einen geringen bürokratischen Aufwand und Patienten sind im Besitz eines 30 Tage - anstatt nur sieben Tage - gültigen Rezeptes.
Auch was den Straßenverkehr betrifft, wird von Prof. Dr. Müller-Vahl erklärt, dass der THC-Grenzwert nicht für Patienten gilt. Nutzer von Cannabismedikamenten haben das sogenannte Medikamentenprivileg, sodass sie nach dem Einsatz ihrer Medizin bei bestehender Fahrtüchtigkeit auch weiterhin ein Fahrzeug führen dürfen. Erwähnt wird zudem, dass jetzt das zuvor noch angewandte Strafrecht bei Selbstversorgern,

die ohne eine Kostenübernahme der Krankenkassen an Cannabis aus den verschiedensten Quellen gelangten, nicht mehr gilt. Der Anbau, die Mitgliedschaft in einer Anbauvereinigung und der Besitz sind schließlich legalisiert worden. Befürchtungen existieren aber, dass Ärzte aufgrund der Veränderungen ihre Patienten in Anbauvereine schicken könnten, wo das Cannabis jedoch nicht unter den nötigen Arzneimittelvorschriften produziert werden wird. Ebenfalls gab es bereits wieder einmal Engpässe in den Apotheken, da sich jetzt „Pseudopatienten“ mit Privatrezepten dort das verfügbare Medizinalcannabis in großen Mengen besorgten. Betont wird in dem Videobeitrag noch, dass die jetzt geltenden Abstandregelungen zu Schulen, Spielplätzen und anderen Orten auch von Patienten eingehalten werden müssen, was jedoch in Zukunft möglicherweise korrigiert werden wird, da man dies als Nachteil für die Betroffenen bezeichnen kann.
Auf Vimeo kann man sich den gut einstündigen Videobeitrag von Prof. Dr. MüllerVahl und der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft anschauen und weitere Details über Cannabis und Multiple Sklerose erfahren. In den letzten zwanzig Minuten des Videos steht Prof. Dr. Müller-Vahl noch Fragen von Teilnehmern des Livestreams zur Verfügung und gibt konkrete Auskunft über die jeweiligen Anliegen von Patienten und Zuschauern. Definitiv einen aufmerksamen Blick wert!




























































TEXT DIETER KLAUS GLASMANN
Es gibt tausende Sorten von Hanf. Jede von ihnen ist ein Gemisch aus unzähligen Cannabinoiden, Terpenen und weiteren Inhaltsstoffen, die in Spuren vorkommen. Jede Sorte zeichnet sich durch ihr individuelles Wirkstoffprofil aus. Möchte man für eine spezifische medizinische Indikation eine bestimmte Hanfsorte benutzen, ist es wichtig, das Wirkstoffprofil sehr genau zu kennen, um zu wissen, ob sie für die jeweilige Person die perfekte Lösung darstellt.
Auch der Freizeitkonsument möchte wissen, welches Verhältnis aus THC und CBD seine Pflanze hat und welche weiteren Cannabinoide enthalten sind. Doch wie kann man feststellen, welche Cannabinoide in


welcher Konzentration in einer Sorte enthalten sind? Es gibt viele Analyseverfahren, mit denen sich der Gehalt an verschiedenen Wirkstoffen in den einzelnen Hanfsorten feststellen lässt. Einer der absolut bewährten Standards, der in der analytischen Methodik am häufigsten eingesetzt wird, ist HPLC. Dies ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für high performance liquid chromatography, also Hochleistungsflüssigkeitschromatografie. HPLC ist aus dem Laboralltag nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, in einer Hanfsorte den Gehalt an verschiedenen Inhaltsstoffen extrem genau zu bestimmen. Aber auch Streckmittel, Pestizide und andere unerwünschte Beimengungen können mittels HPLC aufgespürt werden. Es gibt am Markt mehrere Anbieter von HPLC-Anlagen, die speziell auf die Analyse von Hanfprodukten ausgelegt sind.
Das Kernstück einer solchen Anlage ist die HPLC-Säule. Diese besteht im Wesentlichen aus einem Rohr, welches mit einem zum Chromatografieren geeigneten Medium wie Kieselgel gefüllt ist. Durch dieses Rohr lässt man nun eine flüs-
sige Probe diffundieren, die durch das Kieselgel in ihre Bestandteile aufgespalten wird. Metaphorisch gesprochen kann man sich das Funktionsprinzip am besten so vorstellen wie ein Fluss, in dem sich Steine befinden. Das Wasser, welches in diesem Fluss fließt, spült verschiedene Dinge mit sich, wie Sand, Zweige, Algen und Ähnliches. Während kleine Partikel wie Sand sehr rasch mit diesem Fluss mitgespült werden und in kurzer Zeit an einem bestimmten Ort ankommen, brauchen die größeren Bestandteile länger, weil sie sich immer wieder zwischen den Steinen verfangen und abgebremst werden. Exakt dieses Prinzip nutzt man im Grunde bei HPLC. Dies ist eine sehr bewährte Methode, um ein Cannabisextrakt in seine einzelnen Bestandteile aufzutrennen. Eine Probe des zu testenden Hanfproduktes wird zunächst in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst. In der Regel verwendet man hier Methanol oder Acetonitril. Dann lässt man diese Lösung durch die Säule aus Kieselgel fließen. Dort findet, wie in dem obigen Beispiel mit dem Fluss, eine Auftrennung in alle Bestandteile statt, die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten an einem Detektor am Ende


der Röhre ankommen. Am Detektor stehen nun mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie die einzelnen Komponenten identifiziert werden können. Für die Identifikation von Cannabinoiden kommt meist eine UV-Detektion zum Einsatz. UV-Licht von einer bestimmten Wellenlänge wird von den einzelnen Cannabinoiden in unterschiedlicher Weise absorbiert. Genau diese Absorption misst ein Photosensor und leitet den Messwert in einen Computer weiter, der diesen mit einer Datenbank abgleicht und auf diese Weise das Cannabinoid identifizieren kann. Bei der Suche nach anderen Substanzgruppen kommen verschiedene weitere Detektionsmethoden zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Brechungsindex der einzelnen Komponenten zu messen und daraus auf den Bestandteil zu schließen. Substanzen brechen Licht unterschiedlich. Dies kann man sich zunutze machen, um sie zu unterscheiden. Ein Löffel sieht in einem durchsichtigen Glas aus Wasser gebrochen aus. Wäre anstelle von Wasser eine andere Flüssigkeit im Glas, würde der Löffel anders aussehen. Genau diese unterschiedliche Lichtbrechung je Substanz kann man mit entsprechend empfindlichen Sensoren messen und sie so identifizieren. Auch Massenspektrometrie kommt bei HPLC zum Einsatz. Jede Substanz weist eine ganz spezielle elektrische Ladung auf, wenn sie ionisiert wird. Man kann sich das vorstellen wie einen elektromagnetischen Fingerabdruck. Genau diese Ionisierung der einzelnen Komponenten kann ein Massenspektrome-
ter messen und so die Substanz identifizieren. Diese Form von HPLC nennt man auch HPLC-MassenspektrometrieKopplung oder HPLC-MS. Das Ergebnis ist ein Liniendiagramm, auch Chromatogramm genannt, welches alle detektierten Substanzen in ihrer Häufigkeit darstellt. Mittels HPLC können Bruchteile von Nanogramm einer jeden Substanz in der Probe gefunden werden. Diese enorme Genauigkeit kann mit anderen gängigen Methoden bislang nicht erreicht werden. Viele handelsübliche tragbare Laborkits, die ebenfalls zur Analyse von Cannabisproben genutzt werden können und auch für Privatpersonen erschwinglich sind, liefern deutlich ungenauere Ergebnisse. Die Analysemethode basiert bei den meisten Modellen auf Infrarotspektroskopie und kann Genauigkeiten mit einer Toleranz von 1–2 Prozent liefern. Zusätzlich sind diese Geräte meist nur darauf ausgelegt, die wichtigsten Cannabinoide wie THC und CBD zu bestimmen. Sämtliche exotische Cannabinoide werden mit dieser Analysemethode in der Regel nicht erfasst.
HPLC ist heute der absolute Standard, wenn es darum geht, in kurzer Zeit ein vollständiges Wirkstoffprofil einer Hanfsorte zu erstellen. Mit kaum einer anderen Methode lässt sich so schnell und genau eine quantitative Auflistung aller Cannabinoide erstellen. Aussagen über die medizinische Verwen-



Als akkreditiertes Labor für die Cannabisanalyse bieten wir Ihnen Analysen über Cannabinoide, wie zum Beispiel THC und CBD, sowie Prüfung auf Rückstände, Inhaltsstoffe und mikrobiologische Belastungen in Cannabis-Blüten, -Ölen und -Produkten an. Darüber hinaus besitzen wir eine Erlaubnis zur Teilnahme am Medizinalcannabisverkehr nach § 4 MedCanG. Mit unserem Prüfbericht erhalten Sie einen Nachweis über die Inhaltsstoffe Ihrer Produkte, der auch vor den Behörden Rechtssicherheit bietet.
Schaffen Sie mit unserem Prüfsiegel Vertrauen bei Ihren Konsumenten!


dung einer bestimmten Sorte könnten bei Weitem nicht so effizient getroffen werden, wenn HPLC nicht zur Verfügung stehen würde. Ein großer Vorteil von HPLC ist, dass es zu keinen Verfälschungen des Wirkstoffprofils durch thermische Einwirkungen kommt. Bei anderen Analyseverfahren, bei denen Wärme erforderlich ist, kann durch die einsetzende Decarboxylierung das Ergebnis verfälscht werden, da die Cannabinoidsäuren zunehmend in Cannabinoide übergehen. Dieses Problem fällt bei HPLC weg. Auf diese Weise ist es möglich, sehr genau das Verhältnis aus THCA und THC zu bestimmen. Auch Qualitätskontrollen von CBD-Ölen werden üblicherweise mittels HPLC durchgeführt. Ein gewisses Limit dieser Technologie stellt, je nach verwendeter HPLC-Anlage, die Bestimmung des Gehalts der verschiedenen Terpene dar. Terpene sind auch bei Raumtemperatur deutlich flüchtiger als Cannabinoide, weshalb bei einigen Formen der HPLC-Analytik deren Bestimmung ungenau sein kann. Häufig wurden bislang die Konzentrationen der einzelnen Terpene mittels Gaschromatografie ermittelt, da sich durch deren niedrigen Siedepunkt diese Methodik anbietet und Gaschromatografie bei flüchtigen Substanzen das bevorzugte Mittel ist. Mittlerweile gibt es jedoch deutlich weiterentwickelte HPLC-Anlagen, die auch das Terpenprofil parallel zum Cannabinoidprofil bestimmen können. Diese Kombinationsanlagen werden auch als zweidimensionale HPLC-Anlagen bezeichnet. Auch aus der Qualitätssiche-
rung von medizinischem Cannabis ist HPLC nicht wegzudenken. Mit diesem Analyseverfahren können Proben sehr sicher auf Verunreinigungen durch Pestizide oder Schwermetalle geprüft werden. Auch Mykotoxine lassen sich auf diese Weise aufspüren. So kann eine Charge, die mit Aspergillus oder anderen Schimmelpilzen verunreinigt ist, aus dem Verkehr gezogen werden. Leider gibt es genau diese dringend notwendige Form der Qualitätssicherung in den meisten Ländern der Welt nicht, wenn es um Freizeitkonsum geht. Hier bleibt dem Endverbraucher nichts anderes übrig, als sich auf das zu verlassen, was er auf der Straße verkauft bekommt. Erste Modelle von HPLC-Anlagen wurden in den 1960er-Jahren entwickelt. An der Technologie forschten weltweit mehrere Pioniere aus der Chemie. Unter anderem leistete auch der österreichische Chemiker Josef Franz Karl Huber auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Die Methodik wurde im Laufe der folgenden Jahrzehnte immer weiter verfeinert. Heute ist HPLC aus dem analytischen Laboralltag nicht mehr wegzudenken.
Auch wenn das Blut auf THC oder andere Drogen untersucht werden soll, kommt HPLC zum Einsatz. Man kann Blutproben mit den geeigneten Lösungsmitteln aufbereiten und in der gleichen Weise chromatografieren. Auf diese Weise können Bruchteile von
einem Nanogramm THC im Blut nachgewiesen werden. Auch vor Gericht sind ausschließlich mit dieser Genauigkeit durchgeführte Blutuntersuchungen verwertbar. Schnelltests dienen aufgrund ihrer Ungenauigkeit nur als mögliches Indiz und sollten verweigert werden. Auch wenn der derzeitige Grenzwert von 3,5 ng/ml in Deutschland noch immer weit entfernt von einer Gleichstellung mit Alkohol ist, lässt sich unabhängig davon dennoch festhalten, dass eine derartig genaue Bestimmung von Substanzspuren im Blut ohne Techniken wie HPLC nicht durchführbar wäre.




Die Legalisierung von Cannabis als Medizin in Deutschland im März 2017 ist für viele schwer erkrankte Menschen ein Meilenstein und ein Wendepunkt ihrer persönlichen Krankengeschichte. Auch ich weiß noch genau, wo ich in dem Moment gewesen bin und was ich gerade getan habe, als ich erfahren habe, dass es nun über ein Rezept für Betäubungsmittel möglich ist, medizinisches Cannabis aus der Apotheke zu erhalten.
Jahre der Versuche, meine Schmerzen mit allerhand Chemie in den Griff zu bekommen, ohne dabei unter einer Vielzahl an Neben- und Wechselwirkungen leiden zu müssen, sollten bald der Vergangenheit angehören. Die Voraussetzung dafür aber sollte sein, dass man einen Arzt findet, der bereit ist und sich dazu imstande sieht, eine Cannabistherapie zu verordnen und zu begleiten.
Da ich zum Zeitpunkt der Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Universitätsstadt Heidelberg mit ihrem medizinischen Schwerpunkt lebte, ging ich davon
aus, dass die Anzahl moderner und liberal eingestellter Mediziner so groß sei, dass es nicht lang dauern sollte, bis ich mein erstes Cannabisrezept in Händen halte.
Die Ursachen meiner Schmerzen sind orthopädischer Natur und auf diversen bildgebenden Verfahren, CT, MRT und Röntgen dokumentiert und sichtbar. Somit ging ich davon aus, dass Zweifel an der Schwere meiner Erkrankung, oder gar an ihrer Existenz, für mich kein Hindernis sein würden.
Die Realität sollte mich schon bald einholen, als ich mich von Praxis zu Praxis, von Arzt zu Arzt, und dabei auch leider von “Nein“ zu “Nein“ kämpfte. Nicht selten verließ mich der Mut, ich zweifelte an mir, meiner Wirbelsäulenerkrankung und der Legitimität meines Anspruchs auf eine Behandlung mit medizinischem Cannabis. Immer wieder musste ich mich aufraffen und den Kloß im Hals runterschlucken, bevor ich wieder eine Praxis anrief, um dort nicht selten schon vom Thekenpersonal mit einem “Nein, mit Drogen machen wir hier nichts!” abgewimmelt zu werden, ohne dass die Ärztin oder der Arzt überhaupt von meinem Anliegen erfahren hat. Meine Erstverschreibung kam schließlich im Frühjahr 2018 über
Kontakte durch einen Neurologen zustande. Für diesen Moment bin ich noch heute unendlich dankbar, denn damit begann ein Lebensabschnitt mit einer völlig neuen Lebensqualität. Die regelmäßigen Fahrten zum verschreibenden
Arzt waren stets lang und haben mehr als einen halben Tag beansprucht, doch dies nahm ich gern in Kauf.
Ende 2019 erforderten die Lebensumstände dann einen Umzug, der noch viele weitere Kilometer zwischen mich und mein Rezept bringen sollte, in eine sehr ländlich geprägte Gegend. Hier einen Arzt zu finden, der meine Cannabistherapie weiter begleiten wird, war gänzlich unvorstellbar. In zweimonatigen Intervallen versuchte ich, die Termine bei meinem weit entfernten Neurologen wahrzunehmen, doch es brauchte wirklich eine andere Lösung - praktikabel und realisierbar.
Erste Berührungspunkte mit Telemedizin - und mit GreenMedical
Als ich zum ersten Mal von
der Möglichkeit erfuhr, medizinisches Cannabis auf Rezept durch Online-Ärzte zu erhalten, gefiel mir die Vorstellung auf Anhieb, dass es so einfach sein könnte. Die ersten neugierigen Besuche bei Telemedizin-Plattformen weckten bei mir zunächst keinen besonders seriösen Eindruck, und ich stand der Sache allgemein ein wenig skeptisch gegenüber. Dennoch probierte ich die Dienstleistungen der Telemedizin aus und machte tatsächlich auch erste positive Erfahrungen, wenn auch nicht ausschließlich. GreenMedical kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auf diese Plattform bin ich leider erst wesentlich später gestoßen.
Mein erster Kontakt mit GreenMedical ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Noch heute bin ich beeindruckt, wie schön und klar alles gestaltet ist und wie schön man durch den Prozess geführt wird, mit allen notwendigen Erklärungen und Informationen. Die Auswahl von Medikamenten und Apotheken war sehr einfach, obwohl die Anzahl der verschiedenen Cannabismedikamente kaum zu



überschauen war. Trotzdem fühlt man sich in keinem Moment damit überfordert, da alles sehr übersichtlich und anschaulich dargestellt ist. Mir sind einige Punkte klar geworden, die bei der Auswahl eines seriösen Anbieters wichtig sind.
Die Zahl der Telemedizin-Plattformen hat seit der CanG Reform stark zugenommen. Da wird es immer wichtiger, den Anbieter mit Sorgfalt zu wählen, dem man sein Geld, seine Sorgen und vor allem auch persönliche Daten anvertrauen möchte. Am Beispiel von
GreenMedical kann man sich einige Details ansehen, auf die man achten sollte. Hinter GreenMedical steht eine etablierte Unternehmensgruppe der Gesundheitsbranche mit eigenem Krankenhaus und Labor mit Sitz in Deutschland. Auch die kooperierenden Ärzte sind in Deutschland registriert und verfügen über eine deutsche Approbation.
Alle Daten der Plattform werden nach allen geltenden DSGVO-Standards in einem inländischen Rechenzentrum gehostet. Neben der Sicherheit legt GreenMedical auch größten Wert auf Kundenbetreuung. Darüber hinaus steht den Patienten ein engagiertes Support-Team mit Sitz in Berlin zur Seite, das schnell, zuverlässig und persönlich
bei Fragen und Anliegen unterstützt.
Nach nur wenigen Augenblicken auf der GreenMedical Plattform hat man den Aufbau und die Funktionen verstanden und findet sich hervorragend zurecht. Als Erstes wird das Cannabisprodukt ausgewählt, das zu den individuellen Bedürfnissen passt. Anschließend ist der medizinische Fragebogen vollständig auszufüllen, um den Gesundheitszustand zu erfassen, der die Grundlage für eine Therapie mit Cannabis als Medizin ist. In diesem Anamnesefragebogen können die Patienten auch bereits ihren Medikationswunsch angeben.
Nach der Überprüfung und gegebenenfalls Rücksprache kann der Arzt über die Verschreibung entscheiden und das Rezept freigeben. Dies kann direkt vom Arzt zur Apotheke gesendet werden, die der Patient ausgewählt hat. Bequem, sicher und schnell können die Medikamente so direkt an die Haustür geliefert werden. Gerade für Patienten, die nicht in großen Städten wohnen, oder auch für chronisch kranke Menschen, für die der Weg in eine Praxis sehr beschwerlich ist, ist diese komfortable Möglichkeit eine willkommene Alternative, um Cannabis als Medizin nutzen zu können. Alternativ kann das Rezept aber per Post erhalten werden und persön-
lich bei der Apotheke der Wahl eingereicht werden.
Alles, was man zu Cannabis als Medizin wissen muss und mehr
Sehr praktisch fand ich auch das unkomplizierte Einsehen der Bestellhistorie, da man so etwa ein Wunschmedikament wiederfinden kann, das man in der Vergangenheit bereits über GreenMedical bezogen hat. Patienten mit einer sehr konstanten Medikation können im Grunde einfach ihre letzte Bestellung wiederholen, insofern das betreffende Medikament bei der Apotheke vorrätig ist. Mit dem Live-Bestands-Tracker lässt sich jederzeit überprüfen, ob die bevorzugte Blüte oder der gewünschte Extrakt in der Wunschapotheke verfügbar sind.
Wer sich noch nicht auskennt und sich erst einmal erkundigen möchte, findet im Bereich “Wissen“ viele Informationen zu Krankheiten, Symptomen, Cannabisblüten, Extrakten und Apotheken. Ergänzend sind im Q&A Bereich noch die wichtigsten Fragen zu Cannabis als Medizin beantwortet, insbesondere alle anfallenden Fragen um den Ablauf des Bestellprozesses und der Cannabistherapie. Egal, mit welchem Vorwissen man die Homepage von GreenMedical besucht – die Orientierung fällt leicht, und selbst Kenner entdecken stets
neue Details. Der ohnehin bereits sehr einfach und intuitiv gestaltete Bestellprozess soll in Zukunft ermöglichen, neben dem Rezept auch das medizinische Cannabis direkt über die Plattform zu bezahlen. Zuvor wurde bei GreenMedical lediglich die Bezahloption für das Rezept angeboten, während der Kauf der Medikamente direkt bei der jeweiligen Apotheke abgeschlossen wurde. Diese Optimierung wird die Patientenerfahrung noch ein wenig verbessern, die Bestellungen für Patienten weiter vereinfachen und den Ablauf beschleunigen.
Apropos beschleunigen: Im Verlauf der Erstellung dieses Beitrags wurde ebenfalls eine Bestellung bei GreenMedical durchgeführt. Zwischen der Eingabe des Rezeptwunschs und der DHL-Lieferung quer durch die Republik lagen hier weniger als 48 Stunden. Der Service und die Auswahl lassen also wirklich keine Wünsche offen und machen GreenMedical für viele Patienten zur ersten Wahl für ihr Cannabisrezept.



Der Tatsachenroman HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien basiert auf meiner 25-jährigen Reise mit der polarisierenden Hanfpflanze in einem größtenteils illegalen, jedoch stets als legitim empfundenen Kontext. Das literarisch aufgepimpte Mischwerk aus Sachbuch, Dokumentation und fiktionaler Erzählung über das positive und negative Potenzial von Cannabis wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 in einem noch nicht festgelegten Verlag erscheinen.
Hauptfigur von HIGH auf Rezept ist der 1982 in Heidelberg geborene Sascha. Sein offizieller Name lautet eigentlich Alexander, jedoch wird das Kind von russlanddeutschen „Frühaussiedlern“ und Menschenrechtsaktivisten aus der Sowjetunion innerhalb seiner Familie stets mit dem russischen Kosenamen Sascha angesprochen. Dieser Rufname etabliert sich schließlich auch in seiner Heimat im Kraichgau, der Hügellandschaft zwischen Heidelberg und Karlsruhe.
Saschas Verständnis von Freiheit, Heimat und Lebensqualität steht im Mittelpunkt der fünf Kapitel: (1) Carmen, (2) Cannabis, (3) Das kanadische Vordach, (4) Corona und (5) Die kolumbianis-
che Telenovela. Geprägt vom Einfluss der sowjetischen Lady Oma Ruth und seines urbadischen Freundes Peter, entwickelt die statistische Anomalie bei seiner alleinerziehenden Mutter eine individuelle Mischung aus Musik, Internationalismus, Leberwurst und badischer Mundart.
Ende der 1990er Jahre beginnt Saschas Feldweg mit Cannabis. Die in seinem Provinzgymnasium allgegenwärtigen und einseitig auf Abschreckung setzenden „Keine Macht den Drogen“-Broschüren verfehlen bei ihm letztlich völlig ihr Ziel, und es kommt trotz oder gerade wegen der staatlichen Gehirnwäsche zum illegalen Supergau im Kraichgau. Partner in Crime ist Klassenkamerad und Freund Johannes, aka Mustard. Da die beiden Cannabis-naiven „Highstapler“ weder an gutes Gras kommen noch einen „Oddel“, „Wickel“ oder „Dübel“ genannten Joint „bauen“ können, lackieren sie sich mit einer kaputten Acrylbong und schlechtem Haschisch ihre Leberwursthelme.

In den folgenden beiden Jahrzehnten stapft der grüne Held von HIGH auf Rezept auf den psychoaktiven Spuren von Komponist Peter Tschaikowsky und Schriftsteller Fjodor Dostojewski durch Heidelberg, München und Mannheim. Begleitet von den fesselnden Gitarrensoli des genialen Musikers Frank Zappa nutzt Sascha das High ohne Rezept unterbewusst für kreative Prozesse und zur Bewältigung emotionaler Ausnahmesituationen. „Druff wie ein Flieger“ schlürft er mit seinen badischen Haschbrüdern sedierende Haschischmilch und inhaliert mit Zahnarsch Heinz in Highdelberg die ein oder andere „Spacezigarette“, bevor er sich mit
Cannabis-Amis und ihren „Knife Hits“ kompromisslos die Hirnknifte zuschmiert.
Die ersten beiden Kapitel, Carmen und Cannabis, greifen am deutlichsten das Leitmotiv von HIGH auf Rezept auf, wonach ein Cannabishigh das physische und psychische Wohlbefinden fördern und erweitern, aber auch schädigen und einengen kann – manchmal sogar innerhalb derselben Biografie. Insbesondere inhalierte Cannabisblüten lassen sich aufgrund des schnellen Anflutens des psychoaktiven Wirkstoffs THC im Blut leicht als suchtfördernde Droge missbrauchen, aber auch als hochwirksame Naturmedizin mit einem günstigen Nebenwirkungsprofil nutzen. 2018 bekommt Saschas Feldweg mit Cannabis aufgrund der Krebserkrankung seiner ebenfalls 35-jährigen Freundin Carmen eine gänzlich neue Bedeutung. Als „Cannabistherapie-Beauftragter“ des Zugvogels aus dem rumänischen Banat führt ihn die Suche nach Zugang zu dem pflanzlichen Arzneimittel erneut in Richtung Schwarzmarkt. Dieses Mal empfindet Sascha die Abhängigkeit von illegalen Quellen aber als sehr gefährlich, absolut unwürdig und grundfalsch. Vor diesem Hintergrund begibt sich der Cannabisseur aus der badischen Provinz Ende 2018, nach insgesamt 20 Jahren außer-
halb des Gesetzes, sendungsbewusst in den legalen Rahmen der im März 2017 geschaffenen medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland.

Saschas fünfjährige, aber gefühlt 50-jährige Etappe als PR-Manager im medizinischen Canna-Business von 2018 bis 2023 macht mehr als zwei Drittel der Dokufiktion HIGH auf Rezept aus. Mit einer kündigungsbedingten
Unterbrechung im Zuge des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 arbeitet er in den Europazentralen von zwei börsennotierten, aber kulturell und ideologisch sehr unterschiedlichen Joint Ventures aus Nord- und Südamerika.
Auch Saschas professionelle „Tour de Cannabis“ beginnt im Kraichgau. Sein erster cannabisbasierter Arbeitgeber wird 2015 in einem unscheinbaren Gewerbegebiet gegründet − weniger als acht Kilometer von seinem Heimatdorf mit Stadtrecht entfernt. Das vom Stammzellenbiologen Dr. Bashir Zappa aus New York angeführte MedCann steht seit 2016 unter dem kanadischen Vordach des weltgrößten Cannabiskonzerns Baldachin Growth und ist in deutschen Apotheken mit seiner medizinischen Marke Spektrum Cannabis präsent. Sascha wird erst durch Carmen im Sommer 2018 auf das börsennotierte Start-up aus dem badischen Cannabis-Urschleim aufmerksam, bewirbt sich direkt auf eine ausgeschriebene Stelle als PR-Redakteur und bekommt nach drei Vorstellungsgesprächen schließlich die Zusage für den Kommunikationsjob.
Anders als ursprünglich vorgesehen befindet sich der Arbeitsplatz der Hauptfigur von HIGH auf Rezept jedoch nicht im Kraichgau bei der einheimischen Cannabiskönigin Sabine Hunger, sondern in der gerade eröffneten Europazentrale von Baldachin im 8. Stock eines Wolkenkratzers − in Carmens Herzensstadt Frankfurt am Main. Während es am badischen Stammsitz des Pionierunternehmens einen großen Betäubu-
ngsmittelkeller gibt und Hochdeutsch als kulturfremd gilt, wird bei den internationalen Cannabisexoten in der inoffiziellen deutschen Cannabishauptstadt „Mainhattan“ hauptsächlich Englisch gesprochen − und das grüne Gold aus Kanada ist Theorie.
Mit Blick auf die Skyline schwebt Sascha über dem Drogenelend des berühmtberüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertels. Der Neuling schließt seinen Teamleiter nicht nur wegen des vertrauten Vornamens sofort ins Herz. Schließlich kennt er den Philosophen Dr. Johannes Schmidt bereits seit einigen Jahren als den Cannabisautor Sebastián Marincolo. Der Bewusstseinsforscher vermittelt Sascha von Anfang an, dass es bei Baldachin neben den Themen Patientenzentriertheit und Lebensqualität auch um sehr viel Geld, Expansion um jeden Preis und das Streben nach einer Cannabisweltrevolution geht.

Deutschland ist ein zentraler Zielmarkt für den internationalen Cannabiskonzern aus Kanada. Mit dem Gesetz „Cannabis als Medizin“ vom März 2017, das nicht zuletzt wegen der Verankerung der Kostenerstattung für Cannabistherapien durch die gesetzlichen Krankenkassen weltweit Beachtung findet, zählt das bevölkerungsreichste Land Europas im Dezember 2018 bereits etwa 50.000 Cannabispatienten. Das Gesamtpotenzial in der Bundesrepublik wird sogar auf über 800.000 Personen geschätzt.
Die hohen Wachstumserwartungen werden weiter angeheizt. In Pressemeldungen und internen Dokumenten
betont Sascha ständig, dass Kanada seit Oktober 2018 über einen legalen Cannabismarkt für Erwachsene verfügt – als zweiter Staat nach dem südamerikanischen Uruguay und als erstes G7-Land überhaupt. Mit der größten Marktkapitalisierung in der Branche und einem saftigen Investment über vier Milliarden US-Dollar vom weltgrößten Alkoholkonzern aus den USA im Rücken steht Baldachin Growth an der Spitze des „Green Rush“, dem Finanzhigh im boomenden Canna-Business.
Parallel zum Einstieg der Hauptfigur von HIGH auf Rezept bei Baldachin erfolgt im Dezember 2018 die Übernahme des international renommierten Verdampferherstellers Staudt & Bender aus Baden-Württemberg. Für Sascha ist dieser Meilenstein nicht nur aus fachlicher Sicht besonders, da er aus der Zeit als Carmens „Cannabistherapie-Beauftragter“ ein Medizintechnikgerät der Hightechfirma zur tabakfreien und lungenschonenden Inhalation von Cannabis besitzt und mit dem mobilen Vaporisator viele positive Erinnerungen an den Feldweg mit ihr verbindet. Der Neustart in 069 glückt. Bei der Arbeit im Wolkenkratzer wartet die Bananen spendende Frohnatur Sabine Lust, und Zuhause im dörflichen Frankfurter Stadtteil Alt-Fechenheim das frei laufende Pferd Jenny. In seiner täglichen Arbeit mit Blick auf die Skyline steuert
der fast zehn Jahre berufserfahrene Kommunikationsprofi seine grüne PR im sich stetig wandelnden Spannungsfeld zwischen den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Wirtschaft und den idealistischen Werten einer sozialen Bewegung.
Saschas Spielraum wird zusätzlich durch das Betäubungsmittelgesetz und das Heilmittelwerbegesetz eingeschränkt. Nach wenigen Monaten bei Baldachin wird er vom PR-Redakteur zum PR-Manager befördert und Anfang 2019 gemeinsam mit Teamleiter Dr. Johannes auf eine bewusstseinserweiternde Geschäftsreise in die Firmenzentrale des Cannabiskonzerns in der kanadischen Provinz Ontario geschickt.
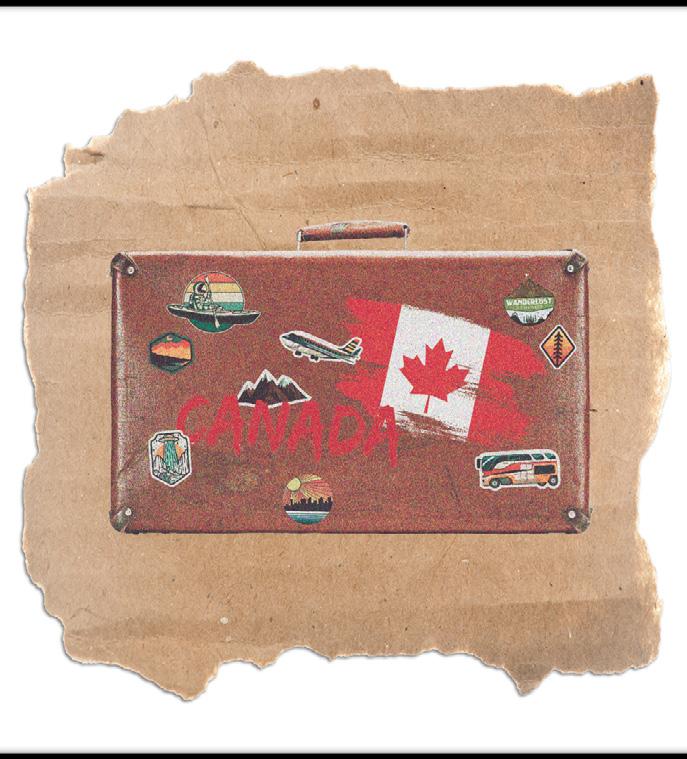
Im kalten Herzen der Cannabisweltrevolution landet Sascha in zu Konferenzräumen umfunktionierten Produktionshallen einer ehemaligen Schokoladenfabrik. Im kanadischen Cannabismekka erträgt der Gesandte von Baldachin Europe viele sinnlose PowerPoint-Präsentationen der PR-Kollegen aus Lateinamerika, Australien und der Häuptlinge aus Kanada. Zwischendurch besichtigt er mit Dr. Johannes die riesige Cannabisproduktionsanlage im Cannabis-Kreml und schießt sein Bewusstsein mehrfach zu Satellit Sputnik ins All. Außerdem lernt er die als „grüne Ikone“ bekannte Nancy Blue kennen und drängt sich den nordamerikanischen Revolutionswächtern bei nüchternen
Temperaturen unter –20 Grad als Vertreter seines deutschen PR-Vorgesetzten für ein noch unbekanntes Großereignis in wenigen Monaten auf, bei dem Dr. Johannes als Leiter Marketing & Kommunikation in Elternzeit sein wird. Wieder zurück in der europäischen Realität holt sich der PR-Zar von HIGH auf Rezept von Prof. Raphael Mechoulam Kraft für das lange geheim gehaltene Megaevent − der anstehenden Übernahme der Cannabinoidsparte K5 der bayerischen Phytopharmafirma Deoromantico. Der „Godfather of Cannabis Research“ aus Israel hat zwar nichts mit dieser kleinen Revolution in Deutschland zu tun, ist jedoch für Sascha eine wichtige Inspiration auf diesem jungfräulichen Pfad. Bis zu Baldachins Schachzug im Mai 2019 war die gesamte Fachwelt davon ausgegangen, dass sehr bald ein Cannabisunternehmen unter das Vordach einer Pharmafirma kommt − und nicht umgekehrt.
Bei einer als „D-Day“ bezeichneten Aktion wird die Zwangsheirat im Reich des Verkäufers verkündet. In einem Oldtimer-Museum in der bayerischen Oberpfalz ist Sascha als Kommunikationsverantwortlicher von Baldachin mittendrin und danach für die PR-seitige Integration des neuen Unternehmensteils unter einem gemeinsamen Vordach
zuständig. Dabei gerät er in einen Cannabiskulturkampf zwischen kanadischen Haschbrüdern und bayerischen Pharmafrettchen, denn die neuen Kollegen von K5 betrachten Baldachin mit seinem auf Cannabisblüten basierenden Produktportfolio als Vertreter einer medizinisch wertlosen „Steinzeitmedizin“.
Die Beute-Kanadier bezeichnen ihr oral einzunehmendes Flaggschiffprodukt Dronabinol als „Reinsubstanz“. Auch lange nach der Übernahme bewerten sie ihr Vorzeige-Cannabismedikament mit dem isolierten Wirkstoff THC als den Vollspektrumprodukten ihres neuen Besitzers medizinisch und ethisch überlegen.

In HIGH auf Rezept wird der unterhaltsame Integrationsprozess genau seziert. Aufgrund des monatelang fallenden Börsenkurses reagiert der US-amerikanische Hauptinvestor im Sommer 2019 und beginnt, Schlüsselpositionen bei Baldachin schrittweise durch Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu besetzen. Europa bleibt von diesen Umbrüchen nicht unberührt, und viele Cannabisexoten aus dem Urschleim müssen gehen. Im Zuge der verlorenen Ausschreibung für den prestigeträchtigen Cannabisanbau in Deutschland wird schließlich auch Dr. Bashir Zappa gestürzt.
Sascha ist untröstlich über den Untergang seiner Ikone in einer griechischen Tragödie, entschließt sich jedoch mit der zweiten Luft aus dem „Haschöfele“ von Staudt & Bender zum Weitermachen. Mit dem Polterfeingeist Martin, seinem neuen Vorgesetzten, startet er eine märchenhafte Medienarbeitsoffensive. Gleichzeitig kehrt mit seinem alten Teamleiter Dr. Johannes ein ganz besonderer Verbündeter zurück.
Bis zum Ausbruch der Coronapandemie richtet sich Sascha in der neuen Konstellation im Wolkenkratzer ein, wird jedoch Anfang April 2020 per Videochat in seinem Home-Office gekündigt. Beim ständigen Pendeln zwischen seiner alten Heimat im Kraichgau und seinem neuen Zuhause in Fechenheim entwickelt er neue Routinen.
Immer intensiver denkt Sascha an seinen Feldweg mit Carmen. Plötzlich kann er das Geschehene nicht mehr verdrängen und fühlt sich in seiner sozialen Isolation auch um die Zukunft mit seiner Seelenverwandten Helene betrogen. Beim Auftakt eines kafkaesken Arbeitsrechtsprozesses gegen seinen nun ehemaligen Arbeitgeber aus Kanada ist das Steppenkind aus seinem „Volk auf dem Weg“ längst nur noch im Geiste anwesend. Bei langen Spaziergängen im Kraichgau oder in Meetings mit dem frei laufenden Pferd Jenny am Frankfurt-
er Mainbogen wird ihm bewusst, dass seine Mission in der medizinischen Cannabisindustrie noch lange nicht abgeschlossen ist.

2.0
Von Nostalgie und Geldnot getrieben, schließt sich der Protagonist von HIGH auf Rezept im März 2021 alten Weggefährten aus der Zeit unter dem kanadischen Vordach an. Sascha wird PR-Darsteller in der kolumbianischen Telenovela des cannabisbasierten Gesundheitsunternehmens Philyra Life Sciences. Die knapp fünf Jahre jüngere Rechtsanwältin Marie Stahl wird seine
neue Chefin – und bald auch eine enge Freundin.
Umgeben von der vertrauten Cannabiswalküre und weiteren Bekannten aus dem Wolkenkratzer fühlt sich der neue Job für Sascha fast wie eine Verlängerung seiner alten Tätigkeit an. Erneut arbeitet er mit dem Indica-Sativa-Fanatiker Hendrick Schäuble aus der inoffiziellen deutschen Hauptstadt chronischer Schmerzen, Mannheim, zusammen. Mit dem Marketing-Cowboy Bob God aus Arizona kommt Ende 2021 ein transkontinentaler Freund zu Philyra, und ab dem ersten Tag erzeugt die französischsprachige Tierheilpraktikerin Chantal Karat aus Genf bei dem vom Corona-Blues geplagten Alt-Baldachiner ein Gefühl von Heimat. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen angesichts der staatlichen Covid-Maßnahmen drastisch verändert. Im nun obligatorischen Home-Office lernt die Hauptfigur von HIGH auf Rezept seine neuen Kollegen am Computerbildschirm kennen. Zwei Kolumbianer aus Frankfurt am Main, der spanische Medizinchef Dr. Pedro Gonzales aus dem Baskenland sowie sehr diverse Teammitglieder aus Südamerika und Großbritannien begleiten Sascha auf seiner zweiten Station im Canna-Business.
Ab Sommer 2021 befindet sich der multiresistente osteuropäische Keim − wieder systemrelevant und frisch geimpft − nicht mehr in einem voll verglasten Wolkenkratzer über den Wolken von Frankfurt, sondern auf dem Boden der Tatsachen, mitten im berühmt-berüchtigten Bahnhofsviertel. Parallel zur Coronapandemie wird Deutschlands Drogen-Hotspot Nr. 1 von einer bisher unbekannten Crack-Epidemie heimgesucht. Die Suchtkrise im „Elendsquartier“ verschärft sich, und das nun kolumbianische PR-Äffchen ist gezwungen, die Konsequenzen der stetig zunehmenden Kokain-Importe aus Südamerika nach Europa hautnah mitzuerleben.
Der mittlerweile erfahrene Cannabiskommunikator spürt außerdem, dass die Hochphase des „Green Rush“ vorbei ist und Phylira keine vier Milliarden US-Dollar in der Hinterhand hat. Sascha beobachtet, wie in der weiterhin wachsenden Cannabiswirtschaft eine unübersichtliche Unternehmenslandschaft entsteht, die sich einem zunehmenden Konsolidierungsdruck nicht entziehen kann. Vor diesem Hintergrund verfolgt das in Südamerika vertikal integrierte Unternehmen in Europa eine ökonomisch zurückhaltende „As-

set-Light-Strategie“.
Die Firmenfeiern von Phylira Europe erlebt Sascha aber als ganz und gar nicht bescheiden. Obwohl es aufgrund der Corona-Regeln nur wenige Teamevents mit allen europäischen „Kannabineros“ gibt, führt die Mischung aus bekannten Cannabisexoten, stets feierwütigen Südamerikanern und den nicht minder partybegeisterten Briten zu einer grenzenlosen Ausgelassenheit. Unter dem Motto „Juntos“ (spanisch für zusammen) schießt Zar Sascha der Dichte sein Bewusstsein einmal mehr zu Sputnik ins All, gewinnt alberne Kostümwettbewerbe und steigt mit seiner grenzenlosen Liebe für die südamerikanische Mentalität zum Head of Communca-
tions Europe des börsennotierten Unternehmens auf.
Im skurrilen Schlusskapitel von HIGH auf Rezept geht es auch um das in der kolumbianischen Telenovela stets präsente Trauma im Zusammenhang mit Pablo Escobar, dem blutigen Terrorismus der Narcos und dem „War on Drugs“ der „Gringos“. Das unter dem kanadischen Vordach postulierte Ziel einer Cannabisweltrevolution spielt bei Phylira keine Rolle. In der Ende 2021 begonnenen Debatte über die Legalisierung von Cannabis für die geschätzt 4,5 Millionen erwachsenen nicht medizinischen Konsumenten in Deutschland positioniert sich das Unternehmen eindeutig.
Mit dem Grundsatz „Medical first“ geht es der im Frankfurter Bahnhofsviertel regierenden Cannabiswalküre Señora Stahl explizit um eine echte Legalisierung mit kommerziellen Lieferketten, wobei der Fokus vor allem auf der Zukunft von medizinischem Cannabis in Deutschland liegt. Im Einklang mit CEO Pablo Flores in Bogotá fühlt sich auch Philyra in Europa in erster Linie „der Gesundheit verbunden“, wie das Hanf Magazin in einer Reportage im Sommer 2021 titelt. In dem Artikel über das firmeneigene Kliniknetzwerk wird die Bedeutung des Sammelns von Pa-
tienten- und Produktdaten beschrieben, um auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse die Qualität und damit auch den Zugang zu erstattungsfähigen Cannabistherapien zu verbessern.

Vor dem Hintergrund einer Reihe politischer und ökonomischer Turbulenzen ist Phylira Life Sciences im Sommer 2023 zu einem wirtschaftlichen Neuanfang gezwungen. Die Abspaltung des europäischen Unternehmensteils von der südamerikanischen Mutterpflanze führt zu einer Götterdämmerung im Frankfurter Bahnhofsviertel. Saschas „CanExit“ folgt im November 2023, nach
exakt fünf Jahren in der medizinischen Cannabisindustrie.
Innerhalb dieser Zeit hat sich die Zahl der Cannabispatienten in Deutschland mehr als verfünfzehnfacht und liegt mittlerweile bei über 150.000. Mit telemedizinischen Rezeptfabriken scheinen die Verfügbarkeitsprobleme bei verschreibenden Ärzten weitestgehend behoben. Auch bei abgebenden Apotheken und dem nun aus einer Vielzahl von Ländern importierten sowie zusätzlich in Deutschland angebauten Cannabis in pharmazeutischer Qualität gibt es im Vorfeld der Teillegalisierung für Erwachsene im April 2024 keine Engpässe mehr. Der PR-Guerillero aus dem Kraichgau sieht den Preis dieser positiven Entwicklung allerdings in einem „Green Rush 2.0“ und der Verwässerung der medizinischen Dimension von Cannabis.
Am letzten Arbeitstag der mittlerweile 41-jährigen Hauptfigur von HIGH auf Rezept bekommt die 36-jährige Cannabiswalküre mit der bezaubernden Pippa eine Tochter – und Sascha infiziert sich zum zweiten Mal mit Corona. Im Fieberwahn denkt er in seiner

neuen Wohnung in Fechenheim an die Highlights seiner fünfjährigen Reise im medizinischen Canna-Business, an die Gründe für seinen Ein- und Ausstieg aus der Branche sowie an die Zukunft der
wieder rasant wachsenden deutschen Cannabiswirtschaft mit ihrem einstmals so präzisen moralischen Kompass.


Es ist oftmals eine große Herausforderung für die Zubereitung und die Darreichungsform eines Wirkstoffs, die optimale Aufnahme im Körper zu gewährleisten.

Das Stichwort ist hier die Bioverfügbarkeit, die Aufschluss darüber gibt, wie effektiv eine Substanz mit einer bestimmten Konsumform aufgenommen werden und vor allem an dem Ort ankommen kann, an dem sie wirken soll. Cannabinoide sind prinzipiell hochpotente Wirkstoffe, jedoch ist die Bioverfügbarkeit der
Konsumform der entscheidende Faktor, ob diese ihre Wirkung in vollem Umfang entfalten können. Wie den meisten bekannt sein dürfte, macht es nur wenig Sinn, aus Hanf einfach einen Tee zu kochen. Der Grund ist die fehlende Wasserlöslichkeit von Cannabinoiden. Löst man sie dagegen in Fetten auf, können
Cannabinoide in oraler Form vom Körper aufgenommen werden. Auch wenn die verbreiteten Darreichungsformen von Cannabinoiden bereits eine brauchbare Bioverfügbarkeit und Wirkung aufweisen, wird bei manchen Anwendungsfällen nur ein erstaunlich kleiner Teil tatsächlich effektiv aufgenommen. Bei einer oralen Einnahme von THC oder CBD in Arzneimittelform liegt, trotz der zweifelsfrei vorhandenen Wirkung, die Bioverfügbarkeit tatsächlich nur zwischen 4 % und 20 %. Meist liegt sie bei etwa 10 %. Das bedeutet, dass ein Großteil des Wirkstoffs unresorbiert wieder ausgeschieden wird. Wie viel Prozent der aufgenommenen Dosis tatsächlich resorbiert wird, hängt von mehreren Faktoren ab, wie der aufgenommenen Nahrung und der genetisch bedingten Durchlässigkeit des Darms. Auch bei äußerlicher Anwendung ist die Bioverfügbarkeit gering. Dies führt dazu, dass mit einem simplen Auftragen einer Cannabinoidzubereitung auf die Haut tiefere Gewebeschichten nicht erreicht werden können. Anstatt die Dosis immer weiter zu steigern, ist es deutlich effektiver, die Bioverfügbarkeit einer Cannabiszubereitung zu verbessern. Eine dieser Möglichkeiten, die Bioverfügbarkeit zu optimieren, sind Nanoemulsionen.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, worum es sich bei einer Emulsion handelt. Eine Emulsion ist ein Gemisch von zwei Stoffen, die eigentlich nicht mischbar sind. Man kann dies am besten veranschaulichen mit einem Gemisch aus Öl und Wasser. Gibt man Öl und Wasser in ein Glas, wird das Öl zunächst auf dem Wasser schwimmen. Schüttelt man den Inhalt des Glases durch, wird sich vorübergehend das Öl in kleinere Tröpfchen zerteilen und im Wasser schweben. Doch nach kurzer Zeit findet bereits wieder eine sogenannte Entmischung statt, die dazu führt, dass nach und nach das Öl wieder auf der Oberfläche schwimmen wird. Es gibt verschiedene chemische und physikalische Tricks, mit denen man genau diese Entmischung unterbinden kann. Man erhält auf diese Weise eine relativ stabile Vermengung zweier nicht mischbarer Komponenten. Diese Zubereitung wird als Emulsion bezeichnet. Eine Nanoemulsion geht nun noch einen Schritt weiter. Wie man aus dem Namen bereits entnehmen kann, sind die einzelnen Tröpfchen in einer Nanoemulsion so klein, dass sie nur noch einen Durchmesser von wenigen Nanometern haben. In der Praxis erfolgt die

Herstellung von Nanoemulsionen häufig mithilfe von Ultraschall. Es gibt am Markt bereits mehrere Anbieter von entsprechenden Ultraschall-Rührgeräten, mit denen es möglich ist, eine CBD- oder THC-Nanoemulsion herzustellen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Rührstab, der Ultraschall in einer bestimmten Frequenz abgibt. Man gibt in das Gefäß ein Gemisch aus einem Cannabisextrakt, Wasser sowie einem Emulgator. Als Emulgator wird häufig Lecithin verwendet. Ein Emulgator sorgt dafür, dass Substanzen, die normalerweise nicht mischbar sind, dennoch vermischt werden können und sich auch nicht wieder entmischen. Er erzeugt also die eigentliche Emulsion. Die Behandlung mit Ultraschall führt dazu, dass die Tröpfchen der einzelnen Bestandteile auf eine Größe von wenigen Nanometern reduziert werden, sodass man als Endprodukt eine entsprechende Nanoemulsion vorliegen hat. Die durchschnittliche Größe der einzelnen Tröpfchen in einer Nanoemulsion beträgt etwa 10–50 Nanometer. Um während der Ultraschallbehandlung zu ermitteln, ob die erforderliche Partikelgröße bereits erreicht wurde, kommt ein Messverfahren zur Anwendung, welches sich DLS nennt. Dies ist eine englische Abkürzung


und steht im Deutschen für dynamische Lichtstreuung. Im Wesentlichen ist das ein Laser, der mit einem Photosensor kombiniert wurde. Abhängig von der Partikelgröße wird das Laserlicht unterschiedlich reflektiert. Ein integrierter Computer kann aufgrund der Reflektion und Streuung des Lichts durch die Partikel die Größe der Partikel berechnen.
Wie bereits erwähnt, kann durch Nanoemulsionen die Bioverfügbarkeit erheblich erhöht werden. Wenn die Cannabinoide als Tröpfchen mit nur wenigen Nanometern Durchmesser vorliegen, können diese aufgrund ihrer geringen Größe sozusagen zwischen den Zellen hindurchwandern und somit effektiver in den Körper eindringen – so kann man sich das stark vereinfacht vorstellen. Diese Erhöhung der Bioverfügbarkeit ist für die Medizin von großer Bedeutung. Auch abseits von Cannabinoiden wird dieses Verfahren bereits standardisiert eingesetzt. Derzeit sind weltweit etwa 60 Medikamente zugelassen, deren Bioverfügbarkeit mittels Nanoemulsionen optimiert wurde. Studien konnten zeigen, dass mit dieser Methode die orale Bioverfügbarkeit von CBD, abhängig von der Größe der Nanopartikel, auf das Drei-
bis Vierfache erhöht werden kann. Auch beim wichtigsten Cannabinoid, dem THC, kann mittels Nanoemulsion eine drastische Verbesserung der Bioverfügbarkeit erzielt werden. Es gibt ein Patent aus dem Jahr 2018 über ein optimiertes Verfahren zur Herstellung von THC-Nanoemulsionen mit enorm verbesserter Bioverfügbarkeit. Durch ein spezielles Gemisch aus Emulgatoren kann mit dieser Technologie die Bioverfügbarkeit auf das bis zu 20-Fache erhöht werden. Auch die transdermale Applikation konnte mit diesem Patent enorm verbessert werden. Wenige Minuten, nachdem diese Nanoemulsion auf die Haut aufgetragen wird, setzt bereits eine spürbare THC-Wirkung ein, und es kann im Blut eine THC-Konzentration gemessen werden, die ansonsten erst nach Stunden in dieser Höhe vorhanden sein würde. Es ist davon auszugehen, dass optimierte Nanoemulsionen andere transdermale Verabreichungen, etwa das THC-Pflaster, in Zukunft ablösen könnten. Die stark verbesserte Aufnahme durch die geringe Partikelgröße macht Nanoemulsionen auch für die äußerliche Anwendung interessant. Ein häufiges Problem ist, dass Wirkstoffe in Salben nicht tief genug in die Haut eindringen können. Es kann auch vorkommen, dass die Haut Verbrennungen hat oder durch andere Einflussfaktoren nekrotisch geworden ist. In diesem Fall

ist die Durchlässigkeit für Wirkstoffe vermindert oder nicht mehr vorhanden. Nanoemulsionen hingegen können in diesem Fall bei äußerlicher Anwendung durch ihre geringe Partikelgröße deutlich leichter die äußeren Schichten durchdringen und auch in tieferen Bereichen des Gewebes noch ihre Wirkung entfalten. Es gibt bereits eine brasilianische Studie, die zeigen konnte, dass eine äußerlich angewendete CBD-Nanoemulsion gegen Nekrosen wirksam ist, wie sie durch Schlangenbisse verursacht werden.
Abseits von einer drastisch erhöhten Bioverfügbarkeit bieten Nanoemulsionen noch weitere Vorteile. Als einer der wichtigsten Punkte ist der rasche Wirkungseintritt von THC bei oraler Verabreichung zu nennen. Während es bei THC ansonsten einige Stunden dauern kann, bis die volle Wirkung eintritt, zeigen sich bei der oralen Einnahme von THC-Nanoemulsionen bereits nach wenigen Minuten die ersten Effekte. Dies kann für Patienten, die THC zur Linderung von starker akuter Symptomatik benutzen möchten und den oralen Konsum dem inhalativen vorziehen, ein entscheidender Vorteil sein.
Ein weiterer Effekt, der durch die rasche Resorption bei oraler Einnahme auftritt, ist das Umgehen der primären Verstoffwechslung in der Leber. Dieser, auch als First-Pass-Effekt bekannte Mechanismus der Leber, führt dazu, dass THC in das deutlich potentere und länger wirksame 11-Hydroxy-THC umgewandelt wird. Da THC in Form von Nanoemulsionen so schnell aufgenommen wird, kann dieser Umwandlungsprozess vermindert oder sogar weitgehend unterbunden werden. Manche Personen reagieren unerwartet stark auf dieses deutlich potentere THC-Derivat. Die Verlaufskurve des THC in der Plasmakonzentration ist in diesem Fall jener bei gerauchtem Konsum nicht unähnlich. Dies kann je nach Patient und medizinischer Indikation auch ein Vorteil sein. Patienten, die eine kurze und starke Wirkung bevorzugen, jedoch nicht inhalativ konsumieren möchten, könnten von dieser oral verfügbaren und etwa gleichwertigen Variante der THC-Aufnahme profitieren. Nicht zuletzt sind auch geringere benötigte Mengen an Wirkstoff zu nennen. Aufgrund der extrem effizienten Aufnahme kann mit einem Bruchteil der ansonsten üblichen Dosis der gleiche Effekt erreicht werden.

TEXT ANASTASIA AVRAMCHUK
Wie die Telemedizinplattform Ihr
Leben leichter macht
Medizinisches Cannabis ist seit 2017 in Deutschland legal, aber erst seit einem halben Jahr ist es auch
in großen Teilen der Gesellschaft angekommen. Es wird nicht mehr nur von jungen Menschen in alternativen Cafés besprochen, sondern hat sich als ernstzunehmendes Arzneimittel etabliert.
Chronische Schmerzen, Angstzustände, Schlafstörungen – die Liste der Beschwerden, bei denen Cannabis als Heilmittel eingesetzt werden kann, ist lang. Doch wie kommt man als Patient in den Genuss einer sicheren, schnellen und vor allem diskreten Versorgung mit medizinischem Cannabis? Hier kommt DoktorABC ins Spiel.
DoktorABC, eine der führenden Telemedizin-Plattformen in Deutschland, bringt die medizinische Versorgung auf ein neues Level. Und das nicht nur für Cannabispatienten. Seit sieben Jahren bietet DoktorABC Telemedizin an und hat sich im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung einen Namen gemacht.
Mit einer hervorragenden Bewertung auf Trustpilot von 8000 zufriedenen Kunden gibt es kaum Zweifel an der Qualität dieses Service. Doch was macht DoktorABC so besonders? Lassen Sie uns das einmal in aller Ruhe durchgehen.
All-in-One-Lösung von DoktorABC: So einfach war Medizin noch nie
Stellen Sie sich vor: Sie sitzen zu Hause und können Ihre rezeptpflichtigen Medikamente online bestellen. Eine zehnminütige Online-Konsultation genügt, und innerhalb von 24–48 Stunden wird das Medikament zu Ihnen nach Hause geliefert. So einfach ist das. Klingt gut? Sie sparen sich stressige Termine und lange Wege - stattdessen haben Sie die Wahl zwischen der Komplettlösung mit Lieferung des Medikaments oder nur der Zusendung des ausgestellten Rezepts. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven, denn die Plattform erledigt alles für Sie.
kostenlose Lieferung
direkt an die Haustür
Medizinisches Cannabis ist ein sensibles Produkt. Daher sorgt DoktorABC nicht nur für eine einfache Bestellung, sondern auch für eine schnelle und sichere Lieferung.
Die Medikamente werden in Zusammenarbeit mit lizenzierten Versandapotheken innerhalb von 24 bis 748 Stunden nach Hause geliefert – und das ganz ohne zusätzliche Versandkosten. Das bedeutet, Sie können sich zurücklehnen, während Ihr Arzneimittel per DHL direkt an Ihre Haustür geliefert wird.
Für alle, die nicht auf ihre Gesundheit warten wollen, bietet DoktorABC sogar einen Premium-Lieferservice an. So kommen Sie noch schneller an Ihre Medizin, ohne einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen bereits von diesem Service begeistert sind, ist klar: Zeit ist eben doch die wertvollste Ressource.
Falls Sie dachten, es gehe bei DoktorABC nur um irgendein Cannabis, dann haben wir gute Nachrichten: Die Plattform bietet eine Auswahl von mehr als 600 verschiedenen Cannabissorten von führenden Herstellern wie Avaay, Cannamedical, Demecan und Cantourage. Diese Vielfalt bedeutet, dass für jede medizinische Notwendigkeit und Präferenz die passende Sorte gefunden werden kann.
Ob beruhigend oder anregend, ob eu-

phorisch oder schmerzlindernd – das Angebot von DoktorABC ist genauso vielfältig wie die Bedürfnisse der Patienten. Und das Beste daran: Die genauen Inhaltsstoffe der Produkte sind stets transparent und nachvollziehbar, weil sie genau von den Herstellern gemessen wurden und von den Apotheken bestätigt werden. Kein Rätselraten, keine versteckten Überraschungen – Sie wissen genau, was Sie bekommen.
Weit mehr als nur
Cannabis: Telemedizin mit Vollservice
Während medizinisches
Cannabis zweifellos im
Rampenlicht steht, ist DoktorABC kein OneTrick-Pony. Die Plattform bietet eine breite Palette von Behandlungsmöglichkeiten an, die weit über Cannabis hinausgehen.
Fast 40 Behandlungskategorien und mehr als 1.000 verschiedene Medikamente stehen zur Verfügung. Von Asthmabehandlung, Bluthochdruck, Testosteronmangel, Hautproblemen, Übergewicht, Verhütung bis zu erektiler Dysfunktion – es gibt kaum ein medizinisches Problem, das nicht durch die erfahrenen Ärzte von DoktorABC behandelt werden kann.
Was macht die Plattform dabei so besonders? Es ist der ganzheitliche An-
satz. Sie sind nicht nur eine Nummer im System, sondern ein Patient, der eine individuelle Beratung und Behandlung erhält. Und das alles, ohne das Haus zu verlassen.
Sieben Jahre
Erfahrung: Das spricht für sich
Erfahrung ist in der Medizin ein unschätzbarer Vorteil, und DoktorABC bringt gleich sieben Jahre davon mit. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich das Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf in der Welt der Telemedizin erarbeitet. Mit unzähligen erfolgreich behandelten Patienten und einer hervorra-

genden Trustpilot-Bewertung von 8000 Bewertungen ist klar: Hier wird Qualität großgeschrieben. Aber es sind nicht nur die Zahlen, die beeindrucken. Es ist die Art und Weise, wie DoktorABC mit seinen Patienten umgeht. Individuell, persönlich, vertrauenswürdig.
Diese Werte machen den Unterschied, vor allem, wenn es um sensible Themen wie die Cannabis-Therapie geht.
Der beste Kundenservice –erreichbar auf allen Kanälen
Jeder hat schon einmal schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht. Stundenlanges Warten in einer Telefonschleife oder das ewige Hin- und Herschicken von E-Mails können wirk-
lich an den Nerven zerren. Nicht so bei DoktorABC. Hier steht der Kundenservice an erster Stelle. Egal, ob Sie telefonisch, per Chat oder über WhatsApp Kontakt aufnehmen –das freundliche Team ist von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr für Sie da. Sie haben Fragen zur Behandlung? Sie möchten wissen, wie der Bestellvorgang funktioniert? Oder haben sie ein Problem mit der Lieferung? Das Support-Team von DoktorABC ist nur einen Anruf oder eine Nachricht entfernt.
Das Fazit: DoktorABC macht das Leben einfacher
Am Ende bleibt eine Frage: Warum soll-
te man es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? Mit DoktorABC haben Sie eine Plattform an Ihrer Sei te, die sich um all Ihre gesundheitli chen Bedürfnisse kümmert – von der Verschreibung über die Beratung bis hin zur Lieferung von Medikamenten, alles in einem.
Ob Sie sich für medizinisches Can nabis interessieren oder eine andere Behandlung benötigen, DoktorABC macht den Prozess einfach, sicher und diskret. Keine langen Wartezei ten, keine unnötigen Arztbesuche, keine Kompromisse bei der Qualität – nur eine erstklassige medizinische Versorgung direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.
Wenn das nicht nach einer modernen Lösung klingt, die jeder nutzen sollte, was dann? Und seien wir ehrlich: In einer Zeit, in der man alles vom Sofa aus erledigen kann – warum sollte die Gesundheit da eine Ausnahme machen?
Wenn Sie also bereit sind, Ihre Ge sundheit in die besten Hände zu ge ben, dann schauen Sie doch mal bei DoktorABC vorbei und überzeugen Sie sich selbst von diesem außerge wöhnlichen Service. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken – und vielleicht auch Ihr Zeitplan.
Scannen Sie den QR-Code, um den Rabatt zu nutzen.



TEXT DAVID GLASER
Cannabinoide sind die wichtigste Stoffgruppe im Hanf. Mittlerweile sind über 100 Vertreter dieser Stoffgruppe bekannt, die sich in den einzelnen Sorten in unterschiedlichen Konzentrationen finden. Es gibt Anwendungsfälle, in denen es Sinn ergibt, Cannabinoide zu extrahieren, entweder um noch potentere Rauchwaren zu erhalten oder um für medizinische Zwecke ein einzelnes
Cannabinoid in Reinform zu isolieren. Je nach gewünschtem Endprodukt stehen bei der Extraktion von Cannabinoiden verschiedene Methoden zur Verfügung. Wenn das Endprodukt nicht zum Rauchen bzw. Dabbing, sondern zum oralen Konsum bestimmt ist, ist es wichtig, das Cannabis davor zu decarboxylieren, um das THCA in psychoaktives THC umzuwandeln.
Cannabinoide sind in verschiedenen Kohlenwasserstoffen sehr gut löslich und eignen sich daher für eine Extraktion. Häufig verwendete Kohlenwasserstoffe für diesen Zweck sind Butan oder Ethan. Die wahrscheinlich älteste und bekannteste Extraktion dieser Art ist die Extraktion mittels Butan. Diese Extraktion ist auch bekannt unter dem Namen BHO-Extraktion, welcher sich von der englischen Bezeichnung des Endproduktes Butane Hash Oil ableitet. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass dabei das Chlorophyll nicht mit extrahiert wird. Das fein zerbröselte Cannabis wird zunächst in ein druckbeständiges Rohr gestopft. Am unteren Ende dieses Rohrs befindet sich eine Öffnung, über die ein Filter montiert ist. Am oberen Ende wird ein Ventil montiert, über welches das Butan aus einer Flasche heraus mit Hochdruck hindurchgepresst wird. Das Butan liegt in der Flasche in flüssiger Form vor und entweicht mit Hochdruck, sobald das Ventil geöffnet wird. Während das Pflanzenmaterial mit Hochdruck von Butan durchströmt wird, werden die Cannabinoide im Butan gelöst und am unteren Ende des Rohrs wird das mit Cannabinoiden an-
gereicherte Butan in einem Behälter aufgefangen. Butan hat seinen Siedepunkt bei -1 °C. Das bedeutet, die Flüssigkeit im Auffangbehälter kocht bei Zimmertemperatur und verdampft rasch. Das Verdampfen kann beschleunigt werden, indem der Auffangbehälter mit einem Wasserbad zusätzlich erwärmt wird. Nachdem das Butan verdampft ist, bleibt ein Extrakt zurück, welches einen sehr hohen THC-Gehalt aufweist. Wird anstelle von Butan ein anderes Lösungsmittel verwendet, ist der Ablauf prinzipiell gleich. Diese Methode kommt vor allem zum Einsatz, wenn man Produkte für Dabbing erzeugen möchte. Werden THC-reiche Sorten mit dieser Methode extrahiert, kann im Durchschnitt ein THC-Gehalt von 80 % erreicht werden. Die Extraktion mit Kohlenwasserstoffen ist sehr gefährlich, da große Mengen an hochexplosiven Dämpfen entweichen. Viele Kohlenwasserstoffe sind auch giftig und sollten nicht eingeatmet werden.
Die Extraktion mittels CO2 ist eine der am häufigsten verwendeten Extraktionsmethoden in der Industrie. Ähnlich wie bei einer Extraktion durch Kohlenwasserstoffe wird hier das CO2 mit Hochdruck durch das zerkleinerte Cannabis hindurchgepresst. In einem

Auffangbehälter sammelt sich dadurch ein Konzentrat aus den gelösten Inhaltsstoffen. Man verwendet für diesen Zweck sogenanntes überkritisches Kohlendioxid, also CO2, welches verflüssigt wurde. Diese Methode hat einige Vorteile gegenüber der Extraktion mit Kohlenwasserstoffen, weshalb sie in der Industrie eine der gängigsten Methoden ist. CO2 ist nicht brennbar und völlig ungiftig, was die Extraktion erheblich sicherer macht. Es verdampft außerdem augenblicklich, sobald es aus der Hochdruckanlage in den Sammelbehälter entweicht. Die CO2-Extrak-
tion ist die sauberste und sicherste Methode, um in industriellem Maßstab Cannabis zu extrahieren.
Auch in verschiedenen Alkoholen sind Cannabinoide sehr gut löslich. Zur Extraktion kommen hier vor allem Ethanol und Isopropanol zur Anwendung. Dies ist die wahrscheinlich trivialste Form der Extraktion, die vielfach von Heimanwendern durchgeführt wird. Doch auch im industriellen Maßstab findet diese
Methode aufgrund ihrer sicheren Durchführung Verwendung. Man gibt das zerkleinerte Gras in Alkohol und lässt es einige Stunden ziehen. Nachdem das Ganze durch einen Filter gesiebt wurde, lässt man den Alkohol verdampfen. Dies kann beschleunigt werden, indem das Gefäß in ein Wasserbad gestellt wird. Am Ende bleibt ein klebriges, wachsartiges Extrakt zurück. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass zusätzlich auch das Chlorophyll in Alkoholen löslich ist, wodurch die Konzentration der Cannabinoide niedriger ausfällt.
Um die Ausbeute zu erhöhen, kommt in der Industrie vor allem Ultraschall zum Einsatz. Dieser bricht die Zellen des Pflanzenmaterials auf und kann so eine fast vollständige Extraktion der Cannabinoide gewährleisten. Dabei wird die Behandlung mit Ultraschall in der Regel mit einer der genannten Extraktionsmethoden kombiniert. Die meisten am Markt befindlichen Modelle zur Ultraschallextraktion basieren darauf, ein Gemisch aus einem Lösungsmittel und Cannabis unter ständigem Umrühren gezielt mit Ultraschall zu behandeln.
Auf diese Weise kann die Extraktion erheblich beschleunigt und die Ausbeute optimiert werden. Häufig kommen auch Extraktionstechniken zum Einsatz, bei denen man sich die Vorteile eines Vakuums zunutze macht. Das frisch geerntete Cannabis wird zunächst gefriergetrocknet und im Anschluss in eine Vakuumkammer gegeben. Durch das Vakuum geht das Wasser direkt in einen gasförmigen Zustand über, verdampft und reißt dadurch sozusagen die Cannabinoide mit sich. Das Gas wird abgeleitet, verflüssigt und ergibt ein Extrakt mit hoher Reinheit. Häufig kommt auch eine Kombination aus der Ethanol-Extraktion und einer Vakuumtechnik zur Anwendung. Hierbei wird das EthanolExtrakt zunächst auf -40 °C gekühlt, um Fette und Wachse zu entfernen. Nach diesem Reinigungsschritt wird aus dem Extrakt das Ethanol in einem Vakuum verdampft. Das Vakuum hat hierbei den Vorteil, dass eine niedrigere Temperatur benötigt wird, da der Siedepunkt vieler Substanzen im Vakuum deutlich niedriger ist. Auf diese Weise kann der Zerfall von Cannabinoiden verringert werden. Zum Verdampfen kommt vielfach ein Rotationsverdampfer zum Einsatz. Dieser hat im Vergleich zu einem simplen Erwärmen den Vorteil, dass die Temperaturverteilung infolge der Rotation den Prozess effizienter macht.
Wichtig zu verstehen ist, dass alle hier vorgestellten Methoden zunächst ein Vollspektrum-Extrakt liefern. Auch wenn in vielen Extrakten, je nach verwendeter Hanfsorte, ein THC- bzw. CBD-Gehalt von 90 % vorliegen kann, sind zahlreiche weitere Cannabinoide, Terpene sowie weitere Pflanzenstoffe enthalten. In der Medizin ist es oftmals nötig, ein Cannabinoid in pharmakologischer Reinheit zu isolieren. Möchte man nun also THC oder ein beliebiges anderes Cannabinoid mit einem Reinheitsgrad von über 99 % isolieren, ist eine weitere Verarbeitung des Extrakts nötig. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn man ein seltenes Cannabinoid in Reinform isolieren möchte, welches nur in Spuren vorkommt. Die hierzu benötigten Trennverfahren basieren darauf, dass man sich individuelle chemische und physikalische Eigenschaften eines einzelnen Cannabinoids zunutze macht. Die einfachste Form der Trennung ist die Fraktionierungsdestillation. Hier macht man sich die unterschiedlichen Siedepunkte der verschiedenen Cannabinoide zunutze. Man erwärmt das Extrakt auf den Siedepunkt des ge-
wünschten Cannabinoids und lässt die aufsteigenden Dämpfe kondensieren. Ist dieses Verfahren nicht möglich, zum Beispiel weil mehrere Cannabinoide mit dem Siedepunkt zu nahe nebeneinander liegen, wendet man häufig Chromatografie an. Verschiedene Substanzen, so auch Cannabinoide, können unterschiedlich schnell durch verschiedene Medien hindurch diffundieren. Dies kann man sich zunutze machen, um sie voneinander zu trennen. Es stehen mehrere Methoden der Chromatografie zur Verfügung, die von der simplen Säulenchromatografie bis zu Apparaturen im industriellen Maßstab reichen. Eine Variante, die in der Industrie häufig zum Einsatz kommt, nennt sich zentrifugale Verteilungschromatografie. Bei dieser Technik nutzt man die durch schnelle Rotation entstehende Zentrifugalkraft, um die einzelnen, voneinander zu trennenden Cannabinoide in ein spezielles Lösungsmittel hineindiffundieren zu lassen. Dabei kann jedes Cannabinoid unterschiedlich tief in das Medium eindringen – sehr ähnlich, wie man es von der herkömmlichen Chromatografie kennt. Eine solche Zentrifuge besteht aus vielen kleinen Kapseln. In diesen Kapseln befindet sich eine Emulsion aus den zu trennenden Substanzen und einem speziellen Lösungsmittel, welches als chromatografisches Medium dient. Diese beiden Komponenten

kann man sich zunächst als getrennt vorstellen, wie eine Schicht aus Öl, die auf Wasser schwimmt. Durch die Rotation werden die zu trennenden Substanzen nun unterschiedlich weit in das darunterliegende Lösungsmittel hineingepresst. Durch die gleichzeitig auftretende und zum Rotationsmittelpunkt
wirkende Zentripetalkraft wird die jeweilige Substanz an dieser Stelle gehalten. Nun muss nur noch eine Absaugvorrichtung das jeweilige Cannabinoid aus der entsprechenden Stelle der Kapsel absaugen, und man erhält dieses in pharmakologischer Reinform.
TEXT DIETER KLAUS GLASMANN
Die Erwartungen an die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel waren hoch in Deutschland, als nach der Bundestagswahl 2021 der Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach, die Pläne für eine Regulierung der Abgabe über lizenzierte Fachgeschäfte vorstellte. Im Verlauf der Gesetzgebung wurden diese Erwartungen dann zunehmend enttäuscht, bis zuletzt eine Teil-Entkriminalisierung mit Versorgungsmöglichkeit mittels Eigenanbau oder dem


gemeinschaftlichen Anbau in Vereinen übrig geblieben ist.
Alles kam also strenger, bürokratischer und auch später, als es eigentlich sein sollte. Dennoch ist die KCanG Reform ein Erfolg und befreit Millionen von Menschen von Verfolgungsdruck und vieler damit einhergehenden psychischen Belastungen. Ein Stück Freiheit wurde mühsam erkämpft und ab dem 1. April 2024 konnten Cannabiskonsumenten damit beginnen, diese Freiheit zu erkunden und wahrzunehmen.
Erinnerst Du Dich an die Tage nach besagtem 1. April 2024? Ich zum Beispiel erinnere mich an viele Nachrichten, die das Ende der Cannabis Prohibition verkündeten, an zahllose Social Media Posts, die entweder die Entkriminalisierung feierten, oder die konservativen ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten
Marlene Mortler oder Daniela Ludwig verhöhnten. Es war eine ausgelassene Stimmung, die viele befreit konsumierend erfahren durften.
Ferner war das Ganze aber auch ein bisschen wie der achtzehnte Geburtstag, die Volljährigkeit, ab der man trinken und rauchen darf und zumindest theoretisch in fast jeden Club hinein darf. Da die coolen Partys aber meist privat sind oder man sich auch zuvor schon in Clubs hineinmogeln konnte, blieb der erwartete große Unterschied aus, den die Volljährigkeit dann doch
machen sollte.
Und so ähnlich fühlten sich auch die ersten Tage nach dem 1. April an. Man kifft zunächst einfach mal genau so, wie man auch vorher schon gekifft hat. Dass sich etwas verändert hat, stellten viele erst etwas später fest, wenn sie sich etwa die Seeds für den ersten legalen Homegrow oder sogar Stecklinge kauften. Generell ist das Gärtnern vielleicht der Bereich, an dem man die neue Freiheit im Alltag am besten wahrnehmen und spüren kann. Eine ganz andere Angelegenheit sind aber Veranstaltungen jenseits des gewöhnlichen Tagesablaufs: Konzerte, Stadt- und Straßenfeste, Festivals und prinzipiell Events aller Art.
Gerade bei Reggae-Festivals wird ein Publikum erwartet, das neben der Musik auch dem Ganja, dem Cannabis, sehr zugetan ist. Deswegen wurden insbesondere die An- und Abreise zu den größeren Reggae-Festivals immer wieder zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Besuchern und den Polizisten, die die Wege zu den Festivals flankieren und die An- und Abreisenden mit Durchsuchungen und Drogenkont-

rollen belästigen. Doch wie verhält sich das nun nach der Entkriminalisierung von Cannabis? Werden mehr Kraftfahrer angehalten und überprüft, da man davon ausgeht, dass die Legalität mehr vom Konsum beeinflusste Fahrer hervorbringt? Werden weniger Kontrollen durchgeführt, da man damit rechnet, weniger illegale Substanzen vorzufinden? Oder hat sich eigentlich gar nichts verändert, weil sich die neue gesetzliche Lage noch nicht eingespielt hat? Um uns darüber zumindest im Ansatz einen Eindruck verschaffen zu können, wollten wir die Erfahrungen an den Festivals Summerjam und Black Forest On Fire im Jahr 2024 ein wenig anschauen und vergleichen.
Mit bis zu 30.000 Besuchern ist das Summerjam Festival das größte Reggae-Festival in Deutschland. Auch in Europa gehört es zu den Publikumsstärksten Reggae-Events. Auf zwei großen Bühnen geben sich die weltweit größten Acts des Musikgenres fast im Stundentakt die Klinke in die Hand. Leider wird von der Community angemahnt, dass immer mehr Bands und Artists aus anderen Sparten wie Hip-Hop gebucht werden. Doch insgesamt war das Line-up 2024 mit vielen Legenden und auch neuen Größen der Reggae
und Dancehall-Musik besetzt, darunter Busy Signal, Romain Virgo, Steel Pulse, Julian und Ky-Mani Marley und viele mehr. Übrigens stehen mit Inner Circle, Alborosie, Etana und einigen weiteren auch für 2025 schon ein paar richtige Reggae-Highlights fest.
Dass die Summerjam eine Menge Cannabis-affine Menschen anzieht, ist gleichermaßen Klischee wie Fakt, und das weiß auch die Polizei. Auch wenn die Region um Köln, dem Austragungsort des Festivals, nicht zu den konservativsten Gegenden Deutschlands zählt, so sind größer angelegte Kontrollen ein normales Bild um das Festivalgelände herum. In diesem Jahr fielen diese allerdings sehr moderat aus und waren kaum zu sehen. Ob dies speziell an dem Weg lag, den ich zur Summerjam nahm, vermag ich nicht zu beurteilen, doch es kam mir so vor, als ob man den Event in diesem Jahr die Legalität feiern lassen wollte.
Auf dem Festivalgelände sind seit jeher Polizeistreifen zu Fuß unterwegs, jedoch beobachtet man diese fast nie dabei, dass sie ohne besonderen Anlass Menschen kontrollieren. Auch offensichtlich Cannabis rauchende Besucher werden in der Regel nicht behelligt. Die Beamten widmen sich tendenziell eher Dealern oder Delikten wie Taschendiebstahl oder Gewalt, also Taten, bei welchen nicht nur eine Eigenschädigung


vorliegt, sondern andere zu Opfern werden.
Da sich bei der Summerjam beides stark in Grenzen hält, weil Reggaemusik ein zumeist sehr friedvolles Publikum anzieht, haben die Polizisten vermutlich einen größtenteils entspannten Einsatz. Dies bestätigte auch ein Beamter vor Ort auf Nachfrage. Er sieht lediglich das Vermischen mit Hip-Hop und Rap-Fans problematisch, da bei diesen eine höhere Gewaltbereitschaft vorhanden ist als bei Rastas und Reggae-Enthusiasten. So teilt wohl auch die Polizei die Hoffnung, dass Summerjam ein richtiges Reggae-Festival bleibt und nicht weiter musikalisch zersetzt werden wird.
Apropos, richtiges Reggae-Festival.
Wer in diesem Jahr ein Reggae Ereignis mit ganz besonderem Flair erleben wollte, der war auf dem Black Forest On Fire Festival goldrichtig. Bei diesem Event, der sich in die malerische Landschaft eines Tals in Berghaupten, inmitten des Schwarzwalds schmiegt, stimmt einfach alles von A bis Z. Die Größe von etwa 5.000 Besuchern reicht aus, um große Namen wie Alborosie, Queen Omega oder auch Black Uhuru auf die Bühne zu bringen, ist aber noch überschaubar genug, um
nicht den Charakter einer Großveranstaltung zu bekommen.
Verantwortlich für das Festival ist ein eigens dafür gegründeter Verein, der mit einem immens hohen Qualitätsanspruch die Organisation der Veranstaltung übernimmt und die anfallenden Herausforderungen und Aufgaben durch das freiwillige und unentgeltliche Engagement der Mitglieder bewältigt.
Mit dem Südwesten Deutschlands, also Baden-Württemberg, ist die Location des Black Forest On Fire im Bereich konservativerer Behörden gelegen. Tatsächlich wurde bei der Anfahrt auch die Polizei stellenweise gesichtet, doch unter den befragten Besuchern konnte keiner von einer Kontrolle berichten, bei der Cannabis im Fokus stand. Sobald man einmal den Bus geparkt oder sein Zelt aufgestellt hat, fiel dann auch das letzte bisschen Anspannung ab, die mögliche Kontrollen im Vorfeld verursachen können. Nun fühlt man sich mehr als sicher und geborgen im schönen Berghaupten und in der Gegenwart eines Festivals mit einer herzlichen Reggae-Community, wie mancher sie im kühlen Deutschland kaum vermuten würde.
Die Landschaft und der liebevolle Aufbau alleine erschaffen schon eine Atmosphäre, die nur noch von der
Freundlichkeit und dem Engagement der ehrenamtlich tätigen Helfer übertroffen wird. Auf dem Festivalgelände waren, soweit eine Beurteilung möglich ist, keine Beamten zu sehen. Diese wären aber auch wirklich überflüssig gewesen, denn die Rücksicht der Besucher untereinander, insbesondere auch auf Kinder, hätte größer nicht sein können. Orte für den Konsum wurden mit Bedacht gewählt und gezielt Areale für Kinder beim Rauchen gemieden. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Menschen von ganz alleine zu vernünftigem Handeln neigen, ganz ohne Zwang, Schikane oder Sanktionierungen.
Sowohl das Summerjam Festival als auch das Black Forest On Fire haben in diesem Jahr großartig abgeliefert, das kann man kaum anders ausdrücken. Summerjam hatte 2024 einen Vibe, den man in manchem Jahr zuvor etwas vermissen konnte. Bei den Künstlern und den Besuchern war eine unglaublich positive Atmosphäre zu spüren. Diese könnte natürlich teilweise auch auf die Freude über die Legalität von Cannabis zurückgeführt werden, doch es lag wohl
auch an der Wichtigkeit und Dringlichkeit der Botschaft, die viele Künstler in diesem Jahr den Hörern mitgeben wollten. Sehr viele Sänger haben über die anhaltenden Kriege und Spannungen gesprochen, die aktuell die Welt erschüttern. Damit waren Reggae und Rasta Botschaften wie Love and Unity so wichtig wie nie zuvor. Auch bei den bekanntesten Artists klangen diese Sätze nicht wie pauschal dahergesagt, sondern wie ein echtes Herzensanliegen.
Gleichermaßen war auch das Black Forest On Fire voller Spirit und von einem unglaublich positiven Miteinander geprägt. Wer dieses Festival im Jahr 2024 besucht hat, will auch 2025 wieder dort sein. Ob wegen der guten Musik und der optimalen Audioqualität, ob wegen des schönen Aufbaus in der Schwarzwälder Kulisse, oder einfach wegen der Menschen, die dort für drei Tage ein Zuhause in einem großartigen Umfeld finden.
Um langfristig feststellen zu können, wie sich der Umgang mit Cannabis auf diesen Festivals mit der Zeit weiterentwickelt, aber auch wegen der vielen guten Erfahrungen, würden wir gerne beide Events auch im kommenden Jahr wieder besuchen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns dort und unterhalten uns vor Ort für den nächsten Festivalreport 2025.


TEXT DAVID GLASER
Während THC für die psychoaktive Hauptwirkung von Cannabis verantwortlich ist, trägt das individuelle Profil an Terpenen
zur ganz speziellen psychoaktiven und aromatischen Einzigartigkeit der verschiedenen Hanfsorten bei. Dieser als Entourage-Effekt bekannte synergetische Effekt bezeichnet die psychoaktive Gesamtkomposition, die sich durch die Kombination aller in der Sorte enthaltenen Cannabinoide und Terpene ergibt. Während die meisten Terpene für sich alleine eingenommen nur eine sehr subtile psychoaktive Wirkung entfalten, gibt es auch einzelne Vertreter mit einer ausgeprägteren Wirkung. Was alle Terpene gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie ein enormes medizinisches Potenzial aufweisen. Besonders in den vergangenen Jahren gab es in der Forschung einige neue Entdeckungen im Bereich der psychoaktiven Terpene, die sowohl für Freizeitkonsumenten als auch für Patienten von Bedeutung sind.
Das wahrscheinlich bekannteste psychoaktive Terpen ist Beta-Caryophyllen. Dieses kommt neben Hanf auch noch in zahlreichen weiteren Pflanzen vor. Unter anderem ist dieses Terpen in Pfefferkörnern in größeren Mengen vorzufinden. Beta-Caryophyllen wirkt auf den CB2Rezeptor. Seine Bindungsaffinität am CB2-Rezeptor liegt bei einem Ki-Wert von 155 nM, was in einem mittelstarken
Bereich einzuordnen ist. Dadurch hat es eine leicht sedierende Wirkung und wirkt insgesamt der starken, oftmals etwas paranoiden Wirkung von THC entgegen.
Ein gängiger Ratschlag gegen eine zu hohe Dosis THC ist es, Pfefferkörner zu kauen. Die Wirkung dieser Methode liegt im Gehalt von Beta-Caryophyllen begründet, welches über seine CB2-Wirkung die THC-Wirkung reduziert. Auch für die medizinische Anwendung ist dieses Terpen überaus interessant. Mit einer agonistischen Wirkung am CB2Rezeptor weist es prinzipiell eine hohe therapeutische Bandbreite auf, welche mit jener von CBD vergleichbar ist. Es gibt mehrere Studien, die nachweisen konnten, dass Beta-Caryophyllen eine entzündungshemmende Wirkung hat. Ähnlich wie CBD kann es eine breite Palette an entzündungsfördernden Zytokinen hemmen, was es für eine große Anzahl an entzündlichen Erkrankungen interessant macht. Durch Beobachtungen an Mäusen ist bekannt, dass es primär Entzündungen in der Haut und Schleimhäuten effektiv lindert. Ferner fördert es auch die Wundheilung. Aktuelle Forschungsergebnisse konnten auch zeigen, dass Beta-Caryophyllen eine neuroprotektive Wirkung aufweist und oxidativen Stress hemmt. Diese Tatsache könnte es in Zukunft als neue alternative Behandlungsform für neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz
oder Alzheimer interessant machen. Aufgrund seiner sedierenden Wirkung, welche über den CB2-Rezeptor vermittelt wird, ist dieses Terpen auch für die Behandlung psychiatrischer Erkrankungen potenziell geeignet. Eine aktuelle italienische Studie aus 2024 geht davon aus, dass Beta-Caryophyllen zukünftig ein neuer Therapieansatz bei der Be-
handlung von Angsterkrankungen und Depressionen sein könnte. Ein großer Vorteil von Beta-Caryophyllen ist, dass es keinerlei Abhängigkeitsrisiko mit sich bringt – ganz im Gegensatz zu Benzodiazepinen, welche oftmals die Standardmedikation bei Angsterkrankungen darstellen. Auch die körperlichen Nebenwirkungen sind im Vergleich

zu klassischen Psychopharmaka wie SSRIs verschwindend gering. Untersuchungen an Zellkulturen konnten außerdem zeigen, dass Beta-Caryophyllen gegen Diabetes wirksam sein könnte. Es zeigte eine regulierende Wirkung auf die Insulinfreisetzung in bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften könnte es zukünftig auch gegen Folgeerscheinungen von Diabetes, wie zum Beispiel Arteriosklerose, eingesetzt werden.
Ein weiteres leicht psychoaktives Terpen ist Terpinolen. Dieses weist ebenfalls eine beruhigende und angstlösende Wirkung auf. Manche Anwender beschreiben auch eine stimmungsaufhellende Wirkung. Auch gegen Schlaflosigkeit kann Terpinolen aufgrund seiner sedierenden Wirkung eine nicht süchtig machende Alternative darstellen. Besonders wenn es mit Myrcen kombiniert wird, einem ebenfalls sedierend wirkenden Terpen, kann die schlaffördernde Wirkung deutlich spürbar ausgeprägt sein. Schlafstörungen stellen ein erhebliches und weitverbreitetes Problem dar. Psychoaktive Terpene aus Hanf können hier eine nicht süch-
tig machende und dennoch wirksame Option darstellen. Es wird auch vermutet, dass die synergetische Wirkung dieser beiden Terpene einer der Gründe ist, warum manche Hanfsorten den sogenannten Couch-Lock-Effekt haben, welcher durch ausgeprägte körperliche Entspannung geprägt ist. Über welche Rezeptoren Terpinolen diese Wirkung entfaltet, ist bislang noch nicht vollständig geklärt. Vermutet wird eine Wirkung an den GABA-Rezeptoren sowie an bestimmten Rezeptoren des Serotoninsystems. Terpinolen gehört zu den eher seltenen Terpenen in Cannabis. Einzelne Sorten wie Super Lemon Haze können in ihrem Terpenspektrum jedoch einen Anteil von bis zu 20 % aufweisen. Auch in vielen anderen Pflanzen ist dieses Terpen anzutreffen. Neben seiner psychoaktiven Wirkung weist dieses Terpen auch interessante medizinische Eigenschaften auf. Terpinolen verfügt über ausgeprägte antibakterielle Effekte. Ein brasilianisches Forscherteam kam 2020 zu dem Ergebnis, dass dieses Terpen gegen bestimmte antibiotikaresistente Bakterien wirksam ist. Besonders effektiv erwies es sich gegen den Erreger Staphylococcus aureus, ein typischer Krankenhauskeim, der im Laufe der Zeit gegen mehrere konventionelle Antibiotika Resistenzen entwickelt hat und dementsprechend schwierig zu bekämpfen ist. Bei In-vitro-Versuchen

konnte Terpinolen nicht nur das Bakterium Staphylococcus aureus eliminieren, sondern es sorgte auch dafür, dass das Antibiotikum Oxacillin wieder Wirkung zeigte. Oxacillin ist ein Standardantibiotikum, welches gegen Staphylococcus aureus zum Einsatz kommt.
Jedoch haben viele Subtypen dieses Erregers bereits Resistenzen gebildet. Das Forscherteam stellte fest, dass durch die Zugabe von einer geringen
Menge Terpinolen in eine Kultur dieses
Bakteriums, die selbst noch keine Wirkung zeigte, das Hinzufügen von Oxacillin einen synergetischen Effekt ergab. Diese Synergie bewirkte, dass Oxacillin wieder wirksam wurde und Staphylococcus aureus vollständig eliminieren konnte. Ein vergleichbarer Effekt konnte auch im Zusammenhang mit Antimykotika und pathogenen Hautpilzen festgestellt werden. Auch bei Hautpilzerkrankungen werden Resistenzen zunehmend zu einem Problem, sodass

Antimykotika oftmals nur bedingt wirksam sind. Forscher konnten durch Invitro-Untersuchungen feststellen, dass Terpinolen die Wirksamkeit des Antimykotikums Terbinafin verstärkt. Durch diesen synergetischen Effekt konnte Terbinafin Hautpilze wieder eliminieren, die davor bereits Resistenzen gebildet hatten. Diese besondere Eigenschaft könnte Terpinolen zukünftig zu einem aussichtsreichen Kandidaten zur Bekämpfung der immer mehr auftretenden Resistenzen machen. Terpinolen könnte zukünftig auch in der Krebsmedizin noch an Bedeutung gewinnen. Studien an Zellkulturen kamen zu dem Schluss, dass dieses Terpen das Wachstum bestimmter Typen von Gehirntumoren hemmen könnte. Auch manche Arten von Leukämiezellen werden durch Terpinolen in ihrem Wachstum gehemmt. Das Terpen blockiert bestimmte Proteine, die für die Zellteilung von Krebszellen wichtig sind, ohne aber durch diesen Prozess gesunde Zellen zu schädigen.
TERPENE EBENFALLS AM CB1-REZEPTOR WIRKSAM
Eine relativ neue und besonders interessante Entdeckung im Bereich der Terpene ist die Tatsache, dass einige von ihnen ebenfalls eine leichte agonistische Wirkung am CB1-Rezeptor aufwei-
sen. Eine 2020 veröffentlichte US-Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Terpene Alpha-Humulen, Geraniol, Linalool und Beta-Pinen am CB1-Rezeptor aktiv sind. Sowohl durch Beobachtungen an Mäusen als auch durch Versuche an Zellkulturen konnte gezeigt werden, dass diese Terpene eine messbare agonistische Wirkung am CB1-Rezeptor aufweisen. Der Effekt konnte wieder aufgehoben werden, wenn der CB1-Antagonist Rimonabant hinzugefügt wurde. Durch diese Gegenprobe war der Beweis erbracht, dass die genannten Terpene tatsächlich am CB1-Rezeptor aktiv sind. Für sich alleine eingenommen erzeugen diese vier Terpene eine subtile psychoaktive Wirkung, die in der Regel als mild, beruhigend und stimmungsaufhellend beschrieben wird. In Kombination mit den weiteren Inhaltsstoffen, insbesondere durch deren synergetische Wirkung mit den Cannabinoiden, tragen sie maßgeblich zur individuellen psychoaktiven Note der jeweiligen Hanfsorte bei. Die Entdeckung, dass auch manche Terpene am CB1-Rezeptor aktiv sind, ist nicht nur für Freizeitkonsumenten relevant, sondern bringt auch erhebliches medizinisches Potenzial mit sich. Forscher gehen davon aus, dass es durch eine gezielte Kombination aus Terpenen und Cannabinoiden möglich ist, die schmerzstillende Wirkung von THC erheblich zu erhöhen. Dies ist auch der
Grund, warum sich bestimmte Hanfsorten durch ihr individuelles Profil aus Terpenen und Cannabinoiden für die Behandlung bestimmter Leiden besonders herauskristallisiert haben. Vor allem für chronische Schmerzpatienten ist diese Tatsache sehr relevant. Eine Sorte, die reich an Terpenen ist, welche durch ihre CB1-Aktivität synergetisch mit THC wirken, kann helfen, neuropathische Schmerzen effektiver zu lindern. Durch eine optimal angepasste Cannabismedikation können wiederum suchterzeugende Opiate oder andere konventionelle Schmerzmittel mit erheblichen Nebenwirkungen weiter reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren Terpene in der Schmerzbehandlung noch eine größere Rolle spielen werden.

Tausende Menschen haben seit der Entkriminalisierung von Cannabis den Eigenanbau kennen und lieben gelernt. Ob draußen im Garten oder Indoor mit dem Einsatz moderner Technik – der Homegrow wird schnell von einer reinen Beschaffungsmaßnahme zu einer wahren Leidenschaft. Die Technologien, Ansätze und Methoden sind heute so vielfältig, das Thema ist geradezu eine Wissenschaft. Dementsprechend können die ersten Recherchen im Netz so manchen ein wenig überfordern und den einen oder anderen sogar davon abhalten, sich dem Homegrow in der Praxis zu widmen. Aber der Anbau muss nicht kompliziert sein, denn es gibt auch Möglichkeiten, die für jeden leicht umzusetzen sind. Mit der BerkanaAll-in-One-Lösung von Druid Nutrients hat der Grower eine Nährstofflösung in der Hand, mit der die Pflanzen alles geboten bekommen, was sie benötigen – nicht mehr und nicht weniger.


Die Berkana All-in-One-Solution deckt das gesamte Nährstoffspektrum ab, das die Pflanzen benötigen. Es ist eine Nährstoffformel, die nicht nur für Cannabis funktioniert, sondern auch für alle anderen möglichen Gewächse wie Gemüse, Kräuter, Blumen und Früchte. Dafür enthält Berkana eine Mischung aus natürlichen Chelat-Mi-

neralien sowie Spurenelementen aus Erd- und Meersalz, aus Pflanzenextrakten, Huminstoffen und Fruchtölen. Sie wurde entwickelt, um den kompletten Nährstoffbedarf der Pflanze zu befriedigen. Damit ist sie eine Komplettlösung für Grower, die ihren Pflanzen einfach, effizient und effektiv Nährstoffe zuführen wollen. Auch bei der Wahl der Verpackungsmaterialien ist Druid Nutrients der Nachhaltigkeit verpflichtet und bietet dementsprechend umweltschonende Verpackungen an.
Berkana ist im Vergleich zu vielen anderen Produkten, die in der Regel flüssig sind, eine trockene Nährstofflösung, die sowohl alle Mikro- als auch Makronährstoffe enthält, die die Pflanze im Wachstum oder in der Blüte benötigt – ebenso alle Aminosäuren und Mineralien, die für die Gesundheit und eine gute Entwicklung erforderlich sind.
Das vereinfacht den gesamten Anbauprozess und macht ihn für jeden zugänglich – und das ohne Kompromisse bei der Leistung. Es müssen keine Produkte angemischt und kein komplexer Zeitplan eingehalten werden. In allen Wachstumsphasen bekommen die Pflanzen, was sie brauchen, um stark und robust zu sein und schließlich eine ergiebige Ernte abzuliefern. vDas Resultat spricht für sich – schlicht und ein-
fach. Darum ist es am besten, eigene Erfahrungen mit Berkana zu machen. Hier findest du alle Infos und alle drei Paketgrößen, die Druid von Berkana im Angebot hat:

Artikel auf Deutsch: www.hanf-magazin.com/ss16
Imagine waking up in the middle of the night, drenched in sweat, heart pounding, anxiety coursing through your veins. You shuffle to the kitchen, pour a glass of ice water, and wonder: Is this really what my life will be now?
If you’re navigating perimenopause or menopause, the answer is: it doesn’t have to be. Yes, the hormonal roller coaster can feel relentless—hot flashes, mood swings, insomnia, joint pain—but what if there were a gentle, modern approach to reclaiming your balance?
Hormone Replacement Therapy (HRT) has long been a mainstay in menopause treatment, providing real relief for many. But it’s not for everyone. Concerns about breast cancer, cardiovascular risk, or the desire to avoid synthetic hormones often lead women to explore other avenues. Non-hormonal pharmaceuticals like antidepressants, gabapentin, or clonidine might take the edge off, but they come with their own side effects: nausea, dizziness, dry mouth. Frequently, it feels like trading one set of symptoms for another.
That leaves a vast middle ground where countless women are left quietly struggling. Herbal remedies—black cohosh, soy isoflavones, evening primrose oil—get some attention, but clinical data supporting their effectiveness remains spotty at best. And while lifestyle modifications like acupuncture, yoga, mindfulness, and dietary shifts are worthwhile, they don’t always offer complete relief. It can start to feel like you’re throwing spaghetti at the wall to see what sticks.
There’s a rising star in the conversation—cannabis. Yes, that cannabis. Thanks to evolving legal landscapes, more reliable products, and a growing body of research, women are turning to cannabis and its key compounds—cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC)—as potential allies in managing menopause.
Cannabis works through the body’s endocannabinoid system (ECS), a network of receptors that helps regulate sleep, pain, mood, and temperature—exactly the systems that go haywire during menopause. Think of it as your body’s internal balance-keeper, nudged back toward harmony by cannabis.
While clinical trials are still catching up, anecdotal evidence and survey data are mounting. Here’s what women are reporting:
Better Sleep: Insomnia and night sweats are some of the most disruptive symptoms. CBD’s calming effects and THC’s sleep-inducing properties are helping many women get the rest they desperately need. In a recent survey, 73% of women who used cannabis reported improved sleep.
Mood Support: Perimenopause and menopause often bring anxiety, irritability, and emotional swings. CBD, in particular, has shown promising results in reducing anxiety without the intoxicating effects of THC. As one user put it, “It’s like my brain finally hits the pause button.”
Pain Relief: Joint and muscle pain are common complaints. CBD’s anti-inflammatory properties, combined with THC’s pain-relieving effects, can provide significant relief.
Hot Flash Management: While scientific research is limited, many women anecdotally report that cannabis, especially THC, helps manage hot flashes— offering a potential cooling effect when nothing else seems to work.
Interestingly, women in the perimenopausal stage—where hormonal fluctuations are often most intense—report greater reliance on cannabis compared to those who are postmenopausal, citing more severe anxiety, hot flashes, and mood disturbances.
These aren’t isolated anecdotes. They reflect a broader trend: thousands of women seeking a comprehensive, plantbased approach to symptom relief. Yet, it’s important to recognize that much of the current data is self-reported. We’re still waiting for robust, randomized clini-
cal trials to validate what users already suspect—that cannabis could be a powerful tool in menopause care.
One of cannabis’s greatest strengths is its versatility. It comes in various forms, allowing women to tailor their use based on symptoms, lifestyle, and comfort level:
Tinctures: Taken sublingually, tinctures kick in within 15–45 minutes and last 4–6 hours. Great for precise dosing to ease anxiety or improve sleep.
Edibles: These take 1–2 hours to work but offer extended relief for 6–8 hours or more. Ideal for nighttime use or chronic pain.
Vaping: Offers near-instant relief—effects begin within seconds and last 1–3 hours. Helpful for sudden hot flashes or anxiety spikes.
Topicals: Lotions or balms applied directly to the skin can relieve localized pain without any psychoactive effects. They begin working within minutes and last 2–4 hours.
Whatever form you choose, the key is to start low and go slow. Begin with around 2 mg of THC or 10 mg of CBD. Keep a symptom diary to track dose, timing, and effects. This data will help you fine-tune your approach and avoid
unpleasant side effects.
Think of cannabis not as a silver bullet but as a powerful soloist in your wellness symphony. It works best when accompanied by supportive lifestyle choices:
Nutrition: Incorporate phytoestrogenrich foods like soy, flaxseed, and legumes, along with omega-3 fatty acids for hormonal balance.
Exercise: Weight-bearing workouts strengthen bones, while gentle activities like yoga or tai chi soothe the nervous system and boost mood.
Sleep Hygiene: A consistent bedtime, a cool bedroom, and a screen-free winddown routine can help prepare your body for rest—amplifying the sleep benefits of cannabis.
Mind-Body Practices: Meditation, breathwork, and guided imagery help quiet mental chatter, reduce stress, and enhance the calming effects of cannabinoids.
Together, these elements form a holistic, empowering approach to navigating menopause with greater ease and dignity.
Cannabis isn’t a miracle cure, but it offers something rare: a single option that can simultaneously ease sleep issues, soothe mood swings, and reduce pain. For women who feel caught between traditional medicine and unproven remedies, it presents a promising middle path—one rooted in both nature and emerging science.
As research advances and cultural stigmas fade, cannabis could radically reshape our approach to menopause—a condition long misunderstood and underserved.
Meanwhile, approach it thoughtfully.
Talk with healthcare providers who understand the endocannabinoid system and can guide you in integrating cannabis safely and effectively. Your menopause journey deserves more than just enduring symptoms or patching them over—it deserves real, personalized solutions.
Because let’s be honest: hot flashes are dramatic enough without adding unnecessary suffering to the mix.
TEXT DAVID GLASER

Mit großer Wahrscheinlichkeit fühlen sich wohl die meisten Cannabiskonsumenten mit ein wenig Erfahrung und einer gewissen Beobachtungsgabe dazu befähigt, eine halbwegs qualifizierte Auskunft über die Zusammenhänge zwischen dem Gebrauch von Cannabis und dem Einfluss auf den Schlaf zu geben. Der erste stumpfe Satz, der dem einen oder anderen bei diesem Thema vielleicht spontan in den Kopf schießen wird, könnte in etwa folgendermaßen lauten: „Wenn du zu viel Cannabis konsumierst, wirst du müde und dann schläfst du ein.“ Insbesondere mit Blick auf meine Jugendzeit kann ich eine solche Aussage eigentlich nur unterschreiben. In der jugendlichen Phase des Experimentierens und Ausprobierens, in der man in der Clique feststellen möchte, wer welche Mengen Cannabis vertragen kann, habe ich nicht gerade selten einige Abende bei Kumpels oder privaten Partys verschlafen, wenn ich mir an der Bong mal wieder zu viel zugetraut habe. Ich machte mir geradezu einen Namen als der Typ, der nach einem ordentlichen Zug erst mal mit weißgrauer Haut und roten Augen auffiel, bevor er dann auf irgendeinem bequemen Sitzmöbel ein Nickerchen machte. Und offen gesagt war „zu viel Cannabis“ bei mir gar nicht wirklich so sehr viel. Ich war nur schon immer extrem empfänglich für die Wirkung von Cannabis – ebenso von

Drogen aller Art, von Alkohol und von Kaffee – eigentlich wirklich von allem. Das Verschlafen aller möglichen Events und gesellschaftlichen Anlässe in meiner Jugend kann selbstverständlich nicht als wissenschaftliche Evidenz herangezogen werden, um die Wirkung von Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabis generell auf den Schlaf des Menschen konkret beschreiben und beurteilen zu können. Da Schlafstörungen ein wichtiger Symptombereich sind, in welchem Cannabis als Medizin zum Einsatz kommt, dürfen wir jedoch davon ausgehen, dass die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Cannabis und Schlaf auch immer wieder Gegenstand einiger Studien und wissenschaftlicher Versuche war – und es auch in Zukunft sein wird.
Cannabis und sein psychoaktiver Hauptwirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol) sind seit Langem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Schlafqualität. Während einige Menschen Cannabis zur Förderung des Schlafs verwenden, gibt es auch Hinweise darauf, dass THC Schlafstörungen verursachen kann. Dieser Bericht beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen THC und Schlaf, wobei sowohl potenzielle Vorteile als auch Risiken Berücksichtigung finden sollen.
Tetrahydrocannabinol wirkt, indem es an Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2) im Gehirn und im Körper bindet. Diese Rezeptoren sind Teil des Endocannabinoid-Systems, das unter anderem auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Studien haben gezeigt, dass THC Einfluss auf die verschiedenen Schlafphasen nimmt, insbesondere auf den REM-Schlaf (Rapid Eye Movement), der mit Träumen und emotionaler Verarbeitung verbunden ist, sowie den Tiefschlaf, der für die körperliche Erholung entscheidend ist.
Dass Cannabis für die Schlafqualität förderlich sein kann, ist hinlänglich bekannt. Deswegen findet Medizinalcannabis auch in der gängigen Praxis Verwendung bei Schlafstörungen. In erster Linie leistet THC in diesem Bereich Hilfe beim Einschlafen, verhindert nächtliche Schlafunterbrechungen und verbessert bei einigen Patienten auch allgemein die Fähigkeit, länger durchschlafen zu können:
• Cannabis als Einschlafhilfe: THC

kann die Einschlafzeit verkürzen, insbesondere bei Menschen, die unter chronischen Schmerzen, Stress oder Angstzuständen leiden. Diese Wirkung macht es für einige Personen zu einem bevorzugten Mittel bei Schlaflosigkeit (Insomnie).
• Verstärkung des Tiefschlafs: Untersuchungen deuten darauf hin, dass THC den Anteil des Tiefschlafs an der gesamten Schlafzeit erhöhen kann, was für die Regeneration des Körpers und des Immunsystems wichtig ist.
Ob man Cannabis eher als Hilfe zum Einschlafen einsetzt oder doch als Mittel, um besser durchschlafen zu können, ist für die Wahl der richtigen Therapie nicht unerheblich. Ein Patient, der aufgrund innerer Unruhe oder anderer Gründe schwer einschlafen kann, dem wird vermutlich mit dem Einsatz einer inhalativen Darreichungsform von Cannabis leicht geholfen sein. Wenn es ums Durchschlafen geht, ist die Inhalation – egal ob durch einen Vaporizer oder auch einen Joint – nicht der ideale Weg, denn der Wirkungseintritt geschieht zwar schneller über die Lunge, dafür halten die Effekte aber nicht sonderlich lange an. Wer länger und tiefer schlafen möchte, wird tendenziell eher zu einer oralen Lösung, also essbarem
oder trinkbarem Cannabis, greifen. Hier tritt die Wirkung verzögert ein, hält dafür aber wesentlich länger an. Vielen Patienten hilft eine Kombination beider Anwendungen am besten – sie schlafen schnell ein und können dann einige Stunden ohne Unterbrechung durchschlafen.
Ungeachtet des im vorigen Absatz genannten Potenzials für die Verbesserung der Schlafqualität hat die Verwendung von Cannabis auch mögliche negative Auswirkungen auf den Schlaf. Manche davon hängen mit dem Gebrauch von Cannabis selbst zusammen, andere sind Folgen, die sich erst nach der Beendigung des Konsums zeigen:
• Beeinträchtigung des REMSchlafs: THC kann leider den REM-Schlaf nicht nur verlängern, sondern auch reduzieren. Dies bedeutet, dass die Phase, in der Träume auftreten und emotionale Erinnerungen verarbeitet werden, verkürzt wird. Langfristig kann dies den kognitiven und emotionalen Zustand negativ beeinflussen.
• Abhängigkeit und Entzug: Regelmäßiger Konsum von THC kann zu einer Toleranzentwicklung führen,

sodass mit der Zeit immer höhere Dosen notwendig werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Beim Absetzen kann es zu unangenehmen Zuständen kommen, die gern als Entzugserscheinungen genannt werden – darunter Schlafstörungen wie verstärkte Träume (REMRebound) und ein unruhiger Schlaf.
• Beeinträchtigung des natürlichen Schlafrhythmus: Langfristige Nut-
zung von THC könnte den zirkadianen Rhythmus stören – ein innerer Prozess, der die physiologischen Vorgänge im menschlichen Körper im gewohnten 24-Stunden-Rhythmus ausbalanciert und steuert. Außerdem kann die natürliche Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, beeinflusst werden.
Ob THC im Einzelfall nun kurzfristige oder nachhaltige Schlafstörungen auslösen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab – darunter die Dosierung, die Häufigkeit der Nutzung sowie die Verfassung und die individuelle Reaktion des jeweiligen Konsumenten. Während Tetrahydrocannabinol vielen Menschen kurzfristig beim Einschlafen helfen kann, zeigen Studien, dass chronischer oder hochdosierter Konsum ebenso auch mit einer schlechteren Schlafqualität und Problemen wie Schlaflosigkeit oder unruhigem Schlaf verbunden sein kann. Insbesondere bei abruptem Absetzen des Cannabiskonsums nach längeren Phasen des Gebrauchs treten häufiger Schlafstörungen auf. Dies wiederum birgt vor allem Risiken für diejenigen, die eine bestehende Schlafstörung in Selbstmedikation mit Cannabis behandeln. Während sich am Anfang zunächst das erleichterte Einschlafen bemerkbar macht – und vielleicht auch eine längere Schlafphase –, können im späteren Verlauf dann nicht selten auch die negativen Einflüsse von THC auf die Schlafqualität zutage treten und die ganze Symptomatik nachhaltig verschlechtern.
Wie wir also feststellen können, hat Cannabis das Potenzial, sowohl förderlich als auch hinderlich für den Schlaf und eine gute Schlafqualität zu sein. Während es meist kurzfristig beim Einschlafen helfen und auch den Tiefschlaf fördern kann, birgt es langfristig das Risiko von Störungen der REM-Schlafphase, von psychischer Abhängigkeit und sogar von nachhaltigem Schlafentzug. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen THC zur Verbesserung ihres Schlafs in Betracht ziehen, sollten dies mit Vorsicht tun und idealerweise vor einer Behandlung medizinischen Rat einholen und ihre Therapie von einem fachkundigen Mediziner begleiten lassen. Darüber hinaus ist in Zukunft eine weitere Erforschung der Zusammenhänge zwischen Cannabis und Schlaf notwendig, um die genauen Mechanismen zu verstehen, die die Interaktion zwischen den Substanzen und dem menschlichen Körper bestimmen. Dadurch kann der Einsatz von THC für die Schlaftherapie gezielter gewählt werden, was den Behandlungserfolg steigern und vor allem die Risiken und Nebenwirkungen auf ein Minimum reduzieren wird.
TEXT DAVID GLASER
Hanf ist wahrscheinlich eine der ältesten Nutzpflanzen, die der Mensch kultiviert. Seit Anbeginn der Kultivierung entwickelte der Mensch immer ausgeklügeltere Techniken, um bestimmte Eigenschaften der Pflanze zu optimieren. Waren es zunächst einfache Kreuzungen aus verschiedenen Sorten, folgten später F1-Hybride. Seit den 1980er-Jahren ist es mit zunehmender Entwicklung der Forschung möglich, gezielt in das Genom von Pflanzen einzugreifen und dieses punktuell zu ver-

ändern. Eine relativ neue und hocheffektive Vorgehensweise, mit relativ geringem Kostenaufwand sehr gezielt Änderungen im Genom vorzunehmen, ist CRISPR. Diese Methode wurde im Jahr 2012 von den beiden Forscherinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier entdeckt. 2020 erhielten sie für diese Entdeckung den Nobelpreis für Chemie.
Auch in der Cannabisindustrie beginnt CRISPR allmählich an Bedeutung zu gewinnen.
Funktionsweise
Die exakte Bezeichnung von CRISPR lautet CRISPR-Cas9. Die Abkürzung CRISPR kommt aus dem Englischen und steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, zu Deutsch: gruppierte palindromische Wiederholungen. Es geht also um Sequenzen in der DNA mit bestimmten Eigenschaften. Palindromisch bedeutet, dass ein Wort, sowohl von vorne als auch von hinten gelesen, die gleiche Bedeutung hat. Ein Beispiel hierfür wäre der Name „Anna“. Auch in der DNA gibt es Abschnitte, die, von beiden Seiten gelesen, den gleichen Wert ergeben. Die gesamte DNA besteht aus den vier Nukleinbasen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, welche mit ihren jeweiligen Anfangsbuchstaben abgekürzt werden. Man kann im Grunde die gesamte DNA und somit auch das Genom einer Hanfpflanze, aufgeschlüsselt in die vier Buchstaben, welche die Nukleinsäuren repräsentieren, darstellen. Eine Eigenschaft von DNA ist es nun, dass an Teilabschnitten davon ein komplementäres DNA-Stück, wie ein Stück von einem Puzzle, andocken kann. Voraussetzung ist, dass dieses DNA-Stück palindromisch ist. Möchte man zum Beispiel an einem DNA-Abschnitt mit der Codierung GAATTC andocken, muss das komplementäre DNA-Puzzlestück die Codierung CTTAAG haben. Das ist die Bedeutung der Abkürzung CRISPR. Entdeckt wurde dieser Mechanismus durch Beobachtungen an Bakterien. Wenn Bakterien von Viren angegriffen werden, dann verteidigen sich diese, indem sie mittels CRISPR ein DNA-Puzzlestück erzeugen, das an einer bestimmten Stelle in der Virus-RNA andocken kann. Zusätzlich wird mit einem bestimmten Enzym, welches den Namen Cas9 trägt, die RNA an dieser Stelle durchschnitten und das Virus dadurch bekämpft, weshalb Cas9 auch als Genschere bezeichnet wird. Versteht man diesen Ablauf im Detail, kann man diesen künstlich nachbauen und anstelle von Viren die DNA von beliebigen Zellen an bestimmten Stellen zerschneiden. Darüber hinaus kann man in die durchtrennte DNA neue DNA-Abschnitte einfügen. Man kann sich dies am besten vorstellen wie das Suchen und Ersetzen von Wörtern in einem Textbearbeitungsprogramm. Was die Technologie CRISPR-Cas9 also macht, ist eine Art Suchen und Ersetzen von bestimmten Abschnitten in der DNA. Das Prinzip lässt sich auf beliebige Zellen anwenden und somit auch auf das Genom von Hanf.

Potenziale für die Cannabisindustrie
CRISPR eröffnet die Möglichkeit, Hanfpflanzen in einer bisher nicht dagewesenen Weise zu verändern. Darüber hinaus ist diese Technologie wirtschaftlich interessant, da sie sehr kostengünstig und skalierbar ist. Frühere Technologien zum Eingriff in das Genom verursachten ein Vielfaches an Kosten und waren erheblich aufwändiger. Frühere Tech-
nologien zum Editieren des Genoms benötigten oftmals viele Versuche, bis das gewünschte Ergebnis erreicht war. CRISPR-Cas9 ist im Vergleich dazu in seiner Funktionsweise außerordentlich selektiv und zuverlässig. Ein klassischer Anwendungszweck wäre der Eingriff in die Cannabinoidproduktion, um seltene Cannabinoide in relevanter Menge von der Pflanze produzieren zu lassen. Viele Cannabinoide wie THCV oder CBE kom-
men nur in geringen Spuren vor. Mit CRISPR ist es möglich, in die DNA einen Abschnitt einzubauen, der die Produktion dieser Cannabinoide in größeren Mengen ermöglicht, sodass sich eine Extraktion lohnen würde. Dies wäre je nach Cannabinoid erheblich kostengünstiger als eine aufwendige Synthese. Auch in die Produktion von CBD und THC kann gezielt eingegriffen werden. Es ist möglich, den Abschnitt der DNA zu entfernen, der THC produziert. Auf diese Weise können Nutzhanfsorten gewonnen werden, die tatsächlich kein THC mehr enthalten. Das gesamte Profil an Cannabinoiden und Terpenen lässt sich mittels CRISPR anpassen. Mit dieser Technologie kann auch der Ertrag erheblich gesteigert werden, indem man gezielt in die Gene eingreift, die für das Wachstum zuständig sind. Es ist auch möglich, die Schädlingsresistenz zu verbessern und auf diese Weise den Einsatz von Pestiziden zu minimieren. Ein weiterer Vorteil kann die Standardisierung des Saatguts sein. Es ist möglich, mit dieser Methode eine ausgesprochen konsistente Qualität von Samen zu erhalten. Dies macht die Ernte sehr planbar und wirtschaftlich skalierbar. Im Grunde lässt sich mit CRISPR eine maßgeschneiderte Hanfpflanze erstellen, welche exakt die gewünschten Eigenschaften aufweist. Zu bedenken ist allerdings, dass diese
Technologie noch immer vergleichsweise neu ist. Langzeiterfahrungen fehlen aktuell noch, und ein Eingriff in das Genom ist immer als potenziell kritisch zu betrachten. Es ist nicht auszuschließen, dass Risiken auftreten, die bislang noch nicht entdeckt wurden.
Aktuell wird CRISPR bereits von einigen Unternehmen in der Hanfbranche genutzt. Einer dieser Pioniere ist das israelische Unternehmen CanBreed. In Zusammenarbeit mit der Fakultät für Landwirtschaft an der Hebräischen Universität wurden bereits mehrere Hanfsorten geschaffen, deren Genom mit dieser Technologie gezielt adaptiert wurde. CanBreed bietet Samen an, die eine gleichbleibende Qualität mit identischen Pflanzen garantieren. Zusätzlich ist es dem Unternehmen gelungen, in seine Hanfsorten eine Resistenz gegen Mehltau einzubauen. Mehltau ist eine häufige Pilzinfektion in Hanfkulturen, die mit Ernteausfällen einhergeht. Durch CRISPR kann eine vollständige Resistenz gegen diesen pathogenen Pilz erreicht werden. Auch das britische Unternehmen Precision Plants hat bereits erste genomeditierte Hanfsorten entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich vorwiegend auf Nutzhanf und bietet neuartige Sorten an, die identi-

sche Merkmale und einen hohen Ertrag garantieren. Das US-Unternehmen Ebbu setzt ebenfalls bereits CRISPR im kommerziellen Cannabisanbau ein. Das Unternehmen entwickelt Sorten mit einem spezifischen Cannabinoidprofil und identischen Merkmalen. Es ist außerdem gelungen, Hanfsorten zu züchten, die nur ein einziges Cannabinoid produzieren. Dies kann die Extraktion des jeweiligen Cannabinoids
vereinfachen und kostengünstiger gestalten, da weitere Trennverfahren im Extraktionsprozess eingespart werden können. Weltweit arbeiten derzeit mehrere Forschungseinrichtungen an der Entwicklung von Hanfsorten mit einem hohen Anteil an seltenen Cannabinoiden. Im Fokus stehen dabei vor allem THCV, CBC und CBG. Das sind sehr seltene Cannabinoide, die jedoch einen hohen medizinischen Nutzen aufweisen.
Mittels CRISPR-Cas9 können Hanfsorten entwickelt werden, die genau diese Cannabinoide in großer Menge produzieren. Im Fokus steht aktuell auch die Produktion von Sorten, die resistent gegen bestimmte Krankheitserreger sind. Vor allem das latente Hopfenvirus stellt im Hanfanbau ein Problem dar, welches mit konventionellen Mitteln nur schwierig eliminiert werden kann. Mittels CRISPR ist es Forschern bereits gelungen, Hanfsorten zu entwickeln, die gegen dieses Virus resistent sind.
Der Eingriff in das Genom von Pflanzen ist ein Thema, bei dem bislang kein einheitlicher rechtlicher Konsens gefunden wurde. Dementsprechend ist der Einsatz der neuen CRISPR-Cas9-Technologie in den jeweiligen Ländern unterschiedlich geregelt. Während in einigen Teilen der Welt Unternehmen bereits auf diese Weise veränderte Hanfpflanzen züchten, ist dies in Deutschland und Österreich aktuell noch nicht der Fall. Auch in den restlichen Ländern der EU spielt CRISPR-Cas9 in Hanfsorten aktuell noch keine Rolle. Es sind derzeit nur vereinzelte Kulturen mit anderen Nutzpflanzen angemeldet, bei denen diese Technologie versuchsweise zum Einsatz kommt. In der EU sind Pflanzen, die mittels CRISPR-Cas9 verändert wur-
den, rechtlich anderen Gentechnologien in der Landwirtschaft gleichgestellt. Eine der Ursachen, warum es explizit für CRISPR-Cas9 noch keine eigene Regelung gibt, ist die Tatsache, dass die Identifikation von Pflanzen, die mit dieser Technologie verändert wurden, schwierig ist. Während genetische Veränderungen durch ältere Technologien sicher nachgewiesen werden können, ist dies bei CRISPR-Cas9 nicht ohne Weiteres möglich. In manchen Ländern wie den USA wird nicht zwischen unveränderten und genomeditierten Pflanzen unterschieden. Auch Pflanzen, die mittels CRISPR-Cas9 verändert wurden, unterliegen dort keinen anderen rechtlichen Beschränkungen als natürlich gewachsene Pflanzen.


Ein unglaublich sympathisches und dynamisches VaterTochter-Gespann mit den Namen Leonie und Thomas Marisch bespricht in seinem Podcast alle erdenklichen Aspekte ganzheitlicher Gesundheit. Den Körper in Balance bringen und halten – insbesondere auch mit Hanf und Cannabidiol – darauf liegt der Fokus ihrer Gespräche. Dabei liefern sie neben wertvollen Tipps zum Nachmachen vor allem eine gute Atmosphäre und spürbare Leidenschaft für ihr Thema. Das wirkt motivierend und regt dazu an, besser in sich hineinzuhören.

Lars und Julian sind die Cannabis-Guides, die Dich durch den Podcast #hanffluencer führen.
Im Gespräch mit ihren Gästen liefern sie wertvollen Content – sowohl über grundsätzliche Themen rund um die Hanfpflanze, die die Zuhörer-Community beschäftigen, als auch über aktuelle Entwicklungen in der Politik und der Cannabisbranche. Mit ihrem Podcast möchten sie ihr Publikum gleichzeitig aufklären, informieren und unterhalten.

In erster Linie ist Vince & Weed für seine unterhaltsamen und lehrreichen YouTube-Videos bekannt, in denen er seiner Community Cannabis auf allen Ebenen näherbringt. Die Themen Dabbing und Terpene stehen dabei ebenso im Fokus wie der Anbau oder der medizinische Nutzen.
Sein YouTube-Video-Podcast ist auch auf Spotify abrufbar. Regelmäßig empfängt er dort Cannabis-Experten aus allen Bereichen und erörtert mit ihnen eine Vielzahl spannender Themen. Für die Community sind Vince und sein Podcast längst eine feste Institution – keine Episode sollte man verpassen.

Bei der Frage nach dem wertvollsten Podcast mit Cannabis-Bezug muss Sucht & Ordnung eigentlich ganz oben genannt werden. Roman Lemke beschäftigt sich hier zu einem großen Teil mit den ernsten Themen des Cannabis-Universums – auch mit jenen, bei denen andere gerne schweigen. Prävention, Safer Use und Konsumkompetenz vermittelt er wie kaum ein anderer. Ob im Gespräch mit Gästen oder allein mit seinen treuen Zuhörern – Sucht & Ordnung liefert der Community immer jede Menge Rat, Hilfestellung und Wissen. Besonders wird der Podcast durch Romans durchgehend authentische, persönliche und nahbare Art.

Der Verband der Cannabis-versorgenden Apotheken (VCA) betreibt einen eigenen Podcast, bei dem der medizinische Gebrauch von Cannabis klar im Vordergrund steht. In ihren Interviews gibt Apothekerin Dr. Christiane Neubauer, Geschäftsführerin des VCA, in erster Linie Patienten eine Stimme und lässt sie über ihre Erfahrungen berichten. Als Expertin im Themenbereich „Cannabis als Medizin“ lädt sie gelegentlich auch Mediziner oder Apotheker ein, um unterschiedliche Aspekte zu beleuchten.

Obwohl der Blütezeit Podcast gerade erst seit knapp einem Jahr besteht, konnte er sich bereits hervorragend in der Szene etablieren und mit starken Episoden ein stetig wachsendes Publikum überzeugen. Moderator Dirk Bartscherer hat in der kurzen Historie des Podcasts bereits zahlreiche hochkarätige Gäste – Künstler, Aktivisten oder Experten der Cannabisbranche – ans Mikrofon geholt. Mit ihnen bespricht er vor allem aktuelle Fragen und Themen, die im Zuge der CanG-Entkriminalisierung von Cannabis als Genussmittel aufkommen.





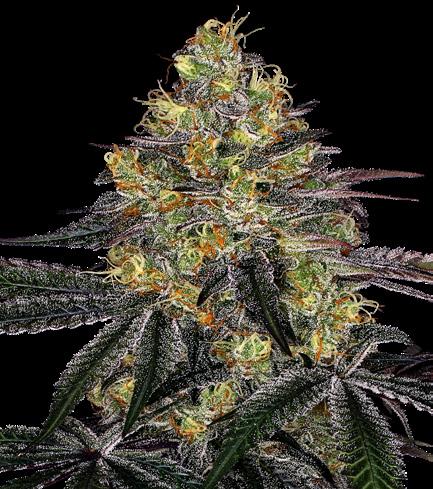














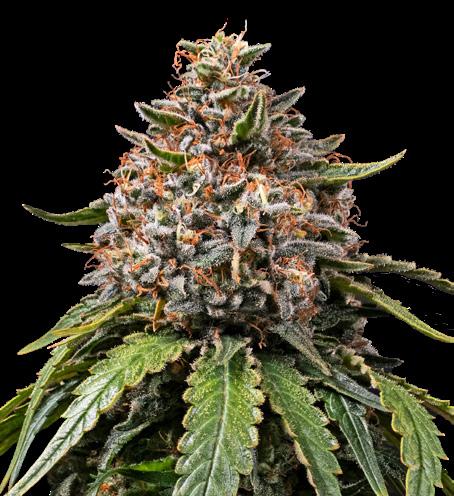





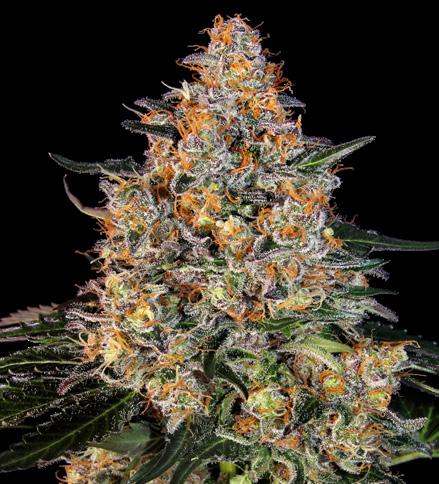















PRODUKTE • Vorstellungen

DAS HEMPIONS KOCHBUCH
HEMPIONS.COM
Die vier Hempions-Gründer Florian und Fabian Braitsch, Daniel Meier und Lukas Bitschnau haben gemeinsam mit Ernährungsberatern, Therapeuten und Spitzenköchen 50 vitale Hanfrezepte in einem ansprechend gestalteten Kochbuch zusammengetragen. Alle vier Autoren sind im Leistungssport zu Hause und beschäftigen sich intensiv mit gesunder Ernährung. Lecker, praktisch, nachhaltig, regional und gesund – nach diesen Prinzipien wurde das Hempions Kochbuch gestaltet. Es bietet alles, was man braucht, um Hanf unkompliziert in die eigene Küche zu integrieren.

PURAMED - 55% CBD VOLLSPEKTRUM PREMIUM PASTE IN BIO-KOKOSÖL
PURAMED.AT
Für die 55 % CBD-Vollspektrum-Premium-Paste in Bio-Kokosöl verwendet PuraMed ausschließlich Hanf von höchster Qualität. Dank eines besonders schonenden Extraktionsverfahrens bleiben das volle Spektrum an Cannabinoiden und Terpenen erhalten. Wer das Potenzial von CBD selbst erleben möchte, kann sich zur PuraMed-Selbststudie informieren: Über einen Zeitraum von 60 Tagen begleiten die Hersteller Teilnehmer bei der Anwendung der hochkonzentrierten CBD-Paste. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über die Teilnahmebedingungen direkt bei PuraMed zu informieren.

- HANF FLIPS
HEMPIONS.COM
Die Bio-Hanf-Flips von Hempions sind der ideale Snack für alle, die bewusst genießen wollen. Sie kombinieren hervorragenden Geschmack mit hochwertigen Nährstoffen aus Hanf und Linsen. Im Vergleich zu klassischen Kartoffelchips enthalten sie bis zu 50 % weniger Fett. Die Flips sind vegan sowie frei von Gluten und Laktose. Durch die Kombination pflanzlicher Proteine und Ballaststoffe sorgen sie für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Zudem liefern sie wertvolle Omega-3-Fettsäuren sowie wichtige Mineralstoffe wie Zink, Eisen und Magnesium – eine leckere Unterstützung für den Energiestoffwechsel.

Besonders in der Herbstzeit, wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, verlangt der Körper in der Regel wieder deftigere Nahrung als im Sommer, um sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Hier bietet sich die herzhafte und cremige Zwiebel-Speck-Suppe an, welche gemeinsam mit einer käsigen Parmesan-Espuma sowie herzhaftsüß karamellisierten Bacon-Splittern nicht nur den Körper, sondern auch die Selle erwärmt.
In unserem Rezept darf natürlich Hanf/Cannabis nicht fehlen, so haben wir die Suppe mit ein wenig nahrhaftem Hanfsamenöl verfeinert, welches ein wunderbares Ensemble in Kombination mit den fein-cremigen Zutaten des Gerichts eingeht.
Zur "Erwärmung der Seele" haben wir uns für ein wenig THC-Honig karamellisierten Bacon entschieden, um die Entspannung zu Hause nach einem dunklen Herbsttag zu fördern.

800 ML GEMÜSEBRÜHE
2 EL BUTTERSCHMALZ
1 KG ZWIEBELN
1–2 KNOBLAUCHZEHEN
250 G SPECK DURCHWACHSEN
1CL WEISSWEIN
400 SAHNE
ZUSÄTZLICH:
WEICHE BUTTER & MEHL 1:1
ETWAS MILDES HANFSAMENÖL ZUM
DEKORIEREN UND VERFEINERN
Für die Zubereitung der Suppe werden die Zwiebelwürfel in heißem Butterschmalz ausgelassen und glasig gedünstet, anschließend werden die Speckwürfel und die Schwarte hinzugegeben und ebenfalls gedünstet. Sobald der Speck sein Fett ausgelassen hat, das Ganze mit Weißwein ablöschen, mit Brühe und Sahne auffüllen, Knoblauch hinzugeben und bei geschlossenem Deckel bei geringer Hitze für mindestens 30 Minuten leicht köcheln lassen.
Anschließend wird die Suppe mit einem Pürierstab oder Mixer gründlich fein püriert und durch ein Sieb passiert. Um die Suppe ein wenig anzudicken, wird nun eine "Beurre manie" verwendet - ein Gemisch 1:1 aus weicher Butter und Mehl. Beides wird in einer Schale zusammen vermengt, bis eine glatte Paste entstanden ist. Zum Andicken wird jetzt schrittweise die Paste in die Suppe eingerührt. Da es meist einige Minuten dauert, bis das Mehl seine Bindekraft entfaltet, ist es ratsam, in langsamen Schritten und unter ständigem Rühren die Butter-Mehl-Paste einzuarbeiten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Da durch die Beurre manie die Geschmacksintensität der verwendeten Zutaten gemindert wird, sollte abschließend mit Salz und Pfeffer sowie gegebenenfalls etwas braunem Roh-Rohrzucker zur Vollendung abgeschmeckt werden.
Übrigens: für die Zubereitung der Beurre manie kann natürlich auch Canna-Butter verwendet werden. Hierbei sollte jedoch die Dosierung beachtet werden.

360 ML MILCH
200 G PARMESAN
120ML SAHNE
8 STREIFEN FRÜHSTÜCKSSPECK
CANNABINOID INFUNDIERTER HONIG

Zubereitung:
Für die Espuma die Milch zuerst vorsichtig erhitzen, den fein geriebenen Parmesan hinzugeben und ca. 20 Min. ziehen lassen. Anschließend die Sahne zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.Die Masse wird inzwischen durch ein feines Sieb in einen Siphon gefüllt, kräftig geschüttelt und kopfüber mit einer Sahnekapsel aufgeschraubt und nochmals kräftig geschüttelt. Die Espuma vor dem Servieren mindestens 6 Stunden im Kühlschrank kühlen.
Um den karamellisierten Bacon herzustellen, werden die Speckstreifen lang auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und mit etwas Honig bestrichen.
Für unser Rezept eignen sich sowohl CBD sowie THC Honig-Sorten aus dem (legalen) Fachhandel als auch eigens infundierter Honig.
Das Backblech wird anschließend in einen auf 200°c vorgeheizten Backofen gegeben und der Speck unter Beobachtung knusprig ausgebacken.
Zum Servieren haben wir die heiße Suppe mit einer Espuma-Haube versehen und mit etwas Hanfsamenöl sowie karamellisierten Bacon-Splittern garniert. Als Beigabe eignet sich helles Brot.

In den vergangenen Jahren hat sich der kulinarische Einsatz von Cannabinoiden wie CBD und THC zunehmender Beliebtheit erfreut. Diese natürlichen Verbindungen aus der Cannabispflanze bieten nicht nur gesundheitliche Potenziale, sondern können auch den Geschmack und die Aromen von Gerichten bereichern.
Dieses Rezept zeigt, wie CBD- und THC-Blüten in Kombination mit Lachs, Orange und Rosmarin zu einem besonderen Erlebnis für Gaumen und Körper werden können. Ergänzend wird auf die geeignete Dosierung sowie auf die Rolle von Fett als Träger eingegangen.
Warum eignet sich Lachs besonders gut für die Aufnahme von Cannabinoiden?
Lachs gehört zu den fettreichen Fischen, die besonders gut geeignet sind, Cannabinoide wie CBD und THC zu binden. Cannabinoide sind fettlöslich, das bedeutet, sie entfalten ihre Wirkung optimal in Kombination mit öl- oder fetthaltigen Trägern. Die hochwertigen Fette im Lachs unterstützen dabei die Aufnahme im Körper und tragen dazu bei, dass sowohl die geschmacklichen als auch die physiologischen Effekte der Cannabinoide besser zur Geltung kommen.
Decarboxylierung – der Schlüssel zur Aktivierung
Rohe Cannabisblüten enthalten hauptsächlich CBDa und THCa, also Vorstufen der bekannten aktiven Wirkstoffe. Um die gewünschten Effekte zu erzielen, ist eine Erhitzung notwendig, die sogenannte Decarboxylierung. Dabei werden durch moderate Temperaturen die Cannabinoidsäuren in ihre wirksamen Formen überführt.
Weshalb die Decarboxylierung entscheidend ist
THC entfaltet seine psychoaktive Wirkung erst nach der Umwandlung aus THCa. Ohne diesen Schritt bleibt es weitgehend wirkungslos. Auch CBD wird in der aktivierten Form besser vom Körper aufgenommen, obwohl es auch in seiner sauren Ursprungsform wohltuend sein kann.
2 LACHSFILETS MIT HAUT, JE ETWA 200 BIS
250 GRAMM
2 BIS 3 GRAMM DECARBOXYLIERTE CBDODER THC-BLÜTEN, ZERKLEINERT
1 BIO-ORANGE, SAFT UND ZESTEN
2 ZWEIGE FRISCHER ROSMARIN
2 ESSLÖFFEL GROBES BERGSALZ
1 ESSLÖFFEL BRAUNER ROH-ROHRZUCKER (OPTIONAL)
FRISCH GEMAHLENER SCHWARZER PFEFFER
OPTIONAL: ZWEI ZENTILITER GIN


Decarboxylierung: Zerkleinerte Blüten auf einem Backblech mit Backpapier bei 110 Grad für etwa 35 Minuten im Ofen erhitzen. Nach dem Abkühlen fein hacken oder zwischen den Fingern zerreiben.
Beizmischung herstellen: In einer Schüssel das Salz mit Zucker, Orangenzesten, Orangensaft und Pfeffer vermengen. Rosmarin fein hacken und hinzugeben. Die decarboxylierten Blüten ebenfalls einarbeiten. Wer möchte, ergänzt die Mischung um etwas Gin, um Aromen zu verstärken und die Fettlöslichkeit der Cannabinoide weiter zu unterstützen.
Lachs beizen: Die Lachsfilets in eine flache Form legen und die Mischung gleichmäßig auf der Haut- und Fleischseite verteilen. Sanft andrücken, damit alles gut haftet. Luftdicht abdecken und für mindestens zwölf, idealerweise bis zu vierundzwanzig Stunden im Kühlschrank beizen lassen.
Nach der Beizzeit: Den Lachs aus der Beize nehmen und die Oberfläche vorsichtig mit kaltem Wasser oder trockenem Küchenpapier abwischen, um überschüssiges Salz, Kräuter und Blütenreste zu entfernen. Danach trocken tupfen und in sehr feine Scheiben schneiden.
Servieren: Gebeizter Lachs wird roh genossen – zum Beispiel als Carpaccio, Graved Lachs oder auf Brot. Eine Hitzebehandlung ist nicht vorgesehen, um die Textur zu bewahren und die Cannabinoide nicht zu zerstören.
Garnitur: Dill, Rosmarin und feine Orangenscheiben ergänzen das Gericht optisch und geschmacklich. Ein Spritzer Zitrone sorgt für Frische.
Dosierung von CBD und THC: Die Menge der verwendeten CBDoder THC-Blüten richtet sich nach der gewünschten Wirkung, der Potenz der Blüten und dem persönlichen Umgang mit Cannabinoiden. Im Allgemeinen gilt: CBD wirkt entspannend und ist nicht psychoaktiv. THC kann psychoaktiv wirken und sollte eher niedrig dosiert werden. Da ein Filet meist in Scheiben serviert wird, empfiehlt es sich, die Gesamtmenge an Blüten an der Portionsgröße auszurichten.

Beispiel: Ein Filet ergibt ca. 10 bis 15 Scheiben. Verwendet man 1 g THC-haltige Blüten (10 Prozent THC), ergibt das rund 100 mg THC auf das Filet.Pro Scheibe wären das 6 bis 10 mg. Bei 3 bis 5 Scheiben pro Portion liegt die Dosis bei etwa 20 bis 35 mg THC – für Unerfahrene eventuell zu stark. Für CBD kann die gleiche oder sogar eine höhere Menge problemlos verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit: Gebeizter Lachs sollte nach dem Beizen gut verpackt im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von drei Tagen verzehrt werden. Für längere Haltbarkeit kann er auch vakuumiert und eingefroren werden – idealerweise in dünn geschnittenen Portionen.
Die Wahl der Zutaten – Wildfang trifft auf organisch
In einem so anspruchsvollen Rezept wie diesem sind die Zutaten von entscheidender Bedeutung. Für ein authentisches und geschmacklich perfektes Ergebnis empfiehlt es sich, auf Wildlachs aus freien Gewässern zurückzugreifen. Dieser Lachs, der in seinem natürlichen Lebensraum heranwächst, hat nicht nur einen

intensiveren Geschmack, sondern enthält auch hochwertige Fette, die die Cannabinoide optimal aufnehmen und transportieren. Weiterhin ist er in der Regel weniger belastet und nachhaltiger in der Aufzucht.
Das Gleiche gilt für das Cannabis: Biologisch angebautes Cannabis sorgt dafür, dass du auf unnötige Chemikalien wie Pestizide, Herbizide oder Ähnliches verzichten kannst. Es verleiht dem Gericht ein pures, intensives Aroma und garantiert eine authentische Geschmackserfahrung.
So entsteht ein faszinierendes Spannungsverhältnis zwischen dem wild lebenden, natürlichen Lachs und dem sorgfältig kultivierten, organischen Cannabis – zwei Zutaten, die aus gegensätzlichen Ursprüngen stammen, sich jedoch in diesem Rezept zu einer harmonischen, sinnlichen Einheit verbinden. Ein perfektes Zusammenspiel aus Natur, Qualität und Geschmack.
Cannabinoid-gebeizter Lachs vereint kulinarische Raffinesse mit funktionalem Mehrwert. Durch den gezielten Einsatz von decarboxylierten CBD- und THC-Blüten sowie hochwertigen Zutaten entsteht ein Gericht, das sowohl geschmacklich überzeugt als auch bewusst eingesetzt werden kann. Die Kombination aus Fett, natürlichen Aromen und aktiven Pflanzenstoffen ermöglicht ein genussvolles und zugleich wirksames Erlebnis.
Wir möchten eine einfache Variante zeigen, wie man herzhafte, infundierte SnackNüsse selbst herstellen kann. Diese Version ist sehr einfach in der Anwendung und bedarf keiner aufwendigen Vorbereitungen. Hierbei wird den Nüssen in der Zubereitung einfach das fein gemahlene Blütencannabis als Gewürz mit unter die Ummantelung gemengt.
Um ein feines Mehl zu erhalten, welches sich gleichmäßig mit den anderen Kräutern um die Nüsse legt, sollte das verwendete Pflanzenmaterial sehr trocken sein. Hier eignen sich sogenannte "Sugar Leafs", die Trichome-behafteten kleinen Blätter direkt an der Blüte, welche beim "Trimmen" meist separiert werden, hervorragend. Eine vorherige Decarboxylierung des Materials ist in diesem Fall nicht zwingend notwendig, da der Röstvorgang der Nüsse diesen Schritt übernimmt.
Wer absolut sichergehen möchte, kann sein Cannabis natürlich vorweg aktivieren, was jedoch den Erhalt von Flavonoiden und Terpenen merklich reduziert. Die Wahl der Nüsse sowohl als auch die Wahl der verwendeten Kräuter und Gewürze liegt hier vollkommen frei nach eigenem Belieben.
Wir haben uns für eine mediterrane Erdnuss-Mischung entschieden, da die Vielzahl der verwendeten Kräuter eine wunderbare Kombination mit nahezu sämtlichen Cannabissorten eingeht und ein vollmundiges und ausgewogenes Gesamtaroma ergeben. Für eine grobe Berechnung der Dosierung ist es ratsam, das verwendete Cannabismaterial abzuwiegen.
Hier eine grobe Beispielrechnung zur Orientierung:
Der Prozentsatz des Cannabinoid-Gehalts (z. B. THC) wird einfach um eine Null nach rechts verschoben, um den Milligramm-Anteil pro Gramm Blütenmaterial zu berechnen. Verwendet man beispielsweise 2 g Cannabis mit einem THC-Gehalt von 21 %, ergibt das 420 mg THC in den 2 g Cannabis. Wenn man dieses Cannabis dann mit 400 g Nüssen vermischt, ergibt das schätzungsweise 420 mg THC auf 400 g Nüsse oder 105 mg THC auf 100 g Nüsse. Schwankungen durch unterschiedliche Materialqualitäten, Verarbeitung und Verteilung müssen selbstverständlich berücksichtigt werden

400 G ERDNÜSSE BLANCHIERT
1 EIWEISS
1–2 EL OLIVENÖL
1 TL KNOBLAUCHPULVER
1 TL ZWIEBELPULVER
1 TL GETROCKNETER THYMIAN
1 TL FEIN GEMAHLENES CANNABIS (VORZUGSWEISE BLÜTEN ODER FEINTRIMM)
1 TL GETROCKNETER OREGANO
1⁄2 TL ROSMARIN (OPTIONAL, JE NACH VORLIEBE)
1⁄2 TL PAPRIKAPULVER (OPTIONAL, GERÄUCHERT FÜR EXTRA GESCHMACK)
1⁄4 TL SALZ (NACH GESCHMACK, FALLS ES NICHT GANZ SALZFREI SEIN SOLL)
1⁄4 TL SCHWARZER PFEFFER (OPTIONAL)
1 EL ZITRONENSAFT (FÜR EINEN FRISCHEN KICK)


Vorbereitung der Erdnüsse
Blanchierte Erdnüsse werden zuerst vorgeröstet, indem sie bei 180 °C im Ofen für etwa 10–15 Minuten geröstet werden, bis sie leicht goldbraun sind. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Nüsse nicht verbrennen. Hierzu sollten sie alle 5 Minuten durchmischt und gewendet werden, damit sie gleichmäßig rösten. Wer bereits geröstete Erdnüsse hat, überspringt diesen Schritt.
Nun wird die Eiweißmischung vorbereitet. Dazu wird das Eiklar in einer Schüssel leicht aufgeschlagen, jedoch nicht steif. Anschließend wird das Olivenöl hinzugefügt und ebenfalls gleichmäßig untergeschlagen.
Die Kräuter und Gewürze werden inzwischen miteinander vermengt, gröbere Zutaten werden am besten mit einem Mörser oder mit einem mechanischen Multizerkleinerer zu feinem Mehl verarbeitet.
Die abgekühlten Erdnüsse werden jetzt mit dem Eiweiß vermischt, bis alle ummantelt sind, anschließend mit der Gewürzmischung bestreut und ebenfalls durchmengt, bis alle Nüsse gleichmäßig mit der Würzmischung umhüllt sind.
Man kann auch einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen, um das Ganze frischer zu machen.
Die gewürzten Erdnüsse werden inzwischen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilt und im vorgeheizten Ofen bei 160 °C für ca. 15–20 Minuten gebacken, bis sie knusprig und goldbraun sind. Dabei ist darauf zu achten, die Nüsse regelmäßig zu rühren und zu wenden, damit sie gleichmäßig rösten und nicht verbrennen.
Anschließend werden die Nüsse flach ausbreiten und auskühlen lassen. So werden die Nüsse noch knuspriger. Nach dem Auskühlen können die infundierten Erdnüsse in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden.

Mit einem Abo verpasst du keine Ausgabe des Hanf Magazins. Du erhältst 2 Ausgaben pro Jahr direkt zu dir nach Hause.
JAHRESABONNEMENT:
Preise: 30,00 € (DE, AT), 45,00 € (CH)
Medizin
Nutzhanf Politik & Recht Wirtschaft
AUSLAGESTELLEN: gratis erhältlich bei diversen Auslagestellen siehe: auslagestellen.hanf-magazin.com
NACHBESTELLUNGEN VON ÄLTEREN AUSGABEN: auf shop.hanf-magazin.com - Einzelheft 15,00 € (zzgl. Versandkosten) - Magazinbundle ab 36,00 € (zzgl. Versandkosten)
VERLAG & HERAUSGEBER
HANF MAGAZIN c/o Whole AG Lauriedhofweg 1 CH-6300 Zug
LEITUNG Lucas Nestler
ANZEIGEN Lucas Nestler/ info@hanf-magazin.com
LAYOUT & SATZ Julia Nestler
REDAKTION & GASTAUTOREN DIESER AUSGABE
Anastasia Avramchuck, David Glaser, Dieter Klaus Glasmann, Peter Leis, Heike Leonhardt, André Schneider, Shabnam Sarshar, u. v. m. TEXT SHABNAM SARSHAR
Für unverlangt eingesandtes und nicht mit einem Urhebervermerk gekennzeichnetes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Vervielfältigung, Speicherung sowie Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages. Gerichtsstand ist Zug. Die theoretischen Inhalte oder Berichte wahrer Begebenheiten sind keine Anleitung oder Aufforderung zu Straftaten und sollen nicht als diese verstanden werden. Einige Details wie Namen und Orte können zum Schutz der Personen verfälscht werden, um journalistisch arbeiten zu können. Jeder Redakteur vertritt seine eigene Meinung.

























STONER ADVENTSKALENDER
Freue dich auf tägliche Stoner Essentials und erweitere deine Sammlung mit nützlichem Zubehör.





HANF-ADVENTSKALENDER.COM








Verwöhne dich täglich mit neuen Beauty- & Pflegeprodukten aus Hanf & CBD für deine Wellness-Routine.

ADVENTSKALENDER
Entdecke täglich eine leckere hanfbasierte Köstlichkeit und erlebe die Vielfalt der Hanflebensmittel.

ADVENTSKALENDER
Essentials, die dir
Anbauprojekt helfen.

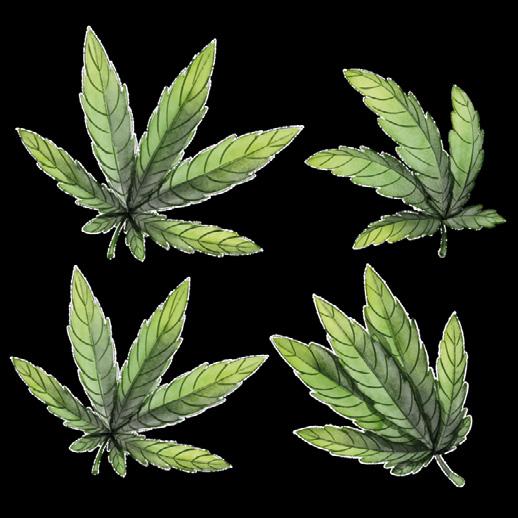
HANF ADVENTSKALENDER - DAS ORIGINAL
Erlebe jeden Tag eine neue Überraschung aus einer großen Palette von hochwertigen Hanf& CBD-Produkten.


CBD ADVENTSKALENDER
Genieße jeden Tag eine neue CBD-Überraschung und fördere dein Wohlbefinden mit hochwertigen Produkten.
