FALTER
Nr. 27a/25

Nr. 27a/25
Fahren. Parken. Reisen. Forschen.

Wie wir die Verkehrswende scha en und was uns dabei bremst
Reportagen: Das blaue Entsiegelungswunder von Wels +++ Zu Besuch in der Fahrrad-Hauptstadt Europas
Meinung: Wo Patriarchat und Mobilität kollidieren +++ Braucht es ein Auto in der Stadt?
Pionier-Porträts: Hermann Knoflacher +++ Pedi-Bus Währing +++ Christoph Schwarz +++ Poxrucker Sisters Tipps: Zugreisen +++ Bücher +++ Dokumentarfilme
Jetzt FALTER abonnieren inklusive Hängematte von Ticket to the Moon aus besonders leichter Fallschirmseide. Ab € 180,–






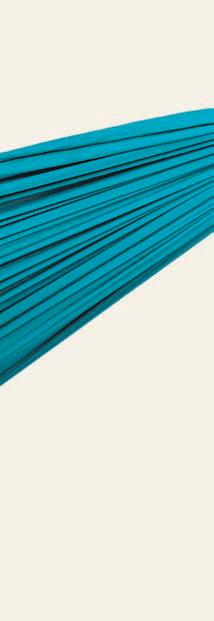
abo.falter.at
Sie haben bereits ein Abo: Hängematte um € 65,–
FAHREN
5 Porträt: Peter und Jakob Kühnberger, Grätzllabor Währing
6 Essay: Wo und wieso die Verkehrswende stockt – und was das mit dem Patriarchat zu tun hat
10 Infografik: Tempolimits für Anfänger
12 Der Kabare ist Berni Wagner über drei seltene Straßen-Spezies
14 Wieso kaufen alle (Wiener) einen SUV?
PARKEN
19 Porträt: Klimaaktivist und Künstler Christoph Schwarz
20 Das blaue Entsiegelungswunder von Wels
23 Der ewige Streit um den Wiener Gürtel
24 Zum 85er: Begegnung mit dem Verkehrsplaner Hermann Knoflacher
REISEN
27 Porträt: Poxrucker Sisters, Dialektpop-Trio
28 Zu Besuch in Europas Rad-Hauptstadt Kopenhagen
31 Platzt der Traum vom grünen Fliegen?
32 Der Viel-Zugfahrer und Autor Othmar Pruckner im Interview
FORSCHEN
35 Porträt: Cornelia Dlabaja, Stadtforscherin
36 Stanz: Das gallische Dorf Österreichs
40 Die kühnsten Mobilitätsutopien und was aus ihnen wurde
42 Das Grüne Band oder: Wieso Arten wandern müssen
44 Mobilitätsbücher und Dokus
46 Pro/Contra: Braucht es in Wien ein eigenes Auto?

Irgendwo zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt steckt die Verkehrswende fest. Was tun?

Zugreisen sind mühsam, teuer und kompliziert? Nicht unbedingt, meint der Autor Othmar Pruckner
Auf den Straßen des Landes kommt alles zusammen: Die Bevölkerung teilt sich in verfeindete Gruppen von Radfahrern, Autofans und überzeugten Zufußgehern. Straßenbauprojekte, die neue Stadtteile erschließen sollen, stoßen auf Unmut und Widerstand. Für Parkplätze, Wege und Einfamilienhäuser (samt Garage, versteht sich) versiegeln wir munter weiter, als gäbe es unendlich viele Hektar fruchtbaren Bodens. Und der Verkehrssektor ist immer noch das Sorgenkind in der österreichischen Klimabilanz.
Für dieses nun dritte Klimamagazin haben wir uns deshalb eine Frage gestellt: Wie kommen wir
26 18 34
IMPRESSUM

Wieso der Künstler Christoph Schwarz mitten in Wien sein „Cabriobeet“ parkt.

Bis 2007 galt die Wildkatze in Österreich als ausgestorben. Weil sie wandern kann, ist sie zurück.
da raus? Wo sind die vielversprechenden, Hoffnung machenden oder einfach nur schönen Projekte im Land? Die Entsiegler, Aktivistinnen, Forscher, Zugfahrerinnen? Die Zufußgeher, Pionierinnen und Aussteiger? Sie lesen auf den nächsten 48 Seiten eine Fülle an Antworten auf die Frage, wie wir die Verkehrswende stemmen können – und wo es noch hakt. Und das in verschiedenen Formaten. Um eine Auswahl zu geben: Mein Kollege Jürgen Klatzer hat sich zum Beispiel angesehen, wie tief Tempolimits in unserer Gesellscha verankert sind, Antonia Zeiss hat die Zahlen und Fakten illust-
riert (so wie darüber hinaus noch mehr in diesem He ). Gerlinde Pölsler berichtet von der Stanz, wo sich die Bewohner gegen die Landflucht wehren. Anna Goldenberg hat Innovationen auf den Prüfstand gestellt. Der freie Autor Ralf Waldhart war in Wels, um das größte Entsiegelungsprojekt Österreichs zu begleiten. Und unser Fotograf Christopher Mavrič hat wie jedes Jahr vier Vorreiterinnen und Vorreiter abgelichtet.
Wir hoffen, dass Sie Inspiration und Reiselust finden – um den Straßenkampf kurz zu vergessen.
FALTER Zeitschri für Kultur und Politik. 48. Jahrgang. Aboservice: T: +43-1-536 60-928, E: service@falter.at, www.falter.at/abo Herausgeber: Armin Thurnher Medieninhaber: Falter Zeitschri en Gesellscha m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, T: +43-1-536 60-0, F: +43-1-536 60-912, E: wienzeit@falter.at Chefredakteur: Florian Klenk Redaktion: Katharina Kropshofer Herstellung: Falter Verlagsgesellscha m.b.H. GRAFIK: Barbara Blaha, Dirk Merbach KORREKTUR: Regina Danek, Helmut Gutbrunner Geschä sführung: Siegmar Schlager Finanz: Claudia Zeitler Marketing: Barbara Prem Leitung Sales: Ramona Metzler (kar.), Sheila Martel, Christian Fabi Abwicklung: Jana Buchner, Oliver Pissnigg Vertrieb: PGV, St. Leonharder Straße 10, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt 1011 Wien Homepage: www.falter.at. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,
7 MILLIARDEN EURO: So hohe Investitionen wären laut einer Grundlagenstudie von Bund und Ländern aus dem Jahr 2022 nötig, um den Radverkehr in Österreich zu verdoppeln und somit auf 14 Prozent im Modal Split zu bringen (der Anteil des Rad- am Gesamtverkehr). Laut einem Bericht des Klimaministeriums aus dem Jahr 2024 liegt dieser österreichweit bei circa sieben Prozent.
Verkehrsanteil der Fahrräder: 7%
128.000 Kilometer So lang ist Österreichs Straßennetz. Es ist somit um zwei Drittel länger als jenes in der ähnlich großen Schweiz. Die Klimakrise macht vor ihm nicht halt: In den vergangenen Jahren haben sich die Kosten für Reparaturen aufgrund von Muren, Hochwasser und Stürmen verdreifacht.
820.000
Wiener ÖffiJahreskarten
700.000
Autos in Wien
DEN ZWEITEN PLATZ belegt Wien in einer europaweiten Umfrage zur Qualität des Öffi-Netzes. Geschlagen wird die Stadt nur von London. 820.000 Öffi-Jahreskarten gibt es hier – im Vergleich zu 700.000 Autos.
Wer blockiert die Verkehrswende?•Tempolimits für Anfänger•Wagners Staßenkunde•Die SUV-Falle
DAS EUROPÄISCHE REH (CAPREOLUS CAPREOLUS)
„Ihr Menschen müsst euch mehr anstrengen!“
TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ
W as glauben Sie, wie viele Wildtiere werden in Österreich jährlich durch den motorisierten Straßenverkehr getötet? Das Kuratorium für Verkehrssicherheit erhebt diese Zahlen, spricht aber lieber von Unfällen und Fallwild. Kollidiert ein Auto mit nur 50 km/h mit einem 80 Kilo schweren Wildtier, dann wirkt ein Aufprallgewicht von zwei Tonnen. Auf den Fahrer. Und wir Rehe fallen einfach um. Ein Unfall eben, was soll man denn machen, wenn Menschen nachts mit 100 km/h durch die Lebensräume anderer Lebewesen bolzen? Sich noch ein größeres SUV zulegen? Deswegen gab es in der letzten (Jagd-)Saison auch fast 70.000 gefallene Wildtiere, 40.000 davon waren Rehe. Offiziell, denn weniger als zwei Prozent der Wildunfälle werden registriert. Läu einem eine Katze vor die Stoßstange oder knallt einem eine Meise an die Windschutzscheibe, gilt die Delle nur als Bagatelle und wird gar nicht erst erhoben. Dabei ist der Straßenverkehr für manche Tierarten wie Luchs, Dachs oder Feldhase die häufigste
Todesursache und für mehr als 50 Prozent der Gesamtsterblichkeit verantwortlich. Mehr als 39 Prozent aller auf der Straße getöteten Wildtiere verendeten in Niederösterreich, dem weiten Land, in dem fast 1,3 Millionen erwachsene Menschen mehr als 600.000 Pkw besitzen. Sehr aufschlussreich ist auch die Begründung dafür: Landesjägermeister Josef Pröll erklärt die Zahlen damit, dass Wildtiere, um Futter zu finden, sehr viele Straßen queren müssen und naturnahe Lebensräume öfters als in anderen Bundesländern von Verkehrswegen zerschnitten werden.
Diese Analyse überrascht uns nicht. Ja, durch Straßenbau werden fruchtbare Böden versiegelt, der motorisierte Individualverkehr attraktiv gehalten und der bislang schon hohe Anteil von 60,6 Prozent an den gesamten CO₂-Emissionen weiter erhöht. Falls ihr Menschen weiterhin als intelligenteste Lebewesen dieses Planeten gelten wollt, dann müsst ihr euch schon etwas mehr anstrengen! F

Jakob und Peter Kühnberger
LA21.wien, Grätzllabor und Initiatoren des „Pedibus“ Was macht einen guten Bus aus? Natürlich viele Füße – zumindest, wenn ein „Pedibus“ gemeint ist. Dieser „fährt“ momentan in Wien-Währing, dort bald auf 13 „Linien“. Das Ziel: rechtzeitig, gemeinsam und zu Fuß in der Schule anzukommen. Peter und Jakob Kühnberger – Vater und Sohn – haben mit Währingern im „Grätzllabor“ schon viele Projekte ausgetüftelt. 2024 unterstützten sie den Pedibus zunächst an drei Volksschulen.
Ab Herbst sollen es vier sein: Beim Elternabend stecken sie dann Pinnnadeln auf einen Stadtplan, verbinden diese mit Wollfäden – und suchen so nach den besten und vor allem sichersten Routen. Sechs bis zwölf Wochen gehen die Eltern den Weg dann gemeinsam mit ihren Schützlingen, je nachdem, wie viele Kreuzungen und Hindernisse es zu überwinden gilt. „Die ,Busfahrer‘ wechseln sich ab“, sagt Peter Kühnberger – so haben die Eltern „freie Tage“. Irgendwann können die Kinder alleine „fahren“ – „und haben viel Freude daran“.
Auf Wiens Straßen herrscht ein ungleiches Krä ezerren zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern. Die Verkehrswende hingegen scheint festzustecken. Woran liegt das? Und vor allem: Wie kommen wir da raus?
ESSAY: KATHARINA KROPSHOFER
D as Herz schlägt mir immer noch bis zum Hals. Gerade habe ich mein Fahrrad vor dem Büro abgesperrt, taumle wütend und zugleich geschockt die Stiegen hinauf. Nur wenige Minuten zuvor hat mich ein Autofahrer fast umgebracht. Es war kein Versehen, keine Unaufmerksamkeit. Es war diese alltägliche, fast banale Absicht, die ich und viele andere Fahrradfahrerinnen in Wien nur zu gut kennen.
Jeden Tag passiere ich diese Kreuzung: Der Radweg führt zuerst über eine autobreite Spur, die sich Busse, Taxis und die morgendliche Fahrrad-Herde teilen. Am Ende der Burggasse zwackt die Spur nur noch einen schmalen Streifen ab, um schließlich – und hier kommt der gefährliche Part – ganz abzubrechen. Die Straßenzeichen zeigen den Radlern an, sie mögen sich vor den Autos positionieren und so die Poleposition für den Straßenkampf einnehmen: Denn nun sind die ausgleichenden Krä e aufgehoben. Dort, wo der Weg zur dreispurigen Straße wird, wo die einen rechts am Museumsquartier vorbei den Getreidemarkt runterfahren, andere links Richtung Norden abbiegen und viele so wie ich geradeaus zum vergleichsweise ruhigen Ring wollen. „Du scheiß Fotze“, höre ich zu meiner Linken, als ich genau diese Geradeaus-Spur wähle, die nun kein Fahrradweg mehr ist. „Fahr nach rechts, auf die Seite“, schreit mir ein Taxifahrer entgegen und gestikuliert wild. Ich will ruhig bleiben, deute nur auf den Pfeil am Boden, der nach vorne zeigt, doch ahne spätestens dann Böses, als der SUV mit nur wenigen Zentimetern Abstand an mir vorbeizischt, meinen Ellbogen leicht strei .
Ich fahre weiter, will rechts an ihm vorbei. Doch den gut tätowierten Fahrer im Muskel-Shirt hat die „Road Rage“ gepackt: Er steuert sein Auto zur Seite, schneidet mir wiederholt den Weg ab, sodass ich nur knapp abbremsen kann. Ich erspare Ihnen den Wortwechsel, den sein heruntergekurbeltes Fenster anregt.
Später, als sich der Schock gelegt hat und nur noch Wut und Unverständnis überbleiben, weiß ich eines: Irgendwo hier, zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt, steckt die Verkehrswende fest. Während die Industrie immer mehr auf grüne Technologien setzt, der Strom schon großteils aus erneuerbaren Quellen kommt, ist der Verkehrssektor der einzige, dessen Emissionen seit 1990 gestiegen sind. Die Steiermark hat
den Lu hunderter großteils wieder abgeschafft, das EU-Parlament diskutiert über ein Aus des Verbrenner-Aus und die österreichische Regierung streicht Förderungen für E-Autos, während sie Teile der Pendlerpauschale erhöht.
Auch wenn in Wien die Anzahl der Radwege wächst, der U-Bahn-Ausbau und die Nachtzug-Vorherrscha stolz machen, baut Österreich weiterhin mehr Straßenkilometer als Schienen. Mit entsprechenden Opfern: 2024 wurden österreichweit immer noch knapp 10.000 Menschen bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt. Vor allem die Zahl der Schwerverletzten stieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 32 Menschen starben. Die überwältigende Mehrheit der Zusammenstöße passierte nicht auf abgetrennten Radwegen, sondern auf Straßen, auf denen verschiedene Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen.
Wie also sollen wir die Verkehrswende schaffen, wenn weiterhin Straßenkampf herrscht, jede Verkehrsmittelwahl so eng an Identität geknüp ist? Wie will Österreich bis 2040 und die EU bis 2050 klimaneutral sein, wie die Stadt Wien es schaffen, dass bis 2030 ganze 85 Prozent aller Wege per Rad, Öffis oder zu Fuß zurückgelegt werden?
Rrrrrrrumm. „Früher hä e ich den Kopf gedreht und mir gedacht: Urleiwand“, sagt Bojan Jovanovic. „Aber heute denke ich mir: Wie peinlich!“ Der Wiener sitzt in einem italienischen Café im ersten Bezirk und überkreuzt entspannt die Beine, als ein Fahrer in einem aufgemotzten Wagen für ein paar Meter Gas gibt. Früher. Damit meint Jovanovic die Zeit, als er noch Motorradrennen und Rallyes gefahren ist („der unfairste Sport des Planeten“), für die Zeitschri Der Reitwagen geschrieben und jede freie Minute in dieser Welt verbracht hat. Als seine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Wien-Liesing zog, fand der Vater schnell einen Job beim dortigen Porsche-Händler. Jovanovic wuchs sogar in der Porschestraße auf, machte die HTL für Kra fahrzeugtechnik, später begann er Alufelgen zu designen. Ein Leben für den Verbrenner. Heute ist sein Leben in ein „Davor“ und ein „Danach“ geteilt. Die Transformation begann, als ihn ein alter Freund wieder an seine Leidenscha fürs Radfahren erinner-
Fortsetzung nächste Seite
Das Auto ist zur Normativität geworden, der alles untergeordnet wird, meinen Fachleute. Wer per Fahrrad, Öffis oder zu Fuß unterwegs ist, weicht so vom Status quo ab



te. Sie setzte sich fort, als Jovanovic vor sechs Jahren nach Indien fuhr, sich auf die Suche nach sich selbst und nach Entschleunigung begab – und ihm der „Wahnsinn des Individualverkehrs“ bewusst wurde. Als er dann zurück in seiner schnellen Welt war, kam er mit dieser nicht mehr klar.
Nach 30 Jahren Unterbrechung fährt Jovanovic nun Fixie, also ein Fahrrad mit starrem Gang, hat seine Leidenscha für starke Motoren auf zwei dünne Räder und schmale Sättel umgelenkt. 10.000 Kilometer legt er darauf in den besten Jahren zurück, reist per Rad über die Dolomiten oder entlang des Eisernen Vorhangs. Vor vier Jahren hat er sein letztes Auto verkau . Der Weg zu dieser Entscheidung war kein leichter, der Abschied selbst eine Bagatelle. Seine Geschichte ist vielleicht kein Klassiker, keine Anleitung für einen Umstieg. Und doch erzählt sie viel über unsere motorfixierte Gesellscha . Für Jovanovic war es die Selbstverständlichkeit, mit der das Auto sein Leben dominierte. „Ich kann die Faszination verstehen“, sagt er. „Aber am Ende schränkt einen diese vermeintliche Freiheit nur ein.“ Vielleicht wirkt es schneller, günstiger, praktischer (und manchmal ist es das auch), mit dem Kombi von A nach B zu fahren. Doch viele Kosten bleiben versteckt: Services, Versicherungen, Parkpickerl, CO2-Steuer.

steuerliche Begünstigung für Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen auch privat nutzen dürfen) verzichten. So rechnet es das Wifo vor.

cars ein Standardspielzeug sind – und wie bitte heißen die absurden elektrischen Miniautos, mit denen Kleinkinder über die Donauinsel rattern?
Diese Normativität geht so weit, dass ein Abbau von Parkplätzen als Freiheitsentzug erlebt wird, und kaum eine Maßnahme laut Umfragen für so viel Unmut sorgt wie die Forderung nach mehr Tempolimits (auch wenn dies der einfachste Weg wäre, um Emissionen einzusparen, siehe Seite 10). Kein Wunder also, dass sich der Taxifahrer mit seinem fetten SUV aufregte, als ich mit meinem zarten Blechesel seinen Weg blockierte.
Doch die Welt der PS und Zylinder, der Schnellstraßen und Parkhäuser zeigt sich noch auf einer anderen Ebene: Autofahren befriedigt viele Sinne. Das Rumoren, der Geruch, das Vibrieren zwischen oder unter den Beinen. Besonders Männer spricht das wohl an. Das beschreibt der deutsche Autor Boris von Heesen in seinem Buch „Mann am Steuer. Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert“. Tempo, Größe, Status, Leistung: Autos sind eng mit einem gewissen (auch falsch verstandenen) Männlichkeitsbild verknüp . Wer dann ein (zu) großes Auto kritisiert, bedroht automatisch auch die Identität des Fahrers.
Die Regierung subventioniert das auch: 5,7 Milliarden Euro könnte Österreich einsparen, würde das Land auf das Dieselprivileg (also eine geringere Besteuerung von Diesel im Vergleich zu Benzin), die Pendlerpauschale (eine Abgeltung für tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz) oder das Dienstwagenprivileg (eine
„Autonormativität“ nennen Experten und Expertinnen diese unhinterfragte Normalität, mit der alles dem Kfz unterworfen wird: Wir bauen unsere Städte nach dem Prinzip des „Auto first“, verpflichten uns zu Garagenplätzen für jede neue Wohnung. Fahrradfahren oder Zufußgehen wird so automatisch zur Abweichung vom Status quo. Und der Teufel steckt auch im Detail. So schreibt die Autorin und Verkehrswende-Aktivistin Katja Diehl, dass das Handynetz in Deutschland als Erstes entlang von Autobahnen ausgebaut wurde. Wer das nächste Mal über das schlechte Internet auf einer Zugreise jammert, kann sich bei der Autolobby bedanken. Sie hat sich auch in unseren Alltag jenseits der Straßen eingeschlichen: Wer sagt denn, dass die Helden unserer Filme immer im schnellen Rennauto ihre Mission antreten müssen? Dass Bubenkleidung immer mit Baggern überzogen sein muss, Bobby-
Die neu gestaltete Praterstraße in Wien gilt als Vorzeigebeispiel für den Ausbau von Fahrradwegen. Doch reicht es, mehr Angebot zu schaffen, um die Zahl der Verbrenner wirklich zu reduzieren?
Die Vorherrscha der Männer am Steuer zeigt sich nicht nur hinter dem Lenkrad, sondern geht hinauf zu den wichtigsten Entscheidungsträgern: Auch heute sind die Vorstände fast aller deutschen Autokonzerne männlich. Von Heesen nennt das einen „eingeschworenen, anachronistischen Boys Club“, der nicht nur die Wirtscha , sondern auch die Politik umfasst – von Bürgermeistern, die Flächen versiegeln, um neue Straßen und Parkplätze zu bauen, bis hin zu Ministerien, die Subventionen, Tempolimits oder Straßenverkehrsordnungen beschließen. Männlichkeit und fossile Vorherrscha , das geht zusammen wie Schnitzel und Kartoffelsalat.
Aber natürlich ist die falsch verstandene, möglicherweise auch toxische Männlichkeit nicht alleine schuld daran, dass die Verkehrswende stockt. Es sind auch nicht alle Radfahrer heilig (auch ich kenne die Wut, will manchmal auf Autos einprügeln und Kühlhauben, die über den Gehsteig ragen, am liebsten mit destruktiver Kra aus dem Weg räumen) oder alle SUV-Fahrer männlich, geschweige denn toxisch. Doch das momentane System schadet nicht nur
dem Klima und somit uns allen, sondern insbesondere den Männern selbst: Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass Männer doppelt so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden haben wie Frauen. Und sogar dreieinhalb- bis viermal so o im Verkehr sterben.
Wir alle scheinen jedenfalls zu anderen Menschen zu werden, sobald wir in ein Auto steigen. Das Gefühl der Überlegenheit vermischt sich mit dem der Unzerstörbarkeit. Wie sonst soll man sich diese Geschichte aus Paris erklären: Dort war ein SUV-Fahrer in eine Diskussion mit einem Radfahrer gekommen, nachdem der Autofahrer versucht hatte, sich auf einem Radweg an den Stauschlangen vorbeizuschummeln. Es endete nicht beim Wortgefecht: Der Lenker überfuhr den 27-Jährigen, laut Zeugen mit Absicht. Kurz darauf starb dieser.
Seit langem frage ich mich deshalb: Wieso muss nicht jeder und jede bei der Führerscheinprüfung eine verpflichtende Fahrrad-Stunde absolvieren? Mittlerweile bin ich überzeugt: Das ist kein Witz, sondern eine Notwendigkeit. Eine von vielen.
Ein sozialer Kipppunkt ist wohl dann erreicht, wenn nicht nur der Markt in eine gewisse Richtung zeigt, sondern sich auch Werte und Einstellungen ändern. Wie das erreicht werden kann? Mit einer Mischung aus großen und kleinen, schnellen und langsamen Maßnahmen: von der Abschaffung klimaschädlicher Auto-Privilege hin zum Ausbau des Angebots, aber auch der Vision eines nicht-autonormativen Lebens.
„Klar kann ich mich über die verspätete U-Bahn aufregen – aber die Zeit, die man beim S-Bahn- oder Zugfahren gewinnt, sieht niemand“, meint Bojan Jovanovic. Eine gute Klima-Governance, also eine strenge, führende Hand, stellt den „Verboten“ die Vorteile gegenüber, das, was wir gewinnen könnten. Vor kurzem erschien etwa eine Studie in der Fachzeitschri PNAS. Sie zeigte, dass die Aufregung über neue Vorschri en verfliegt, sobald sie einmal umgesetzt sind. Egal ob Rauchverbot, Verbrenner-Aus oder Tempolimit.
Es stimmt positiv, dass in China 2024 bereits mehr E-Autos als Verbrenner zugelassen wurden und dass das wohl auch dem Weltmarkt zeigt, wohin die Reise geht. Aber wer eine echte Verkehrswende will, muss weiter gehen, kann nicht nur neue Technologien erfinden und alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen. Und auch mehr tun, als nur Infrastruktur aus- und umbauen.
Es geht nicht darum, alle Autos sofort von den Straßen zu verbannen – das wäre in vielen Fällen auch sozial ungerecht. Aber wir müssen Freiheit und Mobilität neu denken, diese nicht mehr als „individuelles Recht verstehen“, wie es die Autorin Katja Diehl formuliert. Vor allem, wenn sie die Freiheit, die Sicherheit und das Wohlergehen anderer gefährden. Etwa durch eine höhere Risikobereitscha , wie sie Jovanovic schon früh lernte, das mentale Zusammendenken von Leistung und Stärke. Ich habe übrigens versucht, den Taxifahrer, der mich fast ins Krankenhaus gebracht hat, zu kontaktieren. In meiner Wut hatte ich ein Foto seines Autokennzeichens gemacht. Ich wollte mit ihm reden, ihn fragen, wieso er in mir ein Feindbild sieht, was ihn stört an den Radfahrern der Stadt, wo seine Wut herkommt. Gemeldet hat er sich nicht. Aber wer weiß – vielleicht findet sich für ein solches Gespräch ja ein Leser dieses Textes. Redebedarf gäbe es genug. F
10.000
Menschen wurden 2024 österreichweit bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt
20
Prozent mehr Schwerverletzte gab es dabei im Vergleich zum Vorjahr
32
Menschen starben sogar
2040
Bis dahin will Österreich klimaneutral sein
85
Prozent aller Wege sollen bis 2030 in Wien per Rad, zu Fuß oder per Öffis zurückgelegt werden
5,7
Milliarden Euro könnte Österreich laut Wifo einsparen, würde das Land auf klimaschädliche Subventionen verzichten


Irgendwo hier, zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt, steckt die Verkehrswende fest































































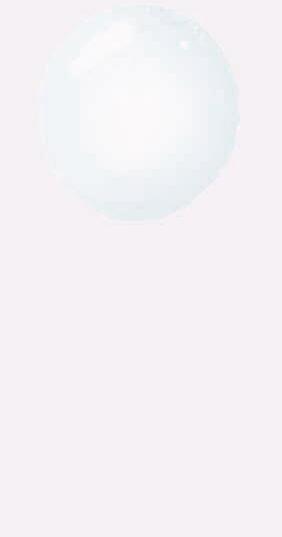






DANN KOMM RAUS AUS DEINER BLASE! LERNE MEHR ÜBER DEN KLIMAWANDEL UND UNSERE MISSION NULL-EMISSION. Unsere Zukunft braucht frischen Wind statt heißer Luft! Deshalb reden wir nicht nur drüber – wir handeln! Begleite uns auf unserer Mission, unsere Produktionsstandorte bis 2030 emissionsfrei zu machen. Wir klären auf, was das bedeutet und an welchen Innovationen wir dafür arbeiten. www.sonnentor.com/co2
FRAGEN?















AUF!







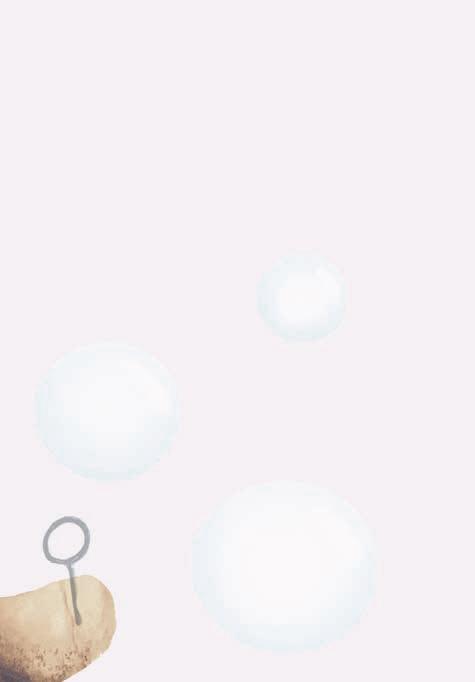
In Österreich sind Autofahrer besonders schnell unterwegs. Eine Temporeduktion hä e viele Vorteile für Klimaschutz, Gesundheit und Geldbörserl. Der Falter hat die wichtigen Fakten und Zahlen
ZAHLENSUCHE: JÜRGEN KLATZER
Da standen die Vertreter des Klimarats und überreichten der Regierung ihre Empfehlungen. Es sind Empfehlungen, wie man die Umwelt und das Klima besser schützen kann. 93 Stück sind es. Viele von ihnen kennt man: öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, Bodenverbrauch bremsen, klimaschädliche Subventionen abschaffen. Es sind die Klassiker unter den Klimaschutzmaßnahmen. Was fehlt, ist das Tempo-100-Limit auf Autobahnen.
Was der Klimarat im Juni 2022 in seinem Bericht verschri licht hat, gilt auch heute noch: Geschwindigkeitsbeschränkungen sind ein heißes Pflaster. In Österreich wird das Limit auf Autobahnen eher erhöht (Stichwort Pilotprojekt 140) statt reduziert. Auf bis zu 130 km/h zu beschleunigen, ist vielen zu wichtig, um stattdessen für den Umweltund Klimaschutz vom Gas zu gehen.
Daten aus dem jüngsten Nationalen Klimabericht zeigen, dass der Verkehrssektor (neben Energie und Industrie) zu den Hauptverursachern der heimischen Treibhausgasemissionen zählt. Der Straßenverkehr schneidet besonders schlecht ab. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen um rund 50 Prozent gestiegen. Der Grund: mehr Autos. Größere Autos. Ältere Autos. Und: schnellere Autos. Schon lange fordern Experten also, die Tempohöchstgrenzen zu senken. 100/80/30 heißt die Lösung: 100 km/h auf der Autobahn, 80 km/h auf Freilandstraßen und 30 km/h im Ortsgebiet. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts stößt ein durchschnittlicher in Österreich zugelassener Pkw bei Tempo 130 pro Kilometer 171 Gramm CO2 aus, bei Tempo 100 nur 132. Gleichzeitig sinkt der Spritverbrauch um 23 Prozent. Nicht zu vergessen: Langsamer bedeutet auch leiser. Auf mehr als der Häl e der 2300 Autobahnen-Schnellstraßen-Kilometer stehen bereits Schutzwände. Sie sollen verhindern, dass Anrainer vom Verkehrslärm belästigt werden. Von 2016 bis 2021 wurden dafür über 250 Millionen Euro ausgegeben. Bei einer Temporeduktion auf 100 km/h würden 17,8 Prozent weniger Menschen von Autolärm belästigt werden. Trotz der Vorteile für den Klimaschutz, die Gesundheit und das eigene Geldbörserl ist von neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen aktuell keine Rede. Ein bisschen Hoffnung existiert aber doch: Seit 2024 können Gemeinden schneller und einfacher das Limit auf Tempo 30 reduzieren. Ein kleiner Schritt im rasenden Österreich. F
Je höher das Tempo, desto mehr CO2 wird ausgestoßen und desto höher ist der Kra stoffverbrauch
HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten darf in Österreich besonders schnell gefahren werden
VERKEHRSLÄRM
Je höher das Tempo, desto intensiver ist der Lärm. An vielen Autobahnstellen stehen deshalb Lärmschutzwände
Mehr als fühlen sich von Verkehrslärm stark beeinträchtig
2/3
Bei einer Tempogrenze von 100 km/h auf Autobahnen sind 17,8 % weniger Menschen von Lärm betroff en
SIND SIE FÜR NEUE TEMPOLIMITS?
47 Prozent können sich laut einer Umfrage neue Tempolimits vorstellen. 47 Prozent sind gegen beide Varianten
30 % für VARIANTE 117 % für VARIANTE 2
40
Ortsgebiet
30 90 80
Freilandstraßen
Nach der Temporeduktion war es in Zürich tags um 1,57 Dezibel und nachts um 1,69 Dezibel leiser (im Durchschni )
130 Auf 62 % des Autobahn- und Schnellstraßennetzes gilt das Tempo
3/4 BEISPIEL ZÜRICH: VON 50 KM/H AUF 30 KM/H
SIND SIE ZU SCHNELL UNTERWEGS?
In Österreich wird ö er das Geschwindigkeitslimit überschri en als in der Schweiz
FREILANDSTRASSE
TODESFÄLLE
349 Menschen sind 2024 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um 13,2 Prozent weniger als 2023
% der tödlichen Unfälle sind auf eine nichtangepasste Geschwindigkeit zurückzuführen
GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN
In 30er-Zonen überschreiten 71,8 Prozent der Autofahrer das Tempolimit, auf der Autobahn sind es noch immer fast 20 Prozent
der Strafen der Verkehrspolizei geht auf erhöhte Geschwindigkeit zurück 6 Mio.
FREILANDSTRASSE
Unfälle/tödliche Unfälle 2024 ingesamt: 37.117
ÜBERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT
2024 wurden 6.145.227 Verwaltungsstrafen wegen überhöhter Geschwindigkeit gezählt
6.145.227

Eigentlich ist Berni Wagner ja Kabare ist – aber als Biologe quasi prädestiniert, die Schlüsselarten auf Wiens Straßen zu charakterisieren.
Eigentlich ist das ja paradox. Aber beim Thema Mobilität bewegt sich irgendwie nicht viel. An Diversität scheitert es dabei ausnahmsweise nicht. In einer Stadt wie Wien kann man sich immerhin auf unzählige Arten fortbewegen. U-Bahn: Super! SBahn: Warum nicht? Straßenbahn: Okay. Seilbahn: Bisher nur ein Gerücht (aber kommt wahrscheinlich trotzdem noch früher an als die Badner Bahn).
Auf den Autobahnauffahrten tummeln sich immer wieder Fiaker und Rasenmähfahrzeuge. Am Heldenplatz kann man zu-
Es gibt viele Fortbewegungsmi el in der Stadt. Doch täglich kämpfen drei Arten um ihre Vorherrscha . Der Biologe und Kabare ist Berni Wagner hat sie beobachtet
FOTOS: CHRISTOPHER MAVRI Č
SCHERZARTIKEL: BERNI WAGNER
mindest einmal im Jahr nicht nur auto-, sondern sogar Panzer stoppen. Es gibt E-Scooter, Segways und Hoverboards für die sogenannte Mikromobilität (womit aber bitte nicht die batteriebedingte Reichweite gemeint sein soll!). Skateboards fährt jetzt eine neue Generation, die genauso aussieht wie wir früher. Als wären sie geklont aus den Zellen unserer abgeschür en Knie mit Proben aus den Halfpipes – gruselig. Inlineskates gibt’s auch wieder – noch gruseliger!
Die Donau kann man rudernd, im Tretboot oder im Twin City Liner befahren. Und auch
wenn Kickls Polizeiklepper inzwischen in Beamtenpension sind: Wer Freunde zum Pferdstehlen hat, wird in der Spanischen Hofreitschule nach wie vor fündig. Die berittene Flucht durch den Rathauspark ergäbe dann sogar eine ganz neue Art von „Park & Ride“. Wobei man ja am Rathausplatz in den kalten Monaten ein noch exotischeres Vergnügen erleben kann: wie es ist, beim „Eistraum“ mitten in einer Großstadt zwischen historischen Gebäuden und weltberühmten Sehenswürdigkeiten mit den Eislaufschuhen im Stau zu stehen.
Nein, an Vielfalt mangelt es dem Ökosystem Betonwüste sicher nicht. Aber sein Gleichgewicht ist bedroht. Denn täglich kämpfen hier drei Spezies um die Verkehrsvorherrscha . Ein spektakuläres Naturschauspiel und hochspannend für einen Biologen wie mich (nein, wirklich, ich hab das studiert!). In jahrelanger Beobachtung habe ich daher den Habitus dieser drei Schlüsselarten dokumentiert.
Auto (Motoris maximus):
Sie sind die Top-Prädatoren in der Nahrungskette der urbanen Mobilität. In riesigen Rudeln patrouillieren sie den Gürtel entlang und schwärmen in jede noch so verwinkelte Einbahn aus. Wenn sie sich bedroht fühlen, verteidigen sie ihr Territorium mit Zähnen und Klauen (also Kühlergrill und Stoßstange). Und sie fühlen sich o bedroht. Nicht nur wegen der Baustellen, die im Sommer pilzgleich aus dem Boden schießen. Viele Autos sind ja invasive Arten, also neu im urbanen Dschungel – und deshalb noch nicht vollständig an das Stadtleben angepasst. Wer jemals gesehen hat, wie der mächtige Landrover in seinem natürlichen Lebensraum (schlammige Forststraße mit 25 Prozent Steigung) vergnügt durch den Matsch tollt, merkt erst, wie betrüblich es ist, ihn eingepfercht in kleinen Gässchen erleben zu müssen. Und wer dann noch sieht, wie ein majestätischer SUV verschämt versucht, sich in einen Motorrad-Parkplatz hineinzulavieren, dem wird klar: Diese Fahrzeuge hätten hier nie angesiedelt werden dürfen. Sowas hält man nicht in der Stadt – da sind sie doch arm!
Apropos: Ein Auto beherbergt meistens einen sogenannten Endosymbionten. Dieser verbringt den Großteil seines Lebens im Autoinneren und kommt teils nicht einmal mehr zur Nahrungsaufnahme oder zum Ablaichen heraus. Dieser sogenannte „Fahrer“ ist o so eng mit dem Auto verbunden, dass er sich zu 100 Prozent mit seinem Wirt identifiziert und nicht mehr sagen kann, wo er selbst beginnt und das Auto au ört. Solche Exemplare stehen direkt vor einem, sagen aber: „Ich stehe dort drüben.“ Doch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Autofahrer waren einst selbst nur – oh Schreck! – Fußgänger. Womit wir bei der nächsten Art sind.
Fußgänger (Pedestrus pedestrus): Fußgänger sind die zahlreichste Gruppe im urbanen Verkehr – und gleichzeitig seine tragischen Helden. Sie bewegen sich auf dem einzigen Fortbewegungsmittel, das nicht subventioniert wird: den eigenen Bei-
nen. Dadurch sind sie die natürlichen Opfer aller anderen Verkehrsteilnehmer und ein Spielball ihrer Launen. So werden Fußgänger zum Beispiel gerne als bewegliche Slalomstangen benutzt. Oder es wird ihr ausgeprägter Fluchtreflex aktiviert, indem man sie anhupt oder anklingelt: Eine solche Machtdemonstration lässt sie verlässlich und auf amüsante Weise hochschrecken. Wie wenn ein Kind in eine Gruppe Tauben hineinläu , um die eigene Wirkmächtigkeit zu spüren: ein lustiges Spiel für alle mit dem Empathielevel von Fün ährigen. Der Fußgänger fühlt sich also ebenfalls bedroht. Aber zu Recht. Findige Notare sollen inzwischen Büros an besonders unübersichtlichen Straßenübergängen mieten – und verdienen so gutes Geld mit Fußgängern, die vor dem Queren noch ein schnelles Testament machen wollen. Doch gerade aus ihrer so bescheidenen Position im mobilen Ökosystem ziehen die zu Fuß Gehenden ihren Stolz. Ja, manche bestehen sogar darauf, dass sie noch mehr zu Fuß gehen als andere – und trotzdem nur wenige Paar Schuhe brauchen! Solche stolzen Sohlengänger fühlen sich dadurch ganz nah an Mutter Erde (das heißt: dem darüber liegenden Asphalt). Wem das zu he ig ist, hat inzwischen die Option des Barfußschuhs, das gefühlsechte Kondom unter den Latschern. Doch Obacht: Manche Zeitgenossen der städtischen Savanne sehen nur so aus, als wären sie Fußgänger. In Wirklichkeit haben sie sich längst weiterentwickelt – zum Radfahrer!
Radfahrer (Bicicletta pedalus):
Für immer getrieben vom Freiheitsgefühl, als das erste Mal ihre Stützräder abgenommen wurden, sind diese Rebellen des Nahverkehrs der natürliche Feind des Autos. Zwar sind sie kleiner und leichter gebaut. Aber dadurch wendiger. Besser an ihre ökologische Nische angepasst. So provoziert allein ihre Existenz die plumpen Pkw-Platzhirsche. Denn trotz geringerer PS ist das Fahrrad in der Stadt o schneller als das Auto. Zum Beispiel wenn das Auto gerade an einer Ampel steht und sich das Rad bis vorne vorbeischlängelt. Oder noch mehr, wenn es die rote Ampel zugegebenermaßen ein klitzekleines bisschen ignoriert. Alles für den Etappensieg und die positive CO2-Bilanz!
Bei Fahrrädern gibt es eine Unzahl an ausdifferenzierten Unterarten: Rennrad, Klapprad, Lastenrad – Letzteres eine Art manövrierfähiger urbaner Rammbock, in dessen hölzernem Bug der Nachwuchs wie ein Bobteam im Eiskanal die harten Kurven aerodynamisch mitschunkelt. Das Einrad –leider seit Jahren nicht mehr gesichtet. Es dür e zusammen mit dem Männerdutt und dem gezwirbelten Schnurrbart in die ewigen Jagdgründe eingegangen sein. Das Tandem dagegen gab es in Wien noch nie, weil fröhlich vergnügte Liebespaare hier verboten sind. Stattdessen ist eine
der engsten städtischen Beziehungen jene zwischen einem Rad und seinem Fahrer. Auch hier besteht eine Art Symbiose. Aber sie ist dank Klickpedalen jeden Moment lösbar, und Rad und Fahrer können o bis zu 30 Minuten voneinander getrennt überleben – solange der Fahrer in der Zwischenzeit o genug erwähnt, dass er eh mit dem Rad da ist. Radfahrer haben sich ihr enges Territorium hart von den Autos erkämp und verteidigen es nun mit ihren schnittig schmalen Vorderrädern (vulgo: „Dackelschneider“) gegen Eindringlinge jeder Art. Doch es ist ihnen nicht genug. Sie wollen mehr.
So besteht also die Sorge, dass die Räder bald die Autos völlig verdrängen könnten. Denn während sich die Räder fröhlich vermehren, kommen viele Autos kaum noch vom Fleck. Vom Fahrzeug zum Stehzeug ist es o nur ein kleiner Schritt. Der wird selbstverständlich nicht gegangen, sondern gefahren! Aber irgendwann hört jegliche Bewegung endgültig auf. Wie versteinert blockieren die fossilen Ungetüme dann Quadratkilometer an Stadtfläche. Ein trauriges Schauspiel!
Trotzdem müssen wir kritisch bleiben gegenüber einer erstarkenden Lobby für Wiederaufzucht: Ein großes Reservat in der Lobau soll es den Autos ermöglichen, nach Herzenslust zu quietschen und zu qualmen. Niemand soll sich mehr sorgen müssen um den Bestand von Mustang, Jaguar und Panda (solange sie Reifen haben). Aber soll sich der Mensch hier wirklich einmischen? Die Natur erscheint o grausam, aber wenn die Selektion eben vorgibt, dass die Zeit des Stadtautos zu Ende geht – wer sind wir, um hier zu seinen Gunsten eingreifen zu wollen? F

Zur Person Bernhard „Berni“ Wagner (*1991) ist ein österreichischer Kabare ist. 2022 hat er den Österreichischen Kabare preis für sein Programm „Galápagos“ bekommen, in dem es um Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wissenscha sfeindlichkeit geht, 2024 für sein Programm „Ghöst“. Momentan steht er mit „Monster“ auf der Bühne. Vor seiner KabareKarriere studierte er an der Universität Wien und forschte für die Österreichische Akademie der Wissenscha en. Seine Doktorarbeit hat er über die Basis für Musik bei Menschen, Affen, Ra en, Schweinen und Wellensi ichen geschrieben.
Paris, Graz, Tokio: Viele Städte wollen ihre SUVs loswerden. Wien hingegen verzeichnet die meisten Neuzulassungen. Was ist da los?
BERICHT: KATHARINA KROPSHOFER
ILLUSTRATION: ANTONIA ZEISS
Fast wäre es ein Klischee zu viel. Der graumelierte Herr steigt aus seinem weißen Wagen, sucht nach der Zigarre in der Mittelkonsole, klemmt sie in den Mundwinkel und sagt: „Völliger Schwachsinn.“
Der Mann fährt SUV, so der eingebürgerte Produktgruppenname für den überdimensionierten VW Touareg, den er hier parkt. Mit Schwachsinn meint er aber etwas anderes.
Im Februar 2024 machten die Pariser in ausgewählten Gemeindelokalen ihre Kreuze: „Plus ou moins de SUV à Paris?“, also mehr oder weniger SUVs, so die simple Frage der Bürgerbefragung. Sie entschieden sich zu 54,5 Prozent für „moins“, also weniger. Zwar lag die Wahlbeteiligung bei nur sechs Prozent (aus Desinteresse oder fehlender Information), doch das Ergebnis ist wegweisend: Das Auto, das optisch die Apokalypse überstehen könnte, scheint dem Untergang geweiht.
Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will Besitzern von über 1600 Kilo schweren Wagen, die in die Stadt fahren, mehr Geld fürs Parken abverlangen. Seit Oktober vergangenen Jahres ist es soweit: 18 Euro die Stunde zahlen Besucher dann in der Innenstadt; macht ganze 225 Euro für all jene, die sechs Stunden bleiben, bummeln oder Sightseeing machen wollen.
Die sozialistische Stadtregierung will so „Belästigungen“ (Lärm, Emissionen, vor allem Lu verschmutzung) bekämpfen. Und eine Botscha an die Autoindustrie senden. Denn diese fährt seit Jahren diesen Trend: Größer, stärker, schwerer werden ihre Fahrzeuge, das Stadt- und Landbild ist schon davon geprägt. Nicht nur in Paris. Ist Paris das Vorbild, um knappen Stadtraum gerechter zu verteilen? Oder will die Bürgermeisterin mit Populismus ihre Wähler bei Laune halten? Eine Spurensuche in sechs Kapiteln.
48,8 %
DER NEUZULASSUNGEN 2024 WAREN SUV
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchsetzbar ist – schon gar nicht in Wien“, meint der Wiener SUV-Fahrer, der weder Name noch Foto in der Zeitung sehen will. Seit zehn Jahren fährt er Autos dieses Kalibers, er fühle sich wohler, sicherer. Mehr fürs Parken zu zahlen würde ihn nicht davon abbringen. Das tat schließlich auch der höhere Benzinverbrauch nicht.
Er spricht für viele Autofahrer in diesem Land. 2024 haben die Behörden so viele „Sport Utility Vehicles“ wie noch nie zugelassen: 2010 waren 12,9 Prozent der neuen Autos SUVs, nun schon rund 49 Prozent. Die meisten davon spuren nicht durch hochalpines Gefilde, sondern ausgerechnet in Wien über asphaltierte Alleen.
„Das ist ein Trend, den man nur als Fehlentwicklung bezeichnen kann“, sagt Michael Schwendinger von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Ressourcen- und Energieverbrauch, und das in Ballungsräumen mit immenser Flächenkonkurrenz. Nur ein Teil der Gesellscha scheint davon zu profitieren: Autokonzerne. „Die freuen sich über die Umsätze“, so Schwendinger. SUVs sind groß und schwer, nicht notwendig für Transporte im Alltag, bringen
den Herstellern aber bessere Margen. Das sind keine Landscha sfahrzeuge mehr, sondern Bequemlichkeitsmaschinen und Statussymbol. Vor allem, scheint es, in Wien.
%
DER STRASSENFLÄCHE WIENS SIND FÜR PARKPLÄTZE RESERVIERT
Die Touristen auf dem Gehsteig gegenüber suchen die beste Perspektive. Doch ein ideales Foto des Café Bräunerhof, Thomas Bernhards Stammlokal, werden sie heute nicht schießen. Die olivgrüne Wucht von einem Wagen verstellt an diesem Donnerstagvormittag die Sicht.
Zwei bis drei Quadratmeter mehr Fläche braucht ein SUV im Vergleich zum Durchschnitts-Pkw, so der VCÖ. „In Städten ist der öffentliche Raum knappes Gut“, sagt auch Paul Pfaffenbichler, Verkehrsforscher an der Universität für Bodenkultur. „Und je knapper, desto teurer ist es normalerweise.“ Für ihn sind Preisgestaltungen wie in Paris also zulässig.
28 Prozent des Wiener Straßenraums sind für Parkplätze reserviert. Im Vergleich: In München sind es 21, in Rotterdam lediglich 15 Prozent. Je größer das Auto, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reifen, ein Stück Motorhaube über die blaue Linie ragt. Seit Oktober 2022 stra die
Stadt sogar mit 36 Euro, sollte ein Teil eines abgestellten Fahrzeugs in Gehsteige oder Radwege ragen. Wie rigoros die Parksheriffs das ahnden, geben die Zahlen nicht her. Wo die wilden Wagen wohnen, fehlt der Platz o woanders: Radfahrer, die gegen die Einbahn fahren dürfen, weichen aus oder warten, bis ein gar dickes Auto vorbeigezogen ist. 2024 blockierten unachtsam abgestellte Autos auch die Straßenbahnen der Stadt durchschnittlich viermal am Tag, so die Wiener Linien. „Wir merken, dass Autos breiter werden, das kann zum Problem werden“, sagt eine Sprecherin. Die Zahl sinkt, seitdem die Strafen auch hierfür steigen. Und selbst in Garagen gibt es Wachstumsschmerzen. Wer nicht mehr selbst einparken kann, bekommt o Hilfe von hauseigenen Mitarbeitern. Zwei von ihnen schrubben heute in der Operngarage eine Karosserie. 2010 haben die beiden hier angefangen, seit 2017 fahren 80 bis 90 Prozent ihrer Kunden nur noch SUVs. „Wir haben eine eigene Klientel, aber normale Kleinwagen pflegen wir selten“, sagt der eine. Neue Garagen, wie jene an der Freyung, werden bereits mit 2,65 Meter Parkplatzbreite geplant, alte o nachgerüstet. Die Smart-en Jahre sind vorbei. Trotzdem hört man den Zeigefinger fast nach oben schnellen, wenn man mit Severin Karl telefoniert. Er ist seit 20 Jahren Chefredakteur von Auto Bild Österreich und kann nur wiederholen, was viele Branchenkenner sagen: „Der Begriff SUV ist zu beliebig.“ Ein
»In Städten ist der öffentliche Raum knappes Gut. Und je knapper, desto teurer ist es normalerweise
PAUL PFAFFENBICHLER, VERKEHRSFORSCHER AN DER BOKU
Tesla Model 3 zum Beispiel, der als Elektro-Limousine gilt, ist breiter als ein Mazda CX-5, der als SUV verkau wird. „Was, wenn der neue Trend Familienvan heißt?“ Dieser sei mindestens so hoch, genieße aber ein anderes Image.
Wer SUV sagt, meint nicht immer das Gleiche. Das Wort habe die Werbung geschaffen, heißt es beim Verkehrsclub ÖAMTC, dem – wenn man so will – weniger ökologischen Gegenpart des VCÖ. Der pauschale Kampf gegen SUVs? Unzulässig.
93,6 %
WAHRSCHEINLICHER IST ES, ALS FUSSGÄNGER VON EINEM SUV ALS VON EINEM NORMAL GROSSEN AUTO UMGEBRACHT ZU WERDEN (JEDOCH IN DEN USA)
Doch warum setzt nun halb Wien auf solche Autoriesen? Komfort und Sicherheit sind die stärksten Argumente. Dass sie die schützen, die darin sitzen, ist vielfach bewiesen. Doch wenn es um die anderen Verkehrsteilnehmer geht, wird die Sache komplizierter. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit erhebt keine Zahlen für diese Karosserieklasse, aber kennt Studien.
Fortsetzung nächste Seite

WirschauenaufsGanze. DieBiobäuerinnen&Biobauern
MehrInfoszumEU-Bio-Logo: bio-austria.at/EU-Bio-Logo

DieBio-Landwirtscha leistetdurcheinevielfältigeFruchtfolge,Humusau auimBodenundden Verzichtaufchemisch-synthetischePflanzenschutzmi eleinenwichtigenBeitragzumSchutzder Biodiversität.DasistgutfürdieUmwelt,machtaberauchfitfürnotwendigeAnpassungenanden Klimawandel.ZumBeispielsorgenRegenwürmerundandereKlein-undKleinstlebewesenfür lebendige,gutstrukturierteBio-Böden.DiesespeichernmehrFeuchtigkeitundkönnenrasch großeWassermengenaufnehmen–gutbeiTrockenheitalsauchHochwasser.



was-ist-biodiversitaet
Darin zeigen Forscher der belgischen KU Leuven: Wenn zwei Autos kollidieren, von denen eines mindestens doppelt so schwer ist wie das andere, erleiden die Insassen des leichteren Autos dreimal häufiger schwere Verletzungen.
Oder diese viel zitierten US-amerikanischen Studien aus dem Jahr 2023: Hohe Motorhauben sowie stumpfe Profile normal hoher Autos seien besonders tödlich. Vergleicht man SUVs mit anderen Autos, ist die Wahrscheinlichkeit, als Fußgänger bei einem Linksabbiege-Unfall zu sterben, ganze 93,6 Prozent höher.
Dann sind da aber noch Forschungsergebnisse aus Deutschland und der Schweiz: In den meisten Fahrzeugkategorien führen schwere Fahrzeuge nicht automatisch zu tödlichen Unfällen. War ein SUV Unfallgegner des Fußgängers, waren diese nur um sieben Prozent häufiger schwer oder lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallsituation, das Fahrverhalten des Lenkers und die Geschwindigkeit waren relevanter für den Ausgang.
„Die eigene Sicherheit geht zulasten aller“, sagt der Verkehrsplaner Ulrich Leth, der an der TU Wien forscht. Und das, obwohl Wien der sogenannten „Vision Zero“ folgt, also auf null Verkehrstote im Jahr abzielt. 20 waren es im Jahr 2024.
Trotzdem sagte der ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf im Februar 2024 in einem Interview auf Ö1: „Leute, die SUVs kaufen, denken an ihre Kinder.“ Zumindest an ihre Sicherheit, wohl nicht an ihre Zukun .
%
MEHR TREIBSTOFF ALS DER DURCHSCHNITTLICHE NICHT-SUV VERBRAUCHT EIN SUV
Der Verkehr ist das Problemkind der Klimapolitik: Die Emissionen in Österreich sinken leicht, der Autoverkehr bildet die stinkende Spitze. Das macht den SUV nicht nur zum Symbol, sondern zum realen Problem: Hätten die Fahrzeuge nicht derart zugelegt, wären die Emissionen des Motorsektors zwischen 2010 und 2022 um 30 Prozent stärker gefallen, so eine Analyse der Global Fuel Economy Initiative. So wird der SUV zum Schnitzel unter den Autos. Ein kleiner Genuss für den Einzelnen, ohne an die Ressourcen der vielen zu denken. Etwa 20 Prozent mehr Treibstoff als der durchschnittliche Nicht-SUV verbrauchen die Autos laut der Internationalen Energieagentur (IEA).
Denn mit dem Lu widerstand der hohen Front steigt der Energieverbrauch. Wird das Auto schwerer, braucht es wiederum mehr Energie, um überhaupt auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Was die Autobauer in den vergangenen Jahren dank neuer Technologie an Emissionen sparen, haben sie in Größe, Ausstattung und Gewicht der Fahrzeuge wieder zugelegt.
Die Masse dient aber nicht nur der Freude an der Überlegenheit, sie stammt auch von der Sicherheitstechnik. Selbst Kleinwagen würden viel schwerer, sagt der Mo-
Die Leute kaufen ihre Autos nach dem GAUPrinzip: größter anzunehmender Urlaub
MICHAEL SCHWENDINGER, VERKEHRSCLUB VCÖ
torjournalist Severin Karl. Abstandsradare, Spurhalteassistenten, selbst manche Komfortprodukte sind nun Standard. Auch der Golf – eines der meistgebauten Pkw-Modelle – hat sich seit seiner Geburt fast verdoppelt: 1974 wog der erste Golf noch 750 Kilo, der neue Golf in achter Generation wiegt mindestens 1300 Kilo.
Oder genau das ist das Problem: „Die Leute kaufen ihre Autos o nach dem GAU-Prinzip: größter anzunehmender Urlaub“, sagt Schwendinger vom VCÖ. Eine Dimension, in der im Notfall Couch und fünf Koffer Platz finden – selbst wenn das nur einmal im Jahr notwendig ist, man auf Carsharing oder Automiete setzen könnte.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat SUVs den Kampf angesagt

Planungsdirektor
Thomas Madreiter setzt auf einen breiten Ansatz

Für Michael Schwendinger vom VCÖ sind SUVs eine absolute Fehlentwicklung
SUVS LEGTEN DIE TYRE EXTINGUISHERS IN WIEN-DÖBLING LAHM
Ein SUV-Fahrer scheint multitaskingfähig zu sein, jedenfalls in der anekdotischen Stichprobe. Kaum einer fährt ohne Wurstsemmel in der Hand oder Airpods in den Ohren durch Wien. Die zweite Beobachtung lautet: Der Haargel- und Hyaluron-Koeffizient korreliert mit der Autogröße. Geschlecht und Alter scheinen keine Rolle zu spielen. Die blonde junge Frau auf dem Weg ins Fitnessstudio fährt genauso Porsche Cayenne wie der melierte Rolex-Träger. Manche Aktivisten haben sich auf diese Fahrzeugklasse und ihre Steuermänner eingeschossen. „Achtung, Ihr Spritfresser ist tödlich“, steht auf dem Flugblatt, das immer wieder hinter etlichen Scheibenwischern klemmt. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Gezeichnet: Die „Tyre Extinguishers“. Die Aktivisten ließen weltweit SUVs die Lu aus den Reifen, weil sie in ihnen den Ausdruck jenes Verhaltens sehen, das uns die Klimakatastrophe beschert. In Döbling legte der lokale Ableger der Gruppe so bereits 15 bis 20 (laut Polizei) beziehungsweise 80 SUVs (laut Aktivisten) lahm, ein Fahrer hatte den Zettel nicht bemerkt und fuhr auf den Gehsteig. Mittlerweile sind die Aktionen weniger geworden.
Die Protestform ist gefährlich, doch die Wissenscha findet starke Worte: „Die Form des SUVs ist schon ein absurdes Konzept, das allen verkehrsplanerischen Erfahrungen widerspricht“, sagt der TU-Forscher Leth. Sportlich und gefährlich statt zweckmäßig und effizient.
Die andere Seite hört sich so an: „Wenn ich von Wien 1 nach Wien 7 fahre, brauche ich keinen SUV. Aber wir sehen keinen Handlungsbedarf, den Eigentümern etwas vorzuschreiben“, sagt der Verkehrsjurist Matthias Wolf vom ÖAMTC. Die WKOVertretung der Fahrzeugindustrie will erst gar nicht mit dem Falter reden. „Danke für das Angebot, wir werden davon keinen Gebrauch machen“, schreibt ein Sprecher. Ist die Diskussion wirklich so verhärtet, dass Gegner Hand anlegen, während die Befürworter nicht einmal zum Gespräch bereit sind? Dass Radfahrer auf große Autos spucken, die ihnen den Weg versperren, und aggressionsgeladene Fahrer mit Gewalt drohen? Vielleicht machen es sich die Aktivisten mit ihrem blanken Hass auch zu einfach: Ein SUV-Fahrer verzichtet vielleicht eher auf eine Flugreise, steigt vielleicht öfters aufs Rad und nützt sein Auto nur für gelegentliche Wochenendausflüge.
ALLER NEU VERKAUFTEN FAHRZEUGE WERDEN 2030 ELEKTRISCH SEIN
Soll man SUVs nun aus der Stadt sperren, als Sündenbock für die fossile Verkehrspolitik der Gegenwart? „Ein SUV ist nicht per se böse“, sagt der Journalist Severin Karl. Hochleistungs-SUVs mit 400 PS brauche kein Mensch, aber auch manch braves Familienauto gelte als SUV. Auch in der elektrischen Variante. Mehr als ein Drittel aller Neuwagen, die 2030 auf dem Markt zu finden sind, werden mit Strom fahren, schätzt die Internationale Energieagentur. Warum sollten die nicht in komfortabler Form kommen?
Weil große, schwere E-Autos nicht unbedingt viel klimaschonender sind als kleine, benzinbetriebene Wagen. Die Produktion brauche schlichtweg zu viele Ressourcen, so der American Council for an Energy-Efficient Economy. Dieser Nachteil gleicht sich, wenn überhaupt, dann erst im späten Autoleben aus: Im schlechtesten Szenario verursacht ein E-Auto über die Lebensdauer um 37 Prozent weniger CO2 als ein Benziner. Im besten Fall um 83 Prozent.
Und dann gibt es noch das Platzproblem. Es gehe darum, nicht nur das Parken für große Autos teurer zu machen, sondern billiges Parken an sich einzuschränken, den Autoherstellern auf EU-Ebene bessere Vorgaben für schlankere Autos zu geben, da sind sich alle Gesprächspartner einig.
Der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter spricht von einem „breiten Aktionsansatz“, um die Leute zu Fußgängern, Rad- oder Öffifahrern zu machen. Über SUVs als solche sagt er nur, dass der Begriff „mobilitätsfachlich zwiespältig“ sei, die Definition – wie schon gehört – fehle.
Seit 2021 jedenfalls brauchen Wiener in allen Bezirken ein Parkpickerl, das hat den Pendlerverkehr reduziert – doch den Binnenverkehr begünstigt. Wer jetzt überall im Bezirk leicht einen Parkplatz findet, muss sich den Garagenplatz nicht mehr leisten. Auch hier lohnt der Blick ins ferne Paris: 160 Parkzonen zählt die Stadt allein im Zentrum – in Wien wäre das ein Gebiet so groß wie die Donaustadt. Und mehr Zonen heißt weniger Bewegung. Noch sehnsüchtiger blicken die Forscher aber nach Osten: Wer in Tokio ein Auto anschaffen will, muss beweisen, einen privaten Stellplatz zu haben. Das Parken im öffentlichen Raum ist quasi verboten. „Es geht nicht darum, alles autofrei zu machen, sondern die Nutzung von Autos auf ein vernün iges Fundament zu stellen“, sagt der Forscher Pfaffenbichler. Die Wiener Stadtregierung habe das teilweise erkannt. Jetzt muss es nur noch wer den Wienern sagen. F
Dieser Artikel erschien zuerst in Falter 7/2024













Jetzt 10 % Rabatt* auf Ihre PV-Anlage sichern





































Familie Fühler
Photovoltaik-Fans




Rabatt von minus 10 % gilt auf den Netto-Preis für die Errichtung der Photovoltaik-Anlage inkl. der Kosten für die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme, ausgenommen allfällige Regiekosten. Der Rabatt ist für alle Kund*innen gültig, die im Zeitraum von 01.04.2025–31.08.2025 über die Website ein Angebot einholen und den unterzeichneten Vertrag innerhalb der Angebotsfrist an Wien Energie übermitteln. Eigenen Sonnenstrom produzieren und sich dabei unabhängiger machen? Dieser Plan kann ganz leicht aufgehen! Holen Sie sich schnell das maßgeschneiderte Komplettangebot für Ihre PV-Anlage auf: wienenergie.at/pv-anlagen












blockieren falsch geparkte Autos im Durchschnitt Trams und Busse in Wien. Oder in absoluten Zahlen: 939 Mal pro Jahr. 2010 waren es sogar noch 3600 Falschparker, 2020 dann 1649 – die Zahl sinkt somit.
aller Gehsteige und aller Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Wien gelten als barrierefrei. Das heißt: abgesenkte Gehsteige, behindertengerechte Querungen, taktile Leitsysteme oder sensorgesteuerte Ampeln. 2024 hat die Stadt deshalb den „Access City Award“ der Europäischen Kommission gewonnen.
Öffentliche Parkplätze & Fahrbahnen verbleibender öffentlicher Raum
10 EURO PRO MONAT kostet die Parkometerabgabe, mit der man in Wien ein „Parkpickerl“ beantragen kann. Rund 480.000 öffentliche Parkplätze gibt es in Wien – gemeinsam mit den Fahrbahnen nehmen sie damit zwei Drittel des verfügbaren Platzes ein. Kritiker haben damit ein Problem: Autos sollten in Garagen und Parkhäusern abgestellt werden, anstatt so viel öffentlichen Raum zu beanspruchen. Doch momentan kostet das teilweise zehnmal so viel.
Das blaue Entsiegelungswunder•Der ewige Gürtel-Streit•Hermann Knoflacher im Porträt
DER GROSSE REGENWURM AKA TAUWURM (LUMBRICUS TERRESTRIS)
„Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“
TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ
D as Erdreich ist der Regenwald der Industrienationen. Denn er ist genauso artenreich wie diese tropischen Lebensräume. Wenn man ihn versiegelt oder unsachgemäß bewirtscha et, passiert genau das Gleiche wie mit den Regenwäldern: Der Lebensraum wird vernichtet. Wie im Kinderlied über die hustenden und dann verschwindenden Regenwürmer werden wir ohne freie Böden immer weniger. Und das mit einer bedrohlichen Geschwindigkeit. Menschen machen zum Vergleich gerne bildha e, aber ungenaue Angaben, die zwischen 11 und 18 Fußballfeldern liegen. Dazu passt eine Aussage des Philosophen Konrad Paul Liessmann: „Das hat mit Füßen zu tun, es wird getreten [...] und ist damit eine Form der Herrscha sausübung.“
Auch Bodenversiegelung ist eine Herrscha sausübung über die Natur, die das Umweltbundesamt 2022 erhoben hat: Täglich werden in Österreich 11,3 Hektar Fläche neu in Anspruch genommen und davon etwa die Häl e versiegelt. Um der Lebensrealität
der Österreicher besser zu entsprechen, kommuniziert man diese Fläche mit einem alltagsnahen Bild: 23 Supermärkte inklusive Parkplätzen werden pro Tag zum sogenannten Dauersiedlungsraum – der Antithese zu Gebirgen, Flüssen, Wiesen und Wäldern. Wisst ihr denn nicht, wie differenziert und wunderbar dieser Lebensraum ist, den ihr mit Beton abdichtet? In einem fast magischen Prozess verbinden sich bei der Passage durch unseren Darm Mineralstoffe mit organischer Substanz zu Humus. In einer naturnahen Wiese können bis zu 500 von uns ein Tunnelsystem anlegen, das einen schnellen Wasserabfluss durch den Boden ermöglicht, das Erdreich belü et und Wurzelkanäle für Pflanzen schafft. Auf einer Fläche mit Acker- und Grünland von 50 Hektar bauen wir ein Tunnelsystem in der Länge des zehnfachen Erdumfangs. Ein Boden ohne uns reagiert auf Regen wie ein verstop es Sieb: Es kommt nicht mehr viel durch. Betonieren Sie nur weiter, aber das nächste Hochwasser kommt bestimmt. F

Christoph Schwarz
Filmemacher, Medienkünstler, Klimaaktivist
Es ist nicht sein erster Parkplatz – und vermutlich auch nicht der letzte. Seit eineinhalb Jahren parkt das Cabriobeet am Währinger Gürtel, knapp vor der Nussdorfer Straße. „Um den Wunsch der Anrainer für die Begrünung der Parkspur am Gürtel zu unterstützen“, sagt Christoph Schwarz. Er ist kein Unbekannter: Seit 2021 macht der Wiener mit seinen künstlerischen Interventionen auf sich aufmerksam. Das Cabriobeet ist sein
auffälligstes Projekt. Es soll auf einen „Fehler im System“ hinweisen: Zehn Euro im Monat zahlt Schwarz für das Anrainerpickerl, das seien verschenkte zehn Quadratmeter öffentlicher Raum. Besonders am Gürtel sei das doppelt ungerecht: Die Anwohner müssten schon Lärm, Schmutz und Hitze von drei Fahrspuren aushalten – dazu komme eine Parkspur. „Der Autobestand geht zwar zurück, aber die Gürtelfahrbahnen werden trotzdem nicht reduziert.“ So gebe es auch 2025 nur eine Möglichkeit, eine Gürtelspur zu begrünen: ein Cabrio mit Kräutern zu bepflanzen.
Die Stadt Wels will auf ihrem Messegelände 40.000 Quadratmeter entsiegeln –und einen riesigen Park bauen. Doch steckt dahinter wirklich Klimaschutz?

Auf dem ehemaligen Gelände der Messe Wels sollen 13 Hallen abgerissen und 40.800 Quadratmeter für einen Park entsiegelt werden (oben)
Dafür verantwortlich sind unter anderem der Baudirektor der Stadt, Wolfgang Pichler und die Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ)

Das Licht in der großen, leerstehenden Halle ist schummrig. Dreck und Staub überziehen den Boden, drei Männer sitzen um einen Tisch. Darauf steht eine brennende Tafelkerze, leere Bierflaschen, eine au lasbare E-Gitarre. Sie haben sich heute in Halle 6 der Messe Wels zusammengefunden, um Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal wollen sie die unzähligen Konzerte, die sie hier veranstaltet und miterlebt haben, Revue passieren lassen. Denn an diesem frühsommerlichen Apriltag startet der Abriss dieser Hallen –und damit auch Österreichs größtes Entsiegelungsprojekt.
Christa Raggl-Mühlberger erinnert sich mit etwas Wehmut an die Konzerte, die sie hier in der Messe Wels miterlebt hat. Sie ist Vizebürgermeisterin (FPÖ) und politisch für das Projekt „Volksgarten neu“ verantwortlich. Gemeinsam mit Wolfgang Pichler, dem Baudirektor der Stadt Wels, spaziert sie das Traunufer entlang.
Seit ihrer Kindheit sind die Messehallen so etwas wie unverrückbare Barrieren, die den Fluss von der Stadt trennen. „Wasser und Fluss, das sind immer ganz positive Elemente“, erzählt Raggl-Mühlberger und meint damit: Wenn die Hallen wegfallen, wird der Fluss wieder sichtbarer, rückt er näher an die Stadt heran. Steht man neben den heruntergekommenen, mit Graffiti beschmierten Hallen, spürt man von dieser „positiven Energie“ noch nichts. Auf dem schmalen Weg müssen die beiden Verantwortlichen immer wieder stehen bleiben, um Radfahrerinnen auszuweichen.
Mit der Umgestaltung des Areals soll sich all das ändern: Dann werden 13 der 21 bestehenden Hallen abgerissen, 40.800 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Bis zum Sommer 2026 soll so eine mehr als zehn Hektar große Parkanlage mit 500 neuen Bäumen und einem großen Seerosenteich entstehen. Statt Beton und Asphalt wird der Park den Bewohnern dann künftig mehr Platz für Freizeit, Bewegung und Erholung bieten. Eine terrassenartige Bucht wird den Zugang zur Traun ermöglichen – das hatten

Das ist kein vorrangiges Klimaschutzprojekt, es ist ein Lebensqualitätsprojekt
BÜRGERMEISTER ANDREAS RABL (FPÖ)
sich die Anrainer während eines Bürgerbeteiligungsprozesses gewünscht. Gut ankommen dür e das Projekt. Eine junge Mutter, die an den Hallen vorbeispaziert, freut sich auf den zusätzlichen Platz, auf dem sie sich mit ihrem Baby dann auch mal „in Ruhe ausbreiten kann“.
Projekte wie der neue Volksgarten in Wels machen auch Klimaexperten Hoffnung – denn wenn es um das Thema Boden geht, sieht die Rea-
lität in Österreich meist anders aus: 23 Jahre sind vergangen, seit die blauschwarze Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel in ihrer „Strategie zur nachhaltigen Entwicklung“ den Bodenverbrauch erstmals begrenzen wollte. Zielvorgabe: bundesweit maximal 2,5 Hektar pro Tag. Auch wenn sich der Verbrauch seither um circa die Häl e reduziert hat –gelungen ist das bis heute nicht. Stattdessen verbrauchen die Österreicher

weiterhin jeden Tag rund zwölf Hektar wertvollen Boden, die Häl e davon wird mit Beton oder Asphalt versiegelt. Das führt dazu, dass mittlerweile eine Fläche der Größe von Wien und Vorarlberg versiegelt ist – und mit ihr auch wichtige Funktionen des Bodens passé sind. Ist dieser lu - und wasserdicht abgedeckt, kann er weder zur Ernährungssicherheit beitragen noch Abkühlung verschaffen oder für saubere Lu und sauberes Trinkwasser sorgen noch Schutz bei Hochwasser und anderen Naturkatastrophen garantieren.
Dass ein verbindliches Ziel zum Erhalt dieser Ressource trotzdem so schwer realisierbar ist, liegt auch an
Fortsetzung nächste Seite

Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See setzt 2025 gezielt auf nachhaltiges Urlauben und strebt das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen an.
In 2025 stehen in der Region nicht nur Zukunftsfragen des umweltbewussten Reisens im Fokus, sondern auch konkrete Projekte, die zeigen sollen, wie gelebter Umweltschutz in der Praxis funktionieren kann. Im Zentrum: die letztjährige Kampagne „mein SEE.“ und eine Auszeichnung, die nachhaltiges Engagement sichtbar macht.
Innovation am Faaker See Regionale Betriebe und Bildungseinrichtungen wurden eingeladen, innovative Projekte zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Faaker Sees zu präsentieren. Beim Tourismustag 2025 der Region wurde daher erstmals der „mein KRISTALL. Faaker See Award“ verliehen – eine Auszeichnung für das herausragendste Engagement im Bereich nachhaltiger Tourismus, ausgewählt aus einer Vielzahl eingereichter Projekte.
Auszeichnung für Herzensprojekt
Mit einem durchdachten Nachhaltigkeitskonzept der Genussreduktion überzeugte der Gewinner
– der „Grüne Heinrich“: Vom plastikfreien Frühstück über einen Unverpackt-Laden bis hin zu Zero-Waste-Ideen reicht das Engagement, das mit dem Faaker See Award ausgezeichnet wurde. Auch die 3AT der Tourismusschule Villach wurde mit dem Zukunftsaward geehrt. Ihr Projekt fokussierte sich auf Bewusstseinsbildung im Bereich Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen Wie engagierte Betriebe und Mithelfer:innen in der Region zeigen, braucht es oft nicht viel: ein Frühstück mit regionalen Produkten, ein Clean-Up-Spaziergang am Seeufer oder ein bewusstes Gespräch mit Gästen – kleine Gesten mit großer Wirkung. Denn alles, was am und rund um den Faaker See geschieht, hinterlässt Spuren für das Wasser, für die Natur, für alle, die hier leben und urlauben. Das nächste Ziel für die Region: Das Erlangen des österreichischen Umweltzeichens für Destinationen.
Mehr zur Kampagne auf www.mein-see.at
Fortsetzung von Seite 21
den unterschiedlichen Interessen von Bund, Ländern und Gemeinden. Finanziell ist es für Letztere ein Vorteil, wenn sich Betriebe auf ihrem Gemeindegebiet ansiedeln. Mehr Einwohnerinnen und Unternehmen bedeuten mehr Steuergeld, das sie über den Finanzausgleich vom Bund bekommen. Ein ökologischer und ökonomischer Teufelskreis, aus dem auch die aktuelle Regierung einen Ausweg sucht.
ÖVP, SPÖ und Neos wollen bis 2026 einen Zielpfad erarbeiten, wie sie das 2,5-Hektar-Ziel erreichen und Bundesländer bei Planungs- und Widmungsfragen stärker in die Pflicht nehmen können. Für die Umweltschutzorganisation WWF zumindest ein positiver Aspekt des Regierungsprogramms. In bodenschutzrelevanten Punkten bleibt es sonst vage. Ist also ausgerechnet eine blau regierte Stadt Vorreiter, wenn es um Klimaschutz und Klimawandelanpassung geht? „Wir haben einen sehr starken Fokus auf Parkanlagen“, sagt der Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl (FPÖ). Entsiegelungsprojekte wie hier in Wels sind ein wichtiger Schritt, um Städte an eine immer heißere Welt anzupassen, Menschen vor Hitze zu schützen. Will man sich dem 2,5-Hektar-Ziel annähern, werden sie kün ig unumgänglich sein.
Es geht nicht mehr nur um Vermeidung weiterer Versiegelung, sondern längst auch darum, gesetzte Schritte rückgängig zu machen, bringt es Gernot Stöglehner, Professor für Raumplanung an der Boku, in seinem Buch „Rettet die Böden“ auf den Punkt. Das sieht auch der Bundesrechnungshof so: In einem neuen Bericht lobt er den neuen Volksgarten explizit und sieht das Projekt als Vorbild für andere Städte.
Dass so ein bedeutendes Entsiegelungsprojekt ausgerechnet in einer FPÖ-geführten Stadt umgesetzt wird, mag auf den ersten Blick verwundern. Doch Bürgermeister Rabl relativiert. Dass der neue Volksgarten zu einem „großen Klimaschutzprojekt hochstilisiert wird“, stört ihn. Sein selbsterklärtes Ziel ist ein anderes: „Das ist kein vorrangiges Klimaschutzprojekt, es ist ein Lebensqualitätsprojekt.“ Dass beide Dinge unzertrennlich miteinander verbunden sind, ist für ihn kein valides Argument: „Bei mir stehen die Menschen an erster Stelle und nicht das Klima. Wenn das zusammenkommt, ist es positiv. Nur für den Klimaschutz hätte ich es aber nicht gemacht.“ Seit 2021 ist auch der grüne Umwelt-Stadtrat Thomas Rammerstorfer in das Projekt involviert. Als Rabl 2015 zum ersten blauen Bürgermeister von Wels gewählt wurde, beschloss Rammerstorfer, auch in die Politik zu gehen: „Nicht aus Faszination, sondern weil ich immer zivilgesellschalich, ökologisch und antifaschistisch bewegt war.“ Das Hin und Her um die Deutungshoheit sieht er pragmatisch: „Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob Rabl dieses Umweltprojekt als Lebensqualität oder Heimatschutz

Die ehemaligen Veranstalter der Konzerthalle kamen im April ein letztes Mal zusammen (links), bald werden die Hallen (unten) abgerissen

oder was auch immer verkau .“ Die positive Wirkung ist für ihn unumstritten.
Mittlerweile beschreibt er die Zusammenarbeit als professionell. Trotzdem wird er nicht müde, zu erwähnen, dass im Gemeinderat niemand so o gegen „die Blauen“ stimmt wie seine Fraktion. In Rabl sieht er einen „ausgesprochen vifen Strategen“, der dieses Umweltprojekt auch ein Stück weit als „Mediengag nutzt, um sich ein Denkmal zu setzen“. Was er noch in ihm sieht: einen Populisten – mit allen Vor- und Nachteilen: „Er schafft es, sowohl das rechtsextreme Milieu bei der Stange zu halten als auch bis weit in das bürgerliche, liberale Spektrum vorzudringen.“
Auch wenn die Richtung beim neuen Volksgarten stimmt: Rund um Wels gingen zwischen 2018 und 2022 auch 26 Hektar Grünland verloren. Dabei würde genau dieses Grünland dabei helfen, „die städtische Lebensqualität auch bei veränderten klimatischen Verhältnissen nachhaltig zu sichern“, hält der Bundesrechnungshof in seinem Bericht fest. Und somit das Anliegen, das Bürgermeister Rabl so am Herzen liegt. Rammerstorfer sieht deshalb Handlungsbedarf: „Wir haben jetzt schon relativ viel Bauland, das noch nicht bebaut wurde. Bevor man neue Widmungen macht, müsste man zuerst das mobilisieren und bei den Umwidmungen auf die Bremse steigen.“
Diese Einschätzung teilt auch Barbara Birli, Expertin für Boden- und Flächenmanagement im Umweltbundesamt: „Das Beste für den Bodenschutz wäre es, gar nicht erst zu ver-
reiche Bewerbung für die Landesgartenschau 2027. Immerhin ziehe das Touristen an. Kosten wird dieses Leuchtturmprojekt rund 65 Millionen Euro. Dafür werde man sich intensiv um Förderungen bemühen, betont Rabl. Über neue Schulden müsse sich die Stadt aber ohnehin keine Gedanken machen. Finanziell stehe Wels mit Ersparnissen von rund 120 Millionen Euro auf stabilen Beinen. Zu verdanken ist das auch einem Verkauf von Aktienanteilen der Sparkasse Oberösterreich aus 2016. Erlös: 72 Millionen Euro. Neben den Abbrucharbeiten, der Umsetzung des Parks und den Kosten für die Landesgartenschau ist in den 65 Millionen auch der Bau einer neuen, modernen Messehalle inkludiert. Die Messe Wels zählt immerhin zu den erfolgreichsten Messegesellschaften Österreichs – und das soll auch so bleiben. „Wenn wir uns als Messestadt weiterhin vorne positionieren wollen, brauchen wir Ersatz. Die Hallen haben einfach nicht mehr den modernen Anforderungen entsprochen“, erklärt Rammerstorfer. Neu versiegelt müssen sie dafür nicht. Sie entstehen auf dem Gelände der alten Landwirtscha shallen, die bereits im Jänner 2025 auf dem Areal abgerissen wurden.
siegeln.“ Also nicht auf der grünen Wiese zu bauen, sondern alte Standorte – wie in Wels – zu „revitalisieren“. Entsiegeln ist teuer, technisch aufwendig und nicht überall durchführbar, ergänzt Elias Grinzinger, Projektassistent für Regionalplanung und Regionalentwicklung an der Technischen Universität Wien. Damit sich der Boden erholen und wieder wichtige Funktionen als Wasserspeicher oder Lebensraum wahrnehmen kann, bedarf es mehr, als Asphalt und Beton wegzureißen. Eventuell vorhandene Schadstoffe müssen abgetragen, der Boden gelockert und neuer Boden aufgetragen werden. „Durch Entsiegelung bekommt man nur manche Bodenfunktionen zurück, aber in keinem Fall alle“, betont Grinzinger. Bis der Boden wieder als landwirtscha liche Fläche zur Verfügung steht, kann das je nach Standort bis zu 100 Jahre dauern.
Dass am Messegelände Fläche entsiegelt wird, um dort eine große Parkanlage zu errichten, war nicht immer selbstverständlich. Wohnanlagen, ein 30-stöckiges Messehotel oder ein neuer Uni-Campus: Viele Ideen zirkulierten im Gemeinderat, bevor Bürgermeister Rabl das Projekt 2021 erstmals unter dem Namen „Central Park“ vorstellte. Ein Name, den er auch heute noch gerne verwendet, „weil sich die Leute darunter sehr schnell etwas vorstellen können“. Das „Sahnehäubchen“ war für Rabl jedoch die erfolg-
Doch bei all der guten Zusammenarbeit bei diesem Vorhaben: Blau und Grün bleiben politisch doch zwei Welten. In Wels lässt sich das an einem Zaun veranschaulichen, der den Park in den Nachtstunden absperren soll. Während Rabl sich bei dieser Maßnahme auf den Schutz vor Vandalismus beru , sind die Gründe, warum Rammerstorfer dem Zaun etwas abgewinnen kann, ganz andere: „Durch die Verringerung der Lichtverschmutzung und des Lärms ist es Kleintieren gerade in diesen ökologischen Zonen durchaus zuträglich.“ Die wahren Motiven des Bürgermeisters könnten andere sein, mutmaßt Rammerstorfer: Seit Jahren streitet die Stadt über ein Campierverbot für Roma und Sinti auf dem Messeparkplatz.
Doch nicht nur der Volksgarten hält den Welser Gemeinderat auf Trab, sondern auch das neue Mobilitätskonzept, an dem die Stadt gerade tü elt. 80 Prozent wünschen sich in einer Bürgerbefragung eine AutoVerkehrsberuhigung, Radinfrastruktur und öffentlicher Verkehr werden besonders schlecht bewertet. Auch der Messebetrieb, der Volksgarten und die Landesgartenschau fließen bereits in das Konzept mit ein. Ein Bahnanschluss am Messegelände ist bereits vorhanden.
Eines ist sicher: Die Folgen des Klimawandels machen auch vor Wels nicht halt. Sie sind bereits jetzt spürbar. Daran wird auch die kürzlich präsentierte Klimastrategie nichts ändern. Konkrete Handlungsanleitungen oder Empfehlungen sucht man darin nämlich vergeblich.
Die Geschichte von Wels erzählt aber nicht nur vom größten Entsiegelungsprojekt Österreichs. Sie ist auch eine Blaupause für rechte Parteien, wie sie der eigenen Klientel Klimaschutz verkaufen kann. F
ANALYSE:
SORAYA PECHTL
ILLUSTRATION:
ANTONIA ZEISS
Zu hören waren an diesem Tag nur Musik, Menschen, die sich unterhielten, und das Klingeln von Fahrradglocken. Keine Motorengeräusche, kein Gehupe. Am 2. Mai wurde der Wiener Gürtel für wenige Stunden zum Radhighway. Knapp 600 Menschen fuhren mit ihren Rädern beim vierten Gürtel-Bike-Ride über die Straße. Ziel ihres Protests: eine sichere Radinfrastruktur. Der Wiener Gürtel ist die meistbefahrene Landstraße Österreichs. Zwischen 60.000 und 70.000 Autos brettern täglich über bis zu vier Fahrspuren. Aber der Gürtel ist auch Lebensraum für hunderttausende Stadtbewohner, die den Abgasen und dem Dröhnen der Autos und Lkws ausgesetzt sind. Über 70 Dezibel zeigt die Lärmkarte des Klimaschutzministeriums hier an. Doch einen durchgängigen Gürtelradweg gibt es nicht. Die Radfahrer teilen sich den Weg über weite Strecken mit den Fußgängerinnen. „Das führt o zu Konflikten“, sagt Judith Brocza, Sprecherin der Initiativen „Radeln For Future“ und „Parents For Future“, die den Radprotest organisierten.
Ist das noch zeitgemäß? Sollte der Gürtel nach Pariser Vorbild zum grünen Boulevard mit Radweg werden? Oder braucht es die Straße, damit Grätzel vom Verkehr entlastet werden?
26. Mai, Neubaugürtel, Ecke Felberstraße. Der Frühverkehr hat nachgelassen, trotzdem ist viel los auf der vierspurigen Straße. Ein Lkw hupt einen zögerlichen Autofahrer an. Radfahrer schlängeln sich an den Fußgängern vorbei. Und am Mittelstreifen sind an diesem Tag zahlreiche Journalisten versammelt. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner präsentieren ihre Pläne für die Verbesserung des Gürtel-Radwegs. Viele würden sagen: Endlich!
Mitte Juni wird die innere Fahrspur auf dem Abschnitt zwischen Christian-BrodaPlatz und Stollgasse zu einem baulich getrennten Zweirichtungsradweg. Die Autofahrer haben auf diesem 250 Meter langen Abschnitt kün ig weniger Platz. 250 Meter klingen nicht nach viel, trotzdem bringt der Abschnitt deutliche Verbesserungen für den Radverkehr. Die zahlreichen Ampeln auf der Westbahnhof-Seite fallen weg, die Radler müssen nicht mehr so o anhalten, sie teilen sich den Streifen nicht mehr mit Fußgängerinnen und sie müssen die Straße nicht mehr queren, wenn sie am Gürtel entlangfahren wollen. Ist das der ersehnte Au akt zu einem Gürtel-Radhighway? Im neuen rot-pinken Regierungsprogramm ist zwar von einer Verbesserung des Gürtel-Radwegs die Rede, was das genau heißt, bleibt aber unklar.
Pläne dafür gebe es bereits. Die Grünen haben vor einem Jahr ihre Vision für einen grünen Gürtel vorgestellt. Lkws und
Wie viel Platz sollen Autos in der Stadt bekommen? Und wie viel Radfahrer
und Fußgängerinnen? Am Wiener Gürtel entzündet sich ein Streit um die Verkehrspolitik der Stadt
Autos sollen ab 2030 nur noch zwei anstatt vier Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung haben. Die freigewordene Fläche stünde für Pflanzen und Menschen bereit. Auf beiden Seiten könnte ein 3,5 Meter breiter Radschnellweg entstehen, wie ihn die Initiativen „Radeln For Future“ und „Parents For Future“ fordern.
Die Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), die Sima untersteht, war bisher gegen eine Verkehrsberuhigung am Gürtel. Schließlich sei dieser die Hauptverkehrsachse im Süden und Westen Wiens. Erst die Bündelung des Verkehrs am Gürtel ermögliche es, dass in angrenzenden Grätzeln weniger Autos fahren würden.
So sieht das auch die ÖVP – die dritte Partei, die den Gürtel umgestalten will. Geht es nach der Volkspartei, soll der Autoverkehr bleiben, aber am Margaretengürtel in einem Tunnel verschwinden. Zwischen Eichenstraße und Schönbrunner Straße soll eine 60.000 Quadratmeter große Grünfläche entstehen, die über die drei Fahrspuren ragt. Über den Lerchenfelder Gürtel soll ein auf Stelzen geführter Hoch-Radweg entstehen.
Die Frage, ob eine Verkehrsberuhigung am Gürtel sinnvoll ist, scheint die Stadt zu spalten. Ist sie überhaupt möglich?
Ja, sagt Barbara Laa, Verkehrswissenscha erin an der TU Wien. Nur Fahrspuren am Gürtel zu reduzieren wird aber nicht reichen. Wenn die Stadt wirklich wollte, müsste sie erst den Verkehr in den Grätzeln lähmen, etwa mit Bodenschwellen, Begegnungszonen und Tempolimits. Dann würden die Autos nicht vom Gürtel auf umliegende Straßen ausweichen. Der Automobilclub ÖAMTC hingegen sieht das ein wenig anders. „Die Verkehrsbelastung am Gürtel ist abschnittsweise sehr unterschiedlich. Man kann nicht einfach eine ganze Spur wegnehmen, sondern müsste jeden einzelnen Abschnitt gesondert prüfen“, sagt Matthias Nagler, Referent für Verkehrspolitik beim ÖAMTC.
Allerdings ist der Autoverkehr am Gürtel in den vergangenen Jahrzehnten teilweise um bis zu 15 Prozent zurückgegangen. Ein Trend, der sich mit weniger Fahrspuren fortsetzen könnte. „Wenn wir weniger Autoverkehr wollen, werden wir ihm weniger Fläche zur Verfügung stellen müssen“, sagt Laa. Derzeit sind rund 65 Prozent der Verkehrsfläche in Wien für den Autoverkehr vorgesehen. Radwege kommen nur auf ein Prozent.
Am Neubaugürtel – dort, wo nun ein Radweg entsteht – zeigt sich im Kleinen, dass der Autoverkehr auch mit weniger Fahrspuren auskommt. In den vergangenen eineinhalb Jahren war dort wegen einer Baustelle eine Fahrspur gesperrt. Laut Verkehrsanalysen der Stadt hatte das keine nennenswerten Auswirkungen auf den Fließverkehr. F
– und bis heute recht behält
BEGEGNUNG:
FLORIAN KLENK
FOTO:
HERIBERT CORN
W enn Hermann Knoflacher in Wien mit Journalisten unterwegs ist, trägt er manchmal ein Holzgestell auf den Schultern. Es sieht aus wie ein überdimensioniertes Quadrat mit Nummerntafeln –und wirkt auf Passanten wie ein Akt der Verzweiflung oder ein Stück Straßentheater. Manche lachen. Manche fotografieren. Manche schütteln den Kopf.
Was da auf den Gehsteigen Wiens wackelt, ist ein Statement. Es ist Knoflachers berühmtes „Gehzeug“, eine Mobilitätsskulptur, gebaut in den 1970er-Jahren, um zu zeigen, wie viel Platz ein Mensch beansprucht, sobald er sich in ein Auto setzt.
Knoflacher, Jahrgang 1940, emeritierter Professor für Verkehrsplanung an der Technischen Universität Wien, nennt das Gehzeug sein liebstes Argument gegen die Auto-Gesellscha .
Er hat sein ganzes Berufsleben gegen das Auto gekämp . Gegen das „Virus Auto“, wie er es auch in seinem vergriffenen Buch nennt.
Jahrzehntelang galt Knoflacher als spinnerter Weltverbesserer, belächelt von Autofahrern, ignoriert von Politikern, verspottet von Wirtscha slobbys. Heute ist vieles von dem, was er einst forderte, in Umsetzung oder wird von Fachleuten – viele davon seine Schüler – eingefordert. Wien diskutiert über autofreie Innenstädte, Fahrrad-Highways, verkehrsberuhigte Bezirke. Knoflacher wird in wenigen Wochen 85 Jahre alt. Zeit für eine Zwischenbilanz.
Ich traf ihn einmal an einem warmen Vormittag vor dem Institut für Verkehrsplanung in der Gußhausstraße. Er stand da wie ein Mahnmal mit seinem Gehzeug. Gelassen, höflich, klar in der Sprache. „Die Wiener DNA“, sagte er, „ist eine Fußgänger-DNA. Sie wurde nicht fürs Auto gebaut.“ Die Idee der autogerechten Stadt sei eine ideologische Wucherung des 20. Jahrhunderts gewesen. Jetzt sei es an der Zeit, sich zu erinnern, wie Wien einmal war – und wieder sein könnte.
Knoflacher kam 1959 zum Studium nach Wien. „Die Innenstadt war damals so verstaut wie heute die Südosttangente“, erzählt er. Mehr als 200.000 Autos strömten ins Zentrum, heute sind es nur ein Viertel. Die Geschä e hatten abends geschlossen, die Rollos waren heruntergelassen. Abgas-
geruch lag in der Lu , in den Hauseingängen warteten Huren auf Freier. „Es war ein Rotlichtviertel, durchzogen von Blechlawinen.“ Wiens Innere Stadt: Das war eine triste Zone im Verkehrskoma.
Der Paradigmenwechsel kam mit dem Bau der U1 in den frühen 70ern. Während der Bauarbeiten wurden zentrale Straßen gesperrt. Die Kärntner Straße. Der Stephansplatz. Auf einmal war da: Ruhe. Platz. Leben. Die Menschen blieben stehen, flanierten, begannen miteinander zu reden. Da hätten viele zum ersten Mal gesehen, wie schön Wien sein kann, erinnert sich Knoflacher. Und sie wollten mehr davon.
Der Widerstand war gewaltig. Der Stadtkern, hieß es, werde sterben, wenn keine Autos mehr hineinführen. Die Geschä sleute jammerten, die Medien skandalisierten, die Politiker warnten. „Alles Unfug“, sagt Knoflacher. „Nicht die Autos beleben eine Stadt. Die Menschen tun es.“ Wenn sie sich langsamer bewegen, werden sie aufmerksamer, kauffreudiger und legen mehr wert auf eine ästhetische Gestaltung der Stadt.
Es war nie Knoflachers Jugendtraum, die Stadt autofrei zu machen. Es war eine „wissenscha lich begründete Forderung“, wie er erzählt. Knoflacher kennt beide Seiten. Vor seiner akademischen Lau ahn war er selbst Bauingenieur, hat Brücken entworfen, Garagen geplant. Und für die Autoindustrie gearbeitet. Er war Teil des Systems, das er später bekämp e. Vielleicht verleiht ihm genau das seine Glaubwürdigkeit.
„Straßenbau ist gebaute Macht“, sagt er. Und spannt den Bogen zu den Römern. Wer herrschen will, braucht Straßen. Und Kontrolle.
Heute sind es nicht mehr die Imperatoren, sondern globale Konzerne, die sich die Infrastruktur untertan machen. Autobahnen werden – zugespitzt formuliert –für Konzerne wie Amazon gebaut, nicht für Menschen. „Die Gottheit heißt Kapitalwachstum. Und wir alle dienen ihr.“ Die großen Einkaufszentren in den Vororten sieht er wie „Wegelagerer“, die den Zentren die Kau ra abziehen.
Mitte der 1960er-Jahre beginnt Knoflacher, Verkehrsplanung als politische Wissenscha zu begreifen. Er stellt die erste, damals ketzerische These auf: Man kann Autoverkehr reduzieren, indem man ihn behindert. Rote Wellen, enge Gassen, Vorrang für Straßenbahnen, sogenannte „Ohrwascheln“. „Der Autofahrer muss Zeit verlieren“, erkannte Knoflacher. Nur so begrei er, dass die Bahn schneller, bequemer, besser ist.



Das „Gehzeug“ war der nächste Schritt. Eine Performance und ein juristisches Experiment zugleich. In der Straßenverkehrsordnung steht, dass öffentliche Straßen „von jedermann unter gleichen Bedingungen“ benutzbar sein müssen. Warum also, dachte sich Knoflacher, dürfen Autos so viel Platz einnehmen – und Fußgänger nicht?
Sein Holzrahmen ist exakt so groß wie ein Mittelklassewagen. Als er bei unserer Begegnung über die Mariahilfer Straße spazierte, zeigt die Skulptur: Das ist der Platz, den ein Mensch beanspruchen würde, wenn er ein Auto wäre. Niemand würde uns als Fußgänger diesen Platz gönnen. Warum gönnen wir ihn dem Auto?
Für Knoflacher ist das Auto also nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern eine Krankheit. Es verändert den Menschen, sagt er. Macht ihn rücksichtslos und gefährlich. Der Mensch sei im Allgemeinen kultiviert. Der Autofahrer nicht.
Wer sich ins Auto setzt, mutiert. Der Mensch als Autofahrer ist nicht mehr höflich, sondern er drängelt, hupt, riskiert. „Er bringt Leute um!“, sagt Knoflacher und verweist
Hermann
Knoflacher, geboren 1940, war Professor an der Technischen Universität Wien und prägte die Verkehrspolitik der Stadt wie kein anderer.
Seine Vision einer san en Mobilität machte ihn früh zum Vordenker. Heute gilt er als Pionier einer menschengerechten Stadtplanung.
Sein Buch „Virus Auto“ (Ueberreuter Verlag) ist antiquarisch erhältlich
auf die Zahlen. Weltweit sterben jährlich 1,3 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Vier Millionen an den Folgen von Abgasen und Lärm. Das ist eine „globale Pandemie“.
Was also tun? Die Antwort ist für Knoflacher klar: „Das Auto gehört an den Rand.“ Und zwar nicht in einem symbolischen Sinn, sondern ganz konkret: Es soll draußen bleiben aus den Städten. Die Innenstädte, die Ortskerne, die Lebensräume der Menschen sollen vom Auto entkoppelt werden. Nur dann, sagt er, entsteht wieder echtes Leben.
Er erzählt von Fußgängerzonen, die er geplant hat. Von Innenstädten, die au lühten. Von Dor ernen, die neu belebt wurden. Die Autos gingen. Die Menschen kamen. Sie gingen zu Fuß. Blieben stehen. Redeten. Entdeckten ihre Nachbarn. Es ist, als würde man eine Welt unter einer dicken Staubschicht wieder sichtbar machen.
Der Pendler, sagt er, ist kein Schicksal. Er ist ein Symptom. Und das Mittel gegen das Elend der Pendler sei nicht die Umfahrung, sondern die Dor elebung. Arbeitsplätze im Ort. Nahversorgung. Gemeinscha . Die Städte heilen – indem man auch das Land saniert.
Die Wiener Innenstadt ist eine Fußgängerstadt.
Da kann überhaupt nichts passieren, wenn ich da die Autos rausnehme. Das kann man von heute auf morgen machen
Hermann Knoflacher zeigt mit seinem „Gehzeug“, wie absurd viel Platz ein Auto braucht.
Heute fordert er: „Macht den Gürtel zur Fußgängerzone!“
Kritik, das weiß Knoflacher, hat ihn immer begleitet. Auch von Journalisten. Vor allem, wenn es um vermeintlich unantastbare Rechte geht, wie das Autofahren. Den täglichen Ö3-Verkehrsfunk nennt er eine „Nullmeldung“, wenn er keine Alternativen bietet. „Was bringt mir eine Staumeldung, wenn ich eh schon mittendrin bin?“ Er fordert eine neue Sprache für die Verkehrskommunikation. Keine Verharmlosung. Keine Lügen. Ehrlichkeit. Und Alternativen.
Am liebsten würde er die Ringstraße und sogar den Gürtel zur Fußgängerzone machen. „Das wäre heilsam“, sagt er. Und das meint er ernst. Nicht als Provokation, sondern als Therapie. Der Ring, der Gürtel, sie könnten zu Orten der Erholung werden, der Begegnung, des Handelns. Kein Chaos, keine Katastrophe. Nur eine Stadt, die sich wieder spürt.
Denn die Welt, so weiß Knoflacher, wird dort schön, wo sich die Menschen langsam bewegen. F
UM EIN DRITTEL ist die Zahl der Nachtzugverbindungen in Europa seit 2001 laut EU-Kommission geschrump . Doch in den vergangenen Jahren gab es wieder Aufschwung. Besonders durch die ÖBB. Diese fährt aktuell 25 europäische Metropolen per Nightjet an.
1/3
NACHTZUGVERBINDUNGEN
Um 8% sanken die dienstlichen Flugreisen zwischen 2013 und 2023, so Zahlen des VCÖ. Das Wirtscha swachstum entkoppelte sich in derselben Zeit von der Anzahl der Geschä sreisen. Der Vorteil von Videokonferenzen wurde vor allem während der Corona-Pandemie spürbarer.
So lange war das Schienennetz in Österreich Ende 2023. Zwischen 2000 und 2020 ist das Netz um neun Prozent geschrump – während das Netz an Autobahnen und Schnellstraßen im gleichen Zeitraum um rund 17 Prozent gewachsen ist, so der VCÖ. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das Bahn-Netz aber engmaschig.
In Europas Rad-Hauptstadt•Der Traum vom grünen Fliegen• Interview mit Viel-Zugfahrer Othmar Pruckner
TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ
D er Ausstoß von Treibhausgasen durch touristische Aktivitäten wächst einer aktuellen Studie zufolge doppelt so schnell wie die Emissionen der übrigen Wirtscha ssektoren. 2019 waren es fast neun Prozent der weltweiten Gesamtemissionen. Aus Sicht einer Spanischen Wegschnecke kann ich sagen, dass wir weder selbstbestimmt nach Österreich gekommen sind, noch aus Spanien, sondern aus Westfrankreich. Das bringt uns aber auch nicht mehr Sympathien, denn „eingewanderte“ Tierarten werden in vielen Ländern als Problem wahrgenommen. Mehr als 13.000 Arten importierten die Menschen seit der Entdeckung Amerikas und im Zuge der Globalisierung nach Europa. In Österreich werden von den 2000 gebietsfremden Spezies 88 als invasiv bezeichnet. Ursprünglich nannte man neu ins Land kommende Tier- und Pflanzenarten noch freundlich Adventivarten. Als die Freude verging, nannte man uns Neobiota, Neulebewesen, so als wären wir aus der Retorte wie Frankenstein. Jetzt verwendet man den Ausdruck „invasive Arten“. Doch fast immer waren Menschen daran schuld, dass Lebewesen aus ihren ursprünglichen Lebensräumen verschleppt wurden. Mit dem militärischen Begriff „Invasion“ erzeugt man das Bild einer geplanten Attacke durch feindliche Mächte. Andere sprechen
„Menschen erzeugen das Bild einer geplanten Attacke.“
von ökologisch minderwertigen Arten, die heimische Lebewesen durch Konkurrenz verdrängen, sich genetisch vermischen oder neue Krankheiten mitbringen. Wieder andere prangern Gehölzrassismus und Ökofaschismus an.
Die Diskussion über die „Gefährlichkeit“ einer Art wird entweder von wirtscha lichen Interessen
bestimmt (Agrar- oder Jagdkonkurrenz) oder man schiebt scheinheilig Naturschutzgründe vor. Die Weltnaturschutzunion IUCN verwaltet eine OnlineDatenbank zu den „One Hundred of the World’s Worst Invasive Alien Species“. Wir, die Spanischen Wegschnecken und der Schrecken aller Gärtner, sind in dieser Liste aber nicht zu finden. F

Christina, Stefanie und Magdalena Poxrucker Poxrucker Sisters: Dialektpop-Trio und Öffi-Enthusiastinnen
Das Waldviertel sei die größte Herausforderung. Doch Prinzipien sind
Prinzipien: Die Schwestern Magdalena, Stefanie und Christina Poxrucker machen Dialektpop – und touren öffentlich. „Im Auto zu sitzen ist so passiv“, sagt Magdalena Poxrucker. „Im Zug ist das kein Thema.“
Schon o haben sie dort gemeinsam an Liedern gefeilt, Au ri e geplant oder einfach Schwesternzeit verbracht. Seit es das Klimaticket
gibt, rentiert sich das sogar. Natürlich muss das Verhältnis stimmen: Viermal umzusteigen oder nachts nicht mehr heimzukommen, geht auch für die idealistischsten Öffi-Nutzer nicht. Auch das Equipment reist per Auto. Trotzdem haben die Schwestern dem Öffi-Fahren ein eigenes Lied gewidmet. In „Ja voi“ geht es darum, dass jeder und jede so sein kann, wie er oder sie will. „Viele sehen im Auto ein Prestigeobjekt, das Besitz anzeigt“, sagt Christina Poxrucker. „Wir sagen immer: Jeder Bus gehört auch uns.“

Wie Kopenhagen zur Welthauptstadt des Radfahrens wurde –und was Wien daraus lernen kann
STREIFZUG:
RUDI ANSCHOBER








Welcome“, sagt der Zugbegleiter und überreicht allen Fahrgästen im alten Sechserabteil lächelnd ein kleines Geschenk. Nichts Besonderes, ein Papiersack mit Wasser, Knäckebrot, Obst und einer kleinen Schokolade – und doch verändert diese Überraschung die Stimmung. Gerade überschreiten wir am Weg von Hamburg nach Kopenhagen die Grenze. Und es kommt Vorfreude auf.
Nach Jahrzehnten bin ich erstmals wieder in jenem Land, dessen Bewohner bei allen wissenscha lichen Erhebungen zu den glücklichsten der Welt gezählt werden. Zuerst die Ankun im altehrwürdigen Hauptbahnhof Kopenhagen H mit Anschlüssen an S-Bahn und Metro, dann wandere ich in Richtung Hotel in den Stadtteil Vesterbro; vorbei an der Freiheitssäule, ein 20 Meter hoher Obelisk, der an die Au ebung der Leibeigenscha im Jahr 1788 erinnert. Ich bleibe kurz stehen, etwas kommt mir hier ungewöhnlich vor: Es ist die Stille in dieser Stadt, kaum Autoverkehr. Die-
se Ruhe erinnert mich an das neue, umgebaute Paris, in dem kürzlich eine Erhebung der Airparif (die unabhängige Messorganisation der Region Île-de-France) eine Halbierung der Schadstoffe seit Beginn der großen Verkehrswende belegt hat. Doch hier in Kopenhagen scheint es mir noch ruhiger. Im Hotel angekommen, frage ich die Rezeptionistin Kaja, was da los sei. Sie lacht: „Das ist normal hier, du bist in Kopenhagen. Wir haben viel weniger Autoverkehr und dafür sehr viele Radfahrer.“ „Sind Sie auch Radfahrerin?“, frage ich. „Aber natürlich.“ Sie verstärkt ihr Lachen. „Das sind wir hier doch fast alle.“
Auch ihr Kollege, der jeden Morgen aus der Vorstadt mit dem Elektroauto voll Bio-Gebäck an seinen Arbeitsplatz kommt, stimmt zu: „Ich profitiere doch auch vom Fahrradkult. Mit jedem Fahrrad mehr steht einer weniger vor mir im Morgenstau.“ Kopenhagen gilt als die Welthauptstadt des Radfahrens. Aber stimmt das überhaupt? Ich bin hier, um das zu überprüfen.
Bei den internationalen Rankings der fahrradfreundlichsten Städte liegt Kopenhagen seit vielen Jahren unter den Top drei, meist an der Spitze. Vor wenigen Monaten wählte es das „Institut für Lebensqualität“ im Happy City Index 2025 an die Spitze. Auf breiten Gehsteigen, gut geschützt vor dem restlichen Verkehr, wandere ich in Richtung Rathaus und erlebe dort den ers-
ten, kleinen Stau. Nicht auf der Autostraße, sondern am breiten Radweg. Dicht an dicht fahren Radfahrer, halten sich an die rechte Seite ihrer Einbahn. Junge Menschen mit Rucksäcken und Kopfhörern, Frauen im Businesslook, Männer mit Anzug und einem Aktenkoffer im Fahrradkorb, junge Eltern mit Kindern. Dazwischen viele Lastenräder. Wenige überholen – ein Bild einer entspannten, gleichmäßigen Fortbewegung. Es ist immerhin Stoßzeit: Kopenhagen schaltet in dieser Zeit die Ampeln für Radfahrer auf grüne Welle. Das geht sich für jene aus, die mit 20 km/h unterwegs sind.
Ich komme zurück in mein Hotel. Rezeptionistin Kaja hat noch immer Dienst. Ich stehe vor ihr und schüttle den Kopf. „Eindrucksvoll, so viele Radfahrer. Macht ihr das wegen des Klimaschutzes?“, frage ich. „Ja, auch, aber du bist mit dem Rad in Kopenhagen einfach schneller, es ist gesund und schließlich sparen wir damit eine Menge Geld.“
Also leihe ich im Hotel ein Rad aus –Fahrräder gehören hier zur Infrastruktur –, nehme den erstbesten Radweg und beginne zu verstehen. Es ist zwar noch kühl, aber der Fahrtwind ist angenehm auf meiner Haut. Ich fühle mich durch die Breite der Radwege, die gute und einheitliche Markierung und das disziplinierte Verhalten der Radfahrer sicher. Ich erlebe keinen Radweg, der im Nichts landet, keine gefährliche Konkurrenz um Platz mit Autos. Die vielen Brücken für Radfahrer und Fußgänger über die zahlreichen Gewässer Kopenhagens ermöglichen es, dass das Fahrrad vielfach das schnellste Fahrzeug Kopenhagens ist. Sicherheit, Zeiteinsparung, Wertschätzung, Kultur – das waren die Trümpfe Kopenhagens auf dem Weg zur Radhauptstadt.
Radfahren hat in Kopenhagen Tradition. Im Hotel hängen Bilder, die die Geschichte Kopenhagens zeigen und belegen, dass bereits vor 100 Jahren das Fahrrad im Trend lag. Doch das war nicht immer so, zwei Turbos waren entscheidend.





Links: Der Autor mit dem Rikscha-Fahrer Mikkel, der Touristen so seit zehn Jahren durch die Stadt führt
Oben: Auch ein großer Teil der Kinder wird per Rad in Schule oder Kindergarten gebracht
Gerade als Anfang der 70er-Jahre die Autolobby immer mehr Druck machte, einen Vorrang für Autos forcierte, traf die Ölkrise das besonders von fossiler Energie abhängige Dänemark stark. Dieser Energieschock war der Auslöser für einen Kurswechsel: für die Errichtung eines dichten Fernwärmenetzes in den Gemeinden (in Kopenhagen werden mittlerweile über 90 Prozent der Haushalte durch Fernwärme versorgt); den Ausbau erneuerbarer Energieträger und der Energieeffizienz; und natürlich für das Radfahren, das in ganz Dänemark attraktiver wurde. Anders als viele andere Länder Europas blieb Dänemark konsequent bei diesem Kurs. Kein Wunder also, dass alle Parteien (mit einer Ausnahme) auch das aktuelle Klimagesetz beschlossen haben.
Den zweiten Entwicklungsschub für das Radfahren brachte die Uno-Weltklimakonferenz (COP) 2009 mit Kopenhagen als Gastgeber. Erstmals sollte in einer starken politischen Allianz, die vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama angeführt wurde, ein verbindlicher Weltklimavertrag für eine weltweite Klimawende sorgen. Als jedoch kurz vor der COP Klimaleugner wichtigen Klimaforschern die Manipulation von Daten vorwarfen, brachte diese Verleumdung Verunsicherung und ein Scheitern der Konferenz. Erst 2024 wurde der hauptbetroffene USForscher Michael E. Mann von Gerichten endgültig rehabilitiert.
Das zweite Ziel der dänischen Gastgeber nahm die Stadtregierung sofort nach der Weltklimakonferenz in Angriff: Kopenhagen, so der Plan, sollte zur attraktivsten Radfahrstadt der Welt ausgebaut werden. Radwelthauptstadt war Kopenhagen damit noch lange nicht. Obwohl es manche niederländische Gemeinden bestreiten: Heute gewinnt Kopenhagen in Serie den Preis für die radfahrerfreundlichste Stadt. 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner besitzen 140.000 Autos, aber 700.000 Fahrräder. Jede vierte Familie ist mit einem Lastenrad unterwegs. Mehr als 45 Prozent der Einwohner pendeln mit dem Rad zum Job und zur Ausbildung, innerstädtisch sind es sogar mehr als 60 Prozent. Das Fahrrad ist mittlerweile das wichtigste Verkehrsmittel der Stadt. Und es soll sogar noch besser werden: Alle zwei Jahre erscheint der RadBericht, der Entwicklungen und Verbesserungsnotwendigkeiten aufzeigt, untersucht, ob etwa die Zahl der Stellplätze für Fahrräder ausreicht und wo es eine Verbreiterung von Radwegen braucht. Diese Entwicklung hat viele Mütter und Väter, trägt aber vor allem einen Namen: Jan Gehl. Nach seinem Studium erhielt der Stadtplaner Mitte der 60er-Jahre ein Stipendium, das ihn für sechs Monate ins italienische Umbrien und in die Toskana brachte. Dort sollte er den Zusammen-
Fortsetzung nächste Seite
Rahmenprogramm zur Ausstellung
Grüne Wäsche Wien bis 28.09.2025
Kinderworkshop
Ungeheuer Grün Tomash Schoiswohl Di 01.07.2025, 11:00 – 14:00 Mi 02.07.2025, 11:00 – 14:00
Bikeride
Löwenzahn statt
Masterplan! Sebastian Hafner & Elina Kränzle Fr 11.07.2025, 17:00 – 19:00
140.000 Autos besitzen die 600.000 Einwohner der Stadt, aber 700.000
Fahrräder
45 Prozent der Kopenhagener pendeln mit dem Rad zur Arbeit und auch
38 Prozent der Kinder kommen so zur Schule sowie
60 Prozent der dänischen Parlamentarier
3 Prozent der Parkplätze sollen pro Jahr zu Rad- und Fußwegen werden
3 Kilometer pro Tag legen die Bewohner durchschni lich mit dem Rad zurück
Forum Greenwashing O ene Gesprächsrunde Fr 05.09.2025, 18:00 – 19:30
Filmscreening Taming the Garden Ein Dokumentarfilm von Salomé Jashi Mi 17.09.2025, 19:30 im Sophiengarten
Closing Solarmanufaktur & Urban Nomad Mixes Fr 26.09.2025, 14:00 – 17:00
Eine Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Wien, Fachbereich Kunst und Bild | Kontext Projektraum Garage im Innenhof des KunstHausWien. Museum Hundertwasser; Untere Weißgerberstr. 13; 1030 Wien; www.kunsthauswien.com
Fortsetzung von Seite 29
hang von Städteplanung, Gemeinscha und Lebensqualität erforschen. In seinem Buch „Public Spaces, Public Life“ schildert Gehl den Umbau Kopenhagens zur Stadt der Verkehrsberuhigung und des Radfahrens: angefangen mit der beispiellosen Radinfrastruktur und einem konsequenten Ausbau der Fußgängerzonen hin zu einer Stadt, die jedes Jahr drei Prozent der Parkplätze in Radund Fußwege umwandeln will.
Für Jan Gehl ist entscheidend, was zwischen den Häusern passiert. Er vergleicht die Stadt mit einer Party: Nur wo man sich wohlfühlt, bleibt man gerne. Sein Credo: „Viel zu lange haben wir Städte geplant, als wollten wir Autos glücklich machen. Dabei sollten Städte doch die Menschen glücklich machen.“
Immer wieder sehe ich hier in Kopenhagen auch Rikschas. Ich bestelle eines dieser Dreiräder. Nach kurzer Zeit holt mich Mikkel ab und schnell merke ich, dass dies ein Glücksgriff ist. Ein tolles Fahrgefühl, eine warme Decke um die Beine und Antworten auf viele Fragen.
„Seit wann fährst du mit der Rikscha?“
„Sicher schon zehn Jahre.“
„Ist das nicht sehr anstrengend?“
„Nein, denn ich habe ja meinen elektrischen Assistenten!“ Mikkel fährt wie all seine Kollegen ein E-Rikscha.
„Warum fahren die Dänen so viel mit dem Rad?“
„Weil es selbstverständlich ist. Weil es gesund, schnell und sicher ist. Weil die Parkplätze teuer sind. Und weil es wertgeschätzt wird! Siehst du die Haltegestelle an den Ampeln, damit Radfahrer nicht absteigen müssen? Die Pumpstationen, an denen wir vorbeigekommen sind? Oder die Mistkübel für Radfahrer, die erhöht und schräg angebracht sind? Das sind Nettigkeiten. Wir lernen das schon als Kinder.“
Später recherchiere ich, dass in Kopenhagen 38 Prozent der Schulkinder mit dem Rad in die Schule fahren (in Wien schätzen Verkehrsexperten vier Prozent) – und dazu kommen in Kopenhagen weitere sieben Prozent, die die Eltern mit dem Lastenrad bringen.
Aber was ist mit dem vielen Schlechtwetter, dem langen, kalten Winter? Mikkel lacht, zeigt auf seinen warmen Anorak und verweist auf wasserfeste Schuhe, die regenfeste Hose zum Überstreifen sowie die passenden Handschuhe, die er an seinem Arbeitsplatz immer gri ereit hat. Und tatsächlich habe ich in der kurzen Zeit nach meiner Ankun bereits mehrere Geschä e mit Schlechtwetterausrüstung für Radfahrer gesehen.
Kurz nach dem Abschied von Mikkel treffe ich auf Tim. Er ist Radmechaniker und mit seinem E-Bike, das zu einer fahrenden Werkstätte umgebaut wurde, im Einsatz. Tim patrouilliert durch die Stadt und repariert jene E-Bikes, die mit Defekten gestrandet sind. Wir kommen ins Gespräch. Er sieht vor allem die wirtschalichen Vorteile des Radverkehrs. So viele Touristen, viele Jobs, die es ohne Radboom nicht geben würde.
Die Stadt pflegt diesen Jobmotor, das Angebot für interessierte Touristen ist groß: Geleitete Radtouren informieren über die Geschichte der Stadtentwicklung, Radfahrten zu kulinarischen Verkostungen sind ge-



schnittswert bei weit über 85 Prozent. Das ist weltweit einzigartig.



Wieder eine Initiative, die vor 20 Jahren gestartet und konsequent ausgebaut wurde. Wieder sind dadurch viele kleine Unternehmen, vor allem am Stadtrand, entstanden. Und wieder stehen dabei Energie, Ernährung und natürlich das Fahrrad im Zentrum: Die Bewohner Kopenhagens fahren im Durchschnitt drei Kilometer pro Tag mit dem Rad. Ein Radwunder – nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Land: Die Dänen legen 21 Prozent jener Fahrten, die weniger als zehn Kilometer weit führen, mit dem Fahrrad zurück. In Österreich sind es laut Schätzungen von Verkehrsexperten rund sechs Prozent.




E-Rikschas, Lastenräder und andere Gefährte machen Kopenhagen zur Rad-Hauptstadt Europas
Wichtig dafür war der Ausbau der Infrastruktur, aber auch eine gewisse Lebenskultur, die rund um das Radfahren entstanden ist
Die wunderbare Radinfrastruktur, ein seit Jahrzehnten stabiler politischer Kurs bei der Mobilität, Wertschätzung und viel Bewusstseinsbildung sind die Eckpfeiler für das Fahrradwunder in Dänemark. Radfahren ist für viele ein Teil ihres Selbstverständnisses. Laut aktueller Erhebung fahren auch über 60 Prozent der dänischen Parlamentarier per Rad an ihren Arbeitsplatz.
Ich sitze in einem Kaffeehaus in der Nähe des Vergnügungsparks Tivoli, blättere durch Zeitungen und Magazine und spreche darüber mit anderen Gästen. Radfahren ist in jedem Medium Thema. Die eingesparten Krankenstandstage, das verringerte frühe Sterberisiko, die volkswirtscha lichen Einsparungen, die verbesserte Lu qualität, das Gemeinscha serlebnis, die Lebenskultur. Doch auch an Kritik fehlt es nicht: breiter müssten manche Radwege werden, es brauche mehr Raum für das Rad, vor allem mehr Stellplätze.
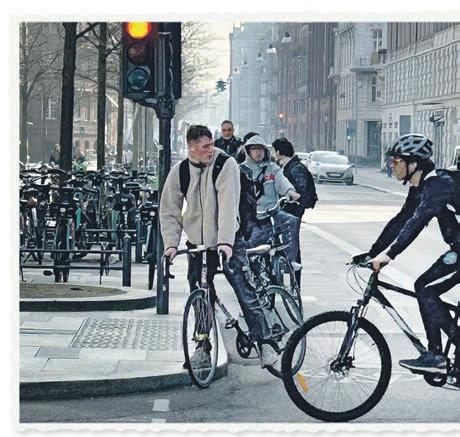


fragt, Initiativen zeigen aber auch das nachhaltige Kopenhagen. Da geht es dann per Rad zum Backsteingebäude beim Bahnhof, das unbemerkt von Passanten mit zwei Großwärmepumpen Fernkälte für Krankenhäuser und Büros produziert und den aufgeheizten Rückfluss zur Wärmegewinnung verarbeitet. Berichtet wird bei den nachhaltigen Radtouren auch von der Umstellung der fast 1000 öffentlichen Küchen Kopenhagens auf bio: Mittlerweile liegt der Durch-
Unten am Hafen wird mir bewusst, was eine der heutigen Schlagzeilen bedeutet: Aktuelle Studien erwarten bei anhaltendem Trend einen Anstieg des Meeresspiegels. Schon in den nächsten 50 Jahren könnten es bis zu 74 Zentimeter sein, das würde 500.000 Gebäude in Dänemark gefährden.
Dänemark leistet seinen Beitrag zur Klimawende – und das mit bemerkenswerter Einigkeit: als Vorreiter bei der Wärmewende, die nun verstärkt auf Meerwasser-Großwärmepumpen setzt, als erstes Mitgliedsland der EU, das die Renaturierungsvorgaben nach gemeinsamem Beschluss von Regierung, Klimaschutzbewegung und Landwirtscha erfüllen will – durch einen Rückbau von zehn Prozent (also 390.000 Hektar) der landwirtschalichen Flächen. Zusammen mit dem Ziel, Fleisch- und Milchproduktion zu verringern, wird das der größte Umbau der dänischen Landwirtscha seit 100 Jahren.
Doch auch eine internationale Bewerbung des Erfolgskonzeptes gehört dazu. Dafür wurde 2009 die „Cycling Embassy“ gegründet. Sie soll Radfahren auf der ganzen Welt mit Expertise unterstützen. Ein Beispiel kann man auf der Website der dänischen Botscha mit Sitz in Wien nachlesen: „Die Botscha hat einen eigenen Aktionsplan, um unseren Arbeitsplatz (noch) grüner zu gestalten. Ein wichtiger Teil unseres Alltags ist somit das Fahrradfahren – egal ob zu einem Treffen in einem Ministerium oder von der Botscha nach Hause.“
Wer weiß, vielleicht färbt das ja bald auf die Stadt ab. F
Die europäische Lu fahrtindustrie hat sich strenge CO2 -Regeln verpasst. Die Frage ist nur, wie sie dahin kommen will. Denn der Rohstoff dafür ist viel zu knapp
BERICHT:
EVA KONZETT
W
enn Sie das nächste Mal in einen strahlend blauen, ungestörten Himmel schauen, dann denken Sie an Pommes frites! Die knusprigen Kartoffelstäbchen haben nämlich einiges mit umweltfreundlichem Flugverkehr zu tun. Sie teilen sich die Grundlage – Speiseöl. Wenn auch in einer geordneten Reihenfolge. Aus recycelten Speiseresten, Speisefetten und eben aus Frittieröl kann man nämlich nachhaltigen Treibstoff für Flugzeuge machen.
Derzeit verursachen Flugreisen – die Jumbojets zwischen München und Shanghai oder die Kurzstreckenflieger von Wien nach Barcelona – insgesamt rund drei Prozent aller globalen Treibhausgas-Emissionen. Zweifach schadet ein Flug dem Klima: zum einen durch den CO2-Ausstoß, zum anderen durch die Bildung von Kondensstreifen. Aus dem Ruß der Abgase werden Eiskristalle und die spiegeln die Erdwärme auf die Erde zurück.
Davon will niemand Geringerer wegkommen als die Fluggesellscha en selbst. Sie haben sich das Ziel verpasst, bis Mitte des Jahrhunderts keine klimaschädlichen Gase mehr auszustoßen. Weil die Menschen (und die Waren) nicht wieder auf Dampfschiffe des vorvergangenen Jahrhunderts setzen werden, muss das Fliegen grüner werden. Und weil aber anders als beim Automobil ein Batteriebetrieb vor allem für Jumbojets auf der Langstrecke technisch quasi unmöglich ist, müssen andere Kra stoffe in den Tank hinein.
Gesetzlich schiebt die EU das Vorhaben an: Seit 2025 müssen dem Kerosin auf europäischen Großflughäfen (mit mehr als 800.000 Passagieren pro Jahr) zwei Prozent nachhaltige Treibstoffe beigemischt werden. Ab 2030 müssen es sogar sechs Prozent sein. Das sind viele Altfrittierkanister. Und hier beginnt auch das große Problem: Keiner der nachhaltigen Treibstoffe hat derzeit genügend Rohstoffe. Der Traum vom grünen Flugverkehr ist also vor allem eines: eine Geschichte der Knappheit.
In Österreich erzeugt die teilstaatliche OMV in der Raffinerie in Schwechat mit
Rohstoffen eines Altspeiseölsammlers aus dem steirischen Sinabelkirchen nachhaltige Flugtreibstoffe. Die beiden größten Flughäfen des Landes – jener in Schwechat und jener in Salzburg – können damit auskommen. Global gesehen aber essen die Menschen nicht genügend Pommes frites und Chicken Nuggets um die Flugindustrie damit antreiben zu können.
Auch deshalb testet das Unternehmen „die Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen, darunter land- und forstwirtscha liche Reststoffe und Siedlungsabfälle“, wie es vonseiten der OMV heißt. Marktreif ist das nicht.
Ingenieure arbeiten an weiteren Verfahren, etwa dem PtL, das steht für Power-to-Liquid. Mittels Elektrolyse entsteht aus Wasser Wasserstoff, der dann in einem mehrstufigen Verfahren zu Flüssigkra stoff zusammengebaut wird.
Das Verfahren braucht sehr viel Strom. Wenn dieser nicht aus erneuerbaren Quellen stammt, ist das sogenannte E-Kerosin nicht umweltverträglicher als der Kra stoff aus fossilen Rohstoffen. Die OMV baut dafür eine große Anlage in der rumänischen Raffinerie Petrobrazi. Sie soll mit grünem Wasserstoff betrieben werden.
Umweltschonende Treibstoffe können auch aus Biomasse wie Raps oder Mais gemacht werden. Ein solcher Ackerbau würde aber der Nahrungsmittelproduktion im Weg stehen. Deshalb haben sich Fluglinien verpflichtet, solche Kra stoffe nicht einzusetzen.
Heuer werden weltweit circa zwei Millionen Tonnen Sustainable Aviation Fuel (SAF), also nachhaltiger Flugkra stoff, produziert. Das ist weniger als ein Prozent des Treibsto edarfs für die Flugindustrie. Das geht sogar den höchsten Branchenvertretern nicht schnell genug: „Die Mengen an nachhaltigem Flugkra stoff steigen, aber leider nur enttäuschend langsam. Die Regierungen senden widersprüchliche Signale an die Ölkonzerne, die weiterhin Subventionen für die Erschließung und Förderung von fossilem Öl und Gas erhalten“, heißt es
ILLUSTRATION:
in einer Presseaussendung des internationalen Dachverbands der Fluggesellscha en IATA vom Dezember 2024. Der Verband liefert auch Zahlen: Um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen (Netto-Null-Emissionen) müssen zwischen 3000 und 6500 neue Anlagen errichtet werden, die nachhaltige Kra stoffe produzieren. Laut IATA müssten man dafür 128 Milliarden Dollar investieren. Und das jedes Jahr.
Doch das ist nicht das einzige Problem. SAF ist in der Produktion deutlich teurer als Kerosin. Je nach Herstellungsart müssen Fluggesellscha en dafür das Vierfache bezahlen. Investoren sind zögerlich, viel Geld für Klimamaßnahmen hinzulegen. Zu wirr sind die Signale aus der Politik, die etwa im Automobilsektor Auflagen und Förderungen wieder gestrichen hat. Und: Alle Prognosen gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen fliegen werden. Da kann dann der CO2-Abdruck des einzelnen Passagiers sinken, in Summe steigen die Emissionen trotzdem an. Dass die Flugindustrie die selbstgesteckten Ziele verfehlen könnte, gibt die IATA mittlerweile offen zu.
Dabei hä en nachhaltige Treibstoffe in den Flugzeugen einen weiteren, o mals nicht bedachten Effekt. Sie verringern die Rußpartikel im Ausstoß und verkleinern die Kondensstreifen. Diese und die sich daraus bildenden Zirruswolken haben laut Angaben des Deutschen Zentrums für Lu fahrt eine klimaschädlichere Wirkung als alle in den vergangenen 100 Jahren in der Lu fahrt entstandenen Kohlendioxid-Emissionen. Linienflugzeuge haben eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, je nachdem wie o sie gewartet und wie stark sie beansprucht werden. Frachtflieger können 40 Jahre und mehr im Einsatz sein. Ältere Triebwerke brauchen nur im Kerosin enthaltene Schmiermittel, sie könnten mit reinem SAF gar nicht abheben. Neue Modelle sind technisch dafür schon aufgerüstet. Seit 2018 forscht das Deutsche Zentrum für Lu fahrt deshalb gemeinsam mit der amerikanischen Nasa an SAF-Varianten. Dafür ließen sie einen mit einem Kerosin-SAF-Gemisch betankten Airbus A320 mehrfach von der Ramstein Air Base aufsteigen. Messflugzeuge flogen zwei Minuten später hinterher. Die Versuche zeigten: Es bildeten sich deutlich weniger Eiskristalle und damit weniger Kondensstreifen. Der Traum vom grünen Fliegen würde wieder einen streifenlosen Himmel bringen. Nur mit Schäfchenwolken drinnen. F

„Die Koralmbahn bringt eine Zeitenwende“
Der Viel-Zugfahrer Othmar Pruckner über überraschend einfache Reiseziele, wie viel die Koralmbahn verändern wird und warum er kein fanatischer „Pufferküsser“ ist
Othmar Pruckner, 68, besteigt in kurzen Abständen zwei Verkehrsmittel: erstens Rennräder. Zweitens Züge. Rund um seinen Wohnort Langenlois im Kamptal tritt er genauso in die Pedale wie entlang der Donau: Da durchquerte der gelernte Geograf und Germanist acht von zehn Staaten, die der Strom verbindet. Heraus kam das Buch „Donauabwärts. In 33 Tagen mit dem Fahrrad vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer“ (2024). Auch aus dem Zugfenster hat der frühere Trend-Redakteur schon große Teile Europas vorüberziehen gesehen. 2022, kurz nach Einführung des Klimatickets, schrieb er das Reisebuch „Auf Schiene. 33 Bahnreisen durch Österreich und darüber hinaus“ (beide Titel sind im Falter Verlag erschienen). Gern spannt der Autor seine beiden Lieblingsfortbewegungsmittel zusammen – und packt das Rad kurzerhand in den Zug.
Falter: Herr Pruckner, 1992 war Bahnfahren ziemlich out, Sie haben aber schon damals Ihr erstes Zugreisebuch publiziert. Haben Sie schon im Kinderzimmer Weichen gestellt? Oder gab es später ein eisenbahnerisches Erweckungserlebnis?
Othmar Pruckner: Weder noch. Es hat wohl mit einer Interrailreise angefangen, und in Studientagen bin ich einige Male mit dem Wien-Oostende-Express nach London gefahren. Auch durch die Türkei bis Tiflis in Georgien bin ich gegondelt, nach Lemberg,
ZUG-GESPRÄCH:
GERLINDE PÖLSLER
nach Sizilien. Und in den USA von Houston nach New Orleans. Extremreisen habe ich aber keine gemacht.
Haben Sie je eine richtige Katastrophenfahrt erlebt?
Pruckner: Nein, Katastrophenfahrt nicht ... Aber ich wollte einmal mitsamt dem Rad zur Quelle der Donau, nach Donaueschingen, fahren, und da hat gar nichts funktioniert. Der Zug war überfüllt, er ist wegen technischer Probleme stehen geblieben, natürlich habe ich zweimal den Anschluss verpasst – alles, was sich an schlechter Zugqualität vorstellen lässt, ist passiert. Und zwar nicht in Rumänien oder Bulgarien, sondern 2023 in Deutschland.
Abseits von Städtedestinationen schrecken viele Leute vor Ausflügen oder Reisen mit der Bahn zurück – sie meinen, es sei so umständlich und vieles funktioniere nicht …
Pruckner: Natürlich kommt man nicht überall mit dem Zug hin – für mich ist aber immer wieder überraschend, wo man doch überall hinkommt. Wer weiß schon, dass man nach Hallstatt leicht und bequem mit der Bahn reisen kann? Schon die Fahrt ab Gmunden entlang von Traunstein, Traunsee und Traunfluss ist ein Erlebnis, und die letzte Meile macht man auf dem See-
Der Journalist Othmar Pruckner kombiniert am liebsten zwei Verkehrsmi el: Fahrräder und Züge – und schreibt darüber
weg, nämlich per Motorfähre. Es geht beim Bahnfahren immer auch um die Fahrt an sich, um den Landscha sfilm, der draußen abläu .
Skeptiker sehen sich schon irgendwo in der Landscha herumstehen, an einem einsamen Bahnhof, weit weg vom See oder Wanderweg, zu dem sie wollen.
Pruckner: Gerade viele Wanderungen kann man direkt von kleinen Stationen ausgehend machen. Auch zum Wasser kommt man gut. Ab Wien ist man beispielsweise in einer Stunde in Langenlois mit seinem Kamp-Flussbad. Ganz wunderbar gelangt man an den noblen Attersee: Vom Bahnhof zehn Minuten zu Fuß und man ist beim ruhigsten und schattigsten Strand, der vorstellbar ist. Auch das Bodenseeufer ist bequem erreichbar. Bei den Kärntner Seen heißt es vielleicht einmal ein Stück mit dem Bus fahren, aber möglich ist sehr viel. Es braucht halt ein bisschen Vorbereitung. Wobei das mit der weiten Entfernung manchmal ja auch stimmt. Vom Bahnhof Neusiedl, schreiben Sie, gehe man zu Fuß fast eine Stunde bis zum See. Bei dieser Tour – und auch etlichen anderen –empfehlen Sie daher, das Rad einzupacken. Wie einfach oder kompliziert ist das denn?
Pruckner: Es gibt ein paar richtige Radshuttle-Verbindungen mit eigenen Radwaggons, zum Beispiel vom Osttiroler Lienz bis nach Südtirol. Da sind hunderte Radfahrer pro Tag unterwegs. Auf den Hauptstrecken aber sind die Plätze sehr beschränkt. Wenn man da einen Anschlusszug versäumt, wird es schwierig, weil man dann keinen reservierten Platz für das Rad mehr hat und sich hineinschummeln muss.
Mit Rad muss man also auf jeden Fall vorher reservieren?
Pruckner: Auf den Hauptstrecken ja. In den Regionalexpresszügen nicht. Wenn man nach Znaim oder Retz oder Krems will, funktioniert das auch so sehr gut.
Sind Sie schon mal am Bahnsteig stehen geblieben und konnten nicht mit, weil das Rad keinen Platz mehr hatte?
Pruckner: Auf der Fahrt von Berlin nach Wien ist mir das beinahe mal so gegangen. Die reservierten Radabteile waren vollgestop mit Gepäck von anderen Reisenden, in den Zug noch hineinzukommen war eine Meisterleistung.
Im Dezember nimmt die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ihren Betrieb auf, Sie arbeiten gerade an einem Buch darüber: „Mit Highspeed in den Süden“. Die Fahrzeit zwischen den zwei Landeshauptstädten verkürzt sich von drei Stunden auf sagenha e 45 Minuten. Was bedeutet das für das Bahnfahren in Österreich?
Pruckner: Das bringt schon eine Zeitenwende. Auch von Wien ist Klagenfurt dann in drei Stunden 20 zu erreichen. Und wenn 2030 auch der Semmeringtunnel fertig wird, verkürzt sich diese Zeit nochmals auf zwei Stunden 40. Das wird Fahrgastzuwächse wie seinerzeit beim Start der neuen Westbahn bringen. Durch diese gelangt
man heute mit dem Zug viel schneller von Wien nach Salzburg als mit dem Auto, und dasselbe passiert nun in Richtung Süden. Das macht die Bahn viel konkurrenzfähiger.
So schnell die Fahrt mit der Koralmbahn wird, so lange hat es bis zu ihrem Bau gedauert.
Pruckner: Ja, die ersten Zeichnungen dazu entstanden Mitte der 1980er-Jahre.
Wer hat die ersten Ideen aufgebracht?
Pruckner: Es gibt eine Reinzeichnung aus dem Jahr 1985 mit dem Titel „Koralpenbahn Graz-Klagenfurt, Pilotstudie“ vom Grazer TU-Professor Karl Klugar. Sein Nachfolger Klaus Rießberger verfeinerte die Planungen. Ein Jahrzehnt später hat die damalige „Hochleistungs-AG“ der ÖBB mit ernstha en Planungen begonnen. Lange Zeit wollten aber in Wahrheit weder die Bundespolitik noch die ÖBB die Strecke haben: Zu hohe Kosten für zu wenig Nutzen, dachte man. Wirklich gewollt haben es die Länder Steiermark und Kärnten und ihre damaligen Landeshauptleute Waltraud Klasnic (ÖVP) und Jörg Haider (FPÖ). Als dann 2000 plötzlich die schwarz-blaue Bundesregierung am Ruder war, haben die beiden die Koralmbahn bei Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) regelrecht durchgedrückt.
Wie ist ihnen das gelungen?
Pruckner: Haider hat seine Verkehrsministerin Monika Forstinger regelrecht erpresst: Macht die Gelder dafür frei, oder ich stelle die Koalitionsfrage! Ab 2004 haben die Planungen dann Fahrt aufgenommen, der erste Koralmbahn-Vertrag wurde unterschrieben.
Wohin wird Sie Ihre erste Reise mit der Koralmbahn führen?
Pruckner: Die habe ich schon hinter mir: Ich war bei einer Testfahrt dabei, am Führerstand einer Taurus-Lok mit 250 km/h durch den Tunnel – ein Bubentraum! Wenn die Bahn dann fertig ist, werde ich ö er ins Lavanttal fahren, das ich sehr gerne mag, ebenso wie auf die Koralm oder ins steirische Schilcherland. Und überall werde ich das Rad mitnehmen.
In Ihrem Buch schlagen Sie auch mehrere Ausflüge mit alten österreichischen Lokalbahnen vor. Haben Sie eine Favoritin?
Pruckner: Hm … Vielleicht die Waldviertler Schmalspurbahnen, die nicht mehr im Re-
gelbetrieb unterwegs sind. So eine Dampflok ist für mich der Inbegriff einer Maschine. Man muss kein fanatischer Pufferküsser sein, um diese pfauchenden, frühen Wunderwerke der Technik zu mögen. Diese Züge und Loks erzählen, wie vor 100 oder 150 Jahren gereist und die Landscha erobert wurde.
Sie empfehlen auch etliche Kurzreisen über Österreichs Grenzen hinaus. Wo ist man denn von Wien aus sehr rasch, woran man vielleicht gar nicht denkt?
Pruckner: Ich war vor kurzem wieder im tschechischen Znaim, das ist eine wunderbare Stadt mit schönen Plätzen, und die Fahrt dauert ab Wien nicht einmal zwei Stunden. In gut 70 Minuten ist man im ungarischen Győr, in knapp eineinhalb Stunden in der altbewährten Einkaufsstadt Sopron und in dreieinhalb Stunden in Budweis. Schon o besucht habe ich Bratislava: Ich mache eine Strecke mit der Bahn und eine mit dem Rad.
Wie schaut’s denn in anderen Ländern aus, wenn man ein Rad mitnehmen will?
Pruckner: Da muss man leider sagen: Im Osten Europas ist es eigentlich nicht möglich. Außer man zerlegt sein Rad.
Schon mal gemacht?
Pruckner: Ich habe das schon zerlegt, ja. Da war ich mit Freunden unterwegs, die mir geholfen haben. Man muss die Pedale abbauen, die Räder, alles, bis aus dem Rad ein Paket geworden ist. Das dauert schon zwei bis drei Stunden, man braucht Werkzeug … Das überlegt man sich halt zehn Mal.
Welche Nachtzugreisen können Sie denn empfehlen?
Pruckner: Zum Beispiel eine Abenteuerreise ins kroatische Split, das ich sehr liebe!
Wieso ist das eine Abenteuerreise?
Pruckner: Die Waggons sind gefühlt mindestens 50 Jahre alt, der Zug hat keine Klimaanlage, zuletzt ist nur mehr eine altersschwache Diesellok vorgespannt, es geht sehr langsam und meist mit Verspä-

tung voran. Dafür sind die letzten Stunden durchs einsame Dalmatien landschalich eindrucksvoll. Frühstück gibt es keines, aber immerhin ist man nach einer Nacht in Split, von wo man gut mit der Fähre weiterkommt. Auch Zürich, Berlin, Venedig, Rom, Warschau und dann weiter nach Danzig –das geht alles sehr gut mit dem Nachtzug.
Für Zugreisen über mehrere Länder ist es auch gar nicht so einfach, alle Tickets zu organisieren … Pruckner: Genau, wir waren zuletzt in Cluj, im rumänischen Transsilvanien. Ab Wien geht’s mit dem Schlafwagen nach Alba Iulia. Dort muss man umsteigen, das Anschlussticket kann man in Österreich nicht so einfach kaufen. Man kann es aber zum Beispiel über die Website der Rumänischen Staatsbahn suchen und buchen.
Sehen Sie Bemühungen in diese Richtung?
Pruckner: Nicht wirklich. Die nationalen Bahnverwaltungen sind sehr eigenbrötlerisch und einander nicht koscher. Wir haben es mit einem großen Flickwerk zu tun, im europäischen Bahnverkehr gibt es allein vier Stromsysteme. ÖBB-Chef Andreas Matthä, der auch Präsident der europäischen Bahnen ist, bemüht sich sehr um mehr Zusammenarbeit, aber da sind harte Bretter zu bohren. Die Bahn ist zwar als Klimaretter erkannt worden, aber um sie konkurrenzfähig zu machen, müsste viel mehr Geld hineinfließen.
Wie steht Österreich im Vergleich da?
Pruckner: In Österreich ist 50 Jahre lang, bis in die Nullerjahre, alles Geld in die Straße geflossen und kaum etwas in die Schiene. Dennoch steht Österreich beim Bahnausbau wesentlich besser da als etwa Deutschland und viele andere europäische Länder.
Nun werden aber auch Investitionsprojekte der ÖBB aufgeschoben, insgesamt 26 quer durchs Land. Und Lokalbahnen wie der Mühltal- und Hausruckbahn droht gar die Einstellung. Wird auch hier budgetbedingt die Schiene zu sehr ausgebremst?
Pruckner: Das finde ich schon sehr schade, es werden auch dringende Projekte aufgeschoben. Die gute Nachricht ist: Es wird weitergebaut, wenn auch langsamer.
Können Sie zum Schluss noch einen Geheimtipp verraten?
Pruckner: Ja, tatsächlich – etwas, das mich auch reizt: Mit dem Autoreise- und Schlafwagenzug von Villach in die Türkei, bis nach Edirne zu fahren. Dieser Zug fährt einmal in der Woche, die Reise dauert drei Nächte und zwei Tage. Die Verbindung findet man nicht im Suchsystem Scotty, weil sie privat betrieben wird. Und so gibt es – vermute ich – noch einige andere Geheimnisse auf Österreichs Gleisen, von denen zumindest ich absolut keine Ahnung habe. F
Reisen mit Bahn und Bus: So geht’s
traivelling.com
Nach Madrid, Tiflis oder Stockholm direkt buchen: Die Wiener Buchungspla form macht das seit Ende Juni möglich. Traivelling will die sinnvollsten und günstigsten Routen für Reisen in ganz Europa, nach Asien und Nordafrika finden.
www.trainline.com
Hier lassen sich Bahn- und Bustickets verschiedener Anbieter für ganz Europa vergleichen und buchen.
www.omio.com
Diese Pla form ermöglicht den Vergleich von Flug-, Zug-, Fähren- und Bustickets.
www.zugpost.de Viele, viele Tipps für und Geschichten über das Zugfahren
bahn-zum-berg.at Großes Öffi-Bergtourenportal. Auf Wunsch jede Woche Zusendung eines personalisierten Newsle ers mit ÖV-Touren, die vom angegebenen Wohnort aus erreichbar sind.

Othmar Pruckner: Auf Schiene. 33 Bahnreisen durch Österreich und darüber hinaus. Falter Verlag, 320 S., € 29,95
Die Waldviertelbahn ist eine der verbliebenen Lokalbahnen. Sie fährt von Gmünd nach Litschau, Heidenreichstein und Groß Gerungs
TREIBHAUSGASAUSSTOSS — 50 %
40 BIS 50 PROZENT weniger Treibhausgasausstoß als ein vergleichbarer Verbrenner verursachen E-Autos. Es entstehen bei der Herstellung zwar o mehr Emissionen, das wird aber im Betrieb ausgeglichen. So eine Überblicksstudie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Wer zuhause oder in der Arbeit einen Ladeplatz hat, kommt sogar günstiger weg.
500.000
TONNEN REIFENABRIEB entstehen pro Jahr in Europa, zeigen verschiedene Studien. Ein einzelnes Fahrzeug produziert dabei 120 Gramm dieses Mikroplastiks pro 1000 gefahrenen Kilometern – das dann Gewässer, Böden, ihre zahlreichen Bewohner und so auch Menschen belastet. Ab 2028 soll EU-weit eine neue Abgasnorm gelten, die den Reifenabrieb, aber auch die Lebensdauer von Elektrofahrzeug-Batterien regelt.
0,8
ZWISCHEN UND
8,5
MILLIONEN TONNEN CO2-ÄQUIVALENTE PRO JAHR könnten im Verkehrssektor reduziert werden, so der zweite österreichische Klima-Sachstandsbericht. Besonders der Umstieg auf E-Mobilität und technologische Verbesserungen bei Pkws und Lkws könnten hier helfen. Und noch eine wichtige Maßnahme heben die Fachleute im Bericht hervor: eine Reform des „Tanktourismus“.
Zu Besuch in der Stanz•Die kühnsten Mobilitätsutopien•Das Grüne Band•Bücher, Dokus • Pro/Contra
„Unsere Ausrottung wäre klimatisch ein Fehler.“
TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ
Ö sterreicher lieben uns Blauwale, während man uns in anderen Ländern zum Fressen gern hatte. Unsere Population war nach dem Zweiten Weltkrieg durch die rücksichtslose Bejagung auf nur noch 2000 bis 3000 Individuen zurückgegangen, bevor 1946 das Internationale Übereinkommen zur Regelung des Walfangs beschlossen wurde. Mittlerweile gibt es wieder 10.000 bis 25.000 von uns, was aber trotzdem nur drei bis elf Prozent des Gesamtbestandes im Jahr 1911 ausmacht.
Unsere Ausrottung wäre nicht nur moralisch, sondern auch klimatisch ein großer Fehler gewesen: Unsere Wal-Art konsumiert von allen marinen Säugetieren die größte Menge an Plankton und anderen Meerestieren und speichert damit Kohlenstoff. Da diese Organismen ebenfalls Kohlenstoff aufgenommen und in ihren Körpern ge-
speichert haben, werden auf diese Weise relevante Mengen dem CO 2 -Kreislauf entzogen. Wenn wir sterben, sinken unsere Körper auf den Meeresgrund, wodurch große Mengen Kohlenstoff in die Tiefsee transportieren werden. Zusätzlich tragen wir auch indirekt zur Kohlensto indung bei, indem wir Nährstoffe in Form von Kot oder Urin wieder ins Meer abgeben. Diese Nährstoffe fördern das Wachstum von Phytoplankton (pflanzliche Kleinstlebewesen), wodurch wiederum Kohlenstoff aus dem Meerwasser aufgenommen wird.
In einem unserer 40 Tonnen schweren Körper sind etwa zwei Tonnen Kohlenstoff gebunden. Wenn diese Menge auf einmal den Meeresboden erreicht, entspricht das dem Kohlenstoffeintrag, der sonst in etwa 2000 Jahren auf dieser Fläche entsteht. Unsere sinkenden sterblichen Überreste, auch „Whale Falls“ genannt, werden in der Tiefsee sehr langsam von einer einzigartigen Flora und Fauna zersetzt – ein Ökosystem, das vollständig von den in uns gespeicherten Nährstoffen lebt. Der Titel eines der James-Bond-Filme der Menschen lautet „Live and let die“. Unser Motto hingegen ist: Leben und leben lassen! F

Cornelia Dlabaja Stadtforscherin, Universität Wien, FH Wien der WKW Früher hieß es mal „Stadt der kurzen Wege“. „Jetzt sprechen alle von der 15-Minuten-Stadt“, sagt Cornelia Dlabaja. Soll heißen: Geschäfte, Schule, alles Wichtige soll in einer Viertelstunde zu Fuß erreichbar sein. Die Sozialwissenscha lerin forscht zu nachhaltiger Stadt- und Tourismusentwicklung. Sie erhebt regelmäßig, wie solche Konzepte in der Wiener Seestadt funktionieren (es tut es). Aber in Sachen Hitze
musste die Stadt auch hier nachbessern, anderswo ist es noch schlimmer. Wie also bringt Wien wachsenden Tourismus und Konzepte gegen Stadthitze unter einen Hut? Negativbeispiele gibt es genug, etwa den Heldenplatz. „Das ist der größte und schönste Parkplatz der Stadt“, sagt Dlabaja. Aber auch Vorbilder: Ro erdam hat etwa das „Travel like a local“-Konzept etabliert und Wien nun die „Visitor Economy Strategie“. Sta die immer gleichen Orte abzuklappern, lernen Touristen einzelne Nachbarscha en kennen.

Stanz im Mürztal liegt abgelegen in einem Graben. Was den Ort nicht daran hinderte, das „Windmobil“ loszuschicken, eine ErneuerbareEnergie-Gemeinscha zu gründen und eine Klimaklage gegen die Republik einzubringen
DORFGESCHICHTE:
GERLINDE PÖLSLER
FOTOS:
I ch bin halt ein leidenscha liches Landei“, lacht Sophie Pirker-Pichler. Die 35-Jährige ist in Stanz im Mürztal aufgewachsen –nein, es muss heißen: in der Stanz. Darauf legen die Bewohner Wert. Die Stanz also liegt abgelegen in der Hochsteiermark, in einem Graben zwischen Mürzzuschlag und Bruck an der Mur. Zug fährt keiner durch, der nächste Bahnhof liegt in Kindberg. Von dort fährt man acht Kilometer durch Blumental und Edelsdorf, bis man in der Stanz ankommt. Sie wäre eine klassische Kandidatin für eine Gemeinde, in der immer mehr verschwindet: Geschä e, Leben, Kinder. Doch vieles ist hier anders.
Auch Pirker-Pichler ging nach der Matura nach Wien. Sie studierte Germanistik und schlug dann beim Falter Verlag auf, wo sie Buchprojekte wie „Wien, wie es isst“ be-
treute. Auf die Dauer, spürte sie aber, würde sie in der Großstadt nicht glücklich, „und mein Mann und ich wollten Haus bauen und eine Familie gründen“. Ehemann David Pirker ist auch ein Ur-Stanzer. Seine Großeltern konnten dem Paar einen Grund übergeben. Jetzt stehen die beiden strahlend vor ihrem Haus, abgeschieden am Berg, Tochter Matilda, vier, spielt drinnen. „Naturnah und ohne Schnickschnack“, sagt Pirker-Pichler. „Ich genieße es in vollen Zügen.“
Dass die Rückkehrerin sich hier wieder voll zuhause fühlt, hat auch damit zu tun, dass sie bei der Gemeinde Stanz angestellt ist – Trauungen abhält, sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und die Bücherei leitet. Und diese Gemeinde ist weit über die Mur-Mürz-Furche hinaus für zweierlei bekannt: dass sie sehr innovativ ist. Und sehr widerständig. Vor allem auch, was die Mobilität angeht.
Schon seit 2018 holt ein Ru axi vor allem ältere Stanzerinnen und Stanzer von zuhau-


„Die Stanz“, wie die Bewohner ihre Gemeinde nennen, liegt abgeschieden in einem Graben. Zug fährt keiner bis hierher. Sie wäre eine klassische Kandidatin dafür, dass alles immer weniger wird: Leben, Leute, Infrastruktur. Doch die Stanz lässt sich was einfallen
se ab und bringt sie zum Arzt, zum Einkaufen oder nach Kindberg. 2022 gründete sich hier eine der ersten Erneuerbare-EnergieGemeinscha en Österreichs. Und als die Stanz 2023 die Republik klagte, weil diese, so die Kläger, zu wenig gegen den Klimawandel unternahm und ihre Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend schützte, berichtete sogar die deutsche Zeit darüber. Dabei kämp auch Stanz, wie so viele andere Orte, die ähnlich abgelegen sind und keine großen Arbeitgeber beherbergen, mit einem Bevölkerungsrückgang. 2020 zählte die Gemeinde 1855 Einwohner, aktuell sind es 1769. Mehr Leute ziehen weg als zu, sie gehen studieren oder finden woanders einen Job. Allerdings wäre alles andere wohl unrealistisch. Und immerhin zieht Stanz überhaupt Zuzügler an, und gar nicht so wenige: 2023 verließen 68 Menschen die Gemeinde, 46 zogen hin. Innerhalb von fünf
Fortsetzung nächste Seite
Preis-Sammler
Stanz hat zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst:
Leuch urmgemeinde im „Smart Rural 27“-Projekt der EU-Kommission
European Energy Award
Energy Globe Styria Award
Holzbaupreis Steiermark für mehrgeschoßige Wohnbauten im Ortszentrum
Fortsetzung von Seite 37
Jahren starben weniger Bewohner, als Babys geboren wurden. Auch deswegen kann man von dem kleinen Dorf etwas lernen. Der Falter hat schon 2020 über Stanz berichtet: „Wie ein Dorf am Leben bleibt“ hieß die Reportage. Damals war die Gemeinde auch Protagonistin des Films „Rettet das Dorf“ von Regisseurin Teresa Distelberger. Schon damals sah sich die Stanz gern als „gallisches Dorf“.
2014 hatte sie sich erfolgreich gegen eine Zusammenlegung mit anderen Gemeinden gewehrt, wie sie die damalige Landesregierung unter Franz Voves (SPÖ) forcierte. Friedrich Pichler, zu dem alle „Fritz“ sagen, führte die widerständische Bürgerinitiative an. So lang, „bis der Landeshauptmann anrief und sagte: Okay, ihr dür s allein bleiben“, erzählte er dem Falter. Dieser Tag, der 4. Oktober 2014, wird als „Unabhängigkeitstag“ jedes Jahr mit Sturm und Maroni gefeiert. Bei der folgenden Gemeinderatswahl zog Pichler mit seiner Bürgerliste „Für eine lebenswerte Stanz“ als stimmenstärkste Fraktion in den Gemeinderat ein.
Unter dem studierten Forstwirt startete die Kommune auch einen „Lokale Agenda“-Beteiligungsprozess. Elisa und Rainer Rosegger von der Agentur Scan, spezialisiert auf Kommunalentwicklung und Beteiligung, begleiteten sie dabei. Beide sind im Dorf aufgewachsen. Elisa Rosegger erzählte, wie es vorher gewesen war: „Der Strukturwandel im Dorf war spür- und sichtbar. Der Adeg ist leer gestanden, der Autoverkehr hat das Ortsbild dominiert, die Begegnungen waren sehr reduziert.“
Dann fanden sich insgesamt 80 Leute zu Arbeitsgruppen zusammen und beschlossen Änderungen. Die Ergebnisse waren ein paar Jahre später schon zu begutachten: Mit „Trixis Dorfladen“ sperrte endlich wieder ein Nahversorger auf. Im selben Gebäude, oberhalb, entstanden 20 neue Wohnungen. Teils kleinere für junge Leute, teils für betreutes Wohnen. Alles mitten im Zentrum, direkt neben dem Gemeindeamt.
Die ehemalige Schlecker-Filiale mutierte zur Dorfwerkstätte, wo sich die Stanzer für Vorträge, Konzerte und Kurse treffen. Im Kostnix-Laden kann jeder noch brauchbare Sachen abgeben und mitnehmen. Das Ziel: kürzere Wege. Dass die Bewohner nicht für jede Kleinigkeit ins Auto kraxeln und in den Nachbarort fahren müssen – und auch wer kein Auto hat, soll dabei sein können. Dann kamen die „Hupfauf-Bankerln“. Die Idee: Sucht jemand eine Mitfahrgelegenheit, dann setzt sie oder er sich auf eine der knallgrün gestrichenen Bänke. Wer mit dem Auto vorbeifährt, nimmt sie oder ihn mit. „Bleibt einer nicht stehen, muss er das am Abend beim Wirt erklären“, sagt Pichler mit einem Augenzwinkern. Da aber am Berg oben und hinten im Graben selten jemand vorbeifährt, startete 2018 das erste E-Mobil: Montag bis Freitag von sieben bis 18 Uhr holt es Anrufer an einer beliebigen Adresse im Ort ab und bringt sie zum gewünschten Ziel, maximal bis Mürzzuschlag oder Bruck. Pro Fahrt sind im Ortsgebiet drei Euro zu zahlen, sonst vier. Einsteigen würden laut Pirker-Pichler „hauptsächlich ältere Frauen, die keinen




Gemeindemitarbeiterin Sophie Pirker-Pichler in der Bücherei (li. oben). Nach zehn Jahren in Wien ist die Stanzerin wieder heimgekehrt
Die Stanz ist weitläufig, die einen wohnen am Berg, die anderen hinten im Graben. Per Windmobil bringen Ehrenamtliche vor allem ältere Menschen zum Arzt oder zum Einkaufen (li.)
Schmerzlich vermisst, jetzt wieder da: ein Nahversorger samt Postpartner (oben)
Führerschein haben, und betagte Männer, die nicht mehr fahren können“. Oder sich im Winter bei Schnee und Eis nicht mehr trauen. „Das E-Mobil bringt mich nicht nur zum Arzt und zum Nahversorger“, sagt eine ältere „heavy userin“: „Die Fahrer und die Damen helfen mir dann ja auch mit den Einkäufen, tragen die Taschen und bringen mich danach wieder heim.“
Seit Februar heißt das E-Mobil nun „Windmobil“, wegen einer Werbepartnerscha mit der Windheimat GmBH, die mehrere Windparks betreibt. „Das alte Auto hatte besonders bei kalten Temperaturen und Bergfahrten nicht mehr so viel Reichweite“, so Pirker-Pichler, „manchmal mussten wir sogar Fahrten absagen.“
Die Fahrer und die Damen helfen mir dann auch mit den Einkäufen, tragen die Taschen und bringen mich wieder heim
Das Besondere am Windmobil: Es hält sich über all die Jahre auf rein ehrenamtlicher Basis. Rund 20 Fahrer und Fahrerinnen, die meisten Senioren, auch Hausfrauen oder Menschen mit Teilzeitjob, schupfen den Betrieb. Im Schnitt kommen sie knapp einmal im Monat für einen Tag dran. Gibt es Überlegungen, das Service auch am Wochenende anzubieten? „Wir haben darüber nachgedacht, ob man das Auto samstags und sonntags ausborgen kann“, sagt Pirker-Pichler. Doch wer kümmert sich dann wieder um die Übergaben? Die Idee ist vorläufig im Sand verlaufen. Und freilich: Wer berufstätig ist, kommt in dieser Gegend trotzdem kaum ohne eigenes Auto aus. Mit der Zeit gegangen ist aber nicht nur das E-Mobil. Mit ihrer „Energiegemeinscha Stanzertal“ waren sie unter den Ersten in Österreich: Seit 2021 können in Österreich Privathaushalte, Gemeinden sowie Klein- und Mittelbetriebe ErneuerbareEnergie-Gemeinscha en gründen. Noch im
selben Jahr legten die Stanzer mit den Vorbereitungen für die Gründung einer solchen Energiegemeinscha los.
Beim Infoabend rechneten Pichler und Dieter Schabereiter, der Pichler später als Bürgermeister nachfolgen sollte, mit vielleicht zehn Interessierten. Gekommen sind fast 70, und die meisten traten gleich bei. Die einen als Produzenten, die anderen als Konsumenten, manche als beides.
Die Idee: Regionale Energieerzeuger stellen überschüssigen Strom anderen Gemeindebewohnern zur Verfügung. „Wir haben Holz ohne Ende vor der Haustür“, warb Pichler. „Warum sollten wir das nicht intelligent nutzen?“ Für das lokale Nahwärmenetz liefern die Bauern also Hackschnitzel. Außerdem produzieren Photovoltaikanlagen Strom, teils auf den Dächern von Bauernhöfen, im Juli kommt ein neues Wasserkra werk dazu. So wird der Ausbau grüner Energie vorangetrieben und die Gemeinde kann selbst entscheiden, welchen Strom sie will. Stanz holte damit auch EU-Fördergelder und wurde zur „Leuchtturmgemeinde“ im EU-Projekt „Smart Rural 27“ gekürt. 2023 wagte sich die Gemeinde über etwas Großes: Zusammen mit der Umwelt-
schutzorganisation Global 2000 und drei Privatleuten – etwa einem Mann, dem die Hitze gesundheitlich stark zusetzt – klagte Stanz die Republik. Ziel: den Ausstieg aus fossilen Energien zu erzwingen. Und das kam so: Der Wiener Rechtsanwalt Reinhard Schanda, der die „Klimaklage“ ausarbeitete, hatte schon viele Jahre einen Zweitwohnsitz in der Stanz. Und diese ist durch die Folgen der Klimakrise besonders gefährdet. Der Ortskern zählt großteils zur „roten Zone“, ist also stark überschwemmungsgefährdet. Geschichten vom Hochwasser aus dem Jahr 1958 prägen die Dorfgeschichte. Auch im Juli 2016 überfluteten Muren das Dorf, Bürgermeister Pichler musste damals mit entscheiden, welche Häuser zu evakuieren waren. Und so fiel der Entschluss, sich an der Klage zu beteiligen, nicht schwer.
Inzwischen hat der Verfassungsgerichtshof die Klage abgewiesen, hielt aber immerhin fest, dass den Staat „die Pflicht treffen“ könne, „wirksame Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit sowie zum Schutz des Privatlebens und des Eigentums zu ergreifen“. Allerdings habe der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum dafür, wie er diese Pflicht wahrnimmt. Seit Dezember 2023 liegt die Klage beim Europäischen Gerichtshof.
All diese Initiativen haben die Stanzer überzeugt: Bei der Gemeinderatswahl im März holte die Bürgerliste mit 50,8 Prozent erstmals die absolute Mehrheit.
Zentral dafür sei die Rückholung des Nahversorgers gewesen, glaubt PirkerPichler. Dass jene Betreiberin, die 2020 das neue Geschä übernommen hatte – ohne Supermarktkette im Hintergrund –, nach

Laura Feller
Welche Einflüsse haben Konsum, Mobilität und Ernährung auf die Umwelt? Für Kinder ab 8 Jahren. 64 Seiten, € 22,90
Stanz startet einen „Lokale Agenda“-Beteiligungsprozess
Das erste E-Mobil, ein Ru axi, fährt los. Inzwischen wurde daraus das „Windmobil“
Die Energiegemeinscha Stanzertal bringt Hersteller und Verbraucher erneuerbarer Energie zusammen
Klimaklage gegen den Staat, gemeinsam mit Global 2000 und drei Privatleuten
Tempo 30 vor Volksschule und Kindergarten
vier Jahren wieder au örte – aus persönlichen Gründen, nicht weil es schlecht gegangen wäre, im Gegenteil –, war zwar ein Rückschlag, aber ganz ohne geht es halt doch nicht.
Nun führt die Kastner-Gruppe mit „Nah&Frisch“ den Laden als sogenannten „Hybridmarkt“: Bis mittags bedienen Verkäuferinnen und Verkäufer die Kunden, am Nachmittag und sogar sonntags können diese in Selbstbedienung einkaufen. Das Geheimnis der Gemeinde liegt wohl im Gemeinscha sgefühl, das bei all den Initiativen entsteht. Die Windmobil-Fahrer fahren ohne Lohn, dafür plaudern sie mit ihren Fahrgästen, und einmal im Jahr lädt der Bürgermeister sie zu einem großen Ausflug ein. „Erst seitdem ich Teil der Lebensqualitätsgruppe bin“, sagte eine Frau einmal, „fühle ich mich als echte Stanzerin.“ Sie war 35 Jahre zuvor zugezogen.
Klar, dass Bürgermeister Dieter Schabereiter schon wieder viele Bälle in der Lu hat. So schwebt ihm eine Begegnungszone mit Tempo 20 im Ortskern vor. Endlich durchgegangen ist auch eine Neuerung, über die Sophie Pirker-Pichler als Mutter einer Vierjährigen besonders froh ist: Autofahrer müssen vor der Schule und dem Kindergarten jetzt auf Tempo 30 runterbremsen. F
















Seit Jahrtausenden träumt die Menschheit von der schnellen Fortbewegung.
Was wurde aus den kühnsten Utopien – von Wachsflügeln bis Hyperloop? Ein Blick in die aktuelle Forschung
REISEFÜHRERIN:
ANNA GOLDENBERG
ILLUSTRATION:
Ein Auto als bester Freund und Lebensretter? Scheint heute längst überholt. Doch als das Musical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ 1968 in die Kinos kam, verkörperte das titelgebende Gefährt so ziemlich alle Mobilitätsträume dieser Zeit: ein eigenes Auto, das auch schwimmen und fliegen kann – und die Familie zudem warnt, wenn Gefahr in Verzug ist. Manches davon hat sich gewandelt: Hohe Benzinpreise, Lu verschmutzung und Parkplatznot waren damals kein Thema. Anderes ist geblieben: Die Sehnsucht danach, sich möglichst schnell und flexibel über Land, im Wasser und in der Lu fortzubewegen. Die Technik macht Fortschritte, doch unbegrenzt sind die Möglichkeiten noch längst nicht.
Welche Utopien sind machbar und welche nicht? Ein Überblick über die größten Mobilitätsträume der Menschheitsgeschichte – und was aus ihnen wurde.
In der Luft …, Was haben Engel, Hexen und Feen gemeinsam? Sie können fliegen. Dass der Mensch vielen Fabelwesen diese Fähigkeit zuschreibt, ist kein Zufall. Der Traum vom Fliegen ist wohl so alt wie die Menschheit selbst.
Seit die antiken Griechen in ihrer Mythologie Dädalus und Ikarus mit Flügeln aus mit Wachs verbundenen Vogelfedern gen Sonne schickten, hat sich die Wissenscha rasant weiterentwickelt. Der erste erfolgreiche Motorflug fand 1903 statt, der erste Linienflug über den Atlantik 1939. Mit dem Airbus in wenigen Stunden tausende Kilometer zurückzulegen ist längst zur Normalität geworden. Doch zwei Flugutopien hat sich die Menschheit noch immer nicht erfüllt.
„Der Mann mit dem goldenen Colt“, der neunte James-Bond-Film, kam 1974 ins Kino. Der Bösewicht hat ein ganz besonderes Gefährt: Sein Auto, ein AMC Matador, versieht er im Schuppen schnell mit einem Propeller und Flügeln – und fliegt los. (Bond-Autor Ian Fleming schrieb üb-
rigens auch „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“.) An einem solchen fliegenden Auto, das sowohl an Land wie auch in der Lu unterwegs sein kann, tü eln Forschende und Start-ups seit langem. „Urban Air Mobility“ heißt die Sparte. Das Ziel: Staut es sich in der Stadt, hebt man einfach ab.
Doch genau hier liegt ein Problem: Das Senkrechtstarten, wie es Helikoptern gelingt, ist eine technische Herausforderung. Man bräuchte einen starken Rotor und große Propeller, die dann das gesamte Gewicht in die Lu hieven können. Und diese wären wiederum beim Fahren im Weg. Aber es gibt Fortschritte: Im Februar gelang dem niederländischen Start-up Pal-V der Jungfernflug seines Modells Alef Model A. Das Auto fährt Propeller aus und hebt geradlinig nach oben ab.
Ähnlich weit ist der Traum von den eigenen Flügeln. Ohne Fahrzeug einfach abheben, so wie all die schwebenden Fabelwesen – eine Utopie, für die sich auch Armeen interessierten. Für den Nahkampf, aber auch für das Überqueren von Hindernissen wie Minenfeldern oder Stacheldrahtzäunen, wären fliegende Soldaten von Vorteil. Die deutsche Wehrmacht soll an einem Raketenrucksack, dem „Himmelsstürmer“, gearbeitet haben.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs forschte die US-Armee weiter, stellte aber Ende der 60er-Jahre die Arbeit ein – zu teuer, zu gering der Nutzen. Den sogenannten Jet-Suit gibt es aber; als Fortbewegungsmittel durchgesetzt hat der Raketenanzug sich bislang nicht. Beim britischen Unternehmen Gravity Industries kann man sich die Düsen umschnallen und versuchsweise abheben. Und sich um 3000 Euro pro Tag ein bisschen wie ein Fabelwesen fühlen.
»Für den Nahkampf wären fliegende Soldaten von Vorteil. Die deutsche Wehrmacht soll an einem Raketenrucksack gearbeitet haben
… an Land … Eigentlich kann der Mensch einem leidtun: Er hat weder Kiemen noch Flügel und gerade einmal zwei Beine. Auf denen kann er zwar stabil stehen und gemütlich gehen, aber fürs Springen, Laufen und Klettern ist er nicht optimal ausgestattet. Die Knochen sind zu schwer, die Bänder zu kurz, die Muskeln zu schwach. Ans Land gefesselt, träumt der Mensch deshalb schon lange von schnelleren Fortbewegungsmitteln. Etwa von jenen, die das Gehen optimieren, was ja grundsätzlich eine praktische, weil flexible Methode ist. Anders als Räder scheitern Beine nämlich nicht an Stiegen oder unwegsamem Gelände. Schon 1893 präsentierte der Kanadier George Moore das Modell eines dampfgetriebenen „Steam Man“: ein mannshoher Roboter in Ritterrüstung, angeblich stark genug, um es mit zwei Männern gleichzeitig aufzunehmen und schwere Lasten zu transportieren. Ebenso wie das im selben Jahr angemeldete Patent des mechanischen Pferdes wurde das Projekt allerdings nie gebaut. Aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt ein weiteres Prinzip, das mehr Erfolg hatte: die Rohrpost. Dabei werden zylindrische Transportbehälter in einer Röhre mithilfe von Lu druck hin- und hergeschickt. Sie erreichen damit Geschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern. Was findige Forschende rasch auf die Idee brachte: Könnte
man dieses System nicht vergrößern, sodass es nicht nur Briefe und kleine Objekte, sondern auch Menschen transportiert?
Doch für größere Objekte war der Ludruck als Antrieb zu ineffizient. Als verheißungsvoller stellte sich eine andere physikalische Kra heraus: der Magnetismus. Die Magnetschwebebahn gibt es bereits, allerdings nur auf kurzen Strecken. Dabei ziehen oder schieben Magnetfelder einen Zug. Weil der Zug nicht auf den Schienen sitzt, sondern schwebt, entsteht keine Reibung –und das spart Energie: rund 30 Prozent im Vergleich zum ICE. Das behauptet zumindest der Hersteller von Transrapid, einer Magnetschwebebahn, die in Shanghai im Einsatz ist.
Der Hyperloop kombiniert beide Techniken: Die Passagierkapseln schweben in einer Vakuumröhre und werden, vereinfacht gesagt, mit Elektromagneten bewegt. Der Multimilliardär und Unternehmer Elon Musk arbeitete an dem Projekt; aktuell beschä igt es mehrere chinesische Forschungsteams. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Stundenkilometern sollen die Züge dann düsen. In einer Stunde von Wien nach Paris, wer träumt nicht davon? Doch eine aktuelle Studie chinesischer Forscher zeigt, dass noch einiges zu tun ist: Bei solch hohen Geschwindigkeiten rütteln die Passagierkabinen nämlich so sehr, dass die Erschütterungen gesundheitliche Folgen haben können. Und so muss der Mensch vorerst doch am Boden bleiben.
»Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Stundenkilometern sollen die Züge dann düsen. In einer Stunde von Wien nach Paris, wer träumt nicht davon?
»Das Amphicar 770, ein Cabriolet mit Platz für fünf Personen, kam in Deutschland 1961 auf den Markt. Im Wasser fährt es Schiffsschrauben aus
… und im Wasser
Gut 71 Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt; und auch hier hat der kiemen- und flossenlose Mensch die effiziente Fortbewegung noch nicht optimal gemeistert. Denn Boote und Schiffe haben einen entscheidenden Nachteil: Sie funktionieren nur im Wasser. Doch was, wenn man an Land unterwegs ist und schnell einen Fluss überqueren muss? Eine Utopie ist tatsächlich Realität geworden: Das schwimmende Auto gibt es.
Erste Modelle waren bereits während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz; sowohl die Wehrmacht wie auch das US-amerikanische Militär nutzten schwimmende Autos. Das Amphicar 770, ein Cabriolet mit Platz für fünf Personen, kam in Deutschland 1961 auf den Markt. Im Wasser fährt es Schiffsschrauben aus, eine Pumpe schützt den Motorraum. Es funktionierte – doch der Bedarf an solchen Spritztouren war sichtlich überschaubar; die Produktion wurde 1968 eingestellt.
Als Gag taugt das Fortbewegungsmittel aber allemal: Seit 2016 bietet in Salzburg ein Amphibienbus Touristentouren an Land und im Wasser an. 41 Euro kostet die anderthalbstündige Tour.
Mehr als 85 Jahre nach dem ersten Transatlantikflug träumt die Menschheit zudem noch immer von einem anderen Weg der Atlantiküberquerung: unten durch. Rund 5500 Kilometer müsste ein solcher Tunnel lang sein und in fünf Kilometer Tiefe verlaufen – eine technische Herausforderung auch aufgrund des hohen Was-
serdrucks. Michel Verne, der Sohn des visionären Autors Jules Verne, schrieb diese Utopie erstmals 1888 auf. Ein Dauerbrenner ist sie nach wie vor.
Erst im Februar 2025 verkündete Elon Musk, seine Firma The Boring Company könne einen solchen Tunnel für gerade einmal 20 Milliarden Dollar bauen; verliefe das Hyperloop-Hochgeschwindigkeitssystem unterirdisch, dauere die Reise von London nach New York gerade einmal eine Stunde.
Andere Fachleute halten diese Idee für wenig realistisch. Aber Utopien müssen das ja auch nicht sein. F
Auf 12.500 Kilometern zieht sich das Grüne Band von der norwegisch-russischen Grenze bis in die Türkei. Das macht es zum größten Naturschutzprojekt Europas. Wären da nicht die vielen Straßen und Flächen, die es durchkreuzen
STREIFZUG:
KATHARINA KROPSHOFER
GRAFIK:
ANTONIA ZEISS
E s war eine kleine Sensation. So drückte es zumindest der Direktor des Nationalparks Thayatal, Christian Übl, aus, als er 2007 den Beweis für einen besonderen Gast liefern konnte: Dort, in den niederösterreichischen Wäldern, unweit der tschechischen Grenze, hatten die Naturschützer sogenannte Locksti e angebracht. Schnell zeigten die mit Baldrian besprühten Stöcke ihre magnetische Wirkung – und brachten den Fachleuten fünf Nachweise für Wildkatzen. Die seltenen Tiere hatten sich an den Holzstöcken gerieben und Haare hinterlassen. Immerhin gleicht der Baldriandu dem Sexuallockstoff der Katzen. Wildkatzen sind anspruchsvoll: Sie brauchen gut strukturierte Wälder mit Mäusen oder anderen Nagern, die sie nachts jagen können. Und sie sind sehr sensibel gegenüber Störungen, durch Forstwirtscha zum Beispiel. Dass die Tiere also heute in Österreich herumstreichen können, hat mit einem dunklen Kapitel in der Geschichte Europas zu tun.
Fast 40 Jahre lang teilte der Eiserne Vorhang den Kontinent in West und Ost – ein Unglücksfall für viele Menschen, doch ein Glücksfall für viele Pflanzen- und Tierarten: Dort, wo kaum jemand Zutritt hatte, lediglich ein paar Bauern ihre Felder bestellten, konnten sich viele Arten ungestört ausbreiten und vermehren. Eine Verschnaufpause für die Natur, fernab vom Menschen und seinem Einfluss.
Schon während des Kalten Krieges hatten Naturschützer wie der Anrainer Kai Frobel beobachtet, dass es in dieser „Todeszone“ Arten gab, die woanders kaum mehr vorkamen: das Braunkehlchen etwa, im Rest von Deutschland ein Opfer der intensiven Landwirtscha . Als der Eiserne Vorhang dann ab Mai 1989 sukzessive und im November offiziell geöffnet wurde, ergriffen Frobel und seine Kollegen die Initiative: Schon am 9. Dezember 1989 riefen sie zum ersten Naturschutztreffen des vereinigten Deutschlands auf, beschlossen den Erhalt des Gebiets und gaben ihm einen Namen: „Grünes Band“.
„Es gab sogar Pläne, auf dem Streifen eine Autobahn zu bauen“, erzählt Liana Geidezis vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der sich für die Erhaltung des Grünen Bandes in Deutschland einsetzt, „aber sie haben das verhindert.“
12.500 Kilometer, von Norwegen bis in die Türkei, verläu das Grüne Band. 1300 Kilometer davon liegen in Österreich
TRITTSTEINKONZEPT:
Naturschutzgebiet
Tri steine
Korridor
Das Grüne Band entstand nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Naturschützer ha en festgestellt, dass in der dortigen Ausschlusszone viele seltene Arten Unterschlupf fanden – und setzten sich für den Schutz des Gebietes ein.
Heute verwalten Organisationen in 24 europäischen Ländern diese unterschiedlichen Flächen – und setzen sich dafür ein, dass das Grüne Band noch lückenloser wird: Sie kaufen landwirtschaliche Flächen zu oder versuchen, Straßen, die durch das Band verlaufen, zu überbrücken. Das ist wichtig, damit Arten auch entlang des Bandes wandern, sich somit ausbreiten, fortpflanzen und einzelne Population miteinander austauschen können
Spätestens, als 2001 erstmals eine Erhebung von Lebensräumen entlang des gesamten deutschen Abschnitts des Grünen Bandes gemacht wurde, stieg die politische Akzeptanz für das Projekt.
Heute zieht es sich auf 12.500 Kilometern von der norwegisch-russischen Grenze im Norden bis ans türkische Schwarze Meer im Süden. Es verbindet Nationalparks, Naturschutzgebiete, seltene Ökosysteme wie Trockenrasen. Zwei Drittel des Bandes stehen heute unter Schutz, in Österreich ist es immerhin ein Drittel, das einen solchen rechtlichen Status hat. Dazu kommen Flächen, die zwar kein Naturschutzgebiet, aber für viele Arten trotzdem wichtig sind. Die Initiative „Grünes Band Europa“– ein Zusammenschluss von 24 Ländern, die das Grüne Band durchquert, Behörden, NGOs, Universitäten und Raumplanern – betreut es. Es ist somit das größte Naturschutzprojekt Europas. Manche würden sogar sagen: weltweit.
Aber es ist nicht nur die schiere Fläche, die es so besonders macht. Sondern auch seine Länge: Das Klima am norwegischen Eismeer ist schließlich ein anderes als in trockenen Mittelmeerregionen und wieder anders als im Kern Europas, wo Wälder und Wiesen dominieren. „Das Grüne Band ist häufig auch braun“, sagt Geidezis, ein Füllhorn an unterschiedlichen Landscha en. In Deutschland zum Beispiel ist ein großer Teil der Fläche Offenland, also zum Beispiel wertvolle Wiesen. Ein Überbleibsel der Geschichte: Grenztruppen hatten Bäume und Büsche klein gehalten, um Flüchtende besser sehen zu können.
In Österreich liegt die Koordinierung beim Naturschutzbund. Beinahe 1300 Kilometer verlaufen zwischen dem Mühlviertel über die Nationalparks Thayatal, Donauauen sowie den Nationalpark Neusiedler See –Seewinkel Richtung Süden zur slowenischen Grenze in Kärnten. Korridore nennen Fachleute diese mehr oder weniger zusammenhängenden Flächen. Sie bieten die Möglichkeit, dass sich Arten ausbreiten und migrieren können. Neben dem Grünen Band gelten auch Brücken über Autobahnen als biologische Korridore, auf denen etwa Rehe wandern können. Oder auch Untertunnelungen, die für Amphibien auf dem Weg zu ihrem Laichplatz überlebensnotwendig sind.
Naturschutzgebiet
Das Grüne Band besteht aus Naturschutzgebieten, aber auch noch aus Flächen, die intensiv bewirtscha et werden
„Das Grüne Band ist eigentlich eine Idee“, sagt Florian Danzinger, also nicht nur eine Aneinanderreihung von Lebensräumen. Er kümmert sich am Umweltbundesamt um das Projekt, lehrt nebenbei an der Universität Wien. Und war für diese auch an einer Studie zur Durchgängigkeit des Grünen Bandes beteiligt. Das Ergebnis: Vom Böhmerwald nach Oberösterreich übers Waldviertel gibt es kaum Lücken, zerfranster wird es im pannonischen Raum und im westlichen Weinviertel, in dem Landwirtscha eine größere Rolle spielt. Dazu kommt, dass Österreich eines
der dichtesten Verkehrsnetze Europas hat. Und wo Straßen queren, wird die Wanderung für viele Tiere schwierig.
Etwa für die Wildkatze: Sie wandert am liebsten entlang von Waldrändern. Große Unterbrechungen in der Landscha sind für sie gefährlich. Lange galt sie in Österreich deshalb als ausgestorben – bis zur „Sensation“ 2007. Erst Anfang April haben die Ranger des Nationalparks Thayatal zwei weitere Wildkatzen ausgewildert und besendert. Um nachzuvollziehen, wohin sie sich bewegen – und ob sie sich auch mit Artgenossen austauschen.
Neben den Korridoren, also direkt zusammenhängenden Lebensräumen, gibt es auch sogenannte Trittsteine. Damit meinen die Forscher kleine Inseln an Grün, die nahe genug beieinander liegen, dass „mobile Organismen“ – also Insekten, Vögel, Amphibien, aber auch zum Beispiel windbestäubte Pflanzen – die Entfernung überbrücken können. Die meisten Vögel sind „hochmobil“. Wenn sich Amphibien während ihrer Laichwanderungen bewegen, legen sie auch mal einen Kilometer zurück. Aber wenn Lau äfer von Hecken in andere Ökosysteme wandern, reden wir lediglich von ein paar hundert Metern.
Die Fachleute vergleichen das Grüne Band deswegen mit einer Art Perlenkette: Streng geschützte Gebiete wie Nationalparks wechseln sich mit kleineren Gebieten, Trittsteinen wie Trockenrasen im Waldviertel, ab. Doch vielerorts leidet das Grüne Band auch an „Verinselung“: dann, wenn intensiv genutzte Flecken es unterbrechen. Damit Tier- und Pflanzenarten überleben können, müssen sich Individuen aber auch austauschen. Das treibt die Evolution voran. Fliegen Samen in eine neue Gegend oder legt ein Schmetterling seine Eier auf einer entfernteren Fläche ab, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Genpool verändert und so differenziert. Passiert das nicht und zu viele Individuen einer Population bleiben auf derselben Fläche, droht Inzucht – und so womöglich schlechtere Überlebenschancen.
Organisationen wie der Naturschutzbund in Österreich oder der BUND in Deutschland kaufen deshalb Flächen auf, versuchen Landwirten Ausgleichsflächen zu bieten, damit diese wichtige Korridore freimachen. In Deutschland kommen dazu 460 Straßen, die das Band queren. Landstraßen stören weniger, sagt Liana Geidezis. Aber im nördlichen Harzgebiet liegt ein besonders umstrittener Ort: Vier Kilometer ist das Grüne Band dort von Straßen und Feldern durchtrennt.
Ein wunder Punkt, wenn auch der einzige. In Deutschland gelten immerhin schon vier Fün el der Fläche als „Naturdenkmal“, die zweithöchste Schutzkategorie in Deutschland. Gerade hat der BUND auch eine Studie in Au rag gegeben, um das erste Mal festzustellen, wie viele (seltene) Arten es wirklich auf der Fläche gibt. Und
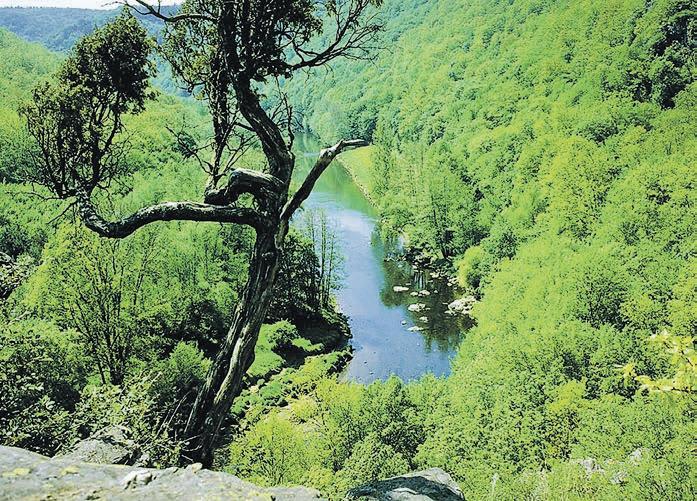

Das Grüne Band ist eigentlich eine Idee
FLORIAN DANZINGER, UMWELTBUNDESAMT UND UNIVERSITÄT WIEN
Der Nationalpark Thayatal ist Teil des österreichischen Grünen Band-Abschni s. Hier können nicht nur Gewässer freier fließen, sondern auch besondere Arten finden Platz – wie die Wildkatze. Sie galt lange als ausgestorben, bis Forscher 2007 Nachweise erbrachten. Im Thayatal findet die Katze das was sie braucht: Ungestörte, strukturierte Landscha
noch ein großer Schritt steht an: Das Grüne Band soll Naturerbe werden. Ein Antrag liege schon bei der Unesco. Auch aus Österreich gibt es zahlreiche Erfolgsgeschichten. Es gibt aber auch noch „Schwachstellen“, so Danzinger: Gebiete im nördlichen Weinviertel etwa, also weite Teile der Bezirke Hollabrunn und Mistelbach, wollen die Naturschützer noch besser verknüpfen, die Landscha sstruktur verbessern.
Eines ist aber klar: Ein Pauschalrezept für guten Naturschutz gibt es nicht. Flächen und ihre Arten einfach in Ruhe zu lassen, tut manchen Arten gut. Viele Gebiete wollen aber auch gepflegt werden. Naturschützer stellen dann sicher, dass seltene Arten
– etwa auf Trockenrasen – nicht durch häufige Gräser oder „invasive Arten“ verdrängt werden oder die Flächen verbuschen. Der Naturschutzbund kau deswegen zum Beispiel auch landwirtscha lich genutzte Flächen an, zahlt Bauern dafür, dass sie auf unrentable Ansätze wie extensive Beweidung setzen. Wenn Schafe grasen, überleben nur daran angepasste, meist seltene Arten.
Das Grüne Band ist für Florian Danzinger deshalb mehr als „nur“ eine Initiative für mehr Naturschutz: Es ist ein diverser Fleckerlteppich, ein Sammelsurium an unterschiedlichen Lebensräumen und Arten; eine Idee, angetrieben von der Geschichte; und ein Paradebeispiel für das diverse Europa: „Es ist nicht nur ein Zusammenschluss von Lebensräumen, sondern auch der Staaten, die sich darum kümmern, von Kulturen und Sprachen. Genau das macht es so spannend.“ F
Die Falter-Klimajournalistinnen Katharina Kropshofer und Gerlinde Pölsler stellen Ihnen zwölf Bücher und vier Dokumentarfilme
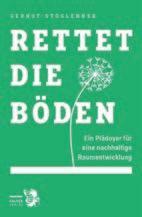
Gernot Stöglehner:
Re et die Böden. Falter Verlag, 216 S., € 24,90
Hören wir endlich auf, Österreich zuzubetonieren! Das fordert der Raumplaner Gernot Stöglehner. Er zeigt auf, warum was schiefläu und was sich wie ändern müsste. Auch die Verbauung für (Verkehrs-)Infrastruktur ist dabei ein großes Thema. Und die fängt schon einen Schritt vorher an – nämlich beim Errichten von Einkaufszentren oder Einfamilienhäusern, denn: Ausufernde (Siedlungs-)Strukturen ziehen immerhin eine Menge Autoverkehr nach sich.

Hermann Knoflacher: Virus Auto 4.0. Alexander, 432 S., € 25,70
Seit gut fünf Jahrzehnten analysiert der Wiener Verkehrsplaner mit spitzer Zunge, wie wenig unsere gebaute Umgebung noch mit Vernun zu tun hat. Das Auto wirke wie ein ansteckendes Virus, das direkt aufs Stammhirn der Menschen ziele. In kürzester Zeit habe es die Menschen dazu gebracht, alles seinem Wohlergehen unterzuordnen. Dörfer seien seinetwegen zu „Leichen“ geworden. Wer sonst traut sich eine derart kompromisslose Rede?

Jan Gehl: Städte für Menschen. Jovis, 304 S., € 32,–
Viele Verkehrsplaner orientieren sich an ihm: dem Architekten und Stadtplaner Jan Gehl, der Plätze, Straßen und Viertel in Großstädten auf der ganzen Welt umgestaltet hat. Ihm geht es um „das menschliche Maß“: Da sich mit der Geschwindigkeit die Wahrnehmung verenge, müsse man den öffentlichen Raum wieder aus der Perspektive und in der Geschwindigkeit von Fußgängern betrachten anstatt von Autos heraus. Mit vielen Beispielen und Bildern.

Petra Sturm: Cenzi Flendrovsky. Eine Bicycle Novel. Edition Atelier, 48 S., € 20,–
Auf der Wiener Bellariastraße hatte die Radsportlerin Cenzi Flendrovsky 1900 einen Unfall und starb mit nur 28 Jahren an den Folgen. Als die Historikerin, Radlerin und Falter-Bildredakteurin Sturm selbst dort stürzte, wusste sie: Über die Frau muss eine Graphic Novel her. Diese (Illustrationen: Jorghi Poll) erzählt weit mehr als „nur“ Sportgeschichte, sondern etwa auch über eine Frau, die schon damals mit Pluderhosen im Sattel saß.

Katja Diehl: Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt. Fischer, 272 S., € 14,40
Die deutsche Verkehrsexpertin machte sich durch ihren Podcast „she drives mobility“ einen Namen – und erbitterte Feinde. Und das bloß, weil sie fordert, jede und jeder sollte ein Leben ohne eigenes Auto führen können. Oder weil sie die Verkehrssituation als ungerecht kritisiert und aufzählt, welche Gruppen aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden. Stellenweise schreibt sie in recht flapsigem Tonfall, inhaltlich aber überzeugt sie.
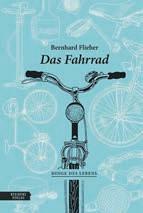
Bernhard Flieher: Das Fahrrad. Residenz, Reihe „Dinge des Lebens“. 64 S., € 15,–
Bernhard Flieher hat einen Fahrradunfall. Mit dessen Schilderung beginnt der Redakteur der Salzburger Nachrichten seine Liebeserklärung an das Gefährt. Er erläutert die Anfänge des Fahrrads, das vielen Menschen Freiheit brachte, seine Verdienste für die Emanzipation und seine Rolle im Widerstand gegen die Nazis. Auch lustige Anekdoten kommen vor. All das liest sich flott und erweitert den Blick auf diesen wunderbaren Alltagsgegenstand.

Boris von Heesen: Mann am Steuer. Heyne, 288 S., € 18,50
Sie haben sicher schon mal von „road rage“ gehört – oder sie vielleicht sogar selbst erlebt. Der deutsche Wirtscha swissenscha ler und ehemalige Männerberater Boris von Heese hat einen Verdacht: Die „road rage“ ist etwas Männliches und das Patriarchat, das dahintersteht, blockiert die Verkehrswende: durch falsche Vorstellungen von Freiheit, unausgeglichene Geschlechterverhältnisse in Autokonzernen oder Filmhelden in schnellen Karren.

Rebecca Solnit: Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens. Ma hes & Seitz, 384 S., € 33,50
Ob Lau and, Gipfelbesteigung, oder Pilgerreise: Gehen macht uns erst zum Menschen. So würde zumindest die bekannte Kulturtheoretikerin Rebecca Solnit argumentieren. „Dass wir gehen, scheint uns so selbstverständlich, dass wir o vergessen, welch kultureller Reichtum [...] in unserer alltäglichen Fortbewegungsart liegt.“ Schon beim Lesen passt sich die Geschwindigkeit des Denkens an – wie ist es dann erst, wenn man endlich losgeht?

Jane e Sadik-Khan, Seth Solomonow: Streetfight. KNV, 368 S., € 19,99
Sie hat federführend New York umgestaltet: Schon ab 2007 unter Bürgermeister Michael Bloomberg wandelte Janette Sadik-Khan PkwSpuren in Radwege, Fußgängerzonen und Plazas um. Sogar den Times Square transformierte sie. O benötigte sie keine großen Umbauten, sondern pinselte einfach Flächen bunt an und wies ihnen neue Funktionen zu. Motto: einfach mal probieren statt ewig diskutieren. Mit vielen Vorher-nachher-Bildern.

Jaroslav Rudiš: Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Piper, 256 S., € 16,50
Wegen seiner Brille durfte Jaroslav Rudiš nicht Lokführer werden. Heute fährt er trotzdem ständig mit der Bahn, und das quer durch Europa: von Berlin bis zum Gotthardtunnel, im Nachtzug durch Polen und die Ukraine sowie im Speisewagen von Hamburg nach Prag. Dabei trug er eine grandiose Auswahl skurriler Geschichten zusammen. Daneben ist sein Buch hochpolitisch, denn: „Es sind die Bahnstrecken, die unser Europa zusammenhalten.“
vor, mit denen Sie Mobilität besser verstehen, die Lösungen aufzeigen oder einfach Lust aufs Reisen machen

Cara New Dagge : Petromaskulinität. Fossile Energieträger und autoritäres Begehren. Ma hes & Seitz, 72 S., € 12,40
Was haben Öl oder Kohle, Männlichkeitsbilder und autoritäre politische Strömungen gemeinsam? Ziemlich viel, wenn man der Politikwissenschalerin Cara New Daggett glaubt. In ihrem knappen Essay zeichnet sie die Verbindung nach, erklärt, wieso vor allem konservative, weiße Männer im globalen Norden an fossilen Brennstoffen festhalten – oder sogar den Klimawandel leugnen. Ein Klassiker zum Thema „Klimagerechtigkeit“.
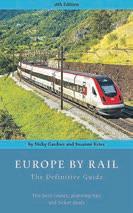
Nicky Gardner, Susanne Kries: Europe By Rail. Hidden Europe Publi cations, 544 S., € 19,99
Ein Klassiker fürs Zugreisen in Europa: „The Definitive Guide“ wird alle paar Jahre aktualisiert, derzeit ist die 18. Auflage aus 2024 auf dem Markt. Die Berliner Autorinnen und langjährigen Herausgeberinnen des Magazins Hidden Europe beschreiben darin 50 Schlüsselrouten auf dem europäischen Festland und den Britischen Inseln. Dabei setzen sie auf langsames Reisen und führen auch zu Orten abseits der Hotspots.

Sparschwein (2024)
Christoph Schwarz, ARGE Schwarz, 97 Min.
Eine gute Mockumentary ist jene, bei der man nicht sofort merkt, dass man gerade aufs Korn genommen wird. Der Aktivist und Künstler Christoph Schwarz (er ist das im Film und im echten Leben) hat sich ein Ziel gesetzt: Ein Jahr lang für eine ORF-Produktion einen „Geldstreik“ durchhalten – als Kapitalismuskritik in Zeiten der Klimakrise. Was er den Produzenten nicht sagt: Er hat sich für das Regiebudget kurzerhand ein Wochenendhaus im Waldviertel gekau . Und

I’m in love with my car (2017)
Michele Mellara und Alessandro Rossi, Mammut Film, 70 Min.
Zuerst ist man sich unsicher: Schaut man sich hier einen Dokumentarfilm von Autoliebhabern an? Oder wurde er doch von Kritikern gestrickt? Von 100 Jahre alten Werbespots, die das gerade anbrechende Zeitalter der Automobile preist, zu Volksschulkindern, die stolz ihre motorisierten Fantasiefahrzeuge vorstellen: Autos prägen unser modernes Leben – und vor allem unsere fünf Sinne, so die These der italienischen Filme-
so sieht man ihm dabei zu, wie er Lebensmittel rettet, Falschgeld verbrennt, ein Cabriobeet bepflanzt (siehe S. 18), sich und sein Milieu kritisch beleuchtet und vor allem: die Verkehrspolitik für vieles verantwortlich macht, was momentan so schiefläu mit den Privilegien für Autofahrer in der Stadt. Eine unterhaltsame und aktivistische „Helden“reise.

Der automobile Mensch (2024) Reinhard Seiß, Urban+, modular/90–400 Min.
„Was glauben denn Sie? Schaffen wir die Klimaziele noch?“ In leicht frotzelndem bayerischem Tonfall hebt der Kommentar an. Die Stimme des Münchner Kabarettisten Christian Springer begleitet einen durch die Doku „Der automobile Mensch“, die in insgesamt 400 Minuten „Irrwege einer Gesellscha und mögliche Auswege“ (Untertitel) aufzeigt. Der Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seiß hat sich dafür verschiedene Verkehrskon-

Women don’t cycle (2023) Manon Brulard, 47 Min.
macher. In prägnanten 70 Minuten illustrieren sie, wie Windschutzscheiben zum Fenster zur Welt wurden oder Drive-Thrus unsere Essgewohnheiten verändert haben. All das erzählt in einem erfrischenden, nicht belehrenden Ton unsere (gestörte) Beziehung zu dieser allgegenwärtigen Maschine.
2019 bricht die belgische Filmemacherin Manon Brulard aus Brüssel zu einer Radreise nach Tokio auf, die ihr Leben verändern soll: Mehr als elf Monate und 13.500 Kilometer später hat sie zahlreiche andere Frauen getroffen, die auch Rad fahren. Denn das ist nicht überall so selbstverständlich: Im Irak ist es für Frauen schwieriger, Sport auszuüben – egal welchen. Aber auch an vielen europäischen Orten herrscht immer noch das Vorurteil, Frauen wären langsamer oder schlechter dar-
zepte vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz angesehen. Klingt trocken? Ist es keineswegs! Seiß ist ein gewitzter Autor, der das Publikum mit feinen Polemiken („Radfahren in Wien ist ein Minderheitenprogramm – für Menschen, die die Gefahr lieben“) und grauenha en Statistiken (die Österreicher fahren täglich 19 Mio. Kilometer mit dem Auto zum Einkaufen, das heißt: 473-mal um den Globus!) zu unterhalten weiß.
in. Immerhin ist die Radsportwelt weiterhin von Männern dominiert. Mit jedem Pedaltritt versucht Brulard, dieses Stereotyp aufzubrechen. Und das macht „Women don’t cycle“ zu weitaus mehr als nur einem klassischen Reisefilm.
Hohe Kosten, rare Parkplätze, gute Öffi-Verbindungen: Viel spricht in Wien gegen den Besitz eines eigenen Autos. Trotzdem gab es im Jahr 2024 ganze 735.800 gemeldete Pkw. Unsere Autorinnen argumentieren für und gegen die metallischen Kutschen
Niemand braucht ein Auto in einer Super-ÖffiStadt wie Wien. Ich leiste mir trotzdem eines. Und habe dabei nur ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich fahre einen 13 Jahre alten Volvo XC 60 mit knapp 160.000 Kilometern, einem (fantastischen, von Volvo leider nicht mehr produzierten) 5-Zylinder-Diesel-Motor mit 163 PS und Allradantrieb. Keine Automatik, Handschaltung. Mein Volvo ist ein Traktor mit einem Hauch von Komfort in Form eines Schiebedaches. Er verfügt über nichts, was moderne Autos auszeichnet: kein eingebautes Navi, keine elektronische Einparkhilfe, keine Fahrerin-Assistenz. Er ist ziemlich analog. Genau deswegen wollte ich ihn. Wenn ich mich mit diesem fossilen Anachronismus auf vier Rädern mühsam aus meiner Hinterhof-Garage rausquäle (unmöglich, im 1070 Bobostan mit diesem Auto einen normalen Parkplatz zu finden) und in die Neubaugasse einbiege, in der ich wohne, ernte ich regelmäßig strafende Blicke. Ich passe perfekt ins Klischee der blonden Tussi im Diesel-SUV. Genauso gut könnte ich im Hochsommer Nerz tragen. Aber ihr, denke ich mir dann, wisst nicht, dass die CO2-Bilanz meines Volvos dank seines Alters und seiner mäßigen Nutzung absolut zu rechtfertigen ist. Er ist mittlerweile vielleicht sogar umweltfreundlicher als ein frischer Tesla. Außerdem nutze ich meinen SUV nur für Überlandfahrten – und das nur an den Wochenenden.
Am Weg durch die Stadt Richtung Autobahn fahre ich extra umsichtig. Ich halte mich akribisch an die Geschwindigkeitsvorgaben in der 30er-Zone und freue mich, wenn mich Remus-getunte Drängler mit der Lichthupe auffordern, Gas zu geben. Dann chauffiere ich mein wuchtiges Fahrzeug noch achtsamer.

Barbara Tóth leitet das Ressort Medien des Falter und wohnt in Wien – samt ihrer „PS-Kutsche“
Alles an diesem Auto ist unvernün ig, ökologisch gesehen. Ich zahle dafür hohe Steuern, der Garagenplatz ist kein Schnäppchen, Service und Volltanken sowieso nicht. Aber ich beklage mich nicht. Ich finde diesen Preis für meinen Old-School-Lebensstil völlig gerechtfertigt. Als Kind der Generation Golf am Land aufgewachsen, war der Führerschein und das erste eigene Auto synonym für frei und unabhängig sein. Raus aus dem Kaff, in dem man lebt.
Heute kann ich mir mein Leben ohne eigenes Auto gar nicht mehr vorstellen. Als Mutter mit zwei Teenagern im Schlepptau und dem ganzen Sportkrempel. Skifahren, spontane Trips zum Windsurfen am Neusiedler See, Wandern, Radfahren. Und immer wieder: einfach ans Meer fahren, wenn man Sehnsucht nach Italien hat. Die Kanaltal-Katharsis, der erste Espresso an der Italo-Tankstelle. Klar, all das könnte ich auch mit Zug und Leihauto organisieren. Aber es ist mir zu mühsam. Zu umständlich. Es würde mich um die Spontaneität bringen und Zeit kosten. Kostbare Zeit, die ich derzeit nicht habe.
Aber ihr, denke ich mir dann, wisst nicht, dass die CO 2-Bilanz meines Volvos dank seines Alters und seiner mäßigen Nutzung absolut zu rechtfertigen ist
Außerdem: Autofahren macht mir einfach Spaß. Ich mag das Brummen meiner fünf Zylinder. Beim Überholen liebe ich ihre verlässliche Beschleunigungskra . Ich freue mich jedes Mal, wenn uns der Allrad wie auf Schienen über verschneite Passstraßen führt. Und wundere mich immer über all die SUV-Halter ohne Allrad. Wenn schon diese verpönte Fahrzeugklasse, dann doch der Funktion wegen, oder?
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, einmal ohne Auto zu leben. Seit Jahren träume ich von einem VW California Beach, das wird meine nächste PS-Kutsche. Ich bleibe Madame Gaspedal, mit nur ein bisschen schlechtem Gewissen.F
J ulia ist 41 Jahre alt, lebt mit einem Kind und Partner im dicht besiedelten Bezirk Favoriten. Sie arbeitet als Angestellte in einem Einzelhandelsgeschä im neunten Bezirk, sieben Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Dort verdient sie 1800 Euro netto im Monat. Ein Auto besitzt die Frau nicht. Die meisten Wege legt sie mit den Öffis oder zu Fuß zurück.

Soraya Pechtl leitet den Wien-Newsle er Falter.morgen und schreibt regelmäßig über das Thema Mobilität
Julia ist eine fiktive Person – sie ist der durchschnittliche Wiener beziehungsweise die durchschnittliche Wienerin (51 Prozent der Stadtbevölkerung sind weiblich). Wie sie brauchen die meisten Menschen, die in der Stadt leben, kein Auto. 59 Prozent der Wiener haben einen Arbeitsweg von weniger als zehn Kilometern. Ein Viertel muss laut einer Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ sogar weniger als fünf Kilometer zurücklegen. Das sind Wege, die man zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen kann. Das tun die Wiener großteils auch bereits. Für ihre Alltagswege verwenden sie in 75 Prozent der Fälle diese drei Fortbewegungsarten. Mit dem Ausbau des Radwegenetzes dür e der Anteil weiter steigen.
Eines der bestenÖffi-Netze der EU hat Wien bereits. In der Stadt gibt es mehr Öffi-Jahreskarten (820.000) als Autos (700.000). In einer europaweiten Umfrage landet das Wiener Öffi-Netz nach London auf Platz zwei. Ja, in einigen Grätzeln Transdanubiens gibt es noch Au olbedarf – zusätzliche Bim- und Busverbindungen sind aber geplant.
In den allermeisten Wohngebieten der Stadt befinden sich die UBahn oder die Bim bereits in Geh-Reichweite. Wer in Wien von A nach B will, kommt öffentlich meist schneller und besser gelaunt an als mit dem Auto – vor
allem, wenn die Straßenbahn ein eigenes Gleisbett hat und nicht von Falschparkern oder Staus behindert wird. Mehr davon, bitte! Die Frage nach dem Autobesitz ist aber nicht nur eine ökologische –der Verkehr ist in Wien der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen –, sondern auch eine soziale.
Jeder, der ein Auto hat, weiß, dass sich die Ausgaben für Versicherungen, Parkplätze und Reparaturen läppern. Wer einen Pkw besitzt, gibt laut Daten der Statistik Austria in 40 Jahren 214.000 Euro für Mobilität aus. Das sind 5350 Euro pro Jahr. Autofreie Haushalte geben nur 1575 Euro pro Jahr aus. Menschen wie Julia können sich mit ihrem Wiener Durchschnittsgehalt ein Auto eigentlich nicht leisten. In vielen ländlichen Regionen Österreichs wäre sie ohne Auto stark eingeschränkt. In Wien ist sie das nicht.
Menschen wie Julia können sich ein Auto eigentlich nicht leisten. In vielen ländlichen Regionen Österreichs wäre sie ohne Auto eingeschränkt. In Wien ist sie das nicht.
Wenig überraschend haben viele Städter aus diesen Gründen auch kein eigenes Auto. Auf 1000 Einwohner kommen in der Bundeshauptstadt nur 284 Pkw – Tendenz sinkend. 47 Prozent aller Haushalte sind komplett autofrei. Österreichweit ist in Wien „die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl am höchsten, die Auto-Abhängigkeit mit Abstand am geringsten“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Und noch ein letztes Argument lässt sich entkrä en: Wer am Wochenende zu einem abgelegenen See fahren will, kann sich eines der zahlreichen Sharing-Angebote bedienen. Bei den Wiener Linien gibt es ein Mietauto ab 44 Euro pro Tag. Wer ö er unterwegs ist, kann ein monatliches Abo abschließen und bezahlt noch weniger. Für viele Gelegenheitsfahrer ist Sharing meist die günstigere und in jedem Fall klimafreundlichere Alternative als ein eigenes Auto. F
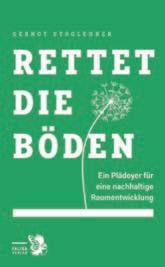
G ernot Stö g leh ner
Bö den sp ielen ei ne wichtige olle im Wasser- und O 2 -Kreislauf . nnov ativ e Lösungsansätz e zeigen, wie odenschutz trotz w achsender Inansp ruchnahme für B auland und nfras truk tur geli ngen ann.
21 6 Seiten, € 24,90
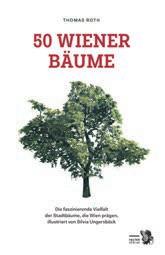


50 WIENER ÄUME
Thom as oth
Präsentiert wird die faszinierende
Vielf alt an aumart en, die Wien r ägen von ex otischen aritäten bis hi n u alten, einhei mischen iganten. Ergänzt durch Illustr ationen von Silv ia Ungersbö ck
192 Seiten, € 24,90
FA MOSE ÖG EL
K laus üchtern
Der FALT ER -Bir d- Watcher würdigt in seinen amüsant en und akribisch genauen Besp rechungen die best en eit en e des ogels.
224 Seiten, € 24,90
50 WIENER PFL A NZ EN
Birgit L ah ner
D er ideale Guide um die ielfältige Pflanzen welt Wiens neu u entde ck en.
Mit Blick i n die ergangenheit , ezügen z ur ak tuellen Forschung und überraschenden
Anwendungstipps.
25 6 Seiten, € 29,90