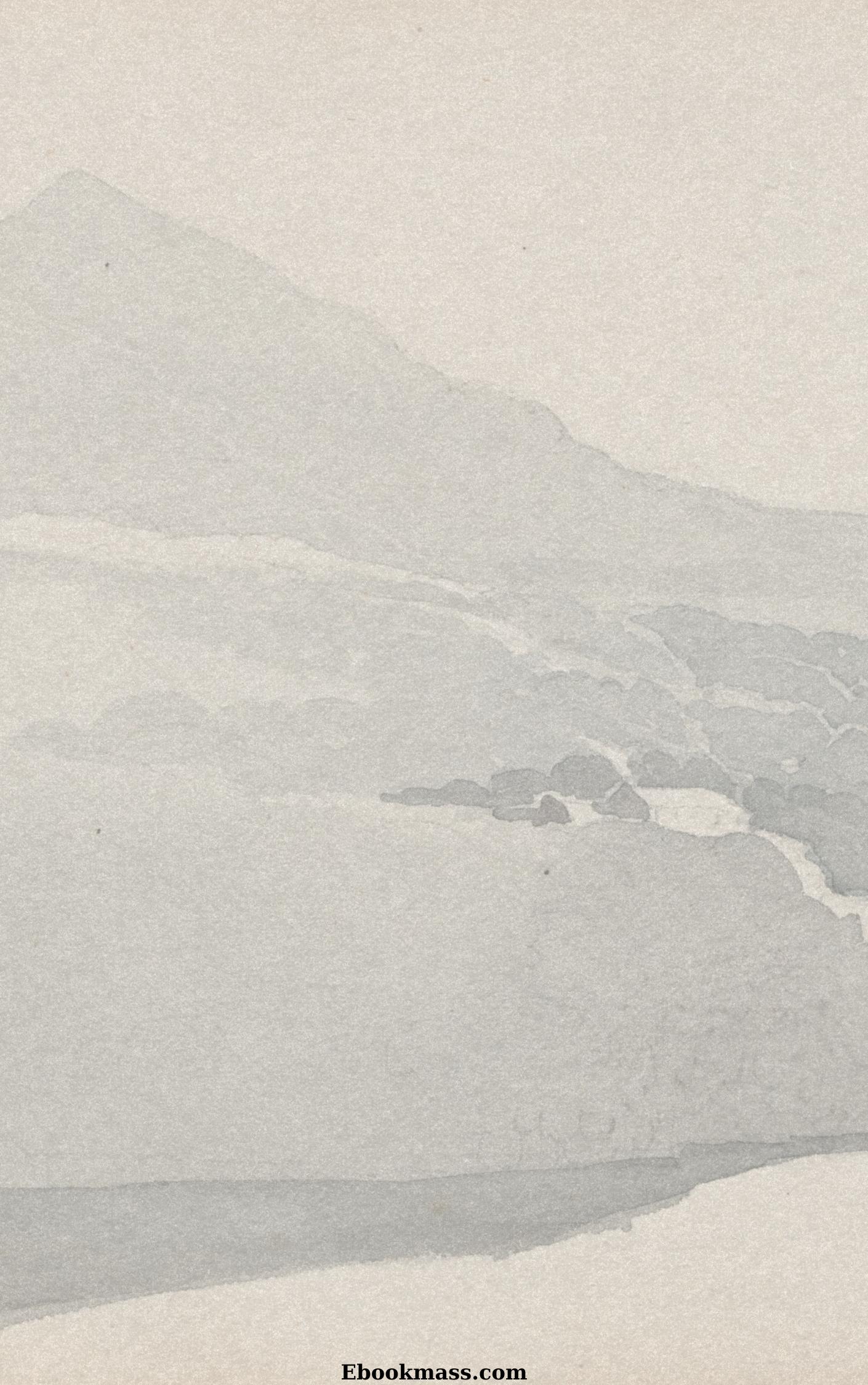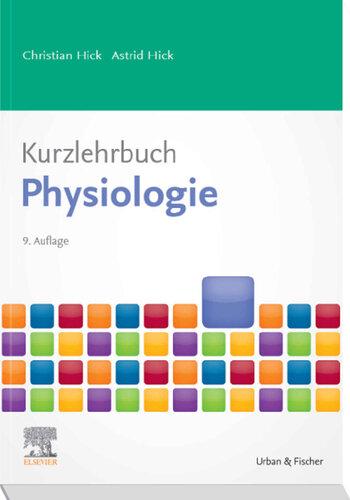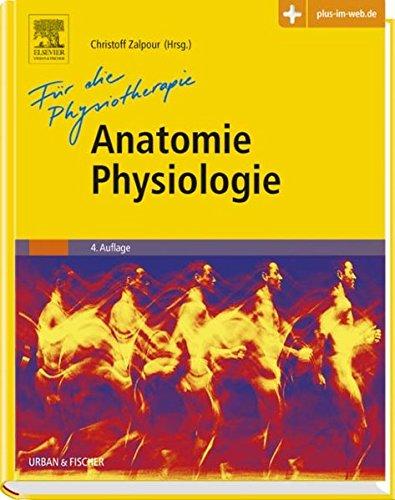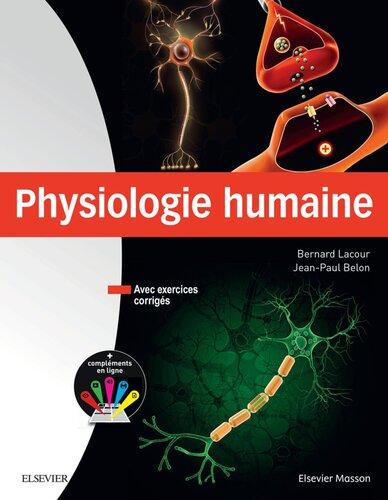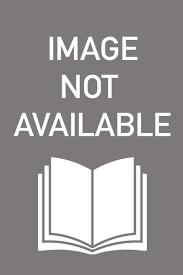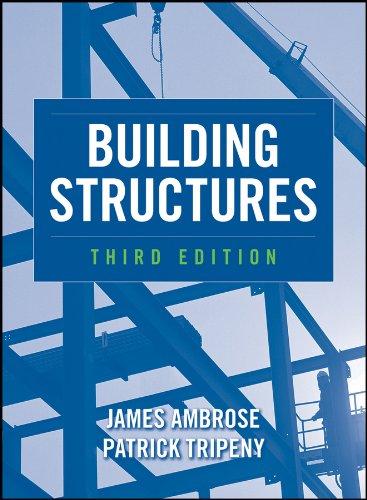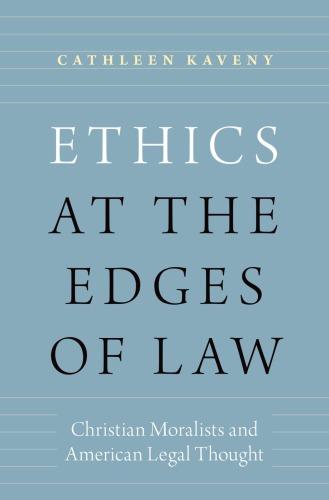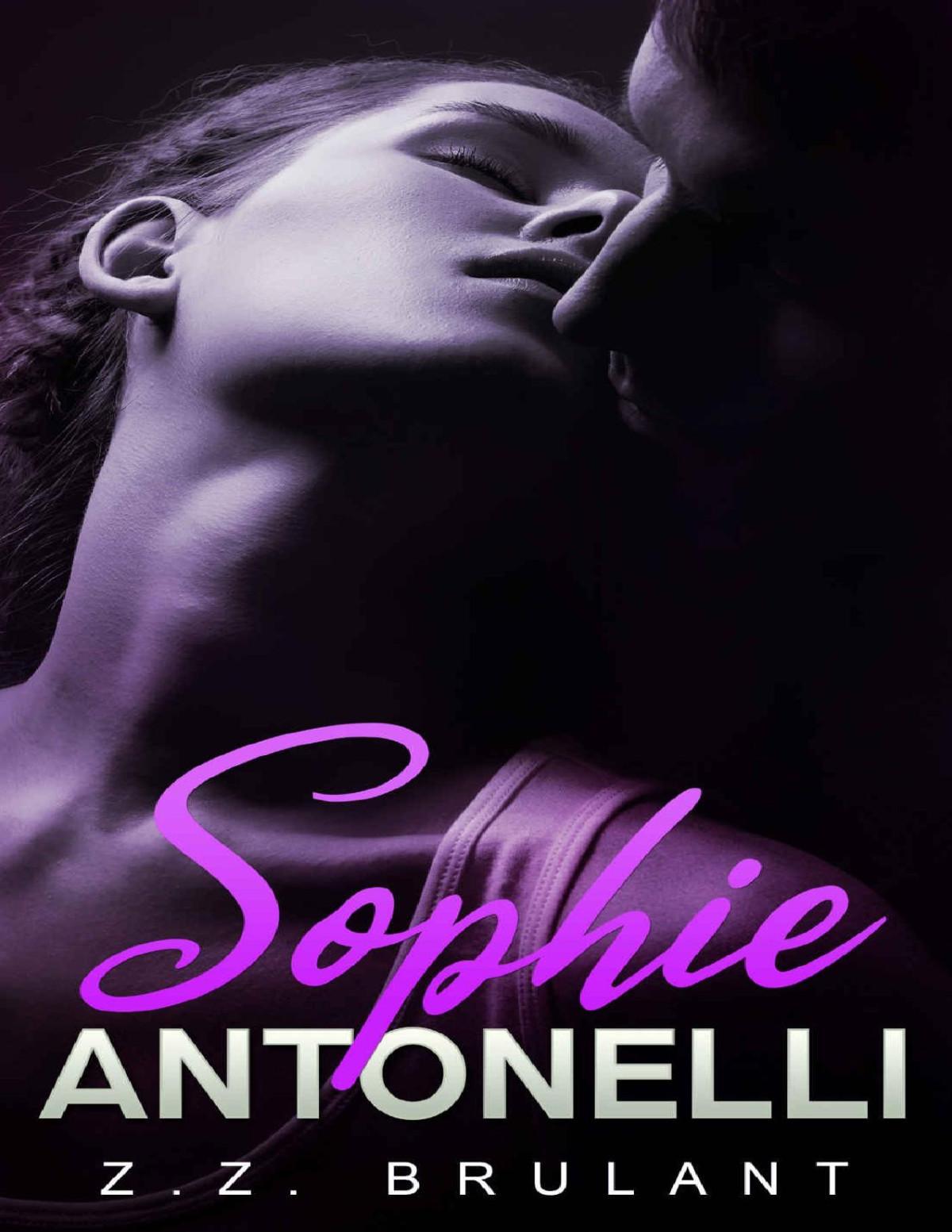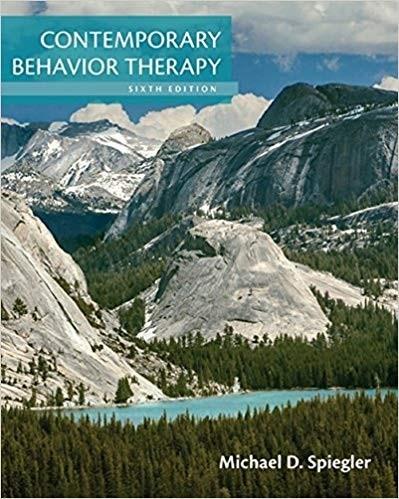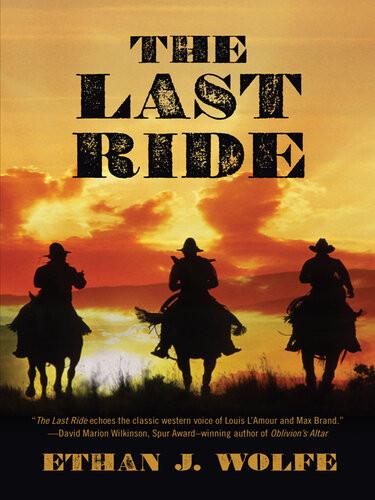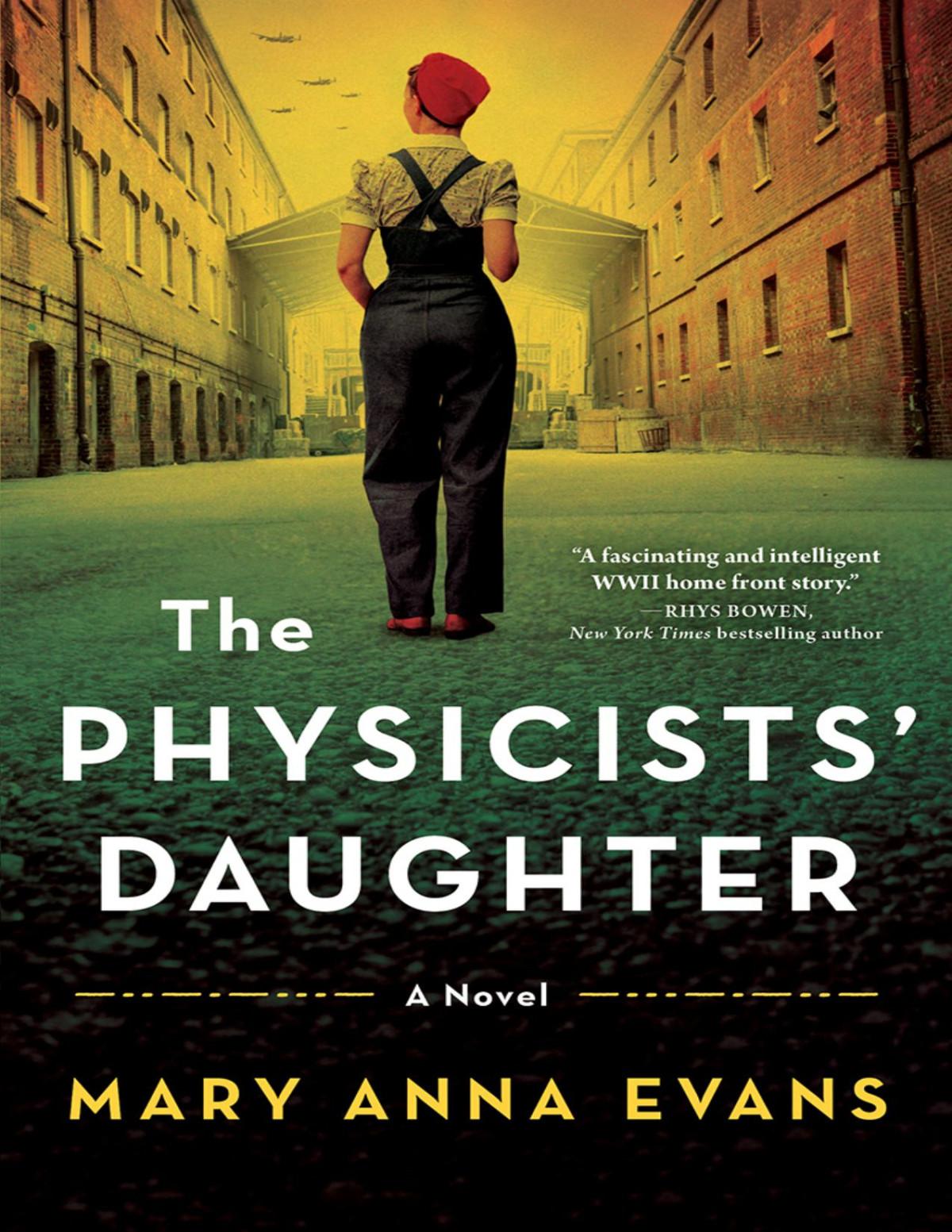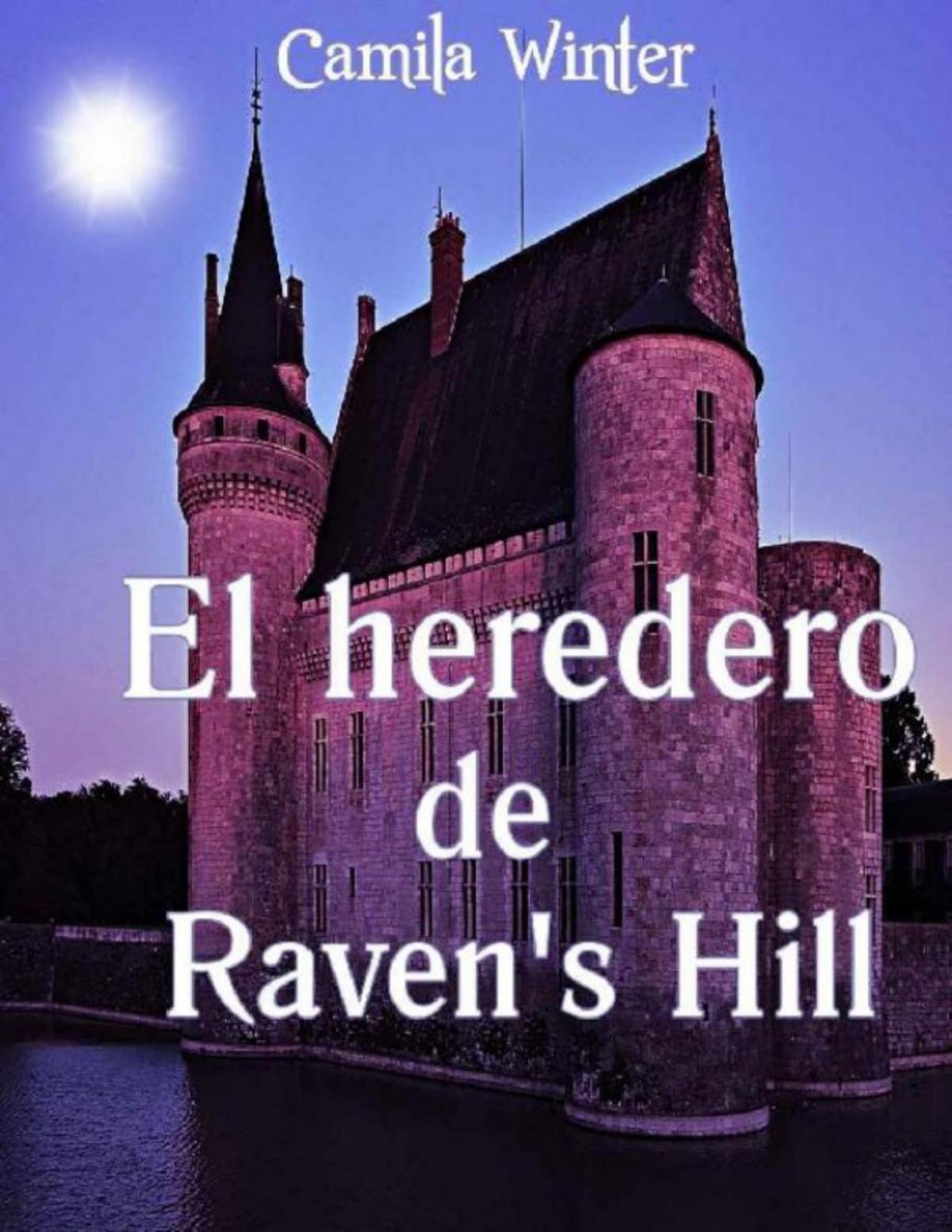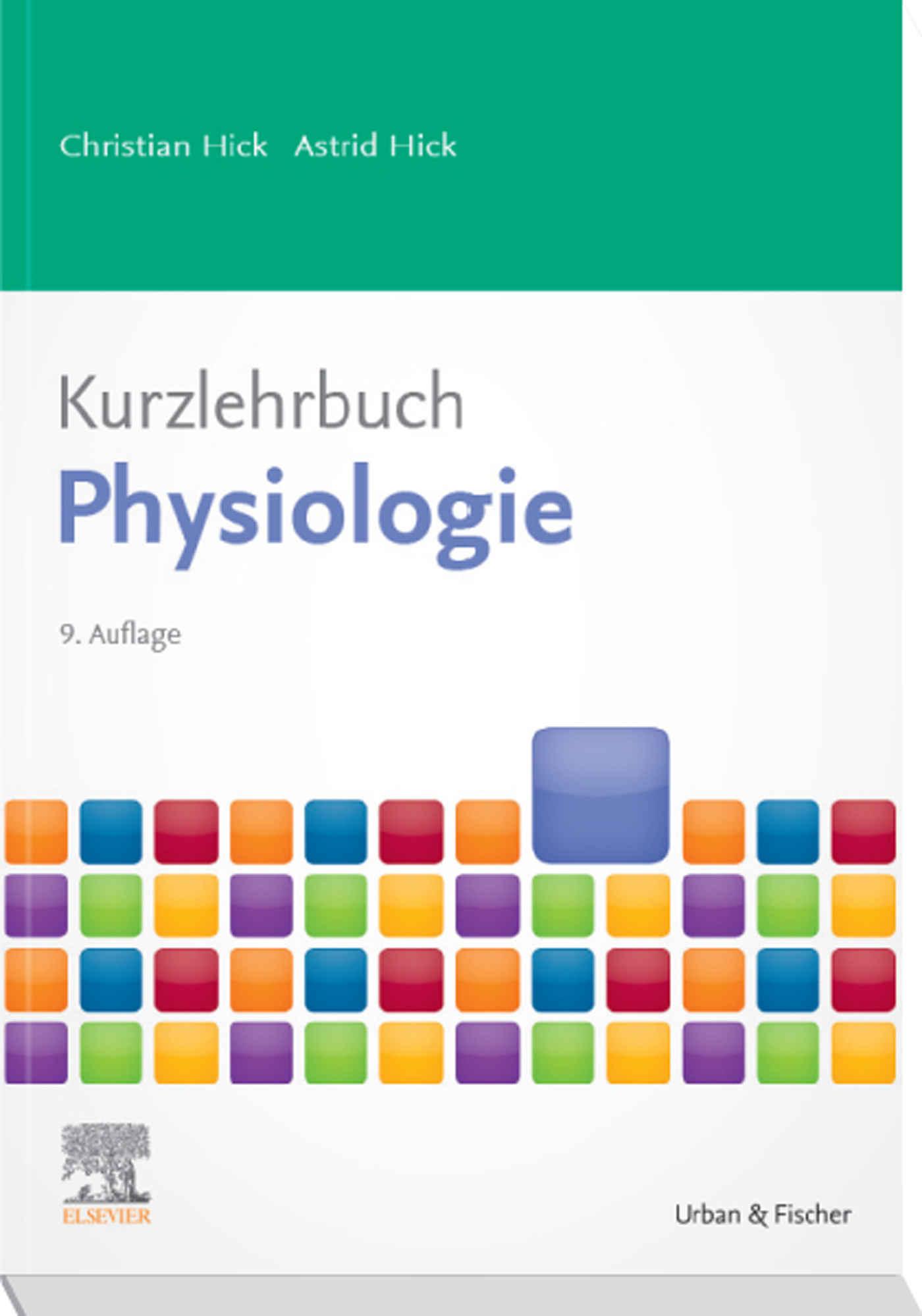Inhaltsverzeichnis
Vorderseite
Titelbla�
Copyright
Vorwort
Lesen, verstehen, bestehen–die Kurzlehrbücher
Abbildungsnachweis
01: Allgemeine Physiologie und Zellphysiologie
1.1. Wegweiser
1.2. Physiologische Maßeinheiten
1.3. Osmose
1.4. Stofftransport
1.5. Zellorganisation
1.6. Informationsübermittlung zwischen Zellen
1.7. Signaltransduktion
02: Blut und Immunsystem
2.1. Wegweiser
2.2. Blut
2.3. Erythrozyten
2.4. Blutplasma
2.5. Hämostase und Fibrinolyse
2.6. Abwehrsysteme und zelluläre Identität
03: Herz
3.1. Wegweiser
3.2. Elektrophysiologie des Herzens
3.3. Elektrokardiogramm
3.4. Herzmechanik
3.5. Ernährung des Herzens
3.6. Steuerung der Herztätigkeit
3.7. Pathophysiologie
04: Blutkreislauf
4.1. Wegweiser
4.2. Grundlagen
4.3. Hochdrucksystem
4.4. Niederdrucksystem
4.5. Gewebedurchblutung
4.6. Organkreisläufe
4.7. Fetaler und plazentarer Kreislauf
05: Atmung
5.1. Wegweiser
5.2. Nichtrespiratorische Lungenfunktionen
5.3. Physikalische Grundlagen
5.4. Atemmechanik
5.5. Gasaustausch
5.6. Atemgastransport im Blut
5.7. Atmungsregulation
5.8. Atmung unter speziellen Bedingungen
5.9. Gewebeatmung
5.10. Säure-Basen-Gleichgewicht und Pufferung
06: Arbeits- und Leistungsphysiologie
6.1. Wegweiser
6.2. Umstellungsreaktionen bei gesteigerter Muskeltätigkeit
6.3. Leistungsdiagnostik und Grenzen der Leistungsfähigkeit
6.4. Ermüdung und Erholung
6.5. Training
07: Ernährung, Verdauungstrakt, Leber
7.1. Wegweiser
7.2. Ernährung
7.3. Motorik des Magen-Darm-Trakts
7.4. Sekretion
7.5. Aufschluss der Nahrung
7.6. Nahrungsresorption
7.7. Humorale Steuerung der Magen-Darm-Funktion
08: Energie- und Wärmehaushalt
8.1. Wegweiser
8.2. Energiehaushalt
8.3. Wärmehaushalt
09: Wasser- und Elektrolythaushalt, Nierenfunktion
9.1. Wegweiser
9.2. Wasser- und Elektrolythaushalt
9.3. Niere
10: Hormonale Regulation
10.1. Wegweiser
10.2. Grundlagen
10.3. Hypothalamus und Hypophyse
10.4. Schilddrüse
10.5. Nebenniere
10.6. Calciumhaushalt
10.7. Endokrines Pankreas
10.8. Sonstige Hormone
11: Sexualentwicklung, Reproduktionsphysiologie und Alter
11.1. Wegweiser
11.2. Weibliche Sexualhormone
11.3. Menstruationszyklus
11.4. Hodenfunktion
11.5. Kohabitation
11.6. Schwangerschaft
11.7. Laktation
11.8. Sexuelle Differenzierung
11.9. Alter
12: Funktionsprinzipien des Nervensystems
12.1. Wegweiser
12.2. Ruhemembranpotenzial
12.3. Signalübertragung in Zellen
12.4. Signalübertragung zwischen Zellen
12.5. Signalverarbeitung im Nervensystem
12.6. Sensorische Systeme
13: Muskelphysiologie
13.1. Wegweiser
13.2. Quergestreifte Muskulatur
13.3. Glatte Muskulatur
14: Vegetatives Nervensystem
14.1. Wegweiser
14.2. Morphologische Grundlagen
14.3. Signalübertragung
14.4. Funktionelle Organisation
15: Motorik
15.1. Wegweiser
15.2. Spinale Motorik
15.3. Hirnstammmotorik
15.4. Basalganglien
15.5. Kleinhirn
15.6. Motorischer Kortex
16: Somatosensorisches System
16.1. Wegweiser
16.2. Tastsinn
16.3. Temperatursinn
16.4. Nozizeption
16.5. Juckreiz
16.6. Tiefensensibilität
16.7. Viszerale Sensorik
16.8. Sensorische Informationsverarbeitung
17: Visuelles System
17.1. Wegweiser
17.2. Dioptrischer Apparat
17.3. Retina (Netzhaut)
17.4. Sehbahn
17.5. Informationsverarbeitung
17.6. Sehschärfe (Visus)
17.7. Farbensehen
17.8. Räumliches Sehen
18: Vestibuläres und auditorisches System
18.1. Wegweiser
18.2. Vestibuläres System
18.3. Auditorisches System
18.4. Stimme und Sprache
19: Geschmack und Geruch
19.1. Wegweiser
19.2. Geschmack
19.3. Geruch
20: Integrative Leistungen des Zentralnervensystems
20.1. Wegweiser
20.2. Organisation des Kortex
20.3. Elektrophysiologie des Kortex
20.4. Hirnstoffwechsel und Hirndurchblutung
20.5. Lernen und Gedächtnis
20.6. Physiologische Rhythmen
20.7. Bewusstsein
20.8. Sprachregionen
20.9. Triebverhalten, Motivation und Emotion
Register
Weitere Bücher bei Elsevier
Copyright
Elsevier GmbH, Hackerbrücke 6, 80335 München, Deutschland Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen an books.cs.muc@elsevier.com
ISBN 978-3-437-41884-6 eISBN 978-3-437-05885-1
Alle Rechte vorbehalten
9. Auflage 2020
© Elsevier GmbH, Deutschland
Wichtiger Hinweis für den Benu�er
Ärzte/Praktiker und Forscher müssen sich bei der Bewertung und Anwendung aller hier beschriebenen Informationen, Methoden, Wirkstoffe oder Experimente stets auf ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse verlassen. Bedingt durch den schnellen Wissenszuwachs insbesondere in den medizinischen Wissenschaften sollte eine unabhängige Überprüfung von Diagnosen und Arzneimi�eldosierungen erfolgen. Im größtmöglichen Umfang des Gese�es wird von Elsevier, den Autoren, Redakteuren oder Beitragenden keinerlei Haftung in Bezug auf jegliche Verle�ung und/oder Schäden an Personen oder Eigentum, im Rahmen von Produkthaftung, Fahrlässigkeit oder anderweitig, übernommen. Dies gilt gleichermaßen für jegliche Anwendung oder Bedienung der in diesem Werk aufgeführten Methoden, Produkte, Anweisungen oder Konzepte.
Für die Vollständigkeit und Auswahl der aufgeführten
Medikamente übernimmt der Verlag keine Gewähr. Geschü�te Warennamen (Warenzeichen) werden in der Regel besonders kenntlich gemacht (®). Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann jedoch nicht automatisch geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über h�ps://www.dnb.de abru�ar.
20 21 22 23 24 5 4 3 2 1
Für Copyright in Bezug auf das verwendete Bildmaterial siehe Abbildungsnachweis
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschü�t. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgese�es ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und stra�ar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überse�ungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Um den Textfluss nicht zu stören, wurde bei Patienten und Berufsbezeichnungen die grammatikalisch maskuline Form gewählt. Selbstverständlich sind in diesen Fällen immer alle Geschlechter gemeint.
Planung: Susanne Szczepanek
Projektmanagement: Cornelia von Saint Paul
Redaktion: Martin Kortenhaus, MT-Medizintexte GbR, Illertissen
Bildredaktion und Rechteklärung: Juliana Samoilowa
Sa�: Thomson Digital, Noida/Indien
Druck und Bindung: Drukarnia Dimograf Sp. z o. o., BielskoBiała/Polen
Umschlaggestaltung: SpieszDesign, Neu-Ulm
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.elsevier.de.
Vorwort
Liebe Studierende,
für diese 9. Auflage unseres Kurzlehrbuchs Physiologie haben wir das Buch aktualisiert und wichtige physiologische Sachverhalte neu aufgenommen. Natürlich haben wir auch wieder geprüft, ob sich die Fragen des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) mit unserem Buch beantworten lassen. Wo erforderlich, haben wir fehlende Informationen ergänzt. Berücksichtigt sind hierbei die Examina der le�ten 10 Jahre bis einschließlich Frühjahr 2019.
So hoffen wir, dass sich das Kurzlehrbuch Physiologie als „scha�ares Physiologiebuch“ im rauen Lerneinsa� weiterhin bewähren kann.
Das Kurzlehrbuch Physiologie bietet aber mehr als reine Prüfungsvorbereitung. Unter Verzicht auf wissenschaftlichen Ballast und Fußnotenwissen wird eine knappe, aber dennoch erklärende, lehrbuchartige Darstellung des physiologischen Basiswissens geboten. Außer als „Lernbuch“ für schriftliche oder mündliche Prüfungen kann das Kurzlehrbuch daher auch als studienbegleitender Basistext zur medizinisch relevanten menschlichen Physiologie genu�t werden.
Das bewährte Konzept einer benu�erfreundlichen Au�ereitung des Lernstoffs haben wir beibehalten:
• Die Gliederung des Textes in kurze, übersichtliche Abschni�e erleichtert Orientierung und Wissensaufnahme.
• Textpassagen, die für die Beantwortung der IMPP-Fragen besonders wichtig sind, wurden durch einen grünen Balken
am Rand des Textes kenntlich gemacht.
• Eine IMPP-Hitliste zu Beginn der Kapitel benennt die Schwerpunkte der bisherigen Prüfungsfragen.
• Kurze Merktexte helfen beim Einprägen physiologisch wichtiger Sachverhalte.
• Lerntipps geben Hinweise auf Schwerpunkte und Vorlieben des IMPP und unterstü�en die gezielte Prüfungsvorbereitung.
• Klinische Hinweise verdeutlichen die Praxisrelevanz physiologischen Wissens.
• Ein ausführlicher Index ermöglicht den raschen Zugriff auf die gesuchten Informationen.
Die vorliegende Neuauflage wurde durch die große Zahl Ihrer Zuschriften und Kritiken wesentlich gefördert. Wir möchten daher an dieser Stelle allen Leserinnen und Lesern für ihre Vorschläge, Ergänzungen und Korrekturhinweise ganz herzlich danken und Sie bi�en, uns auch in Zukunft Ihre Anregungen mi�uteilen: christian.hick@uni-koeln.de. Wir würden uns wünschen, dass mit unserem Buch das medizinische Basisfach Physiologie etwas von seiner „Schwere“ verliert und es Ihnen die parallele Vorbereitung auf IMPP-Fragen (Detailwissen) und mündliche Prüfungen (Verständniswissen) erleichtert. So kommt dann hoffentlich, wie eine Kommilitonin schrieb, „der Spaß an der Physiologie zurück“.
Köln, im Winter 2020
Astrid und Christian Hick
1.2. Physiologische Maßeinheiten
Für die quantitative Beschreibung physiologischer Vorgänge im Organismus sind die folgenden physikalischen Maßeinheiten besonders wichtig:
1.2.1. Druck, Arbeit, Leistung
1.2.1.1.
Druck
Der Druck (P) ist definiert als Kraft (F) pro Fläche (A):
Die Einheit des Drucks ist das Pascal (Pa), die Kraft wird in Newton (N), die Fläche in Quadratmetern (m2) angegeben. Als ältere Druckeinheiten werden in der Physiologie noch mmHg (Quecksilber) und cmH2O verwendet. Dabei gilt:
1.2.1.2.
Arbeit
Die Arbeit (W) ist definiert als Kraft (F) mal Weg (s). Im physikalischen Sinne sind Energie und Wärmemenge mit der Arbeit identisch:
Die Einheit von Energie, Arbeit oder Wärmemenge ist das Joule (J). Für die Umrechnung aus der älteren Energieeinheit Kalorie (cal)
gilt:
Merke
Das Produkt aus Druck [N/m2] und Volumen [m3] ergibt ebenfalls Arbeit [N × m]: Druck-VolumenArbeit. Die Arbeit des Herzens ist unter physiologischen Bedingungen hauptsächlich eine Druck-Volumen-Arbeit (► Kap. 3.4.5).
Klinik
Ein plö�licher Blutdruckanstieg führt zu einem raschen Anstieg der Druck-Volumen-Arbeit des Herzens. Um diese Mehrarbeit leisten zu können, ist das Herz auf eine Steigerung der Energieversorgung durch Sauerstoff angewiesen. Der gesteigerte Sauersto�edarf wird über eine Erhöhung der Koronardurchblutung sichergestellt. Ist dies z. B. bei arteriosklerotisch verengten Koronararterien nicht möglich, entsteht ein Sauerstoffmangel im Myokardgewebe. Der Patient verspürt ein Engegefühl in der Brust: Angina pectoris.
1.2.1.3. Leistung
Die Leistung (P) ist definiert als Arbeit (W) pro Zeit (t):
Die Einheit der Leistung ist das Wa� (W), das einem Joule Arbeit (J) pro Sekunde (s) entspricht (► Kap. 8).
1.2.2. Stoffmenge und Konzentration
1.2.2.1. Stoffmenge
Die Stoffmenge einer Substanz wird in Mol (Symbol: mol) angegeben. Dabei gilt:
1.2.2.2. Konzentration
Die Konzentration einer Substanz kann auf 3 verschiedene Weisen ausgedrückt werden:
• Die Massenkonzentration [g/l] gibt die Masse eines Stoffs pro Volumeneinheit an. So beträgt z. B. die Massenkonzentration von Hämoglobin im Blut beim Mann 15–16 g/100 ml.
• Die Stoffmengenkonzentration [mol/l], auch als molare Konzentration bezeichnet, ist die Stoffmenge pro Volumeneinheit. Die Stoffmengenkonzentration von K+Ionen z. B. im Blutplasma liegt bei 5 mmol/l.
• Die molale Konzentration [mol/kg] ist die Stoffmenge pro Masseneinheit eines Lösungsmi�els. Molale Konzentrationsangaben sind–im Gegensa� zu volumenbezogenen molaren Konzentrationsangaben–von Temperaturschwankungen und den hieraus resultierenden Volumenschwankungen unabhängig. Deshalb werden vor allem die Konzentrationen osmotisch wirksamer Substanzen besser in molalen und nicht in molaren Einheiten angegeben (► Kap. 1.3.2.2). In physiologischen Flüssigkeiten wie dem Blutplasma machen zudem die gelösten Bestandteile (vor