Onkel Johns Hütte Tobias Faller
Visit to download the full and correct content document: https://ebookmass.com/product/onkel-johns-hutte-tobias-faller/

More products digital (pdf, epub, mobi) instant download maybe you interests ...
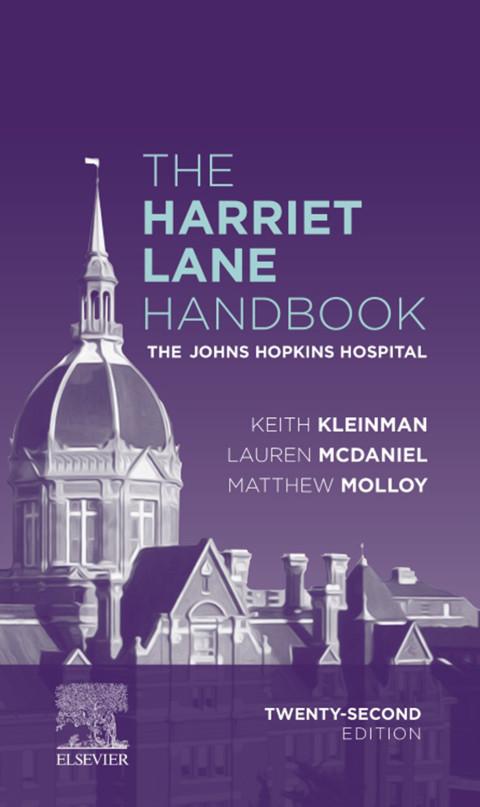
The Harriet Lane Handbook: The Johns Hopkins Hospital (Mobile Medicine) 22nd Edition The Johns Hopkins Hospital
https://ebookmass.com/product/the-harriet-lane-handbook-thejohns-hopkins-hospital-mobile-medicine-22nd-edition-the-johnshopkins-hospital/
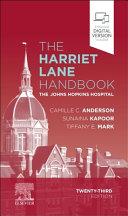
The Harriet Lane Handbook-The Johns Hopkins Hospital, 23e (May 15, 2023)_(0323876986)_(Elsevier) Johns Hopkins Hospital
https://ebookmass.com/product/the-harriet-lane-handbook-thejohns-hopkins-hospital-23e-may-15-2023_0323876986_elsevier-johnshopkins-hospital/

The Handbook of Language Assessment Across Modalities Tobias Haug
https://ebookmass.com/product/the-handbook-of-languageassessment-across-modalities-tobias-haug/
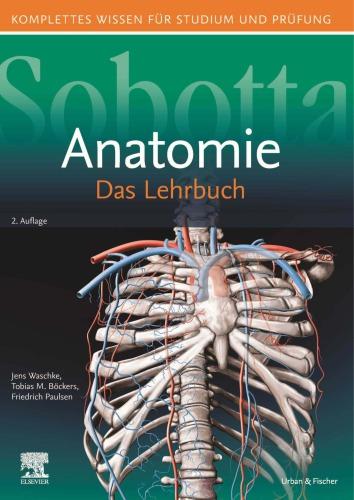
Sobotta Lehrbuch Anatomie. 2. Auflage Edition Tobias M. Böckers
https://ebookmass.com/product/sobotta-lehrbuchanatomie-2-auflage-edition-tobias-m-bockers/
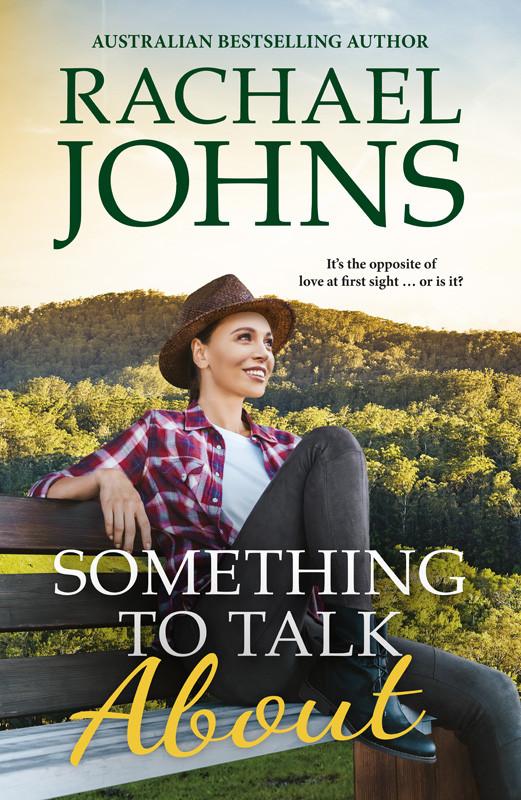
Something
to Talk About (Rose Hill, #2) Rachael Johns
https://ebookmass.com/product/something-to-talk-about-rosehill-2-rachael-johns/
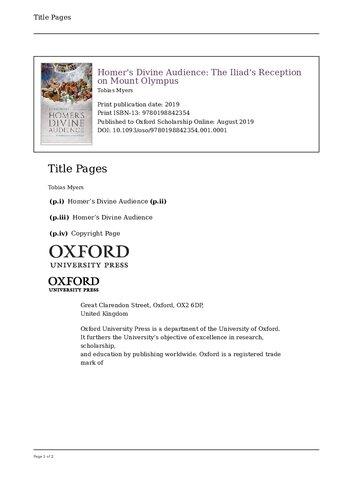
Homer's Divine Audience: The Iliad's Reception on Mount Olympus Tobias Myers
https://ebookmass.com/product/homers-divine-audience-the-iliadsreception-on-mount-olympus-tobias-myers/
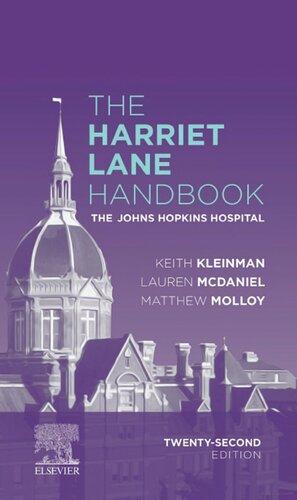
The Harriet Lane Handbook 22nd Edition (2020) The Johns Hopkins Hospital
https://ebookmass.com/product/the-harriet-lane-handbook-22ndedition-2020-the-johns-hopkins-hospital/
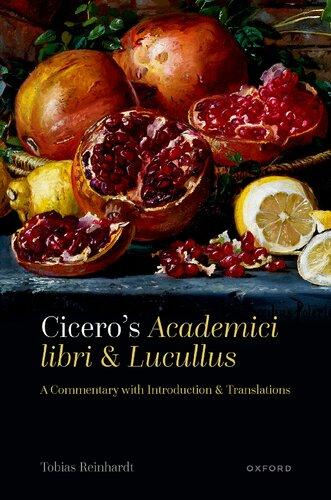
Cicero's Academici libri and Lucullus: A Commentary with Introduction and Translations Tobias Reinhardt
https://ebookmass.com/product/ciceros-academici-libri-andlucullus-a-commentary-with-introduction-and-translations-tobiasreinhardt/

1931: Debt, Crisis, And The Rise Of Hitler 1st Edition Edition Tobias Straumann
https://ebookmass.com/product/1931-debt-crisis-and-the-rise-ofhitler-1st-edition-edition-tobias-straumann/
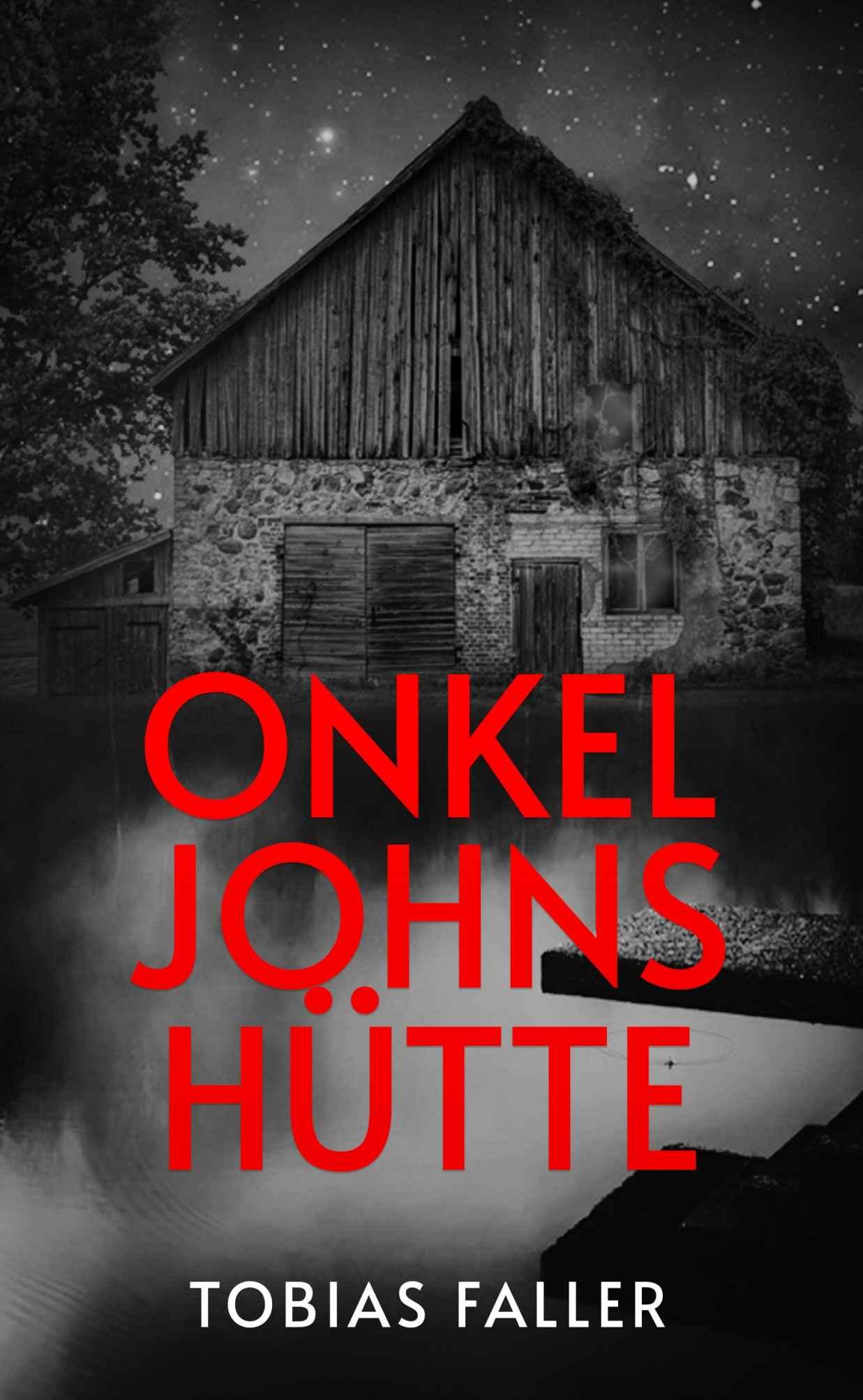
Prolog
Hunderte Male war Alexander Trent schon den Spaziergangweg am Wasser entlanggelaufen. Vielleicht sogar tausend Male; er hatte ja aber auch nicht mitgezählt. Es ist eine idyllische Route, knapp 500 Meter entfernt von jeglicher Zivilisation, mit viel Grün und viel Stille. Nun gut – viel Stille konnte Trent heute nicht erwarten, schließlich hatte er sich an seinem freien Sonntag die ganze Familie geschnappt und war mit ihr auf eine Wanderung gegangen. Das ganze Wochenende musste er darauf warten, dass seine Liebsten von ihrem Ausflug zu den Schwiegereltern zurückkamen; vielleicht hatte er es auch deshalb kaum erwarten können, aus dem Haus zu kommen.
Hand in Hand lief er mit seiner Ehefrau am Ufer des Sees entlang und hielt Ausschau nach seinen beiden Kindern, die vorneweg rannten und laut grölend sichtlich ihren Spaß an dem Ausflug hatten. Am meisten mochte Trent an der Route, dass er hier weitestgehend ungestört war und nur selten auf andere Menschen traf. Es war ein Rückzugsort inmitten der Natur, die er schon seit über 30 Jahren, seit frühsten Kindheitstagen, immer wieder aufsuchte, um auf andere Gedanken zu kommen.
Alexander Trent war mittlerweile 34 Jahre alt und hatte 33 Jahre davon in Bridgeport gelebt – tiefstes Südengland, auf halber Strecke zwischen Exeter und Bournemouth, an einem Fleck, an den nur Menschen leben, die hier schon immer gelebt hatten. Das hatte seine Vorteile und seine Nachteile, aber für Trent überwogen die Vorteile eindeutig. Ein Jahr hatte er es mal versucht, sich an das Stadtleben zu gewöhnen und war übergangsweise nach Bournemouth gezogen, doch er musste recht schnell feststellen, dass das nichts für ihn war, und so flüchtete er recht schnell wieder zurück in die vertraute Heimat. Man konnte es ihm nachsehen, schließlich hatte er hier ja auch alles: einen sicheren Job bei der Bank, viele Freunde, seit sieben Jahren eine Ehefrau und seit sechs Jahren auch schon Kinder. Das zweite war jetzt auch schon drei und bereits überraschend gut zu Fuß, wie Trent beim Familienausflug feststellte.
Die Route führte die Familie zwischen zwei großen Seen entlang. Genau genommen war es nur ein See, denn wenn man den Weg noch mehr als einen Kilometer weiterlaufen würde, würde man irgendwann an einen kaum drei Meter breiten Kanal kommen, der die beiden Gewässer miteinander verband – doch so weit lief selten jemand in die Halbinsel hinein. Ganz am Anfang befand sich noch ein kleiner Spielplatz und alle paar Meter auch eine Sitzgelegenheit, doch je weiter nach hinten man laufen würde, desto mehr Gestrüpp und ein immer schlechter befestigter Weg würden dort warten.
Doch die Kinder schienen viel Lust und vor allem Ausdauer mitgebracht zu haben und machten nicht den Anschein, als würden sie umdrehen und nach Hause gehen wollen. „Könnt ihr noch?“, rief Trent ihnen zu, als sie etwa die Hälfte der Halbinsel hinter sich hatten.
„Ja!“, schallte es enthusiastisch und beinahe synchron zurück.
In diesem Moment kamen der Familie auch die ersten Menschenseelen entgegen, die sie seit Verlassen ihres Hauses gesehen hatten.
„Na, wie geht’s?“, fragte ein Mann, der ein paar Jahre älter sein dürfte als Trent und ebenfalls seine Ehefrau und Kinder im Schlepptau hatte, die jeweils etwa drei Jahre älter als die von Trent waren.
„Alles bestens, und selbst?“ Trent schien den Mann zu kennen.
„Ach, ich kann nicht klagen“, gab dieser salopp zurück.
Dann liefen die beiden Familien aneinander vorbei und der kurze Small Talk war schon wieder beendet.
Es war ein schöner Sonntagnachmittag im Spätsommer - nicht besonders warm, aber das war es hier eigentlich nie. Bridgeport lag zwar an der Küste, aber als Sommerurlaubsort eignete es sich wahrlich nicht. Immerhin war der Himmel wolkenfrei und die Sonne schien Trent und seiner Familie ins Gesicht. Zufrieden grinsend schloss der Familienvater kurz die Augen und genoss den Moment. Er spürte die warmen Hände seiner Frau und hörte das aufgeregte Geschrei seiner Kinder. Das Leben war schön.
Als er die Augen wieder öffnete, waren sie schon fast am Ende der Halbinsel angelangt. In etwa 200 Metern würden sie auf den Kanal treffen und der Rückweg wäre unausweichlich. In der Ferne
sah er eine Frau auf sie zukommen, aber die dürfte immer noch hundert Meter entfernt sein. Ihnen etwas näher entgegen befand sich hingegen ein älterer Herr, der sich mithilfe eines Gehstocks mühsam vorwärtsbewegte. „Guten Tag“, grüßten Trent und seine Frau ihn beinahe zeitgleich.
„Tag“, grummelte der Rentner nur zurück und schlich dann weiter von Dannen.
„Nicht so schnell“, rief Trent seinen Kindern hinterher, als der Mann sie gerade passiert hatte, doch die befanden sich scheinbar schon außer Hörweite.
„Gehst du hinterher und schaust, dass sie keine Dummheiten machen?“, fragte seine Frau.
„Klar“, antwortete ihr Gatte, ließ ihre Hand los und zog sein Lauftempo ein wenig an.
Ein paar Meter weiter traf er dann schließlich auf die Dame, die er schon aus der Ferne erkannt hatte und die kaum älter als er selbst sein konnte, auch wenn er keinen klaren Blick auf ihr Gesicht erhaschen konnte, da sie ihren Kopf beim Laufen in Richtung Boden gesenkt hatte. „Tag“, grüßte er auch sie im Vorbeigehen, aber eher alibimäßig, denn er drehte sich bereits weg und lief zügig seinen Kindern hinterher, noch bevor die Frau überhaupt die Chance hatte, ihn zurückzugrüßen.
Die Kleinen waren wirklich schnell unterwegs, musste Trent sich eingestehen. Obwohl er sein Schritttempo so sehr angezogen hatte, dass er schon auf hundert Meter ein wenig ins Keuchen geraten war, hatten die beiden Kinder immer noch ein paar Meter Vorsprung und näherten sich dem Wasser. Ganz am Ende der Halbinsel stand noch eine ranzige Hütte, die schon so lange dort stand, wie Trent denken konnte und mindestens genauso lange auch schon nicht mehr renoviert worden war. Als er noch ein Kind war, gingen hier ab und an mal ein paar ältere Männer ein und aus, wie eine Art Stammtisch, aber die waren mittlerweile wahrscheinlich verstorben und entsprechend war das Gebäude genauso verlassen wie der Rest ihrer Umgebung.
„Hey!“, rief Trent seinen Kindern hinterher. „Macht mal langsam.“ Die beiden drehten sich um, liefen dann aber trotzdem bis zum Wasser weiter. Trent seufzte und setzte dann nochmal zu einem
kurzen Sprint an, um seine Kinder zumindest noch vor dem Ufer einzuholen.
„Beeil‘ dich“, hörte er seine Frau aus der Ferne mit etwas besorgtem Tonfall noch rufen.
Doch sie brauchte keine Sorgen haben, denn etwa zehn Meter vor dem Ufer erreichte Trent seine beiden Kinder und nahm sie an die Hand. „Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt langsam machen“, tadelte er sie.
„Habe dich nicht gehört“, entgegnete sein Älterer und setzte dabei einen Blick auf, den Trent mit seiner väterlichen Erfahrung so deutete, als würde er die Wahrheit sagen.
„Aber du hast dich doch sogar umgedreht.“
„Ich habe was gehört.“
„Das war wahrscheinlich ich.“
„Nein, was anderes.“
„Was anderes? Hier ist doch nichts außer Mama, euch und mir.“
„Ich glaube, es kam aus der Hütte.“
Trent drehte sich um und zeigte mit dem Finger auf das verlassene Haus. „Meinst du diese Hütte?“
„Welche Hütte denn sonst?“
Daraufhin lachte Trent und raufte seinem Sohn durch die Haare. Mittlerweile hatte auch die Mutter zum Rest der Familie aufgeschlossen.
„Er hat gesagt, er hat was gehört“, klärte Trent auf.
„Ach ja?“ Seine Gattin zog eine Augenbraue nach oben. „Offensichtlich ja nicht dich, sonst wären sie wohl kaum so schnell vorneweggerannt.“
„Nein, aus der Hütte.“
„Ach was, die steht doch leer.“
„Wird schon nichts gewesen sein“, pflichtete Trent ihr bei.
Dann nahm er seine Frau wieder bei der Hand, umarmte mit dem anderen Arm seinen Jüngeren und schaute zur linken Seite auf eine der beiden Seehälften hinaus.
„Schön hier, nicht?“, fragte seine Frau in die Runde.
„Ja“, nickten die beiden Kinder.
„Und so ruhig. So entspannend.“
„Lasst uns noch ein paar Minuten hier sitzenbleiben, um wieder Kraft zu tanken, und dann nach Hause gehen und ein paar Kekse essen“, schlug Trent vor.
„Ja!“, pflichteten seine beiden Söhne ihm freudestrahlend bei.
Als Alexander Trent so dasaß, mit seiner Familie in den Armen, der Sonne im Nacken und der heimatlichen Idylle um ihn herum, wurde ihm wieder einmal bewusst, wie gut er es doch hatte. Gegen nichts auf der Welt würde er es eintauschen, und er könnte sich nichts ausdenken, was diesen schönen Moment kaputtmachen könnte.
„So!“, rief er plötzlich, nachdem die ganze Familie, inklusive der sonst nur schwer stillzustellenden Kinder, minutenlang wortlos am Seeufer verharrt und den Ausblick genossen hatte. „Wer will Kekse?“
Natürlich war der Ansturm auf den bevorstehenden Snack groß, und so dauerte es auch keine fünf Sekunden, bis die vier wieder zu Fuß unterwegs war. Trent drehte sich noch einmal um, um die schöne Momentaufnahme nochmal aufzuschnappen, und lief dann seinen nimmermüden Kindern hinterher, die schon wieder ein Mordstempo vorlegten. Dieses Mal hatte seine Frau aber Dienst, sie einzufangen, bevor sie irgendetwas Dummes anstellten, also steckte er gemütlich die Hände in die Hosentaschen und schlenderte den staubigen Trampelpfad entlang, der sie irgendwann wieder in die Nähe der Zivilisation führen sollte.
Als er bei der Hütte vorbeikam, warf er im Vorbeilaufen einen flüchtigen Blick ins Innere. Wie er sich gedacht hatte: da war nichts. Moment.
Oder doch?
Eigentlich war Trent schon ein paar Schritte weitergelaufen und hatte sich bei seinem Routineblick nichts weiter dabei gedacht, als dass er seine Annahme bestätigt bekommen würde. Doch ganz leer war die Hütte nicht, wie er aus dem Augenwinkel gesehen hatte. Vorsichtig lief er ein paar Schritte zurück und auf die Hütte zu. „Wartet mal“, rief er seiner Familie zu, während er mit seinen Händen das Gestrüpp zur Seite drückte, welches ihm den Weg zum Fenster versperrte.
„Was ist denn los?“, rief seine Frau ihm zu. Doch Alexander Trent antwortete nicht. Sekundenlang starrte er wie gebannt in das Innere der Hütte. „Was ist denn los?“, versuchte seine Frau es noch einmal. Doch Trent gab wieder keine Antwort. Verängstigt nahm seine Gattin die Kinder an die Hand und lief ihm vorsichtig entgegen. Erst als Trent realisierte, dass seine Familie ihm auf ein paar Meter nahegekommen war, drehte er sich um.
„Nicht näherkommen!“, rief er mit gebrochener Stimme. Er drehte sich ihre Richtung um, und seine Frau musste sich zusammenreißen, vor Schreck nicht einen lauten Schrei auszustoßen. Trents Gesicht war mit einem Male kreidebleich geworden. „Geht sofort nach Hause“, rief Trent ihnen zu. „Aber bevor du gehst, rufe die Polizei und einen Krankenwagen.“
Benedict Freeman hasste es nicht in Bridgeport, er liebte es aber auch nicht überschwänglich. Es war einfach eine Kleinstadt wie jede andere auch. In anderen Worten: einfach langweilig. Nichts passierte. Für Polizisten, deren Traumberuf vorsieht, den ganzen Tag Donuts zu essen und Karten zu spielen, war Bridgeport der ideale Platz in dieser Welt, doch Freeman war keiner dieser Polizisten. Er war eher einer, der da sein wollte, wo Verbrechen passierten, um sie aufzuklären und die Täter hinter Gitter zu führen. Aber alles in allem war Bridgeport immer noch besser als, sagen wir, eine provinzielle Stadt in Mittelengland, in der es den ganzen Tag bloß regnete. Nennen wir diese Stadt mal Milton.
Doch während in Milton zumindest ab und an mal ein paar WhiteCollar-Verbrechen geschahen, war Bridgeport der Inbegriff von Ödnis. Knapp zehntausend Leute lebten in Bridgeport, in unmittelbarer Nähe zur südlichen englischen Küste. Ab und zu verirrten sich mal ein paar Touristen hierher, denn – das musste Freeman zugeben – schön war es hier schon. Nicht der Ort, an dem er oder andere Mittdreißiger Urlaub machen würden, aber sicherlich ein Ort, an dem 80-jährige Paare sich die steife Brise von der See ins Gesicht wehen lassen würden, während sie bei einem überteuerten Schwarztee das spärliche Treiben am schmalen Küstenstreifen – denn Strand konnte man das bei bestem Willen nicht nennen – begutachten würden. Hier gab es keine großen Unternehmen, keine kriminelle Energie und selbst die Jugendlichen schlugen nur selten über die Stränge, sodass auf dem Polizeirevier inklusive Freeman nur vier Personen gebraucht wurden. Seine Kolleginnen und Kollegen hier waren allesamt mehr oder weniger in seinem Alter und alles umgängliche Leute, was Freeman die Integration in sein neues Exil erheblich vereinfachte. Zum einen wäre da seine neue Chefin, Paula Strong, deren Eltern aus irgendeiner ehemaligen britischen Kolonie stammen, aber Freeman hatte sich noch nie getraut, zu fragen, aus welcher. Kurz nach Freemans Ankunft hatte sie ihren 40. Geburtstag gefeiert und war alles in allem insbesondere in der Anfangszeit auch deutlich weniger
penetrant als andere Chefs, mit denen Freeman in der Vergangenheit zu tun hatte. Strong machte ihren Job gut: Sie hatte ihre Rasselbande im Griff und konnte selbst auch gut austeilen; eine Eigenschaft, die Freeman äußerst schätzte. Die andere Dame in der Runde war Jessica Brennan, die erst wenige Monate vor Freeman in Bridgeport angekommen war und davor noch zur Polizeischule ging. Nichtsdestotrotz hatte sie einiges drauf und war ebenso wie ihre Chefin kaum kleinzukriegen, was Freeman regelmäßig imponierte. Vervollständigt wurde die illustre Runde von James Ferguson, den alle zu dessen Verärgerung aber immer nur „Fergie“ nannten. Ferguson war ein Jahr jünger als Freeman und glich ihm optisch beinahe aufs Haar. Die beiden verband eine ausgeprägte Hassliebe zueinander. Zum einen kam Ferguson für Freeman einem Freund so nahe wie niemand in den letzten zehn Jahren, zum anderen trieb Ferguson ihn aber auch regelmäßig in den Wahnsinn. Nicht etwa, weil er ein schlechter Polizist war – er war einfach nur ein unmotivierter, fauler Sack, der nur das nötigste tat, um nicht gefeuert zu werden.
Während Strong und Brennan mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchten, ihren Job gewissenhaft auszuführen und die Karriereleiter aufzusteigen, ließ Ferguson die Zügel gerne mal schleifen. Als er Freeman nach dessen ersten Arbeitstag mit in ein Pub nahm, fasste dieser das noch als nette und zuvorkommende Geste auf, doch schnell musste er feststellen, dass Ferguson das Pub nicht explizit zur Feier von Freemans Dienstantritt aufsuchte, sondern dort zu den Stammgästen gehörte und das Etablissement gerne auch schon mal während der Arbeitszeit aufsuchte und noch vor Feierabend das erste Pint hinunterkippte.
Ein Jahr und zwei Monate war Freeman nun schon in Bridgeport und er hatte tatsächlich versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Er wollte der Stadt zumindest eine Chance geben, und bislang hatte sich dieses Prinzip auch bewährt. Ihm tat der Abstand zu allem, was in den Wochen und Monaten vor seiner Ankunft hier passiert war, einfach nur gut, ebenso wie die Ruhe und die Entspannung, die er abseits des Trubels genießen konnte. Er würde zwar im Leben kein Dorfmensch mehr werden, aber für den Moment gefiel es ihm hier gut. Doch je länger er hier war, desto mehr begann
er auch, sich zu langweilen und darauf zu hoffen, dass endlich mal wieder etwas Berichtenswertes passieren würde.
Und dann klingelte das Telefon.
Es war Sonntagnachmittag; Freeman war zu Hause und ließ sich in seinem kleinen Garten, umringt von den ersten Pflanzen, die er eigenhändig zum Blühen gebracht hatte, die Sonne ins Gesicht scheinen. Seinen Krimiroman hatte er vor ein paar Minuten zugeschlagen und auf einen kleinen Beistelltisch neben sich gelegt, und von genau diesem nahm er nun sein Handy in die Hand. Er hatte Bereitschaftsdienst, und auch wenn vielen Leuten der Sonntag heilig war, war er doch ein bisschen froh, etwas zu tun zu haben. „Benedict Freeman?“, meldete er sich.
„Hier ist Paula.“ Am anderen Ende der Leitung sprach Paula Strong, seine Chefin.
„Was gibt’s?“
„Wissen Sie, wo die beiden Seen sind?“
„Ich dachte, es ist nur ein See?“
„Was auch immer. Wissen Sie, wie Sie auf die Halbinsel dazwischen kommen?“
„Ja.“
„Dort steht ganz am Ende eine Hütte. Dort treffen wir uns.“
„Um was geht es denn?“, hakte Freeman nach.
„Eine Familie hat bei einem Spaziergang einen älteren Herrn gefunden, der sich in dieser Hütte erhängt hat. Die Sanitäter sind schon dort, konnten aber nichts mehr machen.“
Freeman rollte mit den Augen und wirkte nach dieser Auskunft beinahe ein bisschen enttäuscht. „Ich will Ihnen nicht zu nahetreten, aber können Sie einen Suizidfall nicht allein regeln? Ich bin immerhin nur im Bereitschaftsdienst.“
„Ich dachte, ich tue Ihnen vielleicht einen Gefallen“, entgegnete Strong. „Oder haben Sie etwas Besseres zu tun?“
Freeman schaute sich um, dann schaute er auf seine Uhr und stieß einen gut hörbaren Seufzer aus. „Wann soll ich dort sein?“
Es dauerte rund 25 Minuten, bis Benedict Freeman an Ort und Stelle ankam: zehn Minuten vom Aufstehen aus dem Gartenstuhl, ins Auto und bis zu den Seen, und dann weitere fünfzehn Minuten zu Fuß die Halbinsel entlang, da er seinen Wagen vor dem Naturschutzgebiet abstellen musste. Schon hunderte Meter vor der Hütte sah er das Rot des Krankenwagens und grummelte vor sich hin, warum die Sanitäter wieder eine Sonderbehandlung bekamen, während er sich diesen Trampelpfad entlangquälen musste, an dessen Seiten der Rettungsdienst das hohe Gras bei seiner Durchfahrt rigoros plattgemäht hatte.
Als er an der Hütte ankam, setzte er dann aber eine nettere Miene auf und grüßte die Anwesenden freundlich: zwei Sanitäter, seine Chefin Paula Strong und ein sichtlich schockierter Mann in Freemans Alter, der mit bleichem Gesicht auf einem Stein ein paar Meter abseits des Geschehens saß, apathisch in die Ferne starrte und auch nicht auf Freemans Begrüßung reagierte.
Der Ermittler verschaffte sich einen kurzen Überblick über die Situation: Die Hütte war weitestgehend leer, nur an den Wänden hingen ein paar ausgestopfte Jagdtrophäen. An einer Seite stand ein maroder Schreibtisch, auf dem sich jahrelang Staub angesammelt haben musste. Der dazugehörige Stuhl lag umgekippt auf dem Boden, und direkt darüber hing der Mann, wegen dem Freeman diesen kleinen Spaziergang überhaupt angetreten hatte: Ein älterer Herr, zwischen 60 und 70 Jahren alt, Halbglatze, graue Haare an den Seiten; trug ein kariertes Hemd und Jeans; klein, aber mit dicker Wampe. Das Seil, deren Schlinge er um den Hals trug, spannte sich über einen Balken an der Decke, wurde aber an einem Balken in der Wand in etwa eineinhalb Metern Höhe befestigt. Die Schlinge saß so fest um den Hals des Mannes, dass sich sein Gesicht bereits ein wenig lila verfärbt hatte.
„Wissen wir, wer er ist?“, fragte Freeman seine Chefin.
„Nein, er hat keinen Geldbeutel oder irgendwelche anderen Ausweisdokumente dabei.“
„Gar nichts?“
„Nur eine Kleinigkeit.“ Strong drehte sich herum und kramte aus ihren Unterlagen ein Foto hervor, dass sie ihrem Kollegen in die Hand drückte. „Das haben wir in seiner Brusttasche gefunden.“
Freeman studierte das Bild aufmerksam. Der Bildqualität zufolge war es schon ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte alt. Die Bildqualität wurde zusätzlich davon beeinträchtigt, dass das Foto in einem dunklen Raum geschossen worden sein musste und der Blitz total überbelichtete. Es zeigte zwei Kinder, beide etwa 13 oder 14 Jahre alt. Links im Bild befand sich ein Junge mit kurzgeschorenen braunen Haaren und einer auffälligen großen Narbe am Hals, daneben ein Mädchen mit langen hellbraunen Haaren. Beide trugen recht einfache Kleidung und schienen von dem Foto eher überrascht zu sein, zumindest lächelten sie beide nicht und schauten eher missmutig in die Kamera. „Das hilft uns akut leider nicht weiter. Oder kennen Sie die Kinder etwa?“, fragte er, nachdem er etwa eine halbe Minute einen Blick auf das Foto geworfen hatte.
„Drehen Sie es um“, sagte Paula Strong nur.
Freeman wendete den Abzug, und tatsächlich: Da war etwas, was ihm bislang noch nicht aufgefallen war. Mit einem Tintenfüller hatte nämlich jemand auf die Rückseite geschrieben: „Für Onkel John“. „Dann müssen wir jetzt nur noch jemanden finden, der John heißt und einen Neffen und eine Nichte hat, und der Fall ist gelöst“, scherzte Freeman und gab seiner Chefin das Foto zurück.
„Haben Sie sich da gerade freiwillig für Schreibtischarbeit gemeldet?“
„Keineswegs“, entgegnete Freeman, während er am gespannten Seil entlanglief und einen aufmerksamen Blick darauf warf. „Ich bin lieber im Außeneinsatz.“
„Sie sind doch jetzt hier draußen. Dann machen Sie sich mal nützlich“, erwiderte Strong.
„Ist das der Mann, der die Leiche gefunden hat?“, fragte Freeman seine Chefin und deutete unauffällig auf den Herrn, der immer noch wie angewurzelt vor der Hütte auf einem Stein saß.
„Das haben sie gut kombiniert.“
„Haben Sie schon mit ihm gesprochen?“
„Ich habe es versucht, aber er steht noch unter Schock. Wenn die Sanitäter hier fertig sind, können sie sich direkt um ihn kümmern.“
„Soll ich es mal versuchen?“, fragte Freeman.
„Tun Sie, was Sie nicht lassen können.“
Freeman knackte demonstrativ und zum Seufzen seiner Chefin mit den Fingern und lief mit hervorgestreckter Brust auf den Mann zu, der immer noch wie ein Häufchen Elend vor der Hütte kauerte. „Guten Tag“, rief Freeman ihm zu. „Mein Name ist Benedict Freeman, ich bin von der Polizei von Bridgeport. Mit wem habe ich das Vergnügen?“
Der Mann schaute etwas verschreckt auf, als er von Freeman angesprochen wurde. „Trent“, murmelte er nach einigen Sekunden der Stille, in denen er seine Gedanken zu sammeln schien.
„Ist das ihr Vorname oder ihr Nachname?“
„Nachname“, stammelte der Mann, wieder etwas überrumpelt und erst nach einigen Sekunden Bedenkzeit. „Alexander Trent.“
„Freut mich!“, entgegnete Freeman. „Hören Sie, Herr Trent. Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie ein traumatisches Erlebnis war, aber Sie könnten uns extrem weiterhelfen, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten würden. Bekommen Sie das hin?“
„Ja“, flüsterte Trent.
„Laut unseres Protokolls hat Ihre Frau die Polizei vor etwas mehr als einer Stunde kontaktiert. Ich gehe davon aus, dass das zu dem Zeitpunkt war, an dem Sie die Leiche entdeckt haben?“
„Richtig.“
„Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?“
„Mein Sohn.“
„Sie waren mit Ihrer Familie hier?“
„Meine Familie war das ganze Wochenende weg. Wir wollten bloß einen Sonntagsspaziergang machen, jetzt wo sie wiedergekommen sind.“
„Ihr Sohn hat die Leiche gefunden?“, hakte Freeman nach.
„Er hat etwas in der Hütte gehört.“
„Und daraufhin sind Sie ans Fenster gegangen und haben nachgeschaut?“
„Nein. Das war schon auf dem Hinweg. Fünf Minuten früher.“
„Wissen Sie, was Ihr Sohn gehört hat?“
„Nein. Bloß irgendwelche Geräusche.“
„Haben Sie irgendjemanden in der Nähe der Hütte gesehen?“
„Nein. Nur weiter vorne auf der Halbinsel.“
„Darauf komme ich vielleicht später noch einmal zurück, aber für den Moment sollte das reichen“, sagte Freeman und legte für einen kurzen Moment aufmunternd die Hand auf die Schulter des niedergeschlagenen Zeugen. Innerlich war Freeman ein wenig davon genervt, dass dessen Antworten alle mit einer Verneinung begannen und man ihm jedes Detail aus der Nase ziehen musste. Während er zurück in Richtung der Hütte lief, erinnerte er sich jedoch daran, wie er zum ersten Mal eine Leiche entdeckt hatte, damals als junger Polizist in einer Seitenstraße in London. Es war kein schöner Anblick, jedoch ein prägender. Als Freeman so darüber nachdachte, entwickelte er volles Verständnis dafür, dass nicht jeder damit so locker umgehen konnte wie er damals.
„Sie sind aber schnell wieder da. Haben Sie etwas herausgefunden?“, fragte Strong ihn, als Freeman sich wieder zu ihr und den beiden immer noch beschäftigten Sanitätern in der Hütte begab.
„Ja, er hat sich, glaube ich, ein bisschen vom ersten Schock erholt“, erzählte Freeman. „Sein Name ist Alexander Trent. Sein Sohn hat etwas in der Hütte gehört und auf dem Rückweg hat er dann einen Blick hineingeworfen und die Leiche entdeckt.“
„Nicht dass er sich Vorwürfe macht, dass er einen Selbstmord hätte verhindern können.“
„Das hätte er höchstwahrscheinlich sowieso nicht“, erwiderte Freeman.
Strong zog eine Braue nach oben. „Was meinen Sie?“
„Lassen Sie mich kurz etwas ausprobieren.“ Dann lief er langsam in Richtung des Schreibtischs an der Hand, ging in die Knie, um ihn nochmal genauer zu inspizieren, und tastete vorsichtig das Tischbein ab. „Passen Sie mal auf“, rief er in den Raum und zog so neben Strongs Aufmerksamkeit auch die der beiden Sanitäter auf sich, die bislang in aller Seelenruhe die Leiche von ihrem postumen Elend befreit und im ersten Schritt zumindest mal auf den Boden gelegt hatten. Freeman verbog sich leicht, winkelte seinen Arm an, holte kurz aus und schlug mit einem schnellen Schlag mit dem Ellenbogen auf das Tischbein, das laut krachte und sofort zersprang und das Konstrukt zum Einsturz brachte.
„Was wollen Sie uns beweisen?“, fragte Strong erstaunt.
„Das ist der dazugehörige Stuhl, oder nicht?“, gab Freeman ungeachtet zurück und deutete auf den Stuhl, der nicht weit von ihm entfernt auf dem Boden neben dem Opfer lag.
„Ja, aber ...“, wollte Strong erneut einwenden, doch Freeman kam ihr erneut zuvor.
„Was denken Sie, wie viel wiegt das Opfer? Neunzig Kilo? Vielleicht sogar hundert?“
„Eher hundert“, antwortete der Sanitäter, der den leblosen Körper wenige Augenblicke zuvor mit seinem Kollegen schultern musste.
„Sagen wir zu Vorführungszwecken, das Opfer wiegt neunzig Kilo.“
„Und was wollen Sie uns vorführen?“, quengelte Strong.
„Passen Sie mal auf“, sagte Freeman erneut und stellte den umgekippten Stuhl vorsichtig wieder auf. „Ich wiege 82 Kilogramm.“
„Glaube ich Ihnen nicht“, entgegnete Strong keck.
„Na gut, es sind 84. Darf ich jetzt fortfahren?“
„Bitte sehr!“
„Ich wiege 84 Kilogramm“, begann Freeman erneut. Seine drei Zuschauer hatten offenbar noch eine längere Rede erwartet, doch Freemans kleine Vorführung bedurfte keiner weiteren Worte.
Vorsichtig stieg er auf den Stuhl – doch es dauerte keine Sekunde, bis er wieder auf dem Hosenboden gelandet war. Genauso wie der Tisch krachte es nämlich einmal kurz und der Stuhl zerfiel in seine Einzelteile. „Quod erat demonstrandum“, schloss Freeman sein Experiment ab. „Was zu beweisen war.“ Er schaute jedoch bloß in überforderte Gesichter.
„Was war denn zu beweisen?“, hakte Strong nach.
„Lassen Sie mich ein wenig ausholen“, begann Freeman.
„Natürlich!“, murmelte seine Chefin und rollte dabei genervt mit den Augen. Geschichten erzählen, das hatte er in ihrer knapp einjährigen gemeinsamen Zeit oft unter Beweis gestellt, konnte Freeman gut.
„Als ich hier angekommen bin, ist mir gleich die ungewöhnliche Konstruktion aufgefallen, an der dieser Mann hängt. Warum hat er das Seil einmal quer durch den Raum gespannt und nicht einfach
am Balken an der Decke befestigt? Von dort hätte er sich genauso hängen können.“
„Der Balken hängt in zweieinhalb Metern Höhe“, wandte Strong ein. „Bei seiner Statur hätte er es wahrscheinlich selbst mithilfe eines Stuhls mit dem Rücken bekommen.“
„Mal davon abgesehen, dass der Stuhl ihn nicht ausgehalten hätte, wie ich gerade demonstriert habe, habe ich eine andere Theorie“, verbesserte Freeman sie. „Schauen Sie sich mal das Seil an.“ Er lief quer durch den Raum und deutete auf eine Stelle, an der der Strick deutlich dünner und abgenutzter war als am Rest des Seils. „Wie können Sie sich das erklären?“ Paula Strong schien einen Verdacht zu hegen, aber sie wagte es nicht, ihn auszusprechen. Stattdessen machte Freeman weiter: „Und nun zu der Sache mit dem Stuhl: Ich bin leichter als das Opfer, aber als ich auf den Stuhl gestiegen bin, ist er sofort in sich zusammengebrochen. Ergo: Der Stuhl wäre auf jeden Fall auch zusammengebrochen, wenn unser John Doe sich daraufgestellt hätte. Ergo: Er stand nie auf diesem Stuhl. Ergo: Er muss irgendwie anders dort hochgekommen sein, und da kommen wir wieder zurück zu unserem abgenutzten Seil. Er wurde nämlich von jemand anderem hochgezogen und dabei hat sich das Seil an dieser Stelle ein bisschen abgerieben. Ergo: Wir untersuchen hier keinen Suizidfall.“ Stilecht baute Freeman eine dramatische Pause in seine Ausführung ein. „Wir untersuchen einen Mord.“
Paula Strong handelte sofort. Die Erklärung von Benedict Freeman machte absolut Sinn – sogar so viel, dass sie sich ärgerte, nicht selbst darauf gekommen zu sein. Aber im Nachgang sagt sich das immer einfacher Kaum hatte Freeman das M-Wort in den Mund genommen, hatte Strong Verstärkung angefordert und ließ die Hütte, die somit zum Tatort geworden war, mit Absperrband verbarrikadieren.
„Das ist der erste Mord in Bridgeport seit über zehn Jahren“, stellte die Polizeichefin fest. „Damals war ich gerade mal ein paar Monate dabei.“
„Was ist passiert?“, wollte Freeman wissen.
„Ein Ehestreit; der Mann wäre sogar fast davongekommen, wenn sein Nachbar durch sein Fenster zum Hinterhof nicht ein paar verdächtige Aktivitäten beobachtet und ihn verpetzt hätte.“
„Ich denke, einen Ehestreit können wir in diesem Fall eher ausschließen. Aber wissen Sie, wer uns weiterhelfen könnte?“
„Wer denn?“
„Unser Freund hier.“ Dann zeigte Freeman auf Alexander Trent, an dem die entstandene Hektik am Tatort anscheinend spurlos vorbeiging, schließlich saß er immer noch apathisch auf dem Stein vor der Hütte und schaute bedröppelt zu Boden.
„Was meinen Sie?“
„Der Mann hat ausgesagt, dass sein Sohn fünf Minuten vor der Entdeckung der Leiche noch etwas gehört hat. Das heißt, hier muss etwas vor sich gegangen sein. Entweder der Mann war noch nicht tot und hat noch ein bisschen gezappelt oder, selbst wenn er schon tot war, war sein Mörder mit ihm hier drin.“
„Aber er hat doch niemanden in der Hütte gesehen, oder nicht?“, warf Strong ein.
„Das würde wiederum auf Option eins deuten und würde außerdem noch einen anderen Schluss zulassen: Da nur ein Weg zu dieser Hütte und wieder zurück zum Festland führt, müssen Herr Trent und seine Familie dem Täter über den Weg gelaufen sein.“
„Worauf warten Sie dann noch? Befragen Sie den Mann!“ Paula Strong schöpfte plötzlich Hoffnung, dass sich der Fall schnell aufgelöst haben würde.
Freeman leistete den Anweisungen seiner Chefin Folge und ging wieder mit seinem gewohnt selbstsicheren Gang auf den Kronzeugen zu, der all den Trubel um sich herum zwar mitbekam, aber nicht den Anschein erweckte, als konnte er einordnen, dass aus dem möglichen Suizid gerade eine Mordermittlung geworden war. In der Zwischenzeit waren auch sein Kollege James Ferguson und seine Kollegin Jessica Brennan am Tatort angekommen, nachdem sie von Strong aus ihrem wohlverdienten Wochenende geklingelt wurden. Freeman begrüßte die beiden im Vorbeigehen mit einem Kopfnicken, ehe er sich auf die Befragung fokussierte.
„Ich bin’s nochmal“, kündigte sich Freeman schon mit ein paar Metern Vorlauf an.
Trent hob den Kopf und rollte mit den Augen. „Was wollen Sie jetzt schon wieder?“
„Ich weiß nicht, wie viel Sie davon mitbekommen haben, aber wir gehen aktuell davon aus, dass unser Opfer durch Fremdeinwirkung zu Tode kam.“
„Sie meinen, er wurde ermordet?“, hakte Trent überrascht nach. Offenbar befand er sich tatsächlich noch in seiner eigenen Welt.
„Das ist unser Verdacht“, versicherte Freeman. „Noch mehr sogar: Wir gehen davon aus, dass Sie den Täter gesehen haben.“
„Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich niemanden gesehen habe.“
„Ich meine auch nicht, als sie die Leiche entdeckt haben, sondern als sie noch gar nicht wussten, was vor sich ging“, klärte der Polizist auf. „Sehen Sie, es gibt genau einen Weg, der vom Festland zu dieser Hütte führt. Da Sie niemanden beim Verlassen der Hütte gesehen haben, Ihr Sohn aber Geräusche gehört hat, muss der Täter den Tatort bereits verlassen haben und ist Ihnen auf Ihrem Spaziergang entsprechend entgegengekommen.“
„Wie können Sie wissen, dass der Mann nicht schon Stunden zuvor tot war?“, wandte Trent ein.
„Ihr Sohn hat doch etwas gehört, sagen Sie. Ich gehe davon aus, dass das die letzten Versuche unseres Opfers waren, seinem
Schicksal doch noch zu entkommen. Und entsprechend muss der Täter kurz zuvor noch bei ihm gewesen sein. Das letzte Wort liegt in dieser Hinsicht zwar beim Gerichtsmediziner, aber der wird vermutlich nur das bestätigen, was ich Ihnen gerade erzählt habe.
Deshalb würde ich dem Verdachte gerne jetzt schon nachgehen.“
Trent überlegte. Freemans Ausführungen schienen auch für ihn Sinn zu ergeben. „Mir sind ein paar Menschen auf dem Weg hierher entgegengekommen“, sagte er.
„Können Sie sie beschreiben?“
„Der Erste war Marcus Kane mit seiner Familie.“
„Sie kennen den Mann?“
„Schon seit Ewigkeiten. Er wohnt in Bridgeport.“
„Okay, weiter“, winkte Freeman ab, als hätte Trent ihm angeboten, ihn persönlich zu Kanes Haustür zu führen. „Wen haben Sie noch gesehen?“
„Dann kam ein alter Mann, etwa 75 Jahre alt, den ich schon ein paar Mal in Bridgeport gesehen habe.“
„Wie sah der Mann aus?“, fragte Freeman, während er auf seinem Notizblock Trents Aussagen ordentlich mitschrieb.
„Hager, viele Falten, kaum Haare auf dem Kopf und ein gebückter Gang – alt eben. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Keine Ahnung, wie er heißt.“
„Keine besonderen Merkmale?“
Trent überlegte; schließlich schüttelte er den Kopf. „Alt eben“, wiederholte er.
„Sonst noch jemand?“
„Ja, eine junge Frau noch. Ungefähr mein Alter, eher noch ein bisschen jünger. Ich habe kaum auf sie geachtet. Blond war sie. Ungefähr so groß wie ich.“
„Hatten Sie sie schon einmal gesehen?“
„Noch nie in meinem Leben“, gab Trent zu Protokoll, ehe er leise hinzufügte: „Ich habe allerdings auch nicht wirklich genau auf ihr Gesicht geachtet.“
„Und die Menschen sind Ihnen in dieser Reihenfolge entgegengekommen? Erst – wie war sein Name nochmal? – Marcus Kane mit seiner Familie, dann der alte Herr und dann die junge Dame?“
„So ist es.“
„Dann haben Sie mal vielen Dank; das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen.“ Er wollte sich gerade von Trent entfernen, da fiel ihm noch etwas ein: „Sie können übrigens jetzt vorerst nach Hause gehen. Sie frieren sich hier doch noch Ihr Gesäß ab auf dem kalten Stein. Ihre Personalien haben wir ja, oder? Schalten Sie Ihr Handy lieber nicht auf lautlos; Sie müssen bald zu uns auf die Wache kommen, um die Verdächtigen zu identifizieren.“
Im Inneren der Hütte hatte Paula Strong die beiden Neuankömmlinge James Ferguson und Jessica Brennan in der Zwischenzeit auf den aktuellen Stand der Ermittlungen gebracht. Ein Mordfall in Bridgeport war auch für sie Neuland, doch ein wenig Abwechslung im Job schien den beiden in diesem Moment zu gefallen, auch wenn die beiden dies auf gänzlich unterschiedliche Weisen zum Ausdruck brachten: Während Brennan voller Tatendrang strotzte und ihre Chefin mit Nachfragen durchlöcherte, stand Ferguson gewohnt bärig-ruhig daneben und hatte einen zufriedenen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Dieser verflog aber, als Benedict Freeman zielstrebig in Richtung seines Kollegen lief und ihm schon mit Vorlauf zurief: „Ferguson!“ Wenn Freeman so um die Ecke kam, war das für Ferguson meistens mit Arbeit verbunden, und zu Arbeit stand der Polizist wie die englische Fußballnationalmannschaft zum Elfmeterschießen.
„Guten Tag“, begrüßte er seinen Kollegen noch einmal.
„Guten Tag allerseits“, grüßte Freeman in die Runde zurück.
„Kennen Sie einen Marcus Kane?“
„Sicher.“
„Wissen Sie, wo er wohnt?“
Ferguson überlegte. „Ich glaube schon.“
„Perfekt. Dann fahren Sie bitte später bei ihm vorbei und bringen Sie ihn zur Wache.“
„Wieso das denn?“
„Er ist ein Verdächtiger in einem Mordfall“, erklärte Freeman.
„Trent hat Ihnen also Namen genannt?“, fiel Strong ihm begeistert ins Wort.
„Einen Namen und zwei Beschreibungen.“ Freeman schaute auf seinen Notizblock. „Ein älterer Herr, etwa 75 Jahre alt, faltig, keine
Haare und gebückter Gang. Sieht scheinbar alt aus. Kommt wahrscheinlich aus Bridgeport oder Umgebung, zumindest hat Herr Trent ihn schon mehrmals gesehen.“
„Das könnte ungefähr jeder Rentner in Bridgeport sein“, seufzte Ferguson.
„Nicht ganz“, rief Strong. „Als ich hier angekommen bin nach dem Notruf von Trents Familie ist mir ein alter Mann entgegengekommen.“
„Das könnte hinkommen. Er wird wohl nicht so schnell zu Fuß sein“, stimmte Freeman ihr zu. „Können Sie sich an sein Aussehen erinnern?“
Strong überlegte, wie sie den Mann am besten beschreiben konnte. „Na ja, alt eben.“ Freeman zog eine Augenbraue hoch. „Ich werde mal Augen und Ohren offenhalten und mich darum kümmern“, versprach sie. „Wer war die dritte Person, die von Trent gesehen wurde?“
„Eine junge Frau, blonde Haare, etwa Anfang dreißig und einen Meter fünfundsiebzig Meter groß. Laut seiner Aussage hat er sie noch nie zuvor gesehen. Die ist Ihnen nicht zufällig auch noch über den Weg gelaufen?“
„Vielleicht eine Touristin? Wir können mal in den Hostels hier nachfragen“, schlug Strong vor.
„Das wäre ein guter Anfang“, pflichtete Freeman ihr bei. „Auch wenn ich nicht wüsste, warum man in diesem Alter seine Urlaubstage verschwenden würde, um nach Bridgeport zu fahren.“
„Wir sollten aber auch nicht außer Acht lassen, dass sie vielleicht einfach aus einer Nachbargemeinde für einen Sonntagsspaziergang hierhergefahren ist“, warf Jessica Brennan ein, bevor Strong Freeman für seinen unqualifizierten Beitrag tadeln konnte.
„Oder um an einem Fleck, an dem sie niemand kennt, einen Mann zu ermorden“, fügte die Polizeichefin stattdessen hinzu.
„Das Einfachste wird sein, die Frau schnellstmöglich zu ausfindig zu machen und sie zu befragen“, setzte Freeman den Spekulationen ein Ende. „Jessica, kümmern Sie sich darum?“
„Und was machst du?“, fragte James Ferguson beinahe schon ein bisschen trotzig, als würde Freeman nur Arbeit verteilen und sich selbst davor drücken.
Doch dieser gab daraufhin nur ein süffisantes Lächeln zurück.
„Erst einmal kümmere ich mich darum, dass am Tatort alles protokollgemäß abgewickelt wird. Und dann möchte ich erst einmal herauszufinden, wer unser Opfer hier überhaupt ist.“
Am Anfang des Tages hatte Benedict Freeman sich seinen Sonntag zwar ganz anders vorgestellt, aber so ganz unrecht kam ihm die unverhoffte Beschäftigung dann doch nicht. Während Paula Strong und Jessica Brennan sich auf den Weg zur Wache gemacht hatten, um die beiden Verdächtigen ausfindig zu machen, blieben Freeman und James Ferguson am Tatort und sicherten weitere Spuren. Ferguson hatte zwar noch den Auftrag, Marcus Kane ausfindig zu machen, doch da dessen Adresse bekannt war und Freeman noch Unterstützung vor Ort brauchte, war diese Tätigkeit in der Priorisierung nach unten gerutscht. Mittlerweile hatte der Leichenwagen seinen Weg durch das Dickicht gebahnt, um das Opfer abzuholen und zur Obduktion zur Gerichtsmedizin zu bringen. Die Todesursache war zwar relativ offensichtlich, aber gerade in Bezug auf den Todeszeitpunkt wollte die Polizei absolute Gewissheit haben, selbst wenn Freeman sich seiner Sache absolut sicher war.
„Was denkst du, ist das Motiv bei dieser ganzen Sache?“, wollte Ferguson von seinem Kollegen wissen, während sie die Leiche in den Wagen schoben.
„Um ein Motiv auszumachen, müssen wir erst einmal die Identitäten der Verdächtigen und des Opfers feststellen und ihre Verbindungen zueinander herausfinden. Was allerdings auffällig ist, ist die Tatsache, dass unser Täter sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Mord wie einen Suizid aussehen zu lassen. Die ganze Sache muss also schon lange im Voraus geplant worden sein.“
„Wenn wir nur den Namen des Mannes kennen würden, würde sich unsere Suche vermutlich schnell erleichtern“, stellte Ferguson fest, und fügte dann frech hinzu: „Wolltest du dich nicht darum kümmern?“
„Das macht mir auch Hoffnung, dass wir schon bald Licht ins Dunkle bekommen“, antwortete Freeman. „Irgendjemand in Bridgeport wird den Mann ja wohl kennen.“
Nachdem die beiden Polizisten die Leiche zum Abtransport bereit gegeben hatten, gab es für sie am Tatort offiziell nichts mehr zu tun. Vier Stunden hatte die ganze Aktion von Freemans Ankunft an nun
gedauert. Dieser blickte noch einmal in die Hütte. Nach der Spurensicherung und den Aufräumarbeiten sah es wieder so aus, als wäre hier nichts passiert. Bis auf die Jagdtrophäen an der Wand stand das Innere der Hütte nun leer, denn auch der Schreibtisch und der Stuhl, die Freeman zuvor zu Vorführungszwecken zerbrochen hatte, wurden als Beweisstücke mitgenommen.
„Jetzt können wir uns wenigstens einen ruhigen Sonntag machen“, resümierte Ferguson, hatte die Rechnung aber ohne seinen Kollegen gemacht.
„Ganz im Gegenteil“, wies dieser ihn nämlich zurecht. „Mit dieser Einstellung kann man vielleicht einen Fahrraddiebstahl behandeln, aber keinen Mordfall. Wir fahren auf die Wache und arbeiten weiter daran.“
Ferguson seufzte zwar gut hörbar und versuchte, eine Diskussion zu starten, die Freeman allerdings schnell abblockte. Also schnappten sich die beiden Polizisten ihr Hab und Gut und machten sich gemeinsam zu Fuß auf den Weg in Richtung des Festlands, wo Freeman seinen Wagen geparkt hatte.
„Eigentlich ist das hier ja schon ein schöner Wanderweg“, begann Ferguson auf halber Strecke ein Gespräch. „Ich meine, so ruhig am Wasser, schön grün.“
„Du kannst hier ja jederzeit herkommen, wenn es dir so gut gefällt“, entgegnete Freeman unbeeindruckt, auch wenn er seinem Kollegen Recht geben musste: Idyllisch war es hier schon.
„Glaubst du, unser Täter hat den Ort bewusst gewählt?“, wollte Ferguson dann wissen.
„Hier ist normalerweise nicht viel los, oder?“, fragte Freeman seinen Kollegen, der eine wesentlich bessere Ortskenntnis besaß als er selbst.
„Nein, nicht wirklich. Ist eben doch nochmal ein bisschen außerhalb des Orts. Und wenn Leute hierherkommen, dann laufen sie meistens nicht bis zum Ende der Halbinsel. Der Weg dorthin lädt ja auch nicht unbedingt zu einem gemütlichen Spaziergang ein.“
„Dann kann es schon gut sein, dass der Ort gewählt wurde, weil hier normalerweise nichts los ist. Unser Täter hatte aber Pech, dass Alexander Trent gerade hier unterwegs war.“
„Aber eine Sache macht mich weiterhin stutzig“, merkte Ferguson an.
„Welche denn?“
„Warum wurde das Opfer mitten am Tag ermordet? Warum nicht nachts, wenn garantiert niemand hier ist?“
„Das ist in der Tat ein guter Einwand“, kommentierte Freeman bloß, denn auch er konnte sich darauf keinen Reim bilden. Dann liefen die beiden Polizisten weiter. In etwa 200 Metern hätten sie ihren unfreiwilligen Ausflug endlich beendet und könnten sich mit dem Auto in Richtung des Polizeireviers begeben. Freeman war es satt, zu laufen. Er wollte sich am liebsten sofort hinter seinen Bildschirm klemmen und die Beweise irgendwie zusammenfügen. In Gedanken saß er bereits vor seinem Schreibtisch und kritzelte auf einem weißen Dokument die bisherigen Erkenntnisse zusammen, verband die Anhaltspunkte mit Linien und umkreiste mit einem dicken Rotstift einen Namen, der vor seinem geistigen Auge jedoch noch verschwommen war.
„Siehst du das auch?“ Der Tagtraum wurde plötzlich von Ferguson unterbrochen.
Freeman hob seinen Kopf und schaute geradeaus. Er musste zwei Mal hinschauen, um sich zu vergewissern, dass er keine Fata Morgana sah, doch recht offensichtlich befand er sich dieses Mal nicht wieder in einem Traum, sondern in der Wirklichkeit, und das, woraufhin Ferguson ihn aufmerksam gemacht hatte, war tatsächlich da: Einige Meter vor ihnen kam ihnen eine Frau entgegen. Aber nicht irgendeine Frau, sondern eine großgewachsene junge Dame mit blonden Haaren. Freeman lief zielstrebig auf sie zu und murmelte noch irgendetwas mit „Zufall“ und „zu schön, um wahr zu sein“. „Guten Tag“, grüßte er die Dame, als sie in Reichweite war.
„Guten Tag“, antwortete die junge Frau und wollte weiterlaufen, ehe Freeman seinen Arm zur Seite ausfuhr und sie damit aufhielt.
„Wohnen Sie hier in Bridgeport?“, fragte er.
Die Frau blieb auf der Stelle stehen und schaute ihn verunsichert an. „Wer möchte das denn wissen?“, stammelte sie, wohl in der Angst, einer Belästigung zum Opfer zu fallen.
„Benedict Freeman, Polizei von Bridgeport“, klärte Freeman sie jedoch schnell auf, während er seine Marke hervorholte.
„Ich bin nur zu Gast hier“, entgegnete die Dame, der anzusehen war, dass sie nicht sicher war, ob sie nach dieser Offenbarung erleichtert sein sollte oder nicht.
Freeman warf Ferguson einen triumphalen Blick zu. Möglicherweise hatten sie gerade eine heiße Spur entdeckt. „Wie heißen Sie?“
„Madeleine Lee.“
„Und was führt Sie hierher, Frau Lee?“, hakte er schließlich weiter nach.
„Urlaub. Ich bin gerne an der Küste.“
„Ich meinte: Was führt Sie auf diesen abgelegenen Wanderweg?“
„Ich habe im Internet nach Wanderwegen gesucht und das hat sich dann angeboten.“
„Sie scheinen den Weg ja zu mögen, wenn Sie zwei Mal am Tag hierherkommen.“
„Zwei Mal?“ Die Frau schaute überrumpelt in Freemans Richtung.
Dessen Taktik, mit der Tür ins Haus zu fallen, schien sich bezahlt zu machen. „Wir haben einen Zeugen, der Sie vorhin hier schon einmal spazieren gesehen hat.“
„Einen Zeugen?“ Madeleine Lee schien gar nichts mehr zu verstehen. „Wieso werde ich denn beobachtet? Wieso ist es denn wichtig, dass und wie oft ich hier spazieren gehe?“, fühlte sie vorsichtig vor.
„Das ist ganz einfach, sage ich Ihnen“, erwiderte Freeman. „Wir ermitteln in einem Mordfall, der sich heute Mittag in der Hütte am Ende dieser Halbinsel zugetragen hat. Wir haben einen Zeugen, der die Leiche unmittelbar nach ihrem Ableben entdeckt hat, und da nur ein Weg zum Tatort hin- und wieder wegführt, muss er dem mutmaßlichen Täter entgegengekommen sein.“ Er hielt kurz inne. „Eigentlich bin ich nur ungern der Überbringer schlechter Nachricht, aber da er auch Sie genannt hat, sind Sie nun eine Verdächtige in einem Mordfall.“
Der jungen Dame klappte die Kinnlade herunter und sie wusste nicht, was sie darauf entgegnen sollte. „Und nun?“, flüsterte sie geschockt.
„Nun nehmen wir Sie mit auf unser Polizeirevier und befragen Sie dort“, klärte Freeman auf.
Man konnte Lee ansehen, dass sie darauf nicht wirklich Lust hatte, allerdings leistete sie keinen Widerstand und geleitete die beiden Polizisten freiwillig zu ihrem Wagen, der noch weitere hundert Meter entfernt geparkt war.
Nachdem Freeman die Verdächtige auf den Rücksitz geleitet hatte, schaute er ein bisschen ungläubig in Richtung seines Partners und flüsterte ihm zu: „Das wäre ja fast zu einfach, wenn das schon des Rätsels Lösung wäre.“
Eine knappe Viertelstunde später trafen Benedict Freeman, James Ferguson und Madeleine Lee im Polizeirevier von Bridgeport ein. Auf der Fahrt vom Tatort dorthin hatte Ferguson bereits Alexander Trent verständigt, dass dieser bitte sofort zum Revier kommen solle, um die Verdächtige zu identifizieren. Allerdings hatten die beiden Ermittler keine Zweifel daran, dass ihnen die Gesuchte buchstäblich in die offenen Arme gelaufen war – warum auch immer.
Als Freeman am Revier ankam, warteten bereits weitere gute Nachrichten auf ihn: Paula Strong und Jessica Brennan hatten in seiner Abwesenheit einen hervorragenden Job gemacht und sowohl Marcus Kane auf die Wache beordert als auch den alten Mann ausfindig gemacht, der Alexander Trent entgegengekommen war. Jetzt müsste Freeman nur noch darauf warten, bis alle Beteiligten eintrafen, und dann würde sich der ganze Fall hoffentlich schnell aufklären.
„Bitte setzen Sie sich hier in den Raum und warten Sie noch eine Weile“, hatte Freeman Lee instruiert und sie in ein Verhörzimmer geleitet, wo er sie erst einmal zurückließ.
„Das ist doch verrückt“, stellte Paula Strong fest, nachdem Freeman die Tür des Zimmers geschlossen hat. „Wir haben keinerlei Indizien außer ihrer Haarfarbe und ihrer Größe, und es dauert keine paar Stunden, bis sie Ihnen in die Arme läuft.“
„Noch haben wir nicht abschließend geklärt, ob sie es wirklich ist“, dämpfte Freeman die Euphorie, auch wenn er selbst nicht daran glaubte, dass Alexander Trent ihnen nicht bestätigen würde, was alle hier sowieso schon für bare Münze nahmen.
Die Weile, die Freeman der Dame für die Dauer ihrer Wartezeit angekündigt hatte, zog sich mehr und mehr in die Länge. Es brauchte nämlich seine Zeit, bis alle Protagonisten auf dem Polizeirevier eintrudelten. Der Erste war Marcus Kane, ein unschuldig dreinblickender Familienvater Anfang 40 mit Wohlstandswampe und rückläufigem Haaransatz, der trotz mehrfacher Erklärung von Jessica Brennan nicht ganz verstand, was die Polizei denn jetzt genau von ihm wollte. Paula Strong war
unterdessen unterwegs, um den älteren Herren abzuholen, der sich als William Morgan, ein 77 Jahre alter Dorfbewohner, herausstellte. Trent hatte mit seiner vagen Beschreibung nicht ganz Unrecht behalten; Benedict Freeman hätte auch nicht gewusst, wie er den alten Herrn besser hätte beschreiben sollen als „alt eben“. Sein Gesicht war faltig, seine Haare äußerst rar gesät und außer seiner hageren Statur wies Morgan wenige Merkmale auf, die bei seiner Identifizierung hilfreich gewesen wären. Umso froher war Freeman, dass seine Chefin den Greis schnell ausfindig gemacht hatte, indem sie im lokalen Seniorenheim danach fragte, ob einer der Bewohner heute einen Spaziergang zu den Seen unternommen hatte. Als Letzter trudelte fast eine Stunde nach den Polizisten der wichtigste Mann dieser Runde ein: Alexander Trent, der Kronzeuge. Trent machte immer noch einen niedergeschlagenen Eindruck. Zwar war er nun für kurze Zeit zu Hause bei seiner Familie gewesen, doch er sah nicht so aus, als hätte er in dieser Zeit einen klaren Gedanken fassen können. Ganz im Gegenteil: Trent wirkte weiterhin zutiefst verstört und nahm seine Gegenwart nur sehr schwerfällig wahr. „Wie läuft das jetzt ab?“, wollte er von Freeman wissen. „Stellen Sie mir jetzt fünf Leute vor und ich muss Ihnen sagen, wer davon der Verdächtige ist?“
„Nein, wir sind hier nicht beim Film“, entgegnete Freeman. „Ich zeige Ihnen die Verdächtigen, die wir aufgegabelt haben, und Sie sagen mir dann einfach, ob das die Person ist, die Sie gesehen haben, oder eben nicht.“
Da das nun wahrlich keine Raketenwissenschaft war, machten Freeman und Trent sich auf dem Weg ins Nebenzimmer des ersten Verhörzimmers, in dem Marcus Kane saß. Durch eine Scheibe beobachteten die beiden den nervösen Gast. „Ja, das ist Marcus Kane“, bestätigte Trent, nachdem er ihn weniger als eine Sekunde angeschaut hatte. „Weiter?“
„Und für das Protokoll: Ihn und seine Familie haben Sie heute auf der Halbinsel gesehen?“
„Ja.“
„Dann können wir weitermachen.“ Mit diesen Worten führte Freeman ihn hinter die Scheibe des zweiten Verhörzimmers, in dem
sich William Morgan befand. „Das ist William Morgan. 77 Jahre alt, wohnhaft in Bridgeport“, stellte er den Verdächtigen vor.
„Das ist der Mann, den ich gesehen habe“, sagte Trent auch hier, ohne mit der Wimper zu zucken.
„Wenn mein Job doch nur immer so einfach wäre“, merkte Freeman leise an. Dann geleitete er den Zeugen vor den letzten Raum, in dessen Inneren die junge Frau saß und unruhig umherschaute. „Wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass das die Frau ist, die Sie gesehen haben, bin ich ein glücklicher Mann“, sagte Freeman, ehe er auch den Namen dieser Verdächtigen nannte: „Madeleine Lee heißt die gute Frau. Alles weitere wissen wir noch nicht.“
Doch dieses Mal kam Trents Antwort nicht wie aus der Pistole geschossen. Mit tief stechendem Blick studierte er das Äußere der mutmaßlichen Verdächtigen. Freeman beobachtete, wie Trents Blick am Körper der Dame herabwanderte. Schließlich drehte dieser sich in die Richtung des Polizisten um. „Ich glaube, sie ist es“, stammelte er, etwas enttäuscht über seine Unsicherheit. „Ich kann es Ihnen nicht mit einhundertprozentiger Gewissheit sagen.“
„Aber sie sind sich recht sicher?“, fühlte Freeman ihm weiter auf den Zahn.
„Ziemlich.“ Trent fasste sich an die Stirn. „Ich habe sie kaum gesehen, gerade mal einen Sekundenbruchteil. Aber wahrscheinlich ist sie es.“
„Machen Sie sich keinen Kopf darüber“, munterte Freeman ihn auf. „Falls Sie abstreitet, bei der Halbinsel gewesen zu sein, lassen wir noch Ihre Frau kommen; die ist ihr ja wohl auch über den Weg gelaufen, oder nicht?“
Trent nickte. „Brauchen Sie sonst noch etwas von mir?“
„Ich werde nun erst einmal das Vergnügen haben, die drei Leute hier zu interviewen. Vielleicht ergibt sich daraus noch die ein oder andere Nachfrage an Sie. Aber für den Moment haben Sie genug für uns getan.“ Dann begleitete er den aufgewühlten Zeugen noch zum Ausgang, schüttelte ihm die Hand und verabschiedete ihn in seinen alles andere als ruhigen Sonntagabend.
Als Freeman wieder ins Innere des Polizeireviers lief, warteten seine Kolleginnen und sein Kollege bereits auf ihn. „Und?“, wollte
