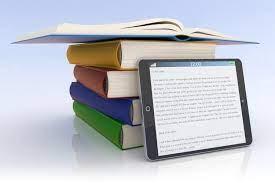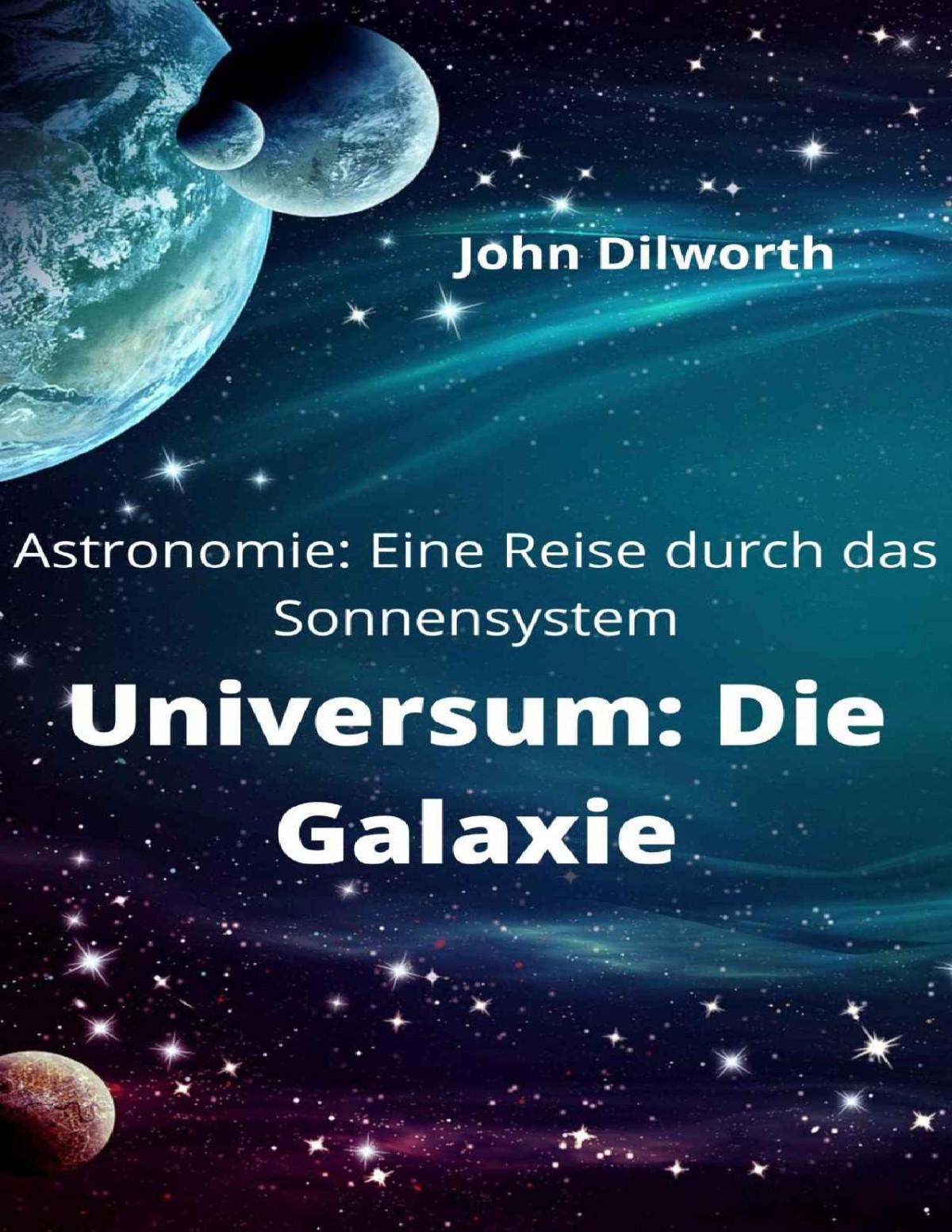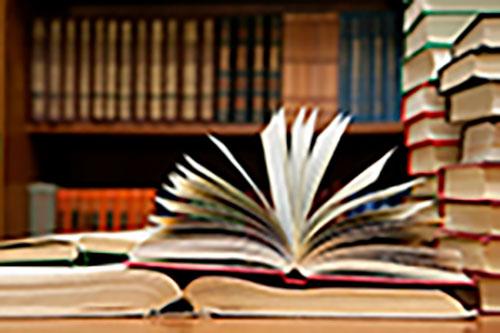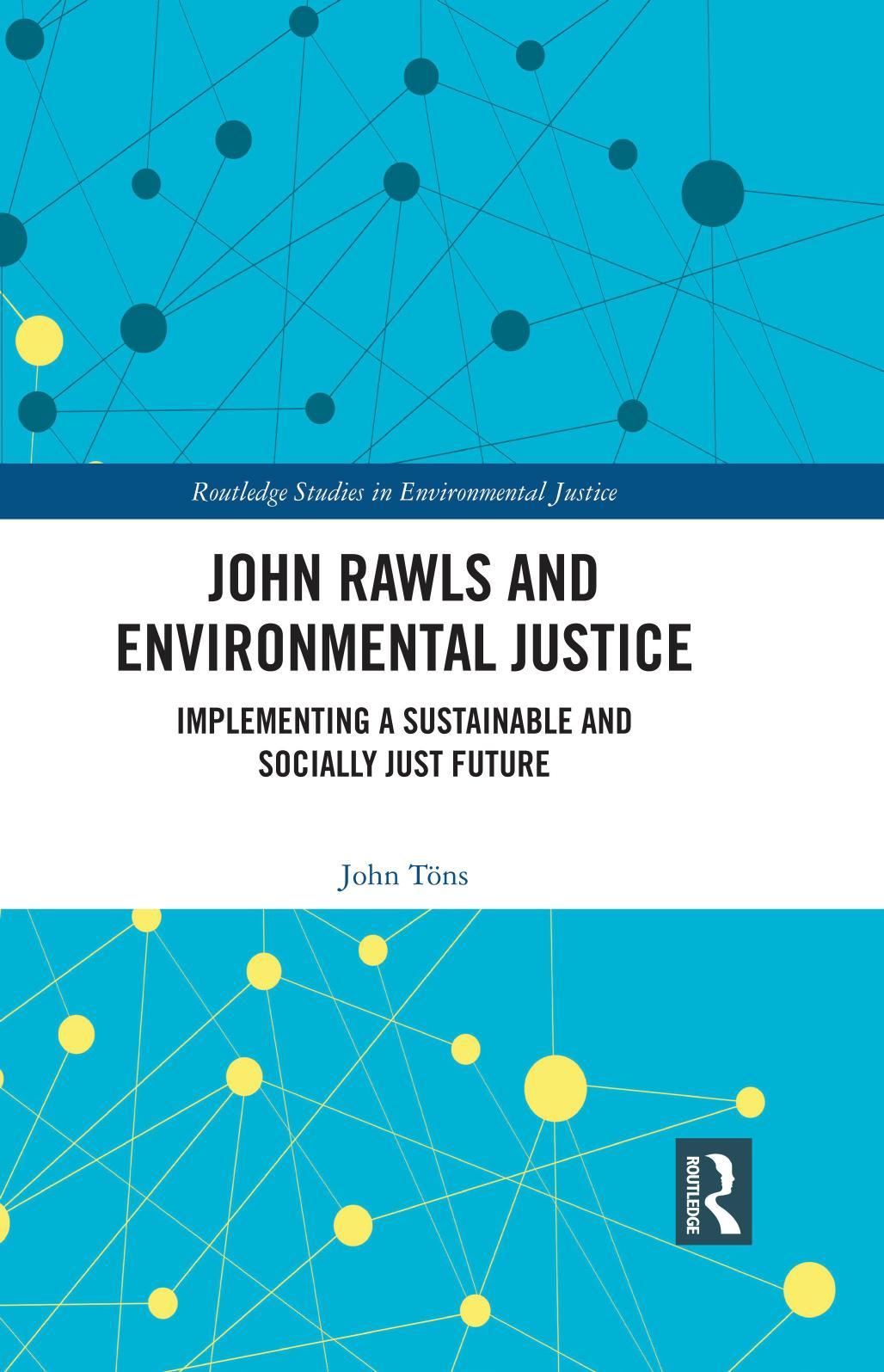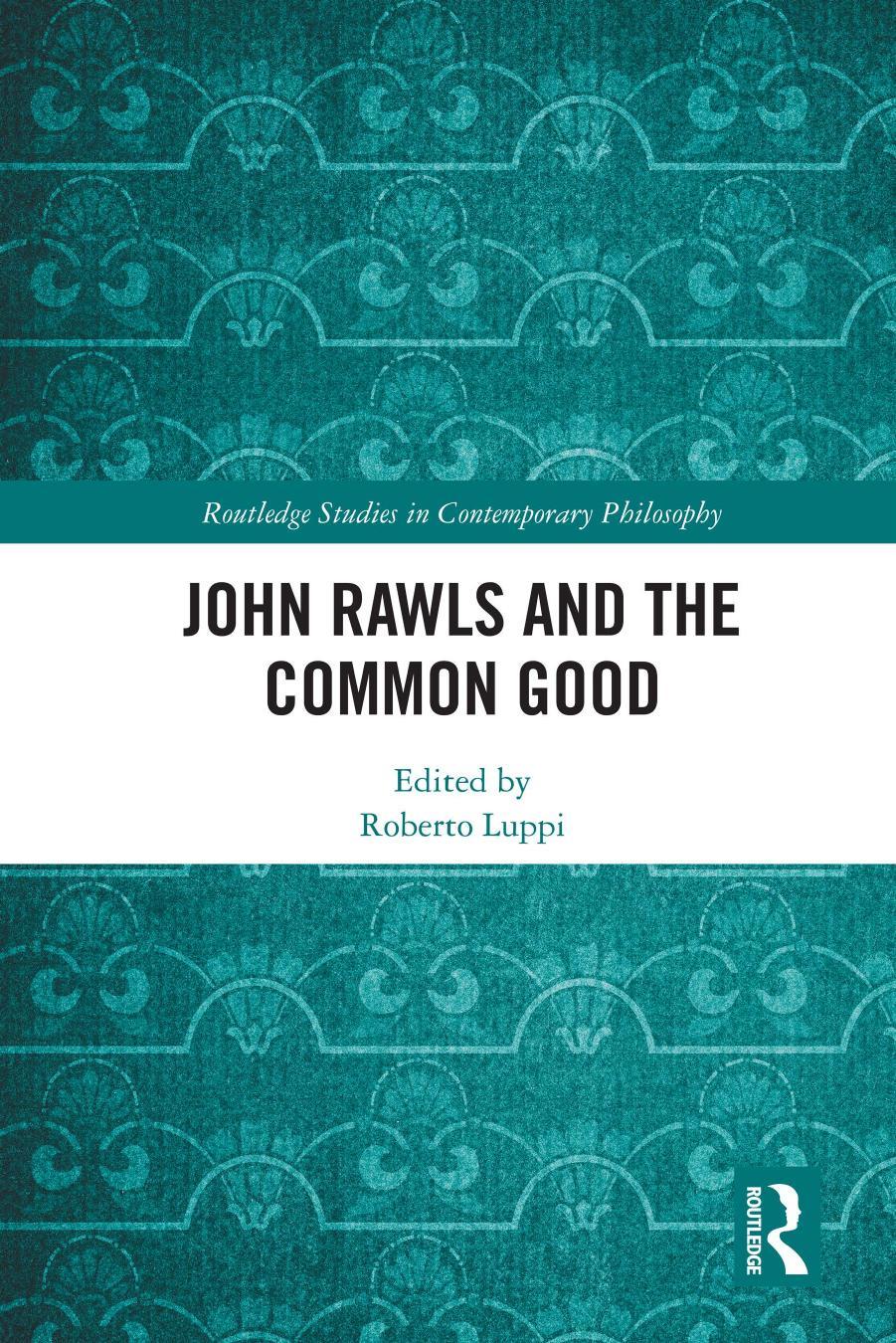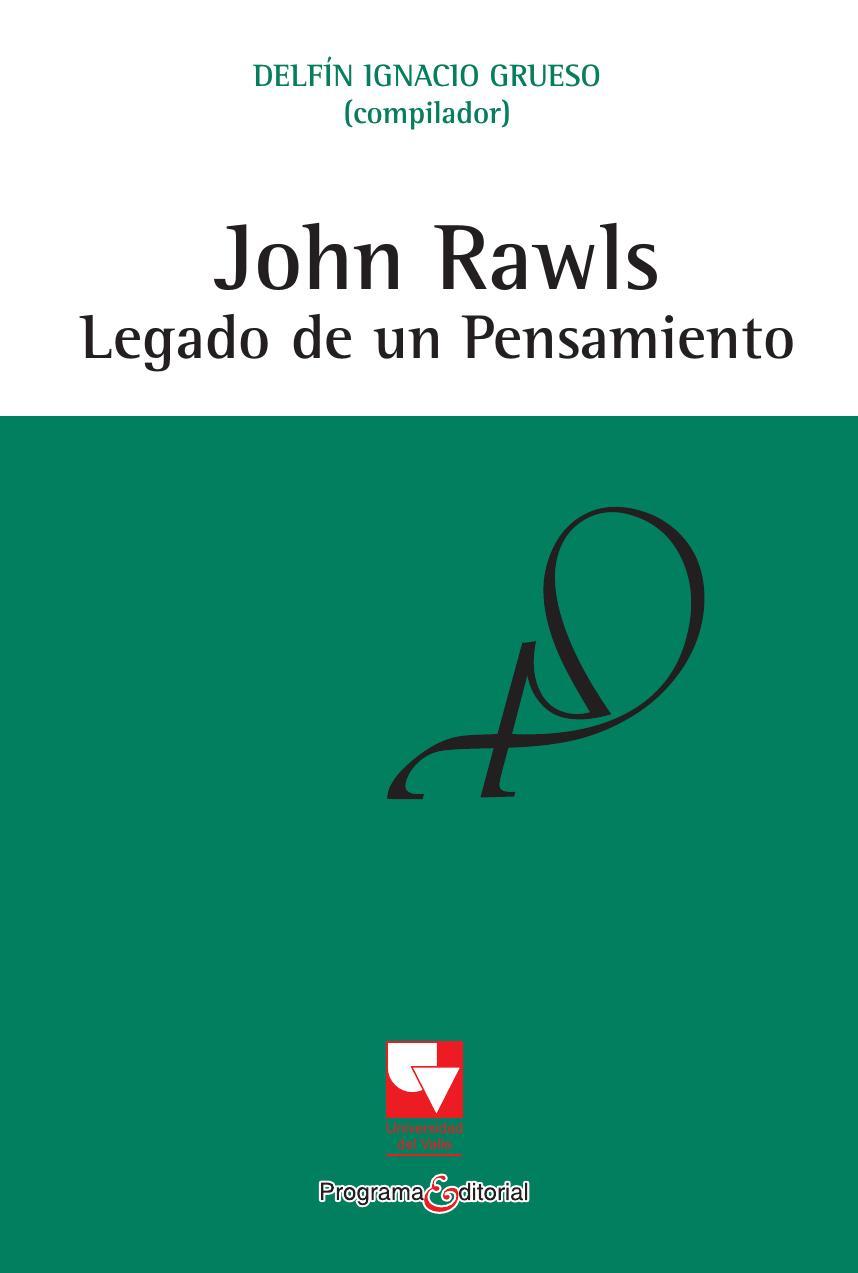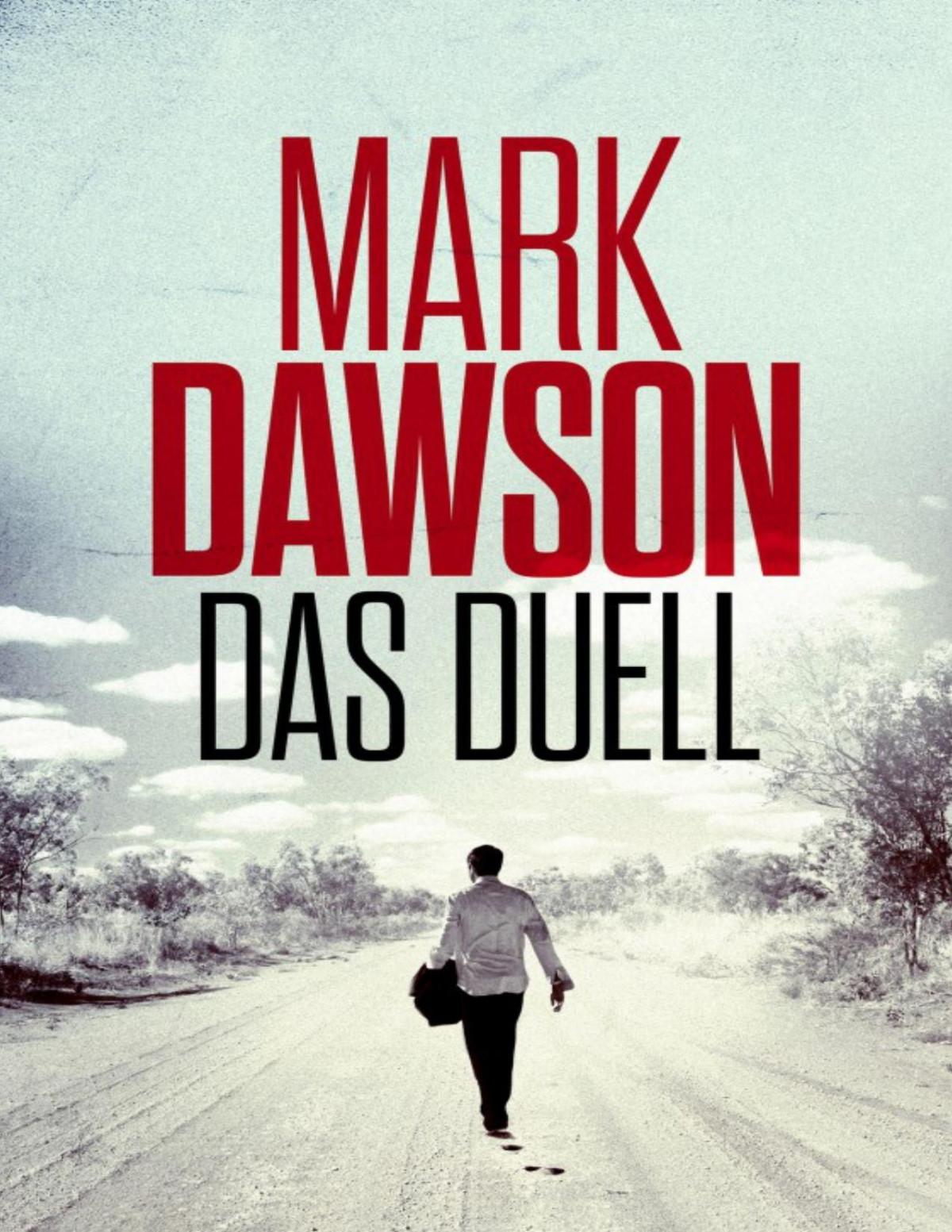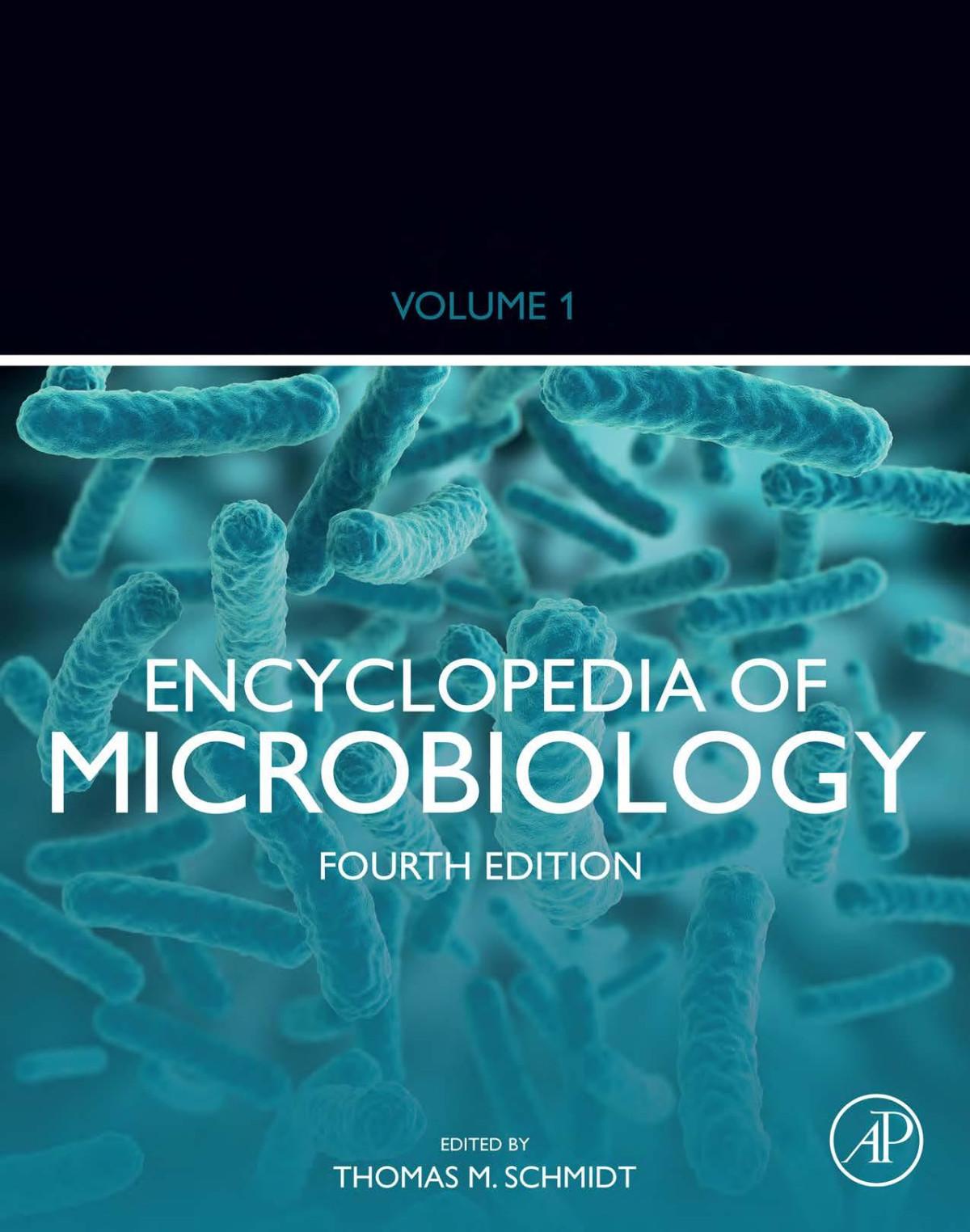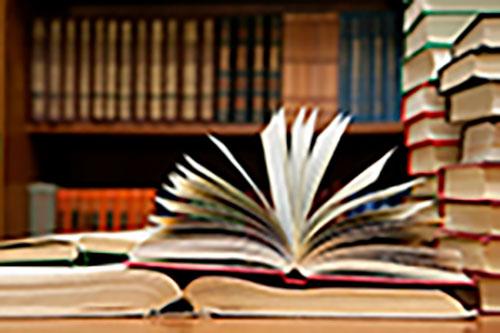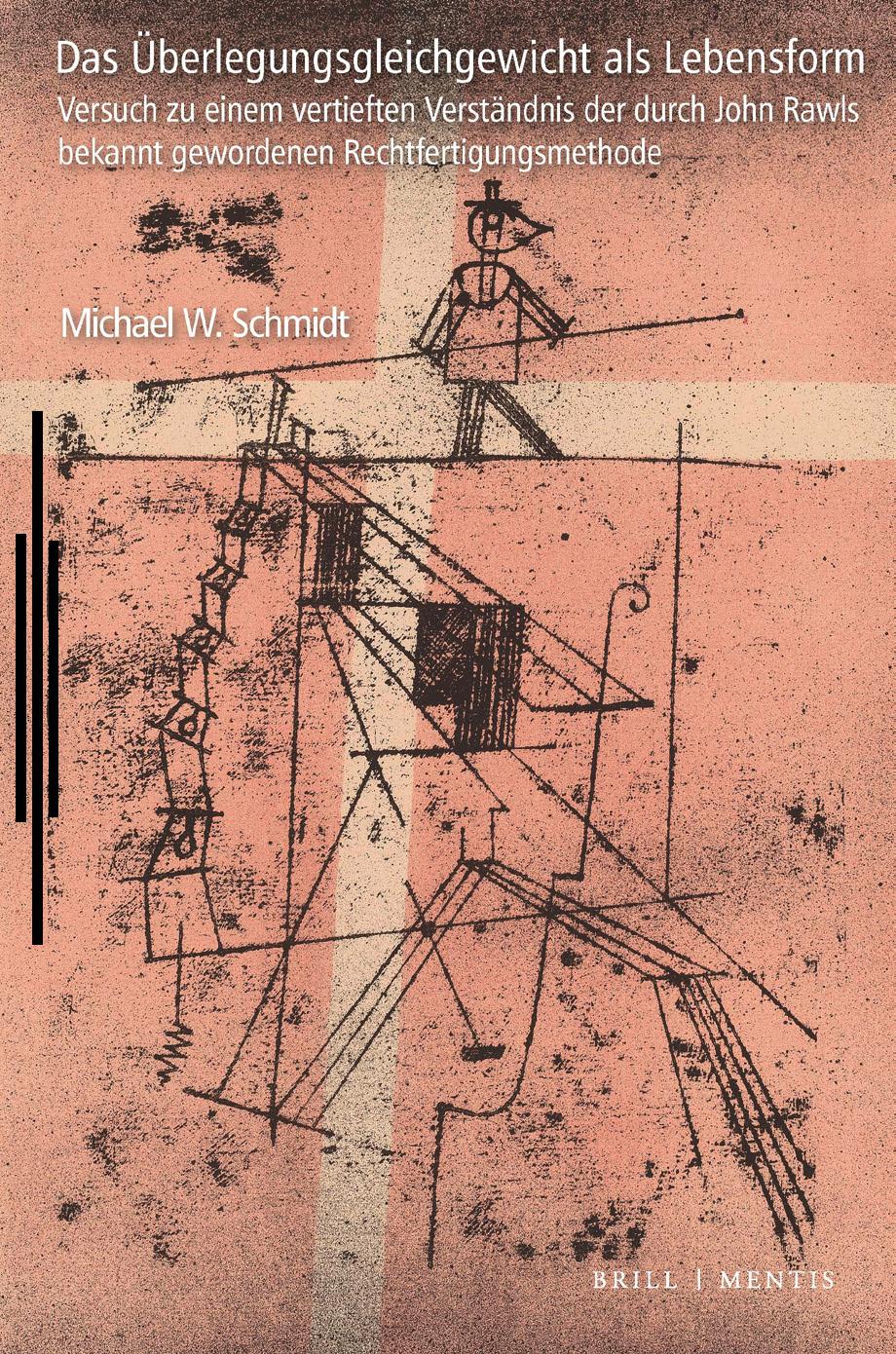Abstract in English
The objective of this thesis – Reflective Equilibrium as a Form of Life – is to contribute to the deepening of understanding of the method of reflective equilibrium – a method of internal epistemic justification.
In the first part of the study, four paradigmatic conceptions of the method will be analyzed in order to carve out a conceptual core: The ones by John Rawls – who coined the name of the method – Norman Daniels, Michael DePaul and Catherine Elgin. I will argue that the conceptual core of the method contains four elementary rules:
1) A minimalistic fallibilism,
2) a moderate holism,
3) a minimalistic rationality, and 4) a weak foundationalism.
Compliance with these rules is necessary and jointly sufficient for any epistemic procedure of justification to be in accordance with the method of reflective equilibrium.
The second part of the study is intended to answer some of the open questions concerning this definition of the conceptual core of the method.
It will be argued that the a minimalistic fallibilism, as a very central element of the method, is justified since there is no belief whose truth is transparent to an epistemic agent. Even if it were the case that such beliefs exist, there would be attractive options of retreat which provide a quasi-universal justification of minimalistic fallibilism. It will also be argued that all alternative methods of justification are either compatible with the method of reflective equilibrium or are not justified.
While a metajustification of the method – understood as a justification of the method employing the method itself – is on the one hand not completely satisfactory, as it presupposes the acceptance of the method before it is justified, it is epistemically acceptable on the other hand, since it allows for a critical inquiry and is open-ended.
It will be pointed out that a moderate foundationalism can be justified by the method for some specific area of inquiry insofar as basic beliefs can be identified. Yet, the default-position of the method is only a weak foundationalism (often also termed »coherentism«).
With regard to the possibility of a formal interpretation of the method with which one could specify key terms used in the definition of the conceptual core, I will sketch general ways such a formalization might take. However, I
will argue that the informal interpretation of the method has priority over any formal interpretation.
In the third and concluding part of the study, I will present the claim that one should interpret the method of reflective equilibrium as a form of life. This means that the method is at least implicitly accepted by some epistemic agents: they have developed a disposition and ability to act according to the method. This interpretation of the method can be related to the notion of critical thinking, which, as a civic virtue and educational ideal, is subject of empirical research and practical application. A possible misunderstanding with respect to the method of reflective equilibrium as a form of life should be avoided: To interpret the method as a form of life does not indicate that it must be a comprehensive form of life. Acknowledging it in private life is optional. According to the proposed understanding of the method it is primarily a public and political form of life.
Vorwort
Ursprünglich entstand meine Faszination für die Methode des Überlegungsgleichgewichts im Rahmen der Frage, wie man Menschenrechte adäquat begründen kann. Ob die Methode hierzu brauchbar ist, habe ich in meiner Magisterarbeit untersucht – und obgleich ich die Frage dort vorerst positiv beantworten konnte, blieben viele Fragen bezüglich der Methode selbst offen.
Diese offenen Fragen zumindest teilweise zu beantworten, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.
Aus sprachkritischen Gründen – ich möchte, dass sich in dieser Arbeit alle Personen angesprochen fühlen und repräsentiert sehen können – missfällt es mir allein das generische Maskulinum zu nutzen. Gleichzeitig scheint es mir für diese Problematik zurzeit noch keine optimale Lösung zu geben, weswegen ich als Verlegenheitslösung sowohl das generische Femininum verwende als auch das generische Maskulinum und Neutrum. Ich hoffe, dass dies dem Verständnis nicht abträglich ist und vielleicht sogar auf konstruktive Weise für die Thematik sensibilisiert.
Mein erster Dank geht an die zwei Betreuer meiner Arbeit: Prof. Dr. Michael Schefczyk und Prof. Dr. Hans-Peter Schütt. Sie haben diese Arbeit durch ihre Betreuungszusage erst ermöglicht und standen mir stets mit gutem Rat und voller Unterstützung zur Seite. Ich habe viel von ihnen gelernt – sowohl im Akademischen als auch im Persönlichen.
Ebenso danken, möchte ich denen, welche die Entwicklung der Arbeit tief beeinflusst haben: Zuerst Viktor Schubert, meinem guten Freund und Sparringspartner – im Philosophischen sowie im Sportlichen; Prof. Dr. Claus Beisbart, Prof. Dr. Georg Brun und meiner Kommilitonin Dr. Tanja Rechnitzer, an deren Workshops in Bern ich teilnehmen durfte; den Organisatorinnen und Teilnehmerinnen des Doktoranden-Workshops der Gesellschaft für Analytische Philosophie am 14.–15. November 2014 in Bonn (insbesondere Prof. Dr. Gerhard Ernst und Dr. Erik Stei, deren ausführliches Beratungsgespräch einen neuen Fokus in meine Arbeit brachte); den Studierenden meiner Seminare am Karlsruher Institut für Technologie (KIT ); den Teilnehmenden des »Sidgwick-Panels« der ISUS -Konferenz 2018 in Karlsruhe (besonders Dorothee Bleisch, die das Panel mit mir organisiert hat).
Dank gebührt auch jenen, die mich mit Gesprächen, Kommentaren und Korrekturen zu einzelnen Kapiteln dieser Arbeit bereichert und unterstützt haben und bisher noch ungenannt geblieben sind: Prof. Dr. Gregor Betz, Dr. Inga Bones, Claudia Brändle, Prof. Dr. Roger Crisp, Simeon Imhoff, Dr. Tobias Kronenberg, Dr. Hans-Jürgen Link, Richard Lohse, Ellen Ostrom,
Dr. Michael Poznic, Iria und Marisa Röder-Sorge, meinem Vater Hartmut Schmidt, Dr. Christoph Schmidt-Petri, sowie Prof. Dr. Christian Seidel.
Ich möchte auch den Personen und Institutionen danken, die diese Arbeit in finanzieller Hinsicht ermöglicht haben: Peter Zoche und dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI ), die mir nach der Rückkehr von einer ereignisreichen Reise durch meine Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft ermöglicht haben, das Vorhaben anzugehen; Herrn Schütt und dem Institut für Philosophie des KIT für die Unterstützung zweier Konferenzteilnahmen; der Friedrich-Ebert-Stiftung, deren finanzielle und ideelle Förderung ich nur weiterempfehlen kann; Michael Schefczyk für meine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter und die inspirierende Zeit im Projektteam der ISUS -Konferenz; der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften für eine Förderung der Drucklegung, sowie meinen Eltern Gisela und Hartmut Schmidt.
Herrn Dr. Michael Kienecker und Herrn Dr. Stephan Kopsieker vom mentis Verlag möchte ich für die Aufnahme ins Verlagsprogramm sowie die äußerst unterstützende und freundliche Zusammenarbeit Dank sagen.
Dankbar bin ich – vor allem – für die Menschen, denen ich in Freundschaft und Liebe verbunden sein darf. Ohne sie hätte ich sicherlich nicht die Kraft gehabt, mich dieser Arbeit zu widmen. Ich hoffe, dass ich ihnen besser durch mein Tun, als durch meine Worte zeigen kann, was sie mir bedeuten.
Erster Teil
Was ist ein Überlegungsgleichgewicht?
Kapitel 1
Warum könnte es sinnvoll sein, sich mit einer Methode der Rechtfertigung zu befassen? –
Eine kursorische Einführung ins Thema
Da wir […] unsere Vernunft benutzen, um sie selbst zu beschreiben, und da die Vernunft sich selbst nicht transparent ist, können wir unsere Vernunft, so wie alles andere auch, falsch beschreiben. Das Streben nach einem Überlegungsgleichgewicht ist in diesem wie in allen anderen Fällen ohne Ende.
John Rawls, Politischer Liberalismus, 177.
Die Begründung aber, die Rechtfertigung der Evidenz kommt zu einem Ende; das Ende aber ist es nicht, dass uns gewisse Sätze unmittelbar als wahr einleuchten, also eine Art Sehen unsererseits, sondern unser Handeln, welches am Grunde unseres Sprachspiels liegt.
Ludwig Wittgenstein, Über Gewissheit, § 204
In dieser Arbeit wird untersucht, was ein Überlegungsgleichgewicht eigentlich ist. Als Lexikoneintrag würde vielleicht Folgendes genügen:
Der Ausdruck bezeichnet einen Zustand, der über eine gleichnamige Methode der Rechtfertigung erreicht werden soll, die in der akademischen Philosophie eine Rolle spielt und die im Bereich der Erkenntnistheorie angesiedelt werden kann. Nicht ausschließlich, aber vor allem im Bereich der Moralphilosophie, gibt es einen häufigen Bezug auf die Methode.
Worum geht es also? Eine Methode versucht – nicht nur etymologisch gesehen – einen Weg zu einem Ziel aufzuzeigen.1 Und das verfolgte Ziel wäre
1 Das Wort »Methode« lässt sich auf das altgriechische »μέθοδος« zurückführen, wobei der zweite Bestandteil des Wortes (ὁδός) mit »Weg« übersetzt wird und der erste (μετά) unter anderem mit »nach«. Dementsprechend übersetzen lässt sich das altgriechische Wort insgesamt auch als »Nachgang im Verfolgen eines Ziels im geregelten Verfahren.« Ritter 1980, 1304.
© Brill mentis, 2022 | doi:10.30965/9783969752500_002
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
hier die Rechtfertigung von Überzeugungen, die genau dann vorliegen würde, wenn sich die zugehörigen Überzeugungen in einem Zustand des »Gleichgewichts« befinden und miteinander »harmonieren«. Man kann also zwischen einem Zustand trennen, der als Überlegungsgleichgewicht bezeichnet wird und in dem Überzeugungen gerechtfertigt sind, und einer Methode des Überlegungsgleichgewichts, die zu diesem Zustand führt.2 In dieser Arbeit wird die Methode des Überlegungsgleichgewichts untersucht – aber dazu muss man natürlich auch ein Verständnis des Zustands der Rechtfertigung erlangen, der mit ihr angestrebt wird.
Rechtfertigung spielt in der Philosophie vor allem eine Rolle, wenn es um Erkenntnis und Wissen geht. Was genau man unter diesen Worten zu verstehen hat, ist allerdings alles andere als klar. Und auch der knappe fiktive Lexikonartikel zu Beginn befriedigt nur bedingt, da er jede Menge legitimer Fragen evoziert. Indem ich die Beziehung zwischen Rechtfertigung, Wissen und Erkenntnis im Folgenden ein wenig genauer erörtere, möchte ich in diesem Einleitungskapitel erstens für die weitere Untersuchung notwendiges Hintergrundwissen einführen und zweitens aufzeigen, wie man ein Interesse an der ausführlichen Untersuchung einer Rechtfertigungsmethode überhaupt motivieren kann; warum das Lesen der weiteren Seiten also spannend und gewinnbringend ist. Eine ausführliche Übersicht über die weitere Arbeit folgt mit dem zweiten Kapitel.
Wenn ich mich in einer schwierigen Situation befinde, vielleicht in einem scheinbaren moralischen Dilemma, das mich unschlüssig und unsicher macht, dann liegt der Wunsch nahe, herauszufinden, was man denn in einer solchen Situation eigentlich tun sollte. Wenn ich aus einer unschuldigen Neugierde untersuche, wie viele Punkte der kleine Marienkäfer hat, der auf meiner Hand spaziert, dann möchte ich herausfinden, was genau eigentlich der Fall ist. Das sind Fälle, in denen man nach Erkenntnis strebt. In dem ersten Fall nach moralischer Erkenntnis, also der Antwort auf die Frage: »Was soll ich tun?« In dem zweiten Fall handelt es sich um Naturerkenntnis –etwa empirisches Wissen um die physikalische, biologische oder chemische Gestaltung der uns umgebenden Welt. Ein weiteres Erkenntnisinteresse
2 Vgl. auch Tersman 1993, 45ff. Sowohl Zustand als auch Methode werden oft einfach mit dem Ausdruck »Überlegungsgleichgewicht« bezeichnet – auch ich werde die Methode manchmal kurz als »Überlegungsgleichgewicht« bezeichnen. Aus dem Kontext sollte man entnehmen können, was von beidem gemeint ist.
könnte auch an sozialen Fakten, Menschen und »beseelten« Lebewesen, Kunst sowie an mathematischen oder logischen »Tatsachen« bestehen; oder an dem Zusammenspiel meines eigenen Körpers und meiner höchst eigenen Psyche – gemäß der antiken Inschrift am Tempel des Apollon von Delphi: »Erkenne Dich selbst.«
Oft handelt es sich bei der angestrebten Erkenntnis um sogenanntes propositionales Wissen, das in Aussagesätzen ausgedrückt werden kann. Daneben gibt es noch andere Arten von Wissen, etwa ein Wissen, wie gehandelt wird –ein Know-how; im Deutschen bietet sich in einem weiten Sinn auch das Wort »Kunst« hierfür an – und diese Art von Wissen zu vernachlässigen wäre eine absurd intellektualistische Haltung.3 Es ist eine Sache zu wissen, wie die Schrittfolge des Langsamen Walzers schematisch dargestellt wird und abstrakt definiert ist, eine andere Sache ist es ihn als Paar elegant tanzen zu können. Und für diese elementare Form des Wissens (manche sprechen hier allerdings lieber nur von »Fähigkeit«) ist das propositionale Wissen – zumindest auf den ersten Blick – weder notwendig noch hinreichend. So lernen wir beispielsweise Sprechen, noch weit bevor es uns möglich ist, Regeln der Sprache sprachlich auszudrücken und zu reflektieren. An dem Beispiel des Sprechens lässt sich aber erahnen, dass, auch wenn das propositionale Wissen für die Praxis oft nicht zwingend erforderlich ist, es doch oftmals äußerst hilfreich und für eine »wahre Meisterschaft« vielleicht auch unerlässlich ist. Auch wenn es letztlich darum geht tatsächlich richtig zu handeln, ist die Verbindung mit dem propositionalen und insbesondere theoretisch-abstrakten Wissen – wenn man für den Augenblick mögliche Probleme bei einer scharfen Trennung der Begriffe außer Acht lässt – genau das, was oftmals angestrebt wird oder gar angestrebt werden sollte. Mit den Worten von Johann Gottfried von Herder:
»Kunst kommt von Können oder von Kennen her (nosse aut posse), vielleicht von beiden, wenigstens muß sie beides in gehörigem Grad verbinden. Wer kennt, ohne zu können, ist ein Theorist, dem man in Sachen des Könnens kaum trauet; wer kann ohne zu kennen, ist ein bloßer Praktiker oder Handwerker; der echte Künstler verbindet beides.«4
Wie gelangt man aber nun zu angestrebten Erkenntnissen oder im Speziellen zu Wissen? Für das Know-how gilt – zumindest dem Volksmund nach – dass
3 Vgl. Herder, Kalligone; vgl. Sayre-McCord 1996. Es gibt jedoch auch die (selbstverständlich legitime) Position des epistemischen Intellektualismus (so bezeichnet gemäß Gilbert Ryles The Concept of Mind) nachdem sich knowing-how oder knowing-where auf knowing that – also propositionales Wissen – reduzieren lässt. Vgl. Ryle 1949.
4 Herder, Kalligone, 125.
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
die Übung den Meister macht. Wenn es um propositionales Wissen geht, fällt uns in alltäglichen Fällen die Antwort oft auch nicht schwer: Wenn ich etwa wissen möchte, welche Augenfarbe meine Gesprächspartnerin hat, dann kann ich einen tiefen Blick in ihre Augen riskieren. Wenn ich das aber für zu aufdringlich und nicht angebracht halte oder mir nicht ganz sicher bin, wäre eine andere Möglichkeit, danach zu fragen. Auch hier handelt es sich um zwei verschiedene Arten von Wissen: Das eine basiert in gewisser Weise auf meiner Sinneswahrnehmung, das andere auf dem Zeugnis einer anderen Person. Das Zeugnis könnte natürlich falsch sein, obwohl die Wahrscheinlichkeit – einem verbreiteten (und hoffentlich bald überholten) Stereotyp zufolge – dafür niedriger liegt, als wenn die Frage dem Alter gegolten hätte; doch auch die Sinne sind nicht vor Täuschungen sicher, genauso wie man sich über den richtigen sprachlichen Ausdruck in Bezug auf farbliche Nuancen und Erscheinungen streiten kann.
Ein gutes Beispiel für die Problematik, dass auch die uns so verlässlich erscheinenden Sinne nicht vor Täuschungen gefeit sind, war zu Beginn des Jahres 2015 ein verblüffendes Phänomen, dass im Internet unter der Überschrift (beziehungsweise mit dem Hashtag) Dressgate oder The Dress für Furore sorgte: Bei der unter ungünstigen Lichtverhältnissen aufgenommenen Fotografie eines Abendkleides wurde dessen Farbgestaltung von vielen Menschen als weiß-gold, von anderen aber als schwarz-blau wahrgenommen, wobei letzteres der tatsächlichen Farbgebung des Kleids entspricht. Eine plausible wissenschaftliche Erklärung ist, dass das Gehirn bei vielen Menschen aufgrund des grellen Bildhintergrunds eine Farbkorrektur aktiviert, die in diesem Fall täuscht.5
Damit ist schon eines der zentralen Probleme des Wissens angedeutet: nämlich, dass es wohl selten so etwas wie Gewissheit über das gibt, was wir meinen zu wissen. Dennoch gehen wir im Alltäglichen – auch wenn die prinzipielle Möglichkeit einer Täuschung (selbst)kritisch eingeräumt wird – von vielen Dingen aus, die wir tatsächlich wissen. Und dabei handelt es sich nicht nur um Dinge der höchstpersönlichen Umgebung, sondern auch ganz allgemeine Aussagen, wie etwa, dass alle Menschen sterblich sind, dass die Erde eine Art unvollkommener Kugel ist oder dass bestimmte Naturgesetze gelten, wie etwa die Gravitation, die sich in Formeln ausdrücken lassen und Geschehnisse und Reaktionen in unserer Umgebung berechenbar und vorhersagbar machen.
5 Im Gegensatz zu anderen bekannten optischen Täuschungen in Bezug auf Farben, gibt es hier einen erheblichen Dissens der Betrachter in Bezug auf die korrekte Farbgebung. Vgl. Brainard / Hurlbert 2015.
In der europäischen Kultur ist das Streben nach Wissen und auch die Frage, wie dieses Streben am besten betrieben wird, tief verbunden mit der Philosophie und der Wissenschaft. Die ersten Philosophen, die so genannt wurden und sich selbst so bezeichneten, waren Naturphilosophen, die systematisch versuchten, Wissen über die Welt zu erhalten und sich damit von der mythischen Welterklärung abwendeten. Philosophie ist nun aber eine in höchstem Maß reflexive Beschäftigung, so dass auch die Beschäftigung mit dem, wie wir zu Wissen gelangen und was Wissen überhaupt ist, in den Fokus der philosophischen Erkundung rückt.
Ein Blick nun zuerst auf die Frage nach dem Begriff des Wissens: Nach einem Verständnis, das in Platons Dialogen diskutiert wird und das bis in die Gegenwart paradigmatisch ist, liegt Wissen dann vor, wenn man erstens eine eindeutige Überzeugung von einem Sachverhalt hat, zweitens diese Überzeugung, in dem Sinn »wahr« ist, dass der Sachverhalt auch tatsächlich der Fall ist, und man drittens nicht einfach zufälligerweise richtig geraten hat, sondern auch gute Gründe für eine richtige Überzeugung anführen kann. Seine Meinung zu begründen, also adäquate Argumente dafür anzuführen, dass die Meinung auch wahr ist, das ist ein Versuch der Rechtfertigung. Man spricht daher auch von der Analyse des Wissens als »gerechtfertigter, wahrer Überzeugung«. Im Jahr 1963 wurde von Edmund L. Gettier ein dreiseitiger Aufsatz mit dem Titel Is Justified True Belief Knowledge? veröffentlicht, der deutlich macht, dass man nicht in allen Fällen zugestehen würde, dass jemand, der begründet eine wahre Überzeugung vertreten hat, tatsächlich auch etwas gewusst hat.6
Hier eines der beiden Beispiele, die Gettier anführt: Nehmen wir an, Smith, der sich für einen Job beworben hat, erfährt von dem Vorstandvorsitzenden unter der Hand, dass sein Mitbewerber Jones die Stelle erhalten wird. Außerdem hat Smith bei einer Gelegenheit zufällig mitbekommen, dass Jones genau zehn Münzen in seiner Geldbörse hat. Nun hat er – mittels logischer Schlüsse – durchaus »gerechtfertigter Weise« auch die Überzeugung, dass der Mann, der den Job bekommen wird, zehn Münzen in seiner Geldbörse hat. Wie der Zufall es will, bekommt Smith aber den Job und zufälligerweise –und ohne, dass er sich dessen bewusst ist – hat auch er genau zehn Münzen in seiner Geldbörse. Nun hat Smith zwar die in Betracht gezogene formale Bedingung für Wissen erfüllt (nämlich: eine wahre begründete Überzeugung zu haben) doch wir würden natürlich nicht sagen, er habe gewusst, dass der Mann der den Job bekommt, zehn Münzen in seiner Geldbörse hat: denn er
6 Vgl. Gettier 1963.
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
ging in seinen Überlegungen ja stets von Jones aus.7 Dass man in diesem Sinne gerechtfertigter Weise eine wahre Überzeugung hat, reicht also noch nicht dafür aus, auch ein Wissen zuzusprechen – diese Einsicht beschäftigte in der Folge die Erkenntnistheorie.8
Eine Lösung für dieses Problem, die Alvin Goldman vier Jahre später in Betracht zog, war, dass man für die Zuschreibung von empirischem Wissen nicht etwa eine wahre Überzeugung benötigt, für die man selbst eine explizite Rechtfertigung angeben kann, sondern dass eine andere Bedingung erfüllt sein muss: nämlich, dass das, was den Aussagesatz, von dem ich überzeugt bin, wahr macht, auch genau das ist, was mich dazu führt, von ihm überzeugt zu sein.9 Wenn ich also meine, einen guten Freund von mir im Theater zu erkennen und er tatsächlich auch dort ist (und es sich also nicht etwa um eine Halluzination oder einen Doppelgänger handelt), wäre meine wahre Überzeugung, dass dem so ist, genau dann Wissen, wenn es einen kausalen Zusammenhang zwischen meiner Überzeugung und seiner Anwesenheit gibt – etwa, wenn meine Überzeugung auf einer Wahrnehmung meines Freundes beruht: dass ich ihn also sehe oder seine Stimme höre. Beruht meine Überzeugung aber zum Teil auch auf logischen Schlüssen – etwa, wenn mir Lavagestein unter Zuhilfenahme von wissenschaftlichen Theorien anzeigt, dass sich hier in Vorzeit ein Vulkanausbruch zugetragen hat, und ich bilde dementsprechend solch eine Überzeugung aus – so dürfen die damit zusammenhängenden Schlüsse oder meine eigene Rekonstruktion der Kausalereignisse zumindest keine groben Fehler enthalten.10
Die kausale Verknüpfung von Tatsachen und zugehörigen wahren Überzeugungen ist in dem Beispiel Gettiers etwa ganz klar nicht der Fall. Denn in dem Gedankenexperiment kommt man ja gerade aufgrund der falschen Annahme über Tatsachen zufälligerweise doch zu einer wahren Überzeugung. Damit kann diese Theorie Goldmans besser unser intuitives Urteil darüber, was Wissen ist, erklären.
Doch auch für die kausale Analyse des Wissens lassen sich Gegenbeispiele konstruieren – eines wird von Goldman verwendet, um eine Revision seiner Theorie durch ihn selbst zu erläutern: Henry fährt in einem Auto übers Land und versucht seinem Jungen spielerisch beizubringen, welche Dinge es dort typischerweise gibt: »Da ist eine Scheune«, sagt er beispielsweise und ist auch
7 Vgl. Gettier 1963, 121f.
8 Laut Alvin Goldman hatte bereits Bertrand Russell 1912 in The Problems of Philosophy auf diesen Punkt hingewiesen, der von Gettier erneut zur Diskussion gestellt wurde. Vgl. Goldman 1967, 375.
9 Vgl. Goldman 1967.
10 Vgl. Goldman 1967, 363.
davon überzeugt, da er eine sieht. Bei dem Objekt, auf das er zeigt, handelt es sich auch tatsächlich um eine Scheune. Weiß Henry also, dass es eine Scheune ist? Im Normalfall schon, nun fährt er aber gerade durch eine Gegend, in der es von Scheunenattrappen aus Pappmaché wimmelt. Nur durch puren Zufall hat er in diesem Moment auf die einzig richtige Scheune in der ganzen Umgebung gezeigt. Die relevante Information hinzugenommen, dass es durchaus möglich gewesen wäre, dass Henry einer Scheunenattrappe auf den Leim gegangen wäre, würden wir wohl kaum sagen wollen, dass Henry wusste, dass es sich bei dieser Scheune tatsächlich um eine handelte. Dies konnte Goldmans alte kausale Theorie des Wissens jedoch nicht erklären, denn die Kausalkette wird in diesem Beispiel korrekt durch Henry rekonstruiert.11 Ein unverantwortliches oder irrationales epistemisches Verhalten müssen wir Henry für das Gedankenexperiment auch nicht unterstellen, denn wir würden ihm selbst dann kein Wissen zuschreiben wollen, wenn man gar nicht vernünftiger Weise von ihm verlangen kann, dass er die Information hätte einholen müssen, dass es in diesem Landstrich Scheunenattrappen gibt. Seine auf Wahrnehmung beruhende Überzeugung ist in diesem Fall einfach generell nicht verlässlich, weil sie ihn nicht zuverlässig zwischen Attrappe und echter Scheune unterscheiden lässt (zumindest wenn wir annehmen, dass die Attrappen gut gemacht sind) – in diesem Umfeld ist unser Wahrnehmungsapparat ähnlich ungeeignet wie in Bezug auf sehr weit entfernte oder sehr nahe Objekte, sehr kleine oder sehr große Objekte, Objekte unter Wasser oder – um auf das vorige Beispiel des Internetphämnomens Dressgate zu verweisen – unter ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen. Erneute Anpassungsleistungen scheinen also notwendig für eine Theorie des Wissensbegriffs.
An der vorigen Feststellung greift eine vielversprechende Lösungsstrategie an, nämlich der Reliabilismus, der im Anschluss unter anderem von Alvin Goldman vertreten wurde: Um von Wissen sprechen zu können muss dem Reliabilismus zufolge eine wahre Überzeugung durch einen verlässlichen kognitiven Mechanismus gewonnen werden, der nicht nur tatsächlich wahre Überzeugungen produziert, sondern auch in relevanten kontrafaktischen Situationen, und damit eben in zuverlässiger Weise. Zumindest sollte der Mechanismus in der Lage sein, in solchen relevanten kontrafaktischen Situationen, falsche Überzeugungen verlässlich zu unterbinden.12
Als ein Prototyp für epistemisch verlässliche Mechanismen werden von Goldman erneut Wahrnehmungsprozesse oder -mechanismen unter günstigen Randbedingungen gesehen. Ein Wahrnehmungsprozess sei verlässlich genau
11 Vgl. Goldman 1976, 772f.
12 Vgl. Goldman 1976, 771.
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
in dem Umfang, in dem gegensätzliche Eigenschaften der Umwelt auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungszuständen führen, welche wiederum zumeist wahre Überzeugungen und Unterscheidungen beim epistemischen Akteur hervorrufen. Diese Interpretation fällt für Goldman mit einer alten Bedeutung des englischen Ausdrucks »knowledge« zusammen, der oft übersehen werde, nämlich die Bedeutung im Sinne von »etwas von etwas anderem unterscheiden (können)«.13 Sein Vorschlag ist, um zu »wissen« muss man unterscheiden können zwischen möglichen relevanten Alternativen. Allerdings nicht zwischen allen logisch denkbar möglichen Alternativen (man könnte auch sagen: möglichen Welten). Nehmen wir das Scheunen-AttrappenBeispiel mit Henry: Dort ist die Möglichkeit einer Scheunen-Attrappe relevant, da wir – von einer externen Warte aus – die Information haben, dass sie existieren. Kann Henry also nicht verlässlich zwischen Attrappe und Scheune unterscheiden, hat er auch kein Wissen darüber, ob er eine Scheune sieht –selbst dann, wenn er eine sieht und deswegen davon überzeugt ist eine zu sehen. Die Existenz eines arglistigen Dämons, der uns über die Außenwelt täuscht und auf diese Art auch falsche visuelle Reize aufzwingt, muss Henry anscheinend aber nicht ausschließen können; man könnte argumentieren: weil wir keine Informationen darüber haben, dass dieser Dämon existiert –diese Unterscheidungsfähigkeit ist damit nicht relevant. Dies ist zumindest Goldmans Position, da es ansonsten fast nichts geben könnte, was wir nach seiner Theorie wissen und dies sieht er bei anderen Theorien definitiv als Problem an.14 Dennoch bleibt aber die Frage offen: Wann genau ist eigentlich eine mögliche Täuschung derart relevant, dass man zuverlässig, kontrafaktisch, zwischen ihr und einer wahren Überzeugungen unterscheiden können muss? Würden wir weiter bestreiten, dass Henry weiß, dass er eine Scheune sieht, wenn es auf der ganzen Welt nur irgendwo eine einzige Scheunenattrappe geben würde, die er nicht von einer echten Scheune unterscheiden kann?15 Auch der Reliabilismus sieht sich also mit Problemen – diesem und weiteren –konfrontiert.16 Was genau Wissen ist, bleibt also auch bei einem Antwortversuch in dieser Gangart eine knifflige Frage, die zumindest bis jetzt noch nicht in einem allgemeinen Konsens aufgegangen wäre. Die Analyse des Wissensbegriffes ist weiterhin ein aktuelles philosophisches Problem.
13 Vgl. Goldman 1976, 771f.
14 Vgl. Goldman 1976, 774ff.
15 Vgl. auch Goldman 1976, 775.
16 Vgl. Goldman 1976, 775–778; für eine Übersicht möglicher Probleme vgl. Ernst 2016, 121–135.
Bei all den Problemen mit dem Begriff des Wissens wird offenbar, dass es bei dessen Analyse aus historischer Sicht nur wenige konstante Elemente gibt, die allgemein akzeptiert werden – ein recht unumstrittener Kandidat wäre etwa, dass eine wahre Überzeugung für Wissen notwendig ist. Andere Elemente der traditionellen Wissensanalyse scheinen wesentlich hinterfragbarer: etwa scheint beim Reliabelismus einfach die Bedingung der propositionalen Rechtfertigung zu entfallen, ohne dass dies offensichtlich gleich zu einem Problem führen würde. Dass eine derartige explizite Rechtfertigung durch das wissende Subjekt selbst keine notwendige Bedingung für Wissen ist, sondern eine von außen als verlässlich beurteilte Beziehung,17 wird als Externalismus verstanden. Man kann hier von Externalismus sprechen, weil hier die in Frage stehende Überzeugung nicht vom Subjekt selbst durch Gründe gerechtfertigt werden muss, sondern von einem externen Standpunkt aus – von einem unabhängigen Beobachter – als eine Überzeugung gerechtfertigt werden könnte, die verlässlich zustande gekommen ist. In diesem Sinne ist der Reliabilismus Goldmans ein epistemischer Externalismus.
Ein alltägliches Beispiel für eine Einstellung, die für den erkenntnistheoretischen Externalismus spricht, ist etwa, wenn man auch einem Kleinstkind Wissen zuschreibt. Wer hier bestreiten möchte, dass Kleinstkinder schon etwas wissen können, weil sie eben noch nicht zusammenhängend reden und Gründe anführen können, der muss sich fragen lassen, wie er das Phänomen erklären möchte, wenn das Kind einen Ball zurückhaben möchte, während man diesen hinter dem Rücken versteckt hält – ist das nicht genau das Phänomen, das einem zu zeigen scheint, dass es durchaus versteht, dass es um ein ganz bestimmtes Objekt geht, und dass es genau »weiß«, dass der Ball nicht einfach verschwunden ist? Gründe anführen oder seine Überzeugung rechtfertigen, kann das Kind in diesem Stadium noch nicht, auch wenn es seiner Überzeugung durchaus schon Ausdruck verleihen kann. Oder wie steht es mit einem aufgeregten Dackel, der, wenn die Leine aus dem Schrank hervorgeholt wird, genau »weiß«, dass dies ein sicheres Zeichen fürs »Gassi gehen« ist?18 Schreiben wir dem Schimpansen »Santino« im schwedischen Furovik Wissen zu, wenn er vor der Öffnung des Zoos aus Mauerstücken Wurfgeschosse herstellt und sie an passenden Orten lagert, um sie auf die erst später
17 Diese Beziehung zwischen der Überzeugung und der Wahrheit der Überzeugung wird zum Teil auch »Rechtfertigung« genannt. Man muss also zwischen einer expliziten Rechtfertigung unterscheiden, die für einen epistemischen Akteur intern ist und einer impliziten, die extern ist. Wenn ich allgemein nur von »Rechtfertigung« schreibe, beziehe ich mich auf die interne explizite Form.
18 Diese Beispiele stammen von Gerhard Ernst. Vgl. Ernst 2016, 114f.
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
eintreffenden Besucher schmeißen zu können?19 Ein Externalismus ist auch aus anderen Gründen plausibel, etwa weil, wie Goldman klarstellt, es durchaus so ist, dass wir viele der Dinge, von denen wir in Anspruch nehmen, dass wir sie wissen, ursprünglich auf eine Weise gelernt und gerechtfertigt wurden, an die wir uns nun nicht mehr erinnern. So etwa, wenn wir den Geburtstag Abraham Lincolns zwar »wissen«, aber nicht mehr rekonstruieren können, dass dieses Wissen aus bestimmten Lexikoneinträgen stammt, die man aus externer Sicht als verlässlich anzusehen bereit wäre.20
Welchen Wert hat also die philosophische Beschäftigung mit einer Methode der Rechtfertigung angesichts der Tatsache, dass nicht alle plausiblen Theorien des Wissens eine explizite Rechtfertigung für notwendig erachten? Welchen Sinn hat es, sich mit Methoden und Theorien der Rechtfertigung auseinanderzusetzen, bei denen die Rechtfertigung intern sein muss – man also explizit und bewusst Gründe für eine Überzeugung angibt?
Erstens ist es auch weiterhin eine legitime Position, eine interne Rechtfertigung als Voraussetzung für Wissen anzusehen. Aber der erkenntnistheoretische Internalismus ist keine unumstrittene Position und sieht sich selbst unter starkem Rechtfertigungsdruck. Es gibt allerdings zweitens auch die Position, dass Wissen nicht der einzige epistemische Wert ist.21 Man kann durchaus Positionen vertreten, nach denen es keinen epistemischen Wertemonismus gibt, sondern ein Wertepluralismus existiert – also dass man im Rahmen der Suche nach Erkenntnis mehrere Dinge final erreichen möchte. Eine dieser Positionen sieht in der expliziten internen Rechtfertigung durch einen epistemischen Akteur ein unabdingbares Mittel, uns einen weiteren finalen Wert der Erkenntnis zu sichern: Dieser epistemische Wert kann als Verstehen oder Verständnis (im Englischen understanding) bezeichnet werden.22 Ich möchte vorschlagen, diesen Ausdruck wie folgt zu gebrauchen: Wir verstehen im epistemischen Sinne etwas genau dann, wenn wir es in ein kohärentes Überzeugungssystem einfügen können, in dem sich die jeweiligen legitimen Überzeugungen gegenseitig bestmöglich stützen und gerechtfertigt sind und dabei tatsächlich auch eine gewisse Menge an wahren oder korrekten Überzeugungen oder Wissen vorhanden ist. Doch was spricht
19 Vgl. Osvath 2009.
20 Goldman 1967, 370.
21 Oftmals wird sogar vertreten, dass wir im Bereich der Erkenntnis nur nach wahren Überzeugungen streben – dies wäre ein epistemischer Wertemonismus in Bezug auf Wahrheit.
22 Vgl. auch Baumberger / Beisbart / Brun 2017, 3f. Wie genau »Verstehen« oder »Verständnis« verstanden werden sollte, ist natürlich eine umstrittene Frage. Es gibt mehrere konkurrierende Theorien hierzu. Vgl. Gordon 2019. Meine Verwendung des Ausdrucks sollte mit den meisten von ihnen kompatibel sein.
dafür, in einem solchen Verstehen ein eigenständiges Ziel der Erkenntnis zu sehen? Ein Verständnis eines Sachgebiets zu erlangen ist – so könnte man anführen – vielleicht gerade deshalb bereichernd und sinnvoll, weil es den Einsatz der Eigenschaften des Menschen verlangt, die uns als Menschen – oder, vielleicht besser, als »vernünftige Lebewesen« beziehungsweise als Person –auszeichnet: nämlich das Angeben von rationalen Gründen.23 Es gibt natürlich drittens auch Gründe dafür, der expliziten Rechtfertigung einen von bestimmten Zielen (wie etwa wahren Überzeugungen oder Wissen) abhängigen instrumentellen Wert zuzuerkennen.24 Denn auch wenn Rechtfertigung nicht notwendig für basales Wissen sein sollte, könnte es beispielsweise durchaus zur Mehrung oder Verfeinerung unseres Wissens beitragen:25 Generell scheint es tatsächlich so zu sein – wenn man den Blick vom reinen Begriff des Wissens und seinen Problemen etwas abwendet und sich fragt, wie man systematisch denn zu »Wissen« über unsere Welt gelangt – dass einem im persönlichen Leben die Idee des Externalismus nur bedingt weiterhilft. Die Ideen des erkenntnistheoretischen Externalismus spielen zumindest in direkter Weise keine große Rolle, wenn es darum geht, für sich selbst oder in einer Diskussion ein bestimmtes »Wissen« erst bewusst zu erarbeiten, eine Überzeugung zu vertreten oder sich zwischen alternativen Positionen zu entscheiden: hier kommt es immer – sofern es überhaupt auf Wissen ankommt – auf eine Form des intern beziehungsweise explizit begründeten Wissensanspruchs an. Selbst wenn eine Überzeugung aus einer externen Perspektive bestmöglich gerechtfertigt ist, müssten wir uns selbst eine Rechtfertigung dafür geben können, wenn wir uns fragen, welche Überzeugung wir als wahr annehmen sollen.
Die explizite und propositionale Rechtfertigung ist natürlich nicht nur notwendig für eine Frage, die man sich selbst »beantworten« will, sondern vor allem auch bei Streitfragen, also Fragen, die man mit oder gegenüber anderen Menschen klären will.
23 Rainer Forst spricht in diesem Zusammenhang etwa vom Menschen als einem Rechtfertigungswesen. Vgl. Forst 2007, 9.
24 Wahre Überzeugungen oder Wissen sind ihrerseits wahrscheinlich ebenso instrumentell wertvoll, etwa für unser Wohlbefinden, was nicht ausschließt, dass sie auch um ihrer selbst willen angestrebt werden sollten.
25 Man könnte auch trennen zwischen einem basalen, einfachen Wissen und einem komplexen höheren Wissen, für das im Gegensatz zu grundlegendem Wissen durchaus ein Verstehen beziehungsweise eine gelungene Rechtfertigung notwendig ist. Wissenschaftliches Wissen würde dann etwa zu diesem »höheren Wissen« zählen. Ernest Sosa etwa spricht in diesem Zusammenhang von »animal knowledge« und »reflective knowledge«. Vgl. Sosa 2009.
ist ein Überlegungsgleichgewicht?
Eine meiner Motivationen zur Untersuchung einer Methode der Rechtfertigung, die ich hier transparent machen will, ist neben der Bedeutung der Begründung und Rechtfertigung für einen selbst, zur Erreichung eines Verstehens als epistemischem Wert und bei der Beantwortung von tatsächlichen Fragen des Lebens – sozusagen einer Form der Rechtfertigung und Entscheidungsfindung als Lebenskunst – die Bedeutung für den öffentlichen Rechtfertigungs- und Entscheidungsfindungsdiskurs. Denn wie etwa kann man allgemeine Regeln, die ja doch zur Lösung vieler Probleme notwendig sind, im Streitfall nicht nur einfach durchsetzen, sondern erstens für sich kritisch rechtfertigen (also zu einer rationalen Entscheidung gelangen) und dann in einem zweiten Schritt auch öffentlich rechtfertigen und damit für eine ganze Personengruppe? Eine solche Rechtfertigung, die über eine machtpolitische Durchsetzung hinausgeht und damit eine Internalisierung verlangt – ein »Wissen« um die Geltung der Regeln – ist für die Stabilität von Gesellschaft notwendig oder zumindest förderlich. Denn nur dann kann ein Bürger die gesellschaftlichen Regeln, die er nicht vollkommen teilt, nicht als Zwang empfinden, wenn er Gründe für die Regeln genannt bekommt, die er prinzipiell akzeptiert und teilt. Auch wenn er nicht allen Elementen des Schlusses zustimmen muss und weiterhin anderer Meinung ist, was die richtigen politischen Regeln sind –solange die Regeln auf einem Weg zustande gekommen sind, den er akzeptiert und solange mit den Regeln Ziele verfolgt werden, die er ebenso teilt, kann ein politischer Pluralismus befürwortet werden, der bisweilen im Konkreten zu Ergebnissen gelangt, die man selbst nicht teilt.
Im Politischen kann eine gelungene Rechtfertigung also zu sozialem Frieden und Stabilität beitragen – eventuell ist sie sogar notwendig dafür, dass man vernünftigerweise mit den gesellschaftlichen Verhältnissen Frieden schließen kann. Doch wann ist eine derart politische oder öffentliche Rechtfertigung gelungen und wann genügt sie nicht den Anforderungen? Wie sollte man vorgehen, um im demokratischen Forum etwas zu rechtfertigen? Hier scheint, genau wie im außerpolitischen Kontext, zumindest keine Beliebigkeit zu herrschen.
Eine mögliche Antwort, die zurzeit vor allem in der Praktischen Philosophie vertreten wird, ist: man sollte mittels vernünftiger Überlegung versuchen ein Gleichgewicht zwischen relevanten abstrakten Theorien und konkreten Überzeugungen und Handlungen – beziehungsweise zwischen Theorie und Praxis –herstellen. Man sollte ein sogenanntes reflective equilibrium herstellen. Dieser bildhaft ästhetisierende Ausdruck – der im Deutschen nun eben zumeist mit Überlegungsgleichgewicht übersetzt wird – wurde von John Rawls eingeführt, um damit das Ziel seiner Rechtfertigungsmethode zu bezeichnen, die sowohl
in seinem berühmtem Werk Eine Theorie der Gerechtigkeit als auch seinen weiteren Werken eine zentrale erkenntnistheoretische Rolle spielt.
Ein einmal hergestelltes Überlegungsgleichgewicht ist bei Rawls aber nicht endgültig, es handelt sich eher um ein fragiles Gleichgewicht: Durch neue Erfahrungen und Überzeugungen kann sich das Gleichgewicht auflösen und es notwendig machen, dass man eingreift und erneut nach Balance sucht. Der »Denker als Seiltänzer«26 ist, bildlich gesprochen, davon bedroht vom moralischen Hochseil zu fallen, wenn er etwa auf der einen Seite ein wohlüberlegtes Urteil fasst, das eine bestimmte Handlungsweise moralisch bewertet und vorschreibt, was jedoch nicht mit den Anweisungen zu vereinbaren ist, die sich aus moralischen Regeln und Theorien ergeben, an denen er auf der anderen Seite festhält.
Der Versuch im Konflikt eine Balance zu finden, bedeutet nun – und hier ist das Bild sehr aussagestark –, dass man auf der Suche nach einer neuen Gewichtung, nach Anpassung, den Blick auf beide Seiten richtet: alle Seiten eines Konflikts können stets einer Revision unterzogen werden. Jemand, der versucht ein Überlegungsgleichgewicht herzustellen, kann als Ziel also keinen festen statischen Zustand erreichen, sondern muss sich mit diesem dynamischen Prozess der Rechtfertigung abfinden. Ein nächster Schritt auf dem Hochseil könnte dazu führen, dass man strauchelt – aber einfach stehen zu bleiben schützt nicht vorm Fall!
Dabei ist eine Methode der Rechtfertigung, die in diesem Sinn versucht eine ganzheitliche Balance zu finden – wie Wolfgang Stegmüller bemerkt –unabhängig von moralischen Fragestellungen, mit der die Methode des Überlegungsgleichgewichts aufgrund des etymologischen Ursprungs oft verbunden wird, »abstrakt und allgemein genug« um auch in anderen Bereichen angewandt zu werden.27
26 Vgl. Arnswald / Weiberg 2001. Vgl. Nietzsche, Also sprach Zarathustra.
27 Vgl. Stegmüller 1986, 149f.